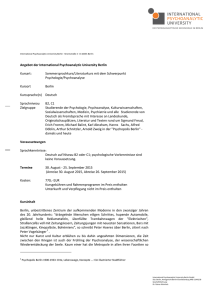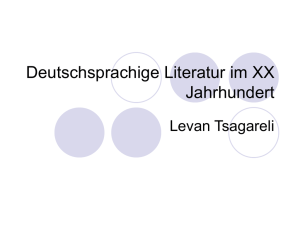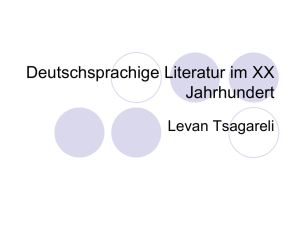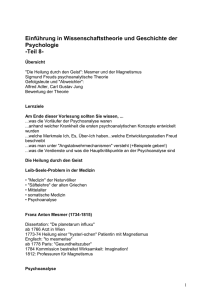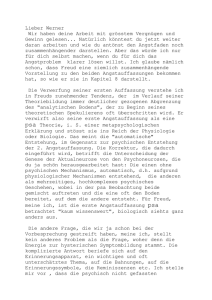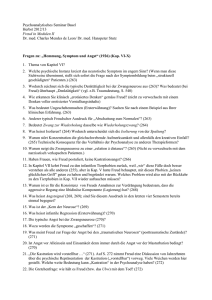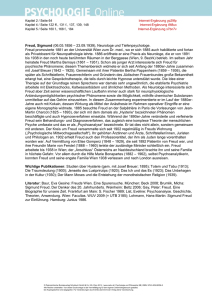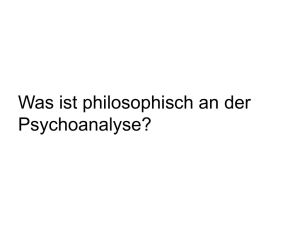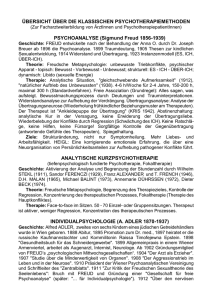Leseprobe zur Einleitung in die Tiefenpsychologie
Werbung
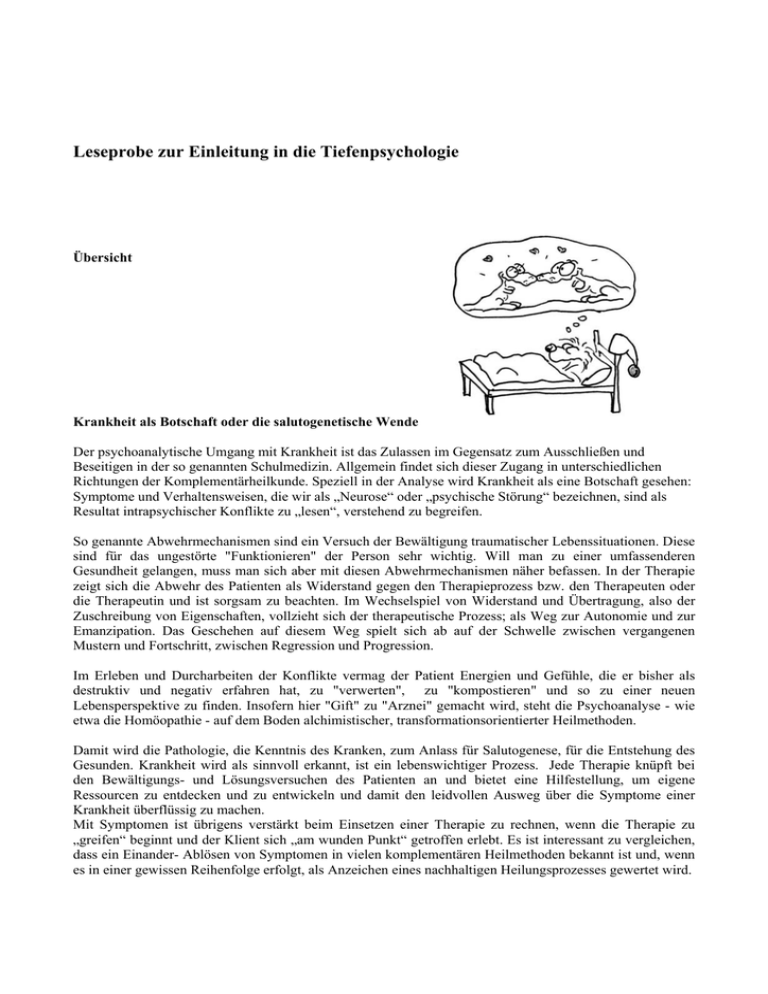
Leseprobe zur Einleitung in die Tiefenpsychologie Übersicht Krankheit als Botschaft oder die salutogenetische Wende Der psychoanalytische Umgang mit Krankheit ist das Zulassen im Gegensatz zum Ausschließen und Beseitigen in der so genannten Schulmedizin. Allgemein findet sich dieser Zugang in unterschiedlichen Richtungen der Komplementärheilkunde. Speziell in der Analyse wird Krankheit als eine Botschaft gesehen: Symptome und Verhaltensweisen, die wir als „Neurose“ oder „psychische Störung“ bezeichnen, sind als Resultat intrapsychischer Konflikte zu „lesen“, verstehend zu begreifen. So genannte Abwehrmechanismen sind ein Versuch der Bewältigung traumatischer Lebenssituationen. Diese sind für das ungestörte "Funktionieren" der Person sehr wichtig. Will man zu einer umfassenderen Gesundheit gelangen, muss man sich aber mit diesen Abwehrmechanismen näher befassen. In der Therapie zeigt sich die Abwehr des Patienten als Widerstand gegen den Therapieprozess bzw. den Therapeuten oder die Therapeutin und ist sorgsam zu beachten. Im Wechselspiel von Widerstand und Übertragung, also der Zuschreibung von Eigenschaften, vollzieht sich der therapeutische Prozess; als Weg zur Autonomie und zur Emanzipation. Das Geschehen auf diesem Weg spielt sich ab auf der Schwelle zwischen vergangenen Mustern und Fortschritt, zwischen Regression und Progression. Im Erleben und Durcharbeiten der Konflikte vermag der Patient Energien und Gefühle, die er bisher als destruktiv und negativ erfahren hat, zu "verwerten", zu "kompostieren" und so zu einer neuen Lebensperspektive zu finden. Insofern hier "Gift" zu "Arznei" gemacht wird, steht die Psychoanalyse - wie etwa die Homöopathie - auf dem Boden alchimistischer, transformationsorientierter Heilmethoden. Damit wird die Pathologie, die Kenntnis des Kranken, zum Anlass für Salutogenese, für die Entstehung des Gesunden. Krankheit wird als sinnvoll erkannt, ist ein lebenswichtiger Prozess. Jede Therapie knüpft bei den Bewältigungs- und Lösungsversuchen des Patienten an und bietet eine Hilfestellung, um eigene Ressourcen zu entdecken und zu entwickeln und damit den leidvollen Ausweg über die Symptome einer Krankheit überflüssig zu machen. Mit Symptomen ist übrigens verstärkt beim Einsetzen einer Therapie zu rechnen, wenn die Therapie zu „greifen“ beginnt und der Klient sich „am wunden Punkt“ getroffen erlebt. Es ist interessant zu vergleichen, dass ein Einander- Ablösen von Symptomen in vielen komplementären Heilmethoden bekannt ist und, wenn es in einer gewissen Reihenfolge erfolgt, als Anzeichen eines nachhaltigen Heilungsprozesses gewertet wird. 1. Psychoanalytische Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit „Gesundheit“ ist für FREUD im wesentlichen ein praktischer, quantitativer Begriff: „Ob der Person ein genügendes Maß an Genuss- und Leistungsfähigkeit verblieben ist“ (FREUD 1917, S. 476). Daraus folgt auch seine Vorstellung über die „Heilbarkeit der Neurosen“: ein Mindestmaß an „Genuss- und Leistungsfähigkeit“ (FREUD 1917, S. 476) bzw. „Arbeits- und Liebesfähigkeit“ herzustellen, „hysterisches Elend in gemeines Unglück“ (FREUD 1895, S. 312) zu verwandeln, das Leben „ertragen“ zu lernen. Diese „Selbstbescheidung“ (SNAKED 1993, S. 11) gehört zur Psychoanalyse wie auch die Skepsis gegenüber allen hohen Erwartungen von Heilung im Sinne einer vollkommenen seelischen Gesundheit. Es sei dies eine „Erziehung zur Realität“. Glück sei im „Plan der Schöpfung“ nicht vorgesehen, meint FREUD in der Spätphase seines Lebens. Allerdings darf diese „Erziehung zur Realität“ nicht dazu verleiten, die Psychoanalyse für eine Erziehung zur Anpassung an soziale Normen zu missbrauchen. „In der Psychoanalyse selbst“, schreibt er, „sind genug revolutionäre Momente enthalten, um zu versichern, dass der von ihr Erzogene im späteren Leben sich nicht auf die Seite des Rückschritts und der Unterdrückung stellen wird“ (FREUD 1933, S. 162). Hier deutet sich an, dass psychoanalytisches Reden von gesund und krank immer zugleich in einem gesellschaftlichen Kontext zu verstehen ist, wie dies ja auch die medizinisch-soziologische Betrachtung der Salutogenese thematisiert. Es sind dies zwei Seiten einer Medaille: Die mikroskopische Sicht der Psychoanalyse – mit dem Fokus der therapeutischen Beziehung – ruft nach der makroskopischen Untersuchung der gesellschaftlich relevanten Faktoren zu Gesundheit und Krankheit. In der Systemtherapie wird der - ebenso mögliche - umgekehrte Weg beschritten, nämlich von der Makroskopie des gesellschaftlichen Systems zur mikroskopischen Sicht. FREUDs Begriff von "Gesundheit" mit seinem Hinweis auf die Genuss- und Leistungsfähigkeit hebt sich deutlich von einem medizinischen Gesundheitsbegriff ab, der einem organischen oder biochemischen Bezugsrahmen entstammt, wo die Über- oder Unterschreitung der Normwerte als „Krankheit" bezeichnet wird. FREUD bezieht sich vorrangig auf die subjektive Befindlichkeit des Individuums („Genussfähigkeit“). Die andere Perspektive erfasst die Aktivität des Individuums in der Realität bzw. seiner sozialen Umgebung („Leistungsfähigkeit“). Bezüglich der subjektiven Befindlichkeit des Individuums werden in der Folge von psychoanalytischen Autoren (ALLPORT, MANN) positives Selbstwertgefühl, Selbstakzeptierung und Selbstvertrauen zum Maßstab psychischer Gesundheit (vgl. BLÄTTNER 2004), wie auch die Fähigkeit einer „Steuerung durch das bewusste Ich“ (SCHULTZ-HENKE). Die psychoanalytischen Bestimmungen von „gesund“ und „krank“ verstehen sich auf einem Kontinuum von mehr oder weniger (vgl. BLÄTTNER 2004). FREUD verkehrt die gängige Ausgrenzung des psychisch Kranken in ein Paradox und stellt fest, „dass wir alle krank, d.h. neurotisch sind, denn die Bedingungen für die Symptombildungen sind auch für den Normalen nachzuweisen.“ (FREUD 1917, S. 375) Überdies erfolge die Symptombildung im Traum erfolgt nach den gleichen psychischen Mechanismen wie die Symptombildung in der Neurose und sei entsprechend zu „lesen“ (vgl. Lernfeld 5). Welchen Sinn die Symptome einer psychischen Erkrankung haben, erschließt sich in der Deutung im gemeinsamen Entdeckungsprozess von Therapeut(in) und Klient(in), so wie sich dies exemplarisch im Forschungsprojekt von BREUER und Anna O. zugetragen hat (Lernfeld 3, 1). Das Paradox von gesund und krank erfahren therapeutische Ausbildungskandidaten oft in besonderer Weise. So berichtet mir ein Kollege vom Beginn seiner Ausbildung: Er hat ein Vorstellungsgespräch bei seiner zukünftigen Lehranalytikerin und antwortet auf die Frage, was er „mitbringe“ an psychischen Belastungen und Konflikten: „nichts“. Und weiter: Er komme nur, um eine psychoanalytische Ausbildung zu absolvieren. Dieser Einstieg, so mein Kollege, habe ihm ein Lächeln seiner Analytikerin und eine sehr lange Lehranalyse „eingebracht“. Der Panzer seiner „Abwehr“ hatte ihm bis dahin seine unbewussten Konflikte verdeckt und das Gefühl von „ganz normal“ vorgetäuscht. Ganz im Sinn der FREUDschen Paradoxie liegen die Arbeiten von A. GRUEN zum Phänomen der „Normopathie“. Was sich in bestimmtem gesellschaftlichen Kontext als „normal“ gibt, ist bei näherem kritischen Hinschauen eine erschreckende Pathologie. GRUEN beschreibt dies in seiner Arbeit: „Der Wahnsinn der Normalität“ (1992). In seiner Arbeit untersucht GRUEN Entstehung und Psychodynamik der menschlichen Destruktivität, u.a. an Beispielen aus Nazi-Deutschland. Ein ehemaliger polnischer KZHäftling verdichtet die Paradoxie in einem Ausspruch: „Sie konnten Menschen totschlagen – und sie waren ganz normal dabei.“ GRUEN führt dazu aus: „Während jene als ‚verrückt‘ gelten, die den Verlust der menschlichen Werte in der realen Welt nicht mehr ertragen, wird denen Normalität bescheinigt, die sich von ihren menschlichen Wurzeln getrennt haben. Und diese sind es, denen wir Macht anvertrauen und die wir über unser Leben und unsere Zukunft entscheiden lassen....“ (GRUEN 1992, 10). Für GRUEN gilt als Beginn von Normopathie, wenn das Kind das Bewusstsein für sein eigenes Selbst zu verlieren beginnt, die Gefühle von Vater und Mutter nicht mehr unmittelbar wahrnimmt, sondern sich danach richtet, wie diese es sehen. Diese „Anpassung“ bedeutet, ein „verfälschtes Selbst“ aufzubauen, d.h. die Unfähigkeit, in sich selbst zu wurzeln und ruft - in der Folge – zerstörerisches und böses Verhalten hervor (vgl. Lernfeld 2, 1). Gehorsam und Anpassung, Außengelenktheit unter Preisgabe des eigenen Inneren bedeutet den Verrat an sich selbst – um der Teilhabe an einer halluzinierten Macht willen. Eliminiert werden damit menschliche Gefühle wie Verzweiflung, Möglichkeiten menschlicher Wahrnehmung wie Empathie, Möglichkeiten menschlichen Erlebens wie Begeisterung. Wenn man das eigene Selbst zurückgewiesen hat, weil es die eigene Machtposition gefährdet hätte, beginnen Rachegefühle das Leben zu bestimmen. Die Anpassung statt der inneren Unabhängigkeit konstituiert die Realität der Macht, statt der Realität der Liebe. So „normal“ es war, die Eltern zu lieben, die einem Schmerzen bereiteten, so „normal“ ist es dann, dafür geliebt werden zu wollen, wenn man anderen Schmerzen zufügt – und dabei das Beste im Sinn zu haben. Die Frage nach Gesundheit und Krankheit, nach normal und anormal führt danach zur Frage nach dem wahren und falschen Selbst (vgl. Lernfeld 2). Dem Ethnologen und Psychoanalytiker C. DEVEREUX gelingt es, psychoanalytische Erfahrungen soziologisch anzuwenden und die kulturelle Bedingtheit von normal und anormal (1982) herauszustellen. Ähnlich wie A. GRUEN stellt er die „Anpassung“ als Kriterium seelischer Gesundheit in Frage: „Die Theorie der Anpassung weigert sich, die Existenz von Gesellschaften zuzugeben, die derart ‚krank‘ sind, dass man selbst ziemlich krank sein muss, um sich an sie anpassen zu können.“ (DEVEREUX 1982, S. 9) Manche Kulturen sind so hoffnungslos „im Treibsand eines circulus vitiosus“ von sozialer Autodestruktivität versunken, dass sie, je mehr sie sich zu befreien suchen, um so tiefer versinken. DEVEREUX verweist auf einen Kannibalenstamm, die Tonkawa,, der sich mit seinem Kannibalismus die Feindschaft und sogar die Auslöschung durch seine Nachbarn zuzieht. „So geschah es auch im Bemühen, einen imaginären ‚inneren Feind‘ auszurotten und der ‚Einkreisung‘ zu entgehen, dass das Nazi-Deutschland sich überall – ganz reale – ... Feinde schuf und eine auf Zerstörung des Nazismus eingeschworene Weltkoalition auf den Plan rief.“ (DEVEREUX 1982, S. 9) DEVEREUX verweist weiters auf analoge Phänomene der sozialen Autodestruktivität im Süden der USA, die die geistige Gesundheit der angeblich „angepassten“, weißen Bevölkerung wie die der schwarzen gleichermaßen untergraben. 2. Trauma – Konflikt – Neurose Am Anfang von FREUDs Erforschung der Neurosen steht der Begriff Trauma. Zeitgenössische Ideen fortführend, etwa die Arbeit von P. JANET, übernahm er ihn für den Bereich des Psychischen. Ursprünglich in der Medizin auf körperliche Strukturen bezogen, bezeichnet der Begriff „Trauma“ eine Wunde, eine physische Verletzung. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurde in der psychiatrisch-neurologischen Forschung die ätiologische Bedeutung, die pathogenetische Wirkung traumatischer Schockerlebnisse diskutiert. FREUD verstand die hysterischen Symptome zunächst als Folge verdrängter traumatischer Erlebnisse, als deren wiederbelebte und entstellte Darstellung. Er bezeichnete erschütternde Erlebnisse eines Menschen, die psychisch nicht verarbeitet werden konnten und die begleitenden, aber unbewältigten Affekte (Schreckaffekt, Angst, Scham, psychischer Schmerz) als psychische Traumen (FREUD 1893). Besondere Bedeutung für die Verursachung psychischer Störungen gewannen jedoch traumatische Kindheitserlebnisse, die das unreife Ich des Kindes und die in der Entwicklung befindlichen Strukturen frühzeitig beeinträchtigen. FREUDs bestimmend gebliebene Definition beschreibt das psychische Trauma – von Alter und Entwicklungsstand des Individuums unabhängig – als plötzliche Reizüberflutung, die die gewohnte Funktionsweise des psychischen „Apparates“ außer Kraft setzt und das Ich mit einem Zustand totaler Hilflosigkeit konfrontiert (FREUD 1920). Diese Formulierung betont die intrapsychischen Vorgänge im traumatischen Moment eines unfassbaren Erlebnisses, das allenfalls nachträglich verarbeitet werden kann. Seither hat sich die Perspektive auf den gesamten Prozess der Traumatisierung ausgedehnt. Über die traumatische Situation samt den unmittelbaren Reaktionen hinaus, umfasst dieser die unmittelbaren Bewältigungsversuche, aber auch die späterhin erforderlichen Anpassungsprozesse als die „inneren“ Traumafolgen. Anfangs führte FREUD die spätere Neurose – in einem Zweiphasigen Modell – zurück auf reale sexuelle Verführungstraumen in der Kindheit und deren nachträgliche intrapsychische Wiederbelebung nach der Pubertät, sofern „spätere Traumen“, auch äußerlich unscheinbare Ereignisse, die Erinnerung an die infantile Szene reaktivierten. Als FREUD durchschaute, dass es sich bei den von seinen Patientinnen berichteten Verführungsszenen zumeist um Produkte der Phantasie handelte, konnte er langsam erkennen, dass schon in der Kindheit genuine sexuelle Regungen bestehen (vgl. Lernfeld 3, 5). Zum anderen zeigte sich darin, dass es eine innere psychische Realität gibt, die in der Psychoanalyse neben der äußeren Realität gewürdigt werden muss. Unbewusste Wünsche und Phantasien sind für das Entstehen einer Neurose ein traumatisches Potential, ebenso wie Realereignisse. So kann z.B. die „Realisierung“ eines ödipal-feindseligen Beseitigungswunsches aufgrund des Todes des Vaters zu einer verdrängten Mörderphantasie führen, die durch ein späteres Erlebnis reaktiviert wird (vgl. Lernfeld 2). Aus psychoanalytischer Sicht ist der Mensch ein Konfliktwesen (vgl. Lernfeld 2). Das Erlebnis des Konflikts zwischen naturnahen, sexuellen wie aggressiven „Triebwünschen“ und den sozialen Ge- und Verboten schlägt sich nieder im Dialog bzw. Konflikt der „Instanzen“ von ES, ICH und ÜBER-ICH (vgl. Lernfeld 2). Der neurotische Konflikt ist dadurch bestimmt, dass er sich unbewusst abspielt. Zur Neurose wird dieser Konflikt, wenn unter dem Druck sich verstärkender Bedürfnisse oder zunehmender Versagungen bestimmte Minimalgrenzen der Befriedigung unterschritten werden und die bis dahin funktionierenden Techniken der Erlebnisverarbeitung versagen. Klinisch äußert sich dies im Auftreten von Symptomen und im Entstehen von Leidensdruck. Versteht man mit FREUD das neurotische Symptom als den Versuch, einen zugrunde liegenden Konflikt zu lösen, dann stellt es die Neurose als eine sinnvolle, kreative Anpassungslösung dar, die es dem Patienten ermöglicht, mit widersprüchlichen Bedürfnissen weiter zu leben, freilich oft eingeschränkt und mehr schlecht als recht. Eine moderne psychoanalytische Auffassung von Krankheit muss klar unterscheiden zwischen pathogenen bzw. neurotischen Konflikten und existentiellen Konflikten, welche jeder Mensch im Lauf seiner Entwicklung bewältigen bzw. erleiden muss, auch wenn dies oftmals nicht leicht erscheint. Trennungsphasen und damit einhergehende Konflikte z.B. sind im Leben angelegt und müssen bewältigt werden. Der Mensch kann daran wachsen. Krankheit im Sinne der Psychoanalyse wäre demnach ein nicht bewältigbares, persistierendes Leiden. Der neurotische Konflikt bedeutet das Vermeiden einer reifen Konfliktlösung durch Regression (= Zurückweichen auf alte, nicht mehr alters- und situationsgerechte Lösungen früherer Entwicklungsstufen). Wie bereits dargestellt, steht der Ödipuskomplex im Zentrum der FREUD’schen Konfliktdiskussion (Lernfeld 2). Die Bewältigung dieses Konfliktes ist notwendig zur Entwicklung einer gesunden psychosexuellen Identität. Seine Nicht-Bewältigung, Fixierung und Verdrängung ist die Basis neurotischer Störungen. Frühere Konflikte betreffen die Ebene der Zweierbeziehung, in der Regel die Dyade von Kind und Mutter. Aus der frühen Erfahrung lässt ein Kind zugleich z.B. tödliche Hassgefühle gegenüber der Mutter zu, bekommt dann aber zugleich zwangsläufig Angst davor, die auch geliebte Mutter zu verlieren. Die so divergierenden Impulse werden dann aufgrund der enormen existierenden Angst gespalten und kommen neben- bzw. nacheinander zum Ausdruck. Dies ist das Kennzeichen einer Borderline-Störun (Persönlichkeitsstörung aus einer frühen Entwicklungsphase, gekennzeichnet durch Polarisierung Ich / Selbst versus Mitmenschen, die Lebenssituation wird entweder als ganz schlecht oder als ganz gut gesehen, es wird entweder idealisiert oder entwertet). Therapeutisch bedeutsam ist dabei das Nebeneinander heftiger Gefühle von Hass, Enttäuschung, Wut einerseits und von Liebe andererseits in der Übertragung zu erleben. Der therapeutische Prozess bedeutet, dass der Klient oder die Klientin allmählich lernt, beide seine Seiten zu akzeptieren, als zu ihm gehörend anzunehmen und so die „Spaltung“ zu überwinden. Von narzisstischen Störungen („Störungen der Fähigkeit zur Selbstliebe“) haben wir schon gesprochen (Lernfeld 3). Hierbei ist das Selbstwertgefühl einer Persönlichkeit labil. 3. Der „Sinn“ der Symptome Am Anfang einer manifest werdenden psychischen Erkrankung steht in aller Regel ein äußerer, sozialer Konflikt. Erst dieser reaktiviert einen ungelöst gebliebenen, unbewussten, inneren psychischen Konflikt. Angesichts der Unmöglichkeit einer angemessenen Konfliktlösung tritt in der Folge Angst auf. Wenn diese Angst mit Hilfe verschiedener Abwehrmechanismen nicht mehr bewältigt werden kann, kommt es zu einer psychischen Störung, zur Symptombildung. Nach Ansicht der Psychoanalyse haben die entstehenden Leidenssymptome einen „Sinn“, eine Bedeutung. In seinen poetisch dargestellten Fall-Geschichten bringt FREUD uns nahe, wie etwa hysterische Symptome, z.B. eine Lähmung durch Verschiebung („Konversion“) psychischer Erregung ins Körperliche, entstehen. Das Symptom ist ein „rätselhafter Sprung“ vom Psychischen ins Organische. Zum Teil kann unsere „Organsprache“ das Rätsel auflösen und den Sprung nachvollziehen, indem die Hysterie den sprachlichen Ausdruck wörtlich nimmt und – den „Stich ins Herz“ bei der Liebesenttäuschung, den „Schlag ins Gesicht“ bei kränkender Anrede – wie ein wirkliches Ereignis empfindet. „Wie wahrscheinlich ist es nicht“, sagt FREUD, „dass die Redensart‚ ‚etwas herunterschlucken‘, die man auf eine unerwiderte Beleidigung anwendet, tatsächlich von den Innervationsempfindungen herrührt, die im Schlunde auftreten, wenn man sich die Rede versagt, sich an der Reaktion auf Beleidigung hindert?“ (FREUD 1895, S. 251) Gegenüber einem abgeschwächten Sprachgebrauch, der zum körperlichen Empfinden keine unmittelbare Beziehung mehr hat, nimmt FREUD bei der Hysterie das Erbe einer ursprünglichen Sprache an, in der die Menschen noch lebten, was sie sagten. SCHMIDBAUER (1986, S. 157) erinnert in diesem Zusammenhang an das Grenzgebiet der Psychosomatik, wo Emotion und Rationalität, Seele und Geist ineinander übergehen. Er verweist auf archaische Heilungsrituale im Schamanismus, wo auf der „poetischen Geisterreise“ des Schamanen der ursprüngliche Wortsinn beschworen wird, um so die Seele des Kranken zu befreien (SCHMIDBAUER 1986, S. 158). Schon C. LEVISTRAUSS (1971), der als Ethnologe den magisch-religiösen Text einer Schamanenbeschwörung analysiert, sieht die Wirksamkeit dieses Heilverfahrens in der Symbolsprache, die die unbewussten Konflikte und Hemmungen auf der Schwelle zwischen der organischen und psychischen Welt ins Bewusstsein bringt und damit wirksam wird – im konkreten Fall als Hilfe bei einer schweren Geburt (LEVI-STRAUSS 1971, S. 204 – 225). Schamanische wie psychoanalytische Heilverfahren führen eine Änderung herbei, da sie den „Symptom-Sprung“ vom Psychischen ins Organische rück-übersetzen. Herr C., in Psychoanalyse wegen wechselnder, hypochondrisch erlebter Körpersensationen, wie Schwitzen, Herzarrhythmie und diverser Krankheitsängste, kann bei sich immer wieder beobachten, wie er statt Gefühlen seine innere Wahrnehmung auf Körperorgane verlagert bzw. durch Körpersensationen „ersetzt“. So kann er eine ganze Sitzung damit zubringen, wie er Wut spürt, z.T. gegen den – höchst autoritären – Vater, wie auch gegen die sich immer wieder hilflos gebende Mutter. Es steigert sich die Wut zum Impuls, seine Wut heraus zu schreien – so sehr, dass er am Halse dies spürt; dann folgt Angst, der Mutter weh zu tun – und wieder der Hass gegen sie, dass sie ihn ständig mit ihren Leidenszuständen manipuliert – und dann spürt er einen starken Druck auf der Brust. In dieser fortgeschrittenen Psychoanalyse zeigt sich der „Sprung“ vom Psychischen ins Somatische noch „in actu“, als ein Springen von schwer erträglichen Wut- und Hassgefühlen gegenüber den Eltern, besonders der Mutter, ins Körperliche – und kann wieder rück-übersetzt werden in die Gefühle und die ursprüngliche Eltern-Kind-Beziehung Frau H., im Vorspann dieses Lernfelds vorgestellt, erlebt einen Symptomwechsel. Im Laufe ihrer Therapie gehen die Panikattacken zurück. Dafür spürt sie Gefühle von Unsicherheit und Angst, wie vor etwas Unheimlichem, auch oder gerade angesichts ihrer beruflichen Erfolge. Als persistierendes Rest-Symptom bleibt ihre Wahl „unmöglicher Männer“. Hierin zeigt sich der noch unaufgelöste Ödipus-Komplex. In der beginnenden ödipalen Phase, mit zwei bis drei Jahren, war sie von der nachgekommenen Schwester aus der Position, „Schatzerl“ des Vaters zu sein, von der Schwester verdrängt worden, die diesen Platz beim Vater einnahm, bzw. der der Vater diesen Platz nun gab. Unaufgelöst ist dieser „Vaterkomplex“, da sich Frau H. daraus so etwas wie ein inneres Verbot gemacht hat, nicht nur eine Beziehung zu beginnen, um sich dann eine Abweisung wie beim Vater zu holen, sondern auch darin Erfüllung zu finden, d.h. als Frau „erfolgreich“ zu sein, so wie ihr dies sonst in ihrem Leben ja schon gelingt. Der Symptomwechsel zeigt, dass die therapeutische Beziehung ihr die größten Ängste, Panikattacken etc. bereits genommen hat. Das persistierende „Beziehungs-Symptom“ zeigt, wo sich die Psychoanalyse noch im Erinnern, Wiederholen, Durcharbeiten befindet und wie die therapeutische Beziehung Frau H.s Selbstwertgefühl, ihre Selbstakzeptanz und ihr Selbstvertrauen als Frau fördert. Die Symptome sind wie eine Begleitmusik zum Basso-continuo der Grundmelodie der frühkindlichen Konflikte, die sich angesichts real erlebter Stress- und Belastungssituationen und in der ÜbertragungsBeziehung re-inszenieren. Eine vergleichende Betrachtung erhellt die Ähnlichkeit der grundlegenden Konflikte mit der Symptombildung in der therapeutischen Übertragungssituation auch im Sinne des Ähnlichkeitsprinzips der Homöopathie (FREUD et al. 2002a). Mit Symptomen ist, wie schon FREUD bemerkt, verstärkt beim Einsetzen einer Therapie zu rechnen, wenn die Therapie zu „greifen“ beginnt und der Klient sich „am wunden Punkt“ getroffen erlebt (vergleiche auch die „Erstverschlimmerung“ in anderen komplementären Verfahren, siehe ENDLER et al. 2004). Sie können auch zu einer „Verschlimmerung“ des Krankheitsbildes führen oder – wie die Kasuistik mit Frau H. zeigt – wechseln, sich „mildern“. Es ist interessant zu vergleichen, dass ein Einander- Ablösen von Symptomen in vielen komplementären Heilmethoden bekannt ist und, wenn es in einer gewissen Reihenfolge erfolgt, als Anzeichen eines nachhaltigen Heilungsprozesses gewertet wird (ENDLER et al. 2004). Als körperliche Resonanz des psychischen Konfliktes sind sie ein wichtiges Signal für die noch nicht aufgelösten, tieferen, unbewussten Konflikte. Im Unterschied zur üblichen medizinischen Strategie, Symptome zu beseitigen, werden sie in der Psychoanalyse als Signale, als „Organ-Sprache“ beachtet. Am Ende einer Therapie werden sie überflüssig, haben sie ihren „Sinn“ erfüllt und verschwinden. Allerdings ist es durchaus nicht überflüssig, dass bei einer schweren psychischen Erkrankung eine therapeutische Begleitung, auch wenn diese nicht zur Befreiung von den Symptomen führt, Sinn haben und sogar lebenswichtig sein kann. Symptome erscheinen wie ein „äußerst sinnvolles und präzises Wunderwerk“, in dem sich die vielfachen Verflechtungen des psychischen Erlebens schrittweise, nie aber abschließend erforschen lassen. In ihrer Vielfalt und Komplexität entsprechen sie sozusagen der Vielfalt des Lebens selbst (vgl. BAURIEDL 1994).