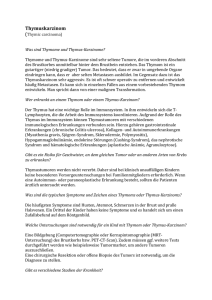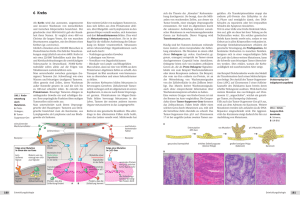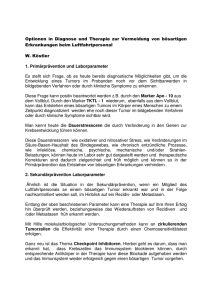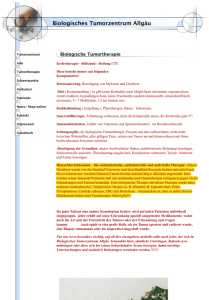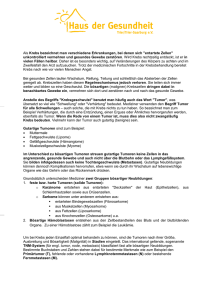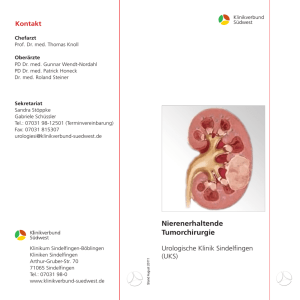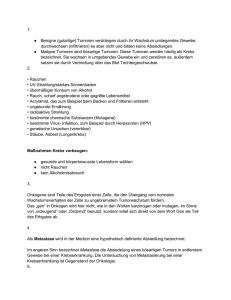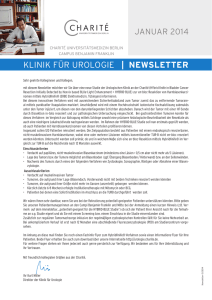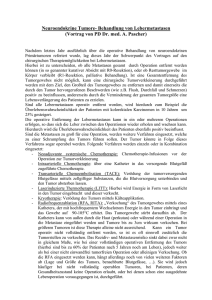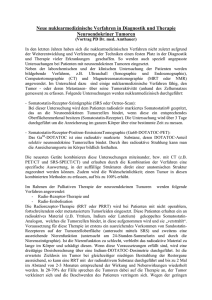klinik forum - Universitätsklinikum Tübingen
Werbung

Onkologie_Sonder umbruch 17.07.2003 12:19 Uhr Seite 1 S O N D E R A U S G A B E 2002 Patientenzeitung Krebs Onkologie am Tübinger Universitätsklinikum ➔ Heute, zu Beginn des dritten Jahrtausends, ist Krebs immer noch eine schlimme, immer noch oft tödlich verlaufende Erkrankung. Der in den letzten Jahrzehnten des zurückliegenden Jahrhunderts oft so nahe gewähnte Durchbruch im Kampf gegen diese „Geißel der Menschheit“ ist bis jetzt nicht erfolgt. Vielleicht wird er ja nie gelingen, denn heute weiß man, dass bösartige Tumoren selbst innerhalb der gleichen Krebsform sehr unterschiedliche Zellhaufen sein können, Patienten auf eine bestimmte Therapie nicht in gleicher Weise reagieren müssen, weil jeder anders gestrickt ist, und dass in der Regel mehrere und unterschiedliche Ursachen für die Entwicklung einer Krebsgeschwulst zugrunde liegen. „Die“ Therapie gegen Krebs wird es deshalb wohl nie geben. Und auch nicht „das“ Medikament oder „die“ Impfung. Hoffnung, Heilung, Lebensqualität sind im Zusammenhang mit Krebs dennoch keine Fremdworte mehr. Unzählige hochmotivierte Wissenschaftler haben in den zurückliegenden Jahren enorme, für die Betroffenen spürbare und erlebbare Fortschritte in Diagnose und Behandlung erreicht. Es wurden (und werden weiter) neue Diagnoseverfahren, Operationstechniken, Therapiekonzepte und Medikamente entwickelt (einer der Schwerpunkte in Tübingen). Der Hodenkrebs ist ein Paradebeispiel für wissenschaftlichen und medizinischen Erfolg: Er ist heute zu über 90 Prozent heilbar (Seite 6), das Bauchspeicheldrüsen-Karzinom eines für Stagnation: Die Fünf-JahresÜberlebensrate liegt bei drei Prozent (Frauen) und sechs Prozent (Männer). Die Wissenschaft forscht, prüft, verbessert von unterschiedlichsten Ansätzen her: Krebs ist zu einer fächerübergreifenden (interdisziplinären) Angelegenheit geworden, in der Forschung ebenso wie in Diagnose und Therapie. Inzwischen sitzen längst auch die Biotechnologie und die Molekularforschung mit im Boot. In der Krebsforschung und -behandlung gilt das Sprichwort von den vielen Köchen, die den Brei verderben, nicht. Es hat sich gezeigt, dass die besten Chancen für Krebskranke unabhängig vom Krankheits-Stadium in onkologischen Zentren bestehen. Der explosionsartige Wissenszuwachs in der Onkologie und vor allem seine Umsetzung in die Praxis macht ein Zusammenführen dieses Wissens notwendig. In den onkologischen Zentren wie dem Tübinger stehen heute die aktuellsten medizinischen Erkenntnisse und technischen Möglichkeiten in Diagnostik und Therapie zur Verfügung. Dort kümmern sich Ärzte verschiedener Fächer um den Patienten, die infolge hoher Behandlungszahlen die notwendige Erfahrung in der Interpretation der diagnostischen Ergebnisse und für die Behandlungswahl der zum Teil recht komplexen Krankheitsfälle haben. Mit der Gründung von onkologischen Kompetenzzentren hat das Interdisziplinäre Tumorzentrum am Tübinger Klinikum den entscheidenden Schritt in der modernen Tumorbehandlung getan. Am Tübinger Universitätsklinikum laufen eine ganze Menge klinischer Studien zur Beurteilung neuer Diagnoseverfahren und multimodaler Therapiekonzepte, Studien auch zu unterstützenden und lindernden Behandlungsstrategien. Außerdem gehen viele bundes- und europaweite Studien vom Schnarrenberg aus oder kommen dort zusammen. Ein Teil der (vorher gefragten) Patienten wird auch innerhalb solcher klinischer Studien behandelt – was nichts mit „Versuchskaninchen“ zu tun hat, sondern eher mit einer Chance: Keinem anderen Patienten wird mehr ärztliche Aufmerksamkeit und bessere Überwachung zuteil. Noch vor drei Jahrzehnten überlebte gerade ein Drittel der Krebskranken die Fünfjahresfrist, heute ist es die Hälfte. Es könnten erheblich mehr sein. Jeder dritte Krebstod könnte der Deutschen Krebsgesellschaft zufolge vermieden werden durch Vorbeugung, Früherkennung und die Schaffung verbindlicher Standards. Doch bei Nummer eins und zwei hapert es gewaltig, obwohl doch jeder diesbezüglich seines eigenen (Un-)Glückes Schmied ist. Vor allem das Rauchen als häufigste Krebsursache konterkariert die medizinischen Fortschritte. Obwohl dieses KLINIK FORUM keinen Anspruch auf Vollständigkeit in der Auflistung von Erkrankun- gen und Problemen erheben kann, reicht der Inhalt vermutlich aus, um zu zeigen, dass Rauchen seine üblen Spuren nicht nur in der Lunge hinterlässt. Alkohol, Fehlernährung, Bewegungsmangel tun ein übriges. Jedes Jahr erkranken in Deutschland rund 340.000 Menschen an Krebs. Auch die Früherkennung scheint sich noch immer nicht so richtig durchzusetzen, obwohl doch schon vor 107 Jahren im Brockhaus Konversationslexikon von 1895 auf die Notwendigkeit frühzeitiger Behandlung hingewiesen wurde. Und im Kleinen Brockhaus von 1905 wird noch explizierter formuliert: „Heilung nur durch sehr frühzeitige Operation möglich.“ Daran hat sich in den letzten hundert Jahren bei den bösartigen Tumoren nichts geändert. Noch immer sterben jedes Jahr deutschlandweit 190.000 Menschen an Krebs – laut Deutscher Krebsgesellschaft gehen davon 10.000 Todesfälle auf das Konto fehlender Früherkennung. Onkologie ➔ Bereich der Medizin, in dem sich Wissenschaftler und Kliniker fächerübergreifend vom Internisten über den Radiologen, Pathologen und Chirurgen bis zum Radioonkologen (Strahlentherapeuten) und Nuklearmediziner mit Entstehung, Diagnose und Behandlung von Tumoren und Tumorerkrankungen beschäftigen. HILFE UND UNTERSTÜTZUNG FÜR PATIENTEN TUMORZENTRUM ➔ Eine optimale Versorgung von Tumorpatienten entsprechend dem aktuellen Kenntnisstand ist nur möglich, wenn alle an einer Behandlung beteiligten Disziplinen koordiniert zusammenarbeiten. Diese Kooperation in allen onkologischen Bereichen sowohl in der Krankenversorgung als auch in der klinischen und experimentellen Forschung zu fördern und zu intensivieren, hat sich das 1981 am Universitätsklinikum gegründete „Interdisziplinäre Tumorzentrum Tübingen“ (ITZ) zur Aufgabe gemacht. Denn, so § 2 seiner Satzung, „Die wichtigste Aufgabe des Tumorzentrums ist die stetige Verbesserung der Diagnose, Therapie und Nachsorge bei Patienten mit Tumorerkrankungen.“ Diesem Ziel dient vor allem auch die Bildung von onkologischen Zentren, von denen es bereits zwei gibt – das Zentrum für Gastrointestinale Onkologie (Seite 4) und das Zentrum für Weichteilsarkome (Seite 15). Weitere stecken noch in der Anerkennungs- beziehungsweise Planungsphase. Zu den Arbeitsschwerpunkten zählen unter anderen auch: – Informationstage für Tumorpatienten und ihre Angehörigen, – ein telefonischer onkologischer Beratungsdienst für Haus- und Krankenhausärzte der Region bei allen onkologischen Fragen, – Psychosoziale und psychologische Begleitung und Betreuung von Tumorpatienten und ihren Angehörigen, – Brückenpflege. Wer Fragen im Zusammenhang mit Krebs hat, kann sich an das ITZ wenden, telefonisch unter 0 70 71/29-8 52 36, per E-Mail: [email protected] oder im Internet: www.itz-tuebingen.de/ Onkologie_Sonder umbruch 17.07.2003 12:19 Uhr Seite 2 KLINIK FORUM Sonderausgabe O N K O L O G I E 2 PATHOLOGIE STRAHLENTHERAPIE WEICHENSTELLER HINTER DEN KULISSEN ZIELGENAU UND SCHONEND ➔ „Ist ein Tumor gutartig, wurde die Diagnose vom ➔ Hauptschwerpunkt der onkologischen klinischen behandelnden Arzt gestellt. Ist er bösartig, ist der Pathologe dafür verantwortlich!“ Prof. Burkhard Bültmann, der dieses geflügelte Pathologen-Wort zitiert, ist Direktor des Pathologischen Instituts der Universität Tübingen. Es ist das älteste und gleichzeitig modernste pathologische Universitäts-Institut in Deutschland. Und es ist das einzige Uni-Institut in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit einer eigenen Abteilung für molekulare Pathologie, ein Gebiet, von dem sich Pathologen und Onkologen entscheidende Verbesserungen in Diagnose und Therapie versprechen. Als Patient bekommt man den Pathologen oder die Pathologin nie zu Gesicht, und doch besetzt er oder sie, sozusagen hinter den Kulissen, die entscheidende Position innerhalb der Onkologie. Sobald nämlich der Verdacht auf einen bösartigen Tumor auftaucht, muss er eingeschaltet werden. Sein Job ist es, dem behandelnden Arzt eine zuverlässige Diagnose über Gutartigkeit oder Bösartigkeit des verdächtigten Gewebes zu liefern. Ein Schnitzer hätte fatale Folgen – man denke nur an den Essener Brustkrebs-Skandal, der 300 Frauen gesunde Brüste kostete. Die behandelnden Ärzte erwarten von den Pathologen all die Informationen, die sie für eine maßgeschneiderte Therapie benötigen: Antworten auf Fragen nach der Größe, Bösartigkeit und Wachstumsgeschwindigkeit des Tumors, danach, ob er auf Hormone, eventuell auf eine Immuntherapie anspricht. Handelt es sich um einen lokalen Tumor, eine Systemerkrankung, einen Primärtumor oder eine Metastase? Oft wird zuerst eine Metastase entdeckt – doch von welchem (Primär-)Tumor und wo steckt der? Diese Frage nach dem Primärtumor bei Metastasen ist zu Lebzeiten der Patienten laut Bültmann nur in etwa 60 Prozent der Fälle zu klären. Die Tübinger Pathologen sind allerdings bei der Suche durch den Einsatz moderner immunhistologischer und molekularpathologischer Diagnostik inzwischen zu 80 Prozent fündig. Nur ein Beispiel: Ein PlattenepithelKarzinom im Hals stellte sich als Metastase heraus. Es gab aber nirgendwo einen Absender. Dank der modernen Analyseverfahren konnte ein bereits zwei Jahre zuvor entferntes Muttermund-Karzinom als Primärtumor identifiziert werden. Laut Bültmann werden im Jahr am Tübinger Pathologischen Institut 40 000 Patienten-Biopsien (einschließlich der von außerhalb des Klinikums aus Krankenhäusern oder Praxen geschickten) untersucht. Bei 50 bis 60 Prozent besteht der Verdacht auf einen bösartigen Tumor, „bei 6000 bis 8000 bestätigt er sich“. Die bereits angesprochene Detail-Diagnose erlaubt oft erst ein „interoperativer Schnellschnitt“: Unter der Operation wird Tumorgewebe entnommenen und untersucht. Die Operation ist derweilen unterbrochen. Auf der Basis der Schnellschnittdiagnose legt der Operateur dann sein weiteres Vor- gehen fest – zum Beispiel organ- oder nicht organerhaltendes Operieren. Diese interoperativen Schnellschnitt – Untersuchungen – 4500 jährlich im Tübinger Klinikum – erfordern, so Bültmann, „einen möglichst hautnahen Kontakt zu den Kliniken“. Schon seit geraumer Zeit sind deshalb die Pathologen mit mehreren Teams und der notwendigen technischen Einrichtung vor Ort in einem Labor im OP oder direkt davor präsent: in der Frauenklinik und in den Kliniken Berg. Diese Vorort-Teams nutzen die Möglichkeiten der Telemedizin: Wenn bei einer Schnellschnitt-Untersuchung Zweifel oder ein Funken Unsicherheit auftritt, wird ein Gewebeschnitt per Computer ins Pathologische Institut auf den Bildschirm eines Fachkollegen geschickt, der ihn dort mit begutachtet und überprüft (US-Standard). Dazu ein Beispiel: Als der Bauch eines Patienten für die Operation eines Bauchspeicheldrüsen-Tumors geöffnet wurde, entdeckten die Operateure im Bauchfell „Suspektes“ – Metastasen, stellte der Pathologe fest, Metastasen auch in den Lymphknoten. Da vom Ergebnis seiner Untersuchung das weitere ärztliche Vorgehen entscheidend abhing, holte der Pathologe im OP bei den Kollegen im Institut eine Zweit- und Drittbefundung ein. Seine Diagnose wurde bestätigt und dem Patienten auf Grund des bereits fortgeschrittenen Tumorleidens eine nicht mehr sinnvolle und belastende Operation erspart. Bültmann: „Hier müssen dann andere Maßnahmen eingesetzt werden, zum Beispiel Chemo- und/oder Strahlentherapie. Tumor ➔ eine Schwellung, Geschwulst oder Gewebe-Neubildung – der Begriff sagt nichts über Gut- oder Bösartigkeit aus. Karzinom ➔ ein bösartiger Tumor, eine maligne Geschwulst. Sarkom ➔ ein vom Binde- oder Stützgewebe ausgehender bösartiger Tumor. Lymphom ➔ ein bösartiger Lymphknotentumor, zählt zu den Systemerkrankungen. Leukämie ➔ Sammelbegriff für bösartige Erkrankungen des blutbildenden Systems. IMPRESSUM „KLINIK FORUM“ Patientenzeitung des Universitätsklinikums Tübingen Herausgeber: Universitätsklinikum Tübingen Redaktion: Dr. Ellen Katz (verantw.), Text: Rosemarie Greiner Redaktionsanschrift: Universitätsklinikum Tübingen, Geissweg 3, 72076 Tübingen Anzeigen: Günther J. Straub, Tel. (0 71 52) 4 89 30, Fax (0 71 52) 4 17 48 Layout und Satz: Heller – Grafik & Illustration. Druck: Deile Druck GmbH Nächste Ausgabe: Februar 2003 Forschung ist die Entwicklung neuer Behandlungskonzepte von der Strahlentherapie über die medikamentöse Behandlung und chirurgischen Möglichkeiten bis zu Immuntherapien. In klinischen Studien werden sie verglichen mit den derzeitigen Standard-Therapien: Sind die neuen effektiver, schonender? Vermindern sie die Nebenwirkungen? Erhöhen sie die Lebensqualität mit ihrem Ergebnis? Können sie heilen, wo bislang keine Heilung denkbar ist? Einen wichtigen Part dabei hat, nicht nur beim Kampf gegen die heimtückischen Hirntumoren (siehe „Hirntumoren“, Seite 14) die Radioonkologie, in der Regel im Verbund vor allem mit der Chemotherapie. Mit einer Kombinationsbehandlung aus Chemotherapie und spezieller Strahlentherapie lassen sich heute, so der Strahlentherapeut und Ärztliche Direktor der Radioonkologischen Klinik Prof. Michael Bamberg, auch in vordem aussichtslosen Fällen Erfolge erreichen, lebensverlängernd, Lebensqualität verbessernd und durchaus, wie vor allem die kindliche Hirntumortherapie und die Behandlung der Hodentumoren (siehe Seite 6) zeigen, auch heilend. Mit der neuen „intensitätsmodullierten Radiotherapie“ (IMRT), die bislang erst in Heidelberg, Berlin und eben in Tübingen angewendet wird, kann die Bestrahlung nun definitiv maßgeschneidert erfolgen: Man hat nicht wie herkömmlich ein fest abgestecktes Bestrahlungsfeld, das mit bestimmter Intensität bestrahlt wird, sondern eines, das sich an der Form des Tumors orientiert. Diese wird zuvor per Computer analysiert und der Tumor dann – das ist der Trick dabei – in viele kleine Teilbereiche zerlegt. Diese kleinen Teilbereiche können jetzt zielgenau mit der jeweils nötigen Dosis bestrahlt werden, bekommen sozusagen eine individuelle Behandlung verpasst. Computergesteuerte Strahlenblenden kontrollieren die Dosierungen. Über diese Blenden können die Einzeldosen auch unter der Bestrahlung verstärkt oder abgemildert werden. Eingesetzt wird die IMRT vor allem, wenn ein Tumor in kritischer Umgebung liegt, der Chirurg also nicht radikal und schon gar nicht mit einem „Sicherheitsabstand“ zum gesunden Gewebe operieren kann, wie das vor allem im Gehirn, an der Schädelbasis, Gefäßen oder am Sehnerv der Fall ist. Immer mehr an Bedeutung in der Radioonkologie gewinnen die Brachytherapie, bei der die Strahlenquelle unmittelbar am zu bestrahlenden Feld appliziert wird (siehe „Getrübter Adlerblick“, Seite 14), desgleichen auch die in Deutschland bisher erst an fünf Kliniken praktizierte Kathetertechnik, die angewendet wird, wenn es auf punktgenaue Bestrahlung ankommt (siehe „Wo Alleingang schädlich sein kann“, Seite 15) und die Hyperthermie (Überwärmung) in Verbindung mit Chemotherapie, die unter anderem bei Rezidiven etwa an der Brustwand oder bei inoperablen Dickdarmtumoren genutzt wird. Onkologie_Sonder umbruch 17.07.2003 12:19 Uhr Seite 3 3 RADIOLOGIE – OMBUDSMANN DES PATIENTEN ➔ Der Hausarzt sagt: „Da stimmt was nicht in Ihrem BRÜCKENPFLEGE Das Tübinger Projekt kümmert sich um pflegebedürftige Krebspatienten zuhause. Seine beiden Einsatzschwerpunkte sind die Brückenpflege und der Spezialpflegedienst für Schwerkranke und Sterbende. Die Brückenpflege – Vorbereitung der Entlassung aus der Klinik nach Hause und deren Organisation, – psychosoziale Beratung und Begleitung, – Überwachung von Schmerztherapie und Symptomkontrolle, – Rufbereitschaft rund um die Uhr für die von ihr betreuten Patienten. Spezialpflegedienst für Schwerkranke und Sterbende (zeitintensive Pflege) – Intravenöse Ernährung, – Einsatz nach aktuellem Bedarf, – Nachtwachen, – Sterbebegleitung. Einsatzbereich der Mitarbeiter/innen des Tübinger Projekts sind der gesamte Landkreis Tübingen und die Gemeinden Walddorfhäslach und Pliezhausen. Kontaktaufnahme über Telefon 07072/206111 oder E-Mail: [email protected] Bauch, da muss nachgesehen werden...“ Und schickt den Patienten zum Radiologen. Der soll sich mal den Unterleib mit dem Computertomografen angucken. Er stellt einen Tumor ziemlich weit hinten im Dickdarm fest, schon nicht mehr ganz klein... In der Onkologie spielt die radiologische Diagnostik eine entscheidende Rolle. Sie ist so etwas wie der „Ombudsmann des Patienten“, sagt Prof. Claus Claussen, Geschäftsführender Direktor der Radiologischen Klinik und Ärztlicher Direktor der Abteilung Radiologische Diagnostik. Ihre Aufgabe unter anderen ist die Primärdiagnostik, also nach vermuteten Tumoren oder Metastasen zu suchen, sie genau zu orten, festzustellen, in welchem (Entwicklungs-) Stadium sie sich befinden und später den Therapieverlauf zu kontrollieren – reagiert der Tumor auf das gewählte Behandlungskonzept, stagniert sein Wachstum, ist er gar geschrumpft oder hat er sich im Gegenteil weiter ausgedehnt? Mit Hilfe der bildgebenden Verfahren kann der Radiologe selbst kleine Veränderungen ausmachen, charakterisieren und differenzieren. Dazu stehen ihm heute immer genauere, schnellere und sicherere Geräte und Techniken zur Verfügung, mit denen werdende Tumoren bereits im Vorstadium ausgemacht und, wenn es ihre Lage erlaubt, minimal invasiv abgetragen werden können: Computertomografen (CT), die dreidimensionale Bilder liefern zum Beispiel oder Multischicht-CT, die 16 Schnitte auf einmal aufnehmen. Mit dem Kernspintomografen und der Positronen-Emissions-Tomografie wiederum lassen sich sowohl morphologische Veränderungen des Gewebes als auch Veränderungen in der Stoffwechselaktivität (z.B. Durchblutung, Zuckerstoffwechsel) feststellen. „Man kommt“, so Claussen, „immer mehr von der alleinigen bildgebenden Darstellung weg zur funktionellen Bildgebung.“ An der Spitze dieser Entwicklung steht das sogenannte Falken-Auge (Hawk Eye). Seit knapp zwei Jahren verfügt die Tübinger Nuklearmedizin als eine der ersten Abteilungen weltweit über dieses HighTech-Gerät. Es ist die Kombination zweier bildgeben- Campus der Verfahren in einer Apparatur: der Szintigrafie (die die Stoffwechselaktivitäten zeigt) und der Transmissions-Tomografie (die über Röntgenaufnahmen den Tumor, sei er auch noch so klein, sichtbar macht). Prof. Roland Bares, Ärztlicher Direktor der Abteilung Nuklearmedizin der Radiologischen Klinik, zur Funktionsweise des Geräts: „Es überlagert die radiologischen mit den nuklearmedizinischen Messungen zu einem Gesamtbefund.“ Mit dem Falken-Auge kann der Tumor schon in einem Frühstadium lokalisiert werden, in dem er noch zu keiner Größen- oder Formveränderung des betroffenen Organs geführt hat und in dem die erhöhte Stoffwechselaktivität seine Existenz bereits verrät, erklärt Dr. Christiane Pfannenberg, Oberärztin an der Radiologischen Klinik und Mitglied im Team „Bildfusion“. Hier arbeiten Radiologische Diagnostik, Nuklearmedizin und Radioonkologie zusammen. Eingesetzt wird dieses neue nuklearmedizinische Verfahren – im Moment noch im Rahmen von Studien – zur Tumoren- und Metastasen-Diagnostik an Knochen und Skelett, zur Diagnostik neuro-endokriner (Hormone produzierender) Tumoren im Bauchraum, zur Entzündungsdiagnostik, Optimierung der Herzszintigrafie und Therapie-Kontrollen bei Schilddrüsenkarzinomen. Inzwischen sind mehrere hundert Patienten mit dem Falken-Auge diagnostiziert worden. „Wir haben gezeigt“, sagt Bares, „dass sich Zusatzuntersuchungen vermeiden lassen – in zwei Drittel der früher unklaren Fälle war eine zuverlässige Aussage möglich.“ Und: „Bei jedem vierten Patienten ergaben sich Zusatzinformationen, die zur Änderung der bisherigen Behandlung geführt haben.“ Doch auch wenn die Radiologische Diagnostik in erster Linie ein diagnostisches Fach ist, hat sie, so Claussen, auf Grund der immer genaueren Lokalisationsmöglichkeit und Technikentwicklung auch zur lokalen Tumor-Therapie einiges beizutragen: zum Beispiel Stillung von Blutungen im Darmbereich und in der Leber (Embolisations-Therapie) oder die Radiofrequenzablation-Therapie bei Lebertumoren und -metastasen (siehe „Krebs im Verdauungstrakt – eine Gemeinschaftsaufgabe“). Onkologie_Sonder umbruch 17.07.2003 12:19 Uhr Seite 4 KLINIK FORUM Sonderausgabe O N K O L O G I E 4 KREBS IM VERDAUUNGSTRAKT – EINE GEMEINSCHAFTSAUFGABE ➔ Krebserkrankungen im Verdauungstrakt – Speiseröhre, Magen, Leber, Dick- und Enddarm, Gallenwege und Bauchspeicheldrüse – machen fast ein Drittel aller bösartigen Neuerkrankungen bundesweit aus. Am Tübinger Universitätsklinikum sind es rund 2000 im Jahr. Wenn heute Peter X. mit dem Verdacht auf einen solchen Krebs im Verdauungstrakt (die Mediziner sprechen vom Gastrointestinal-Trakt) in die Medizinische Klinik geschickt wird, kann er sicher sein, dass ihm dort zu seiner bestmöglichen Versorgung alles zur Verfügung steht, was es an moderner Diagnostik und Behandlungsmöglichkeiten gibt. Was ihm vorgeschlagen wird, hängt dabei nicht von der Entscheidung eines einzelnen Arztes ab. „Die Behandlung dieser größten Gruppe solider Tumoren wird heute als interdisziplinäre Angelegenheit betrachtet“, erklärt Chirurgie-Chef Prof. Horst Dieter Becker. Einheitliches Behandlungskonzept Vor zwei Jahren haben Direktoren und Mitarbeiter der Chirurgischen Klinik, der Medizinischen Klinik, Abt. I und II, der Klinik für Radiologie, Abt. Radiologische Diagnostik und des Instituts für Pathologie das mit dem Interdisziplinären Tumorzentrum (ITZ) verbundene Zentrum für Gastrointestinale Onkologie (ZGO) gegründet. Dieses Zentrum stimmt unter Federführung der Oberärzte der beteiligten Bereiche die Aktivitäten aller Kliniken, die Patienten mit bösartigen Tumoren des Verdauungstrakts behandeln, ab. Die Patienten werden daher, so der koordinierende Arzt Dr. Christoph Burkart, „egal in welcher Klinik sie aufgenommen werden, von Anfang an von der Diagnostik über die Therapie bis zur Nachsorge und psychosozial einheitlich fächerübergreifend abgestimmt nach modernsten Konzepten untersucht und behandelt“. Die Chirurgie ist laut Becker im Bereich des Verdauungstrakts „viel radikaler“ geworden. Man entfernt im Zweifelsfall nicht nur das befallene Organ, sondern auch ein angrenzendes und ersetzt per Transplantation das ganze Ensemble. Andererseits operiert man bei begrenztem Tumor in der Regel nur lokal. Dank spezieller Ultraschallverfahren und spezieller Computer- und Kernspintomografie, „können wir heute sehr genau sagen, wie weit ein Tumor fortgeschritten ist“, so der Chirurg. Außerdem können die Pathologen an Hand der Gewebebiopsie bei immer mehr Tumoren mit Hilfe molekularbiologischer Analysen Aussagen machen über ihr Verhalten (langsames oder schnelles Wachstum etwa), über ihre Ansprechbarkeit durch eine bestimmte Behandlung und zur individuellen Prognose. Zurück zu unserem Beispiel Peter X. Der Verdacht auf einen bösartigen Enddarm-Tumor hat sich bestätigt. Jetzt wird interdisziplinär beraten, wie behandelt werden soll: Ist es sinnvoll, den Tumor vor der Operation durch Radiotherapie (Bestrahlung) zu schrumpfen, nach der Operation eventuell noch eine zusätzliche Chemotherapie zu geben? Soll man erst operieren und dann bestrahlen und /oder eine Chemotherapie durchführen? Oder nur operieren, sofern noch keine Lymphknoten befallen sind? Minimal invasiv bei noch nicht zu weit fortgeschrittenem Stadium? Becker: „Das sind Wege, die wir gemeinsam klären müssen.“ Als erfolgreich erweist sich dabei vor allem auch die Kombination verschiedener Verfahren. Das gilt gleichermaßen für die meisten anderen Tumoren. Burkart: „Es werden immer mehr multimodale Therapiekonzepte angewendet – sowohl bei Tumoren, die bisher schlecht auf die Behandlung angesprochen haben wie Speiseröhre, Magen und Bauchspeicheldrüse, als auch für Tumoren, die bereits mit gutem Erfolg behandelt wurden und durch solche kombinierten Behandlungskonzepte noch bessere Heilungs-Chancen haben wie Dickdarm- und Enddarmtumoren.“ Darmkrebs vermeidbar – aber... Mit bundesweit rund 57.000 Neuerkrankungen (Frauen 30.000, Männer 37.000) pro Jahr mit steigender Tendenz (1995: 51.000) besetzt der Darmkrebs nach wie vor den Spitzenplatz der Krebsstatistik. Knapp 30.000 sind 1999 (letzte offizielle Statistik) daran gestorben. Dies, obwohl gerade Darmkrebs leicht zu vermeiden wäre. Mit regelmäßiger Früherkennung bräuchten, so die Erfahrung DARMKREBS – SIGNALE – Veränderte Stuhlgewohnheiten: plötzlicher Durchfall oder plötzlich auftretende Verstopfung oder Wechsel von beidem. – Krampfhafte Bauchschmerzen, – wiederholt Stuhldrang (oft ohne Erleichterung), – Blut im Stuhl, – unklarer Gewichtsverlust. der Onkologen, neun von zehn der 30.000 nicht zu sterben. Denn beim Darmkrebs gibt es immerhin Warnsignale. Und es gibt Früherkennungsmöglichkeiten: – den jährlichen Test auf unsichtbares (okkultes) Blut im Stuhl – in den USA, wo die Leute zu dieser Untersuchung gezwungen werden, ist die Krebsrate bei Dickdarm innerhalb von fünf bis acht Jahren um 50 Prozent gesunken, – die Darmspiegelung als effektivstes Früherkennungsinstrument. Sie wird jetzt endlich von den gesetzlichen Krankenkassen vom 56. Lebensjahr an pro Versichertem zweimal bezahlt. Doch eigentlich sollte man, so Becker zum KLINIK FORUM, die letzten 40 Zentimeter alle drei Jahre spiegeln lassen – „75 bis 80 Prozent aller Dickdarmtumoren sind hier lokalisiert!“. (Siehe dazu auch „Risikofaktoren“). Auch die Tumoren der Speiseröhre (knapp 4.000 bundesweit pro Jahr), und der Bauchspeicheldrüse (10.530) nehmen zu. Bei der Speiseröhre sind es vor allem Tumoren am Übergang zum Magen. Burkart: „Sie entstehen auf dem Boden einer durch chronischen Magensäurereflux (Sodbrennen) bedingten Schleimhautentzündung und -schädigung.“ Durch regelmäßige Magenspiegelung und neuerdings auch molekularbiologische Untersuchungen (Forschungslabor von Prof. Michael Gregor und Bodo Klump, Medizinische Klinik, Abt. I) können die Tu- D A R M K R E B S : R I S I K O FA K T O R E N Außer den allgemeingültigen Risikofaktoren – Rauchen – Alkohol – fettreiche, ballaststoff- und vitaminarme Ernährung – mangelnde Bewegung gibt es noch Faktoren, die in bestimmten Konstellationen die Krebsentstehung fördern können: – Chronische Entzündungen der Dickdarmschleimhaut wie Colitis ulcerosa oder Barrett Ösophagus können bösartig werden. Regelmäßige Kontrolle ist deshalb anzuraten. – Polypen – die meisten Dickdarmtumoren (etwa 90 Prozent) haben als Vorstufe einen Polypen. Sie entwickeln sich über zwei bis drei Jahre. Von einem bestimmten Zeitpunkt an entarten sie. Deshalb sind Vorsorgeuntersuchungen besonders wichtig, wenn man selbst oder ein direkter Familienangehöriger unter Dickdarmpolypen leidet. – Erbliche Belastung spielt bei fünf bis zehn Prozent der Dickdarmkarzinome eine Rolle. Heute ist es durch molekularbiologische Untersuchungen möglich festzustellen, ob jemand die Veranlagung geerbt hat oder nicht (was nicht heißt, dass er deshalb auch einen Krebs entwickelt). Es wird in jedem Fall empfohlen, bei familiärem Dickdarmkrebs (ebenso wie beispielsweise bei familiärem Brustkrebs) die Vorsorgeuntersuchungen engmaschig wahrzunehmen. Denn 70 bis 80 Prozent der erblich vorbelasteten bekommen den Krebs auch. Rechtzeitig entdeckt, ist er gut heilbar. Onkologie_Sonder umbruch 17.07.2003 12:19 Uhr Seite 5 5 BLASENKREBS DURCH RAUCHEN morerkrankungen meist frühzeitig erkannt und erfolgreich behandelt werden. Leberkrebs – neue Ansätze bei nicht operablen Tumoren Die Zahl der bösartigen Lebertumoren (4.470) hat ebenfalls zugenommen, wobei hier neben den Hauptrisikofaktoren Alkohol und Rauchen auch die Spätfolgen von Hepatitis B- und C-Infektionen eine Rolle spielen. Den größten Anteil an dieser steigenden Zahl haben freilich Metastasen von Primärtumoren an und in anderen Organen: Darm, Brust, Lunge... In den zurückliegenden zehn Jahren hat es große Fortschritte in der Leberkrebs-Therapie gegeben. Die Leber selbst zeigt sich in punkto Operation recht gutwillig – immerhin kann der Chirurg bis zu zwei Drittel des Organs wegnehmen und es regeneriert sich innerhalb weniger Monate. Doch trotz aller Fortschritte können noch immer nur etwa 25 Prozent der Patienten mit Lebertumoren oder -metastasen operativ behandelt werden. Den nicht zu operierenden Tumoren kommen radiologische Therapieverfahren zu gute, ein Bereich der Radiologie, der sich, so der Geschäftsführende Direktor der Radiologischen Klinik, Prof. Claus Claussen, in den letzten Jahren dank neuer Lokalisierungsmöglichkeiten durch bildgebende Verfahren rasch entwickelt hat. Ganz vorne H E I L U N G S R AT E N (Tübinger Werte ) Dickdarm Magen Leber Speiseröhre Bauchspeicheldrüse 60 bis 65 Prozent 20 bis 22 Prozent 15 Prozent 10 Prozent 5 bis 8 Prozent unter diesen nichtoperativen Behandlungsansätzen im Bauchraum und Magen-Darm-Trakt steht die in der Tübinger Klinik entwickelte minimal invasive Tumorzerstörung durch Radiofrequenzablation, also Wärme, unter computer- oder kernspintomografischer Sichtkontrolle. „Es gibt kaum ein TherapieVerfahren, das sich derart schnell entwickelt hat“, meint Privatdozent Dr. Philippe Pereira, Oberarzt an der Abteilung Radiologische Diagnostik. Für Patienten, denen mit einer Operation nicht geholfen werden kann, bedeutet dieses Verfahren eine Chance, die es vor fünf Jahren noch nicht gab. Unter Sichtkontrolle wird nach örtlicher Betäubung eine nadelförmige Sonde durch die Haut geführt und direkt im Tumor platziert, wo die Wärme das Tumorgewebe in zehn bis zwanzig Minuten abtötet. Das Verfahren hat gewisse Grenzen: Es sollten nicht mehr als fünf Einzeltumoren sein und die nicht größer als fünf Zentimeter. Diese Therapie wird seit drei Jahren in Tübingen, das als Zentrum für dieses Verfahren ausgewiesen ist, unter Studienbedingungen angeboten. Es gibt inzwischen eine Arbeitsgruppe, zu der neben Tübingen München, Heidelberg und Aachen gehören, die die bisherigen Studien mit einer größeren Patientenzahl untermauern will. Doch die bisherigen Erfahrungen zeigen schon, so Pereira, „dass es eine gute palliative Methode bei Leberkrebs und -metastasen ist“. Und vielleicht auch bei ausgewählten Fällen eine heilende? Drei Viertel der so behandelten Patienten hat lokal, also in der Leber, bisher keine Metastasen mehr bekommen. Auch dieser Frage wird in gezielten Untersuchungen nachgegangen. Seit kurzem wird das Verfahren deshalb, in Zusammenarbeit mit der Urologischen Klinik, auch bei inoperablen Nierentumoren angewendet. Magenkrebs – eher zufällig entdeckt Die Häufigkeit des Magenkrebs ist zwar rückläufig, aber trotzdem noch der vierthäufigste Tumor. Er gehört zu den hinterhältigsten Krebsen: „Es gibt keine Frühsymptome, er wird häufig bei einer Magenspiegelung zufällig entdeckt oder macht sich im Spätstadium durch Bauchschmerzen und Gewichtsabnahme bemerkbar“, erklärt Burkart. Bezogen auf die Fünfjahresüberlebensrate liegt die Prognose bei den am häufigsten diagnostizierten Stadien zwischen 30 und fünf Prozent. In einer von der Tübinger Medizinischen Klinik und der Radioonkologischen Klinik durchgeführten Studie (Prof. Carsten Bokemeyer, Prof. Wilfried Budach) wird derzeit untersucht, ob die Überlebenschancen von Patienten nach Operation eines Magenkarzinoms durch kombinierte Chemo- und Strahlentherapie verbessert werden können. Verantwortlich gemacht für die Entstehung von Magenkarzinomen werden, so Burkart, „neben Ernährungsgewohnheiten wie Verzehr stark gesalzener oder geräucherter Speisen bestimmte Arten chronischer Magenschleimhautentzündung. Wenn also eine medikamentöse Behandlung bei Oberbauchschmerzen nichts bringt, sollte man sich bald einer Magenspiegelung unterziehen, rät Burkart. Die Diskussion über einen direkten Zusammenhang zwischen Helicobacter pylori, dem Erreger chronischer Magenschleimhautentzündung, und Magenkrebs ist noch nicht abgeschlossen – der Keim ist weder entlastet noch dingfest gemacht. Immerhin hat man festgestellt: Kein Erreger, selten Krebs. Wenn Krebs, dann oft in Gesellschaft des Erregers. ➔ Blasenkrebs ist bei Männern mit fast 11.000 Neuerkrankungen in Deutschland pro Jahr doppelt so häufig wie bei Frauen (rund 5.000 Neuerkrankungen). Das Durchschnittsalter bei der Diagnose liegt zwischen 69 Jahren (Männer) und 73 Jahren (Frauen). Drei Viertel der bösartigen Tumoren sind oberflächlich. Sie kann man, erklärt der Ärztliche Direktor der Urologischen Klinik, Prof. Arnulf Stenzl, organerhaltend durch die Harnröhre wegoperieren. Erreicht wird diese Erhaltung der Blase und damit auch von Lebensqualität in einem hohen Prozentsatz durch moderne Behandlungsmethoden wie Fluoreszenzendoskopie und Laserbehandlung. Auch Immuntherapie spielt hier eine Rolle. Wenn keine der genannten Möglichkeiten wirkt, wird Chemotherapie eingesetzt, Heilungs-Chance 15 bis 20 Prozent. BLASENKREBS... ... ist nach Lungenkrebs der zweithäufigste durch Rauchen verursachte Krebs. Die Teerstoffe gelangen über das Blut in die Niere und von dort in die Harnblase, wo sie in Harn gelöst in der Regel mehrere Stunden lagern – Zeit genug zum Unheil stiften. Weitere Risiken: Industriegifte, wie sie etwa in der Farben-, Lack-, Haarspray- oder Motorölherstellung entstehen können. Nur chirurgisch behandelt liegt die Fünf-Jahres-Überlebenszeit bei 80 Prozent. Voraussetzung dafür ist, man behandelt rechtzeitig. Abwarten, sagt Stenzl, geht da nicht, „dann hat der Tumor den Käfig verlassen“ und ist sonst wohin weitergewandert. Das restliche Viertel der bösartigen Blasentumoren ist so aggressiv, dass es in die Blasenwand ANZEICHEN für ein mögliches (!) Blasenkarzinom: – Blut im Urin, – Schwierigkeiten beim Harnlassen, – häufige Harnwegsinfektionen, – Schmerz im Unterbauch. eindringt – „dann muss die ganze Blase herausgenommen werden“. Doch auch hier haben die letzten Jahre enorme Fortschritte gebracht: „Wir bauen heute eine neue Blase aus einem Stück Dünndarm auf und schließen sie an die Harnröhre an.“ Die Patienten können wie vorher „Pipi machen“, bei Frauen bleibt die Scheide erhalten, gegebenenfalls wird sie wieder rekonstruiert. Die Männer erleiden keinen Potenzverlust. Onkologie_Sonder umbruch 17.07.2003 12:19 Uhr Seite 6 KLINIK FORUM Sonderausgabe O N K O L O G I E 6 MÄNNERSPEZIFISCHE KREBSERKRANKUNGEN WORÜBER MÄNNER LIEBER SCHWEIGEN ➔ Zu den ausschließlich Männern vorbehaltenen Krebserkrankungen gehören Hodenkrebs und Prostatakrebs. Beide Tumorleiden sind heute bei frühzeitigem Erkennen heilbar. Mann spricht aber nicht gerne darüber. Prostatakrebs – Angst vor Impotenz Prostatakrebs ist der häufigste urologische und neben dem Lungenkrebs auch der zweithäufigste Krebs überhaupt. Bestimmte Blutwerte und Krebsmarker geben verlässliche Auskunft über Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Prostatakarzinoms. Der neue Chef der Urologischen Klinik Prof. Arnulf Stenzl hält die Diskussion über Sinn oder Unsinn von guten Vorsorgeuntersuchungen deshalb für wenig sinnvoll. Er ist sicher: „Wir haben mit dem PSA-Bluttest, der Untersuchung auf prostata-spezifische Antigene, das beste, was die Tumorvorsorge und das Monitoring angeht.“ In der Tübinger Klinik wird der Test inzwischen routinemäßig angewendet. Je nach Ergebnis, das sich (ähnlich wie beim Cholesterin) aus zwei Werten zusammensetzt, wird dann eine Gewebeprobe zur weiteren Untersuchung entnommen oder nicht. Stenzl hat jahrelange Erfahrung mit diesem VorsorgeTest: In Innsbruck, wo er bisher tätig war, wurden seit 1993 rund 60.000 Männer mit dem PSA-Test gescreent. Der Bluttest zeigt zudem auch bei bereits behandelten, sprich operierten Patienten eine „äußerst sensible Reaktion“. Wenn die Werte normal sind, „sollte man nichts mehr machen“. Weitere Nach- oder Verlaufskontroll-Untersuchungen, mit bildgebenden Verfahren etwa, seien dann überflüssig – „man erspart dem Mann lästige Untersuchungen und Unsicherheit und dem Gesundheitswesen Geld“. Die Frage, wann und bis zu welchem Alter man bei erkanntem Protatakarzinom behandelnd eingreifen soll, gehört ebenfalls zu den immer noch kontrovers diskutierten Fragen unter Medizinern. Viele hören heute bei Männern ab 75 auf, überhaupt noch nach einem Tumor zu gucken, bei einem Durchschnittsalter von 80 scheint der sowieso unwichtig. Stenzl kann dem nicht folgen: Wenn ein Mann einen bösartigen Tumor hat und auf Grund seiner physischen und psychischen Konstitution durchaus noch eine Lebenserwartung von zehn Jahren haben kann, „kann man nicht einfach zusehen – das ist nicht fair, da sollte man behandeln!“ Prostatakrebs in jungen Jahren ist äußerst aggressiv, aber glücklicherweise auch selten. Der neue Urologie-Chef ist entschieden dafür, mit 45 Jahren mit den Vorsorge-PSA-Tests zu beginnen, bei familiärer Krebsvorbelastung bereits mit 40. Wenn keine Symptome festgestellt werden, reicht Vorsorge im Zweijahres-Abstand. Die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland freilich zahlen den PSA-Test nicht, im Gegensatz zu Österreich, wo nicht zuletzt die Innsbrucker Untersuchung überzeugt hat. Bei der Therapie eines Prostatakarzinoms stehen Stenzl zufolge Operation und Bestrahlung gleichwertig nebeneinander. „Auf jeden Fall besteht bei Prostatakrebs Behandlungsbedarf.“ Die Angst der Männer vor anschließender Impotenz ist, sagt Stenzl, unbegründet: „Wir können heute zum Beispiel so operieren, dass nicht nur der Schließmuskel erhalten bleibt, sondern auch die Potenznerven verschont werden, wenn das vom Tumor her möglich ist.“ Wenn die Potenznerven aber entfernt werden müssen, „können wir – gleich im Rahmen der Tumoroperation – aus dem Unterschenkel sensitive Nerven nehmen und die entfernten Potenznerven damit mikrochirurgisch rekonstruieren“. 80 bis 90 Prozent der Patienten mit einem Prostatakarzinom in günstigen Stadien können laut Stenzl mit Heilung rechnen. „Sie haben dann die gleiche Lebenserwartung wie jeder andere, der nie einen solchen Tumor hatte.“ Minimal invasive Chirurgie ist bei der Prostata möglich, aber es besteht da noch ein Problem bei der Potenzerhaltung. Diesbezüglich hat die sogenannte Brachytherapie Vorteile. Dieses Verfahren, bei dem radioaktive Strahlenquellen in der Vorsteherdrüse flächendeckend deponiert werden, wird angewendet vor allem bei nicht operablen Tumoren oder Patienten, die nicht operiert werden wollen. Metastasen – vorwiegend in den Lymphknoten oder als äußerst schmerzhafte Knochenmetastasen in der Wirbelsäule – sind der Schrecken auch der behandelnden Mediziner. Für den Urologie-Chef wohl der Hauptgrund seines Plädoyers dafür, „lieber früher“ therapierend tätig zu werden. Stenzl: „Das ist der Vorteil eines großen Klinikums. Wir können Protokolle anbieten, beispielsweise Strahlenbehandlung gegen Schmerzen.“ Unter Umständen können dann auch neue Präparate für eine Chemotherapie eingesetzt werden. Bei der Immuntherapie wird noch geforscht. Im Fall von Metastasen ist derzeit die Hormontherapie erste Wahl. Früher wurden die Männer kastriert, heute blockt man die Hormonzufuhr medikamentös ab durch Depotspritzen alle ein bis drei Monate und/oder Tabletten. Damit, sagt Stenzl, „können wir den Tumor und die Metastasen für ein paar Jahre ruhig halten.“ Der Preis für den Gewinn an Leben: Neben Impotenz all die Unannehmlichkeiten eines Klimakteriums. Und wenn nun die Hormontherapie nicht oder nicht mehr wirkt? „Chemotherapie nach Protokoll, in Zukunft vielleicht Immuntherapie.“ Hodenkrebs – zu 99 Prozent heilbar Hodenkrebs ist bei Männern zwischen 20 und 40 die häufigste Tumorerkrankung. Prof. Carsten Bokemeyer, Medizinische Klinik, Innere Medizin II (Häma- tologie, Onkologie, Immunologie, Rheumatologie, Ärztlicher Direktor Prof. Lothar Kanz): Mit neun Neuerkrankungen pro Jahr und 100.000 Männer „kommt er genau so oft vor wie alle akuten Leukämien – und die Häufigkeit nimmt in den Industrienationen noch zu.“ Hodenkrebs gilt in der internistischen Onkologie als Musterbeispiel für heilbaren Krebs. „Er kann heute in den allermeisten Fällen geheilt werden“, sagt Bokemeyer. Selbst bei Patienten mit metastasierter Erkrankung (Lungen- oder Lebermetastasen) liegt die Heilungschance durch eine Kombinations-Chemotherapie mit Cisplatin bei 70 bis 80 Prozent. Noch immer sterben aber jedes Jahr etwa 200 Patienten in Deutschland an bösartigen Keimzelltumoren des Hodens, was angesichts der heutigen diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten und Studienergebnisse nicht der Fall sein müsste. Eine Vergrößerung des Hodens sollte für jeden Mann Alarmsignal und Anlass sein, einen Urologen aufzusuchen. Primärtumoren müssen umgehend von einem darauf spezialisierten Urologen operiert werden. Bei dieser Operation wird aber nur der betroffene Hoden entfernt, der gesunde bleibt erhalten. Hodentumoren sind, wie Bokemeyer sagt, „ein gutes Beispiel dafür, wie durch klinische Studien die Behandlungskonzepte ständig verbessert wurden“. In solchen klinischen Studien wurden vor allem auch in Tübingen neue Verfahren entwickelt: beispielsweise die Nutzung der Positronen-Emissions-Tomografie (PET) in der Diagnose (Abteilung Nuklearmedizin, Prof. Roland Bares), oder auch der Einsatz intensivierter Therapie mit Stammzellen für Patienten mit vielen Metastasen oder bei einem Rückfall nach Behandlung (Rezidiv) und Kranken, bei denen die übliche Behandlung nicht wirkt. Die entscheidende Frage für Patienten mit Hodentumor ist die nach Verlust oder Erhalt ihrer Fruchtbarkeit. Dies um so mehr, als die meisten Erkrankungen ja in jungen Jahren auftreten. Zu Bokemeyers Forschungsschwerpunkten gehört eben die Überprüfung möglicher Spätfolgen von Therapien und der Versuch, sie zu vermeiden. Eine der wichtigen Erkenntnisse: „Zwischen 50 und 70 Prozent der Patienten werden trotz Chemotherapie wieder fruchtbar und können Kinder zeugen.“ Und: „Bisher gibt es keine Hinweise, dass diese Kinder Missbildungen oder Schädigungen haben.“ Immer wieder hört man, dass geheilter Hodenkrebs mit Leukämie bezahlt werden müsse. Auch hier ein wichtiges Ergebnis klinischer Forschung und Studien: „Wir wissen jetzt, dass die Gefahr, später eine Leukämie oder einen andren Krebs zu entwickeln, sehr begrenzt ist“. Sie betrifft laut Bokemeyer „maximal ein bis zwei Prozent der Intensiv-Behandelten, und das Jahre danach“. Onkologie_Sonder umbruch 17.07.2003 12:19 Uhr Seite 7 7 FRAUENSPEZIFISCHE KREBSERKRANKUNGEN KREBS UND SPORT BAUSTEIN-THERAPIE FÜR BESSERE CHANCEN ➔ Diagnose und Behandlung frauenspezifischer Krebserkrankungen – Brustkrebs, Gebärmutterhalsund Gebärmutterkörper-Karzinome, Eierstocktumoren und bösartige Veränderungen an den Geschlechtsorganen – spielen eine entscheidende Rolle im Aufgabenbereich der Tübinger Frauenklinik. Sie ist das größte Brustzentrum Baden-Württembergs (516 Tumordiagnosen im Jahr 2000) und assoziiertes Beratungszentrum für familiären Brust- und Eierstockkrebs der Krebshilfe. In Deutschland erkranken mittlerweile pro Jahr rund 48 000 Frauen an Brustkrebs. In Baden-Württemberg sterben jedes Jahr laut Statistischem Landesamt in Stuttgart mehr als 2000 Frauen daran (1952: knapp 800, 1961: 1110, 1987: 2007, 2000: 2242). Das mag zum Teil an nicht wahrgenommener Vorsorge, zum Teil aber auch an mangelhafter Vorsorge liegen, denn heute, so der Ärztliche Direktor der Tübinger Universitäts-Frauenklinik Prof. Diethelm Wallwiener, liegt die Heilungs-Chance bei Tumoren unter einem Zentimeter bei bis zu 90 Prozent. „ Je kleiner der Tumor, desto größer die Chance einer Dauerheilung!“ Deshalb hält er auch das nach wie vor kontrovers diskutierte Brustscreening mit Tastuntersuchung für sinnvoll. „Bei jungen Frauen bringt der Ultraschall viel, doch bei Frauen ab 40 ist die Mammographie nötig“, sagt er. Mit ihr lassen sich schon die kleinsten Tumoren und vor allem auch die winzigen Partikel der Mikrokalke aufspüren, die die ersten Hinweise auf eine Krebsvorstufe sein können. Frauen, die in der Frauenklinik Hilfe suchen, profitieren von einem Charakteristikum der Tübinger gynäkologischen Onkologie: der engen fächerübergreifenden Zusammenarbeit mit den Radiologen, Strahlentherapeuten und Pathologen. Der Einsatz modernster Mammographie-, Ultraschall- und Biopsie-Techniken, die körperlich und psychisch deutlich weniger belastende minimal invasive Chirurgie, die heute bei Tumoren im Bauchraum, zur Gebärmutterentfernung und bei Brusttumoren wo möglich angewendet wird, haben zusammen mit der rasanten Entwicklung der Molekularbiologie und der Nutzung erster Medikamente aus der Genomforschung (Antikörper) zu neuen Konzepten in Diagnostik und Therapie geführt. So erfolgen heute laut Wallwiener mehr als zwei Drittel der radikalen Tumorentfernungen brusterhaltend durch Wiederaufbau mit körpereigenem Gewebe. In diesen Fällen ist eine Nachbehandlung mit Bestrahlung zwingend. Die Operation ist heute generell nicht mehr nur Operation, sondern Teil eines Gesamttherapiekonzepts, zu dem Strahlen- und medikamentöse Therapie als unterstützende (adjuvante) Behandlung gleichermaßen gehören – in der Fachsprache nennt sich das multimodale (Baustein-Komponenten-) Therapie. Diese Baustein-Therapie baut vor und nach dem Eingriff adjuvante Sicherheits-Therapien in die Behandlung ein: Wallwiener: „Fast jede Patientin wird inzwischen nach der Operation einer Chemotherapie oder endokrinen Therapie unterzogen.“ Doch nicht nur nach der OP – auch vorher wird inzwischen in vielen Fällen vorbereitend behandelt: „Heute sollte man keinen bösartigen Brusttumor, der größer als zwei Zentimeter ist, operieren ohne vorher zu therapieren.“ Mit Chemotherapie bei Frauen vor den Wechseljahren und bei Frauen danach mit Antiöstrogentabletten, wenn die Untersuchungen der Stanzbiopsie nachgewiesen haben, dass die Tumorzellen Hormonrezeptoren, also die nötigen Antennen für die Aufnahme haben (wenn nicht: auch hier Chemotherapie). Ziel der präoperativen Therapie ist eine Schrumpfung des Tumors. Je kleiner die Geschwulst, desto sicherer lässt sich auch die letzte Tumorzelle entfernen. Die Frauen, sagt der Klinikchef, können selber tasten, wie ihr Tumor in diesen drei bis vier Vorbehandlungsmonaten kleiner wird. Dank dieser „Schrumpf-Therapie“ erweisen sich brusterhaltende Operationen in den meisten Fällen heute als genau so sicher wie die radikale Brustamputation. Brustkrebsoperation bedeutet für viele Frauen immer noch die Angst vor angeschwollenen Armen. In Tübingen werden, um die Lymphbahnen maximal zu schonen, die sogenannten Wächterlymphknoten getestet – „man kann den oder die wichtigsten finden und muss nicht unnötig viele entfernen, um zu sehen, ob die Achselhöhle befallen ist“. Noch gefürchteter als der Brustkrebs ist, obwohl sehr viel seltener, der Eierstockkrebs. Hier lief die Entwicklung in die Gegenrichtung: Organerhalt ist meist unmöglich. Wenn der Arzt eine Veränderung ertastet, ist sie schon fortgeschritten, hat meist schon die Organgrenze überschritten. Dem späten Erkennen könnte man nur gegensteuern durch häufigeres Bemühen der transvaginalen Ultraschallsonde, mit der man in den Eierstock hineinsehen und damit gegebenenfalls einen Tumor viel früher feststellen kann – aber das wird von den gesetzlichen Krankenkassen als Screening nicht bezahlt. So bleibt hier grundsätzlich nur die große radikale Operation in Kombination mit Chemotherapie. Frauen, die die „Pille“ genommen haben, haben damit in gewisser Weise ihre Eierstöcke ruhig gestellt. Eierstockkrebs tritt unter ihnen seltener auf als bei Frauen, die sie nicht genommen haben und vor allem als bei Frauen ohne Kinder. Außerdem gibt es einen Zusammenhang mit Brustkrebs, Wallwiener: „Eierstockkrebs tritt fünf- bis fünfzehnmal häufiger auf bei Frauen, die Brustkrebs hatten oder haben.“ ➔ Der positive Einfluss des Sports auf das HerzKreislaufsystem ist bekannt. Jetzt ist auch nachgewiesen, dass regelmäßige körperliche Betätigung das Risiko einer Reihe von Krebserkrankungen vermindern kann. Während allerdings gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen bereits mäßige körperliche Aktivität vorbeugend wirkt (jeden Tag beispielsweise eine halbe Stunde joggen oder eine Stunde Rad fahren oder gehen), bedarf es zur Senkung des Krebsrisikos laut Dr. Hans-Christian Heitkamp (Medizinische Klinik) einer nach Umfang und Intensität deutlich höheren körperlichen Anstrengung. Heitkamp und seine Arbeitsgruppe haben unter anderem 39 Studien der zurückliegenden 15 Jahre zum Zusammenhang zwischen Häufigkeit von Dickund Enddarmkrebs und körperlicher Aktivität analysiert. Das Ergebnis: Männer und Frauen zeigten bei hoher Gesamtaktivität – also in Beruf und Freizeit – ein um bis zu 40 Prozent niedrigeres Dickdarmkarzinom- (nicht aber Rektum-) Risiko. SPORT NACH KREBS Körperliche Aktivitäten sind der Gesundheit auch nach Krebs förderlich! Informationen über Möglichkeiten sich diesbezüglich zu betätigen in Tübingen: „Sport nach Krebs“, Ansprechpartnerin Elke Göhner, Telefon 0 70 71 / 61 457. Über Angebote in anderen Städten und Regionen informiert der Württembergische Landessportbund Goethestraße 11, 70174 Stuttgart, Telefon 0711/22 90 542. Eine erkennbare Verringerung des Krebsrisikos durch ausgedehnte körperliche Aktivität ist, so der Tübinger Sportmediziner, auch für Brust- (30 Prozent), Prostatakrebs (10 bis 70 Prozent) und wahrscheinlich auch für Bronchialtumoren nachgewiesen. Gründe für den ausgemachten Zusammenhang zwischen viel Bewegung und Krebs werden unter anderem in einer durch die körperliche Betätigung verkürzten Transitzeit im Darm und damit einer geschrumpften Kontaktzeit möglicher krebserzeugender Stoffe mit der Darmschleimhaut gesehen. Vor allem aber, sagt Heitkamp, „scheint der Verbesserung des immunologischen Zustands und damit der gesteigerten Abwehr von entarteten Zellen durch leichte bis mittlere körperliche Aktivität ein hoher Stellenwert zuzukommen.“ Informationen zum Thema Krebs und Sport bekommen Interessierte von Dr. Hans-Christian Heitkamp, Telefon 0 70 71 / 29-8 64 93. Onkologie_Sonder umbruch 17.07.2003 12:20 Uhr Seite 8 KLINIK FORUM Sonderausgabe O N K O L O G I E 8 LUNGENKREBS HOHER VERLUST AN LEBENSJAHREN ➔ Lungenkrebs – ein Wort, bei dem sich Raucher achselzuckend abwenden. Gibt’s nicht genug heftige Raucher, die uralt geworden sind? Stimmt. Aber es stimmt auch – weltweite Untersuchungen haben das eindeutig bewiesen –, dass für rund 90 Prozent der Bronchialkarzinome der Zigarettenkonsum verantwortlich ist. „Lungenkrebs“, sagt Prof. Carsten Bokemeyer (Medizinische Klinik Abteilung II), „ist fast immer mit Rauchen assoziiert“. Das erklärt auch, weshalb Frauen sich mit der Erkrankungshäufigkeit immer mehr den Männern nähern: Während die Zahl rauchender Männer kleiner wird, greifen immer mehr Frauen zur Zigarette. Bei den Männern ist der Lungenkrebs in Deutschland mit heute rund 27.900 Neuerkrankungen im Jahr vom Spitzenplatz 1 (bis 1997) auf Platz 2 zurückgefallen hinter den Prostatakrebs mit aktuell rund 31.500 Neuerkrankungen pro Jahr. Bei den Frauen ist Lungenkrebs inzwischen mit etwa 8.900 Neuerkrankungen unter die sechs häufigsten Krebse aufgerückt. Es gibt zwei Arten von Lungenkrebs: das kleinzellige und das nicht-kleinzellige Karzinom. Das kleinzellige Lungenkarzinom ist das aggressivere und es wächst vor allem sehr schnell. Eine Operation kommt, so Bokemeyer, „nur selten in Frage, da der Tumor ausgesprochen schnell Metastasen bildet“. Die Behandlung besteht aus Chemotherapie und, in einzelnen Fällen, zusätzlicher Bestrahlung. Die Überlebensrate liegt nach zwei Jahren bei etwa 20 Prozent. Ohne Behandlung führt dieses Karzinom schon nach wenigen Wochen zum Tod. Das nicht-kleinzellige Karzinom wächst langsamer – die Chance, es in einem frühen Stadium zu entdecken, ist deshalb größer. Bokemeyer: „Wenn es lokal noch nicht fortgeschritten und noch ohne Metastasen ist, ist die Operation die Therapie der Wahl“. Falls der Tumor noch lokalisiert, aber bereits fortgeschritten ist, „wird zunächst versucht, ihn durch eine mit Bestrahlung kombinierte Chemotherapie zu verkleinern, um ihn dann operieren zu können“. Dies geschieht im Verbund mit der Abteilung Radioonkologie (Prof. Michael Bamberg), der Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie (Prof. Gerhard Ziemer) und der Gerlinger Lungenfachklinik Schillerhöhe – Universitätsklinikum und Lungenfachklinik arbeiten auf der Basis eines Kooperationsvertrags zusammen. Im metastasierten Stadium hat man früher oft gar keine tumorspezifische Behandlung gemacht. Heute, 1/2 Seite Brillinger usw. Onkologie_Sonder umbruch 17.07.2003 12:20 Uhr Seite 9 9 HAUTKREBS DER GEFRÄSSIGSTE VON ALLEN sagt Bokemeyer, „haben wir eine Reihe gut verträglicher, stabilisierend und oft auch rückbildend wirkender Zytostatika zur Verfügung, die eine deutlich verbesserte Prognose bedeuten“. Mit einer „milALARMSIGNALE Zum Arzt sollte man unbedingt gehen bei – Bronchitis, Erkältung, die selbst unter Antibiotika-Einnahme nicht besser wird, – ständigem Husten, – Bluthusten, – Atemnot, – Schmerzen im Brustkorb, – Abgeschlagenheit, Gewichtsverlust, – Lähmungen. den“ Chemotherapie gelingt es, die Lebensqualität dieser Patienten wesentlich zu verbessern und meist auch eine Lebensverlängerung zu erreichen. Derzeit werden, unter anderem auch in Tübingen, neue biologische Therapeutika überprüft, „mit ersten vielversprechenden Ergebnissen“. Es sieht so aus, als könnten sie, zusätzlich zur Chemotherapie, die Prognose noch verbessern. Weil die Chancen gegen den Lungenkrebs bei frühzeitiger Entdeckung am besten sind, wird jetzt wieder über eine regelmäßige Reihenuntersuchung (Tumorscreening) der Lunge mit einem sogenannten Spiral-Computertomografen diskutiert – „die Technologie kann das leisten“. 28.214 Männer und 9.434 Frauen sind 1999 (letzte Statistik) in Deutschland an Lungenkrebs gestorben. PATIENTENTAGE Der nächste „Patiententag“ des Interdisziplinären Tumorzentrums Tübingen für Tumorpatienten und ihre Angehörige findet am Samstag, 5. April 2003, in den Kliniken Berg, CRONA-Gebäude, auf dem Tübinger Schnarrenberg statt (Anmeldung ist erforderlich). Der seit 1997 jährlich mit wachsendem Zuspruch stattfindende Patiententag informiert mit Vorträgen und Besichtigungsangeboten über das ganze Spektrum der am Tübinger Klinikum möglichen medizinischen und begleitenden Hilfe bei Krebs. ➔ Das Melanom, der „schwarze Krebs“, ist der gefährlichste unter den Hautkrebsen und der gefräßigste: In den zurückliegenden 20 Jahren hat sich die Häufigkeit seines Auftretens verdreifacht – „es gibt keinen anderen Krebs, der derart zunimmt“, sagt der Leiter der Sektion für Dermatologische Onkologie an der Tübinger Hautklinik Prof. Claus Garbe. Begonnen hat dieses immer häufiger werdende Auftreten in den 60er Jahren und sich seit den 70er Jahren beschleunigt, was übrigens für alle Hautkrebsformen gilt, also auch für die Basalzell- und die Plattenepithelkarzinome. Damals begann man in Gebieten mit viel und starker Sonne zu urlauben. „20 Jahre später beginnt der gravierende Anstieg!“ Schon Anfang der 90er Jahre haben Untersuchungen gezeigt, dass die Zahl der Leberflecken mit dem Risiko, ein Melanom zu entwickeln, korreliert. Als wichtigsten auslösenden Faktor nennt Garbe Freizeitaktivitäten im Freien, in der Sommersonne, egal, ob zuhause oder im Urlaub. Garbe: „Es muss kein Sonnenbrand sein, es reicht schon Sonne bis unterhalb der Schwelle des Sonnenbrands!“ Die Summe des Sonnentankens ist entscheidend, Hautkrebs ist in aller Regel das Ergebnis kumulativer UV-Dosis. Woraus unter anderem folgt: Kinder müssen besonders geschützt werden, „das Melanom-Risiko wird in den ersten 20 Lebensjahren durch UV-Strahlen gesetzt“. In Diagnose und Behandlung von Hautkrebsen hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Frühzeitig erkannt, liegt die Heilungs-Chance bei etwa 95 Prozent. Computerunterstützte Diagnose und digitale Bildanalyse mit außerordentlicher Sensivität und Spezifität erlauben bei regelmäßiger Überwachung (Risiko-Patienten einmal im Jahr) Hautkrebs nicht nur frühzeitig zu identifizieren, sondern auch Aussagen über Prognose und sinnvolle Behandlung zu machen. „Der wichtigste Faktor ist die Tumordicke zum Zeitpunkt der Erstdiagnose“, sagt Garbe. „Mit zunehmender Dicke nimmt das Risiko für die Melanomentwicklung fast linear zu.“ Wenn aber erst einmal Fernmetastasen da sind, „können wir zwar durch therapeutische Maßnahmen eine Lebensverlängerung erreichen, aber keine Heilung!“ Eine zytostatische Therapie hat beim Melanom, so Garbe, keine große Wirkung. Immuntherapie scheint den dermatologischen Onkologen eine bessere Möglichkeit. So setzt man, erklärt Garbe, neue Interferone mit längerer Halbwertzeit unterstützend zur Vorbeugung einer Metastasierung ein. An der Tübinger Hautklinik hat dazu gerade eine große internationale multizentrische Studie begonnen. Garbe erhofft sich davon den Beweis dafür, dass mit der Immuntherapie auch bei Patienten mit erhöhtem Metastasenrisiko diese Gefahr vermindert werden kann. Eine andere Strategie ist die Impfung gegen Hautkrebs. „Auch hier sind wir in große Studien eingebunden.“ Die Impfung soll verhindern, dass sich nach dem operativen Entfernen des bösartigen Melanoms der Krebs über Metastasen weiter aus- breitet. Sie ist schonender als die Chemotherapie und hat praktisch keine Nebenwirkungen. Das Serum wird für den Patienten individuell hergestellt: Dendritische Zellen aus seinem Blut, die die Immunabwehr stimulieren, werden mit Peptiden (Tumor-Antigenen) beladen. An diesen Tumor-Antigenen kann jetzt das Immunsystem MelanomMetastasen erkennen. Es ist, sagt Garbe, eine experimentelle Therapie, „noch nicht entwickelt für die breite Anwendung“. Ein Problem dabei sind die Transplantationsantigene – man muss die Peptide nach dem HLA-Typ aussuchen, damit sie auch tatsächlich „selbst“ und „fremd“ erkennen können. Die Impfung ist arbeitsaufwendig und teuer, „pro Impfung ist eine MTA eine Woche lang beschäftigt“. An der Hautklinik wurden bisher zwölf Patienten damit behandelt. Der Weg über die dendritischen Zellen ist laut Garbe der einzige Ansatz, der den Tumor wirklich anspricht. Trotzdem ist er überzeugt, dass die Impfung „sich als Behandlung metastasierter Hautkrebse nicht durchsetzen wird“. Sie kann aber, meint er, in einigen Jahren eine Routinebehandlung im sekundären prophylaktischen Bereich werden: „um nach der operativen Melanom-Entfernung Metastasen zu verhindern.“ Es gibt bereits (in Studien behandelte) Melanom-Patienten, die schon seit zwei oder drei Jahren nach Operation und anschließender Impfung frei von Krebszellen sind. NOCH KEIN ENDE IN SICHT Noch Anfang der 70er Jahre war Hautkrebs laut Prof. Claus Garbe „kein Thema, auch nicht in der Dermatologie – früher hat die Syphilis die Krankenhäuser gefüllt, heute ist es der Hautkrebs“. Inzwischen erkranken in Deutschland jährlich 100.000 Menschen an Hauttumoren, „und das ist noch nicht das Ende“. Basalzell- und Plattenepithelkarzinome haben mit rund 16 Prozent aller bösartigen Neubildungen Platz zwei auf der Liste der häufigsten Krebsarten erklommen – bei den Männern nach Lungen- und Prostatakrebs, bei den Frauen nach Brustkrebs. Die Tübinger Hautklinik versorgt pro Jahr laut Prof. Claus Garbe rund 400 neuerkrankte Melanom-Patienten. In Deutschland wurden 10.000 Neuerkrankungen im Jahr 2000 in Deutschland registriert – 1997 waren es noch knapp 7.000 („Arbeitsgemeinschaft Bevölkerungsbezogener Krebsregister in Deutschland“). 2.500 sterben jedes Jahr bundesweit daran. Was nur die wenigsten wissen: Melanome sind nicht nur eine Oberhauterkrankungen. Sie kommen auch an Schleimhäuten beispielsweise des Darms oder vor allem auch der Netzhaut im Auge vor (siehe dazu „Getrübter Adlerblick“). Onkologie_Sonder umbruch 17.07.2003 12:20 Uhr Seite 10 KLINIK FORUM Sonderausgabe O N K O L O G I E 10 STAMMZELLEN – IN DER ONKOLOGIE SCHON EIN URALT-„WERKZEUG“ ZUM BEISPIEL LEUKÄMIE ➔ Die Leukämie-Therapie sowohl bei Erwachsenen als auch im Kindesalter gehört zu den international renommierten Schwerpunkten der Onkologie am Tübinger Universitätsklinikum. Das liegt nicht zuletzt an der engen Zusammenarbeit, die die Abteilung II, Hämatologie, Onkologie, Immunologie und Rheumatologie der Medizinischen Klinik, Ärztlicher Direktor Prof. Lothar Kanz und die Kinderklinik, Abteilung I, Ärztlicher Direktor Prof. Dietrich Niethammer, verbindet. So betreiben beide gemeinsam zum Beispiel ein hochmodernes Labor für Zelltherapie und die Entwicklung neuer Diagnose- und Behandlungsstrategien wie aktuell etwa in der Eltern-Spende, Rezidivoder Immuntherapie. Krebsimpfung – noch keine Regelversorgung Blutstammzellen – zunächst aus dem Knochenmark, dann auch aus dem peripheren Blut – wurden am Tübinger Klinikum in der Krebstherapie schon genutzt lange bevor die breite Öffentlichkeit durch die heißen Diskussionen und Auseinandersetzungen über Forschung mit embryonalen Stammzellen auf sie aufmerksam wurde. Die Stammzelltransplantation ist ein wichtiger Schwerpunkt der von Prof. Lothar Kanz geleiteten Abteilung II. Alle bösartigen und gutartigen hämatologischen Neubildungen, die mit einer allogenen (Fremdspender-) oder autologen (Spender und Empfänger identisch) Stammzelltransplantation behandelt werden können, gehören zu ihrem Aufgabenbereich. Auch wird hier die ganze Bandbreite solider Tumoren versorgt, in Spezialambulanzen (wie etwa der hämatologisch/onkologischen Ambulanz, der immunologischen Ambulanz oder in der Transplanta- Takap tionssprechstunde) ebenso wie teilstationär in der hämatologisch-onkologischen Tagesklinik und stationär. Die Abteilung Kanz deckt vor allem die systemische Therapie in großer Breite ab, also die Behandlung des Gesamtorganismus beziehungsweise eines Organsystems, sofern die Krebserkrankung – vom Brustkrebs bis zur Leukämie – ihn/es einbezogen hat. Dabei erfolgt die Versorgung der Patienten auch hier in fächerübergreifender Zusammenarbeit vor allem mit der Strahlentherapie, Radiologie, Chirurgie, medizinischen Mikrobiologie und Virologie, die Transfusionsmedizin nicht zu vergessen. In klinischen Studien – das heißt (noch) nicht in der Regelversorgung – werden unter anderem Rezidivtherapien (siehe „Es geht auch ohne Fremdspende“) und neue immuntherapeutische Verfahren verfolgt wie insbesondere Impfungen, die das Immunsystem so aktivieren sollen, dass es selbst den Krebs zerstört. Dabei arbeitet die Abteilung vor allem mit dendritischen Zellen, die im Labor aus Patientenblutzellen gezüchtet und mit für den Tumor spezifischen Eiweißbruchstücken beladen werden. Prof. Lothar Kanz: „Eine äußerst interessante und vielversprechende Entwicklung in der Krebstherapie.“ Bösartige Tumoren, bei denen die Patienten auf eine derartige Impfung angesprochen haben, sind vor allem das maligne Melanom und das Nierenkarzinom. Um diese Immuntherapie allgemein anzuwenden, ist es freilich laut Kanz zu früh: „Noch ist offen, ob bislang beobachtete Erfolge einzelner Patienten statistisch gesehen über das hinausgehen, was wir mit anderen Therapieverfahren erreichen können.“ Niemand versäume also etwas, wenn er jetzt keine Immunisierungstherapie in Form einer Impfung erhalte. Es geht auch ohne Fremdspende Jedes Jahr erkranken in Deutschland rund 1.800 Kinder unter 15 Jahren an Krebs. Dass ihr Anteil an allen Krebskranken unter einem Prozent liegt, ist dabei kein Trost – Krebs ist bei Kindern die zweithäufigste Todesursache. Die durchschnittliche Überlebensrate liegt drei Jahre nach Feststellung der Erkrankung bei 78 Prozent, fünf Jahre danach bei 74 Prozent. Zu den Risikofaktoren werden genetische Belastungen gezählt, auch infolge der Wirkung schädlicher Stoffe, denen Eltern ausgesetzt sind. Diskutiert wird, ob Infektionen und fehlende Schutzimpfungen das Erkrankungsrisiko erhöhen und ob Viren eine Rolle spielen. Dass niederfrequente elektromagnetische Felder Leukämien verursachen, wie vielfach angenommen wird, konnte nicht bestätigt werden. Die häufigsten bösartigen Neubildungen bei Kindern sind die Leukämien (33,8 Prozent), und unter ihnen wiederum die akute lymphatische Leukämie (27,9 Prozent), die gehäuft bei den ein- bis vierjährigen vorkommt und heute eine Zehn-JahresÜberlebensrate von 76 Prozent hat. Bei der akuten nicht-lymphatischen Leukämie (etwa fünf Prozent aller bösartigen Neubildungen bei Kindern) ist die Überlebenschance sehr viel schlechter. Tübingen ist das älteste und mit 50 Transplantationen pro Jahr größte Knochenmark-Transplantationszentrum für Kinder in Deutschland und eines der größten in Europa. Die Leukämietherapie, so der Ärztliche Direktor der Kinderklinik Prof. Dietrich Niethammer im Gespräch mit dem KLINIK FORUM, ist der Bereich, in dem schon sehr früh mit Protokollen, Studien und Therapiestrategien gearbeitet wurde. Heute, sagt er, „werden über 90 Prozent der Kinder am Tübinger Universitätsklinikum innerhalb von Therapiestudien behandelt“. Die Tübinger Kinderonkologen gehören nach wie vor in Europa zu den Gruppen, die die Strategien für die Transplantation im Kindesalter bestimmen. Das Grundproblem bei der Knochenmarktransplantation: Die beiden Immunsysteme – das eigene und das fremde – stoßen sich, wenn sie sich genetisch unterscheiden, ab. Tatsächlich finden sich manchmal unter drei Millionen Menschen keine identischen Immunsysteme. Es sei denn unter Geschwistern bei einer Chance von eins zu vier. „Damit haben wir angefangen“. Die internationale Suche nach Fremdspendern (seit 1980) „funktioniert, ist aber sehr aufwändig“, vor allem sehr zeitaufwändig, ein tödliches Handicap, wenn die Zeit drängt. Vor sechs Jahren brachen die Tübinger deshalb mit dem Dogma, dass Eltern nicht Spender sein sollen. Niethammer: „An Hand von Tierexperimenten in Israel und den Erfahrungen italienischer Kollegen bei Erwachsenen wiesen wir endgültig nach, dass es geht: mit sehr hoher Stammzellenzahl und der Onkologie_Sonder umbruch 17.07.2003 12:20 Uhr Seite 11 11 KEHLKOPF- UND RACHENKREBS BEI ALLER DRAMATIK EINE ERFOLGSSTORY Entfernung aller Lymphozyten und T-Zellen aus dem Transplantat.“ Das von den Tübinger Kinderonkologen entwickelte Verfahren ist inzwischen bei etwa 70 Kindern angewendet worden. „Die Ergebnisse sind mindestens so gut wie mit Fremdspenden“, sagt Niethammer. Keines dieser Kinder hätte ohne dieses neue Verfahren eine Chance gehabt, denn sie haben keine Geschwister und fanden keinen Fremdspender. Oder es musste so schnell gehen, dass die Zeit für die Suche nicht reichte. Wie bei dem Säugling, der wegen eines Immundefekts auf der Intensivstation lag und beatmet werden musste. „Wir holten sofort den Vater und am nächsten Tag wurde transplantiert.“ Ein Rückfall (Rezidiv) bedeutet nach wie vor ein Problem. Die Immuntherapie, so Niethammer, macht bei akuter Leukämie nur Sinn, wenn es um wenige Leukämiezellen geht. In gemeinsamer Forschung haben die Tübinger Hämatologen um Niethammer eine Methode gefunden, mit der man im Knochenmark bereits Leukämiezellen aufspüren kann, solange man sie mit üblichen Untersuchungsverfahren noch gar nicht erkennen kann – auch ein Tumor hat zur eigenen Regeneration sowie Bildung der Krebszellen Stammzellen, Zellen, die in unreifem Stadium aus dem Ruder gelaufen sind. Diese Selbsterneuerung des Tumors durch seine Stammzellen, „weist möglicherweise in eine Richtung, in der man weiterkommt“ (Kanz). Bisher versucht man die Tumorzellen zu zerstören. „Aber wir müssen nicht den Tumor treffen, sondern wir müssen bereits die Tumorstammzelle an der Nachschub-Beschaffung hindern“, sagt Kanz. Mit dem neuen Verfahren kann man laut Niethammer etwa die Hälfte dieser Kinder vor einem Rückfall schützen. In einer bundesweit laufenden Studie wird jetzt untersucht, „wie wir das auch bei der anderen Hälfte schaffen können.“ Den vierten Platz unter den bösartigen Neubildungen bei Kindern nimmt das Neuroblastom, ein höchst aggressiver Nervenkrebs, mit 150 Neuerkrankungen jedes Jahr in Deutschland ein. Es gibt keine Früherkennung – 50 Prozent der Kinder haben bereits Metastasen, wenn der Krebs entdeckt wird. Andererseits hat er bis zum ersten Lebensjahr die Tendenz, sich spontan zurückzubilden. Die Hoffnung, ein einfacher Urin-Test als Neuroblastom-Screening könnte zu rechtzeitiger Entdeckung und Rettung vieler Kleinkinder führen, hat sich in einer der größten Studien bundesweit nicht erfüllt (siehe auch „Hirntumoren – noch schwer zu packen“). ➔ Kehlkopfkrebs und Rachenkrebs nehmen seit Jahren kontinuierlich zu. Bei Männern hat sich Kehlkopfkrebs seit dem zweiten Weltkrieg versechsfacht und bei Frauen waren Kehlkopf-, Mund- und Rachenkrebs bis vor zehn Jahren fast unbekannt. In der Tübinger HNO-Klinik wurden bis vor einem Jahrzehnt im Jahr je eine bis zwei Frauen behandelt, heute sind es Prof. Hans-Peter Zenner zufolge jährlich bis zu 50 und mehr Patientinnen. Als Hauptursache gelten Zigarettenrauchen (Kehlkopfkrebs) Zigarren- und Pfeifenrauchen (Mundkrebs), Alkohol (Rachenkrebs), und vor allem die Kombination von Rauchen und Alkohol. Zenner: „Nichtraucher bekommen selten Kehlkopfkrebs.“ Ein Raucher, hat der Leiter der HNO-Klinik am Tübinger Klinikum ausgerechnet, „investiert etwa 50.000 Euro, um einen Krebs zu kriegen“. Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Der medizinische Fortschritt in den zurückliegenden zehn Jahren war „enorm“. Zenner: „Bis dahin musste der Kehlkopf vollständig entfernt werden, um das Leben der Patienten zu retten, das waren im Jahr 110 bis 120 FRÜHSYMPTOM Wenn früh genug behandelt wird, ist Kehlkopfkrebs heilbar. Doch die Patienten kommen häufig erst, wenn sie Knoten am Hals (Metastasen) bemerken. Prof. Zenner: „Das belastet die Möglichkeit, sie zu heilen.“ Dabei gibt es ein Frühsymptom: Heiserkeit! Generell gilt: Jeder, der länger als drei Wochen heiser ist – ab zum HNO-Arzt, der kann die Diagnose stellen. Zenner: „Diesem Patienten können wir versprechen, dass wir ihn heilen können.“ Betroffene. Heute können wir bei 90 Prozent der Patienten den Kehlkopf retten.“ Mit Hilfe moderner Lasertechnik wird der Tumor in mehreren kleinen Laser-Eingriffen herausgeschält, „ohne den Kehlkopf entfernen zu müssen.“ Heilungschance in diesen Fällen laut Zenner: über 90 Prozent. Im Einzelnen ist die Behandlung abhängig von der Ausdehnung des Tumors: Stahl (Operation) und Strahl (Bestrahlung) oder auch nur eins von beidem. Kleine Tumoren wird man, sagt Zenner dem KLINIK FORUM, bei Erhalt der Kehlkopffunktionen (Atemund Schluckfunktion, vor allem auch die Stimme!) entweder in einer relativ kleinen Operation durch den Mund mit Laserhilfe herausnehmen, oder vier bis sechs Wochen lang in der Klinik für Radioonkologie (Prof. Michael Bamberg) bestrahlen – „die beiden Behandlungsformen sind gleichwertig“. Wenn das Kehlkopfkarzinom schon ausgedehnt ist, hat es in der Regel auch schon gestreut. In der Radiologischen Diagnostik (Prof. Claus Claussen) lässt sich das mit Farbdopplersonografie und Kernspintomografie erkennen. Dann, so Zenner „wird nicht nur der Kehlkopf, sondern auch die Halsregion operiert, zusätzlich zur Operation am Kehlkopf müssen auch die Lymphknoten ausgeräumt werden.“ Und fast immer wird möglicher versprengter Krebszellen wegen nachbestrahlt. Bei sehr großen Kehlkopftumoren bleibt nur die Totalentfernung (Laryngektomie). Damit ist aber auch der Verkehrspolizist entfernt, der Nahrung und Atemluft auf ihren richtigen Weg in Speise- beziehungsweise Luftröhre einweist. Um zu verhindern, dass nach der Totaloperation beim Schlucken Nahrung in den Luftweg gelangt, wird am unteren Hals ein neuer Atem-Zugang in die Luftröhre (Tracheostoma) gelegt. Der kehlkopflose Patient atmet fortan nicht mehr durch Nase oder Mund sondern ausschließlich durch diese Öffnung. Wenn bei solch einem sehr großen Tumor eine OP nicht (mehr) möglich ist oder vom Patienten nicht gewollt wird, versucht man, die Geschwulst mit einer Kombination aus Bestrahlung und Radiochemotherapie anzugehen. Bösartige Tumoren im Rachenraum sind etwas seltener. „Kleine wie große werden in der Regel heraus operiert und nachbestrahlt. Außerdem werden, da bei Rachenkrebs das Metastasen-Risiko größer als beim Kehlkopfkrebs ist, die Lymphknoten des Halses fast immer ausgeräumt. Nicht selten wird auch der Rachen vollständig entfernt. Das bedeutet, „dass wir häufig plastisch rekonstruieren müssen“. Man nimmt dazu Brustmuskel mit Haut und Arterie und schiebt ihn nach oben – man nennt das Insellappen. Oder man verwendet Haut vom Unterarm mit allen Gefäßen und verbindet sie mit denen im Rekonstruktionsgebiet. Solche Operationen im Rachenraum samt Wiederaufbau der Strukturen dauern je nach Ausmaß sechs bis zwölf Stunden. Wenn, was manchmal der Fall ist, die Speiseröhre tangiert ist, muss sie wiederhergestellt werden. Betrifft es den oberen Teil, wird auch hier wie in der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie ein Bauchchirurg zur Hilfe geholt, der ein Stück Dünndarm mit Blutgefäßen entnimmt, das vom HNO-Chirurgen oben an die Halsgefäße angeschlossen wird. Wenn der Defekt weiter unten in der Speiseröhre sitzt, muss die gesamte Speiseröhre entfernt werden. Der Chirurg zieht dann ein Stück Magen hoch, das als Speiseröhrenersatz von den HNO-Ärzten angeschlossen wird. Das sind Extrem-Fälle und Marathon-Operationen von bis zu zwölf Stunden. Onkologie_Sonder umbruch 17.07.2003 12:20 Uhr Seite 12 KLINIK FORUM Sonderausgabe O N K O L O G I E 12 KREBS IM GESICHTSBEREICH ➔ Die „blöde Scheuerstelle“ der Teil-Zahnprothese hatte ihn schon länger geärgert. Als sie monatelang nicht heilen wollte, sich stattdessen ausdehnte und sogar zu bluten begann, begab er sich in die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie des Tübinger Universitätsklinikums. Dort dann der totale Schock – fortgeschrittener bösartiger Mundhöhlen-Tumor! Die Diagnose hatte die Welt plötzlich verändert. Würde er mit einem entstellten Gesicht leben müssen? Wer würde noch mit ihm zu tun haben wollen? Rund 10.000 Menschen erkranken jährlich in Deutschland an Krebs im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich, Tendenz steigend, vor allem bei den jüngeren Jahrgängen und bei den Frauen, sagt Prof. Siegmar Reinert, Ärztlicher Direktor der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie am Universitätsklinikum. Lange Zeit waren unter den Neuerkrankten drei Mal so viele Männer wie Frauen. Viele Patienten kommen erst in einem weit fortgeschrittenen Stadium eines bösartigen Gesichts-, Mundhöhlen- oder Rachen-Tumors zum Arzt. Und das, sagt Reinert, „obwohl man die Karzinome frühzeitig selbst erkennen kann, wenn man seinen Körper beobachtet“. Unter den Behandlungsverfahren spielt die Operation neben der Bestrahlung (Radiotherapie) und Chemotherapie die wichtigste Rolle. Durch die Bestrahlung sollen bei der Operation nicht erwischte Krebszellen zerstört werden. Chemotherapie wird meist in Kombination mit der Bestrahlung vor oder nach der Operation eingesetzt. Man nutzt sie auch dazu, bei großen Tumoren, die nicht operierbar sind, das Wachstum des Krebses zu verlangsamen. Ein wichtiger Bestandteil aller Bemühungen ist die Erhaltung beziehungsweise Wiederherstellung von Aussehen und Funktionen der betroffenen Partien. Solange die bösartigen Veränderungen in der Mundhöhle und im oberen Rachen noch klein sind, wirken sich die Entfernung der bösartigen Gewebeveränderung und die Abdeckung der OP-Wunde mit Umgebungsgewebe weder funktionell noch kosmetisch negativ aus. Selbst wenn bei einem Oberkiefertumor eine Defektprothese nötig wird, „bleibt die Sprache unauffällig, kann der Patient problemlos essen, und von außen sieht man nichts“. R I S I K O FA K T O R E N – Rauchen ist der Risikofaktor Nummer 1, – Alkohol, vor allem scharfe Sachen über Jahre hin, – die Kombination von beidem, – schlechte Mundhygiene, – mechanische Reize (abgebrochene Zähne, scharfe Zahnkanten, scheuernde Klammern oder Prothesen), – UV-Strahlung bei Hauttumoren. Anders, wenn Mundboden, Zunge oder Unterkiefer in Mitleidenschaft gezogen sind, Strukturen also, die sich bewegen. Oder bei Gesichtstumoren, etwa von innen herauswachsenden PlattenepithelKarzinomen, bei deren Operation man „oft ganze Areale des Gesichts wegnehmen muss und fast immer auch die Hals-Lymphknoten. Bösartige Tumoren im Gesichts- und Rachenbereich streuen vorwiegend in die Halslymphknoten, ganz selten in andere Körperregionen oder Organe. Doch auch in diesen schwierigen Fällen, so Reinert, bleibt oberstes Therapieziel die möglichst naturgetreue Rekonstruktion von Aussehen und Wiederherstellung der Funktionen, also von Mimik, Sprache, Schlucken, Kauen. Je nach Stadium des bösartigen Tumors wird dabei mit dem gesamten Spektrum mikrochirurgischer Transplantate gearbeitet. Reinert: „Im Allgemeinen wird versucht, gleich bei der Operation möglichst gewebeadäquat mit Gewebe des eigenen Körpers zu rekonstruieren.“ Das geschieht mit Haut-Fett-MuskelLappen samt den sie ernährenden Blutgefäßen (ohne sie würden die Transplantate absterben) und wo nötig auch Nerven aus dem Unter- oder Oberarm oder dem Bereich der Brust oder dem Rückenmuskel, oder sogar mit einem Stück Dünndarm („dabei helfen uns die Bauch-Chirurgen“). Bei defektem Knochen wird auch dieser gleich ersetzt durch ein Stück aus dem Schulterblatt, Beckenkamm oder dem seitlichen Unterschenkel. Oft aber haben es die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen mit großen, die Strukturen flächenhaft beeinträchtigenden Defekten zu tun, beispielsweise, wenn Augenhöhlenweichteile betroffen sind, das Karzinom in einer Kieferhöhle sitzt oder sich über ganze Gesichtshälften ausgedehnt hat. Dann muss meist die ganze Augenhöhle ausgeräumt, die Nase oder das Ohr mit Umgebung herausgeschnitten werden und dann geht es nicht ohne eine kombinierte Versorgung: „Da arbeiten wir zunächst mit körpereigenen Transplantaten, an denen dann implantatgehaltene Gesichtsprothesen, sogenannte Epithesen, fixiert werden.“ Man muss einem so behandelten Menschen schon sehr genau ins Gesicht sehen, um ohne Kenntnis seiner Situation die Augen- (Nasen-, Wangen- oder Ohr-) Epithese aus Kunststoff zu erkennen. ERSTE ANZEICHEN – geschwürige oder erhabene Veränderungen an Haut oder Schleimhaut, die nicht abheilen, – blutende Haut- oder Schleimhautveränderungen. SPÄTERE ANZEICHEN HohenEntringen (bei Mundhöhlen- und Rachenkrebs): – Sprechbehinderung, – Schluckbeschwerden, – Schwellungen mit Atembeschwerden, – Kloßgefühl im Bereich des Mundbodens oder der Zunge, – anhaltender Mundgeruch. Es sind bis zu zwölf und mehr Stunden dauernde Eingriffe, „doch das sind für den Patienten sehr wertvolle Stunden“ – auch wenn diese enormen Anstrengungen die Überlebens-Prognose nach neuesten Erkenntnissen offenbar nicht entscheidend verlängern, „aber die Patienten haben deutlich an Lebensqualität gewonnen“. Onkologie_Sonder umbruch 17.07.2003 12:20 Uhr Seite 13 Emanuel usw Bad Rippoldsau Onkologie_Sonder umbruch 17.07.2003 12:20 Uhr Seite 14 KLINIK FORUM Sonderausgabe O N K O L O G I E 14 KREBSERKRANKUNGEN AM AUGE HIRNTUMOREN GETRÜBTER ADLERBLICK NOCH IMMER SCHWER ZU PACKEN ➔ Krebs im Auge? „Gibt’s nicht!“ Gibt es doch. 0,5 Prozent aller bösartigen Tumoren beim Menschen entwickeln sich laut Prof. Karl Ulrich Bartz-Schmidt, Leiter der Abteilung Augenheilkunde I (vorderer und hinterer Augenabschnitt) der Tübinger UniversitätsAugenklinik, am und im Auge. Mit 0,5 bis einem Fall je 100.000 Einwohner und Jahr ist das Aderhaut-Melanom der häufigste bösartige primäre Tumor im Auge. In der Tübinger Augenklinik wird er pro Woche ein- bis zweimal diagnostiziert. Dieses mit unspezifischen Symptomen – Sehbeschwerden, erhöhtem Augendruck, Gesichtsfeldeinschränkung – beginnende maligne Aderhaut-Melanom bedingt Prof. Martin Rohrbach zufolge die meisten Todesfälle im Bereich der Augenheilkunde. Zehn bis 40 Prozent der Patienten schaffen die statistisch günstige Überlebenszeit von fünf Jahren nicht. Außerdem sind die bösartigen Zellen wanderfreudig: Das Aderhaut-Melanom metastasiert in alle Organe, vorwiegend aber in die Leber. Sind die Metastasen erst einmal erkennbar (manifest), „ist die Lebenserwartung ausgesprochen schlecht“. Entscheidend ist deshalb die möglichst frühe Erkennung dieser bösartigen Veränderung, die meist zwischen dem 55. und 63. Lebensjahr auftritt und bei drei bis 20 Prozent der Betroffenen mit einem Sekundärglaukom einhergeht. Regelmäßige Kontrolle beim Augenarzt macht sie möglich. Die Behandlung ist zunehmend differenzierter geworden und hat sich deshalb in jüngster Zeit weitgehend auf wenige spezialisierte Zentren verlagert, deren eines die Tübinger Augenklinik ist. Die Möglichkeiten, erklären die beiden Experten, reichen heute vom abwartenden Beobachten über den Augapfel erhaltende Methoden bis, im äußersten Notfall, zur Entfernung des Augapfels. Bei den Augapfel erhaltenden Verfahren hat die Strahlentherapie eine führende Stellung inne. Sie wird angewendet, wenn eine Infrarot-Laserbehandlung nicht mehr in Frage kommt (Tumoren mit mehr als drei Millimeter Dicke). Wegen des hier nur kurzen Wegs von der Strahlenquelle zum Tumor wählt man, so Rohrbach, überwiegend die gewebeschonende Form der Brachytherapie: „Am Ort des Tumors wird Lorch anpassen ein Strahlenträger aufgenäht, der dort einige Tage verbleibt, bis die vorher errechnete Strahlendosis appliziert ist.“ Die Rückbildung des Melanoms dauert einige Monate. Bei einem Tumor, der für eine erfolgversprechende Strahlentherapie schon zu groß ist aber noch eine Chance lässt zur Erhaltung des Augapfels versucht man es mit lokalem Herausschneiden des bösartigen Gewebes und zusätzlichem Nachbestrahlen. Wenn die Geschwulst allerdings bereits mehr als zwölf Millimeter Dicke erreicht hat, ist in der Regel nur noch die Entfernung des Auges möglich. Im Auge können sich außerdem Metastasen von Tumoren in anderen Teilen des Körpers entwickeln. An erster Stelle sind das Brustkrebs-Metastasen. Auch hier wird laut Bartz-Schmidt mit Bestrahlung behandelt, auf die die Metastasen „sehr gut ansprechen“. Weniger „dramatisch aber häufiger“ als maligne Tumoren im Auge sind bösartige Gewebeveränderungen am Auge: Lid-Basaliome, PlattenepithelKarzinome, Talgdrüsenkarzinome (die Meibom-Drüsen der Lidplatte sind die größten Talgdrüsen des Menschen) seien hier als die wichtigsten genannt. Doch an Tumoren des äußeren Auges, konstatiert Rohrbach, „stirbt man heute eigentlich nur noch äußerst selten“. Ausnahme auch hier: „Melanome der Haut und Bindehaut“. Auch Kinder bleiben nicht verschont. Der häufigste bösartige Tumor im Auge ist bei ihnen das Retinoblastom, ein neuronaler Tumor, der sich von Netzhautzellen ableitet und unbehandelt oder zu spät erkannt zur Erblindung führt. Bartz-Schmidt: 90 bis 95 Prozent der Kinder sind, wenn der Tumor festgestellt wird, jünger als fünf Jahre. In der Tübinger Augenklinik wird die Behandlung der ganzen Bandbreite kindlicher Augenerkrankungen abgedeckt. Doch angesichts der geringen Zahl kleiner Tumorpatienten einerseits und des sich bei Kindern im Vergleich zu Erwachsenen quantitativ und qualitativ „vollkommen anders“ (Rohrbach) darstellenden Tumorspektrums werden die in der Tübinger Augenklinik diagnostizierten Retinoblastom-Fälle in das auf die Therapie von kindlichen Augentumoren spezialisierte Retinoblastom-Zentrum Essen überwiesen. ➔ Hirntumoren rangieren zahlenmäßig eher am unteren Ende der Statistik. Doch in ihrer zerstörerischen Potenz nehmen sie es mit den bösartigsten unter den „großen“ Tumoren wie beispielsweise Darm-, Brust- oder Prostatakrebs auf, und sie sind in der Regel äußerst schwer zu packen. Ihre Behandlung ist ein überregional anerkannter Schwerpunkt am Tübinger Klinikum, sowohl in der Krankenversorgung als auch in der Forschung. Radiologen, Neurologen, Neurochirurgen, Radioonkologen (Strahlentherapeuten), Pathologen, Pädiater und Internisten arbeiten dabei Hand in Hand. Kinder: 70 Prozent Heilungs-Chance Innerhalb dieses Schwerpunkts spielen die kindlichen Hirntumore eine wichtige Rolle. Nach der Leukämie sind Hirntumoren mit 20 Prozent aller bösartigen Erkrankungen im Kindesalter die zweithäufigste Krebserkrankung bei Kindern, und sie ließen bis vor wenigen Jahren nur wenig Hoffnung. Das hat sich geändert. Dank verbesserter Behandlungskonzepte und ganz neuer Therapieansätze überleben heute, so der Ärztliche Direktor der Klinik für Radioonkologie Prof. Michael Bamberg, die meisten Kinder mit einem Hirntumor. Kinder mit reinen Germinomen beispielsweise – im Schädel auftretende sehr strahlenempfindliche Keimzelltumoren, die manchmal in den Wirbelsäulenkanal streuen – leben zu fast hundert Prozent heute noch nach fünf Jahren ohne Rückfall. Erreicht wird das, erläutert der Strahlentherapeut, durch eine nicht nur den Tumor, sondern auch das ganze Rückenmark einbeziehende großräumige Strahlenbehandlung mit anschließender Chemotherapie. Auch der häufigste Hirntumor bei Kindern, das früher kaum Chancen lassende Medulloblastom, hat einiges von seinem Schrecken verloren. Der Tumor entsteht in der Regel in der hinteren Schädelgrube und tendiert dazu, über den Liquor in Gehirn und Rückenmark zu metastasieren, was ihn besonders gefährlich macht. Um mit ihm fertig zu werden und einen Rückfall auszuschließen, wird, erklärt Bamberg, nach dem operativen Eingriff das gesamte Liquorsystem in einzelne Bestrahlungsfelder zergliedert, die dann zielgenau jeweils bestrahlt werden können. Der Ausgangstumor bekommt noch eine zusätzliche Dosis verpasst. Anschließend wird eine unterstützende Chemotherapie gegeben. Bamberg: „Die kombinierte Behandlung führt dazu, dass jetzt über 70 Prozent der Kinder noch nach fünf Jahren leben.“ Gliome nach wie vor unheilbar Die bösartigste Form unter den Hirntumoren, die in jedem Lebensalter auftreten kann, vorwiegend aber ab dem 50. Lebensjahr, ist das maligne, im Gehirn selbst entstehende Glioblastom. Jedes Jahr erkranken Onkologie_Sonder umbruch 17.07.2003 12:20 Uhr Seite 15 15 WO ALLEINGANG SCHÄDLICH SEIN KANN WEICHTEILSARKOME ERFORDERN FÄCHERÜBERGREIFENDE ZUSAMMENARBEIT daran etwa 3.000 Menschen in Deutschland. Es gehört wie das Oligodendrogliom zu den Gliomen, die zusammen mit den von der Hirnhaut ausgehenden Meningiomen (zu je 25 Prozent) die Hälfte aller primären Hirntumoren ausmachen. Glioblastome gelten trotz aller Fortschritte nach wie vor als unheilbar. „Sie haben eine äußerst schlechte Prognose“, sagt Prof. Michael Weller, Oberarzt an der Neurologischen Klinik. Früherkennung ist hier nicht möglich – „selbst wenn man jeden regelmäßig im Kernspintomografen untersuchen würde, gäbe das keine Sicherheit – Glioblastome können sich in Wochen oder Monaten entwickeln“. Man kann allerdings auch nicht vorbeugen. Abgesehen von einer genetischen Veranlagung, die laut Weller selten ist, gibt es, sagt er, nichts, was man als Risikofaktor für einen Hirntumor ausmachen könnte. Kopfschmerzen als Alarmsignal sind eher untypisch, aber es gibt Warnzeichen: „Wenn ein Erwachsener plötzlich Krampfanfälle, epileptische Anfälle bekommt, kann dies ein Vorbote eines Tumors sein und sollte dringend untersucht werden.“ Halbseitenlähmung, Sprach- und Sehstörungen, oder auffälliges verändertes Verhalten können ebenfalls Hinweise sein (freilich auch auf einen Schlaganfall). Mit Kernspin- oder Computertomografie lässt sich der Verdacht ausräumen oder erhärten. Bestätigt sich der Verdacht durch die anschließende Gewebeentnahme (Biopsie), ist der Neurochirurg an der Reihe. Er entfernt den Tumor so weit, wie es dessen Lage im Gehirn zulässt. Bruchteile von Millimetern mehr oder weniger könnten, beispielsweise, das Sprachzentrum beschädigen. Dies und der den Glioblastomzellen eigene Wandertrieb in das umliegende Hirngewebe machen eine Folgebehandlung unumgänglich: „Standard ist eine Strahlentherapie, mit der heute die Hälfte der Patienten länger als ein Jahr weiterlebt“. Eine zusätzliche Chemotherapie, die oft im Rahmen einer Studie eingesetzt wird, hat sich bei einem Teil der Gliome laut Weller bewährt. „Weit mehr als die Hälfte der Oligodendrogliome spricht auf diese Chemotherapie gut an, mehr als die Hälfte der Tumoren sind sogar ganz verschwunden.“ Für wie lange, lässt sich zur Zeit noch nicht sagen. SELBSTHILFEGRUPPEN Selbsthilfegruppen für Krebspatienten in der Region Tübingen: Frauenselbsthilfe nach Krebs, Deutsche ILCO (für Menschen mit künstlichem Ausgang von Darm und Harnblase), Sport nach Krebs, Deutsche Leukämie- und Lymphomhilfe, TULPE (Betreuung und Hilfe für Gesichtsverletzte), Verband der Kehlkopflosen, Förderverein für krebskranke Kinder. Die jeweiligen Telefonnummern erfahren Sie unter Tel. 0 70 71/29-8 52 -8 35/-8 36/-8 37. ➔ Nicht jeder kann mit dem Begriff „Weichteilsarkom“ etwas anfangen. Im Vergleich zu manchen anderen Krebsarten ist es mit jährlich etwa 2000 Neuerkrankungen bundesweit eher selten. Es ist ein bösartiger und ziemlich aggressiver Tumor des Bindeoder Stützgewebes, der überall im Körper vorkommen und vom Kleinkind bis zum alten Menschen jeden heimsuchen kann. Hinzu kommt, dass das Weichteilsarkom in etwa 150 verschiedenen histologischen Subtypen auftreten kann. Die Diagnose ist deshalb komplex und sehr schwierig. Die Behandlung fordert nicht nur spezielle Fachkenntnis: Fächerübergreifende Zusammenarbeit ist unabdingbar. Am Tübinger Klinikum sind sowohl die Disziplinen als auch das Fachwissen versammelt. Nach dem Zentrum für Gastrointestinale Onkologie wurde deshalb im Frühjahr 2001 am Interdisziplinären Tumorzentrum des Universitätsklinikums als zweites Disease Specific Center das „Zentrum für Weichteilsarkome“ (ZWS) gegründet. Chirurgen, Onkologen, Orthopäden, Radiologen, Radioonkologen, Nuklearmediziner und Pathologen kümmern sich in diesem einzigen ZWS in Baden-Württemberg gemeinsam um die Patienten. In der interdisziplinären Sarkom-Tumorkonferenz aller beteiligten Fachrichtungen wird die Behandlung jedes einzelnen Patienten diskutiert und festgelegt. Wichtigstes Ziel ist, so der Radioonkologe Prof. Wilfried Budach, einer der drei Sprecher des ZWS, zu erreichen, dass Patienten mit dem Verdacht eines Weichteilsarkoms gleich nach Tübingen kommen. 50 Prozent der Patienten sind, wenn sie ans ZWS kommen, bereits voroperiert, sagt Budach. Viele Ärzte operieren und denken gar nicht daran, dass es sich um eine sehr bösartige Geschichte handeln könnte. So war einem jungen Mann eine Geschwulst am Unterschenkel als harmlose Fettgeschwulst (Lipom) wegoperiert worden. Sie war aber, wie man später in der Orthopädischen Klinik feststellte, ein Sarkom des Fettgewebes gewesen. Budach: „Viele Tumoren werden so eingeschätzt und rausgeschnitten.“ Doch bei Patienten, die schon in nicht spezialisierten Zentren vordiagnostiziert und vorbehandelt worden sind, ist die Wahrscheinlichkeit, eine Extremität zu verlieren oder zu sterben, sehr viel größer. „Schon ein falscher Biopsiezugangsweg kann die Chance einer funktionserhaltenden Therapie zerstören – für den Patienten bedeutet das Amputation.“ Bis vor 25 Jahren waren Amputationen fast die Regel (50 bis 80 Prozent). Dank der modernen interdisziplinären Zusammenarbeit ist dieser Anteil heute beim Knochensarkom auf zehn bis 20 Prozent, beim Weichteilsarkom auf unter zehn Prozent geschrumpft. Erreicht wurde das, so der Radioonkologe, unter anderem mit modernen Biopsie- und Entnahmetechniken und -untersuchungen, Budach: „Der beste Chirurg ist verlassen, wenn er einen schlechten Pathologen hat!“ Darüber hinaus wurde die Prognose „maximal“ verbessert durch die Kombination verschiedener Diagnose- und Therapieverfahren vor allem auch mit den Möglichkeiten der diagnostischen Radiologie und der Nuklearmedizin, Radioonkologie, Orthopädie, Chirurgie und der internistischen Onkologie. Die Strahlentherapie wird in 70 bis 80 Prozent der Fälle unterstützend eingesetzt, um möglicherweise im Operationsbereich noch verbliebene mikroskopisch kleine Tumorzellen abzutöten. In kritischen Regionen wird dazu seit drei bis vier Jahren in Tübingen und weiteren fünf Kliniken deutschlandweit die Kathetertechnik genutzt. Dies geschieht vor allem dort, wo das Risiko von Restzellen besonders hoch ist: zum einen, weil nur wenig Sicherheitsabstand vom gesunden Gewebe möglich war oder der Tumor nicht ganz entfernt werden konnte, zum anderen, weil sonst andere Strukturen, etwa Nerven oder Sehnen, geschädigt worden wären und es deshalb auf eine punktgenaue Bestrahlung ankommt. Nach der Entfernung des Sarkoms werden kleine Kunststoffkatheter eingelegt, über die (stationär) zehn Tage lang jeden Tag zweimal fünf Minuten mit einer radioaktiven Strahlenquelle eine vorher exakt berechnete Strahlendosis verabreicht wird. Der Vorteil: „Wir können noch gezielter und deshalb lokal auch mit einer höheren Strahlendosis als bei Bestrahlung von außen arbeiten.“ Bei den Weichteilsarkomen im Kindesalter und den Knochensarkomen des Erwachsenen spielt die Chemotherapie die entscheidende Rolle, so Privatdozent Dr. Jörg Hartmann, Koordinator des ZWS aus der Medizinischen Klinik. Hartmann: „Die Entwicklungen in der Chemotherapie sind nach langer Zeit fehlender Fortschritte aber auch bei den übrigen Typen von Erwachsenen-Sarkomen durch Erfolge in der Molekularbiologie sprunghaft beschleunigt worden – in der Zukunft sind Verbesserungen der Prognosen besonders in diesem Therapiebereich zu erwarten.“ Als Beispiel nennt Hartmann den erfolgreichen Einsatz der Substanz ST1 571 bei gastrointestinalen Stromatumoren, die sich zuvor gegen jede Behandlung resistent verhalten hatten. Er berichtet von zwei internationalen Studien mit je rund 900 Patienten, von denen nach 18 Monaten 80 Prozent der Patienten weiterhin unter Therapie stehen. „Früher lag die Lebenserwartung in diesem Stadium bei etwa neun Monaten.“ Die Forschung in diesem Bereich verläuft laut Hartmann sehr intensiv – „inzwischen wurden weitere Sarkomtypen identifiziert, die auf Glivec (ST1 571) ansprechen.“ Onkologie_Sonder umbruch 17.07.2003 12:20 Uhr Seite 16 KLINIK FORUM Sonderausgabe O N K O L O G I E 16 MEDIKAMENTE FÜR JEDEN MASSGESCHNEIDERT ➔ Die Universitäts-Aphotheke liegt im Talbereich des Klinikums. Ihren Chef Dr. Hans-Peter Lipp und seine Mitarbeiter trifft man trotzdem immer wieder oben auf dem Schnarrenberg – nicht, weil ihm dort die Luft besser bekommt, sondern weil ihr Fach- und Sachverstand auch am Krankenbett gefragt ist. Vor allem zwischen Uni-Apotheke und onkologisch tätigen Klinikärzten existiert eine vielfältige fächerübergreifende innovative Zusammenarbeit. „Einen Durchbruch mittels neuer Medikamente mehr Heilung zu erreichen, ist noch sehr schwer“, sagt der Leiter der Uni-Apotheke. „Aber wir können die Rückfallraten verringern und bei manchen Krebserkrankungen auch die Durchschnitts-Überlebenszeit verlängern.“ Erste Medikamente aus der Genomforschung, spezifisch wirkende Antikörper wie Herceptin oder Mabthera, die bei Brust- oder Lymphdrüsenkrebs eingesetzt werden, zeichnen sich laut Lipp durch hohe Tumorwirksamkeit und gute Verträglichkeit aus. Auf dem Gebiet der Molekularbiologie, im Bereich der aktiven Immunisierung und beim Einsatz von Radionukliden, den Lipp für „sehr zukunftsträchtig“ hält, tut sich einiges. Für viele Tumoren gibt es heute standardisierte Therapieregimes, festgelegt in ihrer Dosierung. Allerdings müssen sie immer wieder dem Stand der Wissenschaft und vor allem an die Voraussetzungen des einzelnen Patienten angepasst werden“, erklärt Lipp. „In diesem Zusammenhang gilt es, die Plausibilität der Verschreibung zu kontrollieren, da viele Arzneimittel in der Tumortherapie nur einen engen Spielraum zwischen Wirksamkeit und Nebenwirkungsspektrum aufweisen.“ Es gibt immer wieder Patienten, die nicht verstehen, weshalb sie nicht das selbe Mittel wie der Bettnachbar bekommen, der doch den gleichen Krebs hat und gut mit dem Medikament fährt. Doch der Darmkrebs (als Beispiel) des einen ist nicht gleich dem Darmkrebs des anderen. Es kommt entscheidend auf die individuelle (Krankheits-) Situation an: vor allem auf das Stadium der Erkrankung und die Patientencharakteristika wie Größe, Gewicht, Körperoberfläche. „ Jeder Patient bekommt deshalb seine individuelle, für ihn maßgeschneiderte Dosis“, sagt Lipp. Die Tübinger Uni-Apotheke liefert im Jahr 28000 Einzelzubereitungen ins Klinikum – „ein ziemlicher Stress“, sinniert Lipp, „durch die Ausweitung der Tageskliniken müssen wir da viel auf Abruf arbeiten!“ Neben diesen klassischen pharmazeutischen Serviceleistungen der Universitäts-Pharmazeuten wie der Herstellung von Medikamenten spielt die Beratung der Mediziner und des Pflegepersonals vor Ort, etwa bei komplizierten Therapieentscheidungen eine wichtige Rolle. Bei allen Fragen und Problemstellungen, die eine Analyse der Wirkung von Arzneimitteln im Organismus (Pharmakodynamik) nötig machen oder, andersherum, den Einfluss des Organismus auf ein Medikament (Pharmakokinetik) betreffen, schätzen die Kliniker die Diskussion mit dem Apotheker, seine Beratung und fachliche Hilfestellung vor Ort am Krankenbett. Welche Dosis kann man einen bestimmten Patienten geben bei dem mehrere Organe nur eingeschränkt funktionieren? Eine Substanz beispielsweise, die über die Leber ausgeschieden wird, kann bei einem Patienten mit kranker Leber nicht in der selben Dosis wie bei einem mit gesundem Organ eingesetzt werden. Und wie sieht es mit der Dosierung aus, wenn der Patient sein Medikament nicht mehr schlucken kann, sondern nur noch eine Spritzen- oder Infusionsbehandlung in Frage kommt? Sehr seltene Nebenwirkungen werden darüber hinaus im fächerübergreifenden Team besprochen. „Die behandelnden Ärzte müssen wissen, wieso es bei diesem Kranken zu diesen Nebenwirkungen kam und welche aktuellen Möglichkeiten des Eingreifens, Gegensteuerns es geben könnte“. Dies gilt vor allem auch bei besonderen Fragestellungen therapieinduzierter Toxizitäten, das heißt, wenn eine Therapie ausgeprägte unerwünschte Begleiterscheinungen zeigt. Lipp nennt als Beispiel einen Patienten, bei dem schließlich eine Milchzucker-Unverträglichkeit als Auslöser der Nebenwirkungen herauskam. „Man wechselte auf eine laktosefreie Verabreichungsform des Medikaments und die Nebenwirkungen waren weg.“ Gemeinsam gehen Ärzte und Apotheker auch der Frage nach, inwieweit Arzneimittel auch in bisher nicht zugelassenen Bereichen einsetzbar sind. „Gibt es“, nennt Lipp ein Beispiel, „bereits ausreichend klinische Erfahrungsberichte, die einen entsprechenden Arzneimitteleinsatz erlauben, um beispielsweise die Nebenwirkung eines Krebsmittels deutlich zu vermindern oder noch einen deutlichen Therapieerfolg versprechen?“ Fragen dazu beantwortet Dr. Hans-Peter Lipp, Tel. 0 70 71/29-8 22 78, Fax 29 50 50, E-Mail: [email protected] Nusser & Schaal