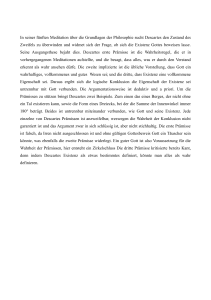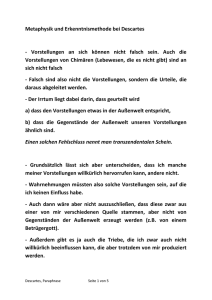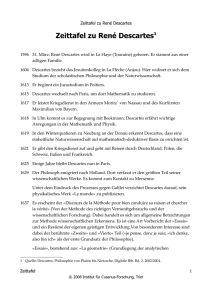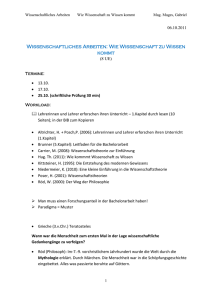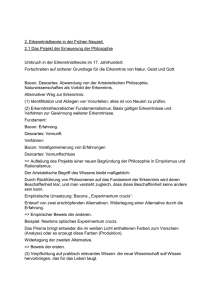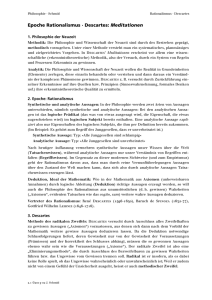Descartes: Meditationen und Prinzipien der Phil
Werbung

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Institut für Philosophie ÜfA: Descartes: Meditationen und Prinzipien der Philosophie Holger Lyre Wintersemester 2005/2006 Essay zur 3. Meditation – Marcel Pawlowski 01.12.2005 Descartes’ Ziel in der dritten Meditation ist es, einen Beweis für die Existenz Gottes zu finden. Er baut dabei auf dem Cogito-Argument auf, d.h. er weiß, dass er ein Ding ist, das denkt. Er bemerkt ferner, dass er ein Mittel hat zu entscheiden, wann etwas wahr ist: Er setzt fest: „[…] dass alles das wahr ist, was ich ganz klar und deutlich einsehe.“ 1 Zu diesen Dingen gehört auch die Logik, die er zuvor als zweifelhaft verworfen hatte, nun aber mit der Begründung, sie sei nur sehr wenig zweifelhaft als wahr annimmt, um im folgenden Argumentieren zu können. Dabei folgt bereits aus der Logik selbst, dass ein auf zweifelhaften Prämissen aufgebauter Beweis inkorrekt ist. Selbstverständlich auch dann, wenn die Prämissen schließlich aus dem Bewiesenen folgen. Eigentlich ließe sich Descartes’ Gottesbeweis an dieser Stelle bereits verwerfen. In den vorangehenden Meditationen zweifelt Descartes jedoch Wahrheitswerte an, zieht Schlüsse und weiß schließlich etwas, das zweifellos wahr sein soll. Daher benutzte Descartes meiner Meinung nach bereits die Gültigkeit der Logik implizit, auch wenn er dies bestreitet. Ich nehme sie daher einmal als gegeben hin. Descartes argumentiert nun wie folgt: zunächst weist er Vorstellungen eine objektive Realität und Dingen eine formale Realität zu. Ferner geht er davon aus, dass jede Vorstellung eine Ursache haben muss. Dann aber fordert er, dass die Ursache einer Vorstellung mindestens soviel formale Realität besitzen muss, wie die Vorstellung an objektiver Realität besitzt, bzw. dass es zumindest eine erste Vorstellung gibt, deren Ursache dann formale Realität haben muss. Diese erste Ursache könnte natürlich Descartes selbst sein, er hat schließlich schon festgestellt, dass er existiert. Um nun zu zeigen, dass dort außerhalb von ihm noch etwas anderes existiert, muss er zeigen, dass er eine Vorstellung hat, die nicht aus seiner eigenen formalen Realität abgeleitet werden kann, d.h. eine Vorstellung mit größerer objektiver Realität als sein Ich formale Realität hat. Er behauptet nun, diese Vorstellung sei die Gottes als „[…] unendliche, unabhängige, allweise, allmächtige Substanz […]“ 2 und sie besäße die größtmögliche objektive Realität. Er selbst habe diese vollkommenen Eigenschaften nicht, wodurch seine formale Realität geringer sein muss. Er schlussfolgert nun, dass er nicht die Ursache der Vorstellung Gottes sein kann, es also außerhalb von ihm eine Ursache mit ausreichender formaler Realität geben muss. Diese Ursache kann nur Gott sein, da nur diese alle vollkommenen Eigenschaften hat. Descartes’ Argumentation mag zwar in sich schlüssig sein, doch der Aussagewert seines Beweises steht und fällt mit der Gültigkeit der Prämissen. Diese bieten gleich eine ganze Reihe von Angriffspunkten. Ich will mich hier auf einen beschränken und die anderen Prämissen einmal stillschweigend hinnehmen: 1 2 René Descartes, Meditationes de Prima Philosophia, Reclam, 3. Meditation, 2. Abschnitt ebd., 22. Abschnitt Warum sollte die Vorstellung Gottes nicht aus mir selbst hervorgegangen sein? Descartes meint, meine Endlichkeit erlaube mir nicht, die Idee von etwas Unendlichem zu bilden. Aber vielleicht erfasse ich die Unendlichkeit ja gar nicht. Ich kann mich vielleicht der Vorstellung des Unendlichen annähern, indem ich mir etwas sehr großes vorstelle und wann immer ich mich einer Grenze nähere etwas hinzunehme. Aber das Unendliche erreicht mein Geist nicht. Kann ich überhaupt die Vorstellung von etwas Unendlichem haben? Descartes selbst sagt: „Es liegt nämlich im Begriff des Unendlichen, daß es von mir, der ich endlich bin, nicht verstanden werden kann.“ 3 Wie lässt sich eine solche Vorstellung dann aber klar und deutlich auffassen? Wie kann die Vorstellung von Gott die „[…] wahrste, klarste und deutlichste aller meiner Vorstellungen […]“ 4 sein, wenn ich, der ich endlich bin, sein Wesen nicht fassen kann. Descartes sagt dazu: „Jene Vorstellung ist auch vollkommen klar und deutlich, denn in ihr ist alles enthalten, was ich klar und deutlich wahrnehme, […]“ 5 . Ich kann allerdings immer nur einen endlichen Teil von ihm betrachten, der per Definition im Vergleich zur Unendlichkeit verschwindend gering sein muss. Doch eine Vorstellung, die nicht einmal den Bruchteil einer Sache umfasst kann in meinen Augen nicht deutlich sein, selbst wenn ein Teil von ihr klar und deutlich ist. Im Anschluss, fast so, als wüsste Descartes von den Schwächen des Beweises, führt er noch einen zweiten Beweis Gottes. Er versucht die Annahme, er selbst existiere ohne dass es ein vollkommenes Seiendes (Gott) gibt, zum Widerspruch zu führen. Der Beweis baut darauf auf, dass Descartes irgendwie entstanden sein muss. Wenn Gott nicht der Schöpfer wäre, so kämen als solche in Frage: Descartes selbst, seine Eltern, oder eine andere, weniger vollkommene Ursache als Gott. Descartes will nun die Annahmen zum Widerspruch führen und beginnt damit zu zeigen, dass er sich nicht selbst geschaffen haben kann. In diesem Fall hätte er sich nämlich mit allen ihm bekannten Vorzügen ausgestattet. Da er eine Vorstellung von der Vollkommenheit Gottes hat, hätte er sich diese verliehen und wäre somit selbst Gott. Bei einem derart narzisstischen Menschen wie Descartes mag dies zutreffen, vorstellbar ist aber auch, das er sich nicht alle Eigenschaften verliehen hat, das er sich vielleicht sogar die Erinnerung an das Vermögen oder Unvermögen, sich diese Vollkommenheit zu verleihen, gelöscht hat. Ein zweiter entscheidender Aspekt seiner Argumentation ist es, festzuhalten, dass er geschaffen worden sein muss. Dazu stellt er zunächst fest: „Die ganze Lebenszeit kann nämlich in unzählige Teile zerlegt werden, und jeder dieser Teile ist gänzlich unabhängig von allen anderen.“ 6 Wie das? Hat nicht jeder dieser Teile einen Anschlusspunkt an einen anderen? Wenn dem nicht so wäre und wir in jedem Moment aufs neue aus Nichts geschaffen werden und uns unsere vermeintlich bisherigen Erfahrungen eingepflanzt werden, so verlieren zeitliche Abfolgen ihren Sinn. Die Teile unserer Lebenszeit können ungeordnet abfolgen und uns würde dies nicht auffallen, womöglich existieren wir nur in diesem einen Augenblick. Um mit Descartes zu sprechen: wir würden getäuscht in unserer Wahrnehmung von Zeit. Wir müssten anzweifeln, dass so etwas wie Zeit existiert und schließlich zu dem Schluss kommen, dass wir gar nicht immer wieder neu geschöpft werden müssten, da wir nur wüssten, dass es uns jetzt gerade gibt, dass es vielleicht überhaupt nur diesen einen Augenblick gibt. 3 ebd., 25. Abschnitt ebd., 25. Abschnitt 5 ebd., 25. Abschnitt 6 ebd., 31. Abschnitt 4 Descartes kann auch nicht immer aus sich heraus existiert haben, behauptet er anschließend, da „[…] dieselbe Kraft und Tätigkeit nötig ist, um ein Ding in den einzelnen Momenten seiner Dauer zu erhalten, als zu seiner Neuschöpfung erforderlich wäre […]“ 7 Eine weitere Begründung liefert er nicht, er verweist nur darauf, dass dies „[…] zu den durch das natürliche Licht offenkundigen Wahrheiten […]“ 8 gehöre. Dies soll wohl möglichen Einwänden entgegenkommen nach dem Motto: denkt man nur genügend klar darüber nach, so kommt man zu der selben Schlussfolgerung. Vielleicht war es aber auch eine zu seiner Zeit allgemein anerkannte Meinung, was dann aber im Widerspruch zu Descartes’ radikalem Zweifeln und seiner Abneigung gegenüber scholastischen Meinungen stünde. Aus heutiger Sicht jedenfalls steht diese Behauptung wie aus der Luft gegriffen da und widerspricht unseren Vorstellungen. Womöglich haben die zu Descartes’ Zeiten noch unbekannten Erhaltungssätze der Physik zu dieser heutigen Auffassung geführt. Es ist mir jedenfalls kein Grund ersichtlich, weshalb die Dinge nicht auch bleiben sollten, wie sie sind, sofern nichts auf sie einwirkt um sie zu ändern. Wäre Descartes nun aus einer anderen Ursache als sich selbst oder Gott hervor gegangen, so müsste diese Ursache mindestens genauso viel Realität enthalten wie er, also ein vernunftbegabtes Wesen sein. Dieses müsste wieder aus etwas hervorgegangen sein, das eine derartige Ursache darstellt. Descartes behauptet nun, es müsse eine letzte Ursache geben, die dann aus nichts mehr hervorgegangen sein kann. Dies könne nur Gott als vollkommenes Wesen sein. Dieser Schluss ist spätestens seit Entwicklung der Evolutionstheorie nicht mehr zwingend. Insbesondere besteht zumindest die Möglichkeit, dass sich vernunftbegabte Wesen aus nichtvernunftbegabten Wesen entwickeln konnten. Descartes hätte hier sicher vehement protestiert, da in seinen Augen nicht-vernunftbegabte Wesen bloße Automaten darstellen, die eine geringere formale Realität enthalten als vernunftbegabte Wesen. Insbesondere zufällige Entwicklungen schließt er mit seiner Auslegung von Ursache und Wirkung offensichtlich aus. Doch auch wenn man die natürliche Evolution nicht als gesicherte Erkenntnis hinnimmt, zeigt es eine Alternative zu Descartes’ Schluss auf und macht somit seinen Beweis auch an dieser Stelle zunichte. Abschließend ist zu bemerken, dass Descartes’ Beweise zwar logisch korrekt sein mögen, wie man es von einem Mathematiker seines Rangs erwartet, aber dennoch keine Aussagekraft haben. Grund sind die mangelhaften Prämissen. Manche Unzulänglichkeiten mögen sich aus dem historischen Kontext erklären, doch häufig scheint mir der radikale Zweifel zuviel vom Fundament abgetragen zu haben, um nun darauf noch sichere Argumentationsschritte zu vollziehen. 7 8 ebd., 31. Abschnitt ebd., 31. Abschnitt