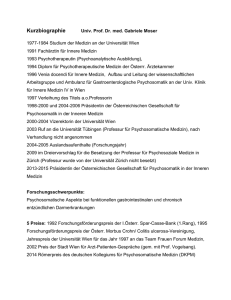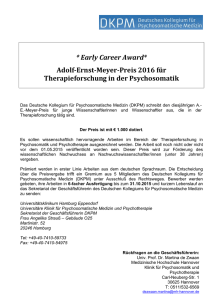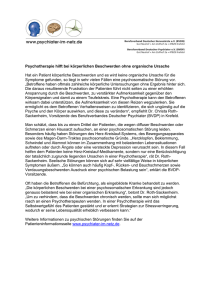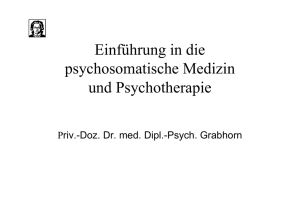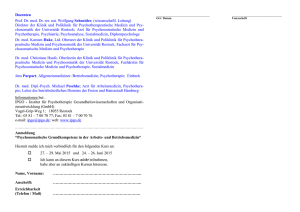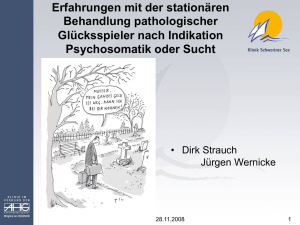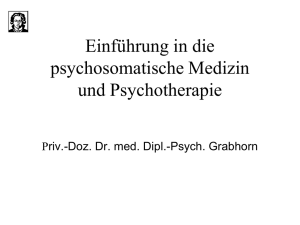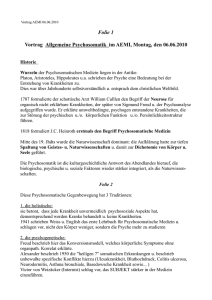Titelgeschichte - Medizinische Hochschule Hannover
Werbung

Psychosomatik: Balanceakt zwischen Körper und Seele MHHInfo April/Mai 2007 Titel Psychosomatik »Herz an Kopf: bitte kommen« So reagieren Körper und Seele aufeinander – ein Ausflug in die Psychosomatik Psychosoziale, das heißt »seelische« Belastungen aber auch bereichernde Lebensumstände, sind innerhalb der Medizin lange Zeit nicht als wichtige Faktoren erkannt worden, die auch Krankheiten und ihre Verläufe beeinflussen können. Die kulturell gewachsene, künstliche Trennung zwischen »Körper« und »Seele« hat lange Zeit den Blick für eine solche integrative Sichtweise in der Medizin verstellt. In diesem Zusammenhang hat auch die Öffentlichkeit zu wenig zur Kenntnis genommen, dass gerade tief greifende Störungen oder Abbrüche zwischenmenschlicher Beziehungen häufig mit dem Auftreten körperlicher Erkrankungen einhergehen. Nur eine eher kleine Gruppe von psychosomatisch interessierten Ärzten, Psychologen und Psychotherapeuten hat solche Phänomene am Beispiel unter anderem von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen und der chronischen Schmerzerkrankung früh beschrieben. Tatsächlich sind gerade massive Trennungsbefürchtungen oder -erlebnisse nicht selten im Umfeld sich verschlechternder chronischer Körperbeschwerden zu finden. Andererseits können nahe und haltgebende Beziehungen einem kranken Menschen oft erstaunliche Energie und Durchhaltevermögen vermitteln.Aber wie kann dieser »geheimnisvolle Sprung vom Seelischen zum Körperlichen« wie Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, es ausdrückte, geschehen? Positive wie negative zwischenmenschliche Beziehungen bewirken Veränderungen in verschiedenen netzwerkartig aufgebauten Hirnstrukturen, beispielsweise innerhalb des so genannten limbischen Systems. Dadurch werden weit reichende andere biologische Reaktionen im Hypothalamus und im Hirnstamm angestoßen, beispielsweise die Ausschüttung von Stresshormonen. Diese Reaktion kann wiederum zu einer Kaskade weiterlaufender biologischer Prozesse führen. Wir Menschen spüren dies dann als erlebbares Gefühl, wobei der gesamte menschliche Körper als »Resonanzboden« unserer Gefühle immer an deren Entstehung und Wahrnehmung beteiligt ist, Gefühle immer auch »körperlich« sind: Sie bestehen im Idealfall immer aus unmittelbaren Körperreaktionen und einer damit einhergehenden, bewussten Gefühlsempfindung, beispielsweise: »Mein Herz fängt an zu klopfen – ich habe Angst.« Menschen, die Schwierigkeiten mit der bewussten Wahrnehmung von Gefühlen haben, empfinden negative Gefühle vor allem körperlich, beispielsweise als Magenbeschwerden, Muskelverspannungen oder wiederkehrende Schmerzen. Daraus können sich auf Dauer auch chronische körperliche Störungen entwickeln. Hier eignen sich individuell ausgewählte psycho- und körpertherapeutische Verfahren, um diese zunächst rein »körperlich gebundenen« Emotionen wie Trauer, Enttäuschung oder Wut bewusst spürbar werden zu lassen. Das Bewusstwerden eines negativen Gefühls und eines dahinter stehenden Konfliktes kann dann zu einer Verminderung der vegetativen Anspannung und damit einhergehender chronischer körperlicher Symptome beitragen. Alle Säugetiere reagieren mit Angst, beziehungsweise entsprechenden körperlichen Reaktionen, wenn sich eine wichtige Bezugsperson, beispielsweise die Mutter von ihrem Kind, entfernt. Die Entwicklung eines solchen beziehungsregulierenden Netzwerkes ist entwicklungsgeschichtlich gesehen sinnvoll, denn funktionierende Beziehungen und Leben in der Gruppe sind wichtige Überlebensvorteile. Zur Beziehungsfähigkeit gehört es, die eigenen, aber auch die Gefühle des Gegenübers zu spüren und darauf adäquat reagieren zu können. Das komplexe Zusammenspiel verschiedener Hirnregionen und neurochemischer Netzwerke ist störanfällig und kann bei frühkindlichen belastenden Lebensereignissen – beispielsweise bei zu wenig Zuwendung der Bezugspersonen – eine langwirksame Beeinträchtigung von Emotionalität, Beziehungserleben, aber auch stressverarbeitende Systeme mitbedingen. Gefühle mit ihren sowohl mehr »körperlich« und als auch mehr »seelisch« spürbaren Anteilen sind wahrscheinlich eines der grundlegenden, lange Zeit verkannten Steuerungssysteme unserer Organismus. In Zukunft wird es in der psychosomatischen Präventionsarbeit darum gehen, negative Einflüsse zu vermindern und positive Ressourcen zu nutzen. Harald Gündel, Direktor der MHH Abteilung Psychosomatik und Psychotherapie 13 Titel Psychosomatik MHHInfo April/Mai 2007 »Wenn Gefühle und Gedanken krank machen, muss man sein Leben verändern« Nachgefragt bei Professor Dr. Harald Gündel, Leiter der MHH-Abteilung Psychosomatik und Psychotherapie Das Fachgebiet Psychosomatik berücksichtigt die Bedeutung seelischer Vorgänge bei der Entstehung und beim Verlauf körperlicher Krankheiten. Was passiert mit dem Körper, wenn die Seele »streikt«? Zunächst sind mit dem Begriff der Seele im umgangssprachlichen und nicht-religiösen Sinn unsere Gefühle und Gedanken gemeint. Sie haben natürlich ebenso wie alle anderen körperlichen Funktionen eine organische Grundlage und können erheblichen Einfluss auf den gesamten menschlichen Organismus haben: Teile des Großhirns und das so genannte limbische System, in der Mitte des Gehirns gelegen, sind wesentlich an der Entstehung und Verarbeitung von Gefühlen beteiligt. Dauerhaft negative und belastende Gefühle, beispielsweise ausgelöst durch chronische seelische Konfliktsituationen, können das Ausbrechen oder das Verschlimmern körperlicher Erkrankungen fördern. Aber auch umgekehrt gibt es diese Wechselwirkung: Etwa, wenn ein Mensch an einem Tumorleiden erkrankt und als Folge darauf depressiv wird. Insofern muss man die Seele und den Körper immer als eine natürliche und untrennbare Einheit sehen. Gibt es typische psychosomatische Krankheiten? Typisch sind in diesem Sinne – neben den eher primär psychischen Erkrankungen in unserem Fachgebiet wie posttraumatische Belastungsstörung, Angsterkrankungen und manche Formen der Depression – häufig die chronischen körperlichen Störungen, für die es keine ausreichend fassbaren organischen Ursachen gibt, wie beispielsweise chronische Rücken- oder Ganzkörperschmerzen, unklare Brustschmerzen, Tinnitus und wiederholte Hörstürze, chronische Magen-Darm-Beschwerden, Essstörungen und auch Angsterkrankungen, die sich vornehmlich körperlich äußern, beispielsweise mit chronischem diffusen Schwindel oder wiederholten unklaren Durchfällen in Stresssituationen. Gibt es typische Merkmale für Patienten mit psychosomatischen Krankheiten? Menschen mit chronischen seelischen Konflikten – ob mehr mit 14 sich selbst, Beziehungsstress oder Spannungen und Unzufriedenheit am Arbeitsplatz – haben ein höheres Risiko. Auch Personen, die traumatische seelische Erlebnisse hatten, sind oft empfänglicher für bestimmte psychosomatische Erkrankungen. Hinzu kommen Persönlichkeitsmerkmale, die sich belastend auswirken: Beispielsweise haben Menschen mit Hang zu überhohem Einsatz und gleichzeitigem Perfektionismus im Beruf ein zwei- bis dreifach höheres Herzinfarkt-Risiko. Inwiefern grenzt sich die Psychosomatik von den »Nachbarabteilungen« Klinische Psychiatrie und Sozialpsychiatrie ab? Im Fachgebiet der Psychosomatik und Psychotherapie haben wir es besonderes häufig mit Menschen zu tun, die gleichzeitig an körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen leiden, zum Teil auch mit Patienten mit chronischen körperlichen Erkrankungen, die sich auch in einer enormen psychosozialen Belastungssituation befinden, oder als Reaktion auf eine schwere körperliche Erkrankung seelische Probleme entwickeln. Bei anderen, primär psychischen Beschwerden wie Angststörungen oder bei Depressionen klären wir dagegen oft im Einzelfall mit den Kollegen aus der Psychiatrie und Psychotherapie ab, welches Konzept für diesen speziellen Patienten besser passt. Wie reagieren die Patienten, wenn sie zum Beispiel mit einem Herzleiden bei Ihnen landen? Natürlich besteht grundsätzlich die Gefahr, dass sich Patienten, die mit einer rein körperlichen Behandlungserwartung in die MHH kommen und dann in der Psychosomatik vorgestellt werden, stigmatisiert und abgeschoben fühlen. Dies passiert aber tendenziell immer seltener. Außerdem können die Kollegen aus den somatischen Fächern dagegen auch sehr wirksam vorbeugen: Indem sie die psychosomatische Untersuchung bei entsprechenden Risikopatienten bereits zu Beginn der interdisziplinären ambulanten oder stationären Diagnostik automatisch mit einbeziehen. Dann können die betroffenen Patienten auch Titel Psychosomatik Im Gespräch: Professor Dr. Harald Gündel viel eher die eingangs beschriebenen und völlig natürlichen Zusammenhänge zwischen Körper und Seele akzeptieren und eine psychotherapeutische Behandlung beginnen. Akzeptieren die Kollegen aus den somatischen Abteilungen ihr Fach? Das Fach Psychosomatik und Psychotherapie ist ein wichtiger und sicher noch ausbaufähiger Baustein im Kanon der medizinischen Fächer, ähnlich anderen Querschnittsfächern, die Berührungspunkte mit vielen anderen somatischen Fächern haben. An der MHH ist meine bisherige Erfahrung ausgesprochen positiv: Es gibt erfreulicherweise viele offene Türen, und der Bedarf an interdisziplinärer Zusammenarbeit scheint erheblich zu sein. Wie wichtig ist für Ihr Fachgebiet ein Patient, der Einsicht zeigt? Da wir weniger mit Medikamenten und mehr mit psychotherapeutischen Behandlungsmethoden arbeiten, ist die eigene Motivation unserer Patienten besonders wichtig. Doch die ist in der Regel erst vorhanden, wenn die Behandlungseinsicht da ist. Ohne sie ist eine Therapie nicht sinnvoll. Natürlich ist es gerade bei vielen Patienten mit vor allem körperlichen Störungen und einer zunächst körperlichen Behandlungserwartung notwendig, eine entsprechende Behandlungseinsicht überhaupt erst zu erreichen: Dies geschieht bei uns im Rahmen eines aktuellen, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft unterstützten Forschungsprojektes.Wir bieten den betroffenen Patienten in zwölf Sitzungen eine Art maßgeschneiderte »Probe-Psychotherapie« (Piso-Studie, siehe Seite 19)* an und vermitteln ihnen den Zusammenhang zwischen körperlichen Beschwerden und psychischen Belastungen. Um psychotherapeutisch weiterzumachen müssen die Patienten anschließend aber selbst eine Behandlung wünschen. Ein solcher Schritt ist für viele aber nicht leicht: Einige Patienten wehren sich sogar heftig gegen die Suche nach auslösenden psychischen Ursachen für ihre Krankheit, oft, weil bis heute psychische Störungen nicht selten als schamhaft und stigmatisierend erlebt werden. Doch wenn es dem Patienten gelingt, zusammen mit dem Therapeuten diese Hürde zu überwinden, können krank machende Verhaltensmuster erkannt und bearbeitet, oft auch verändert werden. Wie helfen Sie Ihren Patienten? Eine psychoanalytische Weisheit lautet in diesem Zusammenhang: Nach und nach dorthin schauen, wo es seelisch schwierig ist, wo auf Dauer belastende und krankmachende seelische Konflikte bestehen. Ist ein Problem oder Konflikt bewusst und offensichtlich, der dazugehörige seelische Schmerz nicht mehr verdrängt, sondern offen fühlbar, ist es für den Betreffenden selbst zum Glück oft viel schwerer, einfach wider besseres Wissen so weiterzumachen wie bisher. Dann stellen viele Patienten nach und nach ihr Leben an den entsprechenden Stellen um. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen – es kann mehrere Jahre dauern. Die in unserer Abteilung eingesetzten Therapieformen sind überwiegend psychodynamische und verhaltenstherapeutische Verfahren sowie weitere Körper- und Kreativtherapien. Welche Zukunft hat das Fach Psychosomatik und Psychotherapie? Es hat im Licht der hochaktuellen Forschungsergebnisse zur großen Bedeutung von psychosozialen Lebensumständen für Gesundheit und Lebenserwartung mehr als gute Chancen, weiterhin zu wachsen und innerhalb der Medizin einen zunehmend wichtigen Beitrag zu leisten. Im Blick speziell auf die MHH als einem Klinikum der Supra-Maximal-Versorgung stehen Lebensqualität, aber auch die medizinische Komplikationsrate bei vielen chronischen körperlichen Erkrankungen in direktem Zusammenhang mit dem seelischen Befinden. An dieser Stelle interdisziplinär mitzuarbeiten sehe ich als eine wichtige Aufgabe unserer Abteilung an. Das Gespräch führte Kristina Weidelhofer. * Anmerkung der Redaktion 15 Titel Psychosomatik MHHInfo April/Mai 2007 Psychsomatische Krankheiten und Begriffe Psychoonkologie Schlafstörungen: Sie können Folge eines Traumas sein. Posttraumatische Belastungsstörung Schwere Verkehrsunfälle, Verbrechen oder Unglücksfälle sind Geschehnisse mit potentiell lebensbedrohlichem Charakter. Dabei überschwemmen Affekte, Sinneseindrücke und Gedanken den Betroffenen. Seine normalen Stressverarbeitungsmechanismen funktionieren dann nicht mehr – es läuft eine Art biologische Notfallreaktion ab. Bleiben können tiefe Gefühle von Ohnmacht, Angst und Erschrecken. Fast jeder Mensch erlebt dies in seinem Leben. Bei den meisten verschwinden die negativen Gefühle weitgehend von alleine – nach drei bis sechs Monaten. Leider klappt das nicht immer. Im Mittel bleibt etwa bei fünf bis 15 Prozent der Betroffenen eine posttraumatische Belastungsstörung zurück – bei Opfern eines schweren Verbrechens können es bis zu 50 Prozent sein. Sie leiden dann beispielsweise an Alpträumen oder an immer wieder zurückkehrenden Bildern des Traumas, innerer Unruhe und Schlafstörungen. Die indizierte Behandlung ist dann eine traumazentrierte Psychotherapie, mit der sich in der Regel recht gute Ergebnisse erzielen lassen. Leider werden besonders Kinder nicht oder unzureichend therapiert. So kann es – speziell wenn sie mehrfach traumatisiert werden – zu einer besonders schwerwiegenden Störung kommen. Das hat eine entsprechend schwierige und langwierige Behandlung zur Folge. Dennoch lohnt sich eine traumazentrierte Psychotherapie immer, da sie das Leiden reduzieren kann. Wolfgang Lempa 16 Die Diagnose »Krebs« ist bei Patientinnen und Patienten sowie ihren Angehörigen mit intensiven Belastungen verbunden: Gedanken drängen sich auf – beispielsweise an Schmerz und Leid, Verlust körperlicher Integrität, Sterben und Tod. Bei etwa 40 bis 50 Prozent aller Krebspatienten entwickeln sich daraus psychische Störungen – meist sind es Angststörungen oder Depressionen. Ziel der Psychoonkologie ist es, die psychosozialen Aspekte im Verlauf einer Krebserkrankung und -behandlung wissenschaftlich zu untersuchen, um besonders Frauen, die an Krebs leiden, besser versorgen und betreuen zu können. Die Patientinnen brauchen eine psychosoziale Betreuung – insbesondere, wenn sie auf die Diagnose »Krebs« mit übergroßer Angst reagieren oder wenn sie Anzeichen einer Depression zeigen – etwa Schlaf-, Antriebs- oder Konzentrationsstörungen, Verlust des Interesses oder der Freude an Tätigkeiten, starke Ermüdbarkeit, Empfinden von Schuld oder Wertlosigkeit. Die Betreuungssituation ist in Deutschland noch nicht ausreichend. Zum psychoonkologischen Behandlungsangebot gehören: Entspannungsverfahren, kreative Behandlungen wie Musikund Maltherapie, körperorientierte Verfahren und Gesprächskreise. Hinzu kommt eine Psychotherapie. Der Patientin soll geholfen werden, ihre Krankheit zu bewältigen und sich neu zu orientieren. Dazu gehört auch die Verbesserung von Kontakten zur Familie, zu Freunden oder Selbsthilfegruppen. Ziel ist es, Angst und Depression abzubauen und Denkprozesse anzustoßen – etwa zum Sinn des Lebens, Umgang mit Sterben und Tod sowie zur Verantwortung und Selbstverwirklichung. Im MHH-Brustzentrum sind psychoonkologische Aspekte in das Versorgungsangebot integriert: Es gibt kunsttherapeutische Angebote, psychosoziale Beratung und ein bedarfsorientiertes psychotherapeutisches Angebot. Mechthild Neises Wenn die Brust nicht so gesund ist wie diese: Patientinnen mit Brustkrebs können von einer psychosozialen Betreuung profitieren. Titel Psychosomatik Essstörungen: Man sieht sie einem Körper nicht unbedingt an. Somatisierungsstörungen Essstörungen Die Anorexie (Anorexia nervosa, Magersucht) ist durch ein extremes, oftmals lebensgefährliches Untergewicht gekennzeichnet. Dieser ausgezehrte Zustand wird durch Fasten und eventuell durch exzessiven Sport oder Tabletteneinnahme erreicht. Anorektische Patientinnen und Patienten empfinden ihren Körper als schön oder wenigstens als bessere Alternative zu einer normalen Körpergestalt. Die Magersucht sollte zumindest anfänglich stationär behandelt werden. Die Bulimie (Bulimia nervosa, Ess-Brech-Sucht) ist durch häufige Essanfälle und weitgehend eingeschränkte Nahrungsaufnahme außerhalb der Essanfälle gekennzeichnet. Um der Gewichtszunahme entgegenzuwirken, praktizieren die Betroffenen absichtliches Erbrechen nach den Essanfällen. Zum Teil experimentieren Betroffene auch mit Abführtabletten und exzessivem Sport. Die Bulimie kann eher als die Anorexie auch ambulant psychotherapeutisch behandelt werden. Wenn das Essverhalten durch Essanfälle mit Kontrollverlust gekennzeichnet ist, aber kein Versuch der Regulation gegen die Gewichtszunahme – zum Beispiel durch absichtliches Erbrechen – gemacht wird, kann es sich um eine Binge Eating Störung handeln. Diese Erkrankung, die erst vor wenigen Jahren benannt wurde und für die es noch keinen deutschen Begriff gibt, geht meistens mit einer Gewichtszunahme einher. Verhaltenstherapeutische Verfahren haben sich als recht wirksam gegen die Störung erwiesen. Bei der Adipositas (krankhaftes Übergewicht) handelt es sich nicht unbedingt um eine Essstörung, da genetische und in früher Kindheit erworbene Faktoren einen großen Anteil an der Krankheitsentstehung und dem Verlauf haben können. Es gibt aber eine Untergruppe von Patienten, die Essen zur seelischen Stabilisierung benutzt. Bei diesen Patienten ist mehr als bei anderen Adipösen eine psychotherapeutische Begleitung in der Behandlung notwendig. Burkhard Jäger Bis zu 20 Prozent aller Menschen leiden zeitweilig oder auch chronisch an Somatisierungsstörungen. Sie gehören zu den häufigsten Störungsbildern in der allgemein-medizinischen Praxis. Somatisierungsstörungen – auch somatoforme Störungen genannt – sind durch körperliche Symptome gekennzeichnet, für die keine oder keine ausreichenden organischen Befunde als Erklärung erhoben werden können. Neben allgemeinen Beschwerden wie Müdigkeit und Erschöpfung stehen Symptome wie ausgeprägtes Schmerzerleben (zum Beispiel Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen), Magen-DarmBeschwerden (etwa Blähungen, Übelkeit, Reizmagen, Reizdarm) sowie Herz- und Kreislaufprobleme (beispielsweise Herzstolpern, Herzrasen, Herzschmerzen) an erster Stelle. Auslösende Faktoren sind in der Regel akute konflikthafte Belastungssituationen (etwa in Beruf und Familie), die im Wechselspiel mit längerfristigen psychosozialen Schwierigkeiten aber auch genetischen Dispositionen des einzelnen Patienten stehen. Die Diagnose einer somatoformen Störung wird nach Ausschluss einer die Beschwerden ausreichend erklärenden organischen Ursache und nach Erhebung der psychischen Symptome sowie der psychosozialen Anamnese gestellt. Häufig werden die somatoformen Symptome von Depression und Angst begleitet. Wichtig ist eine frühzeitige Diagnosestellung, um den Prozess der Chronifizierung zu verhindern. Entscheidend für einen Behandlungserfolg ist neben der Beschwerdelinderung das Erarbeiten von Verständnis und Handlungskompetenzen beim Patienten für den Umgang mit symptomauslösenden und -unterhaltenden Bedingungen im psychosozialen Alltag. Dazu ist in vielen Fällen eine Psychotherapie der Schlüssel zu einer Heilung. Christiane Waller Rückenschmerzen: Konflikte können sie auslösen. Titel Psychosomatik »Ich darf weiterleben« MHH-Psychologe Professor Künsebeck therapiert Transplantationspatienten (bb) Sie zerriss ihren Organspendeausweis. Trauer, Entsetzen und Wut brachten die MHH-Patientin Brigitte Gravermann dazu, als sich ihre Mutter im Alter von 64 Jahren nach einer Organtransplantation sieben Wochen lang tapfer quälte und dann starb. Das war im Jahr 1989, Brigitte Gravermann war 38 Jahre alt. Nie wollte die Sozialpädagogin in die gleiche Situation kommen, niemals würde sie zustimmen, ein fremdes Organ zu erhalten – obwohl sie schon damals wusste, dass sie, wie ihre Mutter, eine Zystenleber und Zystennieren hat und wahrscheinlich darunter sehr leiden und daran sterben wird. 24 Jahre war Brigitte Gravermann alt, als sie im Jahr 1975 auf Wunsch ihrer Mutter zur genetischen Beratung in die MHH ging, und dort von ihrer Krankheit erfuhr. »Ich bin aus allen Wolken gefallen, da ich mich damals pudelwohl fühlte«, erinnert sie sich. Mit Anfang 40 bekam sie jedoch hohen Blutdruck, die Nierenfunktion ließ nach und Wasser lagerte sich in ihrem Gewebe ein. Ihre Gliedmaßen wurden dünner, ihr Bauch nahm an Umfang zu. Infektionen kamen hinzu, Zysten platzten, Einblutungen und Fieber schwächten sie. MHH-Ärzte schlugen eine Transplantation vor. »Das kam mir wie ein Todesurteil vor«, sagte Brigitte Gravermann. Sie ignorierte alles und leitete weiterhin eine Kindertagesstätte. Als ihre Kräfte deutlich nachließen, suchte sie bei anthroposophischen Ärzten die Bestätigung, dass sie keine Transplantation benötigt. Doch auch die rieten ihr zu dem Schritt. »Da wachte ich auf«, erzählt die Patientin. Das war im Jahr 2004. »Dann ließ ich mich auf die Warteliste schreiben, mit dem Gefühl, das Richtige zu tun«, sagt sie. Sie schrieb Vollmachten, Abschiedsbriefe, eine Patientenverfügung und ihr Testament. Sie heiratete ihren Lebensgefährten und reiste mit ihm nach Neuseeland. Doch da sie immer noch die Erinnerungen an den Tod ihrer Mutter sehr quälten, hatte sie Angst vor der Transplantation. Deswegen suchte sie Professor Dr. Hans-Werner Künsebeck auf, Diplom-Psychologe der MHH-Abteilung Psychosomatik und Psychotherapie. Dort sprach sie ihre Ängste aus und fühlte sich verstanden. Er unterstützte sie dabei, ihre Sorgen und Ängste loszulassen und sich ohne Wenn und Aber für die Transplantation zu entscheiden. »Ich konnte seinem Urteilsvermögen vertrauen, da er gute und schlechte Verläufe von Organtransplantationen kennt. Er wusste wovon er sprach«, sagt sie. »Zudem kennt er Mitarbeiter, Gepflogenheiten und Strukturen der MHH. Er war es auch, der mich ermutigte, überhaupt an einen positi18 Nach der Transplantation: Brigitte Gravermann malte das Gefühl, das Glück, das sie verspürte, kaum noch tragen zu können. ven Ausgang der Operation zu denken – etwa daran, dass mein Bauch wieder schrumpft und dass ich wieder zu Kräften kommen könnte.« Damals waren ihre Gliedmaßen mager, sie konnte kaum noch essen, war schlapp, müde und musste fast an die Dialyse.Aufgrund der stark gewachsenen Leber und Nieren hatte sie einen Bauch, als wäre sie im siebten Monat schwanger. Im Juli 2006 kam der erwartete Anruf, eine Niere und eine Leber waren für sie da, sie wurde in der MHH operiert. »Frau Gravermann, ihre Leber macht ja schon fast normale Werte«, hörte sie, als sie nach der OP aufwachte. »Das gibt’s doch nicht, ich darf weiterleben«, dachte sie damals. Kaum noch schlafen konnte sie – vor Glück und Dankbarkeit. »Diese Zeit war sehr aufwühlend, ich hätte alle Ärzte und Schwestern küssen können«, sagt sie. Bereits nach drei Wochen konnte sie entlassen werden. Sie schloss ihre 2002 begonnene berufliche Weiterbildung zur Soziotherapeutin-Kunst ab und wünscht sich nun, selbst mit Patienten vor und nach einer Transplantation kunsttherapeutisch arbeiten zu können. »Mit meinen neuen Organen habe ich keine Probleme«, sagt sie heute, acht Monate nach der OP. Zur Nachsorge kommt sie in die MHH, sie lässt ihr Blut untersuchen und spricht mit Professor Künsebeck – über Gefühle ihres neuen Lebens, wozu auch Dankbarkeit gehört. Deswegen hat sie auch wieder einen Organspendeausweis. Therapie für Transplantationspatienten Die psychosomatische Medizin nutzt eine Vielzahl von Therapieverfahren, die für Transplantationspatienten hilfreich sein können. Grundlage für den Abbau von Ängsten ist eine ausführliche Information und Beratung, oft ergänzt mit Verhaltenstherapie, die auch Entspannungsverfahren einschließt. Ein weiteres, oft angewandtes Verfahren ist die supportive Psychotherapie. Sie greift ressourcenorientiert die Verarbeitungsmöglichkeiten des Patienten auf, stärkt und erweitert seine Fähigkeiten zur Problem- und Krisenbewältigung. Hans-Werner Künsebeck, Mitarbeiter der Abteilung Psychosomatik und Psychotherapie MHHInfo April/Mai 2007 Titel Psychosomatik Wenn der Körper unbeachtete Gefühle zeigt Piso-Studie: Helfen psychosomatische Therapien, die Lebensqualität chronisch Kranker zu verbessern? (bb) »Ich schlucke immer alles«, sagt Peter Siebert*. Angela Angelovski, Psychologin der MHH-Abteilung Psychosomatik und Psychotherapie, hört ihm genau zu. Seit Jahren quälen ihn Bauchschmerzen, keiner der Ärzte, die er aufsuchte, konnte dies bisher mit einer körperlichen Ursache ausreichend erklären. Sie rieten ihm, an einer Studie teilzunehmen, die sich »Psychosomatische Behandlung bei somatoformen Beschwerden« nennt – kurz: Piso. Wissenschaftler sechs deutscher Universitäten erforschen, ob Patientinnen und Patienten mit jahrelangen chronischen Symptomen, die bereits zahlreiche Arztbesuche und erfolglose Diagnostiken hinter sich haben, eine psychosomatische Therapie nützt. Die Betroffenen nehmen je einmal pro Woche eine Therapiestunde in Anspruch – zwölf Wochen lang. Die Studie wird in Kooperation mit der Schmerzambulanz der MHH-Abteilung Anästhesiologie durchgeführt. Ein großer Teil der Studienteilnehmer kommt aus der Schmerzambulanz, aber auch aus anderen MHH-Abteilungen. Die Untersuchung erstreckt sich vom Frühjahr des Jahres 2006 bis zum Herbst 2007 und wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und vom Ministerium für Bildung und Forschung unterstützt. Er beachtete seine Gefühle nicht genug Zunächst konnte Peter Siebert seine Bauchschmerzen nur diffus beschreiben, später genauer – und so fand er zusammen mit der Psychologin heraus, dass sie etwas mit den Gefühlen Ärger, Aufregung und Angst zu tun hatten. »Dies war ein Wendepunkt für ihn, bis dahin hatte er ausschließlich an körperliche Ursachen gedacht. Dann hat er gemerkt, dass der Körper ihm zeigte, dass er seine Gefühle nicht ausreichend beachtet«, sagte Angela Angelovski. Zusammen mit ihr erarbeitete der Patient Wege, seine Gefühle angemessen zu äußern und zu regulieren – und die Schmerzen blieben fern. Pro Universität machen bei der Studie 40 Patienten mit. 20 von ihnen sind in einer Vergleichsgruppe. Sie nehmen an Gesprächen zur Behandlung ihrer Symptome teil, aber nicht an einer Therapie. Die Therapie besteht aus drei Phasen: Zunächst erhalten die Teilnehmer viele Informationen über somatische, aber auch psychische Hintergründe von Schmerzen und vor allem deren Wechselwirkung. In der zweiten Phase lernen sie, besser mit den Beschwerden umzugehen – zum Beispiel, diese nicht in den Mittelpunkt ihres Lebens zu stellen, aber auch, akute psychische Belastungen mit sich daraufhin verstärkenden Schmerzen überhaupt erst in Verbindung zu bringen. Um zu merken, wann die Beschwerden erträglicher werden – etwa bei einem Spazier- Ziel: Eine verbesserte Lebensqualität gang – führen die Patienten außerdem ein Tagebuch. In der letzten Phase werden die neuen Erfahrungen mehr und mehr in den Alltag übertragen. Vor Beginn, nach dem Ende der Therapiesitzungen sowie ein Jahr darauf erhalten die Teilnehmer Fragebögen. Zudem werden dann auch die Schwankungen des Herzrhythmus gemessen, um die Fähigkeit der Stressbewältigung zu erfassen. »Das autonome Nervensystem ist bei Patienten mit somatoformen Störungen nicht gut reguliert. Das kann anhand der Schwankungen gemessen werden«, erklärt Angela Angelovski. Nur sehr selten bleiben – wie bei Peter Siebert – die Schmerzen schon nach den zwölf Therapiesitzungen aus. Doch schon, wenn die Teilnehmer erkennen, dass ihre körperlichen Beschwerden mit ihrer psychischen Situation zusammenhängen, ist ein Ziel der Studie erreicht. Manche sind dann motiviert, sich auch nach dem Ende der Studie weiter therapieren zu lassen. »Das Ziel kann leider nicht immer sein, dass die Schmerzen vollständig verschwinden. Aber die Lebensqualität, die kann sich in jedem Fall verbessern«, sagt Angela Angelovski.« *Name von der Redaktion geändert Balanceakt: Der Körper zeigt oft ein Ungleichgewicht zwischen Körper und Seele an. 19 Titel Psychosomatik MHHInfo April/Mai 2007 Von der Neurose bis zum Unbewussten Fachbegriffe aus unserem Titelthema (ina) Unter Neurosen wird eine Gruppe von psychischen Störungen verstanden. Es wird angenommen, dass eine Neurose durch einen inneren, unbewussten Konflikt entsteht. Psychische Störungen sind erhebliche Abweichungen vom Erleben oder Verhalten gesunder Menschen im Denken und Fühlen. Die Psychoanalyse ist ein psychotherapeutisches Behandlungsverfahren. Sie zählt zu den aufdeckenden Therapien, die versuchen, dem Patienten ein tieferes Verständnis der Zusammenhänge seines Leidens zu vermitteln. Die vor allem rationale Einsicht in die Verursachungszusammenhänge ist jedoch nicht das wesentliche Ziel einer psychoanalytischen Therapie. Vielmehr wird eine weitergehende Umstrukturierung der Persönlichkeit und insbesondere des Gefühlslebens in denjenigen Bereichen angestrebt, die zur Aufrechterhaltung beispielsweise krankhafter Persönlichkeitseigenschaften beitragen. Unter Psychotherapie versteht man die Behandlung psychischer, emotionaler und psychosomatischer Krankheiten, Leidenszustände oder Verhaltensstörungen mit Hilfe wissenschaftlich fundierter Methoden. Je nach Form der Psychotherapie findet hierbei gegebenenfalls auch eine Auseinandersetzung mit dem Unbewussten statt, um die Ursachen der Erkrankung zu klären, oder es wird der Bereich des bewussten Denkens und Empfindens ergründet und durchleuchtet. Dies geschieht beispiels- weise bei einer Gesprächs- oder Verhaltenstherapie. Alle Psychotherapien beruhen wesentlich auf dem Prinzip, neue Verhaltensweisen zu erproben und diese zu festigen. Psychodynamische Verfahren sind Psychotherapiemethoden, die sich wie die Psychoanalyse mit den bewussten und unbewussten Kräften der Psyche beschäftigen. Dabei geht es darum, wie die verschiedenen psychischen Anteile das eigene Verhalten und Erleben beeinflussen. Häufig wird hierfür auch der Begriff Tiefenpsychologische Verfahren verwendet. Das Unbewusste ist im psychologischen Sprachgebrauch der Bereich der menschlichen Psyche, der dem Bewusstsein nicht direkt zugänglich ist. Die Tiefenpsychologie geht davon aus, dass unbewusste psychische Prozesse die Menschen in ihrem Handeln, Denken und Fühlen entscheidend beeinflussen, und dass die Bewusstmachung unbewusster Inhalte eine wesentliche Voraussetzung für die Therapie von Neurosen ist. Umgangssprachlich wird für das Unbewusste auch der Begriff Unterbewusstsein verwendet. Tiefenpsychologie ist die zusammenfassende Bezeichnung für psychologische und psychotherapeutische Ansätze, die unbewussten psychischen Prozessen einen zentralen Stellenwert für die Erklärung menschlichen Verhaltens und Erlebens einräumen. Alumni-Fotoalbum (ina) Die Lebenssituation des Patienten berücksichtigen – diesem wichtigen Teil der Psychosomatik hat sich Professor Dr. Gerhard SchmidOtt verschrieben. Nach dreizehneinhalb Jahren als Leitender Oberarzt der MHH-Abteilung Psychosomatik und Psychotherapie zog es den Mediziner nun zu neuen Aufgaben nach Löhne bei Bad Oeynhausen: Dort leitet er seit dem 1. April 2007 die Abteilung Psychosomatik der Berolina Klinik, einer Rehabilitationsklinik mit den Schwerpunkten integrierte Psychosomatik und Verhaltensmedizin. Doch Professor Schmid-Ott nimmt nicht endgültig Abschied von der MHH: »Ich werde weiterhin in der Lehre tätig 20 sein und Doktorarbeiten betreuen«, sagt der 51-Jährige. In der MHH war es einer seiner Forschungsschwerpunkte, den psychosomatischen Zusammenhang von chronischen Erkrankungen der Haut wie beispielsweise Schuppenflechte oder Neurodermitis näher zu beleuchten, ein Teilgebiet der Psychoneuroimmunologie. Wichtig war ihm dabei immer die intensive Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen. Als Chefarzt freut er sich darauf, neue Konzepte mitzugestalten. Dabei betrachtet er seine Patienten auf Augenhöhe: »Diese gegenseitige Achtung ist wie ein Lächeln – sie kostet nichts – und jeder freut sich darüber«, sagt er. Vermissen wird er die gute Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus seiner, aber auch aus anderen Abteilungen. MHHInfo April/Mai 2007 Titel Psychosomatik Sie gehören zum Team der Station 60: Irmgard Kiegeland, Dr. Wolfgang Lempa, Sebastian Becker, Martina Schrader, Simone Nowak, Waltraud Engelskirchen und Maren Wilhelm (von links). Wir stellen uns vor Die psychosomatisch-psychotherapeutische Station 60 (ina) Essstörungen, Ängste und Depressionen, seelische Belastungen infolge einer schweren körperlichen Erkrankung, körperliche Beschwerden ohne entsprechenden pathologischen Befund: Solche Patientinnen und Patienten werden auf der psychosomatisch-psychotherapeutischen Station 60 behandelt. Es sind Menschen mit schweren und chronifizierten psychosomatischen und psychischen Störungen, bei denen eine Kombination verschiedener psychotherapeutischer Methoden in einer Intensivbehandlung angezeigt ist. Das Stationsteam besteht aus zwei Ärztinnen sowie sieben therapeutischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Diese qualifizieren sich durch eine Krankenpflegeausbildung und eine psychotherapeutische Weiterbildung. Ein Psychologe, der in mehreren Psychotherapieverfahren ausgebildet ist, leitet die Station. Bis zu 15 erwachsene Personen finden auf Station 60 Platz, die in der MHH-Kinderklinik untergebracht ist. Sieben Zweibettzimmer und ein Einzelzimmer stehen für die Patienten bereit. Sie bleiben hier durchschnittlich neun Wochen – eine lange Zeit, in der sie sich einer konflikt- und lösungsorientierten tiefenpsychologischen Behandlung unterziehen. Ziel ist es, dass die Patienten die Ursachen ihrer Beschwerden, also den Zusammenhang zwischen Konflikten und Stress, Gefühlen und körperlichen Symptomen verstehen und dann mit Hilfe verhaltenstherapeutischer und psychodynamischer Verfahren eine Besserung der Symptomatik erreichen. Einzelpsychotherapie und die nach Bedarf stattfindenden Kontaktgespräche mit den Stationsmitarbeitern sowie die ärztliche Visite und Sprechstunde gehören zum integrativen Konzept. Vorgehalten werden zwei unterschiedliche Behandlungsangebote, eines mit einem Schwerpunkt auf Einzelpsychotherapie und eines auf Gruppenpsychotherapie. Alle Patienten nehmen an einer Reihe von Gruppentherapieangeboten teil. Beispielsweise lernen sie in einer Gruppe anhand von Rollenspielen, ihre sozialen Kompetenzen und ihre eigenen Interessen wie Durchsetzungsfähigkeit, Selbstsicherheit und Abgrenzungsvermögen zu verbessern oder nehmen an einem Entspannungstraining teil. Voraussichtlich im Herbst 2007 wird die Station 60 ins Haus F auf dem MHH-Gelände umziehen. Damit erweitert die Abteilung Psychosomatik und Psychotherapie ihre Behandlungsmöglichkeiten auf 20 stationäre Plätze.Weiterhin ist angedacht, dort ein Angebot von zehn tagesklinischen Plätzen zu schaffen. Ab April 2007 ist es für Menschen mit chronifizierten psychosomatischen und psychischen Störungen möglich, sich in der neuen Institutsambulanz der Abteilung Psychosomatik und Psychotherapie behandeln zu lassen. Vor einer stationären Aufnahme ist grundsätzlich ein ambulantes Vorgespräch in der psychosomatischen Poliklinik erforderlich. Kontakt: Station 60 Telefon: (0511) 532-9416 E-Mail: [email protected] 21