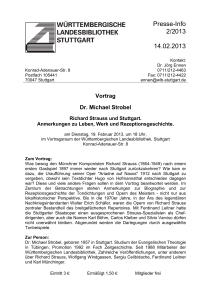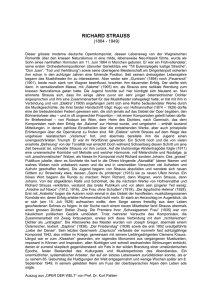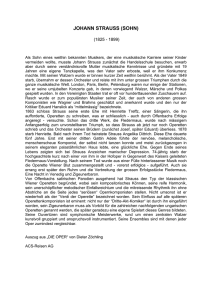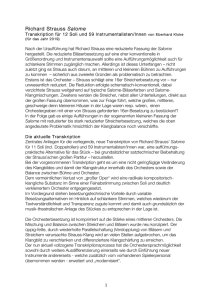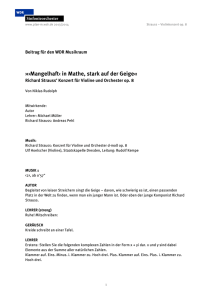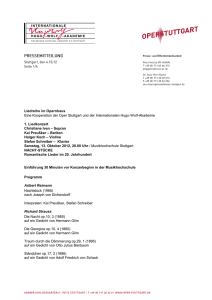Abschiedssprachmusik
Werbung
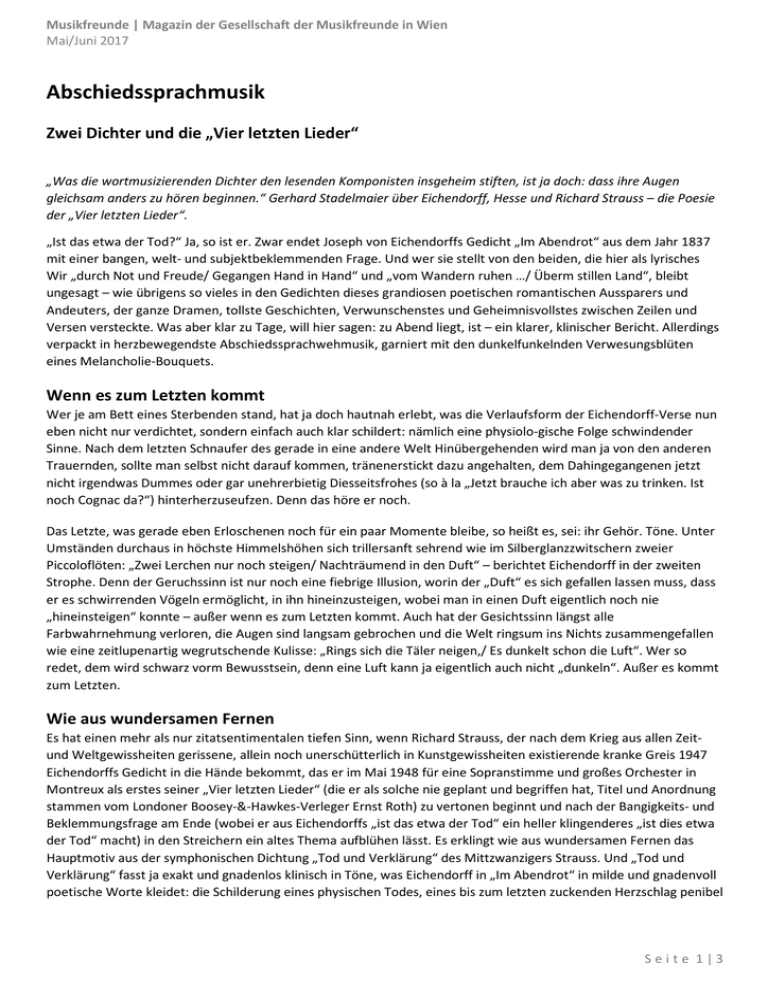
Musikfreunde | Magazin der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien Mai/Juni 2017 Abschiedssprachmusik Zwei Dichter und die „Vier letzten Lieder“ „Was die wortmusizierenden Dichter den lesenden Komponisten insgeheim stiften, ist ja doch: dass ihre Augen gleichsam anders zu hören beginnen.“ Gerhard Stadelmaier über Eichendorff, Hesse und Richard Strauss – die Poesie der „Vier letzten Lieder“. „Ist das etwa der Tod?“ Ja, so ist er. Zwar endet Joseph von Eichendorffs Gedicht „Im Abendrot“ aus dem Jahr 1837 mit einer bangen, welt- und subjektbeklemmenden Frage. Und wer sie stellt von den beiden, die hier als lyrisches Wir „durch Not und Freude/ Gegangen Hand in Hand“ und „vom Wandern ruhen …/ Überm stillen Land“, bleibt ungesagt – wie übrigens so vieles in den Gedichten dieses grandiosen poetischen romantischen Aussparers und Andeuters, der ganze Dramen, tollste Geschichten, Verwunschenstes und Geheimnisvollstes zwischen Zeilen und Versen versteckte. Was aber klar zu Tage, will hier sagen: zu Abend liegt, ist – ein klarer, klinischer Bericht. Allerdings verpackt in herzbewegendste Abschiedssprachwehmusik, garniert mit den dunkelfunkelnden Verwesungsblüten eines Melancholie-Bouquets. Wenn es zum Letzten kommt Wer je am Bett eines Sterbenden stand, hat ja doch hautnah erlebt, was die Verlaufsform der Eichendorff-Verse nun eben nicht nur verdichtet, sondern einfach auch klar schildert: nämlich eine physiolo-gische Folge schwindender Sinne. Nach dem letzten Schnaufer des gerade in eine andere Welt Hinübergehenden wird man ja von den anderen Trauernden, sollte man selbst nicht darauf kommen, tränenerstickt dazu angehalten, dem Dahingegangenen jetzt nicht irgendwas Dummes oder gar unehrerbietig Diesseitsfrohes (so à la „Jetzt brauche ich aber was zu trinken. Ist noch Cognac da?“) hinterherzuseufzen. Denn das höre er noch. Das Letzte, was gerade eben Erloschenen noch für ein paar Momente bleibe, so heißt es, sei: ihr Gehör. Töne. Unter Umständen durchaus in höchste Himmelshöhen sich trillersanft sehrend wie im Silberglanzzwitschern zweier Piccoloflöten: „Zwei Lerchen nur noch steigen/ Nachträumend in den Duft“ – berichtet Eichendorff in der zweiten Strophe. Denn der Geruchssinn ist nur noch eine fiebrige Illusion, worin der „Duft“ es sich gefallen lassen muss, dass er es schwirrenden Vögeln ermöglicht, in ihn hineinzusteigen, wobei man in einen Duft eigentlich noch nie „hineinsteigen“ konnte – außer wenn es zum Letzten kommt. Auch hat der Gesichtssinn längst alle Farbwahrnehmung verloren, die Augen sind langsam gebrochen und die Welt ringsum ins Nichts zusammengefallen wie eine zeitlupenartig wegrutschende Kulisse: „Rings sich die Täler neigen,/ Es dunkelt schon die Luft“. Wer so redet, dem wird schwarz vorm Bewusstsein, denn eine Luft kann ja eigentlich auch nicht „dunkeln“. Außer es kommt zum Letzten. Wie aus wundersamen Fernen Es hat einen mehr als nur zitatsentimentalen tiefen Sinn, wenn Richard Strauss, der nach dem Krieg aus allen Zeitund Weltgewissheiten gerissene, allein noch unerschütterlich in Kunstgewissheiten existierende kranke Greis 1947 Eichendorffs Gedicht in die Hände bekommt, das er im Mai 1948 für eine Sopranstimme und großes Orchester in Montreux als erstes seiner „Vier letzten Lieder“ (die er als solche nie geplant und begriffen hat, Titel und Anordnung stammen vom Londoner Boosey-&-Hawkes-Verleger Ernst Roth) zu vertonen beginnt und nach der Bangigkeits- und Beklemmungsfrage am Ende (wobei er aus Eichendorffs „ist das etwa der Tod“ ein heller klingenderes „ist dies etwa der Tod“ macht) in den Streichern ein altes Thema aufblühen lässt. Es erklingt wie aus wundersamen Fernen das Hauptmotiv aus der symphonischen Dichtung „Tod und Verklärung“ des Mittzwanzigers Strauss. Und „Tod und Verklärung“ fasst ja exakt und gnadenlos klinisch in Töne, was Eichendorff in „Im Abendrot“ in milde und gnadenvoll poetische Worte kleidet: die Schilderung eines physischen Todes, eines bis zum letzten zuckenden Herzschlag penibel Seite 1|3 Musikfreunde | Magazin der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien Mai/Juni 2017 beobachteten Verlöschens, vom Komponisten völlig teilnahms- und kommentarlos in Töne gesetzt. Aber in gewaltig schwingenden Klangwundermassen. Die Gefühle bleiben ganz dem Hörer überlassen, die der Komponist ihm in generöser und virtuos orchestrierter Geste freistellt. Strauss, der große Objektivist, der Subjektives – anders als Mahler, als Wagner, als Schumann, als Schubert und besonders: Beethoven – nicht durchlebt oder gar durchleidet, sondern in seinen Opern wie in seinen Liedern oder symphonischen Dichtungen sozusagen nur protokolliert, hält sich immer raus. Nicht umsonst stammt der goldene Satz: „Ein guter Komponist müsste auch eine Speisekarte komponieren können“ von ihm. Aber was für Speisen! Auf Dichterspesen. Und der Tod ist leicht wie eine Feder Eichendorff spendiert den „Vier letzten Liedern“ gleichsam den vorgezogenen Leichenschmaus zu einem Tod, der schon im Gedicht auf federleicht vierhebigen Versfüßen im Abendrot darauf wartet, dass man mit ihm ein Einverständnis herstellt, kein Aufbegehren anzettelt: „Wie sind wir wandermüde –“, der vorletzte Vers der letzten Strophe hat als einziger im Gedicht einen Gedankenstrich am Ende, bevor die letzte Zeile „Ist das etwa der Tod?“ fragt. Der Gedankenstrich streicht hier keine Gedanken. Er verwandelt sie in ein vorbewusstes erkennendes Innehalten. Eine höhere Wahrheit. Die jetzt zum Ereignis wird, an dem das Fragezeichen nichts mehr ändert. Und so, wie Strauss diesen herzzerreißenden Moment komponiert, ist es, als wolle die ins Abgrundtiefe sich hinabträumende Sopranstimme mitsamt dem Orchester in vollkommener Moll-Ruhe sich auflösen – bevor dann die zwei Piccoloflöten-Lerchen noch ein letztes Mal über allem Tod und aller Verklärung dem Himmel nachträumend entgegensteigen. Hermann Hesse und der „schöne alte Herr“ Um Himmelsträume und Einverständniserklärungen in unvermeidliche Abschiede geht es auch in der nach Eichendorff zweiten, einer dreifachen lyrischen Wortdichterspende an den Tondichter der „Vier letzten Lieder“, alle drei aus der Feder Hermann Hesses: „Frühling“ aus dem Jahr 1899, den Strauss im Juli 1948, „September“ (1927), den Strauss im September 1948, und „Beim Schlafengehen“ (1911), das Strauss im August 1948 vertonte. (Das eigentlich zuerst komponierte „Im Abendrot“ wurde vom Verleger an den Schluss gesetzt und blieb seither auch dort.) Hesse freilich hatte zu Vertonungen seiner Gedichte ein neutrales bis skeptisches Verhältnis, wie er in einem Brief bekannte: „Mir persönlich haben von den zahllosen Vertonungen meiner Verse nur ganz wenige etwas bedeutet; im Übrigen bin ich froh, wenn ich unvertont bleibe.“ Von der Person des Komponisten, dem „schönen alten Herren“, den er zufällig in einem Hotel in der Schweiz kennengelernt hatte, wohin sich das Ehepaar Strauss aus dem zerbombten Nachkriegsdeutschland zurückgezogen hatte, war Hesse durchaus angetan, von dessen Musik weniger, die er als „virtuos, raffiniert, voll handwerklicher Schönheit, aber ohne Zentrum, nur Selbstzweck“ empfindet. Geburt, versteckt in Todesahnungen Dabei beobachtet Strauss den jeweiligen versteckten Herzton Hesses exakt: Wenn im „Frühling“ ein lyrisches WeltIch „in dämmrigen Grüften“ lange geträumt hat von „deinen Bäumen und blauen Lüften,/ Von deinem Duft und Vogelgesang“ und den Frühling als Sehnsuchtspartner personalisiert, der da liegt „erschlossen/ In Gleiß und Zier,/ Von Licht übergossen/ Wie ein Wunder vor mir“ – dann wechselt die ergriffen ekstatische Gedicht-Atmosphäre im Tongemälde dunkel-pessimistisch zunächst zwischen c-Moll und as-Moll, wendet sich innerhalb weniger Takte nach H-Dur und cis-Moll, um dann erst zu Ende der ersten Strophe Es-Dur zu erreichen. Im opulenten Glanz des Orchesters und in den Melismen der Sopranstimme schwingt die herz-ungewisse todversprechende Haltlosigkeit und Losgelassenheit mit, die dann in „Im Abendrot“ so endspielsicher sich einstellt. Was Hesse dem Tondichter da insgeheim spendiert, ist eine Geburt, versteckt in Todesahnungen – die man aber erst dann liest, wenn man sie hört. Seite 2|3 Musikfreunde | Magazin der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien Mai/Juni 2017 Abschiedsekstasen und ein großes „Noch einmal!“ Und der „September“ ist sowieso der ideale Sterbemonat. Wenn die Blumen noch präsent sind, in die der Regen sinkt, und Tausende gelbfarbener Tupfen vom Akazienbaum „Blatt um Blatt“ tropfen, und der Sommer die „müdgewordenen Augen“ zutut, nachdem er „erstaunt und matt“ in den sterbenden Gartentraum geblickt hat – dann ist im Silberklang der Celesta, den Flirrlagenwechseln der Streicher und den Abschiedsekstasen der Sopranstimme der Todes- und eben auch Trostton des Gedichts ganz wunderbar getroffen. Als ein gelassenes Einverstandensein mit dem Ende. Und könnte die „in freien Flügen schweben“ und „tausendfach zu leben“ anhebende „Seele unbewacht“ im Gedicht „Beim Schlafengehen“ besser gelesen und in allen Seligkeitskurven protokolliert werden als im großen Violinsolo, das der Singstimme eines „frommen Kindes“, müdgemacht durch alles Tag- und Hand- und Kopfwerk, sozusagen geschwisterlich die Augen zu schließen hilft? Was die wortmusizierenden Dichter den lesenden Komponisten insgeheim stiften, ist ja doch: dass ihre Augen gleichsam anders zu hören beginnen. Nachdem das alte Europa spätestens in den Feuer- und Mordhöllen des Zweiten Weltkriegs seine entsetzensmüden Augen schloss, wagte der alte Richard Strauss mit Eichendorffs und Hesses Lidschlägen einen unfassbar reinen, trotzig emphatischen Hör-Blick zurück aufs Schöne, wiewohl Sterbende und Vergehende, in Tönen und Tonalitäten aber wie in einem großen „Noch einmal!“ als Traum zu Bewahrende. Die Uraufführung am 22. Mai 1950 in London (unter Furtwängler mit Kirsten Flagstad und dem Philharmonia Orchestra) hat er nicht mehr erlebt. Es hätte ihm gefallen. Gerhard Stadelmaier Dr. Gerhard Stadelmaier, Jahrgang 1950, bis September 2015 der fürs Theater und die Theaterkritik verantwortliche Redakteur im Feuilleton der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, lebt in Bad Nauheim. Zuletzt erschienen von ihm „Regisseurstheater. Auf den Bühnen des Zeitgeists“ und der Roman „Umbruch“. Seite 3|3