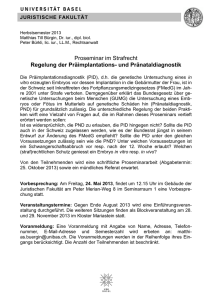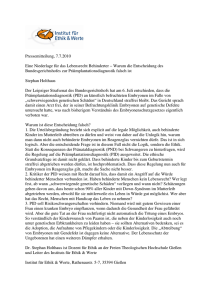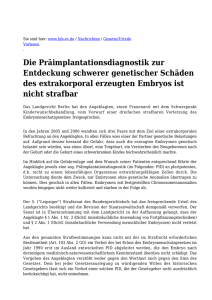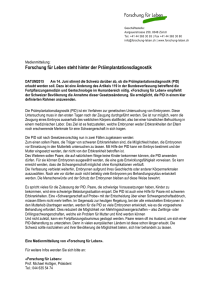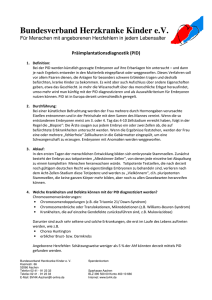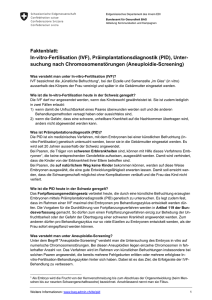kommentar - Deutsches Ärzteblatt
Werbung

aerzteblatt.de/dossiers Die Zeitschrift der Ärzteschaft | Gegründet 1872 www.aerzteblatt.de/dossiers/embryonenforschung 2010 INHALT EMBRYONENFORSCHUNG Der Beginn des Lebens Die Debatte über Präimplantationsdiagnostik und die Forschung an und mit Embryonen Seit der Veröffentlichung des „Diskussionsentwurfs zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik (PID)“ im Jahr 2000 hat sich das Deutsche Ärzteblatt intensiv an der Debatte über PID, die Forschung an und mit Embryonen sowie die Gewinnung von Stammzellen beteiligt und die unterschiedlichsten Stimmen zu Wort kommen lassen. In diesem Dossier spiegeln die Beiträge der DÄ-Redakteurinnen und -Redakteure, aber auch Aufsätze und Kommentare von Ärzten, Politikern, Juristen sowie Theologen ▄ die Meinungsvielfalt zu dieser Thematik wider. BEITRÄGE AUS DEM JAHR 2010 2 Regenerative Medizin: Ein Fachgebiet auf Hochtouren 35 4 8 10 Präimplantationsdiagnostik: Eile ist kein guter Berater Eva Richter-Kuhlmann Eva Richter-Kuhlmann Pränatale Diagnostik und Schwangerschaftsabbruch: Kooperation zwischen Ärzten, Beratungsstellen und Verbänden 36 Christiane Woopen, Anne Rummer 38 Präimplantationsdiagnostik: Gespaltene Gesellschaft Norbert Jachertz, Eva Richter-Kuhlmann Gendiagnostik: Neues Gesetz, neue Pflichten Übersichtsarbeit: Pränataldiagnostik genetischer Erkrankungen Eva Richter-Kuhlmann Peter Wieacker, Johannes Steinhard Präimplantationsdiagnostik: Ein Fall für die Gerichte Gisela Klinkhammer 12 Interview mit Hubert Hüppe, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen 15 Embryonenforschung: Über den Umgang mit menschlichem Leben 49 XCell-Center: Das Dilemma der Übergangsfrist Vera Zylka-Menhorn Sibylle Rolf 19 Bundesgerichtshof zur Präimplantationsdiagnostik: Druck auf die Politik IMPRESSUM Gisela Klinkhammer 20 Übersichtsarbeit: Perinatale Probleme von Mehrlingen Joachim W. Dudenhausen, Rolf F. Maier 27 Nobelpreis für Medizin: „Vater“ von vier Millionen Babys Vera Zylka-Menhorn, Nicola Siegmund-Schultze, Renate Leinmüller 29 Präimplantationsdiagnostik: Vom Kinderwunsch zum Wunschkind Norbert Jachertz 34 Präimplantationsdiagnostik: Das Parlament ist gefragt Eva Richter-Kuhlmann 1 Deutsches .. Arzteblatt DOSSIER EMBRYONENFORSCHUNG Chefredakteur: Heinz Stüwe, Köln (verantwortlich für den Gesamtinhalt im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen) Chefs vom Dienst: Gisela Klinkhammer, Herbert Moll Redaktion: Gisela Klinkhammer, Michael Schmedt (Internet) Technische Redaktion: Michael Peters Schlussredaktion: Inge Rizk, Christine Menz-Hackenberg Verlag: Deutscher Ärzte-Verlag GmbH, Köln aerzteblatt.de DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG Heft 1–2, 7. Januar 2010 REGENERATIVE MEDIZIN Ein Fachgebiet auf Hochtouren Das große Potenzial von Stammzellen für die Medizin ist unbestritten. Wie breitgefächert die Forschungsansätze jedoch sind und derzeit auch noch sein müssen, zeigte sich bei der Weltkonferenz für regenerative Medizin. D ie Fachrichtung boomt. Nahezu im Wochentakt wird von neuen Entwicklungen auf dem Gebiet der Stammzellforschung und der regenerativen Medizin berichtet. Einen Besucherrekord von 1 100 Wissenschaftlern aus 37 Ländern erlebte in diesem Jahr auch die Weltkonferenz für regenerative den Wissenschaftlern, Unternehmen und regulatorischen Behörden, um dieses neue Wissen sicher und zuverlässig zum Patienten zu bringen“, berichtete Kongresspräsident Prof. Dr. med. Frank Emmrich dem Deutschen Ärzteblatt. In der Tat befinden sich viele Gebiete im Stadium der Grundlagen- Medizin in Leipzig. Unter dem Motto „Das Potenzial von Stammzellen“ widmete sie sich Themen wie Pluripotenz und Reprogrammierung von Stammzellen, Stammzelltherapie und Organersatz durch Gewebezüchtung sowie der Übertragung therapeutischer Ansätze in die klinische Praxis. Veranstaltet wurde die Konferenz vom Leipziger Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie und Translationszentrum für Regenerative Medizin Leipzig. „Das Feld der regenerativen Medizin hat in den vergangenen Jahren große Fortschritte gemacht. Dessen ungeachtet liegt noch viel Arbeit vor forschung. Obwohl das Potenzial der Stammzellen in der Medizin als unbestritten gilt, vermag noch niemand zu sagen, wann wirksame und sichere Therapien in großem Stil verfügbar sein werden. Die derzeit größten Hoffnungen werden auf die aus Körperzellen abgeleiteten humanen induzierten pluripotenten Stammzellen (iPS-Zellen) gesetzt. Foto: AOK-Bilderdienst Embryonale Stammzellen im Blastozystenstadium: Da alternative, ethisch unbedenkliche Verfahren entwickelt worden sind, können die Forscher zunehmend auf embryonale Stammzellen verzichten. Gewebespezifische Zellen zur Organregeneration Wie bei humanen embryonalen Stammzellen (hES-Zellen) können aus iPS-Zellen über entsprechende In-vitro-Differenzierungsprotokolle gewebespezifische Zellen gewon- nen werden. Mit ihrer Hilfe könnten insbesondere Organe regeneriert werden, in denen ansonsten die Kapazität zur Selbsterneuerung durch somatische Stammzellen schwach ausgebildet ist, wie zum Beispiel im Nervensystem, im Pankreas oder im Herzen. Eine weitere Option ist die Möglichkeit, pharmakologische potenzielle Wirkstoffe direkt an Zellen des individuellen Patienten zu testen. Auch Ian Wilmut von der Universität Edinburg, Großbritannien, geistiger „Vater“ des Klonschafs Dolly, hob das Potenzial der induzierten pluripotenten Stammzellen hervor. Durch sie könnten sowohl die Ursachen von Krankheiten besser verstanden und gleichzeitig die Sicherheit von neuen Medikamenten untersucht werden. „Menschliche iPS-Zellen bieten die Möglichkeit, unerwünschte Nebenwirkungen in einem früheren Stadium des Prozesses zu identifizieren und zu eliminieren“, sagte Wilmut. Sowohl Teragonität als auch Toxizität ließen sich an ihnen besser als im Tiermodell testen. Grundvoraussetzung für eine Nutzung pluripotenter Stammzellen in der Wirkstoffentwicklung seien jedoch stabile Verfahren zur reproduzierbaren Gewinnung gewebespezifischer Zellen, betonte Prof. Dr. med. Oliver Brüstle vom Institut für Rekonstruktive Neurobiologie der Universität Bonn. Sein Team konnte kürzlich zeigen, dass sich aus humanen embryonalen Stammzellen stabile neurale Stammzellen (long-term self-renewing hES cell-derived neural stem cells, lt-hESNSC) herstellen lassen. Ihr entscheidender Vorteil: Selbst über lange Zeiträume hinweg können aus ihnen verschiedene neurale Subtypen – wie Neurone, Astrozy- 2 DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG ten und Oligodentrozyten – ausreifen. Unter geeigneten Differenzierungsbedingungen können aus ihnen zudem Transmittersysteme gewonnen werden, die bei vielen pharmakologischen Fragen relevant sind, wie beispielsweise GABAerge, glutaminerge, dopaminerge und serotoninerge Neurone. „Die direkte Gewinnung von Neuronen und Gliazellen über diese stabile neurale Stammzellpopulation bedingt nicht nur eine enorme Zeitersparnis und Standardisierung. Sie eröffnet auch die Möglichkeit, genetische Modifikationen direkt an den aus ihnen gewonnenen somatischen Stammzellen durchzuführen“, erklärte Brüstle. Auf diese Weise könnte in schneller Folge eine Vielzahl krankheitsrelevanter Mutationen in humanen Neuronen und Gliazellen untersucht werden. Eine Alternative beim Einsatz von Stammzellen könnten auch humane spermatogonale Stammzellen sein, die ohne gentechnische Reprogrammierung entwicklungsfähig erscheinen. Forschungen an Keimzellen von Mäusen hatten zunächst gezeigt, dass es möglich ist, die Stammzellen, aus denen sich Spermien bilden – sogenannte spermatogonale Stammzellen (SSCs) – in vitro in ein pluripotentes Stadium zu reprogrammieren. Spermatogonale Stammzellen werden isoliert und kultiviert Prof. Dr. med. Thomas Skutella vom Anatomischen Institut der Universität Tübingen konnte diese Untersuchungen erstmals auf den Menschen übertragen und Kulturen von humanen adulten, pluripotenten, aus der Keimbahn abgeleiteten Stammzellen (human germline-derived stem cells, haGSCs) gewinnen. Sowohl in vitro als auch in vivo hat sein Team über lange Zeiträume hinweg aufgereinigte, proliferative haGSC-Kulturen von spermatogonalen Stammzellen aus adulten humanen Hoden isoliert und gezüchtet. Dabei zeigten die Zellkulturen Expressionsprofile, die denen von pluripotenten humanen embryonalen Stammzellen vergleichbar sind. Gleichzeitig konnten sie alle Grundgewebe des menschlichen Körpers bilden. Skutella schließt daraus, dass diese Zellen ein adultes Gegenstück zu den humanen ES-Zellen und eine weitere Alternative zu humanen induzierten pluripotenten Stammzelllinien sind. Ihr Vorteil sei insbesondere, dass sie als adulte Zellen im Gegensatz zu embryonalen Stammzellen ethisch unbedenklich eingesetzt werden könnten. Optimal könnten Skutella zufolge diese Zellen auch für die Behandlung erblich bedingter Erkrankungen sein, da die Möglichkeit bestehe, pluripotente haGSC-Linien der entsprechenden Pathologien herzustellen. So könnten beispielsweise Hodenbiopsien bei Parkinsonpatienten durchgeführt und die isolierten spermatogonalen Stammzellen über die Transformation in haGSCs in Vorläuferzelllinien des Nervensystems differenziert werden. Hieraus könnten dann dopaminerge Neurone für pharmakologische Assays induziert werden. Aufgabe der Forscher ist es jetzt, aus der Vielfalt der Möglichkeiten die Methode zu identifizieren, die am zuverlässigsten normale Zellen produziert, und die induzierten pluripotenten Zellen untereinander und mit den ES und ▄ haGSCs zu vergleichen. Dr. med. Eva Richter-Kuhlmann GESETZLICHE HÜRDEN Die Translation von Ergebnissen der Stammzellforschung in die klinische Anwendung bereitet aus verschiedenen Gründen Probleme. „Die Anstrengungen zu den notwendigen klinischen Studien zum Nachweis der Wirksamkeit von Stammzellen müssen deutschlandweit gebündelt werden“, fordert deshalb Priv.Doz. Dr. med. Philip Kasten, Carl-GustavCarus-Universität Dresden. Für Einzelpersonen oder Einzelinstitutionen sei der derzeit notwendige organisatorische Aufwand kaum zu bewältigen. Deshalb sollten sich Zentren, die regenerative Therapien durchführen wollen, zusammenschließen sowie Studieninitiativen koordinieren. Dies sei auch der Konsens von Expertenworkshops gewesen, die 2009 im Rahmen der Jahreskongresse der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie und der Deutschen Gesellschaft für Or- 3 thopädie und Unfallchirurgie in Abstimmung mit dem Center for Regenerative Therapies Dresden, dem Berlin-Brandenburg Center for Regenerative Therapies und dem Muskuloskelettalen Zentrum Würzburg stattfanden. „Der Einsatz von mesenchymalen Stammzellen ist auch für den operativ orthopädisch/unfallchirurgisch tätigen Chirurgen interessant“, sagt Kasten. Leider herrsche jedoch eine große Diskrepanz zwischen den Daten aus tierexperimentellen Studien und tatsächlichen klinischen Untersuchungen. Dies sei vor allem auf die in den letzten Jahren geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen zurückzuführen, erläutert der Chirurg. Entsprechend der 14. Novelle des Arzneimittelgesetzes (vom 29. August 2005) müssen nämlich klinische Studien, die die Wirksamkeit und/oder Sicher- heit von Stammzellpräparaten untersuchen, nicht nur beim Paul-Ehrlich-Institut angezeigt, sondern von diesem auch genehmigt werden. Dazu muss eine Herstellungserlaubnis des zuständigen Regierungspräsidiums einschließlich einer pharmakologischen/toxikologischen Prüfung vorliegen, die die Qualität des Arzneimittels nach dem Good-medicalpractice-Standard voraussetzt. „Dies erfordert jedoch eine finanziell und experimentell aufwendige präklinische In-vivoAnalyse zur chromosomalen Instabilität und Sicherheit“, erklärt Kasten. „Selbst universitäre Forschungseinrichtungen stoßen dabei an ihre Grenzen.“ Mit der 15. Novelle des Arzneimittelgesetzes, die im September 2009 in Kraft getreten sei, seien zudem noch verschiedene Ausnahmegenehmigungen aufgehoben worden, die die klinische Anwendung von Stammzellen erschweren könnten. DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG Heft 3, 22. Januar 2010 PRÄNATALE DIAGNOSTIK UND SCHWANGERSCHAFTSABBRUCH Kooperation zwischen Ärzten, Beratungsstellen und Verbänden Die Umsetzung der neuen gesetzlichen Vorgaben wird wissenschaftlich begleitet. Ziel ist es, schwangere Frauen besser aufzuklären und zu beraten. Christiane Woopen, Anne Rummer ach den Auseinandersetzungen der letzten beiden Jahrzehnte (5, 8) kommen seit dem Jahreswechsel auf die Ärzte, die im Kontext von pränataler Diagnostik (PND) und medizinisch-sozialer Indikationsstellung tätig sind, neue gesetzlich verankerte Anforderungen zu: Am 1. Januar 2010 ist das Gesetz zur Änderung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) in Kraft getreten (dazu 4). Ziel der Gesetzesänderung ist es, die Aufklärung und Beratung von schwangeren Frauen (und ihren Partnern) zu verbessern, denen ein auffälliger fetaler Befund mitgeteilt werden muss und/oder die eine medizinischsoziale Indikation zum Schwangerschaftsabbruch erhalten. Daneben treten am 1. Februar 2010 ebenfalls einschlägige Regelungen des Gendiagnostikgesetzes (GenDG) in Kraft. N Pflichten der Ärzte nach SchKG Seit dem 1. Januar hat der Arzt, der der schwangeren Frau einen auffälligen pränatalen Befund mitteilt, gemäß § 2 a Abs. 1 SchKG folgende Pflichten: Er hat die schwangere Frau bei Mitteilung eines auffälligen fetalen pränataldiagnostischen Befunds in verständlicher Form und ergebnisoffen über medizinische und psychosoziale Aspekte und Möglichkeiten der Unterstützung zu beraten. Im Rahmen dieser Beratung hat er ihr Informationsmaterial der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA, 2) auszuhändigen. Zur ärztlichen Beratung sollen Kollegen hinzugezogen werden, die mit der diagnostizierten Gesundheitsschädigung bei gebore- nen Kindern Erfahrung haben oder die auf die Betreuung der kindlichen Gesundheitsschädigung spezialisiert sind (zum Beispiel Pädiater oder Humangenetiker). Die schwangere Frau ist über ihren Anspruch auf psychosoziale Beratung nach § 2 SchKG hinzuweisen und ihr sind mit ihrem Einverständnis eine solche Beratung sowie Kontakt zu Selbsthilfegruppen oder Behindertenverbänden zu vermitteln. Den Arzt, der die schriftliche Feststellung über das Vorliegen der Voraussetzungen eines medizinisch-sozial indizierten Schwangerschaftsabbruchs zu treffen hat, hat nach § 2 a Abs. 2 SchKG auch unabhängig vom Vorliegen eines pränataldiagnostischen Befunds folgende Pflichten: Er muss die schwangere Frau über medizinische und psychische Aspekte eines Schwangerschaftsabbruchs beraten. Er hat sie über ihren Anspruch auf psychosoziale Beratung zu informieren und gegebenenfalls eine Beratung zu vermitteln. Frühestens nach Ablauf einer dreitägigen Bedenkzeit nach Mitteilung der Diagnose oder – ohne vorangegangene PND – nach Beratung zum Schwangerschaftsabbruch kann der Arzt eine schriftliche Bestätigung der Schwangeren einholen: entweder über die ärztliche Beratung und Vermittlung weiterer Kontakte oder über ihren Verzicht darauf (3). Danach erst kann er bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 218 a Abs. 2 StGB die Indikation zum Schwangerschaftsabbruch schriftlich feststellen. Pflichten der Ärzte nach GenDG Das Gendiagnostikgesetz enthält zusätzlich eigene spezielle Regelungen, die sich auf vorgeburtliche genetische Untersuchungen, einschließlich vorgeburtlicher Risikoabklärung, beziehen. Für Ärzte bedeutet dies, dass beide Regelwerke parallel zu beachten sind. § 15 Abs. 3 GenDG schreibt eine ärztliche Beratungspflicht vor einer vorgeburtlichen genetischen Untersu- 4 DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG chung und nach Vorliegen des Ergebnisses durch eine entsprechend qualifizierte Person vor (s. u.). Die genetische Beratung gilt nach dem Willen des Gesetzgebers als eigene ärztliche Leistung. Sie ist daher von der ärztlichen Aufklärung über die genetische Untersuchung zu trennen, die der genetischen Beratung vorgeschaltet ist und die als Grundlage für die Ausübung des Selbstbestimmungsrechts und einer wirksamen Einwilligung in die Untersuchung verstanden wird. Im Unterschied zur ärztlichen Aufklärung geht die genetische Beratung über die Vermittlung von Informationen hinaus. Sie hat explizit in allgemeinverständlicher Form und ergebnisoffen zu erfolgen. In die Beratung einzubeziehen sind „insbesondere mögliche psychische und soziale Fragen im Zusammenhang mit einer Vornahme oder Nichtvornahme der genetischen Untersuchung und ihren vorliegenden oder möglichen Untersuchungsergebnissen“ (§ 10 Abs. 3 GenDG). Möglichkeiten zur Unterstützung bei physischen und psychischen Belastungen der betroffenen Person durch die pränatale Untersuchung und ihr Ergebnis sind ebenfalls zu berücksichtigen. Ferner bietet das GenDG die Möglichkeit, eine weitere sachverständige Person zur Beratung hinzuzuziehen. Für die genetische Beratung gilt ebenso wie für die genetische Untersuchung ein Arztvorbehalt. Entsprechend der Begründung des Gesetzgebers darf jeder Arzt im jeweiligen Fachgebiet beraten, zu dessen Ausbildungsinhalten nach der jeweiligen für ihn geltenden Weiterbildungsordnung Kenntnisse über erbliche Krankheiten gehören; bei Pränataldiagnostik ist das zum Beispiel für Gynäkologen von Bedeutung. Für die schwangere Frau ist die Inanspruchnahme nicht verpflichtend; entscheidend ist, dass der Arzt ihr ein entsprechendes Angebot macht. Wenn der Pränataldiagnostiker, der im Sinne des GenDG untersucht, und der Arzt, der den Befund mitteilt, dieselbe Person sind, müssen sowohl die Anforderungen nach GenDG als auch – bei Vorliegen eines pathologischen Befunds nach PND – die Vor- 5 schriften des § 2 a SchKG eingehalten werden. Wenn Untersuchung und Befundmitteilung jedoch durch unterschiedliche Personen durchgeführt werden, muss der untersuchende Arzt das GenDG, der mitteilende Arzt das SchKG befolgen. Qualifizierungsanforderungen an die Ärzte Bereits seit dem 1. Januar stellt das SchKG explizite Anforderungen an den Arzt, der den pränatalen Befund mitteilt. In der Regel wird das der Pränataldiagnostiker oder der niedergelassene Gynäkologe sein. Die Beratung soll ergebnisoffen, verständlich und umfassend sein und Probleme einbeziehen, die sich aus dem medizinischen fetalen Befund oder aus psychischen beziehungsweise psychiatrischen Aspekten im Zusammenhang mit der pränataldiagnostischen Untersuchung ergeben. Zu einem psychischen Konflikt kann ein schwer belastendes Lebensereignis wie beispielsweise der Verlust der Partnerschaft führen. Einen psychiatrischen Aspekt, der im Rahmen des Beratungsgesprächs durch den die Diagnose mitteilenden Arzt zu berücksichtigen ist, kann eine im Zusammenhang mit dem pränataldiagnostischen Befund entstehende Depression darstellen. Zusätzlich WISSENSCHAFTLICHE BEGLEITUNG Seit dem 1. Dezember 2008 fördert das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend das Projekt „Interdisziplinäre und multiprofessionelle Beratung bei Pränataldiagnostik und Schwangerschaftsabbruch“ an der Forschungsstelle Ethik der Universität zu Köln. Bundesweit wird eine zweistufige Fragebogenerhebung über die Erfahrungen mit den im SchKG und im GenDG vorgeschriebenen Neuerungen über Aufklärung und Beratung sowie zu den Kooperationsstrukturen seitens der Ärzte, psychosozialen Beratungsstellen, Verbände und Organisationen durchgeführt. Daneben wird an ausgewählten repräsentativen Einzelstandorten eine differenziertere und tiefergehende Erfassung der Erfahrungen von einzelnen Ärzten verschiedener Disziplinen, psychosozialen Beratungsstellen und Selbsthilfeverbänden sowie Behindertenorganisationen mittels Interviews stattfinden. In einem Projektbeirat werden die durch die Neuregelungen betroffenen Gruppen der einzelnen Akteure zusammengeführt. Der Projektbeirat wird in die Planungsphase sowie in die Begleitung während der Projektarbeit einbezogen. Zur Erreichung eines der wichtigsten Ziele des Projekts – die Etablierung jeweils geeigneter Kooperationsstrukturen und die Entwicklung abgestimmter Beratungskonzepte zur interdisziplinären und multiprofessionellen Beratung bei Pränataldiagnostik und Schwangerschaftsabbruch – ist die Mitwirkung aller betroffenen Ärzte, Verbände und Gruppen außerordentlich wichtig. Auf die erste geplante Erhebungsrunde im Frühjahr 2010 wird daher bereits jetzt hingewiesen und um tatkräftige Unterstützung gebeten. DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG ist über psychosoziale Unterstützungsangebote zu informieren. Der Gesetzgeber sieht aufgrund dieser neuen Anforderungen einen Bedarf an geeigneten Fortbildungsund Qualifizierungsmaßnahmen der Ärzteschaft, und „ergänzend sollte die Qualität der ärztlichen Aufklärung und Beratung durch entsprechende Änderungen in den für die Ärzteschaft geltenden Richtlinien gesichert werden“ (Bundestagsdrucksache 16/12970, Seite 24). Bezüglich der besonderen Qualifizierung für eine genetische Beratung nach dem GenDG (§ 7 Abs. 3 GenDG) sowie der Inhalte der Beratung bleiben Vorgaben der Gendiagnostik-Kommission am Robert-Koch-Institut abzuwarten. § 2 a SchKG fordert eine interdisziplinäre Beratung: Zur Beratung der schwangeren Frau sind Ärzte hinzuzuziehen, die mit der diagnostizierten Gesundheitsschädigung bei geborenen Kindern Erfahrung haben. Um dies gewährleisten zu können, muss die Möglichkeit einer zeitnahen Einbeziehung von Kollegen in den konkreten Einzelfall sichergestellt sein. Dazu wird es zweckmäßig sein, Kooperationen einzurichten, die die unterschiedlichen medizinischen Disziplinen abdecken und die organisatorisch so flexibel ausgestaltet sind, dass die Beratung zeitnah durchgeführt werden kann. In unterschiedlichen Versorgungskontexten (Krankenhaus, Praxis, Schwerpunktpraxis) wird dies unterschiedliche Formen annehmen, die es zum großen Teil erst noch zu entwickeln gilt. Multiprofessionelle Kooperationen Neben der Interdisziplinarität fordert § 2 a SchKG eine multiprofessionelle Beratung, die neben der ärztlichen Beratung eine solche durch eine psychosoziale Beratungsstelle im Sinne des § 3 SchKG sowie Kontakte zu Selbsthilfegruppen und Behindertenverbänden umfasst. Ziel der neuen Regelung ist es vor allem, dass sich die psychosoziale Beratung als selbstverständlicher Be- Fotos: ddp Interdisziplinäre Kooperationen standteil der Betreuung von schwangeren Frauen bei pränataler Diagnostik etabliert (Bundestagsdrucksache 16/12970, Seite 24). Um dieses Konzept nicht leerlaufen zu lassen, genügt es nicht, lediglich Informationsmaterial mit Kontaktadressen zu übergeben. Dies ist nach dem Willen des Gesetzgebers nur im Ausnahmefall zulässig (Bundestagsdrucksache 16/12970, Seite 24). Vermittlung bedeutet vielmehr zumindest die Benennung konkreter Kontaktadressen. Idealerweise wird auch die unmittelbare Vermittlung eines Termins durch den Arzt erfolgen, um zu ermöglichen, dass die Frau noch in der akuten Schocksituation eine erste psychosoziale Beratung, meist im Sinne einer Krisenintervention, in Anspruch nehmen kann. In Modellprojekten wurde von betroffenen Frauen eine solche – idealerweise auch räumlich – enge Zusammenarbeit von Ärzten und psychosozialen Beratungsstellen als besonders hilf- reich erlebt (6). Eine wichtige Aufgabe wird es daher sein, standardmäßig Kooperationen zwischen Ärzten und psychosozialen Beratungsstellen einzurichten. Solche Kooperationen setzen Kenntnis und Akzeptanz der unterschiedlichen Beratungs- und Arbeitsweisen von Ärzten und Beraterinnen, eine etablierte Vermittlungspraxis bei ausreichender Flexibilität der Terminvereinbarung sowie einen regelmäßigen Austausch voraus (7), was auf der Grundlage einer förmlichen Kooperationsvereinbarung erfolgen kann und transparente Qualifizierungsvoraussetzungen aller Beteiligten erfordert. Die Zusammenarbeit von Ärzten und psychosozialen Beratungsstellen wird auch der Entlastung der betroffenen Ärzte dienen, die auf die psychosoziale Beratung aufbauen können. Diese umfasst bestimmungsgemäß (§ 2 Abs. 2 Nrn. 5 und 7 SchKG) insbesondere Informationen über die Hilfsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung und ihre Familien sowie Lösungsmöglichkeiten für psychosoziale Konflikte im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft (13, 14). Vor allem aber haben betroffene Frauen bei einer psychosozialen Beratungsstelle einen unabhängigen Raum, Ängste zu formulieren, mit Hilfe der Beraterinnen einen Weg zum Umgang mit der neuen Situation zu finden und sich über die eigene Position im Klaren zu werden. Es gibt durch die vielfältigen Bemühungen in den letzten zehn Jahren (1, 6) an einigen Orten bereits Strukturen qualifizierter psychosozialer Beratung bei Pränataldiagnostik. Ein flächendeckendes Netz an ausreichender Qualifikation und Kapazität existiert jedoch nicht. ❚ Zitierweise dieses Beitrags: Dtsch Arztebl 2010; 107(3): A 68–70 Anschrift der Verfasserinnen Prof. Dr. med. Christiane Woopen Dr. iur. Anne Rummer Institut für Geschichte und Ethik der Medizin Forschungsstelle Ethik Universität zu Köln Herderstraße 54 50931 Köln @ Literaturverzeichnis im Internet: www.aerzteblatt.de/lit0310 6 DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG Heft 3, 22. Januar 2010 LITERATURVERZEICHNIS HEFT 3/2010, ZU: PRÄNATALE DIAGNOSTIK UND SCHWANGERSCHAFTSABBRUCH Kooperation zwischen Ärzten und psychosozialen Beratungsstellen Die Umsetzung der neuen gesetzlichen Vorgaben wird wissenschaftlich begleitet. Ziel ist es, schwangere Frauen besser aufzuklären und zu beraten. Christiane Woopen, Anne Rummer LITERATUR 1. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Interprofessionelle Qualitätszirkel in der Pränataldiagnostik. http://www.bzga. de/bigpix.php?id=99b3a79c6cd327137 f318a6df18a0018&w=527&h=700. [Stand: 02.12.2009]. 2. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Informationsmaterial für Schwangere nach einem auffälligen Befund in der Pränataldiagnostik. http://www.bzga.de/ ?uid=758e89ecac60ff99bd9aa4cfde7bc7 3b&id=medien&sid=193 3. .Kentenich H, Vetter K, Diedrich K: Schwangerschaftskonfliktgesetz: Was ändert sich für Frauen, Frauenärztinnen und Frauenärzte beim Abbruch aus medizinischer Indikation? Frauenarzt 2009: 936–44. 4. Klinkhammer G: Reform des Schwangerschaftskonfliktgesetzes: Mehr Beratung. Deutsches Ärzteblatt 2009: A 2352–3. 7 5. Hübner M: Gesetzentwürfe und Anträge zur Änderung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes. Medizinrecht 2009: 390–6. 6. Rohde A, Woopen C: Psychosoziale Beratung im Kontext von Pränataldiagnostik. Evaluation der Modellprojekte in Bonn, Düsseldorf und Essen. Deutscher Ärzteverlag, Köln 2007. 7. Wassermann K, Rohde A: Pränataldiagnostik und psychosoziale Beratung. Aus der Praxis für die Praxis. Schattauer, Stuttgart 20 8. Woopen C, Rummer A: Beratung im Kontext von Pränataldiagnostik und Schwangerschaftsabbruch. Pflichten der Ärzte und Ansprüche der schwangeren Frauen. Medizinrecht 2009: 130–8. DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG Heft 4, 29. Januar 2010 GENDIAGNOSTIK Neues Gesetz, neue Pflichten Durch das zum 1. Februar in Kraft tretende Gendiagnostikgesetz ändern sich die Anforderungen bei genetischen Untersuchungen. „Aufgepasst“ heißt es jetzt besonders für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, die Gentests ins Labor schicken. ach einem siebenjährigen Dauerstreit tritt es zum 1. Februar in Kraft: das Gesetz über genetische Untersuchungen bei Menschen (Gendiagnostikgesetz). Doch die im vergangenen Frühjahr mühsam verabschiedeten Regelungen sorgen bereits wieder für Diskussionen. „Einige Definitionen im Gesetzestext sind unglücklich gewählt und könnten zu vermehrter Unsicherheit unter Ärztinnen und Ärzten führen“, erklärt Prof. Dr. med. Peter Propping, Humangenetiker an der Universität Bonn, dem Deutschen Ärzteblatt. „Untersuchungen auf der Ebene der Genprodukte werden vom Gesetz als genetische Untersuchungen definiert, weil sie genetische Eigenschaften erfassen. Hier gibt es Klarstellungsbedarf.“ Nicht nur Humangenetiker sind von dem neuen Gesetz und damit den neuen Pflichten betroffen. Besonders gut sollten sich auch niedergelassene Pädiater, Gynäkologen, Internisten und Neurologen mit ihm vertraut machen. Denn ab Februar gilt: Ärztinnen und Ärzte, die eine genetische Untersuchung veranlassen (und nicht diejenigen, die sie im Auftrag durchführen), sind verpflichtet, ihre Patienten aufzuklären und eine schriftliche Einverständniserklärung zur Untersuchung einzuholen. N Aufklärungspflicht obliegt dem verantwortlichen Arzt Verantwortlich für eine genetische Untersuchung ist dem neuen Gesetz zufolge eindeutig der Arzt, der die Indikation stellt und die genetische Analyse an ein Labor delegiert. Er ist auch verpflichtet, den Patienten über Zweck, Art, Umfang, Aussagekraft und Konsequenzen der Un- tersuchung – auch bezüglich einer möglichen psychischen Belastung durch die Befunde – sowie Risiken aus der Probengewinnung aufzuklären. Gleichzeitig muss er ihn über das Recht auf Widerruf der Einwilligung sowie über das Recht auf Nichtwissen und das Angebot einer genetischen Beratung nach Vorliegen des Ergebnisses in Kenntnis setzen. Zudem darf er nicht vergessen, den Inhalt der Aufklärung zu dokumentieren. „Eine schriftliche Einwilligung zur genetischen Untersuchung durch die untersuchte Person ist immer erforderlich“, erklärt Prof. Dr. med. Manfred Stuhrmann-Spangenberg, Humangenetiker an der Medizinischen Hochschule Hannover. Diese Einwilligung müsse auch gegenüber dem beauftragten Labor nachgewiesen werden. Zudem müssten auch die Einwilligungen zur Probenaufbewahrung sowie zur Weitergabe der Untersuchungsergebnisse an Dritte (beispielsweise an den Hausarzt) schriftlich durch den Patienten erfolgen. „Wir hoffen nicht, dass Ärzte eine eigentlich indizierte genetische Untersuchung nicht veranlassen, nur weil sie den Aufwand als verantwortlicher Arzt scheuen“, sagt Stuhrmann-Spangenberg. Ferner darf dem Gesetz zufolge das beauftragte Labor das Ergebnis einer genetischen Untersuchung ausschließlich dem verantwortlichen Arzt mitteilen. Dieser wiederum darf es künftig auch nur an die betroffene Person weitergeben. Zudem muss er es mindestens zehn Jahre lang aufbewahren oder auf Verlangen des Patienten vernichten. Generell beschränkt das Gendiagnostikgesetz vorgeburtliche genetische Untersuchungen auf medizi- nische Zwecke. Eine Schwangere kann keinen Gentest in Auftrag geben, um lediglich das Geschlecht ihres Kindes bestimmen zu lassen. Stellt der Arzt bei einem aus medizinischen Gründen vorgenommenen Test allerdings das Geschlecht fest, kann er es auf Wunsch nach Ablauf der zwölften Schwangerschaftswoche mitteilen. Neu: Genetische Beratung erfordert formale Qualifikation Zu beachten ist ferner: Bei jeder prädiktiven Untersuchung ist jetzt eine genetische Beratung vor und nach der Untersuchung gesetzlich vorgeschrieben, die zudem schriftlich dokumentiert werden muss. Diese Verpflichtung wirft aber ein neues Problem auf: „Jede vorgeburtliche genetische Untersuchung löst damit die Pflicht zu einer vorhergehenden genetischen Beratung aus. Deren Durchführung setzt eine Qualifikation voraus, deren Umfang und Inhalt von der beim Robert-Koch-Institut angesiedelten Gendiagnostikkommission erst noch definiert werden muss“, erläutert Propping, ein von der Bundesärztekammer gesandter ständiger Gast bei der Kommission. Allerdings werde diese Aufgabe nicht so leicht zu lösen sein, da dazu die Weiterbildungsordnung geändert werden müsse, gibt der Humangenetiker zu bedenken. Nach seiner Ansicht könnte eine Zusatzweiterbildung angeboten werden, die die Ärztinnen und Ärzte autorisiert, genetische Beratungen in ihrem jeweiligen Fachgebiet vorzunehmen. Für diese Umstrukturierung bleiben der Kommission und der Bundesärztekammer gerade einmal zwei Jahre Zeit, denn dem Gesetz zufolge muss die formale Qualifikation ab 1. Februar 2012 vorliegen. Stuhrmann-Spangenberg und Propping sehen aber auch noch weiteren Diskussionsbedarf. So muss nach dem Gesetz das Untersuchungsmaterial nach Abschluss der Untersuchung vernichtet werden, sofern der Patient nicht bestimmt hat, dass das Material aufbewahrt werden soll. „Eine Aufbewahrung ist aber aus vielen 8 Foto: vario images DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG GENETISCHE UNTERSUCHUNGEN Gründen sinnvoll“, meint Stuhrmann-Spangenberg. Sie könne beispielsweise den Patienten später die Möglichkeit eröffnen, dem Verdacht einer Fehldiagnose nachzugehen. „In vielen Fällen lassen sich sichere Aussagen über Erkrankungsrisiken von Nachkommen oder anderen Familienmitgliedern nur treffen, wenn Untersuchungsmaterial der Indexpatienten zur Verfügung steht“, erläutert der Humangenetiker. Sei der Indexpatient aber verstorben und das Untersuchungsmaterial dieses Patienten verworfen, könne den Nachkommen oder Familienmitgliedern eventuell keine sichere Aussage über deren Erkrankungswahrscheinlichkeit gemacht werden. „Dieses Problem muss den Patienten in der Aufklärung erläutert werden. Den meisten aufklärenden Ärzten dürfte diese humangenetische Sichtweise allerdings weniger vertraut sein.“ Arztvorbehalt: gut gemeint, aber auch problematisch In der täglichen Praxis problematisch könnte sich künftig auch der im Gesetz festgeschriebene Arztvorbehalt gestalten. Auf den Vorschlag des Bundesrats, diesen einzuschränken, war die Regierung im Gesetzgebungsprozess vor einem Jahr nicht eingegangen. Nun sind sowohl genetische Reihenuntersuchungen, die auf einen gesundheitlichen Nutzen für die Patienten 9 Diagnostisch: ● genetische Untersuchung mit dem Ziel der Ab- Prädiktiv: ● genetische Untersuchung mit dem Ziel klärung einer bereits bestehenden Erkrankung ● Abklärung von genetischen Suszeptibilitäts● ● ● faktoren bei multifaktoriellen Erkrankungen (auch wenn eine solche noch nicht besteht) pharmakogenetische Untersuchung Untersuchung auf genetisch bedingte Krankheitsresistenz Arztvorbehalt abzielen, als auch beispielsweise das Neugeborenenscreening ausschließlich Ärztinnen und Ärzten vorbehalten. „Prinzipiell ist der Arztvorbehalt begrüßenswert“, betont Stuhrmann-Spangenberg. Durch ihn könne möglicher Wildwuchs gendiagnostischer Maßnahmen, zum Beispiel durch Angebote im Internet, in Apotheken oder im Supermarkt eingedämmt werden. Für problematisch hält ihn der Humangenetiker jedoch im Bereich des Neugeborenenscreenings, da dort die Aufklärung und Blutentnahme häufig durch Hebammen durchgeführt wird. „Auch wenn hier eine Vorverlagerung der ärztlichen Aufklärung zum Frauenarzt eine denkbare Alternative darstellt, ist es durchaus möglich, dass die Teilnahmerate am Neugeborenenscreening sinkt“, befürchtet er. Dies könne keinesfalls im Sinne des Gesetzes sein. Künftig verboten sind durch das Gesetz auch vorgeburtliche Unter- ● ● der Abklärung einer erst künftigen Erkrankung genetische Untersuchung mit dem Ziel der Abklärung der Anlageträgerschaft für Erkrankungen bei Nachkommen Facharztvorbehalt (Qualifikation auf der Basis der Weiterbildungsordnung für Ärzte) suchungen auf Erkrankungen, die erst im Erwachsenenalter auftreten können. Ferner sind Untersuchungen, die zwar keine Gentests sind, jedoch ebenfalls Rückschlüsse auf genetische Erkrankungen zulassen, den Gentests gleichgestellt. Erlauben sie eine Voraussage über die Gesundheit des ungeborenen Kindes, ist ebenfalls eine Beratung vorgeschrieben. Gleichfalls verbietet das Gesetz ab sofort heimliche Vaterschaftstests: Männer, die ihre Vaterschaft überprüfen, oder Mütter, die sich wegen verschiedener Sexualpartner Klarheit über den Vater ihres Kindes verschaffen wollen, müssen vor dem Test die Zustimmung des jeweils anderen potenziellen Elternteils einholen. Zuwiderhandlungen werden mit bis zu 5 000 Euro bestraft. Ein vorgeburtlicher Vaterschaftstest kommt nur bei einer Schwangerschaft nach sexuellem Missbrauch oder einer Ver▄ gewaltigung infrage. Dr. med. Eva Richter-Kuhlmann DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG Heft 5, 5. Februar 2010 PRÄIMPLANTATIONSDIAGNOSTIK Ein Fall für die Gerichte Foto: Medical Picture Vor zehn Jahren löste ein Diskussionsentwurf der Bundesärztekammer die Debatte über die Einführung des genetischen Untersuchungsverfahrens aus. Demnächst beschäftigt sich der Bundesgerichtshof mit der Thematik. er Bundesgerichtshof (BGH) wird auf die Selbstanzeige eines Arztes hin überprüfen, ob die genetische Untersuchung und Aussonderung „schadhafter“ Embryonen bei einer künstlichen Befruchtung strafbar sind. Das teilte die Bundesanwaltschaft Mitte Dezember 2009 in Karlsruhe mit. Demnach müsse der in Leipzig ansässige 5. Strafsenat des BGH grundsätzlich entscheiden, ob die Präimplantationsdiagnostik (PID) eine „strafbare Selektion menschlichen Lebens“ sei, sagte der für das Verfahren zuständige Bundesanwalt Gerhard Altvater. Die Vorinstanzen sind bisher genauso gespalten wie Ärzteschaft und Politik. Der Angeklagte, der als Frauenarzt eine „Kinderwunschpraxis“ in Berlin betreibt, behandelte von De- D zember 2005 bis Mai 2006 drei Patientinnen, bei denen er jeweils acht extrakorporal befruchtete Eizellen im Blastozystenstadium präimplantationsdiagnostisch untersuchte. An vier Eizellen stellte er gravierende genetische Defekte fest. „Nachdem er seine Patientinnen über das Untersuchungsergebnis informiert hatte, lehnten diese die Überführung der genetisch auffälligen Embryonen in die Gebärmutter ab. Diese seien daraufhin nicht weiter bebrütet worden, abgestorben und letztlich verworfen worden,“ schrieb das Landgericht Berlin. Ein Strafsenat des Berliner Kammergerichts bejahte am 9. Oktober 2008 den Tatverdacht gegen den Arzt. Nach dem Embryonenschutzgesetz (ESchG) sei das Verwenden eines Embryos verboten, und dazu gehöre auch seine Vernichtung: „Verwenden im Sinne der Vorschrift (§ 2 Abs. 1 ESchG) bedeutet weiter nichts, als mit dem Embryo etwas in einer Absicht tun, die nicht seiner Erhaltung dient. Demgemäß fällt unter anderem das zur Tötung des Embryos führende Wegschütten darunter“, heißt es in der Begründung. Eine große Strafkammer des Landgerichts Berlin entschied dagegen, dass der Arzt nicht gegen die Normen des Embryonenschutzgesetzes verstoßen habe: „Weder verbiete der Wortlaut des Gesetzes die Präimplantationsdiagnostik noch ergebe sich ein Verbot der Handlungen des Arztes aus dessen Auslegung. Aus den Gesetzesmaterialien gehe vielmehr klar hervor, dass der Gesetzgeber im Jahre 1991 ein Verbot der Zucht von Embryonen zu reinen Forschungszwecken beabsichtigte, nicht aber eine ,Selektion wegen erheblicher schwerster Schäden‘.“ Die Berliner Staatsanwaltschaft legte dagegen Revision beim BGH ein. Der Rechtsstreit zeigt, dass auch nach zehnjähriger Diskussion über diese Thematik ein Ende der Debatte nicht abzusehen ist. Zur Vorgeschichte: In Heft 9/2000 des Deutschen Ärzteblattes hatte die Bundesärztekammer (BÄK) einen „Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik“ vorgelegt. Damit beabsichtigte die BÄK, „einen Beitrag zur gesamtgesellschaftlichen Diskussion auf diesem so schwierigen und sensiblen Gebiet der Fortpflanzungsmedizin zu leisten“. Nach dem Richtlinienentwurf sollte die PID restriktiv eingesetzt werden – nur bei wenigen Paaren mit hohem genetischem Risikofaktor nach einem komplizierten Genehmigungsverfahren. Der damalige Chefredakteur des Deutschen Ärzteblattes, Norbert Jachertz, nahm bereits im selben Heft Stellung zu dieser Thematik: „Wenn mit PID die Grenze zur Selektion ungeborenen Lebens überschritten wird – und das wird sie, man mag noch so verhüllende Bezeichnungen wählen –, dann wird die Entwicklung von den wohlwollenden, wohlmeinenden Wissenschaftlern und Ärzten nicht mehr zu steuern sein.“ 10 DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG Die Politik beschäftigte sich inzwischen ebenfalls mit der Frage, ob die PID mit dem Embryonenschutzgesetz vereinbar sei und falls nicht, ob man sie dann in engen Grenzen zulassen solle. Die mehrheitliche Meinung war, dass in Deutschland aufgrund des Embryonenschutzgesetzes die PID unzulässig sei. Dennoch forderte die damalige Bundesgesundheitsministerin, Andrea Fischer, dass die PID in einem neuen Fortpflanzungsmedizingesetz explizit verboten werden sollte. Eine andere Auffassung vertrat Ministerialrat a. D. Dr. jur. Rudolf Neidert (Heft 51–52/2000). Er bedauerte, dass die intensive Kontroverse, „die sich vor allem im Deutschen Ärzteblatt niedergeschlagen hat, leider noch das Trennende stärker als das Verbindende zeigt“. Das Embryonenschutzgesetz gelte nur für die wenigsten Embryonen, die in vitro gezeugten nämlich – und für diese nur von der Befruchtung bis zur Nidation. „In derselben Entwicklungsphase genießen die natürlich gezeugten Embryonen keinerlei Lebensschutz, weshalb nidationshemmende Mittel straflos vertrieben und angewendet werden dürfen“, schrieb Neidert. Er hielt es deshalb für richtig, dass eine rechtliche Regelung dieser Diagnostik von einer engen genetischen Indikation ausgehen solle, so wie es der Wissenschaftliche Beirat der Bun- EMBRYONENSCHUTZGESETZ § 1 Missbräuchliche Anwendung von Fortpflanzungstechniken (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 1. auf eine Frau eine fremde unbefruchtete Eizelle überträgt, 2. es unternimmt, eine Eizelle zu einem anderen Zweck künstlich zu befruchten, als eine Schwangerschaft der Frau herbeizuführen, von der die Eizelle stammt, (. . .) § 2 Missbräuchliche Verwendung menschlicher Embryonen (1) Wer einen extrakorporal erzeugten oder einer Frau vor Abschluss seiner Einnistung in der Gebärmutter entnommenen menschlichen Embryo veräußert oder zu einem nicht seiner Erhaltung dienenden Zweck abgibt, erwirbt oder verwendet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft (. . .) 11 desärztekammer vorgeschlagen habe. Im Jahr 2002 legte die Enquetekommission des Bundestages „Recht und Ethik der modernen Medizin“ Empfehlungen vor, in denen sich eine Mehrheit der Kommissionsmitglieder dafür aussprach, „die PID in Deutschland nicht zuzulassen und das im ESchG enthaltene Verbot der In-vitro-Fertilisation zu diagnostischen Zwecken ausdrücklich im Hinblick auf die PID zu präzisieren“. Der Nationale Ethikrat plädierte ein Jahr später dagegen mehrheitlich für eine „eng begrenzte Zulassung der PID“. Gewebespender für ein Geschwisterkind Inzwischen geht es bei der PID nicht mehr nur darum, genetische Schäden festzustellen, sondern es gibt international auch mehrere Fälle, wo ein Kind nur deshalb in vitro gezeugt wurde, um als Gewebespender für ein Geschwisterkind zu dienen. Im März 2003 ist nach Angaben des Deutschen Referenzzentrums für Ethik in den Biowissenschaften in Großbritannien das erste Rettergeschwisterkind geboren worden. Es sollte seinem kranken Bruder das Leben retten, der dringend Blutstammzellen benötigte. Die Eltern hatten die PID damals noch in den USA vornehmen lassen, um rechtliche Probleme in ihrem Heimatland zu umzugehen. Inzwischen hat Großbritannien die Bestimmungen diesbezüglich gelockert. Auch in anderen Ländern ist die PID zur Auswahl von Rettergeschwistern zulässig. Im Dezember 2008 ist in Großbritannien nach Angaben des University College London erstmals ein Säugling zur Welt gekommen, der bereits kurz nach der Befruchtung auf ein krank machendes Brustkrebsgen untersucht wurde. Die Eltern hatten sich für eine künstliche Befruchtung und eine anschließende PID entschieden, nachdem in der Familie des Vaters in den vorherigen drei Generationen Brustkrebs aufgetreten war. Die Ärzte hatten elf Embryonen im Reagenzglas erzeugt. Drei Tage nach der Befruchtung untersuchten sie diese auf das Risikogen BRCA1. Sechs der Embryonen trugen das krank machende Brustkrebsgen und wurden „aussortiert“, zwei ohne das gefährliche Gen wurden in die Gebärmutter verpflanzt, von denen sich jedoch nur ein Embryo einnistete. Nicht nur in Spanien und Großbritannien, sondern auch in zahlreichen weiteren Ländern ist die Präimplantationsdiagnostik inzwischen weitgehend zulässig, was zu einem zunehmenden PID-Tourismus führte. Jährlich wählen mehrere Hundert europäische Paare mit Kinderwunsch für eine Präimplantationsdiagnostik den Weg in benachbarte Länder. Die Zielländer für ausländische Wunscheltern, die eine PID durchführen lassen möchten, sind vor allem Spanien (zehn Zentren) und Belgien (sechs Zentren), wie aus einer vor kurzem vorgelegten Expertise von Pro-Familia hervorgeht. Mögliche Änderung des Embryonenschutzgesetzes Reproduktionsmediziner halten dies für einen unhaltbaren Zustand ebenso wie die Tatsache, dass zurzeit Gerichte darüber entscheiden, in welchem Maß genetische Untersuchungen von Embryonen erlaubt sind: „Die Deutsche Gesellschaft für gynäkologische Endokrinologie und Fortpflanzungsmedizin begrüßt die Klarstellung der Rechtsverhältnisse. Gleichzeitig ist zu kritisieren, dass es dem Gesetzgeber bis zum heutigen Zeitpunkt nicht gelungen ist, in einem umfassenden Fortpflanzungsmedizingesetz die vielen offenen Fragen auf dem Gebiet der Fortpflanzungsmedizin zu regeln, so dass es jetzt Gerichtsverfahren und Selbstanzeigen obliegt, diesbezügliche Klarheit zu schaffen.“ Sollte sich das Berliner Landgerichtsurteil vor dem BGH durchsetzen, wird sich auch die Politik wieder mit dieser Thematik auseinandersetzen müssen. Und damit würde eine Änderung des bisher geltenden Embryonenschutzgesetzes vermutlich ▄ unausweichlich werden. Gisela Klinkhammer @ Ein Kommentar zu dieser Thematik unter www.aerzteblatt.de/blogs/ gratwanderung DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG Heft 8, 26. Februar 2010 INTERVIEW mit Hubert Hüppe, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen Berührungspunkte statt Berührungsangst Seit dem 1. Januar 2010 ist Hubert Hüppe der neue Bundesbehindertenbeauftragte. Was er sich für seine Amtszeit vorgenommen hat, erzählt er hier. Herr Hüppe, die letzten 18 Jahre waren Sie Bundestagsabgeordneter, davon acht Jahre Behindertenbeauftragter der CDU/CSU-Fraktion. In dieser Legislaturperiode gehören Sie zwar nicht mehr dem Bundestag an, sind jedoch zum Bundesbehindertenbeauftragten ernannt worden. Was bedeutet das Amt für Sie? Hüppe: Natürlich habe ich mich sehr über die Ernennung gefreut, denn sie gibt mir die Möglichkeit fortzusetzen, was ich in den Jahren als Behindertenbeauftragter der Fraktion begonnen habe. Dabei geht es nicht darum, dass Menschen mit Hubert Hüppe, CDU, ist verheiratet und hat drei Kinder, von denen der jüngste Sohn mit Spina bifida geboren wurde. Behinderungen jemanden benötigten, der für sie spricht. Sie sind gut organisiert und kennen ihre eigenen Belange selbst am besten. Durch die Anbindung an Regierung und Parlament sehe ich das Amt aber als Möglichkeit, den berechtigten Interessen politische und öffentliche Aufmerksamkeit zu geben. Ich mache mir natürlich Gedanken, ob ich der Verantwortung und den Erwartungen gerecht werden kann, die an meine Person geknüpft sind. Viele Behindertenverbände und Einzelpersonen haben es sehr unterstützt, dass ich diese Position erhalten konnte. Wie ich immer sage: Ich kann nicht über das Wasser gehen, aber ich werde mein Möglichstes tun. Welche Ziele haben Sie sich gesetzt? Hüppe: Ich will mehr gemeinsame Lebensräume für Menschen mit und ohne Behinderung schaffen: in der Schule, im Kindergarten, in der Arbeitswelt – also das, was der Begriff „Inklusion“ meint. Leider ist mein Einfluss auf landespolitische Zuständigkeiten wie beim Thema Schule gering. Aber seit in Deutschland die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen gilt, haben wir anerkannt, dass Teilhabe ein Menschenrecht ist. Dies werde ich anmahnen und auch von den Ländern einfordern. Meine Mitwirkung bei der Umsetzung der Konvention wird meine wichtigste Aufgabe sein. Dazu werde ich die Aufgabe des „Koordinierungsmechanismus“ übernehmen. Das bedeutet, dass ich bei der Umsetzung vor allem die Betroffenen beteilige, weil sie ihre Probleme am besten kennen und oft auch die Lösungen wissen. Gleichzeitig will ich auch andere gesellschaftliche Gruppen und die Länderbeauftragten einbeziehen. Die Bundesregierung wird für den Bund einen Aktionsplan erstellen. Wann ist mit dem Plan zu rechnen? Hüppe: Mit den Vorbereitungen wurde schon begonnen. Ich rechne damit, dass er Ende des Jahres erstellt ist. Ihre Vorgängerin im Amt, Karin EversMeyer, SPD, hatte ähnliche Arbeitsschwerpunkte. Werden Sie auch noch andere Prioritäten setzen? 12 DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG Hüppe: Anders als meine Vorgänger halte ich die bioethische Diskussion für sehr wichtig. Ich glaube, dass es gut ist, auch in diesem Amt darauf zu achten. Ein weiterer Schwerpunkt für mich ist der Bereich Gesundheit und Rehabilitation. Ich will versuchen, die Leistungen für Menschen mit Behinderung auf ihre Zuständigkeit hin zu durchforsten. Denn es gibt eine ganze Menge Ansprüche, die Menschen mit Behinderung laut Gesetz haben, die diese aber nicht erhalten, weil Kranken-, Pflege-, Rentenkassen und andere Träger die Verantwortung den jeweils anderen zuschieben. sogar wenn sie außerhalb des Mutterleibes lebensfähig wären. Für behinderte Kinder gibt es ja das Recht, die Regelschule zu besuchen. Hat sich das in Deutschland bereits durchgesetzt? Oder ist es für behinderte Schüler und deren Eltern immer noch sehr schwer, auf eine Regelschule zu gelangen? nen, wissen nicht, was sie machen sollen. Und weil sie das nicht wissen, gehen sie den Situationen – und damit den Menschen – oft aus dem Wege. Dabei verpassen wir alle etwas. Sie haben selbst einen behinderten Sohn. Haben Sie auch diese Probleme? Glauben Sie, dass die pränatale Diagnostik einen Einfluss auf das Bild der Behinderten in unserer Gesellschaft hat? Könnte es nach Ihrer Ansicht auch sein, dass das Embryonenschutzgesetz noch einmal auf den Prüfstand kommt, wenn es um das Thema Präimplantationsdiagnostik geht? Hüppe: Ja, aber ich will das nicht heraufbeschwören. Die CDU hat sich beim Bundesparteitagsbeschluss fast einmütig gegen die PID ausgesprochen, und ich hoffe, dass nicht ausgerechnet unter einer christlich-demokratisch geführten Regierung das Embryonenschutzgesetz angefasst wird. Das würde niemand verstehen. Thema Spätabtreibungen: Die Bedenkzeit wurde eingeführt. Können Sie sich damit zufriedengeben? Hüppe: Natürlich freue ich mich, dass jetzt mehr beraten wird. Man muss aber darauf achten, dass Behinderten- und Angehörigenverbände an der unabhängigen Beratung teilnehmen. Denn es ist für unsichere Eltern wichtig zu wissen, wie man mit einem behinderten Kind lebt. Enttäuscht war ich, dass die Statistikpflicht im Parlament abgelehnt wurde. Zufrieden kann ich nicht sein, solange in Deutschland ungeborene Kinder immer noch bis zur Geburt getötet werden dürfen, 13 „Ich will mehr gemeinsame Lebensräume für Menschen mit und ohne Behinderung schaffen – in der Schule, im Kindergarten, in der Arbeitswelt. “ Hüppe: Das Problem in Deutschland ist, dass Menschen mit Behinderungen, solange sie den für sie vorgesehenen Sonderweg gehen, kein Stein in den Weg gelegt wird. Falls sie aber Teilhabe wollen, wird es schwierig. Ich nenne ein Beispiel aus Westfalen: Wenn Sie dort Ihr behindertes Kind in einen heilpädagogischen Kindergarten geben, dann wird es zu Hause abgeholt und wieder heimgebracht, und Sie zahlen keinen Beitrag. Wenn dasselbe Kind aber in den integrierten Kindergarten geht, dann zahlen Sie den Kindergartenbeitrag, obwohl die erste Variante viel teurer ist. Das ist völlig gegen das, was die UN-Konvention will. Nämlich, dass Kinder mit und ohne Behinderungen von klein auf den Umgang miteinander lernen. Viele unbehinderte Menschen fühlen sich unsicher, wenn sie behinderten Menschen begeg- Hüppe: Wir waren die Ersten, die in unserer Stadt an der Grundschule eine Integrationsklasse mit gemeinsamem Unterricht durchgesetzt haben, und die Ersten, die ein behindertes Kind an der fortführenden Hauptschule hatten. Sie sagen „durchgesetzt“: Was war denn nötig, um den gemeinsamen Unterricht zu erreichen? Hüppe: Zuerst mussten wir einmal eine Schule finden, die bereit war, ein behindertes Kind aufzunehmen. Viele Schulen haben sich geweigert und fadenscheinige Gründe vorgebracht, warum es nicht geht. Letztendlich war es die städtische Schule, die dann zugestimmt hat. Welche Vorkehrungen sind nötig, um solche Kämpfe künftig zu vermeiden? Hüppe: Die Zahl behinderter Kinder im gemeinsamen Unterricht ist Fotos: Georg J. Lopata Hüppe: Ja, natürlich! Kinder mit Behinderungen gelten als „vermeidbar“, wenn sie geboren werden sogar juristisch als Schaden. DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG in den Bundesländern sehr unterschiedlich. Ich wünsche mir konkrete Zahlen und Termine. Jedes Bundesland soll sagen: „Wir haben jetzt zehn Prozent, aber wir wollen 20, 30 oder 40 Prozent der Kinder inklusiv unterrichten.“ Das ist der richtige Weg. Ein jetzt vorgelegtes Gutachten gibt grundsätzlich jedem Kind mit Behinderung einen Anspruch. Andere europäische Länder liegen bei 80 Prozent. die sich auf behinderte Personen einstellen, deswegen bestraft werden. Hier sind die Kassenärztlichen Vereinigungen gefordert, mit denen ich noch vor der Sommerpause darüber reden möchte. Zudem werde ich demnächst mit dem Gemeinsamen Bundesausschuss über Heilund Hilfsmittel für Menschen mit Behinderungen sprechen. Seit Juli letzten Jahres gibt es das Bundeskompetenzzentrum Barrierefreiheit. Können dort nicht Lösungsansätze gefunden werden? Weiß man auch, wie viele der behinderten Kinder durchschnittlich bereits jetzt auf Regelschulen gehen? Hüppe: Man schätzt 14 Prozent. Wir haben übrigens erstaunlicherweise zusätzlich eine Zunahme von Kindern in Förderschulen. Es ist auffällig, dass darunter immer mehr Kinder mit Migrationshintergrund sind. Da stellt sich die Frage, ob sie wirklich behindert oder vielleicht nur aus dem System rausgedrückt worden sind. Man muss aufpassen, dass man Kinder nicht als „behindert“ definiert, nur weil sie in der Schule sozial auffällig werden. Wir sollten in allen Bereichen, wie Berufsleben, Bildung, Kindergarten, schauen, was die Menschen können – und nicht nur danach, was sie nicht können. Wird es in der Situation der Wirtschaftskrise schwieriger, für behinderte Menschen einen Arbeitsplatz zu finden? Hüppe: Natürlich wird es dadurch nicht einfacher. Es gibt für Menschen mit Behinderung ganz viele verschiedene – zum Teil auch teure – Maßnahmen, Programme und Einrichtungen. So viele, dass auch der Sachbearbeiter beim Jobcenter kaum durchblickt. Auch hier wünsche ich mir einfachere Wege. Dazu gehört ein Budget für Arbeit für Menschen, für die heute ausschließlich eine Werkstatt für behinderte Menschen infrage käme. Ich bin sicher, dass es uns damit gelingt, mehr Menschen mit Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu vermitteln. Ich könnte mir auch eine Art Kombilohn für schwerbehinderte Menschen vorstellen. Man braucht manchmal nur mehr Fantasie. Vor allem gilt: Schaut, was die „Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention wird im Mittelpunkt meines neuen Amtes stehen. “ Menschen können, und nicht, was sie nicht können. In der UN-Konvention heißt es, dass behinderte Menschen die medizinische Versorgung erhalten sollten, die sie aufgrund ihrer Behinderung benötigen. Der letzte Deutsche Ärztetag hat festgestellt, dass das leider nicht immer der Fall ist. Wie wollen Sie das ändern? Hüppe: In Australien ist das DRGSystem entwickelt worden; dort hat man aber Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu einem gewissen Prozentsatz von der Berechnung ausgenommen. Die Deutschen sind hingegen immer besonders konsequent und meinen, mit Fallpauschalen alles abdecken zu müssen. Wenn dann Menschen tatsächlich besondere Bedürfnisse haben, die einen entsprechenden Einsatz erfordern, sehen sich manche Krankenhäuser nicht in der Lage, das leisten zu können. Deshalb müssen wir fragen: „Kann das DRG-System tatsächlich für alle gelten?“ Das zweite Problem ist der ambulante Bereich. Da hoffe ich auf die Unterstützung der Kassenärztlichen Vereinigungen. Denn bislang kann man ja gar keinem niedergelassenen Arzt guten Gewissens empfehlen, mit Barrierefreiheit zu werben. Denn dann riskiert er sein Budget. Es darf nicht sein, dass diejenigen, Hüppe: Wenn wir für alle gesellschaftliche Teilhabe wollen, ist Barrierefreiheit nicht nur im Gesundheitsbereich eine ganz wichtige Voraussetzung. Beim Stichwort „Barrierefreiheit“ denken die meisten Menschen nur an Rollstuhlfahrer. Aber es geht um viel mehr: beispielsweise die einfache Sprache für sogenannte geistig behinderte Menschen oder um blinde oder gehörlose Menschen, auch um kleinwüchsige Menschen. Barrierefreiheit, auch für ältere Menschen, wird immer wichtiger. Das Kompetenzzentrum ist dabei ein wichtiger Partner, vor allem weil dort die Betroffenen mitarbeiten. Wo sind die Hauptprobleme für behinderte Menschen? Hüppe: Neben den Barrieren – auch denen im Kopf – die Arbeitslosigkeit, der Antrags- und Zuständigkeitswirrwarr und oft das Gefühl, als „Behinderter“ und nicht als Mensch gesehen zu werden. Wie wird das persönliche Budget in Anspruch genommen? Hüppe: Obwohl es seit zwei Jahren darauf einen Rechtsanspruch gibt, leider viel zu selten. Bei der Pflegeversicherung dagegen wird die Geldleistung viel häufiger in Anspruch genommen als die Sachleistung. Bei der Hilfe für behinderte Menschen ist es genau anders herum. Neben den Vorbehalten der Betroffenen und der Leistungsträger und dem geringen Bekanntheitsgrad scheint vor allem der Bürokratieaufwand abschreckend zu wirken. ▄ Das Interview führten Gisela Klinkhammer und Dr. med. Eva Richter-Kuhlmann. 14 Foto: epd DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG Heft 10, 12. März 2010 EMBRYONENFORSCHUNG Über den Umgang mit menschlichem Leben In Deutschland und Großbritannien wird die Zulassung der Forschung an humanen embryonalen Stammzellen unterschiedlich geregelt. Vor allem bezogen auf den Menschenwürde-Begriff ergeben sich tiefgreifende Unterschiede. Sibylle Rolf ur Frage nach der ethischen Zulässigkeit der Forschung an Embryonen zum Zweck der Gewinnung von humanen embryonalen Stammzellen (hES-Zellen) ist in den vergangenen Jahren viel veröffentlicht worden (1–3). In Europa wird diese Frage unterschiedlich gehandhabt, was sich an der Gesetzgebung in Großbritannien und Deutschland exemplarisch zeigen lässt (4): Während auch nach der Novellierung des Stammzellgesetzes (StZG) im Jahr 2008 die deutsche Gesetzgebung nur einen Import von hES-Zelllinien erlaubt, die vor dem 1. Mai 2007 im Ausland erzeugt worden sind, gestattet das britische Human Fertilisation and Embryology Act (HFE Act 1990/2008) die Erzeugung von menschlichen Embryonen zu Forschungszwecken sowohl durch Invitro-Fertilisation (IVF) als auch durch Zellkerntransfer, also durch Klonierung und die Bildung von zytoplasmischen Hybriden (5), wie es im April 2008 von einer Forschergruppe in Newcastle erstmals durchgeführt worden ist (6). Bezogen auf den Begriff der Menschenwürde ergeben sich bereits auf den ersten Blick tiefgreifende Unterschiede in britischer und deutscher Gesetzgebung: Das deutsche Stammzellgesetz (StZG, 2002/ 2008) verbietet unter ausdrücklicher Berufung auf den im Grundge- Z 15 setz (GG) festgeschriebenen Menschenwürde-Begriff (Art. 1 Abs. 1 GG) eine Forschung an menschlichen Embryonen, während im britischen HFE Act der Menschenwürde-Begriff (human dignity) nicht rezipiert wird. Dieser unterschiedlichen legislativen Entscheidung ist ein Diskussionsprozess vorausgegangen, der durchaus vergleichbar gewesen ist: Die Regierungen beider Länder waren der Forschung gegenüber aufgeschlossen, die sich nach der weltweit ersten erfolgreichen IVF in England (1978) eröffnet hatte. Parlamentarier in beiden Ländern waren demgegenüber tendenziell gegen eine Forschung an menschlichen Embryonen. Dabei ist während der ethischen Diskussionen im Vorfeld der Gesetzgebung vor allem mit dem Argument operiert worden, eine Forschung an menschlichen Wesen oder auch „ungeborenen Kindern“ (unborn children) sei moralisch nicht akzeptabel. Beginn des Menschseins Zumindest implizit, häufig aber auch explizit ist damit auf den Menschenwürde-Begriff als eine normative Größe rekurriert worden, der als solche eine Forschung an Menschen verbiete, weil diese gegen den im Menschsein liegenden unbedingten Anspruch verstoße. In der britischen Debatte hat sich die Stimmung zugunsten der For- schung vor allem aufgrund von zwei Faktoren gewendet (8): zum einen aufgrund der Hoffnung, die Forschung an menschlichen Embryonen könne langfristig zur Entwicklung von Therapien gegen degenerative Erkrankungen führen sowie dazu beitragen, Schwangerschaft und Geburt besser verstehen und kontrollieren zu können. Zum anderen hat sich die Debattenlage durch den im Laufe der 1980er Jahre aufgekommenen Begriff „preembryo“ zugunsten der Forschung an Embryonen gewendet. „Pre-embryo“ bezeichnete ein embryonales Wesen, das sich vor dem 14. Tag nach der Kernverschmelzung noch in Zwillinge teilen kann und dessen zentrales Nervensystem noch nicht anfänglich ausgebildet ist. (9). Wegen der begrifflichen Abgrenzung von „Prä-Embryonen“ und „Embryonen“ konnte sich in der britischen Gesetzgebung eine Erlaubnis der Forschung an menschlichen Embryonen unter Aufsicht und Regulierung und mit der Auflage durchsetzen, dass Embryonen, an denen geforscht worden ist, nicht über den 14. Tag hinaus am Leben erhalten und keinesfalls implantiert werden sollten. Die deutsche Gesetzgebung hat demgegenüber mit dem Begriff „Menschenwürde“ andere Akzente gesetzt, auch wenn die Applikation des Begriffs auf Embryonen in den DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG und dann erst die ethischen Konsequenzen aus diesem Verständnis, die allgemein als Bestimmung des „Status des Embryo“ verstanden und zusammengefasst werden (10). Leidvermeidung. Wenn das Grundsatzaxiom des Utilitarismus das größtmögliche Glück für die größtmögliche Anzahl von Menschen ist, so ist zur Erreichung dieses Ziels eine relativ breite Auswahl von Mitteln möglich. Die Forschung an, wie zunächst auch in britischen Empfehlungen vertreten, „überzähligen“ Embryonen nach IVF kann in diesem Zusammenhang dabei helfen, die Abläufe in der Schwangerschaft besser zu verstehen und Risiken in Schwangerschaft und embryonaler Entwicklung besser einschätzen und therapieren zu können. Die Erzeugung von hESZellen lässt langfristig auf eine Therapie von degenerativen Krankheiten hoffen. Klassischer Utilitarismus Ein wesentlicher Grund für den unterschiedlichen ethischen und rechtlichen Umgang mit der Forschung an hES-Zellen in Großbritannien und Deutschland liegt in der unterschiedlichen ideengeschichtlichen Prägung beider Länder: In Großbritannien sind in weit stärkerem Maß der klassische Utilitarismus (11) und seine gegenwärtigen Ausprägungen (3, 12) ausschlaggebend als in der deutschen Debatte, die sich als deutlich stärker von der Tradition der Aufklärung geprägt erweist. Mit dem klassischen Utilitarismus kompatibel ist sowohl die Struktur des Abwägens unterschiedlicher Güter mit dem Ziel der Glücksmaximierung für eine möglichst große Anzahl von Menschen als auch die grundsätzliche Orientierung medizinischer Forschung am Ziel der Therapiegewinnung zur Leidminderung oder Tradition der Aufklärung Aus biologischer Sicht ist der menschliche Embryo, sobald mit der Verschmelzung der Vorkerne ein neues Genom entstanden ist, ein menschliches Wesen. In ethischer Hinsicht ist diese Tatsache interpretationsbedürftig. Foto: dpa ersten Lebenstagen nicht unumstritten und schon gar nicht eindeutig ist. Schon allein der Rekurs auf „Menschenwürde“ im ersten Artikel des StZG auch nach seiner Novellierung verdeutlicht, dass eine Applikation von „Menschenwürde“ auch auf frühe menschliche Embryonen als möglich erschien. An dieser sprachlichen Differenzierung wird deutlich, wie in moralischer Hinsicht uneindeutige biologische Fakten in der ethischen Urteilsbildung unterschiedlich gedeutet werden. Aus biologischer Sicht ist der menschliche Embryo, sobald mit der Verschmelzung der Vorkerne ein neues Genom entstanden ist, ein menschliches Wesen, das sich kontinuierlich bis hin zur Geburt und weiter entwickelt. Nun ist diese Tatsache in ethischer Hinsicht interpretationsbedürftig, weil sie noch keine normativen Aussagen zum Umgang mit Embryonen macht. Für solche Zusatzannahmen werden meist drei unterschiedliche Positionen differenziert (2): zum einen die Position, menschliches Leben sei wesentlich bewusstes und personales Leben und verdiene als solches auch rechtlichen Schutz – wenn nämlich bestimmte Kriterien wie Vernunftgebrauch und Bewusstsein erfüllt sind, die am Beginn (und am Ende) des menschlichen Lebens nicht erfüllt sein können. Eine entgegengesetzte Position geht davon aus, dass menschliches Leben mit der Entstehung eines neuen Genoms beginnt, dass also die genetische Identität eines menschlichen Embryos ausreicht, um dessen absolute Schutzwürdigkeit zu begründen und zu gewährleisten. Eine Position, die in der Mitte steht, beurteilt die Entwicklung des menschlichen Lebens als einen allmählichen, graduellen Prozess, in dem es vor allem eine qualitative statusverändernde Zäsur gibt, die meist mit der Nidation bestimmt wird. Die Frage, um die es in dieser Debatte letzten Endes geht, ist darum die Frage nach dem Beginn und dem Ende des Menschseins. Damit steht nicht nur der Umgang mit menschlichem Leben infrage, sondern das grundlegende Verständnis menschlichen Lebens überhaupt – Um der medizinisch hochrangigen Ziele willen wird darum eine fremdnützige Forschung an Embryonen als ethisch zulässig angesehen, auch wenn diesen von Beginn der Debatte an ein „special status“ zugebilligt worden ist (9). Weil darüber hinaus, wie der Sprachgebrauch innerhalb der Debatte gezeigt hat, Embryonen in den ersten 14 Tagen als „Prä-Embryonen“ bezeichnet werden können, spricht kein ernst zu nehmendes ethisches Argument gegen ihre Verwendung in der medizinischen Forschung mit dem Therapiepotenzial zugunsten vieler Patienten. Ein dem Menschsein selbst inhärenter unbedingter Achtungsanspruch, der etwa mit „Menschenwürde“ expliziert wird, widerspricht dieser Argumentationsstruktur zwar nicht grundsätzlich, wird von ihr aber auch nicht impliziert. „Menschenwürde“ als ein mit dem „Menschsein“ koextensiver Begriff hat sich in der Debatte um das HFE Act nicht durchgesetzt und wird gegenwärtig anders als im deutschen Kontext meist als empirische Kategorie im Sinne einer aktiv gebrauchten Autonomie oder eines aktuell vorliegenden Gebrauchs von Vernunft verstanden (13) – oder als nichtsinnvoller Begriff gekennzeichnet (14). In diesem Verständnis kann er auf menschliche Embryonen in einem frühen Stadium nicht angewandt werden, was erklärt, dass der Be- 16 griff „dignity“ im Sinne eines „würdigen“ oder „würdevollen“ Verhaltens weitaus häufiger im Zusammenhang mit einem „Sterben in Würde“ (dying with dignity) verwendet wird (15). Dabei bezeichnet er aber keine menschliche Wesenseigenschaft, die absolut ist und unabwägbaren Schutz einfordert. In der deutschen sind gegenüber der englischen Ideengeschichte in einem weit ausgeprägteren Maß Paradigmen der Aufklärungsphilosophie wirksam. Der Philosophie Immanuel Kants folgend kann von einer Würde auch von Ungeborenen in einem frühen Stadium ausgegangen werden, weil auch diese an der von Kant als transzendentale Idee verstandenen „Menschheit“ partizipieren. Nach Kant ist die vernünftige Menschheit diejenige Instanz, die moralisches Handeln ermöglicht, weil aufgrund der Vernunft und der von der Vernunft ermöglichten Autonomie als der vernünftigen Selbstgesetzgebung moralisches, also ethisch vorzugswürdiges Handeln überhaupt entstehen kann (16). Kant geht so weit, diese Vernunftbegabung auf jeden Menschen zu applizieren (17). Er nimmt damit anders als der klassische und der gegenwärtige Utilitarismus die Voraussetzung eines transzendenta- Foto: Picture Alliance DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG Der Philosophie Kants folgend kann von einer Würde auch von Ungeborenen in einem frühen Stadium ausgegangen werden. nicht gegen an sich wertvolle Ziele wie hochrangige medizinische Forschung zur Entwicklung von Therapien gegen degenerative Erkrankungen abgewogen werden darf. Wie „Menschenwürde“ inhaltlich zu bestimmen ist, ist von der deutschen Gesetzgebung offengelassen worden. Das immer wieder zitierte Diktum von Theodor Heuss, Menschenwürde sei eine „nichtinterpretierte These“, würdigt diese Offenheit und lässt eine Bandbreite an Interpretationen zu. „Menschenwürde“ kann im kantischen oder christlichen Sinn als „Mitgift“, im empiristischen als „Leistung“ oder systemtheoretisch als Ergebnis von gelingender Kommunikation ver- In der deutschen Gesetzgebung hat sich seit 1945 die Achtung der Menschenwürde etabliert. len, nichtempirischen Interpretationsrahmens an, nach dem nicht nur aktuell vernünftige oder empfindsame menschliche Wesen als menschliche Wesen zu verstehen und zu würdigen sind, sondern jedes menschliche Wesen, weil es an der vernunftbegabten und damit moralfähigen menschlichen Vernunftnatur partizipiert. In der deutschen Gesetzgebung hat sich seit 1945 die Achtung der Menschenwürde etabliert, die auch die wesentliche Begründungsfigur für das Verbot der Erzeugung von hES-Zellen unter Verbrauch von menschlichen Embryonen bildet. Mit der Menschenwürde ist eine absolute Kategorie in die Gesetzgebung aufgenommen worden, die 17 standen werden (18). An der Bandbreite von Verständnismöglichkeiten wird deutlich, dass das Verständnis von Menschenwürde elementar damit zu tun hat, wie Menschsein im Allgemeinen interpretiert wird, wenn „Menschenwürde“ den unbedingten Achtungsanspruch bezeichnet, der dem Menschsein eignet. Biologische Fakten sind ethisch interpretationsbedürftig. Auch wenn aus biologischer Sicht menschliches Leben mit der Entstehung des Genoms beginnt und sich kontinuierlich entwickelt, hat eine ethische Stellungnahme zum Umgang mit menschlichem Leben durch Zusatzannahmen die moralischen Implikationen der naturwissenschaftlich feststell- und erforschbaren Gegebenheiten zu klären (19). Diese Zusatzannahmen haben im Zusammenhang mit der fremdnützigen Forschung an menschlichen Embryonen den Charakter von anthropologischen Positionen (20). Dabei steht etwa infrage, ob Menschsein eine Realität bezeichnet, die als solche zu würdigen, also festzustellen ist, oder ob Menschsein eine Eigenschaft ist, die Menschen anderen Menschen zuerkennen, die sich etwa in Beziehung und Kommunikation oder mit der Ausbildung neuronaler Strukturen entwickelt und nicht „von Anfang an“ da ist beziehungsweise von Voraussetzungen wie der Umgebung abhängt (21). Für die britische Gesetzgebung gibt es in der Entwicklung von menschlichen Embryonen einen Zeitraum, in dem diese noch nicht menschlich sind. Auch wenn eine ähnliche Position in der deutschen Debatte immer wieder vertreten wird, ist sie von der gegenwärtigen Gesetzgebung im StZG nicht rezipiert worden. Hinter die grundlegende Differenz in dieser Debatte, die sich letzten Endes als ein Streit um Menschenbilder zeigt, kann nicht zurückgegangen werden. Sie kann aber so transparent wie möglich gemacht werden. Was menschliches Leben ist, ist eine vorausgesetzte und weltanschaulich geprägte Aussage und Position, die jeder an der Debatte Beteiligte für sich selbst zu klären hat (22). Sprachliche Transparenz und die differenzierte Darstellung von anthropologischen Implikationen einer Position sollten selbstverständlich sein. Bis es dabei zu einem tragfähigen gesellschaftlichen Kompromiss kommt, ist die Haltung der Vorsicht, wie sie vor allem in tutioristischen Positionen gepflegt wird, angemessen (23). ❚ Zitierweise dieses Beitrags: Dtsch Arztebl 2010; 107(10): A 438–40 Anschrift der Verfasserin PD Dr. theol. Sibylle Rolf Universität Heidelberg Wissenschaftlich-Theologisches Seminar Systematische Theologie/Ethik Kisselgasse 1, 69117 Heidelberg E-Mail: [email protected] @ Literatur im Internet: www.aerzteblatt.de/lit1010 DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG Heft 10, 12. März 2010 LITERATURVERZEICHNIS HEFT 10/2010, ZU: EMBRYONENFORSCHUNG Über den Umgang mit menschlichem Leben In Deutschland und Großbritannien wird die Zulassung der Forschung an humanen embryonalen Stammzellen unterschiedlich geregelt. Vor allem bezogen auf den Menschenwürdebegriff ergeben sich tiefgreifende Unterschiede. Sibylle Rolf LITERATUR 1. Dabrock P, Klinnert L, Schardien S: Menschenwürde und Lebensschutz. Herausforderungen theologischer Bioethik, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2004, 173–210. 2. Rolf S: Zwischen Forschungsfreiheit und Menschenwürde. Unterschiede beim Umgang mit menschlichen Embryonen in England und Deutschland, Frankfurt/Main: Hansisches Drucks- und Verlagshaus 2009. 3. Harris J: The Ethical Use of Human Embyonic Stem Cells in Research and Therapy, in: Burley J, Harris J (eds.), A Companion to Genethics, Oxford: Wiley Blackwell 2002, 158–74. 4. Schütze H: Embryonale Humanstammzellen. Eine rechtsvergleichende Untersuchung der deutschen, britischen, französischen und US-amerikanischen Rechtslage, Berlin, Heidelberg, New York: Springer 2007. 5. Human Fertilisation and Embryology Act, 1990, 6. British parliament backs hybrid embryosNature News 453, 441 (20 May 2008). 7. Richardt N: A Comparative Analysis of the Embryological Research Debate in Great Britain and Germany, Social Politics: International Studies in Gender, State and Society 10.1 (2003) 86–128. 8. Mulkay M: The embryo research debate. Science and the politics of reproduction, Cambridge: Cambridge University Press 1997. 9. Report of the committee of inquiry into human fertilisation and embryology by Command of Her Majesty, London 1984. 10. Maio G (ed.): Der Status des extrakorporalen Embryo. Perspektiven eines interdisziplinären Zugangs, Stuttgart: frommannholzboog Verlag 2007. 11. Mill J S, Bentham J: Utilitarianism and other Essays, hg. von A. Ryan, Harmondsworth/Middlesex, Penguin Classics 1987. 12. Singer P: Rethinking Life and Death. The Collapse of Our Traditional Ethics, Oxford: St Martin’s Griffin 1995. 13. Deech R, Smajdor A: From IVF to immortality. Controversy in the era of reproductive technology, Oxford: Oxford University Press 2007, 108–9. 14. Macklin R: Dignity is a useless concept, British Medical Journal 2003, 327, 1419–20. 15. So auf verschiedenen Websites, die sich für die Legalisierung von assistiertem Suizid aussprechen, etwa http://www.dignity indying.org.uk/. 16. Kant I: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, hg. und kommentiert von C. Horn, C. Mieth und N. Scarano, Frankfurt/Main: Suhrkamp 2007. 17. Kant I: Metaphysik der Sitten, 1797, Rechtslehre § 28, B 112f. 18. Rolf S: Menschenwürde – Grund oder Spitze der Menschenrechte?, in: Brunn F M, Dietz A, Polke C et alii (eds.), Menschenbild und Theologie. Beiträge zum interdisziplinären Gespräch, Festgabe für Wilfried Härle, MThS 100, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2007, 141–60. 19. A theologian’s brief on the place of the human embryo within the christian tradition, and the theological principles for evaluating its moral status: submitted to the House of Lords select committee on stem cell research by an ad hoc group of christian theologians from the anglican, catholic, orthodox and reformed traditions, in: Waters B, Cole-Turner R (eds.): God and the embryo. Religious voices on stem cells and cloning, Washington DC: Georgetown University Press 2003, 190–203. 20. Düwell M: Bioethik. Methoden, Theorien und Bereiche, Stuttgart: J. B. Metzler 2008, 130–41. 21. Starre Fronten überwinden. Eine Stellungnahme evangelischer Ethiker zur Debatte um die Embryonenforschung, in: Anselm R, Körtner U H J (eds.): Streitfall Biomedizin. Urteilsfindung in christlicher Verantwortung, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2003, 197–208. 22. Härle W: Die weltanschaulichen Voraussetzungen jeder normativen Ethik, in: Härle: Christlicher Glaube in unserer Lebenswelt. Studien zur Ekklesiologie und Ethik, Leipzig 2007: Evangelische Verlagsanstalt, 210–37. 23. Damschen G, Schönecker D (eds.): Der moralische Status menschlicher Embryonen. Pro und contra Spezies-, Kontinuums-, Identitäts- und Potentialitätsargument, Berlin/New York: de Gruyter 2003, 187–267. 18 DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG Heft 28–29, 19. Juli 2010 BUNDESGERICHTSHOF ZUR PRÄIMPLANTATIONSDIAGNOSTIK Druck auf die Politik Gisela Klinkhammer ei Paaren mit einer Veranlagung zu schweren Erbschäden dürfen Ärzte künftig im Reagenzglas befruchtete Eizellen auf Genschäden untersuchen und nur die gesunden Zellen für eine künstliche Befruchtung auswählen. Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) erlaubte damit die Präimplantationsdiagnostik (PID) an pluripotenten Zellen. Er begründete seine Entscheidung damit, dass sie die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche schwerst behinderter Kinder vermindern könnte. Das ist nachvollziehbar, denn wenn eine Behinderung festgestellt wird, sind Abtreibungen auch noch nach der zwölften Schwangerschaftswoche möglich. Der Angeklagte, ein Berliner Frauenarzt, war vom Vorwurf einer dreifachen strafbaren Verletzung des Embryonenschutzgesetzes freigesprochen worden. Der Arzt hatte bei drei Patientinnen jeweils acht extrakorporal befruchtete Eizellen im Blastozystenstadium untersucht. An vier Eizellen hatte er gravierende genetische Defekte festgestellt, weshalb diese „nicht weiter bebrütet, abgestorben und letztlich verworfen wurden“, wie es das Landgericht Berlin formulierte. Ein Strafsenat des Berliner Kammergerichts hatte einen Verstoß gegen das Embryonenschutzgesetz bei dem Arzt, der sich selbst angezeigt hatte, zunächst bejaht. Eine große Strafkammer des Berliner Landgerichts hatte dann entschieden, dass er nicht gegen die Normen des Embryonenschutzgesetzes verstoßen habe. Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte dagegen Revision beim BGH eingelegt, der das Urteil jetzt aber bestätigte. Der Gynäkologe hat somit die rechtliche Klärung eines Themas erzwungen, das seit Jahren kontrovers diskutiert wird. Wiederholt beschäftigte sich, ausgehend vom „Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik“ der Bundesärztekammer (DÄ, Heft 9/2000), vor allem auch das Deutsche Ärzteblatt mit dieser Thematik. Dabei ging es vorwiegend um die Frage, ob die PID mit dem Embryonenschutzgesetz vereinbar sei und falls nicht, ob man sie in engen Grenzen zulassen sollte. Zahlreiche Politiker hielten die PID B 19 für unvereinbar mit dem Embryonenschutzgesetz. Und das aus guten Gründen. Denn nach dem Embryonenschutzgesetz ist das Verwenden eines Embryos verboten. Und darunter fällt dann ja wohl ebenfalls die Selektion und anschließende Tötung des Embryos durch Wegschütten. So sah es jedenfalls das Berliner Kammergericht. Außerdem ist davon auszugehen, dass mit dem Urteil der Rechtfertigungsdruck auf Menschen mit Behinderung und deren Eltern weiter wachsen könnte. Doch der BGH kam offenbar zu einer anderen Einschätzung und veranlasst damit jetzt auch die Politik, sich wieder mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Kritiker der Methode befürchten allerdings, dass die PID irgendwann nicht mehr nur bei Paaren mit genetischen Defekten angewendet wird. Tatsächlich gibt es international bereits einige Fälle, wo ein Kind nur deshalb in vitro gezeugt wurde, um als Gewebespender für ein Geschwisterkind zu dienen. Solchen Praktiken erteilte der BGH glücklicherweise eine eindeutige Absage. Er betonte, dass Gegenstand seiner Entscheidung lediglich die Untersuchung von Zellen auf schwerwiegende genetische Defekte sei. „Einer unbegrenzten Selektion von Embryonen anhand genetischer Merkmale wäre damit nicht der Weg geöffnet.“ Letztendlich ist eine Klarstellung durch den Gesetzgeber zu wünschen. Gisela Klinkhammer Chefin vom Dienst (Text) DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG Heft 38, 24. September 2010 ÜBERSICHTSARBEIT Perinatale Probleme von Mehrlingen Joachim W. Dudenhausen, Rolf F. Maier ZUSAMMENFASSUNG Hintergrund: Das veränderte Gebäralter und die Erfolge der Reproduktionsmedizin haben zu einem Anstieg der Mehrlingsrate in der industrialisierten Welt geführt. Methoden: selektive Literaturrecherche Ergebnisse: Die Risiken der Frühgeburtlichkeit, der intrauterinen Wachstumsrestriktion und des vorgeburtlichen Todes erhöhen sich bei diesen Schwangerschaften; mütterliche Risiken wie Präeklampsie, Gestationsdiabetes und Blutungen sind deutlicher. Von den Überwachungsverfahren in der Schwangerschaft ist die pränatale inklusive der genetischen Diagnostik wichtig, vor allem die Ultraschalldiagnostik zur Erkennung des fetofetalen Transfusionssyndroms und der Zygotie. Schlussfolgerungen: Bei der Betreuung der Mehrlingsschwangeren ist die Zusammenarbeit von Pränatalmediziner, Geburtsmediziner und Neonatologen gefordert. Dabei ist die Kooperation zwischen ambulanter und stationärer Patientenversorgung besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Zitierweise: Dtsch Arztebl Int 2010; 107(38): 663–8 DOI: 10.3238/arztebl.2010.0663 Klinik für Geburtsmedizin, Charité – Universitätsmedizin Berlin: Prof. Dr. med. Dudenhausen Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Universitätsklinik Magdeburg: Prof. Dr. med. Maier ie Zahl der Mehrlingsschwangerschaften ist durch Fortschritte in der Reproduktionsmedizin stetig größer geworden. Dies hat zur Folge, dass die geburtshilfliche Betreuung der Mehrlingsschwangeren sowie die neonatale Versorgung der Mehrlinge besonders intensiv und anspruchsvoll sind. Gefordert sind Pränatalmediziner, Geburtsmediziner und Neonatologen sowohl in der Klinik als auch in der niedergelassenen Praxis. Für die kompetente Zusammenarbeit an diesen Schnittstellen werden aufgrund der wissenschaftlichen und klinischen Erkenntnisse sowie einer selektiven Literaturrecherche unter Berücksichtigung älterer nationaler (1) und internationaler (2) Leitlinien Kernaussagen zusammengestellt. D Häufigkeit Die Häufigkeit von Mehrlingen unterliegt großen Schwankungen auf der Welt. Die bereits im Jahr 1895 von Hellin aufgestellte Regel hat im Wesentlichen auch heute noch Gültigkeit, um die Häufigkeit von Mehrlingen abschätzen zu können: Beträgt die Häufigkeit von Zwillingen 1 : 85, so ist sie für Drillinge 1 : 85 × 85 und für Vierlinge 1 : 85 × 85 × 85. In der Frühschwangerschaft ist die Zahl wesentlich höher, Boklage beobachtete den Verlauf von 325 Zwillingsschwangerschaften, 19 % dieser Schwangerschaften endeten am Termin als Zwillinge, 39 % als Einlinge, 43 % ohne ein lebendes Kind. Er errechnete als wahrscheinliche Konzeptionsrate an Zwillingen 1 : 8 (3). In den meisten europäischen Ländern ist die Zwillingsrate in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts von etwa 12 auf etwa 9,5 pro 1 000 Schwangerschaften gesunken, um ab den frühen 80er-Jahren wieder anzusteigen auf etwa 12 und um etwa 1990 auf 13 bis 14 pro 1 000 Schwangerschaften. Während der Verlauf in den 60er- und 70er-Jahren im Wesentlichen durch die Veränderung der Altersstruktur der Schwangeren verursacht wurde (zuerst eine Zunahme der jüngeren Schwangeren, später eine Zunahme der über 35-jährigen Schwangeren), wird der Anstieg ab 1990 als Folge reproduktionsmedizinischer Bemühungen gesehen (4). Ovulationsinduktion und IVF (In-vitro-Fertilisation) werden hauptsächlich als Ursache dieser Steigerung angesprochen. Für die Häufigkeit von dizygoten Zwillingen ist das Vorkommen von Mehrlingen in der Familie der Mutter wesentlich wichtiger als das in der Familie des Vaters. Frauen, die selbst als dizygote Zwillinge auf die Welt kamen, entbanden etwa in 2 Prozent der 20 DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG Grundlagen der Zygotiebestimmung TABELLE Durchschnittliche Schwangerschaftsdauer bei Mehrlingen Art der Schwangerschaft Wochen Einlinge 39 Zwillinge 36 Drillinge 32 Viellinge 30 Fälle auch Zwillinge. Dagegen lag die Häufigkeit von Zwillingen bei Frauen, deren Ehemänner dizygote Zwillinge waren, etwa nur bei 1 Prozent (e1). Schwangerschaftsdauer Die durchschnittliche Schwangerschaftsdauer ist bei Mehrlingsschwangerschaften deutlich kürzer (Tabelle) (e2). Im Jahre 1987 lag die Frühgeburtenrate bei Zwillingen (< 37+0 SSW) in den USA bei 44,5 Prozent gegenüber 9,4 Prozent bei Einlingen (5). Als Ursachen der verminderten Schwangerschaftsdauer wurden die mechanische Belastung der Zervix, die relativ zum Gewicht von Fet und Plazenta verminderte Uterusdurchblutung und die relativ verminderte Plazentafunktion gesehen. Außerdem scheinen die Ausreifung der „Gap-Junctions“ aufgrund der hohen Östrogenaktivität und Prostaglandinsynthese sowie die relative Abnahme der Progesteronaktivität bei der Mehrlingsschwangerschaft bedeutungsvoll für die verkürzte Schwangerschaftsdauer zu sein. Ultraschalldiagnostik Die perinatale Mortalität ist durch die gestiegene Entdeckungsrate der Mehrlinge in der Schwangerschaft abgefallen. Die nach den Mutterschaftsrichtlinien durchgeführten Ultraschalluntersuchungen bei allen Schwangeren haben in der Bundesrepublik Deutschland zu einer nahezu vollständigen pränatalen Diagnostik von Mehrlingen geführt. Die frühzeitige Diagnostik in der Schwangerschaft ist sowohl für das Management der Schwangerschaft, für die Überwachung von Mutter und Kindern sowie das intrapartale Vorgehen und die Vorbereitung der Eltern wichtig. Die Diagnose der Mehrlingsschwangerschaft, die Festlegung des Schwangerschaftsalters und die Überwachung des fetalen Wachstums sind entsprechend den Normkurven möglich. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass sich die fetalen Wachstumskurven von Kopfdurchmesser und Femurlänge bei Einlingen und Zwillingen statistisch nicht unterscheiden (e3, e4). Eine differenzierte Fehlbildungsuntersuchung ist indiziert. Darüber hinaus sind als mehrlingsspezifische Untersuchungen die Bestimmung der Zygotie und der Plazentation wichtig. 21 Monozygote Zwillinge Monozygote Zwillinge entstehen aus der Teilung eines Embryos. Man rechnet mit etwa vier monozygoten Zwillingen auf 1 000 Geburten. Die embryofetale Mortalität ist bei monozygoten Zwillingen höher als bei dizygoten Zwillingen und Einlingen. Die Rate größerer Fehlbildungen wird bei monozygoten Zwillingen mit 2,3 % gegenüber 1 % bei Einlingen und die von kleineren Fehlbildungen mit 4,1 % gegenüber 2,5 % angegeben. Die statistisch schlechteren Ergebnisse verzeichnen die monochorionischen, monoamnioten Zwillinge, wobei die Fälle mit zwei Mädchen hierbei die weniger schlechten Ergebnisse aufweisen (e5). Bei einer Teilung des Embryos bis zum fünften Tag nach Fertilisation entstehen dichorionisch-diamniote Zwillinge (etwa 30 %). Bei einer Teilung im Zeitraum zwischen dem fünften und siebten Tag nach Fertilisation bilden sich monochorionisch-diamniotische Zwillinge (etwa 70 %). Bei einer Teilung nach Tag 8 entstehen monochorionischmonoamniotische Zwillinge (etwa 1 %). Verbundene Zwillinge entstehen durch eine inkomplette Teilung am Tag 15 bis 17 nach Befruchtung. Ihre Häufigkeit ist in Europa etwa 1 auf 33 000 Geburten (e6). Dizygote Zwillinge Durch die Befruchtung von zwei verschiedenen Eizellen aus zwei verschiedenen Follikeln entstehen dizygote Zwillinge. Das Wachstum der Follikel wird durch die Gonadotropine reguliert. Es ist behauptet worden, dass höhere FSH-Spiegel zu einer höheren Zahl an dizygoten Zwillingen führen würden. Die FSH-Produktion wird von Licht- und Dunkelperioden beeinflusst. So soll es in Skandinavien eine größere Zahl an dizygoten Zwillings-Konzeptionen im Juli geben gegenüber einer geringeren Zahl im Januar. Die Wahrscheinlichkeit, dizygote Zwillinge zu haben, steigt mit dem mütterlichen Alter bis etwa 39 Jahre, danach sinkt sie wieder. Sie sinkt auch in Zeitperioden der Mangelernährung (e7). Höhergradige Mehrlinge Höhergradige Mehrlinge können aus der Befruchtung einer, zweier oder mehr Eizellen oder durch Teilung einer oder mehrerer befruchteter Eizellen entstehen, so dass eine gleichzeitige di- und monozygote Mehrlingsschwangerschaft entsteht. Die Kenntnis der Zygotie ist eine wichtige Voraussetzung, um Risikofaktoren in der Schwangerschaft richtig bewerten zu können. Beispielsweise kann es zu einer Wachstumsdifferenz bei der intrauterinen Mangelentwicklung eines Zwillings oder aber auch bei dem feto-fetalen Transfusionssyndrom kommen; das Letztere trifft allerdings nur bei monozygoten Zwillingen auf. Für die Klärung der Zygotie ist die Ultraschalldiagnostik heute unentbehrlich. Mit 10 bis 15 Schwangerschaftswochen ist bei dichorionischen Schwangerschaften eine lambdaförmige Strukturierung der DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG Eihäute beim Übergang zur Plazenta darzustellen (Abbildung 1). Separate Plazenten oder eine (fusionierte) Plazenta und die Membrandicke (monozygote Zwillinge haben eine dünne, dizygote Zwillinge eine dicke Trennwand) sind wichtige Befunde. Das physiologische Verschwinden eines Embryos oder frühen Feten aus einer Mehrlingsschwangerschaft („vanishing twin“) führt zur Resorption, einem leeren Fruchtsack oder einem fetus papyraceus. Klinisch fällt dieser Prozess in der Regel einzig durch eine Blutung ex utero auf. Abbildung 1 Dichorionische Zwillingsschwangerschaft bei 15+3 Schwangerschaftswochen mit diskordantem Wachstum; Pfeil = Lambda-Zeichen Pränatale genetische Diagnostik Seit den 70er-Jahren des vorigen Jahrhunderts wird Frauen eine genetische Diagnostik angeboten, die gilt selbstverständlich auch bei Mehrlingen. Prinzipiell sind die Amniozentese im zweiten Trimester oder die Chorionzottenbiopsie einsetzbar. Die Komplikationsrate der Amniozentese bei Mehrlingen wird als fünffach (etwa 5 %) erhöht gegenüber der bei Einlingsschwangerschaften (0,6 bis 1 %) angegeben (e8). Abbildung 2 Monochorionische Zwillingsschwangerschaft bei 20+2 Schwangerschaftswochen und mildem feto-fetalen Transfusionssyndrom; Pfeil, Amnionhaut; Stern, Fruchtwasserhöhle des Donators Selektiver Fetozid Die häufigsten und wichtigsten Gefahren für die Mehrlingsschwangerschaft sind die verkürzte Schwangerschaftsdauer und die erhöhten Gefahren für die Mutter: bei Drillingen: 20 Prozent Präeklampsie, 30 Prozent Anämie, 35 Prozent postpartale Blutungen; bei Vierlingen: 32 Prozent Präeklampsie, 25 Prozent Anämie, 21 Prozent postpartale Blutungen (6, e9, e10). Die selektive Reduktion von höhergradigen Mehrlingsschwangerschaften zu Zwillingsschwangerschaften erfolgt, um die dargestellten Gefährdungen für das Leben der Mutter oder der Föten zu vermindern. Sie wird ausgehend von den Erfahrungen mit dem indizierten Fetozid bei Fehlbildungen eines Mehrlings (7), mit verschiedenen Methoden durchgeführt wie Hysterotomie, Herzpunktion, Luftinjektion oder Injektion kardiotoxischer Substanzen. Arbeitsgruppen, die mit der Problematik des selektiven Fetozid häufig konfrontiert sind, halten die transabdominale intrathorakale Kaliumchlorid-Injektion bei einem Alter des Embryos von elf bis zwölf Wochen für die wirksamste Methode (8). Der Gewinn für die überlebenden Mehrlinge rechtfertigt nach Meinung vieler Autoren das Vorgehen (9, e11). Dabei ist vor der Injektion bei monozygoten Zwillingen zu berücksichtigen, dass durch die Injektion in den betreffenden Zwilling ein Überfließen der kardiotoxischen Substanzen auf den anderen Zwilling und damit eine erhebliche Gefährdung möglich ist. Bei 10 Prozent der Schwangeren ist der vollständige Schwangerschaftsverlust nach dem selektiven Fetozid zu erwarten. Der selektive Fetozid ist ethisch höchst problematisch und sollte durch die Anwendungen geeigneter reproduktionsmedizinischer Maßnahmen vermieden werden. Feto-fetales Transfusionssyndrom (FFTS) Monozygote, monochorionische Zwillingsschwangerschaften weisen interfetale Gefäßverbindungen auf plazentarer Ebene auf, sowohl arterio-arterielle und veno-venöse Anastomosen auf der Chorionplatte als auch arterio-venöse Shunts in den Kotyledonen (e12). Sie sind die Basis für eine Blutumverteilung, deren Ursache letztlich nicht geklärt ist. Möglicherweise besteht in dem Plazentarkreislauf des Donators infolge einer Plazentainsuffizienz ein erhöhter Gefäßwiderstand, der die Blutumverteilung verursacht. Es kommt zugunsten eines Zwillings, der dadurch größer (9, e13), polyglobul und/oder hypervolämisch wird (Akzeptor) und ein Polyhydramnion entwickelt, zum Zurückbleiben des Wachstums des Donators, der anämisch und hypovolämisch wird und ein Oligohydramnion entwickelt. Diagnostisch leitend ist die Assoziation von intrauterinen Gewichtsdifferenzen (über 20 %) und der ultrasonographisch festzustellenden Fruchtwasservolumendifferenz (Polyhydramnion beim Empfänger, Oligohydramnion bei Donator). Das Fruchtwasservolumen kann so abnehmen, dass der Donator als kleiner Zwilling an die Eihaut gedrückt wird (stuck twin) (Abbildung 2). 22 DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG Abbildung 3: Nabelschnurproblematik bei monoamniotischer Zwillingsschwangerschaft; antepartale ultrasonographische Nabelschnurdiagnostik und intraoperative Situation * Dank gilt Prof. Karim Kalache, Klinik für Geburtsmedizin Campus Charite Mitte, für die Überlassung der Abbildungen. Die Mortalitätsraten sind beim FFTS insgesamt sehr hoch (56 bis 100 %). In 3 bis 5 Prozent der Fälle kommt es bereits intrauterin zum Fruchttod (10). Nach dem Tod eines Zwillings entsteht in bis zu 14 Prozent der Fälle ein sogenanntes „twin embolization“-Syndrom (e14). Dabei kommt es zur arteriellen Hypotonie und zur Einschwemmung von thromboplastischem Material vom toten zum überlebenden Feten. Folgen sind eine disseminierte intravasale Gerinnung und/oder Infarkte mit unter anderem schweren neurologischen Schädigungen (11), so dass unbedingt vor dem intrauterinen Tod eines Feten eingegriffen werden sollte. Zur Therapie des FFTS werden heute angewandt: ● die wiederholte Amniozentese und Fruchtwasserentlastung; der pathogenetische Mechanismus dieser Behandlung ist unklar, jedoch ist häufig die wiederholte Amniozentese eine wirksame Methode (e15, e16). ● die elektive Koagulation der Gefäßverbindungen stellt die logische und konsequenteste Form der Behandlung dar (e15, 12, 13). Intrauteriner Tod Der antepartale Tod eines oder mehrerer Mehrlinge ist häufig (etwa 1 bis 5 Prozent aller Mehrlingsschwangerschaften) (e17). Neben der emotional-psychologischen Belastung für die Eltern ist besonderes Augenmerk auf den Zustand des oder der überlebenden Mehrlinge zu richten (e18). Bei monochorionischen Mehrlingen mit einem gestorbenen Mehrling ist bei überlebenden Mehrlingen mit einer hohen Rate an neurologischen Schäden zu rechnen. Diese werden auf die Embolisation thrombogenen Materials von dem toten Mehrling in den lebenden zurückgeführt. 23 Verminderung des Frühgeburt-Risikos Die Tatsache, dass Mehrlinge in der perinatalen Periode stärker gefährdet sind als Kinder aus Einlingsschwangerschaften, ist aus der hohen Frühgeburtenrate und aus der höheren Frequenz der intrauterin mangelentwickelten Kinder zu erklären. Die Komplikationsrate infolge Unreife und Mangelgewicht liegt bei Zwillingen bei etwa 40 %. Die Frühgeburtenhäufigkeit wird für Zwillingsschwangerschaften mit 30 % angegeben und liegt damit um das Drei- bis Fünffache über vergleichbaren Kollektiven von Einlingsschwangerschaften. Neben der frühen Diagnose der Mehrlingsschwangerschaft sind die frühzeitige Arbeitsunfähigkeitserklärung (etwa 20 SSW) und die körperliche Schonung als präventive Maßnahme anerkannt (e19, e20); die stationäre Behandlung ohne weiteres Risiko, die präventive Cerclage (e21) und die prophylaktische Tokolyse (e22) werden heute nicht mehr empfohlen. Intrauterine Mangelentwicklung Verschiedene Faktoren tragen bei der Mehrlingsschwangerschaft zur intrauterinen Mangelentwicklung bei, deren Häufigkeit bei Mehrlingen mit etwa 60 % angegeben wird (e23): der Ernährungszustand der Mutter, der reduzierte uterine Blutfluss, Anomalien der Nabelschnur, Transportkapazität der Plazenta, Plazentasitz, ungleiche Anteile der Gesamtplazentamasse der Mehrlinge sowie das FFTS. Schwangerschaftsbeendigung Zur Vermeidung intrauterinen Fruchttodes in Terminnähe wird heute häufig die Empfehlung zur Schwangerschaftsbeendigung nach 38 abgeschlossenen Schwangerschaftswochen gegeben. Bei beabsichtigter vaginaler Geburtsleitung wird meist eine Prostaglandin-Reifung der Zervix begonnen. Bei folgenden Indi- DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG kationen wird bei diesem Schwangerschaftsalter heute meist die primär indizierte Schnittentbindung vorgenommen: ● Drillinge oder höhergradige Mehrlinge ● vorangehender Mehrling in Beckenend- (BEL) oder Querlage (QL) ● Ultraschall-Schätzgewicht des zweiten Zwillings mehr als 500 g über dem des ersten Zwillings ● Zwillinge mit einem Ultraschall-Schätzgewicht unter 1 800 g ● monoamniotische Zwillinge (Sektio bei 34+0 Schwangerschaftswochen) (Abbildung 3). Neonatale Mortalität und Morbidität Zu der Frage, ob und in wie weit eine Mehrlingsschwangerschaft per se die neonatale Mortalität und Morbidität erhöht, finden sich teilweise widersprüchliche Daten in der Literatur. Das liegt unter anderem an unterschiedlichen Studienpopulationen, an unterschiedlichem Studiendesign (prospektive oder retrospektive Erhebung) und an unterschiedlichen Zeiträumen (vor oder nach Einführung von Surfactant und von intrauteriner Lasertherapie). Zwar steigen mit der Zahl der Kinder in einer Schwangerschaft die neonatale Mortalität und Morbidität, es verringert sich aber auch die Schwangerschaftsdauer, so dass zunehmend die Probleme, die mit einer Frühgeburt zusammenhängen, zum Tragen kommen. Bei Vergleichen zwischen Einlingen und Mehrlingen müssen also stets das Gestationsalter, das Geburtsgewicht und auch das Geschlecht berücksichtigt werden (14, e24). Neonatale Mortalität Bei Zwillingen entwickelt sich ab etwa 32 Schwangerschaftswochen und bei Drillingen ab etwa 29 Schwangerschaftswochen ein im Vergleich zu Einlingen verzögertes intrauterines Wachstum (15). Bei Mehrlingen mit einem Geburtsgewicht unter der 10. Perzentile ist die neonatale Mortalität erhöht. Adjustiert man aber für das Gestationsalter, das Ausmaß der Wachstumsretardierung und das Geschlecht, so findet sich bei Zwillingen mit fetaler Wachstumsretardierung eine ähnliche neonatale Mortalität wie bei Einlingen (e25, 15, 16). In diesem Zusammenhang scheint eine Gewichtsdiskordanz zwischen Zwillingen eine wichtige Rolle zu spielen: Eine erhöhte neonatale Mortalität wurde beschrieben bei einer Gewichtsdiskordanz von mehr als 25 %. Betroffen ist vor allem der kleinere Zwilling, insbesondere, wenn er ein Geburtsgewicht unter der 10. Perzentile hat (17–19). Bei großer Gewichtsdiskordanz scheint aber auch der größere Zwilling ein erhöhtes Mortalitätsrisiko zu haben (e26, 20). Eine erhöhte neonatale Mortalität wurde bei monochorionischen im Vergleich zu dichorionischen Zwillingen beobachtet, insbesondere, wenn ein Zwilling intrauterin verstorben ist (21, 22). Zu der Frage, ob die Reihenfolge der Geburt einen Einfluss auf die Prognose hat, gibt es unterschiedliche Daten: So wurde bei sehr kleinen Zwillingen (Geburtsgewicht unter 1 500 g) ein erhöhtes Mortalitätsrisiko für den 2. Zwilling unabhängig vom Geburtsmodus beschrieben (e27). Andere Autoren fanden solche Unterschiede nicht (15). Neonatale Morbidität Atemnotsyndrom Die Inzidenz des Atemnotsyndroms (RDS) steigt mit der Zahl der Mehrlinge (etwa 23 % bei Drillingen, 65 % bei Vierlingen, 75 % bei Fünflingen), allerdings bei gleichzeitig sinkendem Gestationsalter (e27, e24). Das Risiko für respiratorische Probleme ist erhöht bei Knaben und beim 2. Zwilling (23, e28). Ein kompletter Zyklus von pränatal gegebenen Steroiden reduziert die Inzidenz des RDS auch bei Mehrlingsschwangerschaften (e27). Allerdings wurde ein abnehmender Effekt der pränatalen Lungereifeinduktion mit zunehmender Pluralität beschrieben (24). Zerebrale Schädigung Die Häufigkeit von zerebralen Schädigungen wird wie bei Einlingen auch bei Mehrlingen sehr stark vom Gestationsalter und vom Geburtsgewicht beeinflusst. Aber auch die Chorionizität und der intrauterine Fruchttod eines Mehrlings spielen eine große Rolle. In einer Metaanalyse von 28 Studien war das Risiko für neurologische Störungen beim überlebenden Zwilling vierfach höher bei monochorionischen als bei dichorionischen Zwillingen (22). Nekrotisierende Enterokolitis Für das Auftreten einer nekrotisierenden Enterokolitis (NEC) wurde bei monochorionischen Zwillingen nach Adjustierung für Gestationsalter und Geburtsgewicht ein um den Faktor 4 erhöhtes Risiko (3,8 % gegen 0,9 %) gefunden (21). Langzeitergebnisse Kinder nach Mehrlingsschwangerschaft haben ein erhöhtes Risiko für neurologische Auffälligkeiten. Eltern sollten über dieses Risiko aufgeklärt und ein geeignetes Nachuntersuchungsangebot organisiert werden (25). KERNAUSSAGEN ● Die Zahl der Mehrlingsschwangerschaften steigt. ● Risiken für das Kind wie Frühgeburtlichkeit, Wachstumsrestriktion und intrauteriner Tod sind höher, ebenso Risiken für die Mutter wie Präeklampsie, Gestationsdiabetes und Blutungen. ● Die Ultraschalldiagnostik ist wichtig zur Überwachung der Schwangerschaft, Erkennung von Wachstumsdiskrepanz, Zygotie, und feto-fetalem Transfusionssyndrom. ● Die neonatale Morbidität von Mehrlingen ist durch das Atemnotsyndrom, nekrotisierende Enterokolitis sowie zerebrale Schädigungen gekennzeichnet. ● Die Betreuung von Mehrlingsschwangeren ist eine Herausforderung für Pränatalmediziner, Geburtsmediziner und Neonatologen. 24 DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG Interessenkonflikt Die Autoren erklären, dass kein Interessenkonflikt im Sinne der Richtlinien des International Committee of Medical Journal Editors besteht. Manuskriptdaten eingereicht: 12. 5. 2009, revidierte Fassung angenommen: 29. 10. 2009 LITERATUR 1. Deutsche Gesellschaft für Perinatale Medizin: Betreuung der Mehrlingsschwangerschaft und Leitung der Mehrlingsgeburt. Perinatalmedizin 1990; 2: 1–3. 2. ACOG Practice Bulletin: Multiple gestation: complicated twin, triplet and high-order multifetal pregnancy. Obstet Gynecol 2004; 104: 869. 3. Boklage CE: Survival probability of human conceptions from fertilization to term. Int J Fertil 1990; 35: 75–94. 4. Borkenhagen A, Stöbel-Richter Y, Brähler E, Kentenich H: Mehrlingsproblem bei Kinderwunschpaaren. Gynäk Endokrinol 2004; 2: 163–8. 5. Taffel SM: Demographic trends in twin births: USA. In: Keith LG, Papiernik E, Keith DM, Luke B: Multiple pregnancy. Epidemiology, gestation and perinatal outcome. Parthenon, New York, London 1995. 6. Ludwig M, Kohl M, Krüger A, et al.: Komplikationen bei höhergradigen Mehrlingsschwangerschaften für Mütter und Kinder. Geburtsh Frauenheilk 2004; 64: 168–77. 7. Evans MI, Goldberg JD, Dommergues M, Wagner RJ: Efficacy of second-trimester selective termination for fetal abnormalities: international collaborative experience among the world's largest centers. Am J Obstet Gynecol. 1994; 171(1): 90–4. 8. Berkowitz RL, Lynch L, Lapinski R, Berger P: First-trimester transabdominal multifetal pregnancy reduction: a report of two hundred completed cases. Am J Obstet Gynecol 1993; 169: 17–21. 9. ACOG Committee Opinion: Multifetal pregnancy reduction. Obstet Gynecol 2007; 109: 1511–5. 10. Carlson NJ, Towers C: Multiple gestation complicated by the death of one fetus. Obstet Gynecol 1989; 73: 685. 11. Maier RF, Bialobrzeski B, Gross A, Vogel M, Dudenhausen JW, Obladen M: Acute and chronic fetal hypoxia in monochorionic and dichorionic twins. Obstet Gynecol 1995; 86: 973–7. 12. Hecher K, Hackeloer BJ, Ville Y: Umbilical cord coagulation by operative microendoscopy at 16 weeks' gestation in an acardiac twin. Ultrasound Obstet Gynecol 1997; 10: 130–2. 13. Senat MV, Deprest J, Boulvain M, Paupe A, Winer N, Ville Y: Endoscopic laser surgery versus serial amnioreduction for severe twinto-twin transfusion syndrome. N Engl J Med 2004; 351: 136–44. 14. Ballabh P, Kumari J: Neonatal outcome of triplet versus twin and singleton pregnancies: a matched case control study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2003; 107: 28–36. 15. Garite TJ,Clark RH: Twins and triplets: the effect of plurality and growth on neonatal outcome compared with singleton infants. Am J Obstet Gynecol 2004; 191: 700–7. 16. Odibo AO, McDonald RE: Perinatal outcomes in growth-restricted twins compared with age-matched growth-restricted singletons. Am J Perinatol 2005; 22: 269–73. 17. Bagchi S, Salihu HM: Birth weight discordance in multiple gestations: occurrence and outcomes. J Obstet Gynaecol 2006; 26: 291–6. 18. Blickstein I, Keith LG: Neonatal mortality rates among growth-discordant twins, classified according to the birth weight of the smaller twin. Am J Obstet Gynecol 2004; 190: 170–4. 19. Wen SW, Fung KF: Fetal and neonatal mortality among twin gestations in a Canadian population: the effect of intrapair birthweight discordance. Am J Perinatol 2005; 22: 279–86. 20. Demissie K, AnanthCV: Fetal and neonatal mortality among twin gestations in the United States: the role of intrapair birth weight discordance. Obstet Gynecol 2002; 100: 474–80. 25 21. Hack KE, Derks JB: Increased perinatal mortality and morbidity in monochorionic versus dichorionic twin pregnancies: clinical implications of a large Dutch cohort study. BJOG 2008; 115: 58–67. 22. Ong SS, Zamora J: Prognosis for the co-twin following single-twin death: a systematic review. BJOG 2006; 113: 992–8. 23. Canpolat FE, Yurdakok M: Birthweight discordance in twins and the risk of being heavier for respiratory distress syndrome. Twin Res Hum Genet 2006; 9: 659–63. 24. Blickstein I, Shinwell ES: Plurality-dependent risk of respiratory distress syndrome among very-low-birth-weight infants and antepartum corticosteroid treatment. Am J Obstet Gynecol 2005; 192: 360–4. 25. Moore AMM, O'Brien K: Follow up issues with multiples. Paediatr Child Health 2006; 11: 283–6. Anschrift für die Verfasser Prof. Dr. med. Joachim W. Dudenhausen Weill Cornell Medical College Dept. OB/GYN 525 E 68th Street M-701 New York NY 10065 E-Mail: [email protected] SUMMARY Perinatal Problems in Multiple Births Background: Multiple pregnancies have become more common in the industrialized world because of rising maternal ages and advances in reproductive medicine. Methods: Selective literature review. Results: Multiple pregnancy carries a higher risk of prematurity, intrauterine growth restriction, and prenatal death, as well as elevated risks to the mother including preeclampsia, diabetes, and hemorrhage during delivery. Genetic tests and ultrasonography are the most important tests for monitoring during pregnancy. Ultrasound aids in the detection of the feto-fetal transfusion syndrome and in the determination of zygosity. Conclusions: The care of women with multiple pregnancies requires the collaboration of specialists in prenatal medicine, obstetrics, and neonatology as well as a properly functioning integration of outpatient and inpatient care. Zitierweise: Dtsch Arztebl Int 2010; 107(38): 663–8 DOI: 10.3238/arztebl.2010.0663 @ Mit „e“ gekennzeichnete Literatur: www.aerzteblatt.de/lit3810 The English version of this article is available online: www.aerzteblatt-international.de DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG Heft 38, 24. September 2010 LITERATURVERZEICHNIS HEFT 38/2010, ZU: ÜBERSICHTSARBEIT Perinatale Probleme von Mehrlingen Joachim W. Dudenhausen, Rolf F. Maier eLITERATUR e1. White C ,Wyshak G: Inheritance in human dizygotic twinning. N Engl J Med 1964; 271: 1003–5. e2. Gonen R, Heyman E, Asztalos EV: The outcome of triplet, quadruplet and quimtuplet pregnancies managed in a perinatal unit: Obstetric, neonatal and follow-up data. Am J Obstet Gynecol 1990; 162: 45429. e3. Reece AE, Yartoni S, Abdalla M: A prospective longitudinal study of groth in twin gestations compared with growth in singeleton pregnancies. I. The fetal head. J Ultrasound Med 1991; 19: 439. e4. Reece AE, Yartoni S, Abdalla M: A prospective longitudinal study of groth in twin gestations compared with growth in singeleton pregnancies. II. The fetal imbs. J Ultrasound Med 1991; 19: 445. e5. Cameron AH: The Birmingham twin survey. ProcR Soc Med 1968; 61: 229. e6. Imaizumi Y: Conjoined twins in Japan 1979–1985. Acta Gen Med Genell 1988; 37: 227. e7. Eriksson AW, Bressers WMA, Kostense PI :Twinning rate in Scandinavia, Germany and The Netherlands during years of privation. Acta Genet Med Gemellol (Roma) 1988; 37: 277–97. e8. Anderson RL, Goldberg JD, Goldbus MS: Prenatal diagnosis in multiple gestation: 20 years' experience with amniocentesis. Prenat Diagn 1991; 11: 263–70. e9. Collins MS, Bleyl JA: Seventy-one quadruplet pregnancies: managementt and outcome. Am J Obstet Gynecol 1990; 162: 1384. e10. Syrop CH, Warner MW: Triplet gestations: Maternal and neonatal implications. Acta Gen Med Genell 1985; 34: 81. e11. Lipitz S, Reichmann B, Uval J, et al.: A prospective comparison of the outcome of triplet pregnancies manged exspectantly or by multi fetal reduction to twins. Am J Obstet Gynecol 1994; 170: 874. e12. Bajora R, Wigglesworth J, Fisk NM: Angioarchitecture of monochorionic placentas in relation to the twin-twin transfusion syndrome. Am J Obstet Gynecol 1995; 172: 856. e13. D'Alton ME, Newton ER, Cetrulo CI: Intrauterine fetal demise in multiple gestation. Acta Ben Med Gemell 1984; 35: 43. e14. Cheung VY, Bocking AD, Dasilva OP: Preterm discordant twins: what birth weight difference is significant? Am J Obstet Gynecol 1995; 172: 955. e15. Blickstein I: The twin-twin transfusion syndrome. Obstet Gynecol 1990; 76: 714–22. e16. Saunders NJ, Snijders RJ, Nicolaides KH: Therapeutic amniocentesis in twin-twin transfusion syndrome appearing in the second trimester of pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1992; 166: 820–4. e17. Kilby MD, Govind A, O'Brien PM: Outcome of twin pregnancies complicated by a single intrauterine death: a comparison with viable twin pregnancies. Obstet Gynecol 1994; 84: 107–9. e18. Woo HHN, Sin SY, Tang LCH: Single foetal death in twin pregnancies: review of the maternal and neonatal outcomes and management. HKMJ 2000; 6: 293–300. e19. Kaminski M, Papiernik E: Multifactorial study on the risk of prematurity at 32 weeks of gestation. A comparison between an empirical prediction and a discriminant analysis. J Perinat Med 1974; 2: 37. e20. Papiernik E, Kaminski M: Multifactorial study on the risk of prematurity at 32 weeks of gestation. A study of the frequency of 30 predictive characteristics. J Perinat Med 1974; 2: 30. e21. Dor J, Shalev J, Mashiach S: Elective cervical suture of twin pregnancies diagnosed ultrasonically in the first trimester following induced ovulation. Gynecol Obstet Invest 1982; 13: 55. e22. Gummerus M, Helonen O: Prophylactic tocolysis of twins. Brit J Obstet Gynaecol 1987; 94: 249. e23. Miller HC, Merritt TA: Fetal growth in humans. Year Book Medical Publishers, Chicago 1979. e24. Strauss A, Paek BW: Multifetal gestation — maternal and perinatal outcome of 112 pregnancies. Fetal Diagn Ther 2002; 17: 209–17. e25. Baker ER, Beach ML: A comparison of neonatal outcomes of agematched, growth-restricted twins and growth-restricted singletons. Am J Perinatol 1997; 14: 499–502. e26. Branum AM, Schoendorf KC: The effect of birth weight discordance on twin neonatal mortality. Obstet Gynecol 2003; 101: 570–4. e27. Shinwell ES, Blickstein I: Excess risk of mortality in very low birthweight triplets: a national, population based study. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2003; 88: F36–40. e28. Hacking D, Watkins A: Respiratory distress syndrome and antenatal corticosteroid treatment in premature twins. Arch Dis Child Fetal Neonatal 2001; 85: F77–8. 26 DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG Heft 40, 8. Oktober 2010 NOBELPREIS FÜR MEDIZIN „Vater“ von vier Millionen Babys Der Physiologe Robert G. Edwards hatte in den 1970er Jahren gemeinsam mit dem britischen Gynäkologen Patrick Steptoe die In-vitro-Fertilisation entwickelt. s war kurz vor 24 Uhr am 25. Juli 1978, als in Manchester (Großbritannien) Louise Brown auf die Welt kam: Der 2 600 Gramm schwere Säugling zog die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich, denn mit Louise war das erste „Retortenbaby“ geboren, auf Basis einer neuen Technik: der künstlichen Befruchtung der Frau. Heute leben weltweit circa vier Millionen Kinder dank dieser Pioniertat und der Weiterentwicklungen der in-vitro-Fertilisation (IVF). Mit der erfolgreichen Befruchtung im Reagenzglas läuteten der Physiologe Robert G. Edwards und E der inzwischen verstorbene Gynäkologe Patrick Steptoe ein neues Zeitalter in der Behandlung unerwünschter Kinderlosigkeit ein. Am Montag wurde dem heute 85-jährigen Edwards der Nobelpreis für Medizin zugesprochen. IVF heute in vielen Variationen Bereits 1960 erwog der Physiologe die Zeugung eines Embryos in einem Reagenzglas: Edwards versuchte zunächst, Eizellen mit eigenem Sperma zu befruchten und zu kultivieren. Ab 1968 arbeitete er mit Steptoe zusammen. Um an Material zu gelangen, baten sie Frauen GRAFIK 1 Quelle: The Nobel Commitee for Physiology or Medicine; Illustration: Mattias Karlén Natürliche Befruchtung 27 vor einer Hysterektomie um Geschlechtsverkehr. So hofften sie, Spermien zu erhalten, die in den weiblichen Reproduktionstrakt gelangt waren. Ethisch gesehen war das Vorgehen der beiden Mediziner diskussionswürdig. Edwards verteidigte sich aber damit, er respektiere das Recht seiner Patienten, eine eigene Familie gründen zu können. In den Jahren 1972 bis 1974 wurden erstmals Embryonen in Frauen transferiert, aber Schwangerschaften blieben aus. 1976 erreichten Edwards und Steptoe das erste Mal eine Eileiterschwangerschaft. 1977 gelang dann die erste künstliche Befruchtung einer Frau: der Mutter von Louise Joy Brown. Edwards versuchte auch als erster Forscher, überzählige Embryonen zu kryokonservieren. Zu den Therapieformen der assistierten Reproduktion gehören heute neben der IVF die intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI) und die testikuläre Spermienextraktion (TESE). „Im Prinzip wird überall auf der Welt dieselbe Methode der In-vitro-Fertilisation angewendet“, erläuterte Edwards anlässlich seines Besuchs der EXPO 2000 in Deutschland. „Die ICSI zum Beispiel ist eine sehr nützliche Variante. Und es gab damals wie heute sehr wenig Fehlgeburten nach IVF.“ Die Verleihung des MedizinNobelpreises an Robert G. Edwards wird von Reproduktionsmedizinern als ein Meilenstein in der Behandlungsform ungewollt kinderloser Paare gesehen. „Gerade für Deutschland, wo die IVF lange ein Schattendasein geführt hat, ist dies von ganz besonderer Bedeutung“, sagte Dr. med. Georg Döhmen (Mönchengladbach), stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Reproduktionsmedizin zum Deutschen DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG Dr. med. Vera Zylka-Menhorn Dr. rer. nat. Nicola Siegmund-Schultze Dr. rer. nat. Renate Leinmüller Foto: picture-alliance GRAFIK 2 Prozentsatz der Geburten nach assoziierter Reproduktion (2007) 6 Den höchsten Prozentsatz an IVFKindern bei der höchsten Verfügbarkeit an Methoden gibt es in Dänemark. Schweden hat durch den gesetzlich verankerten „SingleEmbryo-Transfer“ die Zwillingsrate massiv gesenkt. 5,5 5 4,5 Quelle: Anders Nyboe Andersen, bei ESHRE Workshop 10 Jahre EIM, 11. 9. 2010 München Auch James Watson, der 1962 den Nobelpreis für seine Entdeckung der Doppelhelixstruktur der DNA erhielt, gehört zu den Kritikern. Er warf Edwards 1970 vor, er müsse für seine Forschungen die Kindstötung akzeptieren. Anders sieht es das Nobelkomitee, das zur ethischen Debatte keine Aussagen treffen wollte: „Edwards musste auch starken Widerstand des Establishments überwinden“, sagte Christer Höög vom Nobelkomitee des Karolinska-Instituts. Die Akademie verweist vielmehr darauf, dass mehr als zehn Prozent aller Paare weltweit von Unfruchtbarkeit betroffen sind. In Deutschland kam das erste Retortenbaby im April 1982 in Erlangen auf die Welt. Bis in die 90er Jahre fanden die meisten In-vitroFertilisationen an Universitätskliniken statt. Inzwischen gibt es rund 120 Kliniken und Fachzentren, die In-vitro-Fertilisationen anbieten. Sie führen jährlich etwa 70 000 Behandlungen durch, 2007 wurden 11 500 Kinder nach künstlicher Befruchtung geboren. Ärzte und Paare wünschen sich, es wären mehr. Derzeit liegt die „Baby-take-home-Rate nach IVF bei 20 bis 22 Prozent, die Schwangerschaftsrate über alle Altersgruppen hinweg bei 28 Prozent, bei den 25- bis 30-jährigen Frauen allerdings bei 35 Prozent. Die angeblich geringe Erfolgsrate ist immer schon eine Kritik an der IVF gewesen. „Ich antworte darauf: Die menschliche Reproduktion ist nicht sehr effektiv“, erklärt Edwards: „Wenn sich junge Paare ein Kind wünschen und häufig miteinander schlafen, beträgt die Konzeptionsrate pro Zyklus höchstens 20 Prozent. Es gibt also natürliche Grenzen. Wir haben damals mit einer Geburtenrate von fünf Prozent angefangen, und die hat sich inzwischen doch erhöht.“ Zu den in Deutschland intensiv debattierten Möglichkeiten der IVF gehört die Präimplatantationsdiagnostik (PID). Dabei wird ein Embryo vor der Implantation auf seine genetischen Eigenschaften untersucht. Bei Erbanlagen für Muskeldystrophie Duchenne, Mukoviszidose, Fragiles-X-Syndrom oder Trisomie 21 zum Beispiel lassen Ärzte in anderen Ländern, in denen die PID erlaubt ist, die entsprechenden Embryonen gezielt im Labor absterben. Die PID ist für viele Ärzte, auch für die Bundesärztekammer, unter bestimmten Umständen akzeptabel, galt aber bislang nach dem deutschen Embryonenschutzgesetz als verboten. Der Bundesgerichtshof aber kam im Juli dieses Jahres zu dem Schluss, das Gesetz erlaube die PID an pluripotenten Zellen. „Für uns Ärzte wäre es nun wichtig, dass hier Klarheit geschaffen wird, damit wir uns nicht in einer juristischen Grauzone bewegen müssen“, betont Döhmen. Die IVF kann als eine Brückentechnologie gesehen werden. Es waren viele Fragen zu klären: wie die der Eizellreifung, ihrer Gewinnung und der notwendigen Kulturbedingungen. Die Reproduktionsmedizin ist heute ein komplexes Fachgebiet, das weit in Bereiche wie die Geburtshilfe, die Onkologie und die Endokrinologie hinein▄ reicht. 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Be ch lgie ec n Re hisc pu he b Dä lik ne ma Fin rk nla nd Fra nk rei De uts ch ch lan d Isl an d Ita lie n L Ma itaue n ze do nie Mo n nte ne gr o No rw eg en Po rtu g al Slo we nie Sc hw n Gr ed oß en br ita nn ien Ethische Bedenken Robert G. Edwards studierte Biologie an der Universität in Wales und später im schottischen Edinburgh. Nach dem Studium begann er seine Forscherlaufbahn am Londoner National Institute for Medical Research. Ab 1963 arbeitete er in Cambridge an der Bourn Hall Clinic, dem weltweit ersten IVF-Zentrum. Heute ist der 85-Jährige emeritierter Professor der Cambridge-Universität. Ts Ärzteblatt. „Ich würde mir wünschen, dass dieser Nobelpreis die aktuellen Bemühungen in Deutschland unterstützt, die Methoden der IVF weiter optimieren zu können.“ Konkret meint Döhmen damit zum Beispiel die in Deutschland verbotene Eizellspende für Frauen mit Kinderwunsch, bei denen die Verwendung eigener Eizellen nach einer Krebsbehandlung zum Beispiel nicht möglich oder mit erhöhten Risiken assoziiert ist. Die Samenspende dagegen ist erlaubt, was angesichts des Gleichbehandlungsgrundsatzes kritisch diskutiert wird. Auch werden im Allgemeinen zwei bis drei Embryonen verpflanzt, so dass es bei circa 20 Prozent der Schwangerschaften Mehrlinge gibt. Ist eine Mehrlingsschwangerschaft mit hohem Risiko für die Mutter verboten, reduzieren die Ärzte die Feten (selektiver Fetozid) – ein ethischmoralisches Problem, mit dem die verschiedenen Länder unterschiedlich umgehen. 28 Heft 42, 22. Oktober 2010 Das Urteil des Bundesgerichtshofs zur Präimplantationsdiagnostik dürfte zur Aufschnürung des Embryonenschutzgesetzes führen. Mit weitreichenden Folgen er Hamburger Strafrechtler Prof. Dr. Reinhard Merkel verteidigt die Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) zur Präimplantationsdiagnostik (PID) ziemlich witzig so: Die Auffassung des BGH, die PID verstoße nicht gegen das Embryonenschutzgesetz, sei zwar formalrechtlich falsch, doch liege das Gericht rechtsethisch richtig. Denn das bewusste Gesetz sei hinsichtlich der PID dringend korrekturbedürftig. Es verbiete etwas, was an anderer Stelle erlaubt sei. Merkel verweist in seinem Auf- D N Vom Kinderwunsch zum Wunschkind 29 satz in der „FAZ“ vom 3. August auf den angeblichen Widerspruch zu § 218 a Absatz 2 Strafgesetzbuch, der die sogenannten Spätabtreibungen straffrei lässt. Das störte auch den BGH. „Und von hier aus“, erkennt der Strafrechtler, „schlägt sich wie von selbst ein Bogen zur Rechtfertigung der PID.“ Merkel zieht damit eine inzwischen vertraute Bahn. Auch der Präsident der Bundesärztekammer, Prof. Dr. med. Jörg-Dietrich Hoppe, zeigte sich erfreut, dass nunmehr „die unlogische Diskrepanz“ endlich aufgehoben sei. Damit fällt allerdings auch die Argumentation der Kritiker der Spätabtreibung – wenn schon PID verboten sei, dürften Abtreibungen nach der zwölften Schwangerschaftswoche erst recht nicht straffrei bleiben – in sich zusammen. Nun ist beides erlaubt, Rechtsangleichung auf dem unteren Niveau. Es sei denn, PID würde ausdrücklich gesetzlich untersagt. Nach dem BGH-Urteil vom 6. Juli setzten sich Kirchen wie Behindertenorganisationen, auch vereinzelte Politiker, so etwa der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Hubert Hüppe (CDU), für ein Verbot ein. Nationaler Ethikrat für Zulassung der PID Ob Verbot oder förmliche Zulassung, dazu müssten das Embryonenschutzgesetz aufgeschnürt und einige Paragrafen explizit über PID eingefügt werden. Ausgang offen. Die Enquetekommission „Recht und Ethik der modernen Medizin“ des 14. (vergangenen) Deutschen Bundestages hat sich zwar 2002 mit 16 zu drei Stimmen dafür ausge- Foto: Keystone DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG sprochen, PID in Deutschland nicht zuzulassen. Doch in der laufenden Legislaturperiode dürften die Karten anders gemischt sein. Ein Verbot forderte 2002 auch der 105. Deutsche Ärztetag; ob der bei seiner Meinung bleibt, wird sich erst nächstes Jahr zeigen können. Der Nationale Ethikrat unter der Kanzlerschaft Gerhard Schröders plädierte 2003 mit 15 zu sieben für die begrenzte Zulassung der PID. Zwei weitere Mitglieder wollten PID der Gewissensentscheidung des Einzelnen im Konfliktfall überantworten. Der damalige Ethikrat sprach sich zudem für ein Fortpflanzungsmedizingesetz aus, das die gesamte Reproduktionsmedizin regeln solle. In diesem Sinn berät jetzt auch der nunmehr gesetzlich fundierte Nationale Ethikrat. Bei dessen Sitzung am 23. Juli ging es nur am Rande um PID, sondern vorrangig um die Reproduktionsmedizin insgesamt. Der Mannheimer Rechtswissenschaftler Prof. Dr. Jochen Taupitz erklärte das Embryonenschutzgesetz für überholt und gab zu bedenken, es „durch ein breiter gespanntes Fortpflanzungsmedizingesetz abzulösen“. Taupitz, der auch der Zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer angehört, zählte schon im alten Ethikrat zu den Vorkämpfern der PID. Die Bioethikerin Prof. Dr. Regine Kollek, die bei der Juni-Sitzung des Rates das Koreferat zu Taupitz hielt, vertrat hingegen die Meinung, nicht einmal das Embryonenschutzgesetz müsse zwingend geändert werden. Doch wenn nicht alles täuscht, dann läuft die Diskussion inzwischen in Richtung Fortpflanzungsgesetz. „Qualitativ hochwertige“ Embryonen Das von einem Reproduktionsmediziner aus Berlin erzwungene Urteil des BGH zu PID könnte somit zu einer weitergehenden Gesetzgebung führen, bei der die bisher offene Frage der Reproduktionsmedizin rechtlich geklärt, Verbote aufgehoben oder bestätigt und PID beiläufig mitbehandelt würde. Das wäre durchaus im Sinne einiger Wortführer der Fortpflanzungsmedizin. Auf deren Wunschliste stehen zum Beispiel die Eizellenspende, die Kultivierung von Embryonen zu allerlei Zwecken, etwa zur Erzeugung von Rettungsgeschwistern oder für das Elective-single-embryo-Verfahren (eSET). Damit ist die kurzzeitige Erzeugung von Embryonen gemeint, aus denen dann die morphologisch besten ausgewählt werden. Zur Einstimmung hat vor zwei Jahren aus- KOMMENTAR Prof. Dr. med. Klaus Diedrich, Reproduktionsmediziner Durch die Präimplantationsdiagnostik (PID) bietet sich eine Möglichkeit, bei Paaren mit schweren genetisch determinierten Erkrankungen bereits vor Etablierung einer Schwangerschaft betroffene Embryonen zu diagnostizieren und vor eben dieser Schwangerschaft auszuschließen. Dadurch kann ein belastender Schwangerschaftsabbruch verhindert werden. Die Schwangerschaft auf Probe kann abgelöst werden durch die Zeugung auf Probe. Nachdem viele Jahre sehr unterschiedliche Auffassungen bezüglich der Zulässigkeit der PID aufeinanderprallten und Ärzte aus Angst vor Strafverfolgung daher diese Methode nicht anwendeten, hat das Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) jetzt für Rechtssicherheit für Ärzte und Betroffene gesorgt. Die Präimplantations- diagnostik ist in Deutschland möglich geworden! Obwohl weltweit pro Jahr mehr als 600 000 Zyklen zur In-vitro-Fertilisation durchgeführt werden, wurde im Jahr 2006 nur in Pro Zulassung PID 1 876 Fällen eine Präimplantationsdiagnostik durchgeführt. Dies zeigt, dass die Indikation zur PID sehr streng gestellt wird. Die PID sollte lediglich eingesetzt werden zum Ausschluss einer nicht therapierbaren schweren Erbkrankheit. Auch die Polkörperdiagnostik ist hierfür bei monogenetischen Erkrankungen geeignet. Randomisierte prospektive Studien haben gezeigt, dass das Aneuploidiescreening nicht die erhofften Ergebnisse einer Verbesserung der Schwangerschaftsrate und Reduzierung der Abortrate bei älteren Patientinnen brachte. Deshalb sollte dieses Aneuploidiescreening heute am Embryo und auch an der Eizelle mit Polkörperdiagnostik nicht mehr außerhalb von Studien angeboten werden. Zwar ist durch das Urteil des Bundesgerichtshofs die PID rechtlich in Deutschland möglich geworden, jedoch ist es für die beteiligten Ärzte wichtig, dass dieses auch gesetzlich positiv geregelt wird. Sinnvoll wäre es, das überalterte Embryonenschutzgesetz durch ein neues Fortpflanzungsmedizingesetz unter Einbeziehung des elektiven Single-Embryo-Transfers und der Eizellspende zu diskutieren und zu verabschieden. 30 DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG gerechnet die SPD-nahe FriedrichEbert-Stiftung – solches Gedankengut vermutet man eher bei der FDP – ein Gutachten vorgelegt. Hinter ihm stecken so prominente Fortpflanzungsmediziner wie die Professoren Klaus Diedrich (Lübeck), Hermann Hepp (München) und Ricardo Felberbaum (Kempten), die sich auch zugunsten der PID verwenden. Durch das eSET-Verfahren verspricht man sich bessere Ergebnisse bei IVF; „qualitativ hochwertige“ Embryonen könnten, so die Hoffnung, die sogenannte Baby-takehome-Rate, also die Zahl der tatsächlich nach IVF/ICSI geborenen und überlebenden Kinder erhöhen. Sie liegt heute bei 17,5 Prozent (detaillierte Statistiken unter www. deutsches-ivf-register.de). Das ist relativ bescheiden im Vergleich zu den belastenden Prozeduren, mit denen IVF für die Paare verbunden ist. Das eSET ist nach dem Embryonenschutzgesetz verboten, falls man sich auf die Rechtslage noch verlassen kann. Belgien oder Spanien, die den Preis eben zahlen. Der BGH erklärt zwar zu seiner Entscheidung, „einer unbegrenzten Selektion von Embryonen anhand genetischer Merkmale, etwa die Auswahl von Embryonen, um die Geburt einer ,Wunschtochter‘ oder eines ,Wunschsohnes‘ herbeizuführen, wäre damit nicht der Weg geöffnet.“ Und die Bundesärztekammer sekundiert, der BGH Selbst wenn „nur“ PID gesetzlich geregelt werden sollte – eine Talfahrt steht bevor. Denn der Wunsch, ein gesundes Kind zu bekommen, wird rechtlich und ethisch teuer erkauft. habe eindeutig klargestellt, dass die PID keinesfalls als Methode zur Erzeugung sogenannter Designerbabys erlaubt sei. Strafrechtler Merkel tut Schlagworte wie „Designerkinder“ oder „behindertenfreie Welt“ als „ideologische Geisterbeschwörungen“ ab. Doch solches Abwiegeln zeugt auch davon, dass den Abwieglern nicht ganz wohl in ihrer Haut ist. Denn PID dient nun mal der Selektion. Das Thema ist hierzulande tabuisiert. Doch man möge die Vergangenheit endlich hinter sich lassen, äußerte dieser Tage ein erfolgreicher Berliner Fertilisationsarzt. In der Tat, so systematisch wie vor drei Generationen in Deutschland, aber auch anders- Das Thema PID ist hierzulande tabuisiert Doch selbst wenn „nur“ PID gesetzlich geregelt werden sollte – eine Talfahrt steht bevor. Denn der so verständliche Wunsch von Eltern oder Paaren, nur ein gesundes Kind zu bekommen, wird rechtlich und ethisch teuer erkauft. Da hilft auch kein Hinweis auf Großbritannien, KOMMENTAR Michael Wunder, Mitglied des Deutschen Ethikrates Der Bundesgerichtshof (BGH) hat ein Tor geöffnet, an dem schon lange gerüttelt wird und das schwer zu schließen sein wird. Das Embryonenschutzgesetz scheint mir immer noch völlig eindeutig: Eine Kontra Zulassung PID Eizelle darf nur zum Zweck der Herbeiführung einer Schwangerschaft künstlich befruchtet werden. Das lässt meiner Ansicht nach weder zu, Eizellen auf Probe zu erzeugen, noch wie der BGH es tut, die Präimplantationsdiagnostik als „unselbstständiges 31 Zwischenziel in einem Gesamtvorgang“ zu bewerten, wobei es auf den einzelnen aussortierten Embryo nicht ankommen soll. Jeder Embryo trägt von Anfang an das ganze Potenzial eines individuellen Menschen in sich, womit ihm Menschenwürde zukommt. Überall in der Welt, wo die PID erlaubt ist, weitet sich ihr Anwendungsbereich aus: von der Wegwahl risikobehafteter oder unerwünschter zur Auswahl erwünschter und für andere Zwecke nützliche Embryonen. Dennoch brauchen wir jetzt einen tragfähigen und Frieden herstellenden Kompromiss. Wie der aussehen kann, ist allerdings noch völlig offen. wo, Eugenik getrieben wurde, kann PID nicht getrieben werden. Doch das Prinzip der gezielten Auswahl der Gesunden und der Aussonderung der Behinderten kehrt mit ihr in die Gesellschaft zurück. Auch wenn Selektion als „Elektion“ oder positiv gewendet als „Wunschkindmedizin“ daherkommt. Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesärztekammer beteuerte in seinem „Diskussionsentwurf“ 2000, PID solle nur eng begrenzt zugelassen werden. Die Grenze wollte und konnte er freilich nicht benennen. Schließlich ist die wissenschaftliche Entwicklung im Fluss. Auch mag sich die Auffassung, was als behindert gilt, ändern. Die Europäische Gesellschaft für Reproduktionsmedizin und Embryologie listet derzeit 54 monogene Erbkrankheiten auf, die mittels PID analysiert werden können. Und man mache sich nichts vor: Wenn die Analyse des Geschlechts möglich und heiß ersehnt ist, dann wird sie vom Auftraggeber nachgefragt und vom Auftragnehmer schließlich erfüllt. Wenn auch bis auf weiteres im nahen Ausland. Nein, wer einmal auf der Rutschbahn sitzt, rutscht, bis er ganz unten landet. Auch wir hier in Deutschland sitzen jetzt drauf. Die Rutschbahn wurde, um im Bild zu bleiben, von den engagierten Wissenschaftlern aufgerichtet, die die IVF entwickelt haben. Aus den Anfängen ist ein ansehnlicher medizinisch-technischer Komplex – 120 Zentren allein in Deutschland, fast 70 000 Behandlungen jährlich – entstanden, der seine eigene Dynamik entwickelt. Da scheint es fast vermessen zu fragen, ob jene Paare, die natürlicherweise kein Kind bekommen können oder deren genetische Disposition ein behindertes Kind wahrscheinlich sein lässt, ihr Lebensglück nicht auch anders finden können – oder mit einem behinderten Kind finden. Wäre das wirklich zu▄ viel verlangt? Norbert Jachertz @ Ein Pro und Kontra vom Medizinrechtler Prof. Dr. jur. Jochen Taupitz und dem Behindertenbeauftragten der Bundesregierung, Hubert Hüppe, im Internet: www.aerzteblatt.de/102040 DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG Heft 42, 22. Oktober 2010 KOMMENTAR Prof. Dr. jur. Jochen Taupitz, Medizinrechtler Die verfassungsrechtliche Betrachtung der PID muss neben dem Schutz des Embryos auch den Schutz des betroffenen Elternpaares und insbesondere der Mutter einbeziehen. Der Schutz von Pro Zulassung PID Ehe und Familie nach Artikel 6 GG beinhaltet auch das Recht einer Behandlung ungewollter Kinderlosigkeit. Wenngleich der Kinderwunsch hierbei keineswegs das Recht auf ein bestimmtes Wunschkind begründet, sind doch die Interessen und Konflikte der potenziellen Eltern jedenfalls dann ernst zu nehmen, wenn sie wissen, dass sie einem besonders hohen Risiko der Vererbung einer schwerwiegenden genetisch bedingten Krankheit ausgesetzt sind. In einer solchen Situation ist es kaum überzeugend, der potenziellen Mutter bestimmte Informationsmöglichkeiten vor der Einnistung der befruchteten Eizelle zu verweigern, die sie nach der Einnistung ohne weiteres bekommen kann und zur Grundlage ihrer Abtreibungsentscheidung machen darf. Lehnt man die PID in dieser Situation ab, lässt man die Abtreibung dagegen zu, mutet man der Frau eine „Schwangerschaft auf Probe“ mit all den psychischen und physischen Belastungen einer späteren Abtreibung zu. Bezogen auf den Embryo bedeutet dies, dass man den Embryo erst weiter heranreifen lassen muß, um ihn dann wegen einer aus seiner genetischen Schädigung resultierenden Konfliktlage der Mutter doch abtreiben zu dürfen. Dies ließe sich allenfalls dann rechtfertigen, wenn hierdurch die Chancen des Embryos auf Leben erhöht würden. Das läßt sich jedoch nicht sagen. Denn dass sich Frauen in der Schwangerschaft eher zugunsten der Austragung des Kindes entscheiden, einen Embryo in vitro wegen eines gleichen pathologischen Befundes dagegen eher (oder gar „leichten Herzens“) ablehnen, ist empirisch nicht belegbar. Allerdings sollte – soweit möglich – alles unternommen werden, um der Frau das Austragen auch eines behinderten Kindes zu ermöglichen. Zudem sollte der PID (wie der Abtreibung) eine verantwortliche, auf das Leben gerichtete Beratung vorangehen. In dieser Weise sollte die Frau bei ihrer Entscheidung für das Leben unterstützt werden, muss ihr aber – wie das Bundesverfassungsgericht bezogen auf die Abtreibungssituation formuliert hat – die „Letztentverantwortung“ überlassen werden. Die geltende Rechtslage ist unbefriedigend – und zwar sowohl aus dem Blickwinkel derjenigen, die die PID (in Grenzen) befürworten, als auch aus Sicht derer, die sie völlig ablehnen. Denn das BGHUrteil lässt viele Fragen offen. Der BGH betont zwar, dass nur eine PID zur Ermittlung schwerer genetischer Schäden des Embryo nach geltendem Recht straflos sei. Dabei hat das Gericht aber nicht festlegt, wie schwer die (vermutete) Schädigung des Embryos sein muss und von wem die Grenzen festgelegt werden. Der vom BGH vergleichend herangezogene § 3 S. 2 ESchG, der den zulässigen Umfang einer Spermienselektion zur Vermeidung einer schwerwiegenden geschlechtsgebundenen Erbkrankheit regelt, macht dies von einer Festlegung der jeweiligen Landesbehörde abhängig. Eine solche ist aber, soweit ersichtlich, bisher in keinem Bundesland erfolgt. Damit sind auch die Grenzen einer zulässigen PID unklar. Insofern bedarf es dringend einer gesetzgeberischen Entscheidung. Eine Regelung der PID kann man sich nicht nur im Embryonenschutzgesetz, sondern eher noch im Gendiagnostikgesetz vorstellen, das ja seit dem 1. Februar 2010 unter anderem die pränatale Diagnostik regelt. Dann könnte z.B. auch die vom BGH offengelassene Frage beantwortet werden, ob das Verbot einer pränatalen Diagnostik zur Ermittlung spät manifestierender genetisch bedingter Krankheiten auch für die PID gelten soll. Langfristiges Ziel muss allerdings die Erarbeitung eines umfassenderen Fortpflanzungsmedizingesetzes bleiben. 32 DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG Heft 42, 22. Oktober 2010 KOMMENTAR Hubert Hüppe, Behindertenbeauftragter der Bundesregierung PID heißt, Embryonen extrakorporal zu erzeugen, um sie nach genetischen Kriterien zu selektieren. Nur zur Ermöglichung der Selektion wird IVF bei in der Regel fortpflanzungsfähigen Patienten eingesetzt. PID zielt darauf ab, die Geburt von Menschen mit bestimmten Anlagen zu verhindern, indem man unter einer Mehrzahl erzeugter IVF-Embryonen solche mit unerwünschten Anlagen identifiziert und tötet bzw. sterben lässt. Letzteres wurde gelegentlich schon feinsinnig als „beiseitelegen“ Kontra Zulassung PID umschrieben – der Euphemismus enthüllt mehr, als er verschleiert. Zunächst zeigen die seit Jahren von der European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) dokumentierten Erfahrungen des Auslands, dass der Anwendungsbereich einer einmal zulässigen PID immer weiter ausgedehnt wird, bis hin zur Geschlechtsselektion als „social sexing“. In Deutschland scheuen sich die PID-Befürworter, einen Katalog über lebenswertes und unwertes Leben zu erstellen. Doch genau diese Entscheidung wird nach jeder PID getroffen. Zudem erfüllen, wenn man die 2009 publizierten ESHRE-Daten liest, IVF und PID nur einer Minderzahl Betroffener den Wunsch nach einem „gesunden“ Kind. Nur jede fünfte Frau bekommt nach PID überhaupt ein Kind. Auch nach PID finden Abtreibungen und Fetozide statt, und einige Kinder kommen trotz aller Untersuchungen behindert zur Welt. Wie fühlt sich eigentlich die ganz große Mehrheit der Paare, die leer ausgeht. Würde bei diesen Menschen nicht noch viel mehr von dem Leid ge- schaffen, von dem immer im Zusammenhang mit der PID-Diskussion gesprochen wird? Vor allem: PID diskriminiert Menschen, die mit Behinderungen, Krankheiten oder Veranlagungen leben, die Grundlage und Selektionsmerkmal einer PID einschließlich „Verwerfen“ betroffener Embryonen sind. Kann es einen abschließenden Katalog „besonders schwerwiegender“ Veranlagungen oder Behinderungen geben, wo PID „eng begrenzt“ zulässig wäre? Eine rechtlich – und wenn auch nur konditioniert – zulässige PID würde uns und diese Menschen jeden Tag damit konfrontieren, dass nicht nur ihre Existenz heutzutage dank PID vermeidbar wäre, sondern auch damit, dass die Vermeidung ihrer Existenz qua PID heute Konsens aller Demokraten wäre. Könnten die Betroffenen, könnten wir das aushalten, könnten wir das ethisch vertreten? Widerspricht das nicht allem, was wir zum Umgang mit Krankheit und Behinderung in den letzten Jahrzehnten dazugelernt und für richtig gehalten haben? Wollen wir dennoch einen solchen Weg einschlagen, und wenn: warum? Die Antwort auf dieses „warum“ ist schuldig, wer heute für die Zulässigkeit der PID eintritt. Es gibt etliche tragbare Alternativen zu PID, darunter die in Deutschland gut etablierte Polkörperdiagnostik (das Ärzteblatt hatte berichtet), und damit ethisch gangbarere Wege als PID. Der Gesetzgeber muss ein gesetzliches Verbot der PID aussprechen. Er hat zuletzt im Gendiagnostikgesetz geeignete Anknüpfungspunkte formuliert. Und er darf sich dabei nicht viel Zeit lassen, um Zweifeln an seinen Grundüberzeugungen keinen Raum zu geben. Heft 42, 22. Oktober 2010 RECHTSREPORT PID zur Entdeckung schwerer genetischer Schäden rechtens Der mit dem Embryonenschutzgesetz verfolgte Zweck des Schutzes von Embryonen vor Missbräuchen steht der Durchführung einer Präimplantationsdiagnostik (PID) nicht entgegen. Das Embryonenschutzgesetz erlaubt die extrakorporale Befruchtung zur Herbeiführung einer Schwangerschaft ohne weitere Einschränkungen. Dies hat das Bundessozialgericht (BSG) entschieden. Damit ist der angeklagte Frauenarzt vom Vorwurf einer dreifachen strafbaren Verletzung des Embryonenschutzgesetzes freigesprochen worden. Er führte in den Jahren 2005 und 2006 bei drei Paaren die Präimplantationsdiagnostik an pluripotenten, das heißt nicht zu einem lebensfähigen Organismus entwicklungsfähigen Zellen durch. Die Untersuchung diente dem Zweck, nur Embryonen ohne genetische Anomalien übertragen zu können. In allen drei Fällen lag nämlich bei einem der Ehepartner der Paare eine genetisch bedingte Erkrankung vor. Zum Teil hatten die Patientinnen bereits behinderte Kinder geboren. Das Tun des angeklagten Frauenarztes war von dem Willen getragen, bei den von ihm behandelten Frauen – von denen die entnommenen Ei- 33 zellen auch stammten – eine Schwangerschaft herbeizuführen. Die Untersuchung der Embryonen stellt nach Auffassung des Gerichts kein durch § 2 Absatz 1 Embryonenschutzgesetz verbotenes „Verwenden“ oder eine missbräuchliche Anwendung von Fortpflanzungstechniken nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 Embryonenschutzgesetz dar. Der Gesetzgeber wollte damals durch das Embryonenschutzgesetz die extrakorporale Befruchtung nur unter der Voraussetzung erlauben, dass sie auf die Herbeiführung einer Schwangerschaft abzielt. Hiermit sollten zugleich vor allem die verbrauchende Embryonenforschung und gespaltene Mutterschaften unter Strafandrohung verboten werden. Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass sowohl eine ausdrückliche Ablehnung oder auch Billigung der PID weder im Wortlaut des Gesetzes, noch in den Gesetzesmaterialien niederschlägt. Vielmehr würde mit dem Ausschluss der PID sehenden Auges das hohe Risiko eingegangen, dass ein nicht lebensfähiges oder schwer krankes Kind geboren wird. Dies bedeutet nicht die unbegrenzte Selektion anhand genetischer Merkmale. Gegenstand der Entscheidung ist nur die Untersuchung von Zellen auf schwerwiegende genetische Schäden. (Bundesgerichtshof, Urteil vom 6. Juli 2010, Az.: 5 StR 386/09) RAin Barbara Berner DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG Heft 42, 22. Oktober 2010 PRÄIMPLANTATIONSDIAGNOSTIK Das Parlament ist gefragt Foto: Caro In den Ländern, in denen die PID prinzipiell zugelassen ist, besteht oft gleichzeitig ein hoher Druck, den Anwendungsbereich zu erweitern. TABELLE Rechtlicher Status der PID in Europa Zulässig Belgien Dänemark Großbritannien Frankreich Griechenland Niederlande Norwegen Schweden Spanien Unklar Finnland Italien Luxemburg Portugal Verboten Deutschland Österreich Schweiz Quelle: Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg ie Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) vom Juli, die Präimplantationsdiagnostik (PID) in Deutschland grundsätzlich zuzulassen, lässt es innerhalb der schwarz-gelben Koalition einmal mehr knirschen und krachen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach sich jetzt mit Nachdruck für ein Verbot der PID aus. Ganz anderer Meinung ist der Koalitionspartner: „Wir wollen klarstellen, dass die PID ohne jeden Zweifel möglich ist“, sagte bereits Anfang Oktober die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP, Ulrike Flach. Sie müsse jedoch „auf schwere genetische Krankheitsdispositionen“ beschränkt bleiben und dürfe nur von geschultem Personal an lizenzierten Zentren vorgenommen werden. Doch genau bei diesem Punkt haben Unionspolitiker Zweifel. Allerdings genügen Lippenbekenntnisse jetzt nicht mehr, denn aus der Welt schaffen lässt sich das BGHUrteil nur mit einem neuen Verbotsgesetz. Für Dr. med. Peter Liese, CDU-Abgeordneter im Europäischen Parlament, ist klar: „Der Bundestag muss eine Entscheidung für ein klares Verbot treffen. Die Er- D fahrungen im Ausland zeigen, dass man die PID nicht begrenzen kann.“ Tatsächlich werden zum Teil in den Ländern, in denen die PID zugelassen ist (Tabelle), auch Erkrankungen diagnostiziert, die erst in späteren Lebensjahren zu Symptomen führen. Der Pädiater verweist dabei auf die polyzystische Nierenerkrankung, die Bestimmung des BRCA-Gens als Marker für eine erhöhte Wahrscheinlichkeit einer künftigen Brustkrebserkrankung oder die Polyposis coli, bei der ein sehr hohes Risiko besteht, an Darmkrebs zu erkranken. „Eine sehr intensive Vorsorge und gegebenenfalls die Entfernung des Darmes können jedoch ein relativ gesundes Leben bis ins hohe Alter ermöglichen“, erläutert Liese. Gleichzeitig treibt den Mediziner noch eine andere Sorge um: „In Großbritannien, Belgien und anderen Ländern ist es mittlerweile Praxis, dass Embryonen nicht nur auf die Frage hin selektiert werden, ob sie selbst in ihrem späteren Leben erkranken werden. Stattdessen werden gezielt Designerbabys hergestellt, um ein betroffenes Geschwisterkind zum Beispiel durch eine Knochenmarkspende zu behandeln.“ Auch Geschlechtsbestimmungen eines Kindes durch PID seien an der Tagesordnung: Eltern in Großbritannien haben vor Gericht angeführt, dass dringend ein Mädchen geboren werden müsse, da sie bereits drei Jungen haben und ein Mädchen durch einen Unfall ums Leben gekommen sei. Das „psychologische Gleichgewicht“ der Familie könne nur durch die Geburt eines Mädchen wiederhergestellt werden. Um solche und ähnliche Selektionen zu vermeiden, verweisen PID-Befürworter auf begrenzte PID-Indikationen – so wie sie beispielsweise in Frankreich existieren. Es sei nahezu unmöglich, zwischen einer schwerwiegenden und einer weniger schwerwiegenden genetischen Krankheit zu unterscheiden, sagte Merkel. In der Tat hängt die phänotypische Ausprägung nicht nur von der Genetik ab. Zudem werden Krankheiten subjektiv unterschiedlich wahrgenommen. „Wir würden mit einer Liste ein Urteil darüber treffen, ob das Leben mit der Erkrankung lebenswert ist oder ein Kind abgetrieben werden muss“, erläutert auch Liese dem Deutschen Ärzteblatt. Gleichzeitig verweist der Arzt auf das CDUGrundsatzprogramm, das beginnend mit der Verschmelzung von Samen und Eizelle den besonderen Schutz des ungeborenen Lebens und den kritischen Umgang mit den sich weiterentwickelnden Möglichkeiten der Pränataldiagnostik vorsieht. Explizit schließe es die PID aus. „Ich gehe davon aus, dass sich die meisten CDU-Abgeordneten daran gebunden fühlen“, meint der CDU-Politiker. Zeigen wird sich dies auf dem CDU-Bundesparteitag im November, auf dem man sich mit dem PID-Verbot befassen will, wie die Kanzlerin ankündigte. Eine weitere bioethische Zerreißprobe steht mit der erneuten Debatte um die PID dann auch dem Parlament bevor. Parallel beschäftigt sich ebenso der Deutsche Ethikrat mit dem Thema. Voraussichtlich bis zum Sommer 2011 will er eine Stel▄ lungnahme zur PID erarbeiten. Dr. med. Eva Richter-Kuhlmann 34 DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG Heft 44, 5. November 2010 PRÄIMPLANTATIONSDIAGNOSTIK Eile ist kein guter Berater Dr. med. Eva Richter-Kuhlmann ährend in den vergangenen Wochen und Monaten das Urteil des Bundesgerichtshofs zur Präimplantationsdiagnostik (PID) nur ein vergleichsweise geringes gesellschaftliches, politisches und mediales Echo gefunden hat, kann es nun der Regierungskoalition offensichtlich gar nicht schnell genug gehen, eine Entscheidung über die umstrittene Methode herbeizuführen. Sowohl bei Union als auch bei den Liberalen herrscht Eile in dieser Frage. Sogar von einer Abstimmung im Parlament noch vor Weihnachten war bereits die Rede. „Wir müssen nicht weiter diskutieren, sondern brauchen eine schnelle Entscheidung“, sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP, Ulrike Flach, in einem Zeitungsinterview. Die PID sei eine Methode, die seit Jahren bereits im Ausland praktiziert werde. Neuigkeiten gebe es nicht, meinte die langjährige Befürworterin der Methode, die gemeinsam mit Fraktionskollegen einen Antrag zur Zulassung der PID in den Bundestag einbringen will. Eilig haben es auch einige Unionspolitiker – jedoch unter einem anderen Vorzeichen. Nachdem sich jüngst Bundeskanzlerin Angela Merkel für ein Verbot der PID ausgesprochen hat, drängen sie darauf, dies rasch gesetzlich festzuschreiben. „Der Bundestag muss möglichst schnell entscheiden, ansonsten werden Fakten geschaffen, die nur schwer wieder rückgängig zu machen sind“, sagte Dr. med. Peter Liese, gesundheitspolitischer Sprecher der Christdemokraten im Europäischen Parlament. Dabei verwies er auf Reproduktionskliniken, die jetzt schon neue Mitarbeiter suchten, um die PID anbieten zu können. Eine Zulassung der PID in engen Grenzen hält Liese nicht für praktikabel. Dies zeige die Erfahrung aus dem Ausland. Gleichzeitig wies er auf die Alternative der Polkörperdiagnostik hin. Sie sei in Deutschland legal, weil hier nicht der Embryo untersucht werde, sondern die Eizelle vor Abschluss der Befruchtung. Gemeinsam mit Hubert Hüppe, Behindertenbeauftragter der Bundesregierung, und Prof. Dr. Patrick W 35 Sensburg (beide CDU) setzt sich Liese deshalb für ein eindeutiges Verbot der PID ein. Nach ihren Vorstellungen würde schon ein zusätzlicher Absatz in § 15 des seit Februar 2010 gültigen Gendiagnostikgesetzes ausreichen, um die PID zu verbieten. Möglich ist Sensburg zufolge eine Regelung, die besagt, dass vorgeburtliche Untersuchungen an extrakorporalen Embryonen mit der Zielsetzung, genetische und morphologische Eigenschaften oder das Geschlecht des Embryos festzustellen, nicht vorgenommen werden dürfen. Das Embryonenschutzgesetz müsste dazu nicht extra geändert werden, meinte der Jurist, der einen entsprechenden Gruppenantrag unterstützen will. Anfang nächsten Jahres soll der Bundestag abstimmen. Damit bleibt dem Parlament nicht mehr viel Zeit. Das ist ungewöhnlich. Bei bisherigen bioethischen Entscheidungen, bei denen der Fraktionszwang aufgehoben war, wurde dem Parlament für Gewissensentscheidungen mehr Einarbeitungs- und Bedenkzeit zugestanden. Diese benötigen einige Bundestagsabgeordnete auch, um sich mit der Problematik vertraut zu machen, beraten zu lassen und sich eine eigene Meinung zur PID zu bilden. Etwas weniger Eile täte der Debatte auf jeden Fall gut. Dr. med. Eva Richter-Kuhlmann Redakteurin für Gesundheits- und Sozialpolitik in Berlin Heft 47, 26. November 2010 PRÄIMPLANTATIONSDIAGNOSTIK Gespaltene Gesellschaft worter eines Verbots der PID und ließ die Befürworter einer Zulassung „in engen Grenzen“ nicht unzufrieden zurück. Von der FDP kam alsbald ein Signal in ihrem Sinne: Sie sehe, so die stellvertretende Vorsitzende und gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Ulrike Flach, „für unsere Position, eine eingeschränkte Zulassung der PID zu erreichen, jetzt eine sehr gute Chance auf eine Mehrheit im Parlament“. Ähnlich Carola Reimann (SPD), die Vorsitzende des Gesundheitsausschusses des Bundestages: Sie gab sich „zuversichtlich, dass wir für unsere Position einer eng begrenzten Zulassung der PID eine Mehrheit im Bundestag bekommen“. Die Kirchen suchen Lösungen Auf die Kirchen können sich die Christdemokraten in Sachen PID kaum verlassen. Bekennende Protestanten wie Peter Hintze plädierten für die „engen Grenzen“, andere, so Thomas Rachel namens des evangelischen Arbeitskreises der CDU/CSU, für ein Verbot. Beim ökumenischen Gottesdienst vor Beginn des Parteitags erinnerte der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Robert Zollitzsch, an die unveränderte kaFoto: ddp uf das christliche Menschenbild beriefen sich sowohl Gegner als auch Befürworter der Präimplantationsdiagnostik (PID) beim CDU-Parteitag in Karlsruhe am 16. November. Gemeinsam suchten sie nach einer Lösung für eine gesetzliche Regelung der PID. Die CDU fand letztlich keine. Nach einer dreieinhalbstündigen sachlichen und doch hochemotionalen, von gegenseitigen Respektsbezeugungen gekennzeichneten Debatte kam es zwar zu dem Beschluss, PID zu verbieten, doch der fiel denkbar knapp aus: 408 Delegierte forderten das Verbot, 391 befürworteten eine Zulassung in engen Grenzen. Abgestimmt hatten 814 Delegierte, das entspricht somit 51 beziehungsweise 49 Prozent der abgegebenen Stimmen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte sich in ihrer auf konservativ und christlich eingestimmten Rede auch zur PID geäußert und für ein Verbot ausgesprochen, „weil ich Sorge habe, dass wir die Grenzen nicht definieren können“. Später hatte sie mit einem rigorosen Eingriff in die Tagungsleitung dafür gesorgt, dass das Thema ohne Begrenzungen von Redezeit und Rednerliste diskutiert werden konnte. Das Ergebnis enttäuschte die Befür- A Foto: dpa [m] Der CDU-Parteitag votierte nur knapp für ein Verbot der PID. Auch die Kirchen und die Ärzteschaft sind uneins. „Wenn das Leben ein Geschenk Gottes ist, dann ist es nicht unter Bedingungen gegeben“, meint Julia Klöckner. Volker Kauder weist auf die Entwicklung der medizinischen Indikation der Abtreibung hin und fürchtet bei der PID ähnliche Ausweitungen. tholische Position: Das menschliche Leben beginne mit der Verschmelzung von Eizelle und Samen. Die Konsequenz: PID ist unzulässig, weil sie dazu führt, menschliches Leben zu „verwerfen“. Einen Monat zuvor hatte der neue Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirchen in Deutschland, Nikolaus Schneider, hingegen „seine Sympathie für das Bestreben, die PID unter eng gefassten Bedingungen zuzulassen“, kundgetan. So auch die PID-Befürworter bei der CDU. Allerdings konnten sie auf dem Parteitag nicht darlegen, wie und wo die „engen Grenzen“ zu ziehen sind. Auch wichen sie der Frage aus, ob nicht mit der Auswahl nach gesund oder erblich belastet, eine Bewertung von lebenswertem oder nicht lebenswertem Leben getroffen wird. All jene, die PID zulassen wollen, haben vielmehr die individuellen Schicksale betroffener Frauen und Paare im Blick. Und sie haben Bilder von betroffenen Frauen zur Hand, die sich sehnlich ein gesundes Kind wünschen, aber befürchten, eine genetische Belastung weiterzutragen. Bundesarbeitsministerin Dr. med. Ursula von der 36 DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG 37 ja, in welchem Umfang, die PID in Deutschland anwendbar ist oder nicht“, fordert Dr. med. Frank Ulrich Montgomery. Persönlich hält der Vizepräsident der Bundesärztekammer (BÄK) die PID für ethisch nicht vertretbar. „Als Bürger nehme ich aber zur Kenntnis, dass sich wahrscheinlich eine Mehrzahl der Menschen die Möglichkeit der PID für eng begrenzte Indikationen wünscht. Wenn es also nicht zu einem Verbot kommt, sondern zu einer Zulassung der PID, müssen wir Ärzte bereitstehen, einen ausufernden Missbrauch durch klare Regeln der Anwendung zu verhindern.“ Umstritten: Indikationsliste Vorschläge, wonach die BÄK einen Katalog derjenigen Indikationen ausarbeiten soll, bei denen eine Verwerfung des Embryos zulässig wäre, lehnt Montgomery jedoch als nicht zielführend ab, da er die Träger dieser Erbmerkmale stigmatisieren würde. „Ich bevorzuge eine Lösung wie bei der Lebendspende im Transplantationsgesetz. Wir sollten Einzelfallentscheidungen durch von der Ärztekammer eingesetzte Kommissionen vorsehen“, erklärte er gegenüber dem Deutschen Ärzteblatt. Nach seiner Ansicht sollten diese Kommissionen aus Ärzten, Juristen, Psychologen und Religionswissenschaftlern bestehen und sowohl die psychologische Situation des Paares betrachten als auch die Möglichkeiten und Alternativen zur PID ausloten. Eine ähnliche Lösung präferiert der Gynäkologe und langjährige PID-Befürworter Prof. Dr. med. Klaus Diedrich, Universität zu Lü- „Keine PID ohne In-vitro-Fertilisation“: Ursula von der Leyen hält das Verfahren für derart belastend, dass es den beschworenen „Dammbruch“ geradezu verhindere. Foto: action press Leyen vermochte aus ihrer ärztlichen Erfahrung heraus mit bewegenden Schilderungen das Plenum zu rühren. Den PID-Befürwortern kommt zudem entgegen, dass über den Beginn menschlichen Lebens kein Einvernehmen herrscht. Familienministerin Kristina Schröder zum Beispiel, die PID zulassen möchte, setzte den Beginn mit der Einnistung an. Der Embryo in der Petrischale bereitet ihr deshalb keine ethischen Probleme. Wiederholt wurde auf dem Parteitag der vermeintliche oder tatsächliche Widerspruch zwischen einer womöglich verbotenen PID und der erlaubten Pränataldiagnostik (PND) bemüht. Sei es nicht widersinnig, den Test des Embryos in der Petrischale zu verbieten, PND im Mutterleib mit der möglichen Folge einer Spätabtreibung aber zu gestatten?, fragten die PID-Befürworter. Die Antwort der Gegner: PID sei ein nüchtern geplanter Vorgang, während PND und Spätabtreibung mit einem schweren Konflikt bei der Mutter einhergingen. Das eine könne mit dem anderen nicht verglichen werden. Die Befürworter eines Verbots der PID argumentierten nicht mit dem Einzelfall, sondern grundsätzlich. Sie befürchten, die Grenzen würden sich nicht festlegen lassen, menschliches Leben werde qualifiziert, Behinderte diskriminiert. Sie gehen davon aus, dass menschliches Leben mit der Verschmelzung beginne und unterschiedslos von Anbeginn zu schützen sei. Diese Haltung deckt sich mit der geltenden Beschlusslage des Deutschen Ärztetages, dessen Delegierte sich bereits im Jahr 2002 für ein Verbot der PID ausgesprochen haben. Doch auch innerhalb der Ärzteschaft gehen – ähnlich wie innerhalb der politischen Parteien und der Kirchen – die Ansichten, ob die PID gesetzlich verboten werden sollte, weit auseinander. Konsens gibt es jedoch in einem Punkt: dem Wunsch nach Rechtssicherheit für die betroffenen Eltern und für die verantwortlichen Ärztinnen und Ärzte. „Am Ende dieser Debatte müssen klare gesetzliche Regelungen stehen, ob überhaupt, und wenn beck. „Die Paare sollten nach ausführlichen Informationsgesprächen entscheiden können, ob sie eine PID beantragen möchten. Die letztliche individuelle Entscheidung darüber, ob diese vorgenommen wird, sollte jedoch eine interdisziplinäre Kommission treffen, die bei der Bundesärztekammer angesiedelt ist und ihrer strengen Kontrolle unterliegt“, erläuterte er dem Deutschen Ärzteblatt. Es dürfe weder eine Indikationsliste noch eine „Ausweitung durch die Hintertür“, beispielsweise auf sich spät manifestierende Erkrankungen, geben. „Die PID kann in bestimmten Fällen hilfreicher als die PND sein“, betonte Diedrich. „Von allen schwierigen und zum Teil schlechten Lösungen ist sie immer noch die beste.“ Das bewiesen auch die internationalen Zahlen zur Anwendung der PID: „Es findet kein Dammbruch statt“, sagte der Gynäkologe. Das knappe Votum des CDU-Parteitages deutet er – obwohl es etwas mehr zu einem Verbot tendierte – als positives Signal: „Der Deutsche Bundestag wird im nächsten Jahr für eine begrenzte Zulassung der PID plädieren“, hofft er. Eine Freigabe der PID fordern auch die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe und der Berufsverband der Frauenärzte. „Ein Verbot der PID würde eine Entmündigung der Frauen und der Paare bedeuten, die eine erhebliche genetische Belastung in ihre Elternschaft mitbringen und die häufig bereits behinderte Kinder zu Hause betreuen“, schreiben sie in einem offenen Brief an die BÄK. Diese Frauen müssten eine neue Schwangerschaft mit einer hohen Wahrscheinlichkeit beginnen, dass diese später durch einen Abbruch beendet werde. Die Organisationen setzen sich deshalb für eine Beratungsregelung und eine selbstverantwortliche Entscheidung der Eltern ein. Gleichzeitig schlagen sie vor, eine PID-Indikationsliste und gegebenenfalls Aktualisierungen in die Hände einer bei der BÄK angesiedelten Ethikkommission zu ▄ legen. Norbert Jachertz Dr. med. Eva Richter-Kuhlmann DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG Heft 48, 3. Dezember 2010 ÜBERSICHTSARBEIT Pränataldiagnostik genetischer Erkrankungen Peter Wieacker, Johannes Steinhard ZUSAMMENFASSUNG Hintergrund: Die Pränataldiagnostik ist ein Teilbereich der klinischen Genetik und Frauenheilkunde. Sie ist ein typisches Beispiel für die effektive Verbindung von theoretischer und klinischer Medizin. Meilensteine auf diesem Weg waren einerseits die Entwicklung zytogenetischer, molekulargenetischer und molekularzytogenetischer Methoden und andererseits der Fortschritt in der Sonographie. Dieses Verfahren ermöglicht es, das Risiko invasiver Eingriffe zu senken und die Diagnostik von Fehlbildungen zunehmend früher und zuverlässiger zu gestalten. Methode: Es wird ein Überblick gegeben über selektiv recherchierte Literatur unter Berücksichtigung von Leitlinien und Empfehlungen. Ergebnisse und Schlussfolgerungen: Der häufigste Anlass für eine invasive Pränataldiagnostik ist der Wunsch nach einer Beurteilung des embryonalen/fetalen Chromosomensatzes. Monogen bedingte Erkrankungen können zunehmend pränatal diagnostiziert werden, wobei man je nach Fragestellung Gentests anwendet oder biochemisch untersucht. Polygen-multifaktorielle Erkrankungen können derzeit über genetische Tests nicht zuverlässig diagnostiziert, aber im Falle von Fehlbildungen teilweise durch Ultraschall pränatal festgestellt werden. Möglichkeiten und Grenzen invasiver und nichtinvasiver Verfahren der Pränataldiagnostik werden diskutiert. ►Zitierweise Wieacker P, Steinhard J: The prenatal diagnosis of genetic diseases. Dtsch Arztebl Int 2010; 107(48): 857–62. DOI: 10.3238/arztebl.2010.0857 Institut für Humangenetik, Universitätsklinikum Münster: Prof. Dr. med. Wieacker Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Bereich Pränatale Medizin, Universitätsklinikum Münster: Dr. med. Steinhard er Begriff Pränataldiagnostik umfasst die Gesamtheit aller diagnostischen Bemühungen, Informationen über das Embryo oder den Feten zu erhalten. Im engeren Sinne wird darunter die vorgeburtliche Diagnostik genetisch bedingter Erkrankungen oder deren Dispositionen verstanden. In Anbetracht der Fortschritte auf diesem Gebiet wurden 1998 von der Bundesärztekammer Richtlinien zur pränatalen Diagnostik von Krankheiten und Krankheitsdispositionen veröffentlicht (1). Bei etwa 4 % aller Neugeborenen liegt eine erblich bedingte oder mitbedingte Erkrankung vor. Erblich mit determinierte Krankheiten kann man in drei Gruppen einteilen: ● Chromosomenaberrationen ● monogen bedingte Erkrankungen, die jeweils auf eine einzelne mutierte Erbanlage zurückzuführen sind ● polygen-multifaktorielle Krankheiten, die jeweils durch mehrere Erbanlagen und exogene Faktoren bedingt sind. Im Folgenden werden die Möglichkeiten und Grenzen der Pränataldiagnostik chromosomaler Aberrationen und monogen erblicher Erkrankungen diskutiert. Auf die Ultraschalldiagnostik zur vorgeburtlichen Diagnostik von Fehlbildungen – isoliert oder im Rahmen übergeordneter Erkrankungen, die auch monogen vererbt werden können – wird in dieser Übersicht nicht eingegangen. D Pränataldiagnostik von Chromosomenstörungen Typische Anlässe für eine vorgeburtliche Chromosomendiagnostik sind: ● Das mütterliche Alter: Mit steigendem Alter der Mutter nimmt die Wahrscheinlichkeit einer Chromosomenstörung beim Kind zu (Grafik). Bei etwa der Hälfte der Chromosomenstörungen handelt es sich um eine Trisomie 21 (Down-Syndrom) (2). ● Das Ergebnis eines nichtinvasiven Screening-Verfahrens. ● Ein sonographischer Befund, der den Verdacht auf eine Chromosomenstörung nahelegt. ● Eine Chromosomenstörung wie Translokation, Inversion oder Insertion bei einem Elternteil. In diesem Fall ist die Wahrscheinlichkeit einer unbalancierten Chromosomenstörung beim Kind über das mütterliche altersbedingte Risiko erhöht. 38 DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG Fruchtwasserzellen zur Ergänzung der konventionellen zytogenetischen Diagnostik eingesetzt werden. Durch FISH-Analyse (Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung) mit chromosomenspezifischen Sonden an Interphasekernen oder durch molekulargenetische Untersuchungen von hochpolymorphen Markern an einer DNAProbe, die aus nativen Amnionzellen isoliert wurde, kann eine Aussage über numerische Störungen der Chromosomen 13, 18, 21, X und Y getroffen werden (Abbildung 2). Mit diesem Test kann man die häufigsten Chromosomenstörungen erfassen. Das Ergebnis der Untersuchung liegt bereits nach ein bis drei Tagen vor. Der Test ist vor allem dann bedeutsam, wenn im Ultraschall morphologische Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf die genannten Aberrationen hinweisen, und wenn bei fortgeschrittener Schwangerschaft kurzfristig ein Ergebnis angestrebt wird. Ein pränataler Schnelltest kann zwar bei unauffälligem Befund zur Beruhigung der Schwangeren beitragen, aber er kann die Karyotypisierung nicht ersetzen (htpp://gfhev.de/de/Leitlinien/ index.htm). GRAFIK 1 Chorionzottenbiopsie Wahrscheinlichkeit einer Chromosomenstörung beim geborenen Kind in Abhängigkeit vom mütterlichen Alter (nach Hooke, 1981) (2) ● Eine vorhandene Chromosomenstörung bei einem Kind des Paares: Zum Beispiel ist nach der Geburt eines Kindes mit einer freien Trisomie das Risiko einer numerischen Chromosomenaberration bei jedem weiteren Kind um circa 1 % gegenüber gleichaltrigen Eltern erhöht (3). Da für eine Chromosomenanalyse fetale Zellen erforderlich sind, ist ein entsprechender Eingriff notwendig. Hierfür stehen unterschiedliche Verfahren zur Verfügung, wobei die Wahl sich nach dem Schwangerschaftsalter, der Fragestellung und dem Eingriffsrisiko richtet (Tabelle 1, eKasten 1). Amniozentese Die Amniozentese wird typischerweise zwischen der 15. und 17. Schwangerschaftswoche post menstruationem (p.m.) unter sonographischer Kontrolle durchgeführt. Das eingriffsbedingte Fehlgeburtsrisiko liegt bei 0,5–1 % (3). In der Regel werden circa 15 mL Fruchtwasser entnommen. Für die Chromosomenanalyse ist zuvor eine Kultivierung der Amnionzellen erforderlich, die durchschnittlich zwei Wochen dauert. Anschließend werden Metaphasen numerisch und strukturell analysiert (Abbildung 1). Aus dem nativen Fruchtwasser bestimmt man das Alpha-Fetoprotein (AFP), dessen Konzentration bei offenen Neuralrohrdefekten, aber auch bei einigen anderen Spaltbildungen wie Gastroschisis erhöht ist. Bei erhöhtem AFP-Wert wird die Acetylcholinesterase als Marker für Neuralrohrdefekte bestimmt (eKasten 2). Im Rahmen einer Amniozentese kann zusätzlich ein sogenannter pränataler Schnelltest an unkultivierten 39 Die Chorionzottenbiopsie (CVS, „chorionic villus sampling“) wird typischerweise in der 11./12. Schwangerschaftswoche p.m. durchgeführt. Eine CVS sollte nicht vor der 11. Schwangerschaftswoche erfolgen, da das Risiko für Extremitätenfehlbildungen sonst ansteigt. Als Ursache hierfür wird eine plazentare Traumatisierung mit Gefäßinfarkten in einer kritischen Entwicklungsphase diskutiert. Die CVS kann je nach Lage des Chorions transzervikal oder transabdominal vorgenommen werden. Die Chromosomenanalyse erfolgt sowohl nach Direktpräparation oder Kurzzeitkultur (1 Tag) als auch nach Langzeitkultur (7–10 Tage). Bei entsprechender Erfahrung dürfte das eingriffsbedingte Fehlgeburtsrisiko in der Größenordnung von bis zu 1 % liegen (eKasten 3). Plazentapunktion Die Plazentapunktion entspricht im Prinzip einer transabdominalen Chorionzottenbiopsie zu einem späteren Zeitpunkt („late CVS“). Sie kann angewendet werden, wenn ein schnelles Ergebnis bei fortgeschrittener Schwangerschaft gewünscht wird. Kordozentese Bei der technisch anspruchsvollen Kordozentese wird die Nabelschnurvene präferentiell an der Plazentaansatzstelle punktiert. Häufigste Indikationen sind der Verdacht einer fetalen Anämie bei Rhesusinkompabilität, eine Parvo-B19-Infektion oder ein Hydrops fetalis. Die Kordozentese dient auch zur schnellen Karyotypisierung oder molekulargenetischen Diagnostik. Sie kann in der Regel ab der 16. bis 20. Schwangerschaftswoche p.m. je nach Indikation durchgeführt werden. Die Nabelschnurpunktion ist von Bedeutung, wenn bei fortgeschrittener Schwangerschaft ein schnelles Ergebnis angezeigt ist, zum Beispiel beim sonographischen Nachweis von Fehlbildungen oder schwerer Wachs- DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG tumsretardierung, die auf eine Chromosomenaberration hinweisen können. Das Ergebnis einer Chromosomenanalyse an Lymphozyten des Nabelschnurblutes kann nach drei bis fünf Tagen vorliegen. Grenzen der zytogenetischen Diagnostik Die pränatale Karyotypisierung ist ein zuverlässiges Verfahren, dem jedoch – wie jeder Untersuchung – Grenzen gesetzt sind. Diese können technischer oder biologischer Natur sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass keine fetalen Zellen gewonnen werden, liegt bei entsprechender Erfahrung unter 1 %. Selten kommt es zu Kulturversagern. Eine Limitation der zytogenetischen Diagnostik ist gegeben durch die optische Auflösung der Chromosomen. Strukturelle Chromosomenaberrationen, deren Größe unter dem erreichten optischen Auflösungsvermögen liegt, können nicht erkannt werden. Eine weitere Grenze betrifft die Detektion eines eventuellen chromosomalen Mosaiks, bei dem zwei oder mehr Zelllinien vorkommen. Ein Mosaik kann nur erkannt werden, wenn chromosomal aberrante Zellen in der untersuchten Probe vorhanden sind. Beim Nachweis bestimmter struktureller Aberrationen wie Translokation oder Inversion sind weiterführende Untersuchungen oft erforderlich (eKasten 4). Nichtinvasive Verfahren Die Indikationsstellung einer invasiven Pränataldiagnostik aufgrund des mütterlichen Alters wird zunehmend durch eine kombinierte Bewertung von Risikoparametern ersetzt, wobei das mütterliche Alter nur noch einen unter mehreren Parametern darstellt. Vor allem wegen des Abortsrisikos infolge der invasiven Methoden besteht ein Bedürfnis nach nichtinvasiven Verfahren als Alternativen zu den genannten Eingriffen. Neben dem mütterlichen Alter erlauben es spezielle biochemische Parameter aus dem mütterlichen Blut und sonographische Parameter des Kindes im 1. Trimenon, das Aneuploidierisiko individuell einzuschätzen. Bei der Beratung sollte man auf jeden Fall darauf hinweisen, dass durch solche nichtinvasive Verfahren lediglich eine Modifikation des mütterlichen altersbedingten Risikos für gewisse Chromosomenstörungen erreicht wird, eine Chromosomenaberration jedoch nicht ausgeschlossen werden kann. Sie können aber eine Entscheidungshilfe für oder gegen eine invasive Methode bieten. Nackentransparenzmessung Eine gesteigerte Nackentransparenz beim ungeborenen Kind ist mit einem erhöhten Risiko für eine chromosomale Störung und andere Erkrankungen (4) verbunden. Mithilfe einer sonographischen Messung der Nackentransparenz zwischen der 11+0 SSW und der 13+6 SSW lässt sich zusammen mit dem mütterlichen Alter und gegebenenfalls biochemischen Zusatzuntersuchungen ein individualisiertes Risiko für Aneuploidien wie Trisomie 21, 13 und 18 kalkulieren. Bei einer positiven Screeningrate von 5 % können so 80 % (nur TABELLE 1 Invasive pränataldiagnostische Methoden Technik Zeitpunkt Abortrisiko Anwendungsbereiche Chorionzottenbiopsie 11.–14. SSW ~1% – Chromosomenanalyse – Gendiagnostik – biochemische Diagnostik Amniozentese 15.–17. SSW 0,5 %–1 % – Chromosomenanalyse – Diagnostik offener Neuralrohrdefekte – Gendiagnostik – biochemische Diagnostik Plazentapunktion ab 15. SSW ~1% – Chromosomenanalyse – Gendiagnostik – biochemische Diagnostik Kordozentese ab 16.–20. SSW*1 ~1% – Chromosomenanalyse – hämatologische und biochemische Diagnostik Fetale Biopsie ab 20. SSW *2 – Diagnostik bestimmter Genodermatosen *1 je nach Indikation *2 Das Fehlgeburtenrisiko sollte von der durchführenden Einrichtung genannt werden. SSW, Schwangerschaftswoche Nackentransparenzmessung) respektive 90 % (Nackentransparenzmessung und biochemische Parameter) der Trisomie-21-Fälle detektiert werden (Tabelle 2). Die Nackentransparenzmessung ist jedoch nicht einer gezielten Fehlbildungsdiagnostik gleichzusetzen, die im Rahmen eines sogenannten erweiterten ErstTrimester-Screenings durch spezialisierte Ärzte durchgeführt werden kann. Ziel einer solchen weiterführenden sonographischen Untersuchung im genannten Zeitraum ist die Suche nach fetalen Auffälligkeiten/Fehlbildungen, wobei die Messung der Nackentransparenz integrativer Bestandteil ist. Die Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (DEGUM) (5) empfiehlt jedem Frauenarzt, der ein Zertifikat zur Nackentransparenzmessung erworben hat, aber keine spezielle Qualifikation in der Fehlbildungsdiagnostik besitzt, bei einem auffälligen Befund (erweiterte Nackentransparenz über der 95. Perzentile des jeweiligen Gestationsalters) und bei Mehrlingsschwangerschaften in ein entsprechendes Zentrum zu überweisen (DEGUM Stufe II oder III). Neben Chromosomenstörungen verbergen sich in diesem Risikokollektiv nämlich vermehrt weitere Erkrankungen wie zum Beispiel Herzfehler (4). Für eine aussagekräftige NT-Messung sind neben der Qualifikation des Untersuchers und der Wahl der angemessenen Untersuchungszeit auch gerätetechnische Voraussetzungen zu beachten. Unter Einbeziehung weiterer Ultraschallparameter – wie der Messung des Nasenbeins, der Beurteilung des Doppler-Profils der Trikuspidalklappe sowie des Ductus venosus und des fazialen Winkels – kann das individuelle Risiko für zum Beispiel Trisomie 21 mit Detektionsraten bis zu 95 % weiter präzisiert werden (Tabelle 2). 40 DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG Steiß-Länge ermittelt wird, erfolgt hier automatisch eine Kontrolle des Gestationsalters. Beim Triple-Test ist dies nicht der Fall. Die Labore berechnen die individuellen Risiken für Trisomie 21, 13 und 18 und für Neuralrohrdefekte über die durch den Frauenarzt angegebene Schwangerschaftswoche. Häufig wird dabei lediglich der Tag der letzten Regel zugrunde gelegt, was zu einer relativ hohen Fehleranfälligkeit führt. Nach eigener Erfahrung werden viele Paare durch einen falsch berechneten Triple-Test unbegründet verunsichert. Diese Tatsache und die Möglichkeit präziserer und früherer Risikoeinschätzungen von Chromosomenstörungen im 1. Trimenon sprechen gegen den Triple-Test. Pränataldiagnostik monogen bedingter Erkrankungen Abbildung 1: Karyogramm eines Feten mit Trisomie 18. Es sind drei Chromosomen 18 zu erkennen. An einem Chromosom 11 ist ein Bruch zu erkennen (Pfeil), der einem Präparationsartefakt entspricht. Abbildung 2: Nachweis eines Down-Syndroms (Trisomie 21) im Rahmen eines pränatalen Schnelltests durch FISH-Analyse mit Sonden, die jeweils spezifisch für die Chromosomen 13 (grün) und 21 (rot) sind. Die drei roten Signale weisen auf eine Trisomie 21 hin. Biochemische Parameter In den letzten Jahren hat sich die Bestimmung von Choriongonadotropin (freies βhCG) und „pregnancy-associated plasma protein A“ (PAPP-A) im mütterlichen Serum zwischen der 11. und 14. Schwangerschaftswoche in Kombination mit der Nackentransparenzmessung und dem mütterlichen Alter zunehmend etabliert (kombinierter Erst-Trimester-Test) (5). Davor wurde häufig der Triple-Test (6) angeboten, bei dem α-Fetoprotein (AFP), βhCG und freies Estriol (E3) zwischen der 15. und 20. SSW bestimmt werden. Ergänzt man den Triple-Test um einen weiteren biochemischen Parameter, Inhibin A, erhält man den sogenannten Quadruple-Test (7). Für die Auswertung der biochemischen Parameter ist die verlässliche Bestimmung des Gestationsalters von großer Bedeutung. Da bei der Bestimmung von PAPP-A und βhCG in Kombination mit der NT-Messsung immer auch die fetale Biometrie über zum Beispiel die Scheitel- 41 Man kennt derzeit etwa 5 000 erbliche Erkrankungen, die monogen nach den Mendelschen Regeln vererbt werden. Hier stehen autosomal-dominante, autosomalrezessive und X-chromosomale Vererbung im Vordergrund, bei denen deutlich höhere Erkrankungsrisiken bestehen als bei der Altersindikation. Bei einer autosomal-dominant erblichen Erkrankung beträgt die Wiederholungswahrscheinlichkeit der Krankheit für ein Kind eines betroffenen Elternteils a priori 50 %. Bei einer autosomal-rezessiv erblichen Krankheit beträgt die Erkrankungswahrscheinlichkeit für gemeinsame Kinder eines gesunden Überträgerpaares 25 %. Eine X-chromosomal-rezessiv erbliche Erkrankung birgt ein Erkrankungsrisiko für einen Sohn einer Überträgerin von 50 %. Gegenwärtig ist für mehr als 1 000 dieser Erkrankungen ein Gentest möglich, wobei es sich größtenteils nicht um eine Routinediagnostik handelt. Die pränatale Gendiagnostik ist nicht wie die zytogenetische Pränataldiagnostik aufgrund des mütterlichen Alters ein Screening-Verfahren. Wegen der Einzigartigkeit jedes Falls ist eine entsprechende Planung im Vorfeld erforderlich. Dabei sind zwei Strategien zu unterscheiden: der direkte und der indirekte Gentest. Beim direkten Gentest wird (werden) die infrage kommende(n) Mutation(en) nachgewiesen oder ausgeschlossen. Ein direkter Gentest zur Pränataldiagnostik setzt die Kenntnis der vorhandenen Mutation(en) beim Indexpatienten voraus. Beim indirekten Gentest wird der sogenannte Risiko-Haplotyp beim Feten nachgewiesen oder ausgeschlossen. Der indirekte Gentest nutzt das Prinzip der genetischen Kopplung. Ein indirekter Gentest setzt somit eine Familienuntersuchung voraus, bei der durch Kopplungsanalyse mit polymorphen Markern festgestellt wird, welche Allele eng benachbarter Marker in dieser Familie mit der Erkrankung einhergehen. Theoretisch reicht für einen indirekten Gentest in einer informativen Familie das Wissen um die Lokalisation des in Frage kommenden Gens. Eine diagnostische Unsicherheit besteht, wenn eine Locus-Heterogenität vorliegt, das heißt wenn Mutationen in unterschiedlichen Genen zur gleichen Erkrankung führen. Eine weitere, allerdings quantifizierbare Unsicherheit ist gegeben durch die Möglichkeit einer Rekombination zwischen DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG Gen und einem gekoppelten Marker. Es versteht sich von selbst, dass die zuverlässige Interpretation eines indirekten Gentests die Richtigkeit der angegebenen Abstammung voraussetzt. Bei einem pränataldiagnostischen Gentest ist im Hinblick auf die Konsequenzen eines positiven Befundes – insbesondere bei autosomal-dominant erblichen Erkrankungen – die Möglichkeit einer variablen Expressivität und einer verminderten Penetranz zu berücksichtigen. Eine variable Expressivität einer Mutation liegt vor, wenn der resultierende Phänotyp interoder intrafamiliär unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Eine verminderte Penetranz besteht, wenn die Durchschlagkraft einer Mutation nicht vollständig ist. In diesem Fall kann trotz vorhandener Mutation der Phänotyp unauffällig sein. Variable Expressivität und verminderte Penetranz lassen sich durch die Wirkung modifizierender Faktoren erklären, die derzeit größtenteils unbekannt sind. Es ist daher wichtig, im Rahmen einer genetischen Beratung auf diese gegebenenfalls vorliegende Problematik hinzuweisen. Aus zeitlichen und technischen Gründen wird ein Gentest meistens im Rahmen einer CVS durchgeführt, wobei nach DNA-Isolierung aus Chorionzotten meistens eine Polymerasekettenreaktion (PCR) zur Amplifikation der DNA vor einer eventuellen DNA-Sequenzierung erforderlich ist (eKasten 5). Erbliche Stoffwechselerkrankungen können teilweise biochemisch an Chorionzotten oder Amnionzellen diagnostiziert werden (10). Voraussetzungen hierfür sind, dass das entsprechende Gen in diesen Zellen exprimiert wird und der Stoffwechseldefekt an Fibroblasten (nach einer Hautbiopsie) eines Indexpatienten der Familie zuvor nachgewiesen wurde. Nach einigen Stoffwechselerkrankungen wird direkt im Fruchtwasserüberstand gefahndet (eKasten 6). Genetische Beratung bei Pränataldiagnostik Nach dem Gendiagnostikgesetz ist seit dem 1. 2. 2010 die Schwangere vor einer pränatalen Diagnostik und nach Vorliegen des Untersuchungsergebnisses genetisch zu beraten (11). Dabei sollten unter anderem folgende Punkte thematisiert werden: ● Vermittlung des Basisrisikos für angeborene Erkrankungen und Fehlbildungen, das alle Elternpaare tragen, und der individuellen Risikoerhöhung (zum Beispiel altersbedingtes Risiko bei der Mutter) ● Möglichkeiten und Grenzen der genetischen Pränataldiagnostik ● infrage kommende(s) Krankheitsbild(er) ● Risiken der möglichen Untersuchungen ● Konfliktsituation im Zusammenhang mit der Pränataldiagnostik ● Alternativen. Bereits die Möglichkeit einer Pränataldiagnostik kann Paare in schwierige Konfliktsituationen stürzen. In vielen Fällen trägt die Pränataldiagnostik zur Beruhigung der Eltern bei. Bei pathologischen Befunden kann sie derzeit leider nur in sehr seltenen Fällen durch eine TABELLE 2 Detektionsraten für Trisomie 21 in Abhängigkeit von den angewandten Screening-Parametern bzw. Testverfahren (modifiziert nach [8] und [9]. 1. Trimester (11.–14. SSW) maternales Alter 30–50 % PAPP-A, HCG, MA 60–63 % NT-Messung und MA 74–80 % kombinierter Test (NT, PAPP-A, HCG, MA) 86–90 % kombinierter Test und Nasenbein, Trikuspidalfluss, Ductus venosus, fazialer Winkel 95 % 2. Trimester (15.–19. SSW) maternales Alter 30–50 % 2. Trimester Double-Test (AFP, HCG, MA) 60 % Triple-Test (AFP, HCG, E3, MA) 68 % Quadruple-Test (AFP, HCG, E3, Inhibin A, MA) 79 % Ultraschall (16.–23. SSW) mit Screening nach Defekten und Markern 75 % Invasive Diagnostik Chorionzottenbiopsie Nahezu 100 % Amniozentese Nahezu 100 % MA, maternales Alter; modifiziert nach Bethune 2007 (8) und Nicolaides 2008 (9) *PAPP-A, pregnancy associated plasma protein A; HCG, humanes Chorion-Gonadotropin; NT, Nackentransparenz; AFP, Alpha-1-Fetoprotein; E3, Estriol frühzeitige Behandlung des Feten oder Kindes die Prognose verbessern. Der Nachweis einer schwerwiegenden Erkrankung oder Behinderung kann Anlass für einen Schwangerschaftsabbruch sein. Nach § 218 a Abs. 2 StGB ist der mit Einwilligung der Schwangeren von einem Arzt vorgenommene Schwangerschaftsabbruch dann nicht rechtswidrig, wenn der Abbruch – Zitat: „... unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen Lebensverhältnisse der Schwangeren nach ärztlicher Erkenntnis angezeigt ist, um eine Gefahr für das Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren abzuwenden, und die Gefahr nicht auf eine andere, für sie zumutbare Weise abgewendet werden kann“. In diesem Konflikt zwischen dem Wunsch der Eltern nach einem gesunden Kind und der grundsätzlichen Anerkennung des Schutzbedürfnisses des Ungeborenen stellt der Schwangerschaftsabbruch nach pränataler Feststellung einer Erkrankung oder Behinderung beim Kind „das unvollkommene Bemühen dar, eine im Kern nicht auflösbare Konfliktsituation zu beenden“ (1). Bei jeder genetischen Beratung, so auch bei einer Beratung vor und nach pränataler Diagnostik, gilt das Prinzip der Nicht-Direktivität. In diesem Zusammenhang sollte deutlich gemacht werden, dass ein pathologischer 42 DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG Befund keinesfalls einen Schwangerschaftsabbruch präjudiziert. Als Ergänzung zur genetischen Beratung im Rahmen einer Pränataldiagnostik kann als Zusatzangebot eine „psycho-soziale Beratung“ erfolgen. Diese kann aufgrund des oben genannten Konfliktpotenzials im Rahmen der vorgeburtlichen Diagnostik für die Ratsuchenden hilfreich sein und eine Auseinandersetzung mit den möglichen Konsequenzen der Diagnostik anbieten und bei einer drohenden Behinderung des Kindes Hilfe und Begleitung leisten. Gerade im Zusammenhang mit auffälligen Befunden ist unserer Erfahrung nach eine solche Beratung empfehlenswert. Nach dem neuen Schwangerschaftskonfliktgesetz, das zum 1. 1. 2010 in Kraft getreten ist, muss im Zusammenhang mit einer Abruptio medicinalis legalis über deren psycho-soziale Implikationen aufgeklärt werden. Gleichzeitig muss die Frau über das Recht zur psycho-sozialen Beratung durch eine geeignete Beratungsstelle und über die Option einer zusätzlichen fachärztlichen Beratung durch zum Beispiel spezialisierte Kinderärzte aufgeklärt werden. Dem Arzt, der die Indikation stellt, obliegt die Vermittlung dieser Beratungen. Zusätzlich ist nach Diagnosemitteilung eine dreitägige Bedenkzeit Pflicht, bevor die formale Indikation zur Abruptio gestellt werden darf (eKasten 7). Danksagung Die Autoren danken Prof. P. Propping (Bonn) für die kritische Diskussion. Interessenkonflikt Die Autoren erklären, dass kein Interessenkonflikt im Sinne der Richtlinien des International Committee of Medical Journal Editors besteht. LITERATUR 1. Bekanntgaben der Herausgeber: Bundesärztekammer: Richtlinien zur pränatalen Diagnostik von Krankheiten und Krankheitsdispositionen. Dtsch Arztebl 1998; 95(50): A 3238–44. 2. Hooke E: Rates of chromosome abnormalities at different maternal ages. Obstet Gynecol 1981; 58: 282–5. 3. Murken J: Pränatale Diagnostik. In: Murken J, Grimm T, Holinski-Feder E (eds.): Humangenetik. 7th edition. Stuttgart: Thieme Verlag 2006; 386–411. 4. Wald NJ, Morris JK, Walker K, Simpson JM: Prenatal screening for serious congenital heart defects using translucency: a meta-analysis. Pren Diagn 2008; 28: 1094–104. 5. Nicolaides KH, Azar G, Byrne D, Mansur C, Marks K: Fetal nuchal translucency: ultrasound screening for chromosomal defects in first trimester of pregnancy. BMJ 1992; 304: 867–89. 6. Wald NJ, Cuckle HS, Densem JW, et al.: Maternal serum screening for Down´s syndrome in early pregnancy. BMJ 1988; 297: 883–7. 7. Wald NJ, Densem JW, George L, Muttukrishna S, Knight PG: Prenatal screening for Down´s syndrome using inhibin-A as a serum marker. Prenat Diagn 1996; 16: 143–52. 8. Bethune M: Literature review and suggested protocol for managing ultrasound soft markers for Down syndrome: thickened nuchal fold, echogenic bowel, shortened femur, shortened humerus, pyelectasis and absent or hypoplastic nasal bone. Austr Radiol 2007; 51: 218–25. 9. Nicolaides K: Some thoughts on the true value of ultrasound. Ultrasound Obstet Gynecol 2007; 30: 671–4. 10. The Online Metabolic and Molecular Bases of inherited diseases (http://www.ommbid.com/) 11. Gesetz über genetische Untersuchungen bei Menschen (Gendiagnostikgesetz – GenDG). Bundesgesetzblatt 2009; Nr. 50. Anschrift für die Verfasser Prof. Dr. med. Peter Wieacker Institut für Humangenetik, Vesaliusweg 12–14, 48149 Münster E-Mail: [email protected] Manuskriptdaten eingereicht: 17. 11. 2009, revidierte Fassung angenommen: 11. 2. 2010. KERNAUSSAGEN ● Mit steigendem Alter der Mutter nimmt die Wahrscheinlichkeit einer Chromosomenstörung beim Kind zu. In etwa der Hälfte der Fälle liegt eine Trisomie 21 vor. ● Für die invasive Diagnostik von Chromosomenstörungen stehen unterschiedliche Verfahren zur Verfügung wie beispielsweise die Chorionzottenbiopsie oder Amniozentese. ● Durch sonographische Messung der Nackentransparenz zwischen der 11+0 Schwangerschaftswoche (SSW) und der 13+6 SSW lässt sich zusammen mit dem Alter der Mutter und gegebenenfalls biochemischen Untersuchungen ein individualisiertes Risiko für gewisse Aneuploidien wie Trisomie 21, 13 und 18 kalkulieren. ● Bei einem auffälligen Ultraschallbefund im 1. Trimenon und einem beim Ersttrimester-Screening entdeckten erhöhten Risiko für eine Chromosomenstörung sollte die Chorionzottenbiopsie als schnellstmögliche invasive Diagnostik angeboten werden. SUMMARY The Prenatal Diagnosis of Genetic Diseases Background: Prenatal diagnosis is a subfield of clinical genetics and gynecology that exemplifies the effective integration of theoretical and clinical medicine. Milestones in its history include the development of cytogenetic, molecular genetic, and molecular cytogenetic methods as well as advances in ultrasonography. The latter technique not only improves the safety of invasive procedures, but also enables earlier and more reliable diagnosis of congenital malformations. Methods: This article provides an overview of the subject in the light of selectively reviewed literature, guidelines, and recommendations. Results and conclusion: Invasive prenatal diagnosis is most commonly performed to assess the embryonal/fetal chromosome set. An increasing number of monogenic diseases can be diagnosed prenatally by either genetic or biochemical testing, depending on the particular disease being sought. Polygenic and multifactorial diseases cannot be reliably diagnosed by genetic testing at present, although a number of malformations can be ascertained prenatally by ultrasonography. We discuss the applications and limitations of invasive and noninvasive techniques for prenatal diagnosis. Zitierweise Wieacker P, Steinhard J: The prenatal diagnosis of genetic diseases. Dtsch Arztebl Int 2010; 107(48): 857–62. DOI: 10.3238/arztebl.2010.0857 ● Monogen erbliche Erkrankungen lassen sich teilweise durch Gentests pränatal diagnostizieren. ● Vor einer Pränataldiagnostik, die das Ziel verfolgt, genetische Erkrankungen zu erkennen, ist nach dem Gendiagnostikgesetz ab 1. 2. 2010 eine genetische Beratung vorgeschrieben. Dabei gilt – wie prinzipiell bei jeder genetischen Beratung – das Prinzip der Nicht-Direktivität. 43 @ Mit „e“ gekennzeichnete Literatur: www.aerzteblatt.de/lit4810 The English version of this article is available online: www.aerzteblatt-international.de eGrafik und eKästen unter: www.aerzteblatt.de/10m0857 DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG Heft 48, 3. Dezember 2010 LITERATURVERZEICHNIS HEFT 48/2010, ZU: ÜBERSICHTSARBEIT Pränataldiagnostik genetischer Erkrankungen Peter Wieacker, Johannes Steinhard eLITERATUR e1. Jackson LG, Zachary JM, Fowler SE, et al.: A randomized comparison of transcervical and transabdominal chorionic-villus sampling. The U.S. National Institute of Child Health and Human Development Chorionic-Villus Sampling and Amniocentesis Study Group. N Engl J Med 1992; 327: 594–8. e2. Multicentre randomised clinical trial of chorion villus sampling and amniocentesis. First report. Canadian Collaborative CVS-Amniocentesis Clinical Trial Group. Lancet 1989; 1(8628): 1–6. e3. Rhoads GG, Jackson LG, Schlesselman SE, et al.: The safety and efficacy of chorionic villus sampling for early prenatal diagnosis of cytogenetic abnormalities. N Engl J Med 1989; 320: 609–17. e4. Medical Research Council European trial of chorion villus sampling. MRC working party on the evaluation of chorion villus sampling. Lancet 1991; 337: 1491–9. e5. Caughey AB, Hopkins LM, Norton ME: Chorionic villus sampling compared with amniocentesis and the difference in the rate of pregnancy loss. Obstet Gynecol 2006; 108: 612–6. e6. Merz E, Meinel K, Bals R, et al.: DEGUM-Stufe-III-Empfehlung zur „weiterführenden“ sonografischen Untersuchung (= DEGUM Stufe II) im Zeitraum 11–14 Schwangerschaftstwochen. Ultraschall in Med 2004; 25: 218–20. e7. Nicolaides KH, von Kaisenberg CS: Die Ultraschalluntersuchung von 11–13+6 Schwangerschaftswochen. London: Fetal Medicine Foundation 2004; www.fetalmedicine.com e8. Gardner RJ, Sutherland GR: Chromosome abnormalities and genetic counseling. Oxford: University Press 2004. e9. Warburton D: De novo balanced chromosome rearrangements and extra chromosomes identified at prenatal diagnosis: Clinical significance and distribution of breakpoints. Am J Hum Genet 1991; 49: 995–1013. e10. Buchholz T, Vogt U, Clement-Sengewald: Polkörperdiagnostik in Deutschland – Erfahrungen und neue Entwicklungen. J Reproduktionsmed Endokrinol 2006; 4: 215–8. e11. Aymé S, Nippert I, Marteau T and the EUROCAT working group: Variations between European regions in termination rates for fetal abnormalities: why is it so? Medgen 1999; 11: 126. e12. DADA Study Group comprising Marteau T, Nippert I, et al.: Outcomes of pregnancies diagnosed with Klinefelter syndrome: the possible influence of health professionals. Prenat Diagn 2002; 22: 562–6. 44 DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG Heft 48, 3. Dezember 2010 EKÄSTEN HEFT 48/2010, ZU: ÜBERSICHTSARBEIT Pränataldiagnostik genetischer Erkrankungen Peter Wieacker, Johannes Steinhard eKASTEN 1 Herkunft der Zellen für pränataldiagnostische Maßnahmen Je nach Eingriff werden Zellen unterschiedlichen Ursprungs gewonnen. Das ist bei der Interpretation eines eventuellen Mosaiks von Bedeutung. Etwa drei Viertel der Zellen aus der Blastozyste entwickeln sich zu Trophoblastzellen, die die äußere Schicht der Chorionzotten auskleiden. Etwa ein Viertel der Blastozystenzellen werden zur inneren Zellmasse, die sich in Hypoblast und Epiblast differenziert. Aus dem Hypoblast entwickeln sich Chorion- und Amnionmesoderm. Aus dem Epiblast gehen die drei Keimblätter (Ektoderm, Mesoderm und Endoderm) sowie das Amnionektoderm hervor (eGrafik). eKASTEN 2 Zytogenetische Untersuchung von Amnionzellen Für die zytogenetische Analyse werden die Amnionzellen, die im Sediment nach Zentrifugation angereichert wurden, in Kultur genommen. Die Amnionzellen stammen aus dem Ektoderm des Feten (vor allem aus der Haut und den harnableitenden Wegen) sowie aus dem Amnionektoderm. Bei der Flaschenmethode werden mindestens zwei Kulturen angelegt, um das Risiko einer missglückten Anzucht zu minimieren und gegebenenfalls chromosomale Mosaike besser interpretieren zu können. Es werden mindestens 15 Metaphasen numerisch und davon mindestens 5 strukturell ausgewertet. Bei der In-situ-Methode werden mindestens 15 Metaphasen aus 6 Klonen analysiert. Bei der Chromosomenanalyse wird eine Bandenauflösung von mindestens 400 Banden (bezogen auf den haploiden Chromosomensatz nach ICSN) angestrebt (Leitlinie Zytogenetische Labordiagnostik: www.gfhev.de). 45 DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG eKASTEN 3 Zytogenetische Untersuchung von Chorionzotten und Abortrisiko bei der Chorinzottenbiopsie Die zytogenetische Analyse von Chorionzotten verlangt eine Untersuchung sowohl nach Direktpräparation oder Kurzzeitkultur (1 Tag) als auch nach Langzeitkultur (7–10 Tage), weil dadurch Zellen unterschiedlichen embryonalen Ursprungs überprüft werden können. Als Mindestanforderung bei der Chromosomenanalyse aus Chorionzotten wird eine Auflösung von 300 Banden (bezogen auf den haploiden Chromosomensatz) verlangt. Die Angaben über das Fehlgeburtsrisiko nach Chorionzottenbiopsie (CVS) variieren je nach Studie. In einer großen randomisierten Untersuchung (e1) bei 3 999 Schwangerschaften, fand man keinen Unterschied bezüglich der Abortrate im Vergleich zwischen transcervikaler und transabdominaler CVS. Eine kanadische Multicenterstudie (e2) mit 2 787 Frauen zeigte ebenso wie eine größere amerikanische Studie (e3) mit 2 959 Frauen keinen statistisch signifikanten Unterschied der Abortrisiken zwischen CVS und Amniozentese. Demgegenüber ergab eine europäische Multicenterstudie (e4) eine höhere Komplikationsrate der CVS gegenüber der Amniozentese. Eine kürzlich veröffentlichte Einzelcenterstudie (e5) verglich 5 243 CVS mit 4 917 Fällen ohne invasive Diagnostik und fand keinen Unterschied bezüglich des Abortrisikos. Insgesamt weisen die Daten darauf hin, dass Erfahrung und Ausbildung des Operateurs mit der CVS-Technik entscheidend für das Komplikationsrisiko sind. Bei entsprechender Erfahrung dürfte das Fehlgeburtsrisiko nach CVS in der Größenordnung von bis zu 1 % liegen. Nach Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (DEGUM) und der Fetal Medicine Foundation (FMF), London, ist bei einem auffälligen Ultraschallbefund im 1. Trimenon und einem im Rahmen des Erst-Trimester-Screenings erhöhten Risiko für eine Chromosomenstörung die Chorionzottenbiopsie als schnellstmögliche invasive Diagnostik anzubieten (e6, e7). Es ist einer Frau, die sich bei erhöhtem Risiko für eine Chromosomenstörung für eine Karyotypisierung entscheidet, nicht zumutbar, zum Beispiel Wochen bis zur Amniozentese warten zu müssen. Zumindest sollte sie über die mögliche Alternative einer frühen Karyotypsierung aufgeklärt werden. eKASTEN 4 Diagnostische Probleme bei der zytogenetischen Pränataldiagnostik Bei der konventionellen Chromosomenanalyse können strukturelle Veränderungen, deren Größen unter der erreichten optischen Auflösung liegen, nicht festgestellt werden. In letzter Zeit wurde eine Methode, die Array-CGH (Comparative Genomic Hybridization) entwickelt, die diese Grenze überwindet. Dabei erfolgt eine kompetitive Hybridisierung von Referenz-DNA und Patienten-DNA, die mit jeweils unterschiedlichen Fluoreszenz-Farbstoffen (rot und grün) markiert sind, auf einem Microarray. Bei einem solchen genomischen Array sind rasterförmig definierte Fragmente des Genoms zum Beispiel auf einem Glasobjektträger fixiert. Durch die Kohybridisierung von Referenz- und Test-DNA lassen sich unbalancierte Deletionen und Gewinne wie Duplikationen aufgrund eines verschobenen Rot-Grün-Verhältnisses erkennen. Auf dieser Art kann mann Mikrodeletionen und Mikroduplikationen, die bei der konventionellen Chromosomenanalyse nicht erkennbar sind, feststellen. Solche krankheitsrelevanten Veränderungen müssen allerdings von „copy number variants“ ohne klinische Bedeutung unterschieden werden. Es ist anzunehmen, dass diese Technologie in Zukunft für die Pränataldiagnostik bedeutsam sein wird, wenn entsprechende Microarrays für diese Fragestellung zuvor wissenschaftlich validiert worden sind. Die Beobachtung einzelner oder weniger Zellen mit einer Chromosomenaberration kann ein diagnostisches Problem darstellen. Man unterscheidet zwischen „echten Mosaiken“, bei denen die aberranten Zellen beim Feten oder nur in der Plazenta („confined placental mosaicism“) vorhanden sind, und Pseudomosaike, bei denen die aberrante(n) Zelle(n) in der Kultur entstanden ist (sind) oder möglicherweise als Präparationsartefakt zu werten (ist) sind. Für die Interpretation solcher Befunde hat sich eine international anerkannte Einteilung bewährt. Das weitere Vorgehen richtet sich nach dieser Einteilung unter Berücksichtigung des involvierten Chromosoms (e8). Zum Beispiel kann eine Kordozentese in bestimmten Fällen zur weiteren Abklärung unklarer Mosaikbefunde nach CVS oder Amniozentese eingesetzt werden. Ein weiteres diagnostisches Problem kann sich stellen, wenn eine Translokation oder Inversion festgestellt wird. Man sollte dann zunächst ermitteln, ob die chromosomale Anomalie von einem Elternteil vererbt wurde oder neu entstanden ist. Im ersten Fall, das heißt bei Vererbung, dürfte in der Regel nicht von einem erkennbar erhöhten Risiko für angeborene Erkrankungen auszugehen sein. Im zweiten Fall, das bedeutet einer de novo entstandenen reziproken Translokation oder Inversion, ist nicht auszuschließen, dass durch die Bruchereignisse ein Gen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Für die Abschätzung dieses Risikos stehen empirische Risikoziffern zur Verfügung. Die Wahrscheinlichkeit angeborener Erkrankungen oder Fehlbildungen beträgt bei einer de novo reziproken Translokation circa 6 % und bei einer de novo Inversion circa 9,4 %. Ferner ist es möglich, dass bei einer zytogenetischen Pränataldiagnostik ein Marker-Chromosom festgestellt wird. Ein Marker-Chromosom ist ein strukturell verändertes Chromosom, dessen Zusammensetzung mit konventionellen Bänderungsverfahren nicht bestimmt werden kann. Bei einem neu entstandenen MarkerChromosom beträgt die Wahrscheinlichkeit für angeborene Erkrankungen und Fehlbildungen durchschnittlich 15 % (e9). Durch spezielle Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) kann diese Wahrscheinlichkeit gegebenenfalls modifiziert werden. In jedem Fall sollte eine Ultraschallfeindiagnostik in einem ausgewiesenen Zentrum durchgeführt werden, um eventuelle Fehlbildungen festzustellen. Auf die Grenzen der Ultraschalldiagnostik ist dabei hinzuweisen. 46 DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG eKASTEN 5 Kontamination der Chorionzotten mit Zellen der Mutter als Fehlerquelle bei der Pränataldiagnostik monogen erblicher Defekte Im Falle einer Kontamination der Chorionzotten mit Zellen der Mutter ist das Risiko einer Fehldiagnose gegeben. Deshalb sollte bei einer solchen Diagnostik grundsätzlich eine Kontaminationskontrolle erfolgen. Dabei wird eine Alleltypisierung von „short tandem repeats“ an der DNA der Mutter und der DNA des Chorionbiopsats durchgeführt. Wenn im Chorionbiopsat zwei mütterliche Allele für einen Locus vorliegen, muss von einer Kontamination mit Zellen der Mutter ausgegangen werden. In diesem Fall ist ein erneuter Eingriff erforderlich. eKASTEN 6 Präimplantationsdiagnostik Im Gegensatz zur Pränataldiagnostik erfolgt die Präimplantationsdiagnostik (PID) an Embryonalzellen vor Eintritt einer Schwangerschaft. Hierfür ist eine In-vitro-Fertilisation (IVF) oder eine intrazytoplasmatische Injektion (ICSI) erforderlich. Nach Kultivierung des Embryos bis zum 8-Zellstadium wird typischerweise eine Zelle (Blastomere) entnommen, die man molekularzytogenetisch oder molekulargenetisch untersucht. Anwendungsgebiete der PID sind: ● Nachweis oder Ausschluss einer spezifischen unbalancierten Chromosomentranslokation, wenn ein Elternteil Träger einer Robertsonschen oder reziproken Translokation ist. ● Nachweis oder Ausschluss einer bestimmten Mutation bei einem erhöhten Risiko für eine monogen erbliche Erkrankung. Da aufgrund des Embryonenschutzgesetzes eine PID in Deutschland nicht durchgeführt wird, gehen die Autoren in diesem Zusammenhang nicht auf die Grenzen und Risiken dieser Methode ein. Aufgrund eines kürzlich ergangenen Urteils wird die rechtliche Bewertung der PID zurzeit erneut diskutiert. Die Polkörperdiagnostik (PKD) ist eine präkonzeptionelle Untersuchung der Eizelle, die teilweise eine Alternative zur PID darstellt. Sie setzt eine IVF oder ICSI voraus. Der erste Polkörper entsteht nach der 1. meiotischen Teilung und enthält ein haploides Genom aus normalerweise 23 Chromosomen, wobei jedes Chromosom aus zwei Chromatiden besteht. Der zweite Polkörper entsteht nach der 2. meiotischen Teilung, wobei jedes Chromosom aus einer Chromatide besteht. Der erste Polkörper entwickelt sich kurz vor der Ovulation. Der zweite Polkörper ist 5 bis 6 Stunden nach Eindringen des Spermiums in die Eizelle, also zum Beispiel nach ICSI, verfügbar. Um dem Embryonenschutzgesetz zu genügen, muss die PKD spätestens 20 Stunden nach der ICSI beendet sein, da nach dieser Zeit männlicher und weiblicher Vorkern miteinander verschmolzen sind und ein Embryo im Sinne des Embryoschutzgesetzes entstanden ist. Eine PKD kann man anwenden, wenn die Ratsuchende eine balancierte Translokation trägt oder wenn sie Anlageträgerin für eine monogen bedingte Erkrankung ist. Derzeit wird in Deutschland eine PKD in nur wenigen Zentren angeboten (e10). Entsprechende Fälle müssen rechtzeitig angemeldet werden, um die Frage der Machbarkeit zu klären. In der Reproduktionsmedizin erhofft man sich von der PKD eine Steigerung der Erfolgsrate nach ICSI, da man durch PKD chromosomal aberrante Eizellen vom Befruchtungsvorgang ausschließen könnte. eKASTEN 7 Entscheidungsspektrum nach Pränataldiagnostik Europäische Studien, in denen untersucht wurde, auf welcher Basis Paare bei einem pathologischen Befund nach Pränataldiagnostik einen Entschluss für das weitere Vorgehen fassen, zeigen, dass nicht nur die Art der Erkrankung, sondern auch regionale Unterschiede und Beratungskonzepte die Entscheidungsfindung beeinflussen. Nach der pränatalen Diagnose eines Down-Syndroms entschieden sich zum Beispiel in der italienischen Region Catania circa 67 % und in den meisten anderen europäischen Regionen circa 95 % für einen Schwangerschaftsabbruch (e11). Beim Klinefelter-Syndrom betrug die Rate an Schwangerschaftsabbrüchen durchschnittlich 44 % (zwischen 0 und 76 % je nach Zentrum) (e12). 47 DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG Heft 48, 3. Dezember 2010 EGRAFIK HEFT 48/2010, ZU: ÜBERSICHTSARBEIT Pränataldiagnostik genetischer Erkrankungen Peter Wieacker, Johannes Steinhard eGRAFIK Embryonalentwicklung der Gewebe, die sich zur Pränataldiagnostik eignen (modifiziert nach 10); Etwa ein Viertel der Blastozystenzellen werden zur inneren Zellmasse. CVS, „chorionic villus sampling“ 48 DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG Heft 50, 17. Dezember 2010 XCELL-CENTER Das Dilemma der Übergangsfrist Seit 2007 führt das „XCell-Center – Institut für Regenerative Medizin“ bei unterschiedlichen Erkrankungen Stammzelltherapien durch, die mangels klinischer Prüfungen zwar ethisch umstritten, nach der Gesetzeslage aber noch möglich sind. Herstellungserlaubnis der Bezirksregierung reicht aus Der Grund liegt in einer komplexen und bislang lückenhaften Gesetzeslage. Noch bis Ende 2012 kann jeder seine auf dem Markt befindlichen (vorschriftsmäßig hergestellten) Produkte ohne behördliche Genehmigung für alle Indikationen anbieten, für die er einen Bedarf sieht. Nach dieser Übergangsfrist besteht (mit wenigen spezifischen Ausnahmen) für alle Produkte entsprechend der 2008 in Kraft getretenen europäischen Verordnung für „Arzneimittel für neuartige Therapien“ eine Zulassungspflicht bei der Europäischen Zulassungsbehörde EMA. Auch eine deutsche Gesetzesnovelle, die mittlerweile eine Genehmigung auf Bundesebene verlangt, greift nicht, da das XCell-Center die 49 als Arzneimittel eingestuften Zellen nicht „in den Verkehr bringt“. Stattdessen reicht dem Privatinstitut eine Herstellungserlaubnis der lokalen Bezirksregierung Köln, Stammzellen aus dem Knochenmark der Patienten zu entnehmen und zur autologen Anwendung aufzubereiten. Ein rechtlich möglicher ärztlicher Heilversuch dürfte nach der Anzahl behandelter Patienten offenbar auch nicht mehr vorliegen. Denn das XCell-Center hat nach eigenen Angaben seit seiner Eröffnung 2007 mehr als 4 000 Patienten mit Stammzellen behandelt – und dies bei folgenden Erkrankungen: amyotrophische Lateralsklerose, Morbus Alzheimer, Apoplexie, Arthrose, Diabetes mellitus Typ 1 und 2, kardiovaskuläre Erkrankungen, Makuladegeneration, multiple Sklerose, Morbus Parkinson, Verletzungen des Rückenmarks und zerebrale Lähmung. „Neben der therapeutischen Applikation als feste Größe legt das XCell-Center großen Wert auf die wissenschaftliche Erforschung der Stammzelltherapie“, heißt es auf der Webseite des Unternehmens. Diese Aussage wird von vielen Stammzellforschern und Fachgesellschaften bezweifelt. Bereits im Juni 2009 warnten die Deutsche Gesellschaft für Neurologie und die Deutsche Parkinson-Gesellschaft vor den Behandlungsmethoden des XCell-Centers, nachdem von diesem Institut behandelte Patienten bei Neurologen vorstellig geworden waren. Fehlender Nutzen, keinerlei wissenschaftliche Grundlagen – so lautet auch das Urteil einer Stellungnahme des Kompetenznetzwerks Stammzellforschung NRW vom 4. Februar, die von 13 renommierten Wissenschaftlern wie Prof. Dr. Hans Schöler (Münster), Prof. Dr. med. Oliver Brüstle (Bonn) und Prof. Dr. med. Jürgen Hescheler (Köln) unterzeichnet wurde. Dort heißt es: „Das Spektrum der Krankheiten, für die es bereits klinisch erprobte stammzellbasierte Behandlungsmethoden gibt, ist momentan noch gering. Andere Stammzellbehandlungen sind zur Zeit als experimentell einzustufen.“ Besondere Vorsicht sei geboten, wenn mehrere Krankheiten mit denselben Zellen behandelt würden. Frühzeitige Warnungen blieben ohne Konsequenzen Im April 2010 wurde auch die Poltik aufmerksam: Der SPD-Bundestagsabgeordnete René Röspel richtete eine Anfrage an das Bundesgesundheitsministerium (BMG), ob man angesichts der wiederholt formulierten Kritik an den im XCellCenter angebotenen Therapien nicht eine Änderung der bestehenden Gesetze für notwendig halte. Die Antwort des BMG durch den parlamentarischen Staatssekretär Daniel Bahr Anfang Mai lautete, dass das rechtliche Instrumentarium zum Verbraucher- und Patientenschutz bei Therapien mit Stammzellpräparaten ausreiche. Die Ärztekammer Nordrhein habe zwar vor kommerziellen Therapien mit Stammzellen gewarnt (24. August 2009 und 23. März 2010), aber keine Bedenklichkeit der Therapien oder verwendeten Präparate festgestellt. Eine erneute Anfrage des Abgeordneten Röspel an das BMG, ob man durch ein früheres Eingreifen den Tod des kleinen Jungen nicht hätte verhindern können, beantwortete die parlamentarische Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz wie folgt: Das rechtliche Instrumentarium zum Patientenschutz Foto: picture-alliance/BSIP itte Oktober enthüllte die „Wirtschaftswoche“, dass am 12. August ein kleiner Junge an den Folgen einer Gehirnblutung gestorben ist (DÄ, Heft 44/2010), nachdem ihm in einem privaten Therapiezentrum adulte Stammzellen mittels Ventrikelpunktion intrazerebral transplantiert worden waren. Diese Therapieform war zuvor nicht in klinischen Studien überprüft worden. Dennoch: Verboten sind die Eingriffe, die am „XCellCenter – Institut für Regenerative Medizin“ mit Sitz am Düsseldorfer Dominikus-Krankenhaus und am Eduardus-Krankenhaus in Köln durchgeführt werden, vom Gesetzgeber bislang nicht. Auf welcher Basis dürfen Ärzte und Unternehmen derartige Stammzelltherapien in Deutschland anbieten und anwenden, während dies in anderen Ländern – wie den Niederlanden – nicht gestattet ist? M DOSSIER: EMBRYONENFORSCHUNG liege in der Verantwortung der Länder – in diesem Fall also bei Nordrhein-Westfalen. Im dortigen Heilberufegesetz ist vorgeschrieben, dass unerwünschte Arzneimittelwirkungen der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft mitgeteilt werden müssen. Entsprechende Verstöße gegen die Berufsordnung können geahndet werden. Gesetzliches Schlupfloch für unseriöse Anwendungen Doch den Versuch, die Verantwortung für die nach § 4 a Arzneimittelgesetz (AMG) zulässige Ausnahmeregelung zur Gewinnung von Stammzellen den Ländern zuzuweisen, wirkt nach Angaben von Dr. med. Robert Schäfer, Geschäftsführender Arzt der Ärztekammer Nordrhein, „unglaubwürdig. Warum stellt denn das BMG die Bedenklichkeit nicht fest? Wahrscheinlich, weil man erkannt hat, dass das gesetzliche Schlupfloch für unseriöse Anwendungen durch die Feststellung der Bedenklichkeit nicht erreicht werden kann“. Vielmehr müsste der Gesetzgeber dem Anwender die Feststellung der Unbedenklichkeit auferlegen. „Aber das will man wohl nicht“, sagt Schäfer dem Deutschen Ärzteblatt. Die Ärztekammer Nordrhein bewerte die im XCell-Center vorgenommenen, teuer verkauften Behandlungen als einen Missbrauch der im Gesetz festgelegten Freiheit. Um das Berufsrecht der dort tätigen Ärzte einzuschränken oder zu unterbinden, benötige man entweder eine Beschwerde seitens der Patienten oder aber verwirklichte Tatbestände: „Das Kind muss wohl erst in den Brunnen gefallen sein, bevor wir etwas unternehmen können“, kritisiert Schäfer. Erst am 14. Oktober stufte das Paul-Ehrlich-Institut diese Form der Stammzelltherapie als „bedenklich“ im Sinne von § 5 Absatz 2 AMG ein. Danach ist es verboten, bedenkliche Arzneimittel bei einem anderen Menschen anzuwenden. Seither unterlässt das XCell-Center nach eigenen Angaben (Kasten) die umstrittene intrazerebrale Zellinjektion. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ermittelt derweil wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung – aber nicht gegen das XCell Center, sondern gegen die behandelnde Ärztin. Dazu liest man auf der Webseite des Unternehmens: „Nach dem ersten Fall einer Komplikation hatte der durchführende Neurochirurg von unserer Seite eine Abmahnung bekommen. Nach dem zweiten Komplikationsfall wurde die Zusammenarbeit mit ihr beendet. Die Komplikationen geschahen bedingt durch den chirurgischen Eingriff vor der eigentlichen Stammzellanwendung. Folglich stehen diese Ereignisse nicht in Bezug zu den Stammzellen.“ Und weiter: „Leider kann XCellCenter keine Wunder anbieten, und daher wird fälschlicherweise ein Skandal länger aufrechterhalten, während die tatsächliche Geschichte, dass viele Patienten die Erfahrung einer Verbesserung ihres gesundheitlichen Zustands erfahren haben, größtenteils unerwähnt bleibt.“ Injektionen von Stammzellen in Blut und Liquor – Verfahren für die ebenso der wissenschaftliche Nachweis der Wirksamkeit und Unbedenklichkeit aussteht – werden daher weiter durchgeführt. Dafür neh- men auch viele Patienten aus dem Ausland Mühen und immense Kosten auf sich – zum Teil mehrfach, weil das erhoffte Therapieziel primär nicht erreicht wurde. „The family is hoping to go back for more treatment, it’s just a matter of money“, sagt eine kanadische Mutter, deren Kleinkind wegen spastischer Zerebralparese im XCell-Center behandelt worden war, nachdem die erforderliche Geldsumme von 30 000 kanadischen Dollar (inklusive Reisekosten) mangels eigener Finanzkraft über öffentliche Barbecues, Konzerte und Golfturniere gesammelt worden war (www.wellandtribune.ca/ ArticleDisplay.aspx?e=2870494). Apropos Charity: Sogar die Ärztekammer Nordrhein ist angefragt worden, ob man bereit sei, den großen Veranstaltungssaal des Ärztehauses für eine Benefizveranstaltung zur Verfügung zu stellen, um damit die Therapiekosten für ein Kind zu sammeln, dessen Behinderung mit einer Stammzelltherapie ▄ geheilt werden sollte. Dr. med. Vera Zylka-Menhorn 3 FRAGEN AN . . . Dr. Cornelis H. Kleinbloesem, CEO-XCell-Center GmbH Hat das XCell-Center klinische Studien zur Stammzelltherapie durchgeführt? Wenn ja, in welchen Indikationen? Kleinbloesem: Die XCell-Center GmbH führt derzeit klinische Prüfungen zur Stammzelltherapie im Hinblick auf zwei Indikationen durch: kritische Extremitätenischämie und Verletzungen des Rückenmarks. Die Anzahl der Probanden beträgt Minimum 40 beziehungsweise 120. Auch nach Angabe auf Ihrer Webseite führt XCell-Center derzeit präklinische und klinische Studien durch, die den Anforderungen der europäischen und amerikanischen Arzneimittelbehörden EMA und FDA entsprechen. So sei weltweit die erste doppelblinde placebokontrollierte Studie in der EU bei Patienten mit Querschnittslähmung initiiert worden. Können Sie dazu nähere Angaben machen – zum Beispiel zum Studienprotokoll? Kleinbloesem: Bezüglich der anderen Indikationen liegen uns aufgrund unserer mehrjährigen praktischen Tätigkeit auf dem Gebiet der autologen Stammzelltherapie einschlägige Erkenntnisse, insbesondere die Wirksamkeit und Sicherheit des Arzneimittels betreffend, vor. Nach Ihrer Webseite hat das XCell-Center die autologe Stammzelltherapie (neuro- chirurgische Eingriffe, Lumbalpunktionen) gestoppt. Für immer oder für einen begrenzten Zeitraum? Kleinbloesem: In Wahrnehmung unserer unternehmerischen Eigenverantwortung haben wir von der Herstellung (einschließlich der Entnahme) autologer Stammzellzubereitungen aus dem Knochenmark zur intrazerebralen/intraventrikulären Anwendung und deren intrazerebrale/intraventrikuläre Anwendung Abstand genommen. Wir werden in dieser Richtung erst nach Erteilung einer nationalen Genehmigung nach § 4 b AMG oder einer europäischen Genehmigung nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 tätig werden. 50