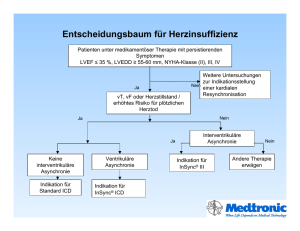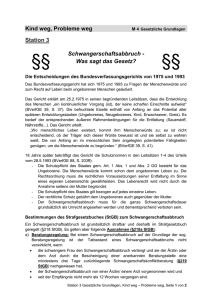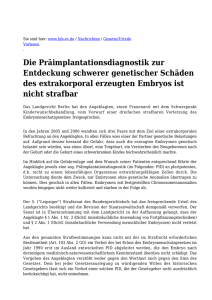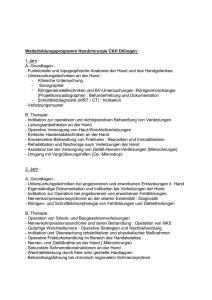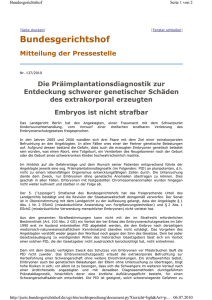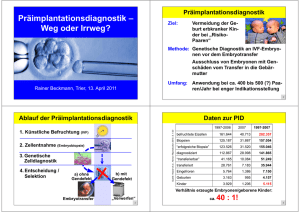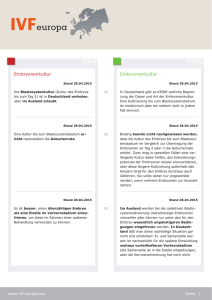Document
Werbung

Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften Association of the Scientific Medical Societies in Germany AWMF S Arbeitskreis "Ärzte und Juristen" Referate Geschäftsstelle | office: Moorenstr. 5, Geb. 15.12 (Heinrich-Heine-Universität) D-40225 Düsseldorf Tel. (0211) 31 28 28 FAX (0211) 31 68 19 e-mail: [email protected] AWMF online: http://awmf.org der Sitzung des Arbeitskreises “Ärzte und Juristen” am 04. und 05. April 2003 in Würzburg unter der Leitung von Prof. Dr. med. W. J. Bock Begrüßung und Einführung: Prof. Dr. med. W. J. Bock, Düsseldorf 1. Thema: Ist eine Änderung des Embryonen-Schutzgesetzes notwendig? - Prof. Dr. med. Klaus Diedrich, Gynäkologie und Geburtshilfe, Lübeck (Vortragsfolien): Tagung Arbeitskreis Ärzte u. Juristen, Würzburg 4.-5. April 03 Ist eine Änderung des Embryonenschutzes notwendig? Prof. Dr. med. K. Diedrich Klinik für Frauenheilkunde u. Geburtshilfe Universitätsklinikum Lübeck Folie 1 Folie 2 Bioethikgesetz in Frankreich 1983 1989 1993 1994 Folie 3 Gründung der nationalen Ethikkommission Entwurf des Bioethikgesetz – Diskussion und Kritik Mitterand: Das Bioethikgesetz ist eine parlamentarische Aufgabe erster Ordnung Diskussionspunkte zur Präimplantationsdiagnostik - Schwerpunkt ist der Wunsch der Eltern, nicht das Recht des Embryos (Fristenlösung) - Gefahr des Missbrauchs („Eugenik“) - Widerspruch: Verbot der Präimplantationsdiagnostik und Zulässigkeit der Pränataldiagnostik Bioethikgesetz wird verabschiedet: Präimplantationsdiagnostik in Ausnahmefällen zulässig Positives Votum der französischen Gesellschaft für Mukoviszidosekranke und Myopathien Folie 4 Protokoll Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ - 04.und 05. April 2003 - Seite 1 Gesetz zum Schutz von Embryonen Embryonenschutzgesetz (ESchG) Embryonenschutzgesetz – ESchG vom 13.12.1990 § 1: § 2: § 3: § 4: § 5: § 6: § 7: § 8: § 9: § 10: § 11: Missbräuchliche Anwendung von Fortpflanzungstechniken Missbräuchliche Verwendung menschlicher Embryonen Verbotene Geschlechtswahl Eigenmächtige Befruchtung, eigenmächtige Embryoübertragung und künstliche Befruchtung nach dem Tode Künstliche Veränderung menschlicher Keimbahnzellen Klonen Chimären- und Hybridbildung Begriffsbestimmung Arztvorbehalt Freiwillige Mitwirkung Verstoß gegen den Arztvorbehalt Folie 5 • §1 Abs. 2: Bestraft wird, wer es unternimmt, eine Eizelle zu einem anderen Zweck künstlich zu befruchten, als eine Schwangerschaft der Frau herbeizuführen, von der die Eizelle stammt. • §2 Abs. 1: Wer einen extrakorporal erzeugten oder einer Frau vor Abschluss seiner Einnistung in der Gebärmutter entnommenen menschlichen Embryo veräussert oder zu einem nicht seiner Erhaltung dienenden Zweck abgibt, erwirbt oder verwendet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Folie 6 Diskussionspapier zu den Vorbereitungen für ein Fortpflanzungsmedizingesetz (FMG) dafür: • Zulassung der Assistierten Reproduktion bei eheähnlicher Partnerschaft • Regelung der heterologen Insemination und Eizellspende • Verbesserung der Schwangerschaftsraten und Reduzierung der Mehrlingsraten • Zulässigkeit der Präimplantationsdiagnostik (strenge Indikationsstellung) • Einrichtung einer zentralen Registrierungs-, Beratungs- und Prüfstelle (analog der britischen HFEA) dagegen: • Ablehnung der Leihmutterschaft • Ablehnung des reproduktiven Klonens • Zurückhaltung bei therapeutischem Klonen Folie 7 Folie 8 Ungewollte Kinderlosigkeit Anzahl der Follikelpunktionen nach IVF und IVF/ICSI nach: Deutsches IVF Register , 1999 • 15 – 20 % aller Paare bleiben ungewollt kinderlos (in Deutschland ca. 1,2 Mio Paare) • Ungewollte Kinderlosigkeit ist eine Krankheit (WHO, 1974) 25000 20000 15000 10000 5000 • Jeder hat das Recht auf ein Kind (Weltbevölkerungskonferenz 1996) Folie 9 IVF IC SI 0 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Folie 10 Geburten bis 2002 Ziel in der Reproduktionsmedizin Geburt eines gesunden Kindes • In vitro Fertilisation (IVF) ca. 1,5 Mio Wie kann man das erreichen? • Intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI) ca. 800.000 • • • • • • Folie 11 Eizell- und Embryonenauswahl Vermeidung von Mehrlingsschwangerschaften In vitro Reifung von Eizellen Polkörperdiagnostik Präimplantationsdiagnostik Kryokonservierung von Embryonen Folie 12 Protokoll Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ - 04.und 05. April 2003 - Seite 2 Mehrlingsschwangerschaften 2000 Embryonenqualität nach Morphologie Tasdemir et al. 1995 Folie 13 Folie 14 Einfluss der Embryonenqualität (ICSI) SS-Rate/ET (%) 2 ideale Embryonen 28,98 2 nicht ideale Embryonen 12,62 Embryonenqualität und Schwangerschaftsrate 1 Embryo transferiert: 53,8 % Schwangerschaftsrate ∅ Mehrlinge Gerris et al. 1999 DIR 2000 Folie 15 Folie 16 Protokoll Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ - 04.und 05. April 2003 - Seite 3 Ablauf einer Präimplantationsdiagnostik Protokoll Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ - 04.und 05. April 2003 - Seite 4 Richtlinien zur Präimplantationsdiagnostik Die PID sollte zugelassen werden: • Indikation: hohes Risiko für schwere Erkrankung • Keine Indikation: • Für - Altersindikation - Geschlechtsbestimmung ohne Krankheitsbezug - In der Regel spät manifestierende Erkrankungen • Indikationsstellung durch Ethikkommission der Ärztekammer • Diagnostische Voraussetzungen: - Kompetente molekular- und zytogenetische Diagnostik • Aufklärung, Beratung, Einwilligung Paare, die ein hohes Risiko tragen ein Kind mit einer schweren und nicht wirksam therapierbaren genetisch bedingten Erkrankung zu bekommen und die mit dem Austragen eines davon betroffenen Kindes in einen existentiellen Konflikt geraten. • Fachliche, personelle und technische Voraussetzungen • Verfahrens- und Qualitätssicherung Votum des Nationalen Ethikrates, Januar 2003 Folie 29 Folie 30 Polkörperbiopsie Indikation zur Polkörperdiagnostik • Älter als 35 Jahre • Keine Fertilisationen nach IVF • Mehr als 2 Aborte Folie31 Folie 32 Häufigkeit der Aneuploidie bei Oozyten von jungen und älteren Frauen Junge Frauen ( 20-25 Jahre ) 17% Ältere Frauen (35-40 Jahre ) 79% Battaglia et al. 1996 Folie 33 Ergebnisse der Polkörperdiagnostik Zahl der Zyklen Oozyten normale Oozyten abnormale Oozyten 1297 1) 8382 47,9% 52,1% 50 2) 373 42% 58% 23 3) 156 48% 52% 1) Verlinsky et al. 2003 2) Montag et al. 2002 3)Schöpper et al. 2003 Folie 34 Zusammenfassung „Wenn die Gesellschaft sagt, dass die Entscheidung über eine Schwangerschaft aufgrund einer ärztlichen Diagnose erlaubt ist, dann heisst das für mich: Tu es so früh und so präzise wie möglich.“ • jedes Paar hat ein Recht auf ein eigenes Kind • wenn dies nur mit medizinischer Hilfe möglich ist, so ist es ethisch vertretbar • Die Reproduktionsmedizin der Zukunft soll - einfach - erfolgreich - wenig belastend (Einlingsschwangerschaft!) - und billig (hoffentlich) sein Mark Hughes, September 2000 Folie 35 • die Aufklärung der Patienten über Risiken, Chancen und Belastung hat oberste Priorität Folie 36 Protokoll Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ - 04.und 05. April 2003 - Seite 5 - Prof. Dr. med. Ingolf Schmid-Tannwald, Frauenklinik der LMU, München: „Die Präimplantationsdiagnostik – ein Beispiel für die Notwendigkeit des Embryonen-Schutzgesetzes“1 Dem Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ der Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlicher medizinischer Fachgesellschaften (AWMF) und insbesondere dessen Vorsitzendem, Herrn Prof. Dr. med. W. J. Bock aus Düsseldorf, gilt mein Dank für die Einladung zu dieser Tagung. Es ist mir eine große Ehre, Ihnen heute meine Überlegungen für den grundsätzlichen Erhalt des Embryonenschutzgesetzes vortragen zu dürfen, das die Erzeugung menschlicher Embryonen ausschließlich zur Behandlung steriler Paare und allein innerhalb des ärztlichen Heilungsauftrages zulässt, die Präimplantationsdiagnostik aber in der Form verbietet, wie sie der wissenschaftliche Beirat der Bundesärztekammer (BÄK) im März 2000 in die Diskussion gebracht hat. Doch kann sich ein Arzt ernsthaft gegen eine Diagnostik aussprechen? Ist nicht die Diagnostik, bekanntlich von den Göttern selbst vor die Therapie gesetzt, der elementare Bestandteil jeglichen verantwortungsbewussten ärztlichen Handelns? Die weiteren Ausführungen werden zeigen, dass es sich bei dieser Art der Präimplantationsdiagnostik nicht eigentlich um Diagnostik, sondern um Selektion, im Rahmen eines Produktions- bzw. Ausschlussverfahrens von menschlichen Embryonen und damit von Menschen mit bestimmten Eigenschaften handelt. Dieses Verfahren ist klar von modernen genetischen Untersuchungsverfahren zu unterscheiden, die im Rahmen der indizierten und durch das Embryonenschutzgesetz gestatteten IVF- Behandlung innerhalb des ärztlichen Heilungsauftrages zunehmend einen Platz beanspruchen. Dabei stellt sich die Frage ob, und ggf. inwieweit solche Ausleseverfahren ethisch gerechtfertigt sein könnten. Vom griechischen Wort „diagnostikon“ abgeleitet, versteht man unter „Diagnostik“ „alle auf die Erkennung einer Krankheit gerichteten Maßnahmen einschließlich der Diagnosestellung“ (Reallexikon Roche). Den Auftrag zur Diagnostik und damit den Heilungsauftrag erteilt der Patient einem Arzt seiner Wahl. Von diesem darf er erwarten, dass er die Grundsätze ärztlichen Handelns respektiert („primum nil nocere“ und „salus aegroti suprema lex“, heute erweitert durch die Informationspflicht und die Respektierung der Patientenautonomie). Ärztliche Ethik besagt, dem Patienten darf kein vorsätzlicher Schaden zugefügt werden. Die zweifellos rigorose, aber notwendig konsequente Forderung von Hufeland: „Der Arzt soll und darf nichts anderes tun, als Leben erhalten, ob es ein Glück oder Unglück sei, ob es Wert habe oder nicht, dies geht ihn nichts an. Und maßt er sich einmal an, diese Rücksicht in sein Geschäft aufzunehmen, so sind die Folgen unabsehbar und der Arzt wird der gefährlichste Mensch im Staate“2, dient dem Erhalt der unaufgebbaren Vertrauensbeziehung zwischen dem Patient und dem Arzt und ist die grundlegende und klassische Ordnungskonstante für die Heilkunde in einer humanen Gesellschaft. Diese Basis in ihrer Eindeutigkeit ist heute nicht mehr allgemein akzeptiert und vielleicht einer der Gründe für Probleme, die wir Ärzte aktuell beklagen. So haben viele Frauenärzte „die Last des Tötens auf sich genommen aus Verständnis und Hilfsbereitschaft für die Frauen“, wie es vor wenigen Jahren der damalige Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) in aller Offenheit bekannte.3 Dies ist u.a. eine Folge der Entwicklung einer quantitativen und qualitativen Geburtenkontrolle, die eine Entscheidung darüber ermöglicht, ob ein neuer Mensch auf die Welt kommen darf und ob er so, wie er ist, kommen darf (ein neuer Mensch – ja oder nein bzw. diesen Menschen – so nicht!). Die „Ausübung der Heilkunde“ und der ärztliche Heilungsauftrag sind – keine Frage - um das Töten „erweitert“ worden. Diese „Erweiterung“ hat auch auf andere Fachgebiete übergegriffen, wie die Legalisierung der aktiven Euthanasie in unseren Nachbarländern zeigt. Zweifellos handelt es sich bei dieser Entwicklung nicht lediglich um eine Erweiterung des Spektrums der Leistungen, die Ärzte im Rahmen der Ausübung der Heilkunde erbringen. Vielmehr erfahren dadurch die Rolle des Arztes, die Heilkunde und die heilkundlichen Fachbegriffe eine Umwertung ihres Wesens. In dem Maße nämlich, in dem das Töten eine Form der „Behandlung“ und der Arzt nicht mehr „Diener des Lebens“ ist bzw. sein will, ist die klassische Grundlage der Arzt- Patientenbeziehung aufgekündigt und die Ausübung der Heilkunde an anderen Werten orientiert: medizinisch geschulte Leistungsträger erbringen im Gesundheitssystem Dienstleistungen, die den Gesetzen des Marktes und der Waren folgen und auch vor unseren Landesgrenzen nicht Halt machen. Damit geht eine Sprachverwirrung und oftmals beabsichtigte semantische Grenzverschiebung einher: der heilkundliche Fachbegriff „Diagnostik“ steht nunmehr für Untersuchungen, aber auch für Auslese; „Therapie“ kann Heilung, Hilfe, Pflege, aber auch Schwangerschaftsabbruch, „Verwerfen“ oder Töten bedeuten. Dieser neuen Logik folgend gilt das Abortivum Mifegyne, nicht zuletzt nach dem befürwortenden Votum der zuständigen wissenschaftlichen Fachgesellschaft beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinalprodukte (BfArM) nunmehr auch im Arzneimittelgesetz als “Heilmittel“. Und das „Ob“ eines Abbruches ist seit Jahren nicht mehr Gegenstand einer medizinisch-fachlich begründeten Entscheidung, also einer Indikation, sondern ergibt sich allein aus dem „Verlangen“ der Frau, wie es der § 218 a Abs.1 StGB formuliert; auch das „Wie“, ob also „medikamentös“ oder operativ vorgegangen wird, soll allein Sache der Frau sein. Diese Sprachverwirrung, die mangelhafte ethische Reflexion und die daraus entstehende Unordnung bilden einen Teufelskreis, aus dem kein Entrinnen mehr möglich scheint: Soll das Verwerfen einiger Embryonen, die bei der Behandlung von ca.100 genetisch belasteten Paaren pro Jahr anfallen, was viel Leid verhindern hilft, wirklich verboten bleiben, wo doch auffällige Foeten viele Wochen später rechtmäßig entfernt werden dürfen? Soll der selektive Abbruch kranker oder behinderter Ungeborener tatsächlich geächtet sein, wo doch nach dem „Abtreibungsrecht“ jährlich ca. 200 000 Abbrüche bei gesunden Ungeborenen bis zur 14. Schwangerschaftswoche straflos durchgeführt und aus öffentlichen Kassen bezahlt werden? Konfuzius, seinerzeit im alten China mit der Frage konfrontiert, womit er beginnen würde, um das Land in Ordnung zu bringen, antwortete, er würde den Sprachgebrauch verbessern. Das habe doch nichts mit der ursprünglichen Aufgabe zu tun, entgegnete man ihm damals, so wie man es wohl auch heute täte. Darauf er: Modifizierte Fassung eines Vortrags gehalten beim Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ der Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlicher medizinischer Fachgesellschaften (AWMF) am 4. 4. 2003 in Würzburg 2 Hufeland C.W. 1806 3 Schmid- Tannwald I.: Pränatale Diagnostik oder Kinder ohne Fehl und Tadel? Pränatale Untersuchungen zwischen Heilungsauftrag und vorgeburtlicher Selektion. In: Vorgeburtliche Medizin zwischen Heilungsauftrag und Selektion. Hrsg.: Schmid- Tannwald I., M. Overdick-Gulden München, Bern, Wien, New York, 2001, S. 55 1 Protokoll Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ - 04.und 05. April 2003 - Seite 6 „Wenn die Sprache nicht stimmt, so ist das, was gesagt wird, nicht das, was gemeint ist. Ist das, was gesagt ist, nicht das, was gemeint ist, so kommen die Werke nicht zustande. Kommen die Werke nicht zustande, so gedeihen Moral und Kunst nicht. Gedeihen Moral und Kunst nicht, so trifft die Justiz nicht, trifft die Justiz nicht, so weiß die Nation nicht, wohin Hand und Fuß setzen. Also dulde man keine Willkür mit den Worten. Das ist es, worauf es ankommt.“ Von Konfuzius lernen bedeutet folglich, ab sofort „keine Willkür mit den Worten“ mehr zu dulden. Vorgeburtliche Untersuchungen sind somit zu präzisieren. Sie sind neutral. Sie können als solche keinesfalls als ärztliche Diagnostik gelten; auch dann nicht, wenn sie ein Absolvent einer medizinischen Hochschule im weißen Kittel an denselben Geräten und nach denselben Methoden durchführt, an denen soeben noch Ärzte ethisch verantwortete und lebensdienliche Pränataldiagnostik betrieben haben! Vorgeburtliche Untersuchungen sind erst dann als Pränataldiagnostik zu bezeichnen, wenn sie auch im Sinne des Ungeborenen durchgeführt werden, d.h. wenn der Arzt grundsätzlich das jeweilige Gesundheits- und Überlebensinteresse der werdenden Mutter und des ungeborenen menschlichen Lebens wahrt. Wenn man aber die vorgeburtlichen Untersuchungen in der Absicht durchführt, bestimmte Ungeborene nach bestimmten Qualitätskriterien auszulesen und zu beseitigen, dann ist dies pränatale tödliche Selektion („search and destroy“). Pränatale Selektion aber als Pränataldiagnostik zu bezeichnen, ist „Willkür mit den Worten“. Wir dürfen diese Gleichsetzung nicht länger dulden und unterscheiden fortan zwischen ärztlicher Pränataldiagnostik (PND) und Pränatalselektion (PNS). Das dient der Wahrheitsfindung und eröffnet die notwendige kritische Auseinandersetzung mit unseren medizinischen Denkbildern und deren Konsequenzen – den aktuellen wie denen der Vergangenheit.4 5 Führt man vor der Implantation des Embryo genetische Untersuchungen durch, so „diagnostiziert“ man nicht früher, sondern verfolgt die Selektion von Embryonen. Denn im Gegensatz zu den gegebenen Therapiemöglichkeiten bei der PND, bestehen derzeit vor der Einnistung keinerlei Behandlungsmöglichkeiten für die Frucht. Dulden wir also nicht länger, dass der Tatbestand der eindeutigen Präimplantationsselektion (PIS) als Präimplantationsdiagnostik schöngeredet wird. Dulden wir keine Camouflage! Unsere Unduldsamkeit gegenüber der „Willkür mit den Worten“ sollte es auch nicht länger erlauben, dass die Auslese von Embryonen im Reagenzglas, als „vorgezogene Pränataldiagnostik“ ausgegeben wird! Hier werden Äpfel und Birnen zusammengezählt, hier wird Unvergleichbares verglichen! Die Präimplantationsselektion (PIS) ist nur für den eine „vorgezogene Pränataldiagnostik“, der die pränatalen Untersuchungen am Ungeborenen einzig und allein in Ausleseabsicht durchführt. Nur als Selektionsverfahren zu verschiedenen Zeitabschnitten sind beide vergleichbar. Sonst nicht; der sog. PID fehlt die Qualität einer ärztlichen Diagnostik mangels Therapierbarkeit und der missverstandenen sog. PND fehlt diese Qualität wegen der prinzipiellen Ausleseabsicht des Untersuchers. Bei allem Verständnis für die Phantasien, Wünsche und Befürchtungen der Mutter und deren sozialem Umfeld fehlt in solchem Vergleich der Bezug zur ärztlichen Ethik und zum eigenen Gewissen. Beenden wir die Willkür mit den Worten und sprechen wir jeweils von Präimplantations- bzw. Pränatalselektion! Und wenn wir unter bestimmten Voraussetzungen die Auslese von Embryonen vor der Implantation im Rahmen der IVF- Behandlung steriler Paare als das kleinere Übel ansehen, dann tarnen wir dies nicht in mehr oder weniger bewusstem Sprachmissbrauch mit dem heilkundlichen Fachbegriff „Diagnostik“, sondern begründen und rechtfertigen wir diese Auffassung und treffen wir glaubwürdige Vorkehrungen gegen den Missbrauch. Dass die Frage der Sorgfalt bzw. Zuverlässigkeit der Untersuchungen vor und nach der Implantation nicht die letzten und eigentlichen Kriterien für Diagnostik oder Selektion sind, liegt - anders lautenden Auffassungen zum Trotz6 – auf der Hand. Es ist das anerkannte Gebot der ärztlichen Diagnostik, dabei dem Patienten nicht durch mangelnde Sorgfalt zu schaden. Ganz anders bei den Selektionsverfahren. Hier dient die Sorgfalt und Zuverlässigkeit vor allem dazu, sich selbst zu schützen; sie soll eigenen Schaden von sich abwenden und Schadensersatzansprüche gegen den Untersucher vermeiden. Dieser zieht daher im Zweifelsfall auch die eigene Sicherheit vor und selektiert lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Ausgelesene klagen nicht. So bewirkt die Angst, etwa die Geburt eines behinderten Kindes „verantworten“ zu müssen, bereits einen Zwang zur Garantie für ein perfektes Kind.7 Bei der Präimplantationsselektion (PIS) vollends, wie sie der wissenschaftliche Beirat der BÄK vor drei Jahren in die Diskussion brachte, übernimmt der behandelnde Mediziner sogar eine Einstandspflicht für das gesunde Kind, quasi „sein Produkt“, wie ein Produzent für die Qualität seiner Ware. Darin liegt, so meine ich, das eigentliche Problem dieses Verfahrens. Diese sog. Präimplantationsdiagnostik ist weder eine Diagnostik, wie gerade gezeigt wurde; sie ist aber auch kein schlichtes Selektionsverfahren für menschliche Embryonen, was problematisch genug wäre. Tatsächlich ist sie ein aus mehreren Schritten bestehendes, sehr komplexes extrakorporales Herstellungs- und Ausleseverfahren von bestimmten Embryonen, gedacht zur „Behandlung“ von genetisch belasteten, aber fruchtbaren Paaren, die ausdrücklich ein unbelastetes leibliches Kind und damit ausschließlich eine reproduktions-technische Lösung ihres Problems verlangen. Das erfordert eine Ausweitung der Indikation für die Herstellung von Embryonen nunmehr auch auf fruchtbare Paare, da nur so die auftragsgemäße genetische Untersuchung und Auslese der eigens im Reagenzglas hergestellten Embryonen vor dem Transfer in die Gebärmutter möglich ist. Mit der Indikationsausweitung einher geht, dass die ärztlich gebotene Lebensschutzverpflichtung, die nach klassischem Verständnis auch gegenüber den solcherart hergestellten Embryonen besteht (dem das Embryonenschutzgesetz Rechnung trägt), von vorneherein vorsätzlich außer Kraft gesetzt wird. 8 Außerdem muss der „Erfolg“ der ersten Auslese der Embryonen (bei der „PID als solcher“), 4 Stengel-Rutkowski S.: Vom Defekt zur Vielfalt. Ein Beitrag der Humangenetik zu gesellschaftlichen Wandlungsprozessen. www.aerzte-fuerdas-leben.de 5 Schmid-Tannwald I.(Hrsg.): Gestern „lebensunwert“- heute „unzumutbar“. Wiederholt sich die Geschichte doch? München, Bern, Wien, New York, 2. Aufl., 2000 6 Kainer F.: Pränataldiagnostik: Verantwortliche ärztliche Tätigkeit im Grenzbereich. Schlusswort. Dtsch Arztebl 2003; 100 C 402 (Heft 8) 7 Philipp W.: Einstandspflicht für den Tod. Die Rolle der Arzthaftung bei der vorgeburtlichen Selektion behinderter Kinder. In: Vorgeburtliche Medizin zwischen Heilungsauftrag und Selektion. Hrsg.: Schmid- Tannwald I., M. Overdick-Gulden München, Bern, Wien, New York, 2001, S. 71 8 Schmid-Tannwald I.: Kontra Pränataldiagnostik. Selektion widerspricht dem Heilungsauftrag. Geburtsh Frauenheilk 2001; 61, 904 Protokoll Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ - 04.und 05. April 2003 - Seite 7 so die allgemeine Empfehlung, durch ein zweites, nachgeschaltetes Selektionsverfahren in der Schwangerschaft („control prenatal diagnosis“) gesichert werden – im Interesse der erwachsenen Beteiligten und ggf. auf Kosten der Existenz des ungeborenen menschlichen Lebens. Der ärztliche Heilungsauftrag wird so in ein Produktionsverfahren von Menschen umfunktioniert, die bestimmte Eigenschaften nicht haben dürfen: genetisch oder chromosomal dürfen sie nicht auffällig sein. Der Arzt und der Ärztestand werden so instrumentalisiert und heteronom vom jeweiligen Auftraggeber bestimmt. Einem solchen Verfahren kann der Arzt nicht zustimmen, ohne sich erneut ein Stück weit aufzugeben bzw. zum Dienstleister zu werden. Dass die sog. PID als ein angebliches Behandlungsverfahren für erblich belastete Paare eingeführt werden sollte bzw. allem Widerstand (105. Deutscher Ärztetag 2002, Parteien, Enquete Kommission des Deutschen Bundestages 2002, Kirchen, gesellschaftliche Gruppen aller Art etc.) zum Trotz doch noch eingeführt werden soll, obwohl es doch ein Herstellungs- und Ausleseverfahren für menschliche Embryonen mit bestimmten Eigenschaften ist, das demnach die menschliche Leibesfrucht als Ware versteht, erschwert den Laien und selbst vielen Ärzten die Ablehnung einer solchen, noch dazu als „Diagnostik“ bezeichneten Methode. Mit der Zurückweisung dieser Technik setzt man sich dem Vorwurf aus, unbarmherzig, unärztlich, inhuman oder „fundamentalistisch“ oder auch nur schlicht unmodern zu sein. Doch auch die Art ist es, mit der seinerzeit und seither das listig verbrämte Produktionsverfahren in die Öffentlichkeit gebracht wurde und dort behandelt wird. Diese hat bei vielen Menschen ein massives Misstrauen und vielfältige Ängste hervorgerufen und den Rückgriff auf die Unantastbarkeit der Menschenwürde (Art. 1GG) und das Embryonenschutzgesetz (EschG) verstärkt, das ja der Menschenwürde des im Reagenzglas hergestellten Embryo voll Rechnung trägt. In beiden Gesetzen sehen viele Zeitgenossen, vor allem auch jene, die aus der Vergangenheit gelernt haben, eine wichtige Bastion gegen die „wachsende Relativierung des Menschen“9 bzw. dessen Herabwürdigung zu einer Ware. Durch den Widerstand, der sich gegen die Einführung des vorgeschlagenen Verfahrens formierte, leistete die Kommission den sterilen Paaren, die eine IVF- Behandlung brauchen, einen Bärendienst. Mit der Verbesserung von Untersuchungsmethoden während der Präimplantationsphase eröffnen sich nämlich den Reproduktionsmedizinern Möglichkeiten, die befruchteten Eizellen (wie erlaubt) nicht nur morphologisch, sondern die erzeugten Leibesfrüchte vor dem Transfer (wie bisher hierzulande gesetzlich verboten) auch genetisch und chromosomal zu untersuchen und so den Transfer genetisch auffälliger Embryonen zu vermeiden. Im „Für“ und „Wider“ der öffentlichen Diskussion um die Kommissionsvorschläge unterblieb weitgehend die kritische Auseinandersetzung über den heutigen Stand dieser Untersuchungsverfahren und deren Vereinbarkeit mit dem ärztlichen Berufsethos. Sie muss daher erst noch geführt werden. Meine einleitenden Ausführungen wieder aufgreifend, stellt sich die Frage, ob es eine solche Diskussion überhaupt geben müsste, wenn die klassischen Grundsätze der Heilkunde noch gelten würden, wie sie in Hufelands Zitat und im Genfer Ärztegelöbnis zum Ausdruck kommen. In diesem Fall könnte die Gesellschaft diese schwierigen Fragen und Probleme vertrauensvoll ihren Ärzten anvertrauen. Zusammenfassung: Noch schützt das Embryonenschutzgesetz den außerhalb des Mutterleibes erzeugten und jeglicher Begehrlichkeit preisgegebenen menschlichen Embryo. Es achtet dessen Menschenwürde und Lebensrecht in einer Weise, wie sie dem ungeborenen Menschen in der Schwangerschaft im Zusammenhang mit der quantitativen Geburtenkontrolle und der qualitativen Auslese längst genommen worden ist. Die sog. PID ist ein Beispiel dafür, wie eine Kommission des wissenschaftlichen Beirates der Bundesärztekammer versucht hat, durch eine Ausweitung der IVF- Indikation auf fruchtbare Paare ein qualitätssicherndes Herstellungs- und Selektionsverfahren für bestimmte Menschen gesellschaftsfähig zu machen, wofür der Arzt eine Einstandspflicht zu übernehmen hätte. Dies ist mit der klassischen Aufgabe des Arztes unvereinbar. Neue medizinische Untersuchungsverfahren in der Präimplantationsphase erscheinen allenfalls im Rahmen des ärztlichen Heilungsauftrages bei streng indizierter IVF- Behandlung mit dem ärztlichen Berufsethos vereinbar. Anschrift des Autors: Prof. Dr. med. Ingolf Schmid-Tannwald, Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der Universität München im Klinikum Großhadern 81377 München, Marchioninistr. 15 Tel.: 089/70 95 46 96; e-mail: [email protected] 1.Vorsitzender der „Ärzte für das Leben“ (www.aerzte-fuer-das-leben.de) Min.-Rat a. D. Dr. iur. Rudolf Neidert, Wachtberg: I. Einleitung 9 „Die auf das Angstempirem zurückgeführte, damit durch Ihren Zweck definierte und legitimierte „Würde“ des Menschen setzt diese als das Medium ein, das den technisch-wissenschaftlichen Verstand der Gesellschaft mit deren moralisch-rechtlicher Vernunft in Übereinstimmung hält. Die Bedeutung dieser vielfach als störend empfundenen „Würde“ nimmt damit zu, je mehr die moderne Gesellschaft Gefahr läuft, von ihren eigenen Schöpfungen überwältigt zu werden.“ Picker E.: Menschenwürde und Menschenleben. Das Auseinanderdriften zweier fundamentaler Werte als Ausdruck der wachsenden Relativierung des Menschen. Stuttgart 2002 Protokoll Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ - 04.und 05. April 2003 - Seite 8 Selten dürfte es ein Gesetz gegeben haben, das so häufig und so gründlich missverstanden, wohl auch bewusst missdeutet worden ist, wie das Embryonenschutzgesetz (ESchG) vom 13. Dezember 1990. In der biopolitischen Kontroverse der letzten Jahre um Präimplanta-tionsdiagnostik (PID) und Stammzellforschung dient vielen Fundamentalkritikern der neuen human- genetischen Verfahren dieses ihr „Vorzeige-Gesetz“ als juristischer Trumpf im Kampf für absoluten Embryonenschutz; typisch ihre Formel vom „hohen Schutzstandard“ des ESchG (z. B. in der Begründ. zum Stammzellgesetz, BT-Drs. 14/8394, S. 8). Das Gesetz ist in aller Munde: Ethiker philosophischer und theologischer Provenienz, Mediziner und Ärztefunktionäre, Politiker und Journalisten – juristische Laien allesamt – hantieren mit seinen Paragraphen oft leichter Hand; doch auch viele juristische Teilnehmer der Debatte unterziehen sich nicht der Akribie peinlich exakter Auslegung dieses gesetzlichen Maßstabes des reprogenetisch Zulässigen. Um so wichtiger ist es deshalb, wenn wir nach der Notwendigkeit von Änderungen dieses Gesetzes fragen, zuerst einmal deutlich zu machen, was das ESchG tatsächlich ist, und vor allem, was es nicht ist. Sonst laufen wir Gefahr, Änderungen des Gesetzes zu fordern, wo es gar keiner Änderungen bedarf (hierzu näher mein Aufsatz „Das überschätzte Embryonenschutzgesetz“ in: Zeitschrift für Rechtspolitik 11/2002, S. 467 ff.). II. Grenzen und Lücken des ESchG In der gebotenen Kürze möchte ich Inhalt und Grenzen, Regelungslücken und Alterungsprozess des Gesetzes umreißen: 1. Nur scheinbar ein Gesetz zum Schutz von Embryonen Die volle Bezeichnung des ESchG lautet „Gesetz zum Schutz von Embryonen“. Doch dem damit erhobenen Anspruch wird dieses Gesetz schon auf den ersten Blick nicht gerecht: Es übernimmt zwar (in § 6 Abs. 1) den medizinischen Begriff des Embryos – das Ungeborene von der Befruchtung bis zum Abschluss der Organogenese mit Ablauf der 8. Woche post conceptionem (p.c.); doch mit der Nidation, d. h. bereits nach zwei Wochen p. c., lässt es seinen Geltungsbereich enden - danach beginnt derjenige der §§ 218 ff. StGB. Außerdem gilt das Gesetz nur für die wenigen künstlich erzeugten Embryonen. Das heißt: sein Geltungsbe- reich ist entgegen seinem Anspruch in doppelter Weise auf einen geradezu marginalen Bereich beschränkt. Folglich gibt es im Regelfall der natürlichen Zeugung für den Embryo keinen Schutz bis zur Nidation und keinen Schutz generell von der Nidation bis zum Übergang in die Fetalphase. Gesetz zum Schutz von Embryonen (Embryonenschutzgesetz – EschG) vom 13. Dezember 1990 Schematische Darstellung seines Geltungsbereiches für Embryonen Folie 1 Senkrechte Achse: Zahlenmäßige Größenordnung vom Gesetz erfasster Embryonen Waagerechte Achse: Wochen des Embryos ab Befruchtung post conseptionem (p. C.) C =Conceptio = Befruchtung durch Kernverschm. (EschG) = Empfängnis (§ 218 a StGB) N = Nidation = Einnistung in der Gebärmutter (EschG und § 218 StGB) O = (Abschluss der) Organogenee (=Organbildung) zum Ende der 8. Woche p. c. Übrigens hatte der Diskussionsentwurf des Bundesjustizministeriums von 1986 für ein Embryonenschutzgesetz gleich als § 1 eine sog. „Embryonenschädigung“ vorgesehen gehabt. Mit dieser Strafvorschrift sollten Schädigungen eines Embryos - ja sogar eines Foetus – während der Schwangerschaft bestraft werden, aber nur, wenn sie leichtfertig begangen waren und zu einer Gesundheitsschädigung des aus ihm hervorgegangenen Menschen geführt hatten. Wegen unlösbarer Friktionen zum parallel geltenden Recht des Schwangerschaftsabbruchs verzichtete man dann im Regierungsentwurf des ESchG darauf. Allerdings blieb dort – trotz der Streichung dieser zentralen Schutzvorschrift – die ursprünglich durchaus gerechtfertigte Bezeichnung als „Embryonenschutzgesetz“ erhalten. Auch in den Bereichen, in denen es tatsächlich gilt, weist das ESchG gravierende Schutzlücken auf: Protokoll Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ - 04.und 05. April 2003 - Seite 9 ( Folie 2: Textauszüge aus §§ 1 und 2 ESchG ) Text-Auszüge aus den §§ 1 und 2 des Embryonenschutzgesetzes (EschG) Missbräuchliche Anwendung von Fortpflanzungstechniken Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird betraft, wer 1. 2. 3. auf eine Frau eine fremde unbefruchtete Eizelle überträgt, es unternimmt, innerhalb eines Zyklus mehr als drei Embryonen auf eine Frau zu übertragen, es unternimmt, mehr Eizellen einer Frau zu befruchten, als ihr innerhalb des Zyklus übertragen werden sollen, §2 Mißbräuchliche Verwendung menschlicher Embryonen (1) einen extrakorporal erzeugten ... menschlichen Embryo veräußert oder zu einem nicht seiner Erhaltung dienenden Zweck abgibt, erwirbt oder verendet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. (2) Ebenso wird bestraft, wer zu einem anderen Zweck als der Herbeiführung einer Schwangerschaft bewirkt, dass sich ein menschlicher Embryo extrakoporal weiterentwickelt. So fehlt vor allem eine ausdrückliche Regelung des Schicksals „verwaister Embryonen“, die trotz der Vorkehrungen des Gesetzes (in § 1 Abs. 1 Nr. 3, sog. Dreier-Regel) nie ganz ver- hindert werden können. Das Schweigen des Gesetzes zu dieser Frage – absterbenlassen oder kryokonservieren, aber wie lange ? – wiegt um so schwerer, als es sich um eine entscheidende Frage des Embryonenschutzes handelt. Nach richtiger Auslegung des allgemeinen Verbots missbräuchlicher Verwendung von Embryonen in § 2 Abs. 1 fällt das Nicht-Implantieren als bloßes Unterlassen nicht unter diese Vorschrift (Günther, Komm., Rdz. 34 zu § 2). Eine Bestimmung über die Prävention lebensbedrohlicher Mehrlingsschwangerschaften ließ der Regierungsentwurf von 1989 noch vermissen – wiederum eine Frage auf Leben und Tod des Embryos. Es war der Bundesrat, der damals bei diesem Punkt Problembewusstsein embryonalen Lebensschutzes an den Tag legte: in seiner Stellungnahme zum Regierungsentwurf forderte er die Aufnahme des Verbots, „einer Frau mehr befruchtete Eizellen zu übertragen, als bei Einnistung aller übertragenen Eizellen auch ausgetragen werden können.“ Auch seine Begründung verdient zitiert zu werden: „Die bewusste Inkaufnahme der gezielten Abtötung von Mehrlingen im Mutterleib als Folge der künstlichen Befruchtung ist aus ethischen Gründen abzulehnen und strafrechtlich zu verbieten.“ (BT-Drs. 11/5460, S. 14). In ihrer Gegenäußerung brachte die Bundesregierung die Dreier-Regel ins Spiel, die denn auch als Nr. 3 in § 1 Abs. 1 eingefügt und dann Gesetz wurde. Weitere Vorschriften des ESchG stellen gar „strafbewehrte Tötungspflichten“ dar (so der Kommentator Günther): nämlich wenn § 6 Abs. 2 die Überragung eines geklonten Embryos verbietet (ähnlich im Fall des § 7). Auf dasselbe läuft die vom Gesetz mit Vorrang versehene Einwilligung der Frau (§ 4 Abs. 1 Nr. 2) hinaus: ihr Veto gegen eine Übertragung verpflichtet den Arzt praktisch, den Embryo absterben zu lassen. Geschütztes Rechtsgut dieser Vorschriften ist eben die Menschenwürde: im Klonfall die des geklonten Embryos, im Fall der Einwilligung die der Frau. Embryonenschutz ist auch hier nicht das oberste Ziel dieses Gesetzes. Als erstes Zwischenergebnis kann ich somit feststellen: Das ESchG erfasst in seiner 1990 verabschiedeten Fassung mit den künstlich befruchteten Eizellen nur den geringsten Teil der Embryonen und diese nur in den ersten zwei von insgesamt acht Wochen der Embryonalzeit. Auch dort, wo das Gesetz gilt, zeigt es Lücken des Embryonenschutzes und lässt höherrangige Rechtsgüter diesem vorgehen. Die Bezeichnung des Gesetzes ist somit irreführend. 2. Tatsächlich ein lückenhaftes Fortpflanzungsmedizingesetz Die falsche Gesetzesbezeichnung monierte denn auch der Bundesrat im weiteren Gesetzgebungsverfahren und schlug – wenn auch vergeblich – die Bezeichnung „Fortpflanzungsmedizingesetz“ vor, mit der Begründung, der Entwurf regle vor allem Probleme der künstlichen Befruchtung (BT-Drs. 11/5460, S. 13). So verhält es sich in der Tat. Folie 3 Abschnitte des Embryonenschutzgesetzes (EschG) Vom 13. Dezember 1990 (Abschnitts-Einteilung vom Verfasser Min.-Rat a. D. Dr. R. Neidert Erster Abschnitt: Missbräuchliche Anwendung der assistierten Reproduktion §1 §2 §3 §4 Missbräuchliche Anwendung von Fortpflanzungstechniken Missbräuchliche Verwendung menschlicher Embryonen Verbotene Geschlechtswahl Eigenmächtige Befruchtung, eigenmächtige Embryoübertragung und künstliche Befruchtung nach dem Tode Protokoll Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ - 04.und 05. April 2003 - Seite 10 Zweiter Abschnitt: Verbotene Verfahren künstlicher Fortpflanzung §5 §6 §7 Künstliche Veränderung menschlicher Keimbahnzellen Klonen Chimären- und Hybridbildung Dritter Abschnitt: Allgemeine Vorschriften §8 §9 § 10 § 11 § 12 § 13 Begriffsbestimmung Arztvorbehalt Freiwillige Mitwirkung Verstoß gegen den Artvorbehalt Bußgeldvorschriften Inkrafttreten Denn wie ein roter Faden zieht sich durch die 13 Paragraphen des Gesetzes die Begrifflichkeit der künstlichen Befruchtung und Kernverschmelzung von Ei- und Samenzelle. In einem ersten Abschnitt (§§ 1 bis 4) geht es offensichtlich um missbräuchliche Anwendungsformen der assistierten Reproduktion durch IVF – insbesondere eine Maßnahme ohne den beabsichtigten Zweck einer Schwangerschaft oder die Verwendung eines frühen Embryos zu einem nicht seiner Erhaltung dienenden Zweck. Ein zweiter Teil (§§ 5 bis 7) umschreibt schlechthin verbotene Verfahren künstlicher Fortpflanzung, so vor allem Klonen und Keimbahnveränderung. Die Paragraphen 8 bis 13 enthalten allgemeine Vorschriften, u. a. eine, wenn auch un- vollkommene, Definition des Embryos. Im wesentlichen handelt es sich also um ein Gesetz über die Zulassung der damals noch relativ neuen Verfahren der künstlichen Befruchtung – mit einer Abgrenzung gegenüber unzulässigen Verfahren. Da der Bund 1990 allerdings noch nicht über die Gesetzgebungskompetenz zur künstlichen Befruchtung verfügte, kleidete man das ESchG in die – der Regelung eines medizinischen Verfahrens nicht gerade angemessene - Form eines Strafgesetzes. Dies hat wichtige Folgen für seine Auslegung; dazu gleich näher ! Schlägt man den Abschlussbericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Fortpflanzungsmedizin“ von 1988 nach, so findet man als ausformulierten Vorschlag ein über ganze Passagen mit dem späteren ESchG identisches Bundesgesetz – allerdings mit der Bezeichnung „Fortpflanzungsmedizingesetz“. Nur andeuten kann ich, dass das ESchG aber auch als Fortpflanzungsmedizingesetz reichlich lückenhaft geblieben ist. Die Problematik der verwaisten Embryonen und der Mehrlinge sind bereits genannt. Im übrigen sei nur noch auf eine völlig ungeregelte Materie hingewiesen: die Samenspende mit ihren im Detail höchst ungeklärten zivilrechtlichen Rechtsfolgen für die Beteiligten, in erster Linie für das künstlich gezeugtre Kind, aber auch für die leibliche Mutter, den sozialen Vater und den Samenspender, d. h. den genetischen Vater. Zweites Zwischenergebnis: Das ESchG ist in Wirklichkeit ein, wenn auch reichlich lückenhaftes, Fortpflanzungsmedizingesetz. Die IVF zu ermöglichen und zugleich einzugrenzen, ist denn auch der Hauptzweck dieses Gesetzes, Embryonenschutz dagegen nur im Rahmen dessen und, soweit damit vereinbar. 3. Ein zum Teil von der medizinischen Entwicklung überholtes Gesetz Wie sehr das ESchG außerdem von der stürmischen reproduktionsmedizinischen und gentechnologischen Entwicklung seit 1990 bereits z. T. überholt ist, zeigen vor allem zwei Entwicklungen: Die Präimplantationsdiagnostik war seinerzeit (1989/90) zwar ansatzweise als neues Verfahren bereits bekannt und im Gesetzgebungsverfahren auch diskutiert. Dennoch wurde sie zumindest nicht ausdrücklich geregelt. Ob das Verwerfen eines geschädigten Embryos nach PID gegen das Gesetz (insb. § 2 Abs. 1) verstößt, ist unter den zahlreichen juristischen Autoren bis heute heftig umstritten; zwei Lager stehen sich ohne Aussicht auf Konsens gegenüber (Nachweise bei Neidert in: Ethik interdisziplinär, Bd. 2, 2002, S. 33 ff., 34 – 37, mit Anm. 10 u. 13 – 17). Zwar haben diejenigen, die eine Strafbarkeit verneinen, die besseren Auslegungsargumente für sich; doch diese Rechtsunklarheit hat bereits zu Anzeigen und Ermittlungsverfahren geführt; offenbar kann nur der Gesetzgeber die für den Arzt und die Paare unerlässliche Rechtssicherheit schaffen. Ein Gesetzentwurf der FDP in der letzten Wahlperiode zur begrenzten Zulassung des Verfahrens – ganz im Sinne der BÄK – ist leider er nicht verabschiedet worden; an eine erneute Einbringung ist gedacht. Angesichts der in den letzten Jahren etablierten neuen Stammzellforschung zeigte sich, dass durch das ESchG zwar die mit dem Absterben des frühen Embryos verbundene Entnahme von Stammzellen verboten ist, nicht aber deren Import aus dem Ausland – wieder eine Gesetzeslücke. Diese ist vor einem Jahr durch das ebenso eilige wie kontroverse Stammzellgesetz geschlossen worden. Bezeichnender Weise geschah dies auf politischen Wunsch nicht durch ein ausdrückliches Änderungsgesetz zum ESchG – man hätte damit sonst die angebliche Vortrefflichkeit dieses Gesetzes in Frage gestellt sehen können. Ob die sehr restriktive Zulassung des Imports die weitere Entwicklung der Forschung – insbesondere im Hinblick auf das therapeutische Klonen - überdauern kann, dürfte die nähere Zukunft erweisen. Beim Stichwort „Klonen“ tun sich fundamentale Regelungslücken auf, die sich durch die gen- technologische Entwicklung ergeben haben. Aufgefordert vom Parlament wegen des revolutionären Dolly-Experiments einer gelungenen Reproduktion durch Zellkern-Transfer, erstattete die Bundesregierung 1998 ihren Klonbericht (BT-Drs. 13/11263). Dieser stellt eindrucksvoll fest, wie vielfältig sich die allzu detaillierten Regelungen des ESchG bereits fünf Jahre nach dessen Inkrafttreten als überholt herausstellten. Hauptgrund: Das Gesetz geht auch in seinen Vorschriften über schlechthin verbotene Verfahren und in seiner Embryo-Definition weitgehend von der Reproduktion durch Befruchtung von Eiund Samenzelle aus. Nicht weniger als 12 Änderungsvorschläge zu 4 Paragraphen sind in dem Bericht aufgelistet. Protokoll Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ - 04.und 05. April 2003 - Seite 11 Schon dies genügt, um ein drittes Zwischenergebnis zu formulieren: Bereits ein Jahrzehnt nach seinem Inkrafttreten muss man das ESchG in Grundzügen und fundamentalen Einzelfragen als von der medizinischen Entwicklung überholt bezeichnen. 4. Strafrechtlich enge Auslegung des ESchG Was auch von den meisten juristischen Autoren bei der Auslegung des ESchG nicht oder nicht angemessen berücksichtigt wird, ist dessen strafrechtlicher Charakter. Aus diesem folgt zugunsten des potentiellen Täters Arzt – um diesen geht es ja in erster Linie – nach Art. t. 103 Abs. 2 des Grundgesetzes als „Grundrecht des Angeklagten“ das sog. Bestimmtheitsgebot: die Strafnorm muss so bestimmt formuliert sein, dass man als Bürger den Umfang des Verbotenen zuvor erkennen kann; dementsprechend muss sie ausgelegt werden. Das hat die Rechtsprechung zu weitgehender Interpretation zugunsten des Täters veranlasst; im einzelnen kann ich das hier nicht ausführen. Gerade der juristische Laie sollte aber bedenken, was es heißt, den Verstoß eines Arztes gegen das ESchG anzunehmen: bei den Bestimmungen über die Grenzen der künstlichen Befruchtung Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren (oder Geldstrafe) ! Auch dieser hohe Strafrahmen zwingt zu einer Auslegung mit aller Restriktion. Deshalb ist mein viertes und besonders wichtiges Zwischenergebnis: Als Strafgesetz ist das ESchG von Verfassungs wegen zugunsten des potentiellen Täters eng auszulegen. Als bisherige Schlussfolgerung im Hinblick auf Änderungsbedarf beim ESchG möchte ich festhalten: Je begrenzter dessen Verbote, desto größer die originäre Therapiefreiheit des Reproduktionsmediziners, und desto weniger muss an dem Gesetz geändert werden. III. Vorschläge zur Änderung des ESchG 1. Änderung des ESchG oder Erlass eines FMG ? Ist nun – nach all dem – eine ne Änderung des ESchG notwendig ? Soll man es zu einem echten Gesetz zum Schutz von Embryonen oder gar des Ungeborenen überhaupt ausbauen ? Soll es lediglich auf den heutigen Stand der naturwissenschaftlich-medizinischen Entwicklung gebracht werden ? Oder folgt aus seinem Charakter eines, wenn auch unvollständigen Fortpflanzungsmedizingesetzes, dass es durch das seit zwei Jahrzehnten geforderte umfassende Gesetz zur künstlichen Befruchtung abgelöst werden sollte ? Genau dies fordert der Nationale Ethikrat in seiner Stellungnahme zur „Genetischen Diagnostik vor und während der Schwangerschaft“ vom 23. Januar dieses Jahres. Doch dieser „große Wurf“ ist nicht die mir gestellte Aufgabe. Ohnehin lässt sich zur Zeit politisch keine entsprechende Initiative absehen – weder auf Regierungsseite, noch von Seiten der Fraktionen. Auch der Koalitionsvertrag vom Oktober letzten Jahres enthält keine diesbezügliche Absichtserklärung. 2. ESchG-Änderungen nur zur „Überbrückung“ bis zu einem FMG Also doch eine Änderung des ESchG ? Ja, aber nur gleichsam zur „Überbrückung“ der Zeit bis zu der notwendigen Gesamtregelung des Rechts der Fortpflanzungsmedizin. Nur solche Änderungen sollte man sich vornehmen, die aus medizinischen, rechtlichen oder ethischen Gründen keinen weiteren Aufschub dulden. Daraufhin möchte ich – außer den von mir bereits angesprochenen Punkten eines Änderungsbedarfs – vor allem die Novellierungsforderungen des Positionspapiers der Fachgesellschaften vom Oktober 2000 durchgehen, einschließlich der gutachtlichen Vertiefungen in der Sondernummer der „Reproduktionsmedizin“ vom August letzten Jahres. Hilfreich sind auch die Referate des Symposiums der Kaiserin-Friedrich-Stiftung vom Februar 2002 in der Zeitschrift für ärztliche Fortbildung (7/02). a) Notwenige, aber nicht vordringliche Änderungen Zunächst zu den Vorschriften des ESchG, deren Änderung zwar durchaus notwendig, aber aus plausiblen Gründen nicht vordringlich erscheint: - Ausklammern möchte ich hier die schwierigen, weit über das ESchG hinausreichenden rechtlichen Diskrepanzen des Embryonenschutzes in vitro und in vivo vor der Nidation, auch diejenigen zwischen ESchG und § 218 danach. Allenfalls in einem umfassenden Fortpflanzungsmedizingesetz sollte man versuchen, den rechtlichen Systembruch in der Pränidationsphase plausibel zu beseitigen. über die Zeit nach der Nidation ist im Zusammenhang mit dem § 218 StGB einiges zu sagen. - Notwendig – wie es auch das Positionspapier richtig fordert -, aber dennoch nicht vordringlich erscheint es mir, die Rechtsfolgen der Samenspende zu regeln, was immerhin bereits seit Aufkommen der heterologen Insemination in den 70-er Jahren ansteht. Bisher hatte eben die Rechtsprechung einschlägige Streitfälle zu entscheiden; allerdings musste sich der Gesetzgeber vom Bundesgerichtshof diesbezüglich bereits Untätigkeitsrügen gefallen lassen (BGHZ 129, 297 ff. 304 f.). - Gewiss begründen alle von der Bundesregierung herausgearbeiteten Regelungslücken bzgl. der Klontechnik durch Kerntransfer Änderungsbedarf. Dennoch kann man die Gefahr solcher strafwürdiger Handlungen von Forschern in Deutschland als eher abstrakt einstufen. Dies gilt auch für das erwähnte Verbot, einen illegalerweise erzeugten Klon-Embryo auf eine Frau zu transferieren; immerhin bezeichnet selbst die Bundesregierung im erwähnten Klonbericht diese Verweigerung von Embryonenschutz als verfassungsrechtlich problematisch. - Vorschläge, für Maßnahmen der assistierten Reproduktion eine zentrale Registrierungs-, Beratungs- und Prüfstelle auf gesetzlicher Basis einzurichten (so das Positionspapier und Taupitz in: Reproduktionsmedizin 4/2002, S. 206 ff.) gehören sinnvoller Weise in den Zusammenhang eines Fortpflanzungsmedizingesetzes; dasselbe gilt für eine Zentralisierung bestimmter Maßnahmen in ausgewiesenen Einrichtungen. b) Notwendige und zugleich vordringliche Änderungen Protokoll Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ - 04.und 05. April 2003 - Seite 12 Nicht nur notwendig, sondern auch vordringlich erscheint mir die Änderung von Vorschriften des ESchG, die den gebotenen Lebensschutz des Ungeborenen nicht gewährleisten, diesen Schutz im Unklaren lassen oder eine Einhaltung des international erreichten Standes der Wissenschaft in der Reproduktionsmedizin unmöglich machen. - über das Schicksal verwaister Embryonen sollte durch eine ausdrückliche Regelung die erforderliche Rechtssicherheit geschaffen werden. Angemessen fände ich eine Pflicht zur Kryokonservierung bis zum Ablauf einer Frist; danach eine Beendigung dieser Lebenserhaltung mit Einwilligung der Eltern. Keinesfalls sollte man diese dringliche Klärung mit der kontroversen Frage einer Verwendung überzähliger Embryonen zu Forschungszwecken belasten. Eine Regelung der Embryonenspende – die zur Lebenserhaltung heute schon als nicht verboten zu betrachten ist – kann man ebenso wie die Forschungsfrage für ein Fortpflanzungsmedizingesetz zurückstellen. - Für vordringlich halte ich auch eine Aufhebung des Verbots der Eizellspende – es ist gleich die erste Vorschrift im ESchG (§ 1 Abs. 1 Nr. 1). Dringlich ist sie aus den schon im Positionspapier von 1997 umschriebenen Indikationen und, weil sich eine Ungleichbehandlung von Ei- und Samenspende verfassungsrechtlich nicht halten lässt, zumal das Ausland sie ganz überwiegend nicht kennt. - Für ethisch-rechtlich vordringlich halte ich auch eine wirksamere Vorkehrung des Gesetzes gegen die der IVF systemimmanente Gefahr von Mehrlingsschwangerschaften (siehe hierzu Feige/Gröbe in: Reproduktionsmedizin 4/2002, S. 153 ff.). Das ESchG von 1990 versucht, dem durch die „Dreier-Regel“ des § 1 Abs. 1 Nr. 3 zu steuern („Übertragung von nicht mehr als drei Embryonen“). Doch diese Obergrenze hat sich für den Regelfall als zu hoch erwiesen. Die „Mehrlingsreduktion“ durch Fetozid – eine „grobe Hochrechnung“ spricht von on ca. 150 Fällen im Jahr – stellt ein ernste moralische Hypothek der IVF dar, worauf schon vor Jahren eindringlich Hepp hingewiesen hat (in: Frauenarzt 5/1996, S. 678 ff., 686 f.). So wird in der 1998 neugefassten IVF-Richtlinie der BÄK dem Arzt wenigstens bei Patientinnen unter 35 Jahren „angeraten“, nur zwei Embryonen zu transferieren; doch verpflichtend ist das nicht, wohl auch nicht ausreichend. In der gen. Ausgabe der „Reproduktionsmedizin“ (4/2002) plädieren statt dessen mehrere Autoren (vor allem Montag/van der Ven und Nieschlag/Behre) dezidiert für die Einlingsschwangerschaft als europäischen Standard der IVF. Dem sollte im ESchG ausreichend, aber flexibel Rechnung getragen werden, etwa: ein Embryo als Sollvorschrift, maximal zwei. - Eine zentrale Forderung des Positionspapiers ist es darüber hinaus, den internationalen Standard von Schwangerschaftsraten nach IVF von ca. 50 % (statt wie bei uns ca. 25 %) zu erreichen. Hier beziehe ich mich zugleich auf die weitergehende Darstellung von Montag und van der Ven, nämlich: Kultur von 4 bis 6 (bei der PID von mindestens 8) Embryonen über 3 bis 4 Tage, danach Auswahl von einem, höchstens zwei optimal entwickelten Embryonen für den Transfer. ( Wieder Folie 2: Textauszüge aus §§ 1 und 2 ESchG ) Nach geltendem Gesetz (§ 2 Abs. 2) ist zwar eine Kultivierung der Embryonen über 3 bis 5 Tage zulässig, da dann die Nidationschance noch durchaus besteht und der Arzt zum Zweck einer Schwangerschaft vorgeht. Ganz im Rahmen des § 1 Abs. 1 Nr. 3 handelt er ebenfalls; ja, er „unterbietet“ gleichsam die zur Verhütung von Mehrlingsschwangerschaften gesetzte Dreier-Grenze ganz im Sinne des Gesetzes. Wenn er freilich 4 bis 6 oder gar mehr Eizellen befruchtet, von denen er allenfalls zwei übertragen will, stößt er an die Grenzen des Gesetzes: § 1 Abs. 1 Nr. 5 verbietet es, mehr Eizellen zu befruchten, als der Frau innerhalb eines Zyklus übertragen werden sollen. Da der Arzt maximal drei Embryonen transferieren darf, ist ihm auch grundsätzlich nur die Erzeugung von drei erlaubt. Auch mit dem Verbot einer Embryoübertragung ohne Einwilligung der Frau (§ 4 Abs. 1 Nr. 2) kann man dieses Ergebnis nicht weginterpretieren: sie kann zwar einem Transfer von Embryonen – etwa morphologisch erkennbar geschädigten – widersprechen; dennoch darf der Arzt nicht mehr erzeugen, als übertragen werden sollen. Der Kommentator Günther (Rz. 17 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5) – auch Frommel (in: Reproduktionsmedizin 4/2002, S. 158 ff. 161) – haben zwar aus der Entstehungsgeschichte des Gesetzes überzeugend dargetan, dass bei einem Befruchtungserfolg von nur rd. ¾ ein Arzt, der mit vier Eizellen eine Befruchtung versucht, um wenigstens drei übertragungsfähige Embryonen zu erhalten, nicht den Tatbestand erfüllt. Aber auch dieser Spielraum des geltenden Gesetzes (vier Befruchtungsversuche, aber dann auch drei Übertragungen !) reicht nicht annähernd für das angestrebte Vorgehen. Dasselbe gilt für ein eventuelles Absterben geschädigter Embryonen, wovon das Positionspapier spricht. Der sehr kühnen, „teleologischen Interpretation“ von Frau Frommel, die das „nicht mehr, als übertragen werden sollen“ hinweg interpretiert, kann ich leider nicht zustimmen. „Die äußerste Grenze zulässiger richterlicher Interpretation“ ist nach der Rechtsprechung nun einmal „der mögliche Wortsinn“ einer Strafbestimmung; diese Wortsinn-Grenze der Nummer 5 würde von einer solchen Ausweitung des Tatbestandes überschritten. So bleibt nur eine Änderung des Gesetzes, am besten eine Streichung von § 1 Abs. 1 Nr. 5. Die Streichung der Grenze in Nummer 5 ermöglicht eine engere Grenzziehung in Nummer 3: Eine Auswahl des besten Embryos könnte Mehrlingsschwangerschaften und Fetozid-Dilemma vorbeugen; Embryonenauswahl würde mehr Embryonenschutz bringen. - Als letzten vordringlichen, besonders heiß umkämpften Regelungspunkt erwähne ich die Präimplantationsdiagnostik. Wie gesagt: nach der gebotenen strafrechtlich restriktiven Auslegung ist die Unterlassung des Transfers eines schwer geschädigten Embryos schon heute nicht strafbar. Doch da juristisch darüber alles andere als Konsens besteht, es sogar Strafanzeigen und Ermittlungsverfahren wegen bloßer Beratungshinweise auf Behandlungsmöglichkeiten im Ausland gegeben hat, - deswegen ist rechtspolitisch eine alsbaldige Klarstellung im Gesetz zu fordern. Modell sollte der Diskussionsentwurf der BÄK vom Februar 2000 sein: Zulässigkeit nur bei hohem Risiko einer schwerwiegenden genetischen Erkrankung des Embryos, wie es auch der FDP-Entwurf vorgesehen hat. Anders als dieser sollte jedoch die Rechtmäßigkeit der Verwerfung des Embryos nach PID in Analogie zur medizinisch-sozialen Indikation des § 218 a Abs. 2 StGB an eine gleiche Unzumutbarkeit des Transfers für die Frau gebunden sein. Würde man sich auf diese Weise an die Gesetzessystematik der Regelung des Schwangerschaftsabbruchs anschließen, hätte man eine verfassungsfeste Lösung. Zwei Verfassungsrechtler, Hufen und Herdegen, haben der Berliner Enquete-Kommission sogar Gutachten erstattet, wonach ein völliges Verbot der PID – d. h. auch einer gemäß § 218 a Abs. 2 begrenzten PID – verfassungswidrig wäre (danach Hufen in: MedR 2001, S. 440 ff., 450, und Herdegen in: JZ 2001, S. 773 ff., 778). Protokoll Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ - 04.und 05. April 2003 - Seite 13 IV. Rechtspolitischer Ausblick Diese juristische Bilanz des ESchG und seines dringlichen Änderungsbedarfs richtet sich an den Gesetzgeber; konkret heißt das: nicht nur an die beschließenden Organe Bundestag und Bundesrat, sondern auch an die Bundesregierung, bei der ja das Recht zur Gesetzesinitiative liegt. Im federführenden Gesundheitsministerium hat es zwar in diesem Jahr – nach dem Votum des Nationalen Ethikrates vom Januar – den Versuch gegeben, eine politische Entscheidung über ein Fortpflanzungsmedizingesetz herbeizuführen; leider kam es aber nicht zu einem Votum der Leitungsebene Aus den Fraktionen waren (März 03) ebenfalls keine, vielleicht noch keine Gesetzgebungsabsichten zu erfahren, zumal man sich vor der für Mai geplanten Konstituierung einer weiteren Enquete-Kommission organisatorisch noch nicht voll positioniert hatte. Ich denke, die wissenschaftlichen Fachgesellschaften sollten ihren wohlbegründeten Änderungsbedarf beim ESchG Parlament und Regierung gleichermaßen präsentieren. Wenn das federführende Ministerium weiterhin keine Initiative erkennen lässt, könnte man über eine Gruppe von Abgeordneten oder eine Fraktion einen Antrag des Bundestages initiieren, der die Regierung zu einem Gesetzentwurf auffordert. In Frage kommt natürlich auch ein Entwurf „aus der Mitte des Bundestages“. Wahrscheinlich wird, wie gesagt, die FDP-Fraktion wieder einen Entwurf zur PID einbringen, aber wohl beschränkt hierauf. Würde man eine Novelle mit dringlichen Änderungen des ESchG erreichen, könnten in den Ausschüssen beide Entwürfe zur Beratung miteinander verbunden werden. Doch was soll geschehen, wenn nichts geschieht ? Wie kann es weitergehen, wenn etwa der PID-Entwurf der FDP wieder nicht beraten oder verabschiedet wird, wenn sich eine ESchG-Novelle nicht erreichen lässt oder keine Mehrheit findet, wenn - erst recht – das seit zwei Jahrzehnten geforderte Fortpflanzungsmedizingesetz in den Schubladen der Ministerien liegen bleibt ? Gegen Mitte der Wahlperiode des Bundestages, d. h. im Herbst nächsten Jahres, wäre ein kritischer Zeitpunkt erreicht: ist bis dahin kein Gesetzentwurf eingebracht, sinken die Chancen einer Verabschiedung in dieser Legislaturperiode schnell gegen Null. Sollte sich dann – frage ich – die deutsche Reproduktionsmedizin weiter die Hände binden lassen, ohne den internationalen Stand ihrer Wissenschaft praktizieren zu dürfen ? Lassen Sie mich deshalb folgendes Szenario entwerfen: Ende des Jahres 2004 – ein Jahrzehnt nach dem ersten und zugleich letzten PIDAntrag bei einer Ethik-Kommission in Deutschland – erreichen mehrere Reproduktionsmediziner, von Medizinrechtlern gründlich beraten, bei ihrer Ärztekammer, dass auf der Basis des PID-Entwurfs der BÄK eine verbindliche Kammer-Richtlinie beschlossen wird. Das zuständige Landesministerium sieht sich – angesichts der gewichtigen Literatur-Stimmen, dass die PID bereits nach geltendem Recht nicht verboten ist, außer Stande, der Richtlinie im Wege der Rechtsaufsicht zu widersprechen. Und nach Inkrafttreten dieses verbindlichen Berufsrechtes können die Mediziner endlich damit beginnen, ihre Paare, die bisher ins benachbarte Ausland reisen mussten, selbst zu behandeln. 2. Thema: Aktuelle Urteilsbesprechung - Aufgaben des Sachverständigen im Arzthaftungsprozess: Dr. Pelz, Münster, OLG Hamm: Dem Sachverständigen kommt im Arzthaftungsprozess eine Schlüsselrolle zu. Seine Bedeutung kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Nun enthalten aber die gesetzlichen Vorschriften der Zivilprozessordnung (ZPO) über die Erhebung des Sachverständigenbeweises eher spärliche Regelungen und gar keine, die auf die Besonderheiten des Arzthaftungsverfahrens zugeschnitten wären. Die Folge ist, dass – wie im Arzthaftungsrecht im allgemeinen - auch in diesem Bereich dem Richterrecht große Bedeutung zukommt. Im Arzthaftungsrecht haben die Gerichte den Streit zwischen Arzt und Patient zu entscheiden, also im wesentlichen die Frage, ob die Behandlung dem Standard entsprochen hat und/oder ob die Behandlung für einen eingetretenen Schaden kausal gewesen ist. Die richterliche Rechtsfortbildung in diesem Bereich geschieht unabhängig von dem Verhältnis des Gerichts zu Prozessbeteiligten, also Parteien, Zeugen oder Sachverständigen. Anders ist es bei der Erhebung von Sachverständigenbeweis. Hier kommt zum Tragen, dass die Aufgabe des Sachverständigen darin besteht, das Gericht sachkundig zu machen und ihm die tatsächlichen Grundlagen des Behandlungsgeschehens und seiner Folgen deutlich zu machen. Aufgabe des Gerichts ist es, auf dieser Grundlage eine juristische Wertung vorzunehmen. Hier zeigen sich die unterschiedlichen Aufgaben von Richtern und Sachverständigem, die oft aber nur schwer voneinander abgrenzbar sind. Es hat deshalb schon seit langer Zeit eine Diskussion über die Abgrenzung der Befugnisse von Sachverständigen einerseits und Richtern andererseits gegeben. Der Bundesgerichtshof hat bereits in einer Entscheidung aus dem Jahre 1955 ausgeführt: Der verfahrensrechtliche Ausgangspunkt für die Beurteilung liegt darin, dass der Tatrichter zu einem eigenen Urteil auch in schwierigen Fachfragen verpflichtet ist. Er hat die Entscheidung auch über diese Fragen selbst zu erarbeiten, ihre Begründung selbst zu durchdenken. Er darf sich dabei vom Sachverständigen nur helfen lassen. Je weniger sich der Richter auf die bloße Autorität des Sachverständigen verlässt, je mehr er den Sachverständigen nötigt, ihn den Richter – über allgemeine Erfahrungen zu belehren und mit möglichst gemeinverständlichen Gründen zu überzeugen, desto vollkommener erfüllen beide ihre verfahrensrechtliche Aufgabe (BGHSt 8, 113 = NJW 1955, 1642). Mit diesen klaren Worten hätte es sein Bewenden haben können, zumal in den folgenden Jahrzehnten durch die Rechtsprechung des VI. ZS. des BGH „klare und überschaubare Konturen“ (Gehrlein MedR 2002, 28 ) herausgearbeitet worden sind. Wie schwer es aber für Gerichte immer noch ist, gemeinsam mit dem Sachverständigen die zugrundeliegende Problematik zu durchdringen und sich immer wieder bewusst zu machen, dass Ärzte und Juristen unterschiedliche Denkweisen haben und unter demselben Wort oft etwas ganz anderes verstehen, zeigen Entscheidungen des VI. ZS des BGH in den vergangenen beiden Jahren. Protokoll Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ - 04.und 05. April 2003 - Seite 14 Ich möchte Ihnen drei Urteile aus den Jahren 2001 und 2002 vorstellen, die dies belegen. Der VI. ZS des BGH hat in diesen Entscheidungen die Anforderungen an Gerichte und Sachverständige in Bezug auf die Bewertung des Behandlungsgeschehens erneut präzisiert und wohl auch erweitert. In allen drei Fällen geht es um die Frage, ob ein grober Behandlungsfehler vorliegt. Diese Konstellation ist typisch für die Schwierigkeiten bei der juristischen Bewertung. Eine gesetzliche Definition des groben Behandlungsfehlers gibt es nicht. Es gilt die Definition des BGH, also Richterrecht. Es ist von großer Bedeutung, ob ein solcher Fehler festgestellt werden kann, weil sich in diesem Fall die Beweislast umkehrt, also der Arzt beweispflichtig dafür ist, dass die fehlerhafte Behandlung für den Gesundheitsschaden des Patienten nicht ursächlich geworden ist. Der erste Fall (BGH, Urteil v. 29.5.2001, NJW 2001, 2792) lag wie folgt: Nach einer Knie-Arthroskopie traten am 3. postoperativen Tag Fieber, Schmerzen, eine Schwellung und eine erhöhte Blutsenkungsgeschwindigkeit auf. Der Arzt leitete eine antibiotische Behandlung ein, ohne Maßnahmen zur Erregerbestimmung zu treffen. Am 7. postoperativen Tag entleerte sich im Rahmen einer Wundspreizung nach der Behauptung des Arztes klares Serom, nach der Behauptung des Patienten Eiter. Auch jetzt wurde keine Keimbestimmung vorgenommen. Nach weiterer erheblicher Verschlechterung wurde am 10. postoperativen Tag eine Revisionsoperation durchgeführt. Die nunmehr erfolgte Keimbestimmung ergab keinen Bakteriennachweis. In der Folgezeit waren zahlreiche weitere Eingriffe erforderlich; gleichwohl verlor der Patient das Bein. Der Sachverständige hatte ausgeführt, es sei zwar nicht ideal und nach seiner persönlichen Auffassung nicht zu rechtfertigen, dass die Operation erst nach 10 Tagen statt schon nach 7 Tagen erfolgt sei, gleichzeitig aber erklärt, dass es eine verbreitete Haltung sei, in solchen Fällen nicht sogleich zu operieren. Es gebe immer noch eine ärztliche Lehrmeinung, die ein operatives Vorgehen in solchen Fällen nicht für zwingend geboten halte, weil eine Wundinfektion im äußeren Bereich außerhalb des Kniegelenks auftreten könne, ohne dass von der Infektion auch das Kniegelenk betroffen sei. Zur Frage der Einleitung einer ungezielten Antibiotika-Behandlung hatte der Sachverständige ausgeführt, dies sei zwar falsch gewesen; auch hätte am 7. postoperativen Tag eine Erregerbestimmung zwingend stattfinden müssen, selbst wenn nur klare Flüssigkeit ausgetreten sein sollte, wie der Arzt es behauptet habe. Das OLG hat sowohl in der Revisionsoperation erst am 10. postoperativen Tag als auch in der ungezielten Antibiotikabehandlung grobe Behandlungsfehler gesehen. Der VI. ZS des BGH hat das Urteil aufgehoben und dies wie folgt begründet: Zunächst werden in den Urteilsgründen die Merkmale des „groben Behandlungsfehlers“ wiederholt. Sie lauten: Ein grober Behandlungsfehler setzt neben einem eindeutigen Verstoß gegen bewährte ärztliche Behandlungsregeln oder gesicherte medizinische Erkenntnisse die Feststellung voraus, dass der Arzt einen Fehler begangen hat, der aus objektiver Sicht nicht mehr verständlich erscheint, weil er einem Arzt schlechterdings nicht unterlaufen darf. Sodann wird ausgeführt, dass es sich insoweit zwar um eine juristische Beurteilung handele, diese jedoch in vollem Umfang durch die vom ärztlichen Sachverständigen mitgeteilten Fakten getragen werden müsse und sich auf die medizinische Bewertung des Behandlungsgeschehens durch den Sachverständigen stützen müsse. Der BGH hat die Äußerungen des Sachverständigen „zwar nicht ideal“, „nach seiner persönlichen Auffassung nicht zu rechtfertigen“, die vom Arzt getroffene Entscheidung sei nicht „grob fahrlässig“, die unterlassene Keimbestimmung sei „zwingend“ vorzunehmen gewesen, als Grundlage für die juristische Wertung „grober Behandlungsfehler“ nicht für ausreichend erachtet, sondern dem Berufungsgericht aufgegeben, darauf hinzuwirken, dass der Sachverständige sich auf eine eindeutige Bewertung des Behandlungsgeschehens festlegt. Und dies dürfte nur in einer neuen Erörterung mit dem Sachverständigen möglich sein. Hier wird deutlich, welche hohen Anforderungen der VI. ZS des BGH an die Erstellung eines Sachverständigengutachtens und an die Pflicht des Gerichts stellt, den Sachverständigen so zu befragen, dass das Vorliegen eines groben Behandlungsfehlers nach der vom BGH vorgegebene Definition praktisch wörtlich vom Sachverständigen bestätigt oder verneint wird. Eine irgendwie geartete Auslegung von Begriffen, die der Sachverständige benutzt hat, dürfte nicht ausreichen. Das mag an der hier vom Sachverständigen benutzten Terminologie dargelegt werden. Die Bezeichnungen „nicht ideal“, „nicht zu rechtfertigen“, zwingend geboten“ können nach meiner Auffassung auch dann einen groben Behandlungsfehler begründen, wenn der Sachverständige gleichzeitig davon spricht, dass eine grobe Fahrlässigkeit nicht vorliegt. Denn die Begriffe „grobe Fahrlässigkeit“ und „grober Behandlungsfehler“ sind bekanntlich nicht identisch. Der zweite Fall ( BGH, Urteil v.19.6.2001, NJW 2001, 2794) lag wie folgt: Die Klägerin war bei der beklagten Ärztin für Allgemeinmedizin seit längerem wegen andauernder Schmerzen im Hals- und Rückenbereich und wegen regelmäßiger Schlafstörungen in Behandlung, zuletzt am 8.8.1995. An diesem Tage wurde eine physiotherapeutische Behandlung vereinbart. Am Nachmittag dieses Tages rief der Ehemann der Klägerin bei der Beklagten an und teilte ihr mit, die Klägerin habe Schlaftabletten genommen. Einzelheiten dieses Gesprächs sind streitig. Die Beklagte empfahl einen Besuch ihrer Praxis am nächsten Tag. In der folgenden Nacht vom 8./9.8.1995 rief der Ehemann der Klägerin gegen 3.00 Uhr bei der Beklagten an und äußerte u.a., die Klägerin wolle weglaufen. Die Beklagte empfahl dem Ehemann der Klägerin, ein Weglaufen zu verhindern und die Klägerin am nächsten Morgen in die Praxis zu bringen. Die Klägerin entfernte sich in der Nacht aus der Wohnung und unternahm einen Suizidversuch, bei dem sie sich schwer verletzte. Protokoll Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ - 04.und 05. April 2003 - Seite 15 Der Sachverständige hatte ausgeführt, dass die Beklagte bei der Patientin eine psychische Störung mit Suizidgefahr für möglich hätte erachten und dementsprechend sich entweder persönlich über den Zustand der Klägerin durch einen Hausbesuch hätte informieren oder zumindest den ärztlichen Notdienst hätte einschalten müssen. Zu der Frage, wie dieser Verstoß gegen den anerkannten ärztlichen Standard zu bewerten sei, hatte der Sachverständige sich nicht geäußert. Das OLG hat der Klägerin Schadensersatz zugesprochen und zur Begründung ausgeführt, das Unterlassen eines nächtlichen Hausbesuchs sei als grob fehlerhaft einzustufen. Es hat sich dabei ersichtlich von der Erwägung leiten lasen, dass der Behandlungsablauf geklärt und das Abweichen vom guten ärztlichen Standard durch die Ausführungen des Sachverständigen bewiesen sei. Das Gericht hat nicht nur die juristische Bewertung des Verstoßes vorgenommen, sondern auch – bewusst oder unbewusst – auch eine Bewertung des Fehlverhaltens aus ärztlicher Sicht. Dies hat der VI. ZS des BGH beanstandet und erklärt, dass auch beim Vorliegen eines Verstoßes gegen bewährte und gesicherte Regeln und Erkenntnisse festgestellt werden müsse, „dass ein unverständliches Fehlverhalten der Beklagten vorgelegen hat, das einem Arzt, gerade auch einer Ärztin für Allgemeinmedizin in der hier gegebenen Situation, schlechterdings nicht unterlaufen darf.“ . Dies bedeutet, dass der ärztliche Sachverständige expressis verbis die juristischen Kriterien des groben Behandlungsfehlers aus seiner Sicht für gegeben halten muss. Bemerkenswert ist wiederum, dass der BGH in der Formulierung „gerade auch einer Ärztin für Allgemeinmedizin in der hier gegebenen Situation“ wiederum den Blick auf die entscheidenden objektiven Umstände und die damit gegebene Behandlungsebene verweist. Es kommt auf den berufsspezifischen Sorgfaltsmaßstab des betreffenden Arztes an. Der letzte Fall (BGH, Urteil v. 27.3.2001, MedR 2002, 28): Bei der am 22.5.1994 geborenen Klägerin trat am 27.5. ein lebensbedrohlicher Zustand auf. Sie wurde in eine Kinderklinik verlegt. Der Beklagte, ein Oberarzt dieser Klinik, diagnostizierte ein akutes Abdomen mit Darmperforation und einen Kreislaufschock. Er veranlasste die Verlegung per Hubschrauber in eine Spezial Klinik und ordnete für den Transport als Flüssigkeitszufuhr 5%igeGlukose mit Kochsalzzusatz an. Während des Transports brach der Kreislauf des Kindes – nach vorheriger kurzer Erholung – erneut zusammen. Aufgrund einer intensiven Volumensubstitution in der Spezialklinik verbesserte sich der Zustand der Klägerin, so dass noch am selben Tage eine Laparotomie vorgenommen werden konnte. Das Kind überlebte mit einer schweren Hirnschädigung. Die Klägerin hat dem Beklagten u.a. vorgeworfen, den eingetretenen Schockzustand unsachgemäß behandelt zu haben, weil er es versäumt habe, für eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr während des Fluges zu sorgen. Im Laufe des sich hinziehenden Prozesses hatte der gerichtliche Sachverständige, wie das nicht selten ist, sich unterschiedlich geäußert. Zunächst hatte er – es ging um die Volumensubstitution bei dem Hubschraubertransport – die Auffassung vertreten, diese Maßnahme habe nicht dem ärztlichen Standard entsprochen; es hätte zumindest vor Beginn des Transports einer wirkungsvolleren Volumensubstitution bedurft; das ärztliche Vorgehen sei aber mit der Hektik in der Kinderklinik zu erklären. Auf den Vorhalt der Beklagtenseite, ihr Vorgehen sei von der Überlegung getragen gewesen, auf jeden Fall eine Hirnschwellung zu vermeiden, erklärte der Sachverständige, rückblickend müsse man das Vorgehen beim Transport nicht für ausreichend und damit für fehlerhaft ansehen, doch sei auf keinen Fall von einem aus objektiver ärztlicher Sicht unverständlichen und damit groben Behandlungsfehler auszugehen. In der ergänzenden mündlichen Verhandlung vor dem OLG führte der Sachverständige schließlich aus, dass jeder behandelnde Arzt wissen müsse, dass bei einer schweren Sepsis eine Bekämpfung des Schockzustandes mit Glukoselösung auf Dauer nicht ausreichend sei. Das OLG hat auf die letzte Äußerung des Sachverständigen seine Wertung gestützt, dass die Versäumnisse des Beklagten als grober Behandlungsfehler zu qualifizieren seien. Der VI. ZS des BGH hat das Urteil aufgehoben, weil das OLG sich nur juristisch mit den unterschiedlichen Erklärungen des Sachverständigen auseinandergesetzt habe, ohne den Sachverständigen selbst mit seinen widersprüchlichen Äußerungen zu konfrontieren und ihn gezielt zu befragen. Zudem hat der BGH deutlich gemacht, dass das Gericht jedenfalls dann, wenn der Sachverständige ausdrücklich einen groben Behandlungsfehler verneint hat, ohne weitere Klärung, ggf. durch ein weiteres Gutachten, nicht – gestützt auf eigene Sachkunde – einen solchen annehmen darf. Der Grad der Verletzung des ärztlichen Standards ist durch ärztliche Sachverständige zu beantworten. Es bleibt festzuhalten: Die Diskussion zwischen ärztlichen Sachverständigen und Juristen über die Unterschiede zwischen ärztlicher und juristischer Terminologie wird weitergehen müssen. Nur in seltenen Fällen wird das schriftliche Gutachten eines ärztlichen Sachverständigen so eindeutig sein, dass auch für den Juristen die ärztlich/medizinische Bewertung des Behandlungsgeschehens unzweifelhaft klar ist. In besonderer Weise gilt dies für die Wertung eines Verhaltens als „grob fehlerhaft“. Jede Äußerung des medizinischen Sachverständigen muss daran gemessen werden, ob sie die von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien des „groben Behandlungsfehlers“ erfüllt. Wenn der Sachverständige nicht schon von sich aus eine entsprechende Wertung vornimmt, wird er sich ausdrücklich dazu erklären müssen, ob das Behandlungsgeschehen „einen eindeutigen Verstoß gegen bewährte ärztliche Behandlungsregeln oder gesicherte medizinische Erkenntnisse darstellt und ein Fehler vorliegt, der aus objektiver Sicht nicht mehr verständlich erscheint, weil er einem Arzt schlechterdings nicht unterlaufen darf.“ Der VI. ZS des BGH will mit den angesprochenen Urteilen offenbar eine Ausweitung der Feststellung grober Behandlungsfehler durch die Instanzgerichte vermeiden. In allen diesen Fällen haben die Fachsenate der Oberlandesgerichte mit unzutreffender, jedenfalls höchst angreifbarer Begründung grobe Behandlungsfehler bejaht. Bedenken gegen die Rechtsprechung zum groben Behandlungsfehler hat es von Anfang an gegeben. Es ist von verschiedenen Seiten davor gewarnt worden, dass angesichts der Schwierigkeiten des Patienten, die Kausalität eines Protokoll Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ - 04.und 05. April 2003 - Seite 16 feststehenden Behandlungsfehlers für den eingetretenen Gesundheitsschaden zu beweisen, die Gerichte dazu neigen würden, den Patienten durch die Feststellung eines groben Behandlungsfehlers zu helfen. Dieser – möglichen – Neigung der Gerichte will der BGH wohl entgegentreten. 3. Thema: Zur Neufassung der Grundsätze der BÄK für die Sterbehilfe - Prof. Dr. W. J. Bock, Düsseldorf Diskussionsgrundlage: Entwurf der „Grundsätze der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung“ (Februar 2003) und Entwurf „Handreichungen für Ärzte zum Umgang mit Patientenverfügungen“ (als Tischvorlage bei der Sitzung verteilt) 4. Thema: Ist eine Revision des Gesetzes zum Schwangerschaftsabbruch sinnvoll? Prof. Dr. med. Th. Schwenzer, Gynäkologie und Geburtshilfe, Dortmund: Brauchen wir eine Änderung des Rechts zum Schwangerschaftsabbruch? Ich bin der festen Überzeugung, dass wir zwei verschiedene Antworten auf die gestellte Frage geben könnten: Wir können die Frage nach einem Änderungsbedarf der gesetzlichen Regelungen verneinen, weil wir die Überzeugung hegen, die gesetzlichen Regelungen stellen eine ausgewogene Balance zwischen den schutzwürdigen Belangen der Mutter und den schutzwürdigen Interessen des ungeborenen Kindes dar. Wenn wir diese Auffassung vertreten, ergibt sich für die Gesellschaft, für Schwangere, für werdende Eltern, ganz besonders aber auch für Mediziner die Verpflichtung, die gesetzlichen Vorgaben umzusetzen und Schwangerschaftsabbrüche nur in den Grenzen der gesetzlichen Regelungen durchzuführen. Ich werde ihnen im Verlauf meines Referates aufzeigen, dass die Fakten zum Schwangerschaftsabbruch anders aussehen: Eine Vielzahl an Schwangerschaftsabbrüchen wird vorgenommen, ohne dass die gesetzlichen Regelungen dem Sinn und dem Buchstaben des Gesetzes folgend eingehalten werden. Es besteht eine Allianz zwischen den Interessen der Schwangeren, in bestimmten Situationen ihren Wunsch nach Abbruch der Schwangerschaft realisieren zu können und Pränatalmedizinern, die unter dem Eindruck eines kranken Kindes oft sehr schnell die Überzeugung vertreten, ein Schwangerschaftsabbruch sei der einzig gangbare Weg. Dies formuliere ich ganz bewusst provokativ. Wenn man andererseits die Frage, ob eine Änderung des Rechts zum Schwangerschaftsabbruch erforderlich ist, bejaht, muss man dies mit dem Ziel tun, die Gesetze an die tatsächliche Praxis, wie Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland derzeit gehandhabt werden, anzupassen. Wenn man dies nicht tut, lässt man Schwangere und Ärzte im Stich. Wohlgemerkt ich vertrete hier bewusst nicht eine bestimmte Position und verstehe mich nicht als Verfechter einer Richtung. Ich bin weder a priori ein Befürworter einer Liberalisierung des Rechts zum Schwangerschaftsabbruch, noch ein Verfechter einer noch restriktiveren Position. Ich möchte die Brüche zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen Gesetz und Praxis aufzeigen und verdeutlichen. Lassen Sie mich zunächst einige Basisdaten zum Schwangerschaftsabbruch zeigen: Abbildungen 1-5 Gemeldete Schwangerschaftsabbrüche 135000 Schwangerschaftsabbrüche Nach Altersklassen 134964 687 8045 130387 2002 130000 125000 761 120000 2001 2002 115000 629 21405 27068 26550 6025 22091 2001 110000 696 39189 6682 29053 27897 39664 6909 105000 0 100000 2001 Quelle: Statistisc hes Bundesamt 2002 < 15 10000 15-18 18-25 20000 25-30 30000 30-35 40000 35-40 Quelle: Statistisc hes Bundesamt Protokoll Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ - 04.und 05. April 2003 - Seite 17 40-45 50000 > 45 Schwangerschaftsabbrüche nach Familienstand Schwangerschaftsabbrüche nach Indikation 7281 127079 472 2002 60158 62476 37 3271 2001 49 3575 131340 7917 555 2001 2002 63688 62806 0 0 20000 Ledig 40000 Verheiratet 60000 Verwitwet 80000 Geschieden Quelle: Statistisc hes Bundesamt 20000 40000 Medizinische Indikation Beratungsregelung 60000 80000 100000 Kriminologische Indikation Quelle: Statistisc hes Bundesamt Schwangerschaftsabbrüche nach Tragzeit 188 1861 22829 2002 44096 46224 15189 177 1904 23538 2001 48245 47474 15626 0 10000 20000 unter 6 Wochen 10-13 Wochen 30000 40000 6-8 Wochen 13-23 Wochen 50000 60000 8-10 Wochen > 23 Wochen Quelle: Statistisc hes Bundesamt In der Frauenklinik im Klinikum Dortmund werden jährlich zwischen 1500 und 1600 Kinder geboren und dabei werden allein an Frühgeburten unter 1500 g jährlich zwischen 120 und 130 Kinder betreut. Damit rangiert die Dortmunder Klinik ganz weit vorn, was die Anzahl an Hochrisikogeburten gerade auch im Grenzbereich werdenden Lebens angeht. In die Frauenklinik integriert ist eine große Abteilung für Pränataldiagnostik, in der drei Fachärztinnen ganztägig bei unauffälligen Schwangerschaften als Routineuntersuchung und bei Risikoschwangerschaften mit auswärts bereits auffälligen Untersuchungsbefunden Pränataldiagnostik betreiben. Jährlich werden zwischen 700 und 800 invasive Untersuchungen und zwischen 4500 und 5000 Fehlbildungs-Ultraschalluntersuchungen durchgeführt. Abbildung 6 Schwangerschaftsabbrüche Klinikum Dortmund 2001 2002 Medizinische Indikation 31 46 Beratungsregelung 31 27 Kriminologische Indikation 1 1 Gesamt 63 74 Aus dieser Arbeit der Pränataldiagnostik ergeben sich naturgemäß eine Anzahl an Fehlbildungen und Chromosomenstörungen, so dass sich in diesen Fällen auch die Frage eines Schwangerschaftsabbruches aus der früheren eugenischen Indikation, die auch heute unter die mütterliche Indikation fällt, ergibt. Auf die besonderen Fragen, die sich aus dieser Tätigkeit im Hinblick auf einen Schwangerschaftsabbruch ableiten lassen, werde ich im Folgenden ausführlich eingehen. Der Schwangerschaftsabbruch nach der Beratungsregelung stellt in Deutschland den zahlenmäßig größten Anteil der erfassten Schwangerschaftsabbrüche dar. Die Beratungsregelung in der jetzigen Form ist 1995 gesetzlich geregelt worden und ist Ausfluss der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahr 1993 mit dem dieses bekanntlich die vorher im Gesetzgebungsverfahren praktisch umgesetzte Fristenregelung für verfassungswidrig erklärt hat. Die Beratung zum Schwangerschaftsabbruch erfolgt in autorisierten Einrichtungen und kann Protokoll Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ - 04.und 05. April 2003 - Seite 18 auch durch entsprechend qualifizierte Ärzte vorgenommen werden. Ich selbst führe mit meinen Mitarbeitern im Auftrag der Ärztekammer Westfalen-Lippe jährlich ein zweitägiges Seminar durch, bei dem Ärztinnen und Ärzte die Qualifikation dafür erwerben können, nach dem Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten (Schwangerschaftskonfliktgesetz – SchKG) eine Schwangerschaftskonfliktberatung durchzuführen und die entsprechende Bescheinigung dann auszustellen. Sie wissen, dass die Beratung nicht ergebnisoffen durchgeführt werden darf, sondern dass der Schutz des ungeborenen Lebens ausdrückliches Beratungsziel sein muss. Schon vor dem Ausstieg der Beratungsstellen in katholischer Trägerschaft gab es keine verlässlichen Daten darüber, wie viele Beratungen zum Erhalt der Schwangerschaft beigetragen haben und mit dem Ausstieg dieser Institutionen ist die Datenlage dazu vollends unsicher. Mehr als 120.000 Schwangerschaftsabbrüche jährlich, die nach der Konfliktberatung vorgenommen werden sind für mich Ausdruck dafür, dass weder die Bemühungen zur Verhinderung ungewollter Schwangerschaften wirksam greifen, noch die Schwangerschaftskonfliktberatung einen erkennbaren Beitrag zur Reduktion von Schwangerschaftsabbrüchen leistet. Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber bewusst den Auftrag gegeben, eine gesetzliche Regelung in einer angemessenen Frist daraufhin zu überprüfen, ob der gesetzliche Auftrag dem Schutz ungeborenen Lebens gerecht wird. Bisher hat der Gesetzgeber diesen Auftrag nicht aufgenommen. Flächendeckend existieren in Deutschland Einrichtungen, die einen Schwangerschaftsabbruch nach der Beratungsregelung durchführen. In der Regel handelt es sich dabei um ambulante Einrichtungen, die den Schwangerschaftsabbruch teils gelegentlich, teils regelmäßig, in vielen Fällen auch als ausschließliche medizinische Leistung durchführen. Nach der Beratungsregelung ist ein Schwangerschaftsabbruch bis zur 12. Woche post conceptionem straffrei durchführbar. In der dem Gynäkologen vertrauten Berechnung ausgehend von der letzten Periodenblutung bedeutet dies, dass ein Schwangerschaftsabbruch etwa bis zur 14. Schwangerschaftswoche gerechnet vom ersten Tag der letzten Periodenblutung an straffrei vorgenommen werden darf. Hier stellt sich für die Umsetzung ein erstes Dilemma: Bis etwa zur 10./11. Schwangerschaftswoche ist der Embryo so klein, dass er relativ komplikationsarm mittels Saug-Kurettage oder konventioneller Kurettage aus dem Uterus entfernt werden kann. Der Eingriff kann ambulant von einem Arzt vorgenommen werden, der sich dazu bereiterklärt hat, derartige Eingriffe vorzunehmen, er beschäftigt Mitarbeiter, die durch konkludentes Handeln ebenfalls ihre Bereitschaft zur Mitwirkung bei derartigen Eingriffen bekunden. Ein unproblematischer risikoarmer auch ambulant durchzuführender Schwangerschaftseingriff ist nur möglich, wenn der Embryo noch nicht zu groß ist. Gerade auch im Bereich des noch rechtlich zulässigen straffreien Schwangerschaftsabbruches kommt es zu einer enorm raschen Größenzunahme des Embryos, so dass die komplikationsarme ambulante Durchführung eigentlich nur bis zur etwa 9./10. Schwangerschaftswoche post conceptionem möglich ist. Danach ist der Embryo so groß, dass er nicht mehr allein durch Kurettage gewonnen werden kann. Hier ist dann die Einleitung einer Fehlgeburt mit Medikamenten, in der Regel mit Prostaglandin, erforderlich. Dies ist unter ambulanten Bedingungen nicht durchführbar, da der Zeitpunkt, wann der Embryo ausgestoßen wird und wann dann eine Nachkurettage erforderlich wird, nicht planbar ist. Die Schwangere muss auch kontinuierlich überwacht werden, solange die Prostaglandine verabreicht werden. Somit ist der Schwangerschaftsabbruch in den späteren Wochen des Zeitraumes, in dem noch ein Abbruch nach der Beratungsregelung möglich ist, im Prinzip an stationäre Einrichtungen gebunden. Zumindest für große kommunale Einrichtungen ist es daher kaum möglich, sich der Durchführung derartiger Eingriffe gänzlich zu verschließen. Ein weiterer Problembereich des straffreien Schwangerschaftsabbruchs ist die immer noch unzureichende technische Durchführung. Es ist heute etablierter Standard, bei einer Kurettage mit dem Ziel eines Schwangerschaftsabbruches zunächst ein sogenanntes Portio-Priming durchzuführen, d.h. den Muttermund medikamentös so aufzuweichen, dass die instrumentelle Aufdehnung des Muttermundes komplikationsarm durchgeführt werden kann. Dies geschieht dadurch, dass ein Prostaglandinzäpfchen drei Stunden vor dem Eingriff verabreicht wird. Durch die konsequente Anwendung dieser Maßnahme ist heute ein Schwangerschaftsabbruch vielfach risikoärmer durchführbar als vor etwa 15 Jahren, als es diese Vorbereitungsmöglichkeiten noch nicht gab. Bei einer Vielzahl von Abbrüchen kam es bei der instrumentellen Aufdehnung des sehr rigide verschlossenen Muttermundes zu Perforationen mit allen Komplikationsmöglichkeiten. Allerdings ist auch heute dieses Verfahren längst nicht etabliert, weil zum Teil aus Kostengründen keine Prostaglandine verabreicht werden oder weil das Zeitmanagement mit dem notwendigen Intervall zwischen der Verabreichung des Zäpfchens und der eigentlichen Kurettage sich schwierig darstellt. Daher werden wir leider jährlich mit bis zu 10 Fällen konfrontiert, in denen es im ambulanten Bereich zu Komplikationen beim Schwangerschaftsabbruch gekommen ist, weil im günstigsten Fall der Abbruch wegen technischer Undurchführbarkeit ohne Vorbereitung nicht gelungen ist und weil im ungünstigsten Fall es zu multiplen Perforationen gekommen ist, so dass die Schwangere blutend und schockig notfallmäßig in die Klinik eingewiesen wird und im ungünstigsten Fall ihren Uterus wegen multipler Perforationsverletzungen verliert. Hier sehe ich einen dringenden Handlungsbedarf über entsprechende Leitlinien. Natürlich sind entsprechend klinische Einrichtungen auch in diesen Fällen manchmal gezwungen, den noch nicht erfolgreich im ambulanten Bereich durchgeführten Schwangerschaftsabbruch zu Ende zu bringen. Dies stellt für die Ärztinnen und Ärzte aber auch für die anderen Mitarbeiter der Klinik eine Herausforderung und psychische Belastung in einem Bereich dar, wo sie eigentlich einen Schwangerschaftsabbruch nicht durchführen wollen. Auch über die kriminologische Indikation verfüge ich aus der Erfahrung der großen Klinik und in der Zusammenarbeit mit der Polizei über die entsprechenden Erfahrungen. Man vermisst hier klare Regelungen, wann von einer kriminologischen Indikation tatsächlich ausgegangen werden darf. In den eigenen Fällen haben wir die rechtmäßige Durchführung eines Schwangerschaftsabbruches nach kriminologischer Indikation von der Mindestvoraussetzung abhängig gemacht, dass bei den Strafverfolgungsbehörden ein Ermittlungsverfahren in Gang gesetzt worden ist. In den von mir in den letzten drei Jahren überblickten 4 eigenen Fällen war zweimal das Ermittlungsverfahren bereits in Gang gesetzt, im dritten Fall haben wir die Schwangere von der Notwendigkeit einer Strafanzeige überzeugen können und dann nach Einleitung des Ermittlungsverfahrens die Schwangerschaft abgebrochen. Weiterhin ist m.E. der Erlaubnisumfang des § 218a Abs. 3 StGB nicht ausreichend weit gefasst. Nur Straftaten nach den §§ 176-179 StGB stellen einen Abbruch straffrei. Es fehlen die §§ 174 StGB, Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen, 174a StGB, Sexueller Missbrauch von Gefangenen etc., 174b StGB, Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung und 174c StGB, Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses. Warum diese Taten der Gesetzgeber nicht in die Regelung des § 218a Abs. 3 StGB mit aufgenommen hat, kann nicht beantwortet werden. Aus meiner Sicht fehlt auch der § 173 StGB, Beischlaf zwischen Verwandten Im Mittelpunkt der medizinisch-juristischen Problematik steht heute ganz zweifelsfrei die medizinische Indikation und hier besonders die Fälle, die unter die Fallgestaltungen der früheren sogenannten embryopatischen Indikation fallen. Diese Fälle verlieren sich zwar gegen die erdrü- Protokoll Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ - 04.und 05. April 2003 - Seite 19 ckende Überzahl indikationsloser Schwangerschaftsabbrüche, sie stellen jedoch eine hohe Belastung für alle Beteiligten, die Schwangere, den indikationsstellenden Arzt, das gesamte Team, das für den Schwangerschaftsabbruch verantwortlich ist, dar. Ein Abbruch der Schwangerschaft nach der heute gültigen medizinischen Indikation kann immer nur so durchgeführt werden, dass zunächst mittels Prostaglandinen eine Abortinduktion vorgenommen wird, die je nach individueller Konstitution der Schwangeren, nach der Anzahl vorangegangener Schwangerschaften und Geburten, möglicher Voroperationen und anderer Einflussfaktoren unterschiedlich lange Zeit in Anspruch nimmt. In der Regel vergehen mindestens 10 – 12 Stunden, im ungünstigsten Fall 3 – 4 Tage, bis es unter konsequenter Anwendung von Prostaglandinen als Vaginalzäpfchen zum Ausstoßen der Leibesfrucht kommt. Danach schließt sich die Ausschabung an. Ein derartiger Eingriff ist nur unter stationären Bedingungen durchführbar. Es wird deutlich, dass derartige Eingriffe nicht von einem einzelnen Arzt - eventuell noch unter Zuhilfenahme einer einzelnen Hilfskraft - durchführbar sind, sondern dass hier ein ganzes Team, insbesondere auch unter Berücksichtigung der Arbeitszeitregelungen im zeitlichen Wechsel in Anspruch genommen wird. Jeder dieser Personen kann grundsätzlich seine Mitarbeit bei derartigen Eingriffen verweigern. Er kann diese Verweigerung generell erklären, er kann sie fallbezogen in jedem Einzelfall aber auch ohne Begründung plötzlich und überraschend ausüben. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Klinik wissen, dass sie jederzeit das Recht haben, ohne Angabe von Gründen die Mitwirkung bei einem derartigen Eingriff zu verweigern. Bisher ist es allerdings immer so gewesen, dass sich die wenigsten Mitarbeiter dann verweigert haben, wenn die Indikation zum Schwangerschaftsabbruch ausführlich im Kollegenkreis besprochen und diskutiert wurde. Aus der persönlichen, sehr engen Zusammenarbeit mit meinen Ärztinnen und Ärzten weiß ich allerdings, dass manches Mal nur aus Rücksicht auf die zwingenden klinischen Abläufe, die schwierige Dienstplangestaltung und aus Kollegialität die Beteiligung nicht verweigert wird. Letztlich wäre es eine Aufgabe des Krankenhausträgers, entsprechende Regelungen zu finden, es ist jedoch schwer vorstellbar, wie eine derartige Regelung aussehen könnte, wenn in größerem Umfang sich immer wieder Kolleginnen und Kollegen der Mitwirkung verschließen würden. Die drei Ärztinnen unseres Bereiches Pränataldiagnostik, die zunächst eine Chromosomenstörung oder eine andere schwerwiegende Fehlbildung feststellen und die Belastungssituation der Schwangeren eruieren, beteiligen sich selbst nicht an der Durchführung der Schwangerschaftsabbrüche. Sie stellen in der Regel die Indikation zum Schwangerschaftsabbruch und sind damit an der eigentlichen Durchführung Kraft Gesetzes gehindert. Auch ich selbst kann in meiner Eigenschaft als Klinikdirektor in Zweifelsfällen nicht den Eingriff selbst indizieren und dann auch für das, was ich indiziert habe, mit der eigenen Durchführung gerade Stehen. Es besteht immer noch eine Kontroverse, unter welchen Umständen Ärzte und die entsprechenden Mitarbeiter verpflichtet sind, bei einem Schwangerschaftsabbruch mitzuwirken oder nicht. Zwar bestimmt § 12 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes vom 27. Juli 1992, dass niemand verpflichtet ist, an einem Schwangerschaftsabbruch mitzuwirken. Missverständlich zu interpretieren ist allerdings der zweite Absatz, in dem es heißt, dass diese Vorschrift dann nicht gilt, wenn die Mitwirkung notwendig ist, um von der Frau eine anders nicht abwendbare Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung abzuwenden. Diese Formulierung zielt vom Grundsatz her auf die frühere medizinische Indikation ab, bei der eine Mitwirkung in Fällen einer unmittelbaren Lebens- oder Gesundheitsgefahr nicht verweigert werden konnte. Durch den Wegfall der eigenständigen eugenischen Indikation sind nun entsprechende Fallkonstellationen unter die medizinische Indikation gefallen und zumindest die Rechtsposition des Bundesjustizministeriums legt nahe, dass das Ministerium in Fällen der medizinischen Indikation kein Weigerungsrecht sieht. In einer Antwort auf eine kleine Anfrage von 88 Bundestagsabgeordneten aus dem Jahr 1999 antwortet das BMJ auf die Frage: „Teilt die Bundesregierung die Auffassung der BÄK, dass gesetzliche Voraussetzungen zuschaffen sind, die klarstellen, dass das Weigerungsrecht, an einem Schwangerschaftsabbruch mitzuwirken, ausschließlich für die Fälle unmittelbarer Lebensgefahr der Schwangeren aufgehoben ist (Erklärung zum Schwangerschaftsabbruch nach Pränataldiagnostik, Dt. Ärztebl. 1998, 95, A3013-A3116 {Heft 47]“ „Die Bundesregierung teilt nicht die Auffassung der BÄK, dass gesetzliche Voraussetzungen zu schaffen sind, die klarstellen, dass das Weigerungsrecht an einem Schwangerschaftsabbruch mitzuwirken, ausschließlich für Fälle unmittelbarer Lebensgefahr der Schwangeren aufgehoben ist. Gem. § 12 Abs. 2 SchKG gilt das Weigerungsrecht nach § 12 Abs. 1 SchKG nicht, wenn die Mitwirkung notwendig ist, um von der Frau eine anders nicht abwendbare Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung abzuwenden.“ Dieselbe Auffassung wird auch deutlich aus einem Interview mit der früheren Bundesjustizministerin Frau Prof. Herta Däubler-Gmelin, die im Spiegel Ausgabe 27 des Jahres 1999 zwar speziell auf das Problem der Spätabtreibung bezogen auf die Frage: „Wann darf ein Arzt eine Spätabtreibung ablehnen?“ antwortete: „Wenn keine Gefahr für Leben oder Gesundheit besteht. Er muss immer Eingreifen wenn der Mutter akute Gefahr droht, etwa Selbstmord. Das sind schreckliche Entscheidungen, die auch strafrechtliche Folgen nach sich ziehen können.“ Die Arbeitsgemeinschaft für Medizinrecht der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe hat diese offenen Fragen zum Anlass genommen, eine Empfehlung zum Umgang mit dem Recht, die Mitwirkung an einem Schwangerschaftsabbruch zu verweigern, herauszugeben. Das entsprechende Papier wurde von Herrn Dr. Franzki und mir vorbereitet und dann von der Arbeitsgemeinschaft, die paritätisch mit Ärzten und Juristen besetzt ist, verabschiedet und ist auch über die AWMF im Internet abrufbar. Dabei wird ausgeführt, dass nach unserer festen Überzeugung die Gefahr, die im § 218 a Abs. 2 StGB als Indikation zum Schwangerschaftsabbruch geschildert ist, nicht gleichzusetzen ist mit der Gefahr im Sinne des § 12 Abs. 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz. Dieser letzten Rechtsnorm wohnt ein ganz anderer Dringlichkeitsgrad inne. Andernfalls hätte der Gesetzgeber bestimmen müssen, dass das Weigerungsrecht in den Fällen des § 218 a Abs. 2 StGB generell nicht gilt. Ich wende mich nun dem Kernproblem der derzeitigen rechtlichen Bedingungen des Schwangerschaftsabbruches zu, nämlich der heute gültigen medizinischen Indikation. Protokoll Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ - 04.und 05. April 2003 - Seite 20 Die medizinische Indikation im engen Sinn bei einer schweren Erkrankung der Mutter stellt für die Praxis kaum Probleme dar, sie ist Gott sei Dank eine seltene Ausnahmeindikation. Zuletzt hatten wir den Fall einer Zweitgebärenden, die in der 18. Schwangerschaftswoche einen akuten Darmverschluss hatte und damit in einer auswärtigen chirurgischen Klinik operiert wurde. Der Darmverschluss war Folge eines SigmaKarzinoms und neben der Sigmaresektion wurde ein vorübergehender Anus praeter angelegt. Bei der histologischen Aufarbeitung des Präparates zeigten sich lokoregionäre Lymphknotenmetastasen, so dass in der gemeinsamen Tumorkonferenz mit den Chirurgen und den internistischen Onkologen unseres Hauses sich die Situation ergab, dass sich eine Chemotherapie als Standard anschließen musste. Das notwendige Therapieregime war fetotoxisch und in der Schwangerschaft nicht durchführbar, der Verzicht auf die adjuvante Chemotherapie hätte die Prognose der Patientin deutlich verschlechtert. Damit war die klassische Situation gegeben, in der ein Schwangerschaftsabbruch aus medizinischer Indikation indiziert und rechtmäßig war. Ich will auch nicht verhehlen, dass wir immer wieder Patientinnen von außerhalb mit bereits vorgefertigten Diagnosen zugewiesen bekommen, bei denen eine Grunderkrankung der Mutter mit dem Austragen einer Schwangerschaft nicht vereinbar sei. In diesen Fällen prüfen wir selbst regelmäßig interdisziplinär sehr sorgfältig, in wie weit sich durch die Schwangerschaft tatsächlich eine Verschlechterung der Prognose ergibt. Häufig stellt man dann fest, dass die ärztliche Bescheinigung auf Fehleinschätzung beruht und sich tatsächlich für die Fortsetzung der Schwangerschaft kein konkret erhöhtes Risiko ergibt. In diesen Fällen bedarf es vieler Gespräche, um die Schwangere davon zu überzeugen, dass ein Abbruch nicht indiziert ist. Wenn ich zur eigentlichen Kernproblematik des derzeitig gültigen Rechts vorstoße, muss ich zunächst einen kurzen Rückblick auf die Entwicklung der Pränataldiagnostik machen: In den 60er Jahren gelang es erstmals, aus Fruchtwasser fetale Zellen auf Nährmedien anzuzüchten und einer Chromosomenuntersuchung zugänglich zu machen. Anfang der 70er Jahre fand diese Untersuchung Eingang in die klinische Routine und mittels Amniozentese konnte Fruchtwasser gewonnen und untersucht werden. Auf diese Weise gelang der Nachweis von numerischen Aberrationen des Chromosomensatzes. Dabei stellt die Trisomie 21 die weit überwiegende Zahl pathologischer Befunde dar. Andere Chromosomenstörungen wie die Trisomie 18 und die Trisomie 13 sind wesentlich seltener. Für die numerischen Aberrationen des Chromosomensatzes gibt es eine enge Korrelation mit dem mütterlichen Alter und ab dem 30. Lebensjahr kommt es zunächst zu einem langsamen dann akzelerierten Anstieg des Risikos. Zunächst wurde eine Altersgrenze von 38 Jahren als Indikation für eine derartige Untersuchung gesetzt, später wurde die Altersgrenze auf 35 Jahre herabgesetzt. Dies geschah insbesondere auch unter dem Eindruck einer immer risikoärmeren Durchführungsmöglichkeit des Eingriffs. In den Anfangsjahren der Amniozentese erfolgte diese noch ungezielt ohne Ultraschallkontrolle, später konnte mit der zunächst noch sehr schlechten Qualität der Ultraschalluntersuchung zumindest der Plazentasitz und ein Raum mit einem relativ großen Fruchtwasserdepot lokalisiert werden. Mit der Verbesserung der Ultraschallgeräte konnte die Amniozentese in frühere Schwangerschaftswochen verlagert werden und hat heute nur noch ein eingriffsbedingtes Abortrisiko, das unter 0,5 % in der internationalen Literatur angegeben wird. Durch differenziertere Untersuchungsmöglichkeiten konnten in der Folge nicht nur grobnumerische Chromosomenstörungen erfasst werden, sondern auch Deletionen einzelner Chromosomenbestandteile und schließlich auch Strukturanomalien, die dann auch einzelnen Krankheitsbildern zugeordnet werden konnten. Bei gesunden Frauen ohne erkennbare genetische Belastung stellt nach wie vor jedoch das Risiko der Trisomie 21 das größte Risiko dar und ist die tragende Leitschiene für die invasive Pränataldiagnostik mittels Amniozentese. Nur in den seltenen Fällen, in denen eine familiäre Belastung erkennbar ist, zum Beispiel weil ein Kind einer früheren Schwangerschaft bereits an einer genetisch bedingten Erkrankung erkrankt ist, erfolgt die Amniozentese mit einer gezielten Fragestellung im Hinblick darauf, ob eine seltene Erkrankung sich auch in einer weiteren Schwangerschaft wiederholt. Dies gilt zum Beispiel für die Mukoviszidose, bei der genetisch determiniert ein 25 %iges Erkrankungsrisiko besteht. Die Pränataldiagnostik wurde erst sehr viel später - mit Beginn der 80er Jahre - durch die nicht invasive Ultraschalldiagnostik flankiert, weil mit den immer besser werdenden hoch auflösenden Ultraschallgeräten Detailstrukturen bei Embryo und Fetus erkennbar wurden. Das ärztliche Handeln wurde von einem gesetzlichen Rahmen flankiert, der hier eindeutige Bedingungen schuf. Im § 218a StGB alter Fassung war festgelegt, dass ein Schwangerschaftsabbruch dann straffrei durchgeführt werden konnte, wenn der Abbruch nach ärztlicher Erkenntnis angezeigt sei, eine Gefahr für das Leben oder die Gefahr einer schweren Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren abzuwenden und die Gefahr nicht auf andere für sie zumutbare Weise abgewendet werden konnte. Im Abs. 2 war dann festgelegt, dass diese Voraussetzungen dann als erfüllt galten, wenn nach ärztlicher Erkenntnis dringende Gründe für die Annahme sprechen, dass das Kind in Folge einer Erbanlage oder schädlicher Einflüsse vor der Geburt an einer nicht behebbaren Schädigung seines Gesundheitszustandes litt, die so schwer wogen, dass von der Schwangeren die Fortsetzung der Schwangerschaft nicht verlangt werden konnte. Damit stand die Schwangere ganz im Zentrum der Entscheidung, in dem sich aus der unzumutbaren Belastung für sie die Indikation zum Schwangerschaftsabbruch ergab. Die Schwere der Erkrankung war bewusst in die Überprüfung der Indikationsstellung mit aufgenommen. Die normative Kraft des Faktischen hat im Alltag dafür gesorgt, dass die Trisomie 21 sich als eine so schwere Erkrankung dargestellt hat, dass in diesen Fällen jeweils die Indikation zum Schwangerschaftsabbruch gesehen wurde. Jeder einzelne von ihnen mag auch vor dem Hintergrund persönlicher Erfahrungen im Umgang mit Menschen, die unter diesem Krankheitsbild leiden, für sich selbst prüfen, ob diese inzwischen über Jahrzehnte geübte Praxis einer ethisch-moralischen Überprüfung stand hält. Mongoloide Kinder und Erwachsene sind fröhliche, lebensbejahende Menschen, die im Einzelfall auch ihrer Familie sicher oft mehr Freude und Bereicherung geben, als sie an Mehraufwand und Belastung abfordern. Dennoch ist de facto ein Zustand eingetreten, dass man heute nur noch ganz selten auf Menschen mit diesem Krankheitsbild trifft, während noch in meiner Jugend mongoloide Kinder zu meiner selbstverständlichen Umgebung beim Spielen gehört haben. Auf die Verwerfungen, die sich in der Folge der Wiedervereinigung mit den § 218 ff StGB ergeben haben, werden möglicherweise die Juristen noch ausführlicher eingehen. Jedenfalls kam es durch das Schwangeren- und Familienhilfegesetz vom 27. Juni 1992 zur Änderung der Möglichkeiten eines legalen Schwangerschaftsabbruches mit der Folge, dass zunächst faktisch eine Fristenlösung eingeführt war. In dieser Neuregelung der §§ 218 ff StGB war die embryopatische Indikation in ihrer ursprünglichen Fassung noch enthalten. Diese Neuregelung ist jedoch nicht in Kraft getreten, sondern wurde mit Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 25. Januar 1993 vorläufig ausgesetzt und im Endurteil Protokoll Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ - 04.und 05. April 2003 - Seite 21 vom 28. Mai 1993 für verfassungswidrig erklärt. Neben der Feststellung der Verfassungswidrigkeit hat auch der Erlass einer Vollstreckungsanordnung zu den §§ 218 ff StGB erhebliche Aufmerksamkeit ausgelöst. Durch diese Vollstreckungsanordnung waren von Juni 1993 bis zum 30. September 1995 nur die Vorschriften über die medizinische, die embryopatische und die kriminologische Indikation in Kraft. Mit Datum vom 21. August 1995 ist dann nach zähem Ringen zwischen den politischen Parteien das Schwangeren- und Familienhilfegesetz geändert worden und hat zu dem nunmehr geltenden Recht der §§ 218 ff StGB geführt. Die gesamte öffentliche Aufmerksamkeit hat sich im Rahmen des Gesetzgebungsverfahren darauf gerichtet, wie die frühere Notlagenindikation geregelt würde und die Konstruktion des zwar rechtswidrigen aber straffreien Schwangerschaftsabbruches bis 12 Wochen post conceptionem in den Fällen, in denen eine qualifizierte Schwangerschaftskonfliktberatung erfolgt ist, stand im Mittelpunkt der Diskussionen. Vielfach erst nach Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Regelungen wurde wahrgenommen, dass nicht nur die vom Bundesverfassungsgericht kassierte Fristenregelung neu geregelt worden war, sondern dass auch die vorher über viele Jahre bestehende embryopatische Indikation in der Neufassung des Gesetzes nicht mehr enthalten war. Dies geschah, obwohl das Bundesverfassungsgericht gegen diese Regelung keine Bedenken vorgebracht hatte. Vielfach wird vermutet, dass dies auf den Druck der Behindertenverbände zurückzuführen gewesen sei. Möglicherweise ist diese Regelung auch darauf zurückzuführen, dass im Jahr 1994 ein Zusatz in Artikel 3 Abs. III Grundgesetz eingefügt worden ist, wonach niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf. In der Zeit nach Inkrafttreten des Gesetzes aufkommende Diskussionen wurde vielfach darüber geführt, dass damit die vorher bestehenden gesetzlichen Fristen, in denen eine embryopatische gegeben war, aufgehoben worden waren und der Fokus der Diskussion konzentrierte sich auf die Problematik der damit möglich gewordenen Spätabtreibungen. Auf diese Thematik komme ich im weiteren Verlauf meines Vortrages noch zu sprechen. Jedenfalls war die Kritik an der neuen rechtlichen Regelung immer darauf gegründet, hier seien die schutzwürdigen Interessen werdenden Lebens nicht ausreichend berücksichtigt. In der Praxis gehen viele Mediziner heute noch davon aus, durch die Subsummierung der früher eigenständigen embryopatischen Indikation unter die medizinische Indikation habe sich für die Indikationsstellung und die rechtmäßige Durchführbarkeit eines Schwangerschaftsabbruches nichts geändert. Ich gestehe, dass ich - wie die meisten Kollegen auch – lange davon ausgegangen bin, bei Vorliegen einer chromosomalen Störung oder einer anderen schwerwiegenden Fehlbildung könne auch heute noch so verfahren werden, wie dies über mehr als zwei Jahrzehnte nach dem vorher gültigen Recht möglich war. Ja es ist davon auszugehen, dass landauf landab in der Bundesrepublik Deutschland Pränataldiagnostik auch heute noch so erfolgt, als habe sich im Jahr 1995 faktisch nichts geändert: Nach Eintritt der Schwangerschaft wird die Schwangere von ihrem Frauenarzt über die Möglichkeiten der nicht invasiven und invasiven Pränataldiagnostik informiert. Nach wie vor ist dafür eine Rubrik im Mutterpass vorgesehen und der Frauenarzt schuldet diese Beratung jeder Schwangeren im Rahmen des geschlossenen Behandlungsvertrages. Er muss ggf. auch dafür haften, wenn er diese gebotene Beratung unterlässt und deshalb eine Pränataldiagnostik von der Schwangeren nicht wahrgenommen wird. Im nächsten Schritt begibt sich die Schwangere zu einer geeigneten Institution, um eine Amniozentese, eine Chorionzottenbiopsie oder eine nicht invasive Diagnostik mittels Ultraschall durchführen zu lassen. In den seltensten Fällen besteht eine genetische Disposition mit einem Risiko von zum Beispiel 1:4, dass ein pathologischer Befund erhoben wird. Selbst bei der über 40jährigen Schwangeren liegt das TrisomieRisiko bei nur 1:40, so dass auch diese Hochrisikoschwangere sich über das Ergebnis der Untersuchung zwar Gedanken und Sorgen macht, insgesamt jedoch relativ sicher ist, sie persönlich würde ein pathologischer Befund nicht treffen. So individuell unterschiedlich im Einzelfall die Wartezeit auf den Befund überbrückt wird, in einem ist sich die Schwangere jedoch sicher, dass ihr für den Fall einer schweren Fehlbildung oder einer schweren Chromosomenstörung geholfen wird, dass sie die Schwangerschaft also nicht austragen muss. Diese Überzeugung konnte die Schwangere über einen langen Zeitraum auch zu Recht haben und hat ihn auch heute noch in der Regel zu Recht. Je länger das aktuelle Abtreibungsrecht sich jedoch in der praktischen Anwendung befindet und je öfter Verfahren anhängig werden, weil die Pränataldiagnostik nicht oder fehlerhaft durchgeführt worden sein soll, um so mehr wird jedoch deutlich, dass mitnichten die frühere embryopatische Indikation quasi nur Unterschlupf unter der medizinischen Indikation gefunden hat. Erstmals für die Entscheidung vom 18. Juni 2002 hatte der Bundesgerichtshof das Abtreibungsrecht in der Fassung des Schwangeren- und Familienhilfegesetzes vom 21. August 1995, also in der aktuell gültigen Fassung zugrunde zu legen. Er hatte nunmehr also zu prüfen, ob sich für die Mutter aus der Geburt des schwerbehinderten Kindes und der hieraus resultierenden besonderen Lebenssituation Belastungen ergeben, die sie in ihrer Konstitution überfordern und die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung ihres insbesondere auch seelischen Gesundheitszustandes als so drohend erscheinen lassen, dass bei der gebotenen Güterabwägung des Lebensrechtes des Ungeborenen dahinter zurückzutreten hat. Zwar hat der BGH in seiner aktuellsten Entscheidung, die in Übereinstimmung mit den Vorinstanzen eine Rechtmäßigkeit eines Schwangerschaftsabbruches nach § 218a Abs. 2 StGB, also der jetzigen medizinischen Indikation bejaht. Er hat dies jedoch nur deswegen bejaht, weil festgestellt worden ist, dass bei der Klägerin nach der Geburt tatsächlich Depressionen auftraten, die deutlich Krankheitswert erreichten und zumindest in den ersten Wochen nach der Geburt auch eine latente Selbstmordgefahr vorlag. Daher durften nach den Ausführungen des BGH die Instanzengerichte in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise von einer anders als durch den Abbruch der Schwangerschaft nicht abzuwendenden schwerwiegenden gesundheitlichen Gefährdung der Mutter ausgehen und einen derartigen, mit dem Tod des ungeborenen Kindes verbundenen Eingriff für rechtlich zulässig erachten. Letzte Zweifel, dass mit der Änderung des § 218a StGB auch eine substantielle Änderung in der rechtlichen Zulässigkeit eines Schwangerschaftsabbruches bei Fehlbildungen eingetreten ist, hat die Senatsvorsitzende des 6. Zivilsenats Frau Dr. Müller in einem aktuellen Aufsatz in der neuen Juristischen Wochenschrift vom März 2003 ausgeräumt. Wörtlich führt Frau Dr. Müller nach der Zitierung des Gesetzestextes weiter aus: „Damit werden im Vergleich zur früheren embryopatischen Indikation deutlich strengere Maßstäbe angelegt, weil es – bezogen auf die Fälle voraussichtlicher Behinderungen des Kindes – nicht mehr ausreicht, dass die Fortsetzung der Schwangerschaft "unzumutbar" ist, sondern eine ernsthaft Lebens- oder Gesundheitsgefährdung für die Mutter erforderlich ist. Angesichts dieser Rechtslage können sich voraussichtliche Behinderungen des Kindes also nur unmittelbar in Richtung einer medizinischen Indikation auswirken, nämlich dahin, dass die Erwartung eines solchen Kindes und insbesondere eine damit verbundene psychische Belastung die Gesundheit der Schwangeren derart gefährdet, dass ein Abbruch der Schwangerschaft aus medizinischer – und zwar ausschließlich auf die Mutter gerichteter – Sicht indiziert ist.“ Protokoll Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ - 04.und 05. April 2003 - Seite 22 Im weiteren Verlauf ihrer Ausführungen unterstreicht Frau Dr. Müller, dass dies nicht nur von theoretischer Bedeutung ist. Sie weist vielmehr daraufhin, dass der Bundesgerichtshof nach dem früher geltenden Recht mehrfach bei Fällen einer Trisomie 21, also dem Down-Syndrom eine embryopatische Indikation bejaht hat. In einem unlängst vorgelegten Fall, musste nunmehr nach neuem Recht entschieden werden, wobei die Auswirkung auf die Mutter ausschlaggebend war. Deren Klage auf Schadensersatz hatte keine Erfolg, weil die Vorinstanzen nicht feststellen konnten, dass bei der gebotenen Prognose die physische und psychische Belastbarkeit der Mutter in einem Maße überfordert war, das geeignet war, das Lebensrecht des Kindes in den Hintergrund zu drängen. Es wird also deutlich, dass der Bundesgerichtshof in der Änderung der §§ 218 ff StGB eine substantielle Verbesserung des Lebensrechts ungeborenen Kinder, gerade auch kranker Kinder sieht und dies in seiner Rechtsprechung auch zum Ausdruck bringt. Für die Praxis bedeutet dies, dass die Feststellung einer Chromosomenstörung oder einer anderen schweren Behinderung zunächst nur die notwendige Voraussetzung dafür ist, zu prüfen, ob bei der Mutter dadurch konkret schwere gesundheitliche oder psychische Belastungen ausgelöst werden, die so schwer wiegen, dass eine Fortsetzung der Schwangerschaft nicht zugemutet werden kann und die berechtigten Lebensinteressen des noch ungeborenen Kindes hinter den Interessen der Mutter zurückstehen müssen. Damit wird deutlich, dass die reale Alltagspraxis, wie heute noch Indikationen zum Schwangerschaftsabbruch gestellt werden, die Vermutung aufkommen lässt, dass die oft Indikation nicht rechtmäßig zustande kommt und damit letztlich ein Straftatbestand verwirklicht wird. Aus meiner Sicht ist es ein unhaltbarer Zustand, dass vielfach noch in Unkenntnis und Fehleinschätzung dieser geänderten Rechtssituation Schwangerschaftsabbrüche noch so indiziert werden, wie dies nach der Gesetzeslage bis 1995 möglich war. Es ist nämlich schwer vorstellbar, dass Strafverfolgungsbehörden eine gänzlich andere Interpretation der geltenden Rechtsnormen der §§ 218 ff StGB vornehmen als der Bundesgerichtshof. Eine Allianz zwischen Patientin und Arzt schützt zwar in der Regel nach dem Prinzip „wo kein Kläger, da kein Richter“ vor Strafverfolgung, an der Unhaltbarkeit der Situation ändert dies jedoch nichts. Es muss unsere Aufgabe sein, diesen Bruch zwischen der täglichen Praxis der Indikationsstellung von Schwangerschaftsabbrüchen und den dazu bestehenden Rechtsgrundlagen aufzuzeigen und es ist letztlich ein gesellschaftlicher und politischer Auftrag einen der von mir aufgezeigten alternativen Wege zu gehen, nämlich einmal eine Anpassung der gesetzlichen Grundlagen zum Schwangerschaftsabbruch an die tatsächliche Praxis vorzunehmen, in dem wieder eine eigenständige embryopatische Indikation eingeführt wird oder in dem alternativ das jetzt gültige Abtreibungsrecht auch inhaltlich voll umgesetzt und praktiziert wird. Beide Wege sind mühsam, man darf sich jedoch der Diskussion dazu nicht entziehen. Lassen sie mich abschließend noch auf das zweite große Problem der Änderung des § 218a StGB eingehen, nämlich die eröffnete Möglichkeit von Spätabbrüchen. Leider lassen die Daten des statistischen Bundesamtes keine Differenzierung zu, wie viele Schwangerschaftsabbrüche jenseits der früher geltenden Grenze von 22 Wochen post conceptionem vorgenommen werden. Das statistische Bundesamt differenziert nämlich nur zwischen 13 und 23 Wochen, hier finden sich 1904 Schwangerschaftsabbrüche im Jahr 2001 und 23 und mehr Wochen mit 177 Fällen im Jahr 2001. Auch für diese Spätabbrüche muss man postulieren, dass in dem einen oder anderen Fall die Indikation auf wackeligen Füßen gestanden hat, weil viel mehr auf die Schwere der Behinderung als auf die Auswirkungen bei der Mutter fokussiert wurde. Die eigentlichen Probleme ergeben sich aber hier aus der Grenze zur Lebensfähigkeit und den meisten von ihnen dürfte der Oldenburger Fall bekannt sein, in dem in der 23. Schwangerschaftswoche bei Trisomie ein Abbruch durchgeführt wurde, der jedoch ein lebendes Kind zur Folge hatte. Das Kind wurde über Stunden unzureichend versorgt und erst dann, nach dem es den Erwartungen der Beteiligten zuwider laufend nicht gestorben war, pädiatrisch versorgt. Das Kind lebt heute noch und es haben sich langwierige staatsanwaltschaftliche Ermittlungen wegen des Verdachts auf unterlassene Hilfeleistung bzw. Körperverletzung durch Unterlassung ergeben. Noch dramatischer ist der Zwickauer Fall, in dem in einer ganz gleich gelagerten Situation der Gynäkologe durch aktive Maßnahmen den vorher gescheiterten Schwangerschaftsabbruch mit Geburt eines toten Kindes nachgeholt hat. Diese Maßnahmen hatten die sofortige Entfernung des Kollegen aus dem Amt und ein Verfahren wegen eines Tötungsdeliktes zur Folge. Ich selbst habe schon lange vor dem Oldenburger Fall für die eigene Klinik die klare Anweisung gegeben, dass nach 22. Schwangerschaftswochen ein Abbruch nur durchgeführt werden darf, wenn es sich um eine Letalfehlbildung handelt, bei der nicht allein durch die Frühgeburtlichkeit, sondern durch die Schwere der Erkrankung bestimmt eine Lebenserwartung nur von wenigen Stunden oder wenigen Tagen besteht. In den wenigen Fällen, die bisher nach der 22. Schwangerschaftswoche in der Dortmunder Frauenklinik anstanden, haben wir bis etwa vor 4 Jahren die Instillation von Rivanol, einer Desinfektionslösung, in die Amnionhöhle vorgenommen, weil dies immer zum sicheren Tod des Fetus führt. Nachdem dieses Verfahren auch wegen der dann zunächst über einen noch längeren Zeitraum spürbar vermehrten Kindsbewegungen und dem unsicheren Wissen um das Leid des Kindes von mir und den Mitarbeitern der Klinik abgelehnt wurde, hat die für die Pränataldiagnostik verantwortliche Abteilungsleiterin in diesen seltenen Einzelfällen einen Fetozid vorgenommen. Seit Herbst letzen Jahres hat sie erklärt, sie könne dieses Verfahren für sich persönlich nicht mehr durchführen, so dass wir seither die klare Regelung haben, Schwangerschaftsabbrüche nach 22 Wochen nicht mehr durchzuführen. Andere Zentren führen den Fetozid weiter durch, ich glaube persönlich jedoch, dass mit der Grenzziehung bei 22 Wochen in den meisten Fällen eine sinnvolle Regelung getroffen ist. Auch ohne eine Änderung der Rechtssituation limitiert sich meines Erachtens der Spätabbruch bereits durch die bestehende Rechtslage, wenn sie denn entsprechend umgesetzt wird. Der BGH hat zwar festgestellt, dass eine Spätabtreibung auch nach 22 Wochen in der Neufassung des § 218a StGB rechtlich zulässig sein kann. Er vermag auch aus dem Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 12. November 1997 nicht zu erkennen, dass eine derartige Befristung verfassungsrechtlich geboten wäre. Der Bundesgerichtshof führt jedoch aus, dass an die Güterabwägung zwischen dem Lebensrecht des ungeborenen Kindes und den Interessen der Mutter mit zunehmendem Gestationsalter besonders hohe Anforderungen gestellt werden müssen: „Auch wenn das Lebensrecht des Kindes dem Grunde nach eine zeitliche Befristung der Schutzpflicht nicht zulässt, kann doch bei der Abwägung zur Bestimmung der Voraussetzungen der medizinischen Indikation auch die Dauer der Schwangerschaft und die daraus resultierende besondere Situation für Mutter und Kind Berücksichtigung finden. In den Fällen der medizinischen Indikation soll der Schwangerschaftsabbruch sowohl aus dem gesundheitlichen Interesse der Frau als auch im Hinblick auf die Schutzwürdigkeit des sich weiter entwickelnden ungeborenen Lebens so früh wie möglich vorgenommen werden. Im Rahmen dieser Prüfung kann den Ergebnissen des medizinischen Fortschrittes der zu einer immer weiteren Vorverlagerung oder extrauterinen Lebensfähigkeit des Embryos führen mag, ihre Bedeutung zukommen.“ Protokoll Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ - 04.und 05. April 2003 - Seite 23 Auch eine weitere Einengung der Rechtmäßigkeit eines Spätabbruches möchte ich hier ganz bewusst zur Diskussion stellen: Der frühere Vorsitzende des 6. Zivilsenats, Steffen, der die aktuelle BGH-Rechtsprechung zur Arzthaftung regelmäßig in Buchform kommentiert, führt in der jüngsten Auflage aus dem Jahr 2002 nämlich aus: „Ganz allgemein rechtfertigt die Indikation nur die Abtreibung, nicht die Tötung des Kindes. Das setzt selbst der nicht fristgebundenen Abtreibung aus medizinischer Indikation eine äußere Grenze. Jedenfalls haftungsrechtlich darf das Tötungsverbot nicht durch die medizinische Möglichkeit zum Fetozid unterlaufen werden.“ Er stellt damit die Rechtmäßigkeit eines Fetozits gezielt in Frage. Ich möchte die Ausführungen in diesem Kommentar bewusst in dieser Runde zur Diskussion stellen. Lassen sie mich zusammenfassen: Die Änderung der Rechtsvorschriften der § 218 ff StGB aus dem Jahr 1995 hat aus meiner Sicht viel weniger Friktionen in dem Themenbereich verursacht, der Anlass für die jahrelang währende politische Auseinandersetzung und das Anrufen des Bundesverfassungsgerichtes gewesen ist, nämlich im Rahmen der früheren Notlagenindikation, die heute über die Beratungsregelung abgedeckt ist. Viel mehr hat der Wegfall der eigenständigen embryopatischen Indikation und die Subsummierung unter die medizinische Indikation schwerwiegende Änderungen mit sich gebracht, wann ein Schwangerschaftsabbruch rechtlich zulässig ist und wann nicht. Dabei hat aus meiner Sicht der Wegfall der gesetzlichen Frist von 22 Wochen die geringere Bedeutung. Viel bedeutsamer ist die nicht nur formale, sondern inhaltlich relevante Änderung im Prüfalgorithmus, wann bei Fehlbildungen des Feten oder chromosomalen Störungen ein Schwangerschaftsabbruch rechtlich zulässig ist. Wenn diese Änderung vom Gesetzgeber und von der Gesellschaft tatsächlich so gewollt ist, dann muss die Judikative letztlich auch die von der Legislative gemachten Vorgaben umsetzen. Andernfalls ist der Gesetzgeber aufgefordert, die gesetzlichen Regelungen an die tägliche Praxis wieder anzugleichen und damit von Ärzten und Schwangeren das Damoklesschwert einer strafbaren Handlung zu nehmen, wenn sie Schwangerschaftsabbrüche weiter so handhaben, wie sie das über mehr als zwei Jahrzehnte unter der bis dato gültigen gesetzlichen Regelung getan haben. - Min.-Rat a. D. Dr. iur. Rudolf Neidert, Wachtberg: „Ist eine Revision des Gesetzes zum Schwangerschaftsabbruch sinnvoll ? I. Nidation als Nahtstelle zwischen ESchG und §§ 218 ff. StGB Lassen Sie mich für mein heutiges Referat - über eine Korrekturbedürftigkeit der §§ 218 ff. StGB - bei meinem gestrigen Thema, einer Revision des ESchG, ansetzen. Ich denke, dies ist nicht der schlechteste Weg zu einer kritischen Auseinandersetzung mit den geltenden Vorschriften zum Recht des Schwangerschaftsabbruchs, wird diese Problematik doch gleichsam „ab ovo“ angegangen. (Folie 1: ESchG / Geltungsbereich) Senkrechte Achse: Zahlenmäßige Größenordnung vom Gesetz erfasster Embryonen Waagerechte Achse: Wochen des Embryos ab Befruchtung post conseptionem (p. C.) C =Conceptio = Befruchtung durch Kernverschm. (EschG) = Empfängnis (§ 218 a StGB) N = Nidation = Einnistung in der Gebärmutter (EschG und § 218 StGB) O = (Abschluss der) Organogenee (=Organbildung) zum Ende der 8. Woche p. c. Wir können an dieser Graphik anschaulich die Nahtstelle zwischen der pränidativen Gesetzeslage und den ab der Nidation geltenden § 218 ff. StGB sehen. Wie gesagt, in den ersten zwei Wochen nach der Befruchtung gilt in vitro das ESchG; in vivo haben wir dagegen einen gesetzesfreien Raum, was aus § 218 Abs. 1 Satz 2 zu entnehmen ist. ( Folie 2: Text der §§ 218 Abs. 1 und 219 b Abs. 1 StGB ) Text der §§ 218 Abs. 1 und 219 b Abs. 1 des Strafgesetzbuches (StGB) (Ausklammerung des pränidativen Bereichs: Protokoll Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ - 04.und 05. April 2003 - Seite 24 von der Befruchtung bis zur Nidation) § 218 Schwangerschaftsabbruch (1) Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Handlungen, deren Wirkungen vor Abschluss der Einnistung des befruchteten Eies in der Gebärmutter eintritt, gelten nicht als Schwangerschaftsabbruch im Sinne des Gesetzes. § 219 b Inverkehrbringen von Mitteln zum Abbruch der Schwangerschaft (1) Wer in der Absicht, rechtswidrige Taten nach § 218 zu fördern, Mittel oder Gegenstände, die zum Schwangerschaftsabbruch geeignet sind, in den Verkehr bringt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Handlungen vor Abschluss der Einnistung gelten danach nicht als Schwangerschaftsabbruch; das Inverkehrbringen nidations-verhindernder Mittel ist deshalb auch nicht strafbar (§ 219 b Abs. 1). Geht man vom Gebot des Lebensschutzes von Anfang an aus, ist diese Gesetzeslage verfassungsrechtlich bedenklich. Als Pointe zu dieser gesetzgeberischen Widersprüchlichkeit stelle man sich folgenden Ablauf vor: Ein per IVF erzeugter Embryo wird etwa drei Tage nach der Befruchtung in den Uterus transferiert. Doch in den Tagen danach – rechtzeitig vor Abschluss der Einnistung – überlegt es sich die Frau anders und nimmt ein nidationsverhinderndes Mittel ein. Obwohl vor der Nidation, gilt hier in vivo weder das ESchG noch ein anderes Verbot zum Schutz des Embryos. So fragt man sich, was für ein Konzept vom rechtlichen Status Ungeborener der Gesetzgeber bei solch divergierenden Reglungen verfolgte; ja, hatte er überhaupt ein Gesamtkonzept zum Schutz des ungeborenen Lebens zwischen Zeugung und Geburt ? II. Schwache Rechtsposition des Ungeborenen in den ersten 12 Wochen Wir sehen: § 218 klammert die ersten zwei Wochen der Entwicklung des Embryos – ich nenne sie einmal „Phase 1“ – aus seinem Geltungsbereich aus. Erst mit Abschluss der Einnistung ab der 3. Woche p. c. setzt für die nächsten 10 Wochen die sog. Beratungslösung des § 218 a Abs. 1 StGB ein, zugleich – was leicht übersehen wird – auch die medizinisch-soziale Indikation des Absatzes 2. Übrigens ist die kriminologische Indikation nach Absatz 3 auf dieselbe Frist von 12 Wochen seit der Empfängnis begrenzt wie die Beratungsregelung. Bleiben wir für diese „Phase 2“ der Embryonalentwicklung bei meiner gestrigen Fragestellung des rechtlichen Lebensschutzes der Frucht ! Es bedarf keiner langen Erklärung darüber, wie gering, wie bedingt der gesetzliche Schutz des werdenden Lebens nach der Beratungslösung ist. Zu Recht wurde von H. Tröndle diese indikationslose 12-Wochen-Regelung von 1995 eine bloße „Fristenregelung mit Beratungspflicht“ genannt (Komm. zum StGB, Rz. 14 b vor § 218). Zwar hat das Bundesverfassungsgericht 1993 (BVerfGE 88, 203 ff., 264 ff.) dem Gesetzgeber hierfür ein „Beratungskonzept“ vorgegeben und dieser dann die Beratungs- stellen auf ein Ermutigen zur Fortsetzung der Schwangerschaft verpflichtet (§ 219 Abs. 1 Satz 1 StGB). ( Folie 3: §§ 218 a Abs. 1 und 219, Auszüge, StGB ) Text der §§ 218 a Abs. 1 und 219 (Auszüge) des Strafgesetzbuches (StGB) (Beratungslösung: „rechtswidrig, aber straflos“) § 218 a Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs (1) Der Tatbestand des § 218 ist nicht verwirklicht, wenn 1. 2. 3. die Schwangere den Schwangerschaftsabbruch verlangt und dem Arzt durch eine Bescheinigung nach § 219 Abs. 2 nachgewiesen hat, dass sie sich mindestens drei Tage vor dem Eingriff hat beraten lassen, der Schwangerschaftsabbruch von einem Arzt vorgenommen wird und seit der Empfängnis nicht mehr als zwölf Wochen vergangen sind. § 219 Beratung der Schwangeren in einer Not- und Konfliktlage (1) Die Beratung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Sie hat sich von dem Bemühen leiten lassen, die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen und ihr Perspektiven für ein Leben mit dem Kind zu eröffnen; sie soll ihr helfen, eine verantwortliche und gewissenhafte Entscheidung zu treffen ..... (2) Die Beratung hat nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz durch eine anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle zu erfolgen. Die Beratungsstelle hat der Schwangeren nach Abschluss der Beratung hierüber eine ... Bescheinigung ... auszustellen. Der Arzt, der den Abbruch der Schwangerschaft vornimmt, ist als Berater ausgeschlossen. Doch letztlich liegen Leben oder Tod des Embryos in der an Gründe nicht gebundenen, nicht unter staatliche Verantwortung gestellten, freien Entscheidung der Frau. Deshalb trägt dieser Abbruch ja auch – so die „Philosophie“ von Gericht und Gesetz – den Makel des „rechtswidrig, wenn auch straflos“. Rund 97 % der rund 130 000 Abbrüche im Jahr werden nach dieser Lösung vorgenommen (nach der amtlichen Statistik 2002: 97,5 % von 130 387). So bleibt dem Embryo für diese „Phase 2“ seines Lebens bei einem Schwangerschaftskonflikt der Frau nur eine denkbar schwache Rechtsposition. III. Gesetzgeberische Bemühungen um eine Embryonenschutz-Vorschrift Protokoll Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ - 04.und 05. April 2003 - Seite 25 Aufschlussreich für das nähere Verständnis der rechtssystematischen Zusammenhänge zwischen ESchG und § 218, aber auch für dessen Defizite, ist der – bald gescheiterte – Versuch der damaligen Regierung, mit ihrem Diskussionsentwurf von 1986 für ein Embryonenschutzgesetz, gleich als § 1, den Tatbestand einer sog. „Embryonenschädigung“ einzuführen. ( Folie 4: § 1 Disk.-E. ESchG 1986 ) Diskussionsentwurf Eines Gesetzes zum Schutz von Embryonen (Embryonenschutzgesetz – EschG) vom 29. April 1986 §1 Embryonenschädigung (1) Wer durch Einwirkung auf einen Embryo oder Foetus eine Gesundheitsschädigung des (aus ihm hervorgegangenen) Menschen herbeiführt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter 1. 2. eine schwere Gesundheitsschädigung herbeiführt oder durch die Tat leichtfertig den Tod des Verletzten verursacht. (3) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 leichtfertig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. (4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Handlungen, die auf einen Abbruch der Schwangerschaft gerichtet sind. An dem Tatbestand fällt auf, dass nicht nur Einwirkungen auf den Embryo, d. h. bis Ende der 8. Woche p. c., erfasst werden sollten, sondern auch solche auf den Foetus, d. h. die Leibesfrucht nach der 8. Woche bis zur Geburt. Das ESchG sollte demnach – parallel zur Geltung der §§ 218 ff. StGB – das Ungeborene während der ganzen Schwangerschaft schützen, allerdings nur gegen vorsätzliche oder leichtfertige Gesundheitsschädigungen, wenn diese sich auf die Zeit nach der Geburt auswirkten. Die Begründung nannte es „eine nicht unerhebliche Strafbarkeitslücke“, dass die Tötungs- und Körperverletzungstatbestände des StGB nicht diese frühen Einwirkungen vor der Geburt erfassten. Es erscheine auch unbefriedigend, „Manipulationen an Keimbahnzellen und Embryonen zu poenalisieren, ohne zugleich auch den seit langem von der Literatur und Rechtsprechung geforderten umfassenden Schutz der Leibesfrucht“ zu gewähren. Die gesetzliche Lücke sah man übrigens „nicht zuletzt“ im Blick auf extrakorporale Befruchtungen. Zu diesem gleichsam komplementären Ineinandergreifen des geplanten Embryonenschutzgesetzes und der bestehenden Vorschriften zum Schwangerschaftsabbruch kam es freilich nicht. Der Regierungsentwurf vom Oktober 1989 (BT-Drs. 11/5460) beschränkte sich darauf, „möglichen Missbräuchen neuer Fortpflanzungstechniken zu begegnen“; es sei nicht seine Aufgabe, Embryonen und Foeten nach der Einnistung zu schützen. Dann heißt es wörtlich: „Insoweit bestehende Lücken des geltenden Rechts ... werden durch ein in Vorbereitung befindliches Strafrechtsänderungsgesetz zu schließen sein.“ Bei dieser Absichtserklärung – mit dem Ziel einer gewissen Harmonisierung des rechtlichen Schutzes für das Ungeborene - ist es bis heute geblieben. Der tiefere Grund für das Scheitern dieses gesetzgeberischen Anlaufs dürfte darin liegen, dass es der „Quadratur des Kreises“ gleichkommt, den Schutz der Leibesfrucht während der Schwangerschaft zu verbessern, ohne vom Recht des Schwangerschaftsabbruchs irgend etwas zurückzunehmen. Wie Absatz 4 des geplanten Paragraphen zeigt, sollte das ja auch vermieden werden – zu Recht oder nicht, das wird noch zu zeigen sein. IV. Die medizinisch-soziale Indikation seit 1995 Wie bereits erwähnt, setzt die medizinisch-soziale Indikation nach § 218 a Abs. 2 ebenfalls bereits mit der Nidation ein. Wenn auch innerhalb der 12-Wochen-Frist des Absatzes 1 die Abbrüche nach der Beratungslösung zahlenmäßig absolut dominieren (127.079 im Jahr 2002), sind es in derselben Zeit nach Absatz 2 doch mehr als ein Drittel aller Abbrüche dieser Indikation (2002: 1.223 von 3.271). Mit der rechtlichen Zäsur am Ende der 12. Woche p. c., wenn Beratungslösung und kriminologische Indikation enden, wird die medizinisch-soziale Indikation zur alleinigen Abbruchmöglichkeit nach dem Gesetz. Ab der 13. Woche nehmen denn auch ihre Fallzahlen zu, wenn auch nicht so stark, wie man vermuten könnte (Fallzahlen 2002 für die 10 Wochen vor der 13. Woche p. c.: 1.223, für die 10 Wochen danach: 1.860). Seit Ende der 8. Woche haben wir es übrigens bereits mit einem Foetus zu tun. Doch nun zu einer kurzen Charakteristik des Tatbestandes von § 218 a Abs. 2 StGB: ( Folie 5: § 218 a Abs. 2 mit § 218 a Abs. 3 a. F. StGB ) Text des § 218 a Abs. 2 (geltende Fassung) Mit § 218 a Abs. 3 (Fassung bis 1995) (medizinisch-soziale bzw. alte embryopathische Indikation § 218 a Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs Protokoll Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ - 04.und 05. April 2003 - Seite 26 (2) Der mit Einwilligung der Schwangeren von einem Arzt vorgenommene Schwangerschaftsabbruch ist nicht rechtswidrig, wenn der Abbruch der Schwangerschaft unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen Lebensverhältnisse der Schwangeren nach ärztlicher Erkenntnis angezeigt ist, um eine Gefahr für das Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren abzuwenden, und die Gefahr nicht auf eine andere für die zumutbare Weise abgewendet werden kann. Bis 1995 geltende Fassung des Absatzes 3 (embryopathische Indikation): (3) Die Voraussetzungen des Absatzes 3 gelten auch als erfüllt, wenn nach ärztlicher Erkenntnis dringende Gründe für die Aufnahme sprechen, dass das Kind infolge einer Erbanlage oder schädlicher Einflüsse vor der Geburt an einer nicht behebbaren Schädigung seines Gesundheitszustandes leiden würde, die so schwer wiegt, dass von der Schwangeren die Fortsetzung der Schwangerschaft nicht verlangt werden kann. Dies gilt nur, wenn die Schwangere dem Arzt durch eine Bescheinigung nachgewiesen hat, dass sie sich mindestens drei Tage vor dem Eingriff hat beraten lassen, und wenn seit der Empfängnis nicht mehr als zweiundzwanzig Wochen verstrichen sind. Vorweg: Gesetzestechnisch ist der Tatbestand schlecht formuliert, zu lang und unübersichtlich, gedanklich kaum noch nachzuvollziehen. Das Wesentliche sei deshalb hervorgehoben: - Bei Vorliegen seiner Voraussetzungen ist der Abbruch „nicht rechtswidrig“, d. h. rechtmäßig, weil der Arzt eine gesetzliche Indikation dafür feststellen muss. - Es muss eine Gefahr für Leben oder Gesundheit der Schwangeren vorliegen; eine schwerwiegende Beeinträchtigung des seelischen Gesundheitszustandes genügt. - Zur Feststellung dieser Gefahr kommt es auf die ärztliche Einschätzung lege artis an; allerdings müssen seit 1995 auch die künftigen Lebensverhältnisse der Frau berücksichtigt wer- den. - Die Gefahr darf nicht auf eine andere für die Frau zumutbare Weise abgewendet werden können; so kommt es entscheidend auf diese Zumutbarkeit an. Alles in allem ein weit gefasster Tatbestand, der über eine medizinisch definierte Indikation hinaus die soziale Situation der Frau einbezieht: deshalb medizinisch-soziale Indikation. Da- hinter verbirgt sich, dass der Gesetzgeber 1995 die embryopathische Indikation gestrichen und in die medizinisch-soziale aufgenommen hat; dadurch ist dieser Tatbestand noch schillernder geworden. Immerhin kann man so viel sagen: Nach der embryopathischen Indikation kam es entscheidend nicht bei dem Kind auf die Gefahr einer erblichen Schädigung an, sondern bei der Frau auf die Unzumutbarkeit einer Fortsetzung der Schwangerschaft. Diese Unzumutbarkeit ist auch das Hauptkriterium der medizinisch-sozialen Indikation. Da diese aber – wie gesagt – eine Lebens- oder schwere Gesundheitsgefährdung der Schwangeren voraussetzt, können embryopathisch motivierte Abbrüche seit 1995 nur bei Vorliegen dieses zusätzlichen Kriteriums anerkannt werden. Deshalb hat die Vorsitzende Richterin am Bundesgerichtshof Dr. Müller im Januar vor dem Nationalen Ethikrat (Vortrag vom 22. 1. 2003) und jüngst in der NJW (10/2003, S. 697 ff., 702) dargelegt, nun seien „deutlich strengere Maßstäbe“ anzulegen. Andererseits wirkt die „Berücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen Lebensverhältnisse“ im neuen Tatbe- stand eher in Richtung „weniger streng“. Deutlich scheint mir deshalb eine Haftungsverschärfung seit 1995 nicht zu sein – wie eben kaum etwas an § 218 a Abs. 2 deutlich ist. V. Der unbefristete § 218 a Abs. 2 angesichts der Lebensfähigkeit des Kindes Während die alte embryopathische Indikation bis zum Ende der 22. Woche p. c. begrenzt war, kennt die Indikation nach § 218 a Abs. 2 keinerlei Frist; sie gilt – rein rechtlich gesehen – bis zum Ende der Schwangerschaft, d. h. bis zur Geburt des Kindes. Dies war freilich vor 1995 nicht anders: auch damals konnte ein embryopathischer Fall nach Ablauf der Frist mit der medizinischen Indikation – bei deren Vorliegen – „aufgefangen“ œ werden. Die medizinisch-soziale Indikation erstreckt sich nach der 12. Woche p. c. als einzige legale Abbruchmöglichkeit noch bis regelmäßig etwa zum Ende der 38. Woche p. c., d. h. über einen Zeitraum von etwa 26 Wochen - über 70 % der Schwangerschaftsdauer. Dieser lange Zeitraum ist vor allem durch das schnelle Wachstum des Foetus und die Ausreifung der Organsysteme – einschließlich des zentralen Nervensystems, des ZNS, - charakterisiert; sie reicht somit von den ersten menschlichen Zügen des Ungeborenen bis zur fertigen Gestalt des lebensfähigen Kindes. Diese embryologisch-foetale Entwicklung habe ich in der folgenden Folie in eine Synopse mit der jeweils einschlägigen gesetzlichen Regelung gebracht. Die Graphik soll eine Beurteilung der Frage erleichtern, inwieweit die gesetzlichen Sanktionen der §§ 218 ff. StGB einen angemessenen Schutz für das Lebensrecht des heranwachsenden Embryos und Foetus darstellen. ( Folie 6: Graphik „Der rechtliche Schutz ...“ ) Protokoll Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ - 04.und 05. April 2003 - Seite 27 Angesichts dessen stellt sich die Frage, ob eine für das zweite und dritte Schwangerschafts- drittel unterschiedslose, einheitliche gesetzliche Regelung des Abbruchs angemessen sein kann. Zwar handelt es sich bei diesem Heranwachsen des Foetus rein naturwissenschaftlichmedizinisch um ein „stufenloses Kontinuum“. Ethisch und rechtlich können jedoch - und müssen auch - in diesem Entwicklungsprozess entscheidungserhebliche Punkte identifiziert werden. Auf die hoch kontroverse Debatte der Bioethiker darüber kann ich hier zwar nicht näher eingehen. Doch so viel: Sieht man das Wesen der menschlichen Person vor allem in der Möglichkeit zu einer leiblich-seelischen Einheit, haben wir in der Entwicklung des ZNS ein relevantes Kriterium; zum Ausdruck kommt es im Übergang von der unbewussten Schmerzperzeption zum bewussten Schmerzerlebnis. Die vorzügliche Stellungnahme des wissenschaftlichen Beirates der BÄK von 1991 hierzu setzt diesen Zeitpunkt etwa ab der 22. bis 24. Woche p. c. an („Pränatale und perinatale Schmerzempfindung“, Stellungnahme des wiss. Beirates der BÄK, DÄBl. vom 21. 11. 91, S. A 4157). Unter dem Gesichtspunkt des Schutzes frühen menschlichen Lebens (Art. 2 Abs. 2 GG mit BVerfGE 88, 203 ff.) ist aber entscheidend ein anderer Entwicklungspunkt des reifenden Foetus: der Beginn der sog. extra-uterinen Lebensfähigkeit, den die Bundesärztekammer bei „einem Schwangerschaftsalter von etwa 22 bis 24 Wochen post menstruationem (p. m.)“ ansetzt („Erklärung zum Schwangerschaftsabbruch nach Pränataldiagnostik“, DÄBl. 1998, S. A 3013 ff., 3015; zur Frage der Zählung siehe unten VI). Hier möchte ich deshalb eine mit der 13. Woche begonnene „Phase 3“ enden lassen; die Zeit von der grundsätzlichen Lebensfähigkeit bis zur Geburt des Kindes wird damit zu einer rechtlich anders zu bewertenden „Phase 4“. Seit längerem gibt es Hinweise in der strafrechtlichen Literatur auf diese verfassungsrechtlich relevante Zäsur (so insbesondere H. Tröndle in NJW 1995, S. 3009 ff., 3015). Ich selbst habe dies im Deutschen Ärzteblatt (vom 25. 12. 2000, S. A 3483 - 3486) herauszuarbeiten versucht, differenzierter und mit umfangreichen Nachweisen in „Ethik interdisziplinär“ (Band 2, 2002, S. 33 – 61, vor allem S. 40 –43 mit Anm. m. 40). Zum rechtlich-politischen Konflikt-Kriterium ist die extra-uterine Lebensfähigkeit dadurch geworden, dass sie durch die Fortschritte der Perinatalmedizin in einen Zeitraum vorverlegt werden konnte, in dem noch Schwangerschaftsabbrüche stattfinden. Der Grund für solch späte Eingriffe liegt vor allem in der Tatsache, dass bestimmte pränataldiagnostische Untersuchungen erst im zweiten Schwangerschaftsdrittel möglich sind (darüber näher unten VI.); meist vergehen 2 bis 3 Wochen bis zum Vorliegen der Ergebnisse und mitunter noch einmal kostbare Zeit bis zu einer Konsequenz aus der Diagnose „schwere Behinderung des Kindes“. Dies war auch ein Grund für die relativ weit bemessene 22-WochenFrist der embryopathischen Indikation. Meine Schlussfolgerungen laufen – entgegen der verbreiteten, aber unhaltbaren These vom absoluten Lebensrecht des Ungeborenen von Anbeginn – auf ein zwischen Befruchtung und Geburt „zunehmendes Lebensrecht“ hinaus (so der Titel meines Aufsatzes im Deutschen Ärzteblatt 2000); diesem entspräche ein zunehmender Lebensschutz in der Rechtsordnung. In einem solchen, vor allem im angelsächsischen Rechtskreis - weniger in Deutschland – vertretenen Gradualismus läge ein Gesamtkonzept, das unsere Rechtsordnung vermissen lässt. Neuerdings scheint dieser Gedanke eines abgestuften Lebensrechtes des Ungeborenen bei uns stärker Fuß zu fassen: so bei der Minderheit in der Enquete-Kommission „Recht und Ethik der modernen Medizin“ (Schlussbericht 2002, S. 209, 221, 225, 227) und bei der Mehrheit im Nationalen Ethikrat (Stellungnahme vom Januar 2003 zur „Genetischen Diagnostik vor und während der Schwangerschaft“, S.123 – 128); siehe auch GG-Kommentator und Ethikrats-Mitglied H. Dreier („Stufungen des vorgeburtlichen Lebensschutzes“, in: Zeitschr. für Biopolitik, 2002/2, S. 4 – 11, und in: H. Dreier / W. Huber, Bioethik und Menschenwürde, 2002, S. 9 – 49). VI. Zur zahlenmäßigen Größenordnung der Spätabtreibung Weniger erheblich für die ethische Frage der Spätabbrüche als für deren politische Wahrnehmbarkeit ist es, um welche zahlenmäßige Größenordnung es sich handelt. Aus zwei Grün- den täuscht man sich in der Öffentlichkeit hierüber: weil unterschiedliche Berechnungsmethoden für das Schwangerschaftsalter Verwirrung stiften und weil man ab einem zu späten Zeitpunkt der Schwangerschaft rechnet. Leider trifft man auch in der maßgeblichen medizinischen Fachliteratur auf mehrdeutige Angaben, ja auf ein Durcheinander mehrerer Zählarten: nämlich post menstruationem (= p. m.), post conceptionem (= p. c.) und Schwangerschaftswochen (= ab der 3. Woche p. c.). Die Zählung p. m. rechnet ab zwei Wochen vor der tatsächlichen Befruchtung (ab hier wird p. c. gerechnet), während die Schwangerschaft – zumindest im Rechtssinne des Protokoll Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ - 04.und 05. April 2003 - Seite 28 § 218 StGB – erst zwei Wochen danach einsetzt; somit beginnt die erste Schwangerschaftswoche 2 Wochen nach der Befruchtung und ganze 4 Wochen nach Beginn der p. m.-Zählung. Ist, was nicht selten geschieht, die Zählweise nicht angegeben, kann man sich also um bis zu 4 Wochen missverstehen. Juristisch entscheidend ist es, dass die §§ 218 ff. StGB für die dort festgelegten Fristen ab der „Empfängnis“ (= Befruchtung), das heißt p. c. rechnen, dementsprechend auch das Statistische Bundesamt (siehe die jeweiligen Erläuterun- gen zu seiner Fachserie 12, Reihe 3). Doch welcher Zeitpunkt ist nun für den Beginn der extra-uterinen Lebensfähigkeit, d. h. für die Zählung der Spätabbrüche, maßgeblich ? Der einschlägige Stand der Wissenschaft dürfte in der erwähnten Erklärung der Bundesärztekammer „zum Schwangerschaftsabbruch ...“ von 1998 umschrieben sein: nämlich mit „einem Schwangerschaftsalter von etwa 22 bis 24 Wochen post menstruationem (p. m.)“; umgerechnet auf die Zählung von Gesetz und Statistik sind dies etwa 20 bis 22 (vollendete) Wochen p. c., d. h. die beiden Wochen 21 und 22. Da hiernach im Einzelfall die Lebensfähigkeit des Kindes schon zu Beginn der 21. Woche p. c. gegeben sein kann, sollte die Zählung der Spätabbrüche nicht etwa erst in der Mitte dieser Marge, sondern bereits ab der 21. Woche, d. h. nach der 20. Woche p. c., einsetzen. Für diese späten Wochen der Schwangerschaft weist die amtliche Statistik des Statistischen Bundesamtes (Tabelle 11) zwei Abschnitte der „Schwangerschaftsdauer von ... bis unter ... Wochen“ aus: „20 – 23“ (d. h. . die Wochen 20, 21 und 22) sowie „23 und mehr“ (d. h. die restliche Zeit ab der 23. Woche). Da die amtliche Zeitunterteilung (20 – 23) für den Beginn der extra-uterinen Lebensfähigkeit somit eine Woche zu früh ansetzt, lässt sich aus der veröffentlichten Statistik die exakte Zahl der Spätabbrüche nicht ablesen. Das Statistische Bundesamt (Zweigstelle Bonn, VIII A 2) war jedoch so freundlich, mir die registrierten späten Abbrüche des Jahres 2002 für die Wochen „21 und mehr“ auszudrucken: es waren 445 Fälle (für 2001: 419, für 2000: 444 Fälle); die zahlenmäßige Größenordnung dieses ethisch so heiklen Problems liegt also weit über 400, nicht etwa deutlich unter 200 Fällen, wie in der Öffentlichkeit bisher angenommen. Meist wird zur Erfassung der Spätabbrüche wegen eingetretener Lebensfähigkeit nur die Zeit ab der 23. Woche p. c. gerechnet, so auch z. B. im CDU/CSU-Antrag „Vermeidung von Spätabtreibungen“ vom Juli 2001 (BT-Drs. 14/6635); das waren für das Jahr 2000 154 Fälle. Den medizinisch maßgeblichen Zeitansatz hat leider auch der Nationale Ethikrat in seinem oben erwähnten Votum vom Januar 2003 verkannt, wo er in Tabelle V zwar „Spätabbrüche“ aus- weist, aber nur die Spalte „23 und mehr“ Wochen p. c. zählt (nämlich die 154 für 2000) – dies, obwohl er in seinen Literaturhinweisen die maßgebliche „Erklärung zum Schwangerschaftsabbruch“ aufführt. (Folie 7: Nat. Ethikrat, Tab. V: SS-Abbrüche 1993 - 2000) Tabelle V: Schwangerschaftsabbrüche von 1993-2000 in der Bundesrepublik Deutschland Lebendgeborene Schwangerschaftsabbrüche Medizinische Indikation Prozentualer Anteil der Abbrüche insgesamt) Embryopathische Indikation (Prozentualer Anteil der Abbrüche insgesamt Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft 23 Wochen p.c. und mehr („Spätabbrüche) (Prozentualer Anteil der Abbrüche insgesamt) Unbekannt (Prozentualer Anteil der Abbrüche insgesamt Ort des Eingriffs Krankenhaus Gynäkologische Praxis 1993 798.447 111.236 1994 769.603 103.586 1995 765.221 97.937 1996 796.015 130.899 1997 812.173 131.890 1998 785.034 131.795 1999 770.744 130.471 2000 766.969 134.609 6.077 (5,46 %) 5.986 (5,78 %) 4.897 (5,00 %) 4.818 (3,68 %) 4.526 (3,46 % ) 4.338 (3,29 %) 3.661 (2,81 %) 3.630 (2,70 %) 893 838 668 - - - - - (0,80 %) (0,81 %) (0,68 %) 90 26 26 159 190 175 164 154 (0,08 %) (0,03 %) (0,03 %) (0,12 %) (0,15 % ) (0,13 %) (0,13 %) (0,11 %) 1.549 (1,39 %) 417 (0,40 %) 136 (0,14 %) - - - - - 49.453 61.783 37.227 66.359 32.795 65.142 62.666 68.233 55.504 75.386 46.416 85.379 59.161 71.310 41.695 92.914 (Zahlen: Statistisches Bundesamt 2001) ab 1996: Veränderung der gesetzlichen Grundlage: verbesserte Durchsetzung der Auskunftspflicht der Inhaber von Arztpraxen und Leiter von Krankenhäusern, Pflicht zur Erfassung der Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft, Wegfall der embryopathischen Indikation bzw. Einschluss in medizinische Indikation. So steht nach diesem gewichtigen Votum für das Problem der späten Abbrüche mit 154 Fällen (für 2000) „politisch“ eine viel zu niedrige Zahl „im Raum“. Angesichts der vielfältigen Unklarheiten in der Zähl- und Erfassungsweise mit der Folge, dass sich die Öffentlichkeit über die quantitative Bedeutung dieses beunruhigenden Problems täuscht, sollte die Ärzteschaft Zählweise, Zählansatz und Anzahl der Spätabbrüche offiziell klarstellen – als Handreichung für die beteiligten Ärzte, die amtliche Statistik sowie für Regierung und Parlament. Bisher bietet die Anordnung der Zahlen durch das Statistische Bundesamt für diese Fehleinschätzung der Größenordnung des Problems immerhin Ansatzpunkte: So ist die Dauer der Schwangerschaft nach der 12-Wochen-Grenze (außer in der differenzierteren Tabelle 11) durchweg mit „13 – €“ 23“ (einem viel zu langen Zeitraum) und „23 und mehr“ (p. c.) ausgewiesen. Das ethisch und rechtlich gravierende Problem der Spätabbrüche erforderte aber eine deutliche Erkennbarkeit in der amtlichen Statistik, somit eine Zäsur bei (vollendeten) 20 Wochen (= ab der 21. Woche), d. h. als letzten Abschnitt: „21 und mehr“ Wochen, auch einen Hinweis auf das Problem in den Erläuterungen. Für eine Ausweisung der Spätabbrüche und eine entsprechende zeitliche Einteilung müsste das Schwangerschaftskonfliktgesetz von 1992 mit seinen Protokoll Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ - 04.und 05. April 2003 - Seite 29 Vorschriften über die Erhebungsmerkmale der Bundesstatistik (§§ 16 und 17) nicht geändert werden, wohl aber die Aufbereitung der Zahlen durch das Statistische Bundesamt. Nur anmerken kann ich hier, dass sich das Amt immer wieder dem Einwand nicht erfasster Abbrüche ausgesetzt sieht – auch, nachdem es seine jährlichen „Einschränkungen hinsichtlich der Vollständigkeit der erhobenen Daten“ (so etwa in Fachserie 12, R 3, 2000, S. 5) wegen verbesserter Erfassung seit 2001 hat wegfallen lassen (siehe hierzu die sachverständigen Leserzuschriften in der FAZ vom 28. 3., 12. 4. und 5. 5. 2003). Mein erster Vorschlag - nicht gesetzgeberischer Art - lautet somit: Klarstellung des Zähl- und Zahlenproblems der Spätabbrüche durch die Ärzteschaft und Ausweisung derselben in der amtlichen Statistik der Schwangerschaftsabbrüche; dadurch Korrektur der „politischen“ Größenordnung des Problems. VII. Die Interdependenz von PND und § 218 a Abs. 2 Die für die Erkennung genetischer Schädigungen wichtigen invasiven Verfahren der Pränataldiagnostik wie Amniozentese, Chorionzotten- und Plazentabiopsie können zum großen Teil erst im zweiten Schwangerschaftsdrittel zur Anwendung kommen. Jedenfalls werden ihre Ergebnisse der Schwangeren meistens erst nach Ablauf der 12-Wochen-Frist bekannt, wenn für den Fall eines Abbruchs nur noch § 218 a Abs. 2 infrage kommt. Zu den Verfahren der PND siehe übersichtlich die Stellungnahme des Ethikrates vom Januar 2003 (S. 19 ff. und 50 ff.); ausführlicher der Schlussbericht der Enquete-Kommission 2002 (S. 146 ff.). So stehen PND und legale Abtreibung in einer sich gegenseitig verstärkenden Wechselbeziehung: die Abbruchmöglichkeiten fördern die Inanspruchnahme der PND; deren Ergebnisse wiederum führen häufig zu Abbrüchen. Im Votum des Ethikrates vom Januar dieses Jahres heißt es richtig: „Daher besteht eine durch die Zulässigkeit des Schwangerschaftsabbruchs ´rechtlich` induzierte Nachfrage nach Pränataluntersuchungen“ (8.2.2.). So gehört das Recht der Pränataldiagnostik in einem weiteren Sinne längst zum Recht des Schwangerschaftsabbruchs. Nun ist zwar die Lösung des Schwangerschaftskonflikts durch Abbruch gesetzlich – eben durch § 218 a Abs. 2 – geregelt, nicht aber der Zugang zur Pränataldiagnostik, die durch ihre Ergebnisse den Konflikt erst ermöglicht. Geregelt sind die Verfahren der PND ausnahmslos untergesetzlich: durch die Mutterschafts-Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen von 1985 für den Kassenbereich und durch berufsrechtliche Vorschriften der Bundesärztekammer wie die Muster-Richtlinien „zur pränatalen Diagnostik von Krankheiten und Krankheitsdispositionen“ und die „Erklärung zum Schwangerschaftsabbruch nach Pränataldiagnostik“ (DÄBl. vom 11. 12., S. C 2284, bzw. vom 20. 11. 1998, S. A 3013). Nicht zuletzt diese ärztlichen Regelwerke sind vorzügliche Handhaben für den Arzt bei seiner Beratungsaufgabe. Das rechtlich entscheidende Manko der PND liegt nicht dort, sondern beim Gesetzgeber, der es seit Beginn pränataldiagnostischer Untersuchungen Anfang der 70er Jahre versäumt hat, die verfassungsrechtlich wesentlichen Voraussetzungen und Grenzen der PND durch Gesetz zu regeln. Wesentlich in diesem Sinn wäre – wegen ihrer Relevanz für Eingriffe in vorgeburtliches Leben – der gesetzliche Rahmen für Arztvorbehalt, diagnostische Verfahren, Indikationen und nicht zuletzt Beratung (zur Wesentlichkeitstheorie des BVerfG siehe H. Dreier, GG-Komm., Rz. 86 vor Art. 1). Kein Wunder, dass die PND in ihrer gesetzlich nicht eingegrenzten Entwicklung über drei Jahrzehnte von einer ständigen Expansion geprägt ist; auch die Haftungsrechtsprechung hat dazu beigetragen. Obwohl sich Enquete-Kommission und Ethikrat kritisch mit der PND befasst haben, findet man in deren Voten von 2002 und 2003 nur Vorschläge zur Änderung nicht-gesetzlicher Vorschriften. Mein zweiter Vorschlag geht also dahin, Voraussetzungen und Grenzen der PND gesetzlich zu regeln; Eckwerte hierfür vorzuschlagen, würde den Rahmen dieses Referats über § 218 sprengen. Ob man die Regelungen in ein umfassendes Fortpflanzungsmedizingesetz aufnehmen sollte oder in das für diese Wahlperiode angekündigte Gendiagnostikgesetz oder in ein selbständiges Gesetz – das ist eine cura posterior. VIII. Abbruch bei Lebensfähigkeit des Kindes nur mit „vitaler“ Indikation Eingangs habe ich – angesichts der Divergenzen zwischen ESchG und § 218 – gefragt, was für ein Gesamtkonzept der Gesetzgeber vom Status des Ungeborenen denn habe. Nach all dem, was inzwischen an rechtlichen Unstimmigkeiten festzustellen war, wage ich die harte Aussage: er hat kein stimmiges Konzept gehabt, sondern nur einen Flickenteppich politischer Kompromisse in verschiedenen Wahlperioden zuwege gebracht; es kennt nur grobe Abstufungen nach dem Entwicklungsstand des Ungeborenen und enthält für die entscheidende Spätphase eine mit dem Grundgesetz schwerlich vereinbare Regelung. So hat neuerdings vor allem A. Eser (1999 in Teil 3 seines zusammen mit H.-G. Koch ver- fassten Standardwerks „Schwangerschaftsabbruch im internationalen Vergleich“) auf Grund eines gradualistischen Konzepts für den Zeitpunkt der erreichten Lebensfähigkeit gesetzgeberisch eine „radikale Kurskorrektur“ gefordert (S. 579). Zugleich legte er eine gesetzliche Neuregelung vor, die den erlaubten Abbruch bei erreichter Lebensfähigkeit des Kindes auf die Ausnahmen beschränkt, dass entweder eine ernstliche Lebensgefahr für die Schwangere besteht oder das Kind seine eigene Geburt nicht überleben würde (S. 615); dies wäre eine „vitale Indikation“. Eindringlich arbeitet auch H. Hofstätter in seiner vorzüglichen Dissertation vom Jahr 2000 („Der embryopathisch motivierte Schwangerschaftsabbruch ...“) die extra-uterine Lebensfähigkeit „als entscheidende Zäsur im Entwicklungsprozess“ des Foetus heraus (S. 167) und fordert, „die weit klaffende Schutzlücke“ durch eine Befristung des § 218 a Abs. 2 auf grundsätzlich 20 Wochen p. c. zu schließen (S. 203 f.). Doch dürfte meine Einschätzung nicht unrealistisch sein, dass im Bundestag – trotz einer starken Minderheit – bis auf weiteres eine Art große Koalition gegen jegliche Änderung an den erreichten 218-Kompromissen besteht. Nicht einmal der an sich verdienstvolle CDU/CSU-Antrag zur „Vermeidung von Spätabtreibungen“ vom Jahr 2000 fordert eine gesetzliche Begrenzung des § 218 a Abs. 2. Der Enquete-Kommission des Bundestages ist die Spätabtreibung lediglich einen Spiegelstrich wert (S. 183), während Mehrheit und Minderheit des Nationalen Ethikrates für diesen Fall eine Begrenzung auf die vitale Indikation fordern (S. 103, 108). Diese Zurückhaltung des Gesetzgebers betrübt mich als Juristen, der auch lange im parlamentarischen Bereich tätig war, um so mehr, als ich sehe, wie gründlich – nicht zuletzt durch den unermüdlichen Einsatz von H. Hepp (eindringlich in: Der Frauenarzt 5/1996, S. 678 ff.) – die Ärzteschaft vor allem mit ihrer „Erklärung zum Schwangerschaftsabbruch“ von 1998 (Federführung: Hepp) diese an den Kern ihres Berufsverständnisses rührende Problematik aufgearbeitet hat. Doch mit einer berufsrechtlichen Regelung lässt sich eine gesetzliche Vorschrift – wie hier § 218 a Abs. 2 – nur erläutern, nicht aber ändern. Ein Blick über die Grenzen zeigt (hierzu das erwähnte Werk von Eser/Koch, S. 580), dass in zahlreichen Ländern – nicht zuletzt solchen mit liberalen Abtreibungsgesetzen – die Grenze der kindlichen Lebensfähigkeit den zulässigen Schwangerschaftsabbruch begrenzt. Es handelt Protokoll Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ - 04.und 05. April 2003 - Seite 30 sich um die Niederlande und Österreich, die skandinavischen Länder, Kanada und die USA, auch um Japan. Deutschland darf nicht länger hinter diesem international erreichten Stand zurückbleiben, zumal es in Politik und Öffentlichkeit häufig den Anspruch erhebt, einen besonders hohen Schutzstandard des Ungeborenen zu gewährleisten. Der Bundestag sollte deshalb – dies ist mein dritter und Hauptvorschlag - noch in dieser Wahlperiode die erforderliche Änderung an § 218 a Abs. 2 StGB vornehmen: eine zeitliche Begrenzung bis zum Eintritt der Lebensfähigkeit des Kindes, außer bei einer Lebensgefährdung der Schwangeren oder fehlender Überlebensfähigkeit des Kindes. - PD Dr. Hans-Georg Koch, Max-Planck-Institut, Freiburg: Ausgangslage Ist eine Revision des Gesetzes zum Schwangerschaftsabbruch sinnvoll? • rechtlich: • Beratungsmodell bis einschl. 12. SSW p.c. • Beratung in anerkannter Beratungsstelle/durch anerkannten Arzt • unbefristete medizinische Indikation • kriminologische Indikation (bis 12. einschl. SSW p.c.) • keine explizite embryopathische Indikation • unterschiedliche Fristen für Ärzte und Schwangere (vgl. § 218a IV 1 StGB) • Indikationsfeststellung durch zweiten Arzt von PD Dr. Hans-Georg Koch, Freiburg i. Br. Strafverfolgung des Schw angerschaftsabbruchs/§ 218 Ausgangslage • rechtstatsächlich: • jährlich ca. 130.000 registrierte Schwangerschaftsabbrüche (2002: 130.387 – Dunkelziffer?) • ca. 97% nach Beratungsm odell • ~ 150-180 Schwangerschaftsabbrüche nach der 22. W oche p.c. (Dunkelziffer?) • ~6-7000 Schwangerschaftsabbrüche an Minderjährigen • Rückzug der katholisch-kirchlichen Beratungsstellen aus dem Beratungssystem • m arginale Bedeutung von §§ 218 ff. StG B in Krim inalund Strafverfolgungsstatistik (s. Tabelle 1) Problemfelder • Grundkonzeption des Beratungsmodells („rechtswidrig, aber straffrei“) • Schwangerschaftsabbrüche im Spätstadium • Schwangerschaftsabbrüche bei Minderjährigen • Vorgeburtliche Diagnostik • „Pille danach“ • Schadensersatz wegen unterbliebenem/fehlgeschlagenem Schwangerschaftsabbruch • Vergütung von als „Beratungsstelle“ anerkannten niedergelassenen Ärzten • Jahr Polizeilich erfasste Fälle Tatverdächtige (insg./m /w ) Abgeurteilte iInsg./m /w) Verurteilte (insg./m /w ) 1996 91 38/23/15 4/2/2 4/2/2 2000 45 46/25/21 2/1/1 1/0/1 Revision sinnvoll? • sinnvoll“ iSv aus rechtlicher Sicht wünschenswert • Wie weit reicht der Schutzauftrag zugunsten des „ ungeborenen Lebens gegenüber der Schwangeren? • Umsetzung mit welchen rechtlichen Mitteln? • Rechtsvergleichende Erfahrungen mit pragmatischen Lösungsansätzen Protokoll Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ - 04.und 05. April 2003 - Seite 31 Revision sinnvoll? Insbesondere (1): RegelungsGrundmodell: • „sinnvoll“ iSv politisch realistisch • Unzureichende Informationslage zur Praxis unter SFHG • derzeit offenbar wenig politische Bereitschaft, das Thema wieder grundsätzlich aufzugreifen • Detailkorrekturen: Gesetzgebung und/oder ärztliche Richtlinien Insbesondere (2): Schwangerschaftsabbrüche bei Minderjährigen • Uneinheitliche, teils die strafrechtlichen Anforderungen sehr restriktiv handhabende (Einwilligungskompetenz) Rechtsprechung von Vormundschaftsgerichten in Fällen der Kontrolle elterlicher Sorgerechtsentscheidungen • Lösung: Entscheidungskompetenz mindestens 16jähriger Schwangerer in der Regel zu bejahen. Konsultation zwischen abbrechendem Arzt und Beratungsstelle zur Abklärung, ob Alleinentscheidung noch nicht 16-jähriger Schwangerer (ausnahmsweise) situationsgerecht • Konzeption des geltenden Rechts aus strafrechtlicher Sicht mangelhaft • „nicht rechtswidrig“ nicht notwendig gleichzusetzen mit „sittlich richtig“ oder „sozialethisch billigens-wert“ • „Notlagenorientiertes Diskursmodell“ als – international zunehmend verbreitete – Alternative Insbesondere (3): „späte“ Schwangerschaftsabbrüche: • Entgegen verbreiteter Auffassung Problem nicht erst durch Reform von 1995 entstanden (nicht unerhebliche Zahl von Schwangerschaftsabbrüchen nach der 22. SSW contra legem embryopathisch begründet, s. Tabelle 2) • Geltendes Recht bewertet extrauterine Lebensfähigkeit zu schwach • „Kleine“ Lösung (ohne Änderung d. §§ 218 ff. StGB): „dynamische“ Interpretation der medizinischen Indikation in Abhängigkeit vom Schwangerschaftsalter, berufsständisch verankerte Konsiliarpflicht, differenziertere statistische Erfassung von Abbrüchen nach der 12 SSW • „Große“ Lösung: Änderung d. § 218 a StGB – Beschränkung der med. Indikation im fortgeschrittenen Schwangerschaftsstadium auf „vitale“ Indikation • These: Frühere deutsche sowie rechtsvergleichende Erfahrungen zeigen, dass nicht der Gesetzeswortlaut entscheidet, sondern das Normverständnis der involvierten Ärzteschaft. Als „eugenisch“ registrierte Schwangerschaftsabbrüche 1980-1993 Jahr Embryopathische Indikation insg./Gesamtzahl 13.-22. SSW 23.SSW u. später 1980 3053/87702 226/1007 22/38 1985 1086/83538 197/1240 26/36 1990 775/78808 377/1418 46/69 1991 785/74571 435/1462 58/80 1992 837/74856 479/1528 102/129 1993 893/111236 513/1527 70/90 Literaturhinweise: • Albin Eser/Hans-Georg Koch, Schwangerschaftsabbruch im internationalen Vergleich, Befunde – Einsichten – Vorschläge, Freiburg 2000, im Internet abrufbar unter http://www.iuscrim.mpg.de/verlag/Forschaktuell/SAB_Gesamt.pdf • Sonderdrucke auf Wunsch über folgende Adresse: PD Dr. Hans-Georg Koch MPI f. ausländisches und internationales Strafrecht Günterstalstr. 73 79100 Freiburg • Albin Eser/Hans-Georg Koch, Schwangerschaftsabbruch und Recht, Vom internationalen Vergleich zur Rechtspolitik, 360 S., Baden-Baden 2003. _______________________________________________________________________________________________________________ Die nächste Sitzung des Arbeitskreises “Ärzte und Juristen” findet am 28. und 29. November 2003 in Leipzig statt. Hauptthema: Arbeit der Gutachter- und Schlichtungsstellen Protokoll Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ - 04.und 05. April 2003 - Seite 32