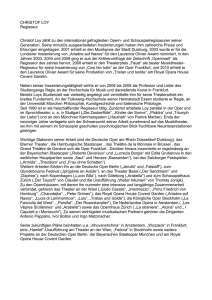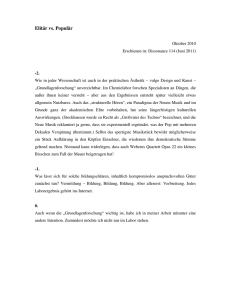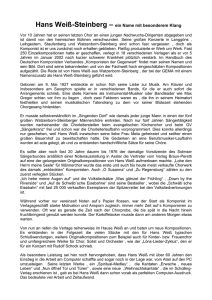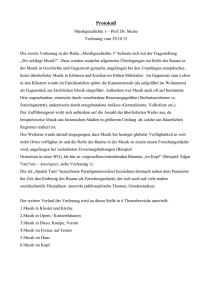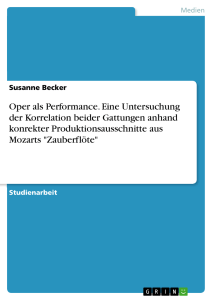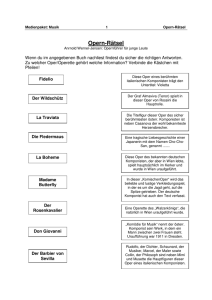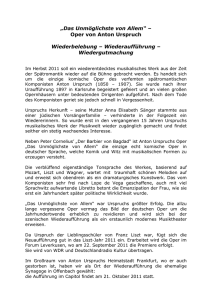1 Die steifen Konzertrituale sind eigentlich eine Parodie Alex Ross
Werbung

Die steifen Konzertrituale sind eigentlich eine Parodie Alex Ross, der Star der New Yorker Musikkritik, Autor des mehrfach aufgelegten und in zahlreiche Sprachen übersetzen Bestsellers The Rest is Noise: Listening to the Twentieth Century, war für einen Vortrag und ein öffentliches Gespräch zu Gast an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). Im Gespräch mit Brandon Farnsworth äußert er sich zu seiner persönlichen Sicht auf der Rolle des Kurators in der Musikinstitution, den Musikjournalismus, das Verhältnis von Klassik und Pop, und aber auch zum Repertoirebetrieb an der New Yorker Metropolitain Opera und zu Off-spaces für innovatives Musiktheater in den USA und Europa. In seinem kommenden Buchprojekt widmet er sich dem Einfluss von Richard Wagner auf verschiedene Kunstsparten. (Gabrielle Weber) Brandon Farnsworth: Alex Ross, in Ihrem Buch Listen to This (2010) zeigen Sie im zweiten Kapitel („Chacona, Lamento, Walking Blues: Bass Linien in der Musikgeschichte“) die Geschichte der Chaconne anhand verschiedener musikhistorischer Perioden und Genres auf. Ein solch umfassender Zugang zur Musikgeschichte hat nicht zuletzt von Seiten der Musikwissenschaft ein großes Interesse hervorgerufen. Was beabsichtigten Sie damit, die verschiedenen musikalischen Genres miteinander zu behandeln? Alex Ross: Dieses Kapitel innerhalb von Listen to This ist der bewusste Versuch, eine gemeinsame Basis der verschiedenen Traditionen aufzuzeigen. Es ging mir aber nicht nur darum Gemeinsamkeiten hervorzuheben. Der berühmten Lamento Basslinie zu folgen brachte auch die Unterschiede im Umgang in den verschiedenen Genres deutlich zu Tage. In einem solch genreübergreifenden Duktus habe ich nur wenige Texte verfasst, nebst dem genannten Kapitel in Listen to This Portraits von Björk und Radiohead und ein paar weitere Texte. Es handelte sich um so etwas wie ein Experiment in begrenztem Rahmen. Popmusik hat ihre eigene komplexe Tradition. Da ich mit klassischer Musik aufgewachsen bin, liegt es mir am besten, darüber zu schreiben. Indem ich von Musik ausging, die mich fesselt und die ich gut kenne, wollte ich die Leser aus meiner persönlichen Sicht ansprechen. Insgesamt scheint mir das Übertragen der Art des Schreibens über klassische Musik auf Popmusik gut zu funktionieren. Die Pop Stamm-Leserschaft empfindet den Vergleich mit den klassischen Werken offenbar als aufschlussreich, da er einen unkonventionellen Zugang zum Thema eröffnet. Von Fall zu Fall integrierte ich in den erwähnten Texten den gängigen Szenejargon der Pop Musik in meinen eigenen Schreibstil, auch wenn ich mich nicht ganz wohl dabei fühlte, und ich denke, dass ich noch nicht die ideale Lösung für diesen Basiszwiespalt der Sprachmodi fand. Im Gegensatz dazu empfinde ich nicht dasselbe Zögern beim Schreiben über Literatur oder andere Themen des Geisteslebens, da ich damit aufgewachsen bin und schon immer darüber schrieb. Es ist für mich beispielsweise einfacher, über Adorno und die Frankfurter Schule zu schreiben, als über Popmusik. Wichtig scheinen mir diese Versuche jedoch, da sie die Leser dazu bringen, Musik außerhalb ihres gewohnten Rahmens oder ihrer vertrauten Hörgewohnheiten kennenzulernen. Klassische Musikerinnen und Musiker zum Beispiel können enorm von einer Kenntnis der Popmusik, die über einzelne Hits oder Melodien hinausgeht, profitieren. Ein Grossteil des klassischen Repertoires aus dem 20ten und 21ten Jahrhunderts steht in engem Bezug zu Popstilen. Um sich darüber bewusst zu werden, benötigt man ein gewisses Verständnis von Rhythmus und verschiedenen stilistischen Aspekten. Aus Perspektive der Popmusik hingegen ist dieser Zugang wesentlich, da oft ein gewisses soziales "Training" fehlt um sich in den "reinen Hörmodus" zu begeben. Für diejenigen, die mit klassischen Konzerten aufgewachsen sind, ist es normal, für die Dauer eines Konzerts zu sitzen und die anderen Sinne zu vernachlässigen, sich also in eine eher abstrakte Art des Hörens zu begeben. Beispielsweise wird es als entspannend erlebt, sich während zwei bis drei Stunden Filme oder TV-Shows anzuschauen, aber nicht, sich an einem Konzertabend für dieselbe Dauer auf ein reines Hörerlebnis einzulassen. Da auch viele der Pop Kultur-Phänomene auf ihre Art komplex und herausfordernd sind, glaube ich aber nicht an Theorien über kurze Attention-Spans. Vielen Menschen aus meiner Generation fehlt es an jeglicher musikalischen Grundausbildung wie Notation, Harmonielehre, etc. Ich versuche eine Art von Anleitung für das Hören vorzugeben und Brücken zu bauen, die dazu verhelfen soll, Musik in einer neuen Art zu schätzen. Ich möchte zu einer bestimmten Art des Hörens ermutigen, ob es sich nun auf Klassische oder Pop Musik bezieht. Es geht mir um ein Heraushören einzelner Elemente jenseits der Oberfläche, wie z.B. der Chaconna Basslinie, um zu zeigen, dass sie trotz großer Unterschiede in Stil und historischer Periode für 1 jede Art von Musik strukturierend wirken. Diese Art des Hörens scheint mir wichtig, da gewisse Aspekte des klassischen Konzertrahmens wertvoll und erhaltenswert sind. Der Pianist beispielsweise, der sich aufs Konzertpodium begibt, sich leise an den Flügel setzt, und die Hammerklavier Sonate zu spielen beginnt, repräsentiert ein sehr kraftvolles Phänomen, auch wenn es manchen vielleicht veraltet oder überholt erscheint. Einer der magischsten Momente in Konzerten bildet für mich der Beginn, wenn Stille in Klang übergeht, denn diese Stille rührt von einer großen Gruppe von Menschen her, die aus einer Erwartungshaltung heraus entscheidet, gemeinsam still zu verharren. Auf Aufnahmen kann dies niemals wiedergegeben werden. Konzerterlebnisse können auch gänzlich neue Welten eröffnen- dies geschieht oft beim gebannten Zuhören im Saal und darf meiner Meinung nach nicht verloren gehen. Andererseits scheint es mir, dass Konzertveranstalter oft in träger selbstbewusster *Höflichkeit" verharren, und dass sie von einer Veränderung der konventionellen Konzertsituation profitieren könnten. Zu oft findet ein äußerliches und anständiges, fast langweiliges Konzertritual statt, anstatt dass ernsthaft und mit einem Anliegen programmiert wird. BF: Worin sehen Sie Ihre Rolle um auf dieses Problem der Konzertsituation aufmerksam zu machen? AR: Ich bin Beobachter, Reporter. Ich gehe behutsam damit um, zu kuratieren oder anzuleiten. Ich sehe meine Aufgabe darin, zurück zu stehen und das Feld der Wahrnehmungsmöglichkeiten der Zuhörenden so weit als möglich zu öffnen. Ich suche immer nach einer neuen Art von Werk, einer neuen Stimme, die nicht dazu passt, worüber ich vorher sprach. Ich möchte nicht auf einer Ideologie oder einem Programm behaftet werden, da meine Texte dann vorhersehbar würden. Ich versuche zu beschreiben was ich höre und sehe, und an irgendeinem Punkt dringt meine Meinung durch, aber das ist wahrscheinlich weniger wichtig. Wenn ich auf etwas Neues stoße, das meine Erwartungen komplett umstösst, führt der Entscheid, ob ich darüber neutral oder kritisch beurteilend berichte, manchmal zu inneren Konflikten. Beim Schreiben über neue Werke ist meine Meinung notwendigerweise provisorisch oder kann sogar falsch liegen - es kommt sogar vor, dass ich 10 Jahre später ganz anderer Meinung bin. BF: Wenn wir über provisorische Meinungen bei der Begegnung mit neuen Werke sprechen, wie schreiben Sie über die steigende Anzahl an inter- oder transdisziplinären Projekten, die oft einmalig und ortsspezifisch stattfinden? Wie verändern diese Voraussetzungen ihre Rolle als Kritiker? AR: Bei solch raumausgreifenden, alle Sphären vermischenden Aktivitäten ist es unglaublich schwierig, alle parallelen Handlungsstränge gleichzeitig zu verfolgen - soll man sie von der musikalischen oder der theatralen Seite her beurteilen? Es war fast einfacher, als noch vorwiegend traditionelle Kammermusik und Orchesterstücke geschrieben wurden. Diese Herausforderung besteht aber auf allgemeinerer Ebene seit jeher bei Opernaufführungen. Die Frage wird besonders dringlich, wenn man es mit abenteuerlichen oder ins Stück eingreifenden Regieansätzen in der Oper zu tun hat, die meist ein Theater erfahrenes Publikum in ähnlichem Ausmaß begeistern, wie sie das in der traditionellen Oper verwurzelte Publikum vor den Kopf stoßen. Einige Künstler werfen die Kategorien über den Haufen: Meredith Monk beispielsweise, stellte die Kritik diesbezüglich immer vor große Probleme. Ihre Arbeiten können aus den Blickwinkeln des Tanzes, der Musik (Pop oder Klassik), des Theaters, oder sogar manchmal Film betrachtet werden. Oft wurde ein konkretes Werk überhaupt nicht besprochen, da die Redaktionen nicht wussten, aus welcher Sparte Kritiker an ihre Premieren geschickt werden sollten. Dies war auch beim New Yorker manchmal der Fall. Keiner der Kritiker fühlte sich zuständig, jeder meinte, ein neues Werk gehöre in ein anderes Ressort. BF: Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang der Probleme und Veränderungen im Feld der Kunstkritik die Rolle Ihres Blogs - handelt es sich dabei um Empfehlungen? AR: Den Blog sehe ich nicht als Kritik per se an, da ich dort nie etwas ausführlich bespreche. Die meiste Zeit verbreite ich bloß Informationen über kommende Veranstaltungen. Sobald ich eine Diskussion rund um ein Werk angestoßen habe, bewegt sie sich in eine völlig andere Sphäre. Der Blog ist für mich so etwas wie ein Skizzenbuch, ein Arbeitsbuch, das verschiedene Möglichkeiten andenkt. Meistens beurteile ich überhaupt nicht. Es geht mir darum, auf etwas aufmerksam zu machen, das man sich anhören sollte jeder einzelne entscheidet dann selbst, ob er es interessant findet oder nicht. Auf der anderen Seite kann 2 ich im Blog auf weniger Bekanntes aufmerksam zu machen, und vor allem junge Komponistinnen und Komponisten, für die es wichtig ist gehört zu werden, schätzen das. Die Vorstellung von Kritik als Empfehlung frustriert mich sehr, denn ich bevorzuge ein weniger vorschreibendes mehrdeutiges Verständnis der Arbeit des Kritikers. Meine Einschätzung zu neuen Stücken ist oft ambivalent und ich gebe deshalb ungern ein festes Urteil ab. Oft lösen neue Stücke eine Art von faszinierender Verwirrung aus, die für mich ein Zeichen dafür ist, dass etwas Wichtiges in diesem Werk passiert ist - etwas, das ich nicht auf Anhieb einordnen kann. Genau diese Stücke erscheinen mir oft einige Jahre später als enorm wichtig. Die Übernachtreaktionen auf eine Uraufführung sind immer provisorisch. Da Uraufführungskritiken Teil der Rezeptionsgeschichte eines Werks werden, mag es entscheidend sein, solche zu formulieren, dennoch ist es wichtiger, zu beschreiben, was auf musikalischer Ebene geschah als eine feste Meinung zu zementieren. BF: In den letzten Jahren stieg innerhalb der Musikinstitutionen die Zahl von Kuratoren oder künstlerischen Leitern, die sich genau mit solchen Fragen beschäftigen, laufend. Wie unterscheidet sich ein solcher Zugang vom ihrigen? AR: Sie sind mit genau denselben Problemen konfrontiert. Der Unterschied liegt darin, dass es sich für sie eher um eine Frage von Leben und Tod einer Veranstaltung handelt. Wenn aufgrund meiner Empfehlung jemand ein Ticket für eine Vorstellung kauft und diese ihr nicht gefällt, beeinträchtigt es mich nicht so stark in meiner Arbeit, wie wenn jemand aus einem Konzert hinausgeht oder sich dazu entschließt, bei diesem Veranstalter keine weiteren Karten für andre Programme zu kaufen. Kuratoren und künstlerische Leiter haben eine viel direktere Beziehung zum Publikum, die auch gefährlich sein kann. Es ist deshalb nur verständlich, wenn Veranstalter sich entscheiden, moderate Programme anzubieten. Genau deshalb bewundere ich mutige Veranstalter, die Risiken bei der Programmation eingehen: manchmal stoßen sie vielleicht ihr Publikum vor den Kopf, versuchen aber danach, es wiederzugewinnen. Aus dieser risikovollen Situation heraus wurde der klassische Konzertbetrieb in den letzten hundert Jahren leider immer konservativer. Viele denken, dies sei ein Überbleibsel aus dem 19. Jahrhundert, doch tatsächlich ist unsere Art der Aufführungspraxis viel beschränkender als alles, was das damalige Publikum akzeptiert hätte. Wir erschufen fast eine Parodie mit diesen strengen, ernsten Konzertritualen, die also solche in der Vergangenheit gar nicht existierten. Was uns fehlt ist Experimentierlust – wir müssen aber auch zulassen, dass Experimente scheitern können. Dies braucht auch eine große Portion an Geduld von den Institutionen selbst. Ein Aufführungszyklus eines größeren Orchesters mit zeitgenössischen Werken braucht vielleicht mehrere Saisons bis er etabliert ist. Es braucht Flexibilität, um mit möglichem Scheitern umzugehen. Nur so entwickelt sich eine Kunstform. Ich stimme denen, die behaupten, dass es bereits viel Experimentieren mit neuen Konzertformaten gab, zu, aber dennoch scheinen die Resultate extrem limitiert zu sein. In Nordamerika gibt es ständig neue Arten der Beleuchtung und der Publikumbestuhlung oder neue Konzertdauern und -zeiten, aber dennoch erfuhr das Konzertformat als solches keinen fundamentalen Wandel. Oft wird einfach eine gewohnte Erfahrung auf einen ungewohnten Ort übertragen, aber das Stück bleibt dasselbe. Dies geschah beispielsweise bei den meisten der Übertragungen von Produktionen der Metropolitan Opera ins Kino, Bezogen auf die Anzahl Besucher waren sie außerordentlich erfolgreich, aber schlussendlich war dasselbe Publikum anwesend wie im Stammhaus, zum Teil sogar älter und traditioneller. Das Ziel, eine neue jüngere Generation an die Oper heranzuführen, wurde nicht erreicht. BF: Wenn wir von Experimenten sprechen, so bildet ein Aspekt dieses Phänomens das Interesse an der Integration von anderen performativen Kunstsparten wie Theater, Film oder Visuelle Kunst. Die Praktiken sind hier viel öfter mit politischen oder sozialen Kommentaren durchsetzt, was in der zeitgenössischen Musik weniger der Fall ist, wo künstlerische Unabhängigkeit immer noch das vorherrschende Modell ist. Wie kann zeitgenössische Musik zu einer Rolle als kritische Instanz finden? AR: Ich begegne zahlreichen Projekten mit politisch durchsetzter Musik, die z.B. Überwachung, Satire oder politische Protagonisten zum Thema haben, auch wenn sie in der Minderzahl bleiben. Die Hauptfrage ist für mich, wie gut die politischen Ideen ins Werk integriert sind. In einem Stück über das Flüchtlingselend, kann der Kompositionsstil sich etwa gelungen zwischen Ligeti und Berg bewegen, der zeitgenössische politische Inhalt hingegen aufgesetzt wirken. Andererseits gibt es Stücke, die eine allzu 3 offensichtliche politische Botschaft ins Ohr der Zuhörer brüllen, in denen das musikalische Material aber uninteressant ist. Politik in der Musik ist historisch bedingt schwierig, da Komponisten oft nicht wissen, wie sie Politisches musikalisch umsetzen sollen. Die Idee von musikalischer Unabhängigkeit ist so tief verankert, dass das Vorhaben fast immer als ein Risiko erscheint. Es sollte aber mehr politische Musik geben, und mehr Verflechtungen mit der zeitgenössischen Realität. Es erstaunt und verblüfft mich jedes Mal, wenn das traditionelle Opernpublikum zum Beispiel die Gültigkeit einer Oper über Terrorismus in Frage stellt. Romane über Terrorismus werden gelesen, Kino und TV-Filme angeschaut, aber die Oper wird offenbar als eine heilige, distanzierte Sphäre angeschaut, die nicht mit düsteren Gegenwartsthemen in Berührung kommen soll. Ein ehemaliger Herausgeber der New York Times mutmaßte einmal in einem Kommentar zu John Adam's Nixon in China, dass Opernkomponisten normalerweise vermeiden, sich mit Themen aus der Geschichte des vergangenen Jahrhunderts zu befassen. BF: Die Visuellen Künste zeigen aktuell ein großes Interesse in Performancekunst. Wie profitiert zeitgenössische Musik, indem sie sich auf diesen „performativen turn“ einlässt? AR: Seit den Anfängen in den 60er Jahren gibt es eine fortlaufende Entwicklung im Bereich des Inter- und Multidisziplinären Arbeitens, in den USA vor allem in der historischen New Yorker Downtown Szene, vertreten durch Protagonisten wie Meredith Monk, Laurie Anderson und Philip Glass. Die historische Entwicklung verläuft in Wellenbewegungen und sicherlich ist eine starke Welle in den letzten Jahren auszumachen, in denen verstärkt Ideen aus der zeitgenössischen Visuellen Kunst wie auch aus Performance in die Klassische und Neue Musik einfließen, und umgekehrt. Eine beträchtliche Anzahl an Protagonisten fällt irgendwo in eine Zwischenkategorie und könnte in beiden künstlerischen Welten angesiedelt werden. Es ist nicht gefährlich sich in Zwischenbereichen zu bewegen. In diesem Zusammenhang ist auch eine größere Diskussion um mediale Arbeiten und Gefäße außerhalb der traditionellen Konzerthäuser zu sehen. Mit der Eröffnung des Park Avenue Armory in New York wurde eine maßgebliche neue Plattform für eine bestimme Art von neuen Werken geschaffen, die die traditionellen Performancekategorien überschreiten. Viele der Arbeiten ähnlicher Art wurden auch in Räumen der Ruhrtriennale oder in vergleichbaren umgewandelten Industriebrachen gezeigt. Orte wie die Brooklyn Academy of Music (BAM) zeigen regelmäßig solche Aufführungen auch schon seit längerer Zeit. Eine weitere Tendenz, die ich schon seit einer Weile beobachte und die für mich ein Charakteristikum des 21. Jahrhunderts ausmacht, ist das Phänomen von Performer-Composern, im speziellen SängerKomponistinnen. Damit verbunden sehe ich prägende Komponistinnen wie Jennifer Walshe, Kate Soper, Agata Zubel und andere, die gleichzeitig eine Wende zu einem unglaublich verspäteten Aufkommen von Frauen als maßgebliche Protagonistinnen in der zeitgenössischer Musikwelt markieren. Ausgehend von der Stimme, wie es bei ihnen allen der Falls ist, gestaltet sich der Arbeitsprozess ziemlich anders als derjenige des Instrumentbasierten Komponierens. Ich bin mir sicher, dass die Art der Musik die dabei herauskommt eine tiefgreifend andere ist und dass es aufregend sein wird, die kommenden Entwicklungen zu verfolgen. Das soll aber nicht heißen, dass die Idee des Komponisten als Autor dabei verloren geht, sie scheint sich nur in anderen Formen zu manifestieren. Ein Einfall äußert sich vielleicht nicht mehr unbedingt in klassischer Notation auf Notenpapier, sondern beispielsweise als vokale oder physische Geste, oder indem eine bestimmte Art von Raum bespielt wird. Zentral dafür wie ich eine Musik anhöre, bleibt aber dennoch immer die Identität eines einzelnen Komponisten. Vielleicht entspricht dies einer antiquierten Vorstellung, aber ich gehe wie selbstverständlich davon aus, da sich ein Personalstil auch in unterschiedlichsten musikalischen Resultaten oder Praktiken meist dennoch zeigt. BF: Was ist denn mit den Institutionen selbst? Sollten Institutionen wie die Metropolitan Opera nicht auch versuchen andere Formate zu programmieren um eine neue Beziehung zu ihrem Publikum zu entwickeln? 4 AR: Das spezifische Problem mit der Metropolitan Opera ist, dass ihre Bühne effektiv nur für eine gewisse Art von Stücken funktioniert, hauptsächlich für solche die ein romantisches Sinfonieorchester benötigen. Es handelt sich um ein Haus von einer enormen Größe. Der Zuschauerraum umfasst 4000 Sitze, und die Bühne einen vergleichbar groß angelegten technischen Apparat. Auch wenn die Met sich mittlerweile ein wenig in eine fortschrittliche Richtung zu entwickeln beginnt, ist es dort schwierig, etwas komplett außerhalb der großen Oper oder Wagnerschen Dimensionen aufzuführen,. Dazu kommen große technische Hindernisse. Hingegen gibt es ja nun in New York das Park Avenue Armory, das alle diese Erwartungen nicht zu erfüllen braucht. Dort gibt es einen viel größeren Freiraum um andere Projekte zu programmieren, wie beispielsweise Stockhausen, Zimmermanns Die Soldaten oder Stücke von Laurie Anderson etc. Der ganze Kosmos der ortsspezifischen Musik ist ein anderer wichtiger Zweig der Neuen Musik. Grosse Institutionen können selbstverständlich konventionelle Aufführungen einerseits auf der traditionellen Bühne aufführen, andererseits aber auch zusätzliche Räume außerhalb bespielen, die sich besser für zeitgenössische Stücke eignen. Solche Satellit Veranstaltungsräume funktionieren teilweise sehr gut, und ziehen auch ein neues und anderes Publikum an. Das dabei anvisierte Ziel, das neue Publikum auch in die traditionellen Stammhäuser zu den anderen Veranstaltungen zu locken, geht aber in der Regel nicht auf. Eine doppelte Identität von Institutionen -zwei verschiedene Publika an zwei verschiedenen Standorten- funktioniert aber meines Erachtens sehr gut; es ist nicht notwendig, dasselbe Publikum in beide Veranstaltungsorte zu bringen und ein einheitliches Publikum zu schaffen, das sich für alle Produktionen interessiert. Man muss bedenken, dass wir es mit einer grossen Vielfalt an historischen Werken wie auch an Produktionen mit Neuen Musik zu tun haben. Es ist hoffnungslos, dem Mythos des einheitlichen homogenen Publikums nachzuhängen. BF: Eine oft gehörte Kritik an zeitgenössischen Performanceformaten ist, dass diese sich an eine Art von Eventbude anlehnen, bei denen die inhaltliche Basis dürftig und oberflächlich ist und Experimente nur mit Ziel der Unerhaltung unternommen werden. AR: Das kommt vor, aber wenn, dann handelt es sich hier einzig um Faulheit! Musikalische und künstlerische Leiter unternehmen oft nur symbolische Gesten, aber verfolgen keine ernsthafte thematische Programmation. Meistens wird einfach einem gewöhnlichen Programm ein zeitgenössisches Label aufgesetzt. Sie gehen nur den halben Weg, und die Kritik daran ist schließlich begründet, da die Resultate weder zum einen noch zum anderen gehören. Auch unkonventionelle Veranstaltungsorte verkommen oft zu langweiligen Clichés. Wenn beispielsweise eine Performance ohne irgendeinen verständlichen Grund anstatt im Konzertsaal in einem Warenhaus oder in einer Bar spielt, kann das kaum als radikal bezeichnet werden. In der Bar findet sich dann meistens genau dasselbe Publikum wie im traditionellen Konzertsaal wieder, das sich dann selbst dazu gratuliert, klassische Musik neu erfunden zu haben - und alles spielt sich in einer klitzekleinen Blase ab, ohne auch nur den geringsten Effekt auf die Welt außerhalb zu haben. BF.: Was halten Sie von den institutionellen Veränderungen der letzten zehn Jahre, und wie könnten die Hauptunterschiede zwischen der Situation in den USA und Europa beschrieben werden? Wie sieht wohl die Rolle von Intendanten und künstlerischen Leitern in Zukunft aus? AR.: Der offensichtlichste Unterschied zwischen Europa und Nordamerika liegt in der Situation der Geldgeber. In den USA wird der größte Teil privat finanziert, während in Europa viele musikalische Aktivitäten noch durch die öffentliche Hand unterstützt werden. Wenn ich alle Facetten mit einbeziehe, würde ich mich selbst lieber in einem musikalischen Umfeld bewegen, das von öffentlichen Geldern finanziert wird, da dies Komponisten und Künstlern größere kreative Freiheit gewährt. Natürlich ist mir auch bewusst, dass öffentliche Gelder aktuell überall zurückgestutzt werden - das bedauerliche Fusionieren der SWR Orchester ist ein Beispiel, das Kürzen von Subventionen in den Niederlanden ein anderes - und politischer Druck lastet immer öfters auf Institutionen, die von öffentlichen Geldern abhängig sind. Sie müssen beispielsweise oft beweisen, dass sie nicht nur "elitäre" Kunst programmieren oder ähnliches. wie wenn die Welt der Popkultur nicht auch elitär wäre, und dies in ungeheuer großen Ausmaßen. All dies spiegelt, wenn auch auf unexakte Art, die Art von Druck, der Kunstschaffende in den USA ausgesetzt sind: die Pflicht, einem breiten Publikum gefallen zu müssen. 5 In beiden Welten besteht die große Herausforderung darin, fortschrittliche Projekte voranzutreiben, Werke der Neuen Musik in Auftrag zu geben, ohne davon abgehalten zu werden, dass man die Relevanz oder die Zugänglichkeit gegen außen beweisen müsste- Worte die für mich sinnentleert sind und Ehrlichkeit in künstlerischen Projekten verhindern. Die Versuchung, das öffentliche Terrain komplett zu verlassen ist groß, und ich habe größten Respekt für diejenigen, die sich entschließen, in der Offszene zu arbeiten, außerhalb der Einflusssphäre von Geldgebern. Gleichzeitig möchte ich auf keinen Fall, dass Neue Komposition als allgemeine und öffentliche "Rede" verloren geht - im Sinne davon, dass komplexe Ideen einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden, in der Hoffnung, dass sie sich eines Tages durchsetzen. Ich hoffe fest, dass unsere größeren Institutionen damit fortfahren, Neue Opern, neue Symphonie- und Chorwerke, d.h. Stücke von großem Ausmaß zu programmieren. Das Risiko, das dabei eingegangen wird, und die Gefahr zu scheitern, sind groß, aber die Tradition die zum Entstehen von Werken wie J.S. Bachs h-Moll Messe und Wagners Ring führte, muss heute unbedingt fortgesetzt werden. Alex Ross: schrieb seit 1993 als freier Autor für den New Yorker seit 1993, und ist seit 1996 ebenda festangestellter Musikkritiker. Seine Themen sind Klassische Musik, von der Metropolitan Opera bis zur downtown Avantgardeszene. Er verfasste Artikel zu Popmusik, Literatur, Geschichte des 20ten Jahrhunderts, und zu Gesellschaft und Genderfragen. Sein erstes Buch The Rest is Noise: Listening to the Twentieth Century, eine Kulturgeschichte der Musik seit 1900, gewann den National Book Critics Circle Award und den Guardian First Book Award und war nominiert für den Pulitzer Preis. Inspiriert von The Rest is Noise programmierte das Southbank Centre 2013 in London einen einjährigen Konzertzyklus, der mehr als 100 Konzerte umfasste. Sein zweites Buch mit dem Titel Listen to This ist eine Sammlung von Essays. Er arbeitet gegenwärtig an seinem dritten Buch Wagnerism, in dem er den großen Einfluss Wagners auf die verschiedensten kulturellen Sparten aufarbeitet. 2008 erhielt er ein MacArthur Fellowship, den Arts and Letters Award der American Academy of Arts and Letters und in Deutschland den Belmont Preis. Brandon Farnsworth: Autor, Forscher und Musikkurator, PhD-Student an der Hochschule für Musik in Dresden, Deutschland. Er schloss seinen MA in Transdisziplinarität an der Hochschule der Künste in Zürich 2015 ab, und einen BA in Musical Performance 2013. Seine aktuellen Forschungsgebiete beinhalten das Aufkommen von kuratorischen Praxen in Musik und Performance wie auch die Rolle der Performativität in unserer neoliberalen Gesellschaft. Projekte beinhalten Rehearsal, ein Marathonkonzert an der Zürcher Hochschule der Künste, 2014, und die Mitautorschaft bei einer Publikation über die Kunstszene Hong Kongs mit dem Titel Why Hong Kong, 2014. Gabrielle Weber: freiberufliche Autorin für die Neue Zeitschrift für Musik, die Schweizer Musikzeitung und dissonance, Kunsthistorikerin, Musikwissenschaftlerin und klassische Sängerin. Sie publiziert und forscht insbesondere zur music in the expanded field und übersetzte das Interview. 6