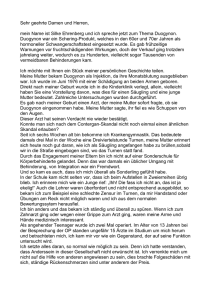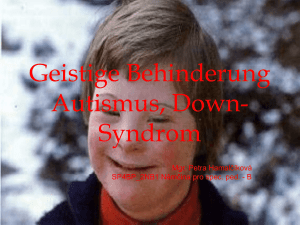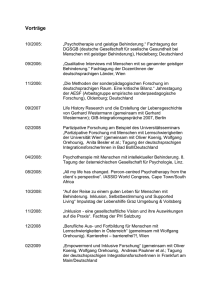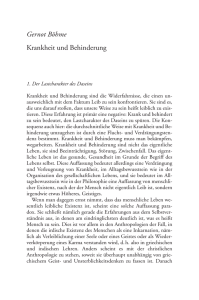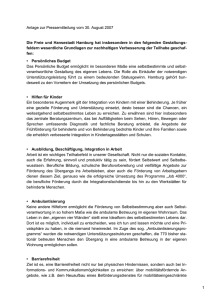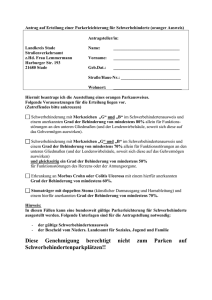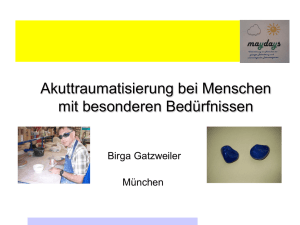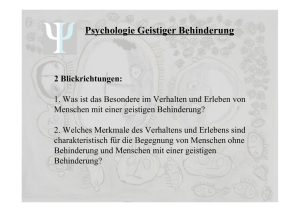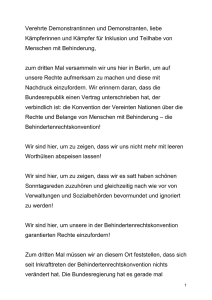Erstkontakt mit Menschen mit geistiger oder - congress
Werbung
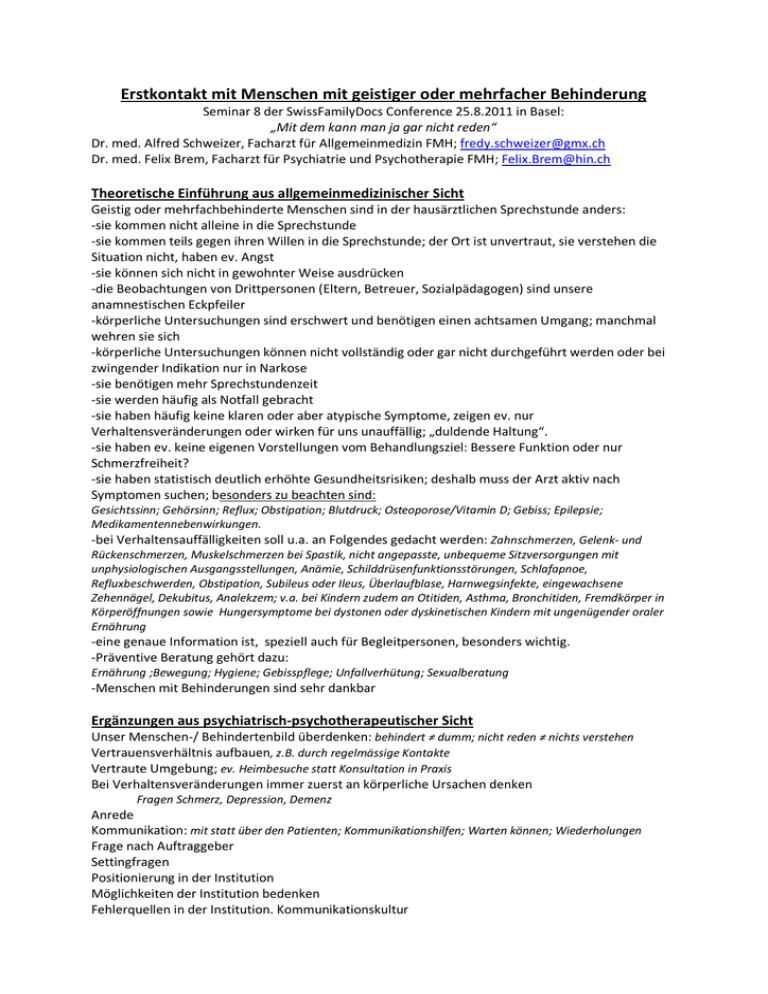
Erstkontakt mit Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung Seminar 8 der SwissFamilyDocs Conference 25.8.2011 in Basel: „Mit dem kann man ja gar nicht reden“ Dr. med. Alfred Schweizer, Facharzt für Allgemeinmedizin FMH; [email protected] Dr. med. Felix Brem, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie FMH; [email protected] Theoretische Einführung aus allgemeinmedizinischer Sicht Geistig oder mehrfachbehinderte Menschen sind in der hausärztlichen Sprechstunde anders: -sie kommen nicht alleine in die Sprechstunde -sie kommen teils gegen ihren Willen in die Sprechstunde; der Ort ist unvertraut, sie verstehen die Situation nicht, haben ev. Angst -sie können sich nicht in gewohnter Weise ausdrücken -die Beobachtungen von Drittpersonen (Eltern, Betreuer, Sozialpädagogen) sind unsere anamnestischen Eckpfeiler -körperliche Untersuchungen sind erschwert und benötigen einen achtsamen Umgang; manchmal wehren sie sich -körperliche Untersuchungen können nicht vollständig oder gar nicht durchgeführt werden oder bei zwingender Indikation nur in Narkose -sie benötigen mehr Sprechstundenzeit -sie werden häufig als Notfall gebracht -sie haben häufig keine klaren oder aber atypische Symptome, zeigen ev. nur Verhaltensveränderungen oder wirken für uns unauffällig; „duldende Haltung“. -sie haben ev. keine eigenen Vorstellungen vom Behandlungsziel: Bessere Funktion oder nur Schmerzfreiheit? -sie haben statistisch deutlich erhöhte Gesundheitsrisiken; deshalb muss der Arzt aktiv nach Symptomen suchen; besonders zu beachten sind: Gesichtssinn; Gehörsinn; Reflux; Obstipation; Blutdruck; Osteoporose/Vitamin D; Gebiss; Epilepsie; Medikamentennebenwirkungen. -bei Verhaltensauffälligkeiten soll u.a. an Folgendes gedacht werden: Zahnschmerzen, Gelenk- und Rückenschmerzen, Muskelschmerzen bei Spastik, nicht angepasste, unbequeme Sitzversorgungen mit unphysiologischen Ausgangsstellungen, Anämie, Schilddrüsenfunktionsstörungen, Schlafapnoe, Refluxbeschwerden, Obstipation, Subileus oder Ileus, Überlaufblase, Harnwegsinfekte, eingewachsene Zehennägel, Dekubitus, Analekzem; v.a. bei Kindern zudem an Otitiden, Asthma, Bronchitiden, Fremdkörper in Körperöffnungen sowie Hungersymptome bei dystonen oder dyskinetischen Kindern mit ungenügender oraler Ernährung -eine genaue Information ist, speziell auch für Begleitpersonen, besonders wichtig. -Präventive Beratung gehört dazu: Ernährung ;Bewegung; Hygiene; Gebisspflege; Unfallverhütung; Sexualberatung -Menschen mit Behinderungen sind sehr dankbar Ergänzungen aus psychiatrisch-psychotherapeutischer Sicht Unser Menschen-/ Behindertenbild überdenken: behindert ≠ dumm; nicht reden ≠ nichts verstehen Vertrauensverhältnis aufbauen, z.B. durch regelmässige Kontakte Vertraute Umgebung; ev. Heimbesuche statt Konsultation in Praxis Bei Verhaltensveränderungen immer zuerst an körperliche Ursachen denken Fragen Schmerz, Depression, Demenz Anrede Kommunikation: mit statt über den Patienten; Kommunikationshilfen; Warten können; Wiederholungen Frage nach Auftraggeber Settingfragen Positionierung in der Institution Möglichkeiten der Institution bedenken Fehlerquellen in der Institution. Kommunikationskultur Krisenintervention Einsatz von Psychopharmaka Es werden zu oft Neuroleptika, zu selten Antidepressiva verschrieben; oft ungerechtfertigter Verzicht auf Benzodiazepine; regelmässige Überprüfung und Ausschleichversuche Hinweise: Zur Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft von Ärzten für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung SAGB / ASHM: http://www.sagb.ch/deutsch.html . Hier ist unter Mitgliedschaft auch das Anmeldeformular zu finden. Zu finden unter http://www.sagb.ch/Links.html - UNO Resolution für die Rechte von Menschen mit geistiger Behinderung - Zu den Vorträgen der Konferenz in Potsdam -unter http://www.sagb.ch/Literaturservice.html - Merkblatt "Was kann man tun?" - Modellprojekt Rheinland-Pfalz - Europäisches Manifest - Leitgedanken - Kasseler Kongress 2001 - Declaration of Rome -Medizinische Krisenintervention bei Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung -unter http://www.sagb.ch/Mitgliederversammlung.html - -----Kurzfassung Referat von Felix Brem (an der Jahrestagung 2008) Grundsatz-Artikel :www.saez.ch/pdf_f/2007/2007-30/2007-30-561.PDF Schmerzskala: - http://stiftung-lebenpur.de/fileadmin/user_upload/slp/Tagung_2008_Schmerz/PDF/Schmerzskala_2010.pdf Elementare Anforderungen an die Organisation gesundheitsbezogener Leistungen für E. - http://www.drk-bw.de/adelheidstift/UN_BRK/BEB-Tagung-LH-0911.pdf Medizinische Behandlung und Betreuung von Menschen mit Behinderung (2008) PDF - http://www.samw.ch/de/Ethik/Richtlinien/Aktuell-gueltige-Richtlinien.html Jahrestagung SAGB/ASHM 2011: Donnerstag, 8.9.2011 14.00-18.15; Inselspital Bern: „Autismus“ - Wichtiges für Nichtspezialisten. Anmeldung: [email protected] Texte: Geistige Behinderung ist nicht etwas, was man hat - wie blaue Augen oder ein 'krankes' Herz. Geistige Behinderung ist auch nicht etwas, was man ist - wie etwa klein oder dünn zu sein. Sie ist weder eine gesundheitliche Störung noch eine psychische Krankheit. Sie ist vielmehr ein spezieller Zustand der Funktionsfähigkeit, der in der Kindheit beginnt und durch eine Begrenzung der Intelligenzfunktionen und der Fähigkeit zur Anpassung an die Umgebung gekennzeichnet ist. Geistige Behinderung spiegelt deshalb das 'Passungsverhältnis' zwischen den Möglichkeiten des Individuums und der Struktur und den Erwartungen seiner Umgebung wider. Diese Definition der American Association of Mental Retardation - AAMR verdeutlicht, dass geistige Behinderung - wie Behinderung überhaupt - heute nicht mehr als individuelles Merkmal eines Menschen aufgefasst wird, sondern als mehrdimensionales und relationales Phänomen . Der Schwerpunkt der Betrachtung verlagert sich also heute von der Person auf den Lebensbereich, in dem eine Person mit geistiger Behinderung spezielle Unterstützung und Begleitung benötigt. Dadurch rücken auch die Hindernisse ('behindert werden') in den Blick, die Personen mit derartigen Entwicklungsvoraussetzungen zusätzlich in den Weg gelegt werden können, zum anderen aber auch die Hilfen, von denen es entscheidend abhängt, wie gut diese Personen im Alltag zurecht kommen. (Geistige Behinderung; von C. Lindmeier; in http://www.familienhandbuch.de/cmain/f_Aktuelles/a_Behinderung/s_334.html ) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x Hierzu ist es notwendig, die geistige Behinderung von den sie oft begleitenden Einschränkungen der körperlichen und sensorischen Fähigkeiten, aber auch von den Prägungen der individuellen Lebensgeschichte zu trennen. Was bleibt, ist ein Mensch, der in seiner individuellen Entwicklung sich die zu seiner sozialen Integration notwendigen gesellschaftlich geprägten und gesellschaftlich geforderten Fertigkeiten, Einstellung und Bedürfnisse nicht in ausreichendem Masse aneignen kann. Das bedingt sein Anderssein, das macht ihn „unnormal“. In dieser Definition wird deutlich, dass sein Anderssein sich aus der Konfrontation mit dem gesellschaftlich Durchschnittlichen ergibt, dass seine Unnormalität immer relativ zu dem gesellschaftlichen Anforderungsniveau zu sehen ist. Ein Beispiel: Noch vor weniger als 20 Jahren konnten viele Bewohner Neuerkerodes, einer Einrichtung für geistig Behinderte, in den benachbarten Dörfern bei den Bauern arbeiten. Sie waren wegen ihrer Fertigkeiten geachtet und waren zumindest in den Arbeitsprozess integriert. Für viele aber bot sich die Chance, von den Bauern in Kost und Logis aufgenommen zu werden, was oft mit engen familiären Beziehungen verbunden war. Mit zunehmender Technisierung der Landwirtschaft wurde es immer schwieriger, für einen behinderten Menschen in der Landwirtschaft Arbeit zu finden. Die Rüben- und Kartoffelernte wurde von Maschinen übernommen, und die Tierzucht wurde auf eine wissenschaftliche Basis gestellt. Behinderte waren keine Hilfe mehr, sie wurden zu Störfaktoren. Der technische Fortschritt veränderte die Arbeits- und Lebensweise in dem Dorf und entzog den Behinderten ihre Nischen, in denen sie am normalen Leben partizipieren konnten: Erst jetzt wird das „Anderssein“ zu einem trennenden Kriterium. Soziale Isolation ist also auch und in erster Linie Resultat der gesellschaftlichen Organisationsform und nicht nur ein Ergebnis von Vorurteilen und menschenunfreundlichen Einstellungen. Was ergibt sich daraus? Der Hinweis auf die gesellschaftlichen Normen als Basis für die Definition einer Unzulänglichkeit, also einer Behinderung, soll nicht als oberflächliche Gesellschaftskritik verstanden werden. Es ist keine Gesellschaft vorstellbar, in der eine geistige Behinderung nicht zu einer schwerwiegenden Einschränkung der Qualität des Lebens führen würde. Eine geistige Behinderung kann man nie völlig ausgleichen. Trotzdem muss man versuchen, den Einfluss gesellschaftlich bedingter Faktoren zu minimieren, die zu einer Verschärfung der Situation führen. Bezogen auf geistig behinderte Menschen heisst das, dass sie keine Patienten sind, also nicht Objekte der Medizin und der Psychiatrie sein dürfen, sondern dass sie in erster Linie Mitbürger sind. Zweitens ergibt sich hieraus die Forderung, Integration in eine ihnen angemessene soziale Umgebung, in einen „Ort zum Leben“ (Gaedt, 1981 u. 1983) zu ermöglichen. Es muss also eine politische Aufgabe sein, die Gesellschaft so zu verändern, dass auch Menschen mit einer geistigen Behinderung ihren „ Ort zum Leben“ finden können. Geistige Behinderung ist keine Krankheit! Ein geistig behinderter Mensch ist, wenn er nicht an einer medizinisch definierten Krankheit leidet, ein normaler Mitbürger. (Gaedt, C. (1995) S. 8). Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Gesundheitliche Probleme und Verhaltensauffälligkeiten –abweichendes Krankheitsverhalten Menschen mit geistiger Behinderung haben oft ein ungewöhnliches Krankheitsverhalten. Sie haben zum Beispiel oft Schwierigkeiten, Schmerzen zu lokalisieren oder Missempfindungen zu differenzieren. Oft misslingt ihnen auch eine realistische Bewertung ihrer Körperwahrnehmung, wodurch ihnen eine treffende Zuordnung zu Ursachen erschwert wird. Es kommt hinzu, dass sie meist zusätzlich das Problem haben, sich nicht so präzise ausdrücken zu können, dass sie sich auf diese Weise Hilfe und Entlastung verschaffen können. In jedem Fall werden Fehleinschätzungen und die Erfahrung der Hilflosigkeit einen prägenden Einfluss auf das Krankheitsverhalten haben. Ein vereiterter Zahn zum Beispiel kann bei einem schwer geistig behinderten Menschen zu einem diffus wahrgenommenen veränderten Körpererleben führen, das sich in Form einer allgemeinen Reizbarkeit äußert. Oft wird dieses Verhalten dann als eine »Verstimmung« gedeutet und nicht weiter hinterfragt. Wenn der Schmerz nicht nachlässt, führen möglicherweise ständige Reibereien und kleinere Konflikte zu nachhaltigen Störungen der Beziehungen zu seinen Mitmenschen, gefolgt von negativen Erwartungen und Rollenzuschreibungen. Der Keim für eine bleibende störende Verhaltensweise ist gelegt. Es kann aber auch sein, dass die gleiche Ursache bei einem anderen zu heftigsten, gegen sich selbst gerichteten Aggressionen führt. Dabei bleibt die Psychodynamik meist im Dunkeln. Will der Betreffende sich selbst bestrafen, um von dem Schmerz loszukommen? Will er einen Teil seines Körpers zerstören, um schmerzfrei zu werden? Will er den einen Schmerz durch einen anderen betäuben? Oder ist die Autoaggression nur Ausdruck einer durch den Schmerz ausgelösten, nicht mehr zu kontrollierenden aggressiven Tendenz? In einem weiteren Fall kann der schmerzende Zahn gezielte aggressive Handlungen gegen andere Personen hervorrufen. Hier ist es offensichtlich aufgrund unreifer psychischer Prozesse zu einer Schuldzuweisung nach außen gekommen. Der Betroffene erlebt sich als Opfer und muss sich wehren. Es kommt hinzu, dass auch Erinnerungen an frühere Schmerzen sowie die nachfolgende, angstauslösende und vielleicht schmerzhafte Behandlung aggressives Abwehrverhalten auslösen bzw. verstärken können. Der Zahnschmerz dient hier nur als Beispiel. Wie Zahnschmerzen, so können auch andere körperlich begründete Befindlichkeitsstörungen zu dauerhaften Verhaltensauffälligkeiten werden. Mit Befindlichkeitsstörungen muss man zum Beispiel auch bei vielen Medikamenten rechnen. Auch wenn sie primär als Psychopharmaka angewandt werden, können sie doch über direkte oder indirekte Wirkung auf die Psyche zu Änderungen des Verhaltens führen. Bekannt sind solche Effekte bei Medikamenten gegen Bluthochdruck (z. B. apathisches Verhalten) oder bei bestimmten Medikamenten gegen Epilepsie (z. B. aggressive Gereiztheit). Besonders schwer einzuschätzen sind paradoxe Wirkungen von Psychopharmaka. So können unter Umständen aggressive Verhaltensweisen durch Tranquilizer verstärkt, statt vermindert werden. Neuroleptika erzeugen oft eine innere Unruhe, die den angestrebten beruhigenden Effekt verschleiern können. Die Vielfalt der Möglichkeiten für eine organisch bedingte Änderung des Verhaltens ist so groß, dass für eine Aufzählung hier kein Raum ist. Es ist deshalb wichtig, bei jeder Verhaltensauffälligkeit auch an diese Möglichkeiten zu denken. Wird der Zusammenhang mit einer körperlichen Ursache nicht gesehen, sind diese Auffälligkeiten fehlinterpretierbar. Sie werden dann nicht als Krankheitsverhalten erkannt und als Hinweis auf eine körperliche Störung genutzt. Stattdessen werden sie fälschlicherweise als Stimmungsschwankung angesehen, vorschnell als gelerntes Verhalten abgetan (etwa um auf sich aufmerksam zu machen) oder als psychiatrische Störung eingeschätzt. So erhalten die Betroffenen statt der in diesen Fällen notwendigen medizinischen Diagnostik und Behandlung dann nutzlose pädagogische oder gar psychotherapeutische Hilfen. Die Bedeutung einer engmaschigen allgemeinärztlichen Betreuung — Frühbehandlung und ganzheitlicher Ansatz Um solche Fehleinschätzungen zu vermeiden, ist eine enge Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Hausarzt notwendig. Dies ist besonders auch deshalb wichtig, weil Menschen mit geistiger Behinderung ein erhöhtes Risiko für vielfältige körperliche Erkrankungen haben. Da sie wegen ihrer Behinderung bei der Bewältigung des Alltags in der Regel ihre Kompensationsmöglichkeiten auch im gesunden Zustand bereits ausschöpfen, ist jede kleine Abweichung vom Normalzustand oft eine unerträgliche Belastung. Der Alltag wird unter diesen Bedingungen zu einer Überforderung auch der psychischen Möglichkeiten. Wiederum äußert sich diese Überforderung häufig in unspezifischen störenden Verhaltensauffälligkeiten. Oft entwickelt sich aus einer nicht erkannten oder nicht ausreichend behandelten Bagatellerkrankung eine sich stetig verschärfende Krisensituation, die letztlich durch chronische Verhaltensauffälligkeiten geprägt sein kann. Um diese »Patientenkarriere« zu verhindern ist es notwendig, gesundheitliche Probleme früh zu erkennen und ausreichend zu behandeln. Hierzu wird ein Arzt nur in der Lage sein, wenn er, vergleichbar mit dem traditionellen »Hausarzt«, mit der persönlichen Lebensgeschichte und den Lebensbedingungen der Betroffenen vertraut ist. Dazu gehört auch ein partnerschaftliches Verhältnis zu den Angehörigen bzw. den Fachleuten, auf deren Informationen er angewiesen ist. Da die Verquickung mit psychischen Störungen— so zum Beispiel bei den psychosomatischen — oft unentwirrbar ist, muss die allgemeinärztliche Tätigkeit im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes in kooperative Beziehungen mit den therapeutischen Diensten eingebettet sein. (Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. (2003) S.93-95)