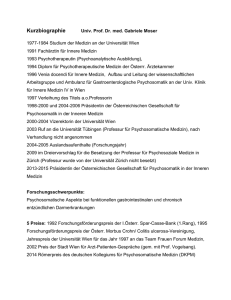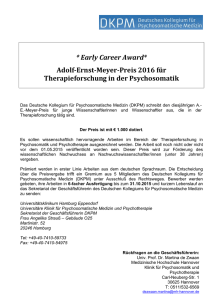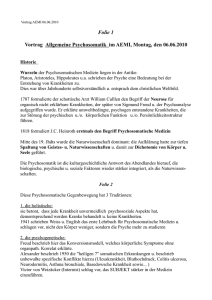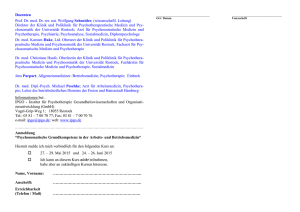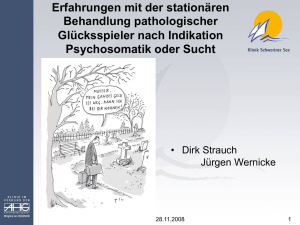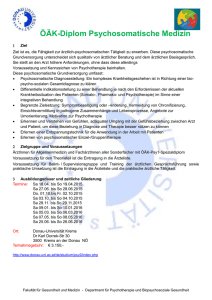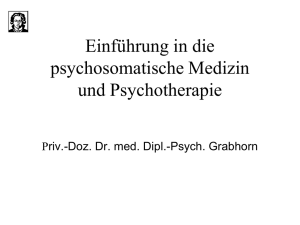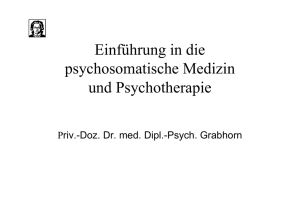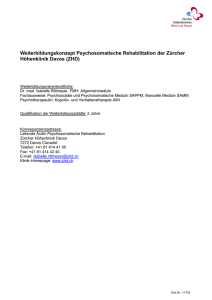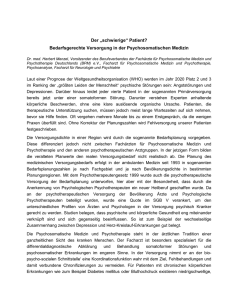Fachspezifische Psychosomatik - Institute of Behavioural Sciences
Werbung
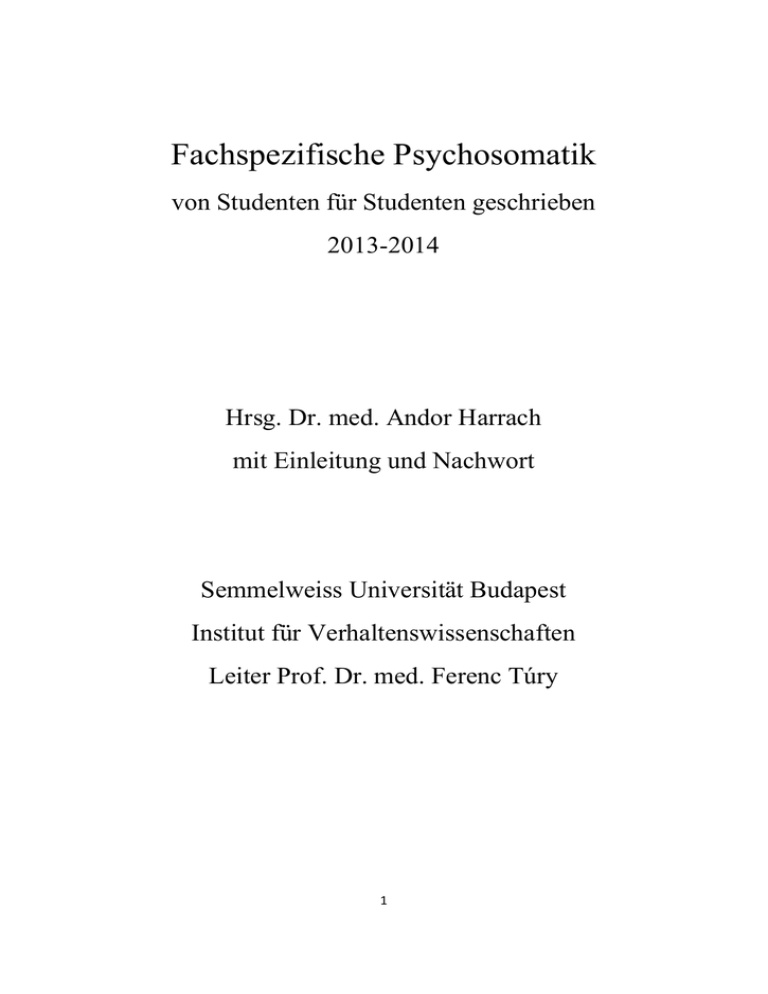
Fachspezifische Psychosomatik von Studenten für Studenten geschrieben 2013-2014 Hrsg. Dr. med. Andor Harrach mit Einleitung und Nachwort Semmelweiss Universität Budapest Institut für Verhaltenswissenschaften Leiter Prof. Dr. med. Ferenc Túry 1 Inhaltsverzeichnis Namensliste der teilnehmenden Studentinnen und Studenten 4 Danksagung 5 Fachliteratur 6 Einleitung und didaktische Überlegungen 9 Fachspezifische Psychosomatik – was ist das? 12 1.Psychosomatik und chronische Erkrankungen 17 2. Essstörungen 22 3. Psychoonkologie 30 4. 37 Frauenheilkunde in der psychosomatischen Medizin 5. Psychosomatik in der Schwangerschaft 40 6. Psychosomatik in der Kinder- und Jugendheilkunde 44 7. Sexualstörungen beim Mann 49 8. Sexualstörungen bei der Frau 53 9. Psychokardiologie 57 10. Psychosomatik in der Gastroenterologie 61 11. Orthopädie in der (und) Psychosomatik 65 12. Psychosomatik in der Chirurgie 73 13. Psychosomatik in der Neurologie 77 2 14. Belastungsstörungen 88 15. Der Allgemeinarzt als Psychosomatiker 94 Nachwort 99 3 Namensliste der teilnehmenden Studentinnen und Studenten 1. Füger, Miriam 2. Gehlen, Liseth 3. Gereke, Benedikt 4. Hess, Matthias 5. Hofman, Jan 6. Hoojier, Valentin 7. Ihle, Ulrike 8. Jones, Elena 9. Kettenhofer,Sophie 10. Kijevsky, Janik Robin 11. Krinninger, Anna 12. Kuld, Noemi 13. Kunz,Annika 14. Kustra, Thomas 15. Levin, Olivia 16. Mühlnikel, Jan 17. Polat, Gözde 18. Ramisch, Antonia 19. Scheidt, von,Susanne 20. Schuh, Thomas 21. Schulz, Steffen 22. Simon, Hannah 4 Danksagung Dr. Birkás, Emma - Fachorganisation Dr. Hajnal, Ágnes – Fachorganisation Fonyó, Magdolna - studentisches Sekretariat Jónás, Zsolt – Systembetreuer 5 Fachliteratur Literatur im Vorlesungsverzeichnis für den Kurs WS Janssen, P., P. Joraschky, W. Tress (Hrsg.): Leitfaden Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. 2006, Deutscher Ärzteverlag, Köln, Klußman,R., M. Nickel: Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Ein Kompendium für alle medizinischen Fachgebiete, 6., erweiterte und korrigierte Auflage, 2009, Springer, Berlin Herzog,W., M.E. Beutel, J. Kruse: Psychosomatische Medizin und Psychotherapie heute. Zur Lage des Fachgebietes in Deutschland. 2013, Schattauer, Stuttgart Literaturliste im Vorlesungsverzeichnis für das Praktikum SS: Balint, Michael: The Doctor, his Patient and the Illnes, London, 1957. in Deutsch: Der Arzt, der Patient und die Krankheit, 1957 und w. Auflagen, Klett-Kotta, Stuttgart Rosin, U.: Transkription einer Balint-Gruppensitzung. in: Schriftenreihe Die Balint Gruppe in Klinik und Praxis, Band 5., 1988., Springer Stubbe, M. und E. R. Petzold: Beziehungserlebnisse im Medizinstudium. Studentische BalintArbeit, 1995, Schattauer, Stuttgart Morgan W. L. und G. L. Engel: Der klinische Zugang zum Patienten. Anamnese und Körperuntersuchung, (1969), deutsch 1977, Huber, Bern Zimmermann-Vieloff, E. : Der Arzt als Placebo, in Balint-Journal, 2010. 11. 39-41. Thieme Harrach, A. : Frühe Quellen der Balint-Gruppen-Arbeit in Ungarn. Scriftenreihe Die BalintArbeit in Klinik und Praxis, Bd. 5. 1988, Springer Hafner, S.: Die Balintgruppe. Didaktische Anleitung für Teilnehmer. Im Auftrag der Deutschen Balintgesellschaft. 2007. Deutsche Ärzteverlag, Köln Otten, H. : Professionelle Beziehungen. Theorie und Praxis der Balintgruppen. 2012, Springer 6 Literaturliste E-Buch Projekt: Uexküll, Th. von, (Hrsg.): Psychosomatische Medizin, 6. Auflage, 2003, 1564 Seiten, Urban –Fischer Verlag. Ein Klassiker, etwas schwerfaellig und schwergewichtig, umfassend, teiweise veraltet, immer noch wichtig für die fachbezogenen Aspekte! Möller, H.-J.G. Laux, H.-P. Kapfhammer: Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie. 2 Bd. Springer, 2011, 4. Auflage. isges. 2906 Seiten. Ein Mammutbuch, gut integrierte Psychosomatik von Kapfhammer mit mehr als 300 Seiten (Graz). Senf, W., M. Broda (Hrsg.): Praxis der Psychotherapie. Ein integratives Lehrbuch. Thieme, 5. Auflage, 2012. 812 Seiten. Gut integrierte Psychotherapie mit Psychosomatik, eher im Sinne der Psychotherapie bei psychosomatischen Krankheitbildern, keine allgemeine Psychosomatik, aber Grundbuch für Psychotherapie. Haenel, J., A. Enders, S. Davis: Psychosomatik und Psychotherapie – BASICS-Buch. UrbanFischer, 2008, 115 Seiten. Geschrieben von einem starken Team: Studenten und erfahrenen Ärzten! Das Wesentliche in leicht verständlicher Form! Eher mit Beispielen als sytematisch, auch mit Fallbeispielen. Fritzsche, K., Geigges, W.,D. Richter, M. Wirsching: Psychosomatische Grundversorgung. Springer, 2003, 415 Seiten. Für Ärzte, die Ärzte bleiben aber die Psychosomatik in ihre Tätigkeit integrieren wollen – als Kurs Pflicht für alle Mediziner, die sich in Deutschland frei niederlassen wollen. Moser, Gabriele: Psychosomatik in der Gastroenterologie. Springer, 2007 Neises, M, S. Ditz: Psychosomatische Grundversorgung in der Frauenheilkunde. Thieme, 2000. Hoffmann, Hochapfel,: Neurotische Störungen und Psychosomatische Medizin. Mit einer Einführung in Psychodiagnostik und Psychtherapie. 2004, Schattauer, Stuttgart Bräutigam, M.,P. Christian, M. von Rad: Psychosomatische Medizin. Taschenbuch. Lehrbuch, 1992, 5. Auflage, Thieme, Stuttgart. Ein Klassiker seit 1972! Henningsen, P., H.,Gündel, A., Ceballos-Baumann. Neuropsychosomatik. Grundlagen und Klinik neurologische Psychosomatik. 2006, Schattauer Veit, Iris: Psychosomatische Grundversorgung. Kohlhammer. 2010 Niemeier, V., U. Stangier, U. Gieler (Hrsg.): Hauterkrankungen. Psychologische Grundlagen und Behandlung. Hogrefe, 2009 Adler, R. : Einführung in die biopsychosoziale Medizin. Schattauer, 2005 7 Heigl-Evers, A. u. U. Rosin (Hrsg.): Psychotherapie in der ärztlichen Praxis. 1989. Vandenhoeck, Verlag für Medizinische Psychologie, Göttingen Auswahl von Artikeln-Büchern zum Referieren: Novack, H. Dennis, at all.: Psychosomatic Medicine: The Scientific Foundation of the Biopsychosocial Model. Academic Psychiatry, 31:5, September-October 2007, 388-401. (Ein Grundartikel zum Thema) Morgan, Willam, L., George L. Engel (1969): Der klinische Zugang zum Patienten. Anamnese und Körperuntersuchung. Eine Anleitung für Studenten und Ärzte. Vorwort von PD Dr. med Rolf Adler. 1977, Huber, Bern Vegetatives Nervensystem – aus den: Physiologie Lehrbüchern 1. „Silbernagel” (Thieme, 6. Auflage, 2010 und 2. Schmidt-Lang-Heckmann, Springer) 31. Auflage, 2010 Müller, N. : Die biopsychosoziale Medizn. Die Anamnesegruppe an der Medizinischen Universitaet Graz. Eine qualitative Evaluation der Lehrveranstaltung. Diplomarbeit Zur Erlangung des Akademischen Grades „Doktorin der gesamten Heilkunde” (Dr.-in med. univ.) Graz, November 2010 „Die Supersysteme und chronische Krankheit”, aus: Lehrbuch der klinischen Pathophysiologie komplexer chronischer Erkrankungen, 3 Bänder. - Bd. 1. Vernetztes Denken in der biomeizinische Forschung, 1-77. S. Hrsg. Rainer Straub, Regensburg, 2006, Vandenhoeck-Verlag für Medizinische Psychologie, Göttingen 8 Einleitung und didaktische Überlegungen Andor Harrach Diese studentischen Texte sind im Zuge des frei wählbaren Kurses Psychosomatik an der Medizinischen Universität Budapest im Studienjahr 2013/14 entstanden. Im Wintersemester standen Vorlesungen und Referate, im Sommersemester praktische Übungen, Diskussionen und Gruppenarbeit im Vordergrund. Überwiegend Studentinnen und Studenten aus dem III. Studienjahr waren die Teilnehmer. In beiden Semestern haben sich etwa 30 Teilnehmer angemeldet - die hohe Zahl hat uns eigentlich überrascht. Allerdings war der Kurs unter den Studenten schon bekannt, weil der Kurs des Wintersemesters schon seit 2007 angeboten wurde und lief regelmäßig mit ähnlicher Teilnehmerzahl. Tatsächlich haben davon in diesem Jahr 20 das Witersemester und 23 das Sommersemester zu Ende gemacht. Jeweis konnten einige aus Gründen des Wochenplanes garnicht erst anfangen, andere sind in der Anfangsphase des Semesters nach Deutschland gewechselt, nachdem sie dort einen Studienplatz bekommen haben – generell sind viele Studentinnen und Studenten bestrebt, ab dem 3. Studienjahr das Studium in Deutschland fortzusetzen. Im Studienjahr 2013-14 haben wir zum ersten mal auch im SS den Kurs als „Psychosomatische Praxis und Junior Balint-Gruppen” ausgeschrieben. Warum-wieso Psychosomatik gleich am Anfang des klinischen Teils im Medizinstudium einzuführen? Die Idee, Psychosomatik im 3. Studienjahr anzubieten, stammte zunächst aus dem Bestreben, den psychologischen Strang des Studiums nach den Fächern „Ärztliche Kommunikation” im ersten Jahr und „Medizinische Psychologie und Soziologie” im zweiten Jahr fortzuführen, nicht abebben zu lassen. Dies nennt man in den USA (Novack, 2007) longitudinalen Unterricht der Psychosomatik in der gesmaten Zeit des Studiums. Wir ahnten, daß auch die im Jahr davor absolvierte Fach Physiologie hierzu günstige Grundlagen bietet. Diese Annahme hat sich mehr als bewahrheitet, denn wir haben ständig erlebt, daß die Physiologie eine hervorragende Brücke zur Psychosomatik darstellt, ja es scheint dringend notwendig zu sein, sich in psychosomatischen Fragestellungen auf die Physiologie zu beziehen. Psychosomatische, d.h. dsyfunktionale körperliche Abläufe sind im 3. Studienjahr daher sehr leicht zu verstehen bzw. zu vermitteln. Drittens machten uns die Erfahrungen im Unterricht der Medizinischen Psychologie und Soziologie im 2. Studienjahr darauf aufmerksam, daß die Studenten sehr dankbar dafür sind, wenn der Dozent den Unterricht mit seinen Erfahrungen aus seiner jahrzehntelangen ärztlichpsychosomatischen Tätigkeit in Deutschland bereichert. Dies scheint gerade in den psycho9 sozialen Fächern von Wichtigkeit zu sein, aber auch dadurch, dass in Deutschland das Fachgebiet Psychosomatik einen ganz anderen Stellenwert als in Ungarn genießt. Die Bedeutung der „sprechenden Medizin” gleich zu Beginn des klinischen Studiums zu unterstreichen ist von eminenter Wichtigkeit. Die praktische sprachliche Kompetenz zu fördern, z. B. durch Fallberichte seitens des Dozenten, durch Fallbesprechungen mit der Methode der „Themenzentrierten Interaktion”, durch die „Bálint-Gruppe”, durch allgemeine Diskussionen untereinander, ist eine wichtige Lehre und eine Freude in diesem Kurs. Das Gruppenverhalten mit eigenen Regeln in den Diskussionen im Stuhlkreis ist ein wichtiger Lehr- und Lernstoff der ärztlich-beruflichen Sozialisation. Gerade dies hat sich im Kurs gelegentlich auch als problematische Angelegenheit erwiesen. Ähnlich ist es übrigens auch im Unterricht im Fach Medizinische Psychologie und Soziologie. Kooperatives Verhalten in einer Arbeitsgruppe, (wie Ko-Autorenschaft bei der Herstellung der Texte), wie sich der Kurs ebenfalls verstand, dient vermutlich ebenfalls als Muster und Grunderfahrung für die weitere berufliche Sozialisation und für die Tätigkeit. Das selbstständig-kreative Arbeiten der Studierenden war im WS das mündliche Referat mit Projektion, im SS die schriftliche Darstellung der Psychosomatik in den einzelnen medizinischen Fächern nach freier Wahl (jeweils Teile aus der fachspezifischen Psychosomatik). Die Darstellungsweise nach medizinischen Fächern will vermitteln, dass Psychosomatik nicht nur ein Fach unter anderen ist, sondern gleichzeitig ist die Psychosomatik in allen Fächern als Querverbindung in der der gesamten Medizin gegenwärtig. Methodische Ansätze zum Herstellen von Texten, wie z.B. die Informationssammlung, die Strukturierung der Texte, die Abwägung des Zitierens der Quellen zum Text waren weitere Aufgaben, die den komplexen Lernprozess bereichert haben. Diese schriftliche Arbeit ist mit eine der Grundlagen der Benotung im Kurs im Sommersemester. Die Empfehlung für die schriftliche Darstellung war, sich eher auf die Phänomenologie und auf eine anfängliche Diagnostik zu beschränken. Dies reicht erstmal als theoretische Grundlage, ja zum Teil auch für eine eingeschränkte minimale ärztliche Tätigkeit in welchem Fach auch immer. Eine vertiefte Beschäftigung damit in den Fächern Psychotherapie bzw. Psychiatrie soll es dann ergänzen. Eine maximalistische Beschäftigung mit dem Thema, aber auch eine abstrakte Sprach könnte eher zu einer Überforderung und ablehnenden Haltung führen. Dieses selektive Denken sollte-konnte auch in den Texten erscheinen. Die Universität bildet Allgemeinärzte, und nicht Fachärzte aus. Aus diesen Gründen haben wir bei der Beschreibung der Krankheitbilder auf die Denkweise Wert gelegt und auf die detallierte, meist künstliche ICD-Kategorisierung der Krankheitsbilder verzichtet, obwohl dieser Aspekt in den Diskussionen zur Sprache kam. 10 Als eine wesentliche Schwierigkeit ist von den Teilnehmern formuliert worden, die Sprachform und die Schriftform in psycho-sozialen Themen zu finden. Viele von Ihnen sind im Studium noch nie mit vergleichbarer Aufgabe konfrontiert gewesen – eine Schwierigkeit auch im späteren ärztlichen Berufsleben! Es war sehr deutlich, der Anschluß an die psycho-soziale Denkweise für diejeneigen Studenten, die vor dem Studium im irgendeinen Bereich der Medizin bereits tätig gewesen sind, sehr viel leichter ist (z.B. Pflege, Rettungsdienst). Viele Studenten haben auch bei vorhandenem Interesse am Fach Psychosomatik die Schwierigkeit des „Umschaltens” von der rein biologischen Denkweise her kommend auf psycho-soziale Aspekte, wie Beziehungsgestaltung, Empathie, das Gespräch, die Wahrnehmung eigener Gefühle, die Sensibilität für Patientensorgen und Patientenverhalten, den Einfluß von Umgebungsfaktoren im Versorgungssystem und in Ausbildungssystemen des Gesundheitswesens verbalisiert. Das stufenweise, aber konsequente Heranführen auf diese Arbeitsweise, auf die „psychosomatische Haltung”, soll der Kurs aufmerksam machen, auch darauf, daß psychosomatischer Arbeit Zeit braucht. Diese Textsammlung als freie Auswahl aus den Krankheitsbildern ist eigentlich die Fortführung des Kurses mit anderen Mitteln. Es ist eine Zusammenfassung für uns alle im Kurs. Vom Kursleiter her soll es auch eine Art didaktische Auswertung des Kurses sein. (Mit Heranrücken der Prüfungszeit gegen Ende des Semesters fokussiert sich allerdings die Aufmerksamkeit der Studierenden eher auf die Prüfungsfächer und weniger auf dieses „Walfach” in den späten Nachmittagstunden.) Die Texte können nur eine Auswahl der Krankheitsbilder innerhalb der Fächer, aber auch in der Auswahl der Fächer überhaupt darstellen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Wichtige Fächer, z.B. Dermatologie, Augenheilkunde, fehlen hier leider. Das Auswählen der Themen erfolgte von Seiten der Studenten übrigens auch frei, dies sollte Ihnen die Möglichkeit geben, eigene Interessen, Vorlieben auszukundschaften, um in späteren Studienjahren und zu Anfang der beruflichen Tätigkeit mit als Orientierung zur endgültigen Beufswahl zu dienen. Die schriftliche Fixierung der Inhalte, der Erfahrungen und Erlebnisse in der Gruppe können die Gruppenarbeit selbst ein Stück fortführen. So ist zumindest unsere Hoffnung, denn psychosomatische Medizin ist auch ein Fach der Emotionen, in dem der Mensch – Patient und Behandler - nicht als „biologische Maschine” verstanden wird. Die Arzt-Patienten-Beziehung ist auch eine zwischenmenschliche Beziehung, eine Begegnung, auch mit vielen unbewußten Anteilen, die als eine eigenständige Dimension der Diagnostik und des Therapieprozesses selbst verstanden und professionell verwertet wird. 11 Fachspezifische Psychosomatik – was ist das? Andor Harrach Die Themenwahl „fachspezifische Psychosomatik” als eine Teildimension der Psychosomatik und die Bezeichnung will didaktisch vermitteln, daß Psychosomatik in der ganzen Medizin gegenwärtig ist. Psychosomatik ist ein Brückenfach, da sie in gewisser Hinsicht alle Fächer verbindet und den „psycho-sozialen Ansatz” insgesamt verwirklicht (s. auch weiter unten). Psychosomatik wird demgegenüber häufig reduktiv als „ein Fach” unter anderen verstanden und nicht, in dem sie gleichzeitig auch eine integrierte bzw. integrierende Dimension aller Fächer ist. Die Konzeption „bio-psycho-soziale Medizin” gilt als ein Gesamtzusammenhang für die Medizin überhaupt. Die konkrete klinische Psychosomatik ist ein konkordanter Teil davon, tätigkeitsorintiert und praxisnah, vertreten in allen Fächern und gleichzeitig ein relativ selbstständiges klinisches Fach als eigenständige Einrichtung. Klassifizierung der Krankheitsbilder in der Psychosomatik Eine richtig konsequente Klassifizierung der Krankheitsbilder ist offensichtlich garnicht möglich, es liegt an der Vielzahl der möglichen Aspekten, die herangezogen werden können. In der fachbezogenen Psychosomatik ist der Leitgedanke die Aufteilung der Fächer in der praktischen klinischen Medizin. Nun kann gerade diese Einteilung selbst auch sehr unterschiedlich ausfallen und sich aus verschiedensten Gründen auch rasch verändern. Gebiete, Teilgebiete, Subdisziplinen, Einrichtungen und Organisationseinheiten, Forschungsgebiete usw. stellen sich institutionsbedingt sehr unterschiedlich dar. Hier schließt sich das andere Prinzip, die Einteilung nach Organen bzw. Organsystemen an. Zusammenhänge der Physiologie bzw. der funktionellen Anatomie ist hier der Leitgedanke. Gleichzeitig sind funktionelle Systeme, wie z.B. Endokrinologie und Immunologie so eng verflochten, daß es hier noch ein übergeordnetes Prinzip für die Einteilung notwendig wäre. Das Beispiel „Neuro-psycho-endokrino-vegeto-immunologie” zeigt es: als „Staat im Staate” hat dieser Komplex eigene Gesetze und wirft Verständnisfragen auf. Das übergeornete Prinzip könnte also heißen: es handelt sich hier um ein Kommunikatiossystem der Supersysteme im Sinne von Straub (2006-2007) und Forschungsgruppe an der Universität Regensburg. Weitere komplexe Funktionen, die zwar grundsätzlich multiorgan-gebunden sind, wie Nahrungsaufnahme, Schlaf, Sexualität, Schwangerschaft, Schmerz, sind in Bezug auf die psychosomatische Praxis gut definierbar und zählen darin sogar zu den klassischen Gebieten. Einen hochwichtigen Themenkreis muß man hier noch ausführen, das Thema der komplexchronischen Erkrankungen. Hier sind praktisch alle Gebiete der praktischen Medizin 12 betroffen. Es gibt keine „offizielle Liste” dieser Erkrankungen, aber jeder Arzt kennt sie. Im Ansatz kennen die meisten Laien auch diese Krankheiten. Die gelten als unheilbar, im Verlauf sind sie chronisch und sehr wechselhaft, unberechenbar. Oft sind sie mit weiteren und vielfältigen Komplikationen assoziiert. Sie verursachen viel Leid, bedeuten hochen Behandlungsbedarf, führen zu starker Einschränkung der Lebensqualität und der Leistungsfähigkeit, oft stellen Todesursachen mit dar. Sie sind ein volkswirtschaftlicher Faktor, aus diesem Grund starteten z.B. die Krankassen in Deutschland ein Forschungsprojekt für die Handhabung bei einem Teil dieser Krankheiten (Diabetes, Hypertonie, Brustkrebs, Depression). In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zählten diese Krankheiten zu einer Form der psychosomatischen Erkrankungen, zu den sog. „Psychosomatosen”, d.h. zu den schweren Erkarankungen mit somatischen und psychischen Anteilen: Asthma bronchiale, essentielle Hypertonie, Ulkuskrankheiten, Rheuma, Ekzem, Diabetes, usw, (die sog. „sieben heiligen Krankheiten”nach Alexander, 1950). Auf Grund der Kritik an dieser Auffassung (Überpsychologisierung) verschwand das Thema. Heute sieht man in diesen Krankheiten eine multiaetiologische Veursachung, darin einen Stressfaktor, ebenso in der physiologischen und pathogenetischen Steuerung der entsprechenden Verlaufssprozesse. Mit dem Thema Stress kehrt die Bedeutung der Umweltfaktoren zurück, darin auch die neuro-psycho-immunoendokrinologischen Zusammenhänge. Der genetische Einfluß wird auch im Zusammenhang mit den umweltbezogenen, epigenetischen Erkenntnissen mit erklärt. Die Formulierungen über den Charakter dieser Einflüsse fallen in der Fachliteratur unterschiedlich aus: Ursachenwirkung, Auslöser, Verlauf modifizierend, psychoreaktiv auftretend auf die Krankheit. Patienten benutzen ähnliche Formulierungen. Ein Thema wird auf jeden Fall immer sichtbarer: emotionale Faktoren, gesteuert durch das limbische System und den präfrontalen Cortex nehmen Einfluß über Hypothalamus, Endokrin- und Immunsystem, Vegetativum auf diese Erkrankungen. Der Kennzeichnung dieses Sachverhaltes im Klinikum wäre genüge getan, wenn im ICD-System zu der somatischen Diagnose zusätzlich für die Kodierung der psycho-sozialen Einflüsse der Kode F54 hizugefügt würde. Die meisten Ärzte kennen nichtmal diese Kodierungsmölichkeit, dabei wäre es eigentlich eine dringende Notwendigkeit. In der Klassifizierung der Krankheiten sind die „offiziellen” Systeme in der Einhaltung der goforderten Kriterien (z.B. keine Aetiologie, nur Phänomenologie!) nicht konsequent genug, die sind auch umstritten und werden immer wieder fortgeschrieben, korrigiert. In der Anwendung dieser Systeme ist auch nicht gewollt, leichtere Störungen, die nicht „von Krankheitswert” sind, als Diagnosen mit hineinzunehmen, denn das würde Konsequenzen für die Finanzierung der Therapie nach sich ziehen. Gleichzeitg können diese Störungen in der Langzeitauswirkung doch weitreichende Folgen haben, (z.B. „Stress”, „Beziehungsstörungen”, usw.). Prävention wird wohl hier gezielt ausgeklammert – es ist mehr als problematisch! Die ausgeführten Problemstellungen führen zu der Frage der Kenntnisse der Fachleute über diese Grundsätze der Psychosomatik bzw. zu der Anerkennung der Wichtigkeit dieses Problemkomplexes für die Medizin. Ausgehend von der Komplexität der Zusammenhänge gelingt man zwangsläufig zu der Formulierung: jeder kann nur Halbwissen besizten, die 13 andere Hälfte kann durch Kooperation, Koordination und Kollegialität wirksam werden und zur Geltung gebracht werden. Die Lehrbücher der Psychosomatik, Psychotherapie und Psychiatrie, die dieses Thema behandeln, bieten sehr unterschiedliche und in der Regel eine mehrdimensionale und reduzierte Auswahl der Störungsbilder. Hier vermischen sich verschiedene Aspekte, wie: 1. Die Aufteilung nach medizinischen Fächern (z.B. Psychosomatik in der Dermatologie). 2. Die Art der Mechanismen der Entstehung von Krankheiten, z.B. bei den sog. Somatisierungsstörungen. Diese Diagnose stellt übrigens die größte Gruppe dar, einerseits weil es häufig ist, denn es kann alle Organe betreffen. Die Symptomatik ist wechselhaft, gleichzeitig mehrere Organe können diese Erscheinungen zeigen, die dem Patienten und dem Arzt viel „Kopfzerbrechen” bereiten können. Hier muß man auch die Konversion als Pathomechanismus erwähnen, bei dem die Funktionen des Nervensystems betroffen sind. In beiden Gruppen gilt die Störung „funktionell”, der Organ ist anatomisch „gesund”, die Krankheit ist „ärztlich nicht erklärbar”, nichts ist messbar. Diese letzte Auffassung ist übrigens heute vermutlich obsolet, denn die modernen Untersuchungsmöglichkeiten können schon organische, molekuläre, genetische Defekte und Veränderungen zeigen, die die Symptome mit verursachen. 3. Es erscheinen in der Aufzählung einfach Einzelkrankheiten (z.B. Hypertonie). 4. Eine Störungsgruppe wird mit Verhaltensaspekten des Patienten definiert (Eßstörungen, sexuelle Störungen, nicht organische Schlafstörungen). 5. Es gibt Beispiele einer gemischten Aufzählung z.B. in einem übergeordneten Kapitel „Klinik”. 6. Integrativ als gleichrangig aufgebaute Konzeption von psychosozialen und somatischen Komponenten bei bestimmten Störungsbildern, Beispiele sind dafür „Sexualmedizin”, „Schlafmedizin”. 7. Auf einzelne Organe bezogene Beschreibung, z.B. bei Herzerkrankungen die „Psychocardiologie”. 8. Auf somatische Therapieverfahren bezogene Kapitel (z.B. Psychosomatik in der Transplantationsmedizin). 9. Altersbezogene Psychosomatik ( Kinder-und Jugendliche, bzw. Alter) 10. Merkmale sozialer Bezogenheit (Sexualstraftäter) 11. Auf Steuerungsfunktionen (Straub und Forschungsgruppe, 2006-07) bezogene Psychosomatik: Psycho-neuro-endokrino-immunologie. Ein anderes Beispiel ist „Neuropsychosomatik” - nicht identisch mit neurologischer Psychosomatik! 12. Überlappung der somatisch-funktionellen Symptome mit überwiegend psychischer Krankheiten (Angst, Depression, Zwang – früher Neurosen genannt): die beiden Bereiche werden in der Regel ohne weitere Reflexion z.T. gemischt dargestellt. Hier überlappt sich das Thema auch mit dem Fachgebiet der Psychiatrie. Als Dilemma zeigt sich hier die Frage einer Schwerpunktsetzung im Versorgungssystem: welche Einrichtungen und welche Fachleue sich mit welchen Krankheiten befassen. Früher fasste man diese Überlappungen als „kleine Psychiatrie” zusammen, es ist der Bereich 14 der nicht-psychotischen, nicht schweren mentalen Störungen. Diese werden in der Regel nicht in „gemischten” Einrichtungen oder Praxen versorgt. Es ist auch eine Art Streitfrage unter den Fachgebieten Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Hauptcharakteristikum der Psychosomatik dabei ist die grundsätzliche Verflächtung mit der somatischen Medizin, und in erster Linie mit der hausärztlichen Grundversorgung. 13. Psychosomatische bzw. psychiatrische Psychotherapie unterscheiden sich ebenfalls den Krankheitsbildern entsprechend und beide finden im geteiltem Rahmen statt. Die Überlappungbereiche einerseits, und die relative Selbstständigkeit dieser Fächer ist ein Zankapfel, der in Deutschland durch die Verselbstständugung der Psychsomatik in dem Sinne kaum mehr existiert. Die umfassendste Darstellung der psychosomatischen Krankeitsbildern, strukturiert nach medizinischen Fächern, findet sich bei Klußmann und Nickel (Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, 2009), es werden etwa 200 Diagnosen beschrieben, die einen psychosomatischen Anteil haben. Die Aufzählung differenziert nich zwischen Somatisierung bzw. organisch mitbegründeten komplex-chronischen Erkrankungen („Psychosomatosen”). Die schulische Auffassung des Buches orientiert sich weitgehend an der Tiefenpsychologie. Eine systematische Darstellung der psychosozialen Faktoren findet sich im DSM-IV (Diagnostische Kriterien des Diagnostischen Manuals Psychischer Störungen DSM-IV, American Psychiatric Association, 1994, Deutsche Bearbeitung H. Saß, H.-U. Wittchen, M. Zaudig, I. Houben, Hogräfe, 1998). Die Liste dieser Problembereiche sei hier aus DSM IV abgekürzt nach Hauptkategorien dargestellt. Die Einbeziehung dieser Themen in die alltägliche medizinische Praxis ist ein Hauptanliegen der psychosomatischen Denkweise. Die DSM IV erweist sich damit als sehr hilfreich, um das Anliegen der bio-psycho-sozialen Medizin auf einfacher Weise zu verwirklichen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Probleme mit der Hauptbezugsgruppe (Familie, Partnerschaft) Probleme im sozialen Umfeld Ausbildungsprobleme Berufliche Probleme Wohnungsprobleme Wirtschtliche Probleme Probleme beim Zugang zur Krankenversorgung Probleme im Umgang mit dem Rechtssystem Andere psychosoziale und Umgebugsbedingte Probleme. Ganz ähnlich stellt sich die Lage bei der ICD-Kategorisierung dar: Psychosoziale und umgebeungsbedingte Probleme, die man in der ICD-Kategorisierung zu den somatischen Diagnosen ebenfalls als zweiten Kode hinfügen kann, bekommen den Kode F54psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren. 15 Das bio-psycho-soziale Modell der Medizin Den Grundgedanken diese Konzeptes formulierte G.L.Engel: The need for a new medical model: a challenge for biomedicine (Science,1977; 196:129-136). Er fordert die radikale Änderung des medizinischen Denkens und der Praxis. Ausschließliche biologische Medizin kann garnicht sein, da der Mensch auch nach psycho-sozialen Gesetzen existiert. Die Ebene der Molekularbiologie setzt er auf eine Ebene mit dem System der Psyche und der Gesellschaft. Dies bedeutet auch, daß das medizinische Versorgungssystem ebenso nach diesen Gesetzen funktioniert und den Heilungsvorgang mitprägt: das Fachpersonal, die Institutionen, die Behandlungen, die Wirtschaftsfaktoren, das soziale Umfeld des Patienten, die Systeme der Bildung, die Kultur, die Gesundheitspolitik. Novack, D.H. at all. (2007) skizziert in einem hervorragenden Artikel die praktische Umsetzung dieser Vorstellung: Psychosomatic medicine: The scientific Foundation of the Biopsychosocial Model. Academic Psychatriy, 31:5, 388-401, Sept.-oct. 2007. Kapfhammer, H.-P.(2010) aus Graz, betont, daß…”eine kategoriale Unterscheidung in sog. „psychosomatische Erkrankungen” und „nichpsychosomatische Erkrankungen” ist als obsolet anzusehen…”. (Seite 1284, Bd. 2. in: Psychiatrie, Psychosomatik Psychotherapie, Hrsg. Möller, Laux, Kapfhammer, Springer, 4. Aufl.2010, 2 Bd. 2906 Seiten). Er beschreibt gleichzeitig die Psychosomatik etwa in 300 Seiten ausführlich und plädiert für eine einheitliche Betrachtung. In dieser Betrachungsweise formulierte Uexküll bzw. seine psychosomatische Schule die Grundsätze der „integrativen Medizin”: Psychosomatische Medizin. Modelle ärztlichen Denkens und Handels. Hrsg. Thure von Uexküll uns Mitarbeiter. Urban-Fischer, 6. Auflage, 2003. 1564 Seiten. Integrative Medizin bedeutet hier: die Psychosomatik als bio-psychosoziales Geschehen ist in der gesamten Medizin vorhanden, die Aufgabe ist es, sie tatsächlich zu integrieren. Die relatíve Selbsständigkeit der Psychosomatik als Fach löst ein dringendes Versorgungsproblem, und ist nicht etwas, was in ihren Grundsätzen von der Psychiatrie oder in der Psychotherapie abhebt. Die 3 Themebereiche zeigen Überlappungen, aber auch eigene grundlegende Spezifika in der Praxis. 16 1.Psychosomatik und chronische Erkrankungen Thomas Schuh und Jannik Robin Kijevsky 1. Bedeutung der Psychosomatik in der Krankheitsentstehung Der Prozess der Entstehung einer chronischen Krankheit steht in einem bio-psycho-sozialen Zusammenhang. Soma und Psyche sind als Einheit zu verstehen, die sich gegenseitig beeinflussen. Folglich haben Ärzte die Möglichkeit den Prozess der Entstehung und den Verlauf einer chr. Krankheit an mehreren Punkten zu beeinflussen. Ein zentrales Element der ärztlichen Hilfestellungen ist die Präsentation von Krankheitsverarbeitungsmodellen. Es gilt einer zusätzlichen psychischen Erkrankung wie Depression vorzubeugen da diese den weiteren Krankheitsverlauf negativ beeinflusst sowie die objektive und subjektive Lebensqualität des Patienten signifikant verschlechtern. Als weitere Komplikation tritt häufig eine verringerte Compliance auf. 2. Psychische Ursachen und somatische Erkrankung Depressionen sind ein starker Multiplikator für somatische Erkrankungen. Auszuschliessen gilt es Nebenwirkungen von Arzneimitteln (IFN) oder Krankheitserregern (HCV) die auf das Nervensystem wirken können und somit Depressionen oder depressive Episoden verursachen. Krankheiten werden von betroffenen als massiver Einschnitt in das bisherige Leben, das Selbstwertgefühl und dem Bedürfnis nach Selbstkontrolle wahrgenommen. Aus der LifeEvent-Forschung ist hervorgegangen dass zum Beispiel Patienten die Armut erfahren eine geringere Lebenserwartung haben. Patienten in psychosozialen Belastungssituationen sind anfälliger für Asthma bronchiale. Weiter ergab diese Forschung, dass Kinder aus niedrigeren sozialen Schichten schwerwiegendere Asthmaanfälle haben als vergleichbare Kinder. Ähnliche Ergebnisse gibt es für den Verlauf von Autoimmunerkrankungen wie MS oder rheumatoide Arthritis. Auch ein Zusammenhang zwischen psychischen Traumata in den ersten Lebensjahren wie Scheidung, Tod eines Elternteils, Gewalt gegen die Mutter und der Entstehung von Diabetes mellitus, ist durch Studien bestätigt worden. Wer einen Herzinfarkt erleidet und infolgedessen depressiv wird hat ein hohes Risiko einen weiteren Herzinfarkt zu erleiden, der dann mit hoher Wahrscheinlichkeit tödlich ausgeht. Hatte ein Patient einen Herzinfarkt und entwickelt eine Depression hat er ein 17-fach höheres Risiko an Diabetes Melitus zu erkranken, was Mortalitätsrate 4,9fach erhöht. 17 Chronische negative Affekte und sozialer Druck durch eine somatische Erkrankung hervorgerufen führen verstärkt zu Depressionen, welche ihrerseits die Prognose und die Risikofaktoren somatischer Erkrankungen verschlechtern. Psychische Traumata haben denselben Effekt. 3. Immun und Stresssystem als Mediatoren zwischen Psyche und Soma Dauerhafte Stresssituationen und traumatische Belastungen führen zu psycho-neuroimmunologischen Wechselwirkungen. Effektoren sind: Die HPA-Achse, die zu einem Anstieg des Cortisolspiegels führt und das vegetative Nervensystem, was zu verstärkter Katecholamin Ausschüttung führt. Gemeinsam bewirken sie eine Dysregulation der zellulären und humoralen Immunantwort weiterhin haben sie metabolische Auswirkungen wie zum Beispiel Insulinresistenz. Entzündungesprozesse führen zu einem erhöhten pro-inflamatorischen Zytokinspiegel wie TNF alpha. Durch chronische Belastungen sinkt der Cortisonwert wodurch die hemmende Wirkung auf pro-inflamatorische Zytokine wegfällt, es kommt also zu Entzündungen. 4. Beispiel Chronische Virus Hepatitis Im folgenden soll das Zusammenspiel der verschiedenen Faktoren der Genese einer chronischen Krankheit veranschaulicht werden. Patienten mit einer Virus-Hepatitis werden mit Symptomen wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit und Leistungsverlust beim Arzt vorstellig. Diese Symptome sind auch in Depressionen anzutreffen. Es ist also leicht möglich dass der Patient neben der Virus-Hepatitis eine Depression entwickelt. Im Gehirn werden serotonerge Synapsen erregt was auf eine Tätigkeit des Viruses auch im Gehirn nahe legt. Neben diesen somatischen Beschwerden sind auch psychosoziale Faktoren an der Genese der Depression beteiligt. Frühkindliche Belastungen und negative Bindungserfarhungen führen zu einer verminderten Immunabwehr was der Ausbreitung des Virus fördert. Die frühkindlichen Erfahrungen können zu einem riskanten Lebensstil führen was die Expositionswahrscheinlichkeit erhöht. Durch die Diagnose der Krankheit stigmatisieren sich die Patienten und grenzen sich sozial ab weil sie sich selber sexuelle Ausschweifungen, Drogenabusus oder Untreue vorwerfen. Dies resultiert in einem verheimlichenden Verhalten um nicht in Erklärungsnöte zu kommen. Vor allem in Partnerschaften wo auch das Thema Übertragung medizinisch relevant ist kann das 18 zu Problemen führen. Das Resultat ist dass die Lebensqualität der Patienten stärker beeinträchtigt ist als die anderer chronisch Erkrankter. Gibt man dem Patienten Medikamente die die Depression verstärken können (z.B. IFN) kann die Compliance des Patienten sich verschlechtern und Medikamente werden nicht mehr wie verordnet eingenommen. Es gilt also dem vor Depressionen zu schützen und gegeben falls dagegen zu intervenieren. Weiters muss er vor der Einnahme von Depression verstärkenden Medikamenten auf die verstärkende Wirkung hingewiesen werden. Mehr Beratung und Aufklärung führen zu einem zufriedeneren und potentiell gesünderen Patienten der folglich auch den Arzt weniger häufig aufsuchen muss bei gleichem oder gesteigertem Therapieerfolg. 5. Bewältigung chronischer Krankheiten 5.1 Individuelle Bewältigungsstrategien Das zentrale Problem, welches dem Patienten gegenüber steht, ist ein Einschnitt in sein bisheriges Leben: sein Leben so wie er oder sie es gewöhnt war,ist nun vorbei, etwaige schmerzhafte Zeiten stehen dem Erkrankten in Aussicht. Der Einschnitt bedeutet somit zweierlei: Zum einen muss der Patient Abschied von seinem einstigen Leben nehmen, also einen Schlußstrich ziehen und zum anderen muss er sich auf die neuen Gegebenheiten einstellen, die die Erkrankung sicherlich mit sich bringen wird, hier befindet er sich also noch ganz am Anfang. Dieser Dualismus einer Handlung oder Sache ist, wie ich finde, eines der zentralen Paradigmen einer Erkrankung bzw. der Medizin im allgemeinen, viellecht sogar des Lebens! Nicht nur die Krankheit selbst, als gemeinsamer Schaden von Soma und Psyche folgt diesem Dualismus sondern auch deren (Differenzial-)Diagnose, bei der (meist) wieder zwischen 2 Eventualitäten differenziert werden muss. Im nun folgenden Text sollen einige Möglichkeiten gezeigt werden, wie unser Patient besser mit seiner Krankheit umgehen kann, ohne seinem „alten Leben“ nachzutrauern. 5.1.1 Einen Schlußstrich ziehen Viele chronische Erkrankungen gehen mit Enschränkungen einher. Das kann sich auf vielerlei Aktivitäten des persönlichen Lebens auswirken, wie zum Beispiel bei einem Läufer, der seinen Sport nun komplett aufhören muss aufgrund von chronischen Gelenkbeschwerden. Zuerst muss sich der Leidtragende klar machen, dass die neue Situation so „ist wie sie ist“ 19 und es wird sich in absehbarer Zeit auch nichts daran ändern. Mit anderen Worten: Er muss seine Krankkeit mit all ihren Folgen akzeptieren. Wie kann man nun als Arzt hier helfen? Ganz einfach: Man stellt (geeignete) Alternativen in Aussicht, hilft seinem Patienten dabei seine Krankheit nicht als Einschränkung sonder als Herausforderung oder als Chance anzusehen. Natürlich lässt sich das nicht von heute auf morgen bewerkstelligen. Es braucht viel Zeit und Geduld sowie jede Menge neuer Ideen um dem Patienten eine optimale Anpassung an sein „neues Schicksaal“ zu ermöglichen. Um insbesondere Frustation präventiv entgegen zu wirken, sollten die neuen Ziele nicht zu hoch gesteckt werden. 5.1.2 Auf „zu neuen Ufern“ Zur Kolonialzeit segelten viele Matrosen und Kapitäne zu meist ins Ungewisse; Kolumbus wollte einen neuen Seeweg nach Indien ausprobieren und fand Amerika. Auf seinem Weg hatte er mit zahlreichen Problemen zu kämpfen: Eine meuternde Mannschaft (=soziales Umfeld), Unter-bzw.Mangelernährung (= eine nicht anschlagende Therapie) und natürlich war Poseidon’s Wut in der Form von Seestürmen unverkennbar (=Erkrankung). Trotz dieser Widrigkeiten segelte er weiter, mit einem klaren Ziel vor Augen. Nun mag dies sicherlich Auslegungssache sein bzw. reichlich Diskussionsstoff liefern, aber viele (alle?) Menschen benötigen ein Ziel in ihrem Leben, für das es sich lohnt zu arbeiten. Jeder Mensch möchte einem (seinem?) gewissen Zeck dienlich sein. Hauptaufgabe des Arztes ist es gemeinsam mit dem Patienten ein neues Ziel zu erarbeiten, was nicht notwendigerweise vom alten Ziel abweichen muss! 5.2 Frühe Bindungserfahrungen 5.2.1 Kindliche Traumata Erfahrungen aus unserer Kindheit, wie wir seit Freud wissen, prägen uns unserer Leben lang. In welchen Ausmaß ist nicht nur individuell unterschiedlich, sondern wird auch kollektiv beeinflußt. Besonders wichtig ist hier die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Kann der Patient überhaupt verstehen in welcher Lage er sich jetzt befindet? Wenn ja, besitzt er dann die Fähigkeit zur Selbstfürsorge? Negiert der Patient diese Fragen, sei es unbewusst oder bewusst, besteht die Gefahr des autoagressiven Verhaltens, was dem Heilungsprozess sicherlich nicht förderlich ist. Hier verlangt also die Heilung einer chronischen Erkankung eine interdisziplinäre Herangehensweise: Um eventuell vorhandene jetztige, akut vorhandene 20 Bewältigungsprobleme mit der gegenwärtigen Situation, die ursächlich auf erlebte Kindheitstraumata zurückzuführen sind, erfolgreich zu therapieren, ist die zusätzliche Konsultation eines Psychologen oder Pyschotherapeuten von Nöten. 5.2.2 Das soziokulturelle Umfeld Hier gilt es besonders zu achten auf: ursrüngliche Herkunft (Migranten!) Religion Lebensweise (Vegan etc.) Geschlecht Alter gesellschaftliche „Klasse“ oder Schicht An einem Beispiel kann man die Wichtigkeit der oben genannten Faktoren erläutern. A.I.D.S. ist eine sogenannte Pandemie der heutigen Zeit, die Übertragung dieser schweren chronischen Erkrankung ist meist auf sexuellen Kontakte mit infizierten Personen zurückzuführen. Wie aber geht eine streng gläubige Familie damit um, wenn ihre Tochter an AIDS leidet? Welchen sozialen Status hat die Krankheit im kulturellen Umfeld? Und noch viel wichtiger: Kann der Betroffene sein Leid überhaupt seinen Eltern oder nächste Verwandten offenbaren ohne von diesen aus der „Sippe“ verstoßen zu werden? Auf diese Fragen gilt es zu achten, ansonsten wird der Arzt seinen Patienten höchstwahrscheinlich vergebens behandeln. Denn insbesondere bei schweren chronischen Erkrankungen bedarf es ausgiebiger Unterstützung von Seiten der Famile. 21 2. Essstörungen Valentin Hooijer und Thomas Kustra Anorexia nervosa Definition: Als Anorexia nervosa wird ein extremes, selbstherbei geführtes Untergewicht bezeichnet. Nach ICD-10 Klassifikation muss das Körpergewicht mindesten 15% unter dem zu erwartendem Körpergewicht liegen (Alters-, Geschlecht- und Körpergrößenabhängig), oder ein BMI unter 17,5 kg/m² vorliegen. Die Gewichtsabnahme wird durch eine stark kalorienreduzierte Diät erreicht. Häufig kommt es bei den Patienten, wenn sie die Diät nicht einhalten, zu Ekelgefühlen und deswegen zur Selbstbestrafung. Beispielsweise kann es nach Heißhungerattacken zu erzwungenen Erbrechen kommen, um diese Gefühle zu mindern. Als weitere Gründe für das Untergewicht kommen in Frage: übertriebene körperliche Aktivität, Laxanzien-Missbrauch, Verwendung von Appetitzüglern und Diuretika. Die Patienten haben trotz des offensichtlichen Untergewichts eine verzerrte Wahrnehmung ihres eigenen Körpers. Viele fühlen sich immer noch zu dick oder haben Angst vor dem Dick werden. Durch eine striktere Einhaltung ihres Kalorienplans versuchen sie diesen Ängsten oder Gefühlen auszuweichen. Psychische Auffälligkeiten der Patienten sind Depressionen, Ängste und Zwangssymptome. Eine gestörte Wahrnehmung der eigenen Figur und ihres Körpergewichts ist typisch. Das eigene Körpergewicht nimmt eine zentrale Stellung in dem Alltag der Betroffenen ein. Selbstbewertung und Selbstvertrauen hängen von dem Körpergewicht ab. Außerdem ist bei den Patienten charakteristischer Weise eine Leugnung, des häufig schon gefährlichen Untergewichts, anzutreffen. Epidemiologie: In Deutschland sind etwa 0,3% der Bevölkerung, vor allem junge Erwachsene im Alter zwischen 15 bis 25 Jahren betroffen. Dabei ist die Anorexia nervosa bei Frauen 20mal häufiger als bei Männern. Äetiologie Folgende Gründe werden als Auslöser der Anorexie diskutiert: Hereditäre Prädisposition: In Zwillingsstudien wurde eine familiäre Häufung der Krankheit festgestellt. Einfluss der Familienstruktur: Die meisten Anorexie Patienten kommen typischerweise aus wohlbehüteten, kleinbürgerlichen Familien. Dabei lassen die Eltern den Kindern wenig Raum für Selbstentscheidungen und Selbstständigkeit. Deswegen kommt es vor allem mit Beginn der Pubertät bei den Kindern zu Autonomie-Bestrebungen. Diese wird dann durch die Kontrolle und Selbstbestimmung über das eigene Körpergewicht erreicht. In manchen Fällen ist auch sexueller Missbrauch innerhalb der Familien als Auslöser der Erkrankung möglich. 22 Soziokulturelle: In den Westlichen Nationen wird ein Schönheitsideal vertreten, dass besonderen Wert auf das Schlanksein und Aussehen legt und damit verbunden ist beruflicher und sozialer Erfolg. Dieses Schönheits- und Schlankheitsideal wird vor allem durch die Medien transportiert. Besonders Frauen versuchen diesem zu entsprechen, weil sie mehr als Männer, von der Gesellschaft gezwungen werden Schlank zu sein. Durch ständiges Vergleichen der eigenen Körperfigur mit der von Anderen, aber auch durch Kritik, durch Eltern oder der Peergroups, kann es zu einer gestörten Wahrnehmung des Körpers kommen. Auf der anderen Seite sind Lob und Anerkennung, z.B. nach erfolgreichen Diäten, positive Verstärker für das Selbstvertrauen. Das heißt, dass das Selbstwertgefühl vom Aussehen, dem Körpergewicht und dem Feedback der Gesellschaft abhängig gemacht wird. Lerntheoretische: Wie bereits oben angedeutet, wird bei Essgestörten Patient das Körpergewicht mit dem Selbstwertgefühl verknüpft. Die betroffenen Personen können durch individuelle Maßnahmen, z.B. durch Essensverweigerung oder selbsterzwungenes Erbrechen, ihr eigenes Gewicht kontrollieren. Ihr schlankes Äußeres wird dann von der Gesellschaft durch positives Feedback belohnt. Individuelle: Die Pubertät oder Adoleszenz ist bei den jungen Erwachsenen mit dem Streben nach Autonomie verbunden. Manche erfahren diese Autonomie durch die Manipulation ihres Körpergewichts. Bei anderen Patienten stellt die Bestimmung über das Körpergewicht ein Ventil für nicht verarbeitete Konflikte dar, z.B. bei Problemen in zwischenmenschlichen Beziehungen, bei Depressionen, sexuellen Konflikten usw. Komorbidität a) Psychische Komorbidität: Anorexia nervosa Patienten zeigen häufig Anzeichen einer Depression, Persönlichkeitsstörungen, z.B. die oben bereits genannte Körperschemastörung, bei der sich die Patienten, obwohl sie bereits krankhaft Abgemagert sind, sich immer noch zu dick fühlen. Außerdem kann die Erkrankung mit Angststörungen oder Suchterkrankungen assoziiert sein. b) Somatische Komorbidität: Störungen des Elektrolythaushalts durch selbstinduziertes Erbrechen, Laxanzien- und Diuretika-Abusus. Eine schwerwiegende Folge ist die entstehende Hypokaliaemie mit daraus resultierenden Herzrhythmusstörungen. 23 Störungen des Hormonhaushalts: Bei Frauen kommt es zu Östrogen-, LH-, FSH- Mangel. Dadurch kommt es zum Ausbleiben des Brustwachstums, zur Amenorrhö und Unfruchtbarkeit. Bei Männern kommt es durch den Mangel an Sexualhormonen zur Impotenz und Verlust der Libido. Herz: Die Herzaktivität ist bei Anorexie Patienten reduziert. Z.B. kommt es zur Verlangsamung des Herzschlags, folglich entsteht eine Hypotonie. Elektrolytstörungen führen zu Herzrhythmusstörungen, die in einem plötzlichen Herztod resultieren können. Verdauungsorganergane: Es können Darmträgheit, mit chronischer Obstipation, Magenkrämpfe, Übelkeit auftreten Niereninsuffizienz kann entstehen Knochen: Der Östrogenmangel führt zur Osteoporose mit gehäuft auftretenden Knochenbrüchen. Bulimia nervosa Definition: Bulimia nervosa ist eine Essstörung, die durch Heißhungerattacken mit übertriebener Nahrungsaufnahme und Kontrollverlust gekennzeichnet ist. Die Betroffenen reagieren auf diese Affekthandlungen mit gewichtsreduzierenden Maßnahmen, meist mit Erbrechen. Aber auch Laxanzien- oder Diuretika-Abusus, Diäten und übertriebene körperliche Aktivität kommen vor. Die eigene Figur und das eigene Körpergewicht stehen im Mittelpunkt der Gedanken des Patienten. Außerdem findet sich eine ständige Angst dick zu werden oder nicht dem Schönheitsideal der Gesellschaft zu entsprechen. Eine frühere Phase mit Anorexia nervosa ist möglich. Beide Krankheiten, Bulimie und Anorexie können ineinander übergehen. Meist sind Bulimie-Patienten normal gewichtig, Unter- oder Übergewicht kann aber auch vorkommen. 24 Epidemiologie: Etwas unter 1 % der Bevölkerung, v.a. Mädchen und junge Frauen im Alter von 15 bis 35 Jahren sind betroffen. Die Erstmanifestation der Krankheit häuft sich um das 17. Lebensjahr und tritt damit etwas später als die Anorexia nervosa auf. Betroffen sind vor allem Personen deren Aussehen und geringes Körpergewicht wichtig für ihren Beruf ist. Z.B. Models, Tänzer, Skispringer. Ein gleichzeitiges Auftreten von Bulimie und Persönlichkeitsstörungen findet sich in etwa 20% der Fälle. Ätiologie und Pathogenese Wie bei der Anorexie stehen im Hintergrund der Erkrankung, Persönlichkeitsstörungen, z.B. die schon erwähnte Körperschemastörung, Ängste, die zentrale Rolle des eigenen Aussehens und des Körpergewichts und häufig auch ein niedriges Selbstwertgefühl. Dabei hängt das Selbstbewusstsein von der Bestätigung der Gesellschaft ab. Die Bestätigung erfahren die Betroffenen wenn sie mit ihrem Körpergewicht dem propagierten Schönheitsideal entsprechen. Ein Unterschied zur Anorexie ist der Mangel an Triebkontrolle und der Kontrollverlust bei den Heißhungerattacken. Diese resultieren in Schamgefühle und Ekel. Ein Ventil für die Minderung der Gefühle stellt das auf die Fressattacken folgende Erbrechen dar. Komorbidität a) Psychatrische und soziale Probleme Missbrauch von Alkohol, Drogen und Medikamenten autoaggressives Verhalten mangelnde Selbstkontrolle, nicht nur in Bezug auf das Essverhalten, sondern auch unkontrolliertes Mode-und Konsumverhalten Depressionen, diffuse und phobische Ängste, Minderwertigkeitsgefühle, sexuelle Konflikte b) somatische Probleme 25 Folgen des häufigen Erbrechens sind: wegen der aggressiven Magensäure kommt es zur Zerstörung des Zahnschmelzes, zur akuten Ösophagitis und Gastritis Elektrolytstörungen, v.a. Hypokaliämie, die zu Herzrhythmusstörungen und plötzlichem Herztod führen können. Die Störungen des Elektrolyt-Haushalts können außerdem noch eine Niereninsuffizienz auslösen. metabolische Alkalose Magenwand und Speiseröhrenruptur, wegen dem entstehenden hohen Druck beim Erbrechen Entzündungen der Speicheldrüsen. Labordiagnostisch ist dann eine Hyperamylasämie feststellbar. Binge eating Definition Bei der Binge-Eating-Störung handelt es sich um eine psychisch bedingte Essstörung, bei der es zu periodischen Heißhungeranfällen mit Verlust der bewussten Kontrolle über das Essverhalten kommt. Charakteristisch ist, dass anders als bei der Bulimie das Konsumierte nicht im Anschluss erbrochen wird, wodurch hierbei längerfristig meist Übergewicht die Konsequenz ist. Bislang wurde die BES noch nicht als eigenständige Diagnose zugelassen. Im ICD-10 wird die BES deshalb unter „Nicht näher bezeichnete Essstörung“ (F50.9) klassifiziert. Diese Definition der Essstörung war längere Zeit umstritten, doch die Kriterien werden von Ernährungswissenschaftlern und Medizinern jedoch zunehmend akzeptiert und die Behandlungsbedürftigkeit dieser Störung wird auch in Europa mittlerweile überwiegend anerkannt. Die Behandlung entspricht größtenteils der Behandlung der Bulimie. 26 Epidemiologie Zur Häufigkeit der Binge Eating-Disorder gibt es unterschiedliche Angaben, welche meist auf Schätzungen beruhen. Ungefähr 2-5% der Allgemeinbevölkerung sind von einer BES betroffen. In Deutschland wird die Anzahl zwischen 800.000 und 2,4 Millionen Menschen geschätzt, und ist somit höher als die Zahl der Bulimiker. Typischerweise manifestiert sie sich zwischen dem 20. und 35. Lebensjahr. Bei der BES kann im Alter zwischen 45 und 54 Jahren auch eine zweite Häufung der Erstmanifestation statistisch nachgewiesen werden. Frauen leiden 1,5-mal häufiger an dieser Essstörung. Ein großer Teil der Binge Eater ist übergewichtig, allerdings leidet umgekehrt nur etwa ein Drittel der Adipositas-Patienten an Heißhungerattacken. Besonders übergewichtige Personen erkranken mit einer Prävalenz von 4-9% deutlich häufiger. Die meisten Übergewichtigen nehmen jedoch kontinuierlich mehr Kalorien auf als sie verbrauchen, nicht anfallsweise. Die an BES Leidenden lassen sich darüber hinaus in zwei Gruppen unterteilen: 1.) Die diet-first-Gruppe führt vor ihrer ersten Fressattacke eine Diät durch und weist im Durchschnittsalter von 26 Jahren eine erste Essattacke auf. 2.) Bei der binge-first-Gruppe werden Personen beschrieben, welche einen Essanfall erleben, bevor sie je eine Diäterfahrung gemacht haben. Sie zeigen das Störungsbild bereits im Alter von 12 Jahren. Ätiologie Die Ätiologie der BES ist größtenteils noch ungeklärt. Es wird von einem Zusammenhang zwischen biologischen, persönlichkeitsbezogenen und soziokulturellen Faktoren ausgegangen. Es lässt sich eine Verbindung zwischen den depressiven Verstimmungen, den psychosozialen Belastungen, der Häufigkeit der Essanfälle, dem Schweregrad der Adipositas mit dem Therapieerfolg nachweisen. Daher gelten als prädisponierende Faktoren eine Adipositas und psychische Störungen begünstigend für die Entwicklung und Aufrechterhaltung einer BES. Diagnose und Symptome Die diagnostischen Kriterien für Binge Eating wurden in den 1990er Jahren von der American Psychiatric Association (APA) aufgestellt: 27 mindestens zwei Essanfälle pro Woche über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten Kontrollverlust während der Nahrungsaufnahme mit Verlust des Sättigungsgefühls sehr hohe Kalorienzufuhr bei einem Essanfall extrem hastiges Essen („schlingen“) Essen bis zu einem starken Völlegefühl der Essanfall wird nicht durch starken Hunger ausgelöst nach dem Essanfall treten Schuld- und Schamgefühle auf, teilweise bis zur Depression die Betroffenen leiden unter den Essanfällen Die Essanfälle gehen nicht mit dem Einsatz von unangemessenen kompensatorischen Verhaltensweisen einher, wie: Fasten Medikamentöser Missbrauch (Laxanzien oder Diuretika) Exzessives Sporttreiben Sie treten ebenfalls nicht ausschließlich auf im Verlauf von: Anorexia nervosa Bulimia nervosa Anders als die Bulimiker oder Magersüchtigen ergreifen Binge Eater nach dem Essen keine Maßnahmen wie Erbrechen oder exzessives sportliches Training, um eine Gewichtszunahme durch die überhöhte Kalorienzufuhr zu verhindern. Ähnlich wie Bulimiker verschweigen Binge Eater in der Regel anderen ihr gestörtes Essverhalten. Befragungen von Betroffenen legen den Schluss nahe, dass die überwiegend durch negative Gefühle, Stress oder Langeweile ausgelöst werden. Psychologen gehen davon aus, dass unangenehme Empfindungen während des Essvorgangs unterdrückt werden. Daher handelt es sich bei Binge Eating um eine Form von Vermeidungsverhalten. Wie auch bei anderen Essstörungen gibt es zur Entstehung und Funktion dieses Essverhaltens jedoch unterschiedliche Theorien. In der Ernährungspsychologie gibt es die Theorie, dass so genanntes „gezügeltes Essverhalten“ ein Risikofaktor für das Entstehen von Essstörungen ist, vor allem für Bulimie und Binge Eating. Therapie In der Therapie wird eine Normalisierung des Essverhaltens angestrebt, wobei auch die auslösenden psychischen Probleme behandelt werden. Ziel ist in erster Linie das Zurückerlangen der Kontrolle über das Essverlagnen. Unterstützend kann eine Therapie mit Antidepressiva wie SSRI Reduktion der Frequenz eingesetzt werden. 28 zur Esssucht Adipositas ist als die sozialmedizinisch bedeutsamste Form der Essstörung anzusehen. Man diagnostiziert sie ab einem Body-Mass-Index von über 30. Es wird davon ausgegangen, dass etwa jeder 3. erwachsene Bundesbürger deutlich übergewichtig ist und aus medizinischen Gründen Gewicht abnehmen sollte. Dies hat zur Folge, dass 5 – 10 % der Krankheitskosten in Deutschland und anderen Industrieländern der Adipositas bzw. ihren Folgeerkrankungen zuzurechnen sind. Traditionell wird die Adipositas jedoch nicht als (primär) psychische Störung angesehen, obwohl sowohl eine Vielzahl von ursächlichen Faktoren als auch Folgeproblemen psychiatrische Relevanz haben. Auch in den modernen psychiatrischen Klassifikationssystemen wird das Übergewicht nicht als eigenständige Störung klassifiziert. Es gibt aber ernst zu nehmende Hinweise darauf, dass der psychische Prozess, der das Entstehen von Adipositas begünstigt, dem psychischen Prozess bei den typischen Essstörungen, also der Anorexie und der Bulimie, zumindest ähnlich ist. Betroffene der sogenannten Ess-Sucht leiden unter den ständigen Gedanken an Essen. Es besteht eine Art "psychische Abhängigkeit" von Nahrung. Die betroffenen Menschen haben die Kontrolle über ihr Eßverhalten verloren und sind durch die sie überkommenden Eßanfälle sowie den Jojo-Effekt von Schnell-Diäten meist leicht bis stark übergewichtig - ein Zustand, unter dem sie stark leiden. Diese Störung betrifft alle Altersgruppen und beide Geschlechter. Auch hier finden sich in der Regel psychosoziale Missstände in familiärem Umfeld, Beziehung, Beruf oder ähnlichem. Therapeutisch haben sich vor allem systemische (familientherapeutische), verhaltenstherapeutische, gestalttherapeutische und psychoanalytische Verfahren bewährt, und zwar in Form von Gruppen- oder Einzeltherapien. 29 3. Psychoonkologie Antonia Ramisch und Gözde Polat Psychoonkologie (aus Psychologie und Onkologie) befasst sich mit der psychologischen Betreuung von Patienten die an Krebs leiden. Folgende Themen werden hier behandelt: 1. 2. 3. 4. Die „Krebspersönlichkeit” Die Diagnose Krebs Der Patient als Familienmitglied Probleme in der Arzt-Patienten-Beziehung 1.Die Krebspersönlichkeit 1.1. Typus C (cancer-prone) nach Lydia Temoshok In den 1970er-Jahren begann zunächst man mit der Untersuchung von psychosozialen Faktoren, die für die Entstehung einer Krebserkrankungen mitverantwortlich sein sollten (Psychoimmunologie). Die amerikanische Virologin Lydia Temoshok entwickelte in den achtziger Jahren ein mögliches Modell: den Typus C (cancer-prone). Dieses Modell baute sich auf möglichen krebsdisponierenden psychologischen Persönlichkeitsmerkmalen auf. Nach Temoshok wies eine Krebspersönlcihkeit, ein Typ C Mensch also, folgende Eigenschaften vor: emotional eingeschlossener Typus Tendenz zu Hilf- und Hoffnungslosigkeit kooperativ, geduldig, rational Alexitymie und Unfähigkeit, Ärger auszudrücken Darunter fällt auch u.a. auch die Hypothese der depressiven Persönlichkeit. Viele dieser Eigenschaften beschreiben den Umgang mit Stresssituationen. Typ C zeigt sich hier öfters überfordert und kommt nicht so gut zu recht. Die Auswirkungen seien dann neuro-endokrine Faktoren (spezifische Hormonlage und damit beeinflusste Immunabwehr), die die Krebsabwehr erschwerten. Mittlerweile verwirft die Wissenschaft das Konstrukt der „Krebspersönlichkeit“ weitgehend. 30 Andererseits ist jedoch bekannt, dass unsere Psyche die Lebensgewohnheiten beeinflusst und daher auch unsere Bereitschaft zu krebsförderndem oder -hemmendem Verhalten. Ein Mensch, der sich leicht „aufregt“ raucht und trinkt (bekannter krebsfördernder Faktor) vielleicht mehr. Ein solcher Lebensstil kann durchaus zur Tumorentstehung beitragen und natürlich den Krankheitsverlauf beeinflussen. Klar ist auch, dass negative Erfahrungen sich auf die Lebensweise auswirken können. Die Betroffenen sind ohne Antriebbewgen sich weniger, die Ernährung ändert sich und sie gehen generell unbewusst schlechter mit ihrem Körper und ihrer Gesundheit um. So ein verhalten kann sich auch wieder auf die Krebserkrankung auswirken. Dennoch ist man der Meinung das die Krebserkrankung einen multifaktoriellen Entstehungsmechanismus hat. Und somit ist eine depressive Persönlichkeit nicht die Ursache einer Krebserkrankung. Diese Betrachtungsweise wäre monokausal und zu einfach. „Fazit : Psychische Faktoren haben auf die Entstehung von Krankheit einen Einfluss, aber ein Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsstruktur und der Entstehung einer Krebserkrankung ist nicht belegt.“1 Bei vielen Menschen ist dieser Glaube an die Krebspersönlichkeit aber noch tief verwurzelt und im Alltagsdenken erfreut sich dieses Konzept noch immer einer recht großen Popularität. „40% der Australier glauben, dass Stress Krebs auslöse, und 38% der Kanadierinnen glauben, dass Stress die Ursache von Brustkrebs sei. “2 Für viele Krebspatienten in der Hinsicht auch die Alternativmedizin und andere Konzepte in der Therapie eine große Rolle. 1.2. Folgen einer Krebserkrankung Seit den 1990er Jahren beschäftigt sich die Psychoonkologie vor allem mit der schweren psychischen Belastungen, die nach der Diagnose Krebs den Patienten erwarten. „Einige Autoren gehen davon aus, dass bei etwa einem Drittel aller Krebspatienten infolge der schweren psychischen Belastung durch die Grundkrankheit auch eine psychische Störung im Sinne einer Komorbidität (Begleiterkrannkung einer Grunderkrannkung) auftritt.“3 2. Die Diagnose Krebs „Viele Patienten erleben die Diagnose Krebs zunächst als einen Sturz aus der Wirklichkeit. Plötzlich wirkt es, als stünde man neben sich und die Konfrontation mit der Erkrankung fühlt sich an wie ein Alptraum, aus dem man am liebsten wieder aufwachen möchte. Das Vertrauen in das eigene Leben und den eigenen Körper werden erschüttert. Gefühle wie Verständnisund Hilfslosigkeit dominieren die Gefühlswelt ebenso wie Wut, Verzweiflung und Angst. 1 http://www.sonnenberg-klinik.de/krebspersoenlichkeit.html Drs. Sicco Henk van der Mei, Leiter der Abteilung für Psychoonkologie, Psychologe und Psychotherapeut, Bewegungswissenschaftler (Medizin), Physiotherapeut 2 http://www.psiram.com/ge/index.php/Krebspers%C3%B6nlichkeit 3 http://de.wikipedia.org/wiki/Psychoonkologie 31 „Krebs“ – trotz stetig verbesserter Therapiemöglichkeiten und guter Heilungschancen für bestimmte Erkrankungen steht das Wort noch immer als Synonym für Schmerzen, lange Behandlungsphasen oder sogar für das Lebensende. Es ist völlig normal, dass man diese Diagnose zunächst nicht wahrhaben möchte und ein gesunder Mechanismus der Seele, sich zu schützen und zunächst zu verdrängen. Einige Betroffene stellen das ganze Leben auf den Prüfstand und hinterfragen Dinge, die sonst als gegeben hingenommen werden. In vielen Fällen steht die Frage nach dem „Warum?“ im Mittelpunkt. Diese kann jedoch niemand beantworten. Wichtiger ist es, das „Warum?“ in ein „Wozu?“ umzuwandeln. „Wozu ist die Krankheit vielleicht hilfreich? Wozu kann sie genutzt werden?"“4 Diagnose Schock, Chaos, Absturz Abwehr Rückzug, Betäubung Angst, Derpression, Wut, Ärger Auseinandersetzung Durcharbeiten relativer Abschluss Abb. 1.5 Es ist wichtig, dass sowohl Ärzte und Pflegepersonal, als auch Angehörige sich bewusst sind darüber, das die meisten Krebspatienten nicht an einer primären psychischen Krankheit leiden, sondern das es sich bei Ärger, Depression, Angst und Wut um eine psychische Reaktion auf die Diagnose Krebs handelt. Die Patienten haben zum Beispiel oft Angst (Meerwein 1991): vor sozialer Isolation, vor verstümmelnden chirurgischen Eingriffen, vor Verlust von Autonomie und Lebensqualität, vor Neid und Eifersucht auf die Gesunden, vor Schmerz, vor Rückfall und Unheilbarkeit. 2.1.Die Diagnosemitteilung Bei der Diagnosemitteilung gelten die allgemeinen Regeln: Die Informationen in der Sprache des Patienten weidergeben, eine thematische Gliederung durchziehen, und sich rückverscihern, ob der Patient den Inhalt auch verstanden hat. 4 http://www.vivantes.de/krebserkrankungen/fuer-patienten-und-angehoerige/diagnose-krebs-wie-geht-esweiter/leben-mit-der-diagnose/umgang-mit-der-diagnose-krebs/ 5 Grob Übernommen von Psychosomatische Grundversorgung; Fritzsche, Geigges, Richter & Wirsching 32 Als Arzt sollte man sich für so ein Gespräch genügend vorbereitetet haben und sich auch ein Zeitfenster lassen. Es muss für eine ruhige Gesprächsatmosphäre gesorgt werden (in einem separaten Raum, ohne Störung). Im Gespäch sollte man immer Hoffnung offen lassen, jedoch keine Illusionen nähren. 2.2.Krankheitsverarbeitung-coping Unter Coping versteht man jedes Verhalten des Patienten , um eine krankheitsbedingte Belastung zu überwinden. Man unterscheidet zwischen bewussten und unbewussten Copingstrategien (Abwehrmechanismen) Zu den bewussten Copingstrategien gehört etwa die Verarbeitung durch Handlungen, z.B. zupacken, sich ablenken. Die Verleugnung ist die wichtigste Abwehrform. Sie ist ein Mechanismus bei der die Erkrankung und die dadurch resultierenden Folgen ausgeblendet werden. Durch diese Verleugnung kann der Patient eine sonst nicht erträgliche Situation erträglich machen. „Verleugnung kann übermäßige Angst, Hoffnungslosigkeit, Depression, und auch regressives Verhalten reduzieren und zurückdrängen.“6 Weitere Abwehrmechanismen: Projektion, kontraphobische Abwehr, Rationalisierung und Verschiebung, Verkehrung ins Gegenteil, Verleugnung und Projektion im rahmen der Partnerschaft. Verarbeitungsstrategien die sich im Bezug auf Lebensqualität und Überlebenszeit als günstig erwiesen haben: aktives, problemorientiertes Coping kämpferische Einstellung gegenüber der Krankheit aktive Verleugnung soziale Unterstützung ungünstig erwiesen haben: Unterdrückung von Gefühlen sozialer Rückzug, Isolation passive Hinnahme, Resignation, Grübeln Depression, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit Abb. 2. 7 3. Probleme in der Arzt Patienten Beziehung Ärztinnen und Ärzte sind in der Behandlung krebskranker Patienten einer starken psychischen und emotionalen Belastung ausgesetzt. Für den Patienten ist der Arzt sowohl eine kompetente Fachperson, als auch ein wichtiger Ansprechpartner im Laufe seines Krankheitsprozesses. Deshalb ist es sehr wichtig, das zwischen Arzt und Patient ein gegenseitiges Vertrauen herrscht, in dem der Patient seine Sorgen, Bedenken und Fragen jederzeit äussern kann. 6 7 Psychosomatische Grundversorgung; Fritzsche, Geigges, Richter & Wirsching Psychosomatische Grundversorgung; Fritzsche, Geigges, Richter & Wirsching 33 Jedoch kann es aus der Sicht des Arztes zu Abgrenzungsproblemen kommen. Durch die ständige Konfrontation mit Krebskranken kann der Arzt sich durch das Leid des Patienten emotional betroffen fühlen, z. B. im Rahmen des Aufklärungsgespräches oder aufgrund eines langen Krankheitsprozesses. Identifikation und Mitgefühl ist im Arztberuf zwar unerlässlich, aber kann auch zu Schwierigkeiten führen, wenn die Trennung zwischen beruflicher Haltung und persönlicher Betroffenheit nicht mehr funktioniert. Dies ist vor allem bei Patienten der Fall, die uns an unsere eigene Familie und Freunde erinnern und mit denen man vielleicht die selben Interessen hat und einen engen Kontakt aufbaut, wodurch die emotionale Distanzierung sehr schwierig wird. Es ist beispielsweise eine Herausforderung einer Mutter von kleinen Kindern die Diagnose Krebs mitzuteilen wenn man selbst Mutter ist und Kinder hat. Es ist auch sehr wichtig, die Gefühle nicht zu verleugnen, sondern zuzulassen und die Gefühle des Patienten von den eigenen unterscheiden zu können, und sie nicht auf sich zu übertragen. Wenn dies nicht funktioniert, dann kommt es zu Abwehrmechanismen wie zum Beispiel die Vermeidung eines Gesprächs oder kürzere Verweildauer am Krankenbett. Weitere Belastungen die bei Ärzten auftreten können sind das Gefühl der Hilflosigkeit gegenüber unheilbar Kranken, sowie der Tod mehrerer Patienten, was zu Schuldgefühlen und zur Enttäuschung des professionellen Selbstbildes führen kann. Im Rahmen der psychosomatischen Fortbildung kann der Arzt mit der Zeit sowohl eine emotionale Nähe als auch eine notwendige Distanz gegenüber dem Patienten erlernen und aufrechterhalten. Der Arzt kann sich aber auch in Umgang mit den Patienten überfordert fühlen, wenn diese beispielsweise verschlossen, anklammernd oder weinerlich sind. Dies kann beim Arzt Resignation, Rückzug, aber auch Aggression auslösen und die weitere Zusammenarbeit schwer beeinträchtigen. Der Arzt muss sich aber in den Patienten hineinversetzen können, denn für den Patienten ist es eine komplett neue Lebenssituation, und das Ungewisse was nun jetzt mit ihm passieren wird angsteinflößend. Es ist wichtig, dass sich der Erkrankte bei seinem Arzt wohlfühlt und ihm vertrauen kann. Der Arzt muss in der Lage sein, sich auf den Patienten einzustellen, so dass er sich verstanden fühlt. Dadurch wird er sich nicht einsam und isoliert fühlen und wird nach dem ersten Gespräch schon sichtlich erleichtert sein. Es sollte eine Atmosphäre geschaffen werden, indem der Patient seine Gedanken und Gefühle ohne Scham mitteilen kann. 34 4. Der Patient als Familienmitglied Wenn jemand in der Familie an Krebs erkrankt, stellt dies nicht nur eine grosse Belastung für den Betroffenen dar, sondern auch für sein Umfeld. Die gesamte Lebensplanung der Familie wird aus der Bahn geworfen und häufig kommt es auch zu einer Störung der Partner- und Familiensituation. Es ist eine Diagnose die zweifelsohne Angst macht, die von Trauer, Einsamkeit und Hilflosigkeit begleitet wird. Nicht nur für den Betroffenen selbst, sondern auch für die Familie. Die Angehörigen wissen oftmals nicht wie sie mit der Situation umgehen sollen und sind überfordert und unsicher im Umgang mit dem Krebspatienten. Sie stehen plötzlich vor der Situation, neben Berufstätigkeit, Familie und gesellschaftlichem Leben auch die Krankheit eines geliebten Menschen bewältigen zu müssen. Deshalb ist es wichtig, das sich die Familie über die Krankheit und die Behandlungsmöglichkeiten informiert um so die Angst vor einer veränderten Lebenssituation zu vermindern. Anfangs fällt es den Angehörigen oft schwer ihre Sorgen und Ängste zu vermitteln, da sie den Betroffenen nicht noch mehr unnötig belasten wollen. Aber es ist wichtig, von Anfang an ehrlich, offen und vertrauensvoll miteinander zu sein um eine positive Atmosphäre zu schaffen. Oft werden die eigenen Probleme verglichen mit dem des Kranken als herabstufend gesehen und nicht mitgeteilt. Aber der Erkrankte möchte nicht die ganze zeit bemitleidet werden sondern eine Normalität erleben. Er braucht zwar das Gefühl Hilfe und Unterstützung zu bekommen, aber er möchte nicht das man sich ununterbrochen mit seiner Krankheit beschäftigt und ihn bemitleidet. Es ist wichtig, das der Krebskranke positive Gedanken bekommt und nicht die Hoffnung verliert die Krankheit zu besiegen. Wenn aber Angehörige mit der ganzen Situation überfordert sind und nur noch darüber reden wie schlimm alles sei und bei jeder gegebenen Gelegenheit anfangen zu weinen, wird das den Erkrankten nicht ermutigen zu kämpfen, sondern wird ihn darin bestätigen, dass alles hoffnungslos ist. Die Krankheit darf aber auch nicht völlig ignoriert werden, indem so getan wird, dass alles in Ordnung sei und alles so wie früher wird. Dies kann nämlich dazu führen, das sich der Patient nicht ernst genommen fühlt. Der Krebs stellt häufig auch eine Bedrohung der Partnerschaft dar. Auch hier muss zunächst ein Weg geschaffen werden, um über Ängste und Sorgen reden zu können. 35 Nicht nur der Erkrankte hat Angst, sondern auch der Partner hat Angst um den anderen und Angst davor was auf ihn zukommen wird, ob er überhaupt der Situation gewachsen ist. Viele Partnerschaften zerbrechen leider an dieser Belastung, aber einige wiederum finden noch mehr zu einander und bekräftigen und unterstützen sich gegenseitig. Quellen Psychosomatische Grundversorgung; Fritzsche, Geigges, Richter & Wirsching http://www.sonnenberg-klinik.de/krebspersoenlichkeit.html Drs. Sicco Henk van der Mei, Leiter der Abteilung für Psychoonkologie, Psychologe und Psychotherapeut, Bewegungswissenschaftler (Medizin), Physiotherapeut http://www.psiram.com/ge/index.php/Krebspers%C3%B6nlichkeit http://de.wikipedia.org/wiki/Psychoonkologie http://www.vivantes.de/krebserkrankungen/fuer-patienten-und-angehoerige/diagnose-krebs-wie-gehtes-weiter/leben-mit-der-diagnose/umgang-mit-der-diagnose-krebs/ 36 4. Frauenheilkunde in der psychosomatischen Medizin Miriam Füger Psychosomatische Erkrankungen in der Frauenheilkunde manifestieren sich an den weiblichen Geschlechtsorganen, die mit Sexualität, Reproduktion und weiblicher Identifikation assoziiert sind. Durch physische, psychische und sozialen Veränderungen in geschlechtsspezifischen Lebensphasen wie Pubertät, Schwangerschaft, Wochenbett oder Klimakterium können sich psychosomatische Krankheitsbilder entwickeln. Hier werden 2 Beispiele aus dem Bereich kurz dargestellt. Klimakterium Klimakterium ist hauptsächlich durch den Begriff Wechseljahre bekannt und wird als ein „kritischer Zeitpunkt im Leben“ bezeichnet. Dieser Begriff umfasst einen über mehrere Jahre andauernden Prozess von der Fruchtbarkeit der Frau bis zum Versiegen der ovariellen Hormonproduktion und somit zur definitiven biologischen Infertilität. Dieser natürliche Prozess findet meist zwischen dem 45. und 55. Lebensjahr statt. Gekennzeichnet ist das Klimakterium durch Veränderungen im Hormonhaushalt und einen Abfall des Östrogen- und Progesteronspiegels, welche mit Zyklusstörungen einhergehen und eine charakteristische Symptomatik hervorrufen. Im Zentrum der Wechseljahre einer Frau steht die Menopause, welche der letzte natürlich auftretenden Regelblutung im Zyklus einer Frau entspricht. Die Zeitspanne der Wechseljahre in denen die Veränderungen im Zyklus auftreten ist die Prämenopause. Die Postmenopause entspricht dem Zeitpunkt nach einem Jahr der letzten Regelblutung. Häufig auftretende vasmotorische Beschwerden des Klimakteriums sind Hitzewallungen, Schweißausbrüche, verstärkte sowie abgeschwächte Blutungen, Schlafstörungen, Schwindel und Kopfschmerzen. Eine weitere spezifische Symptomatik wie Haarausfall, innere 37 Unruhezustände, Atemnot, Schlafstörungen, Kribbeln, Konzentrationsstörungen, Gelenkbeschwerden, Müdigkeit, Knochenschmerzen, Muskelschmerzen kann dominieren. Im weiteren Verlauf Herzklopfen, Harninkontinenz und kann der Östrogenmangel die Entstehung von Spätfolgen wie Osteoporose und kardiovaskuläre Erkrankungen begünstigen. Der Östrogenmangel bedingt außerdem eine Reihe von genitalen Veränderungen wie Scheidentrockenheit und die Atrophie der Scheidenhaut. Somit kann das Klimakterium auch die Sexualität der Frau beeinflussen. Häufig kommt es zu Schmerzen während dem Geschlechtsverkehr (Dyspareunie) und einem abnehmendem sexuellen Interesse (Libidoreduktion), welches die Beziehung zum Partner erheblich beeinflussen und emotional sehr belastend für die Frau sein kann. Das Klimakterium kann ebenso Auswirkungen auf die Stimmungen haben. Viele Frauen unterliegen depressiven Verstimmungen, Antriebslosigkeit, Stimmungsschwankungen, plötzlich eintretende Weinkrämpfe und Niedergeschlagenheit. Häufig zeigt sich in dieser Phase ein eingeschränktes Selbstwertgefühl, viele Frauen sind von Angstgefühlen geplagt und es werden gesteigerte Irritabilität und Nervosität beobachtet. Zusätzlich kann die Symptomatik von äußeren Lebensumständen wie berufliche Erfolge, soziale Beziehungen, Auszug der Kinder oder die eigene Pensionierung maßgeblich beeinflusst werden. Pelvipathie-Syndrom Das Pelvipathie-Syndrom, auch chronisches Beckenschmerzsyndrom, chronic pelvic pain syndrom (CPPS) oder Pelvipathie nervosa, vegetativa genannt sind chronische oder rezidivierende Unterbauchschmerzen bei Frauen, welche über einen Zeitraum von bis zu 6 Monaten anhaltend auftreten und unabhängig von Zyklus oder Geschlechtsverkehr sind. Meist sind Frauen im Alter zwischen 25. und 40. Lebensjahr am häufigsten betroffen. Die Schmerzen können bis in die Leistenregion ausstrahlen und treten neben Bauch- und Beckenbodensymptomatik häufig in Kombination mit Dysmenorrhoe, Kopfschmerzen, urogenitalen Beschwerden (Pollakisurie, Schmerzen beim Wasserlassen, Reizblase), anale Beschwerden (Juckreiz, Krämpfe und Schmerzen bei der Darmentleerung), prämenstruelle Schmerzen, nicht-organischer Flour vaginales, Juckreiz in der Vaginalgegend und Depressionen. Es gibt verschiedene Ursachen, die in Frage kommen. Somatisch bedingt treten 38 am häufisten Endometriose, Myoma und Adhäsionen auf. Häufiger kann das PelvipathieSyndrom jedoch durch psychische Auslöser hervortreten. Beispiele dafür sind sexuelle Störungen, unbewältigte Konflikte in der Partnerschaft, einem vorgefallenen Missbrauch, traumatische Ereignisse in der Kindheit oder eine ausgeprägten Persönlichkeitsstörung. Durch den erhöhten psychischen Druck kann es bei wiederholtem Erleben des Konfliktes zu einer Anspannung des Unterleibs kommen und dauerhafte Schmerzen auslösen. Dadurch wird die Lebensqualität der Betroffenen erheblich einschränkt. Literatur: Neises, M., Ditz, S., Spranz-Fogasy, T., Hrsg. (2005) Psychosomatische Gesprächsführung in der Frauenheilkunde. Ein interdisziplinärer Ansatz zur verbalen Intervention. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart Klußmann Nickel (2009) : Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Springer Wien New York, S. 455. 39 5. Psychosomatik in der Schwangerschaft Ulrike Ihle Eine gesunde Schwangerschaft und die darauf folgende Geburt ist wohl eines der schönsten Erlebnisse eines jeden Paares. Kommt es in dieser erwartungsfrohen Zeit zu Komplikationen, ist dies mit schweren psychischen Belastungen verbunden. Bei der Verarbeitung der vielen möglichen Komplikationen spielt die Psychosomatik eine wesentliche Rolle. Der kommende Abschnitt beschäftigt sich mit den am häufigsten auftretenden Problemen und deren Bewältigung. Hyperemis gravidarum 8 Dieses Syndrom ist die übersteigerte Form der Emis gravidarum, der bekannten Morgenübelkeit, zum Beginn der Schwangerschaft. Betroffen sind vor allem Erstgebärende und Frauen mit Mehrlingsgeburten. Es kommt zum mehrmaligen täglichen Erbrechen, welches verschiedene Symptome zur Folge hat wie: - Trockene Zunge , Durstgefühl und gerötete Schleimhäute als Zeichen der Dehydration, sowie - Stoffwechselstörungen, wie Hypoglykämie und fruchtartiger Mundgeruch. Für den Fetus besteht die Gefahr der Mangelernährung und Elektrolytstörungen. Dies stellt natürlich neben den klinischen Folgen auch eine hohe psychische Belastung für beide werdende Elternteile dar. Meist ist eine stationäre Aufnahme mit Flüssigkeitsbilanzierung und parenteraler Ernährung unabdingbar. Auch die fürsorgliche Zuwendung von Geburtshelfer und Partner sind wichtig bei der Therapie, um eine Befriedigende Symbiose zwischen Mutter und Kind zu gewährleisten. Habitueller Abort 8 9 http://flexikon.doccheck.com/de/Emesis_gravidarum, 03.05.2014 Klußmann Nickel: Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. SpringerWienNewYork, 2009,S.455 40 Unter habituellen Abort versteht man das aufeinanderfolgen von drei oder mehr spontanen Fehlgeburten. Grundsätzlich kann man die allgemeine Abortrate mit 20% ansetzen. Die Ursachen können vielfältig sein. Möglichkeiten welche man in Betracht ziehen kann sind: - Antiphospholipid Syndrom - Diabetes mellitus der Mutter - Blutgruppenunverträglichkeit - Thrombophilie - Genetische Ursachen ( Chromosomenaberrationen) - Chronische Infektionen Auch psychische Faktoren können hierbei eine Rolle spielen. Dazu gehören Stress oder Trennung und ambivalente Einstellung zum Fetus, gerade bei jungen Müttern, welche sich der bevorstehenden Aufgabe nicht gewachsen fühlen. Es macht natürlich einen Unterschied, ob der Abort am Anfang der Schwangerschaft, oder in der 35. Schwangerschaftswoche vonstatten geht. Grundsätzlich sollte man jedoch beide Traumata nicht unterschätzen. Vor allem dank den heutigen technischen Möglichkeiten findet die „Personifizierung des Embryos“ viel früher statt als noch vor 20 Jahren. Dadurch entwickeln Frauen schon viel eher eine intensive Bindung zum erwarteten Kind, welche durch den Abort ein abruptes Ende nimmt. Versagensund Schuldgefühle bis hin zu Kränkung des positiven Selbstwertes sind die Folge. Offene Gespräche und eine gute soziale Unterstützung sind wichtig bei der Bewältigung des Traumas. Auch der Partner sollte mit einbezogen werden, da auch er Trauer erlebt. Ärzte und Pflegepersonal sind dazu angehalten, den Betroffenen die Zeit zum trauern einzuräumen. Angst-Spasmus-Syndrom 10 Die Angst vor Wehen vor allem bei Erstgebärenden oder bei Frauen mit negativen Geburtserlebnis kann zu einem Angst-Spasmus-Syndrom führen. 9 http://flexikon.doccheck.com/de/Habitueller_Abort Klußmann Nickel: Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. SpringerWienNewYork, 2009,S.456 10 Klußmann Nickel: Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. SpringerWienNewYork, 2009,S.457 41 Dies führt bei der Geburt zu einem Regelkreis. Mit den einsetzenden Wehen kommt es zur Verkrampfung psychischer, vegetativer und muskulärer Art. Dadurch steigt die Überempfindlichkeit und der Wiederstand gegen die zervikale Öffnung, was folglich zu einem stärkeren Schmerz und daraus resultierender Furcht und noch größerer Verkrampfung führt. Das Ergebnis ist eine verlängerte Geburt und folgendes negatives Geburtserlebnis. Um dieses Problem zu vermeiden ist ein besonders einfühlender Umgang seitens des Pflegepersonals zu empfehlen. Während der Arzt Akzente der Sicherheit setzt besteht vor allem die Aufgabe der Hebamme in der Zuwendung und Beruhigung der gebärenden Mütter. Die Anwesenheit des Partners als Vertraute Bezugsperson gewinnt an immer größerer Bedeutung bei der Verarbeitung der Wehen. Weiterhin wird durch frühes Anlegen des Neugeborenen der sofortige Kontakt zwischen Mutter und Kind gefördert, wodurch das Erlebnis der Geburt viel schneller verarbeitet wird. Schwangerschaftsabbruch 11 Es gibt vielerlei Gründe einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen. Rechtlich erlaubt ist er ohne medizinische Indikation bis Ende der 12. Schwangerschaftswoche, wobei in Deutschland eine ärztliche Beratung Voraussetzung dafür ist. Ein Abbruch ist immer eine schwierige Entscheidung. Die psychische Belastung ist vor dem Eingriff meist am größten, aber auch danach leiden Frauen unter Reue und Traurigkeit. Es gibt verschiedene Methoden mit dieser schmerzlichen Erfahrung umzugehen, wobei dem Umfeld auch eine große Bedeutung zukommt. Eine Art ist die Verleumdung, in der die Betroffenen versuchen die Gedanken an die Abtreibung zu verdrängen und sich abzulenken. Auch die Schuld auf andere zu schieben stellt eine Möglichkeit dar, um sich von Schuldgefühlen zu befreien. Eine weitere Methode ist die Konfrontation und ständige Rekapitulierung des Geschehenen zur schnelleren Verarbeitung und Stärkung des Ichs. 11 http://www.svss-uspda.ch/de/facts/psychisch.htm Klußmann Nickel: Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. SpringerWienNewYork, 42 2009,S.458 Je nach Grund der Abtreibung und in welchem Trimenon diese stattgefunden hat, kann es auch zu Spätfolgen wie Angst und Depression kommen. Vor allem Frauen, welche auf Grund fötaler Missbildungen in einem späteren Trimester den Abbruch vornehmen, zeigen ähnliche psychologische Reaktionen, wie Frauen mit Tot - oder Fehlgeburt. Diese Situationen bedeuten die Notwendigkeit einer Schwangerschaftskonfliktberatung oder einer geeigneten Therapie dar. 43 6. Psychosomatik in der Kinder- und Jugendheilkunde Olivia Levin In der Kinder- und Jugendheilkunde ist das Thema Psychosomatik besonders wichtig. Kinder reagieren auf emotionale Schwierigkeiten sehr oft mit Organbeschwerden und daher ist es wichtig schon die ersten Zeichen einer Erkrankung zu entdecken, um weitere Folgen zu verhindern. Grundstein für die gesunde Entwicklung eines Kindes ist die Mutter-Kind-Beziehung. Da die Bindung schon als Säugling beginnt, wird das Kind auch durch die Körpersprache und die Gefühle der Mutter beeinflusst. In der Kinderheilkunde gibt es sehr viele Psychosomatische Störungen, ich werde hier auf die sieben wichtigsten Eingehen. 1. Kopfschmerz Es gibt organische (z. B. Hirntumor), vaskuläre und psychogen bedingte Kopfschmerzen. Um eine Diagnose zu stellen, ist in erster Linie eine exakte Anamnese erforderlich. Hierbei gilt es zuerst die Qualität des Kopfschmerzes zu erkennen und zu analysieren. Dadurch kann dann zwischen organischen und psychischen Ursachen unterschieden und die entsprechende Behandlung eingeleitet werden. Die unterschiedlichen Stellen des Kopfschmerzen, verraten viel über die Ursache des Schmerzens: Wie zum Beispiel Schmerzen an der/den… - …Schläfe beidseits, sprechen für Spannungsschmerz - …Stirn steht für Flüssigkeitsmangel - …einseitiger Schmerz sprich für Migräne - …Hinterkopf ist das Zeichen für Überlastung oder Verspannung Die Ursachen können sehr unterschiedlich sein und reichen von Schulangst, über Überforderung, über „Zickenkriege“ unter Freundinnen bis hin zu familiären Problemen. Der Leistungsdruck kann einerseits von der Schule andererseits von den Eltern ausgeübt werden. Die Kinder können dann so belastet sein, dass es ihnen gar nicht mehr gelingt, sich zu entspannen, sie vermeiden Treffen und können nicht mehr kindgerecht spielen. Sehr wichtig ist es dabei in der Anamnese zu erfragen, wann der Kopfschmerz am stärksten ist und ob vor Auftreten der Schmerzen wesentliche Änderung im Leben des Kindes passierten. 44 Bei der Therapie ist es auch sehr wichtig, dass in erster Linie zur Behebung der Ursachen, auch Gespräche und Zuwendung durch Bezugspersonen unterstütz werden. 2.Bauchschmerz Um bei einem Kind herauszufinden, ob es sich um einen organischen oder psychosomatischen Bauchschmerz handelt, ist das Erfragen der Umstände sehr wichtig, dabei ist es sehr hilfreich verschiedene Schmerzqualitäten , wie Pochen, Stechen, Drücken anzuführen und Herauszufinden welche Position oder Handlung am ehesten Erleichterung bringt. Kinder mit organischen Bauchschmerzen zeigen meist Beschwerden, wie Blässe, Schweiß, einen geblähten Bauch und lokale Schmerzen, sie wollen sich hinlegen , sind appetitlos und sind wortkarg. Kinder mit psychosomatischen Problemen neigen oft dazu, theatralisch zu berichten und zu zeigen, „wann es wo-wie“ wehtut, es kommt beim Hinlegen zu keiner wesentlichen Besserung, der Schmerze wird oft abends beim Zubettgehen wieder sehr stark, je nachdem welche Probleme vorliegen. Wenn man die Kinder auffordert zu springen und sie dann schnell fragt wo es „weh tut“, wissen sie es nicht. Mögliche Ursachen von funktionellen Bauchschmerzen: 1. Sexueller Missbrauch: Bei Sexuellen Missbrauch ist der Schmerz meist um den Nabel lokalisiert. Eine Unterbauchuntersuchung ist nicht möglich, die Kinder wehren sich heftig, halten die Hose fest und erzählen über schlimme Träume. 2. Mangelnde Zuwendung: Die Kinder wissen, dass sich bei Bauchschmerzen die Mutter – oder die vertraute Bezugsperson - zu ihnen setzt, den Bauch massiert und etwas Besonderes kocht – es bekommt Einzelzuwendung und fühlt sich ernst genommen. 3. Bettnässen /Enuresis Definition: unwillkürliches Urinieren nach dem 3. / 4. Lebensjahr, ohne dass eine körperliche Ursache vorliegt. Bettnässen ist ab dem 5. Lebensjahr ein Krankheitszeichen, tritt bei Jungen doppelt so häufig auf wie bei Mädchen und ist sehr oft familiär. Es handlt sich dabei um eine Reifungsverzögerung der Blasenfunktion. Die Hauptproblematik liegt am Druck, der auf die Kinder ausgeübt wird, denn 80% der Kinder werden bis zum 7. Lebensjahr ohnehin trocken. Es gibt zwei Formen des Bettnässens: 1. Enuresis nocturna prima: Bettnässen kommt immer vor und ist situationsunabhängig, das Kind war nachts nie sauber. 45 2. Enuresis nocturna secundaria: Bettnässen kommt nur in speziellen Situationen vor z. B. Belastung, das Kind war schon einmal trocken. Spätestens mit fünf Jahren soll eine organische Untersuchung mit genauer Anamnese und Ultraschaluntersuchung der Nieren durchgeführt werden. Das Bettnässen zeigt meist Schwierigkeiten in der Familie auf. Es gibt verschiedene Verhaltensweisen von Enuresiskindern: 1. den ängstlichen, unsicheren leistungsbemühten, 2. den phlegmatischen und 3. den überkompensierten forschen Typ. Direkt beim Einnässen empfindet das Kind zuerst ein angenehmes Empfinden von Wärme durch den warmen Urin, jedoch unbewusst ist es ein aggressiver Akt gegen eine Bezugsperson, sehr oft die Mutter. 4.Enkopresis/Einkoten Definition: unbemerkter, unwillkürlicher Kotabgang. Im Hintergrund steht häufig die unbewusste Verknüpfung der Defäkation mit der Vorstellung, etwas Eigenes herzugeben, also ein „Loslassproblem“ Meist entwickelt sich die Problematik durch Verstopfung, die Kinder haben dann Schmerzen beim Stuhlen und halten zurück, wodurch es zu einer Erweiterung des Rektums kommt. In der Folge gewöhnt sich das Kind an das Gefühl des vollen Enddarms und verliert das Gefühl für die Stuhlregulierung. Da der Stuhl zulange im Rektum ist, entstehen Stuhlsteine, der flüssige Stuhl rinnt an den Stuhlsteinen vorbei und es kommt zum sogenannten „Stuhlschmieren“. Die Therapie ist sehr schwierig weil es meist schon organische Veränderungen gibt, daher ist es ganz wichtig schon beim ersten Auftreten von erschwertem Stuhlgang geeignete Maßnahmen zu treffen. 5. Erbrechen Das Erbrechen eines Kindes kann einerseits organische Ursachen haben (z. B. Pylorusstenose, Infekte, Hirndruck) andererseits situationsbedingt sein. Es ist sehr wichtig durch genaues Befragen zu erfahren, wann und wodurch das Erbrechen ausgelöst wurde. 46 Sehr oft liegt die Ursache in Bestehungsängsten oder generelle Angst vor Situationen. Häufig kommt es auch durch zu hohe Anforderungen, die das Kind nicht bewältigen kann. Es gibt verschiedene Arten von Erbrechen Habituelles Erbrechen: es kommt häufig bei Säuglingen vor Rezidivierendes Erbrechen: meist bei Kleinkindern. Es tritt episodisch auf und kann für mehrere Tage anhalten. - Morgendliches Erbrechen: Es kommt bei Schulkindern vor, die meist unter schulischer Belastung oder Angst leiden. Meist ist es eine Ereigniskoppelung zwischen eines Sinnesreizes und Erlebnissen. - 6. Schreikinder Definition: - Säuglinge, die an unstillbaren, dauerhaften Schrei- und Unruheattacken leiden oder - Säuglinge, die bis zu 10 Stunden pro Tag schreien und sich durch trinken und Liebkosungen nicht beruhigen lassen Die Ursache ist oft eine Interaktionsstörung zwischen Mutter und Kind. Es können aber auch generell Probleme in der Familie sein (Geschwister, Vater, Großeltern, usw.) Wodurch kann die Interaktionsstörung ausgelöst werden? 1. Dramatische Geburt 2. Ängstlich Mutter: die Mutter hat Angst, dass sie etwas falsch macht und überträgt die Angst an den Säugling 3. Ungewünschte Kinder Therapie Oft ist es wichtig eine Mutter-Kind-Videoaufnahme zu machen und diese der Mutter zu zeigen und ihr dadurch aufzuzeigen, was sie verbessern kann. Dadurch wird das Selbstvertrauen der Mutter gestärkt und die Angst, etwas falsch zumachen gelindert. Oftmals wird auch eine externe beratende Fachperson für einen Tag in die Familie gebracht. Sie beobachtet den Familienalltag und gibt bei dem nächsten Gespräch der Familie Tipps und Ratschläge wie sie die Situationen verbessern konnten. 7. Asthma bronchiale Definition: chronische, entzündliche Erkrankung der Atemwege, die durch bronchiale Hyperreaktivität und eine variable Atemwegsobstruktion gekennzeichnet ist. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass neben rein körpermedizinischen Anteilen auch die psychosoziale Komponente eine wichtige Rolle spielt. 47 Es gibt mehrere Ursachen für Asthma bronchiale: Allergische, entzündliche und genetische sowie psycho-soziale Ursachen. Es handelt sich um eine schubweise auftretende Erkrankung. Im symptomfreien Zeitraum ist die Lungenfunktion des Asthmatikers so gut wie normal. Psychologische Einflussfaktoren spielen bei fast allen Formen eine wichtige Rolle. Asthma mit ausschließlich psychologischen Auslösefaktoren ist ebenfalls bekannt. Die Asthmatherapie gliedert sich in eine hochdifferenzierte internistische Komponente und eine ebenso bedeutsame psychotherapeutische Komponente. Es werden háufig Selbstständigkeits-/Abhängigkeitskonflikte beobachtet. Die Problematik kreist in der Regel um eine ungelöste ambivalente Mutterbindung. Verschiedene Theorien (z. B. von Alexander) vermuten einen tiefen Wunsch des Asthmapatienten nach beschützt werden. Sowohl die zurückweisende Mutterbindungen in der Kindheit, als auch die überbeschützende und einengende Mutter sind in der Literatur wiederholt beschrieben worden. Beide Extreme der für Kinder sehr bedeutenden Mutterbeziehungen können als Ambivalenzkonflikt eine hohe innere Anspannung erzeugen, aus dem Wunsch sich ganz anzuvertrauen bei gleichzeitiger großer Angst verschlungen zu werden. Quellenangabe: http://www.schreikinder.com/ http://flexikon.doccheck.com/de/Asthma_bronchiale http://www.onmeda.de/krankheiten/asthma.html http://www.netdoktor.at/krankheit/enuresis-nocturna-7858 http://www.kinderarzt.at/de/lexikon/subject/einkoten-enkopresis/ Buch: Psychosomatische Medizin und Psychotherapie; Klußmann & Nickel, 2009, 6. Erweiterte und korrigierte Auflage 48 7. Sexualstörungen beim Mann Susanne von Scheidt Lustlosigkeit: Besonders ausgeprägt sind die Angst zu versagen bzw. schon erlebte Ereignisse in diese Richtung, welche dann zur Vermeidung führen. Ebenso frühere Erfahrungen, welche unlustvoll oder wenig befriedigend empfunden wurden, reduzieren die Lust. Zusätzlich halten seelische Sorgen und Kummer den Mann davon ab sich zu entspannen und den Sex zu genießen. Häufig ist in Ehen kaum Zeit füreinander, da man sich um die Kinder kümmern soll, nebenher im Beruf Erfolg haben sollte. Auch das Gefühl, dass man seinen Ehepartner sowieso immer hat, vermindert den Drang sich umeinander liebevoll zu kümmern, den anderen wahrzunehmen und ihm die Wertschätzung zu geben. Andere Männer glauben, dass sie unattraktiv auf die Partnerin wirken, da sie keinen Sport treiben, ungesund essen und Rauchen, Alkohol oder andere spezielle Makel an sich beklagen. Obwohl sich unsere Gesellschaft für sexuell offen hält, wird der Mann doch in ein gewisses Schema gesteckt, welches er zu erfüllen hat. Er muss immer können, er muss stark sein, er darf keine Probleme haben, er darf keine Gefühle zeigen. Diese Muster setzten Männer erheblich unter Leistungsdruck, weswegen sie häufig nicht über ihre sexuellen Probleme sprechen und unbehandelt bleiben. Wenige suchen doch heimlich und voller Scharm Hilfe. Vielen fällt es schwer über Probleme zu sprechen, weshalb der Behandler besonders einfühlsam dem Patienten einen angenehmen Raum eröffnen sollte. Öffnet sich der Mann, sind die häufigsten Problemen Lustlosigkeit, Impotenz, Erektionsstörung, erektile Dysfunktion, Ejakulations-, Orgasmusstörungen und Sexsucht, auf die nun im Folgenden genauer eingegangen wird. Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Beziehung zur Frau. Wie gibt sich diese, ist sie zu passiv, kränkelnd, ihn entwertend, zu aktiv, zu fordernd oder bemängelt sie sich ständig selber und verlangt von ihrem Mann, dass er sie befriedigt, wodurch der Druck auf den Mann steigt und so auch Ängste vor Untreue und Trennung aufkommen. Somit kann die Ursache nicht zwangsläufig beim Mann liegen, was in einer Behandlung berücksichtigt werden muss! 49 Impotenz, Erektionsstörung, erektile Dysfunktion Wegen diesen Erkrankungen gehen die meisten Männer am häufigsten zum Arzt oder Psychotherapeuten. Ursachen dieser Erkrankungen lassen sich auf die Problematik, des nicht steif werdenden Penis und somit das unmögliche Eindringen in die Scheide zurückführen. Bei der Impotenz untergliedert man in drei Kategorien. Die primäre Impotenz bei welcher der Mann noch nicht fähig war intimen sexuellen Kontakt zu haben. Der situativen Impotenz liegt ein bestimmter Umstand auch eine bestimmte Partnerin zu Grunde. Die sekundäre Impotenz ist eine erworbene Impotenz aufgrund von bedeutsamen Erfahrungen, wie z. B. Trennung, Tod der Partnerin, berufliche Krisen, Kinderwunsch der Lebenspartnerin. Bei der Erektionsstörung sind etwa 70% organisch bedingt. Bluthochdruck, Arteriosklerose, koronare Herzkrankheiten, Diabetes, bestimmte Medikamente und Testosteronmangel sind wohl die wichtigsten Gründe für ein organisches Erektionsproblem. Ejakulations- und Orgasmusstörung Unter Ejakulatio praecox versteht man den vorzeitigen Samenerguss unmittelbar nach dem Eindringen in die Scheide, wobei der Orgasmus schwach und unbefriedigend oder stark und lustvoll empfunden werden kann. Die Ejaculatio retarda entspricht einem verzögerten Orgasmus, welcher oft gering empfunden wird. Jedoch ist meistens Petting / Selbstbefriedigung ohne Schwierigkeit. Der schmerzhaften Ejakulation liegt oft eine Prostataerkrankung vor, welche teilweise durch eine Behandlung beseitigt werden kann. Seltene Funktionsstörungen Zu diesen zählt die Ejaculatio retardata, welche durch Diabetes mellitus, Androgenmangel, häufig durch Drogen/Alkohol, Psychopharmaka ausgelöst wird. Bei manchen wird der Samenerguss mit Risiko gleichgesetzt oder Frauen werden als Bedrohung wahrgenommen. Ferner kann der Orgasmus als eine gefürchtete aggressive Handlung gesehen werden, jedoch gibt es auch spezifische Selbstbezogene Probleme. 50 Autonomen Polyneuropathien, wie z. B. Diabetes Mellitus, können Retrograde Ejaculationen hervorrufen, bei welchen massenhaft Spermien im Urin nachweisbar sind. Sehr selten ist der trockene Orgasmus dessen Ursachen entweder organischer Natur sind, auf Partnerkonflikte hinweisen oder Nebenwirkungen von Medikamenten sind. „Pseudo-Lösungen“ für beide In einigen Beziehungen werden Arrangement über Stillschweigen getroffen oder Wege der Umgehung des Geschlechtsverkehrs. Bei der Delegation versucht der gesunde Partner die Störung des betroffenen Partners aufrecht zu erhalten. Wendung gegen den Partner ist keine Seltenheit und wird vor allem durch Aggression und/ oder Entwertung durchgeführt. Bei ausgeprägten Näheängsten oder bei der Angst um die Gefährdung der Autonomie spricht man von Ambivalenzmanagement. Dies ist typisch nach der Geburt eines Kindes, wenn die Frau sich aus dem Beruf zurückzieht. Behandlungsformen Zuerst wird der Patient nach einer gründlichen Anamnese körperlich untersucht. Findet sich hierbei eine behandelbare Störung, so sollte diese soweit diese möglich, behoben werden. Mit einer Sexualbehandlung/-therapie kann dem Patienten weitergeholfen werden. Bei psychischen Blockaden kann mithilfe eines Psychodiagnostisches Gespräch Klarheit erworben werden. Zusätzlich ist eine Psychotherapie und/ oder eine Paartherapie empfehlenswert. Diese Behandlungsformen sollten dem Patienten entsprechend angewendet werden. Therapiemöglichkeiten Beim Sensualitätstraining nach Masters und Johnson ist das Ziel die Erwartungsängste abzubauen, welches vorallem Personen mit Angst und Leistungsdruck hilft. Herbei können 51 Libido-, sexuelle Erregungs-, Orgasmusstörungen und psychisch bedingte Schmerzsymptome behandelt werden. Die Konfliktzentrierte Gesprächspsychotherapie ergründet die partnerschaftlichen Probleme, welche ausgesprochen werden, wodurch die Patienten Selbstbewusstsein aufbauen können. Therapie der Libidostörung kann, wenn sie aufgrund von Stress hervorgerufen wurde, zunächst einmal mit mehr qualitative verbrachter Zeit mit dem Partner/in oder im extremen Fall mit Medikamenten, wie Dopamin behandelt werden. Findet sich eine Erregungsstörung bei der Frau, wegen genitaler Durchblutungsstörung, mangelnder Feuchtigkeitsproduktion oder Östrogenmangel, kann diese durch Gleitcremes oder lokale Östrogentherapie, Creme/ Zäpfchen behoben werden. Durch Beratung und Aufklärung kann die Unerfahrenheit der Frau und die daraus resultierende Orgasmusstörung behandelt werden. Dem Vaginismus liegt meistens eine starker unbewusster Abwehrreflex zu Grunde, welcher durch gynäkologische Untersuchungen bestätigt werden kann und durch Gespräche und langsames Dehnen der Vagina therapiert wird. quellen • • • http://www.onmeda.de/krankheiten/sexualstoerungen_der_frau-definition-1536-2.html (22.01.2013) http://www.aerzteblatt.de/archiv/67052/Sexualstoerungen-des-Mannes-Diagnostik-undTherapie-aus-sexualmedizinisch-interdisziplinaerer-Sicht 2009 http://www.psychosomatik.unigoettingen.de/download/32%20Vorlesung%20Maennliche%20Sexualstoerungen.pdf (2004) 52 8. Sexualstörungen bei der Frau Anna Krinninger 1. Einleitung Sexualität umfasst immer körperliche und seelische Vorgänge. Doch gibt es kaum ein Gebiet auf dem sich Physiologie und Psychologie so stark auseinanderentwickelt haben wie bei der Behandlung sexueller Störungen. Männer werden zum Urologen geschickt, für Frauen, bei denen die Trennung der Funktion vom Subjekt gänzlich inadäquat ist, fühlt sich keine medizinische Fachrichtung so richtig zuständig. Ab wann eine Sexualstörung vorliegt, lässt sich nicht ohne weiteres sagen. Vor allem bei Frauen führen Anspannung, Stress, Müdigkeit, Erkrankungen oder Probleme in der Partnerschaft zu Störungen. Dabei sind sexuelle Störungen bei Frauen noch wenig erforscht , obwohl statistisch bei etwa 43% der Frauen zumindest vorübergehend Funktionsstörungen auftreten. 2. Definition Mir sexuellen Funktionsstörungen werden alle Beeinträchtigungen der Sexualität bezeichnet, die gekennzeichnet sind durch Beeinträchtigung und Störungen des sexuellen Verlangens, physiologische Beeinträchtigungen, Schmerzen oder Behinderung bei sexuellen Interaktionen. IDC-10-Definition: Sex. Funktionsstörungen verhindern die von der betroffenen Person gewünschte sexuelle Beziehung. Die sexuellen Reaktionen sind psychosomatische Prozesse. DSM-IV Definition: Störungen sind gekennzeichnet durch eine Auffälligkeit der sex. Verlangens und der psychophysiologischen Veränderungen, die deutliches Leiden und zwischenmenschliche Schwierigkeiten verursachen. 3.Sexuelle Störungen der Frau a) Lustlosigkeit, Inappetenz, Frigidität Diese Störung ist bei Frauen erheblich häufiger als bei Männern und ein Hauptgrund professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dabei hängt es von der subjektiven Bewertung der Frau ab, ob sie ihre Lustlosigkeit als Störung empfindet. Die Bandbreite der Gefühle geht von Gleichgültigkeit über Belästigung, Widerwillen bis hin zu Ekel. 53 Die Ursachen sind vielfältig: Verweigerung gegenüber der Sexualität des Partners, ungelöste Partnerkonflikte, unbewusste Konflikte oder neurotische Störungen. Einbezogen werden sollte auch die individuelle psychische Bedeutung bestimmter Lebensphasen, wie Schwangerschaft, Kindererziehung und Menopause. Weitere Ursachen: Erziehungsfaktoren, traumatische Erfahrungen, Informationsmangel, Erkrankungen und biologische Faktoren, Medikamente. Neben individuellen Konflikten auf allen Stufen der psychischen Entwicklung stehen aber auch Probleme mit der Annahme des eigenen Geschlechts im Vordergrund. Patientengeschichte: 39-jährige Frau, verheiratet ,1 Sohn Problem: keine Lust auf Sexualität mit dem Ehemann, der mit Trennung droht. Lebensgeschichte: Starke Orientierung am Vater, schwache Mutter, leistungsorientiert um Vater zu beeindrucken. Sohn und Mann werden als „auffressend“ erlebt. Beim Paargespräch äußert die Patientin den Wunsch nach mehr Aufmerksamkeit und Versorgung durch den Ehemann In vorliegenden Fall ist die Verbindung von individueller Neurose und Partnerproblematik deutlich. Es liegt eine Identifizierungsstörung mit der Mutter vor, die sie nicht am sexuellen Erleben hindert, solange der Mann sich „vaterähnlich“ verhält. Mit zunehmender Regression des Mannes wird sie mit ihren abgewehrten Versorgungswünschen konfrontiert, was zu einer verstärkten zwanghaften Abwehr bis hin zur sexuellen Erlebnisunfähigkeit führt. b) Vaginismus, Koitusphobie, Dyspareunie Unter Vaginismus versteht man die Verengung des Scheideneingangs durch unwillkürliche Spasmen der Beckenmuskulatur und des äußeren Drittels des Scheideneingangs als Reaktion auf den realen oder vorgestellten Versuch, etwas in die Scheide einzuführen. In der Praxis wird auch unter Vaginismus die Koitusphobie (große Angst vor dem Koitus) ohne Scheidenkrampf verstanden. In beiden Fällen handelt es sich um ein psychisches Problem. Die betroffenen Frauen sind erlebnis.-und orgasmusfähig, wenn der Koitus nicht versucht wird. Körperliche Traumen im Genitalbereich (schwere Geburt, Operationen) können ätiologisch eine Rolle spielen Unter Dyspareunie versteht man den schmerzhaften Koitus meist in Folge mangelnder Lubrikation. Organische Störungen sind auszuschließen. 54 Klinisch ist die D. oft schwer von Vaginismus und Koitusphobie zu unterscheiden. Die Störung ist aber viel seltener partner.-und situationsabhängig, sondern hat eher neurotische Ursachen. c) Orgasmusstörungen, Anorgasmie Eine Orgasmusstörung liegt vor, wenn bei vorhandener Lust und Erregbarkeit eine allgemeine oder nur bestimmte sex. Praktiken betreffende Hemmung des Orgasmus vorliegen. Ob eine echte Störung vorliegt, bedarf großer diagnostischer Sorgfalt. Gesellschaftlicher Leistungsdruck muß berücksichtigt werden. Entscheidend ist, ob die Frau generell keinen Orgasmus erlebt und es sich um eine allgemeine Angst handelt, oder um objektbezogene Ängste vor Abhängigkeit, Überwältigung und Auflösen des Selbst. 4. Diagnostik Zur Diagnostik sex. Störungen gehören - genaue Erfasssung der Symptome und deren Auswirkungen - psychologisches Gespräch - Sexualanamnese 5. Therapie Sexualtherapie besteht zum Großteil aus Informationsvermittlung über Sexualität im Allgemeinen und der Verbesserung der Kommunikation zwischen den Partnern. Grundlage hierfür ist die Bereitschaft beider Partner trotz bestehender Probleme die Beziehung fortzuführen und an den Schwierigkeiten zu arbeiten. Die Sexualtherapie hat folgende Ziele: Abbau von Leistungsdruck, Angst.- und Schamgefühlen, Verbesserung der Körperwahrnehmung und der eigenen Bedürfnisse, Verbesserung der Partnerkommunikation in der Sexualität. Therapiemöglichkeiten: Sensualitätstraining nach Masters und Johnson (Abbau von Erwartungsängsten) Konfliktzentrierte Gesprächspsychotherapie(Ergründung partnerschaftlicher Konflikte) 55 Quellen: Buch: Gromus, Beatrix: Sexualstörungen der Frau, Hogrefe Verlag (2002) Internet: www.fraueraerzte-im-netz.de 56 9. Psychokardiologie Jan Mühlnikel und Benedict Gereke Einleitung Die Psychokardiologie sollte man nicht halbherzig als unwichtig einstufen. Sie nimmt eine wichtige, den Patienten zum Teil sehr stark beeinflussende Position ein, weshalb man sich das Gebiet der Psychosomatik in der Kardiologie besonders zu Herzen nehmen sollte. Jeder kennt unbarmherzige oder auch herzzerreißende Situationen, bei denen die Psyche einen sehr großen Effekt auf das Herz- Kreislaufsystem hat. Manchmal wundert man sich, wie intensiv ein Herzklopfen sein kann. Der aufmerksame Leser hat vielleicht bemerkt, dass das Wort „Herz“ im obigen Absatz sechs Mal verwendet wurde und auch im übertragenen Sinn oft verwendet wird. Dies zeigt welchen Stellenwert das Herz als Organ und Wort in der heutigen Gesellschaft hat. In der Psychokardiologie wird der Zusammenhang zwischen Psyche und Herzerkrankungen (mit stetig zunehmender Prävalenz) beleuchtet. Die Effekte der Psyche auf das Herz- Kreislaufsystem Hypertonie, koronare Herzkrankheit, Angina pectoris, Herzinfarkt, Herzrhythmusstörungen und –insuffizienz sind kardiovaskuläre Krankheitsbilder mit relevanter psychosozialer Beteiligung. Immer mehr Menschen leiden an Depression und psychischen Dysbilanzen. Depressionen werden zu den Risikofaktoren einer koronaren Herzkrankheit gezählt. Es besteht ein relatives Risiko von 1,6 – 1,9 % laut Metaanalysen aus bevölkerungsbasierten Studien. Damit stehen medizinisch gesehen, psychiatrische Erkrankungen und Diabetes mellitus, Rauchen, Hypercholesterinämie und Hypertonie auf einer Ebene. Übergewichtige und zugleich depressive Patienten haben ein dreifach erhöhtes Risiko an einer koronaren Herzkrankheit zu erleiden, als Patienten ohne psychische Vorerkrankung in der Anamnese. Wichtig ist auch zu beachten, dass Patienten mit einer koronaren Herzkrankheit häufig psychische Krankheitsbilder entwickeln, welche sich eventuell nochmals negativ auf die Herzerkrankung auswirken. 57 Einerseits haben psychisch erkrankte Patienten meistens nicht die Kraft und Motivation präventiv einer Herzkrankheit entgegenzuwirken, andererseits begünstigt der veränderte Hormonspiegel (insbesondere Cortisol und Noradrenalin) eine entstehende Herzerkrankung. Ein niedriger sozialer und ökonomischer Status mit damit eventuell verbundenen gesundheitsschädlichen Verhaltensweisen (z.B. Nikotin- und Alkoholabusus, Fehlernährung) haben langfristig einen hohen Stellenwert an denen durch psychosoziale Faktoren verursachten Herzerkrankungen. Menschen, welche ständig unter Stress stehen, haben ebenfalls durch veränderte Hormonspiegel eine Prädisposition für Herzerkrankungen. In akuten Situationen sind Herzrhythmusstörungen und auch Symptome der Angina pectoris hervorzuheben. An dieser Stelle ist die sogenannte Stress-Kardiomyophathie (Synonyme: Broken-HeartSyndrom, Tako-Tsubo-Kardiomyopathie) welche gehäuft bei älteren Frauen (möglicherweise durch postmenopausalen Östrogenmangel) anzutreffen ist, erwähnenswert. Symptome treten meistens nach einer emotionalen, körperlichen Stressbelastung und damit verbundener Aktivierung des autonomen Nervensystems auf und gleichen denen eines Herzinfarkts. Auch hier stehen Stresshormone (insbesondere Katecholamine) im Mittelpunkt des Geschehens. Diese können zu einem Koronarspasmus mit entsprechender Symptomatik wie retrosternalem (Vernichtungs-) Schmerz, Dyspnoe, Kaltschweißigkeit und Übelkeit führen. Mögliche Auffälligkeiten bei der Diagnostik: erhöhte Leberenzyme paradoxe Bewegung der linken Kammer (apical ballooning), Akinesie/Dyskinesie der Herzspitze(Tako-Tsubo erinnert an eine Tintenfischfalle, welche einen engen Hals sowie einen bauchigen Körper besitzt und an die sonographische Form des Herzens mit der ballonartigen Herzspitze erinnert.) Lungenödem durch Herzinsuffizienz Erst durch eine Herzkatheteruntersuchung kann ein Herzinfarkt ausgeschlossen werden. Die Komplikationsgefahr in den ersten Stunden der Stress-Kardiomyopathie ist hoch. Nach einem für viele Menschen einschneidenden Ereignis wie Naturkatastrophen oder Terroranschlägen beobachteten Kardiologen eine erhöhte Anzahl von Patienten mit einer Stress-Kardiomyopathie. Herz- Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache in Industrieländern. Deshalb ist die frühzeitige Erkennung und Therapie der psychisch verursachten Herz-KreislaufErkrankungen sehr wichtig. Die zweiseitige Betrachtung der Psychokardiologie Da in den letzten Jahren eine zunehmende Häufigkeit psychisch bedingter Berentungen und Krankheitstage zu beobachten ist, muss auch die Zweischneidigkeit der Psychokardiologie 58 betrachtet werden. Erstaunlicherweise wirkt nicht nur das Nervensystem, über Sympathikus und Parasympathikus auf die autonome Herztätigkeit. Umgekehrt führen auch Erkrankungen und Störungen des kardiovaskulären Systems psychosoziale Folgen mit sich. Depressive Syndrome, posttraumatische Belastungs-, sexuelle Funktions- und sekundäre Angststörungen (z.B.: Agarophobie) können als Erweiterung der somatischen Probleme von Herz und Kreislauf betrachtet werden. Henne oder Ei - Herz oder Psyche? Die Frage nach der Henne und dem Ei stellt sich, im übertragenen Sinne, auch in dieser Thematik. Die Relevanz zeigt sich vor allem bei Erkrankungen, die statistisch häufig miteinander auftreten. Dies ist zum Beispiel bei einigen psychoaktiven Herzmedikamenten, wie Amiodaron der Fall. Weiterhin wird das enge Zusammenspiel, zwischen Herz und Hirn besonders in extremen Momenten spürbar. Situationsabhängig kommt es sogar zur unterschiedlichen Wahrnehmung gleicher somatischer Aspekte. Das Herzklopfen, zusammen mit Schmetterlingen im Bauch, gilt im Gegensatz zu Palpitation in einer Stresssituation, als etwas durchaus Angenehmes. Die Geschwister Psychologie und Internie Dem Patienten ist es oft unangenehm, wenn ihre somatischen Probleme unter psychologischem Licht betrachtet werden. Erst recht, wenn man vom Kardiologen zu dem Kollegen, mit dem unschönen Spitznamen "Irrenarzt" geschickt wird. Die Voraussetzungen für die Lösung des Problems, sind so, aufgrund der Vorurteile, denkbar schlecht. Um eine gute Diagnose gewährleisten zu können, ist eine Doppelqualifikation äußerst vorteilhaft. Dem Patienten wird so ein weiterer Gang zum neuen Arzt und die soziale Schmach, beim Doktor für Gemütskrankheiten vorstellig gewesen zu sein, erspart. Eine einfache diagnostische Möglichkeit ist ein Fragebogen, welcher grundlegende Informationen zu Risikofaktoren, psychosozialen Belastungen, Angstverhalten, Depressionen und sexuellen Funktionsstörungen ermittelt. Des Weiteren zählt die Inspektion des Patienten nicht nur zu den Grundlagen der körperlichen Untersuchung zu Beginn eines Arztbesuches. Ihr obliegt gerade in der Kardiologie auch eine besondere Bedeutung, im Laufe der Behandlung. Dies zeigt die häufige Entwicklung von Panikstörungen nach einer Schrittmacherimplantation. Außerdem darf auch die Belastung des sozialen Umfeldes nicht unbeachtet bleiben. Kardiologische Probleme führen nicht selten zu Einschränkungen im alltäglichen Leben. Kompensiert wird dieser Umstand häufig durch Angehörige, welche dadurch unter einer zusätzlichen Belastung leiden. Da die ineinander greifenden Arme der Geschwister Internie und Kardiologie nicht voneinander getrennt werden können und dürfen und eine Doppelqualifikation nicht 59 hundertprozentig realisierbar ist, sollte eine grundlegende Ausbildung des Kardiologen im Fachbereich der Psychosomatik garantiert werden. Mit Hilfe von Weiterbildungen, Fallbesprechungen oder Seminaren kann dies umgesetzt werden: diesem Ziel dient in Deutschland das System der psychosomatischen Grundausbildung und der psychosomatischen Grundversorgung. 60 10. Psychosomatik in der Gastroenterologie Matthias Hess Einleitung: Um die psychosomatischen Aspekte der Gastroenterologie genauer zu analysieren, sollten erst einmal die am häufigsten zu untersuchenden Darmerkrankungen in Betracht gezogen werden, die mit psychosomatischen Fällen vim Zusammenhang stehen. Hierzu gehören die chronischentzündlichen Darmerkrankungen (CED), das peptische Ulkusleiden und die gastroösophageale Ulkuskrankheit (GERD). Im folgenden Abschnitt werde ich diese Grundleiden genauer erläutern und auf die jeweilige Therapien eingehen. 1. Psychosomatische Aspekte der CED (Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen) Meistens gibt es sehr komplexe Zusammenhänge zwischen chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen und der Psychosomatik. Oftmals spielen mehr als ein Faktor im sozialen Leben eine Rolle. Oftmals kommt es bei dieser Erkrankung auch zu Missverständnissen zwischen Ärzten und Betroffenen. Zu den Einflussfaktoren gehören vor allem Depressionen und Angst, aber auch chronischer Stress und psychische Störungen. Deshalb ist hier eine sehr spezifische Therapie mit der Gewährleistung einer großen Unterstützung und optimales PatientInnen-Management. Wie weiter oben schon erwähnt, sind die psychosozialen Aspekte dieser Krankheit sehr komplex und dementsprechend auch die Therapie. Da die medikamentöse Therapie finanziell besser unterstützt wird als die Psychotherapie, gibt es hierzu leider auch nur wenige Studien. Die erste Studie erschien im Jahr 1954, als Grace et al. von einer niedrigeren Anzahl von Komplikationen bei PatientInnen mit Morbus CrohnOperation berichtete, die begleitend zur Krankheit in Psychotherapie waren. Allerdings war die Personengruppe mit insgesamt 68 PatientInnen (34 mit Psychotherapie und 34 ohne Psychotherapie) für eine wirkliche Studie viel zu klein, um einen entscheidenden Durchbruch zu erzielen. 1987 erfolgte dann eine Studie durch Künsebeck et al. Diese sagt aus, dass 61 PatientInnen mit einer begleitenden Psychotherapie in einer internistischen Station raschere Abklingen der Krankheitssymptome und bessere Bewältigungstrategien verfolgten, als PatientInnen ohne Psychotherapie. 1991 berichteten Schwarz und Blanchard in einer Studie, dass Entspannungstechniken mit kognitiven Krankheitsbewältigungsstrategien positive Auswirkungen auf CED-Symptome zeigten. Die deutsche Multicenterstudie konnte einen signifikanten Einfluss der Psychotherapie auf Morbus Crohn-PatientInnen nicht belegen. Allerdings berichtete sie von einem Trend, der zu weniger operativen Eingriffen führte, wenn PatientInnen zehn Sitzungen Autogenes Training absolviert hatten. Daraus kann man den Schluss ziehen, dass das subjektive Wohlbefinden durch Psychotherapie jedoch entscheidend positiv beeinflusst wird, was sich auch durch weniger Krankenhausaufenthalte und Krankentage bemerkbar macht. Entscheiden nicht nachweisbar war jedoch bis jetzt das objektive Gesundheitsempfinden. Bislang kam es noch zu keinem Beleg, dass Psychotherapie einen positiven Einfluss auf die biologische Entzündung im Darm hat. Abschließend muss hier aber gesagt werden, dass noch viele weitere Studien erforderlich sein müssen, um in diesem Bereich einen wünschenswerten Durchbruch mit der Psychotherapie zu finden. Derzeit wird keine Psychotherapie bei CED empfohlen. 2. Psychosomale Aspekte des Peptischen Ulkusleidens In den meisten Fällen entsteht ein peptischer Ulkus durch die Infektion mit dem Helicobakter pylori. Jedoch gibt es in bis zu 20% der Fälle auch andere, unbekannte Pathogeneseformen. Deshalb mögen auch hier psychosoziale Aspekte eine gewisse Rolle spielen. In neueren Studien ist vor allem von Stress als entscheidender Faktor für die Entstehung eines Ulkus von bedeutender Ursache. Hier muss v.a. bei der Therapie der Ulkuskrankheit beachten, dass eine medikamentöse Verabreichung allein nicht ausreicht. Jedoch gibt es hierzu noch zu wenige Studien darüber. Wie weiter oben schon erwähnt spielen hier aber psychosoziale Faktoren zur Pathogenese des Ulkusleidens keine kleine Rolle. Wissenschaftler und Psychologen ziehen hier das biopsychosoziale Modell heran, die alles erklärbar machen soll. Hier spielen nämlich Interaktionen zwischen sozialen, psychologischen, immunologischen und endokrinologischen Faktoren eine entscheidende Rolle. 2004 gab es hierzu eine Studie in Dänemark (Rosenstock et al.). Über 2.400 dänische PatientInnen wurden 11 Jahre lang zur Inzidenz des peptischen Ulkus im Zusammenhang mit psychosozialen und genetischen Aspekten untersucht. Die 62 Inzidenz lag bei ca. 3%. Davon hatten etwas weniger als die Hälfte einen Ulkus ventriculi und eine knappe Mehrheit einen Ulkus duodeni. Dabei konnte entscheidend gezeigt werden, dass ein niedrigerer sozioökonomischer Lebensstandard eine höhere Wahrscheinlichkeit aufzeigt, an einem Ulkus zu erkranken. Eine weitere Studie zeigte auf, dass neben Stress auch noch schwerere körperliche Arbeit, Angstzustände und Neurotizismus mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu einem Ulkus führen. Das v.a. Stress als entscheidender ätiologischer Faktor für die Entstehung des peptischen Ulkus eine Rolle spielt, belegt auch eine japanische Studie aus dem Jahr 1998. Hierbei war ein Erdbeben besonders hilfreich. Nach diesem Ereignis zeigten v.a. Ältere, die Bedrohungsängste hatten, eine erhöhe Inzidenz für die Ulkusentstehung. Demnach wurden ca. 16.000 gastroendoskopische Befunde aus dem Jahr 1995, in der das Erdbeben stattfand, mit den Daten von ca. 10.000 PatientInnen vom Vorjahr verglichen. Hierbei stellte sich neben einer Verhältnisverschiebung zugunsten der Ulcera Ventriculi auch eine erhöhte Anzahl von Blutungen im Ulkus heraus. Eine Studie von 1986 (Feldman et al.) fand noch heraus, dass Männer mit Stresssymptomen auch ein deutlich höheres subjektives Krankheitsempfinden empfanden als Patienten, die mit Nephrolithiasis und Cholizystolithiasis behandelt wurden. Also kann gesagt werden, dass subjektiv belastende Stresssituationen ein wesentliches Risiko für die Entstehung eines peptischen Ulkus darstellt. Ein weiterer Faktor, der mit Stress einhergeht, ist natürlich der Konsum von Alkohol und Zigaretten, die ebenfalls entscheidende Verstärkerrollen der Pathogenese sind, wodurch sich auch hier ganz klar das biopsychosoziale Modell belegen lässt. Offen bleibt hier deshalb die Frage, ob die psychosozialen Problem allein (also der Stressfaktor, Angstfaktor) oder durch den infolge des Stresses eingeleiteten Drogenabusus zur Entstehung eine Rolle spielt. In der Therapie reicht deshalb die medikamentöse Bekämpfung durch PPIs allein nicht aus, um langfristigen Erfolg beim Patienten zu erzielen. Dennoch gibt es auch hier kaum Studien dazu. Bisher hat die Studie Beloborodova et al. (2002) aufgezeigt, dass der Einfluss von Psychopharmaka und Psychotherapie den Heilungsprozess reduzieren und eine Rezidive verhindern. 3.Psychosomatische Aspekte der gastroösophagealen Refluxkrankheit In der EU ist die gastroösophageale Refluxkrankheit die häufigste Erkrankung des oberen Gastrointestinaltrakts (¼ der Bevölkerung hat Sodbrennen). Natürlich spielt neben Ernährung 63 und Lebensstil sicherlich auch hier Stress als psychosomatischer Faktor eine Rolle. Auch hier gibt es mit psychosomatischen Behandlungsmöglichkeiten Erfolge in der Therapie. Hierbei muss eingegangen werden, dass chirurgische Maßnahmen oftmals die Symptome nicht gebessert haben. Deshalb sollten Chirurgen bei Ösophaguseingriffen heutzutage auch besonders auf die psychosozialen Aspekte eingehen. Hier spielt in der Psychotherapie v.a. die Muskelentspannung nach Jacobsen eine wichtige Rolle. Diese Therapie führt neben der subjektiven Empfindungsbesserung beim Patienten sogar noch zu einer objektiven Verbesserung der Symptome. Neben dieser Therapie führt nachweislich auch die Hypnose mit Tiefentspannung zu einer erkennbaren Reduktion der Magensäuresekretion. 4. Psychosoziale Aspekte bei Zöliaki Zöliaki ist ebenfalls eine relativ häufige Gastrointestinalerkrankung, die mit einer Glutenunverträglichkeit einhergeht. Ätiologisch spielen bei dieser Erkrankung psychosoziale Ursachen sicher keine Rolle. Jedoch sind die psychischen Folgen der in unseren westlichen Gefilden konsequenten glutenfreien Diät sicherlich folgenreich. Deshalb sollten InternistInnen bei Zöliaki auch auf die psychologischen Folgen der betroffenen PatientInnen hinweisen. Hier bieten sich vor allem gute Selbsthilfeversorgungseinrichtungen, sowie ein Screening der jeweiligen psychischen Belastungen an. Auch hier gibt es Studien darüber, dass psychische Betreuung die Therapie dieser Patientengruppe deutlich verbessern kann. Die Reduktion des Disstresses spielt hierbei eine wichtige Rolle. 64 11. Orthopädie in der (und) Psychosomatik Anika Kunz und Steffen Schulz Mens sana in corpore sano „ein gesunder Geist in einem gesunden Körper“ – diese Aussage zeigt deutlich den Zusammenhang zwischen Körper und Geist . Tritt eine Beeinträchtigung einer Körperfunktion ein, die psychisch ausgelöst ist, so spricht man von einer Konversionsstörung: unbewältigte starke Ereignisse oder Erlebnisse werden in körperliche Symptome umgewandelt. Patienten klagen über Krankheiten oder körperliche Symptome, obwohl kein medizinischer bzw. organischer Befund vorliegt. Sie glauben nicht der Versicherung mehrere Ärzte, dass sie körperlich gesund sind. Dem Versuch, ihre Schwierigkeiten psychisch zu erklären, sind sie nicht aufgeschlossen. Sie sind der Überzeugung, die körperliche Ursache noch nicht gefunden zu haben. (Ausschnitt aus dem Buch „Psychologie Hrsg:Hobmair“) In fast jeder medizinischen Disziplin ist das Zusammenspiel von Körper und Geist von essenzieller Bedeutung für die Heilung des Patienten. Häufig steht das Problem „Schmerz“ im Vordergrund und weniger der Mensch an sich. Mehr und mehr gerät die psychische Betreuung für den Facharzt in den Hintergrund, und man versteift sich auf das eigene Fachgebiet. Dabei macht die Empathie des Therapeuten gegenüber seinem Patienten einen Großteil des Behandlungserfolgs aus. Die Interaktion zwischen Arzt und Patient, die Art, wie der Arzt sich mit dem Patienten unterhält, wie er ihn annimmt und aufklärt, kann eine große Auswirkung auf den Erfolg einer Behandlung oder einer Medikation haben. Ärztinnen und Ärzte, müssen wissen wie man während eines ärztlichen Gespräches die Kommunikation gestaltet, wie man die Akzeptanz und das Verständnis bei den Patienten erhöht, dass man ihn nicht in anderthalb Minuten Gespräch abfertigt und ihm anschließend eine Packung Schmerzmittel über den Tisch schiebt. Der Großteil der Patienten nimmt die Behandlungsmethode „der einfachen Pille“ gerne an, schafft man es doch so seinen Problemen und Gefühlen, die ursprünglich Verantwortlich für 65 das ganze sind, aus dem Weg zu gehen. Man maskiert das Problem durch Tabletten und zu schnelle invasive Maßnahmen. Überflüssige Behandlungen bilden die dunkle Seite der Medizin. Und sie sind erstaunlicher Weise sehr häufig. Man neigt rasch dazu einen operativen Eingriff zu empfehlen. Werden hier jedoch nicht alle Konfliktbereiche berücksichtigt, so kann es schnell zu einer Chronifizierung des Krankheitsbildes kommen. Kranke Menschen begeben sich in die Obhut der modernen Heilkunde. Sie sehen die blütenweißen Kittel, die bunten Pillen und die blitzenden Bestecke. Was jedoch erhalten sie im Austausch für ihr Vertrauen? 20 bis 40 Prozent aller Patienten, heißt es in der renommierten Medizinzeitschrift "New England Journal of Medicine", werden medizinischen Prozeduren ausgesetzt, die ihnen keinen oder keinen nennenswerten Nutzen bringen.(Webseite des Deutschen Kolloquiums für psychosomatische Medizin. www.dkpm.de/cms/dkpm/arbeitsgruppen/dkpm-arbeitsgruppe-psychoneuroimmunologie-pni.) Die echte Wirkung eines Scheinmedikaments ist seit Hippokrates bekannt. Über die Jahrhunderte hinweg griffen Ärzte zu diesem Mittel, wenn sie einem Patienten keine »echte« Behandlung angedeihen lassen konnten. In den vergangenen Jahren ist der Placebo-Effekt zum Thema eines eigenen Forschungszweigs an der Schnittstelle zwischen Medizin und Psychologie aufgestiegen. Der Placebo - Effekt kann grundsätzlich bei jeder Form der therapeutischen Intervention auftreten. Sei es bei Schein-Injektionen, -Operationen oder -Akupunktur oder sogar in der Psychotherapie. Der renommierte Placebo-Forscher Professor Dr. Manfred Schedlowski vom Institut für Medizinische Psychologie und Verhaltensimmunbiologie der Uni-Klinik Essen schätzt, dass bis zu 70 Prozent der Wirkung einer »echten« Therapie auf einem PlaceboEffekt beruhen kann. (Interviews mit Professores Dr. Manfred Schedlowski, Dr. Paul Enck und Dr. Dr. Christian Schubert.) Eine bekannte Studie zu Schein-Operationen ist die des amerikanischen Chirurgen Bruce Moseley (Moseley, J. B., et al., A Controlled Trial of Arthroscopic Surgery for Osteoarthritis of the Knee. N. Engl. J. Med. 347 (2002) 81-88.) http://www.schmerztherapeut-zuerich.ch/meniskus/23-uncategorised/72-ueberfluessige-knieoperationen.html 66 Als Spezialist für Gelenkerkrankungen hatte er zahlreiche ältere Menschen mit Knie-Arthrose unter seinen Patienten, und Arthroskopien gehörten zu seiner Routine. Irgendwann wollte er wissen, ob nicht ein Teil des Behandlungserfolgs auf einem Placebo-Effekt beruht. Er inszenierte ganz normale Operationen mit den üblichen Präliminarien wie Aufnahme ins Krankenhaus, Beruhigungsspritze, Narkose und den typischen Geräuschen eines OP-Saals, operierte aber tatsächlich nur die Hälfte der Patienten. Den anderen ritzte er während der Narkose nur die Haut ein, damit das Knie etwas blutete, und verpasste ihnen eine dicke Naht. Um die Täuschung zu perfektionieren, konnten die „Schein-Operierten“ ebenso wie alle anderen auf einem Monitor eine echte Operation verfolgen, nur dass es bei ihnen gar nicht ihre eigene war. Das Ergebnis war, dass die zum Schein operierten Menschen nach der Heilungsphase ebenso zufrieden waren mit der Behandlung wie die tatsächlich Operierten. Moseley betrachtete das als Nachweis für einen Placebo-Effekt. Gleichzeitig zeigte es aber auch, dass eine Kniegelenks-Operation in vielen Fällen nutzlos oder überflüssig ist, weil die Beschwerden auch von selbst oder mit einer weniger invasiven Therapie verschwinden. Inzwischen gilt dieser Eingriff tatsächlich nicht mehr als Mittel der Wahl bei Kniegelenksverschleiß, sondern wird nur noch bei bestimmten, eng eingegrenzten Krankheitsbildern empfohlen Eine vorgetäuschte Knieoperation kann ebenso gute Erfolge erzielen wie eine echte Operation, zeigte eine Studie. Die Psychosoziale Belastung eines Patienten sollte einen hohen Stellenwert in der Behandlung einnehmen. Die häufigsten psychosomatischen Symptome sind folgende: Rückenschmerzen, Nackenverspannungen, Schulterschmerzen, Kopfschmerzen, Schwindel, Ohrgeräusche, chronische Müdigkeit, Magen-Darmbeschwerden, Bluthochdruck, Herz-Rhythmus- Beschwerden, Herzrasen, Schweißausbrüche, Schlafstörungen, Depression und Ängste. Oft treten diese auch nicht nur einzeln, sondern auch kombiniert auf. Allgemeinärzte schreiben aus Erfahrung mindestens 20-30% der Beschwerden ihrer Patienten einen psychosomatischen Ursprung zu. Dadurch sind Redewendungen wie “mir schlägt das 67 auf den Magen”, “das bereitet mir Kopfschmerzen”, “das liegt mir wie ein Stein auf der Brust”, “eine große Last auf den Schultern tragen” oder auch “davon habe ich einen Kloß im Hals”, entstanden. Gesundheit und Krankheit werden entscheidend durch psychische Prozesse beeinflusst. Schwierige Arbeitsbedingungen, familiäre Probleme oder auch einschneidende Lebensereignisse können schwerwiegende Folgen haben. Hohe Beanspruchungen aufgrund individueller, situationsbezogener Gegebenheiten mit der Gefahr der Überschreitung der Anpassungsfähigkeit können sich einstellen und langfristig zu gesundheitlichen Störungen und Erkrankungen oder gar zu chronischen Leiden führen. In diesem Zusammenhang sind oft Bereiche des muskulo-skelettalen Systems und dabei insbesondere der Rücken betroffen. Seelische und körperliche Fehlhaltungen führen zu Anspannungen in der Rückenmuskulatur und letztendlich zu Schädigungen am Organsystem Rücken. Schulterschmerzen haben oft den Ursprung in emotionalen Blockaden, wenn der Patient das Gefühl hat eine zu große Last tragen zu müssen. Auch Mentale Blockaden können hier ihre Ursache finden. Die Schulterschmerzen sollen dem Patienten zeigen, dass er sich unnötige Aufgaben auferlegt. Er möchte zu viel für die anderen tun, er legt sich Lasten auf, die gar nicht seine sind. Funktionen des Haltungs- und Bewegungsapparat Er ist ein wichtiges Kommunikationsorgan. Durch Gestik manifestieren wir unsere Persönlichkeit und leihen unseren Worten den nötigen Nachdruck. Man kann somit sowohl Aggressionen wie auch Schüchternheit ausdrücken. Der Ausdruck „die Schultern hängen lassen“ zeigt die enorme Wichtigkeit unseres Bewegungsapparats auf so verleiht ein äußeres Erscheinungsbild Selbstvertrauen und Ansehen. Ebenso kann es jedoch auch das Gegenteil bewirken. Ist diese Symptomatik nun jedoch auf ein orthopädisches Problem zurückzuführen, so kann es schnell zu einer unterbewussten psychischen Manifestation kommen. 68 Handelt es sich Grundlegend jedoch um ein psychosoziales Problem, so kann sich daraus auch ein orthopädisches Problem manifestieren. Somatopsychische Reaktionen sind zu erwarten bei: - Störung der Körperform- Störung der Körperfunktion- lang dauernden Schmerzzuständen- Tragen von orthopädischen Apparaten Mögliche Psychosomatische Anteile bei Erkrankungen der Bewegungsorgane (aus Feiereis 1983)I ndikationenen für Psychotherapeutische Mitbehandlung. Nicht Entzündliche Erkrankungen, Myalgien, Osteochondrose, Osteoporose, Arthrose, Spondylose, Missbildungen des Bewegungsapparats, Lähmungen. Genrell sollte bei jeder Erkrankungen die die Gefahr der Chronifizierung mit sich bringt über eine psychotherapeutische Mitbehandlung nachgedacht werden. (https://www.google.hu/search?q=m%C3%B6gliche+Psychosomatische+Anteile+bei+Erkrankung+des+Bewegungsapparates&client=firef oxa&hs=Oez&rls=org.mozilla:de:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=S31hU8yiGsjsswbcqoHIAg&ved=0CAgQ_AUo AQ&biw=1525&bih=744&dpr=0.9#facrc=_&imgdii=_&imgrc=AlI_IW9-c94g0M%253A%3BOM1ILTeWrufUM%3Bhttp%253A%252F%252Farbmed.med.unirostock.de%252Flehrbrief%252Fgif%252FBK_21.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Farbmed.med.unirostock.de%252Flehrbrief%252Farbphys.htm%3B743%3B474 Morbus Scheuermann: Eine im Jugendalter erworbene Verknöcherungsstörung der Wirbelsäule. Vor allem der mittleren und unteren Brustwirblesäule. Da die Krankheit am häufigsten zwischen dem 8. und 14. Lebensjahr auftritt ist die Gefahr einer psychologischen Auswirkung groß. „die Patienten müssen mit einem schwachen Rücken durchs Leben gehen“. Therapie und Diagnose sind mit dem heutigen Behandlungsmöglichkeiten jedoch gut. Körperbehinderte Eine Körperliche „Minderwertigkeit“ hat häufig psychische Folgen. Ein gesteigertes Geltungsbedürfnis, oder das Imponierverhalten bei Kleinwüchsigen. Ebenso ist hier der Napoleon- Komplex anzumerken. Viele Verschiedene Szenarien sind hier denkbar. So ist es typisch, dass es zu einer Überkompensation der Beminderung kommt. Dies kann sich durch Vergleiche in Sport oder anderen Wettkämpfen mit offensichtlich Schwächeren äußern. Erpressung von Schwächeren. Oder auch der Unterdrückung des vermeintlich „schwächeren 69 Geschlechts“. Der Patient kann sich jedoch auch in die Isolation flüchten. Hierfür ist häufig ein negatives „selbst-Bild“ und ein falsches, vom Umfeld des betroffenen Patienten, projezierte Ideal verantwortlich. Lähmungen „Unter einer Lähmung versteht man den anteiligen oder kompletten Funktionsverlust eines Körperteils oder Organsystems. In der Neurologie bezeichnet Lähmung die Funktionsminderung von Nerven, mit daraus folgenden motorischen oder sensiblen Ausfällen. Im übertragenen Sinn kann es sich auch um eine subjektive Lähmungsempfindung trotz intakter Funktion handeln.“(http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4hmung) Der Patient signalisiert durch äußeres Erscheinungsbild Hilfsbereitschaft. Durch die offensichtliche Erkrankung und die Symptomatische Behandlung werden tieferliegende psychische Probleme maskiert und missachtet. Psychogene Muskelschmerzen Die Schmerzen des Patienten beruhen auf einem psychischen Konflikt. Oftmals ist es ein Konflikt den der Patient alleine nicht verarbeiten kann. Es können aber auch ganz alltägliche Dinge wie z.B. Stress bei Arbeit oder in der Familie sein, welche dazu führen das sich ein Psychogener Schmerz manifestiert. Erhält der Patient nun im zweiten Schritt auch noch mehr Aufmerksamkeit für den Schmerz, ist es möglich, das sich der psychogene Schmerz in einem sekundären Schritt manifestiert. Typisch ist hier das der Schmerz weder in der Entspannungsphase noch in der Stressphase unterschiedliche Stärkegrade aufzeigt. Eine Behandlung mit Analgetikern ist hier Kontrainiziert und zeigt auch keinerlei Wirkung. Hier sollte das ein psychiatrisches Konsil im Vordergrund der Behandlung stehen, sobald sicher ausgeschlossen ist das es sich um eine physische Erkrankung handelt. 70 Skoliose und Kyphose Unter einer Skoliose versteht man eine Seitabweichung der Wirbelsäule von der Längsachse mit Rotation der Wirbelkörper um die Längsachse und Torsion der Wirbelkörper (Verschieben der Deck- und Grundplatten gegeneinander) - begleitet von strukturellen Verformungen der Wirbelkörper. (http://flexikon.doccheck.com/de/Skoliose) Als Kyphose bezeichnet man eine nach dorsal konvex verlaufende Krümmung der Wirbelsäule in der Sagittalebene. Sie ist das Gegenteil der Lordose. (http://flexikon.doccheck.com/de/Kyphose) Eine psychotherapeutische Zusatzbehandlung wird empfohlen bei Skoliosen über 20-35° die nach einsetzen der Menarche diagnostiziert werden und bei Kyphosen unabhängig von der schwere und Verdünnung. Bei der Skoliose sind deutlich häufiger Mädchen betroffen. Es handelt sich in 90% um eine idiopathische Skoliose. Eine Behandlung ist nur in der Wachstumsphase möglich. Bei schweren Fällen ist das Korsett eines der häufigsten Behandlungsmittel. Die Gefahren bei einer Operation sind hier enorm hoch, sodass in den seltensten Fällen überschnell gehandelt wird. Jedoch handelt es sich bei den Patienten größtenteils um junge Patienten/innen, mit starken Herz / Lungen Kapazitäten, was sie zu gern gesehenen Patienten in jedem OP machen. (http://www.klinik-hohenfreudenstadt.de/medizin/psychosomatik/psychosomatik-und-orthopaedie.php Häufig sind es die ungelösten Konflikte welche nicht ausreichend verarbeitet werden und zu anhaltenden Belastungen führen. Dies führt zu einer Abnahme der Widerstandskraft, die subjektive Belastung und das Krankheitsgefühl nimmt zu. Es kommt zu Fehlhaltungen, Beschwerden und Schmerzen. Bei solchen Patienten sind die üblichen Behandlungsmöglichkeiten wie etwa, Physiotherapie oder auch Medikamente schnell ausgeschöpft. Das Behandlungskonzept muss hier ziel-, ressourcen- und lösungsorientiert sein. Eine Steigerung der psychischen Kompetenz und des Wohlbefindens der Patienten sind unerlässlich. 71 Ein wichtiges Fundament für die Therapie bildet die Information und die Aufklärung über psychosomatische Zusammenhänge und den transaktionalen Charakter von Stress und Stressbewältigung sowie Schmerz und Schmerzbewältigung. Die Behandlungsmethoden müssen körperliche und geistige Aspekt mit einbeziehen. Hier ein Beispiel der Behandlungsmethode des Klinikum in Hohenfreudenstadt: Rückenschule Ergonomieberatung das Erlernen von Entspannungstechniken Stressbewältigungstraining therapeutisches Flugballspiel bei Bedarf Psychotherapie Gymnastik und Wassergymnastik nach Indikation (auch Atemgymnastik) Ausdauertraining (Nordic Walking) Medizinische Trainingstherapie nach Indikation Ergotherapie nach Indikation balneophysikalische Maßnahmen medikamentöse Therapie Psychopharmaka nur bei dringendem Bedarf Im Sinne der „Hilfe zur Selbsthilfe“ wird ein Repertoire an Bewältigungsstrategien mit dem Ziel, nicht nur gegenwärtige, sondern auch künftige Stresssituationen bewältigen zu können, vermittelt und aufgebaut. Über begleitende Maßnahmen der medizinischen-therapeutischen Abteilungen werden mit Hilfe allgemeiner Entspannung und Kräftigung eine Effektivitätssteigerung und eine bessere Verankerung der psychosomatischen Interventionen bewirkt. (http://www.klinik-hohenfreudenstadt.de/medizin/psychosomatik/psychosomatik-und-orthopaedie.php) 72 12. Psychosomatik in der Chirurgie Hannah Simon Ein jeder hat seine ganz eigenen Assoziationen und Erfahrungen mit der Chirurgie. Dennoch oder vielleicht gerade deswegen sollte man „chirurgische Krankheiten“ definieren. Was sind also „chirurgische Krankheiten“? Dies zu erläutern soll als Einstieg dienen, um sich anschließend mit der Psychosomatik in der Chirurgie beschäftigen zu können. Man wird zum chirurgischen Patienten, wenn man eine Krankheit durchläuft, in der eine operative Behandlung eine entscheidende Therapie darstellt oder zumindest in Frage kommt. Chirurgischer Patient ist man in der Regel immer nur auf Zeit. Für die gleiche chirurgische Krankheit gibt es eine Vielzahl von möglichen Ursachen. Nehmen wir zur Verdeutlichung die chirurgische Krankheit „Oberschenkelfraktur“: Es gibt unzählige Möglichkeiten eine solche Fraktur herbeizuführen: ein Fahrradsturz, ein Verkehrsunfall, ein Sturz vom Baum, um nur einige zu nennen. Hinter jeder dieser Möglichkeiten können tiefere Konflikte stehen, die es für den Arzt zu erkennen gilt. Ist das Kind vielleicht vom Fahrrad gestürzt, weil es schnell wegfahren wollte von zu Hause, weg von familiären Problemen? Zu beachten ist, dass die Schwere der Verletzung nichts mit der Schwere des Konflikts zu tun hat! Doch wie kann man den Menschen beschreiben, der eine solche chirurgische Krankheit hat, wer ist der chirurgische Patient? Angst ist sicherlich eine häufige Gefühlswahrnehmung bei chirurgischen Patienten. Jede Operation birgt ein Risiko. Die Angst kann viele Ursachen haben: das Ausgeliefertsein, 73 Verstümmelungsangst oder auch Todesangst. Diese Befürchtungen bestimmen die Interaktion zwischen Krankem und Chirurg, auch wenn dieser Umstand nicht immer beiden bewusst ist. Die Persönlichkeit des Chirurgen spielt eine erhebliche Rolle bei seiner Entscheidung, ob es sich um einen chirurgischen Patienten handelt oder nicht. Junge männliche Chirurgen weisen eine erhöhte Affinität zu jungen Patientinnen auf. Desto höher die Affinität, desto relativer die Indikation zum operativen Eingriff. Im Hintergrund von akuten abdominellen Schmerzen und deren operativer Behandlung stehen nicht selten die seelischen Konflikte der chirurgischen Patienten. Krankheiten können im Leben eines Menschen große Erschütterungen auslösen, doch genau so können auch Erschütterungen Krankheiten verursachen. Wie sollte also das chirurgische Handeln organisiert sein, um diesem Wissen gerecht zu werden? Der erste Teil der chirurgischen Tätigkeit: Entscheiden, ob und wann ein Patient operiert werden soll. Es gilt zu entscheiden, ob eine absolute Operationsindikation vorliegt, das heißt eine Operation sofort stattfinden soll, oder ob es sich um eine relative Operationsindikation handelt. (Absolute Operationsindikation: zwei Chirurgen – eine Entscheidung; Relative Operationsindikation: zwei Chirurgen – viele Meinungen) Der zweite Teil des chirurgischen Handelns besteht im Durchführen der Operation. In diesem zweiten Teil der chirurgischen Tätigkeit lässt sich auf den ersten Blick keine Arzt-PatientenBeziehung erkennen, dennoch ist diese auch hier vorhanden. Der dritte Teil der chirurgischen Tätigkeit: Die postoperative Behandlung. Hier muss der Chirurg, wie schon im ersten Teil seiner Arbeit, große psychosoziale Fähigkeiten beweisen. Der Arzt ist nicht nur eine Maschine, die einen bestimmten Input liefert und einen bestimmten Output erzielt. Der Arzt ist gleichzeitig auch eine Art Seelsorger für den Patienten. Versteht er das nicht, wird er trotz guter technischer Fähigkeiten scheitern. Ein solches Scheitern kann 74 sich in postoperativen Komplikationen zeigen, beispielweise Wundheilungsstörungen oder Chronifizierungen. Die Phase des chirurgischen Handelns kann sehr kurz sein (z.B. bei Unfallopfern), dennoch werden hier die Weichen für den ganzen weitern Verlauf gestellt. Empathie ist ein wichtiges Handwerkszeug für die Arbeit eines Chirurgen. Der Patient sollte Erfahren, was für ihn wichtig ist und was er erfahren möchte, doch muss darauf Acht gegeben werden, nicht mit zu vielen Informationen Traumen bei dem Kranken auszulösen. Nur mit Empathie wird es dem Arzt gelingen hier das richtige Maß für jeden Patienten zu finden. Allerdings sollte nicht nur die Angst des Patienten in den Fokus gerückt werden. Besonders im zweiten Teil der chirurgischen Tätigkeit ist eine Angst auf Seiten des Chirurgen möglich; Angst vor Versagen oder vor zu hohen Patientenerwartungen können als Beispiele genannt werden. Der Chirurg muss also in der Lage sein während der Operation seine Emotionen unter Kontrolle zu halten. Zur Kontrolle der eigenen Emotionen gehört auch, die vielleicht negative Sympathie, die der Patient beim Arzt hervorgerufen hat, zu unterdrücken. Präoperative Konflikte, Probleme im Umgang mit körperlich oder charakterlich abstoßenden Patienten oder auch intraoperative technische Probleme wegen beispielweise Adipositas können intraoperative Entscheidungen negativ beeinflussen. Die Schlussfolgerung: In der Chirurgie, wie auch in allen anderen medizinischen Fachgebieten, darf keine Schematisierung der Krankheiten stattfinden. Die Voraussetzung hierfür ist eine „sprechende“ Chirurgie! Die Arzt-Patienten-Beziehung ist mindestens im gleichen Maße wichtig wie die technisch handwerklichen Fähigkeiten eines Chirurgen. Dies wird deutlich, wenn man sich vor Augen führt, in welchen Bereichen die gesundheitsbezogene Lebensqualität gemessen werden sollte: 75 - Eine psychische Komponente (Funktionsfähigkeit im Alltag) - Eine psychologische Komponente (psychisches Befinden, Emotionen) - Eine soziale Komponente (soziale Beziehungen) - Eine symptombeschreibende Komponente (körperliche Verfassung) 76 13. Psychosomatik in der Neurologie Jan Hofman 1. Definition Psychosomatik 2. Einführung 3. Neurologische Erkrankungen und psychische Sekundärsymptome 4. Therapie 1. Definition Psychosomatik Die Lehre der Psychosomatik bezieht sich ganz allgemein auf den Zusammenhang zwischen somatischen (körperlichen) Störungen, Symptomen oder Krankheitsbildern und der Psyche. Da viele körperliche Erkrankungen sehr komplex sind, geht man heute von Wechselwirkungen aus, die auf einem multifaktoriellen Geschehen basieren. So beeinflussen sich Körper, Psyche und Umwelt wechselseitig. Für das Verständnis dieser Wechselwirkungen benötigt man ein ganzheitliches Krankheitsverständnis, das alle biologischen, psychologischen und sozialen Ebenen berücksichtigt. So kann zum Beispiel jeder Mensch unter psychischen und psychosozialen Extrembelastungen körperlich erkranken. Dieselben Belastungsfaktoren können zu unterschiedlichen Erkrankungen führen. Verschiedenartige Stresssituationen wiederum können zur gleichen Krankheit führen. Bestimmte Menschen erkranken eher als andere, weil sie über unzureichende Bewältigungsstrategien verfügen und ihre Lebenssituation ungünstiger ist. Beispielsweise können Anspannung, Stress und anhaltende Probleme im beruflichen und privaten Leben zu schwerwiegenden Erkrankungen führen. Als eine der mittlerweile bekanntesten psychosomatischen Erkrankungen zählt das „Burnout-Syndrom“. Von Psychosomatischen Krankheiten spricht man also, wenn eine krankhafte Form von Körper-Seele-Beziehung besteht, d.h. körperliche und seelische Faktoren zusammenwirken, 77 die zum Entstehen und zum Verlauf einer Krankheit beitragen oder sie sogar auslösen. Die Psychosomatik bietet die Grundlage für Diagnostik, Verständnis und die Behandlung solcher kombinierter Störungsmuster. 2. Einführung Seelische Erkrankungen können sich körperlich manifestieren und körperliche Beschwerden und Schmerzen verursachen. Zu den häufig auftretenden psychosomatischen Beschwerden gehören zum Beispiel Schlaflosigkeit, Magen-/Darmbeschwerden, Bluthochdruck, Rückenschmerzen, Schwindel und Kopfschmerzen. Es kann auch zu „pseudoneurologischen“ (dissoziierten) Störungsbildern kommen wie zum Beispiel Lähmungen, ohne dass eine organische Ursache nachweisbar ist. Andererseits kann es auch bei bereits bestehenden neurologischen Erkrankungen zu psychosomatischen Begleitsymptomen kommen, die den Krankheitsverlauf und die Prognose beeinflussen. Neurologische Erkrankungen erfordern nach der akut- und intensivmedizinischen Primärversorgung nicht selten einen langwierigen Prozess der Rehabilitation. Bei solchen chronischen Krankheitsverläufen kommt es relativ häufig zu psychischen und psychosozialen Begleitsymptomen. Diese können sich in Angst, Depression, Erschöpfungszuständen, Resignation, gestörter Krankheitsbewältigung und in Fragstellung von Selbstwert und Lebenssinn äußern. Entstehen dadurch zusätzlich persönliche Konflikte in Partnerschaft und Familie, können die Betroffenen solchen Konfliktsituationen nicht dauerhaft standhalten. Sie entwickeln weitere körperliche Symptome. In beiden Fällen entstehen schwere Einschränkungen körperlicher Funktionen und Fähigkeiten, die sich auch auf den Krankheitsverlauf und die soziale Integration auswirken. Oft ist dann eine zusätzliche medizinisch (psycho-)therapeutische Versorgung erforderlich. 78 Im Folgenden werden einige wichtige neurologische Störungsbilder und die bei ihnen auftretenden sekundären psychosomatischen Begleitsymptome dargestellt, da auch für die erfolgreiche Rehabilitation der oftmals chronisch verlaufenden neurologischen Störungen die Mitbehandlung solcher Sekundärsymptome immer wichtiger wird. 3. Neurologische Erkrankungen und psychische Sekundärsymptome Zu den häufig vorkommenden neurologischen Erkrankungen gehören insbesondere der Hirninfarkt bzw. Hirnblutung, Multiple Sklerose, Morbus Parkinson, Polyneuropathien, chronische Schmerzen und das Cervical- und Lumbalsyndrom. 3.1 Cerebrovaskuläre Störungen Unter cerebrovaskulären Störungen versteht man Erkrankungen, die durch Veränderungen der Blutgefäße im Gehirn entstehen. Ursache ist meist eine arteriosklerotische Veränderung. Der Schlaganfall (Ischämie oder Hirnblutung) gehört hierbei zu der häufigsten Untergruppe (200/100 000 Einwohner pro Jahr) – Die Hirnläsion kann vielfältige Symptome verursachen wie z. B. eine Hemiparese, eine Sensibilitätsstörung, eine Aphasie (Sprachstörung), eine Dysarthrie (Sprechstörung) oder eine Dysphagie (Schluckstörung). Auch kognitive Störungen, Z.B. eine Störung des Gedächtnisses oder der Aufmerksamkeit können die Folge sein. Patienten erfahren nicht nur eine vollständige Veränderung ihres Lebens von einer Minute zur anderen, sie müssen auch mit den Folgen, mit den sozialen und beruflichen Auswirkungen ihrer Erkrankung zurechtkommen. Nach einem Schlaganfall kommt es neben anderen psychischen Störungen auch häufig zu einer Depression (ca. 30 – 50 %). Diese kann durch Veränderung des Hirnstoffwechsels entstehen, aber auch sekundär durch Reaktionen auf die körperlichen und kognitiven Beeinträchtigungen 79 psychische (sog. post stroke depression). Patienten, die an einer Aphasie leiden und dadurch in ihrer gesamten Kommunikation beeinträchtigt sind, sind davon besonders häufig betroffen. Aber auch bei Patienten, die sich nicht normal ernähren können, weil das Schlucken nicht richtig funktioniert, oder die vielleicht nur über eine Magensonde ernährt werden können, kann es zu einer Depression kommen. Die Patienten ziehen sich dann zurück, können von Therapien nicht gut profitieren, lernen schlechter und werden immer unzufriedener. Dies wiederum belastet die Familie zuhause stark, so dass es auch hier zur Dekompensation von Familienmitgliedern kommen kann. 3.2 Multiple Sklerose Die Multiple Sklerose (MS), auch als Encephalomyelitis disseminata (ED) bezeichnet, ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems. Sie ist neben der Epilepsie die häufigste neurologische Krankheit bei jungen Erwachsenen und von erheblicher sozialmedizinischer Bedeutung, da sie unbehandelt häufig zu Invalidität führt. Die Patienten haben oft große Probleme, die Krankheit zu akzeptieren. Dadurch treten begleitend oft Resignation und Depression auf. Bei der Multiplen Sklerose entstehen in der weißen Substanz von Gehirn und Rückenmark verstreut vielfache entzündliche Entmarkungsherde, die vermutlich durch den Angriff körpereigener Abwehrzellen auf die Myelinscheiden der Nervenzellfortsätze verursacht werden. (B + T-Lymphozyten). Es kommt auch zur axonalen Degeneration. Typische Symptome der Multiplen Sklerose sind Sehstörungen bei Optikusneuritis (Retrobulbärneuritis) als Erstmanifestation bei ca. 30 % der Patienten, allgemeine Schwäche, schnelle Ermüdbarkeit, Kribbeln, Spastiken, Lähmungen, Sensibilitäts-störungen, Ataxie, kognitive Störungen, Sprech- und Schluckstörungen. 80 Die MS kann – in Abhängigkeit von der Therapie – auch in den Zeiten ohne sichtbare Symptome aktiv sein („Die MS schläft nie“). Bei einem Schub behindern die aktiven Entzündungsherde (Läsionen) die Weiterleitung von Nervenimpulsen in den betroffenen Nervenfasern und lösen so neurologische Ausfallerscheinungen aus. Am Anfang der Erkrankung sind die Patientin jedoch trotz starker neurologischer Symptome oft noch euphorisch, häufiger jedoch sind sie schon depressiv verstimmt. Aus Angst vor einem erneuten Schub können Schmerzen und Missempfindungen ausgelöst werden. Die Patienten reagieren auf Stress im Alltag viel empfindlicher und sind dadurch schneller erschöpft. Sie haben oft das Gefühl, dass sie nichts mehr leisten können. Von anderen Menschen werden sie aber oft als faul und träge eingestuft. So haben viele Patienten große Probleme, die Krankheit zu akzeptieren und im Alltag damit klarzukommen. Dadurch treten begleitend Resignation und Depression auf. 3.3 Morbus Parkinson Die Parkinson-Erkrankung tritt mit einer Häufigkeit von 20 Erkrankungsfällen pro 100 000 Einwohner und Jahr auf. Sie ist die häufigste fortschreitende Erkrankung des Nervensystems. Sie macht sich im hohen Alter (zwischen 55 und 65 Jahren) bemerkbar, kann aber auch schon in jüngeren Jahren auftreten. Patienten bemerken in erster Linie eine Verlangsamung und Verminderung von spontanen und willkürlichen Bewegungen (Bradykinese/Akinese), eine Steifigkeit der Muskulatur (Rigor) oder ein Zittern (Tremor) der Arme und Beine in Ruhe. Akinese, Rigor und Tremor sowie posturale Instabilität sind die Hauptsymptome der Erkrankung. Sie sind auch die Ursache für Störungen der Stimmfunktion, des Sprechens/der Artikulation, der Atmung, des Schluckens und der Mimik (Hypomimie). 81 Zusätzlich können sogenannte vegetative Beschwerden wie Kreislaufstörungen, vermehrtes Schwitzen, Magen-Darm-Beschwerden, Blasenfunktionsstörungen auftreten. Auch Geruchsund Geschmacksstörungen sowie Störungen des REM-Schlafes können schon frühe Anzeichen der Erkrankung sein. Die Parkinson-Erkrankung ist eine langsam fortschreitende Erkrankung, bei der eine kleine Gruppe von NZ in der Substantia nigra in den Basalganglien des Gehirns zugrunde geht. Die genaue Ursache ist noch nicht geklärt. Die Erkrankung tritt in der Regel sporadisch auf, kann aber auch bei einzelnen Familien durch bestimmte Veränderungen des Erbmaterials verursacht werden. Durch die Schädigung in der Substantia nigra kommt es zu einer Störung des Dopaminstoffwechsels. Es wird vermutet, dass dadurch Parkinson-Patienten eine Veranlagung zur Depression haben. Im Verlauf der Erkrankung kann bei ca. 1/3 der Patienten eine Demenz entstehen. Viele leiden nach Erkrankung an s. g. mci-Störungen (minimal cognitive impairment), die das Leben im Alltag oder im Beruf erschweren. Auch das leise Sprechen, das oft streng oder gelangweilt aussehende Gesicht und der Speichel, der Pateinten aus dem Mund heraus laufen kann, sorgen im Alltag für große Probleme. Viele Patienten ziehen sich vom sozialen Leben zurück. Bedingt durch die Einnahme von dopaminergen Medikamenten, kann es sekundär auch zu Wahnstörungen (Halluzinationen), Störungen der Impulskontrolle, in Form einer Spiel- oder Kaufsucht, eines gesteigerten Essverhaltens oder zur Hypersexualität kommen, wodurch in der Beziehung zum Partner und in der Familie weitere Probleme entstehen, die Patient und Familienangehörige zusätzlich psychisch stark belasten, so dass zusätzlich zur medikamentösen Therapie psychotherapeutische Hilfe notwendig ist. 3.4. Polyneuropathie 82 Die Polyneuropathie zählt zu den Erkrankungen des peripheren Nervensystems. Sie betrifft Nerven, die außerhalb vom Gehirn und Rückenmark – dem zentralen Nervensystem – liegen. Die Folge sind Empfindungs- und Funktionsstörungen in der Körperregion, die von den geschädigten Nerven versorgt werden. Daraus können motorische, sensible oder autonome Funktionseinschränkungen entstehen. Eine Polyneuropathie ist kein eigenständiges Leiden, sondern Folge oder Symptom anderer Erkrankungen, z. B. Infektionen (Diphterie, Borreliose), Autoimmunerkrankungen (z. B. Guillain-Barre-Syndrom), Giften (Schwermetalle), Medikamenten (z. B. Chemotherapeutika), Tumoren, Diabetes mellitus, übermäßiger Alkoholgenuss oder Ernährungsdefiziten u. a.. Oft treten Symptome an den Füßen oder Beinen auf, später an den Händen. Es kann zu Missempfindungen, Kribbeln und Taubheit, zu brennenden Schmerzen oder übersteigerter Schmerzempfindlichkeit kommen. Die Behandlung der Polyneuropathie bezieht sich in erster Linie auf die Ursache. Wenn Patienten unter dauerhaften Schmerzen und Missempfindungen leiden, können auch Antidepressiva eingesetzt werden oder eine Schmerztherapie durchgeführt werden. Die Patienten leiden durch die ständigen Schmerzen und sind dadurch häufig depressiv. 3.5 Chronische Schmerzen Ca. 3,5 Millionen Menschen in Deutschland leiden an chronischen, meist neuropathischen Schmerzsyndromen, die auf Läsionen im ZNS oder PNS zurückzuführen sind. Nur bei einem geringen Teil der Patienten ist eine erfolgreiche medikamentöse Behandlung möglich. Wenn die medikamentösen und konservativen Maßnahmen fehlschlagen, muss man auf invasive Eingriffe zurückgreifen wie z. B. eine epidurale Rückenmarkstimulation als Therapie des komplexen regionalen Schmerz-Syndroms (CRPS). Am häufigsten tritt der Kopfschmerz vom Spannungstyp auf, der mit Depressionen ver-bunden sein kann. Ein Therapieansatz ist die Gabe von Antidepressiva. Da die Patienten im Beruf und in ihrem 83 Alltag oft eingeschränkt oder immer wieder krank sind, entstehen oft weitere zusätzliche psychische Belastungen bei der Arbeit oder in der Familie. 3.6 Cervical- und Lumbalsyndrom Das Cervical- und Lumbalsyndrom ist auch bekannt unter dem HWS-Syndrom, Cervikalgie, Nackenschmerzen, Kreuzschmerzen, Lumbalgie, Lumbago. Oft sind Menschen im Alter über 40 Jahre betroffen. Dieses Syndrom ist definiert, als akut auftretende Schmerzen im Bereich des Nackens und des Rückens, die nicht innerhalb der ersten sieben Tage wieder verschwinden, sondern sich chronisch manifestieren. Oft entstehen die Schmerzen an den Hauptbelastungspunkten der Wirbelsäule, selten im cervicalen und thorakalen Bereich. Ca. 200.000 – 300.000 Menschen leiden pro Jahr in Deutschland an dem HWS-syndrom. Das männliche Geschlecht überwiegt und jeder zweite Patient mit einer Spondylose weist psychosomatische Beschwerden auf wie Aufmerksamkeitsstörungen, hypochondrische Befürchtungen, dysphorische und depressive Verstimmungen mit Vitalstörungen, V. a. Schlaflosigkeit und Inappetenz, die wiederum ihren Alltag und das Leben in der Familie beeinflussen. Insgesamt leidet jeder Zehnte in Deutschland unter Lumbalgien, wovon die Hälfte chronifiziert. Bei der Psychogenese ist vor allem der unbewusste schmerzhafte Affekt ausschlaggebend, da ein anhaltender Körperschmerz entstehen kann, auch wenn anatomisch gesehen, keine körperliche Schädigung vorliegt. Je nach Schmerzstärke, Intensität und Schmerzdauer kann man sich besser oder schlechter daran erinnern. Ein Kreuzschmerz kann z. B. in die Cervicalregion aufsteigen und somit entwickelt sich aus einem Hexenschuss ein Ganzkörperrückenschmerz. Als Therapie sind hier Entspannungstherapie, Physiotherapie, Bewegung und Psycho-therapie anzuwenden. 84 4. Therapie 4.1 Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung & Gesundheit Die ICF beschreibt den Zustand eines Menschen in standardisierter Form in seiner Lebensgesamtheit, vor allem auch soziale Aspekte und entwickelt daraus Behandlungsziele, -verläufe und Weiterbehandlungsbedarf in einer allgemein verbindlichen Sprache mit dem Ziel der Wiedereingliederung und Teilhabe. Sie wurde 2011 im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelt und verabschiedet. Die ICF stellt damit einen theoretischen Rahmen für die moderne (Neuro-)Rehabilitation zur Verfügung. Sie erweitert die medizinische, Symptom orientierte Perspektive der Rehabilitation um die soziale Perspektive. Damit rückt die Teilhabe behinderter Menschen an den für sie wichtigen Lebensbereichen in den Mittelpunkt der medizinischen und therapeutischen Behandlung. Auf der Basis dieses Krankheitsmodells ist es möglich, Aussagen zu treffen, mit welchen Schwierigkeiten der Betroffene im Alltag aufgrund seiner Behinderung zu kämpfen hat und welche sozialen Auswirkungen seine Erkrankung für ihn hat. Auch kann man darüber herausfinden über welche Ressourcen und Hilfen der Betroffene verfügt, um mit seinen Beeinträchtigungen besser zurechtzukommen. Erstmals wird auch der gesamte Hintergrund einer erkrankten Person betrachtet. Dazu gehören, z. B. soziale Beziehungen (wie lebt der Patient, welche Freizeitaktivitäten und Hobbies hatte er) und die Umwelt (z. B. in welchem Stock wohnt der Betroffene, gibt es einen Aufzug, wie ist die Verkehrsanbindung). Am Beispiel eines Patienten mit Schlaganfall soll das ICF-Schema verdeutlicht werden: 85 Dieses bio-psycho-soziale Krankheitsmodell bietet eine gute Grundlage für die Behandlung kombinierter psychosomatischer Störungsmuster wie die oben beschriebenen Erkrankungen, mit ihren begleitenden psychischen und sozialen Folgen. Die psychosomatischen Beschwerden der Patienten müssen genauso ernst genommen werden wie die vorhandenen Grunderkrankungen. Für die Behandlung betroffener Patienten ist eine Mischung aus der körperlichen Behandlung der Symptome und einer Psychotherapie zur Behandlung der psychischen Ursachen notwendig. 86 Quellen: 1) http://www.med.de/lexikon/psychosomatisch.html 2) http://flexikon.doccheck.com/de/Psychosomatik 3) http://www.klinik-am-osterbach.de/neurologie-mit-neurologischer ... 4) Gehirn, Psyche und Körper – Neurobiologie von Psychosomatik und Psychotherapie Johann Caspar Rüegg (5. Auflage) 5) ISF – Praxisleitfaden 2 Trägerübergreifende Informationen und Anregungen für die praktische Nutzung der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) 87 14. Belastungsstörungen Noemi Kuld und Elena Jones Einleitung: Unter dem Sammelbegriff Belastungsstörungen versteht man verschiedene Reaktionen auf belastende Lebensereignisse von Patienten die sich als Akute Belastungsstörungen, Posttraumatische Belastungsstörungen oder Anpassungsstörungen zeigen können. Folgende Krankeitsbilder werden in diesem Kapitel dargestellet: F.43.0 Akute Belastungstörung F43.1 Posttraumatische Belastungsstörung(PTSB: Posttraumatic Stress Disorder) F43.2 Anpassungsstörung Die akute Belastungsstörung, die Posttraumatische Belastungsstörung, sowie die komplexe Posttraumatische Belastungsstörung, die allerdings derzeit erst als langfristige Folge traumatischer Erfahrungen im Kindes- und Jugendalter diskutiert wird, sind spezifische Reaktionen auf traumatische Erfahrungen. Dagegen treten Anpassungsstörungen nach kritischen Lebensereignissen wie Scheidung, Arbeitsplatzverlust oder Verlust eines Angehörigen auf. Der Unterschied zwischen einer traumatischen Erfahrung und einem kritischen Lebenereignis ist die Plötzlichkeit und das Ausmaß der Erfahrung sowie das Überwältigtwerden von Hilflosigkeit. 88 (Flatten, Leitfaden Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, S.465) Spezifische Traumafolgen Definition Trauma: Als psychisches Trauma verstehen wir eine Reaktion auf eine Situation von katastrophalem Ausmaß, welche bei der betroffenen Person ein Erleben von Hilflosigkeit oder Ausgeliefertsein hervorruft. Nicht entscheidend ist dabei das objektive Ausmaß der Verletzung, sondern das subjektive Erleben von Lebensbedrohung, Hilflosigkeit, Ohnmacht und Kontrollverlust, ob als Betroffener oder als Zeuge der Situation. Dabei kommt es oft zu einer Erschütterung des Selbst- und Weltverständnisses. (Flatten et al. 2004, S.3 ff) Die traumatische Erfahrung ist eine Hochstresssituation, welche die Informationsverarbeitungsfähigkeit der Psyche in diesem Moment überfordert. Dadurch kommt es zu einer strukturellen Dissoziation von gespeichertem Wissen über die Situation (Hippocampus und Frontalhirn) und gespeicherten nonverbalem Erleben der Situation (Amygdala). Dadurch entstehen: Drei Hauptsymptombereiche: Diese sind das Wiedererleben, die Vermeidung und die Übererregung (das Angstäquivalent). Das Wiedererleben (Intrusion) ist die zurück Versetzung in die Situation in Form von Erinnerungen als Flashbacks (bildliche Erinnerung) oder Intrusionen. Die Vermeidung kann 89 Orte, Menschen, Gerüche, Aktivitäten, Hobbies und weiteres betreffen, welches den Betroffen an das Traumatische Ereignis erinnern könnte. Die Verdrängung kann bis zur Amnesie führen.Die Übererregung (Hyperarousal,Angstäquivalent) zeichnet sich durch Reizbarkeit, Schlaflosigkeit, Wutausbrüche, Hypervigilanz und Schreckhaftigkeit aus (Saß et al. 2003). Übererregung und Wiederleben sind durch Amygdalaaktivierung vermieden duch eine Unterdrückung der Amygdalaaktivierung. bedingt. Dies wird Nach der akuten Erfahrung tritt diese Symptomatik als akute Belastungsreaktion auf, wenn diese nicht von selbst ausheilt oder behandelt wird, sprechen wir nach einem Monat von einer Posttraumatischen Belastungsstörung. Die akute Belastungsreaktion ist eine normale Reaktion auf ein katastrophales Ereignis, welche meist selbst ausheilt, die PTBS eine Folgeerkrankung, die in der Regel der Behandlung bedarf. Interaktionsmodel Posttraumatischer Prozesse modifiziert nach Maercker 1997 Schutzfaktoren • Kohärenzsinn • soziale Unterstützung • medizinisches Behandlungsmanagment • Ressourcenorientierte Stabilisierung Ereignisfaktoren • Traumaschwere • Unerwartetheit • Unkontrollierbarkeit Posttraumatischer Prozess Traumafolgen Intrusion • Dissoziatve Störungen • Angst • Depression • Somatisierung • Sucht Hyperarousal Vermeidung Dissoziation Risikofaktoren • Alter bei Traumatisierung • Sensibilisierung durch Vortraumatisierung • Prämorbide psychische Störungen 90 • PTSD Die höchste Signifikanz als Schutzfaktor vor PTBS kommt dabei der sozialen Unterstützung nach dem Ereignis zu, Unverständnis durch Erstversorger oder unzureichende Schmerzversorgung erhöhen das Risiko später eine PTBS zu entwickeln. Trauma- Typen: Typ 1, gekennzeichnet durch eine einmalige Situation von kurzer Dauer z.B. Unfälle und Überfälle. Typ 2 folgt dagegen längeren und häufigeren Situationen, hier für sind Folter oder auch wiederholte Vergewaltigungen Beispiele. Diagnose PTBS: Es müssen diagnostische Kriterien A-F vorhanden sein, diese sind nach DSM-IV klassifiziert. A. Es muss ein traumatisierendes Ereignis stattgefunden haben. 1. Die betroffene Person muss Lebensbedrohung oder Todesangst und ernsthafte Verletzungen entweder eines Selbst oder einer anderen Person erlebt haben. 2. Die Reaktion der betroffenen Person beinhaltet das Gefühl von Kontrollverlust, intensiver Angst und Fassungslosigkeit. B. Es kommt zum Wiedererleben des Traumas bei der betroffenen Person in Form (1 von 3 müssen erfüllt sein) 1. Wiederkehrende und eindringliche belastende Erinnerungen 2. Wiederkehrende belastende Träume von dem Ereignis 3. Handeln oder Fühlen, als ob das traumatische Ereignis wiederkehrt C. Anhaltende Vermeidung von Reizen, die mit dem Trauma verbunden sind, oder eine Abflachung der allgemeinen Reagibilität. (3 von 7 müssen erfüllt sein) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Bewusstes Vermeiden von Gedanken, Gefühlen oder Gesprächen Bewusstes Vermeiden von Aktivitäten, Orten und Menschen Unfähigkeit, einen wichtigen Aspekt des Traumas zu erinnern Deutlich vermindertes Interesse oder verminderte Teilnahme an wichtigen Aktivitäten Gefühl der Losgelöstheit oder Entfremdung von anderen Eingeschränkte Bandbreite des Affekts Gefühl einer eingeschränkten Zukunft D. Anhaltende Symptome von Übererregung (2 von 5 müssen erfüllt sein) 1. 2. 3. 4. 5. Schwierigkeiten ein- oder durchzuschlafen Reizbarkeit oder Wutausbrüche Konzentrationsschwierigkeiten Übermäßige Wachsamkeit Übertriebene Schreckreaktion 91 E. Die Symptome halten länger als einen Monat an. F. Der Betroffene leidet unter den Symptomen und es kommt zu Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen und anderen wichtigen Lebensaspekten. (nach Flatten et al. 2001) Prävalenz: Liegt nach: Vergewaltigung bei ca. 50 % Gewaltverbrechen bei ca. 25 % Kriegsereignissen bei ca. 20 % schweren Unfallereignissen bei ca. 15% schweren Organerkrankungen bei ca. 15-25%. (Tabelle 1, Nach G.Flatten, Leitfaden Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, S.464) F.43.2 Anpassungsstörungen: Definition: Anpassungsstörungen entstehen in Folge einer entscheidenden Lebensveränderung. Es gibt die Allgemeine Anpassungsstörung z.B. Veränderung des sozialen Umfeldes (Tod einer geliebten Person etc.) oder bei Migration (Kulturschock). Zudem gibt es auch die Anpassungsstörung bei somatischen Erkrankungen sowie die Amputation eines Beines oder Krebs-Diagnose. Im Gegensatz zur Posttraumatischen Belastungsstörung stehen bei Anpassungsstörungen Ängste und Depressionen im Vordergrund. Die Betroffenen kommen selbst in Alltagssituationen nicht mehr zurecht und hinzu kommen oftmals Alkohol und Nikotin Missbrauch. Einteilung nach Symptomatik: F.43.20 F.43.21 F.43.22 F.43.23 F.43.24 kurze depressive Reaktion längere depressive Reaktion Angst und depressive Reaktion gemischt mit vorwiegender Beeinträchtigung von anderen Gefühlen mit vorwiegender Störung des Sozialverhaltens Literatur: P.L. Janssen, P. Joaschky, Leitfaden Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Deutscher Ärzte Verlag, 2009 92 Iris Veit, Praxis der Psychosomatischen Grundversorgung, W. Kohlhammer, 2010 Prof. Dr. S.O. Hoffmann, Dr. G. Hochapfel, Einführung in die Neurosenlehre und Psychosomatische Medizin, F.K. Schattauer, 1991 T. von Uexküll, Psychosomatische Medizin, Urban und Fischer, 2003 http://www.psychosomatik.unigoettingen.de/download/51%20Vorlesung%20Anpassungsstoerungen.pdf 93 15. Der Allgemeinarzt als Psychosomatiker Liseth Gehlen und Sophia Kettenhofen Untersuchungen haben ergeben, dass ein Mensch in seinem Leben circa 600 Gesundheitsstörungen durchlebt. Im Schnitt sucht er 160 mal einen Allgemeinarzt und 20 mal einen Facharzt auf. Bei steigendem Ärztemangel bedeutet das für den Allgemeinarzt, dass er bis zu 100 Patienten pro Tag behandelt, wovon circa 20 Neuzugänge sind. Durchschnittlich hat er also nur etwa 3,5 Minuten Zeit für Diagnose und Therapie. Der Allgemeinarzt hat gegenüber den meisten anderen Fachrichtungen die Besonderheit, dass er den entscheidenden Erstkontakt zwischen Arzt und Patient herstellt. Im günstigsten Fall kommt es zu einem relativ engen Arzt-Patienten-Verhältnis, welches häufig, ganz im Sinne des klassischen Familienarztes, generationenübergreifend wird. Dann ist es üblich, dass er seine Patienten über einen längeren Zeitraum beobachtet und betreut, wobei Ihm aber nur wenig technische Hilfsmittel zur Verfügung stehen und auch fachärztlicher Rat ist schwerer zu erreichen. In seinem breitgefächerten Tätigkeitsfeld muss er sich dementsprechend auf das Wesentliche beschränken und die Fähigkeit besitzen durch seine genauen Beobachtungen gute und sichere Entscheidungen zu treffen. Hierbei bildet der diagnostisch-therapeutische-Zirkel eine Einheit. Für die Früherkennung von somatischen, psychosomatischen und neurotischen Erkrankungen ist die Einschätzung des Allgemeinarztes besonders wichtig um Chronifizierungen zu verhindern und prophylaktische Behandlung anzusetzen. Genau hier zeigen sich bis heute Probleme: Viele Ärzte werden nur somatisch orientiert ausgebildet. Der alltägliche Zeitdruck in den Arztpraxen erschwert die Arbeit zusätzlich und Krankheiten, die sich auf psychosoziale Aspekte beziehen, werden häufig nicht von den Krankenversicherungen übernommen. Gesellschaft, Ärzte und Patienten begegnen diesem Behandlungsansatz häufig mit Widerstand. Der Arzt, der sich mit den emotionalen Problemen des Patienten auseinander setzt Muss sich dann auch mit seinen eigenen Emotionen beschäftigen. Auch wollen die Patienten häufig, dass sich ihr Arzt nur mit den möglicherweise vorgeschobenen körperlichen Symptomen beschäftigt und nicht mit den wahren Hintergründen. Und schließlich ist unser Gesundheitssystem auf körperbezogene Leistungen ausgerichtet, wobei der Psychosomatik nur wenig Bedeutung zukommt oder sie gar Ablehnung erfährt. 94 1957 beschrieb Bálint den Erstkontakt als einen „unorganisierten Krankheitsprozess, der sich allmählich um ein Symptom herum organisiert“. Im Erstkontakt besteht die einmalige Chance, dass Krankheitsgeschehen des Patienten richtig zu verstehen und zu bewerten. Fehlgedeutete oder nicht erkannte psychosomatische Befunde können zu weiteren somatischen Erkrankungen führen. Zufällig entdeckte Nebenbefunde können die psychosomatischen Hauptbefunde verdecken. Häufig folgen dann unnötige, belastende und teure Tests. Gerade für den Patienten kann das fatale Auswirkungen haben und auch die Krankenkassen werden unnötig finanziell belastet. Einige Fallbeispiele belegen diese These: Fallbeispiel 1 Eine junge Frau erkrankt in Abwesenheit ihres Ehemanns an nächtlichen Herz- und Angstbeschwerden. Szenario 1: Beim Erstkontakt wird der Ehemann nicht erwähnt. Sie wird als herzkrank diagnostiziert und zum Kardiologen weitergeleitet. Szenario 2: Der Ehemann wird erwähnt. Der Arzt erkennt einen Zusammenhang zwischen der Symptomatik und den Beziehungsproblemen. Um nichts zu übersehen kommt es auch zu einer Herzuntersuchung aber die psychotherapeutische Beratung steht im Vordergrund. Fallbeispiel 2: Ein 29 jähriger Metzgermeister hat folgende Beschwerden: Magenschmerzen, Völlegefühl, Blässe, nächtliche Koliken, Schlafstörungen und gestörte Tagesvigilanz sowie Gewichtsverlust. Er erwähnt, dass Bier den Schmerz „betäubt“. Erfolglos konsultiert er zahlreiche Ärzte, die unter anderem Gastritis, nervöse Magenbeschwerden, Subazidität, Ulkusverdacht, Erkrankungen des Pankreas, Leber- und Gallenerkrankungen diagnostizieren. Es folgen verschiedene Heilkuren mit nur kurzfristigen Erfolgen. Wegen der Misserfolge verzweifelt der Patient immer mehr und die Symptome verschlimmern sich. Schließlich erfasst man in 12 Sitzungen sein psychodynamisches Profil: Der Vater des vom Land stammenden Metzgers war kränklich, streng und jähzornig. Die Mutter ist die gute Seele der Familie, die sich um die 8 Kinder kümmert. Während seiner Lehrzeit hatte er großes Heimweh, aber aus Angst vor dem Vater wollte er nicht nach Hause gehen. Nach vollendeter Lehrzeit kam es zu einem großen Streit und Zerwürfnis mit dem Vater. Anschließend wurde er Geselle bei einem Metzger, der ihn wie einen Sohn behandelte. Während dieser Zeit sammelt er seine ersten sexuellen Erfahrungen mit einer Witwe, was zu Schuldgefühlen führte. Als der Vater an Magenkrebs stirbt, beginnen seine Beschwerden. 95 Noch schwerere Schuldgefühle kommen auf, nachdem er eine Affäre mit Ehefrau des Meisters beginnt. Inzwischen ist er verheiratet und hat eine eigene Metzgerei. Er hat Eifersuchtsängste, dass seine Frau fremdgeht. Die Kliniker rieten ihm, sein Geschäft aufzugeben und in einem festen Angestelltenverhältnis zu arbeiten, aber der erhoffte Erfolg blieb aus. Die Diagnose der Psychosomatiker lautet wie folgt: Ödipustrauma, Angst und Schuld, wobei die Magenbeschwerden als konversionsneurotische Identifikation mit dem Vater zu verstehen sind. Das Fallbeispiel verdeutlicht die Relevanz des Erstgesprächs: Durch die Reduktion auf organischchemische und physikalische Beschwerden wurden wichtige pathogenetische Faktoren übersehen. Die Chance eine sich anbahnende neurotische Entwicklung im Entstehen therapeutisch abzufangen wurde verpasst. Eine große Rolle in der Beziehung zwischen Arzt und Patienten spielt das gegenseitige Vertrauen, welches durch verschiedene Faktoren unterstützt wird. Zum Einen berühren sich häufig der Wohnund Arbeitsbereich. Das bedeutet, dass sich Arzt und Patient nicht nur in der Praxis begegnen sondern eventuell auch im Supermarkt oder auf der Straße. Darüber hinaus ist der Hausarzt oft auch behandelnder Arzt der ganzen Familie und erlangt so Kenntnisse über das familiäre Milieu und den Hintergrund. Diese Faktoren führen dazu, dass der Hausarzt nicht nur die Krankengeschichten seiner Patienten kennt, sondern auch ihr Umfeld und mögliche Verhaltensweisen und mit diesen Informationen seine Diagnosen unterfüttern kann. Fallbeispiel 3: Im folgenden Fallbeispiel wird verdeutlicht welche Rolle ein intaktes Vertrauensverhältnis und die jahrelange Begleitung eines Patienten in der Aufstellung einer Diagnose spielen. Zum Patienten: Der Patient ist 44 Jahre alt, mit einer zwei Jahre jüngeren Frau verheiratet aber kinderlos. Vor geraumer Zeit ist er mit seinem Unternehmen insolvent gegangen, es gelang ihm aber eine neue Existenz mit seiner Frau aufzubauen. Krankengeschichte: Vor zehn Jahren beklagte sich der Patient über wiederkehrende depressive Verstimmungen und Oberbauchbeschwerden. Die Oberbauchbeschwerden wurden als Ulcus duodeni diagnostiziert und erfolgreich therapiert. In den letzten Jahren kam der Patient nur noch in die Arztpraxis um Bescheinigungen für Finanzamt oder Gericht zu bekommen, die er aufgrund mehrerer Unfälle benötigte. Bei einer Routine Laboruntersuchung fiel dem Arzt auf, dass der Patient alkoholische Leberschäden aufweist. Allerdings lässt er sich nicht auf eine Behandlung ein. Eines Tages erscheint die verzweifelte Ehefrau in der Arztpraxis und berichtet, dass der Ehemann aufgrund eines erneuten Autounfalls zum 3. Mal den Führerschein entzogen bekommt. Des weiteren berichtet 96 sie über deliriumartige Zustände ihres Ehemanns, die zu einer Gefährdung des florierenden Geschäfts führen. Die Rolle des Arztes: Wichtig für den Arzt ist nun heraus zu finden, in welchem engeren Zusammenhang die einzelnen Grunderkrankungen des Patienten stehen um ihn erfolgreich behandeln zu können. Z. B. stellt sich die Frage ob die Depressionen Ursprung des Alkoholkonsums, des Ulkusleidens und der familiären Probleme sind oder ob familiäre Probleme zu Depressionen und Alkoholkonsum führten? Im Alltag gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen den Rollen von Kliniker und Allgemeinarzt in der Patientenbetreuung. Die Rolle des Klinikers ist häufig von sehr begrenztem Charakter, da er für diagnostische Abklärung und therapeutische Maßnahmen oft auf einen sehr kurzen Zeitraum beschränkt ist und die Diagnostik meist auf verschiedene Fachärzte verteilt wird. Im Gegensatz dazu hat der Allgemeinarzt eher einen betreuenden Charakter. Er begleitet den Patienten über einen langen Zeitraum und übernimmt die meiste Diagnostik und Therapie selber. Für den Allgemeinarzt ist es wichtig bereits den Erwerb von psychosomatischen Erkrankungen zu verhindern beziehungsweise durch Prophylaxe einen Ausbruch der Erkrankung zu vermeiden. Die Bereitschaft mit psychoneurotischen und psychosomatischen Erkrankungen zu reagieren wird bereits in den ersten Lebensjahren erworben. Die Auslösung und Aufrechterhaltung dieses Krankheitsgeschehens hängt aber vor allem von den jeweiligen Belastungssituationen ab. Die Prophylaxe von psychosomatischen Erkrankungen lässt sich in drei Stadien einteilen. Primär ist es natürlich am wichtigsten eine Krankheitsbereitschaft gar nicht erst entstehen zu lassen. Hier spielt es auch eine wichtige Rolle, Eltern in Bezug auf richtiges Verhalten bei der Erziehung zu beraten. Sekundär sollte verhindert werden, dass es zum Aufbrechen bereits manifester Erkrankungen kommt und tertiär muss eine Chronifizierung vermieden werden. Zu den Patientengruppen die eine Sekundär- und Tertiärprophylaxe in Anspruch nehmen gehören Patienten, die unter ihrer akuten Erkrankung leiden und sich eine Abklärung und Beseitigung wünschen, Patienten, die ihr chronisches Leiden behandeln lassen wollen oder Patienten, die sich noch nicht als krank empfinden, die aber aufgrund der Vorbeugung und Gesundheitsberatung den Arzt aufsuchen. Die Verantwortung des Arztes ist gegenüber der ersten Patientengruppe am umfangreichsten und folgeschwersten, da diese Patienten sich in einer Akutsituation befinden. Bei der Versorgung der chronisch Kranken der zweiten Patientengruppe lassen sich häufig Rezidive vermeiden, wenn der Arzt in die Psychodynamik des Krankheitsgeschehens eingreift. Z. B. bei einem an KHK leidenden Patienten der viel unter Stress steht, ist es wichtig, dass es dem Arzt gelingt, den 97 zwanghaft an Leistung gebundenen Lebensstil seines Patienten zu ändern und so einem Infarkt vorzubeugen. Reine Neurosen nehmen 1/3 aller Erkrankungen ein und gehen häufig mit organbezogenen Beschwerden wie Herzklopfen, Zittern und Schweißausbrüchen einher. Daher ist meist die erste Anlaufstelle der Betroffenen der Allgemeinarzt und nicht ein Psychotherapeut. Aufgrund von Zeitmangel und Unterbesetzung wird häufig kein ausreichendes Erstinterview geführt und es kommt zum „Facharzt-Hopping“. Trotz der so entstehenden vielseitigen klinischen Diagnosen kommt es nicht zur Aufklärung der Krankheit sondern zu deren Chronifizierung. Somit kann man sagen, dass die bei Neurosen durchgeführten Organuntersuchungen psychotoxisch wirken. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch ein ausführliches Erstgespräch bei dem auch psychodynamische Determinanten bestimmt werden, Facharzt-Hopping vermieden und mit einer sinnvollen Vorsorge viel Leid, Chronifizierung von Krankheiten und Kosten erspart werden können. Quelle: Wesiack, W.: Der Allgemeinarzt als Psychsomatiker, in: Heigl-Evers, A. U. Rosin (Hrsg.), 1989: Psychotherapie in der ärztlichen Praxis, Verlag für Medizinische Psychologie-Vandenhoeck, Götingen, S. 126-141. 98 Nachwort Andor Harrach Der Kurs Psychosomatik setzt sich zum Ziel, möglichst vielen Studentinnen und Studenten eine erste Annäherung an die komplexe Thematik zu ermöglichen. Im weitgehend somatisch orientierten Unterrichtsalltag wird das Thema überwiegend ausgeklammert. Im klinischen Studiensequenz soll die bio-psycho-soziale Denkweise einerseits longitudinal (fortlaufend bis zum Ende des Studiums), zum anderen horizontal-querschittsmässig als in allen Fächern gegenwärtiges Thema zur Darstellung kommen. Das bio-psycho-soziales Modell beinhaltet einerseits die in Erkrankungen wirksamen psychischen, soziokulturellen, ökologischen und ökonomische Kräfte, andererseits auch die wirkungsvolle Präsenz dieser Kräfte im medizinischen Versorgungssystem und in den Bildungs-, Weiterbildungs- und Fortbildunssystemen selbst. Diese Betrachtung garantiert, dass Humanmedizin auch eine humane Medizin wird. Die hier vorgelegten studentischen Arbeiten werfen vielerlei wohltuende Blitzlichter auf diese Themen. Die Arbeiten sind durch individuelle Impulse der Studenten entstanden, sie spiegeln deren Wissensstand, ihre keimenden Interesse an einer humanistischen Medizin, und zwar ganz von Anfang an hoffentlich dauerhaft ihre berufliche Sozialisation prägend. Es sind keine Arbeiten mit letztem wissenschaflichem Anspruch, sondern Flugversuche, Annäherungen, ehrliche Auseinadersetzungen mit ihrer Umwelt und mit sich selber, mit der eigenen Emotionalität und Lebensplanung, mit der Methodik des Schreibens, mit den modernen Methoden der Literatursammlung (da Bücher wälzen und in Zeitschriften zu blättern eine immer kleinere Rolle spielt). Ihrer eigenen Kreativität in der Gestaltung sollte viel Spielraum gelassen werden. Diese Beiträge sollten in ihrer Gesamtheit betrachtet werden, denn so entfalten die Inhalte ihre Wirkung in Richtung der psychosomatischen Haltung, was vielleicht das Hauptanliegen des Kurses ist. Wir glauben, dass diese frühe Prägung von grundsätzlicher Bedeutung ist. 99