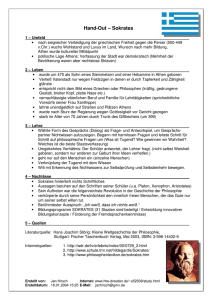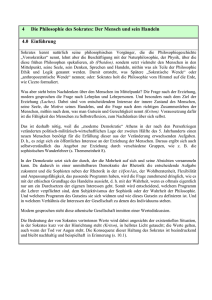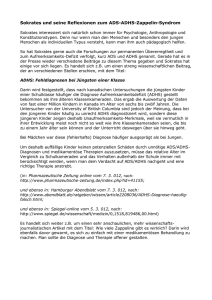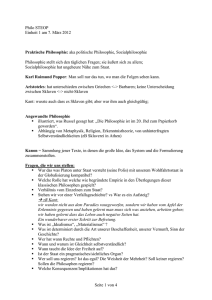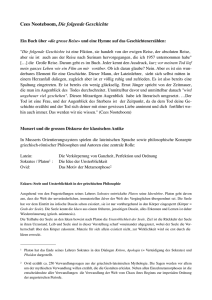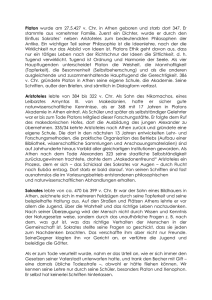Abgrenzung, Vorgehensweise
Werbung

Alfred Dunshirn Unterlagen zur Vorlesung: Geschichte der Philosophie I (Antike) (Sommersemester 2008) Inhalt: Einleitung ................................................................................................................................... 2 Übersicht über die Orientierungsfragen ..................................................................................... 6 Homer ......................................................................................................................................... 8 Platon ........................................................................................................................................ 14 Aristoteles............................................................................................................................... 118 Literatur .................................................................................................................................. 148 Für Hinweise zur Korrektur bin ich sehr dankbar. (Alfred Dunshirn, Universitätsstraße 7, 1010 Wien. e-mail: [email protected]) 1 Einleitung Abgrenzung des Themas Mit Antike ist hier nicht ein Zeitraum der Menschheitsgeschichte auf dem Globus gemeint, den man irgendwann einsetzen lässt und der irgendwann aufhört. Gemeint ist vielmehr die abendländische Antike. Von dieser wiederum wird sich die Vorlesung des kommenden Semesters hauptsächlich auf die griechische Antike beschränken. Innerhalb dieser so genannten griechischen Antike wiederum werden wir uns hauptsächlich auf das vierte vorchristliche Jahrhundert beschränken. Dieses vierte Jahrhundert vor Christus begrenzt die Zeitspanne, in welcher PLATON und ARISTOTELES lebten. Nun kann man diese Beschränkung in vielfältiger Weise kritisieren. Man mag einwenden, dass bei dieser Abgrenzung gänzlich die außereuropäische Philosophie außer Acht bleibt. Dies stimmt. Des Weiteren mag man bemängeln, dass bei der Einengung auf beinahe ein Jahrhundert viele Traditionslinien selbst der abendländischen Philosophie unbeachtet bleiben. Dies hat ebenso wie der erste Einwand seine Berechtigung. Vor allem aber gegen letzteren Einwand soll die oben beschriebene Beschränkung plausibel gemacht werden. Dass nämlich Überblicksdarstellungen der so genannten antiken Philosophie sich auf die abendländische Philosophie einschränken, ist weit verbreitet. Würden sie allerdings hauptsächlich Platon und Aristoteles besprechen, erschiene dies erklärungsbedürftig. Hier soll diese Erklärung durch einen Hinweis auf den Studienplan des Bakkalaureatsstudiums erfolgen. In diesem in gewisser Weise sechssemestrigen Studium kann es meines Erachtens durchaus vorkommen, dass Sie außerhalb einer solchen Lehrveranstaltung zur Philosophie der Antike nie gesondert mit Platon oder Aristoteles konfrontiert werden. Freilich wird auf diese in Vorlesungen zur Ideengeschichte oder theoretischen wie praktischen Philosophie wohl hie und da Bezug genommen werden. Jedoch ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass Sie an einer eigens Platon oder Aristoteles gewidmeten Vorlesung teilnehmen werden können. Auch die Wahrscheinlichkeit, an einem Proseminar zu einem Text dieser Philosophen teilzunehmen, ist gering. Die geringe Wahrscheinlichkeit liegt in der momentanen schwachen Vertretung der antiken Philosophie am hiesigen Institut für Philosophie begründet. Doch ist es zum Verständnis vieler aktueller Problemstellungen bei diversen Philosophen unumgänglich, die antike Diskussion zu kennen. Diese lässt sich nur schwer kenntlich machen aus allgemein gehaltenen Philosophiegeschichten. Noch sinnloser ist dieses Zurückgreifen auf Einführungswerke, wenn es darum geht, so genannte moderne gegen antike Positionen abzuheben und unterschiedliche Konzepte zu ver2 gleichen. Ein solcher Vergleich kann beispielsweise im Bereich der Erkenntnistheorie angebracht erscheinen. Hier kann sich alsbald zeigen, dass ein Vergleich nur durch direkte Lektüre der Originaltexte möglich ist. Als Beispiel sei genannt ein Vergleich von Kants Kritik der reinen Vernunft und ARISTOTELES’ Schrift De anima. Damit soll begründet werden, warum Ihnen im Folgenden eine relativ ausführliche Darstellung der überlieferten Schriften des Platon und Aristoteles gegeben werden soll. Das heißt Sie sollen eingängige Sachinformation darüber erhalten, was Sie wo in welchem Text des Platon oder Aristoteles finden können. Dies soll Ihnen im Kontext mit anderen Philosophen die Möglichkeit geben, im konkreten Einzelfall auf den Diskussionsbereich in der antiken Philosophie zurückfinden zu können. Nun einige Worte zur Vorgehensweise. Vorgehensweise Ich gedenke am Anfang einer Vorlesungseinheit einige Fragen zu stellen, die dann in der jeweiligen Einheit geklärt werden sollen. Eine solche Frage kann zum Beispiel lauten: „Welche Fragen, die für das Gesamtwerk Platons charakteristisch sind, klingen im Euthyphron an?“. Einige derartiger Fragen werden also jeweils zu Beginn aufgeworfen und sollen am Ende jeder Einheit beantwortet werden. Diese Beantwortung soll zugleich als Wiederholung des Besprochenen dienen. Für Sie sollen diese Fragen zugleich auch einen Leitfaden beim Zuhören geben können - Sie können für sich selbst im Verfolg der Vorlesung versuchen, die Antworten auf die Fragen zu geben. Die Gesamtheit der Fragen, die über das Semester hin gestellt und hoffentlich beantwortet werden, dient dann als Fragenkatalog für die schriftliche Prüfung. Daneben soll jeweils am Ende ein gewisser Zeitraum bleiben für Nachfragen bzw. Ergänzungen oder Korrekturen ihrerseits. Dies soll umgekehrt nicht heißen, dass Sie nicht auch eingeladen sind, ad hoc Fragen zu stellen. Wenn Sie also während ich rede, Fragen haben, stellen Sie diese bitte ohne Scheu. Durchaus kann es ja vorkommen, dass ich einen Namen oder Werktitel, den ich nenne, nicht deutlich genug ausspreche oder an die Tafel schreibe. Die Hörsaalverwaltung lässt es wohl nicht zu, nach 45 Minuten eine Pause einzulegen, was mir sehr recht wäre. Wenn ich sagte, Sie bekämen im Endeffekt einen Fragenkatalog zur Hand, so birgt dies eine Gefahr in sich. Sie könnten vermeinen, mit diesen Fragen und ihrer korrekten Beantwortung über den dargestellten Inhalt zu verfügen. Dies wird wohl keineswegs so sein. Sie sollten nicht denken, nach einem Semester über den dargestellten Inhalt, die Werke Platons und Aristoteles zu verfügen. Sie werden lediglich über eine Inhaltsangabe verfügen. Dies mit philoso3 phischem Leben zu erfüllen bleibt ihre eigene Aufgabe. Dies wiederum ist eine Aufgabe für Jahrzehnte. Aus der Akademie Platos ist bekannt, dass man sich mehrere Jahrzehnte dem Studium Platos widmen sollte, bevor man als einer galt, der zur eigentlichen Erkenntnis des höchsten Lehrgegenstandes geführt werden sollte. An den Werken des Aristoteles andererseits ist schon aufgrund ihrer äußeren Gestalt offenkundig, dass sie nicht dazu angetan sind, in einem einzigen Semester aufgenommen zu werden. Die erhaltenen Texte, die unter dem Namen des Aristoteles überliefert sind, sind vorwiegend Vorlesungstexte. Die Abfolge von Vorlesungen, denen diese Aufzeichnungen korrespondieren, umfasste in modernen Semestern ausgedrückt sicherlich mehrere. Ein anderes Bedenken gegen das vorgenommene Unternehmen einer Überblicksvorlesung bezieht sich auf das Alter der hier Anwesenden. Dafür, in vermeintlich souveräner Art Werke eines Platon und Aristoteles zu überblicken, sind die meisten der Anwesenden, den Vortragenden eingeschlossen, zu jung. Dies muss zumindest von der platonischen Philosophie aus gesehen so erscheinen. Nicht nur gibt es bei Platon die oben angesprochene Stelle aus der Politeia (dem Staat), an der es heißt, dass man mit fünfzig zur Erkenntnis des höchsten Lehrgegenstandes, der Idee des Guten geführt werden solle. In zahlreichen Dialogen wird gerade adeligen jungen Menschen erklärt und aufgewiesen, dass sie einen langen Entwicklungs- und Erziehungsprozess auf sich nehmen müssen, ehe sie es zu etwas bringen in der Philosophie. Im Symposion, dem Gastmahl, hört man von einem deutlichen Zeichen: Den Aufstieg zur Idee des Guten und Schönen, von welchem Diotima Sokrates erzählt, würde man erst vollenden, wenn die Sehschärfe abnehme. Dass heißt, nach Auskunft platonischer Figuren ist philosophische Weitsicht erst zu gewinnen, wenn körperliche Alterskurzsichtigkeit sich einstellt. Somit können wir nicht wähnen, einen Überblick über die Werk zu gewinnen, sondern bestenfalls einen Vorblick. Mit einem anderen Wort gesagt können Sie das Folgende als Propädeutik verstehen. Als Propädeutik im Sinn des griechischen Wortes, als Vor-erziehung. Die Erziehung selbst müssen Sie selbst an sich leisten. Sie können dies platonisch gesehen entweder dadurch tun, dass Sie sich von einem wahrhaft philosophischen Menschen belehren lassen. Solche wahrhaft philosophischen Menschen seien allerdings überaus selten. Als zweiter Weg bleibt die Möglichkeit, Aufzeichnungen von Gesprächen solcher göttlicher Menschen zu lesen. Als solche Aufzeichnungen und Erinnerungsmittel von Gesprächen verstehen sich die schriftlichen Dialoge Platons selbst. Eine andere Sparte an Texten, die diese lesende Selbsterziehung ermöglichen, sind die Vorlesungsaufzeichnungen der Texte des Aristoteles. Beide Corpora von Texten, d. h. beide Textsammlungen sprechen so in eigener Weise den Leser an und sind geeignet, selbständig gelesen zu werden. Dies zu sagen, klingt vielleicht seltsam. Man könnte meinen, jedes Gedruckte eignete sich zum Lesen. Streng der 4 bloßen Möglichkeit nach betrachtet stimmt dies wohl auch. Doch haben die Sammlungen der Texte des Aristoteles und Platon in besonderer Weise, die Eigenschaft, sich dem Leser zuzusprechen. Die Werke Platons sind Kunstwerke der Literatur ersten Ranges. Ihre Lektüre wird, so könnte man sagen, den Lesern durch ihre Einkleidung oder, wie das oft genannt wurde, Rahmenhandlung, schmackhaft gemacht. Die Werke Aristoteles sind ihrerseits großteils Vorlesungsaufzeichnungen und sprechen als solche zu ihren Lesern bzw. Hörern. Aus all dem Gesagten könnten Sie nun die Folgerung ableiten, dass es eigentlich grundlos ist, eine Vorlesung über Texte zu hören, die Sie selbst lesen können. Dieser Folgerung würde ich in gewisser Weise zustimmen und Sie sogar in dieser Folgerung wenn Sie sie ernst nehmen, unterstützen. Die beste Einführung in die antike Philosophie anhand von Platon und Aristoteles besteht meiner Ansicht nach schlichtweg darin, die Texte dieser Autoren zu lesen. Ohne Ihnen Unrecht anzutun, muss ich allerdings aufgrund der momentanen Rahmenbedingungen eines Philosophiestudiums in Wien Zweifel anmelden, dass Ihnen die Zeit bleibt, dies zu tun. Aus diesem zugegebenermaßen kontingenten Grund erscheint es also irgendwie berechtigt, eine Einführungsvorlesung zur antiken Philosophie zu unternehmen. Aber demjenigen zufolge, was oben über die Unmöglichkeit eines Überblicks über die genannten Autoren gesagt wurde, kann sich das Kommende höchstens als Vorblick verstehen. Ein Vorblick, der eine dunkle Vorahnung geben soll davon, was Sie bei eigenständiger Lektüre der betreffenden Philosophen antreffen können. 5 Übersicht über die Orientierungsfragen 1. Was sind Charakteristika der homerischen Götter? 2. Was ist laut Platon der höchste Lerngegenstand bzw. das Ziel der Philosophie? 3. Inwiefern kann man Sokrates’ Rede von der Sonnenfinsternis als Inbild eines spekulativen Idealismus sehen? 4. Inwiefern kann man von einer Pädagogik in Platos Philosophie sprechen? 5. Welche zentralen Fragen der Philosophie Platos werden im Euthyphron angesprochen? 6. Was hat der Begriff ‚Idee‘ mit dem Sehen zu tun? 7. Wie ist Sokrates im Logos tätig? 8. Inwiefern wird Sokrates in der Apologie als frommer Denker gezeigt? 9. Warum ist Sokrates nicht aus dem Gefängnis geflohen? 10. Was ist mit dem Sterben der Philosophen im Phaidon gemeint? 11. In welchen Werken spricht Platon über die Priorität der Seele und wie begründet er diese? 12. Was bedeutet Anamnesis? 13. Was ist die Ausgangsfrage des Kratylos? 14. Wer leitet den „Wortmacher“ in seiner Kunst an? 15. Worin besteht die zentrale Frage des Theaitetos? 16. Welche für die jüngere Philosophiegeschichte bedeutende Definition von Wissen wird dem Theaitetos zugeschrieben? 17. Was ist mit der Maieutik des Sokrates gemeint? 18. Was besagt der Satz des Protagoras? 19. Was ist eine Dihairese? 20. Was sind die megista eide, von denen im Sophistes die Rede ist? 21. Wann muss ein Staat auf verschriftlichte Gesetze zurückgreifen (Politikos)? 22. Welche Anfragen stellt der platonische Parmenides an die Ideenannahme des Sokrates? 23. Welcher Begriff wird im Philebos diskutiert? 24. Welche Elemente zählt Sokrates in der Rangordnung der menschlichen Tätigkeiten auf? 25. Welches Phänomen wird im Symposion besprochen? 26. Durch welches Bild veranschaulicht der platonische Aristophanes den Eros? 6 27. Wie wird Eros von Diotima beschrieben? 28. Was versteht man unter Platos Schriftkritik? 29. Was ist die paidia? 30. Was ist die Grundfrage der Politeia? 31. Woraus erklärt Sokrates in der Politeia die Entstehung von Städten? 32. Welche sind die vier aretaí („Tugenden“, „Bestformen“), über die die vollendete Stadt verfügt? 33. Wie wird die Gerechtigkeit in der Politeia bestimmt? 34. Was ist laut Platon der höchste Lerngegenstand in der Philosophie? 35. Worum handelt es sich bei den vier Abschnitten der Linie des Liniengleichnisses? 36. Welche Staatsformen folgen dem Schema der Politeia nach auf die Aristokratie? 37. Welche Schriften sind unter dem Titel Organon zusammengefasst? 38. Welche sind die zehn von Aristoteles aufgelisteten Kategorien? 39. Woraus besteht ein Syllogismus (im engeren Sinne)? 40. Was ist eine der Grundfragen von Aristoteles’ Physik? 41. Welche vier aitíai unterscheidet Aristoteles im zweiten Buch der Physik? 42. Was versteht Aristoteles unter der aísthesis des koinón? 7 Homer Womit den Anfang machen Auch in dieser Unternehmung kann man die Frage aufwerfen, womit eigentlich der Anfang einer solchen Vorlesung zu machen sei. Hinsichtlich der philosophischen Wissenschaft warf Georg Wilhelm Friedrich HEGEL die Frage auf: „Womit muß der Anfang der Wissenschaft gemacht werden?“. Dieser Frage, womit der Anfang der Wissenschaft gemacht werden müsse, ist in seiner „Wissenschaft der Logik“ ein eigenes Kapitel gewidmet.1 Bei einer Vorlesung über die antike Philosophie könnte mit zwei Themen der Anfang gemacht werden, mit denen eine solche Vorlesung gewöhnlich nicht begonnen wird. Gewöhnlich setzt eine derartige Lehrveranstaltung mit den Vorsokratikern ein. Man könnte mit guten Gründen jedoch auch mit Homer oder mit Platon beginnen. Mit Platon könnte man eine Vorlesung über die antike Philosophie beginnen lassen, weil man argumentieren kann, dass die ersten Zeugnisse eines griechischen Philosophen von ihm stammen. Die Texte der so genannten Vorsokratiker, die ja wohlgemerkt Fragmente genannt werden, sind durchwegs Auszüge aus Autoren ab Platon. Man könnte also behaupten, diese Gruppe an Philosophen, die Philosophie im vorsokratischen Sinn betrieben, sind eine neuzeitliche Konstruktion. Sie wurde aus späteren Autoren wie Aristoteles oder Philon oder Simplicius konstruiert. Der erste Philosoph, von dem wir Texte haben sei jedoch, so könnte man weiter argumentieren, Platon. Allerdings wollen wir uns hier nicht auf die Überlieferungsgeschichte einlassen. Das heißt auf die Geschichte, wie und auf welchem Weg und in Handschriften oder Papyrusfetzen Texte griechischer Philosophen erhalten sind. Dies hat gewiss ein eigenes Interesse, muss aber hier vernachlässigt werden. Eine andere Argumentationslinie könnte dahin gehen, Homer den Anfang einzuräumen. Warum dies? Die dem HOMER zugeschriebenen Epen Ilias und Odyssee sind nicht nur die ersten erhaltenen literarischen Denkmäler der Griechen. Sie waren in schwer überschaubarer Weise über Jahrhunderte hinweg eines der Hauptbildungsmittel der Hellenen. Bis in die Spätantike hinein ist beispielsweise belegbar, dass sich Familien in ihrer Geschichte letztlich über Helden aus homerischer Geschichte definieren. Doch in unserem Kontext ist vor allem von Interesse, dass sich Platon wiederholt auf Homer bezieht. Abgesehen von den Aussagen, die er manche seiner Figuren über Homer tätigen lässt, zitiert er an vielen und zentralen Stellen Homer. Als Beispiel sei eine Stelle aus der Apologie des Sokrates genannt, an der Sokrates seine Entschlossenheit, Philosophie zu treiben, mit einem Achill-Zitat unterstreicht. Auch 1 G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik I, Frankfurt a. M. 1986 (Theorie-Werkausgabe; 5), 65-79. 8 Achill habe den Tod und die Gefahr verachtet in der Ausführung dessen, wofür er bestimmt war (vgl. apol. 28c-d). Schon dies könnte die Bedeutung belegen, die Homer für Platon hat. Doch spricht dies Platon auch selbst explizit an. In den Nomoi, den Gesetzen, seinem späten Großwerk, spricht der Gesprächsführer, der der Athener genannt wird, über die Dichtung. Er unterhält sich mit seinen Gesprächspartnern darüber, welche Dichtungen für die ältesten und ehrwürdigsten Bürger die angemessenste sei. Dies sei nicht die Tragödie, sondern das Epos. Dem Epos eignet also auch in den Augen von platonischen Figuren besondere Dignität. Als Einstimmung auf das Großkunstwerk der platonischen Dialoge seien nun einige Bemerkungen zum homerischen Epos erlaubt. Was sind Charakteristika der homerischen Götter? Damit eine Vorlesung über die antike Philosophie einsetzen zu lassen, mag zwar ungewöhnlich sein, ist jedoch nichts Neuartiges. Der Philologe Wolfgang SCHADEWALDT, der besonders für seine Übersetzungen griechischer Dichtungen bekannt geworden ist, tat dies in seinen Tübinger Vorlesungen zu den Anfängen der Philosophie bei den Griechen.2 Diese können Sie übrigens in einem handlichen Taschenbuch nachlesen. Für Schadewaldt lag dies auch nahe, zumal er sich über sein gesamtes akademisches Leben hinweg mit den homerischen Epen beschäftigte . Von ihm stammen sehr gut lesbare Übersetzungen der Ilias und der Odyssee (s. Literaturliste). Was ist in diesen Epen nun zu lesen und was ist daran so wichtig, dass man es für ein Verständnis der Geschichte der Griechen kennen muss? Wir wollen uns hier auf das ältere der beiden Epen, auf die Ilias beschränken. In ihr sind in überaus kunstvoller Weise die Ereignisse von zehn Jahren Krieg vor Troia in das Geschehen weniger Tage zusammengefasst. Alles wird getragen von der großen Tragödie um Achills Zorn. Diese Zentrierung um ein einziges Geschehen ist für Aristoteles ein Anzeichen der Großartigkeit der homerischen Epen. Im Unterschied zu anderen Großdichtungen könne man, so sagt er, aus der Ilias und der Odyssee jeweils nur eine oder zwei Tragödien machen. Dies sagt er in der Schrift, die gemeinhin Poetik genannt mit (Kap. 23, 1459b), womit wir auf das Ende unserer Auseinandersetzung mit den Werken des Aristoteles verwiesen sind. Was ist nun diese Tragödie des Achilleus? Man könnte sagen, es geht um die Geschichte der Entehrung des gewaltigsten Helden vor Troia und sein Schuldigwerden, durch das er seinen Tod erwirkt. So tragend dies für die Handlung ist, ist es nur ein Teil des Gesamtgeschehens. Alles ist eingebettet in den 2 W. Schadewaldt, Die Anfänge der Philosophie bei den Griechen. Die Vorsokratiker und ihre Voraussetzungen. Tübinger Vorlesungen Bd. 1. Unter Mitw. von M. Schadewaldt hrsg. von I. Schudoma, Frankfurt a. M. 1978. 9 Ratschluss des Zeus, von dem im fünften Vers des ersten Gesanges die Rede ist: Diós d’ eteileíeto boulé: „des Zeus Ratschluss hatte sich erfüllt“, hatte sein télos erreicht. Er, Zeus, ist der göttliche Garant für die Schlüssigkeit des Geschehens. Diese Schlüssigkeit ist, so könnte man sagen, eine doppelte: sie bringt zu einem Telos, einem Ende und Ziel, das menschliche Geschehen. Zugleich ist sie die Schlüssigkeit der Dichtung in dem Sinn, wie die Poetik verlangt, dass eine Handlung einen Schluss hat und alles bis dahin schlüssig erzählt wird. Damit sind wird auch verwiesen auf einen aristotelischen Grundterminus: den Ausdruck telos, der das Ziel und Ende anzeigt. Neben Zeus ist die Moira und die mit ihr verbundene Ananke, das Schicksal und der Zwang, ein Garant des Zielerreichens des Geschehens. Ob die Moira ein dem Zeus übergeordnetes oder untergeordnetes oder gleichgestelltes Prinzip ist, wird viel diskutiert und bleibe dahingestellt. Wichtig für und ist zu sehen, dass Zeus mit seinem Ratschluss nicht nur über den menschlichen Konflikt zwischen den Panhellenen, der Versammlung hellenischer Stämme, und den Troianern und ihren Bundesgenossen vermitteln muss. Er muss auch im Rahmen der Iliashandlung sich als Herr über die permanent in Konflikt stehenden Götter zeigen. Diese Darstellung der Götterkämpfe gab der Philosophie enormen Anstoß. So findet sich eine Auseinandersetzung mit den homerischen Epen in der Philosophie nicht nur in dem Bereich, den man Ästhetik zu nennen pflegt. Ein Beispiel dafür gaben wir bereits mit der Nennung der Poetik des Aristoteles. Ein anderes Exempel wären beinahe am anderen Ende der Philosophiegeschichte die Vorlesungen über die Ästhetik von Georg Wilhelm Friedrich HEGEL. In diesen Vorlesungen befasste sich Hegel mit Homer nicht nur in dem Kapitel über die Dichtung. Bereits in seinem ersten, allgemeinen Teil diente ihm Homer als wichtiger Bezugsautor bei der Beschreibung der Elemente von Kunst, wie etwa des Dichters. Doch wie gesagt war Homer nicht nur Ausgangspunkt für die so genannte Ästhetik. Aus der Antike ist überliefert, dass zahlreiche Weisheitslehrer und Philosophen sich mit Fragen zur Homerdeutung oder -auslegung beschäftigten. Diese Werke erhielten dann den Namen Homericae Quaestiones, Homerische Fragen. Aristoteles selbst soll auch ein solches Werk verfasst haben. Wonach wurde in solchen Werken gefragt? Fragwürdig bzw. erklärungsbedürftig erschien vor allem die oben angesprochenen Unstimmigkeiten zwischen den Göttern. Solche Unstimmigkeiten zwischen Göttern oder göttlichen Wesen konnten sich nicht nur darin zeigen, dass sie in offener Feldschlacht gegeneinander antreten, wie dies in der Ilias geschildert wird.3 Erzählt wurde auch, dass sich Götter täuschen, so täuschte in einer überaus berühmten Szene Hera ihren Gemahl Zeus mit einem Liebeszauber, um ihren geliebten Griechen Abhilfe 3 Vgl. beispielsweise den Anfang des fünften Gesanges. 10 im Kampfgedränge schaffen zu können.4 Eine andere sehr bekannte Geschichte ist diejenige von der Verbindung des Kriegsgottes Ares mit der Liebesgöttin Aphrodite, die dem hinkenden Schmiedegott Hephaistos angetraut war. Dieser fing das Liebespaar in einem unsichtbaren Netz und gab es dem Blick der Götter preis.5 Unter den versammelten olympischen Göttern erhob sich bei diesem Anblick das berühmte Lachen.6 Derartige Geschichten erschienen früh erklärungsbedürftig. Aus den Philosophiegeschichten besonders bekannte ist die Kritik des XENOPHANES am so genannten anthropomorphen Götterbild.7 In diesem Fragment werden Homer und HESIOD als diejenigen genannt, die den Göttern alles angehängt hätten. Das eine der großen Werke des Hesiod ist die Theogonie, was soviel bedeutet wie „Götterentstehung“. In diesem Epos versuchte er die verschiedenen Göttergenerationen, von denen erzählt wurde, in eine Chronologie zu bringen. Neben solcher Kritik an der Projizierung menschlicher Schwächen auf die Götter gibt es früh die Überlegung, dass eigentlich mit diesen Geschichten etwas anderes gesagt werde. Bei dergleichen Überlegungen spricht man von Allegorese. Das griechische Wort Allegorese meint, dass eine Sache etwas anderes (állo) aussage (agoreúein). Im Abendland wurde dieses Wort dann vor allem im Zusammenhang mit der Auslegung der Heiligen Schriften des Christentums verwendet. Jedoch könnte man mit Hinblick auf die Versuche einer Homerallegorese davon sprechen, dass die ersten Hermeneutiker, d. h. Textausleger, die Interpreten Homers waren. Eine beliebte Art der Allegorese war die kosmologische Deutung der Göttergeschichten. So wurde zum Beispiel die berühmte Geschichte von der catena aurea, der goldenen Kette gedeutet. Am Anfang des achten Gesanges der Ilias verbietet Zeus den Göttern, in den Kampf vor Troia einzugreifen. Wer diesem Verbot zuwider handelte, den würde er in den Tartaros werfen. Dann würde er erkennen, dass er der stärkste unter den Göttern ist (v. 17). Es mögen auch alle Götter seine Stärke auf die Probe stellen, indem sie mit ihm ein Seilziehen mit einem goldenen Seil veranstalten (v. 19 ff.). Alle gemeinsam könnten ihn nicht auf die Erde ziehen. Diese Geschichte fand in Antike und Neuzeit vielfache Ausdeutung.8 In der Ilias freilich wird es lange dauern, bis Zeus von allen Göttern als der Göttervater akzeptiert wird. Ein Grund der epischen Breite der Ilias ist, dass in ihr der gesamte Himmel der olympischen Götter dargestellt wird. Die zwölf wichtigsten Götter der Griechen erhalten gesonderte Auftritte und zeigen ihre Wirkungsweise. Immer wieder wollen sie auch eigene We4 Ilias XIV, 153 ff. Odyssee VIII, 266 ff. (das bekannte Demodokos-Lied). 6 Od. VIII, 326. 7 Vgl. Frg. 11 D-K: Alles hängten den Göttern Homeros und Hesiodos an, was bei den Menschen Tadel und Schimpf ist (bedeutet), Stehlen, Ehebrechen und auch einander Betrügen. 8 Vgl. z. B. E. Wolff, Die Goldene Kette. Die Aurea Catena Homeri in der englischen Literatur von Chaucer bis Wordsworth, Hamburg 1947. [nicht in der Literaturliste] 5 11 ge gegen den Ratschluss des Zeus gehen, müssen aber letztendlich klein beigeben. Als letzter ordnet sich Poseidon dem Willen seines Bruders Zeus unter. Man sieht, dass sich um die Achill-Tragödie nicht nur das menschliche Geschehen zentriert, dass mit den griechischen Stämmen und den asiatischen Verbündeten der Troianer beinahe die ganze Welt zu einem Welt-Krieg verband. Auch die Götter treten zu ihrem Kreis zusammen um das Zentrum dieser Handlung, die von Zeus geleitet wird. Diese Götterfigur gab den Homer-Deutern zu denken sowie vielen späteren Philosophen. Besonders berühmt geworden ist der Zeus-Hymnus des Stoikers KLEANTHES (3. Jh. v. Chr.), in welchem der Welt-Logos verherrlicht wird. Aber auch in der Dichtung wurde die Figur des Zeus weiterentwickelt, wenn man so sagen will, besonders bekannt ist hier ein Chorlied aus einer Tragödie des AISCHYLOS. Diese Tragödie trägt den Namen Agamemnon und gehört in die erhaltene Tragödien-Trilogie die den Namen Orestie führt. Zeus wird hier zunehmend die Chiffre für das höchste Prinzip der Weltenregierung (vgl. Ag. 160 ff.). Dabei reflektieren die griechischen Schriftsteller darauf, dass der Ausgangspunkt der Kenntnis bzw. der Formierungsgrund des Götterbildes die bei Xenophanes genannten Dichter Homer und Hesiod sind. Auch in der Philosophiegeschichte bekannt ist die Aussage des HERODOT, der immer wieder als Vater der Geschichtsschreibung kolportiert wird. In seinen Historien sagt er, Homer und Hesiod hätten den Griechen die Götter gemacht (II, Kap. 53). In der Philosophiegeschichte, die oben angesprochen wurde, fand diese Aussage Eingang vor allem durch Hegel. An einigen Stellen nimmt er auf diese Herodotkapitel Bezug.9 Wohl tut er dies vor allem über die Vermittlung des Werkes seines Freundes Georg Friedrich CREUZER. Creuzer schrieb ein Werk mit dem Titel Symbolik und Mythologie, welches zu seiner Zeit sehr bekannt war, heute beinahe in Vergessenheit geraten ist. Für uns ist Herodots Zeugnis von Bedeutung, weil es darauf hindeutet, dass Homer und Hesiod relevant sind, wenn man sich ein Bild machen will, woran die Griechen glaubten. Die Homer-Lektüre ist, so könnte man etwas salopp sagen, für diese Kenntnis viel nutzbringender als die Lektüre einer Kulturgeschichte der griechischen Zeit. In vergleichbarer Weise könnte man sagen, dass es für große Zeiträume der deutschen Geistesgeschichte sehr treffend ist, den Lutherschen 9 Hegel nennt ausdrücklich in Bezug auf Herodot Homer und Hesiod als Urheber der Gestalten der griechischen Götter, vgl. z. B. Ästhetik I, TA Bd. 13, 506; Ästhetik II, TA Bd. 14, 34 und 76 (wo er die Herodotstelle nennt); Berliner Schriften, TA Bd. 11, 180; Philosophie der Religion II, TA Bd. 17, 119: „Homer und Hesiod haben den Griechen ihre Götter gemacht.“ Er bezieht sich dabei auf die berühmte Herodotstelle im zweiten Buch der Historien, Kap. 53: οὗτοι (sc. Ἡσίοδος καὶ Ὅμηρος) δέ εἰσιν οἱ ποιήσαντες θεογονίην Ἕλλησι καὶ τοῖσι θεοῖσι τὰς ἐπωνυμίας δόντες καὶ τιμάς τε καὶ τέχνας διελόντες καὶ εἴδεα αὐτῶν σημήναντες. – „Sie (sc. Hesiod und Homer) haben den Stammbaum der Götter in Griechenland aufgestellt und ihnen ihre Beinamen gegeben, die Ämter und Ehren unter sie verteilt und ihre Gestalt klargemacht.“ (Übs. J. Feix). Diese Stelle zitiert auch Hegels Freund Georg Friedrich Creuzer am Anfang seines Hauptwerkes, vgl. Symbolik und Mythologie, Bd. 1, 6. Darauf bezieht sich wiederum Hegel in seinen Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte: „Herodot sagt ebenso: „Homer und Hesiod haben den Griechen ihr Göttergeschlecht gemacht und den Göttern die Beinamen gegeben“ – ein großer Ausspruch, mit dem sich besonders Creuzer viel zu tun gemacht hat … “ (TA Bd. 12, 292). 12 Kleinen Katechismus und seine Bibelübersetzung zu lesen, um zu erfahren, woran breite Bevölkerungsschichten glaubten. Genau diese Kenntnis kann man, darauf wollten wir hinweisen, für die Griechen durch die Homerlektüre beziehen. Diese war jahrhundertelang die Bildungslektüre für die griechische Jugend. Mit dem schon wiederholt zitierten Hegel kann man davon sprechen, dass die Gedichte Homers die „poetische Bibel der Griechen sind“ (Vorlesungen über die Ästhetik, III. Teil, Suhrkamp-Ausgabe Seite 331). Lektüre ist jedoch in diesem Zusammenhang eigentlich ein unpassendes Wort, da es sich vielmehr um Auditüre, um Hörmittel handelte. Auch zu Sokrates’ und Platos Zeit wurde die Ilias wohl hauptsächlich noch über mündlichem Weg aufgenommen und auswendiggelernt. Deswegen ist ihre Kenntnis auch so wichtig für das Verständnis eines Platon, der sich mit der Götterkritik beschäftigt. Gleich im ersten Werk Platons, das wir näher ansehen wollen, findet sich eine Fragestellung hinsichtlich der überlieferten Göttergeschichten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es die Frage nach dem einen Prinzip Zeus ist, das die Philosophen an der Ilias bewegte und bewegt. Im Vorblick auf Platon kann man sagen, dass bei ihm ein anderes Prinzip das leitende sein wird als ein Gott, der über zankende Götter befehligen muss. Dies ist auch einer der Kritikpunkte Platos an der überkommenen Götterauffassung, dass die Götter untereinander uneins sind. 13 Platon Platon zu lesen ist nicht nur ein Teil einer philosophiegeschichtlichen Bemühung. Sein Werk kann zugleich darüber informieren, was es überhaupt heißt, zu philosophieren. Es kann auch zeigen, wie sich Philosophie am Anfang ihres Entstehens präsentierte. Wir wollen hier seine Werke nicht so verstehen, dass sie bloßer Ausdruck eines Denkens sind, das sich über fünfzig Jahre erstreckt hat, über die Zeit der philosophischen Tätigkeit Platons. Vielmehr sollen seine Werke aufgefasst werden als gerundetes Ganzes, als ein mit der Ilias vergleichbares vollendetes Kunstwerk. So zumindest wurde in der Antike die Ilias ebenso wie das Werk Platons verstanden. Gegen beide Positionen wurde in der Neuzeit vehement angerannt. Vor allem das 19. Jahrhundert war die Zeit der Zerreißung dieser Kunstwerke. Homer wurde analysiert, das heißt, man hat ihn zergliedert ihn verschiedene Teile, die von verschiedenen Dichtern stammten. In ähnlicher Weise hat man hinsichtlich der Werke, die unter dem Namen Platon überliefert sind, überlegt, welche echt sind und welche unecht. Damit verstand man sie nicht mehr wie in weiten Teilen der Antike als beinahe göttliche Werke. Von dieser Auffassung der Werke Platons berichten diejenigen Texte, die in der so genannten APPENDIX PLATONICA zusammengefasst sind. Diese Texte berichten über das Leben Platons, geben aber auch Überlegungen zu den Dialogen mit Hinblicknahmen, die im Vergleich zu modernen Fragestellungen sehr originell wirken. So wird etwa im siebenten Kapitel der PROLEGOMENA zur Philosophie Platons es unternommen, das eidos, also die Gestalt bzw. Idee seiner Philosophie zu erläutern. In diesem Zusammenhang wird auch davon gesprochen, dass Platon die Dichter vor ihm und die Philosophen nach ihm übertraf. In diesen Prolegomena findet sich auch die Erzählung, dass seine Mutter mit ihm nach der Geburt auf den Hymettos, einen Berg, ging, um dem ländlichen Apollon und den Nymphen zu opfern. Sie habe ihn niedergelegt und ihn, als sie zu ihm zurückgekehrt sei, mit Honig im Mund gefunden. Diesen hätten die Bienen dorthin gelegt, um anzuzeigen, dass dasjenige, was aus seinem Mund fließen würde, süßer als Honig sein werde (Kap. II). Sie sehen schon, dass diese antiken Einführungstexte zu Platon auch Anekdotenhaftes enthalten und deshalb immer wieder die Neugierde der Leser angezogen hat. Die heutige Neugier in unserer Gegend wird bei diesen Schriften meist dadurch gehemmt, dass sie nicht in deutscher Übersetzung zugänglich sind. Zu nennen sind an Schriften dieser Appendix Platonica, die eigentlich eine „Prae-pendix“, ein „Vor-hängsel“ genannt werden könnte, die Eisagoge des ALBINOS oder ALKINOS, OLYMPIODORs Leben des Platon, die Prolegomena und 14 die Scholien. Deutsche Übersetzungen gibt es zur Eisagoge des Albinos.10 Von den Prolegomena, die im sechsten Band der Platonausgabe von Karl Friedrich Hermann11 abgedruckt sind, ist eine ausgezeichnete französische Übersetzung zu nennen.12 Einer Auswertung dieser Texte widmet sich die Habilitationsschrift von Gyburg RADKE, Professorin für Klassische Philologie an der Freien Universität Berlin. Diese Arbeit soll im Jahr 2008 veröffentlicht werden unter dem Titel: Platon lehren und lernen. Wir nannten oben diese Anekdote nicht, weil es uns hier um die Befriedigung von Neugierde zu tun ist. Auch in modernen Darstellungen der Philosophie Platons finden sich die Wiedergaben verschiedenster Anekdoten, die meist aus später Zeit und zweifelhaften Quellen stammen. Solche Kenntnisse sind, wie man meinen könnte, für die Kenntnis der Philosophie eines Denkers nicht von Belang. Wir wollen hier auch keine breite Einführung in sein Leben geben. Aber wir nannten die antiken Zeugnisse vor allem um zu zeigen, wie Platon lange Zeit hindurch aufgefasst wurde. Er wurde über alle gehoben und beinah in den göttlichen Bereich gerückt. Dadurch war man vor dem gefeit, was in den letzten 200 Jahren mit Platons Texten gemacht wurde. Viel Mühe wurde nämlich darauf verwandt, zu erkunden, in welcher Reihenfolge die Schriften entstanden sind. Dazu soll hier etwas ausführlicher Stellung bezogen werden. Man versuchte, eine relative Chronologie zu erstellen. Das bedeutet, man war bestrebt zu ermitteln, in welchem zeitlichen Verhältnis ein Werk wie der Staat zu den anderen steht. Welche Dialoge früher und welche später geschrieben wurde. Dies war nicht nur ein Geschäft für die Philologen. Diese Betrachtung des platonischen Œuvres prägte sich tief in die Auffassung Platons ein. So unterscheidet man bis heute oft gerne Frühdialoge, dann die Werke seiner mittleren Schaffensphase und dann Spätdialoge. Dabei konnte beileibe keine Einigung unter den Gelehrten erzielt werden, welche Werke welcher Gruppe zuzuordnen sei. Aber es setzte sich die Meinung durch, auf das platonische Werk den Entwicklungsgedanken zu legen. Freilich wollen wir nicht leugnen, dass man sich erdenken kann, dass das historische Individuum, das wir uns unter dem Namen Platon vorstellen, einen Entwicklungsgang durchgemacht hat. Was wir hier in Frage stellen wollen, ist die Möglichkeit, einen derartigen Entwicklungsgang an seinem Werk festmachen zu können. Evidentermaßen haben wir keine Berichte, wann Platon einen seiner Dialoge publiziert hat. Ebenso wenig sind wir überhaupt gezwungen anzunehmen, dass er Werke publiziert hat. Was meine ich damit? Ein Gelehrter, der mit großer Mühe die verschiedenen Versuche einer Erstellung einer relativen Chronologie 10 B. Reis, Der Platoniker Albinos und sein sogenannter Prologos. Prolegomena, Überlieferungsgeschichte, kritische Edition und Übersetzung, Wiesbaden 1999 (Serta Graeca; 7). 11 Platonis dialogi secundum Thrasylli tetralogias dispositi. Ex recognitione C. F. Hermannii, 6 Bde., Leipzig 1851-1853. 12 Prolégomènes à la philosophie de Platon. Texte établi et trad. par L. G. Westerink, Paris 1990. 15 zusammengetragen hat, erwägt die Möglichkeit, dass an den Werken Platons nach seinem Tod weitergearbeitet wurde.13 Es gab kein Urheberrecht in dem heutigen Sinne. Ebenso müssen wir uns von einer Rückprojizierung moderner Zustände befreien. Für Hegel etwa können wir festhalten, dass er seine Phänomenologie des Geistes im Jahr 1807 veröffentlichte und seine Große Logik einige Jahre später. Aber für Platon gilt nicht dasselbe. Ihn zwangen wohl keine Verlagsverträge, etwas aus der Hand zu geben, was man später als ein unvollendetes Frühwerk betrachten kann. Es ist denkbar, dass er an allen in der Akademie verwendeten Texten, die wir heute auch noch besitzen, sein Leben lang arbeitete. Ebenso ist wie gesagt denkbar, dass manche seiner Werke von Schülern vollendet oder umgearbeitet wurden. Dies sei deshalb gesagt, um zu bewirken, dass man etwas behutsamer mit den Texten Platons umgeht, als dies für gewöhnlich getan wird. Wenn man sie nämlich in ein zeitliches Schema presst, kann man leicht der Versuchung unterliegen, aus jeder Epoche seines angeblichen Schaffens repräsentative Texte auszusuchen und zu glauben, an ihnen kann man Platon studieren und verstehen. Davor warnen die antiken Einführungstexte. Sie warnen auch davor, Platon auf einige Positionen zu reduzieren, die man philosophiegeschichtlich festhält, um dann endlich zu Modernerem, Aktuellerem fortschreiten zu können. Diese antiken Einführungsschriften versammeln zwar wie moderne Philosophiegeschichten auch auf einige wenige Seiten zentrale Anliegen der platonischen Texte. Aber sie tun dies nicht mit der Absicht, ein Wissen verfügbar zu machen, sondern um – wie der Titel der Schrift des Albinos sagt – um einzuführen. So beginnt etwa die Einführung des Albinos mit dem Hinweis, dass die Philosophie ein Streben nach sophia, nach Klug- oder Weisheit sei und eine Lösung der Seele vom Körper und eine Umwendung der Seele bewirken solle. Damit sind zentrale Stellen aus dem Phaidon und aus der Politeia angesprochen. Im zweiten Kapitel dieser Schrift des Albinos ist dann von der Angleichung an das Göttliche die Rede, was wiederum den Theaitetos evoziert. Doch sind dies keine Zusammenraffungen von platonischen Textstellen mit dem Zweck, die Lektüre unnotwendig zu machen, wie man manchmal den Eindruck hat, dass dies Philosophiegeschichten leisten sollen. Diese Aussagen sind dort getroffen, um eben einzuführen in die Lektüre der göttlichen Schriften des Platon. Die Auseinandersetzung mit den Texten selbst kann durch nichts ersetzt werden. Aber diese Auseinandersetzung kann auch darüber in Kenntnis setzen, was eigentlich Philosophie ist. Sie ist die Bewegung der Seele, die nicht zuletzt bewegt wird durch die Lektüre bzw. griechischer ausgedrückt das Wiedererkennen der Texte, zumal das griechische Wort für Lesen eigentlich das Wiedererkennen aussagt. 13 H. Thesleff, Studies in Platonic Chronology, Helsinki 1982 (Commentationes humanarum litterarum; 70) 817. 16 Mit dieser Einstellung kann dann jeder der unter dem Namen Platons erhaltenen Dialoge als solcher erachtet werden, der wert ist, gelesen zu werden. Denn man kann von jedem erwarten, dass er einen Aspekt dessen anzeigt, was für Platon das philosophische Geschäft bedeutet. Dies wollen wir betrachten anhand der traditionellen Anordnung der Dialoge Platons, wie sie sich in den Handschriften findet. Diese Anordnung bezeichnet man als die Tetralogienordnung. Eine Tetralogie ist eine Vierergruppe. Solche Vierergruppen gab es vor allem in der griechischen Tragödie. Als im fünften Jahrhundert in Athen die Tradition lebendig war, jährlich in einem Wettkampf Tragödien aufzuführen, kamen an drei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils vier Stücke zur Aufführung, nämlich drei Tragödien und ein Satyrspiel. Ein Beispiel für eine Inhaltstetralogie war oben bereits mit der Orestie des Aischylos genannt worden. Man könnte nun sagen, dass Platos Vierergruppen ein Fortführung der Tradition ist, wie man manchmal gesagt hat, dass die platonische Philosophie die Fortführung der Tragödie mit anderen Mitteln ist. Diogenes Laertius nun, eine der wichtigen doxographischen Quellen aus der Antike, schreibt, wenn man sein Zeugnis richtig versteht, die Einteilung in Vierergruppen Platon selbst zu (Diog. Laert. 3, 56-61). Was ist laut Platon der höchste Lerngegenstand bzw. das Ziel der Philosophie? Bevor wir uns im Detail einzelnen Werken Platos zuwenden, soll etwas zum Ziel der ganzen Unternehmung der platonischen Philosophie gesagt werden. Aus den geschriebenen Werken Platos können wir nämlich entnehmen, was für ihn der höchste Lerngegenstand ist. Dies ist die Idee des Guten. Von ihr als dem höchsten bzw. größten Lerngegenstand, dem mégiston máthema, ist in der Politeia zu lesen (rep. VI, 505a). Daraufhin, nämlich auf das Gute ist alles orientiert. Sie können, wenn sie so wollen, bei der Lektüre jeder Platonzeile voraussetzen, dass in ihr in dieser oder jener Weise nach dem Guten gefragt wird. Für Platon ist dieses Gute, um es etwas schulmetaphysisch auszudrücken, sowohl das erkenntnis- wie seinsbegründende Prinzip. Das Gute ist zugleich dasjenige, was überhaupt erst Erkenntnis ermöglicht, und dasjenige, was den Entitäten, die erkannt werden, ihre Wahrheit „darreicht“, wie es Platon im sechsten Buch der Politeia ausdrückt (508e), und bewirkt, dass ihnen Sein zukommt (509b). Damit gelangt man zu einem für weite Strecken der antiken Philosophie markanten Charakteristikum, das es von vielen neuzeitlichen Ausbildungen der Philosophie unterscheidet. Für Platon und gleichermaßen für Aristoteles ist das Gute etwas, worüber nicht disponiert werden kann. Betrachtet man etwa den Menschen in der Situation seines Handelns, so ist für Platon festzuhalten, dass der Mensch immer dasjenige tut, was ihm gut scheint. Darüber kann er 17 nicht verfügen, das sollte das Wort ‚disponieren‘ vorher ausdrücken. Aber er kann fragen, ob das, was ihm gut scheint, auch gut ist. Bei solchen Fragen hakt die Tätigkeit eines Sokrates ein. Wenn sich jemand dem Gespräch mit ihm öffnet, muss er oft Rede und Antwort stehen, wie er das begründet, was er tut oder behauptet. Beispielsweise wird jemand, der mit Sokrates zusammenkommt, gefragt, warum er seinen eigenen Vater verklagt. Als er antwortet, er tue dies deshalb, weil es ihm fromm erscheine, muss er sich die Frage des Sokrates gefallen lassen, was eigentlich das Fromme sei. Und alsbald wird dieser Gesprächspartner auch mit der Frage konfrontiert, inwiefern dies Fromme mit dem Guten zusammenhänge. Eine solche Szene werden wir in Bälde im Dialog Euthyphron erleben können. Bemerkenswert ist im Zusammenhang mit der Idee des Guten, dass sie in die Nähe gerückt wird nicht nur der Wahrheit, sondern auch des Einen und der Vernunft. An einer für die sog. Ideenlehre zentralen Stelle im Phaidon kann man dies sehen. Sokrates sagt dort, dass er sich als junger Mann für die Betrachtungen eines ANAXAGORAS interessiert habe (97b ff). Er habe über sie gehört, dass sie sich damit beschäftigten, wie alles durch die Vernunft, den Nous geordnet sei. Durch die konkrete Ausformung sei er zwar enttäuscht worden. Dieses vorausgesetzte Vernunftprinzip, das alles so anordne, wie es gut für es sei, sei nicht bemüht worden. Anaxagoras habe nur notwendige Bedingungen zur Erklärung der Realität aufgelistet. Dennoch bleibt aber dies das Initiationserlebnis des Sokrates für die Philosophie. Sie ist ihm dort das Streben geworden, die „Wahrheit der Seienden“ auszuspähen, wie es wörtlich im Phaidon heißt (99e, vgl. die KOPIE). Es geht Sokrates nicht um einzelne Sachen, sondern um die Wahrheit. Und trotzdem ignoriert er die Sachen nicht, da sie die Wahrheit verstellen, wie man dem Bild von der Sonnenfinsternis, das Sokrates im Phaidon bringt, entnehmen kann. Wir werden uns damit später noch beschäftigen. In seinem Interesse ist der Philosoph zwar fixiert auf die Idee des Guten, er muss sich ihr aber in einer indirekten Methode nähern. Sokrates sagt, ihm ist es erschienen, dass er nicht direkt mit den Sinnen auf die Wahrheit hinblicken solle. Ihm könnte geschehen, was den Leuten beim Beobachten einer Sonnenfinsternis geschehe. Sie verdürben sich die Augen. Um dies nicht zu erleiden, müssten sie die sich verfinsternde Sonne in einem Medium wie dem Wasser betrachten. Dazu analog erschien es ihm notwendig, die Wahrheit in einem Medium zu betrachten. Dieses Medium beim Ausspähen der Wahrheit der Dinge sind für ihn die Logoi. Was ist nun ein Logos? Das kleinste, was bei Platon als Logos bezeichnet ist, ist ein Satz aus Namen- und Tunwort (soph. 263a), wie z. B.: „Alfred fliegt“. Das größte, was bei ihm als Logos bezeichnet wird, ist das All, der Gott Pan (Krat. 408d). (Das Wort pan kann das „All“ bezeichnen.) 18 Wohinein floh Sokrates in seinem Philosophieren? Welche Hypothese ist mit dieser Flucht verbunden? Zu den Logoi sei Sokrates hingeflohen, um in ihnen die Wahrheit der Seienden auszuspähen. Dabei habe er sich dessen bedient, worüber er sein ganzes philosophischen Leben schwafelte, die Ideenannahme. Ich spreche hier von ‚Ideenannahme‘ und nicht von ‚Ideenlehre‘, weil Sokrates im Phaidon davon spricht, dass er etwas angenommen hat. Genauer gesagt hat er seinen Betrachtungen etwas zugrunde- bzw. untergelegt. Dieses Unterlegen wird dort mit dem Partizip hypothemenos angesprochen (100b). Er machte eine Hypothese. Diese bestand in etwa Folgendem: Wenn er in den Logoi, in die hinein er geflohen ist, auf eine Prädikation stieß, wie z. B.: „das ist schön“, dann nahm er etwa Folgendes an: Es gibt das Schöne „selbst gemäß sich selbst“ oder, traditionell übersetzt: „an und für sich“. Diese Annahme beschränkt sich nicht nur auf eine Aussage wie „das ist schön“ oder auf das Schöne an und für sich, sondern gilt auch für das Große, das Gute und alle anderen, nämlich Prädikationen. Der nächste Schritt dieser Annahme besteht darin, anzunehmen, dass etwas so bezeichnet wird, wie es bezeichnet wird, weil es teilhat an dem selbst für sich seienden Prädikat. Ein kleines Beispiel: Wenn Sie in einem Imitationsversuch eines sokratischen Gesprächs ihre Sitznachbarin oder ihren Sitznachbarn nach etwas eher Banalem fragen (eventuell um mit ihr oder mit ihm Kontakt aufzunehmen), so könnten Sie fragen: Was hast Du da in Deiner Tasche? Zur Situation: Es lugt etwas aus der Tasche heraus, was Sie erahnen lässt, dass es sich um eine Tafel Schokolade handelt. Sofern Ihr Nebenan sich dem Gespräch nicht verwehrt, könnte es Ihnen antworten: eine Schokolade. Nun zeigt sich Ihr philosophischer Eros. Sie verlassen den üblichen gesprächspragmatischen Rahmen und fragen nicht danach, ob Sie ein Stück davon haben dürfen, sondern ganz sokratisch (wie es sie zumindest dünkt), warum das eine Schokolade sei? Abgesehen von einem Korb könnten sie nun viele Antworten bekommen: Weil das Ding halt so heißt, weil es eine Mischung aus Milch und einem gewissen Pulver ist oder was auch immer. Sokratisch am unfehlbarsten (dieses Wort taucht auch im Phaidon auf, 100d) wäre es zu sagen: Das ist eine Schokolade, weil sie an der Schokoladenheit Anteil hat. Das klingt nun einerseits etwas komisch und auch nicht sehr aussagekräftig. Sie könnten sogar meinen, es wird das Gleiche zweimal gesagt, es handle sich um eine Tautologie oder einen Pleonasmus. Dem ist wohl nicht ganz so. Es wird ja von der Schokolade die Schokoladenheit ausgesagt, von der Einzelinstanz etwas Allgemeines. Allerdings stellt sich sogleich die weitere Frage, was nun die Schokoladenheit sei. Derartiges Blödeln ist zugegebenermaßen nur pseudo19 sokratisch. Aber echt-sokratisch ist die Frage nach dem „Was ist eigentlich das irgendwas?“, z. B. was ist es eigentlich, das Schöne? Dieser Fragtypus begegnet einem gleichsam als Cantus firmus immer wieder in den Dialogen. Wenn wir nun zu unserem halblustigen Beispiel zurückkehren, so können wir fragen, was ist eigentlich die Schokoladenheit? Hier stehen wir vielleicht vor einer gewissen Schwierigkeit. Sie könnten ja antworten: Schokolade ist etwas Süßes. Es mag ihnen erwidert werden: es gibt ja viele süße Dinge(r), welches von den Süßen? Was braun ist. Was ist dann mit weißer oder dunkler Schokolade? Sie können sagen, es ist die zarteste Versuchung? Was ist mit anderen Versuchungen? Das beste auf der Welt? Ist es nicht schlecht für die Zähne. Sie können hier selber weiterdenken, ich möchte Sie damit nicht quälen. Sokrates stellt solche Fragen nach Dingen, über deren Vorliegen sich die Menschen generell einig sind, nur selten. Wie er gelegentlich einmal Alkibiades, einer sehr schillernden historischen Figur der athenischen Politik von großer Begabung gegenüber sagt, seien wir uns ja meistens einig, was wir mit Prädikaten wie ‚Pferd‘ oder ‚Stein‘ meinten (Alk. 1, 111b). Die Eltern oder sonstige Menschen, mit denen wir in Kontakt stehen, lehren uns die Bedeutung solcher Wörter. Problematisch wird es allerdings bei den so genannten Allgemeinbegriffen wie ‚schön‘ oder ‚gut‘. Hierüber streiten die Menschen permanent. Umstritten ist es zum Beispiel, ob es gut ist oder nicht, wenn ein Land gegen ein anderes Krieg führt oder wenn eine Fanmeile vor dem Universitätsgebäude errichtet wird. Bei diesen Problemfeldern wird evident, dass die Erklärung eines solchen Allgemeinen durch Einzelinstanzen nicht hinreicht beziehungsweise nur relativ gültig ist. Auf die Frage, was ist gut, kann man zwar antworten, gut ist Wasser und meinen, dies gilt für alle Menschen. Allerdings ist auch evident, dass es hier auf die Menge an Wasser ankommt. So ist es für Sokrates sicherer, zu antworten (auch wenn dies, wie er zugibt, einfältig erscheinen mag), etwas ist gut, weil es an der Gutheit bzw. dem Guten selbst Anteil hat. Bei der weiteren Nachfrage nach der Gutheit ist dann die Möglichkeit verbaut, sie zu verdinglichen. Darauf weist Sokrates immer wieder hin. Man kann nur ein gewisses Wissen darüber gewinnen, wovon solche Allgemeinbegriffe prädiziert werden können und wovon nicht. Nie aber kann man, so zumindest bedeutende Platonforscher wie Wolfgang WIELAND, das Prädizierte selbst zum Gegenstand einer Aussage machen. Freilich kann man sagen, alles Gute ist auch Nützlich. Aber damit hat man nicht das Gute selbst zum Gegenstand der Aussage gemacht, sondern alle möglichen guten Dinge. Was jedoch gangbar erscheint, ist die Frage nach der Verbindbarkeit von Allgemeinbegriffen. Nach dieser Verbindbarkeit wird im sog. ontologischen Exkurs im Sophistes gefragt. Wie steht das Andere zu der Bewegung, und wie steht zu diesen das Sein? Diese Fragen nach der möglichen Verknüpfbarkeit von Allgemeinbegriffen obliegt dem Dia20 lektiker. Das Wort ‚Dialektiker‘ wurde nicht von mir in den Zusammenhang gebracht. Es taucht bei Platon selbst auf. Die Dialektiker sind eine für Sokrates selbst besonders verehrungswürdige Personengruppe. Sie sind diejenigen, die zu einem Begriff die Überbegriffe und die Unterbegriffe angeben können. Etwas anders formuliert kann man sagen: Sie sind diejenigen, die verschiedene Begriffe auf eine einzige Idee zusammenführen können und umgekehrt einen einzelnen Begriff in seine Teile auseinandernehmen können. Leuten, die zu solchen Zusammenführungen und Zerteilungen fähig sind, würde Sokrates nachfolgen wie Göttern. Dies sagt er im Phaidros (266b). Doch Sokrates tut sich selbst nur in seltenen Fällen als ein solcher Dialektiker in diesem speziellen Sinn hervor. In vielen Werken Platons erleben wir ihn als einen, der überhaupt erst einmal seine Gesprächspartner in die von ihm eingeschlagene Sichtweise eingewöhnen muss. Inwiefern kann man Sokrates’ Rede von der Sonnenfinsternis als Inbild eines spekulativen Idealismus sehen? Diese notwendige Eingewöhnung, um in der Weise des Sokrates fähig zu sein, die Wahrheit der Dinge auszuspähen, wird in der Politeia als periagoge tes psyches bezeichnet (z. B. rep. 518d). Damit wird eine Um- oder Herumwendung der Psyche angesprochen. Die Psyche wiederum bezeichnet das Lebensprinzip, traditionell wird dieses griechische Wort mit ‚Seele‘ übersetzt. Etwas pathetisch könnte man sagen, dass bei der Stelle im Phaidon nicht nur die Ideenannahme begründet wird, sondern auch der spekulative Idealismus. Mit dem Bild von dem die Sonnenfinsternis Ausspähenden haben wir, wenn Sie so wollen, ein Vorstellungsbild für eine Spekulation, die sich mit der Durchdringung von Einzelnem, Besonderen und Allgemeinen befasst. Sokrates’ indirekte Betrachtungsweise der Wahrheit in den Logoi könnte so gesehen werden, dass er der Einzelne ist, in den das Allgemeine gebrochen über die Besonderheit der Dinge, die es verstellen (um im Bild der Sonnenfinsternis zu sprechen), scheint. Insofern aber das Gute in die Nähe der Vernunft gerückt ist, und der Philosoph in seinem Denken den Nous aktiviert, also die Vernunft, kann man auch sagen, dass er dass Allgemeine ist, in den das Eine, das Wahre scheint. Jeweils ist jedenfalls die Brechung durch das Bestimmte, Besondere wichtig. Dieses ist das, was in der Spiegelung in den Logoi die ideenhaften Prädikationen sein können. Die Tiefe der ganzen Angelegenheit lässt sich dadurch oberflächlich und ansatzweise vielleicht erahnen und plausibel machen, wenn man noch einmal die Blickrichtungsänderung ins 21 Auge fasst. Sokrates geht es nicht mehr um die Einzelndinge, sondern um die Wahrheit. Dieser nähert er sich aber über die Einzeldinge. Diese wiederum sind aber nicht, weil sie aus anderen Einzeldingen bestehen, sondern weil sie an Ideenhaftem Anteil haben. So kann man sagen, dass eben die Schokolade nicht durch ihre Bestandteile erklärt wird, sondern durch die Schokoladenheit. Und diese, die Schokoladenheit, weist auf die Beziehung des Ganzen zum Guten hin. Fragt man nämlich nach ihr als einem Allgemeinen, das man, wie gesagt wurde, nicht verdinglichen kann, wird die Frage nach der Verbindung zu anderen Allgemeinbegriffen, deren höchster für den öffentlichen Platon das Gute ist, virulent. (Wie es sich mit der so genannten ungeschriebenen Lehre verhalten hat, sei dahingestellt.) Man könnte also sagen, dass man an diesem Bild sieht, dass es immer mindestens dreierlei zum philosophischen Gespräch im Sinne Platons braucht: Gebraucht wird derjenige, der die Wahrheit ausspäht, vorausgesetzt werden muss die Wahrheit, und als Medium, als die Mitte braucht es die Besonderheit, die sich in den Logoi abspiegelt. Etwas salopp ausgedrückt könnte man sagen, dass es in weiten Teilen der Dialoge, in denen Sokrates auftritt, darum geht, jemanden in diese Sichtweise einzugewöhnen. Wie sich immer wieder in den Dialogen zeigt, ist es für Sokrates’ Gesprächspartner nicht einfach, sich dieser von ihm gemachten Ideenannahme zu bedienen. Auf die Frage, was etwas ist, geben sie immer wieder Einzelinstanzen an. Nicht können sie dasjenige angeben, was Sokrates als Seinsermöglichendes hypostasiert, nämlich den Hinblick bzw. die Idee, durch die etwas das ist, was es ist. Wenn beispielsweise ein angesehener Weisheitslehrer, ein Sophist, gefragt wird, was das Schöne ist, antwortet er: Eine schöne junge Frau (Hipp. mai. 287e). Sokrates gibt sich mit dieser Antwort nicht zufrieden. Eine schöne junge Frau ist nur relativ schön. Im Vergleich zu einer Göttin ist sie nicht schön. Weitere Versuche von Sokrates’ Gesprächspartner, das Schöne durch Angabe von Einzelinstanzen zu definieren, scheitern in gleicher Weise. Dabei liegt das Scheitern nicht nur an der Verbortheit der Gesprächspartner. Tatsächlich ist wohl, wie Wolfgang Wieland eindrucksvoll zeigt, bei dem Ideenwissen ähnlich wie bei einem Gebrauchswissen. Man kann jemanden zwar dazu anleiten, das Schusterhandwerk zu erlernen. Man kann ihn über lange Zeit hin belehrend und anweisend begleiten. Man kann ihm aber nicht abnehmen, selbst eine Erfahrung zu machen und einen mühsamen Lernprozess auf sich zu nehmen. In keinem Fall kann man durch bloße Mitteilung ihn in Kenntnis setzen, wie Schuhe herzustellen seien. Der Lehrling muss sich selbst mit der besonderen Materie, die er sich vorgenommen hat, auseinander setzen. In ähnlicher Weise kann man auch die Ideensicht wohl nicht durch einfache Mitteilung beibringen. Man kann es dem anderen nie abnehmen, selbst das geforderte Wissen zu erlangen. So ist auch bei Platon immer wieder vom mühsa22 men Lernweg des Philosophen zu hören. Besonders ist dies in der Politeia der Fall. Dort ist die Rede von dem „längeren Umweg“ (z. B. rep. 504d). Das Gespräch, das die Politeia selbst darstellt, ist aufgrund seiner Art nicht geeignet, den Zuhörern das beizubringen, was sie auf einem längeren Umweg lernen müssten. Dieser Lerngegenstand wäre, wie schon wiederholt gesagt, letztlich die Idee des Guten. Dazu könnte man wohl im platonischen Sinn vor allem dadurch kommen, dass man die Welt dialektisch durchdringt. Dies meint, dass man erkennen könnte, wie verschiedene Ideen zusammenhängen, verstehen zu können, welche Ideen miteinander verbunden werden können und welche nicht. Doch bevor man zu einer derartigen dialektischen Durchdringung der Welt gelangen könnte, müsste man überhaupt erst einmal Aufenthalt gefunden haben in der Ideenannahme eines Sokrates. Dass dies nicht leicht ist, zeigt sich wie gesagt immer wieder in den Dialogen Platos. Zum anderen ist festzustellen, dass Sokrates in Platos Darstellung bis unmittelbar vor seinem Tod darum bemüht ist, seine Mitwelt in diese Sicht einzugewöhnen. Dieses Charakteristikum ermöglicht uns kurz, etwas über den pädagogischen Charakter der Philosophie Platons zu sagen. Inwiefern kann man von einer Pädagogik in Platos Philosophie sprechen? Nicht nur im Phaidon, dem Werk, welches Sokrates’ Tod zeigt, sondern auch im Euthyphron versucht Sokrates, jemanden mit Ideen operieren zu lassen. Der Euthyphron zeigt uns Sokrates, der die gegen ihn eingebrachte Anklage, er verderbe die Jugend und führe neue Götter ein, entgegennehmen muss. Wir erwähnen diese Rahmenhandlung deswegen, um darauf hinzuweisen, dass Sokrates in Platos Schilderung an seinem Lebensende beileibe nicht als ein entrückter Weiser gezeichnet wird. Er ist nicht ein sophos – das wäre das griechische Wort für einen „Weisen“. Vielmehr ist er der philo-sophos schlechthin. In diesem Kontext sei es auch erlaubt, auf das Griechische dieses Wortes hinzuweisen. Im Zusammenhang mit Platon ist es nicht bloß bildungsbürgerlich zu erwähnen, dass das Wort philosophos ein griechisches ist. Man kann nämlich die Frage aufwerfen – und hat dies in der Vergangenheit getan – ob nicht das Wort philosophos ein genuin platonisch geprägtes ist. Denn befragt man die gelehrten Handbücher, so erfährt man, dass das Wort zwar zuerst für Pythagoras belegt ist. Einem Politiker gegenüber habe er sich auf die Frage nach seiner Beschäftigung als philosophos bezeichnet. Diese Geschichte ist durch einen Platonschüler überliefert (HERAKLEIDES PONTIKOS). 14 14 Aufgrund dieser Überlieferung bei einem Platonschüler haben manche Gelehrte ar- Cic. Tusc. 5, 8 f. 23 gumentiert, dass die Weitergabe dieser Begebenheit platonisch überformt sei. Man könne schließen, dass eigentlich Platon den Begriff philosophos geprägt habe. Wie man leicht vermuten kann, hat freilich auch die gegenteilige Ansicht Vertreter gefunden. Wie dem auch sei, es sollte nur im Bewusstsein sein, dass der Ausdruck philosophos zu Platons und vor allem zu Sokrates’ Zeit ein junger war. Ob er nun von Platon geprägt wurde oder nicht, sei dahingestellt. Sicherlich hat Platon entscheidend zur Ausprägung und zur Tradition dieser Bezeichnung beigetragen. Und für den Protagonisten der meisten seiner Dialoge Sokrates ist der Name tatsächlich noch Programm. Sokrates tut sich immer wieder kund als der, der nicht die sophía besitzt oder über sie verfügen kann. Er ist wirklich derjenige, der sie liebt in dem Sinne, dass er nach ihr strebt. Nicht umsonst wird er an manchen stellen auch mit dem gewaltigen Gott Eros, dem Gott der Begierde, parallelisiert (vgl. v. a. das Symposion). Bei Platon wird Sokrates anders geschildert als die Figur namens Sokrates, die bei ARISTOPHANES auftritt. Dieser berühmte Komödiendichter, von dem wir die einzigen vollständigen Stücke der Alten Komödie haben, ließ in seiner Komödie mit dem Titel Nephelai (Wolken) eine Figur mit dem Namen Sokrates auftreten. Diese Person ist in einem Gebäude situiert, welches „Phrontisterion“, also „Denkstube“ genannt wird. Sokrates verfügt über ein mitteilbares Scheinwissen im Stile der von Platon weitgehend negativ charakterisierten Sophisten. Er vermag es, jemandem beizubringen, das schlechtere Argument zum stärkeren zu machen. Anders begegnet uns Sokrates bei Platon. Dort ist er bis zu seinem Tode jemand, der nicht passiv in einer Denkerstube verweilt und einen Schatz an Weisheit hortet. Vielmehr ist er der permanent Herumgehende. Die Rahmenhandlungen der Dialoge Platos zeigen zu ihrem Beginn Sokrates an verschiedenen Orten der Polis Athen. Sokrates bewegt sich aber nicht nur als Person der Dialoge im Raum der Polis umher, er hält auch die Gespräche in permanenter Bewegung. Er lässt keine substanzhaften Verhärtungen einer Argumentation zu. Er ist das Element, in dem die Dialektik ihre Verflüssigung erfährt. Auch dies ist hier mit dem pädagogischen Aspekt der Philosophie Platons gemeint. Besser müsste man eigentlich vom anthropagogischen Aspekt sprechen. Es werden durch diese Philosophie ja nicht (nur) Kinder im eigentlichen Sinn angeleitet, sondern Menschen jeglichen Alters. Man könnte auch sagen, weite Teile des Œuvres Platons bestehen in einer Kritik der bisherigen Erziehungsmethoden. Darunter fallen die traditionellen Erziehungsmittel wie die Ammenmärchen und die Homerlektüre. Darunter, unter den Bereich der bisherigen Erziehungsmethoden, fallen aber auch die selbsternannten Weisheitslehrer. Es ist ja beileibe nicht nur so, dass Platon nicht in den philosophieleeren Raum hinein zu philosophieren begonnen hätte. Er hat auch nicht als erster theoretisch das Thema der Erziehung thematisiert. Genauso, wie es vor ihm bereits zahlreiche philosophi24 sche Ansätze in griechischen Raum gab, auf die sich Platon bezieht, genau so gab es auch Überlegungen, wie am besten der zukünftige Polis-Bürger zu erziehen sei. Ebenso wie zu seinen Vordenkern Heraklit oder Parmenides bezieht Platon in seinen Werken Stellung zu den selbsternannten Vorerziehern der Menschheit wie Protagoras oder Hippias. Deshalb kann man auch sagen, dass sich ein großer Teil der Dialoge Platons der Auseinandersetzung im Sinne einer Kritik mit diesen Themen beschäftigt. Wir wollen im Folgenden deswegen die Dialoge so darstellen, dass wir zunächst in einer ersten Hälfte zu referieren versuchen, wie Platon überhaupt zu bestimmen versucht, was seiner Ansicht nach ein Philosoph ist und wonach er strebt. Er zeigt uns dies an der Paradephilosophenfigur Sokrates. Dann nimmt er sich die Sophisten und Rhetoren sowie die Lehrer des Homer vor. Er kritisiert dabei nicht primär die von ihnen vermittelten Inhalte, sondern ihre Unfähigkeit, angeben zu können, warum etwas gut zu lernen sei. Dies ist das Hauptmanko dieser Leute, nicht angeben zu können, keine Rechenschaft darüber ablegen zu können, warum etwas ein wichtiger Lerngegenstand ist. Dieses Hauptmanko, dieser Kardinalfehler trifft auf eine Reihe von Leuten zu, die in einer Reihe bekannter Dialoge der Kritik unterzogen werden. Die Rede ist hier vor allem vom Protagoras, dem Gorgias, aber auch dem Menon, dem Euthydemos und dem Größeren Hippias sowie Ion. Erst nach dieser Kritik an bisherigen Erziehungsmethoden geht Sokrates in der Politeia dazu über, eine positive Schilderung dessen zu geben, was Gerechtigkeit bedeuten könnte, sowohl für den einzelnen wie für ein Gemeinwesen. Dieser positiven Schilderung wollen wir uns in der zweiten Hälfte der Referierung der Werke Platons zuwenden. Auf die Politeia wird der Timaios folgen, der eine „wahrscheinliche Rede“ (Tim. 29d) über die vernunftmäßige Einrichtung der Welt darstellt. Darauf folgt der kurze Kritias mit einem Beitrag zur politischen Philosophie – in ihm findet sich die berühmte Erzählung über das untergegangene Atlantis. Als letztes Werk werden die Nomoi, die „Gesetze“ zu besprechen sein. Sie bringen den Entwurf einer konkret geplanten Ansiedlung. Drei alte Herren sprechen über die möglichen Gesetze, die sie den künftigen Bürgern und künftigen Gesetzgebern vorschreiben können und darüber, wie sie den Bürgern die Gesetze schmackhaft machen können. Bevor wir uns einem ersten einzelnen Werk Platons zuwenden, seien noch zwei Vorbemerkungen erlaubt. Aus dem über die Kritik an dem bisherigen Erziehungswesen Gesagten ergibt sich, dass Platon und vor allem der Protagonist seiner Werke Sokrates nicht ganz unkritisch gesehen wurden. Aufgrund der Verurteilung des Sokrates lässt sich auch leicht vermuten, dass der historische Sokrates mehr oder weniger als Inbild der Bewegungen gesehen wurde, die das herkömmliche Bildungssystem unterhöhlt und letztlich die politische Katastrophe Athens 25 herbeigeführt haben. Dies macht auch Platon plausibel in seiner literarischen Gestaltung des Leben des Sokrates. In dem schon wiederholt genannten Dialog Euthyphron, der kurz vor dem Tod des Sokrates spielt, macht sich beispielsweise Sokrates bei einem Priester nicht unbedingt beliebt. Er bittet diesen nämlich um eine Definition, die er nicht geben kann und verunsichert ihn so in seinem bisherigen Dasein. Man kann leicht vermuten, dass vor allem diese Daseinsverunsicherung die Athener gestört hat. Dabei hielt Sokrates, wie wir später hören werden, dieses Verunsichern für eine göttliche Pflicht. Eine weitere Vorbemerkung bezieht sich auf die Rekonstruktion des antiken Erwartungshorizontes der Leser der Werke Platons. Wiederholt wird in der Neuzeit von den Werken Platons als von sog. exoterischen Schriften, d. h. Schriften, die sich nach außen wenden, gesprochen. Sie werden durch die Bezeichnung „exoterisch“ von den esoterischen Schriften des Aristoteles unterschieden. Von letzterem hätten wir nur Schriften, die für den Unterrichtsgebrauch entstanden seien. Von Platon hätten wir demgegenüber hauptsächlich Schriften erhalten, die sich an ein weiteres Publikum wendeten. Wenn man dies bedenkt, kann man fragen, was sich über Jahrhunderte hinweg unbedarfte Leser von den Werken eines Platon erwarteten bzw. können wir auch fragen, wie eventuell in durchaus bewusster Weise die Werke so angeordnet wurden, um dieser Lesererwartung entgegenzukommen. Denn fragt man aus diesem Gesichtspunkt, kann es plausibel erscheinen, wenn jemand annimmt, dass die ersten Werke, die einem Platon-Neuling zur Lektüre anempfohlen werden, diejenigen sind, in denen von dem für ein breites Publikum Spannendsten aus der athenischen Philosophieszene berichtet wird, nämlich von dem Prozess und Sterben des Sokrates. In diesem Zusammenhang sei auch kurz daran erinnert, dass es in der Antike kein Philosophie-Monopol gab. Heute erscheint die akademische Philosophie trotz aller Divergenzen und Streitereien ja oft monopolisiert – jeder Universitätsstandort verfügt, wenn überhaupt, über ein philosophisches Institut. Dort werden zwar verschiedenste Strömungen der Philosophietradition weiterbetrieben, aber alles sozusagen unter einem Dach. Außerakademische Institutionen, die irgendetwas mit Philosophie zu tun haben, werden oft eher belächelt. Mitnichten so eindeutig war es zu antiker Zeit. Hier herrschte ein freier Wettbewerb unter den Werbern für Philosophenschulen. So sich die Eltern das Studium ihres Sprösslings leisten konnten, war es nicht selbstverständlich, wenn man ihn nach Athen schickte, ob man ihn in die platonische Akademie, den aristotelischen Peripatos, den epikureischen Kepos – was soviel wie Garten heißt – oder in die Stoa poikile sandte, die bunte Säulenhalle, welcher die Stoiker ihren Namen verdanken. So erscheint es auch verständlich, wenn erhaltene Schriften der großen antiken Philosophen sich mitunter auch mit der Thematik befassen, warum es überhaupt geboten 26 erscheint, sich mit der Philosophie zu befassen. Und vor allem mit der Frage, warum man sich lebenslänglich mit ihr befassen soll. Der Meinung mancher zufolge, die auch im platonischen Gorgias referiert wird, mag man zwar in der Jugend Philosophie treiben wie etwa Mathematik lernen. Würde man sich jedoch auch noch im Erwachsenenalter mit ihr abgeben, könnte dies nur schädlich sein. Es lag für einen Philosophenschulenbetreiber nahe, solchen Meinungen gegenüber Position zu beziehen. Eine beliebte Form in der Antike, dies zu tun, war die Form des Protreptikos. Dieses Wort ‚Protreptikos‘ bezeichnet eigentlich eine „Hinwendungsschrift“. In der Antike kursierte ein berühmter Protreptikos unter dem Namen des Aristoteles. Im zwanzigsten Jahrhundert taten sich vor allem zwei Gelehrte mit den Versuchen hervor, diesen uns verlorenen Protreptikos des Aristoteles aus Werken späterer Autoren zu rekonstruieren.15 Als ein derartiger Protreptikos zur Philosophie Platos soll hier der Dialog Euthyphron des Platon vorgestellt werden. Er ist freilich keine wirkliche Hinwendungsschrift zur Philosophie. Aber man kann in ihr in nuce viele der großen Themen angeschlagen hören, die in anderen Werken wiederkehren werden. Bemerkenswert an diesem Dialog und seiner Handlung ist auch die Verknüpfung von ethischen, theologischen, erkenntnistheoretischen und sprachtheoretischen Fragen. Man erfährt an seinem Anfang auch indirekt einiges über die Person Sokrates. Hauptsächlich wird dem Rezipienten allerdings seine Art und Weise, Philosophie zu treiben, präsentiert. Euthyphron - Platon in nuce Welche zentralen Fragen der Philosophie Platos werden im Euthyphron angesprochen? Zunächst könnte man meinen, dass es im Euthyphron um ein ethisches Problem im eigentlichen Sinne geht. Sokrates ersucht im Laufe seines Gespräches mit Euthyphron diesen, er möge ihn lehren, was das Fromme sei. Wenn er dies wüsste, könnte er getrost vor die Richter treten, vor denen er sich verantworten muss in der Anklage, er schaffe neue Götter. Er könnte dann sagen, Euthyphron sei sein Lehrer in der Weisheit und sie mögen, wenn ihnen die Tätigkeit des Schülers Sokrates nicht passt, sich doch bitte an Euthyphron wenden (5a-b). Sie verzeihen bitte, wenn durch mein trockenes Referat des Handlungsgerüstes dieses Stückes nicht das Humorvolle und Ironische an diesem Text zum Tragen kommt. Dazu müssen Sie den Text selbst zur Hand nehmen und ihn genießen. 15 S. u. Anm. ►. 27 Man kann sagen, hier geht es ums Handeln, um das Ethische in seinem ursprünglichsten Sinn. Doch wollen wir langsam beginnen. Am Anfang des Stückes beginnt Euthyphron zu sprechen. Er ist offensichtlich verwundert, Sokrates bei der Stoa des Basileus zu treffen. Diese Stoa ist so etwas wie die Staatsanwaltschaft. Viel üblicher ist in den Augen der Allgemeinheit, die eine oberflächliche Kenntnis des Wirken des Sokrates hat, dass er sich in einem Gymnasium herumtreibt und sich dort aufhält und seine Zeit vertreibt. Dies meint das Wort diatribai, welches Euthyphron im Munde führt (2a). Doch auch an einem Ort hoher Gerichtsbarkeit wird Sokrates seine übliche Art des Umgangs mit Mitmenschen entfalten. Des Weiteren wird Sokrates indirekt dadurch charakterisiert, dass Euthyphron die Vermutung ausspricht, dass wohl jemand gegen Sokrates eine Klage eingebracht hat. Es erscheint ihm unwahrscheinlich, dass Sokrates jemanden verklagt. Sokrates wird dadurch als unpolitischer Mensch im engeren Sinne charakterisiert. Sokrates antwortet mit der überraschenden Aussage, dass nicht nur eine schlichte Anklage gegen ihn eingebracht wurde, sondern eine Hochverratsanzeige. Im weiteren Gespräch erfahren wir den Namen des Anklägers: Meletos. Dieser wird kurz beschrieben, obwohl wenig von ihm bekannt ist. Wichtiger ist, dass Sokrates über ihn sagt, dass er ihm als einziger der Bürger richtig zu handeln scheint (2c). Denn es sei richtig, in erster Linie sich darum zu kümmern, dass die Jungen möglichst ihre Bestform erreichen. Sokrates meint, dass Meletos richtig handle, wenn er diejenigen auszumerzen versuche, die diesem Entwicklungsprozess zur Bestform im Wege stünden. Sie können hier aufmerken und sagen: Das ist doch die berühmte sokratische Ironie! Vielleicht stimmt das. Aber Sie sehen auch, dass es keine Ironie in dem modernen Sinn des Wortes ist.16 Sokrates sagt nicht das eine aus und meint das Gegenteil. Er ist wirklich davon überzeugt, dass es primär wichtig ist, sich um die Jugend zu kümmern. So würde Meletos richtig handeln, wenn er einen Bösewicht aus dem Weg räumt. Offen bleibt ja in Sokrates’ Aussage, ob er sich selbst für so einen Bösewicht hält. Euthyphron freilich gibt eine sehr sokratesfreundliche Antwort: Er sagt, dass Meletos dem Staat von Grund auf schaden würde, wenn er Sokrates unrecht täte. Durch seine Rückfrage werden wir über den ersten Anklagepunkt des Meletos informiert: Sokrates schaffe neue Götter. Diese Angabe führt dazu, dass der Leser bzw. Hörer über ein weiteres berühmtes Sokraticum informiert wird: Euthyphron sagt, diese Anklage habe er sich wohl zugezogen, weil er davon spreche, dass ihm wiederholt das „Daimonion werde“ (3b). Näher wird dort nicht darüber gesprochen. In der Apologie geht Sokrates selbst darauf ein. Festzuhalten ist, dass das Wort eine Verkleinerungsform des Wortes daimon ist. Dieses bezeichnet ursprünglich nicht dasjenige, was wir seit dem Mittelalter 16 Vgl. demgegenüber die aristotelische Bestimmung der eironeia in der Nikomachischen Ethik, II 7, 1108 a 1923. 28 darunter verstehen („Dämon“). Es meint einen Gott wie das Wort theos. Ein daimonion ist dann ein ‚Göttlein‘. Diese Verkleinerungsform nützt Sokrates zu der Argumentation in der Apologie, dass man, wenn man ein daimonion anerkennt, auch dasjenige, woher es abstammt, anerkennt. Dies kann aber nur ein Daimon, ein Gott sein. Also widerspreche sich der Ankläger Meletos selbst (apol. 27b ff.). Übrigens können wir hier kurz einen Exkurs in die spätere Philosophie der Antike machen. Wenn sie sich dafür interessieren, was unter dem Daimonion des Sokrates zu verstehen ist, können sie verschiedene Erklärungsversuche bei Plutarch nachlesen. Dieser Mittelplatoniker, der vor allem für seine sog. Doppelbiographien bekannt ist, schrieb ein Werk mit dem lateinischen Titel De genio Socratis – „Über Sokrates’ Daimonion“. Zurück zum Euthyphron: Euthyphron sagt Sokrates gegenüber, dass er das Problem hinsichtlich des Sprechens über die Götter kenne: Wenn er selbst als Priester in der Versammlung etwas über die göttlichen Dinge sagt hinsichtlich des Zukünftigen, so würden sie ihn verlachen. Man dürfe sich darum nicht kümmern. Diese Aussage gibt Sokrates die Gelegenheit, etwas über seine Tätigkeit zu sagen: Er sagt, dass die Athener dann nicht lachen könnten, wenn sie meinten, dass jemand einen anderen belehren wollte. Und diesen Eindruck hätten sie auch von ihm. Denn aufgrund seiner Menschenfreundlichkeit, seiner „Philanthropie“, wie Sokrates sagt, redet er mit jedem (Euthyphr. 3d). Er verlangt nicht nur kein Geld dafür, sondern gibt von sich auch noch etwas dazu, wenn ihn jemand reden hören will. Hier sehen wir deutlich, wie sokratische Philosophie in der Feder Platos Stellung zu den Sophisten und Rhetoren bezieht. Diese unterrichteten laut Platon nur gegen entsprechende finanzielle Gegenleistung und waren stolz darauf, wenn sie mehr als jeder andere Weisheitslehrer verdienten (vgl. z. B. Hippias mai. 282d-e). Diese Weisheitslehrer geben auch das Stichwort für den nächsten Abschnitt im Euthyphron. Denn nun berichtet Euthyphron über seinen Prozess. Er klagt seinen Vater wegen Totschlags an. Diese Angabe spiegelt Sophistisches in den Dialog hinein. Eine solche Anklage wendet sich gegen die herkömmliche Pietät der Polis. Dies spricht auch Sokrates an: Die Vielen, hoi polloi, würden nicht meinen, dass dies richtig sei, gerichtlich gegen den Vater vorzugehen. Begründet kann so ein Schritt werden mit dem, was man bei Weisheitslehrern lernt. Sie lehren beispielsweise, dass das Gerechte getan werden muss, egal, gegen wen sich die Handlung richtet. Dem athenischen Leser des Euthyphron war mit großer Wahrscheinlichkeit die schon erwähnte Komödie Wolken des Aristophanes bekannt. An deren Ende wendet sich ein junger Mann mit dem bei Sokrates Erlernten gegen seinen Vater und schlägt ihn. Derartige Umwandlungen der herkömmlichen Gesellschaftauffassung werden an den Pranger gestellt. So könnte man auch hier in der Handlung des Euthyphron die Auswir29 kung sophistischer Einflüsse, die man aber auch für sokratische halten könnte, erkennen. Doch zeigt das weitere Gespräch, dass, wenn man das so annehmen will, es sich bestenfalls um populärsokratische Ansichten handeln könnte. Der genuine Sokrates nämlich führt Euthyphron zu einer für ihn unlösbaren Begründungsfrage. Besonders pikant dabei ist, dass der Rechtsfall überaus kompliziert erscheint. Der Vater des Euthyphron nämlich setzte einen seiner Tagelöhner fest, der einen anderen Arbeiter im Rausch erschlug. Der Vater hatte nach Athen geschickt, um Rechtsauskunft einzuholen, und in dieser Zeit ist der Gefesselte verstorben. Am Ende des Dialogs wird zwar nicht auf diesen Ausgangspunkt des Gespräches zurückgekommen, aber man kann erschließen, dass durch den Gesprächsverlauf Euthyphron in nicht geringem Maße in seiner Überzeugung, etwas Frommes zu tun, wenn er den Vater anklagt, erschüttert wurde. Freilich lässt die Figur des Euthyphron, so wie sie geschildert wird, auch einen anderen Schluss zu: Es könnte auch sein, dass er in seinem Wissensanspruch beharrt und ebenfalls ein Feind des Sokrates wird, der alles im Kreis herumdreht und keine festen Wahrheiten zulässt. Denn Euthyphron erhebt einen dezidierten Wissensanspruch. Er wisse exakt, was das Fromme und Unfromme sei. Wüsste er dies nicht, würde er sich nicht von den Vielen unterscheiden (5a). Wir sehen hier, dass der Wissensanspruch auch die Hervorhebung der eigenen Person vor dem Pöbel begründet. Wie schon oben erläutert, will Sokrates bei einem solchen Kenner des Frommen Schüler werden. Er könnte seine Ankläger an seinen Lehrer verweisen. Was nun außerhalb dieses pragmatischen Kontextes von weitreichender Wichtigkeit ist, ist die Fragestellung des Sokrates. Er will von Euthyphron wissen, was eigentlich das Fromme ist. An diese Frage schließt Sokrates eine Suggestivfrage. Er sagt: Ist nicht in jeder Handlung das Fromme dasselbe, sich selbst gleich, und ist nicht das Unfromme das Gegenteil? Hat nicht alles, was durchaus unfromm sein soll, ein bestimmtes Aussehen? (5d). Was hat der Begriff ‚Idee‘ mit dem Sehen zu tun? Das Wort, das hier im griechischen Text steht, ist das Wort idéa. Zahllos sind die Diskussionen, ob in diesem Dialog die Ideenlehre bereits ausgeprägt war oder nicht. Uns interessiert hier diese Diskussion nicht. Sie sollen nur darauf hingewiesen werden, dass Sie im Griechischen dieses Wort lesen können, das so signifikant für die Philosophie Platos ist. In Kürze werden Sie von einer Stelle hören, an der Sie gut die kontextuelle Bedeutung dieses Wortes erkennen können. Euthyphron antwortet auf die Frage nach einer Bestimmung des Frommen, dasjenige, was er jetzt tue, sei fromm (5d). Fromm sei, gegen jemanden, der sich verfehlt ha30 be, vorzugehen, auch wenn es der Vater sei. Als Begründung gibt er die allen Menschen bekannte Göttergeschichte an, der zufolge der beste und gerechteste der Götter, Zeus, seinen eigenen Vater gefesselt habe (6a). Mit dieser Begründung ist ein weiteres Großthema platonischer Philosophie angesprochen, die Kritik der Göttergeschichten. In diesem Sinne sagt Sokrates, dass er es jedes Mal übel aufnehme, wenn jemand solche Geschichten über die Götter erzähle. Sokrates kann es nur schwer akzeptieren, wenn jemand wie Euthyphron, der noch dazu ein Experte im Bereich des Göttlichen zu sein vorgibt, behauptet, dass es Krieg und Streit unter den Göttern gebe. Doch will er in diesem Zusammenhang darüber mit Euthyphron nicht sprechen. Vielmehr erscheint es ihm dringlich, Euthyphron darauf hinzuweisen, dass er seine Eingangsfrage nicht richtig beantwortet hat. Sokrates wollte nämlich nicht ein oder mehrere Beispiele frommen Handlungen aufgelistet bekommen, sondern er wollte erfahren, was das Fromme eigentlich sei (6d). Dies ist ein weiteres typisches Charakteristikum für vieler der Dialoge Platos. Auf die berühmte Frage nach dem ho ti pote estin ti, was eigentlich etwas sei, wie zum Beispiel das Schöne, die Erkenntnis, das Tapfere, geben die Gesprächspartner zunächst meist konkrete Beispiele an. Dies kann Sokrates nie befriedigen. So sagt er auch hier zu Euthyphron: „Erinnerst du dich also, dass ich dir nicht auftrug, mich eines oder zwei der vielen Frommen zu lehren, sondern jenes Eidos selbst, durch welches alle Frommen (Dinge) fromm sind?“ (6d) Wir stoßen hier auf das zweite zentrale griechische Wort für Idee, Eidos. Dieses wird oft mit ‚Gestalt‘ übersetzt. Genau so wie bei dem Terminus ‚Idee‘ ist mitzudenken, dass dieser Ausdruck zurückgeht auf die Wurzel vid-, sehen. Diese Wurzel liegt lateinischem videre „sehen“ ebenso zugrunde wie dem deutschen Wort „wissen“ und dem griechischen Wort oida „ich weiß“. Sowohl im Ausdruck ‚Idee‘ wie ‚Eidos‘ schwingt also das Sehen und Gesehen-Haben mit, aus dem ein Wissen resultiert. Das Sehen bringt auch Sokrates unmittelbar im Anschluss an diese Stelle ins Spiel: Er will nämlich, dass ihn Euthyphron diese Idee lehre, „was sie eigentlich ist“, damit er auf sie hinblicken kann und sie als Paradeigma, als Beispiel gebrauchen kann (6e). Warum will Sokrates die Idee des Frommen als Hinblicknahme und Beispiel nützen? Damit er, wenn jemand etwas tut, sagen kann, ob es fromm ist oder nicht. Dieser soeben referierten Stelle kann man einiges ablesen. Zunächst, dass bei dem Wort ‚Idee‘ der pragmatische Kontext des Sehens und Hinblickens für den Griechen offen steht. Dann kann man sehen, dass die Idee als Paradeigma benutzt wird. Ein Paradeigma ist etwas, was man dazu-zeigt. Es ist ein Referenzpunkt, an dem man die Identität von etwas erkennt. Dieses Konzept des Paradeigmas kehrt bei Platon immer wieder. Gleich in der auf den Euthyphron folgenden Apologie wird 31 sich Sokrates als Paradeigma bezeichnen. Der Gott des Orakels machte ihn zu einem Paradeigma, wenn man wissen will, was klug heißt (apol. 23b). Man kann das Handeln des Sokrates neben eine andere Handlung legen, wenn man bestimmen will, ob diese fromm ist oder nicht. Das ist das nächste, was man aus der Euthyphron-Stelle ablesen kann: Sie zeigt an, dass es um mögliche Aussagen geht. Um Aussagen, ob etwas, was jemand macht, fromm ist oder nicht. Unter anderem zur Orientierung beim Urteilen sollen also Ideen dienen. Diese Rede vom Hinblicken, dem apoblepein, wird ebenfalls immer wiederkehren in Platons Dialogen.17 Nicht nur zum Urteilen kann man auf eine Idee hinblicken, auch beim Hervorbringen von etwas. Versuch einer Allgemeindefinition Euthyphron versucht nun eine allgemeine Definition. Diese lautet so: Das Fromme sei das den Göttern Liebe. Allerdings hat er bereits zuvor selbst Sokrates den Weg gebahnt zur Kritik dieser Definition. Da es ja Streit und Uneinigkeit unter den Göttern gebe, so könne das Gottliebe keine eindeutige Definition für das Fromme sein. Was dem einen Gott lieb ist, ist der anderen Göttin unlieb. Ein und dasselbe sei fromm und unfromm. Euthyphrons Angabe bezieht sich nur auf akzidentellermaßen Frommes: Was nämlich fromm sei, weil es Zeus gefalle, sei zugleich unfromm, weil es Hera missfalle. Euthyphron muss den Definitionsversuch präzisieren: Sokrates schlägt ihm vor anzunehmen, dass Fromm das allen Göttern Liebe sei. Sokrates will nun auch diesen Definitionsversuch prüfen. Hier begegnen wir dem nächsten typischen Platon-Charakteristikum. Sokrates bringt nämlich eine sprachliche Betrachtung ins Spiel. Er fragt, in grammatikalischen Termini ausgedrückt, nach dem Unterschied von Aktiv und Passiv. Er fragt, ob das Fromme fromm sei, weil es von den Göttern geliebt wird, oder ob es von den Göttern geliebt wird, weil es fromm ist (10a). Man könnte auch so formulieren: Ist das Geliebtsein von allen Göttern die Folge des Frommseins oder seine Ursache. Euthyphron hat Schwierigkeiten, dieser Frage zu folgen. Wir können hier kurz einschalten, dass es, so weit wir zurückblicken können, zu dieser Zeit auch nicht Usus war, mit grammatikalischen Termini zu operieren. Für einen heutigen Schulabsolventen ist es relativ geläufig, zwischen Passiv und Aktiv zu unterscheiden. Für die Antike ist jedoch zu sagen, dass sich grammatikalische Kategorien erst allmählich Hand in Hand mit philoso17 Für das Hinblicken im Zusammenhang mit einem Ausdruck für ‚Idee‘ vgl. z. B.: Euthyphr. 6c, Men. 72c, Krat. 389b, polit. 285a, rep. 596b, als Handlungsorientierung: Alk. I 134d, Gorg. 507 d, Mx. 240e, rep. 342e, 420b, 540a, Tim. 28a, leg. 625d-e, im Zusammenhang mit einer Worterklärung oder richtigen Aussage: Lach. 197e, Gorg. 503d, 504d, rep. 429b, als Begründung einer Meinung oder eines Urteils: Alk. I 107e, Lach. 182e, Prot. 320b, rep. 578b, leg. 686d; vgl. auch soph. 250b. 32 phischen Kategorien herausentwickelt haben. Maßgebend und anstoßgebend war hier Aristoteles, dessen Betrachtungen darüber, was Sprache leisten kann, von den Stoikern aufgegriffen wurden und in hellenistischer Zeit zu allgemeinem Schulbildungsgut wurden. So ist es nicht verwunderlich, wenn einem sokratischen Gesprächspartner die angesprochene Unterscheidung nicht auf abstrakter Ebene sogleich gegenwärtig ist. Jedoch ist sie für Platos Philosophie von großer Bedeutung. Dieser Typus von Unterscheidung zwischen Tuendem und Getanem bzw. Bewegendem und Bewegten begegnet etwa in hochspekulativen Passagen des Theaitetos (z. B. 182a ff.) und Sophistes (248d ff.), ebenso ist es von zentraler Bedeutung für die Argumentation für die Unsterblichkeit der Seele im Phaidros und in den Nomoi.18 Als primär wird dort jeweils das Sich-selbst-Bewegende betrachtet. Was als von einem anderen bewegt erscheint, muss sekundär sein, wie zum Beispiel der menschliche Leib. Und hier im Euthyphron ist das Primäre das Frommsein. Dieses verursacht, dass es geliebt wird. Deswegen ergibt sich, dass die Definition des Euthyphron nicht tragen kann. Sie zeigt wiederum lediglich etwas dem Frommem Akzidentelles an: Sokrates formuliert dies so, dass er an Euthyphrons Definitionsversuch kritisiert, dass er nur ein Pathos, ein Erleidnis des Frommen angebe, nicht aber die ousia, sein Wesen (11a). Wie ist Sokrates im Logos tätig? An diesem Punkt der Unterhaltung konstatiert Euthyphron, dass den Gesprächspartnern immer das, was sie aufstellen, herumgeht und keine Definition stehen bleibt. Dies ist auch ein allgemeines Erlebnis vieler sokratischer Gesprächspartner. Dies ist auch etwas, was man im Umgang mit dem platonischen Sokrates lernen muss. Es kann oft nicht bei einfachen, positiven Bestimmungen bleiben. Man muss auf dem Weg zur Umwendung der Seele bereit sein, das oftmalige Im-Kreis-Drehen der Argumentation auf sich zu nehmen. Als Euthyphron diesen Kreisgang feststellt, eröffnet Sokrates den Weg zu einer neuen Definition des Frommen. Er bringt ein weiteres allgemein wichtiges Thema Platos zum Anklingen, das wir ebenfalls dem Bereich der Sprachbetrachtung zuschreiben können. Er fragt nach dem Unterschied von Ober- und Unterbegriff. Sokrates forscht nämlich nach dem Verhältnis von Gerechtem und Ungerechten. Es wird sich herausstellen, dass das Gerechte der Oberbegriff, das Fromme ein Unterbegriff ist. In die Hinführung zu dieser Unterscheidung, die Euthyphron ebenfalls nicht sogleich einsichtig ist, ist etwas Weiteres für Platon Typisches eingebaut, nämlich eine Auseinandersetzung 18 S. u. ►. 33 mit einem Dichtungstext. Diese Auseinandersetzung mit der Dichtung findet anhand der Kritik weniger Verse statt. Es ist hier zwar nicht explizit von Homer die Rede, aber sein Name liegt in der Luft. Charakteristisch für Platon ist die Abwegung, welche Art von Dichtung für die Polis nützlich ist und welche nicht. Es wäre oberflächlich zu sagen, er lehnte die Dichtung ganz ab. Er wog ab. Entscheidendes dazu sagt Stefan BÜTTNER in seinem Buch über Platos Literaturtheorie.19 Des Weiteren muss man sehen, dass Platon in Konkurrenz zu Homer, dem unangefochtenen Grundbildungsautor der griechischen Welt trat. Sokrates ist bei Platon an nicht wenigen Stellen mit Achilleus und Odysseus, den großen Helden der großen Epen Homers, parallelisiert, Wie sich alsbald in der Apologie zeigen kann, übertrifft Sokrates in gewisser Weise Achilleus. Das andere auf weite Teile der platonischen Philosophie Vorausweisende ist die Tatsache, dass hier das Gerechte hereingebracht wird. Von der Bestimmung des Gerechten geht die gesamte Politeia aus, und weite Gesprächspassagen der Dialoge mit Sophisten drehen sich um die Frage, was das Gerechte ist. Im Euthyphron nun will Sokrates wissen, welcher Teil des Gerechten das Fromme ist. Euthyphron bestimmt den Teil des Gerechten, der das Fromme ist, als den Dienst an die Pflege der Götter, als die therapeia ton theon. Mit dieser Antwort gerät er in ein weiteres typisch sokratisches Themenfeld, das zu einem Widerlegungsminenfeld ausarten kann. Sokrates argumentiert dahingehend, dass jeder Dienst demjenigen, dem er erwiesen wird, einen Nutzen bringt. Wenn dem so ist, müsste unser Gottes-Dienst den Göttern auch einen Nutzen bringen. Durch die Pflege wird jeder, der gepflegt wird, besser. Nun sei es aber unfromm, zu sagen, die Götter würden durch unsere Verehrung besser. Sokrates verstrickt Euthyphron noch in einige weitere Widersprüche, bis die Gesprächspartner zu dem Punkt kommen, wo sie sagen, dass das Verhältnis der Menschen zu den Göttern das einer Handelsbeziehung sei. Für unsere Gaben für die Götter erhielten wir Gutes. Hier tut sich allerdings für Sokrates die Frage auf: Was können die Götter von unseren Gaben profitieren? Es fällt der bedeutende Satz: „Denn wir haben nichts Gutes, was nicht jene (sc. die Götter) geben.“ (15a). Wenn man diesem Satz zustimmt, so bleibt nichts, was wir den Göttern geben und wovon sie einen Nutzen haben könnten. Euthyphron bleibt nur mehr die Antwort, dass sie Ehre bekommen. Dies ist aber wieder etwas, was ihnen lieb ist. Somit ist man wieder zu dem anfänglichen Definitionsversuch zurückgekehrt, dass das Fromme das den Göttern liebe ist. Das Gespräch hat sich entgültig im Kreis gedreht. Sokrates fordert nun Sokrates zu einem Neubeginn auf, dieser entzieht sich jedoch dem weiteren Gespräch. 19 S. Büttner, Die Literaturtheorie bei Platon und ihre anthropologische Begründung, Tübingen-Basel 2000. 34 Inwiefern wird Sokrates in der Apologie als frommer Denker gezeigt? Euthyphron wird nicht unbedingt sehr positiv eingenommen von Sokrates von dannen gezogen sein. Wenn man bedenkt, dass der Euthyphron sozusagen am Vorabend der Apologie, der berühmten Verteidigungsrede des Sokrates, angesiedelt ist, kann man sehen, dass im Euthyphron plausibel gemacht wird, warum Sokrates bei vielen Athenern unbeliebt war. Er ließ keine Überzeugungen unberührt. Er war für viele das Inbild der Neuerer und darüber hinaus war er für einen Prozess zur Hand im Unterschied von Sophisten und Rhetoren, die als Wanderlehrer herumzogen. Uns interessiert die Apologie im vorliegenden Kontext vor allem, weil sie Sokrates als frommen Denker zeigen kann. Im Euthyphron sprach ja Sokrates davon, dass uns alles Gute von den Göttern komme. Wenn man dem zustimmt, könnte man meinen, dass es die Aufgabe eines frommen Denkers ist, zu bedenken, inwiefern uns alles Gute von den Göttern kommt und inwiefern alles gut ist, so wie es ist. In diese Richtung werden wir Sokrates im Phaidon gehen sehen. Hier in der Apologie wird vor allem Sokrates’ Bezug zu Apollon sichtbar. Dabei ist an der von Platon fingierten Verteidigungsrede Einiges besonders untypisch für eine Verteidigungsrede. Zum einen lässt er Sokrates am Anfang sagen, dass er ungeübt sei in der vor Gericht üblichen Redeweise und dass er so sprechen werde, wie er immer gesprochen habe. Neben der impliziten Infragestellung der Wahrhaftigkeit der Rhetorik seiner Ankläger lässt Platon seinen Sokrates mit der eigenen Rhetorizität spielen. Untypisch für eine Verteidigungsrede ist auch Sokrates’ Aussage, er verteidige nicht sich selbst, sondern die Athener. Er hindere sie daran, sich an ihm zu vergehen (30d). Das tue er deshalb, weil er eine Gabe Gottes sei. Diese Worte setzt Sokrates in Beziehung zu dem Orakelgott, von dem er schon davor gesprochen hatte. Seine Motivation, das Verteidigen der Athener gegen sie selbst, macht verständlich, warum Sokrates sich so fundamental verteidigt. Er verteidigt sich ja, wie er am Anfang der Apologie darlegt, nicht primär gegen die aktuellen Ankläger, sondern gegen diejenigen, die ihn schon lange verleumden. Diesen gegenüber müsse er die Frage beantworten: Was ist eigentlich die Sache, die er treibt und die ihn so in Verruf bringt? Allgemeiner formuliert könnte man sagen: Was ist die Sache der Philosophie, welche sie häufig so suspekt macht? Sokrates antwortet, dass es sich dabei um eine „menschliche Weisheit“ (oder „Klugheit“) handelt (20d). Das hier angesprochene Wort sophía ist schwer zu übersetzen. ‚Weisheit‘ klingt zu hoch, ‚Klugheit‘ zu niedrig. Wie dem auch sei, zu beachten ist der Zusatz „menschliche“. Sokrates fordert nun seine Zuhörer auf, nicht unruhig zu werden. Sie mögen sich nicht ärgern, wenn er den Anschein erweckt, ein Angeber zu sein. Es sei nicht seine Rede, die er da führe, sondern die eines sehr Ehrwürdigen. Dieser sehr Ehrwürdige ist 35 der Orakelherr von Delphi, der Gott Apollon. Im konkreten Kontext kommt Sokrates auf ihn zu sprechen aufgrund eines Orakelspruches. Ein Freund von ihm habe es unternommen, nach Delphi zu gehen und sich ein Orakel geben zu lassen auf die Frage, ob jemand klüger/weiser sei als Sokrates. Die Pythia, die Orakelpriesterin habe ihm geantwortet: Niemand sei weiser als Sokrates. Der in diesem Spruch angesprochene Sokrates habe daraufhin versucht, den Orakelspruch zu verstehen. In dem, was Sokrates in weiterer Folge berichtet, zeigt sich, wie fromm Sokrates ist. Eine feste Voraussetzung seiner Untersuchung war anzunehmen, dass es dem Gott nicht gestattet sei, zu lügen. Eine weitere Annahme des Sokrates bestand darin, dass er die Sache des Gottes am höchsten schätzen müsse. Wir sehen, von welch bedeutenden Rahmenbedingungen das philosophische Geschäft ausgeht. In Parenthese sei angemerkt, in wie auffälliger Weise sich der Held der platonischen Philosophie Sokrates von mythischen Helden der Tragödien unterscheidet. Ödipus, der wohl berühmteste Empfänger eines Orakels über seine Person, unternahm es nicht, zu fragen, was eigentlich der Orakelspruch, dass er seinen Vater töten und seine Mutter ehelichen werde, bedeutet. Dieses Nichthinterfragen wird ihm manchmal als seine Hamartia, seine Verfehlung ausgelegt. Sokrates jedenfalls nahm aus der Hinterfragung des Orakels einen Hauptimpuls für seine philosophische Tätigkeit, die er, wie später sagt, als Gottesdienst auffasste (23c). Er versuchte zunächst einen Elenchos, eine Widerlegung des offenkundigen Sinnes des Orakels. Er ging zu den Personengruppen, die allgemein für klug gehalten werden. Zunächst suchte er diejenigen auf, die sich mit der Polis, dem Gemeinwesen zu schaffen machen, die Politiker. Er bemerkte dabei, dass diese Leute meinten, klug zu sein, es aber nicht waren. Ähnliches erlebte Sokrates bei Dichtern und anderen Berufsgruppen. Deshalb schien es ihm dann, dass er weiser sei als diese, insoweit er nicht glaubte zu wissen, was er nicht weiß. Hier liegt das berühmte oida ouk eidos („ich weiß dass ich nichts weiß“), in der Luft. Allerdings expliziert Sokrates nicht, worin dieses Nichtwissen der Leute bestand. Wir können aus anderen Dialogen erschließen, dass es das Nichtvermögen ist, einen Logos abzugeben darüber, was man tut. Die Dichter z. B. machen ihre Gedichte, so sagt Sokrates in der Apologie, aufgrund irgendeiner Naturveranlagung. Nicht jedoch können sie Auskunft über ihre Kunst geben. Somit schloss Sokrates, dass der Gott tatsächlich weise sei und ihn zu einem Paradigma mache. Er mache ihn zu einem Paradigma, d. h. einem Beispiel der menschlichen Weisheit (23b). An dieser Stelle der Apologie lässt Sokrates Apollon selbst sprechen: „Dieser von euch ist der weiseste, der wie Sokrates erkannt hat, dass er in Wahrheit nichts wert ist in Bezug auf die Weisheit.“ Dies vertritt Sokrates im Herumgehen unter den Bürgern – durch diese Tätigkeit hilft er dem Gott, wie er selbst sagt (23b), und übt einen Gottesdienst aus. 36 Sokrates und Apollon Hier sei ein kurzer Exkurs über das Verhältnis von Apollon und Sokrates eingefügt. Ich meine, dass Sokrates über das gesamte platonische Werk hinweg als menschliche, endliche Verkörperung vieler apollinischer Eigenschaften dargestellt wird. Bei Platon findet sich an einer Stelle eine längere Aussage über die Funktionen des Apoll. Im Dialog Kratylos wird versucht, den Gottesnamen Apollon zu etymologisieren. Sokrates sieht in diesem Namen auf kunstvolle Weise ein Vierfaches verbunden: Apollon sei der loslösende (apolyon), der immer Treffende (aei ballon), der mit dem Einfachen ([h]aploun) Verkehrende, der immerwendende (die Musen) (aeipolon; 405c) – er löst die Menschen von Krankheiten, trifft immer das Ziel, ist als Orakelgott der auf das Wahre und Einfache Gehende und hält die Reigen der Musen in Schwung. In allen diesen vier Fähigkeiten entspricht ihm Sokrates. Dass Sokrates nicht nur aufgrund der Orakels, sondern auch aufgrund der Musenkunst zu Apollon in besonderer Beziehung steht, ist aus dem Anfang des Phaidon evident. Dort sagt Sokrates, dass in seinen Augen die Philosophie die höchste Musenkunst ist (61a). Wie ist es nun aber gemeint, dass Sokrates dem vierfältigen Gott entspricht? Auch Sokrates wirkt kathartisch, d. h. (ab)lösend: Er löst aber nicht durch Wassergüsse die Körper von Krankheiten, sondern durch Redeschwälle die Seelen von falschen Vorstellungen. Das diesbezügliche Wort ‚Katharsis‘ kann, wie aus dem Sophistes erhellt, tatsächlich das nichtkörperliche Reinigen ausdrücken (226d ff.). Sokrates ist zweitens auch aei ballon, was bei Apoll das „Immertreffen“ bezeichnete. Sokrates als Mensch ist der unvollkommene Aspekt davon, er wirft sich sozusagen jeweils auf das Einfache und Wahre hin, ohne es immer zu treffen. Drittens ist er der mit dem Einfachen Verkehrende als der, der immer auf das höchste Gut, die Idee des Guten und das Eine hinweist. Viertens ist er der immer Herumdrehende. Sokrates ist der Haupttänzer im Chor der Philosophen, von dem im Theaitetos die Rede ist. Ich darf kurz wiederholen, welche Vororientierung wir über Sokrates als frommen Apollonjünger erhalten haben: 1. Er versucht, zu lösen, nämlich die Psychai (die Seelen) von falschen Vorstellungen und Meinungen. 2. Er wirft sich immer hin auf das Ziel aller philosophischen Bemühung, auf die Idee des Guten. 3. Er hat es immer mit diesem Einfachen zu tun, und 4. Er wendet seine Umstehenden immer hin zu dieser Untersuchung des Guten. Sokrates und die Gesetze 37 Sokrates jedenfalls nimmt in der Apologie mit der Darstellung seines Gottesdienstes eigentlich schon Stellung zu dem Anklagepunkt, er würde neue Götter kreieren. Er geht allerdings auf diesen Punkt noch gesondert ein in der Verteidigung gegen die aktuellen Ankläger. Nachdem er gegen die alten Verleumder gesprochen hatte, wendet er sich nun seinem Hauptankläger Meletos zu. In dem fingierten Zwiegespräch mit diesem lässt Platon ein entscheidendes Signalwort fallen, das bis in sein letztes Werk zentral bleiben wird. Sokrates fragt seinen Ankläger, wer eigentlich die Menschen besser mache. Die Antwort lautet: die Nomoi, die Gesetze bzw. Bräuche (das Wort nomos kann beides anzeigen). Sogleich erwidert Sokrates, dass er nicht danach frage, sondern nach den Menschen, die mit den Gesetzen umgehen. Damit wird eine Thematik angesprochen, die sich vom Kriton über den Politikos bis zu den Nomoi, dem wohl letzten Werk Platos ziehen wird. Immer wird in diesen Werken hin und her gefragt zwischen den schriftlich zu fixierenden Gesetzen und denjenigen, die imstande sein sollen oder instand gesetzt werden sollen, die Gesetze zu exekutieren. Nirgendwo macht es sich Platon allzu einfach. Stets bleibt bedacht, dass es den lebendigen Umgang und die Veränderungsmöglichkeit von Gesetzeskorpora geben muss. Immer ist aber zugleich der Gedanke präsent, dass nur wenige, göttliche Menschen um das richtige Einrichten von Gesetzen Bescheid wüssten. Wenn man keine solchen göttlichen Gesetzgeber lebend unter sich habe, müsse man die zweitbeste Variante wählen und auf verschriftlichte Gesetze zurückgreifen und diese dann für sakrosankt erklären (vgl. z. B. Politikos 300b). Im Kontext der Apologie fragt Sokrates nach den Menschen, die um die Gesetze bescheid wüssten, weil er Meletos darin widerlegen will, dass er, Sokrates, die Jugend absichtlich schädige. Wir wollen diese Argumentation übergehen. Heraushebenswert erscheint mir noch besonders die Para-Epik in der Apologie, Platos Spiel mit Zitaten aus den großen homerischen Epen, der Ilias und der Odyssee. Denn neben der Betonung seiner Gottesdiensthaftigkeit bringt sich Sokrates auch in die Nähe der großen Helden Achilleus und Odysseus. Dies ist zur Erfassung der gesamtplatonischen Konzeption von Bedeutung. Sokrates wird als Gegen-Held aufgebaut. In der Apologie wendet sich nämlich Sokrates, nachdem er mit Meletos abgehandelt hat, selbst die Frage ein: Scheust du dich nicht, einer solchen Beschäftigung nachzugehen, bei der du Gefahr läufst, zu sterben?20 Auf eine derartige Frage würde Sokrates einwenden, dass es nicht richtig ist, zu fragen, ob man sterben werde oder nicht. Es gelte ausschließlich zu beachten, ob das, was man tut, gerecht oder ungerecht ist. Sonst hätten auch die Halbgötter vor Troia, die dort gestorben seien, schlecht gehandelt. Vor allem der Sohn der Thetis habe dies demonstriert. Als ihm seine Mutter sein bevorstehendes Ende angekündigt hat, habe 20 apol. 28b. 38 er den Tod und die Gefahr gering geschätzt. In dieser Weise glaube auch Sokrates, dass er dort, wo er hingestellt wurde, ausharren müsse. Wir haben bereits gesehen, dass er sich als Gottesdiener hingestellt sieht (und werden dies wieder im Phaidon sehen). In der Apologie kommt Sokrates ein erstes Mal auf den Tod zu sprechen. Er sagt, den Tod zu fürchten bedeute sich Wissen anzumaßen über etwas, worüber man nichts weiß. Dennoch will er nicht blindlings in den Tod gehen, sondern warnt die Athener davor, ihn zu töten. Sie würden sich dadurch selbst schaden (30c). Wir haben somit die Stelle eingeholt, an der Sokrates kundgibt, dass er nicht sich selbst verteidigt, sondern die Athener. Er ist die Gottesgabe die der Polis von dem Gott gegeben ist, damit (hier folgt das nächste berühmte Wort) sie von ihm wie ein edles, aber träges Pferd von einer Bremse aufgestachelt werde. Sokrates interpretiert sich und seine Tätigkeit also als etwas, das in Bewegung hält. Und dies wollen wir neben dem Gottesdienst als weiteres sehr wichtiges Kennzeichen sokratischen Philosophierens herausstreichen. Es ist das In-Bewegung-Bringen und In-Bewegung-Halten. Vor allem hält es die Logoi, die Reden, in Bewegung. Alle diese Logoi sollen zur Bemühung um Arete, um Bestform (Tugendhaftigkeit) hinführen (vgl. 31b). Im gleichen Atemzug erklärt Sokrates aber auch, warum er immer damit im Bereich des Einzelnen blieb, und nicht in großem Auftritt sich um die allgemeine Politik gekümmert habe. Davon habe ihn sein Daimonion abgehalten. Er vermutet auch, dass er, wäre er in der Weise eines Politikers an die Öffentlichkeit gegangen, er schon längst umgekommen wäre. Somit kann man durchaus sagen, dass Sokrates der erste „Politische Philosoph“ war,21 und zugleich sieht man die Zielrichtung seiner politischen Philosophie. In diesem Kontext erzählt Sokrates auch eine Begebenheit, die für die Einschätzung der Gesetzestreue dieses Philosophie-Heros von Bedeutung ist. Er habe sich eben nie um politische Ämter angestrengt, als jedoch im gängigen Zyklus sein Bezirk mit der Stellung von Beamten an der Reihe war, habe auch er ein Amt bekleidet. In diesem Amt habe er sich als einziger einem Volksbeschluss widersetzt, der dem Volk selbst kurz darauf überaus gesetzwidrig erschienen sei. Unter der zeitweilig in Athen herrschenden Oligarchie habe er sich dem Auftrag, jemanden zum Tode zu führen, widersetzt. Das heißt, in der Tat zeigt sich Sokrates als politischer Philosoph, der nicht nur Reden führt, sondern auch die tätliche Widerständigkeit gegen Unrechtsregime kennt. Sokrates der Unlehrer und unentgeltliche Gesprächspartner 21 Vgl. zu dieser Thematik P. Trawny, Sokrates oder Die Geburt der Politischen Philosophie, Würzburg 2007. 39 Ein weiteres zentrales Charakteristikum der sokratischen Philosophie spricht Sokrates nach der Erzählung dieser Begebenheit aus. Er sei niemals der Lehrer jemandes gewesen. Auch gebe er sich überall kostenlos zum Gespräch hin. Dies beides hebt ihn markant von den Sophisten, den Weisheits- und Redelehrern ab. Zu dieser seiner kostenfreien Gesprächsführung mit allen Mitbürgern sei er eben durch Orakel und Träume veranlasst worden, durch jene Weise, wie ein göttliches Geschick, eine theia moira, jemanden zu etwas bewegt. An das Ende seiner Verteidigungsrede stellt Sokrates noch ein Wort aus der Odyssee: Er weiche vom üblichen Vorgehen vor Gericht ab, auch in kleineren Rechtssachen die eigenen Kinder vorzuführen, um die Richter milder zu stimmen. Dies mache er nicht, obwohl auch er nicht, um es mit dem Homerwort zu sagen, von Eiche und Stein sei (34d). Damit zitiert Sokrates Odysseus, der in einer Trugrede zu Penelope spricht. Er erinnert damit an den großen Irrfahrer. Und auch Sokrates betrachtet seine philosophisch-politische Tätigkeit als Irrfahrt. Explizit hat er dies in der Apologie bereits ausgesprochen: 22a – Seine plane, sein Umherirren sei Teil seiner Hochschätzung des Göttlichen. Und Sokrates überantwortet auch dem Gott gemeinsam mit den Athenern im letzten Satz seiner Verteidigungsrede das Urteil über ihn. Der humorige Sokrates Im athenischen Prozesswesen war es nach dem Abstimmen und der Urteilsfindung dem Angeklagten noch eingeräumt, sich selbst ein Strafmaß zuzubilligen. Hier zeigt sich deutlich die humorige Komponente an der Figur des Sokrates. Sokrates soll sich selber eine Strafe zuerkennen, eine time. Dieses Wort kann auch die Ehre bezeichnen. Die „Gegenehre“ (vgl. 36b), die sich Sokrates bestimmt, soll ihn für seine ständige Bemühung um die Bürgerschaft entschädigen. Sokrates bestimmt für sich als dasjenige, was er dafür erleiden soll, die Ehrung im Prytaneion zu (36d). Was hat dies zu bedeuten? Dies war die Ehrung für Sieger bei Wettkämpfen wie denen in Olympia. In dieser zweiten Rede des Sokrates fällt auch der bedeutsame Satz, wonach in Sokrates’ Augen das größte Gut darin besteht, jeden Tag Logoi, d. h. Reden über die Bestform zu führen. Am Ende dieser zweiten Rede wird Platon genannt, der mit anderen Freunden dem Sokrates vorgeschlagen habe, dreißig Minen als Strafausmaß festzusetzen. Dies ist die zweite Nennung des Platon in der Apologie, und eine von insgesamt überhaupt nur drei Nennungen dieses Namens im Œuvre Platons (sofern man von den Briefen absieht).22 22 Erstmals in der Apologie 34a, dann 38b, darüber hinaus Phaid. 59b. 40 In der dritten Rede, derjenigen nach Verhängung des Todesurteils, wird Sokrates wieder ernster. Er prophezeit denen, die ihn verurteilt haben, dass sie das Problem nicht beseitigt haben, sondern es noch viel schlimmer werden wird. Es werden sich noch mehr als zuvor finden, die sie kritisieren, dass sie ihr Leben nicht richtig führen (39d-c). Er vatiziniert, er spricht also über die Zukunft der Philosophie: Unaufhörlich würden sich so lästige Gestalten wie er finden, die um eine Zurechtweisung ihrer Mitbürger bemüht sein werden. An diejenigen, die für ihn stimmten, richtet er eine beruhigende Rede. Er sagt, es scheine ihm, dass das Geschehnis des Prozesses sich für ihn als etwas Gutes erweist. Jedenfalls melde sich sein Daimonion nicht, das ihn sonst oft mitten in einem Gespräch dieses abbrechen hieß. Dann erfolgt die berühmte Ausführung darüber, was der Tod sein könnte. Wir wollen diese Stelle hier nicht eingehender besprechen, da ihrer tiefgründige Ironie zu bedenken wäre. Vordergründig ist zu hören, dass für Sokrates der Tod eines von zwei ist: entweder ein traumloser Schlaf oder der Wechsel von hier weg anderswohin. Ersteres, der traumlose Schlaf wäre sogar für den größten König den meisten seiner wachend verlebten Tage vorzuziehen. Die andere Variante, das Kommen in die Unterwelt, wäre auch von fabelhaftem Gewinn: Man könnte die Helden der Vorzeit treffen und mit ihnen diskutieren – mit dem großen Vorteil für Sokrates, dass er nicht mehr zum Tode verurteilt werden könnte (40c ff.). Jedenfalls fordert er seine Zuhörer eindringlich auf, hinsichtlich des Todes guter Hoffnung zu sein. „Die Angelegenheiten eines guten Mannes werden nicht von den Göttern vernachlässigt“, heißt es in den Schlussworten dieses frommen Denkers (41d). Warum ist Sokrates nicht aus dem Gefängnis geflohen? Allerdings können wir Sokrates nicht so schnell sterben lassen. Er trank den berühmten Schierlingsbecher nicht unmittelbar nach dem Urteil. Dies verhinderte ein religiöses Bedenken. Zu der Zeit des Urteils war gerade ein Schiff nach Delos unterwegs. Dieses sollte dem Gott Apollon ein Opfer bringen. Ein Opfer dafür, dass er zusammen mit Theseus die Knaben und Mädchen, die dem Minotaurus hätten vorgeworfen werden sollen, errettet hat. Wenn man den Text und Kontext etwas strapazieren will, könnte man sagen, dass Sokrates das eigentliche Opfer des Apollon ist. Sokrates blieb noch Zeit, für die Feder Platos zwei Dialoge zu sprechen. In dem einen, dem wesentlich kürzeren, welcher den Titel Kriton trägt, gibt Sokrates den Grund an, warum er sich nicht wie jeder vernünftige Bürger durch Flucht dem Todesurteil entzieht. In dem größe- 41 ren Dialog, der auch seinen Tod darstellt, wird Sokrates vor allem über die Unsterblichkeit der Seele diskutieren. Nun zunächst zur Frage, warum Sokrates nicht geflohen ist: Dies wäre durchaus ein gewohnter Vorgang gewesen. Schon vor ihm und auch nach ihm hat sich die athenische Bürgerschaft Leute vom Hals geschafft durch diesen Typus an Anklage wegen Asebie, also Unfrommheit. So wurde vor ihm der Philosoph und Perikles-Freund Anaxagoras der Asebie für schuldig befunden und verließ Athen. Später traf den berühmten Aristoteles dieselbe Verurteilung, woraufhin dieser ebenfalls Athen verließ. Somit kann man den Kriton, in dem Sokrates die Frage, warum er nicht flieht, beantwortet, auch als Rechfertigung der Gefährten des Sokrates lesen. Sie wären zwar bereit gewesen, ihm die Mittel zur Flucht zur Verfügung zu stellen, aber er wollte nicht. Doch für uns ist das viel Wichtigere, dass der politische Philosoph Sokrates, als der er sich in der Apologie zeigte, bis zu seinem Ende ein authentischer Praktizierer seiner Ansicht ist. Er demonstriert seine Bemühung um areté, um Bestform eindrucksvoll und macht sich keines performativen Widerspruchs schuldig. Erlauben Sie anlässlich dieses Dialogs über die Nicht-Flucht des Sokrates kurz auf seine Parallelisierung mit Achilleus zurückzukommen. Am Anfang des Kriton berichtet nämlich Sokrates von einem Traum. In diesem Traum sei ihm eine schöne und wohlgestaltete Frau erschienen und habe ihm gesagt: „Am dritten Tag könntest du die starkschollige Phthia erreichen.“ (44b). Damit zitiert Sokrates implizit wieder Achilleus. Dieser sagt in der Ilias, als ihn eine Gesandtschaft dazu bewegen soll, wieder in den Kampf einzutreten, dass er nach Hause fahre. Seine Heimat ist Phthia. Für Achill ist allerdings das Tragische, dass er nie nach Hause gelangen wird. Vielmehr wird er sein Leben vor Troia lassen. Wir können sehen, dass Sokrates diesbezüglich den Helden übertrifft. Er kommt der Prophezeiung zufolge in das verheißene Land. Dieser Kontext lässt uns auch kurz vorausblicken auf das Ziel aller philosophischen Bemühung, wie es Platon fasst. Das Ziel des Aufstiegs in dem so berühmten Höhlengleichnis, welches in der Politeia erzählt wird, ist die Schau der Idee des Guten. Diese ist der höchste Lehrgegenstand, zu dem ein Philosophie-Jünger geführt werden soll. Sokrates erläutert in der Politeia an dieser Stelle, dass wohl jeder, der diesen Punkt erreicht hat, immer dort verweilen wollen wird (517d). Zuvor ließ Sokrates ein Krypto-Achill-Zitat in seine Rede einfließen. Er sagt, dass denen, die zur Schau des Guten gelangten, das „Homerische“ geschehe, und dass sie sagen würden: Lieber ein Sauhirt bei einem mittellosen Mann (als in der Unterwelt der Herrscher über alle toten Seelen; vgl. 516d). Damit zitiert er Achills Worte, die dieser aus der Unterwelt an Odysseus richtet, der sich bei den Toten über die Lage in seiner Heimat erkun- 42 digt.23 Viel ist über dieses berühmte Wort geschrieben und gedacht worden. Für uns gehört es in die Vergleichsreihe von Sokrates und Achilleus. Ein weiterer Vergleichspunkt liegt in der mythischen Lokalisierung des Achilleus. Für Platon ist Achilleus einer der Personen, die auf den Inseln der Seligen leben. Dieser Ausdruck ‚Inseln der Seligen‘ kommt bei Platon des Öfteren vor. Sie sind der Ort, zu dem jemand gelangt, der sich besonders verdient gemacht hat. Dorthin soll letztlich auch der verdiente Philosoph gelangen können. Doch der Unterschied zum kämpfenden Helden besteht darin, dass man nicht nach einem Waffengang dorthin gelangt, sondern im Aufstieg aus der Höhle einmal zur Schau der Idee des Guten gelangen muss, dann aber auch wieder absteigen muss. Dies thematisiert Sokrates ausdrücklich in der Politeia. Die ausgesuchten Philosophen, die zum Ausgang aus der Höhle gebracht wurden, müssen dann wieder dazu angehalten werden, hinabzusteigen, und andere denselben Weg zu führen (519d). Dass dies vor allem Sokrates getan hat, legt sich durch einige Texte dar. Vor allem bei der Schilderung dessen, der wieder in die Höhle hinabsteigt, blind erscheint, weil seine Augen nicht an das Dunkle gewöhnt sind, und von den Höhleninsassen verhöhnt und getötet wird, erinnert frappant an Sokrates. Somit übertrifft er auch hierin Achilleus, dass er zu den Inseln der Seligen gelangt, sich aber wieder von ihnen wegbegibt und dann wieder zu ihnen gelangt. Jedenfalls brachte dem Sokrates sein Abstieg in die Höhle, wenn man es so nennen will, auch die Verurteilung ein, die ihm jedoch nicht als Übel erscheint, und die Festsetzung in dem „Fesselhaus“, das am Anfang des Kriton genannt wird. ‚Fesselhaus‘ ist eine Übersetzung des griechischen Wortes desmoterion und soll an die Fesseln, von denen im Höhlengleichnis die Rede ist, erinnern. Durchaus als Übel scheint das Todesurteil seinem Freund Kriton, der mit allen Mitteln Sokrates dazu bewegen will, das Gefängnis zu verlassen. Sokrates ist auch bereit, sich mit Kriton auf eine Argumentation einzulassen. Hier stoßen wir in seinem Gespräch mit diesem auf einen Schlüsselsatz: Er sagt zu Kriton, man müsse betrachten, ob man so handeln solle oder nicht (d. h. ob man fliehen solle oder nicht). Und dann sagt er etwas über eine Eigenschaft, die er immer schon aufgewiesen hat: Ich bin, nicht nur jetzt, sondern immer schon, so beschaffen, dass ich bei mir nichts und niemandem gehorche außer der Logos, der mir beim logizesthai der beste erscheint (46b). Das ist noch nicht verständlich. Sokrates will sagen, dass er nicht einer Meinung oder einem Gefühl von sich gehorcht, sondern nur dem Logos, der ihm als der beste erscheint. (Logos kann ‚Satz‘, ‚Argument‘, ‚Rede‘ etc. bedeuten.) Sokrates gehorcht ihm bei der Tätigkeit des logizesthai, des auf den Logos gestützten Überlegens, Abwegens. Dies ist ein beachtenswertes und zentrales Charakteristikum des Phi23 Od. XI, 489 ff. 43 losophie-Paradigmas Sokrates. Er verfügt, wie uns indirekt mitgeteilt wird, über die Fähigkeit, dass ihm Logoi als besser oder schlechter erscheinen. Er kann einen Logos als den besten wählen. Er folgt diesem in dem Sinne, dass er ihm gehorcht. Dieses sein Charakteristikum ist keines, von dem nur im Kriton die Rede wäre. Im Phaidon wird die Rede von einer Techne der Logoi sein, von einem Umgang mit Argumenten, bei der man ebenfalls die Fähigkeit aufweisen muss, Logoi in ihrer Gutheit zu unterscheiden. Auch im Theaitetos, wo von Sokrates’ Hebammenkunst die Rede ist, wird ihm das Können zugesprochen, Logoi hinsichtlich ihrer Tauglichkeit zu unterscheiden. Wichtig an der Aussage im Kriton ist, dass Sokrates die Logoi, die er sein Leben lang geschätzt hat, nicht jetzt einfach wegwerfen kann. Aber wichtig ist auch zu sehen, dass er grundsätzlich offen dafür ist, dass bessere Logoi als die bisherigen gefunden werden. In weiterer Folge ist von Bedeutung, dass Sokrates sich von seinem Gesprächspartner darin zustimmen lässt, dass man bei der Suche nach dem Guten und Nützlichen nicht jedem Glauben schenken soll, sondern den jeweiligen Experten. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass es nicht um das bloße Leben, sondern um das Gut-Leben geht, um das eu zen (48b). Des Weiteren erscheint im Kriton besonders hervorhebenswert die Rede, die Sokrates fingiert. Sokrates lässt nämlich an einem gewissen Punkt die Gesetze selbst sprechen. Sokrates lässt die Gesetze hinsichtlich seines Fluchtplanes fragen: Was tust du Sokrates? Wie glaubst du, kann ein Gemeinwesen noch bestehen, wenn das Recht keine Wirkung mehr hat und jeder Privatmann (idiotes) es außer Kraft setzt?24 In der weiteren Unterhaltung mit den Gesetzen kann Sokrates diesen gegenüber nicht leugnen, dass sie als erste es waren, die ihn zum Leben brachten und ihn in seiner Existenz erhielten, ihm Nahrung und Ausbildung verschafften. Die Gesetze geben Sokrates zu bedenken, dass er, sobald er erwachsen war, die Stadt verlassen hätte können, wenn er mit den Gesetzen nicht einverstanden gewesen wäre. Da er aber durch sein ganzes Leben gezeigt habe, dass er an Athen hänge (er habe es kaum außer zu Kriegszügen verlassen), so habe er durch seine Taten gezeigt, dass er nichts gegen die Gesetze habe. Etwas modern formuliert könnte man sagen, dass Sokrates auf pragmatischer Ebene demonstrierte, dass er die Gesetze für gültig hielt. Sokrates beschließt sein Gespräch wieder mit der Hindeutung auf die göttliche Führung: Er sagt zu Kriton: „Machen wir es so, da der Gott uns anführt“ (54d). Sokrates’ Sterben 24 Vgl. Krit. 50b. 44 Vermeintlicher Leib-Seele-Dualismus, Beweise von der Unsterblichkeit der Seele Der auf den Kriton folgende Dialog, welcher nach seinem Erzähler Phaidon benannt ist, ist in der Philosophiegeschichte vor allem für zwei der dort angesprochenen Themenkomplexe bekannt. Zum einen wird im Phaidon über das Sterben gesprochen als einer „Trennung der Seele vom Leib“ (64c). Zum anderen wird im Gespräch in einigen Anläufen unternommen, so etwas wie die Unsterblichkeit der Seele zu demonstrieren. Aufgrund der Gewichtigkeit dieser Tradition und der Tatsache, dass im philosophiegeschichtlichen Kontext oft nur Stücke aus diesen Argumentationskontexten in krasser Verkürzung aufgenommen werden, soll auch der Phaidon etwas ausführlicher referiert werden. Am Beginn dieses Dialogs steht sogleich ein Wort, welches in der moderneren französischen Philosophie Platon wieder ins Licht der Beachtung gerückt hat. Im ersten Satz des Phaidon ist die Rede von dem phármakon, das Sokrates am Tag seines Todes trank (57a). Dieses Wort wird an dieser Stelle oft mit ‚Gift‘ übersetzt, ist doch das Schierlingsgebräu gemeint, nach dessen „Genuss“ Sokrates’ Körper erstarrte. Doch ist dieses Wort zumindest zweideutig. Es bezeichnet nicht nur wie im Fall des Phaidon das Tötungsmittel, sondern auch das Heilmittel. Diesbezüglich denke man nur an das von phármakon abgeleitete Wort ‚Pharmazie‘, welches die Kunde der (Heil-)Mittel bezeichnet. Unter diesem Wort titelt auch ein berühmter Aufsatz von Jacques DERRIDA, in welchem dieser auf die Mehrdeutigkeit des Ausdruckes phármakon hinweist und den verschiedenen Stellen bei Platon, an denen er vorkommt, nachgeht. 25 Beispielsweise im Charmides spricht Sokrates von einem phármakon, welches er dem Jüngling Charmides verabreichen könnte (155c f.). Vielleicht trifft das soeben über die Mehrdeutigkeit des Wortes Gesagte auch nicht zu. Neutral könnte man für phármakon ‚Mittel‘ sagen. Dieses Mittel rahmt den Phaidon. (Das Phänomen der Rahmung übrigens ist an mehreren platonischen Dialogen feststellbar.) Am Schluss des Phaidon wird erzählt, wie Sokrates das Mittel zu sich nimmt und damit einen kleinen Scherz verbindet (117b), von dem Sie am Ende dieses Referats hören werden. Eventuell trifft die Übersetzung „Gift“ im Phaidon nicht zu. Wir hörten ja aus der Apologie, dass Sokrates der Prozess und sein Ausgang nicht als Übel erschien. Deshalb sollte man unter Umständen hinsichtlich des phármakon nicht von ‚Gift‘ sprechen. Am Schluss des Phaidon trägt Sokrates seinen Freunden auf, dem Asklepios einen Hahn zu opfern (118a). Asklepios war als Sohn des Apollon ein für die Heilkunde zuständiger Heros. Sokrates lässt somit dem für das körperliche Wohl Zuständigen opfern. Für denjenigen, der für das seelische Wohl zuständig ist, 25 J. Derrida, Platons Pharmazie, in: ders., Dissemination. Hrsg. von P. Engelmann. Übersetzt von H.-D. Gondek, Wien 1995, 69-190. 45 muss er kein gesondertes Opfer bringen lassen. Dieser für das seelische Wohl Zuständige ist Apollon. Er ist der für die geistige Katharsis, die geistige Reinigung Verantwortliche. Ihm diente Sokrates sein philosophisches Leben hindurch. Ihm hat Sokrates auch zu verdanken, dass er am Ende seiner hiesigen Existenz aufgrund seiner philosophischen Betätigung im Unterschied zu allen anderen im Phaidon als anwesend Vorgestellten den Tod gelassen sehen kann. Er kann in seiner letzten Stunde auf Erden alle Argumente gegen die so genannte Unsterblichkeit der Psyche niederrennen. Was ist mit dem Sterben der Philosophen im Phaidon gemeint? Bemerkenswert ist die Eingangsszene des Phaidon aus vielen Gründen – in ihr tut Sokrates unter anderem kund, dass für ihn die Philosophie die höchste Musenkunst ist (s. o.). Zu dieser Äußerung bewegen ihn seine Besucher im „Fesselhaus“, die daran interessiert sind, warum er in der Zelle Äsop-Fabeln vertont und ein Prooimion, ein Vorspiel auf Apollon dichtete (60de). Sokrates berichtet daraufhin, dass in seinem Leben oftmals im Traum an ihn die Aufforderung ergangen sei, „Mousike“ zu machen und zu erwirken (60e). Als sein Tod naht, erscheint es Sokrates sicherer, sich auch in der „normalen“ Musik zu üben. Urheber jener Frage an Sokrates ist ein gewisser Euenos, ein Berufsmusiker. Diesem lässt Sokrates am Ende seiner Antwort bestellen, er möge ihm, Sokrates so schnell wir möglich nachfolgen. Freilich werde er sich nicht selbst den Tod geben, da dies nicht gesetzmäßig sei, wie man sagt (61b-c). An diesem Punkt des Gesprächs melden sich zum ersten Mal die nachmaligen Hauptgesprächspartner des Sokrates, Simmias und Kebes zu Wort. Diese beiden, Simmias und Kebes sind Schüler des Pythagoras. Mit ihnen erwägt Sokrates in weiterer Folge einiges über die Reise „von hier nach dort“ (enthénde ekeíse, 107e, 117c), über den Ortswechsel der Seele – an einem Tag, an dem es angebracht erscheint, dies zu tun. Zur Frage der Statthaftigkeit der Selbsttötung zunächst sagt Sokrates, dass ihr Verbot einen gewissen Grund zu haben scheint. Er verweist auf das in den „Aporrheta“ Gesagte. Die Aporrheta bezeichnen eigentlich das ‚Ungesagte‘ oder ‚Unsagbare‘. (Darunter werden an dieser Stelle meist die Geheimnisse der Mysterien verstanden.) Jedenfalls sagt Sokrates, dass es eine Rede in diesen Aporrheta gäbe, welche besage, dass wir in einer gewissen Bewachung seien, aus der sich zu lösen nicht statthaft sei. Die Götter seien unsere Wärter und wir ihr Besitz (62b). So dürften wir uns nicht aus der Götterherde davonstehlen – so etwa Sokrates’ Wort zur Selbsttötung. Viel erstaunlicher erscheint den Zuhörern Sokrates’ Wort vom Wert des Sterbens. Diesbezüglich sagt Sokrates, dass diejenigen, die sich ihr Leben hindurch wahrhaft in der Philosophie 46 aufgehalten hätten, eigentlich nichts anderes betrieben, als zu sterben und gestorben zu sein (64a). In der Erläuterung dieser merkwürdig klingenden Äußerung fällt die folgenschwere Frage, ob der Tod etwas anderes sei als die apallagé, die ‚Abänderung‘ oder ‚Trennung‘ der Seele vom Leib bzw. Leichnam (64c). Diese Frage des Sokrates verneinen die Zuhörer. Der Tod sei als Trennung der psyché vom sóma zu fassen. Scheinbar ist damit ein fundamentaler Leib-Seele-Dualismus angesprochen. Doch aus dem weiteren Gespräch erhellt, dass mit dieser Trennung vor allem etwas Innerweltliches gemeint ist. Thematisiert wird sie hinsichtlich dessen, dass der wahrhafte Philosoph sich von verschiedenen Genüssen oder etwa der Sorge um schöne Bekleidung und Schuhe entfernt, abtrennt. Er habe an ihnen nur so weit Anteil, als es notwendig ist. Beschäftigungen wie Kleidungserwerb bezögen sich auf den Körper, und da der Philosoph dafür kein Interesse zeigt, „löst er so weit es geht“, so heißt es wörtlich, die Seele von der Gemeinschaft mit dem Körper ab (64e-65c). Dasselbe gelte für den Erkenntniserwerb: Dieser würde vom wahrhaften Philosophen nicht in den somatisch vermittelten Sinnen gesucht, sondern im Schließen mit dem Logos (logízesthai). Dies, nämlich mit dem Logos schließen, könne die Psyche am besten, wenn sie „selbst für sich“ würde und vor dem Soma, dem Leib fliehe (65c). In diesem Zusammenhang fingiert Sokrates erneut eine Rede. Diesmal jedoch nicht eine Rede der Nomoi wie im Kriton, sondern eine Rede der Philosophen. Diese lässt Sokrates von einem bestimmten Weg sprechen, der zur Erreichung des Zieles der Philosophie führt. Das sei der Weg der Katharsis, der Reinigung der Psyche vom Somatischen, um die Dinge „sonnenklar“ (67b, vgl. 66a) zu sehen. Das hier im Griechischen stehende Wort eilikrinés begegnet v. a. in der Politeia und bezeichnet vielleicht wörtlich das „Sonnenklare“. Die Unsterblichkeit der Seele In welchen Werken spricht Platon über die Priorität der Seele und wie begründet er diese? Bei Platon findet sich nicht nur im Phaidon die Ansicht vertreten, dass die Seele unsterblich ist. Dabei ist aus platonischer Sicht vielleicht eher der Akzent auf die Betonung der Priorität der Seele zu legen. Dafür, dass die Psyche immer vor jedem Somatischen ist, wird an entscheidenden Stellen im Phaidros und in den Nomoi argumentiert. Diese Stellen sind heute wieder von besonderer Relevanz zum Beispiel im Kontext der Diskussionen über die Emergenz-Theorie. Im Phaidros findet sich der vielleicht eleganteste und knappste Argumentationsgang zugunsten der Vorgängigkeit der Seele. Dort steht der ‚Aufweis‘ (apódeixis) der Un47 sterblichkeit der Seele in der zweiten Rede des Sokrates über den Eros (245c ff.). Er, der Aufweis, gründet in der Selbstbewegung der Seele. Jedes sich selbst Bewegende sei unsterblich, da das sich selbst Bewegende kein Ende nehme. Die psyché aber sei die arché, der gründende Anfang der Bewegung und diese arché sei ungeworden. Herausgestrichen wird die Priorität der Seele auch in den Nomoi. Dort soll die herkömmliche Annahme von Göttern gegen diejenigen verteidigt werden, die meinen, alles entstehe von Natur aus oder durch Zufall. Dies geschieht im zehnten Buch (von zwölf) der Nomoi. Um dies zu demonstrieren, werden zehn Arten der Bewegung unterschieden, deren erste die Selbstbewegung ist. Auch dort wird die Seele als arché der kínesis herausgestellt (896b). Den komplexen Argumentationsgang, den der Phaidon zu diesem Thema bietet, zu überblicken, ist überaus kompliziert. Eine Rekonstruktion dieses Weges soll hier nicht versucht werden (vgl. dazu das Einführungswerk von Karl BORMANN).26 Äußerlich kann festgestellt werden, dass Sokrates’ Tätigkeit so geschildert wird, dass er für die Argumentation kämpft, dass die Seele unsterblich ist. Wiederholt sagt derjenige, der das Gespräch referiert, dass Sokrates Gegenargumente niedergerannt oder die anderen aufgefordert habe, tapfer mit ihm in der Argumentation mitzukämpfen (vgl. 89a-c). In einigen Schlagwörtern seien Ihnen wichtige Stationen des Argumentationsganges genannt. So können Sie sich vielleicht später einmal daran wiedererinnern und manches nachlesen. Sokrates’ erste Aussage zum Immer-Leben läuft darauf hinaus, sich zustimmen zu lassen, dass wir nicht eine lineare Entwicklung von Lebendem zum Toten annehmen dürfen. Vielmehr werde auch das Tote wieder lebendig. Alles gehe gleichsam im Kreis umher (72b). Diese Formulierung ist beachtenswert hinsichtlich der Ewigkeitskonzeption im Timaios. Im Phaidon wird in diesem Zusammenhang ein erstes Mal Anaxagoras genannt, auf den Sokrates später zurückkommen wird. Darauf verwiesen wir einleitend schon. Was bedeutet Anamnesis? Ein weiteres wichtiges Stichwort im Kontext der Argumentationen für die Unsterblichkeit und Priorität der Seele ist dasjenige der Anámnesis. Dieses Wort wird oft übersetzt mit „Wiedererinnerung“; es ist abgeleitet von dem Verbum anamimnéskesthai. Dieses Zeitwort wiederum ist zusammengesetzt aus der Vorsilbe ana- und dem Verbum mimneskesthai. Das ana- entspricht lateinischem re- und wird meist mit „wieder“ wiedergegeben. mimnéskesthai wird geläufig mit „erinnern“ übersetzt. Dabei ist diese Übersetzung nicht unproblematisch. Weni26 Für eine Übersicht über die sog. Beweise der Unsterblichkeit der Seele im Phaidon vgl. K. Bormann, Platon, 4., erneut durchges. Aufl., Freiburg-München 2003, 96-130. 48 ger einengend wäre vielleicht die Übertragung: „etwas merken“ im Sinne von „etwas speichern“. Denn bei dem deutschen Wort ‚erinnern‘ meinen wir oft schon die Wiedererinnerung mit. Man erinnert sich an etwas, das man schon gespeichert hat. Bei Platon jedoch wird aus anderen Dialogen, vor allem aus dem Theaitetos, eine Unterscheidung von mimnéskesthai und anamimnéskesthai deutlich. Mit der Anamnesis ist, so könnte man aus dieser Wortbetrachtung schließen wollen, nicht nur ein bloßes Memorieren, sondern das Zurückgreifen auf ein Memoriertes, ein mnemeíon gemeint. Derartiges kann man im Theaitetos nachlesen (209c). Wesentlich bekannter ist in diesem Zusammenhang der Dialog Menon. Dort soll jemand durch gezieltes Fragen zur Anamnesis der Kenntnis geometrischer Sachverhalte gebracht werden (zur Anamnesis vgl. 81d ff.). Über das Thema Anamnesis wurde viel diskutiert und viel in es hineinmystifiziert. Eine m. E. schlüssige Interpretation gab Hegel in seinen Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie:27 Das Reden von einer Anamnesis lege nicht die tatsächliche Annahme einer Präexistenz einer Seele vor allem Körperlichen im zeitlichen Sinne nahe, sondern drücke aus, dass im Erkenntnisprozess das An-sich der Seele aktualisiert werde. Umgekehrt formuliert kann man sagen, dass die Erkenntnis von Ideellem nicht aus etwas Sinnlichem abgeleitet werden kann. Es braucht die Vorgängigkeit der Kenntnis des Allgemeinen. Das diesbezügliche klassische Beispiel aus dem Phaidon ist die Kenntnis dessen, was wir als ‚gleich‘ bezeichnen. Was wir mit dem Ausdruck ‚gleich‘ ausdrücken wollen, lesen wir nicht dem ab, was wir als gleich bezeichnen, wie zum Beispiel zwei Hölzern. Die gleichen Dinge sind nicht identisch mit dem Gleichen selbst (vgl. 74c). Wir brauchen zwar notwendig Sinne, aus denen wir etwas beziehen, was wir als gleich benennen. Aber die Sinne sind zu dieser Erkenntnis nicht hinreichend. Kurz nach dieser Stelle macht Sokrates deutlich, dass das Gleiche nur ein Beispiel ist. Ihm geht es wesentlich um die Gesamtheit von dergleichen Prädikaten. Gesondert hebt Sokrates das Schöne, Gute, Gerechte und Fromme hervor. Damit sehen wir einmal die zentralen Themen sokratischer Gespräche auf eine Stelle versammelt. Sokrates spricht über alles, womit wir in Fragen und Antworten etwas „ein Siegel aufdrücken“, wie er sich ausdrückt (75d). Das heißt, Sokrates erfasst den Erkenntnisakt als Fragen und Antworten, wobei die Frager und Antworter in ihren Reden „Siegel aufdrücken“, und zwar solche, die etwas Unsinnliches sind. Zu ihnen sind wir immer schon vor dem Werden gelangt. Dies muss nicht unbedingt so verstanden werden, dass wir zu ihnen vor dem Werden im Sinne der Geburt gelangt sind. Überhaupt ist nur Werden vor dem Hintergrund oder Vordergrund der Siegel, also des stets Gleichen, besprechbar. 27 G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie II, Frankfurt a. M. 1971, 43 ff. (TheorieWerkausgabe; 19). 49 Ein weiteres Schlagwort bei den Unsterblichkeitsbeweisen ist das des Unzusammengesetzten (78c). Die Seele wird im Bereich der Entitäten verortet, die nicht zusammengesetzt sind. Als solche eignet ihr eine höhere Dignität als den zusammengesetzten Körpern. Diese Passage ist voller Problematik und voll von Ansatzpunkten für eine mögliche Kritik. Darauf wollen wir hier nicht eingehen. Man könnte sich fragen, inwiefern Sokrates das, was er sagt, für philosophisch bare Münze genommen wissen will, oder inwieweit er sich seinen Zuhörern, vor allem den Pythagoreern Simmias und Kebes angleicht in seiner Redeweise. Dies sei dahingestellt. Hervorgehoben sei allerdings eine Aussage: Sokrates spricht davon, dass die Philosophie die Seelen mancher „herbeinimmt“, Macht über sie ergreift (paralaboúsa, 82e, 83a). Hier haben wir ein erstes Mal eine Stelle vor uns, an der formuliert wird, dass die Philosophie nicht ein Produkt des Denkers ist, sondern umgekehrt die Philosophie den Denker erfasst. Des Weiteren ist an dieser Stelle bemerkenswert, dass gesagt wird, die Philosophie bemühe sich, die Philosophierenden zu lösen, und die Seele des wahrhaft Philosophierenden würde sich dieser Lösung nicht widersetzen. Zumindest terminologisch bewegen wir uns damit in großer Nähe zur Aufstiegsbewegung des Höhlengleichnisses in der Politeia. Einwände gegen die Darlegung der Priorität der Seele Es lohnt sich noch ein kurzer Ausblick auf die Einwände, die Simmias und Kebes gegen die Darstellung der Unsterblichkeit der Seele vorbringen. Beachtenswert ist besonders an dieser Stelle die Dramaturgie des Dialogs. Denn der Erzähler berichtet, wie den Zuhörern nach den Einwänden gegen Sokrates’ Argumente zumute war. Hier schaltet sich der Zuhörer der Rahmenhandlung ein und sagt, er verstehe diesen Zustand gut (88c-e). Durch dieses Referieren auf den Zustand der Teilnehmer am Gespräch, sowohl der historischen wie derjenigen der Rahmenerzählung, wird um so mehr Gewicht gelegt auf die nachfolgende Verteidigung der Unsterblichkeit der Seele durch Sokrates. Er wird sich in der Tat als Feldherr im Bereich des Logos erweisen, der die Kritik niederkämpft. Die Einwände beziehen sich auf zweierlei: Einerseits wird die Seele mit einer Harmonie verglichen. Wie bei einem Saiteninstrument gehe, wenn dies zerstört werde, die Harmonie als erstes zugrunde, die Bestandteile des Instrumentes dauerten sogar noch länger an (85e ff.). Der zweite Einwand geht darauf, dass zwar die Seele manche Tode überdauern mag, sich aber letztendlich abnützen könnte und irgendwann doch sterbe (87a ff.). Man darf gespannt sein, wie Sokrates diese Einwände widerlegen wird. Das erste Argument (dasjenige, welches auf die Harmonie gestützt ist) kann er leicht niederringen. Es widerspricht der Annahme von der Anamnesis. Wenn sein Gesprächspartner, wie er es 50 getan hat und tut, dem Argument von der Anamnesis zustimmt, kann er nicht zugleich annehmen, die Seele entstehe erst aus dem Körperlichen wie die Harmonie einer Gitarre. Der zweitere Einwand ist für Sokrates wesentlich schwieriger zu widerlegen. Hier muss er das gesamte Konzept seiner Ideenannahme bemühen. Denn Ausgang seiner Betrachtung nimmt Sokrates davon, dass er sagt, man muss diesbezüglich eine Abhandlung machen über Entstehen und Vergehen – perí genéseos kaí phthorás (95e; damit nimmt er einen Buchtitel einer kleineren Schrift des Aristoteles vorweg). Hier erzählt Sokrates – worauf wir einleitend vorausverwiesen – über seinen denkerischen Entwicklungsgang. In seiner Jugend habe ihn die so genannte Naturweisheit interessiert. Er habe wissen wollen, wie und warum alles entstehe und vergehe. Sei das Leben aus Fäulnis entstanden, sei das enképhalon, das Gehirn, dasjenige, was uns die Sinne darreicht (96b), und ähnliche Fragen habe er sich gestellt. Dabei habe er das Gefühl gehabt, zu erblinden. Plötzlich sei ihm dasjenige, wovon er immer geglaubt hat, es zu wissen, völlig unverständlich erschienen. Zum Beispiel habe er nicht mehr gewusst, warum etwas größer werde. In diesem Zustand sei er eben auf das Buch des Anaxagoras gestoßen, welches verheißen habe, dass der Nous der Ordner und Verursacher von allem sei (97b). Diese Angabe einer Ursache habe Sokrates gefallen. Er habe gemeint, dass, wenn der Nous der Urheber von allem sei, er alles so ordnen würde, wie es sich am besten verhält. Wie bereits erwähnt, ist er in der Hoffnung, einen Lehrmeister in dieser Art von Wissenschaft zu finden, enttäuscht worden. Anaxagoras habe nur notwendige, keine hinreichenden Ursachen angegeben. Sokrates sah sich genötigt, eine „zweite Fahrt“, wie er sagt, zu unternehmen (99c-d). Es bleibe dahingestellt, was diese Redeweise von der „zweiten Fahrt“ genau besage, ob es das Fahren ohne Segel, d. h. mit Rudern besage oder etwas anderes. 28 Entscheidend ist die von Sokrates im Folgenden beschriebene neue Methode, die er gewählt hat. Ihm sei erschienen, er könne erblinden. Er könne blind werden wie diejenigen, welche die „zurückbleibende Sonne“ betrachten (99d). Dieses Zurückbleiben meint das Phänomen, welches wir als Sonnenfinsternis bezeichnen. Diejenigen, die direkt auf dieses Phänomen blicken, verdürben sich die Augen. Sie müssten dieses Ereignis in einem Spiegelmedium betrachten. Ebenso meinte Sokrates, dass er an der Seele erblinden könne, wenn er die Sachen mit den Sinnen anstarre. Das Spiegelmedium, dass er sich zum Ausspähen der Wahrheit auswählte, sind die Logoi. Dies sind nicht nur die „Gedanken“, wie Schleiermacher an dieser Stelle übersetzt, sondern die Argumentationen, Sätze, Reden. In diese floh Sokrates, wie er sagt, und auf diese Weise „ging er drauflos“ (100a). Dabei setzte er voraus, dass etwas das ist, was es ist, weil es an der Washeit Anteil hat. Das heißt, wenn er in einem Logos sagt: „Das ist schön“, Dann 28 Vgl. Y. Kanayama, The Methodology of the Second Voyage and the Proof of the Soul’s Indestructibility in Plato’s Phaedo, Oxford Studies in Ancient Philosophy 18 (2000), 41-100. 51 nahm er an, dass es schön sei, weil es an der Schönheit Anteil hat. Das klingt, wie schon einleitend angemerkt, vielleicht nach einer Tautologie, ist es aber nicht. Sokrates verlagert die Problematik auf die Erfassung des jeweiligen autó kath’ hautó, des Begriffes „an und für sich“, wie es schleiermacherisch heißt. Es geht um die Erfassung des Prädikates selbst. Dies freilich ist eine Hauptschwierigkeit des platonisch-sokratischen Philosophierens. Wie kann man diese Ideen erfassen? Das wird bei Platon anderswo erläutert. Hier geht es um den Beweis der Unsterblichkeit der Seele, der eigentlich ziemlich schlicht durch die Teilhabe erklärt wird. Es gäbe Entitäten, die notwendigerweise immer auch anderes als sie selbst sind mit sich brächten. So sei mit der Drei immer das Ungerade verbunden. Nun könne man schließen, dass eine Seele immer mit Leben verbunden sei. Niemals würde sie das Gegenteil, den Tod annehmen. Also sei sie unsterblich. Freilich beruht diese Demonstration auf der Übereinkunft, dass die „Idee des Lebens“ unsterblich ist (106d). Sokrates’ Gesprächspartner haben nun zwar kein Gegenargument mehr vorzubringen, aber sie merken an, dass bei ihnen noch ein gewisser Unglaube zurückbleibt. Sokrates unterstützt sie gleichsam in dieser Skepsis und betont, dass die gemachten Hypothesen noch genauer betrachtet werden müssten (107b). Nach einem abschließenden sog. Mythos, in dem Sokrates die übliche Weltauffassung des graecozentrischen Weltbildes relativiert, wird ihm das phármakon, das Mittel gereicht. In diesem Mythos, den Sokrates vorbringt, um zu zeigen, welche Sorge man für die unsterbliche Seele tragen müsse, findet sich die bekannte Stelle, dass die Mittelmeerbewohner nur einen kleinen Teil der bewohnten Welt ausmachten. Sie würden wie Frösche oder Ameisen um einen Teich wohnen (109b). Nach eingehender Beschreibung der reinen Welt oberhalb der von uns bewohnten Welt wird am Ende dieses Mythos erzählt, dass diejenigen, die herausragend gut gelebt haben, nach ihrem Tod zu diesem reinen Ort gelangen. Von der bisherigen Erde würden sie wie aus „Fesselhäusern“ (114b) befreit werden. Damit haben wir eine gewisse Rahmung zum Anfang des Phaidon. Diese Befreiten seien diejenigen, welche sich mit der Philosophie hinreichend gereinigt hätten und ohne Körper lebten (114c). Sogleich nach Beendigung dieser Erzählung tritt Sokrates in Distanz zu ihr. Es würde keinem, der Nous, also Geist hat, zukommen, zu behaupten, dass es sich so verhalte. Aber es lohne sich, die Hoffnung zu hegen, dass es sich mit der Seele irgendwie so verhalte (114c-d). Sokrates sagt dann noch einiges über seine konkrete Erwartung, was nach seinem Tod sein werde. Dann wird ihm das phármakon, das Mittel gereicht. Hier erlaubt sich Sokrates noch einen wunderbaren Scherz. Er fragt den Gerichtsdiener, der ihm den Schierlingsbecher reicht, ob es erlaubt sei, eine Trankspende zu tätigen. Es war ja in der Antike üblich, vor dem Trinken vor 52 allem des Weines einen Schluck auszugießen für die Götter. Der bedauernswerte Gerichtsdiener – man kann annehmen, dass er etwas erblasst ist bei dieser Frage – erwidert, dass man eigentlich nur soviel zubereiten würde, wie man für notwendig erachte. Sokrates lässt den braven Mann dann walten, er trinkt den Becher und verhält sich wie ein braver Patient, er stirbt in der genau vorgeschriebenen Weise, sodass der Gerichtsdiener feststellen kann, dass Sokrates allmählich von den Beinen beginnend gefühllos wird. Sokrates’ ultima verba, seine letzten Worte sind folgende: „O Kriton, wir schulden dem Asklepios einen Hahn.“ (118a). Damit ist der Körper des „besten, weisesten und gerechtesten Mannes“, wie Phaidon am äußersten Schluss seines Berichtes sagt (118a), erstarrt. Durchaus lebendig geblieben ist jedoch sein Logos. Somit haben wir einen ersten Einführungsteil in Grundthemen der Philosophie Platos und in seine Schilderung des frommen Sokrates hinter uns gebracht. Es hat sich gezeigt, dass Sokrates seit früher Jugend in die Logoi hingeflohen ist, um in ihnen die Wahrheit auszuspähen. Man kann, wollte man Sokrates imitieren, fragen, wie man eine solche Flucht vollziehen soll. Dabei könnte man auf die Überlegung verfallen, zunächst einmal das zu prüfen, woraus die Logoi bestehen. Sätze und Reden aber bestehen, wie der Sophistes lehrt, aus Wörtern (vgl. 263a). So könnte man meinen, man nähere sich über eine Betrachtung der Satzteile einer philosophischen Erkenntnis. Zum Teil war dies auch die Meinung mancher Philosophen vor Sokrates, so berichtet es uns zumindest Platon. Im Euthydemos lässt er Sokrates erwähnen, dass der Meinung des Prodikos zufolge der Beginn in der Philosophie mit der Untersuchung der Richtigkeit der Namen zu machen sei (277d). Genau damit befasst sich seinem antiken Untertitel zufolge der Dialog Kratylos. Kratylos Was ist die Ausgangsfrage des Kratylos? Dieser Dialog ist vor allem seit der Zeit der durch Ferdinand de SAUSSURES Arbeiten eingeleiteten Wende in der Betrachtung der Sprache intensiver rezipiert worden.29 Dabei ist die Ausgangsfrage des Gesprächs, die an seinem Anfang an Sokrates herangetragen wird, diejenige, ob die Namen ihre orthótes, ihre „Richtigkeit“, wie traditionell übersetzt wird, von der phýsis her hätten oder durch thésis; zu den griechischen Ausdrücken ist Folgendes zu sagen: Ob 29 Zu einer Auseinandersetzung mit Saussure seitens der Kratylos-Forschung vgl. z. B. J. C. Rijlaarsdam, Platon über die Sprache. Ein Kommentar zum Kratylos, Utrecht 1978. 53 orthótes mit ‚Richtigkeit‘ treffend übersetzt wird, wird diskutiert. Sie sollen auf dieses Frage hingewiesen werden, ohne dass wir sie hier diskutieren wollen. phýsis wird normalerweise mit ‚Natur‘ ins Deutsche übertragen, thésis beispielsweise mit ‚Satzung‘. Diese phýsis-thésisUnterscheidung ist mittlerweile sozusagen sprachtheoretisches Gemeingut, in beinahe jedem Einführungsbuch zur Linguistik werden sie wohl darauf hingewiesen. Mit beiden Meinungen, sowohl mit der, dass die Namen, d. h. vor allem die Hauptwörter, von Natur aus so adäquat seien, wie sie sind, als auch die Ansicht, dass sie auf Übereinkunft beruhten, verteidigt Sokrates im folgenden Gespräch. Allerdings zeigt sich, dass er mit beiden Thesen Scherz treibt. Deshalb ist bei der Heranziehung von Zitaten aus dem Kratylos besondere Vorsicht geboten. Sie können nicht einen Satz aus diesem Dialog herausnehmen und ihn als Ansicht Platos über die Sprache verkaufen. Vielmehr wird, so meine ich, in dem ganzen Dialog der Etymologisierungsbetrieb aufs Korn genommen. Sokrates sagt an einer Stelle, an der sein Gegenüber anmerkt, dass er ihm in göttlicher Verzückung zu sprechen scheint, dass er sich nur an diesem einen Tag dem Wahn des Etymologisierens hingeben will (396d-e). Das heißt, man muss rekonstruieren, wen Sokrates in diesem Werk womit anspricht. Viel Kritik beispielsweise hat Platon seine Äußerung zum Vergleich des Wortes mit einem Werkzeug eingebracht. Aber diese Aussage findet sich eben im Kontext eines Spieles mit einer gewissen Grundannahme. Zunächst nämlich befasst sich Sokrates mit der Annahme des Hermogenes’, dass die Wörter durch gemeinsame Setzung und Übereinstimmung bestünden (xynthéke, homología, 384d). Sokrates führt seinen Gesprächspartner über einige grundsätzliche Annahmen, die er sich bestätigen lässt, dazu zuzugeben, dass man sich bei der Setzung der Wörter an einer Sache zu orientieren habe. Solche Grundannahmen, die er sich bestätigen lässt, sind zum Beispiel: Es gibt einen wahren und einen falschen Logos (385b), eine wahre und falsche „Aussage“ wie man oberflächlich sagen könnte. Diese Annahme eines falschen Logos ist im platonischen Kontext durchaus nicht selbstverständlich. Im auf den Kratylos folgenden Theaitetos und im Sophistes muss erst mühsam gezeigt werden, wie es das „falsch“, das pseudés, geben kann (besser ist diesbezüglich von einem „trügerisch“ zu sprechen). Hier im Kratylos wird dies nicht problematisiert. Ebenso räumt der Gesprächspartner dem Sokrates ein, dass es von den einzelnen Sichtweisen der Menschen unabhängige Sachen gibt. Des Weiteren gibt er zu, dass das Sprechen eine der menschlichen Tätigkeiten ist (387b). Die Tätigkeiten nun, wie zum Beispiel das Zerlegen eines Tieres, seien sachorientiert (vgl. 387a). Also müsse auch das Sprechen, die Tätigkeit mit Wörtern, sachorientiert sein. Hier wird ein wichtiges Vergleichsbeispiel eingeführt, nämlich das des Webens. Dieses Beispiel wird in mehreren Dialogen wiederkehren. Das Weben kenn54 zeichnet die Tätigkeit des Verknüpfens und Trennens. Das Werkzeug beim Weben ist das Weberschiffchen. Mit diesem wird im Bereich der Tätigkeit des Sprechens das Wort verglichen (388a). Dieses sei das órganon, das ‚Werkzeug‘, mit dem man das Sein unterscheidet und diese Unterscheidung jemanden lehrt, ein didaskalikón órganon kaí diakritikón (388b). Dieser Vergleich wurde Platon oft als unpassend angelastet. Aber sehen wir, was sich bei ihm daraus entwickelt. Zentral ist nämlich, dass der ‚Namenmacher‘ als Werkzeugmacher und somit als einem anderen Künstler nachgeordneter Kunsthandwerker aufgefasst wird (389a ff.). Was hat dies zu bedeuten? Zunächst führt Sokrates den Begriff des Onomatourgen ein, des ‚Namensmachers‘. Dieser wird in die mythische Frühzeit der Menschheit verlagert. Er, der Namenmacher, habe den Menschen die „Bräuche“ eingerichtet, wie sie die Dinge zu benennen hätten. Somit sei er ein Nomothet, ein ‚Brauchsetzer‘ gewesen. Dabei ist dieses Wort Nomothet das gängige Wort für Gesetzgeber. Er, der Namenmacher, erließ also gleichsam Gesetze, wie etwas zu benennen sei. Nun macht sich Sokrates zur Aufgabe, zu hinterfragen, woraufhin dieser Namenmacher bei seiner Tätigkeit blickte (389a). Damit ist man terminologisch auf die Ideenlehre verwiesen. Doch zeigt sich sogleich, dass der Namenmacher analog zum Hersteller von Weberschiffchen nicht der primäre Agent in diesen Handlungen ist. Denn derjenige, der ein Weberschiffchen macht, braucht Anleitung von dem, der sich in der Kunst des Webens auskennt. Ebenso, dies schließt nun Sokrates, braucht der Namenmacher Anleitung von dem, der sich in der Kunst des Benennens auskennt. Was ist aber diese Kunst des Benennens des Seins, die primär die Aufgabe der Unterscheidung hat? Wer leitet den „Wortmacher“ in seiner Kunst an? Diese Kunst ist die Kunst der Dialektik. Dies ist die der Namensmacherkunst vorgeordnete Kunst. Der, der ein Wort sozusagen herstellt, braucht die Anleitung eines anér dialektikós, eines „dialektischen Mannes“ (vgl. 390d). Sie sehen hier, das Wort ‚dialektisch‘ ist keine Kunstbildung des deutschen Idealismus. Es bezeichnet bei Platon die Gruppe der seltenen, überaus verehrungswürdigen Menschen, die alle Dinge richtig unterscheiden können. Sie können in ihren Begriffszergliederungen von allen Einzelbegriffen auf die passenden Oberbegriffe bis zum höchsten Begriff führen und umgekehrt alle Oberbegriffe in ihre Unterbegriffe auseinandernehmen. Im Phaidros tut Sokrates kund, dass er den Spuren solcher, die dazu fähig sind, wie den Spuren von Göttern folgt (266b-c). Für den Kratylos heißt dies, dass man anhand des äußeren Wortbestandes nur das rekonstruieren kann, was der Wortmacher vor 55 Augen gehabt hat. Dies mag richtig, kann aber auch falsch gewesen sein. So habe er das Wort theós ‚Gott‘ aufgrund der damaligen Ansicht gebildet, dass die Gestirne die Götter seien (397c). Diese gingen herum, und das griechische Wort für gehen ist theín. Somit habe der Wortbildner das Wort theós gebildet und damit eigentlich den ‚Geher‘ bezeichnet. Das meinte ich mit dem äußerem Wortbestand. Fragt man im Sinne des Kratylos etymologisch zurück, was ein Wort wie theós heißt, erfährt man nur etwas die Meinung des früheren Wortbildners und Gesetzgebers. Um Wahreres über das Wesen dessen, was wir nun einmal mit theós bezeichnen, zu erfahren, müsste man einen Dialektiker aufsuchen. (Übrigens gibt es zu der Figur des Dialektikers in Platons großen Werken ein eigenes Werk von einem bekannten deutschen Platonforscher, von Thomas Alexander SZLEZÁK).30 Daneben kann noch angemerkt werden, dass die eben genannte Etymologisierung des Wortes theós auch in der Scholastik bekannt war.31 Was den restlichen Text des Kratylos betrifft, möchte ich nur knapp anmerken, dass es durchaus wertvoll wäre, sich genauer zu überlegen, welche Begriffe und in welcher Reihenfolge sie erläutert werden. In eigentümlichen Kreisen werden Götter- und Heldennamen befragt, dann die Wörter für Gott, Daimon, Heros, Mensch, danach die Ausdrücke Seele und Körper, dann wieder Götternamen (daraus referierten wir bereits die Deutung des Namens Apollon), dann allgemeine kosmologische Kategorien wie Luft und Äther (410b-c), dann menschliche Vermögen und Tugenden. Man könnte fragen, inwiefern hier ein gewisses Binnenproömium zur platonischen Philosophie vorliegt, in dem einmal katalogartig die Entitäten aufgezählt werden, über die man philosophieren kann. In einem zweiten großen Teil befasst sich Sokrates mit der entgegengesetzten These, dass die Namen von Natur aus ihre Richtigkeit hätten. Jedenfalls wird man im Kratylos nicht befriedigt bei der Suche nach einer Antwort auf die Frage, wie nun die von Sokrates angegebene Flucht in die Logoi genau funktionieren soll. Auf eine solche Frage erhält man schon eher im Theaitetos Antwort. Worin besteht die zentrale Frage des Theaitetos? Im Theaitetos geht es allgemein um die Frage, was eigentlich Wissen bzw. das ‚Sich-aufetwas-Verstehen‘ (epistéme) ausmacht. Dieser Dialog ist wesentlich bekannterer als der Kratylos. In ihm, dem Theaitetos finden sich die berühmten Stellen, an denen über das Staunen als Anfang des Philosophierens und über den Satz des Protagoras gesprochen wird (s. u.). 30 Th. A. Szlezák, Das Bild des Dialektikers in Platons späten Dialogen. Platon und die Schriftlichkeit der Philosophie Teil II, Berlin - New York 2004. 31 Vgl. z. B. Thomas v. Aquin, Summa theologiae 1 q. 13 a. 8. 56 Des Weiteren wird im Theaitetos ein philosophischer Terminus geboren, der später als Bezeichnung einer Kategorie Furore machen wird. Oftmals hört man über den Theaitetos, dass er ein einführender, deshalb leicht zu lesender Dialog sei. Dem kann ich nicht unbedingt zustimmen. Er erreicht überaus hohe bzw. tiefe spekulative Höhen bzw. Tiefen. Man könnte die im Theaitetos angesprochene Thematik im Bereich der Erkenntnistheorie verorten. Doch kann man in diesem Dialog ebenso den Versuch einer ontologischen Fundierung sehen. Zunächst geht es in ihm um die Frage, warum jemand überhaupt ein Wissen beanspruchen kann, das ein anderer nicht hat. Darüber hinaus werden Fragen erläutert wie: Auf welche Weise kann es zu Irrtum kommen? Warum ist das durch die Sinne vermittelte Gewisse als Erkenntnis nicht ausreichend? Welche für die jüngere Philosophiegeschichte bedeutende Definition von Wissen wird dem Theaitetos zugeschrieben? Wenn es zuvor beim Kratylos hieß, dass sein Inhalt seit dem sog. linguistic turn wieder verstärkt von Interesse war, so gilt dies noch mehr vom Theaitetos. Er und vor allem sein vermeintliches Ergebnis, das keines ist, gilt als Grundtext der Analytischen Philosophie. Wissen sei dasjenige, wovon es eine begründbare, wahre Überzeugung gebe, griechisch: eine alethés dóxa, zu der man einen lógos angeben kann, englisch: justified true belief (eine bis zum Auftreten des sog. GETTIER-Problems in diesem Bereich anerkannte Definition). Warum Dialoge schreiben? Doch nicht nur aufgrund dieser Wirkmächtigkeit soll der Theaitetos referiert werden. In ihm kann man sehen, was Philosophieren im Logos heißen kann. Bemerkenswert ist bei diesem Dialog auch die Rahmenhandlung. Diese spielt nach Sokrates’ Tod. Zwei Bekannte, Eukleides und Terpsion, treffen einander, von denen einer gerade den Theaitetos gesehen hat, der dem Werk den Namen gab. Dieser Theaitetos sei kürzlich von einem Kriegseinsatz heimgekehrt – an einer schweren Krankheit erkrankt – und er liege im Sterben. Anlässlich dieser Begegnung mit Theaitetos hat sich Eukleides an ein Gespräch des jungen Theaitetos erinnert. Dieses Gespräch habe ihm, Eukleides, Sokrates erzählt und ihm prophezeit, dass Theaitetos ein sehr tüchtiger Mann werden würde (Theait. 142c-d). (Ich erzähle dies so ausführlich, weil sich hier eine Motivation innerhalb der platonischen Werke dafür findet, überhaupt etwas zu verschriftlichen.) Wie Sie vielleicht wissen, ist über Platos Dialoge in den letzten Jahrzehnten 57 vor allem aufgrund der sog. Schriftkritik immer wieder diskutiert worden. Im Phaidros werden Probleme aufgezeigt, die sich bei der schriftlichen Niederlegung von etwas ergeben könnten (274b ff.). Hier im Theaitetos wird klar ausgesprochen, dass jemand aus Erinnerungsgründen ein Gespräch, das ihm erinnerungswürdig erschien, in schriftlicher Form niedergelegt hat. Das Wort, welches Eukleides hier verwendet, lautet hypómnema (vgl. 143a). Dieser Ausdruck gab einem Buch von Detlef THIEL, das sich diesem Fragenkomplex der Verschriftlichung widmet, seinen Titel.32 Zusätzlich macht Eukleides die Angabe, dass er das Gespräch nicht in der Form aufgeschrieben habe, in welcher es ihm Sokrates erzählte. Vielmehr habe er es in Dialogform abgefasst. Somit würden nicht Einschübe wie „ich sagte“ oder „er stimmte zu“ den Gesprächsgang stören (143b-c). Sie erhalten damit eine innerplatonische Begründung dafür, warum Dialoge in Dialogform geschrieben werden, und warum es überhaupt geboten erscheint, etwas zu verschriftlichen. Die Thematisierung von erinnerungswürdigen Gesprächen beschränkt sich nicht auf den Theaitetos. In anderen Dialogen ist davon die Rede, dass Leute weite Reisen auf sich nehmen, um jemanden zu treffen, der ihnen ein Gespräch des Sokrates, das vor langer Zeit stattgefunden hat, referieren kann (vgl. z. B. den Anfang des Parmenides). Systematisch wird dies von Platon in den Nomoi thematisiert. Einer der wenigen Gründe für eine Reise hinaus aus der neu eingerichteten Polis bestünde in der Suche nach „göttlichen Männern“, bei denen man etwas lernen könnte (951b-c). Neben dieser Rahmenhandlung des Theaitetos ist der fiktive Zeitpunkt des aufgezeichneten Gesprächs von gewissem Interesse. Am Ende seiner Unterhaltung mit Theaitetos wird Sokrates nämlich sagen, dass er zur Halle des Basileus muss (210d). Damit sind wir auf den Euthyphron und den Beginn des Prozesses des Sokrates zurückverwiesen. Das Gespräch mit Theaitetos fand also, wie auch Eukleides eingangs anmerkt, kurz vor Sokrates’ Tod statt. Diese Information ist zu verknüpfen mit der Beobachtung, dass sich am Anfang des Gespräches, welches im Theaitetos verlesen wird, Sokrates bei einem Mathematikprofessor nach begabten Studenten erkundigt. Dieses aktive Nachfragen ist eigentlich untypisch für Platos Sokrates. In der Mehrzahl der Dialoge Platos sind es andere Leute, die mit einer Frage oder einer Bitte an Sokrates herantreten und ihn so in den Logos bringen. Hier jedoch geht die Aktion von Sokrates aus. Man kann, wenn man das Datum des Dialogs kurz vor seinem Tod bedenkt, fragen, ob hier vielleicht ein neuer Sokrates aufgebaut werden soll. Ist doch Theaitetos auch der Gesprächspartner im folgenden Dialog, in dem Fundamentales über die Ontologie erörtert wird. 32 D.Thiel, Platons Hypomnemata. Die Genese des Platonismus aus dem Gedächtnis der Schrift, FreiburgMünchen 1993. 58 Jedenfalls wollte ich darauf hinweisen, dass sich die Texte Platos nicht als hermetisches Gebilde der Sokratesverehrung geben. Sie sind durchaus auch von ihrer eigenen Systematik her offen für eine Weiterführung. Wichtig ist nicht das Nachbeten sokratischer Gespräche, sondern das Philosophie-Treiben in Sinn des platonischen Sokrates. Sokrates nun wendet sich am Anfang des von Eukleides verschriftlichten Gespräches an den Mathematiker Theodoros mit der Frage, wer von den jungen Leuten besonders begabt sei. Dieser nennt ihm, ohne zunächst einen Namen anzugeben, einen, der so wie Sokrates aussähe, stupsnäsig sei und hervortretende Augen habe. Er habe diese Eigenschaften, so sagt Theodoros, ebenso wie Sokrates, aber weniger stark ausgeprägt (143e-144a). Diese Erwähnung des unvorteilhaften Äußeren des Sokrates und des Theaitetos dient nicht nur zur Parallelisierung der beiden nachmaligen Unterredner (und zur etwaigen humorigen Auflockerung), sondern rahmt den ganzen Theaitetos. Denn gegen sein Ende nennt Sokrates als Beispiel für eine richtige Meinung die richtige Meinung, die man über Theaitetos haben kann. Sokrates sagt, er werde nicht eine richtige und zutreffende Doxa, also ‚Vorstellung‘ oder ‚Meinung‘ über Theaitetos haben, wenn er nur meint, er sei ein Mensch, habe eine Nase und Augen – damit wäre er nicht von anderen unterschieden. Noch genüge es, wenn er wüsste, dass er stupsnäsig sei und hervortretende Augen habe – damit würde er sich beispielsweise nicht von Sokrates unterscheiden. Sokrates müsste vielmehr seine spezifische Stupsnasigkeit und Augenhaftigkeit erkennen. Wenn er diese aber einmal erkennt, bräuchte er die richtige Meinung davon nicht mehr, da er ohnedies schon die Erkenntnis habe. Die Untersuchung über das Wissen ist somit gescheitert (209a ff.). An der Ringkomposition des Theaitetos ist Folgendes bemerkenswert: Im Dialog wird auf etwas Bezug genommen, was im Dialoggeschehen de facto vorliegt. Sokrates referiert am Ende des Dialogs auf das Erkennen der Spezifika des Theaitetos. Damit korrespondierend gibt es am Anfang die Situation, wo sich eine Gruppe Jugendlicher auf Sokrates und den Mathematikprofessor Theodoros zubewegen. Theodoros fragt Sokrates, ob er den jungen Mann, den er ihm angepriesen hat, erkennt: Sokrates antwortet: „Gignosko – ich erkenne ihn“ (144c). Nimmt man diese Aussage mit dem Schluss des Dialogs zusammen, kann man konstatieren: Die Gesprächspartner zeigen durch ihr Handeln, dass sie de facto etwas vermögen, über eine Kenntnis verfügen. Im Gespräch können sie allerdings keine Erklärung dafür finden, worin dieses Vermögen besteht. Sokrates erkennt tatsächlich Theaitetos, kann jedoch keinen Logos dafür finden, worin dieses Erkennen besteht. Diesen Vorgang findet man wiederholt bei Platon. Deutlich wird dies etwa im Laches, wo schließlich darüber gesprochen wird, was Tapferkeit ist. Gesprächsteilnehmer sind unter anderem zwei Tapferkeitsexperten, nämlich kriegser59 fahrene Feldherren. Einer dieser spricht sein Lob über Sokrates aus, dessen Tapferkeit er in einem kürzlich beendeten Feldzug studieren konnte. Auch hier sind die Gesprächsteilnehmer de facto über ihren Gesprächsgegenstand vermögend, können für ihn, die Tapferkeit, aber keine Erklärung, keinen Logos finden. Was ist Episteme? Wir wollen nun zur Ausgangsfrage der Theaitetos zurückkehren. Diese ist die Frage nach der Episteme. Der Weg, auf dem Sokrates zu dieser Frage gelangt, zeigt an, dass Sokrates auch hier seiner im Phaidon erläuterten Vorgangsweise treu bleibt. Er sagt nämlich: „Ich glaube, dass die Weisen durch Weisheit klug sind.“ (145d) – Wenn also jemand als weise bezeichnet wird, so deshalb, weil er an der Weisheit teilhat. Nun fragt Sokrates weiter, ob Episteme und Sophia (d. h. Weisheit bzw. Klugheit) dasselbe seien. Dies gesteht ihm Theaitetos zu. Für uns stellt sich darüber hinaus die Frage, was das Wort ‚Episteme‘ bedeutet. Es wird unterschiedlich übersetzt mit ‚Erkenntnis‘, ‚Wissen‘, ‚Wissenschaft‘, englisch mit knowledge etc. Dem Wort nach ist es vom Verbum epístasthai abgeleitet, was ‚sich auf etwas verstehen‘ bezeichnen kann. Deshalb wird epistéme manchmal mit ‚Sich-auf-etwas-Verstehen‘ übertragen. Diese Übertragung soll darauf aufmerksam machen, das epistéme mehr sein kann als ein wissenschaftliches Wissen im engeren Sinne.33 Als Theaitetos eine Antwort zu finden versucht auf die Frage, was Episteme sei, begeht er denselben Fehler wie mehrere sokratische Gesprächspartner. Er antwortet mit Einzelinstanzen wie Geometrie und Schusterkunst. Er kann nicht in Sokrates’ Fragehinsicht hineinfinden. Dieser will nicht mehrere Einzelwissenschaften zur Antwort erhalten. Er sucht nach einer Erklärung dessen, was Wissen ausmache. Er vergleicht dies mit Folgendem: Wenn jemand fragt, was Schlamm ist, will er nicht zur Antwort bekommen: der Schlamm der Töpfer, der Schlamm der Ziegelmacher und so weiter. Dieses Beispiel ist insofern beachtenswert, weil Sokrates eine mögliche Antwort auf die Frage, was Schlamm sei, gibt: Man könne leicht antworten, dass es die mit Wasser vermischte Erde sei (147c). Allmählich muss Theaitetos einsehen, dass die an ihn gerichtete Frage nach der Episteme überaus diffizil ist. An diesem Punkt des Gesprächs offenbart sich ihm Sokrates als Hebamme. 33 Hinzuzunehmen ist bei dem Versuch, die Bedeutung dieses Ausdrucks festzumachen, seine spezifische Verwendung bei Aristoteles. Für ihn befasst sich die epistéme im engeren Sinne mit dem, was nicht anders sein kann (z. B. mit den Gestirnbahnen). Dadurch unterscheidet sie sich etwas von der phrónesis, dem Handlungswissen, wo das Beraten seinen Platz hat. Die vielleicht bekannteste Differenzierung dieser Termini bei Aristoteles findet sich im sechsten Buch der Nikomachischen Ethik (Kap. 3 ff., 1139b14 ff.). 60 Was ist mit der Maieutik des Sokrates gemeint? Hier erreichen wir die berühmte Stelle, wo von der Maieutik des Sokrates die Rede ist. Diese Maieutik wird bei Platon eigentlich nur selten angesprochen. Aber einige Versatzstücke aus der Metaphorik der Geburtshilfekunst tauchen in mehreren Dialogen auf. Für Sokrates liegt es von Geburts wegen nahe, sich als Hebamme (gr. maía) zu bezeichnen, zumal seine Mutter Phainarete Hebamme war. Theaitetos möge, dies fordert Sokrates, nicht verraten, dass er sich auf diese Kunst verstehe, mit welcher er bewirke, dass alle in die Aporie kommen (149a). Das Zentrale an dieser Selbstoffenbarung des Sokrates ist, dass er sich als jemand zu erkennen gibt, der beurteilen kann, welche Logoi wert sind, verfolgt zu werden, und welche aufgegeben werden sollten. Im Phaidon und Kriton war zu sehen, dass Sokrates die Fähigkeit hat, zwischen guten und besseren Logoi zu unterscheiden, wenn er davon spricht, dass er in seinem Leben immer so vorgegangen ist, dass er dem besten Logos nachgefolgt ist. Über diese logoskritische Fähigkeit hinaus spricht Sokrates im Theaitetos davon, dass er wie die Hebammen, die mit Säuglingen zu tun haben, sich auf das Verabreichen von Pharmaka verstehe und durch Besingen die Wehen hervorbringen und stoppen könnte (149c-d). Exakt diese Termini wie ‚Pharmakon‘ und das ‚Besingen‘ finden sich in einigen anderen Dialogen in ähnlichen Kontexten. Typisch hierfür ist zum Beispiel der Charmides, wo ein junger Mann seinen Kopfschmerz durch Besingung durch Sokrates verlieren soll. Ebenso würde sich Sokrates auf die Kuppelei verstehen (150a). Er wisse, wer mit wem zu verbinden sei, d. h. welchem Menschen welche Logoi in die Seele gesät werden sollten. Hier können wir einen kurzen Ausblick auf einen der anderen Autoren dieser Zeit machen, die über Sokrates berichten. XENOPHON lässt in seinem Gastmahl den Sokrates sagen, dass die einzige Kunst, auf die er sich verstehe, die Kuppelei sei (symp. 3, 11). Manche Gelehrte sind der Ansicht, Xenophon vermittle das authentischere Sokrates-Bild.34 So könnte man also argumentieren, dass dieser Aspekt durchaus biographische Dimension habe. Insgesamt kann man sagen, dass Sokrates nicht nur logoskritische, sondern auch logoshervorbringende Funktion hat. Der Gott hindert ihn zwar, wie er sagt, selbst Logoi hervorzubringen, aber er beurteilt und motiviert Logoi anderer Sprecher (150c). Jedenfalls erscheint hier Sokrates erneut als Diener des einen für ihn zentralen Gottes. Für Sokrates ist es ebenso wenig wie für Apollon thémis, d. h. es ist ihm nicht erlaubt, etwas Trügerisches zuzulassen und das Wahre vernichten zu lassen (151d). Theaitetos unternimmt nun eine erste Definition. Er meint, Episteme sei 34 Grundlegend für diese Diskussion: K. Joël, Der echte und der Xenophontische Sokrates, Berlin 1893. 61 nichts anderes als Aisthesis, dasjenige, was uns die Sinne vermitteln (151e). Hier bringt Sokrates einen berühmten Mann ins Spiel, PROTAGORAS. Was besagt der Satz des Protagoras? Damit erreichen wir eine der sog. Belegstellen für einen Vorsokratikertext. Die Texte nämlich, die wir in den Sammlungen der Vorsokratiker lesen dürfen, sind aus vorwiegend späteren Autoren (wie Platon, Aristoteles oder Kommentatoren wie Simplikios) zusammengesammelt. Der in der gesamten Antike bekannte und diskutierte Satz des Protagoras nun, wonach der ‚Mensch Maß aller Dinge‘ sei, findet sich an der soeben angesprochenen Stelle im Theaitetos (152a). Dabei zeigt sich, dass es durchaus von Bedeutung ist, den jeweiligen Zitatkontext mitzulesen. Denn einerseits könnte man sagen, dass Sokrates hier einen gewissen Spaß treibt mit dieser Aussage der Protagoras, die er heranzieht. Andererseits ist das Umfeld des Zitats eine Paradestelle für Textinterpretation. Denn Sokrates fordert sich selbst und seine Gesprächspartner auf, dem Logos des Protagoras zu Hilfe zu kommen. Er lässt also hier das hermeneutische Problem anklingen, das ausführlicher im Phaidros besprochen wird. (Ein weiterer wichtiger Passus zur Interpretation von niedergeschriebenen Texten findet sich im Dialog Protagoras. Dort legt Sokrates sozusagen die erste Gedichtinterpretation der antiken Literaturgeschichte vor, wenn er ein Simonides-Gedicht erläutert, vgl. 342a ff.) Im Theaitetos nützt Sokrates die Erwähnung des Satzes des Protagoras zur Betrachtung der Funktionsweise der Sinne. In der Vollform lautet diese Sentenz, die auch unter der lateinischen Nennung als homo-mensura-Satz bekannt ist: „Aller Dinge Maß ist der Mensch, der Seienden wie (od. dass) sie sind, der nicht Seienden, dass sie nicht sind.“ Oftmals wurde, wie sich leicht vermuten lässt, dieser Satz als Ausdruck eines radikalen Erkenntnisrelativismus und Subjektivismus gelesen. Ähnliches findet sich zunächst auch in Sokrates’ Deutung. Ob etwas als warm oder kalt empfunden wird, dafür ist nur der jeweils Empfindende das relevante Maß. Vor allem müsse man diesem Satz folgend, so Sokrates, annehmen, dass es nichts „an und für sich gibt“, wie Schleiermacher den Passus autó kath’ hautó übersetzt (157a). Das, was das Signum der Ideenlehre ist, wäre destruiert. Es nimmt kaum wunder, dass bei der im Theaitetos in weiterer Folge entwickelten Wahrnehmungstheorie HERAKLIT ins Spiel kommt. Sehr wohl Verwunderung ruft die Gesprächsführung des Sokrates, der mannigfache Probleme aufzeigt, bei Theaitetos hervor, der an einer Stelle des Gesprächs anmerkt, dass ihn ‚schwindle‘ (155c). Hier sagt Sokrates, dass der Lehrer Theodoros keine schlechte Vermutung über die 62 philosophische Begabung des Theaitetos angestellt habe. Denn dies sei ein Erleidnis des Philosophen, das Wundern (155d). Nach diesem Zwischenspiel erläutert Sokrates ausführlich die Theorie, wonach alles in Bewegung sei und sich alle Sinnlichkeiten aus Bewegung erklärten. Bei diesen Darlegungen mag man sich, wenn man Schleiermachers Übersetzung liest, ein wenig in den Bereich des deutschen Idealismus versetzt fühlen. Alles was ist, sagt Sokrates nämlich, muss immer „für irgendein anderes“ sein (157a). Allerdings könnte man dann richtigerweise nichts mehr am Sein im Logos festsetzen. Diese Nicht-Logos-Haftigkeit stört Sokrates (wie man vermuten darf) besonders. Auf diese relativ lange Explikation des protagoräischen Gedankens folgt eine zunächst eher aufs Lächerlichmachen zielende Kritik. Wenn der Mensch das Maß aller Dinge sei, könne man auch sagen, dass das Schwein oder der ‚Hundsköpfige‘, d. h. der Affe, das Maß aller Dinge sei (161c). Niemandem könne eine größere oder kleinere Klugheit oder Besonnenheit zugeschrieben werden, da ein Besserwissen nicht kommunizierbar sei. Man könne nicht sagen, dass jemand wie Protagoras klüger sei als andere, da jeder selbst für sich Maß der Weisheit sei. Diese vielleicht etwas platte Kritik wird Sokrates später selbst kritisieren. In einem zweiten Anlauf, den er gemeinsam mit dem Geometrieprofessor Theodoros bestreitet, will er dem Satz des so angesehenen Protagoras mehr Gerechtigkeit zukommen lassen. Der Sophist als Weisheitslehrer könne ja sehr wohl bewirken, dass die Menschen ihre falschen Vorstellungen ablegten. In diese zweite, weitaus subtilere Untersuchung der Aussage des Protagoras ist ein berühmter Exkurs über die Philosophen eingeflochten. Die Philosophen werden darin von Sokrates und Theodoros abgehoben gegen die Rhetoren. Diese hätten nie Muße, die Redezeitbeschränkung in der Volksversammlung würde sie bei ihren Reden stets bedrängen – sie seien die Sklaven ihrer Reden. Die Philosophen hingegen hätte Muße (scholé) und könnten von einem Logos zum nächsten gehen, wenn dies erforderlich erscheine. Sie seien ein „Chor von Philosophen“, die sich um die Harmonie in den Logoi bemühten (175e). Hier steht die berühmte Aussage von der Angleichung an Gott: Sokrates sagt, es sei nicht möglich, dass das Schlechte vergehe. Es sei notwendig, dass es immer etwas dem Guten Entgegengesetztes gäbe. Deshalb müsse man versuchen, möglichst rasch „von hier nach dort“ zu fliehen; diese Flucht sei eine homoíosis theó, eine ‚Verähnlichung‘ mit Gott (176ab). Widerlegung des Satzes des Protagoras – Suche nach einem Kriterium des Wissens 63 Doch auch in der ausführlicheren, sozusagen vornehmeren Auseinandersetzung mit dem Satz des Protagoras muss Sokrates an diesem Diktum eine Kritik im buchstäblichen Sinn anbringen: Er befragt ihn nämlich daraufhin, was unser Kriterium bei verschiedenen Unterscheidungen sei. Der Ausdruck kritérion ist ein griechisches Wort, dass etwa ‚Kennzeichen‘, ‚Unterscheidungsmal‘ bezeichnet. Hier bahnt Sokrates eine fundamentale Unterscheidung an: Für Warmes und Kaltes habe zwar jeder das Kriterion in sich selbst; nicht jedoch habe jeder dasselbe Kriterium in sich für zukünftige Ereignisse. So könne ein Arzt anderes darüber voraussagen, wie sich ein Pharmakon auswirken werde als ein Unkundiger. Dieses Referieren auf unterschiedliche Kriterien wird es Sokrates schließlich ermöglichen, Theaitetos plausibel zu machen, dass die Sinne nicht die gesuchte Erkenntnis sein können. Zuvor befasst er sich jedoch noch einmal mit der radikalen Flusslehre im Stile von Herakliteern. Eine Sinnesqualität wie Wärme oder Weiße entstünde, so fasst Sokrates noch einmal zusammen, wenn sich ein Tuendes und Erleidendes aufeinander zu bewegten. Das Auge etwa wäre ein Erleidendes, das von einem Gegenstand erlitte, fähig zu werden, ‚weiß‘ sinnlich zu unterscheiden, und der tätige Gegenstand werde in diesem Aufeinander-zuBewegen weiß. Nicht jedoch würde der Gegenstand zur Weißheit selbst, die sich nur als Ergebnis der Bewegung abscheide. Hier formt Sokrates unter Platos Feder das Wort poiótes, ‚Wiebeschaffenheit‘ und fügt im selben Atemzug hinzu, dass seinem Gegenüber der Ausdruck in dieser dichten Form vielleicht unverständlich ist (182a). Sokrates hat damit den Allgemeinbegriff für Instanzen wie Weißheit oder Wärme gebildet. Dieses Wort wird dann eine der von Aristoteles unterschiedenen Kategorien bezeichnen und über die lateinische Version qualitas einen Siegeszug durch zahlreiche neuzeitliche Sprachen halten. Diese Wortkreation kann uns gut zur endgültigen Widerlegung der Definition des Theaitetos, Wissen sei die Aisthesis, führen. Denn jeder der Sinne kann, darin sind sich Sokrates und Theaitetos einig, nur das ihm Eigene unterscheiden, wie der Sehsinn die Farben. Aber wer oder was ist dafür zuständig, dass wir die Unterschiedenheit der Sinne selbst feststellen? Hier muss Theaitetos zugeben, dass dies nicht mehr die Aisthesis leistet. Was dies jedoch sei, das dies leistet, ist nicht leicht zu sagen. [Übrigens sind wir hier vorverwiesen auf die Unterscheidung der Sinnesleistungen in Aristoteles’ Schrift Über die Seele. Dort wird die eigene Aisthesisleistung von der gemeinsamen Aisthesisleistung unterschieden (s. u.). (Man könnte von hier gleich weiter zum anderen Ende der abendländischen Metaphysik, zu Hegel springen und diese Passage mit dem Anfang der Phänomenologie vergleichen, nämlich mit den Kapiteln über die „Sinnliche Gewissheit“ und über „Die Wahrnehmung oder das Ding und die Täuschung“.) Die einzelnen Sinne verhalten 64 sich zueinander gleichgültig, die Frage stellt sich nach ihrer Vermittlung. Darüber hinaus sind bei Aristoteles die Einzelsinne unfehlbar, erst bei der aísthesis der koiná (vgl. Theait. 185e), der gemeinsamen Entitäten, tritt die Täuschung, das pseúdos ein.] Des Weiteren sind wir im Theaitetos auf das Grundproblem der Philosophie überhaupt verwiesen. Denn Sokrates fragt, nachdem ihm Theaitetos zugegeben hat, dass nicht die Aisthesis das Kriterium der Verschiedenheit ist, was die Dynamis, die spezifische Fähigkeit sei, durch die wir bei allen Dingen gemeinsam das „es ist“ aussagen. Damit können wir uns bereits gedanklich dem Dialog Sophistes zuwenden, in welchem die Grundfrage nach dem Sein gestellt wird. Bevor wir tatsächlich zu diesem Dialog übergehen, sollte ich Ihnen noch zwei für die Philosophiegeschichte bedeutsame Stellen nennen, die zugleich motivieren, warum die ontologische Betrachtung des Sophistes angebracht erscheint. Denn bei den weiteren Definitionsversuchen des Theaitetos wird immer wieder gefragt werden, wie so etwas wie „falsch“ oder „Täuschung“ gedacht werden kann. Wie kann das „nicht“ in eine Meinung oder einen Logos kommen? Diese Frage, wie eine falsche Meinung entstehen könne, wird also bereits im Theaitetos aufgeworfen. Eine mögliche Antwort dafür suggeriert Sokrates dem Theaitetos, indem er fragt, ob etwas Falsches Meinen etwa das „etwas Anderes Meinen“ sei (189d). Diese Überlegung gefällt dem Theaitetos, er stimmt ihr zu. Der Wachsblock- und Taubenschlagvergleich Hier kommt das Überlegen, die diánoia ins Spiel. Sie sei, wie Sokrates als Definition vorschlägt, das Reden der Seele zu ihr selbst, ein lógos tés psychés prós hautén (vgl. 189e). Das Reden der Psyche mit sich selbst kommt bei Platon öfters vor, zum Beispiel im Philebos oder im Menon. Wenn man etwas zu bestimmen meint, so spräche man nach dieser Ansicht zu sich selbst einen Logos, einen Satz, wie beispielsweise: „Das ist ein Mensch“, hinsichtlich einer Meinung, die man über etwas Entferntes hat. Man nähert sich dem Objekt und sagt dann: „Das ist eine Statue.“ Die erste Meinung erweist sich dadurch als trügerisch (vgl. Phil. 38a ff.). Nun ist dieses vorher angenommene Etwas-Anderes-Meinen nur sinnvoll denkbar hinsichtlich des vom Überlegen vorgenommenen Vergleiches von aktuellen Meinungen und Gedächtnisinhalten. Hier bringt Sokrates das nachmalig so verbreitete Bild vom ‚wächsernen Abdruckmittel‘, dem kérinon ekmageíon herein (191c). Doch können die Gesprächspartner auch mit diesem Bild als Hilfsmittel nicht klären, wie es zu falscher Meinung kommt. Auch der zweite Vergleichsversuch mit dem Taubenschlag hilft nicht (197c). Man würde Erinnerungen wie Tauben in einem Schlag halten und manchmal bei einer Erinnerungsleistung eine 65 gewisse Taube holen. Dabei könne man sich irren, welche Taube man ergreifen müsse. Auch diese Erklärungsweise führt zu keinem befriedigenden Ergebnis. Somit gelangen die Gesprächspartner zu der eingangs erwähnten Definition, epistéme sei die mit Logos verbundene wahre Doxa. Wir brechen hier das Referat des Theaitetos ab und erwähnen nur noch eine Stelle, in der gesagt wird, dass die „Verflechtung der Wörter das Wesen des Logos“ sei (onomáton gár symplokén eínai lógou ousían, 202b). Eine sehr ähnliche Bestimmung des Logos findet sich nämlich im Sophistes. Sophistes Nach einer Kritik der Etymologisierung im Kratylos und der grundsätzlichen Befragung des Ausdruckes ‚Episteme‘ im Theaitetos können die Leser in den folgenden Dialogen erfahren, was eigentlich der Beruf des Philosophen bedeute oder nicht bedeute. Eine äußerliche Kontinuität vom Theaitetos zum Sophistes gewährleistet die Figur des jungen Theaitetos, der sich im Sophistes mit einem, wie er genannt wird, eleatischen Xenos unterhält. Wenn man über diesen Xenos, den ‚Gast‘ oder ‚Fremden‘, hört, dass er ‚eleatisch‘ ist, ist man auf seinen Herkunftsort Elea verwiesen. Dieser erinnert wiederum an Parmenides, welcher dort lehrte. Mit ihm zusammen ist das vom Namen seiner Wirkungsstätte abgeleitete Eigenschaftswort in die Philosophiegeschichte eingegangen, in der man von der „eleatischen Disjunktion“ spricht. Dies meint oberflächlich betrachtet die strikte Trennung von Sein und Nichtsein. Schon am Anfang des Sophistes lässt auch die Bezeichnung des Fremden als eleatisch auf ein Referieren auf Parmenides schließen. Mit diesem Schluss hat man recht. Bemerkenswert und viel diskutiert ist die Ausgangsfrage des Gespräches. Die Unterredner nehmen sich vor, zu bestimmen zu versuchen, was ein Sophist, was ein Politiker und was ein Philosoph sei. Gefragt wird, ob sich diese drei Tätigkeitsfelder unterscheiden und wenn, wodurch (217a). An diese Zielangabe des Gesprächs knüpft sich in der Platonphilologie das Rätselraten: Wo ist der Dialog geblieben, der über den Philosophen handelt? Denn sowohl dem Sophisten wie dem Politikos, also dem Staatsmann ist jeweils ein eigener Dialog gewidmet. Leicht zur Hand sind naturgemäß zumindest zwei Vermutungen: der sog. Philosophos sei nie zur Ausführung gelangt, oder er sei im Dialog Parmenides zu sehen, der auf den Politikos folgt. Für uns ist dieses Rätselraten nicht von Belang. Wichtig ist zu sehen, dass der junge Theaitetos bei dem Bestimmungsversuch des Sophisten mit einer neuartigen Methode bekannt gemacht wird. (Dabei begegnet man tatsächlich dem Ausdruck méthodos, welcher den Weg, dem man bei einer gewissen Tätigkeit folgt, bezeichnet, 218d.) Diese neuartige Vorgehens66 weise ist die der Dihairese. Das Wort dihaíresis benennt eigentlich das ‚Auseinandernehmen‘, wobei es als philosophischer Terminus meist mit ‚Begriffszergliederung‘ oder ‚Erklärung‘ übersetzt wird. Wir haben bereits anlässlich der Erwähnung der Dialektiker im Kratylos auf diese Methode der Dihairese vorausverwiesen. Die wahren Dialektiker müssten alles in Unterbegriffe zergliedern und in Oberbegriffe zusammenführen können. Die Dihairese wurde nach Platon Signum für platonische oder platonisierende Philosophie. Bis heute gibt es verschiedenste Betrachtungen bei unterschiedlichen Philosophen über Bedeutung und Wert der Dihairese. Aus zwei Polen der Philosophiegeschichte seien Aristoteles und Gilles DELEUZE genannt. Ersterer, der Schüler Platos kritisierte z. B. in der Ersten Analytik die Methode der Dihairese. Aristoteles bemängelt an ihr das Fehlen des Mittelbegriffs. Deleuze seinerseits sieht die Dihairese des Sophistes auf das „möglicherweise ... außergewöhnlichste Abenteuer des Platonismus“ hinauslaufen, auf die Einleitung zur Umkehrung des Platonismus (Platon und das Trugbild).35 Was ist eine Dihairese? Was nun aber ist (vordergründig) eine Dihairese? Im Sophistes wird die Dihairese exemplifiziert anhand der Bestimmung des Angelfischers. Es werden jeweils zwei Oberbegriffe vorgelegt, von denen einer gewählt werden muss als einer, der den zu suchenden Begriff umfasst. Der gewählte Terminus wird dann weiter unterteilt oder, wie des Öfteren bei Platon gesagt wird, „zerschnitten“. Daraus ergeben sich regelrechte Dihairesenbäume. Viel kann natürlich darüber nachgedacht werden, inwiefern diese Methode sachgerecht ist, einen schon wissenden Vorblick erfordert und inwiefern die Dihairesen im Sophistes tendenziös sind und den Sophisten mit Absicht in ein schlechtes Licht rücken. Jedenfalls ist es bei Platon in den Dialogen, in denen Dihairesen vorgeführt werden, so, dass ein wissender Dialektiker einen Lernenden anleitet. Mitunter werden unproblematische Begriffe zerteilt, einfach der Übung in der Dialektik halber. Aber zurück zum Beispiel: Unterschieden wird zunächst der Oberbegriff Techne, was etwa ‚Kunstfertigkeit‘ bedeutet: Es gäbe, so schneidet der eleatische Fremde vor, eine hervorbringende und erwerbende Techne. Dem befragten Theaitetos fällt es leicht, den Angelfischer in die erwerbende Techne zu kategorisieren. Ebenso kann er ihn in die Gruppe derer setzen, die mit Gewalt erwerben. Des Weiteren in die jagende und so fort, bis der Angelfischer eindeutig dingfest gemacht wurde (221b-c). 35 G. Deleuze, Logik des Sinns. Aus dem Französischen von B. Dieckmann, Frankfurt a. M. 1993, 313. 67 Der Sophist hingegen lässt sich nicht so leicht fassen. Er kann auf mehreren Wegen bestimmt werden. Bei den Dihairesen, die man auf der Suche nach ihm durchführt, kann man immer wieder nach oben (zurück)gehen und eine andere Abzweigung nehmen. Der eleatische Fremde führt mehrere Dihairesen mit Theaitetos durch, die allesamt zu keinem befriedigenden Ergebnis führen. Die zahlreichen Anläufe demonstrieren die poikilía des Sophisten (vgl. 226a), seine ‚Buntheit‘ und Wendigkeit, seine Eigenschaft, schwer zu fangen zu sein. Fruchtbar erscheint dem Fremden, noch einmal bei der Dihairese nachzusetzen, die den Sophisten in den Bereich derer einordnete, die sich mit der Antilogik, der Widerspruchskunst auseinandersetzen (232b). Diese würden ihre Kunst in allen Themenbereichen treiben, über Göttliches wie über Menschliches reden. Da es aber, wie Theaitetos dem Xenos zugesteht, für Menschen nicht möglich sei, über alles eine Episteme, ein Wissen zu besitzen, müssten diese Streitredner sich auf ein scheinbares, ein ‚vermeintliches Wissen‘ stützen (doxastiké epistéme, 233c). Als solcher, der ein Scheinwissen besitze, sei der Sophist ein Nachahmender, und als Nachahmender einer, der nicht das genaue Maß abbilde, sondern Scheinbilder bzw. Trugbilder herstelle (Deleuze lässt grüßen) – phantásmata (234d). Allerdings könne man in diesem Bereich den Sophisten schwer dingfest machen, da er sich dieser Verortung widersetzen werde. Er werde argumentieren, dass es gar keinen Schein gäbe, weil etwas nicht das Nichtsein annehmen könne. Es gäbe das Nichtsein vielmehr gar nicht. Bei dieser Argumentation könne er sich auch auf einen erhabenen Philosophen stützen, nämlich Parmenides. Hier kommt der eleatische Fremde, der seine Herkunft aus der Schule des Parmenides gewissermaßen im Namen trägt, in eine gewisse Verlegenheit. Er müsse die Aufforderung seines Ahnherrn, sich vor dem Denken des Nichtseins fernzuhalten, missachten (237a). Tatsächlich argumentiert er dann eine bestimmte Strecke hindurch im Stile der eleatischen Disjunktion und zeigt die Widersprüchlichkeit derer auf, die das reine Nichtsein aussagen oder denken wollten. Dennoch zeigt sich im weiteren Gespräch, dass es notwendig ist, das Nichtsein in gewisser Weise zuzulassen. Man muss es zulassen, wenn man erklären will, was überhaupt ein Abbild oder Trugbild ist. Und man muss es zulassen, wenn man erklären will, wie falsche bzw. trügerische Meinung und falsche Aussagen denkbar sind. Damit haben wir wieder das Problemfeld des Theaitetos erreicht. Man kann nur in der Weise von einem Falsches-Meinen sprechen, indem man sagt, dass es ein Meinen ist, welches meint, dass etwas ist, was nicht ist (240e). Hier erreichen wir die berühmte Stelle, wo in drastischer Bildhaftigkeit die Rede von einem „Vatermord“ ist (der ja dem griechischen Mythos nicht fremd war). Der eleatische Xenos bittet Theaitetos, er möge ihn nicht für einen Vatermörder 68 halten, wenn er die Lehre des Parmenides prüft (241d). Aber sie müsse irgendwie modifiziert werden, da sonst nicht der Status eines Bildes erklärt werden könnte. Nun kommt es zu einer interessanten Auseinandersetzung mit vorplatonischen Philosophen. Implizit werden verschiedene Personen wie PHEREKYDES oder ARCHELAOS genannt (vgl. 242c-d). Am wirkmächtigsten wurde wohl die Formulierung von der „Gigantomachie hinsichtlich der Ousia“, des ‚Riesenkampfes‘ über das ‚Wesen‘ bzw. das ‚Sein‘ (246a). Diese Gigantomachie, dieser Riesenkampf bestehe und würde immer weiter gehen zwischen den Materialisten und Idealisten. Die einen ließen nur gelten, was sie mit Händen greifen könnten, die anderen würden nur den Ideen Sein einräumen. Beide Extrempositionen, die in der abendländischen Philosophiegeschichte immer wieder begegnen, befragt der Fremde auf ihr Verständnis von Sein hin. Es ist wohl dieses Stellen der ontologischen Grundfrage, welches diesen Dialog in ein Zentrum der Philosophie des zwanzigsten Jahrhunderts gestellt hat. Martin HEIDEGGER hielt wenige Jahre, bevor sein Werk Sein und Zeit erschien, eine ausführliche Vorlesung über den Sophistes.36 So kann man sich die zahlreichen Sophistes-Zitate bei Heidegger und vor allem das Sein und Zeit vorangestellte Zitat erklären. Dieses bezieht sich darauf, dass der Fremde sagt, man müsse aufpassen, nicht zu meinen, es gebe nur hinsichtlich des Nichtseins eine Aporie. Vielleicht wisse man genau so wenig, was „sein“ heiße. Hier sagt der Fremde dann in einem fingierten Dialog mit den Naturphilosophen in nicht unsokratischer Ironie: „Es ist klar, dass ihr das schon lange kennt (was ihr anzeigt, wenn ihr ‚seiend‘ aussprecht), wir aber glaubten es davor zu wissen, jetzt aber sind wir diesbezüglich in der Aporie.“ (244a). In einigermaßen atemberaubender Dialektik wird im Sophistes die Schwierigkeit aufgezeigt, die sowohl Materialisten wie Ideenfreunde damit haben, anzugeben, was sie eigentlich mit ‚Sein‘ meinen. Eine wichtige Funktion in der Darlegung der Schwierigkeiten nehmen die Begriffe Bewegung und Ruhe ein. Sowohl den Materialisten trotzen der Fremde und Theaitetos ab, dass es etwas Unkörperliches geben müsse, wie sie den Ideenfreunden abtrotzen, dass auch die Ideen in gewisser Weise bewegt sein müssten, insofern sie erkannt würden (246a-249a). An den fundamentalen Kategorien Bewegung und Stehen wird wiederum aufgezeigt, dass die etwas anderes als das Sein sein müssen. Dieses wiederum muss gemeinsam mit Stehen und Bewegung etwas anderes sein als das Andere selbst. Und dieses, das Andere oder Verschiedene, muss etwas anderes sein als das Selbe selbst. Sie hören schon, es wird hier kompliziert. Oberflächlich betrachtet stellen sich fünf der „größten (Begriffs-)Gattungen“ heraus: 36 M. Heidegger, Platon: Sophistes. Marburger Vorlesung Wintersemester 1924/25, hrsg. von I. Schüßler, Frankfurt a. M. 1992 (Gesamtausgabe; 19). 69 Was sind die mégista eíde, von denen im Sophistes die Rede ist? Diese größten Begriffe oder Gattungen sind: Sein, Bewegung, Ruhe, das Selbe und das Verschiedene. Der eleatische Fremde will mit Theaitetos untersuchen, wie sich diese Gattungen oder Begriffe miteinander verbinden. Dies gilt ihm als Trost, wenn er nicht endgültig bestimmen kann, was das Sein ist. Immerhin ermöglicht ihm dieser indirekte Annäherungsweg zum Sein, dass er endgültig das Nichtsein zu seinem Recht kommen lassen kann. Denn er kann aufzeigen, dass jegliches immer in vieler Hinsicht etwas nicht ist. Das Verschiedene beispielsweise ist verschieden vom Selben, vom Sein, von Bewegung und vom Stehen. So auch das Sein selbst. Das Nichtsein verhält sich also nicht kontradiktorisch, sondern konträr zum Sein. Des Weiteren erweist sich als die Aufgabe der Dialektik, nicht nur Begriffe zergliedern, sondern auch aufzeigen zu können, welche Begriffe sich mit anderen verbinden und welche nicht. Dies bestimmen zu können wäre die Episteme freier Menschen (253c). Damit hätten die Unterredner des Sophistes das Gesprächsziel des Theaitetos eingeholt. Zunächst ist ihnen aber am wichtigsten, dass sie den parmenideischen Satz vom Sein und Nichtsein modifizieren können. Sein und Nichtsein schließen einander nicht gänzlich aus, das Sein kann am Nichtsein Anteil haben. Somit können die Gesprächspartner dazu übergehen, zu erläutern, wie es falsche Meinungen und Aussagen geben kann. Hier gelangen wir zu der am Ende unseres Überblicks über den Theaitetos angesprochenen Stelle über den Logos als symploké, als Verknüpfung. Der kleinste und erste Logos sei die Verknüpfung eines Namenmit einem Tunwort, wie „Theaitetos sitzt.“. In einen solchen Logos könnte das Nichtsein hineingeknüpft sein wie im Satz „Theaitetos fliegt.“ (263a). Auf diese Weise kann man den Sophisten dingfest machen, der als Nachahmungskünstler kein Wissen darüber besitzt, was er nachahmt, und somit unter Umständen falsche Meinungen und Reden über etwas verbreitet. Politikos Erst jetzt kann man eigentlich sehen, warum es sich lohnen kann, so etwas wie Philosophie zu betreiben. Würde es keine falschen Aussagen geben, könnte man eben nicht verstehen, warum ein Herr Kant Klügeres sagen sollte als ein Schwein. Da die Gesprächspartner des Sophistes sich aber über die Möglichkeit von Täuschung verständigt haben, können sie nun weitergehen und fragen, was eigentlich den Staatsmann und Politiker ausmacht. Am Anfang des Politikos sehen wir wieder bekannte Figuren: Sokrates, den Mathematikprofessor Theodoros, den Gast aus Elea und Theaitetos. Der Politikos gibt sich als Fortsetzung des Sophistes. Sokrates bringt 70 an dessen Beginn seine Dankbarkeit zum Ausdruck, dass er Leute wie Theaitetos und den Gast aus Elea kennen lernen durfte. Im folgenden Gespräch darf Theaitetos als Antworter des eleatischen Gesprächsführers pausieren. Ihn ersetzt sein Studienkollege Sokrates, der junge Sokrates. Dieser wird im anschließenden Dialog eine Einübung in die Dialektik durchmachen. Zwar ist das Thema, an welchem sich die Dialektik übt, die Suche nach dem Staatsmann. Doch sagt der Gesprächsführer ausdrücklich, dass es vornehmlich deshalb unternommen wurde, um dialektischer zu werden (285d). Auf inhaltlicher Ebene erfährt man, dass sich ein Staatsmann auf die richtige Verknüpfung der Bürger verstehen soll. Damit ist wieder das schon vertraute Thema der symploké, der Zusammenflechtung aufgenommen. Zugleich verweist die im Politikos angesprochene Verknüpfung auf die anderen beiden großen staatstheoretischen Werke Platons, auf die Politeia und die Nomoi. Denn die Verknüpfung im Politikos meint die richtige Herbeiführung von Ehebündnissen von eher aufbrausenden, zur kämpferischen Tapferkeit und eher ruhigen, zur verwaltungsbezogenen Besonnenheit tendierenden Bürgerinnen und Bürgern. Diese Thematisierung der richtigen Eheverbindungen findet sich vor allem in den Nomoi, sie wird aber beispielsweise auch später in Aristoteles’ Politik (VII. Buch) besprochen. Im Politikos findet sich diesbezüglich der bildliche Ausdruck, dass die Staatskunst eine Webkunst ist (309b ff.). Wann muss ein Staat auf verschriftlichte Gesetze zurückgreifen (Politikos)? Bemerkenswert erscheint im Politikos auch die Thematisierung der Verschriftlichung von Rechtsvorschriften. Ideal wäre es, so erläutert der Fremde aus Elea, wenn ein Gemeinwesen über einen gottbegabten Staatsmann verfügt. Dies wäre besser als jede kodifizierte Rechtsnorm. Denn der lebende Regent wäre genauer, er könnte das akribés, das genau Angemessene jeweils besser bestimmen. Fixe Gesetze könnten nie den Verschiedenheiten der Menschen gerecht werden (294b). Hier wird (wie so oft bei Platon) eine Analogie zur Humanmedizin hergestellt. Der Staatsmann sei einem Arzt zu vergleichen. Dieser würde, wenn er für einen längeren Zeitraum verreisen müsste, seinen Patienten schriftliche Aufzeichnungen hinterlassen, wie sie sich verhalten sollten, da er meint, sie würden sich seine Anordnungen nicht merken (295b ff.). Er würde ihnen hypomnémata schreiben, Erinnerungsmittel. (Dieses Wort kennen wir aus dem Einleitungsgespräch des Theaitetos.) Nun könnte der Fall eintreten, dass der Arzt früher als erwartet heimkehrt und in der Zeit seiner Reise sich die Rahmenbedingungen der Behandlung geändert hätten, wie das Wetter. Der Arzt würde es durchaus für sinnvoll halten, die Vorschriften zu ändern. 71 Es sei ein seltener Glücksfall, wenn ein Staat einen lebenden, guten Gesetzgeber hätte. Die meisten Staaten müssten sich damit begnügen, Nachahmungen dieses Idealfalles zu sein (297c). Diese Nachahmungen würden sich mit „Zusammengeschriebenem“ behelfen, um ihr Überleben zu sichern. Das griechische Wort für ‚Zusammengeschriebenes‘ ist sýngramma (297d). Dies ist ein weiteres Signalwort für die Schriftkritik Platos. Auch aus dieser Stelle im Politikos ist ersichtlich, dass die Schrift von Platos Figuren nicht schlichtweg abgelehnt wird, ihr wird ein relativer Wert zuerkannt. In Staaten, wo es keine zur Änderung der Gesetze Fähigen gebe, müsse man in der Weise an den kodifizierten Gesetzen festhalten, dass man nicht erlaube, dass jemand sie ändere. Dies sei freilich nur ein deúteros ploús, eine zweite Fahrt (300c). Von einer solchen spricht bekanntlich auch Sokrates im Phaidon, sie ist seine ideengestützte Ausspähmethode der Wahrheit. Für Platon ist deutlich, dass er sich, wenngleich in überaus subtiler Weise, dazu aufgeschwungen hat, eine solche Modifizierung des solchermaßen Fixierten anzudenken. Die großen (im Sinne von ‚berühmt‘) Rechtskorpora der damaligen Zeit waren drei, sie sind mit drei mehr oder weniger legendenumwobenen Namen verbunden und an drei Orten zu lokalisieren: Zum einen sind zu nennen die Normen für Kreta, die dem MINOS zugeschrieben wurden, dann die Gesetze des LYKURG für Sparta und schließlich die Texte des SOLON von Athen. Dieses Dreigestirn an Staaten und Personen ist für Platon der Inbegriff gut verwalteter Gemeinwesen. Diesbezüglich sei an den Kriton erinnert, wo Sokrates erläutert, dass er durch sein Handeln sein Leben lang gezeigt hat, dass er mit den Normen Athens übereinstimmt und sie besonders liebt. Er sei weder nach Sparta noch nach Kreta gezogen, obwohl er deren Gesetze für sehr gut halte (52e). Und in den Nomoi sprechen wohl nicht zufällig drei Personen aus genau diesen Stadtstaaten miteinander und diskutieren die Vor- und Nachteile ihrer Rechtsanordnungen. Dazu ist zu sagen, dass sich Platon nicht nur denkerisch, sondern auch familiär in einer Linie mit dem für Athen so wichtigen Gesetzgeber Solon sehen konnte. Mütterlicherseits war er mit Solon verwandt. Was man neben dieser Bestimmung der Staatskunst als königlicher Webkunst und neben den Überlegungen zur Verschriftlichung von Gesetzen aus dem Politikos noch kennen sollte, ist die Ausgangsbestimmung des Staatsmannes und der große Mythos des Politikos. Der Staatsmann wird als Hirte der Menschen bestimmt (vgl. 266c ff.), woraus sich allerlei Probleme ergeben. Relativ am Anfang dieser Dihairesen erlebt man einmal, dass ein Fehler bei einer Dihairese begangen wird, und dass die Gesprächspartner diesen Fehler konstatieren. Nicht zuletzt aufgrund dieses Fehlers wenden sie sich einem Mythos über die menschliche Natur zu. Dieser Mythos kann als ein Beitrag Platos zu der Frage gelesen werden, warum es das 72 Schlechte auf Erden gibt. Nähme man nämlich an, wie dies zum Teil im Phaidon zum Ausdruck kommt, dass wir auf Erden nicht nur unter menschlichen Hirten leben, sondern auch von Göttern geweidet werden, so erhebt sich die Frage, warum der Mensch trotzdem fehlerhaft handelt. Hier kann der Mythos im Politikos eine Antwort geben, warum der Mensch mitunter in erheblicher Gottferne haust. In diesem Mythos ist von einer Umdrehung des Gestirnlaufes die Rede, von der früheren Königsherrschaft des Kronos, der Erdgeborenheit der früheren Menschen und vielem anderem. Der Xenos schickt sich an, den Grund für all dies anzugeben. In recht knappen Sätzen schildert er Atemberaubendes: Der Gott selbst würde manchmal alles selbst anführen und ihm Kreise lenken, dann wieder ließe er das von ihm Geführte los. Das Losgelassene würde sich eine Zeit lang in derselben Weise weiterbewegen, dann aber in die entgegengesetzte Richtung tendieren, da nichts, was einen Körper habe, sich unverändert immer in derselben Weise verhalten könne. So würde auch der Himmel die ewig gleiche Selbstbewegung nur nachahmen durch die Rückbewegung (anakýklesis, 269e). Der Bereiter dieser ganzen Bewegung ist der Demiurg. Dieser ‚Volkswerker‘ kat’ exochen wird ausführlich im Timaios beschrieben. Im Politikos wird in weiterer Folge ausgeführt, dass Daimones (Götter) die ihnen zugeordneten Herden an Menschen und Tieren beaufsichtigt hätten. Das Wort daímon ist, wie anlässlich der Erwähnung des sokratischen Daimonions gesagt, zunächst ein Synonym für theós. Die Menschen lebten unter dieser Obhut etwa wie im Schlaraffenland, hatten alles im Überfluss, Ackerbau war nicht notwendig, sie hatten sehr viel Muße. Hätten sie auch noch Philosophie betrieben, wären sie zehntausendfach glücklicher gewesen als die jetzigen Menschen (272c). Unter der jetzigen Periode aber habe es sich ergeben, dass der Mensch, nachdem er von der göttlichen Leitung verlassen worden war, schwach und unbewacht war. Die Götter mussten ihm diverse Hilfsmittel wie das Feuer schenken. Damit ist das Ziel des Mythos erreicht, zu erklären, auf welche Art von Mensch sich der Staatsmann bezieht. Von dieser Klärung geht es weiter zu der eingangs angesprochenen Abgrenzung des Staatsmannes gegen andere Künste und zu der Bestimmung der Staatskunst als göttliche Webkunst. Nachdem man aus dem Sophistes und Politikos einen Ausblick darauf erhalten hat, was ein Sophist und was ein Staatsmann ist, und nachdem man sich einigermaßen in der Dialektik geübt hat, kann man nun fragen, was es mit dem Philosophos auf sich hat. Hier finden wir keinen eigens nach diesem Suchziel benannten Dialog vor. Aber wenn man in der tradierten Anordnung weiterliest, findet man ein Gespräch von zwei der ganz großen Philosophoi vor. Im Parmenides sprechen zwei philosophische Originale miteinander. Die Stelle des namenlosen Gastes aus Elea nimmt der eleatische Urherr der monistischen Philosophie, Parmenides, 73 ein und an die Stelle des jungen Sokrates, des Kameraden des Theaitetos, tritt der „echte“ junge Sokrates. Das Einleitungsgespräch des Parmenides Bisher hörten wir über die Frömmigkeit und den Gottesdienst des Sokrates, über seine Methode der Flucht in die Logoi und der Annahme der Ideen. Dann erfuhren wir eine Kritik äußerlicher Sprachbetrachtung, verfolgten das Ringen um eine Bestimmung der Wissenschaft, hörten von der Möglichkeit von etwas Falschem. Nach diesen zahlreichen sozusagen für die Philosophie propädeutischen Untersuchungen kann man nun im ersten Teil des Parmenides eine Kritik der Annahme von Ideen lesen. Hierzu ist zu sagen, dass ein Teil der Interpreten Platos meint, dass diese Kritik an der vermeintlichen Ideenlehre ein Ausdruck von dessen Spätphilosophie sei. Nach seiner mittleren Phase, in welcher er im vollen Saft der Ideenlehre gestanden sei, habe er in einer Spätzeit die Ideenlehre kritischer betrachtet. Ein anderer Teil der Platondeuter ist der Ansicht, dass Platon mit seiner Kritik der Ideen im Parmenides sich und vor allem seine Figur Sokrates selbst interpretiert. Sie meinen, er zeige auf, dass schon der junge Sokrates mit den kritischen Anfragen an die Ideenannahme konfrontiert worden sei und diese Probleme gelöst habe. Das hieße auf Platos Philosophie umgelegt, dass er nicht tatsächlich an der Gültigkeit des Ideenhaften zweifle, sondern vielmehr demonstriere, dass ihm die mit der Ideenannahme verbundenen Probleme je schon präsent gewesen sind und er sie überwunden hat. Etwa in diese Richtung deutet Wolfgang WIELAND den Parmenides in seinem m. E. sehr empfehlenswerten Platon-Buch.37 Der Fiktion des Parmenides zufolge trifft der junge Sokrates auf Parmenides und seinen Schüler ZENON, als diese zu einer Vortragsreihe in Athen weilen. Das im Parmenides referierte Gespräch beginnt damit, dass nach dem Ende eines Vortrages des Zenon Sokrates an diesen herantritt und in der für ihn nachmalig typischen Art eine Nachfrage stellt. Dabei bringt er seine Ideenannahme ins Spiel. Der ihnen zuhörende Parmenides habe die Begabung des Sokrates bewundert und ihn für sein „Drauflosgehen auf die Logoi“ belobigt (130b). Allerdings, so sagt Parmenides, müsse sich Sokrates noch in der Dialektik üben. Die Übung bestehe vor allem darin, eine Annahme in allen ihren Konsequenzen zu erwägen und dann die gegenteilige Annahme ebenso zu betrachten. Als Sokrates daraufhin Parmenides um eine kleine Vorführung der Dialektik bittet, kann dieser schwer nein sagen. Er merkt zwar an, dass es für einen Mann seines Alters gar nicht leicht sei, sich auf ein solches „Meer an Logoi“, auf ein so 37 W. Wieland, Platon und die Formen des Wissens, 2., durchges. und um einen Anhang und ein Nachw. erw. Aufl., Göttingen 1999, 126. 74 großes Gebiet an Diskussionen hinauszubegeben, aber er wolle es versuchen (137a). Er nimmt sich vor, die Annahme, dass das Eine ist, zu untersuchen. Die nachfolgenden Erläuterungen gehören unstreitig zu dem Schwierigsten der antiken Philosophie und wohl zu dem Schwierigsten der Philosophie insgesamt (jedenfalls kann es den Kampf mit Hegel und BRANDOM aufnehmen). Hegel war übrigens überaus angetan von dem Parmenides des Platon. In seinen Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie ist im Abschnitt über Platon zu lesen: „Die ausgeführte eigentliche Dialektik aber ist im Parmenides enthalten, dem berühmtesten Meisterstück der Platonischen Dialektik.“38 Hegel studierte schon als junger Mann die Schriften des PROKLOS (5. Jh. n. Chr.),39 der unter anderem einen Parmenides-Kommentar verfasste. Im Vergleich zu den Ausführungen des Parmenides im zweiten Teil des Parmenides, wo er sich übrigens als Antwortgeber einen gewissen Aristoteles wählt, ist der erste Teil eine einigermaßen leichte Lese-Kost. Welche Anfragen stellt der platonische Parmenides an die Ideenannahme des Sokrates? Berühmt geworden ist die dortige Anfrage des Parmenides an den jungen Sokrates, ob es auch neben den Ideen für Allgemeinbegriffe wie ‚schön‘ und ‚gerecht‘ auch abtrennbare Ideen für Dinge wie Mensch oder Feuer gäbe. Des Weiteren sei zu überlegen, ob es eine Idee von ‚Haar‘ und ‚Schmutz‘ gäbe (130c). Sokrates gesteht ein, dass er hinsichtlich dieser Frage sich schon wiederholt in Aporie befunden habe. Für die erstere Gruppe will sich Sokrates die Annahme von Ideen gefallen lassen, für letztere Gruppe lehnt er sie ab. Parmenides beruhigt ihn gleichsam und erklärt ihm, dass ihn die Philosophie noch nicht so ergriffen habe, wie sie ihn noch ergreifen werde (130e). Damit haben wir auch hier eine Formulierung wie im Phaidon, die anzeigt, dass sich die Philosophie die Denker aneignet und nicht umgekehrt. So muss sich Sokrates, der noch nicht ganz von der Philosophie ergriffen wurde, manche Kritik an der Ideenannahme gefallen lassen. Parmenides wirft etwa das Problem der Teilhabe und das Problem der Erkennbarkeit der Ideen für den Menschen auf. Wenn alle Menschen Anteil an der Idee Mensch hätten, wie könnte diese dann noch eins sein? Sie müsste sich wie ein Segeltuch auf alle erstrecken (130b ff.). Dann würden die einzelnen Instanzen aber nur an einem Teil teilhaben und nicht an der ganzen Idee. Wäre aber die Idee in diesem Sinne geteilt, dann hätten die Partizipierenden nicht an der ganzen Idee Anteil. Ebenso spricht Parmenides das Prob- 38 G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie II, Frankfurt a. M. 1971, 43 ff. (TheorieWerkausgabe; 19), 79. 39 J. Halfwassen, Hegel und der spätantike Neuplatonismus: Untersuchungen zur Metaphysik des Einen und des Nous in Hegels spekulativer und geschichtlicher Deutung, Bonn 1999, 398. 75 lem des unendlichen Regresses an, dass sich daraus ergibt, dass man immer etwas Übergeordnetes brauche, um das Ideenhafte und die Idee als dasselbe zu bestimmen. Das größte Problem aber sei, dass wir die an und für sich seienden Ideen nicht erkennen könnten, da ihre Erkenntnis viel reiner als die bei uns vorfindliche Erkenntnis sei. Ungeachtet aller dieser Bedenken, die man gegen die Annahme von Ideen haben könnte, müsse man die Ideenannahme, so sagt Parmenides, zulassen. Denn sonst würde man die Möglichkeit zum dialégesthai, zum Durchsprechen aller Probleme, aufheben, d. h. zerstören (135c). Und Parmenides gibt Sokrates den Rat, er möge, bevor er sich mit den angefragten Problemen auseinandersetze, zu bestimmen versuchen, was das Schöne, Gerechte, Gute und eine jede der Ideen sei. Betrachtet man die anderen Dialoge Platons, in denen Sokrates zu Wort kommt, so kann man sagen, dass er sich diesen Ratschlag zu Herz genommen und befolgt hat. Mehr noch, man kann feststellen, dass er ein notorischer Sucher der Bestimmungen dieser genannten Ideen wurde. Dabei lässt sich erkennen, wie er manchen der von Parmenides aufgeworfenen Probleme entgegengetreten ist. Philebos Ein Hinweis auf dieses Lösen der von Parmenides aufgezeigten Probleme ergibt sich aus dem Anfang des Philebos. Dieser folgt der Anordnung der Dialoge nach auf den Parmenides und eröffnet eine Reihe von Werken, welche die Zielrichtung sokratischen Philosophierens angeben. Bis jetzt hörten wir ja neben der absoluten Gottes-Devotion des Sokrates hauptsächlich von Problemen: Wie kann es Falsches geben, wie soll das mit den Ideen funktionieren? Vielleicht vermisste der eine oder die andere eine Antwort auf die Frage cui bono, für welches Gut, zu welchem Zweck man die Mühe auf sich nehme. Hinlänglich wird eine solche Frage im Philebos, dem Symposion und dem Phaidros beantwortet, wo das Gute als höchstes Ziel alles Strebens herausgestellt wird. Der angesprochene Hinweis zur Lösung der parmenideischen Probleme besteht darin, das Eine nicht im Bereich der Werdenden und Vergehenden anzusiedeln. Dies schlägt Sokrates im Eingangsgespräch des Philebos vor (15a). Dies verallgemeinernd könnte man sagen, dass man sich davor hüten sollte, die Ideen zu verzeitlichen und verräumlichen. Tut man dies, so kommt man freilich in die Aporien, die aufgezeigt wurden, wie diejenige von der (räumlichen) Teilhabe der Einzelmenschen an der segeltuchartigen Idee Mensch. Darüber hinaus ist, worauf der junge Sokrates im Parmenides schon hinweist, eine Dynamisierung der Ideen anzudenken. Diesen locus classicus zitiert Hegel als einen der bedeutenden Stellen zur Dialek76 tik.40 Es geht dort darum, dass Sokrates sagt, er ist selbst zufrieden, wenn ihm gezeigt wird, dass er selbst Vieles und Eines sei. Er würde es bewundern, wenn jemand aufzeigen könnte, wie sich die Ideen selbst gemäß sich selbst verhalten (wie etwa die Einheit und Vielheit, Ruhe und Bewegung), und dann zu zeigen, wie sie sich selbst „identisch setzen und voneinander unterscheiden“, wie Hegel übersetzt (synkeránnysthai kaí diakrínesthai, Parm. 129e). Dies aufzuzeigen, so könnte man behaupten, unternahmen Aristoteles und Hegel in ihren Schlusslehren. Welcher Begriff wird im Philebos diskutiert? Wie dem auch sei, im Philebos erhält man eine aufschlussreiche Orientierung über sokratischplatonisches Philosophieren. Durchaus lebensnah wird hier erwogen, ob man für das höchste Glück die Hedone halten solle, dasjenige, was traditionell mit ‚Lust‘ übersetzt wird. Angemerkt sei hier, dass das Wort hedoné auch ‚Gewürz‘ bedeuten kann. Jedenfalls hat es ein größeres Bedeutungsspektrum als unser Wort ‚Lust‘, zumindest wenn man ‚Lust‘ pejorativ versteht (unter christlichem Einfluss wohlgemerkt, es grüßt Michel FOUCAULT). So kann man im Griechischen auch lesen, dass jemand am Besonnensein Lust empfindet (vgl. Phil. 12d). Wir sehen hier, dass wir nach den wissenschaftstheoretischen und ideenkritischen Überlegungen zu einer zentralen sokratisch-platonischen Frage zurückgekehrt sind, zu der Frage, wie alle Dinge gut sind so wie sie sind. Hier gilt es zu beachten, dass es im Philebos nicht um Lust versus Denken geht. Schon in seiner ersten längeren Aussage macht Sokrates deutlich, dass er nicht bezweifelt, dass das Sich-Freuen und Lustempfinden gut ist für den Menschen. Aber er propagiert Dinge, die seiner Auffassung nach besser und nützlicher sind. Die Sachen, die Sokrates hier aufzählt, sind in nuce eine Zielangabe platonischer Bemühungen: Besonnensein, Denken, Erinnerung, richtige Meinung, wahre Schlüsse (phroneín, noeín, memnésthai, dóxa orthé, aletheís logismoí, 11b). Nicht nur ist dies ein sehr lebenspraktisches, wohl immergültiges Diskussionsthema, es wird auch die Grenze aufgezeigt, die sich für platonische Gesprächspartner stellt. Wenn sich jemand weigert, Unterscheidungen zuzulassen, dann geht (eine Gefahr, welche im Parmenides beschrieben wurde) jegliches Gespräch zugrunde. Man könnte nun sagen, dies ist genau, was ein radikaler Hedonismus erreichen will: vollkommenes Aufgehen in der Unterscheidungslosigkeit: kein Gestern, kein Morgen, kein Besser, kein Schlechter, nur bloße Lust – wie in einem guten Pop-Song. Als Vertreter einer solchen Lust hat man von Anfang an schlechte Kar40 G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie II, Frankfurt a. M. 1971, 43 ff. (TheorieWerkausgabe; 19), 81. 77 ten, wenn man sich in ein Gespräch begibt, bei dem man gewisse Unterscheidungen zulassen muss. Von Anfang an betont Sokrates das Agonale, das Wettkampfartige des Gespräches über die Lust. Denn immer wieder spricht er von einer Reihung, da es darum geht, einen Zustand der Seele zu finden, der den Menschen glücklich machen kann (wir begegnen hier Vokabeln, die charakteristisch für die Nikomachische Ethik des Aristoteles sind, héxis ‚Haltung, Zustand‘, eudaímon ‚glücklich‘, Phil. 11d). Nun gibt es die Möglichkeit, dass die Lust den ersten Platz erhält, oder dass die Besonnenheit, die Sokrates vertritt, den ersten Platz erhält, oder auch die Möglichkeit, dass keine von beiden den ersten Platz eingeräumt bekommt. Doch, wie angedeutet, tendiert bereits das Sprechen selbst über die Lust dazu, der Besonnenheit den Vorzug zu geben. Denn am Anfang des Gespräches zeigt Sokrates auf, dass sich jemand, der Prädikationen über die Lust zulässt, nicht mehr dem bloßen indifferenten Lustgenuss hingeben kann. Er muss eine Unterscheidungsfähigkeit und somit etwas Besonnenheitsartiges besitzen. Denn Sokrates konfrontiert seinen Gesprächspartner Protarchos mit dem konkreten Problem, dass dieser die Prädikation vornimmt: „Alle lustvollen Dinge sind gut.“ Wenn er dies behauptet, so sagt er über die Lüste etwas von ihnen Verschiedenes aus. Zusätzlich spricht er von mehreren Lüsten. Er muss sich die sokratische Rückfrage gefallen lassen, ob wirklich alle Lüste gut seien. Lasse er keine Differenzierung zu, so würde der Logos, ihr gemeinsames Sprechen, stranden und zugrunde gehen (13d). Andererseits wäre auch Sokrates nicht des gemeinsamen Gespräches, des dialégesthai, wert, wenn er keine Differenzierungen im Bereich dessen zuließe, was er für das Gute hält, die Wissenschaften, das Denken und so weiter. An den Parmenides erinnert dann auch die Erwähnung des Phänomens, dass eines Vieles ist und das Viele Eines. Diese würden in den Logoi immer ein und dasselbe, das sei in uns ein ewiges, altersloses Phänomen der Logoi (15d). Die Kunst, dies im Logos zu erfassen, beziehe sich auf die „Gabe der Götter an die Menschen“, auf die Verbindung von Grenze und Unbegrenztheit (16c). Aufgabe der Dialektik sei, das Dazwischen dieser Beiden, von Grenze und Unbegrenztem zu ermitteln. Ein solches Ziel verfolgt offenkundig auch Sokrates im Philebos. Denn neben vielen anderen überaus beachtenswerten Aussagen kommt es zu einer regelrechten Anordnung und Reihung der für den Menschen erstrebenswerten Dinge. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu dieser Reihung, die das Zwischen von Grenze und Unbegrenztem ausfüllen soll, ist die Demonstration dessen, wie es falsche Lust geben kann. Grundsätzlich wird Lust so definiert, dass sie eine Wiederherstellung signalisiert (32a). Um dies tun zu können ist jedoch, wie ausführlich gezeigt wird, Erinnerung nötig. Des Weiteren kommt die Begierde in Sicht, die nie ein körperliches Phänomen sein kann, da man nicht das begehrt, was dem Körper fehlt. Auch sie ist ein psychisches Phänomen. Dies wird erläutert, um zeigen zu können, inwiefern es falsche, d. h. trügerische Lust gibt. Sie wird analog zur falschen Meinung erklärt. Hier trifft man auf eine sehr für die Erklärung des Begriffes Doxa sehr illustrative Stelle. Die Meinung ist ein Gespräch der Seele mit ihr selbst über etwas. Zum Beispiel spricht sie über etwas, das sich zeigt als etwas unter einem Felsen bei einem Baum Stehendes. Dieses Gespräch wird in der Seele wie in einem Buch aufgezeichnet (38e). Bei späterem Vergleich mit anderen Meinungen erscheint erstere wahr oder falsch. Ähnlich sei es bei Lüsten. Diese könnten im Vergleich mit anderen falsch sein aufgrund einer Distanzverzerrung oder einer falschen Vergleichsgröße. In großer Lust könne sich auch derjenige befinden, der sich in vielfacher Weise verkenne. Dies gebe dann das Sujet für Tragödien ab, bzw. darin spiele sich die „gesamte Tragödie“ unseres Lebens ab (50b). Freilich sei von den Lüsten, die immer mit einem Leid verbunden seien, die reine, unvermischte Lust zu unterscheiden, wie etwa diejenige beim Sehen von Farben und Hören von Tönen. Aber diesem Zugeständnis zum Trotz, dass es reine Lüste gibt, gibt Sokrates der Lust als Anwärterin auf das 78 Gute den Todesstoß. Denn er lässt sich von Protarchos darin zustimmen, dass jede Lust ein Werden sei. Weiters sei aber jedes Werden um willen einer Ousia. Dasjenige nun, um willen etwas werde, müsse man in den Bereich des Guten stellen, das Werdende allerdings in einen anderen Bereich. Diesen Bereich des Werdenden, das um willen eines Guten geschieht, nimmt Sokrates genauer durch und erstellt eine Rangordnung. Welche Elemente zählt Sokrates in der Rangordnung der menschlichen Tätigkeiten auf? Hier sind für ihn zunächst Handwerke und Künste zu nennen, die durch Vermutungen das Richtige treffen, und die durch Einübung und Mühe gelernt werden. Je regelvoller sie durchgeführt werden, desto besser seien sie. Bei den Wissenschaften wiederum müsse ähnlich wie bei den Lüsten selbst eine Unterscheidung nach ihrer Reinheit vorgenommen werden. Je weniger eine Wissenschaft mit Körperlichem befasst sei, desto reiner sei sie. Vor allen anderen müsste aber gesetzt werden die dýnamis toú dialégesthai, das Vermögen und die Fähigkeit zum „Durchsprechen“, zur Dialektik. Diese befasse sich mit dem Seienden, dem, was immer in gleicher Weise sei (57e f.). Soweit zumindest Sokrates. Protarchos wirft hier ein, dass er oftmals von Gorgias gehört habe, dass die Kunst des Überredens die nützlichste sei. Dies erwähne ich aus zweierlei Gründen: Einerseits verweist es uns in unserem Gang durch Platon vor auf die Kritik des Sokrates an der Rhetorik im Stile eines Gorgias. Diese sei mitnichten eine Kunst. Zum anderen ist Sokrates’ Reaktion im Philebos auf die Erwähnung des Gorgias interessant. Denn Sokrates gibt seinem Gesprächspartner Protarchos zu bedenken, dass es ihm nicht um diejenige Wissenschaft zu tun ist, die am nützlichsten ist, sondern um diejenige, die den höchsten Grad an Wahrheit erreicht (im Griechischen ist es übrigens nicht selten, dass man Steigerungsformen zu dem Adjektiv ‚wahr‘ antrifft, wie etwa hier im Philebos den Superlativ alethéstaton, 58c). Sokrates wendet sich, so könnte man etwas überspitzt sagen, gegen eine Nützlichkeitsmetaphysik. Sokrates’ weitere Bemühungen drehen sich um die Ermittlung des in richtiger Weise gemischten Lebens, welches gemischt ist aus den beschriebenen Wissenschaften und den unschädlichen Lüsten. Habe man diese Mischung erreicht, könnte man zu erkennen versuchen, „was eigentlich im Menschen und im Gesamt“ das Gute ist (64a). Damit haben wir eine Zielangabe für das Symposion. Im Gespräch des Philebos wurde, so formuliert Sokrates an dessen Ende, ein Logos erreicht, der wie ein schöner „körperloser Kosmos“ über einen beseelten Körper herrsche (64b). Bei all dem bleibt das Gute das alles überragende Ziel. Wenn man es nicht erreicht, ist nicht an Autarkie zu denken. Hier fällt ein einziges Mal bei Platon dieses Wort (67a), das in der Nikomachischen Ethik einer der Kandidaten für das vollendetste bzw. vollendendste Gut ist. Symposion Welches Phänomen wird im Symposion besprochen? 79 Nachdem man im Philebos eine Orientierung darüber erhalten hat, was das Anstrebenswerteste ist, erfährt man im Symposion, was ständig auf dieses Anstrebenswerteste, nämlich das Gute, hinstrebt, nämlich der Eros. Über ihn wird im Symposion gesprochen. Dabei schmerzt es bei diesem Werk besonders, hier in einer referierenden Äußerlichkeit zu bleiben, ist es doch das vielleicht kunstvollste Werk Platos. Neben der Apologie ist es der Text Platos, der über weite Strecken eigentlich kein Dialog ist. Daneben vereint es mit der Apologie die enorme Bekanntheit. Sicherlich war und ist es neben der Verteidigungsrede eines der bekanntesten und am meisten diskutierten Stücke Platos. Auch in der Antike genoss es ungemeine Popularität, wobei dies nicht nur dem Genius Platos zuzuschreiben ist, sondern auch der Tatsache, dass die literarische Gattung des Gastmahles, wie ‚Symposion‘ meist übersetzt wird, ungemein beliebt war. Dies erlaubt einen kurzen Ausblick in die antike Philosophiegeschichte. Von Xenophons Gastmahl war bereits die Rede anlässlich der Erwähnung von Sokrates’ Selbstoffenbarung als Hebamme im Theaitetos. Dieser Angabe korrespondiert bei Xenophon die Aussage des Sokrates, dasjenige, worauf er sich verstehe, sei die Kuppelei. Ein weiteres erhaltenes Gastmahl besitzen wir von Plutarch, dem großen Mittelplatoniker des ersten nachchristlichen Jahrhunderts. Der genaue Titel lautet: Gastmahl der Sieben Weisen, was schon den fiktionalen Rahmen angibt. Er lässt eine Gruppe an sophoí auftreten, die in der Antike zu einer Siebenergruppe zusammengefasst wurden. Als dritte Etappe sei das Werk des Athenaios mit dem Titel Deipnosophistai genannt, was meist mit „Gastmahl der Gelehrten“ ins Deutsche übertragen wird. In diesem Werk zitieren die Gelehrten, die sich unterhalten, immer wieder Passagen aus verschiedensten Autoren, sowohl Philosophen, Historikern, Dramatikern usw., deren Texte uns heute verloren sind, weshalb dieses Gastmahl oft in Fragmentsammlungen zitiert wird. Aus einer vergleichenden Lektüre dieser Gastmähler könnte noch deutlicher die überragende literarische Qualität des platonischen Symposions hervorstrahlen. (Übrigens können Sie eine detaillierte Gegenüberstellung dieser Werke in der bis vor kurzem einzigen Monographie zum antiken Dialog finden, bei Rudolf HIRZEL in seinem Werk Der Dialog.)41 Schon die so genannte Rahmenhandlung des platonischen Gastmahls ist überaus kunstvoll gestaltet. Das eigentliche Gastmahl mit seinen Reden ist eingebettet in eine Erzählung darüber, wie derjenige, der es erzählt, zur Kenntnis dieser Geschichte gelangt ist. Hier ist die höchste Verschachtelung aller platonischen Werkanfänge erreicht. Dies zeigt wiederum wie beim Theaitetos und Parmenides die Bemühung an, die sich Zeitgenossen beim Erlangen der Kenntnis eines Gespräches mit Sokrates gegeben haben. Wiederum zeigt sich eine Motivation dafür, sich mit Verschriftlichtem abzugeben. Die Rahmenhandlung des Geschehnisses am Abend, an dem das Gastmahl stattfindet, selbst ist wiederum ähnlich zum Theaitetos in gewisser Weise gerahmt. Dies sei eingangs noch ausführlicher referiert, da es indirekt über einen Gestus des Philosophierens des Sokrates informiert. Eines der Glieder in der Erzählung über 41 R. Hirzel, Der Dialog: Ein literarhistorischer Versuch, reprograf. Nachdr. d. Ausg. Leipzig 1895, Hildesheim o. J. Vgl. neuerdings: V. Hösle, Der philosophische Dialog. Eine Poetik und Hermeneutik, München 2006. 80 die Erzählung über die Erzählung des Symposions berichtet, dass er Sokrates auf der Straße getroffen habe, und dass dieser in für ihn ungewöhnlicher Weise beschuht gewesen sei (174a). Dabei ist schon aufgrund des bisherigen Erzählverlaufes dieses Detail beachtenswert, denn einer der Sokratesjünger, der das Gastmahl referiert, nämlich Aristodemos, wird so beschrieben, dass er immer unbeschuht gewesen sei (173b) – wenn Sie etwas überkritisch interpretieren wollen, können Sie sagen, dass hier bereits in gewisser Weise problematisiert wird, wenn sich Philosophen ihre Identität über eine Äußerlichkeit zu geben versuchen. Jedenfalls war vor allem in der römischen Antike ein Philosoph zu gewissen Zeiten vor allem derjenige, der einen Philosophenmantel und einen Stab trug, und damit sich als Kyniker zu erkennen gab. (Zumindest können wir dies zum Beispiel indirekt aus einer Kritik am Scheinkynismus erschließen wie etwa bei Epiktet). Sokrates also geht mit Schuhen angetan durch Athen und trifft Aristodemos. Sokrates berichtet, dass er am Weg zum Haus des Agathon zu einem Gastmahl ist. Die Kommentatoren diskutieren oft, das sei erwähnt, die Bedeutung dieses Namens, da agathón ‚gut‘ heißt. Jedenfalls ist Agathon eine historische Persönlichkeit, ein erfolgreicher Tragödiendichter, der im Wettkampf der Dionysien gewann. Ein solcher Sieg ist der Anlass, dass Sokrates zu einem Gastmahl bei Agathon geht. Allerdings, das ist für das Spätere beachtenswert, ging Sokrates nicht unmittelbar am Tag des Sieges zu Agathon. Er fürchtete, wie er sagt, die Menge, den Ochlos (174a). Wir sehen hier einen Sokrates, der sich nicht mit Zwang in die Menge stürzt, sondern sich sehr wohl aussucht, wohin er sich zum Gespräch begibt. Sokrates fordert Aristodemos, den er auf der Straße trifft, auf, mit ihm zu Agathon zu gehen, auch wenn er nicht eingeladen sei. Aristodemos folgt dieser Aufforderung, gerät allerdings alsbald in eine für ihn etwas peinliche Lage. Denn kurz vor ihrer Ankunft beim Haus des Agathon sagt Sokrates, er bleibe noch etwas zurück, Aristodemos möge allein bei Agathon eintreten. Dieser tritt ein, ohne denjenigen an seiner Seite zu haben, der begründen könnte, warum er uneingeladen gekommen ist. Allerdings behebt der Gastherr Agathon sogleich dieses Problem, er zeigt sich erfreut, dass Aristodemos gekommen ist, er habe ihn ohnedies einladen wollen, ihn aber nicht erreicht. Auf die Frage, wo Sokrates bleibe, erwidert ihm Aristodemos, er sei am Weg zurückgeblieben. Als Agathon Sokrates durch einen Diener holen lassen will, lässt dies Aristodemos nicht zu. Er berichtet, dass Sokrates dies öfters mache und er schon kommen werde. Dies ist der eingangs von mir erwähnte philosophische Gestus. Es ist ein Innehalten, das proséchein heautó tón noún, das ‚Bei-sich-den-Geist-Halten‘ (174d). Es ist, so könnte man sagen, nicht die berühmte Epoché des Skeptikers, sondern (wenn man so will) die ‚Proseche‘ des Sokrates. Dieser Gestus gibt die oben ebenfalls angesprochene Rahmung ab. Denn die Aussage des Aristodemos, dass Sokrates dies öfters tue, wird gegen Ende des Symposions durch Alkibiades’ Bericht über Sokrates bestätigt, in dem er unter anderem darüber berichtet, dass Sokrates 81 manchmal nächtelang abseits des Heerlagers gestanden sei und nachgesonnen habe. Soviel zur Rahmung des Gespräches des Gastmahles. Beachtens- und belachenswert ist auch die Ausgangssituation und der Anlass der Unterhaltung selbst. Diese Situation zeigt, dass ein philosophisches Gespräch dort beginnt, wo das Gewöhnliche durchbrochen wird. Denn die Ausgangslage des Symposion ist die, dass fast alle im Haus des Agathon Anwesenden noch von der Feier des Vortages mitgenommen, d. h. verkatert sind. Deshalb schlägt Pausanias vor, nicht in üblicher Weise nach dem Essen in strenger Manier zu saufen und der eben eingetroffenen Flötenspielerin zu lauschen (176e). Man möge diese fortschicken, und jeder solle nur soviel trinken, wie er will. Das philosophische Gespräch beginnt also nach einer gewaltigen Verkaterung. An dieser Stelle mag auch etwas über den Titel ‚Symposion‘ und die danach benannten Veranstaltungen gesagt werden. Das Wort ‚Symposion‘ bezeichnet das „Zusammen Trinken“. Somit passt die oft gewählte Übersetzung „Gastmahl“ im engen Wortsinn für eigentlich nicht exakt. Wenn der Reigen der Reden im Symposion Platos beginnt, ist das Mahl schon vorüber (vgl. 176a). Das Mahl wäre das deípnon und deípnesthai, das Speisen, wonach auch die Deipnosophisten des Athenaios benannt sind. So wird mitunter für ‚Symposion‘ die Übersetzung „Trinkgelage“ gewählt, was nur zum Teil auf Platos Symposion zutrifft. Wie berichtet, wird auf den üblichen Trinkzwang nach geregelten Vorgaben verzichtet. Erst als der betrunkene Alkibiades die Szene betritt, wird richtig gezecht. Wie dem auch sei, wollte man in Nachfolge Platos ein Symposion veranstalten, so sollte dies wohl nicht mit einem nüchternen Eröffnungsvortrag beginnen, sondern mit einem ordentlichen Besäufnis, an dessen Folgetag dann in Abweichung vom Alltäglichen das Philosophische stattfinden kann. Ein Wort noch zu Sokrates in dieser Verkaterungsszenerie: Er wird explizit aus der Gruppe der Trinkschwachen ausgenommen. Nicht nur war er am Vortag nicht mit von der Partie, ihm wird zugestanden, dass er immer soviel trinken kann, wie er muss (176c). Dies korrespondiert übrigens ebenfalls mit der Alkibiades-Rede am Ende des Symposion. Thema des Symposion Worum geht es aber im Symposion? Eryximachos, der das gemäßigte Trinken vorschlägt, schlägt auch ein Gesprächsthema vor, denn er sagt, wenn sie nicht der Flötenspielerin lauschen, so sollen sie durch Logoi beisammen sein, d. h. im Gespräch miteinander verkehren (176e). Sein Vorschlag greift ein Lieblingsthema des Phaidros auf. Dieser würde immer wieder beklagen, dass es Loblieder auf viele Götter gebe, der große und alte Gott Eros jedoch von noch keinem Dichter ein Loblied erhalten habe. Deshalb schlägt Eryximachos vor, dass rechtsherum jeder einen Lob-Logos auf den Gott Eros halten möge. Beachten Sie diese Vor82 annahme, dass Eros als Gott bezeichnet wird (vl. 177c). Sokrates wird dies später relativieren in seiner Herausstellung des Entwurfcharakters des Eros. Hier erfolgt die bemerkenswerte Aussage des Sokrates über sein Wissen. Er nimmt nämlich den Vorschlag des Eryximachos in der Weise auf, dass er sagt, er würde ihm nicht widersprechen, zumal er, Sokrates, sage, dass er sich auf nichts anderes verstehe als die erotiká, als die Dinge im Zusammenhang mit Eros (177d-e). Dies ist nicht nur ein scherzhafter Beitrag, sondern führt in gewisser Weise das im Theaitetos Gesagte fort, wo Sokrates zu erkennen gab, dass er sich als Hebamme unter anderem darauf versteht, wer mit wem zu verknüpfen sei. So beginnt denn der Reigen der Reden auf den Eros. Es werden zunächst sechs Reden sein. Die sechste muss Sokrates halten, der etwas vorbringen wird, was er von einer Dame namens Diotima gehört hat. Es wird in der Forschung viel darüber diskutiert, wie sich die sechs Reden zueinander verhalten. Manche meinen, dass das von Sokrates Gesagte alle vorausgehenden Reden widerlege. Andere sind der Ansicht, Sokrates’ Stellungnahme würde das vorher Gesagte aufheben, in dem Sinne, dass er die partikuläre Richtigkeit des Gesagten nicht leugnet, aber alles auf einen allgemeineren Boden stellt. Wie dem auch sei, man kann beobachten, dass die Reden über den Eros zunehmend allgemeiner werden. Während der erste Redner Phaidros von dem Eros als dem Verhältnis zwischen altem und jungem Liebhaber spricht, wenden sich seine Nachredner dem Eros beispielsweise als kosmologischem Prinzip zu. Äußerlich betrachtet kann man sagen, dass das Verhältnis der Redenden zueinander ein wohlwollend-freundliches ist. Es ist kein Verhältnis wie in einem Rededuell von Sophisten. Dies erwähne ich deshalb, weil viel über die Rede des Aristophanes im Symposion nachgedacht wird. Dieser Aristophanes ist der berühmte Dichter der Alten Komödie, der von Platon in der Apologie erwähnt wird. Dort könnte man den Eindruck gewinnen, Aristophanes wird als einer der Urheber für den schlechten Ruf des Sokrates angegeben (aufgrund seiner Komödie Wolken). Im Symposion wird ihm der witzigste und vielleicht treffendste Mythos Platos in den Mund gelegt. Die Reden über den Eros sind eine Fundgrube für die an antiken Diskursen über die Sexualität Interessierten. Hier findet sich einiges über die Homosexualität, und nicht nur über die männliche Homosexualität. Während die diesbezüglichen Passagen noch vor fünfzig Jahren in der Sekundärliteratur so aufgenommen wurde, dass betont wurde, wie unverständlich dieser Bereich der griechischen Welt für uns sei,42 so ist das Symposion in jüngerer Zeit wohl immer wieder in Queer-Debatten herangezogen worden. Das klassische Buch zur Bewertung der 42 Vgl. z. B. G. Krüger, Einsicht und Leidenschaft. Das Wesen des platonischen Denkens, Frankfurt a. M. 61992. 83 Quellen über die Homosexualität in der Antike stammt von Kenneth DOVER.43 Zu bedenken ist in diesem Zusammenhang die zumeist gegebene soziale Gebundenheit an obere gesellschaftliche Schichten und die strenge gesellschaftliche Ritualisierung der Homosexualität in der Antike; weiter ist die Differenzierung nach Poleis zu bedenken, die auch im Symposion angesprochen wird. Weithin akzeptiert war das Verhältnis von älterem Liebhaber zu dem jüngeren Geliebten, der an der Schwelle der Pubertät stehen musste. Dies sei erwähnt, weil für den im Symposion auftretenden Alkibiades oft gesagt wird, dass er in seiner Beziehung zu Sokrates dieses rituelle gesellschaftliche Verhältnis umgedreht habe. Dies stimmt teilweise und stimmt auch nicht. Alkibiades bleibt in der traditionellen Bahn, insofern er etwas von Sokrates lernen will, auch wenn dieser meint, ihm nichts Adäquates geben zu können. Dieser Alkibiades, ein schillernder Politiker der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts vor Christus, begegnet auch in anderen Dialogen Platos. Seine Auftritte sind wichtig für eine Bewertung der Sicht Platos vom Politischen Philosophen Sokrates. Die Reden im Symposion beginnen mit einem Lob der homosexuellen Paare als der besten Krieger. Wenn ein Heer aus Lieblingen und Liebhabern bestünde, wäre es unbesiegbar, weil sich jeder schämen würde, den anderen im Stich zu lassen. Die darauffolgende Rede des Pausanias bringt die nachmalig bekannte Unterscheidung von Eros Pandemos und Eros Ouranios, von der ‚im Volk verbreiteten Liebe‘ und der ‚himmlischen Liebe‘, wie oft übersetzt wird (wir bevorzugen den Ausdruck ‚Begierde‘ als Übersetzung von ‚Eros‘). Dem Brauch entsprechend sei nur ein Gebrauch der homosexuellen Lust zulässig, wenn sich der Liebhaber darum bemühe, dass sein Geliebter besser werde und sich zur areté, zur Bestform hinbewege (vgl. 184b ff.). Vom Bereich des Menschlichen führt die Rede des Arztes Eryximachos weg in die kosmologische Dimension. Der Eros sei ein grundlegendes Movens des Kosmos, die Arztkunst verstehe sich auf die richtige Beherrschung der Anfüllung und Entleerung im Bereich der Begierden. Durch welches Bild veranschaulicht der platonische Aristophanes den Eros? Nach diesen prosaischen Erörterungen folgt die Geschichte des Aristophanes, der sehr anschaulich die möglichen sexuellen Orientierungen der Menschen darstellt. Sie liegen in der ursprünglichen Kugelgestalt der Menschen begründet. War doch der Mensch einstmals die doppelte Portion von heute und hatte alles doppelt – vier Arme, vier Beine, zwei Geschlechtsorgane (weiblich-weiblich, weiblich-männlich oder männlich-männlich). So ausgerüstet, 43 K. J. Dover, Greek Homosexuality, New York 1978. 84 konnten diese Kugelwesen allerlei Bewegungen durchführen und wurden den Göttern lästig. Um Abhilfe zu schaffen, teilte Zeus sie in der Mitte. Unser Nabel ist das Erinnerungsmal dieser Zerschneidung als Zusammenführungspunkt der Haut der Schnittflächen. Er diene uns zur Mahnung, auf dass wir hinkünftig geordneter (kosmióteroi) seien (vgl. 190e). Die Hälften suchten allerdings einander, und im Falle des Findens umschlangen sie sich und ließen nicht mehr voneinander ab bis sie starben. Dem musste Abhilfe geschaffen werden, wären doch sonst die Götter ihrer Opferspender verlustig gegangen. So ließ der Göttervater die Geschlechtsorgane auf die andere Seite legen, damit die Kugelhälften beim Zusammentreffen eine gewisse Erfüllung ihres Beisammenseins fänden und dann wieder voneinander abließen. So ward der neue Mensch geboren, schwächer als der alte (Sie haben hier nach dem Politikos den zweiten Mythos zur condition humana vor sich), ein sýmbolon des Menschen (191d). Wie wird Eros von Diotima beschrieben? Auf Aristophanes folgt Agathon, der das Gute im Namen trägt. Seine Rede kommentiert Sokrates mit der Aussage, dass sie ihn an Gorgias erinnere (was bereits eine sehr bedenkliche Äußerung ist), und er sagt, dass er in seiner Einfalt angenommen habe, man solle etwas Wahres über den zu lobenden Eros sagen. Nun habe er jedoch gesehen, dass er nur möglichst großartig dargestellt werden soll. Hier setzt die große Wende ein, dass Eros nicht als Gott gefasst wird, sondern sozusagen als Zwischeninstanz, der die Richtung hin auf das Gute vorgibt. Dies deutet Sokrates schon in einem kurzen Dialog mit Agathon an, in welchem er diesen dazu bringt zuzugeben, dass der Eros immer ein Eros tinos, eine Begierde nach etwas ist (199e). Man hat aber das nicht, wonach man eine Begierde hat. Hier zeigt sich übrigens, dass dem Sokrates alles Dialog wird. Auch in seiner eigentlichen Rede über den Eros sind Dialogpartien enthalten, und eigentlich ist es nicht seine Rede, sondern er berichtet, was ihm Diotima erzählt habe (wohl eine Kunstfigur Platos). Sie war es, die Sokrates in den Erotika belehrte. Sie zeigte ihm auf, dass der Eros ein ‚Zwischen‘ sei (metaxý, 202d), so wie das richtige Meinen ein Zwischen sei zwischen Unwissen und Sich-auf-etwas-Verstehen. Das Wozwischen des Eros ist Poros und Penia, der Zustand des Habens und der Armut. Diese beiden Zustände, die dort als Personifikationen eingeführt werden, seien seine Eltern gewesen. Der Eros sei ein großer Daimon, zwischen Göttlichem und Menschlichen situiert, so wie jedes daimónion, alles Dämonenhafte. Als solcher Daimon sei er die Verbindung zwischen Menschen und Göttern. Hier sei ein erneuter Ausblick auf die antike Philosophiegeschichte erlaubt. Die Dämonen als Zwischenwesen, die oft auf dem Mond lokalisiert werden, sind ab dem Mittelplatonismus ein wichtiges Konzept zur Erklärung 85 mancher Defizienzformen der menschlichen Welt. In diesem Kontext ist wieder Plutarch zu nennen, z. B. sein Werk Über das Gesicht im Mond, ebenso sein Gespräch über den Genius des Sokrates, also sein Daimonion. Ein Werk selben Titels ist uns unter dem Namen des APULEIUS, des philosophus Platonicus, überliefert. In Diotimas Schilderung des Eros erinnert schon das Wort daimónion an Sokrates, deutlicher wird die Parallele bei der Beschreibung des Erscheinungsbildes des Eros. Unter anderem wird er als unbeschuht beschrieben (203d). Die Meinungen der Interpreten gehen auseinander in der Frage, inwieweit Sokrates eine Personifikation des Eros ist. Das bleibe hier dahingestellt. Besonders erwähnenswert in der Rede der Diotima ist noch die Formulierung vom „Gebären im Schönen“ (206b, e). Die Menschen seien sowohl körperlich wie seelisch schwanger und wollten ab einem gewissen Zeitpunkt gebären. Dies zeigte ihr Streben nach Unsterblichkeit an. Zeugen wollten sie dabei im Schönen. Bis zu diesem Punkt könne, so meint Diotima, auch Sokrates eingeweiht werden. Sie ist sich allerdings unsicher, ob er das Weitere mitbekommen könne (210a). Jedenfalls erfolgt jetzt die zentrale Schilderung in Diotimas Einweihung des Sokrates in den Eros. Es geht nun um den berühmten Aufstieg zum Schönen. Man müsse, so Diotima, als junger Mensch mit diesem Aufstieg beginnen und sich mit den schönen Körpern beschäftigen und hier schöne Logoi zeugen (210c). Dabei müsse man zunächst einen einzelnen Körper begehren, dann sehen, dass die Schönheit in allen schönen Körpern verwandt ist. Von dort müsse man sich dem Schönen in den Seelen zuwenden, dort Logoi zeugen, welche die Jugend besser machen. Man werde dann gedrängt, das Schöne in diversen Tätigkeiten und den Gesetzen zu sehen. Davon gehe es dann weiter zu den Wissenschaften. (Sie sehen eine gewisse Parallele zum Philebos.) Und dann ereigne sich das ‚Plötzlich‘: exaíphnes. Mit einem Mal werde man die wunderbare Schönheit erblicken (210e). Hier gebe es keinen Logos mehr. Es habe nur statt das Schöne „selbst gemäß sich selbst mit sich selbst eingestaltig immer seiend“ (autó kath’ hautó meth’ hautoú monoeidés aeí ón, 211b). Zu diesem gelange man über die beschriebenen schönen Entitäten wie auf Stufen bzw. ‚Auftrittsstellen‘ (epanabasmoí, 211c). Hier sei es, wenn überhaupt wo, für den Menschen lebenswert (211d). Das müsse man erreichen, das Schöne selbst zu sehen, „sonnenklar, rein, unvermischt“ (211e). Ebenso plötzlich wie man zu dieser Erschauung des Schönen gelange, hämmert plötzlich der schwer betrunkene Alkibiades ans Tor des Hauses des Agathon. Nun mag man sagen, dies ist das Satyrstück zu der erhabenen Kost, die man bisher im Symposion zu sich nehmen durfte. Aber neben aller Witzigkeit hat die folgende Rede eine wichtige Funktion zur Abrundung des Kunstwerkes, welches das Symposion darstellt. In ihr wird Sokrates als der große Erotiker erwiesen. Denn Alkibiades wird aufgefordert, an dem Gesprächsreigen teilzunehmen. Er will aber keine Rede über Eros halten, er möchte Sokrates loben. Denn er behauptet, eine Sicht von Sokrates zu haben, die andere nicht hätten. Hier muss kurz etwas über Alkibiades gesagt 86 werden, was zur Interpretation der Philosophie Platos von Belang ist. Alkibiades war ein Adelsspross, der viel Glück und Unheil über Athen brachte. Vieles darüber ist bei THUKYDIDES, dem großen Geschichtsschreibers des Peloponnesischen Krieges zu lesen. An Alkibiades zeigt sich paradigmatisch, wie man sich Sokrates’ Philosophie entziehen kann – durch Flucht (vgl. 216a). Er wird (auch bei Platon) als begabt geschildert, und dass er eine besondere Kenntnis des Sokrates hat, ist nicht ironisch gemeint. Im Dialog Protagoras ist er ein Lobredner auf Sokrates. Dort sagt er, dass er nie einen so guten Dialogführer erlebt habe wie den Sokrates. Aber man kann sich natürlich fragen, warum eine Philosophenfigur wie Sokrates nicht besser auf so Leute wie Alkibiades einwirken konnte. Allgemeiner könnte man fragen, warum überhaupt die Philosophie so selten auf die Politik einwirkt. Kurz nach dem fiktiven Datum des Symposion startete die sogenannte Sizilische Expedition (um 415 vor Christus). Athen, im eigenen Hinterland bedrängt, unternahm es, in Sizilien einen Feldzug zu wagen und entsandte eine gewaltige Flotte. Alkibiades war einer der leitenden Generäle. Allerdings wurde er bald zurückberufen nach Athen, da am Vorabend der Wegfahrt die Hermen (so etwas wie Wegmarterln) geschändet wurden (der sog. Hermokopidenfrevel). Aber Alkibiades hatte nicht im Sinn, nach Athen zurückzukehren und sich den Prozess machen zu lassen. So stieg er in Sparta, bei den Feinden Athens aus, und gab ihnen militärische Beratung. Neben einigen Unglücken für das athenische Heer führte diese seine Tätigkeit zu einer Athen erschütternden Niederlage: Das Expeditionsheer wurde geschlagen, die Überlebenden kamen in den Steinbrüchen bei Syrakus in einem Gefangenenkonzentrationslager um. Athen verlor beinahe seine gesamte waffenfähige Mannschaft. Alkibiades tritt ein bei Agathon und ist überrascht, Sokrates anzutreffen. Er klagt ihn an, dass er ihm überall nachstellt (213c), obwohl es vielmehr Alkibiades war, der Sokrates nachgestellt hat. In der letzten Zeit ist Alkibiades vor Sokrates geflohen, weil er befürchtet hat, bei ihm hängen zu bleiben und alt zu werden (216a). Hier sehen wir, wie es bei Alkibiades an der Kippe stand, dass er ein Philosoph wurde. Platon spricht ihm beileibe nicht die Begabung dazu ab. Aber, so erfährt man in der Politeia, besteht gerade bei den begabten Naturen die Gefahr, dass sie aufgrund der großen Erwartungen der Öffentlichkeit korrumpiert und zu schlechten Politikern werden. Nur überaus selten geschehe dies nicht, wenn zum Beispiel jemand körperlich zu schwach sei oder ihn eine Instanz wie das Daimonion davor bewahre, in die Politik zu gehen (rep. 491a ff.). Neben diesen indirekten Reflexionen darüber, warum die Philosophie so wenig Wirkung in der Politik zeitigt, kann man, wie eingangs angedeutet, der Rede des Alkibiades entnehmen, dass Sokrates de facto den von Diotima genannten Aufstieg geschafft hat. Darüber hinaus entspricht Sokrates’ Eros den Eroten der Vorredner. Sokrates erwies sich bei einem Feldzug als mutiger Krieger, der Alkibiades nicht im Stich ließ, er ist ein Vertreter des Eros Ouranios im Sinne des Pausanias, da er nur an der Besserung der Alkibiades interessiert ist, der mit ihm in ein Liebesverhältnis eintreten will, er beherrscht den medizinischen Eros im Sinne des Eryximachos, da er über die richtige Anfüllung des Körpers bescheid weiß, was darin seinen Ausdruck findet, dass er Hunger, Kälte und andere Strapazen 87 des Feldzuges ertrug wie kein anderer und nie jemand Sokrates betrunken gesehen hat (220c ff.). Somit erhält man einige weitere Mosaiksteine zur Schaffung des Bildes des PhilosophieHelden Sokrates. Auch im Symposion selbst beweist Sokrates seine Trink- und Redefestigkeit, unterhält er sich doch bis zur Dämmerung mit den Poeten Aristophanes und Agathon zechend darüber, dass ein guter Tragödiendichter auch ein guter Komödiendichter (und umgekehrt) sein müsse (223d). Leider hat der Berichterstatter des Symposions diesen Teil verschlafen, er wacht erst wieder auf, als Sokrates sich ins Lykeion aufmacht um dort seinen Tag in gewohnter Weise hinzubringen. Dadurch haben wir leider keinen Bericht über die platonische Poetik. Phaidros Der Dialog Phaidros setzt die Thematik des Eros fort und zeigt an, wie das von Diotima angesprochene Zeugen im Schönen sich im Bereich der Seelen abzuspielen hat. Hierauf sei die Besprechung des überaus inhaltsreichen Phaidros beschränkt, der wohl der in der PlatonForschung des vergangenen halben Jahrhunderts am intensivsten besprochene Dialog ist. Dies ist er nicht aufgrund seines Mythos über den Seelenwagen, welcher von einem guten und einem schlechten Pferd gezogen wird, und mit dem man manches Mal zum „überhimmlischen Ort“ gelangen darf (247c), sondern aufgrund der so genannten Schriftkritik. Dabei ist es besonders in diesem Fall dringend geboten, den gesamten Dialog zu lesen. Denn ähnlich wie im Theaitetos wird auch hier Geschriebenes vorgelesen. Allerdings wird nicht der ganze Dialog als vorgelesen vorgestellt wie im Theaitetos, sondern innerhalb des Gespräches von Phaidros und Sokrates errät Sokrates, dass Phaidros eine Schriftrolle mit der Rede des Lysias mit sich führt, von der er ihm erzählt hat. Phaidros hatte zuvor sehr geschickt Sokrates aus Athen fortgelockt, weil er weiß, dass Sokrates Reden liebt. Aber es ist festzustellen, dass Sokrates die Rede des Lysias nicht aus der Erinnerung erzählt bekommen mag, sondern, da Lysias selbst in der geschriebenen Rede anwesend ist, wie es heißt (228e), will er sie vorgelesen bekommen. Das heißt, bei aller Kritik, die später im Phaidros über das Schriftliche erfolgen wird, kann man mit den Figuren Platos sagen, dass ein Autor im Geschriebenen anwesend ist. Allerdings ist, das wird gegen Ende des Dialogs aufgezeigt, das Problem gegeben, dass derjenige, der etwas schreibt, dem Geschriebenen nicht „zu Hilfe kommen“ kann (275e), entweder weil er schon tot ist oder weil er nicht anwesend ist, wenn jemand sein Werk liest. Diese in der Antike weniger zentrale Stelle zu Schriftkritik wurde für eine gewisse Gruppe von v. a. deutschen Platonforschern so wichtig, weil sie der Ausgangspunkt war für die Überlegungen, was die ungeschriebene Lehre Platos gewesen sein könnte. Hier sind vor allem die 88 Namen Hans Joachim KRÄMER und Konrad GAISER zu nennen, welche die relevanten Stellen bei Autoren nach Platon gesammelt haben, in denen davon die Rede ist, was Platon im „Ungeschriebenen“ gelehrt habe.44 Diesbezüglich ein locus classicus ist beispielsweise im vierten Buch der Physik des Aristoteles zu finden, wo Aristoteles über Platos Auffassung von Hyle und Chora (was oft mit ‚Materie‘ und ‚Raum‘ übersetzt wird) spricht und andeutet, dass Platos Aussagen im Timaios (dem schriftlich vorhandenen Dialog) und in den ágrapha dógmata, den ungeschriebenen Lehrmeinungen verschieden sei (Phys. IV, 2, 209b12 ff.). Neben diesen Zeugnissen werden innerhalb der Dialoge Platos so genannte Aussparungsstellen ausfindig gemacht. An solchen Aussparungsstellen sagen die Sprecher, dass sie ein Problem ein anderes Mal besprechen würden. Genaue Merkmale einer Aussparungsstelle gibt ein namhafter Vertreter der Theorien zur Ungeschriebenen Lehre an, nämlich Thomas Alexander Szlezák in seinem schon zitierten Buch Das Bild des Dialektikers in Platons späten Dialogen (220, Anm. 6). Die Grundtermini, die für die ungeschriebene Lehre angenommen werden, sind die Einheit und die unbeschränkte Zweiheit. Ein Grundtext dieser Forschungsrichtung, der knapp über diese Angelegenheit informiert, ist ein Aufsatz von Krämer in den Kantstudien.45 Wenn sie sich allgemein über die Diskussion der letzten Jahrzehnte zur Ungeschriebenen Lehre informieren wollen, empfehle ich das im Jahr 2007 neu aufgelegte Buch von Rafael FERBER, Warum hat Platon die „ungeschriebene Lehre“ nicht geschrieben?.46 Diese Diskussionen erreichten eine beachtliche Schärfe, als Gegenpol zu Szlezák sei Wolfgang WIELAND genannt. In seinem Platonbuch sagt er etwa über die Resultate einer Rekonstruktion der ungeschriebenen Lehre, sie seien „inhaltlich nun einmal von extremer Dürftigkeit und Simplizität“ (43). Auf der anderen Seite spricht etwa Szlezák über die „blinde Polemik“ der Kritiker seiner Sicht der Aussparungsstellen.47 Was versteht man unter Platos Schriftkritik? Wir wollen uns die betreffende Passage im Phaidros etwas genauer ansehen. Phaidros und Sokrates kommen auf die Logographie, das Redenschreiben zu sprechen, weil Phaidros berichtet, dass Lysias, dessen Rede er eingangs vorgelesen hat, von einem Politiker als logográphos, als Redenschreiber verhöhnt wurde (257c). Danach spricht Phaidros die Scheu 44 H. J. Krämer, Arete bei Platon und Aristoteles. Zum Wesen und zur Geschichte der platonischen Ontologie, Heidelberg 1959 (Abh. d. Heidelb. Akad. d. Wiss., Phil.-Hist. Kl.; 1959, 6); K. Gaiser, Platons ungeschriebene Lehre, Stuttgart 21968. 45 H. J. Krämer, Die platonische Akademie und das Problem einer systematischen Interpretation der Philosophie Platons, Kant-Studien 55 (1964), 69-101. 46 R. Ferber, Warum hat Platon die „ungeschriebene Lehre“ nicht geschrieben?, München 2007. 47 Szlezák, Das Bild des Dialektikers, 25 f., Anm. 47. 89 der Politiker an, Schriftliches zu hinterlassen; sie fürchteten, bei der Nachwelt in einem schlechten Licht zu stehen. Sokrates aber legt ihm dar, dass eigentlich jeder Staatsmann begehre, durch Aufzeichnungen verewigt zu werden und bei den Späteren in einem guten Licht zu stehen. Man müsse nur den richtigen Redenschreiber finden. Grundsätzlich sei das Redeschreiben nichts Schändliches. Freilich müsse man betrachten, worin die richtige Weise, Reden zu schreiben, bestehe. Die richtige Techne des Redenverfassens kann laut Sokrates nur, wie dies bei ihm auch zu erwarten ist, aufruhen auf dem Wissen von Sachen, über welche man reden soll. Dieses Wissen aber verschaffe hauptsächlich die Dialektik (265e ff.). Was das Schreiben betrifft, erzählt Sokrates etwas, was er von den Früheren gehört habe (274c). Er bringt die Geschichte von dem Daimon Theuth vor, der neben dem Zählen, der Geometrie und Astronomie auch das Würfelspiel und die Buchstaben erfunden habe. Mit seinen Technai sei er zum ägyptischen König Thamos gegangen, um sie ihm vorzuführen. – Übrigens haben wir hier einen der Reflexe von Ägyptischem in der griechischen Philosophie, Theuth wird als Buchstabenkünstler auch im Philebos erwähnt (18b), ausführlicher wird über die Ägypter als Volk mit tieferem Geschichtsbewusstsein als die Griechen im Kritias gehandelt. Ein anderer wichtiger Quellentext aus der griechischen Philosophie für die Ägyptologie ist Plutarchs Schrift Über Isis und Osiris.48 – Theuth preist dem König die Buchsta- ben an als „Mittel der Erinnerung und Weisheit“ (mnémes te gár kaí sophías phármakon, 274e). Doch der König klärt Theuth darüber auf, dass die Buchstaben die gegenteilige Wirkung hätten. Diejenigen, die sich ihrer bedienten, würden vielmehr an Gedächtnisvermögen einbüßen. Das Geschriebene würde dazu führen, dass die Menschen ohne richtige Erziehung sich nur einbilden würden, Wissen zu besitzen. Sokrates weist auch auf das Problem hin, dass man, wenn man etwas Geschriebenes befragt, immer nur die selbe Antwort erhalte (275d). Darüber hinaus würde jeder Logos, sobald er einmal geschrieben ist, überall herumkugeln und sowohl zu denen gelangen, die ihn verstehen als auch zu solchen, denen er nicht zukommt. Werde ein solcher Logos ungerechterweise gescholten, bedürfe er seines Vaters als eines Helfers, da er sich nicht selbst zur Hilfe kommen kann. Demgegenüber sei der edlere und bessere Logos derjenige, der mit Kenntnis in die Seele eines Lernenden eingeschrieben wird (276a, vgl. 276e), also der lebendige gesprächsweise Umgang von Lehrer und Schüler. Auf diese Aussage folgt der berühmte Vergleich, welcher aus dem landwirtschaftlichen Milieu entnommen ist. Der vernünftige Landwirt, der aus dem eingesetzten Samen Frucht gewinnen wolle, würde wohl nicht sich im Ernst an den schnellwachsenden Adonisgärtchen erfreuen. Adonisgärtchen würde er nur „des Spieles halber“ bei Festen anlegen (276b). Ähnlich würde man die Buchstabengärtchen nur des Spieles halber 48 Zu der Sicht der Griechen von Ägypten vgl. J. Assmann, Weisheit und Mysterium: das Bild der Griechen von Ägypten, München 2000. 90 säen. Die ernste Betätigung bestehe darin, in die geeignete Seele mit Kenntnis einzusäen, wobei man dem Ausgesäten zu Hilfe kommen könne (276d). Beachtenswert sind die Ausdrücke für Ernst und Spiel: spoudé und paidiá. Dieses Paar ist bei Platon des Öfteren anzutreffen. Was ist die paidiá? Eine paidiá ist eine ‚Kinderei‘ (der Ausdruck ist verwandt mit dem Wort pais ‚Kind‘) – Nun könnte man aus der zitierten Stelle ableiten, dass das gesamte schriftliche Werk Platos nur eine Kinderei, ein Scherz, ein Spiel ist. Das stimmt in gewisser Weise. Aber dabei gilt zu bedenken, welche Rolle dem Spiel bei Platon zukommt. Besonders in den Nomoi wird ausführlich über den Zweck des Spieles gesprochen. Es ist eine durchaus ernste Angelegenheit, insofern darin über das Wohl der zukünftigen Bürger entschieden wird. So müssten Mädchen und Burschen ab einem gewissen Alter in fixen Spielen erzogen werden. Die Fixiertheit garantiert, dass sie später nicht an der Fixiertheit der Gesetze Anstoß nähmen. Inhalt der Spiele ist zum Beispiel die Vorbereitung auf den Kampf, woraus ersichtlich wird, dass das Spiel auf eine ernste Sache vorbereitet (leg. 795d ff.). In Analogie dazu könnte man nun für die Werke Platos sagen, dass sie nicht spoudé, nicht Ernst sind in dem Sinne, dass bei ihrer Lektüre ein dialektisches Problem realiter gegen einen Gegner durchgefochten wird. Man nimmt an einem Kampfspiel teil, das auf einen ernsten Redekampf vorbereiten kann. Des Weiteren wird selbstverständlich auch in den Nomoi mitbedacht, dass es immer den lebendigen Umgang mit einem Lehrer braucht – doch dieser kann sich bei seiner Erziehung an schriftlich fixierten Texten wie den Nomoi selbst orientieren. Ähnliches wird auch im Phaidros angesprochen, wo Sokrates sagt, dass das Geschriebene für den Schreiber ein Erinnerungsmittel ist und zum Nutzen sein kann für jeden, der in „derselben Spur“ geht (276d). Das Geschriebene könnte als andere Art des Spieles bei Symposien verwendet werden. Darauf erwidert Phaidros, dass dies eine überaus schöne Art von Spiel wäre im Vergleich zu dem niedrigen Typus an Belustigungen, der sonst bei den Gelagen statt hat (276e). Doch Sokrates hebt noch einmal hervor, dass der Ernst in diesem Bereich etwas viel Schöneres sei, wenn nämlich jemand unter Benutzung der Dialektik und Heranziehung einer geeigneten Seele Logoi pflanzen würde, die sich selbst und ihrem Pflanzer zu Hilfe kommen könnten und eine Fortwirkung ermöglichten, die ihn unsterblich machen (276e-277a). [...] 91 Sophisten, Redelehrer Das heißt, wir haben immer noch keine „positive“ Lehre Platos gefunden. Zumindest könnte man dies konstatieren, wenn man einen pauschalen Überblick über das bisher Besprochene wagen will. Eher wurde die Philosophenfigur Sokrates exponiert, gezeigt, wie es etwas Falsches geben kann, welcher Technik der Begriffszergliederung man sich bedienen kann, und wohin die Bemühungen des erotischen Philologen Sokrates führen. Doch muss man, liest man Platos Werke in der angegebenen Anordnung weiter, noch geraume Zeit auf eine positive Lehre warten. Zunächst stößt man auf eine Vierergruppe, in der sich Platon mit den populären Weisheitslehrern seiner Zeit auseinandersetzt. Es ist ja nicht so, dass adelige junge Leute wie Alkibiades, die in die Politik drängten, nicht auf ein reiches Angebot an Lehrern zurückgreifen konnten. Diese selbsternannten Lehrer machten sich anheischig, allerlei Dinge zu lehren, die für einen zukünftigen Erfolg in der Politik unerlässlich seien. Was Platos Auseinandersetzung mit diesen Personen betrifft, so kann man sehen, dass er seinen Sokrates den Umgang mit ihnen nicht schlichtweg ablehnen lässt. Der Sokrates der Dialoge Euthydemos, Protagoras, Gorgias und des Menon bezieht nicht die Extremposition einer Figur im Menon. Dort tritt ein gewisser Anytos auf, der jeden Kontakt zu den Sophisten, also den Weisheitslehrern ablehnt (91c ff.). Demgegenüber ist Sokrates’ Aufeinandertreffen mit den Sophisten durchgängig von der Bemühung gekennzeichnet, ihren Künsten einen Nutzen abzugewinnen. Sokrates will ihre Tätigkeit so auslegen, dass sie zeigen soll, warum man Philosophie betreiben müsse. Er will die Verunsicherungen, die ihre Wortspielereien bewirken, dazu verwenden, um jemanden zur Philosophie „hinzuwenden“. Dieses Hinwenden heißt auf Griechisch protrépein.49 Davon abgeleitet ist das Adjektiv protreptikós, welches als Substantiv (Protreptikos) eine Hinwendungsschrift zur Philosophie bezeichnet. (Es gibt aus der Antike Nachrichten, dass mehrere Philosophen einen Protreptikos verfasst hätten. So soll Aristoteles eine solche Hinwendungsschrift verfasst haben, um deren Rekonstruktion aus späteren Autoren sich im 20. Jahrhundert vor allem zwei Gelehrte bemüht haben, Sir Ingram Bywater und Ingemar Düring.)50 49 Im Euthydemos beispielsweise erklärt Sokrates Kleinias, man müsse die Widerlegungsversuche seiner Gesprächspartner Euthydemos und Dionysodoros als „Spiel“ (paidiá, 278b) betrachten, das Teil ihrer „(zur Philosophie) hinwendenden Weisheit“ bzw. „Klugheit“ (protreptiké sophía, 278c) sei. Die damit angesprochene Thematik der Protreptik, der Hinwendung, zieht sich durch alle, zum Teil sehr heftigen Diskussionen des Euthydemos bis zu seinem Ende hin, wo Kriton noch einmal seine Unfähigkeit, seine Söhne zum Philosophieren „hinwenden“ zu können (ouk écho hópos protrépo, 307a), beklagt. 50 Zur Forschungsgeschichte vgl. I. Düring, Aristotle’s Protrepticus. An Attempt at Reconstruction, Göteborg 1961 (Studia Graeca et Latina Gothoburgensia; 12), 12-14. Vgl. Aristoteles, Der Protreptikos. Einleitung, Text und Kommentar von I. Düring, Frankfurt a. M. 21993; Aristoteles, Protreptikos. Hinführung zur Philosophie. Rekonstruiert, übs. und komm. von G. Schneeweiss, Darmstadt 2005 (Texte zur Forschung; 85). 92 Der platonische Sokrates fragt neben dieser Nutzbarmachung der sophistischen Erschütterungen für die Hinwendung zu Philosophie nach der Genießbarkeit der Kost, die man bei den Sophisten erhält. Diese Bildlichkeit findet sich am Anfang des Dialogs Protagoras. Dort kommt bereits im Morgengrauen ein gewisser Hippokrates, ein Namensvetter des Arztes aus Kos (vgl. 311b), in das Haus des Sokrates und bittet diesen, ihn bei Protagoras, dem berühmten Sophisten, der gerade in Athen weile, einzuführen. Sokrates legt diesem Bittsteller dar, dass er prüfen solle, ob die geistige Nahrung, die er dort um gar nicht wenig Geld erwerben könne, förderlich sei. Sokrates bemüht in diesem Zusammenhang einmal mehr die Analogie zum Gesundheitswesen. Wenn man jemand seinen Körper zur Behandlung anvertrauen wolle, würde man wohl zahlreiche Bekannte nach Ratschlägen fragen (313a). Ebenso solle man bei der Wahl des Weisheitslehrers vorgehen. Zusätzlich sei das Problem zu bedenken, dass man die dort zu erwerbenden Waren nicht wie Lebensmittel vom Markt holen und zuhause auf ihre Essbarkeit hin überprüfen könne. Man nehme sie unmittelbar in die Seele auf und könne nicht ihre Tauglichkeit gesondert testen (314a-b). Sokrates lehnt also bei Platon den Umgang mit den Sophisten nicht ab, freilich wird er als Kritiker ihrer Lehren geschildert, wobei die Schärfe, mit der er die Lehren kritisiert, durchaus unterschiedlich ist. Offensichtliche Wortspielereien wie diejenigen der Sophisten-Zwillinge im Euthydemos nimmt Sokrates wenig ernst und will sie, wie gesagt, zur Protreptik nutzen. Dem großen common-sense Philosophen Protagoras gegenüber hat Sokrates schon größere Vorbehalte, wenngleich das Gespräch sehr freundschaftlich abläuft. Allerdings gedenkt Sokrates die Unterhaltung zu beenden, als sich Protagoras in ausgedehnte Prunkreden flüchtet und sich nicht auf die kleinteilige Dialektik im sokratischen Sinn einlassen will (vgl. 335b-c). Dem berühmten Redelehrer Gorgias und seinen Schüler begegnet Sokrates mit durchaus strengem philosophischen Pathos. Ihnen gegenüber, die die Macht und das Recht des Stärkeren predigen, will Sokrates die Suche nach der Wahrheit und dem Guten stark machen (vgl. 526d-e). Man könnte demnach sagen, dass sich Sokrates’ Umgehen mit den Sophisten je nach deren Inhalten unterschiedlich gestaltet. Protagoras etwa, der sich in Platos Darstellung darauf verlegt hat, die richtige Beratenheit in den eigenen Angelegenheiten und in denen der Stadt zu lehren, und der der Überzeugung ist, dass die areté lehrbar sei, wird hauptsächlich daraufhin befragt, welchen Logos er angeben kann über das, wozu er die Schüler erziehen will. Dahingegen wird die Gruppe um Gorgias, die mit einer auf Überredung basierenden Redekunst das schwächere Argument zum stärkeren machen will, darauf hingewiesen, dass ihre vermeintliche Techne gar keine Techne sei. 93 [...] Die Anfrage des Kleitophon Dieser ist ein sehr kurzer (meist als für nicht von Platon stammend gehaltener) Dialog, in welchem angefragt wird, inwiefern die Tätigkeit des Sokrates zielführend ist. Kleitophon habe zwar, so berichtet er dort, in seinem bisherigen Umgang mit Sokrates diesen als den besten Mahner kennen gelernt, wenn es darum gehe festzustellen, was man seiner Psyche zumuten und wie man sie gebrauchen solle (408a). Die diesbezüglichen Reden des Sokrates seien die nützlichsten und zur Philosophie anregendsten (408b-c). Aber er, Kleitophon, habe den Anhängern des Sokrates die Frage gestellt, ob das gesamte weitere Leben in der Fortführung dieser Protreptik bestehen solle, und ob das philosophische Tun nur darin bestehe, dass man selbst andere zum Philosophieren antreibe, und diese wiederum andere antrieben und so fort, oder ob es noch eine über diese Propädeutik hinausgehende Tätigkeit bzw. Kunstfertigkeit in der Philosophie gebe. Darauf habe einer der Befragten erwidert, dass dieses Hinausgehende die Techne der „Gerechtigkeit“ (dikaiosýne, 409a) sei. In Hinblick auf diese in Aussicht gestellte Kunst bekennt Kleitophon am Schluss des Gesprächs, dass Sokrates ihm beinahe hinderlich erscheint bei dem Unterfangen, zur Erreichung der Bestform (télos aretés) zu gelangen, wenn man einmal durch ihn zum Philosophieren angeregt worden sei (410 e). Gleichsam als Erwiderung auf diese kritische Anfrage erleben wir in der Politeia, wie Sokrates die Gerechtigkeit darstellt. Die Politeia Was ist die Grundfrage der Politeia? Sokrates will mit seinen Gesprächspartnern in der Politeia vornehmlich bestimmen, was es für den einzelnen bedeutet, gerecht (díkaios) zu sein. Der Fiktion des Gespräches, welches die Politeia darstellt, zufolge geht es nicht primär um den Entwurf einer Staatsutopie. So schreibt Jean Jacques ROUSSEAU am Anfang seines Emil über Platons Staat: „Das ist kein politisches Werk, wie die Leute behaupten, die die Bücher nur nach dem Titel beurteilen: es ist die schönste Abhandlung über die Erziehung, die jemals geschrieben wurde.“51 Freilich wurde die Politeia oftmals als Staatsentwurf verstanden und für die Geschlossenheit des vermeintlich in 51 J.-J. Rousseau, Emil oder Über die Erziehung. Vollst. Ausg. In dt. Fassung besorgt von L. Schmidts, 13., unveränd. Aufl., Paderborn u. a. 1998, 13. 94 ihr entworfenen Systems kritisiert. Ihr wohl bekanntester Kritiker im 20. Jahrhundert war Sir Karl Raimund POPPER mit seinem Buch Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Vielmehr geht das Gespräch der Politeia von der Frage aus, was es für den einzelnen bedeutet, gerecht zu sein. Diese Frage wird im ersten Buch exponiert. Im zweiten Buch schlägt Sokrates vor, auf die „größeren Buchstaben“ hinzublicken. Es würde doch niemand, wenn er bemerkt, dass er etwas wo größer geschrieben lesen kann, auf das Kleinere hinblicken (368d). Ebenso könne man die Gerechtigkeit leichter im Größeren, dem staatlichen Gemeinwesen erkennen. Aufgrund dieser methodischen Überlegung gehen die Gesprächspartner zur Betrachtung des Staatswesens über, kehren jedoch immer wieder zum Einzelindividuum zurück. Wenn etwa die drei wesentlichen Stände des Staates beschrieben werden, so wird dies zurückbezogen auf ein mögliches besseres Verständnis des einzelnen Menschen. In dieser Doppelung, dass die Unterredner sowohl das Kollektive wie das Individuelle zu illustrieren suchen, sind auch die drei großen Gleichnisse in der Mitte der Politeia zu sehen sowie die daran anschließenden Erläuterungen über die Abfolge der Staatsformen. Sokrates ist der Erzähler der gesamten Politeia, die der Fiktion nach das Gespräch eines einzigen Abends darstellt. An ihrem Anfang berichtet Sokrates, dass er in den Piraios, den Hafen Athens hinabgestiegen war, um an einem Fest teilzunehmen. Auf dem Heimweg allerdings sah ihn ein Bekannter, der ihn nötigte, bei ihm einzukehren. Abgesehen davon, dass wir hier einen ähnlichen Gestus wie im Protagoras sehen, wo Sokrates festgehalten wird, damit er nicht nach Hause entschwinden kann (Prot. 335d), ist diese Eingangsszenerie bemerkenswert, weil sie mit der Schilderung des Höhlengleichnisses verglichen werden kann. Dort heißt es, dass derjenige, der den Aufstieg zum höchsten Lerngegenstand geschafft hat, gezwungen werden muss, wieder abzusteigen um andere zum Aufstieg aus der Höhle zu bewegen (s. u.). Wie dem auch sei, Sokrates fügt sich der Nötigung und begleitet seinen Bekannten namens Polemarchos in dessen Haus. Hausherr ist der greise Kephalos, eine interessante Figur, die vorlebt, wie man sich der Philosophie entziehen kann. Sokrates gibt nämlich seiner Freude Ausdruck, dass er den Tattergreis Kephalos sieht, der schon mit einem Bein im Grabe stehe. Sokrates freut sich, mit ihm sprechen zu können, weil es für ihn immer interessant sei zu hören, was Menschen unmittelbar vor dem Tod denken (328d-e). Kephalos berichtet ihm, dass er wert darauf legt, von der Welt zu gehen, ohne jemandem etwas zu schulden. Als nun Sokrates die Rede auf die dikaiosýne, die Gerechtigkeit bringt, entspinnt sich ein Gespräch, das manche Kommentatoren an die so genannten Tugenddialoge erinnerte, weswegen man angenommen hat, das erste Buch der Politeia sei ursprünglich ein eigenständiger Dialog, der Kephalos, gewesen. Sokrates jedenfalls stellt Kephalos die Frage, ob man Gerechtigkeit 95 einfach so definieren könne, dass sie darin besteht, das zurückzugeben, was man von jemandem bekommen habe, oder ob dies manchmal gerecht sei, manchmal nicht (331c). Sobald diese Relativierung beginnt, übergibt Kephalos den Jüngeren das Gespräch, weil er sich noch um die heiligen Handlungen kümmern müsse. Es entwickelt sich ein durchaus sophistisches Gespräch, in dem zunächst die Ansicht vertreten wird, Gerechtigkeit bedeute, jedem das ihm Zukommende zu geben (332c), den Freunden Nützliches und den Feinden Schädliches (332d). Als diese Definition sich als nicht haltbar erweist, bringt der stärker sophistisch gefärbte Thrasymachos die Bestimmung ins Spiel, dass die Gerechtigkeit das dem Stärkeren Zuträgliche sei (338c). In diesem Gesprächsabschnitt kommen ein erstes Mal verschiedene Staatsformen zur Rede, die Tyrannis, Demokratie und die Aristokratie (338d). Die Widerlegung dieser Gerechtigkeitsbestimmung (sie sei das dem Stärkeren Zuträgliche) wird einmal mehr durch das Techne-Argument geführt. Wenn die Staatsführung eine Kunst ist, so würde sie wie jede Kunst um willen eines anderen, geringeren da sein. So wie sich die Arztkunst um den Körper kümmere, müsste sich die Staatskunst um die ihr Untergebenen kümmern (342e). Für Thrasymachos ergibt sich daraus aber, dass die Ungerechtigkeit den größeren Nutzen bringe. In der auf diese Position folgenden Diskussion folgt die bedenkenswerte Aussage, dass in einer Stadt von guten Menschen das Nichtregieren so umstritten wäre wie jetzt das Regieren. Denn in einer solchen Stadt wäre es klar, dass die Regierenden nicht herrschen, um ihren eigenen Vorteil zu suchen, sondern um den der anderen (347d). Allerdings kann Sokrates dem Thrasymachos aufzeigen, dass eine ungerecht regierte Stadt keinen Vorteil vor einer gerecht regierten haben könne, und dass somit seine Ausgangsposition nicht haltbar sei. Common sense-Theorien zur Gerechtigkeit Nach diesem Vorspiel (vgl. 357a) beginnt die eigentliche Darstellung der Gerechtigkeit durch Sokrates. Angespornt wird er zu dieser breiten Ausführung vor allem durch Glaukon und Adeimantos. Diese referieren am Anfang des zweiten Buches der Politeia einige gängige Ansichten über die Gerechtigkeit, die man als utilitaristisch klassifizieren könnte. Ausgegangen wird von der Frage, ob man die Gerechtigkeit als etwas beurteilt, das um seiner selbst willen gewählt (wie die Lüste), oder als etwas, das um willen eines anderen gewählt wird (eine ähnliche Unterscheidung wird zur Ermittlung des vollendenden Guten in der Nikomachischen Ethik anzutreffen sein). Sokrates reiht die Gerechtigkeit in die höchste Kategorie von Gütern ein, in die um ihrer selbst willen erstrebenswerten. Hier wirft Glaukon ein, dass ihm wohl wenige Menschen zustimmen würden. Vielmehr sei die Meinung vorherrschend, die Gerech96 tigkeit sei nur als ein Mittelweg entstanden zwischen dem Besten, dem Unrechttun ohne Bestrafung und dem Schlechtesten, dem Unrechterleiden ohne Rachemöglichkeit. In diesem Kontext steht die berühmte Geschichte von Gyges und seinem Ring. Der Hirt Gyges, der bei dem Herrscher von Lydien diente, habe einen Ring entdeckt, der es ihm ermöglichte, unsichtbar zu werden. Dies habe er ausgenützt, um mit der Gattin des Herrschers Ehebruch zu begehen und dem Herrscher aufzulauern, ihn zu töten und die Herrschaft an sich zu ziehen (359cff.). Auf diesen Mythos folgt ein Referat der Meinungen, dass das Leben des vollkommen Ungerechten angenehmer sei als dasjenige des vollkommen Gerechten. Die Dichter lobten das Leben der Gerechtigkeit nur aufgrund seiner angenehmen Folgen. Woraus erklärt Sokrates die Entstehung von Städten? Als nun Sokrates aufgefordert wird, gegen diese Meinungen die Gerechtigkeit als das Bessere zu erweisen, schlägt er den oben kurz erwähnten methodischen Vorgang vor, auf die größeren Buchstaben hinzublicken (368d). Diese sind im Kontext der Gerechtigkeit die Staaten und die dort anzutreffende Gerechtigkeit. So erwägt Sokrates die Möglichkeit, dass sie, die Unterredner, im Logos eine Polis in ihrem Entstehen betrachten und dadurch ihre Gerechtigkeit sehen könnten (369a). Hier ist also der Ausgangspunkt für das groß angelegte Entwerfen einer Stadt im Logos. Bemerkenswert ist die sogleich von Sokrates ausgeführte Stadtentstehungstheorie, die an die Politik des Aristoteles erinnert und die in modern anmutender Weise die Arbeitsteiligkeit mitbedenkt sowie die Entartung des Gemeinschaftswesen und die daraus resultierenden Zwänge bespricht. Eine Stadt entwickle sich, so Sokrates, weil keiner von uns autark, selbstgenügsam sei, sondern vieler Dinge bedürfe (369b). Sokrates geht hier gewissermaßen die Bedürfnispyramide durch. Zumindest brauche die Stadt Bauern, Schneider, Schuster und Baumeister. Er entwirft dann das Bild eines sehr schlichten Gemeinschaftslebens. Darauf erwidert Glaukon, dass Sokrates die Menschen als ohne „Zukost“ gespeiste entworfen zu haben scheint. Jetzt beginnen sozusagen die Probleme für das Gemeinwesen. Sokrates pflichtet Glaukon bei und meint, dass die Leute wohl auch noch Salz, Oliven, Zwiebel etc. haben wollen (372c), und entwirft dann ein idyllisches Bild von einem Dorfleben à la Breugel. Da sagt der urbane Glaukon zu ihm, eine Stadt der Schweine hätte er wohl nicht anders eingerichtet (372d, die „Stadt der Schweine“ ist ein vormals bekanntes Diktum, das zum Beispiel der Nobelpreisträger Theodor MOMMSEN einmal einem italienischen Stadtvater an den Kopf geworfen haben 97 soll).52 Glaukon will darauf hinaus, dass die Menschen auch Luxusgüter werden haben wollen, feine Pölster (sowie Zigaretten und Sportwägen). Sokrates nimmt dies insofern auf, als er sagt, dass sie also die „schwelgende“ Stadt betrachten müssten (372e). Das hier verwendete Wort tryphán (‚schwelgen‘) ist schon im ersten Dialog, dem Euthyphron anzutreffen (11e). Es hat bei Platon oft pejorativen Beigeschmack und bezeichnet die aufgrund einer gewissen Üppigkeit erreichte Trägheit und den Unwillen bzw. die Unfähigkeit, sich mit etwas genauer auseinander zu setzen. Die wahre und gesunde Stadt sei für Sokrates die von ihm beschriebene, die schwelgende mache einen größeren Handel erforderlich, dieser wiederum Kriegsführung. Dieser üppigen Stadt nämlich werde ihre chóra, ihr Raum zu klein werden, sie werde über ihn hinausschreiten und Krieg führen (373d-e). Sokrates behauptet, hierin die Ursache für die Entstehung des Krieges gefunden zu haben. Das Folgenschwere dieser Auffindung des Kriegsgrundes ist, dass damit die Annahme einer eigenen Kriegerkaste einhergeht. Dies ist so folgenreich, weil weite Strecken des folgenden Gespräches sich darum drehen werden, wie diese Krieger auszubilden seien. Dabei tragen im Folgenden die Krieger den Namen phýlakes, „Wächter“. Ihr Ergon, ihre Funktion im Staat müsse die sein, möglichst viel Muße zu haben, um sich ihrem Handwerk widmen zu können. Auf der anderen Seite ist es das Ergon des Sokrates und seiner Gesprächspartner, welche im Logos einen Staat erstehen lassen, auszuwählen, wer die geeignetsten Wächter sind (374d-e). Bei der Erwägung der Auswahlkriterien fällt zum ersten Mal eines der Wörter für die drei Seelenteile, deren Angabe späterhin so charakteristisch wird nicht nur für das Gespräch der Politeia, sondern auch für die nachfolgende Erzählung im Timaios. Die Seele der Wächter müsse thymoeidés sein (375a-b). Dieses hier unscheinbar eingeführte Wort ist zergliederbar in die Wörter thymós und eídos. Der thymós bezeichnet, worauf wiederholt hingewiesen wird, in etwa dasjenige, was in der mittelhochdeutschen Dichtung muot genannt wird. Er ist vielleicht als das unmateriellere Pendant zu den Lungen zu fassen, dasjenige, was bei einer Zornesregung zum Aufwallen kommt. Viel zu schaffen haben mit dem thymós die homerischen Helden, die ihn nur selten bezwingen können. Das thymoeidés, das ‚thymós-Gestaltige‘ ist die (körperlich gesehen) mittlere der drei Regungen der Psyche: Unter ihr ist das epithymetikón, über ihr das logistikón. Ersteres ist für die Begierden zuständig, die sich auf Ernährung und Fortpflanzung beziehen, letzteres für das auf den Logos gestützte Abwägen. In der Politeia 52 Als der bejahrte Mommsen mit seinem Schwiegersohn Ulrich von WILAMOWITZ-MOELLENDORFF ein zweites Mal nach Venosa, der Heimatstadt des Horaz, kam und feststellen musste, dass eine Inschrift verloren gegangen war, soll er zum Bürgermeister gesagt haben: „Voi dicete che siete la patria del Orazio, ma siete la patria dei porci“ (vgl. P. Levi, Horace. A Life, London 2001, 8). 98 werden mit diesen drei Teilen die drei Hauptstände des Staates parallelisiert, im Timaios werden sie bei der Beschreibung, wie der menschliche Leib entstanden ist, körperlich verortet. Dies wurde vorausblickend gesagt, um anzudeuten, dass mit dem Wächterstand nicht der höchste Stand erreicht wird. Über ihm wird der Gerechtigkeits-Konzeption der Politeia zufolge noch ein weiterer Stand zu stehen kommen, dem die Aufsicht über den Bereich des thymoeidés anvertraut ist. Bereits hier im zweiten Buch fragt Sokrates, ob die Wächter auch philosophisch seien sollten. Jedenfalls ist der Teil des thymoeidés in der Psyche für die Abwehr zuständig, die Wächter dem gemäß für die Verteidigung der Stadt. In der Politeia nimmt nun Sokrates die Erziehung dieser Wächter im Logos vor (376d). Hier folgen die viel diskutierten Aussagen Platos über das musische Hauptbildungsmittel der Hellenen, über die Dichter, allen voran Homer. Auf eine aktuelle Darstellung dieser vermeintlichen Dichterkritik wurde bereits hingewiesen (Büttner). Zunächst müsse man den Mythenmachern (377b) vorstehen und sie von manchen Verfehlungen abhalten. So sei es zum Beispiel verfehlt, zu dichten, dass von den Göttern Schlechtes kommt, wie dies Homer Achilleus im letzten Gesang der Ilias in seiner berühmten Erzählung über die Fässer auf der Schwelle des Zeus tun lässt (379d; vgl. Homer, Ilias XXIV, 527 ff. Vielmehr sei darüber zu dichten, dass der Gott und das Göttliche sich in jeder Hinsicht in der besten Weise verhalte (381b). Des Weiteren dürfen Tod und Unterwelt nicht als entsetzlich dargestellt werden. Hier wird vor allem die Figur des Achill thematisiert, die wir bereits eingangs als Gegenfigur zum Philosophenhelden Sokrates betrachteten. Was die formelle Gestaltung der Musik betrifft, so seien nur bestimmte Darstellungsformen und Tonarten sowie Rhythmen zulässig. Diese ausführliche Auseinandersetzung mit der Musenkunst in der Politeia liegt in der Ansicht begründet, dass in dieser Musenkunst die wirkungsvollste Ernährung zu finden sei. Sie würde mit ihren Harmonien in die Seele eindringen. Hierbei ist zu erinnern, was eingangs über die Philosophie als die höchste Musenkunst gesagt wurde. Diese liegt auch hier in der Luft als eine der Musenarten. Denn Sokrates sagt, dass sie selbst, die Gesprächsführer, nicht eher mousikoí, Musiker, sein würden, als sie die Gattungen der Tapferkeit, Besonnenheit, Großherzigkeit und der damit verwandten Dinge erkannt haben (402b-c). Nach der Musik wird die Gymnastik, die Leibesübung betrachtet und erwogen, welche héxis, welcher ‚Zustand‘ oder welche ‚Haltung‘ des Leibes für die Wächter am passendsten wäre (404a). Auch innerhalb des Bereiches der Wächter wird eine Selektion vorgenommen, es werden diejenigen gesucht, die die Anführer der anderen sein sollen. Auszuwählen seien sie nach ihrer 99 Fähigkeit zu Lernen und sich etwas zu merken, nach ihrer Unbeeindruckbarkeit durch den Kampflärm und ähnliches. Die als besten ausgemusterten Wächter würden dann separiert und ein besitzloses Leben in einer eigenen Kommune führen. Sokrates muss sich die Frage des Adeimantos gefallen lassen, ob diese Wächter nicht wie Söldner lebten und ein schlechtes Leben führten. Hier findet sich eine in der Politeia wiederholt anzutreffende Argumentationsfigur: Die Einrichtung des Staates würde nicht so getroffen werden, dass ein einzelner Stand möglichst große eudaimonía (Glückseligkeit) erreiche, sondern die ganze Stadt (vgl. 420b). Die Wächter und ihre Beschreibung wird mit den Augen und ihrer Ausführung in einer Statue verglichen. Diese würden ebenso wenig in den schönsten Farben gezeichnet (in Purpur), sondern in dem ihrer Funktion entsprechenden Schwarz. Dieser Vergleich der Wächter mit den Augen ist insofern beachtenswert, als im Sonnengleichnis das Auge das Organ der Tätigkeit ist, die das höchste Gut wahrnimmt. Im vierten Buch der Politeia wird dann über die Erziehung neuer Wächtergenerationen gesprochen, die sich vor allem durch ihre Orientierung an fixen Regeln auszeichnet, was auch die Erziehung in den Nomoi kennzeichnet. Anlässlich der Thematisierung der Verschriftlichung von Gesetzen und von philosophischen Schriften war davon schon die Rede. Schon die Kinder sollten, so Sokrates in der Politeia, durch richtiges Musenspiel die Eunomie (die gute gesetzliche Verwaltung) in sich aufnehmen (425a). Dabei würden die Wächter die meisten Einrichtungen selbst in richtiger Weise treffen, wenn ihnen freilich Gott die Bewahrung der Gesetze/Bräuche gewährt (425e). Hier werden die Staatswächter darauf hingewiesen, sich an Apollon und seine Ratschläge zu halten (427b), was erneut den Schutzgott des Sokrates an prominenter Stelle gesondert hervorhebt. Die sog. vier Kardinaltugenden Welche sind die vier aretaí, über die die vollendete Stadt verfügt? In der in dieser Weise eingerichteten Stadt seien die vier bedeutendsten aretaí anzutreffen, von denen in den bisher betrachteten Dialogen wiederholt in aporetischer Weise die Rede war. Den Unterrednern der Politeia scheint es klar, dass die vollendet gute Stadt, welche sie im Logos entworfen haben, weise, tapfer, besonnen und gerecht sei (427e). Damit sind die Adjektive der vier Tugenden genannt, die vor allem über die Vermittlung der Scholastik als die vier „Kardinaltugenden“ bezeichnet werden. Ihre lateinischen Namen lauten: prudentia, 100 fortitudo, temperantia, iustitia.53 Das soll den griechischen Bezeichnungen sophía, andreía, sophrosýne, dikaiosýne entsprechen, deren jeweiliger Zuständigkeitsbereich im vierten Buch der Politeia besprochen wird. Wie wird die Gerechtigkeit in der Politeia bestimmt? Als letzte Tugend wird die Gerechtigkeit durchgenommen. Schon am Anfang ihrer Betrachtung der Tugenden sagt Sokrates zu seinem Gesprächspartner Glaukon, dass es genüge, drei der vier zu bestimmen, die vierte wäre dann das Übrigbleibende (428a). Als sie dann drei Tugenden besprochen haben, fordert Sokrates seinen Mitstreiter im Gespräch auf, ebenso sorgfältig aufzupassen, wie Jäger mit Hunden ein Gebüsch umstellen. Die Gerechtigkeit sei nämlich dunkel und schwer zu fassen – ihre Opazität wird hier mit dem selben Wort bezeichnet, mit dem der „dunkle“ Heraklit mitunter charakterisiert wird: skoteinós (432c).54 Dann macht Sokrates darauf aufmerksam, dass ihnen die Gerechtigkeit schon lange „vor den Füßen herumrollt“ und es ihnen wie denen geht, die etwas in Händen halten und es trotzdem suchen (432d-e) – das Näheste ist uns oft das Fernste (M. Heidegger).55 Die Gerechtigkeit sei ihnen nahe gewesen von Anbeginn ihres Stadtentwurfes, insofern sie wiederholt festsetzten, dass jeder einzelne eine Tätigkeit für die Stadt verrichten solle. Somit könne man die Gerechtigkeit bestimmen als „das Seine tun und nicht viele Geschäfte treiben“ (433a). Nach einer Abwägung, welche die nutzbringendste Tugend sei und nach einer kurzen Besprechung der Gegensätze zu den Tugenden ist für Sokrates nun der Augenblick gekommen, wo er das an der entworfenen Stadt als den größeren Buchstaben Betrachtete auf den einzelnen Menschen bezieht. Es wird von den drei Seelenteilen gehandelt, die oben bereits erwähnt wurden. (Hier ist auch eine Formulierung des so genannten Satzes vom Widerspruch anzutreffen (436b ff.), für den vor allem das vierte Buch der Metaphysik des Aristoteles berühmt ist.) Zunächst werden als Wechselspieler das logistikón und das epithymetikón bestimmt (als Beispiel wird der Durst gebracht, dessen Stillung, auf die das epithymetikón aus ist, manchmal das logistikón untersagt), als dritter Seelenteil wird der mittlere, das thymoeidés namhaft gemacht. Dabei wird auf die orgé referiert, den Zorn oder das Rasen, der oftmals dem logistikón widerstrebe (440a), nicht nur bei homerischen Helden, sondern auch bei Volksmassen, wie 53 Vgl. J. Pieper, Das Viergespann: Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß, 42.-43. Tsd., München 1998. Herákleitos ho skoteinós „Heraklit der Dunkle“, so wird Heraklit des Öfteren in der Antike genannt, z. B. bei Aristoteles, De mundo, 396b20. Vgl. dazu M. Heidegger, Heraklit. Der Anfang des abendländischen Denkens. Logik. Heraklits Lehre vom Logos, Frankfurt a. M. 1994 (Gesamtausgabe Bd. 55), 19. 55 Vgl. z. B. M. Heidegger, Grundfragen der Philosophie, 2. Aufl., Frankfurt a. M. 1992 (Gesamtausgabe Bd. 45), 82. 54 101 die bei Thukydides beschrieben ist. Die Gerechtigkeit des Einzelnen bestehe dann in der richtigen Ordnung dieser Seelenteile (443d-e). Frauen und Kinder im Staat Von dieser Zusammenschau von gerecht eingerichtetem Staat und gerecht eingerichtetem Individuum will Sokrates am Beginn des fünften Buches der Politeia übergehen zur Darstellung der Verfallsformen der idealen Polis. Hier bringt der vom Anfang der Politeia bekannte Polemarchos ein retardierendes Moment herein. Er mahnt nämlich an, Sokrates möge sich deutlicher über dasjenige äußern, was er zuvor nur so obenhin über die Frauen und Kinder im Staat gesagt habe, dass sie den Freunden gemeinsam wären. Dies ist eine von zwei großen Retardationen in der Politeia. Die zweite wird darin bestehen, dass sich Sokrates der Frage stellen muss, ob der entworfene Staat tatsächlich möglich sei. Sokrates wird später diese an ihn herangebrachten Fragen mit Wogen vergleichen, die ihn zu ertränken drohen und die er in seinem Logos bewältigen muss. Die zweitere Frage wird ihn zu den zentralen Gleichnissen führen. Erst nach diesen wird er zum Thema der Verfallsformen des idealen Staates zurückkehren. Es folgen die berühmten Stellen über die aufgabenmäßige Gleichstellung der Frauen und über die Kindergemeinschaft. Ungeachtet ihrer anders gearteten Körperbeschaffenheit sollten die Frauen die gleichen Aufgaben im Staat übernehmen und auch in den Wächterstand aufgenommen werden. Was die Kinderzeugung und -erziehung im Wächterstand betreffe, so wäre es von Vorteil, wenn sich jeder als Elternteil aller Kinder der nächsten Generation erachte, weil so die größtmögliche Einheit des Staates gewährleistet wäre. Anzumerken ist hier, dass es sich wiederum um Sokrates’ Idealentwurf handelt, der um willen der Sicht der Gerechtigkeit vorgenommen wird. In den Nomoi, die von einer tatsächlich anstehenden Polis-Gründung ausgehen, wird sehr wohl von einer herkömmlichen Eheverbindung ausgegangen, wenngleich die Knüpfung und Führung eines Ehebundes stark ins Licht der Öffentlichkeit gerückt wird. Es folgen in der Politeia einige Ausführungen über Belohnung und Bestrafung tapferer und schlechter Wächter und über die Weise der Kriegsführung. Die Möglichkeit des entworfenen Staates Dann kommt es zu der oben angesprochenen zweiten großen Verzögerung des Gesprächsganges, wie ihn Sokrates avisiert hatte. Denn nochmals macht Glaukon Sokrates darauf aufmerk102 sam, dass er sich der Frage zuwenden sollte, die er zunächst noch weggeschoben habe, ob eine solche Polis möglich sei (471c). Hier bringt Sokrates das maritime Bild von den verschiedenen Wogen. Sokrates wirft Glaukon vor, dass er „plötzlich“ einen Angriff auf seinen Logos gemacht habe. (Dieses „plötzlich“ ist übrigens durch das gleiche exaíphnes ausgedrückt (472a), das im Symposion das plötzliche Erreichen des Gipfels des erotischen Aufstiegs sowie das Eintreffen des Alkibiades signalisiert (s. o.).) Er, Glaukon wisse vielleicht nicht, dass er ihm, nachdem er mit Mühe zwei Wogen entflohen sei, nun den größten und schwierigsten Teil der dritten Woge aufhalse (472a). Tatsächlich führt dieser „plötzlich“ eintretende Angriff des Glaukon auf den Logos des Sokrates dazu, dass sich Sokrates dem Zentrum der platonischen Philosophie zuwendet, dem höchsten Lerngegenstand, wenngleich, wie er sagt, er im Rahmen des gegenwärtigen Gesprächs nur eine Kurzversion dieses Lehrstückes präsentieren kann. Nochmals erwähnt Sokrates die eigentliche Zwecksetzung ihres Staatsentwurfes. Sie unternahmen diesen um ein parádeigma, ein ‚Muster‘ aufzustellen, auf das hinblickend sie feststellen könnten, wie ein Gerechter beschaffen sei und wie es sich mit seiner Glückseligkeit verhalte. Dabei seien sie nicht von der Bemühung geleitet gewesen aufzuzeigen, dass eine solche Polis möglich sei (472c-d). Sokrates lässt sich von Glaukon darin zustimmen, dass die tatsächliche Ausführung weniger die Wahrheit berührt als die Beschreibung (473a). Dennoch will Sokrates zu bestimmen versuchen, aufgrund welchen Mangels zur Zeit die Städte schlecht verwaltet würden. Hier kommt er auf den legendären Philosophen-König-Satz zu sprechen. Dieser Philosophen-König-Satz ist die größte Woge, die Sokrates zuvor angesprochen hatte. Denn der Satz birgt die Gefahr, dass man, wenn man ihn ausspricht, in einer Woge von Gelächter untergeht. Denn Sokrates wagt zu behaupten, dass nur, wenn die Philosophen als Könige herrschen oder wenn diejenigen, die nun Könige und Herrscher genannt werden, in eigentlicher und hinreichender Weise philosophieren, dass nur dann ein Ende der Übel eintreten und die entworfene Stadt existieren könne (473c ff.). Um sich gegen die Angreifer dieses Satzes zu wappnen, muss Sokrates genauer in Erinnerung rufen, wie eigentlich die wahren Philosophen beschaffen sind. Es folgt jetzt nicht nur eine Beschreibung der Philosophen, sondern auch eine Begründung, warum gegenwärtig die Philosophie so wenig geachtet sei. Die wahren Philosophen werden von den phíl-oinoi (475a), den philo-theámones und den phil-ékooi abgehoben, den ‚Weinliebenden‘ (475d), ‚Schauliebenden‘ und ‚Hörliebenden‘, wobei offenkundig ein Wortspiel mit 103 dem damals noch jungen Wort philó-sophoi (die ‚Weisheitsliebenden‘) vorliegt.56 Diese, die Philosophen, unterschieden sich von den anderen Liebhabern dadurch, dass sie die Dinge selbst gemäß sich selbst zu betrachten fähig sind, während sich die übrigen nur für die vielen Instanzen interessierten, welche an diesen Dingen selbst Anteil hätten. Freilich seien diese Philosophen selten, aber nur sie seien imstande, wirklich zu leben, während die anderen ihr Leben wie im Traum zubrächten (476bff.). Der wahre Philosoph zeichne sich darüber hinaus dadurch aus, dass er von Jugend an auf die gesamte Wahrheit Appetit habe, sich nach ihr „ausstrecke“. Seine Lust sei die Lust der Psyche, nicht die des Soma, des Leibes (485d). Um diese Ansicht aber gegen die geläufige Meinung zu verteidigen, dass die berufsmäßigen Philosophen (welche über ihre Jungendzeit hinaus Philosophie betreiben) überaus üble Leute und gänzlich unnütz für die Gemeinschaft seien, muss Sokrates ein aus mehreren Elementen gemischtes Bild vorbringen. Dies vergleicht er mit Bildkreationen wie dem Bockhirschen, dem tragélaphos (488a), der bei Aristoteles wiederholt das Beispiel für etwas nicht Seiendes ist.57 Die erste Bildkreation, die Sokrates vorbringt, ist diejenige vom Schiff. Man solle ein Schiff imaginieren, dessen Schiffsherr die anderen überrage, aber schlecht sieht und hört. Diesen würden verschiedene der Schiffer, die sich um das Kommando stritten, betrunken machen und sich selbst der Herrschaft über das Schiff bemächtigen. So sei es auch mit den Städten. (Hier kann man einen ersten Vorblick nehmen auf die ausführliche Schilderung der Abfolge von Staatsformen in den Büchern acht und neun, wo gezeigt wird, welche Personengruppen um die Macht rivalisieren.) Dass die Philosophen nicht angesehen seien, liege in einer Umkehrung der Beweislast. Es ginge nicht an, dass die Philosophen an den Türen derer, die vernünftig regiert werden wollen, klopfen müssten. Vielmehr sollten sich letztere an die Philosophen wenden, so wie die Kranken von sich aus den Arzt aufsuchen. Sokrates unternimmt es dann zu bestimmen, warum philosophische Menschen leicht verdorben würden und sich nur selten retten könnten. Hier fühlt man sich stark an Alkibiades erinnert (vgl. v. a. 494c-d), der uns schon öfters in den Dialogen begegnet ist. Denn vor allem würden Schönheit, Stärke und Reichtum die philosophisch Begabten verderben (491c), sie 56 Bezüglich des Hauptwortes ‚Philosoph‘ wird diskutiert, inwiefern es von Platon entscheidend geprägt wurde. So ist zwar überliefert, dass Pythagoras sich als erster ‚Philosoph‘ genannt hat, doch wird mitunter die Bezeugung dieser Geschichte durch Herakleides Pontikos so gedeutet, dass dieser sie bereits platonisch überformt habe. In dieser Hinsicht einflussreich war der Aufsatz von W. Burkert, Platon oder Pythagoras? Zum Ursprung des Wortes „Philosophie“, Hermes 88 (1960), 159-177. Eine Übersicht über die Diskussion bietet Ch. Riedweg, Zum Ursprung des Wortes ‚Philosophie‘ oder Pythagoras von Samos als Wortschöpfer, in: A. Bierl - A. Schmitt - A. Willi (Hgg.), Antike Literatur in neuer Deutung (Festschrift für J. Latacz anlässlich seines 70. Geburtstages), München-Leipzig 2004, 147-181. 57 Vgl. Aristot., De int. 16a16, Phys. 208a30, vgl. auch An. pr. 49a24. (Mittlerweile dient freilich der Ausdruck tragelaphus in der Biologie als Bezeichnung einer Gattung der Antilopen.) 104 seien von Jugend an mit hohen Erwartungen seitens der Mitbürger konfrontiert (494b ff.) und sie erführen eine schlechte Erziehung durch Sophisten. In einer solchen Einrichtung der Staaten könne nur eine „göttliche Fügung“, eine theía moíra, die philosophisch Begabten erretten (493a, vgl. 492a). Natürlicherweise bestünde eine Rettung nur dann, wenn der betreffende Philosophiebegabte ein körperliches Gebrechen habe, das ihn hindere, in die Politik zu gehen. Eine andere Rettungsmöglichkeit bestehe, wenn sich einem ein Daimonion einstelle (496b-c). Was ist der höchste Lerngegenstand in der Philosophie? Als dann Sokrates auf die höchsten Lerngegenstände zu sprechen kommt, zu denen die hervorragend zur Philosophie Geeigneten hingeführt werden sollten, erwähnt er erneut, dass zu ihrer vollständigen Erklärung ein längerer Umweg notwendig wäre (504b). Auch jetzt genügt es den Zuhörern wieder, dass Sokrates in der Weise über die Idee des Guten spricht, in der er über die Gerechtigkeit gesprochen hat (506d). Man gelangt nun zu der berühmten Stelle, an der Sokrates davon spricht, dass er die Frage, was das Gute selbst eigentlich ist, lassen will. Vielmehr wolle er den Zuhörern nur einen „Spross des Guten“ schildern (506d-e). Damit befindet man sich am Eingang einer Kette von drei Gleichnissen.58 Das erste ist das Sonnengleichnis, welches gefolgt wird von dem so genannten Liniengleichnis. Den Abschluss bildet das bekannte Höhlengleichnis. Das Sonnengleichnis Das Sonnengleichnis liefert ein Vorstellungsbild für das Verhältnis der Idee des Guten zum Erkennenden. Begonnen wird mit dem Sehvermögen, welches, um sehen zu können, etwas benötigt, nämlich das Licht. Dieses wiederum kommt klärlich von der Sonne. Nun erhellt aus dieser Kette, dass das Auge, das Sehvermögen, das Gesehene und die Lichtquelle nicht dasselbe sind. Immerhin wird jedoch das Auge als Organ des Sehvermögens als das „sonnengestaltigste“ (helioeidéstaton, 508b) der Sinneswerkzeuge bezeichnet. (Die platonische Wortschöpfung des helioeidés wurde übrigens von Plotin aufgenommen und über diese Vermittlung von Goethe rezipiert in seinem berühmten Xenion: „Wär’ nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnt es nie erblicken.“ (Zahme Xenien, 3. Buch).) Sokrates gibt selbst die Auflösung dieses Vergleiches an, dass nämlich die Idee des Guten im noetischen Bereich dasjenige sei, was die Sonne im Bereich des sinnlich Vernehmbaren sei. 58 Einen Überblick über diese Gleichniskette bietet die Einführung von Bormann (o. Anm. ►), 51ff. 105 So wie das Sonnenlicht die Sichtbarkeit des Gesehenen garantiert, „reicht“ die Idee des Guten „die Wahrheit dar“ (508e). Wofür sich die Sonne als Vergleichspunkt auch eignet, ist zu zeigen, dass nicht nur das Erkennen der Sonne bzw. der Idee des Guten verdankt wird, sondern das Sein überhaupt. Das Sein (eínai) und die ousía, die Seiendheit, sei anwesend bei dem Erkannten aufgrund des Guten, welches „jenseits des Sein“ stünde. Dies ist die vielleicht berühmteste Formulierung aus der Politeia, die beispielsweise den Titel eines Werkes von Emmanuel LÉVINAS bildet.59 Worum handelt es sich bei den vier Abschnitten der Linie des Liniengleichnisses? Wesentlich umstrittener ist in der Platonphilologie die konkrete Deutung des Liniengleichnisses, welches auf das Sonnengleichnis folgt. Hier werden verschiedene ontologische Ebenen vier Abschnitten einer Linie zugeordnet. Wie die Konstruktionsangaben, die Sokrates für diese Linie macht, genau zu verstehen seien, wird häufig diskutiert.60 Es soll nämlich eine Linie vorgestellt werden, die in zwei ungleiche Teile geteilt, die jeweils wieder nach dem selben Verhältnis geteilt sind. Grob gesagt könnte man die angegebene Einteilung der Linie so charakterisieren: Der eine der zwei Großteile umfasst den wahrnehmbaren Bereich, der andere den des Denkbaren. Im Bereich des sinnlich Zugänglichen hat man es einerseits mit Schatten und Erscheinungen, andererseits mit den Alltagsdingen zu tun, mit Tieren, Pflanzen und artifiziellen Gegenständen. (Die hier anzutreffenden Formulierungen, wie der Ausdruck der Schatten und Spiegelungen im Wasser (510a), sind nicht unbedeutend für den Vergleich mit dem später kommenden Höhlengleichnis.) Der andere Hauptteil der Linie umfasst das Intellegible, einerseits den Abschnitt, welcher mit Hypothesen arbeitet und andererseits denjenigen, welcher ohne Hypothesen auskommen will, der sich mit dem Voraussetzungslosen befasst. In der Kürze, in der Sokrates zunächst diese Unterteilung darstellt, erscheint sie seinem Gesprächspartner nicht verständlich. Sokrates erläutert die Einteilung dann ein wenig ausführlicher so, dass der erste Teil des Bereiches des Intellegiblen mit dem Mathematischen erklärt werden kann. Im Bereich des Mathematischen benutzen die Wissenschaftstreibenden Hypothesen, die sie nicht weiter hinterfragen und für die sie keinen Logos, keine Definition liefern können. Des Weiteren greifen sie auf den vorherliegenden Linienabschnitt, den oberen Bereich des sinnlich Erfassbaren zurück. Also sie sprechen von drei Arten von Winkeln, ohne sie abzuleiten, und verwenden Anschauungsbilder in sinnlich erfassbarer Gestalt. Der obere Teil des Intellegiblen dagegen 59 60 Vgl. Autrement qu’ être ou au-delà de l’essence („Jenseits des Seins“, Le Haye 1974). Vgl. z. B. Wieland, Platon und die Formen des Wissens, 201ff. 106 ist der, mit dem sich die Dialektik befasst, wo die Hypothesen als Hypothesen erfasst (511b) und als Aufstiegshilfen benutzt werden, bis man zu etwas Unvorausgesetztem kommt. (Hier trifft man übrigens mit dem Wort, das ich als „Aufstiegshilfe“ übersetzt habe, auf ein ähnliches Wort wie am Ausgang des Aufstiegs à la Diotima: In der Politeia ist von epibáseis (511b) die Rede, Diotima spricht von epanabasmoí, die zur Erkenntnis des Höchsten führten (symp. 211c). Gemeinsam mit Glaukon, der das Gleichnis noch nicht genau versteht (vgl. 511c f.), aber es in eigenen Worten grob umreißen will, könnte man diese Viergliederung ungefähr so erfassen: Es gibt vier ontologische Bereiche, denen vier Seelenvermögen entsprechen: Es gibt den Bereich der Schatten, dem so etwas wie die Eikasia, das Abbildvermögen entspricht, dann den Bereich der Alltagsgegenstände, dem die Pistis, das Vertrauen entspricht, dann gibt es den Bereich der mathematischen Entitäten, der mit der Dianoia, dem „Durchdenken“ erfasst wird, und schließlich den Bereich des Denkbaren, dem der noús, die Vernunft entspricht. Die übergeordnete Zweiteilung der Linie kann man mit den Wörtern dóxa und nóesis bezeichnen (zu diesen sechs Termini vgl. auch im siebenten Buch 533e f.). Eine schematische Übersicht über die vorzustellende Linie findet sich in der Platoneinführung von Karl Bormann (o. Anm. ►, 56). Wohlgemerkt ist dies nur eine vereinfachende Sicht des Liniengleichnisses. Es ist nicht nur jedem Abschnitt der Linie ein Gegenstandsbereich zuzuordnen und dem wieder eine Wissensform. Vielmehr sind die Bereiche untereinander verwoben. So kann man nur etwas meinen, von dem man auch noetisch etwas erfasst. Worauf aber vielleicht das Ganze hinauslaufen soll, ist, dass durch die Linie angedeutet werden soll, dass man eine Übersicht über die Erkenntnisformen bekommen kann und man dann erfasst, dass das, was man für echt genommen hat, „nur“ ein Abbild war. Diese Deutung würde auch den Weg zum Höhlengleichnis bahnen, wo der Aufstieg explizit angesprochen ist. Höhlengleichnis Jedenfalls wird im Höhlengleichnis deutlich, dass es den in der Höhle Angefesselten, die sich nicht umdrehen können, nicht leicht möglich ist, die Abbilder, die sie an der Projektionswand vor ihnen betrachten, als Abbilder zu erkennen. Sie müssen erst mit einiger Mühe aus ihrer Haltung befreit werden. Ich kann mir hier ersparen, darüber mehr zu erläutern, da sie dieses Gleichnis aus anderem Zusammenhang zur Genüge kennen. Interessant ist, wie gesagt, der sprachliche Vergleich mit dem Liniengleichnis, die Doppelung des Ausdruckes „Schatten“ 107 (515a, 516a). Zunächst sehen die Angebundenen nur die Schatten der Holzgegenstände hinter ihrem Rücken. Wenn sie dann den steilen Weg nach oben geführt werden, sind sie geblendet und können zunächst an der Oberfläche am besten die Schatten erkennen. Bemerkenswert ist, worauf schon am Anfang verwiesen wurde, dass diejenigen, die den Höhepunkt des Aufstiegs erreicht haben, nicht dort gelassen werden dürfen. Freilich würden diese ihren Zustand für den besten halten und sich wie auf den „Inseln der Seligen“ fühlen. Sie hielten es mit Achill, der lieber an der Oberwelt ein Sauhirt bei einem armen Bauern sein möchte als Herrscher über alle Seelen in der Unterwelt (vgl. 516d). Doch diese an die Oberfläche der Höhle Gelangten müssten dazu angehalten werden, wieder in selbige abzusteigen und andere aus der Höhle zu holen. Aus diesem erneuten Aufenthalt in der Höhle resultiere, dass die Augen wieder Probleme bekommen. Beim Aufstieg konnten sie sich nur allmählich an die Helle anpassen, beim Abstieg müssen sie sich mühsam in das Dunkel eingewöhnen. Deshalb gäbe es auch zweierlei Verwirrungen der Augen und der Seelen, wie Sokrates in der Deutung des Höhlengleichnisses sagt (518a). Verwirrt seien die Augen der Aufsteigenden und ebenso der Absteigenden. Deshalb dürfe man nicht alle auslachen für ihre Verwirrung, vielmehr solle man fragen, woher sie kommen. Die Techne der Erziehung der Psyche in der Politeia Der Hauptgehalt der Interpretation des Höhlengleichnisses durch Sokrates ist, so könnte man abkürzend sagen, dass durch die Techne der Erziehung zum Philosophen eine „Umwendung“ der Seele bewirkt werden soll. Das entsprechende griechische Wort lautet periagogé, es ist im Anschluss an das Höhlengleichnis wiederholt zu lesen (518d, e, 521c). Ein wichtiges Wortpaar, das in diesem Zusammenhang und in mehreren Dialogen anzutreffen ist, ist das von hýpar und ónar, von „Wachen“ und „Traum“ (520c, vgl. 533c). Diejenigen, die nach erfolgter Umwendung der Seele in die Höhle hinabstiegen und die dortigen Bilder auf ihren wahren Gehalt hin durchblickten, würden bewirken, dass der Staat wachend und nicht schlafend verwaltet würde. (Zu dem Wortpaar können Sie übrigens die griechische Inschrift auf einer Seite des Sockels der Sitzstatue im Hof des Hauptgebäudes der Universität vergleichen.) In welche Wissenschaften der zukünftige Philosophenkönig eingeführt werden soll. Sokrates geht in weiterer Folge mit seinen Gesprächspartnern überblicksartig einige Wissenschaften durch, die der ideale Philosoph erlernen soll. Hierin kann man einen wichtigen 108 Grundtext für die nachmalige Ausbildung der artes liberales, der so genannten Freien Künste sehen.61 Die von Sokrates angesprochenen Wissenschaften wie die Arithmetik, Geometrie, Astronomie sollen so betrieben werden, dass sie zur Ousia „hinziehen“ (vgl. 523a) und das Vernunftdenken zur Betrachtung anregen. Alles wird daraufhin abgeklopft, ob es dazu beiträgt, „leichter die Idee des Guten zu erschauen“ (526e), und die Seele von den Dingen „hier nach dort“ führt – enthénde ekeíse (529a, vgl. 619e). Diese Wissenschaften sind allesamt Vorübungen zur Dialektik. Hier sind wir wieder bei derjenigen Kunst angelangt, in die wir schon im Sophistes und im Politikos einen Einblick erhielten. Sokrates bespricht in der Politeia wiederum die Großartigkeit der Dialektik, benennt aber zugleich die Gefahren einer schlechten Dialektik. Als er endlich diesen Höhepunkt der Erziehung durch besprochen hat, kann er zu seinem eigentlichen Thema zurückkehren, zu den schlechten Staatsformen. Wie man sich erinnert, wurde Sokrates von seinem eigentlichen Gesprächspfad dadurch abgebracht, dass er nach den Frauen und Kindern in der Polis sowie nach der Durchführbarkeit des Polis-Entwurfs gefragt wurde. Welche Staatsformen folgen dem Schema der Politeia nach auf die Aristokratie? Die fünf Grundtypen an Staatsformen, die Sokrates benennt, sind die Aristokratie, die Timokratie, die Oligarchie, die Demokratie und die Tyrannis. Sokrates macht dann in einem Entwicklungsschema plausibel, wie sich die eine Form aus der anderen entwickelt. Was Sokrates hier beschreibt, könnte man im weitesten Sinn als psychologische Studie bezeichnen. Er beschreibt beispielsweise die Gesinnung der Kinder von Aristokraten, die sehen, dass das edelmütige Verhalten ihrer Eltern nichts einbringe, und die deshalb nach einer anderen Regierungsform trachten. Dies kann hier nicht ausführlich nacherzählt werden. Besonders zur Lektüre zu empfehlen ist die Beschreibung der Entstehung der Tyrannis aus der Demokratie (562a ff.). Ausschlaggebend für die Verschlechterung der Aristokratie ist übrigens das Werden, das notwendigerweise immer Veränderungen mit sich bringe. So könnten die Wächter des Staates nicht immer die richtige Zeugung von neuen Menschen nach der so genannten „Hochzeitszahl“ gewährleisten (546a ff.). Die Auflistung der Herrschaftsformen läuft auf die Schilderung des tyrannischen Menschen hinaus. An ihm wird aufgezeigt, wie sehr unglücklicher er ist als der vernunftorientiert lebende Mensch. Auch hier ist ein Kriterium dafür, ob jemand glücklich oder unglücklich zu nennen ist, das Vermögen, zwischen guten und schlechten Lüsten unterscheiden zu können. 61 Vgl. zur Entwicklung und zur Verdrängung der artes liberales G. Radke, Die Theorie der Zahl im Platonismus. Ein systematisches Lehrbuch, Tübingen u. a. 2003. 109 Schließlich wird errechnet, dass der Philosophenkönig 729mal lustvoller lebt als der Tyrann (32∙32∙32, vgl. rep. 587e). Am Schluss des neunten Buches wird dann der Kreis geschlossen zum Eingangsbuch und der Diskussion mit Thrasymachos. Sokrates meint nun gezeigt zu haben, dass es zum beiderseitigen Nutzen ein Herrschaftsverhältnis zwischen Besserem und Schlechterem, sowohl im Staat wie im Individuum, geben kann (590d). Das zehnte Buch Die Entfernung von der Wahrheit Den Schluss der Politeia bildet (wie den Schluss mehrerer Dialoge) ein Mythos. Im Fall der Politeia ist der Mythos besonders ausgestaltet, er bringt eine ausführliche Schau der Seelenreise nach dem Tod. Bekannt ist dieser Mythos auch für seine pythagoreischen Motive. Vor dem Mythos erfolgt erneut eine Beschäftigung mit der Dichtung. Sokrates bedauert, dass man Homer aus der entworfenen Stadt irgendwie fernhalten müsste. Er sagt, dass er froh wäre, wenn jemand käme, der zeigen könnte, warum man Homer, den er seit seiner Jugend liebgewonnenen habe (595b), doch zulassen dürfe (607c). Philosophiegeschichtlich bekannt ist dieses zehnte und letzte Buch der Politeia auch aufgrund der mit der Problematisierung der Dichtung verbundenen Erläuterung der Wahrheitsabstufung. Diese Stufung geht von der im Bereich des Göttlichen angesiedelten Ideenproduktion über zur ideenorientierten Produktion und endet bei der an dem Einzelding orientierten Produktion. Ausgangspunkt dieser Beschreibung ist die Betrachtung der Mimesis, der Nachahmung (595c). (Dieser Terminus ist übrigens zentral für die Poetik des Aristoteles (vgl. z. B. Kap. 1, 1447a16).) In der Politeia findet sich in diesem Zusammenhang das berühmte Gespräch über die Idee der klíne und der trápeza, der Liege und des Tisches. Ausgegangen wird von dem demiourgós, dem Handwerker, der im Hinblick auf die jeweilige Idee diese Gegenstände, mit denen wir Umgang haben, herstellt (596b). Von diesem wird fortgeschritten zu dem weitaus wunderlicheren Handwerker, der die Ideen selbst hervorbringt, aber nicht nur die von Artifiziellem wie von Tischen und Liegen, sondern auch die Ideen von Pflanzen und Lebewesen (c). Freilich gibt es noch einen dritten Typus von Herstellern, nämlich die nachahmenden Hervorbringer wie die Maler. Daraus resultierten drei Grade von Wahrheit: Den höchsten vertrete der Gott, der die Ideen hervorbringt (597b), den nächsten der Handwerker und den dritten der Nachahmer, der mimetés (597e). Dieser mimetés ist der dritte von der Wahrheit aus gesehen. Daraus resultiere, 110 dass die Dichter keine genaue Kenntnis der Lüste hätten und somit nicht zur Erziehung geeignet seien. Die Erzählung des Er Eine bildliche Demonstration, warum das Gerechtsein nützlich sein kann, bringt die abschließende Erzählung des Pamphyliers Er. Dieser war zwölf Tage lang scheintot, und seine Seele erblickte den Kreislauf der Seelen. Diese würden nach ihrer Lösung vom Körper gerichtet und die einen zur Bestrafung in den Hades, die anderen zur Belohnung auf einen Gang durch den Himmel geschickt werden. Pythagoreische Elemente enthält die Schilderung der kompliziert verschachtelten „Spindel der Notwendigkeit“ (616c), die sich in gegenstrebigen Bewegungen im Kreise dreht. Von Bedeutung sei die philosophische Erkenntnis, die man im irdischen Leben gewonnen hat, wenn es nach tausend Jahren (solang verweilten die Seelen an dem anderen Ort, um alle Verfehlungen zehnfach zu büßen oder die Wohltaten zehnfach vergolten zu bekommen) darum gehe, wieder in einen Körper einzutreten. Die Seelen könnten dann nämlich wählen, welche Lebensweise sie gerne „im nächsten Umlauf des sterblichen Geschlechts“ hätten (617d). Viele Unbesonnene würden sogleich das Leben eines Tyrannen wählen und dann, wenn sie über ihre Wahl nachdenken, diese bereuen. Manche leidgeprüfte Helden würden aufgrund ihrer Abneigung gegen das Menschengeschlecht das Leben eines Tieres wählen (Aias – Löwe, Agamemnon – Adler). Hier würde sich zeigen, dass sich die Besonnensten das Leben eines Privatmannes wählten, so habe jedenfalls Odysseus gewählt (620b-c). Am Eingang dieser Erzählung spricht Sokrates die schon aus anderen Dialogen bekannte Überzeugung aus, dass derjenige, der sich willig zeige gerecht zu sein und dem Gott ähnlich zu werden so weit es für einen Menschen möglich ist, nicht von den Göttern vernachlässigt werde (613a-b). Die das Gegenteil täten, würden – dies wird in der Erzählung des Er deutlich ausgesprochen – den ewigen Qualen der Unterwelt verfallen. Diese dem Tartaros Verfallenen würden nicht mehr in die Welt zurückgelangen; diese Gruppe bestehe hauptsächlich aus Tyrannen (615d-e). Timaios Schon aus philosophiegeschichtlichen Gründen sollte man den Timaios Platos kennen. Von ihm wird immer wieder gesagt, dass er für lange Zeit das einzige Werk Platons war, welches dem lateinischen Abendland genauer bekannt war. Dies liegt darin begründet, dass ein gewis111 ser CHALCIDIUS den ersten Teil dieses Dialogs ins Lateinische übersetzte (bis 53c). Dieser Dialog war für die mittelalterliche christliche Theologie und Philosophie von besonderem Interesse, weil in ihm etwas erzählt wird, was man im weitesten Sinn mit einer Schöpfungsgeschichte vergleichen kann.62 Man kann das Gespräch, welches der Timaios darstellt, unmittelbar auf die Politeia folgen lassen. Jedenfalls zählt an seinem Anfang Sokrates die Anwesenden ab und stellt fest, dass einer der gestrigen Festgäste nicht da ist (17a). In weiterer Folge soll das Geschehen des Vortages umgedreht werden. Nachdem Sokrates ausführlich eine Polis entworfen hatte, soll nun er im Gegenzug durch eine Erzählung darüber bewirtet werden, wie sich diese Polis in Bewegung darstellen würde (vgl. 19b-c). Hier erwähnt Kritias (ein Vetter Platos), dass er bei seinen Überlegungen, was er Sokrates auftischen könnte, sich an eine Geschichte eines entfernten Vorfahren erinnert habe (ein Verwandter und Vorfahr seines Urgroßvaters Dropides, 20e, vgl. 25e). Dies sei die Geschichte von Solon über das untergegangene Atlantis (25a). Allerdings kommt es im Timaios nicht zur Ausführung dieser Geschichte, die erst der Gegenstand des folgenden Dialogs ist, welcher bezeichnenderweise den Titel Kritias trägt. Im Timaios erzählt Timaios, welcher als Experte in der Astronomie beschrieben wird (27a), darüber, wie man sich die Ordnung der Welt, den Kosmos vorzustellen habe. Dabei ist sein Vorhaben, die Erzählung von dem Werden der Welt, der génesis toú kósmou bis zur Natur des Menschen zu führen (vgl. 27a). Was sind Hauptthemen des Timaios, die in der Philosophiegeschichte besondere Aufnahme fanden? Vor allem drei Punkte des eikós mýthos, der „wahrscheinlichen Erzählung“, welche Timaios vorbringt (vgl. 29d, vgl. 30b: eikós lógos), wollen wir herausgreifen, für welche dieses Werk besonders bekannt ist. Zum einen ist die Rede von dem Demiurgen zu nennen, dem göttlichen „Handwerker“, der den Kosmos ordnete (28a ff.), dann die Erläuterung, warum es so etwas wie Zeit gibt (37e ff.), und schließlich die Einführung von etwas Materieartigem, der Hyle, welche als „Aufnehmerin“ und „Amme“ des Werdens beschrieben wird (49a). (Sehr bekannt aus dem Timaios ist auch die Beschreibung der vollkommenen Körper (53c ff.), die oft als „Platonische Körper“ bezeichnet werden.) Weltkörper und Weltseele 62 Die Rezeption des Timaios dokumentieren beispielsweise die Fresken in der Unterkirche von Anagni südlich von Rom. 112 Die wahrscheinliche Erzählung des Timaios setzt damit ein, dass er sagt, der Errichter des Alls sei gut gewesen und für den Guten gäbe es keinen Neid (phthónos, 29e). Damit bezieht Timaios sozusagen Stellung gegen die Ansicht vom phthónos theón, gegen die Meinung, die Götter könnten neidisch sein. Der Errichter des Alls wollte, dass alles ihm möglichst ähnlich werde. Das sei der Grund gewesen, warum er den sichtbaren Bereich „übernahm“ (paralabón), welcher sich in ungeregelter Bewegung befunden hätte, und ihn in einen Zustand der Ordnung gebracht habe (30a). Schon diese Stelle kann man als Beleg dafür nehmen, dass dieser Gott kein schöpfender im christlichen Sinne ist, weil er nicht ex nihilo etwas hervorbringt, sondern etwas übernimmt. Des Weiteren ist am Beginn dieser Erzählung ausgesprochen, dass der Errichter des Kosmos diesen mit einer Seele versehen hat. Ihm sei erschienen, dass nie etwas Ungeistiges schöner sein könne als etwas, das Geist hat. Da aber Geist nur durch eine Seele einer Sache zukommen könne, habe er das All mit einer Seele versehen (30a-b).63 Des Weiteren erzählt Timaios über den Weltkörper. Da jedes Körperhafte sichtbar und fühlbar sei, und da nichts sichtbar sei ohne Feuer und nicht fühlbar ohne Festes, und letzteres nicht ohne Erde möglich sei, so bestünde der Weltkörper aus Feuer und Erde. Diese beiden Bestandteile wiederum seien nur dann in schöner Weise verbindbar, wenn sie durch eine Fessel (desmós, lat. vinculum) zusammengehalten würden. Diese Fessel, welche die schönste Verbindung zustande bringen könnte, sei die analogía, die Proportion. Diese wiederum müsse beim Kosmos, der keine Fläche, sondern ein Festkörper sei, durch zwei Mitten gebildet werden. So habe der Gott in die Mitte von Feuer und Erde Wasser und Luft gesetzt (32b) – Sie haben damit eine Herleitung der vier klassischen Elemente der antiken Naturphilosophie vor Augen (vgl. 48b ff.). Des Weiteren spricht Timaios über die Formung des Kosmos. Der Demiurg habe ihn „kugelgestaltig“ und „kreisrund“ geformt, damit er ihm selbst möglichst ähnlich sei (33b). Darüber hinaus sei er der Ansicht gewesen, er solle als Lebewesen selbständig sein, autarkés (33d) – die Autarkie, die Selbstgenügsamkeit oder Selbständigkeit ist, wie gelegentlich bereits, in Aristoteles’ Nikomachischer Ethik einer der Kandidaten für das vollendetste bzw. abschließendste Gut, nach dem dort gefragt wird. Nach dem Weltkörper kommt Timaios auf die Weltseele zu sprechen, die der Demiurg schon früher als den Körper eingerichtet habe als dasjenige, was über den Körper herrschen soll (vgl. 34c). Diese Weltseele habe der Demiurg durch eine Mischung aus drei Teilen hervorge63 Vgl. M. von Perger, Die Allseele in Platons Timaios, Stuttgart-Leipzig 1997 (Beiträge zur Altertumskunde; 96). 113 bracht, aus einer Mischung von dem Anderen und dem Selben, in welche er das Andere und das Selbe selbst mit Gewalt einfügte (35a). Die genaue Einteilung der Seele habe er dann nach einem komplexen Zahlenverhältnis vorgenommen. Von besonderem Interesse für das Verstehen von Platos Rede über die Verschiedenheit von Glaube und Meinung auf der einen und von Erkenntnis und Geist auf der anderen Seite ist die Erläuterung des Timaios über die Bewegung der Seele. Sobald nämlich alles Körperhafte in die Seele eingefügt worden sei, habe die Seele, die sich selbst in ihr selbst „wendet“, den Anfang eines unbeendeten und vernünftigen Lebens genommen (36e). Dabei spreche die Seele in ihrer Bewegung (37a). Der dabei entstehende Logos drehe sich um das Selbe oder um das Verschiedene. Wenn er sich um das Wahrnehmbare drehe, so entstünden feste Meinungen und Ansichten (dóxai kaí písteis … bébaioi). Drehe sich der Logos um das Berechenbare und kreise er um den Bereich des Selbigen, so wären der Nous und die epistéme das Resultat (37b-c). So weit ein grober Überblick über Timaios’ Erzählung über Weltkörper und Weltseele. Für eine verständliche Deutung dieser überaus schwierigen Passagen ist auf die einschlägigen Kommentare zu verweisen, vgl. z. B. die Arbeiten von Mischa von PERGER,64 Francis M. CORNFORD oder Luc BRISSON.65 Die Einrichtung der Zeit Wohl nicht weniger schwierig zu verstehen ist die im Timaios folgende Erläuterung über die Einrichtung der Zeit. Der „Vater“, der „zeugte“ (ho gennésas patér), freute sich, als er erkannte, dass der Kosmos bewegt und belebt war und ein Abbild der ewigen Götter geworden ist (37c). Er wollte ihn nun dem Paradigma, dem Vorbild noch ähnlicher gestalten. Da er selbst ein ewiges Lebewesen ist, unternahm er es, das All nach Möglichkeit ebenso zu verfertigen. Freilich konnte er dem Gezeugten nicht vollständig seine ewige Natur mitteilen, weshalb er ersonnen hat, ein bewegliches Bild der Ewigkeit zu machen (eikó kinetón tina aiônos, 37d). Man stößt hier im Griechischen auf das Wort aión, welches eben ‚Ewigkeit‘ bedeuten kann, aber mitunter auch nur eine lange Zeit anzeigt. Besonders wirkmächtig wurde die Ver- 64 S. o. Anm. ►. F. M. Cornford, Plato’s Cosmology, New York 1957; L. Brisson, Le Même et l’Autre dans la Structure Ontologique du Timée de Platon. Un commentaire systématique du Timée de Platon, 2. éd. revue, St. Augustin 1994 (International Plato Studies; 2). 65 114 wendung dieses Wortes im Neuen Testament, wo es beispielsweise die gegenwärtige Epoche im Gegensatz zur kommenden Zeit bezeichnet.66 Der Demiurg ordnete nun in seiner Bemühung, ein bewegliches Bild der Ewigkeit zu machen, den Ouranos, d. h. den Himmel bzw. das Weltgebäude und schuf ein gemäß einem Zahlenverhältnis gehendes ewiges Bild der Ewigkeit – eben dies sei dasjenige, was wir Zeit nennen (37d). Gleichzeitig habe er das Werden von Tagen, Nächten, Monaten und Jahren eingerichtet. Diese seien Teile der Zeit, und auch das „War“ und „Wird sein“ seien Gattungen der Zeit. Weil diese Ausdrücke für das „war“ und „wird sein“ Gattungen der Zeit seien, würden wir sie unversehens in unrichtiger Weise auf die ewige Wesenheit übertragen. Wir sprächen von ihr als ob sie „war, ist und sein wird“, obgleich ihr gemäß der wahren Rede nur das „ist“ zukäme (37e). Sie sehen, dass die Dimensionalität der Zeit mit dem „war, ist und wird sein“ bedacht wird und dass diese Dimensionalität zugleich von der ewigen Ousia ferngehalten wird. In erneut sehr komplexer Weise werden dann die Umläufe der Planeten beschrieben. Das griechische Wort planétes „Irrender, Planet“ drückt schon das Herumgehen, den Wandel aus, den laut Timaios die Himmelskörper durchführten. Wenn alle Umläufe der himmlischen Wandelkörper zu ihrem Ausgangspunkt zurückkehrten, sei das vollkommene Jahr erfüllt (39d). Im Anschluss an die Erzählung über die Einrichtung der Zeit berichtet Timaios über die Hervorbringung der Götter. Diese wiederum seien vom Demiurgen mit der Einrichtung weiterer Gattungen an Belebtem beauftragt worden, unter anderem mit der Einrichtung des Menschengeschlechtes (41a ff.). Diese Delegierung liegt darin begründet, dass alles vom Demiurg selbst Eingerichtete eher den Göttern gleichen würde und kein sterbliches Geschlecht ausmachen könne. Solche Sterbliche müsse es aber zur Vervollständigung des Kosmos geben. Hier erfolgt eine erste Ausführung darüber, wie die Götter das Menschengeschlecht eingerichtet hätten und welche Abfolge an Einkörperungen die Menschen zu erwarten hätten, wenn sie die ihnen zukommende Lebenszeit maßvoll oder nicht maßvoll verbrächten (42b ff.). In dieser Erzählung über die Zusammensetzung des Menschen erfährt man unter anderem über die Sehkraft, dass sie die Ursache für den größten Nutzen für die Menschen geworden sei (47a; dies erinnert an das erste Buch der Metaphysik des Aristoteles, s. u.). Denn aus der Beobachtung der Gestirne und der verschiedenen Zeiträume sei der Mensch dazu gekommen, die Philosophie zuwege zu bringen: „Ein größeres Gut als sie (sc. die Philosophie) kam niemals noch wird jemals dem menschlichen Geschlecht als Geschenk von den Göttern kommen.“ (47b). 66 Vgl. Matth. 13, 22. Der entsprechende lateinische Terminus lautet aevum. In der Scholastik finden sich dann Überlegungen zur Unterscheidung von aevum und tempus (vgl. Thomas v. Aquin, Summa theologiae 1 q. 10 a. 5). 115 Mit der Erwähnung Philosophie ist man am Ende eines ersten Erzähldurchganges des Timaios angelangt. Denn er merkt an, dass das bisher von ihm Gesagte dasjenige aufgezeigt habe, was durch den Geist „demiurgiert“, d. h. gewirkt wurde (47e). Es sei jedoch angebracht, auch das durch die Ananke Gewordene, das aus Zwang bzw. Notwendigkeit Entstandene im Logos anzugeben. Die Materie als Amme des Werdens Wenn man wahrhaftig über das Werden des Kosmos reden wolle, müsse man eben diese Notwendigkeit in die Erzählung einmengen. Von diesem neuen Ansatz aus müsse das bisher Dargelegte noch einmal erzählt werden. Dies ist der Grund, warum Timaios ein zweites Mal über die Einrichtung des Menschen sprechen wird. Dieser neue, erweiterte Einsatz bringt den Erzähler Timaios dazu, eine neue Gattung offenkundig zu machen (48e). Timaios rekapituliert, dass es beim ersten Anfang ausreichend war, von zwei Gattungen auszugehen, nämlich vom geistig Vernehmbaren und vom Sichtbaren. Nun scheine aber der Logos ihn zu zwingen den Versuch zu unternehmen, eine „schwierige und dunkle Gestalt“ in den Logos aufzuzeigen (49a). Die spezielle Fähigkeit dieses zu zeigenden Eidos umschreibt Timaios zunächst damit, dass sie die Aufnahme des Werdens sei in der Weise einer Amme. Dieses Reden von einer Aufnehmerin alles Werdens macht Timaios plausibel über eine Kritik der Annahme fester Elemente wie Feuer und Wasser. Die Erfahrung zeige, dass Wasser je nach Verdichtung oder Verdünnung Erde oder Luft, bei weiterer Zersetzung Feuer werde. So werde man auch in der Redeweise „dies ist etwas“ (wie z. B. Wasser) getrogen, da dieses „diese da“ im nächsten Moment etwas anderes sei (49d-e). Man solle nur von momentanen Beschaffenheiten des einen und selben sprechen. Dieses eine und selbe, welches verschiedenste Gestalten aufnehmen könne, sei ein ekmageíon (50c): Etwas, worin alle Gestalten ihren Abdruck hinterlassen könnten. Dieses Abdruckaufnahmemittel müsse selbst ohne jegliche Gestalt sein (50e). Man müsste es als unsichtbares, ungeformtes Eidos fassen, welches alles aufnehmen kann und am Bereich des geistig Vernehmbaren teilhat (51a). In einem zusammenfassenden Neuanlauf, in welchem Timaios die drei von ihm exponierten Gattungen darlegt, benennt er diese Aufnehmerin als dritte Gattung neben dem noetischen und sichtbaren Bereich als die Gattung der Chora (52a). Dieses Wort nun gibt ganz eigene Schwierigkeiten der Übersetzung und Deutung auf. Oft wurde sie einfach mit ‚Raum‘ übersetzt, was auf vielfachen Widerstand gestoßen ist. Die Chora wurde jedoch auch als Hyle, als Materie gefasst. Nahe liegt diese Übersetzung schon aufgrund einer Passage in der Physik des 116 Aristoteles’, wo sich dieser im Zusammenhang mit seinen Untersuchung des Topos kritisch mit diesem Konzept Platos auseinander setzt. Er sagt dort: „Deshalb sagt Platon im Timaios, dass die Hyle und die Chora dasselbe seien.“ (Phys. IV, 2, 209b13). Das Wort hyle wird traditionell mit ‚Materie‘ übersetzt, vor allem über die scholastische Rede von der materia prima, der ersten Materie war und ist sie ein vieldiskutiertes Thema der Philosophiegeschichte, die diesbezügliche Literatur ist – dem Thema entsprechend – materialreich.67 Wir können dies hier nicht weiter verfolgen. Erwähnt sei lediglich noch eine berühmte Studie zu diesem Wort sozusagen vom anderen Ende der Philosophiegeschichte, ein Beitrag von Jacques Derrida.68 67 68 Vgl. z. B. H. Happ, Hyle, Berlin 1971. J. Derrida, Chōra, 2., überarb. Aufl., Wien 2005 (Edition Passagen; 32). 117 Aristoteles Wenn man einen Blick auf die traditionelle Anordnung der Werke des Aristoteles wirft, wie sie etwa die für die Zitierung von Aristotelesstellen maßgebliche sog. Bekker-Ausgabe widerspiegelt,69 so kann man meinen, dass an ihrem Anfang die für Platos’ Sokrates zentrale Frage nach dem Logos fortgeführt wird. Ist doch dort in der Gruppe an Schriften, welche unter dem Titel Organon zusammengefasst ist, hauptsächlich von dem die Rede, was der Logos leisten kann. Wir wollen hier dieser traditionellen Anordnung folgen und anhand von ihr einige Notizen zu Aristoteles machen. Freilich könnte man auch am anderen Ende der Schriften beginnen. An diesem anderen Ende findet man unter anderem Schriften, welche den Titel ‚Ethik‘ tragen. Diese sind die im gegenwärtigen Philosophiebetrieb momentan vielleicht am intensivsten rezipierten Texte des Aristoteles (was nicht immer so war). Allgemeindarstellungen der Philosophie des Aristoteles An diesem Ende beginnt beispielsweise das empfehlenswerte Einführungsbuch zu Aristoteles von Christof RAPP.70 Neben diesem Buch können zwei weitere Taschenbucheinführungen genannt werden, diejenige von Wolfgang DETEL und diejenige, welchen unter dem Namen von Otfried HÖFFE verlegt wird.71 Die Darstellung von Detel beginnt sozusagen umgekehrt zu derjenigen von Rapp mit einer vergleichsweise ausführlichen Darstellung der aristotelischen Schlusslehre. Der umfangreichste dieser drei Bände ist derjenige von Höffe, in welchem sich ein längeres Kapitel über die Nachwirkung aristotelischer Philosophie findet. Aus der Werkstatt von Höffe gibt es übrigens auch ein praktisches Aristoteles-Lexikon.72 Neben diesen Werken, deren aktuelle Auflagen aus dem 21. Jahrhundert stammen, können aus dem 20. Jahrhundert für den deutschsprachigen Raum zwei Gesamtdarstellungen des Aristoteles genannt werden: zum einen das Buch von Werner JAEGER,73 welches geistesgeschichtlich von Bedeutung ist, und zum anderen das Standardwerk von Ingemar DÜRING, welches auf beinahe siebenhundert Seiten umfangreiche Sachinformation bietet. 74 Immer wieder wird in diesem Zusammenhang auch auf die Einführung von John ACKRILL hingewie69 Benannt nach Immanuel BEKKER, der im Auftrag der Preußischen Akademie der Wissenschaften im Jahr 1831 die uns überlieferten Schriften des Aristoteles herausgab: Aristoteles Graece ex recensione I. Bekkeri ed. Academia Regia Borussica, 2 Bde., Berlin 1831. 70 Ch. Rapp, Aristoteles zur Einführung, 3., überarb. Auflage, Hamburg 2007. 71 W. Detel, Aristoteles, Leipzig 2005; O. Höffe, Aristoteles, 3., überarb. Aufl., München 2006 (Beck’sche Reihe; 535). 72 O. Höffe (Hg.), Aristoteles-Lexikon, Stuttgart 2005 (Kröners Taschenausgabe; 459). 73 W. Jaeger, Aristoteles. Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung, Berlin 1923. 74 I. Düring, Aristoteles. Darstellung und Interpretation seines Denkens, Heidelberg 1966. 118 sen, die auch in deutscher Übersetzung erhältlich ist.75 Freilich könnte eine derartige Auflistung an Einführungswerken viele Jahrhunderte zurückgeführt werden, zumal die Wirkung der aristotelischen Texte in der abendländischen Antike ungebrochener war als diejenige der Werke Platos. Schon die Bestimmung der Rezeption einzelner Werke des Aristoteles in bestimmten Epochen erforderte eine gesonderte Darstellung in Buchform, wie dies etwa für die Kategorien, denen wir uns demnächst zuwenden wollen, von Rainer THIEL vorexerziert wurde.76 Kommentare und Übersetzungen Damit zusammenhängend sei nur kurz darauf verwiesen, dass es zahlreiche antike Kommentare zu Aristoteles gibt (die in den vergangenen Jahren ins Englische übersetzt werden).77 Weiter kann man auf die lateinischen Übersetzungen der Werke des Aristoteles hinweisen, die aus der Spätantike oder dem Mittelalter stammen.78 Nicht zu vergessen sind freilich die zahlreichen arabischen Übersetzungen und Kommentare sowie die Kommentare aus der Scholastik, allen voran diejenigen des THOMAS VON AQUIN. Mit diesem Name ist etwa der Zeitraum angezeigt, in welchem die Schriften des oben genannten Organon zur Grundlage der universitären Ausbildung wurden. Sie bildeten das Gerüst für das legendäre collegium logicum, in welchem der Geist in „spanische Stiefeln eingeschnürt“ wird.79 Die damit verbundene dogmatische Festlegung auf einen relativ geringen Teil des aristotelischen Werkes wurde mit ein Grund für die in der Renaissance und dem Humanismus auftretende Polemik gegen aristotelisierende Philosophie. Was heute ein Zugehen auf die Philosophie des Aristoteles meist erschwert, ist die Übersetzungsproblematik. Offensichtlich entziehen sich gerade seine Texte in besonderer Weise einer verständlichen Übersetzung, bzw. bräuchte wohl jede Epoche und jede philosophische Strömung ihre eigene Aristotelesübertragung. Jedenfalls zeigen sich in den deutschen Übersetzungen etwa der Physik oftmals stark die metaphysischen Grundeinstellungen der Übersetzer selbst.80 Empfehlenswert ist der Blick auf anderssprachige Übersetzungen, wie beispielsweise 75 J. L. Ackrill, Aristoteles. Eine Einführung in sein Philosophieren, Berlin - New York 1985 (Sammlung Göschen; 2224). 76 R. Thiel, Aristoteles’ Kategorienschrift in ihrer antiken Kommentierung, Tübingen 2004 (Philosophische Untersuchungen; 11). 77 R. Sorabji, The Ancient Commentators on Aristotle. 78 Vgl. Aristoteles Latinus, Bd. 1 ff., Bruges-Paris 1961 ff. (Union académique internationale. Corpus philosophorum medii aevi). 79 J. W. Goethe, Faust I, v. 390. 80 Zahlreiche der neueren Aristoteles-Übersetzungen im Meiner-Verlag stammen von Hans Günter ZEKL, der offensichtlich um textnahe Übertragungen bemüht ist. Weiter können an neueren deutschen Übersetzungen die- 119 die englischen (z. B. in der Loeb Classical Library, die durchwegs von Aristotelesexperten stammen) oder italienischen. Inwiefern wurden die Schriften des Aristoteles systematisiert? Relativ früh hat man die Schriften des Aristoteles als System aufgefasst, obwohl sie schon von ihrer äußeren Gestalt her alles andere als systematisch sind. Oftmals wird die Meinung vertreten, die Schriften des Aristoteles seien hauptsächlich Vorlesungsunterlagen seines Lehrbetriebs im Peripatos. Diese Texte werden auch als die so genannten „esoterischen“ Schriften bezeichnet im Unterschied zu den „exoterischen“, an ein breiteres Publikum gerichteten. Letztere sind uns von Aristoteles nicht oder nur fragmentarisch erhalten (zum Protreptikos vgl. o.). Kompliziert ist die Überlieferungsgeschichte der erhaltenen Texte, man nimmt an, dass sie über viele Umwege schließlich nach Rom kamen, wo sie im ersten vorchristlichen Jahrhundert von TYRANNION VON AMISOS ediert wurden. Ab diesem Zeitpunkt sind sie jedoch aus der Geistesgeschichte nicht mehr wegzudenken. Dabei wurden die Texte, wie gesagt, früh einer systematisierenden Einteilung unterworfen. Besonders beliebt waren Fünfteilungen nach dem Schema Logik – Physik – Metaphysik – Ethik – Politik. Die letzten drei Glieder dieser Teilung (Metaphysik, Ethik, Politik) könnte man zur Geistphilosophie zusammenfassen, wodurch man das Grundschema der klassischen deutschen Systemphilosophie erreicht hätte, welches sich in Logik, Naturphilosophie und Geistphilosophie gliedert. Dieser Dreigliederung folgend wollen wir in den verbleibenden letzten drei Stunden in gröbsten Zügen eine Skizze entwerfen zu demjenigen, was bei Aristoteles über die Leistungsfähigkeit des Logos zu lesen ist, dann zu demjenigen, was er über Natur im griechischen Sinn zu sagen hat (worunter auch die Betrachtung der Psyche fällt) und schließlich zu demjenigen, was er über die Erste Philosophie schrieb. Welche Schriften sind unter dem Titel Organon zusammengefasst? Unter dem Titel „Organon“ werden folgende sechs Schriften zusammengefasst: Kategorien, Hermeneutik (gr. perí hermeneías, lat. De interpretatione), Erste Analytiken, Zweite jenigen des Reclam-Verlages genannt werden, z. B. die Topik-Übersetzung von Tim WAGNER und Christof Rapp (Aristoteles, Topik. Übs. und komm. von T. Wagner und Ch. Rapp, Stuttgart 2004) oder die Übertragung der Parva Naturalia, der kleinen naturwissenschaftliche Schriften des Aristoteles von Eugen DÖNT (Aristoteles, Kleine naturwissenschaftliche Schriften (Parva naturalia). Übs. und hrsg. von E. Dönt, Stuttgart 1997). 120 Analytiken, Topik, Sophistische Widerlegungen.81 Das griechische Wort órganon bedeutet „Werkzeug“. Aristoteles gab wohl nicht selbst dieser Schriftengruppe diesen Namen. Grob gesagt geht es in den Kategorien um die Aussageformen, in der Hermeneutik um das Urteil bzw. die möglichen Negationsformen, in den Ersten Analytiken um den (logischen) Schluss und in den Zweiten Analytiken um den Beweis. Letzteres Werk wird immer wieder als Aristoteles’ Wissenschaftstheorie bezeichnet. In der Topik geht es um wahrscheinliche Aussagen, auf die Argumentationen auffußen können, und die Sophistischen Widerlegungen schließlich befassen sich mit Trugschlüssen. Die Kategorien Welche sind die zehn von Aristoteles aufgelisteten Kategorien? In der Schrift, welche den Titel „Kategorien“ trägt, handelt Aristoteles hauptsächlich über diejenigen Entitäten, die „ohne Verknüpfung“ ausgesprochen werden (1b25). Mit dem Wort ‚Verknüpfung‘ werden wir erinnert an die Bestimmung des Logos im platonischen Theaitetos und Sophistes. In letzterem wurde der Logos im Sinne von „Satz“ bestimmt als symploké von ónoma und rhéma, als Verknüpfung von Namen- und Tunwort (s. o.). Mit dieser Verknüpfung wird sich Aristoteles in der auf die Kategorien folgenden Schrift befassen. In diesen geht es ihm um die Kategorien. Eine kategoría ist dem ursprünglichen Wortsinn nach eine ‚Anklage‘, dasjenige, was man jemandem „(auf den Kopf) zusagt“ (kat-agoreúein, ein zu dem Hauptwort agorá ‚Versammlung‘ gehörendes Zeitwort). Über diese „nicht gemäß einer Verknüpfung Ausgesagten“ sagt nun Aristoteles, dass jedes davon entweder eine ousía anzeige oder ein „irgendwiegroß“ oder „irgendwieviel“ oder ein „zu etwas“ oder ein „wo“ oder „wann“ oder ein „liegen“ oder „haben“ oder „machen“ oder „tun“ (1b25-27). Eine exakte Übersetzung der im Text stehenden griechischen Begriffe ist wohl sehr schwer durchzuführen und soll hier nicht versucht werden. Wir wollen uns auf einige der Kategorien beschränken. Aristoteles benennt in diesem Satz zehn Kategorien mit unterschiedlichen Wortarten und -formen (Substantiv, Infinitive, Indefinitpronomen, Adverbien, Präpositionalfügung). Bekannter als in diesen Bezeichnungen sind sie in ihrer substantivierten Form geworden. Man spricht dann von: Substanz, Quantität, Qualität, Relation, Ort, Zeit, Lage, Haben, Aktiv (Tun), Passiv (Erleiden). Die Wirkmächtigkeit dieser von Aristoteles vorgenommenen Unterscheidung ist schwer zu ermessen. Über zahlrei81 Für eine Zusammenschau der griechischen Titeln der Schriften des Aristoteles mit ihren lateinischen und deutschen Varianten vgl. A. Dunshirn, Griechisch für Philosophen, Wien 2007, 94 f. 121 che Vermittlungsstufen hat sie sich bis mindestens zu einem der Gipfelpunkte der Begriffsphilosophie ausgewirkt. Hierbei ist nicht nur an die zahlreichen Übersetzungen und Kommentare der Kategorienschrift zu denken, sondern auch an diverse lateinische Sammelwerke der Spätantike, die sich gleichsam als Philosophielehrbücher im Mittelalter großer Beliebtheit erfreuten. Genannt sei als Beispiel MARTIANUS CAPELLAs De nuptiis Philologiae et Mercurii, wo die personifiziert auftretende Dialektik eine Zusammenfassung der Kategorienschrift vorträgt.82 Wenn man die oben angegebene Auflistung der Kategorien mit der Kategorientafel in Immanuel KANTs Kritik der reinen Vernunft oder mit den Kategorien in Hegels Wissenschaft der Logik vergleicht, so zeigt sich, dass manche der aristotelischen Kategorien unverzichtbarer Bestand der neuzeitlichen Rede von Kategorien wurde, und dass andere der aristotelischen Zehnzahl weniger aufgenommen oder in anderen Bereichen angesiedelt wurden, wie etwa das letzte Kategorienpaar von Aktiv und Passiv, welches vornehmlich als Begriffspaar der grammatikalischen Terminologie geläufig ist (sofern man von seinem Fortleben in der Kategorie der Wechselwirkung absieht). An diesen anzudenkenden Vergleich der kantischen und aristotelischen Kategorien kann die Bemerkung angeschlossen werden, dass ebenso wie für Kant für Aristoteles gefragt werden kann, woher er seine Kategorien nimmt und wie er gerade auf zehn kommt. Dies soll hier aber nicht weiter verfolgt werden. ousía Die erste der aristotelischen Kategorien ist diejenige, welche als ousía bezeichnet wird. Sie ist die wichtigste Kategorie. Hier gilt es vorweg zu beachten, dass es Aristoteles in den Kategorien primär um Aussagen, nicht um ontologische Bestimmungen geht. Das Primäre, das ausgesagt wird, ist für Aristoteles immer ein tóde ti, ein „dieses da“. Diese Fixierung der Hinblicknahme auf die Aussagemöglichkeiten wurde erwähnt, weil das Wort ousía auch an zentraler Stelle in der Metaphysik diskutiert wird. In der Forschung ist umstritten, ob Aristoteles hier und dort ein anderes philosophisches Konzept verfolgt oder die Sachen nur aus einer anderen Perspektive betrachtet. Was heißt nun ousía und warum kommt es zu diesen Konfusionen zwischen den Kategorien und der Metaphysik?83 Das Wort ousía ist ein Abstraktum zum Verbum eínai ‚Sein‘, weshalb in letzter Zeit mitunter die etymologisierende Übersetzung ‚Seiendheit‘ gewählt wurde. Eine gängigere Übertragung dieses Terminus lautet ‚Wesen‘. 82 IV 362 f. Vgl. zu dieser Fragestellung z. B. Ch. Rapp, Aristoteles und aristotelische Substanzen, in: K. Trettin (Hg.), Substanz. Neue Überlegungen zu einer klassischen Kategorie des Seienden, Frankfurt a. M. 2005, 145-169. 83 122 Was ist allerdings ein Wesen? Aristoteles unterscheidet in den Kategorien zwischen einer ersten und einer zweiten ousía. Stark vereinfachend könnte man sagen, dass er unter einer ersten ousía ein Einzelding wie „diesen Mensch da“ meint, und mit der zweiten ousía einen Allgemeinbegriff wie Mensch. Wichtig ist nun zu sehen, dass eine erste Substanz wie „dieser Mensch da“ das Grundlegende für jede Aussage ist. Die erste Substanz selbst wird nicht über etwas Zugrundeliegendes ausgesagt (1b5), aber eine zweite Substanz wie „der Mensch“ wird über den Einzelmensch als Zugrundeliegendem ausgesagt. Aus dieser Doppelung kann vielleicht auch die moderne Begriffsverwirrung erhellen. Denn eine erste ousía kann somit selbst die Grundlage einer Aussage sein, während eine zweite ousía über das so Zugrundeliegende ausgesagt wird. Somit zeigt sich, dass der lateinische Ausdruck substantia, das „Darunterstehende“ in gewisser Weise ein passender Terminus für die ousía im Sinne dessen ist, was einer Aussage zugrunde liegt. Freilich kann mit der Rede von einer ousía im Griechischen auch auf anderes abgezielt werden. Zunächst bezeichnet dieses Wort in der Alltagssprache den Besitz, über den jemand verfügt, das ‚Anwesen‘ beispielsweise im Sinn des Bauernhofes. Eine weitere wichtige Unterscheidung der Kategorienschrift hängt sich an dieses erwähnte Ausgesagt-werden-über an. Denn neben den Entitäten, die über etwas ausgesagt werden, jedoch nicht in diesem sind, gibt es Dinge, die als in einem Zugrundeliegenden seiend ausgesagt werden, aber nicht über ein Zugrundeliegendes. Ein Beispiel hierfür bei Aristoteles ist die Farbe (1a26 ff.). Mit dieser macht man den Überstieg zur Kategorie der Qualität. Das entsprechende griechische Hauptwort poiótes ist, wie anlässlich der Beschäftigung mit dem Theaitetos erwähnt, eine platonische Schöpfung. Von den übrigen Kategorien soll nur noch diejenige des prós ti erwähnt werden. Dieses prós ti bezeichnet eigentlich das „zu etwas“. Aristoteles meint damit z. B. Ausdrücke wie „Vater“, die nur in ihrer Bezogenheit auf etwas Sinn hätten. Diese Kategorie wurde dann als Relation bezeichnet. Besondere Bedeutung hat sie in der Philosophie Martin Heideggers gefunden.84 Hermeneutik Die auf die Kategorien folgende Schrift wird vor allem aufgrund ihrer Anfangspassage immer wieder in der Sprachphilosophie diskutiert. Diese Schrift trägt den Titel perí hermeneías, lat. De interpretatione. An ihrem Beginn steht eine Aussage, die man leicht als Ausdruck eines repräsentalistischen Sprachverständnisses auffassen könnte. Heißt es doch dort, dass die Din84 Vgl. M. Heidegger, Sophistes (Vorlesung Wintersemester 1924/25), hrsg. von I. Schüßler, Frankfurt a. M. 1992 (Gesamtausgabe; 19). 123 ge in der Stimme sýmbola, etwa ‚Erkennungszeichen‘ der Dinge in der Psyche seien und die geschriebenen Dinge sýmbola der Dinge in der Stimme. Dasjenige jedoch, wofür diese Erkennungszeichen stünden, sei allen Menschen gemeinsam (16a3-8). Für ein genaueres Verständnis dieser Passage wäre eine eindringliche Untersuchung der einzelnen Ausdrucke notwendig, die hier nicht geleistet werden kann. Einzig dem Wort sýmbolon soll nachgegangen werden, da es auch über die aristotelische Philosophie hinaus oftmals in philosophischen Diskursen auftaucht. Ein sýmbolon bezeichnet wohl eigentlich dasjenige, was zusammengeworfen werden kann (das Wort ist abgeleitet vom Verbum symbállein „zusammenwerfen“). Gedacht kann in diesem Zusammenhang an einen Gegenstand werden, der zerbrochen wird und dessen Teile sich etwa Gastfreunde als Erkennungszeichen überreichen. Dasjenige jedoch, was das hauptsächliche Thema der Schrift perí hermeneías ausmacht, wird nach dieser Passage angesprochen: Es wird vornehmlich um die sýnthesis und dihaíresis (von Wörtern) gehen, um das „Zusammensetzen“ und „Auseinandernehmen“. In diesem Bereich nämlich trete das Falsche und das Wahre auf (16a12f.). Diese Bestimmung, dass von Falschheit und Wahrheit gesprochen werden könne im Bereich der Verknüpfung von Namen, ist uns aus dem Sophistes bekannt. Hier wird in analoger Weise zunächst bestimmt, was eigentlich verknüpft wird. Die Konstituenten der Verknüpfung sind ónoma und rhéma. Im ersten Kapitel findet sich zunächst noch die Angabe, dass bloße Namen- oder Zeitwörter ohne die Hinzufügung nicht wahres oder falsches anzeigten, wie das Wort ‚Bockhirsch‘, wenn man ihm nicht das Sein oder Nichtsein hinzufüge, noch nichts Falsches oder Wahres anzeige (16a16). Kapitel zwei und drei der Hermeneutik bringen die bekannten Bestimmungen dessen, was ónoma und rhéma seien: Ein ónoma sei eine Stimmäußerung, die gemäß Übereinkunft „ohne Zeit“ etwas anzeige (Kap. 2, 16a19), wohingegen ein rhéma eine Zeit „dazu anzeige“ (Kap. 3, 16b6). Die Angabe des „gemäß Übereinkunft“ (katá synthéken) erinnert an die oben angesprochene Einstiegsfrage des Kratylos. Im vierten Kapitel wird dann geklärt, welche Art von Logos mit dem „wahr“ und „falsch“ zu tun habe. Ein Logos etwa, der eine Bitte darstellt, habe nicht mit diesen Bestimmungen zu tun. So sei zwar jeder Logos ein anzeigender (insofern er etwas mitteilt), aber nicht jeder Logos sei ein lógos apophantikós, ein „aufzeigender Logos“, der mit dem „wahr und falsch“ verbunden sei. Auf diesen Typus von Logoi beschränkt nun Aristoteles seine weitere Betrachtung (17a2 ff.). Im Bereich des lógos apophantikós sind zwei Unterscheidungen zu treffen: Entweder ist ein solcher Logos eine katáphasis oder apóphasis (vgl. Kap. 5, 17a7). Diesbezüglich könnte man meinen, es handle sich um Ausdrücke für „Bejahung“ und „Verneinung“. Angemessener ist vielleicht eine wörtlichere Übersetzung dieser Termini: katáphasis könnte man als „Zusage“ und apóphasis als „Wegsage“ be124 zeichnen. Beides sind Fälle einer, nun wird es terminologisch etwas verwirrend, apóphansis, wie das entsprechende Hauptwort zu apophatikós lautet. Eine apóphansis ist eine „anzeigende Stimmäußerung“ darüber, ob etwas „vorliegt“ oder nicht „vorliegt“ bzw. „zukommt“ oder nicht (17a23f.). Mit ‚vorliegt‘ bzw. ‚zukommt‘ wurde das griechische hypárchei übersetzt. Auf dieses Wort sei deshalb gesondert hingewiesen, weil seine Kenntnis für das Verständnis mancher Formulierungen in der Ersten Analytik hilfreich ist. Des Weiteren begegnet es einem beispielsweise in der Formulierung des Satzes des Widerspruchs im vierten Buch der Metaphysik des Aristoteles (IV 3, 1005b19 f.). Häufig kehrt es in der Ersten Analytik wieder in Aussagen des Typus „A hyparchei B“, A kommt B zu, z. B. Mensch kommt Sokrates zu. Diese Formulierung erklärt, warum die Notationen von Prämissen dann von der Prädikatsseite beginnen, es heißt also nicht Sokrates ist weiß, sondern Weiß kommt Sokrates zu. Was Aristoteles in weiterer Folge bedenkt, sind die Unterschiede, die sich bei Aussagen ergeben, je nachdem, ob sie sich um Sachen dreht, die allgemein oder etwas Einzelnes betreffend ausgesagt werden. Damit stößt man auf ein für Aristoteles charakteristisches Begriffspaar, auf dasjenige von kathólou und kath’ hékaston. Aristoteles’ hier im siebenten Kapitel vorfindliche Erklärung dieser Unterscheidung lautet, dass er mit kathólou etwas meint, was naturgemäß über mehrere ausgesagt wird (z. B. ‚Mensch‘), und mit kath’ hékaston etwas, das nicht über mehrere ausgesagt wird (z. B. ‚Kallias‘ [ein Eigenname]; 17a39 ff.). Diese Unterscheidung führt Aristoteles zur Betrachtung der verschiedenen Möglichkeiten von Allgemein- und Einzelaussagen. Je nachdem, ob etwas Allgemeines allgemein ausgesagt werde oder nicht, ergeben sich dann unterschiedliche Verhältnisse zu den entsprechenden Absagen, den Verneinungen. Ein großer Teil der weiteren Schrift wird der Erwägung der verschiedenen Verhältnisse von Zu- und Absagen gewidmet sein, wobei etwa differenziert wird in konträre und kontradiktorische Aussagen. Dergleichen Überlegungen führten zur Ausbildung des sog. „logischen Quadrats“.85 Bereits in Kapitel sieben werden Sachverhalte erwogen, die bis heute nicht eindeutig interpretiert sind (beispielsweise die allgemeine Aussage eines Allgemeinen über etwas Allgemeines). Dies soll hier in keiner Weise mehr gestreift werden, es sollte einzig ein wenig auf die in der Hermeneutik anzutreffende Terminologie hingewiesen werden. Erste Analytik 85 Eine knappe Übersicht über diese Themen der Hermeneutik bietet Rapp, Aristoteles, 86-89. 125 Aus diesem Werk sollen hier ebenso wie bei der Hermeneutik nur einige Termini vorgestellt werden. Die Schrift hebt an mit der Zielangabe, dass es in ihr um die Bestimmungen dessen gehe, was eine apodeíxis, ein „Beweis“ sei (24a11 f.). Diese Zielangabe ist wichtig, wenn man ermitteln will, worum es überhaupt geht in dem, was aristotelische Syllogistik genannt wird. Wohl geht es nicht um dasjenige, was manchmal an ihr beklagt wird, ein formalistisches Spiel, sondern um das Abwägen der Möglichkeiten, wie eine Behauptung untermauert oder umgeworfen werden kann.86 Hierfür dient das Schließen, in welchem ein vorgegebener Satz mit einem anderen zusammengebracht wird, in dem einer der Ausdrücke aus dem ersten vorgegebenen Satz enthalten ist. In den ersten Kapiteln seiner Ersten Analytik unternimmt es Aristoteles zu erläutern, was er unter einem solchen vorgegebenen Satz und einem ‚Ausdruck‘ versteht. Er fragt auch danach, in welchen Weisen etwas von etwas ausgesagt werden kann (bejahend/verneinend, allgemein/partikulär). An diese Überlegungen schließen sich Aussagen über die Schlussformen: Aristoteles unterscheidet drei Schlussformen danach, ob der Mittelbegriff in der Mitte oder außen steht. Woraus besteht ein Syllogismus (im engeren Sinne)? Im ersten Kapitel bestimmt Aristoteles, was er unter einer prótasis versteht. Der Ausdruck prótasis wurde später mit „Prämisse“ übersetzt. Er ist abgeleitete von einem Verbum proteíno, das unter anderem ‚vorgeben‘ bedeuten kann. Eine prótasis bestimmt nun Aristoteles als einen lógos kataphatikós é apophatikós tinos katá tinos, als eine „zusagende oder wegsagende Aussage von etwas über etwas“, eine Aussage, die etwas über etwas bejaht oder verneint (24a16 f.). Hier ist man an die aus der Hermeneutik bekannten Ausdrücke katáphasis und apóphasis erinnert, welche die ‚Bejahung‘ und ‚Verneinung‘ anzeigen. Im Bereich dieser Protaseis, die bejahend und verneinend sein können, unterscheidet Aristoteles dann, ob sie diese Aussagen in „Allform“, „Teilform“ oder „unbestimmt“ treffen (24a17, Übs. H. G. Zekl), und inwiefern sich eine Protasis im Beweis von einer der Dialektik unterscheidet, was hier nicht weiter verfolgt werden soll. Von weitreichender Bedeutung für die Ausprägung der späteren Logik war die Unterscheidung der Begriffsverhältnisse in solchen Protaseis und ihrer möglichen Umkehrbarkeit. Wie oben anlässlich der Erwähnung des Wortes hypárchein gesagt, betrachtet Aristoteles die Sätze, die etwas von etwas aussagen, ausgehend von demjenigen, was in späterer grammatikalischer Diktion das „Prädikat“ genannt wurde. Er spricht demnach davon, dass A einem B „zu86 Vgl. z. B. Aristoteles, Organon. Bd. 3/4: Erste Analytik. Zweite Analytik. Gr.-dt. Hrsg., übs., mit Einl. und Anm. versehen von H. G. Zekl, Hamburg 1998, XXIX ff. 126 kommt“ (diese Formalisierung mit Buchstaben findet sich in dieser Weise im Text der Analytiken). Hinsichtlich dieses Zukommen kann man mit Aristoteles vier Weisen unterscheiden: Ein A kommt allen B zu (a). Ein A kommt manchen B zu (i). Ein A kommt manchen B nicht zu (o). Ein A kommt keinem B zu (e). Entsprechende Sätze sind also nicht in der Weise eines „Alles Menschen sind Lebewesen“ formuliert, sondern nach dem Muster: „’Lebewesen‘ kommt allen Menschen zu.“ Daraus ist auch die diagrammhafte Visualisierung mit Pfeilen verständlich, wie etwa „A→aB“. (Die hier genannten Kleinbuchstaben, welche die Weise des Zukommens bezeichnen, sind übrigens auf die lateinischen Verben affirmo „behaupten“ und nego „verneinen“ bezogen“).87 Zentral ist an dieser Unterscheidung der Arten des Zukommens für Aristoteles die Frage nach der Umkehrbarkeit der entsprechenden Aussagen, die Frage nach dem antistréphein (25a6 ff.). So gelte, wenn keinem B das A zukomme, dass auch B keinem A zukomme, wenn A jedem B zukommt, müsse B manchem A zukommen und wenn A einigen B zukommt, muss auch B einigen A zukommen. Nicht jedoch müsse, wenn A manchem B nicht zukomme, B manchen A nicht zukommen. Aristoteles’ Beispiel hierfür ist das Verhältnis der Begriffe ‚Lebewesen‘ (B) und ‚Mensch‘ (A). Der Begriff ‚Mensch‘ kommt manchen Lebewesen nicht zu. Nicht jedoch kommt der Begriff Lebewesen manchen Menschen nicht zu (vgl. 25a22 ff.). Nach dergleichen Differenzierungen wendet sich Aristoteles im vierten Kapitel der Erläuterung dessen zu, was er unter syllogismós versteht. Zentral in seiner Bestimmung des syllogismós sind die Ausdrücke méson und ákra. Ein méson ist ein „Mittleres“, ein Mittelbegriff, welcher „selbst in einem anderen ist, und in dem anderes ist“ (25b35 f.). Die ákra sind die „Spitzen“, die Extreme, die Außenbegriffe (diese Terminologie findet sich wieder etwa in Hegels Aussagen über diverse Schlüsse, deren Extreme über eine Mitte zusammengeschlossen sind). Somit kann man sagen, dass ein Syllogismus im engeren Sinne konstituiert wird durch zwei Protaseis, die von drei Begriffen gebildet werden, von denen einer zweimal in diesen Protaseis vorkommt. Im resultierenden Satz ist er nicht mehr enthalten. Das klassische Schulbeispiel mit Sokrates (Alle Menschen sind sterblich. Sokrates ist ein Mensch. Also ist Sokrates sterblich.), welches für Aristoteles eigentlich kein akzeptables Beispiel ist, da er für die Syllogismen nur Allgemeinbegriffe zulässt, hat den Begriff „Mensch“ zu seiner „Mitte“. Aristoteles hebt in den weiteren Kapiteln drei Schlussfiguren voneinander ab. Diese drei Figuren resultieren aus der Stellung des angesprochenen Mittelbegriffes. Wenn er in der Mitte steht, so spricht man von der Figur I. Ein Beispiel hierfür ist der oben angeführte SokratesSchluss: Sterblich→aMenschen, Mensch→Sokrates, Sterblich→Sokrates, formal: 87 Vgl. Aristoteles, Organon 3/4 (o. Anm. ►), XIII. 127 A→aB, B→aC, syll.: A→aC. Steht der Mittelbegriff außen auf Prädikatsseite (ist er in beiden Protaseis Prädikat), spricht man von der Figur II, z. B. B→aA, B→eC, syll.: A→eC. Steht der Mittelbegriff schließlich außen auf Subjektsseite (ist er in beiden Protaseis Subjekt), spricht man von der dritten Schlussfigur, z. B.: A→aB, C→aB, syll.: A→iC In jeder dieser Figuren kann man entsprechend den vier Verhältnismöglichkeiten der Begriffe vier mal vier Kombinationen durchführen, was drei mal 16 mögliche Kombinationen ergibt.88 Aristoteles rechnete offensichtlich alle 48 Kombinationen aus und kam zu dem Schluss, dass es unter diesen 16 Kombinationen gibt, die zu einem „vollendeten“ Schluss führen. Das sind Schlüsse, an deren Ende Aussagen stehen, in welchen der obere Randbegriff dem unteren in einer der vier Verhältnisse zukommt. Seit dem Mittelalter hat sich für diese Schlüsse ein Abkürzungssystem eingebürgert. Der erste der traditionellerweise aufgelisteten Schlüsse trägt die Bezeichnung „Barbara“, der oben angegebene Schluss der zweiten Figur hat den Namen „Camestres“, derjenige der dritten Figur „Darapti“. Die Vokale dieser Namen weisen auf die jeweiligen Verhältnisse der Begriffe in den Teilsätzen hin, die Namen der vier vollkommenen Schlüsse der ersten Form beginnen mit den ersten vier Konsonanten des Alphabets (Barbara, Celarent, Darii, Ferio), die Bezeichnungen der Schlüsse der anderen Figuren beginnen mit den Buchstaben desjenigen Schlusses aus der ersten Figur, auf den sie zurückgeführt werden können.89 Überaus komplex sind die sich hier anschließenden Betrachtungen des Aristoteles zu Modalkalkülen. Nicht weniger intrikat ist die Zweite Analytik, die mitunter als Wissenschaft lehre des Aristoteles bezeichnet wird und die mit der Frage nach der epistéme anhebt, was die Ausgangsfrage des Theaitetos in Erinnerung ruft. Diese Schrift wird hier ebenso ausgespart wie die Topik, in welcher die Dialektik abgehandelt wird. Dabei bedeutet Dialektik für Aristoteles, das bei dialektischen Schlüssen nicht von gesicherten Schlüssen, sondern von anerkannten Meinungen ausgegangen wird. Hinsichtlich dieser Schrift kann auf die ausgezeichnete Übersetzung von Tim WAGNER und Christof Rapp im Reclam-Verlag hingewiesen werden.90 88 Eine schematische Übersicht bietet Aristoteles, Organon 3/4 (o. Anm. ►), XXV f. Für eine Übersicht vgl. Aristoteles, Organon 3/4 (o. Anm. ►), XIII. 90 Aristoteles, Topik. Übs. und komm. von T. Wagner und Ch. Rapp, Stuttgart 2004. 89 128 Physik - Schriften zur Naturphilosophie Die zweite Großgruppe, die an den Werken des Aristoteles herausgehoben werden kann, sind die Schriften zur Physik im weitesten Sinne. In diesen Bereich ist nicht nur die große PhysikVorlesung zu zählen, sondern auch die so genannten Parva Naturalia, die kleinen naturwissenschaftlichen Schriften und vor allem die Schrift Über die Seele. Bereits die Titel der Texte, welche unter die Gruppe der Parva Naturalia zusammenfasst sind, zeigen den Spezialisierungsgrad, welchen die naturphilosophischen Untersuchungen des Aristoteles angenommen haben: Über Wahrnehmung und Gegenstände der Wahrnehmung, Über Gedächtnis und Erinnerung, Über Schlafen und Wachen, Über Traumdeutung, Über die Länge und Kürze des Lebens, Über Jugend und Alter, Über Leben und Tod, Über die Atmung. Für diese Schriften kann man auf die Übersetzung eines emeritierten Wiener Gräzistikprofessors hinweisen, auf diejenige von Eugen DÖNT, welche im Reclam-Verlag verlegt wird.91 Diese Spezialisierung zeigen auch die Schriften, welche nach Aristoteles’ großem Zoologiewerk, der Historia animalium gereiht werden. Hier finden sich Texte über die Teile der Tiere (De partibus animalium), über die Bewegung und Fortbewegung von Tieren (De motu animalium, De incessu animalium) und über die Entstehung der Tiere (De generatione animalium). Genannt seien für den Bereich der Schriften zur Physik noch die Schrift Über den Himmel, die immer wieder zitierte Schrift Über Werden und Vergehen und die Meteorologica, die Schrift über die Himmelserscheinungen. Was die Schrift De anima angeht, so sollte bei ihrer Lektüre beachtet werden, dass sie dieser Gruppe naturphilosophischer Texte zuzurechnen ist. Dies kann davor bewahren, mit Fragen an sie heranzutreten, auf die sie schon aufgrund ihres Selbstverständnisses keine Antwort geben will. Diese Schrift soll in aller Kürze im Anschluss an die Physikvorlesung referiert werden, da sie ebenso wie diese Konzepte vermittelt, die im Vergleich zu neuzeitlichen Konzepten eine bedenkenswerte Eigenständigkeit aufweisen. Die Physik Aristoteles’ physiké akróasis, seine Physik-Vorlesung, ist ein umfangreiches Werk in acht Büchern. Sie dreht sich nicht primär um dasjenige, was man in der Neuzeit unter ‚Physik‘ versteht. Eines ihrer Hauptanliegen ist, alles, was mit Bewegung zu tun hat, zu analysieren. Ihr Name leitet sich vom Wort phýsis her, welches traditionell mit dem Wort ‚Natur‘ übersetzt 91 Aristoteles, Kleine naturwissenschaftliche Schriften (Parva naturalia). Übersetzt und hrsg. von E. Dönt, Stuttgart 1997. 129 wird. Wiederholt wurden in jüngerer Zeit Reflexionen darüber angestellt, dass diese Übertragung unpassend sei. phýsis bezeichne nicht das Natürliche im Sinn des ‚Geborenseins‘ (entsprechend dem lat. natura, welches von nasci „geboren werden“ abgeleitet ist), eher nenne es das von sich aus „Aufgehende“. Manchen Philosophen gilt dann dieser Text als der Grundtext der abendländischen Philosophie überhaupt. Erwähnt sei in diesem Zusammenhang an Sekundärliteratur Wolfgang Wielands Buch zur aristotelischen Physik, dessen Platonbuch oben wiederholt genannt wurde.92 Einer der Standardkommentare zur Physik ist derjenige von David ROSS.93 Wir wollen drei Themenfelder der Physik anschneiden: 1. Die Ausgangsfrage der Physik nach der arché tés kinéseos, dem Anfang bzw. Urgrund von Bewegung, wobei zu fragen sein wird, was Aristoteles primär unter Bewegung versteht. 2. Die Unterscheidung der vier aitíai, der vier Ursachen bzw. causae. 3. Aristoteles’ Konzept von Ort und Zeit. Was ist eine der Grundfragen von Aristoteles’ Physik? Im ersten Kapitel des ersten Buches der Physik stößt man auf die weithin bekannte Aussage, dass bei der Bemühung um die Bestimmung der Anfänge der Physis der Weg dieser Untersuchung von Haus aus so beschaffen sei, dass er von den uns Erkennbareren und Klareren zu den von Natur aus Erkennbareren und Klareren führe (vgl. Phys. I 1, 184a16 ff.). Uns seien nämlich zunächst die „Zusammengegossenen“ deutlich und klar, erst später würden aus diesen die Elemente und Anfangsgründe erkennbar. Im Rahmen einer für seine Vorlesungen typischen Auseinandersetzung mit seinen philosophischen Vorgängern setzt Aristoteles dann fest, dass für ihn gelten soll, dass die Naturdinge allesamt oder teilweise bewegt sind (185a12 f.). In diesem Eingangsabschnitt setzt sich Aristoteles auch mit den unterschiedlichen Ansätzen seiner Vorgänger hinsichtlich der archaí, der Anfänge auseinander und unternimmt eine metatheoretische Betrachtung. Er verweist darauf, dass es nicht Aufgabe einer Betrachtung der Physis ist zu erwägen, ob das Sein eines und unbewegt sei; der Geometrietreibende würde ebenso wenig innerhalb seiner Episteme über seine archaí Auskunft geben (184b25 ff.). Vor allem zeigt Aristoteles im ersten Buch der Physik die Inkonsistenzen eines radikalen Monismus auf. Hier stoßen wir auf die vor allem aus der Metaphysik bekannte Aussage, dass das Sein (bzw. das ‚Seiend‘) in vielfacher Weise ausgesagt würde: pollachós légetai tó ón 92 W. Wieland, Die aristotelische Physik. Untersuchungen über die Grundlegung der Naturwissenschaft und die sprachlichen Bedingungen der Prinzipienforschung bei Aristoteles, 3., um ein Vorwort erw. Aufl., Göttingen 1992. 93 Aristotle’s Physics. A revised text with introduction and commentary by W. D. Ross, (repr. of the 1 st ed. 1936) Oxford 1966. 130 (185a21). Als Gemeinsamkeit aller Naturphilosophen erachtet Aristoteles die Annahme zweier grundlegender Gegensätze, aus denen die Naturerscheinungen erklärt werden können (vgl. I 5, 188a19 ff.). Freilich müsse zu diesen Gegensätzen ein Drittes hinzukommen. Nach dieser Kritik an dem Überlieferten stellt sich allmählich als Hauptthema die Frage nach dem Werden ein. Diesbezüglich stellt Aristoteles fest, dass immer irgendein Werdendes „zugrunde liegen“ müsse (hypokeísthai, 190a15). Damit meint er, dass wenn aus einem unmusischen ein musischer Mensch werde, der Mensch als Werdendes zugrunde liege. Damit hänge zusammen, dass jedes Werdende immer ein „zusammengesetztes“ sei (synthetón, 190b11). Zahlenmäßig mag das Werdende zwar eines sein (wie der Mensch), jedoch nicht ‚eidetisch‘, nicht dem Begriff nach. Zu unterscheiden seien beispielsweise bei einem Werdensprozess wie dem oben beschriebenen das Menschsein und das Unmusischsein. Ersteres hielte sich durch im Werden, letzteres vergehe, so könne man von einem Werden von etwas zu etwas sprechen. Am Ende dieses ersten Buches kommt Aristoteles im Zusammenhang mit der Erörterung der allem Werden möglicherweise zugrunde liegenden Hyle ein erstes Mal auf ein „Göttliches, Gutes und Anstrebenswertes“ zu sprechen, was dasjenige, das wächst (von Natur aus entsteht), anstrebt und begehrt. Hierin sieht man eine Bestimmung des sog. Unbewegten Bewegers bzw. des Prinzips der Bewegung, von welchem Aristoteles im achten und letzten Buch der Physik sprechen wird (VIII, 4 ff., vgl. Met. XII, 6 ff.). Bevor er jedoch dazu kommen wird, ist es ein langer Weg. Ein Teil dieses Weges wird bestritten durch die Erwägung dessen, was eigentlich Bewegung ist. Zunächst heißt es am Anfang des zweiten Buches, dass jedes von Natur Seiende in sich die arché kinéseos hat, den Urgrund der Bewegung (192b13 f.). Hier ist die berühmte Stelle, wo die phýsei ónta von den mé phýsei ónta abgehoben werden, die „von Natur Seienden“ von den „nicht von Natur Seienden“. Zugleich werden auch Weisen der Bewegung angegeben: Ortsbewegung, Vermehrung und Vernichtung, Veränderung (b14 f.). Als Beispiele für „nicht von Natur Seiende“ werden die klíne, das Bett bzw. die Liege, und das Gewand genannt. Diese können auch als téchne ónta bezeichnet werden, als „durch Kunstfertigkeit Seiende“. In diesem Abschnitt liest man auch die bekannte Stelle, wo von der Natur als dem solchen Techneprodukten „ersten Innewohnenden“ gesprochen wird. So sei das Holz die Natur des Bettes, wofür ein Anzeichen sei, dass ein in der Erde vergrabenes Bett, wenn es in Fäulnis geriete, nicht ein Bett austreiben würde, sondern einen Baum. Davon ausgehend gelangt man zu einer weiteren Standardaussage aristotelischer Philosophie, die besagt, dass aus einem Menschen ein Mensch wird (vgl. 193b8 ff.). In seiner bekanntesten Version lautet diese Aussage: ánthropos ánthropon genná, „ein Mensch zeugt einen Menschen“. Bei diesem Reden über die Materie als Grundlage und 131 über die (von Natur aus innewohnende) Form (wie den Mensch) als Grundlage nähert man sich der Auflistung der vier Ursachen, die Aristoteles hier im zweiten Buch der Physik unterscheidet, wovon etwas weiter unten die Rede sein wird. Hier soll noch kurz etwas über Aristoteles’ Fassung des Begriffes ‚Bewegung‘ gesagt werden. Am Anfang des dritten Buches spricht Aristoteles deutlich aus, dass einem, wenn man die Natur als eine arché, einen Anfangsgrund, der Bewegung fasse, nicht verborgen bleiben dürfe, was eigentlich Bewegung sei (III 1, 200b13 ff.). Im Zusammenhang mit der Frage nach der Bewegung wird sich Aristoteles der Frage zuwenden, was unter Ort (und Raum) und Zeit zu verstehen sei. Grundsätzlich muss angemerkt werden, dass Bewegung von Aristoteles an mehreren Stellen (wie an dieser) mit metabolé zusammengestellt wird. Der Ausdruck metabolé bezeichnet eigentlich den ‚Umschlag‘ (von metabállein). Nun spricht mitunter Aristoteles von metabolé in der Weise, dass er sie als Oberbegriff für Veränderung auffasst. Sie fungiert dann als Gattungsbezeichnung für vier Arten von Veränderungen, für Vergehen/Entstehen (phthorá/génesis), für Vermehrung (aúxesis, quantitative Veränderung), Änderung (alloíosis, qualitative Veränderung) und ‚Trage‘ (phorá, Veränderung des Ortes).94 Mag auch die Ortsbewegung die primäre Art von Bewegung für Aristoteles sein, so sollte doch bedacht werden, dass sie für ihn nicht die einzige Art ist. Das heißt, dass etwas auch der Umschlag von Rot nach Grün (qualitative metabolé, alloíosis) als Bewegung zu fassen ist. Welche vier aitíai unterscheidet Aristoteles im zweiten Buch der Physik? Von großer philosophiegeschichtlicher Bedeutung ist Aristoteles’ Unterscheidung von vier Ursachen bzw. Urgründen, welche er im zweiten Buch der Physik vorgenommen hat. Er befasst sich mit den Weisen, wie von aítion, von ‚Ursache‘ geredet wird, deshalb, weil es ihm, wie er sagt, in seiner Abhandlung um das Erlangen von Wissen geht. Wissen erlange man aber dann über etwas, wenn man das diá tí, das „wodurch“ bzw. „warum“ kenne (194b17 ff.). Als erste Weise, wie von „Ursache“ gesprochen wird, nennt Aristoteles das „Woraus“ etwas als dem Zugrundeliegenden wird. Als Beispiel nennt er die Bronze eines Standbildes. Dies wurde später als die causa materialis, die Materialursache bezeichnet. Die zweite Weise, in der von „Ursache“ die Rede ist, betrifft die Form, die causa formalis. Die Formalursache wird hier mit zwei Wörtern benannt, die aus der Platonlektüre bekannt sind, mit eídos ‚Gestalt, Form‘ und parádeigma ‚Muster (Beispiel)‘. Diese seien der lógos, die Definition, das tí én eínai einer Sache. tó tí én eínai („das, was es war zu sein“) ist eine von Aristoteles geprägte 94 Vgl. S. Föllinger, s.v. metabolê / Veränderung, in: Höffe, Aristoteles-Lexikon (o. Anm. ►), 346-348. 132 Formulierung, deren Deutung in einer Fülle von Literatur unternommen wird.95 Ferner kann als aítion bezeichnet werden der Ursprung des „Wandels“ oder des „Stillstandes“, was nachmalig causa efficiens genannt wurde. Die vierte und letzte Art von aítion ist das télos. Dieses Wort bezeichnet das ‚Ziel‘ oder den ‚Zweck‘, weshalb man von ‚Teleologie‘ als der Betrachtung zielgerichteter Prozesse spricht. Die dementsprechende causa erhielt die Bezeichnung finalis. Hier in der Physik wird das télos als das hoú héneka bezeichnet, als das ‚Worumwillen‘, welches im Griechischen sprachlich vom „Wodurch“ (diá tí), dem vorgelagerten Grund, unterschieden werden kann. Freilich muss das „Worumwillen“ und das „Wodurch“ sachlich nicht immer ein Verschiedenes sein: Bei den phýsei ónta ist, wie das Beispiel mit Vater und Sohn zeigt, das hóthen he arché und das télos dem Eidos nach identisch, worauf auch der berühmte Satz ánthropos ánthropon genná „ein Mensch zeugt einen Menschen“ hinweist. Im Bereich der durch Herstellung Seienden hingegen sind die genannten Ursachen verschieden – beim Beispiel des Standbildes ist die Bewegungsursache der Künstler und das Ziel das fertige Standbild. Das von Aristoteles gewählte Exempel für ein télos ist die Gesundheit als Zweck des Spazierens – hier erscheint das Verbum peripateín, dessen Substantivierung der Schule des Aristoteles den Namen gab: Peripatos. Ort und Zeit In der Neuzeit wurde die Physik des Aristoteles lange Zeit hindurch bekämpft bzw. späterhin belächelt. Seine Betrachtungen zur Natur seien absurd oder schlichtweg unrichtig. Im 20. Jahrhundert änderte sich die Haltung der Physik gegenüber. Beispielsweise stießen im phänomenologischen Kontext Aristoteles’ Aussagen zu Raum und Zeit (wobei bei Aristoteles eher von ‚Ort‘ und Zeit die Rede sein sollte) erneut auf Interesse. In aller Kürze sollen im Folgenden zwei Skizzen versucht werden zu demjenigen, was Aristoteles und „Ort“ und „Jetzt“ versteht. Die diesbezüglichen Abhandlungen finden sich im vierten Buch der Physik. An dessen Beginn sagt Aristoteles, dass es für den Naturforscher notwendig sei, auch zu erkennen, was es mit dem tópos, mit dem Ort auf sich habe, ob es ihn gebe, wie er sei und was er sei. Dies sei notwendig, weil die „am meisten gemeinsame und eigentlichste“ Form der Bewegung die Bewegung gemäß dem Orte sei, die phorá (208a32 ff.). Auch an dieser Stelle ist ablesbar, dass die Ortsbewegung für Aristoteles nur eine Form von Veränderung ist, wenngleich sie die „eigentlichste“ Bewegung ist. 95 Vgl. z. B. E. Dönt in: Aristoteles, Kleine naturwissenschaftliche Schriften (o. Anm. ►), 15. 133 Wovor man sich hüten sollte im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit Aristoteles’ Rede von dem Ort ist, dass man den Ort im Sinne eines Punktes auffasst, der in einem Koordinatensystem verortbar ist. Vielmehr ist, und dies soll hier vor allem deutlich gemacht werden, der Ort für Aristoteles ein Zwischen. Und genau diese Auffassung machte sein Reden vom Ort für die Phänomenologie des 20. Jahrhunderts so interessant. Was mit diesem Zwischen gemeint ist, kann aus dem wiederkehrenden Beispiel einer Ortsbewegung einleuchten. Aristoteles spricht davon, dass das Wasser, wenn es das Gefäß verlässt, seinen Topos verlässt und an die Stelle des Wassers Luft tritt. Dies betont Aristoteles einerseits, um die Vorstellung von einem leeren Raum, der zurückbleibe, zu widerlegen. Für ihn ist der Raum etwas Kontinuierliches. Zum anderen kann dieses Beispiel demonstrieren, dass der Ort nicht etwas über eine bestimmte Materie zu Definierendes ist. Er ist nicht das Hohle innerhalb des Gefäßes, sondern das Zwischen zwischen Gefäß und Wasser oder zwischen Gefäß und Luft. Deshalb war oben von einem Zwischenbegriff die Rede. Man kann sagen, dass ein Ort immer zwei Dinge voraussetzt, die ihn konstituieren, die aber nie der Ort selbst sind. Ihr Zwischen macht den ersten Topos aus, die weiteren Umgebenden bildeten weitere Orte. Des Weiteren ist besonders bemerkenswert Aristoteles’ Sprechen von der Ortsbewegung der „natürlichen einfachen Körper“ wie die Elemente Feuer und Erde, die sich in eigentümlicher Bewegung an einen ihnen eigenen Ort bewegten (sofern sie nichts daran hindere; 208b8 ff.). Diese Bewegung der natürlichen Körper zeige, dass der Ort eine gewisse dýnamis, eine Kraft bzw. spezifische Fähigkeit, eine Dynamik habe (208b11). Freilich ist das, was Aristoteles tópos nennt, für ihn mit vielen Aporien verbunden (vgl. 208a32), mit denen er sich in diesem vierten Buch auseinandersetzt. Ein ähnlicher Zwischenbegriff ist in der aristotelischen Physik derjenige des „Jetzt“. Es ist das Zwischen zwischen dem Nicht-Mehr und Noch-Nicht. Eine berühmt gewordene Formulierung aus Aristoteles’ Anhandlung über das Jetzt besagt, dass das Jetzt einerseits (immer) dasselbe, andererseits (immer) etwas anderes ist (Phys. IV, 11, 219b12 f.). 96 Dies kann man so verstehen, dass es dasselbe ist hinsichtlich seiner Trennungsfunktion zwischen einem Früher und Später, und andererseits je verschieden ist als konkreter Zeitpunkt (z. B. „Jetzt ist Nachmittag.“ oder „Jetzt ist Länderspiel.“). Man mag dies für eine einfache Erklärung des Jetzt und damit verbunden der Zeit halten. Man kann dies freilich auch mit der hochspekulativen Aus- 96 Stellvertretend für viele Autoren, die sich mit dieser Bestimmung des Jetzt auseinander setzten, sei Thomas von Aquin genannt (vgl. z. B. Summa theologiae 1 q. 10 a. 4), der übrigen einen Kommentar zur Physik des Aristoteles verfasst. Für einen Überblick über die Rezeptionsgeschichte der aristotelischen Zeitphilosophie vgl. die Monographie von P. F. Conen, Die Zeittheorie des Aristoteles, München 1964 (Zetemata; 35). Vgl. auch E. Rudolph (Hrsg.), Zeit, Bewegung, Handlung. Studien zur Zeitabhandlung des Aristoteles, Stuttgart 1988 (Forschungen und Berichte der Evangelischen Studiengemeinschaft; 42). 134 einandersetzung mit der Zeit im deutschen Idealismus zusammenrücken. Dies tat in gewisser Weise Martin Heidegger, der am Ende von Sein und Zeit lapidar in einer Fußnote anmerkt: „Aristoteles sieht das Wesen der Zeit im νῦν, Hegel im Jetzt.“97 Freilich bietet sich eine solche Zusammenstellung schon aufgrund des Anfangs der Phänomenologie des Geistes an, wo von „dem Jetzt“ die Rede ist. Auch Aristoteles’ Zeittheorie selbst muss durchaus nicht simplifizierend gelesen werden. Die entsprechende Passage bei Aristoteles bietet zahlreiche Anknüpfungspunkte zu neuzeitlichen Zeittheorien, sei es die Rede von der Analogie zwischen Bewegung-Ort-Zeit-Jetzt oder von der Abzählbarkeit des durch die Zeit Abgegrenzten. Ein bedeutender Anstoß zu Diskussion ist wohl auch die Erwägung des Aristoteles’, ob es Zeit nur gibt, wenn es jemanden gibt, der ihren Verlaufen konstatiert. Aristoteles sagt, dass man problematisieren könne, ob es Zeit gäbe, wenn es keine Psyche, keine Seele gäbe (223a21 f.). De anima Diese Nennung des Wortes psyché kann als Überleitung zu der zweiten großen Schrift aus dem Bereich der naturphilosophischen Abhandlungen dienen, mit der wir uns hier kurz befassen wollen. Es wurde soeben nochmals ihre Verortung im Bereich der Naturphilosophie genannt. Mindestens ebenso wichtig wie diese Situierung der Schrift zu beachten ist es, das Wort Psyche nicht misszuverstehen. Es bezeichnet wohl im antiken Griechischen etwas anderes, als heutzutage oft unter Seele verstanden wird. Mit psyché ist zunächst das Lebensprinzip gemeint, welches Lebewesen zu Lebewesen macht. Für einen Denker wie Aristoteles, für den das Hyle-Morphismus-Konzept ein wichtiges ist, liegt es nahe, diese psyché als die Form des Körpers zu fassen. So spricht Aristoteles am Anfang des zweiten Buches von De anima davon, dass die Seele das Eidos eines „natürlichen Körpers“ sei, der dem Vermögen nach Leben hat (De an. II, 1, 412a20 f.). Hierin gründet die bekannte scholastische Lehre von der anima als der forma corporis. Diese Schrift des Aristoteles erfreute sich das gesamte Mittelalter hindurch großer Beliebtheit, sowohl im Abendland wie bei den arabischen Gelehrten, beispielsweise zu nennen sind hier Thomas von Aquin und Averroes: So wie zu einigen anderen Texten des Aristoteles verfasste Thomas von Aquin auch zu dieser Schrift einen Kommentar; vor kurzem wurden Auszüge aus den Kommentaren des Averroes zu De anima neu ediert, die einen guten Einblick in die Rezeption dieser Schrift bieten.98 Aber auch von Martin LUTHER sind Kommentare zu De anima 97 M. Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen 182001, 432, Anm. 1. Averroes, Über den Intellekt. Auszüge aus seinen drei Kommentaren zu Aristoteles’ De anima. Arab.-Lat.-Dt. Hrsg., übs., eingel. und mit Anm. vers. von D. Wirmer, Freiburg u. a. 2008. 98 135 erhalten.99 Hegel noch galt diese Schrift als „das vorzüglichste oder einzige Werk von spekulativem Interesse“ über die Seele.100 An ihm kann sich auch der Fokus des Interesses zeigen, der in jüngerer Zeit auf dieser Schrift lag, zumal eine Übersetzung Hegels der Kapitel vier und fünf von De anima erhalten ist.101 In dieser Passage ist unter anderem von dem noús choristós die Rede, von dem abgetrennten (oder abtrennbaren) Geist (bzw. Vernunft) (430a17). Diese Stelle, in der von dem höchsten Seelenvermögen als einem irgendwie trennbaren gesprochen wird, hat die Spekulation immer wieder beflügelt. Gerne wird sie zusammengestellt mit der Rede vom noús, welcher von „türwärts“ (thýrathen) hereinkommt, von außen herankommt. Davon ist bei Aristoteles in der Schrift De generatione animalium („Vom Entstehen und Vergehen“) zu lesen (736b28). Eine ähnlich bekannte Stelle aus De anima ist diejenige aus dem achten Kapitel des dritten Buches, an der es heißt: he psyché tá ónta pós estin pánta – „die Seele ist irgendwie alle Seienden“ (431b21). Um dies nachvollziehen zu können, warum gesagt werden kann, das Lebensprinzip sei irgendwie alles, muss man die von Aristoteles vorgenommene Unterscheidung von Seelenvermögen und seine Bestimmung der Fähigkeiten dieser Vermögen kennen. Abgesehen von dieser Verstehensermöglichung kann die Betrachtung dieser Unterscheidung von großem Wert sein. So könnte eine eingehende Auseinandersetzung damit, wie Aristoteles das bestimmt, was wir landläufig als Wahrnehmung oder Denken zu bezeichnen pflegen, zu einem Vergleich mit entsprechenden neuzeitlichen Ansätzen anregen. Tatsächlich wurde in den letzten Jahrzehnten verstärkt auf die Eigenständigkeit aristotelischer Konzeptionen hingewiesen. Fundamental sei etwa der Unterschied in der Fassung der Wahrnehmung zu einem kantianischen Modell der Rezeptivität der Wahrnehmung. Hier betonen die Proponenten der aristotelischen Wahrnehmungstheorie, dass die Wahrnehmung laut Aristoteles kritische Funktion habe.102 Was versteht Aristoteles unter der aísthesis des koinón? Hier seien einige Anmerkungen zu den sog. Seelenvermögen in aristotelischer Darstellung erlaubt. Zwei zentrale Vermögen der psyché, mit denen sich Aristoteles in De anima befasst, 99 Vgl. Th. Dieter, Der junge Luther und Aristoteles. Eine historisch-systematische Untersuchung zum Verhältnis von Theologie und Philosophie, Berlin - New York 2001 (Theologische Bibliothek Töpelmann; 105), 531-560. 100 G. W. F. Hegel, Enzyklopädie III, ► (Theorie-Werkausgabe; 10), 11; vgl. ders., Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie II, Frankfurt a. M. 1971, 43 ff. (Theorie-Werkausgabe; 19), 198 ff. 101 vgl. W. Kern, Eine Übersetzung Hegels zu De anima III, 4-5, in: Hegel-Studien 1 (1961), 49-88. 102 Vgl. z. B. W. Bernard, Rezeptivität und Spontaneität der Wahrnehmung bei Aristoteles. Versuch einer Bestimmung der spontanen Erkenntnisleistung der Wahrnehmung bei Aristoteles in Abgrenzung gegen die rezeptive Auslegung der Sinnlichkeit bei Descartes und Kant, Baden-Baden 1988. 136 sind die aísthesis und der noús. Ein weiteres Vermögen bezeichnet er als phantasía, dieses nimmt eine gewisse Zwischenstellung zwischen Aisthesis und Nous ein. Als ein anderer wichtiger Terminus dieser begrifflichen Zergliederung der Seele wäre die mnéme, das Gedächtnisvermögen zu nennen. Je nachdem nämlich, an wie vielen dieser Vermögen die Lebewesen Anteil hätten, seien sie in unterschiedliche Gattungen unterschieden (vgl. II, 3, 414a29 ff.). Der erste Terminus für ein Vermögen, welcher hier kurz angesprochen werden soll, ist derjenige der aísthesis. Dieses Wort wird häufig mit ‚Wahrnehmung‘ ins Deutsche übertragen. Dabei zeigt sich aus der aristotelischen Analyse der aísthesis, dass die immer wieder in der Philosophiegeschichte geäußerte Kritik an dieser Übersetzung nicht unberechtigt ist. Man könnte aísthesis neutraler mit ‚Perzeption‘ übersetzen. Diese Übersetzungsprobleme beruhen unter anderem darauf, dass bei Aristoteles von aísthesis mindestens in zweierlei Hinsicht die Rede sein kann. Zum einen gibt es die aísthesis der ídia, zum anderen die aísthesis der koiná. Die ídia bezeichnen das jedem Sinn Eigentümliche. Beispielsweise ist das ídion des Sehens die Farbe (II 6, 418a13). Dem Sehsinn kommt als eigentümliche Fähigkeit zu, Farben zu unterscheiden, dem Hören kommt zu, Töne zu unterscheiden. Beispiele für etwas Gemeinsames, das von mehreren Sinnen perzipiert wird, sind die Größe oder die Bewegung (418a17f.). Als dritte Form ist noch die aísthesis von symbebekóta, von Akzidentellem, zu nennen. So ist die Wahrnehmung, dass das Ding, welches ich mit meinen Sinnen unterscheide, ein Individuum mit einem Eigennamen ist, eine Wahrnehmung von etwas Akzidentellem. Wichtig an dieser Analyse der aísthesis ist auch, dass die Perzeption der ídia sich nicht irrt (418a12), wohingegen bei der aísthesis von Größe oder ähnlichem oder von Akzidentellem eine Täuschung möglich ist. So simpel dies klingen mag, so drastisch sind die Konsequenzen aus dieser Analyse der aísthesis. Denn zunächst erhellt daraus, dass die aísthesis kritische Funktion hat, sie vermag etwas zu unterscheiden. Des Weiteren liefert die Unterscheidungsleistung der aísthesis der ihr eigentümlichen Gegenstände sichere Kenntnis. Hier könnte man auch von Gewissheit sprechen. Das etwas rot ist, ist dem Vollzieher der aísthesis gewiss. Wahrheit freilich, so könnte man weiter sagen, setzt erst mit der aísthesis der koiná oder der akzidentellen Entitäten ein, wenn ich zum Beispiel „Sokrates“ wahrnehme. Dabei zeigt sich auch, dass die Aussage, „ich sehe Sokrates“ eigentlich nicht die Wahrnehmung in ihrer eigentlichen Funktion trifft. Auf diese gestützt dürfte man nur sagen, ich sehe eine gewisse Farbkombination. Dieses Sehen ist allerdings wie gesagt gewiss. 137 Dies wurde so ausführlich erläutert, weil plausibel gemacht werden sollte, warum an der Übersetzung ‚Wahrnehmung‘ für aísthesis Anstoß genommen wurde. In Anlehnung an den Beginn von Hegels Phänomenologie des Geistes könnte man sagen, dass die Wahrnehmung erst dasjenige ist, was auf die sinnliche Gewissheit folgt, und damit auch die Täuschung einsetzt. Diese Analyse der Perzeption gilt als ein Signum der Eigenständigkeit platonischaristotelischer Philosophie gegenüber neuzeitlichen oder vor allem auch stoischen Konzepten. An letzteren wird von Gelehrten, die diese Eigenständigkeit herausstreichen wollen, kritisiert, dass sie die Perzeption überfordern, insofern in ihr schon alles gegeben sein soll, was in einem späteren Erkenntnisprozess unterschieden wird (vgl. hierzu z. B. die Arbeiten von Arbogast SCHMITT).103 Diese Untäuschbarkeit verbindet die Perzeption der eigentümlichen Gegenstände mit dem noús, welcher sozusagen das höchste der Seelenvermögen ist. Dieses Wort wird unterschiedlich mit ‚Geist‘, ‚Vernunft‘ oder auch ‚Denken‘ übersetzt. Das Denken aber der „Unteilbaren“ (tón adihairéton) bewegt sich in demjenigen Bereich, in dem es keine Täuschung gibt (III 6, 430a26 f.). Die Täuschung bzw. Falschheit gebe es immer nur in Zusammensetzungen. Ein weiterer Terminus für so etwas wie ein Seelenvermögen ist derjenige der phantasía. Derjenige Passus in De anima, welcher für eine Definition dieses Phänomens gehalten wird, ist wohl einer der am intensivsten verhandelten Sätze aus dieser Schrift. Im dritten Kapitel des dritten Buches heißt es: „Die Phantasia ist etwas anderes als Aisthesis und Dianoia.“ (427b14 f.). Das Definiendum wird, so könnte man vielleicht sagen, als Zwischen zwischen der Aisthesis, von der oben die Rede war, und der Dianoia bestimmt. Die Dianoia nun könnte man als dasjenige fassen, was ein ‚Nachdenken‘ bezeichnet (dies legen zumindest einige Platonstellen zur Dianoia nahe). Wie allerdings genau das bei Aristoteles mit phantasía Bezeichnete ist, ist durchaus umstritten und bleibe hier dahingestellt. Zum Abschluss wollen wir auf den eingangs zitierten Satz zurückkommen, welcher besagt, dass die Seele in gewisser Weise alle Seienden ist. Aus dem inzwischen Gehörten kann man ein vorläufiges Verständnis dieses Satzes gewinnen. Aristoteles unterteilt die Seienden in zwei Gruppen, in die aisthetá und noetá, in die der Perzeption zugänglichen und die dem Geist zugänglichen. Die oben genannten Vermögen der aísthesis und des noús verhalten sich zu diesen beiden Gruppen von Seienden als die entsprechenden Fähigkeiten, sie bilden den Teil des aisthetikón und epistemonikón, des zur Perzeption und des zum Wissen fähigen Seelenteiles (431b25 f.). Insofern kann also gesagt werden, dass die psyché irgendwie alles ist, weil sie die in zwei Gruppen aufgeteilten Seienden mit den entsprechenden Vermögen auf103 Z. B. A. Schmitt, Platon und das empirische Denken der Neuzeit, Stuttgart 2006. 138 nehmen kann. Allerdings tut sie dies in der Weise, dass sie die Seienden ohne Materie in die Seele aufnimmt, wie Aristoteles wiederholt sagt. Diesbezüglich gibt es in De anima die markante Aussage, dass der Stein „nicht in der Seele“ (431b29) ist (sehr wohl seine Form). In diesen Zusammenhang gehört dann die ebenfalls in der Scholastik oftmals traktierte Aussage, die Seele sei das eídos eidón, die forma formarum: „Das Lebensprinzip ist genau wie die Hand: Denn die Hand ist das Werkzeug der Werkzeuge, und der Geist ist die Gestalt (Form) der Gestalten (Formen) und das Vernehmen ist die Gestalt (Form) der Vernehmbaren (Entitäten).“ (432a1-3). 139 Metaphysik Bei der Metaphysik des Aristoteles bereitet bereits der Titel Schwierigkeiten. Er ist eine nacharistotelische Fügung, und man konnte bis heute nicht exakt rekonstruieren, was damit gemeint ist. Dies wäre nicht weiter problematisch, aber immerhin fungierte dieser Titel lange Zeit quasi als alter nomen der Philosophie, als andere Bezeichnung für das Unternehmen Philosophie. Aristoteles spricht selbst nicht von Metaphysik. Das, worum es ihm in den Texten, die unter dem Titel ‚Metaphysik‘ zusammengefasst sind, geht, benennt er selbst als próte philosophía, als „Erste Philosophie“. Wenn Sie dies ins Lateinische übersetzen, sind Sie bei der prima philosophia, von der zum Beispiel im Titel von René DESCARTES’ Meditationes die Rede ist: Meditationes de prima philosophia in quibus Dei existentia et animae humanae a corpore distinctio demonstrantur.104 Der Name ‚Metaphysik‘ wird in mindestens zweierlei Weise gedeutet: Er bezeichne entweder schlicht diejenige Schrift, welche „nach der Physik“ stehe, oder diejenige Abhandlung, welche sich mit den Problemen befasse, welche auf die Physik folgen.105 Was sind aber diese Fragen, die auf die Physik folgen bzw. worum dreht sich die próte philosophía, die Erste Philosophie. Eine populär gewordene Wendung aus der Metaphysik aufgreifend könnte man sage, in ihr geht es um das „Sein als Sein“, das ón hé ón (vgl. IV 1, 1003a21), das ens qua ens. Mit einem namhaften Philosophen des zwanzigsten Jahrhunderts könnte man auch sagen, sie fragt nach dem Sein des Seienden. Als solche Philosophie, die nach dem Seienden als solchem fragt, kann sie ‚Ontologie‘ im eigentlichen Sinn genannt werden, Lehre vom ón oder den ónta, vom Sein oder den Seienden. Freilich ist dieser Ausdruck eine Prägung der Neuzeit, als Schöpfer dieses Wortes wird Rudolph GÖCKEL (latinisiert Rudolphus Goclenius) genannt. Zur Gliederung der Metaphysik Die Metaphysik umfasst 14 Bücher. Diese formen, so könnte man sagen, ein noch uneinheitlicheres Kompendium als andere Schriften des Aristoteles. Eine Gruppe an Büchern, die in der Philosophiegeschichte besonders intensiv diskutiert wurde und wird, ist diejenige der so genannten Substanzbücher. Dies sind die Bücher sieben bis neun. Vornehmlich die Bücher der aristotelischen Metaphysik werden, das sei angemerkt, gerne mit griechischen Buchstaben 104 Meditationen über die Erste Philosophie, in denen das Dasein Gottes und die Verschiedenheit der menschlichen Seele vom Körper bewiesen werden. 105 Vgl. D. Frede, s. v. Aristoteles, Der neue Pauly 1 (1996), 1140; Aristoteles, Metaphysik. Übs. und eingeleitet von T. A. Szlezák, Berlin 2003, VII und XXIII-XXVII. 140 zitiert. Die entsprechenden Lettern für die Substanzbücher sind Zeta (Z), Eta (H) und Theta (Θ). Hierbei werden die Buchstaben des griechischen Alphabets (entsprechend ihrer Reihenfolge) als Zahlzeichen verwendet. Verwundern mag, dass das Zeta als der sechste Buchstabe des attischen Einheitsalphabets auf das siebente Buch hinweist. Dies hängt damit zusammen, dass es zwei Bücher gibt, welche mit dem Buchstaben Alpha bezeichnet werden, also zwei erste Bücher. Neben dem Buch A gibt es das Buch álpha élatton, das „kleinere A“, bei dem es sich wohl um eine Nachschrift handelt. Dies mag zugleich auf formaler Ebene die Inhomogenität der Metaphysik anzeigen. In den Substanzbüchern geht es, wie der Name sagt, vornehmlich um die Substanz, wobei dieses lateinische Fremdwort hier als Übersetzung des griechischen Wortes ousía fungiert. Wie dieser Terminus in der Metaphysik zu fassen ist und ob und wie er sich von dem, was in den Kategorien ousía genannt wird, unterscheidet, ist eine schwierige Angelegenheit. Wir wiesen oben auf dieses Problem hin. Rund um die Substanzbücher sind Bücher gruppiert, welche sich mit anderen Fragen der Ersten Philosophie befassen. Welche diese Fragen sind, listet das dritte Buch auf. Eine gewisse Sonderstellung hat das Buch fünf (Delta), in dem eine Übersicht über verschiedene philosophische Begriffe gegeben wird. Von gesondertem Interesse war immer wieder das zwölfte Buch, in dem Aristoteles über das spricht, was der „Unbewegte Beweger“ genannt wird. Das erste Buch der Metaphysik – das Streben nach Wissen, die Muße und das Staunen Die Metaphysik hebt an mit dem berühmten Satz: pántes ánthropoi toú eidénai orégontai phýsei – „Alle Menschen begehren von Natur aus nach Wissen“ (980a22). Als Zeichen dafür nennt Aristoteles die Wertschätzung der Sinne (aisthéseis). Man würde sie um ihrer selbst willen schätzen, vor allem den Sehsinn. Diese Hochschätzung des Sehsinnes führt Aristoteles noch aus und erläutert, dass er uns am meisten von allen Sinnen Erkenntnis verschaffe und Unterschiede klar mache (980a26 f.). Daran schließt eine Angabe der Stufen von Erkenntnisvermögen und den entsprechenden Lebensformen. Manche Lebewesen verfügten zusätzlich zur Aisthesis über Gedächtnis, manche noch dazu über Empirie, über Erfahrung. Der Mensch weise auch téchne auf und Berechnung (logismoí) (a27 ff.). Dieser Stufung im Tierreich entsprechend gäbe es eine Stufung innerhalb des menschlichen Erkennens. Aus vielfacher Erinnerung einer selben Sache entstehe Erfahrung. Aus einem Komplex an Erfahrungen wiederum resultiere eine Techne. Dies illustriert Aristoteles mit der Ausbildung der Arztkunst. Wenn jemand wiederholt die Erfahrung mache, welches Mittel 141 wem nutze, so entstehe allmählich eine Techne. Dieser sei noch übergeordnet das Wissen um das diá tí, des „Warum“ (981b12). Diese Entwicklung sei nicht nur im individuellen Bereich anzutreffen, auch die Menschheit habe sich so entwickelt. Am meisten geschätzt würde der sophós, der Kluge, der die Gründe für alles und jedes angeben könne. Hier plaudert Aristoteles sozusagen aus der Schule, insofern er ausspricht, dass die Philosophie dort beginnen könne, wo alle anderen Lebensbedürfnisse befriedigt seien. Als Beispiel dient ihm Ägypten. Zuerst seien die Wissensformen, die nicht zur Befriedigung der notwendigen Bedürfnisse da sein, in den Regionen entstanden, wo die Menschen Muße gehabt hätten. So seien in Ägypten die mathematischen technaí entwickelt worden, weil dem Priesterstand dort Muße gewährt worden sei (981b23 ff.). Bei der darauf folgenden Angabe für eine Abstufung der Wissenschaften zeigt sich die von Platon bekannte Orientierung der antiken Philosophie hin auf das Gute. So sagt Aristoteles, dass diejenige epistéme die archikotáte, die herrschendste bzw. oberste oder gründendste sei, welche das „Worum willen“ einer jeden Handlung kenne (982b4 f.). Dieses Worumwillen, dieser Zweck sei aber das Gute, allgemein das Beste in der Natur. Diese Form von epistéme sei die Klugheit bzw. Weisheit, welche die ersten Anfänge und Ursachen theoretisiere. Eine weitere Parallele zu Platon folgt sogleich: Die Menschen beginnen und begannen, so Aristoteles, aufgrund des Staunens mit der Philosophie (982b12 f.). Wie lautet der Satz des Widerspruchs in der aristotelischen Formulierung? Ein Philosoph, der über das Sein die ersten Gründe und Ursachen angeben können soll, muss laut Aristoteles’ Ausführungen im vierten Buch der Metaphysik einen unerschütterlichsten Grund kennen. Dieser ist für ihn dasjenige, was in der Philosophiegeschichte der Satz des Widerspruchs genannt wird. In Aristoteles’ Formulierung lautet dieser Satz: „Denn es ist unmöglich, dass dasselbe ein und demselben gemäß derselben Hinsicht zugleich zukomme und nicht zukomme.“ (IV 3, 1005b19 f.). Dieser Grundsatz sei anhypótheton, voraussetzungslos. Zu beachten an dieser Formulierung ist das „zugleich“ und „gemäß derselben Hinsicht“. Dies präzisiert die Aussage und sichert sie gegen klassische Widerlegungsversuche des Satzes des Widerspruchs (der Kreisel ist zugleich in Ruhe [Zentrum] und Bewegung [Peripherie], aber er ist dies nicht zugleich in derselben Hinsicht). Freilich gibt es zahlreiche Diskussionen, wie dieser Satz überhaupt zu verstehen sei. Diskutiert wird etwa, ob er als logisches oder ontolo- 142 gisches Prinzip aufzufassen sei.106 Das heißt, ob er die gleichzeitige Gültigkeit zweier entgegengesetzter Propositionen aussage, oder ob er fundamental etwas über die Verfasstheit der Welt vorbringe. Zu beachten ist an dieser Formulierung auch das Wort „zukommen“. Hinter diesem steht das griechische hypárchein, welches bei den Kategorien begegnet ist. Des Weiteren ist besonders erstaunlich, dass Aristoteles nicht nur darauf hinweist, dass dieser Grundsatz nicht bewiesen werden kann, sondern dass man auch wissen solle, wovon man einen Beweis verlangen darf und wovon nicht. In welchen Weisen wird „Sein“ ausgesagt? Ein für die weitere Philosophie nicht weniger wichtiger Satz steht am Beginn des siebenten Buches der Metaphysik. Dort heißt es: tó ón légetai pollachós – „Das Sein wird in vielfacher Weise ausgesagt.“ (1028a10). Es könne nämlich ein „dieses da“, ein Einzelding bezeichnen, ebenso aber etwas irgendwie Beschaffenes oder irgendwie Großes oder überhaupt eine dieser Kategorien. Aristoteles greift damit am Eingang der Substanzbücher auf die Unterscheidungen der Kategorien zurück. Auch hier in der Metaphysik macht Aristoteles deutlich, dass die erste Weise, in der von „Sein“ die Rede sie, diejenige sei, die das „Was“ bezeichnet, welches eben die ousía anzeige. Eine Werk, welches sich mit dieser mannigfachen Bedeutung des Seins auseinandersetzt, war ein wichtiger Impuls für die so genannte Phänomenologie im 20. Jahrhundert.107 Dynamis-Energeia Was bei einem derartigen Kurzstreifzug durch die Erste Philosophie des Aristoteles unbedingt erwähnt werden sollte, ist das Begriffspaar dýnamis-enérgeia, welches für Aristoteles’ gesamtes Werk von großer Wichtigkeit ist. Mit diesem Paar wird eine weitere Art bezeichnet, in der Seiendes sein kann. Es gibt dynámei ónta und energeía ónta, „der Möglichkeit“ und „der Wirklichkeit“ nach Seiende. Das Wort dýnamis wird oft mit „Möglichkeit“ übersetzt. Dabei bezeichnet es zumeist die bestimmte, nicht die abstrakte Möglichkeit. Man könnte diese bestimmte Möglichkeit auch als spezifische Fähigkeit fassen. Ein aristotelisches Paradebeispiel für ein dynámei ón, für etwas der Möglichkeit nach Seiendem, ist der Same, aus dem etwas 106 Vgl. z. B. M. Wedin, Aristotle on the firmness of the principle of non-contradiction, Phronesis 49 (2004), 225-265. 107 Franz Brentano widmete seine Dissertation dem Thema Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles (Freiburg i. B. 1862). Ein Exemplar dieser Arbeit erhielt der achtzehnjährige Martin Heidegger von seinem damaligen Mentor Conrad Gröber zum Geschenk. 143 wächst. Allgemeiner gesagt sind die Naturvorgänge primär über dieses Begriffspaar bestimmbar, wobei für Aristoteles außer Zweifel steht, dass die der Wirklichkeit nach Seienden den der Möglichkeit nach Seienden vorausgehen. So gehe der wirklich seiende Musiker dem, der zu einem solchen ausgebildet wird, voraus (IX 9, 1049b4 ff.). Jedes aus einer Möglichkeit sich Entwickelnde entstehe immer aufgrund eines „ersten Bewegenden“ (1049b27). Dieses erste Bewegende sei eben „im Wirken“. Wörtlich könnte man nämlich des Ausdruck enérgeia mit „Im-Wirken-Sein“ oder ähnlichem zu übersetzen versuchen, zumal er aus den Elementen en- „in“ und einer Wurzel erg- besteht, welche beispielsweise aus dem Wort érgon „Werk“ bekannt ist. Das allererste Bewegende, welches in der höchsten Form von enérgeia befindlich ist, ist der so genannte Unbewegte Beweger. Er ist das höchste Gut, nach dem alles strebt, weswegen gesagt werden kann, dass er alles bewegt. Um diesen Beweger geht es, wie eingangs erwähnt, im zwölften Buch der Metaphysik. Dort ist im siebenten Kapitel vom Nous, der Vernunft bzw. dem Geist, die Rede. Dieser Nous denke sich selbst unter „Hinzunahme“ des Denkbaren bzw. des Gedachten. Wenn er dieses habe, so sei er in enérgeia (1072b20 ff.). Dies aber sei die Theoria, die Betrachtung, die angenehmste und beste Tätigkeit. Uns Menschen sei nur manchmal dieser angenehmste Zustand beschieden, dem Gott immer, dem auch Leben zukomme, da die enérgeia des Nous Leben sei (b27). Nikomachische Ethik108 Unter dem Namen des Aristoteles sind drei Abhandlungen zur Ethik erhalten, die Nikomachische Ethik, die Eudemische Ethik und die so genannten Magna Moralia.109 Die Nikomachische Ethik, der längste dieser Traktate, gilt bis heute als Grundbuch des Nachdenkens über das (richtige) Verhalten (éthos) des Menschen. Bereits ihr erster Satz gibt einen Hinweis auf die verschiedenen Arten menschlicher Tätigkeiten und auf ihr gemeinsames Ziel (I 1, 1094 a 1-3): 108 Die folgenden Übersetzungen sind entnommen aus: A. Dunshirn, Griechisch für Philosophen, Wien 2007, 114 ff. 109 Die Magna Moralia werden in der Forschung heute meist für nicht von Aristoteles stammend gehalten. Auf ihren Titel („Große Ethik“) spielt der Titel von Theodor W. Adornos Aphorismensammlung Minima Moralia („Kleinste Ethik“) an (Th. W. Adorno, Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben, Neuausg. der Erstausg. 1951, Frankfurt a. M. 2001). Die Eudemische Ethik war in ihrer Echtheit umstritten, gilt zur Zeit jedoch für aristotelisch (vgl. dazu z. B. Aristoteles, Nikomachische Ethik. Übersetzt und hrsg. von U. Wolf, Reinbek bei Hamburg 2006, 10). Die Nikomachische Ethik und die Eudemische Ethik sind jeweils nach historischen Gestalten benannt, einerseits nach Aristoteles’ Sohn Nikomachos und andererseits nach dem Herausgeber Eudemos. 144 Jede Kunstfertigkeit und jede Verfahrensweise, in gleicher Weise auch (jede) Handlung und auch Entscheidung, scheint sich auf etwas Gutes hin zu entwerfen (scheint etwas Gutes zu begehren): Deshalb hat man in schöner Weise das Gute aufgezeigt als das, woraufhin sich alles entwirft. Die Erkenntnis (gnósis) dieses Guten habe, so führt Aristoteles weiter aus, ein großes Gewicht für die Einrichtung des Lebens (1094a22 f.). Die Bestimmung dessen, was das Gute generell ist, komme offensichtlich der politiké (téchne), der Politik bzw. Kenntnis des Staatswesens zu. Danach unternimmt Aristoteles eine kritische Auseinandersetzung mit Leuten, die eine Idee des Guten annahmen. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung fällt auch die Aussage (1096a14-17): „Es könnte vielleicht besser scheinen und notwendig zur Rettung der Wahrheit, das Eigene aufzugeben, vor allem wenn es sich um Philosophen handelt: Denn auch wenn beide lieb sind, ist es fromm, die Wahrheit vorzuziehen.“ Auf der Grundlage dieser Aussage wurde die lateinische Formel geprägt: Amicus Plato, sed magis amica veritas. Dann wendet sich Aristoteles im fünften Kapitel der Suche des „Vollendeten“ bzw. „Abschließenden“ zu (1097a28-31): Das Beste aber scheint etwas Vollendetes/Abschließendes zu sein. Daher wäre, wenn es nur ein einziges Vollendetes/Abschließendes gibt, dies das Gesuchte, wenn aber mehrere, das Vollendetste/Abschließendste von diesen. Wir bezeichnen aber als vollendeter/abschließender das gemäß sich selbst Erstrebte als das um einer anderen Sache willen (Erstrebte). Darüber hinaus sei, so fährt Aristoteles fort, dasjenige, was niemals um einer anderen Sache willen gewählt werde, vollendeter als dasjenige, das sowohl an sich selbst als auch einer anderen Sache willen erstrebt wird. Als möglichen Kandidaten für ein solches téleion nennt Aristoteles das Glück, das in einem gewissen Zusammenhang mit der „Selbstgenügsamkeit“ stehe (1097a34 - b16): Etwas Derartiges aber scheint ganz besonders die Glückseligkeit (eudaimonía) zu sein. Denn diese wählen wir immer um ihrer selbst willen und niemals um einer anderen Sache willen; Ehre, Lust, Vernunft und jede ‚Bestform‘ aber wählen wir zwar auch um ihrer selbst willen […], wir wählen sie aber auch wegen der Glückseligkeit […] Es scheint sich aber auch aus der Selbstgenügsamkeit dasselbe zu ergeben: Denn das vollendete/abschließende Gut scheint selbstgenügsam zu sein. […] Für das Selbstge145 nügsame halten wir das, was vereinzelt (auch wenn man es als einziges hat) das Leben wählenswert macht und keiner Sache bedürftig: Wir glauben, dass etwas Derartiges die Glückseligkeit ist. Besonders bekannt ist die aristotelische Ethik für ihre mesótes-Lehre, die Lehre vom anzustrebenden Mittelmaß zwischen zwei Extremen. Die areté, die Tugend bzw. Bestform, befinde sich in der Mitte zwischen zwei schlechten charakterlichen Ausprägungen. Diese Ansicht führt Aristoteles beispielsweise in der Zusammenfassung der Definition der areté im fünften Kapitel des zweiten Buchs der Nikomachischen Ethik aus (1106b36 - 1107a6): Es ist also die ‚Bestform‘ eine zur Entscheidung fähige Haltung, die in der Mitte ist im Verhältnis zu uns und welche bestimmt ist durch den Logos, mit dem sie auch der Besonnene bestimmen würde. Sie ist die Mitte zweier Schlechtigkeiten, einer, die einer Übersteigerung zufolge, und einer anderen, die einem Zurückbleiben zufolge entsteht. Und ferner dadurch, dass die einen (Schlechtigkeiten) hinter dem Gebührenden zurückbleiben, die anderen es überschreiten in den Erlebnissen und Handlungen, ist die ‚Bestform‘ das Finden und Wählen des Mittleren. Es Auf diese Definition der areté folgt im siebenten Kapitel eine Auflistung einzelner aretaí und der entsprechenden Ausdrücke für das jeweilige Übermaß und die Mangelform dieser Einzeltugenden. In manchen Bereichen fehlten Bezeichnungen für eines der beiden Extreme, wie dies zum Beispiel bei der Lust der Fall sei: Hinsichtlich der Lust werde die anzustrebende Mitte als sophrosýne, als „Mäßigkeit“ bezeichnet,110 das Übermaß als akolasía, als „Zügellosigkeit“; es gebe jedoch kaum Leute, die einen Mangel an Lust zeigen, weswegen dieser Zustand keinen Namen erhalten hätte (1107b5-8). Einige der aufgelisteten aretaí beziehen sich auf die „Gemeinschaft in den Logoi und Handlungen“ (1108a11), wie diejenige hinsichtlich der alétheia, der Wahrheit (1108a19-23): Und in Hinblick auf das Wahre sei der Mittlere ein „wahrhafter (Mensch)“ genannt, und die Mitte „Wahrheit“; der Anspruch aber auf zu Großes (sei) „Prahlerei“ (genannt), und der ihn erhebt „Prahler“, der auf zu Wenig jedoch (sei) „Verstellung“ (genannt), und der ihn erhebt „einer, der sich verstellt“. 110 Zu só-phron „von gesundem Verstand, besonnen“, gebildet aus sós „heil, gesund“ und phrén „Verstand“. 146 Was hier mit „Verstellung“ übersetzt ist, heißt griechisch eironeía, wovon das Wort ‚Ironie‘ abgeleitet ist. Das siebente Kapitel des zehnten und letzten Buches handelt über die beste Tätigkeit. Der Tätigkeit des Nous, der Vernunft bzw. des Geistes, wird dabei der Vorrang vor anderen Tätigkeiten eingeräumt (1177b16-24): Wenn nun von den gemäß den Bestformen (ausgeführten) Handlungen diejenigen, welche die Polis und den Krieg betreffen, an Schönheit und Größe hervorragen, aber keine Muße lassen, sich auf irgendein Ziel entwerfen und nicht um ihrer selbst willen wählenswert sind, und wenn dagegen die Tätigkeit des Geistes sich sowohl durch ihre Ernsthaftigkeit (davon) zu unterscheiden, zumal sie betrachtend ist, als auch sich neben ihr selbst auf kein Ziel zu entwerfen und eine ihr eigene Lust zu haben scheint […], und wenn es sich zeigt, dass das selbstgenügsame, müßige und unermüdete Leben – sofern es dem Menschen möglich ist – und alles, was dem Glücklichen zugeschrieben wird, gemäß dieser Tätigkeit besteht, dann wäre dies die vollendete/abschließende Glückseligkeit des Menschen … 147 Literatur Homer - Übersetzungen, Einführungen Homer, Ilias. Neue Übertragung von W. Schadewaldt. Mit zwölf antiken Vasenbildern, Frankfurt a. M. 1975. Homer, Die Odyssee. Dt. von W. Schadewaldt, Reinbek bei Hamburg 1987. Bannert, H., Homer. In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten dargestellt, Reinbek bei Hamburg 1979 (Rowohlts Monographien; 272). Bannert, H., Homer lesen, Stuttgart - Bad Cannstatt 2005 (Legenda; 6). Schadewaldt, W., Die Anfänge der Philosophie bei den Griechen. Die Vorsokratiker und ihre Voraussetzungen. Tübinger Vorlesungen Bd. 1. Unter Mitw. von M. Schadewaldt hrsg. von I. Schudoma, Frankfurt a. M. 1978. Im Platonteil genannte Literatur I Aristoteles, Der Protreptikos. Einleitung, Text und Kommentar von I. Düring, Frankfurt a. M. 2 1993. Aristoteles, Protreptikos. Hinführung zur Philosophie. Rekonstruiert, übersetzt und kommentiert von G. Schneeweiss, Darmstadt 2005 (Texte zur Forschung; 85). Assmann, J., Weisheit und Mysterium: das Bild der Griechen von Ägypten, München 2000. Bormann, K., Platon, 4., erneut durchges. Aufl., Freiburg-München 2003 Büttner, S., Die Literaturtheorie bei Platon und ihre anthropologische Begründung, TübingenBasel 2000. Büttner, S., Antike Ästhetik. Eine Einführung in die Prinzipien des Schönen, München 2006. Deleuze, G., Logik des Sinns. Aus dem Französischen von B. Dieckmann, Frankfurt a. M. 1993. Derrida, J., Platons Pharmazie, in: ders., Dissemination. Hrsg. von P. Engelmann. Übersetzt von H.-D. Gondek, Wien 1995, 69-190. Dover, K. J., Greek Homosexuality, New York 1978. Düring, I., Aristotle’s Protrepticus. An Attempt at Reconstruction, Göteborg 1961 (Studia Graeca et Latina Gothoburgensia; 12). Ferber, R., Warum hat Platon die „ungeschriebene Lehre“ nicht geschrieben?, München 2007. Gaiser, K., Platons ungeschriebene Lehre, Stuttgart 21968. Heidegger, M., Platon: Sophistes. Marburger Vorlesung Wintersemester 1924/25, hrsg. von I. Schüßler, Frankfurt a. M. 1992 (Gesamtausgabe; 19). Hirzel, R., Der Dialog: Ein literarhistorischer Versuch, reprograf. Nachdr. d. Ausg. Leipzig 1895, Hildesheim o. J. Hösle, V., Der philosophische Dialog. Eine Poetik und Hermeneutik, München 2006. Krämer, H. J., Arete bei Platon und Aristoteles. Zum Wesen und zur Geschichte der platonischen Ontologie, Heidelberg 1959 (Abh. d. Heidelb. Akad. d. Wiss., Phil.-Hist. Kl.; 1959, 6). Krämer, H. J., Die platonische Akademie und das Problem einer systematischen Interpretation der Philosophie Platons, Kant-Studien 55, 1964, 69-101. Krüger, G., Einsicht und Leidenschaft. Das Wesen des platonischen Denkens, Frankfurt a. M. 6 1992. Lévinas, E., Autrement qu’ être ou au-delà de l’essence [„Jenseits des Seins“], Le Haye 1974. Nüsser, O., Albins Prolog und die Dialogtheorie des Platonismus, Stuttgart 1991. Pieper, J., Das Viergespann: Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß, 42.-43. Tsd., München 1998. 148 Radke, G., Die Theorie der Zahl im Platonismus. Ein systematisches Lehrbuch, Tübingen u. a. 2003. Radke, G., Platon lehren und lernen. Der Philosophieunterricht in der Spätantike, Berlin 2008. Reis, B., Der Platoniker Albinos und sein sogenannter Prologos. Prolegomena, Überlieferungsgeschichte, kritische Edition und Übersetzung, Wiesbaden 1999 (Serta Graeca; 7). Rijlaarsdam, J. C., Platon über die Sprache. Ein Kommentar zum Kratylos, Utrecht 1978. Rousseau, J.-J., Emil oder Über die Erziehung. Vollst. Ausg. In dt. Fassung besorgt von L. Schmidts, Paderborn u. a. 131998. Die Sophisten. Ausgewählte Texte, Gr./Dt. Hrsg. und übs. von Th. Schirren und Th. Zinsmaier, Stuttgart 2003. Szlezák, Th. A., Das Bild des Dialektikers in Platons späten Dialogen. Platon und die Schriftlichkeit der Philosophie Teil II, Berlin - New York 2004. Thesleff, H., Studies in Platonic Chronology, Helsinki 1982 (Commentationes humanarum litterarum; 70) 8-17. Thiel, D., Platons Hypomnemata. Die Genese des Platonismus aus dem Gedächtnis der Schrift, Freiburg-München 1993. Trawny, P., Sokrates oder Die Geburt der Politischen Philosophie, Würzburg 2007. Prolégomènes à la philosophie de Platon. Texte établi et trad. par L. G. Westerink, Paris 1990. Wieland, W., Platon und die Formen des Wissens, 2., durchges. und um einen Anhang und ein Nachw. erw. Aufl., Göttingen 1999. Brisson, L., Le Même et l’Autre dans la Structure Ontologique du Timée de Platon. Un commentaire systématique du Timée de Platon, 2. éd. revue, St. Augustin 1994 (International Plato Studies; 2). Cornford, F. M., Plato’s Cosmology, New York 1957. Derrida, J., Chōra, 2., überarb. Aufl., Wien 2005 (Edition Passagen; 32). Happ, H., Hyle, Berlin 1971. Perger, M. von, Die Allseele in Platons Timaios, Stuttgart-Leipzig 1997 (Beiträge zur Altertumskunde; 96). Im Aristotelesteil genannte Literatur Ackrill, J. L., Aristoteles. Eine Einführung in sein Philosophieren, Berlin - New York 1985 (Sammlung Göschen; 2224). Aristoteles Latinus, Bd. 1 ff., Bruges-Paris 1961 ff. (Union académique internationale. Corpus philosophorum medii aevi). Aristoteles, Kleine naturwissenschaftliche Schriften (Parva naturalia). Übersetzt und hrsg. von E. Dönt, Stuttgart 1997. Aristoteles, Metaphysik. Übs. und eingeleitet von T. A. Szlezák, Berlin 2003. Aristoteles, Organon. Bd. 3/4: Erste Analytik. Zweite Analytik. Gr.-dt. Hrsg., übs., mit Einl. und Anm. versehen von H. G. Zekl, Hamburg 1998. Aristotle’s Physics. A revised text with introduction and commentary by W. D. Ross, (repr. of the 1st ed. 1936) Oxford 1966. Aristoteles, Topik. Übs. und komm. von T. Wagner und Ch. Rapp, Stuttgart 2004. Bekker, I. (Hg.), Aristoteles Graece ex recensione ed. Academia Regia Borussica, 2 Bde., Berlin 1831. Averroes, Über den Intellekt. Auszüge aus seinen drei Kommentaren zu Aristoteles’ De anima. Arab.-Lat.-Dt. Hrsg., übs., eingel. und mit Anm. vers. von D. Wirmer, Freiburg u. a. 2008. Bernard, W., Rezeptivität und Spontaneität der Wahrnehmung bei Aristoteles. Versuch einer Bestimmung der spontanen Erkenntnisleistung der Wahrnehmung bei Aristoteles in Ab149 grenzung gegen die rezeptive Auslegung der Sinnlichkeit bei Descartes und Kant, BadenBaden 1988. Conen, P. F., Die Zeittheorie des Aristoteles, München 1964 (Zetemata; 35). Detel, W., Aristoteles, Leipzig 2005. Düring, I., Aristoteles. Darstellung und Interpretation seines Denkens, Heidelberg 1966. Heidegger, M., Heraklit. Der Anfang des abendländischen Denkens. Logik. Heraklits Lehre vom Logos, Frankfurt a. M. 1994 (Gesamtausgabe Bd. 55). Höffe, O., Aristoteles, 3., überarb. Aufl., München 2006 (Beck’sche Reihe; 535). Höffe, O. (Hg.), Aristoteles-Lexikon, Stuttgart 2005 (Kröners Taschenausgabe; 459). Jaeger, W., Aristoteles. Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung, Berlin 1923. Kern, W., Eine Übersetzung Hegels zu De anima III, 4-5, in: Hegel-Studien 1 (1961), 49-88. Rapp, Ch., Aristoteles zur Einführung, 3., überarb. Aufl., Hamburg 2003. Rapp, Ch., Aristoteles und aristotelische Substanzen, in: K. Trettin (Hg.), Substanz. Neue Überlegungen zu einer klassischen Kategorie des Seienden, Frankfurt a. M. 2005, 145169. Rudolph, E. (Hrsg.), Zeit, Bewegung, Handlung. Studien zur Zeitabhandlung des Aristoteles, Stuttgart 1988 (Forschungen und Berichte der Evangelischen Studiengemeinschaft; 42). Schmitt, A., Platon und das empirische Denken der Neuzeit, Stuttgart 2006. Thiel, R., Aristoteles’ Kategorienschrift in ihrer antiken Kommentierung, Tübingen 2004 (Philosophische Untersuchungen; 11). Wedin, M., Aristotle on the firmness of the principle of non-contradiction, Phronesis 49 (2004), 225-265. Wieland, W., Die aristotelische Physik. Untersuchungen über die Grundlegung der Naturwissenschaft und die sprachlichen Bedingungen der Prinzipienforschung bei Aristoteles, 3., um ein Vorwort erw. Aufl., Göttingen 1992. 150