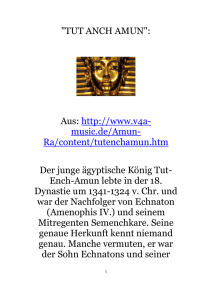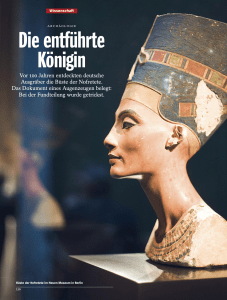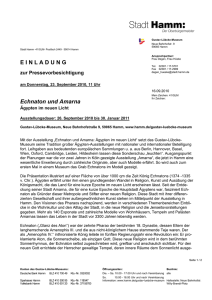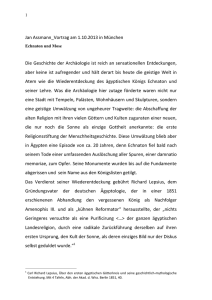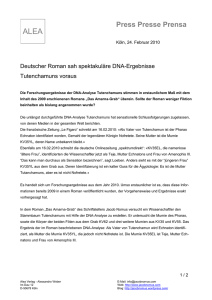Grandiose Heidelberger "Echnaton"-Oper
Werbung
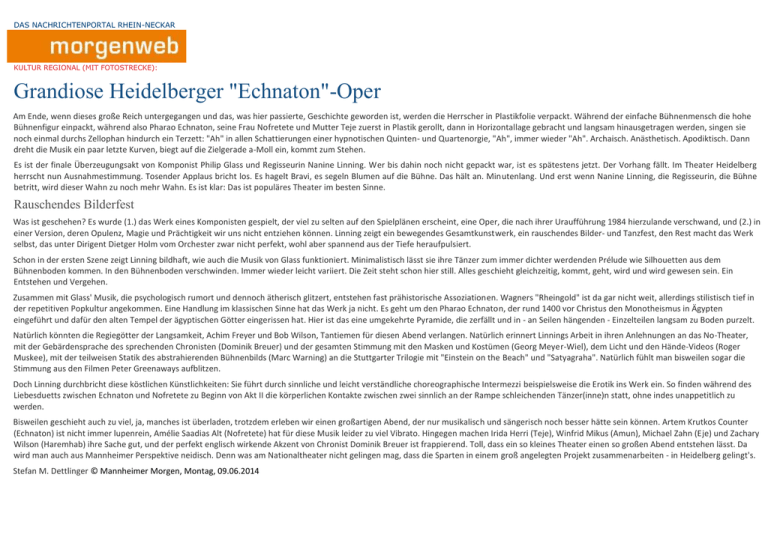
DAS NACHRICHTENPORTAL RHEIN-NECKAR KULTUR REGIONAL (MIT FOTOSTRECKE): Grandiose Heidelberger "Echnaton"-Oper Am Ende, wenn dieses große Reich untergegangen und das, was hier passierte, Geschichte geworden ist, werden die Herrscher in Plastikfolie verpackt. Während der einfache Bühnenmensch die hohe Bühnenfigur einpackt, während also Pharao Echnaton, seine Frau Nofretete und Mutter Teje zuerst in Plastik gerollt, dann in Horizontallage gebracht und langsam hinausgetragen werden, singen sie noch einmal durchs Zellophan hindurch ein Terzett: "Ah" in allen Schattierungen einer hypnotischen Quinten- und Quartenorgie, "Ah", immer wieder "Ah". Archaisch. Anästhetisch. Apodiktisch. Dann dreht die Musik ein paar letzte Kurven, biegt auf die Zielgerade a-Moll ein, kommt zum Stehen. Es ist der finale Überzeugungsakt von Komponist Philip Glass und Regisseurin Nanine Linning. Wer bis dahin noch nicht gepackt war, ist es spätestens jetzt. Der Vorhang fällt. Im Theater Heidelberg herrscht nun Ausnahmestimmung. Tosender Applaus bricht los. Es hagelt Bravi, es segeln Blumen auf die Bühne. Das hält an. Minutenlang. Und erst wenn Nanine Linning, die Regisseurin, die Bühne betritt, wird dieser Wahn zu noch mehr Wahn. Es ist klar: Das ist populäres Theater im besten Sinne. Rauschendes Bilderfest Was ist geschehen? Es wurde (1.) das Werk eines Komponisten gespielt, der viel zu selten auf den Spielplänen erscheint, eine Oper, die nach ihrer Uraufführung 1984 hierzulande verschwand, und (2.) in einer Version, deren Opulenz, Magie und Prächtigkeit wir uns nicht entziehen können. Linning zeigt ein bewegendes Gesamtkunstwerk, ein rauschendes Bilder- und Tanzfest, den Rest macht das Werk selbst, das unter Dirigent Dietger Holm vom Orchester zwar nicht perfekt, wohl aber spannend aus der Tiefe heraufpulsiert. Schon in der ersten Szene zeigt Linning bildhaft, wie auch die Musik von Glass funktioniert. Minimalistisch lässt sie ihre Tänzer zum immer dichter werdenden Prélude wie Silhouetten aus dem Bühnenboden kommen. In den Bühnenboden verschwinden. Immer wieder leicht variiert. Die Zeit steht schon hier still. Alles geschieht gleichzeitig, kommt, geht, wird und wird gewesen sein. Ein Entstehen und Vergehen. Zusammen mit Glass' Musik, die psychologisch rumort und dennoch ätherisch glitzert, entstehen fast prähistorische Assoziationen. Wagners "Rheingold" ist da gar nicht weit, allerdings stilistisch tief in der repetitiven Popkultur angekommen. Eine Handlung im klassischen Sinne hat das Werk ja nicht. Es geht um den Pharao Echnaton, der rund 1400 vor Christus den Monotheismus in Ägypten eingeführt und dafür den alten Tempel der ägyptischen Götter eingerissen hat. Hier ist das eine umgekehrte Pyramide, die zerfällt und in - an Seilen hängenden - Einzelteilen langsam zu Boden purzelt. Natürlich könnten die Regiegötter der Langsamkeit, Achim Freyer und Bob Wilson, Tantiemen für diesen Abend verlangen. Natürlich erinnert Linnings Arbeit in ihren Anlehnungen an das No-Theater, mit der Gebärdensprache des sprechenden Chronisten (Dominik Breuer) und der gesamten Stimmung mit den Masken und Kostümen (Georg Meyer-Wiel), dem Licht und den Hände-Videos (Roger Muskee), mit der teilweisen Statik des abstrahierenden Bühnenbilds (Marc Warning) an die Stuttgarter Trilogie mit "Einstein on the Beach" und "Satyagraha". Natürlich fühlt man bisweilen sogar die Stimmung aus den Filmen Peter Greenaways aufblitzen. Doch Linning durchbricht diese köstlichen Künstlichkeiten: Sie führt durch sinnliche und leicht verständliche choreographische Intermezzi beispielsweise die Erotik ins Werk ein. So finden während des Liebesduetts zwischen Echnaton und Nofretete zu Beginn von Akt II die körperlichen Kontakte zwischen zwei sinnlich an der Rampe schleichenden Tänzer(inne)n statt, ohne indes unappetitlich zu werden. Bisweilen geschieht auch zu viel, ja, manches ist überladen, trotzdem erleben wir einen großartigen Abend, der nur musikalisch und sängerisch noch besser hätte sein können. Artem Krutkos Counter (Echnaton) ist nicht immer lupenrein, Amélie Saadias Alt (Nofretete) hat für diese Musik leider zu viel Vibrato. Hingegen machen Irida Herri (Teje), Winfrid Mikus (Amun), Michael Zahn (Eje) und Zachary Wilson (Haremhab) ihre Sache gut, und der perfekt englisch wirkende Akzent von Chronist Dominik Breuer ist frappierend. Toll, dass ein so kleines Theater einen so großen Abend entstehen lässt. Da wird man auch aus Mannheimer Perspektive neidisch. Denn was am Nationaltheater nicht gelingen mag, dass die Sparten in einem groß angelegten Projekt zusammenarbeiten - in Heidelberg gelingt's. Stefan M. Dettlinger © Mannheimer Morgen, Montag, 09.06.2014