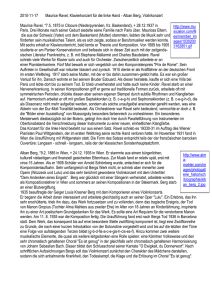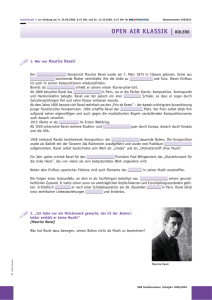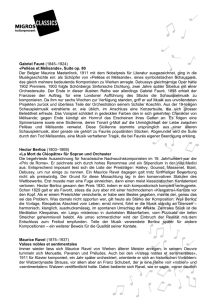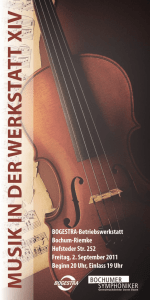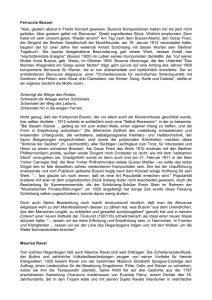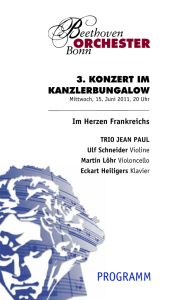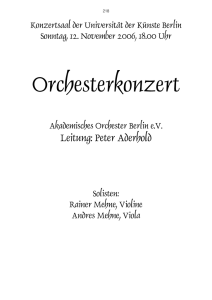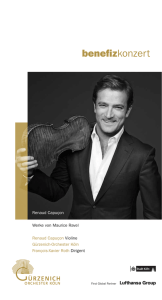ö 1-klassiker 12140
Werbung

Ö 1-KLASSIKER SCHMIDT + PFITZNER + RAVEL MEDIENBEGLEITHEFT zur CD Franz Schmidt (1874-1939) Symphonie Nr. 4 C-Dur, 49.02 Minuten Hans Pfitzner (1869-1949) Vorspiele zur musikalischen Legende »Palestrina«, 22.21 Minuten Maurice Ravel (1875-1937) La Valse – Poème chorégraphique, 12.27 Minuten Miroirs – Suite für Klavier, 29.35 Minuten Konzert für Klavier und Orchester G-Dur, 21.04 Minuten Bolero, 14.58 Minuten 12140 Ö 1-KLASSIKER: SCHMIDT + PFITZNER + RAVEL Das vorliegende Heft ist die weitgehend vollständige Kopie des Begleitheftes zur CD Konzept der Zusammenstellung von Dr. Haide Tenner, Dr. Bogdan Roscic, Lukas Barwinski Executive Producer: Lukas Barwinski Musik Redaktion: Dr. Gustav Danzinger, Dr. Robert Werba, Albert Hosp, Mag. Alfred Solder Text: Eleonore Kratochwil Lektorat: Michael Blees Grafikdesign: vektorama. Fotorecherche: Österreichische Nationalbibliothek/ Mag. Eva Farnberger Fotos: ORF, Österreichische Nationalbibliothek, Bildarchiv Herausgeber der CDs und der Begleithefte: Universal Music GmbH, Austria 2007 Besonderen Dank an: Prof. Alfred Treiber, Mag. Ruth Gotthardt, Dr. Johanna Rachinger, Musiksammlung der Österreichischen Nationalbibliothek Medieninhaber und Herausgeber des vorliegenden Heftes: Medienservice des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur 1014 Wien, Minoritenplatz 5 Bestellungen: Tel. 01/982 13 22-310, Fax. 01/982 13 22-311 E-Mail: [email protected] 2 Ö1-KLASSIKER, VOLUME 40 SCHMIDT + PFITZNER + RAVEL FRANZ SCHMIDT: SYMPHONIE NR. 4 C-DUR »Ehrlicher als Richard Strauss, einfallsreicher als Reger und formvollendeter als Bruckner« – so beschreibt Hans Pfitzner seinen Zeitgenossen Franz Schmidt. Ein großes Lob, das Pfitzners Bewunderung für den um fünf Jahre jüngeren Kollegen bezeugt. Nicht von allen Kollegen war Schmidt so geschätzt worden. Nach der Jahrhundertwende hatten sich zwei musikalische Lager gebildet. Während die Avantgarde die Auflösung der traditionellen Formmodelle und Funktionsharmonien vorantrieb, hielten die drei Hauptvertreter der konservativen Tendenz, Schmidt, Reger und Pfitzner, an der klassischen Tradition fest. Kritiker des musikalischen Anti-Modernismus verurteilten deren Werke aus diesem Grund als »epigonenhaft« und »konventionell«. Doch Schmidt war ganz im Gegenteil zeitlebens von einem Form- und Erneuerungswillen durchdrungen gewesen. Gerade die »klassischsten« der Formen, die Sonatensatzform und die Symphonie, hielt er für den besten Raum für seine Experimente. Dieses Bild eines »verspielten« und experimentierfreudigen Schmidt wurde und wird noch immer durch gängige Formulierungen verstellt. So auch bei seiner vierten Symphonie, wo Texte über das Werk, die es als »einsätzig« beschreiben oder die Sätze als »pausenlos aneinandergefügt«, die eigentliche Neuheit verschweigen: Nicht die Auflösung der Viersätzigkeit war Schmidts Ziel gewesen, sondern eine formale Straffung. Durch Kombination der Symphonie mit der Sonatensatzform gelingt Schmidt hier ein originelles Werk, das doch ganz und gar dem klassischen Geist entspricht. Im formalen und inhaltlichen Zentrum der Symphonie steht Schmidts Trauer um den Tod seiner geliebten Tochter Emma, die bei der Geburt ihres Kindes gestorben war. Schmidt hatte diese Bekenntnissymphonie selbst als »Requiem« bezeichnet und als Mittelteil des Adagios einen Trauermarsch komponiert, von dem aus sich das Werk in vollkommener Symmetrie nach beiden Seiten hin aufbaut. So ist der rhythmisch pochende Marsch eingebettet in zwei Durchführungen – die durchführungsartige Wiederholung der »Exposition« einerseits und die eigentliche »Durchführung« des Werks, das Scherzo des dritten Satzes. Schmidt dazu: »Nach dem eine Katastrophe andeutenden Abschluss der Durchführung (Scherzo), tritt die Reprise des ersten Satzes ein, in der alles gereifter und verklärter erscheint.« Nicht nur dieses Zitat, auch andere Ausführungen des Komponisten zur Vierten deuten auf die programmatischen außermusikalischen Gedanken hin. Am Ende der Symphonie erklingt schließlich das Trompetensolo des Anfangs. Dazu Schmidt: »Es ist sozusagen die letzte Musik, die man ins Jenseits hinübernimmt, nachdem man unter ihren Auspizien geboren und das Leben gelebt hat.« Franz Schmidt Franz Schmidt Grabmahl am Wiener Zentralfriedhof. 3 Franz Schmidt wurde am 22. Dezember 1874 in Pressburg geboren. Die Familie übersiedelte 1888 nach Wien, was für das musikalische Wunderkind Franz bedeutete, dass er am damaligen Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde studieren würde können. Nach seinem Musikstudium erhielt er 1896 die Stelle eines Cellisten im Hofopernorchester und wurde damit Mitglied der Wiener Philharmoniker. Ab 1901 wirkte er als Cellolehrer am Konservatorium, ab 1914 als Klavierpädagoge, ab 1922 auch als Lehrer für Kontrapunkt und Komposition, als der er zahlreiche später bedeutende Musiker, Dirigenten und Komponisten ausbildete. Von 1925 bis 1927 war er Direktor, von 1927 bis 1931 Rektor der späteren Universität für Musik. Diese glänzende berufliche Laufbahn steht ganz im Kontrast zu seinem Privatleben, das von schweren Schicksalsschlägen nicht frei blieb. Schmidts erste Frau dämmerte ab 1919 in Wien in der Heilanstalt »Am Steinhof« dahin. Nach der Heirat mit seiner ehemaligen Klavierschülerin Margarethe Jirasek schien sich sein Leben wieder etwas stabilisiert zu haben. Doch von dem Trauma, das Schmidt beim Tod der Tochter 1932 erlitt, sollte sich der gesundheitlich bereits Angeschlagene nicht mehr erholen. In den letzten Lebensjahren wurde er mit dem Beginn des nationalsozialistischen Regimes konfrontiert, unter dem er die Kantate »Deutsche Auferstehung« schrieb. Obwohl Schmidt zeitlebens ein unpolitischer Mensch gewesen war, hatte der Text der Kantate sein ganzes musikalisches Schaffen posthum stark kompromittiert. HANS PFITZNER: VORSPIELE ZUR MUSIKALISCHEN LEGENDE »PALESTRINA« Auch Hans Pfitzner hatte den Aufstieg der Nationalsozialisten erlebt. Seine Bemühungen, als »Deutschester« unter den Komponisten des Dritten Reiches anerkannt und gewürdigt zu werden, führten nach dem Ende des Dritten Reiches dazu, dass seine Werke von den Konzertbühnen ferngehalten wurden. In der Zeit nach dem Krieg überlebte beinahe nur die musikalische Legende »Palestrina« auf den Spielplänen. Pfitzner hatte sich bei diesem Werk einer historischen Figur angenommen, deren Leben legendär geworden war: Dem italienischen Kirchenkomponisten Giovanni Pierluigi da Palestrina, der im 16. Jahrhundert in Rom gelebt hatte, wird nichts weniger als die so genannte »Rettung der Musik« nachgesagt. Beim Trienter Konzil sollte unter den vielen Reformen auch die Verbannung der inzwischen verweltlichten Kirchenmusik beschlossen werden. Palestrina hatte dies, so die Legende, im letzten Moment verhindern können. Pfitzner war während früher Studien der Musikgeschichte auf den Komponisten gestoßen: »Ich sah sofort, dass das Leben dieses Mannes ein Künstlerdrama ersten Ranges in sich schloss, wenn auch nicht ein Drama in gewöhnlichem Sinne und herkömmlicher Form. Meine Version war etwa diese: Da sitzt ein Mann in Rom beinahe das 16. Jahrhundert hindurch an ein und derselben Stelle, verlässt den Ort, wo er wirkt, sein ganzes Leben lang nicht. Er tut nichts weiter als seiner Kunst dienen [...], von nichts belohnt, als dem Gefühl seines Wertes, im Dunkeln. Da auf einmal fällt auf ihn ein blendendes Licht, er steht sozusagen in welthistorischer Bedeutung da.« Grundlegend erschien Pfitzner dabei der Kontrast jener beiden Welten, zwischen denen sich in seiner Vorstellung der Künstler Palestrina zerrieb: eine »äußerliche« Welt, in der sich das menschliche Wirken in seiner Zeitlichkeit abspielt, sowie eine innere Welt, »die im Herzen des schöpferischen Menschen die Ewigkeit sucht«. So beginnt der erste Akt in der eigentlichen Palestrina-Welt, in einem Innenraum, dem Wohnzimmer des Komponisten. Die Stimmung ist bereits im Vorspiel gedämpft. Gerade übt Palestrinas Schüler Silla den von der Kirche verpönten neuen 4 Florentiner Stil. Kardinal Borromeo, der mit Sillas Vater unerwartet das Zimmer betritt, ist über die weltliche Musik verärgert – und verwundert, als der alte Meister den Jungen in Schutz nimmt. Nun berichtet der Kardinal, dass der Papst angedroht hat, die mehrstimmige Figuralmusik zu verbieten. Der Kaiser habe aber verlangt, dass zuvor noch ein neues Werk komponiert werden solle, in dem die vom Papst geforderte Gregorianik mit der Mehrstimmigkeit zusammengeführt werden solle. Palestrina sei erwählt worden, diese Messe zu schreiben. Als der Komponist ablehnt, da er sich dieser Aufgabe nicht gewachsen und keine künstlerische Kraft mehr in sich fühlt, verlässt der Kardinal erzürnt den Raum. Dem bedrückten Palestrina, der einsam zurückbleibt, erscheinen in der Dämmerung geheimnisvolle Gestalten: Es sind die Komponisten vergangener Zeiten, die den Künstler auffordern, das Werk in Angriff zu nehmen und so ihre Musik vor dem Vergessen zu bewahren. In einer Vision erblickt er auch seine verstorbene Frau. Endlich erscheinen Engelsgestalten, die ihm die Melodien der neuen Messe, die er schaffen soll, vorsingen. Er beginnt fieberhaft zu schreiben, bis er völlig erschöpft einschläft. »Palestrina« im Theater an der Wien, 1949 Walter Berry in »Palestrina«, Wr. Staatsoper, 1964 Der zweite Akt, der das Trienter Konzil als einen Pool weltlicher Eitelkeiten bloßstellt, steht in starkem Kontrast zu den beiden anderen Akten. Wieder werden im Vorspiel Geschehnisse und Atmosphäre bereits im Voraus gespiegelt. Die lauten, grellen und grotesken Farben in der Musik bilden den Tumult ab, zu dem es im Sitzungssaal des Konzils kommt, nachdem Borromeo die Festnahme des »ketzerischen« Palestrina bestimmt hat. Das Vorspiel zum letzten Akt zeigt einen gebrochenen Mann: Nach der Entlassung aus dem Gefängnis sitzt Palestrina wieder an seinem Schreibtisch. Sein Sohn hatte die Entlassung bewirkt, indem er die Messe, deren Notenblätter er im Zimmer des Vaters gefunden hatte, dem Kardinal übergeben hat. Der Erfolg der neuen Messe ist so groß, dass der Papst selbst bei Palestrina erscheint, um ihm seine Anerkennung auszusprechen. Die Feier des Volkes macht der müde und resignierte Mann nicht mit: Er bleibt in seinem Zimmer allein zurück. Obwohl Pfitzner die Zusammenstellung der drei Vorspiele für den Konzertsaal selbst vorgenommen und zu diesem Zweck auch jedes mit einem eigenen Konzertschluss versehen hatte, handelt es sich bei den drei Stücken um keine selbständigen und voneinander unabhängigen »Ouvertüren«: Das dreiteilige Werk ist durchwegs von Motiven und Themen bestimmt, die in der Oper selbst erscheinen. Die Schaffenskrise Palestrinas, seine Zweifel und seine Verzweiflung, stehen im Mittelpunkt der Musik des ersten und dritten Vorspiels. Dazwischen charakterisiert das 5 Orchester die dem Komponisten fremde und feindlich gesinnte Außenwelt. Feindlich vor allem deshalb, weil diese Welt mit ihren mannigfaltigen Interessen, Tendenzen und Einflüssen ihn seiner künstlerischen Welt ständig zu entreißen droht. Vor den Geistern der toten Komponisten verteidigt er sein Verhalten: »Ihr lebtet stark in einer starken Zeit, die dunkel noch im Unbewussten lag. Doch des Bewusstseins Licht, das tödlich grelle, das störend aufsteigt wie der freche Tag, ist Feind dem süßen Traumgewirk, dem KünsteSchaffen; der Stärkste streckt vor solcher Macht die Waffen.« Wie modern das Künstlerdrama »Palestrina« ist, wird deutlich, wenn man bedenkt, dass gerade die Zeit, in der Pfitzner komponierte, geprägt war durch eine umfassende Krise der abendländischen Kunst. Jene bereits erwähnte Spaltung in zwei musikalische Lager entspricht dabei nur einer groben Einteilung, während es in Wirklichkeit zu einer Aufsplitterung in eine Vielzahl von Stilen und Richtungen gekommen war. Belebt wurde dieser Pluralismus der Stile durch das Eindringen exotischer Klangwelten aus China, Japan und Indonesien zum einen, zum anderen durch das Interesse an folkloristischem Musikgut und vor allem auch durch die Novität aus der Neuen Welt, dem Jazz. MAURICE RAVEL: LA VALSE Einer der all diese Neuerungen mit Interesse verfolgte und sogleich in Musik umsetzte, war Ravel. Das Paris der Belle Époque, in dem Ravel aufwuchs, war ein wirtschaftlich blühendes, modernes Zentrum der Welt. Künstler aus allen Nationen lebten und arbeiteten hier. Ravel hatte sich einer Gruppe von jungen Dichtern, Malern und Musikern, die sich die »Apachen« nannten, angeschlossen. So führte er einmal das Leben eines Bohemiens, dann wieder das eines Dandys, der in den eleganten Salons ein- und ausging. Neben der klassischen Ausbildung am Conservatoire spielte er in den Cabarets und besuchte die neuesten Revuen. Der Rhythmus des rauschenden und pulsierenden Paris spiegelt sich in den freudigen Tanzrhythmen von Ravels Musik wider. Ob anmutige Barocktänze oder spanischer Flamenco, ob langsame Ländler oder süße, sentimentale Walzer – Ravel liebte diese Rhythmen und verarbeitete sie wo er nur konnte. So plante er ab 1906 ein Stück, das aus einer ununterbrochenen Reihe von Walzern bestehen würde, eine Art Hommage an Johann Strauß. 1919 war La Valse fertig. Die Komposition hatte wegen ihres turbulenten Schlusses viele Kritiker seiner Zeit irritiert. Doch macht dieser – so Ravel – »phantastische, fatale Wirbel«, der sich über die eleganten Walzer des ersten Teiles des Stücks legt, in seiner freien Struktur gerade die Modernität des Werks aus, das die »Valse nobles et sentimentales« von 1911 schon wieder überwindet. Trotz aller »Phantastik« und Ausgelassenheit spürt man selbst in La Valse wie kalkuliert und kontrolliert der Komponist die Noten setzt – ein Charakteristikum Ravels, dessen Perfektionistentum ihn so weit trieb, dass er von seinen Werken Skizzen aller Art vernichtete. Fast scheint es, als ob Ravel beabsichtigte von seiner Arbeit nur die äußerste »Schicht« zu zeigen. Eine »Maske«? Ravels Musik als kaltes Spiegelbild, hinter dessen glatter Oberfläche sich nichts verbirgt? Ähnlich vielleicht seiner eleganten Erscheinung, die seine Person weitgehend verdeckte, was die besten Freunde später veranlasste, zu sagen, dass sie ihn, Ravel, nie wirklich gekannt hätten. 6 MIROIRS Jenes Stück, das Ravels scheinbar »abgehobene« Wirklichkeit, jene Welt der Spiegelungen und Spiegelbilder am deutlichsten behandelt, ist Miroirs. Ravel hatte die fünf Klavierstücke, die zwischen 1904 und 1905 entstanden waren, seinen Freunden aus dem Künstlerkreis der »Apachen« gewidmet, und zwar nicht beliebig: So war die impressionistische Etüde »Noctuelles« (Nächtlicher Spuk), bei der ein Nachtfalter in seinem unruhigen Flug beobachtet wird, dem Dichter Léon-Paul Fargue zugedacht; »Oiseaux tristes« (Trauernde Vögel), das, wie Ravel selbst meinte, »charakteristischste Stück« der Gruppe, ist hingegen dem Pianisten Ricardo Vines gewidmet, der etliche seiner Werke uraufgeführt hatte. Neben den Bildern aus dem Tierleben stehen malerische Schilderungen des Wassers: »Une barque sur l'Océan« (Eine Barke auf dem Ozean) hatte Ravel für den Maler Paul Sordes geschrieben, während über der »Alborada del gracioso« (Morgenlied des Narren) der Name Michel Calvocoressis steht, eines Musikschriftstellers, der Ravel von Anfang an gewogen gewesen war. »La Vallée des cloches« (Das Tal der Glocken) hatte Ravel – angeregt durch die vielen Pariser Kirchenglocken – dem Komponistenfreund Maurice Delage geschenkt. Mehr als in seinen früheren Werken war Ravel zur Zeit der »Miroirs« von Debussys impressionistischer Technik beeinflusst gewesen. Dessen Idee, Musik zu schreiben, »deren Form so frei erscheine, dass man sie für improvisiert halten könnte«, begeisterte ihn. Die absolute Klangfreiheit des Werks zeigt, wie extrem Ravel in der Umsetzung experimenteller Konzepte war – das Werk ist dadurch überraschend anders als der Rest seiner Instrumentalmusik. Noch mehr überrascht aber, dass sich gerade die suggestiven »Spiegelungen« der Miroirs als die intimere und menschlichere Kunst Ravels entpuppen. KONZERT FÜR KLAVIER UND ORCHESTER G-DUR Mit dem Konzert für Klavier und Orchester in G-Dur, dem vorletzten seiner Werke, kehrte Ravel wieder zur Schlichtheit der musikalischen Mittel zurück: Der Rhythmus ist einfach, die Diatonik dominiert die Chromatik. In den beiden Ecksätzen des Konzerts setzt sich Ravel nun wieder mit der Sonatensatzform auseinander. Dazu treten Elemente des Jazz sowie der baskischen und spanischen Musik. Der Künstler hatte geplant, den Klavierpart bei der Uraufführung 1932 selbst zu übernehmen – doch um seine Gesundheit stand es nicht gut. Schon als Jugendlicher hatte Ravel unter seiner sensiblen körperlichen Verfassung zu leiden gehabt. Seit einem Autounfall, bei dem er Verletzungen am Schädel davongetragen hatte, begann sich sein Zustand zu verschlimmern. Die Krankheit, unter der er zu leiden begonnen hatte, war ungewöhnlich. So hatte er unter anderem Anfälle von Aphasie, bei denen es zu plötzlichem Sprachverlust kommen konnte. Maurice Ravel 7 Trotz der reduzierten Sprache hatte sein Gehirn nicht aufgehört, Musik zu denken: So hörte er die Klänge in sich, konnte sie aber nicht spielen oder gar niederschreiben. Ravels Krankheit behinderte ihn schließlich in seiner musikalischen Ausdrucksfähigkeit so stark, dass er sich 1937 einer Operation unterzog. Kurz nach der Operation öffnete er die Augen, fiel aber bald wieder in ein Koma, aus dem er nie mehr erwachte. BOLERO Boléro ist wohl jenes Werk, mit dem der Komponist Ravel auch 70 Jahre nach seinem Tod immer noch am schnellsten in Verbindung gebracht wird. Schon 1928, bei seiner Uraufführung, war das Stück gut aufgenommen worden. In kürzester Zeit erreichte es eine unglaubliche Popularität. Diese Tatsache überraschte Ravel, für den es sich bei dem Stück nur um ein Experiment handelte. Doch auch wenn die Behandlung des Orchesters aus dem Blickwinkel des Komponisten »stets einfach und unkompliziert« ist, »ohne den geringsten Versuch, Virtuosität zu produzieren«, so ist die Idee, jedes der vorhandenen Instrumente einzeln zu präsentieren und allmählich gemeinsam einer Klimax zuzuführen, herausragend. Das rhythmische Grundmuster, das 326 Takte lang wiederholt wird, entstammt der spanischen Tanzmusik. Es war Ravels Mutter gewesen, die ihn in seiner Kindheit mit dieser Musik konfrontierte. Ihrer baskischen Tradition folgend hatte sie den kleinen Maurice mit spanischen Melodien in den Schlaf gesungen. Andererseits hatte auch das mechanische Spielzeug, das er von seinem Vater, einem Bauingenieur aus der französischen Schweiz, stets geschenkt bekam, einen großen Eindruck bei ihm hinterlassen. Diese phantastische Kinderwelt, die von der großen Liebe zur Mutter getragen war, hatte Ravels musikalische Sensibilität stark geprägt – wohl mit ein Grund, warum er lange Zeit vor Beziehungen zurückgescheut hatte. Sein ganzes Leben lang war die Musik die eigentliche und einzige Geliebte gewesen, und – so Ravel: »Ohne die Musik hätte mein Leben keinen Sinn gehabt.« 8