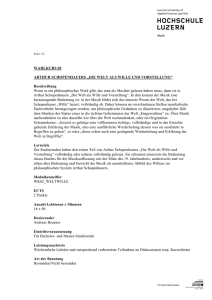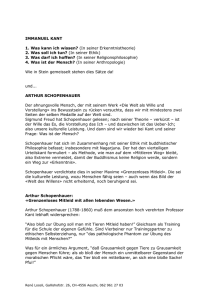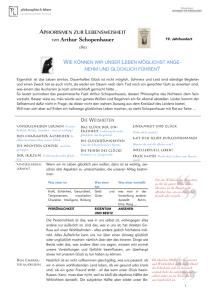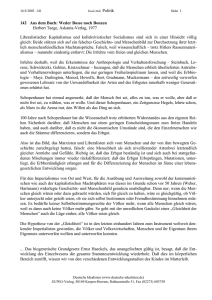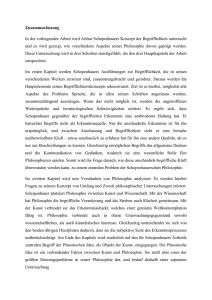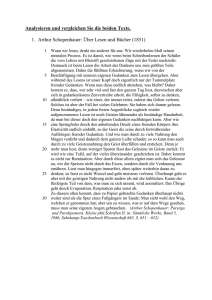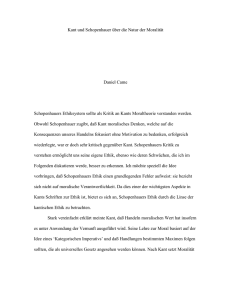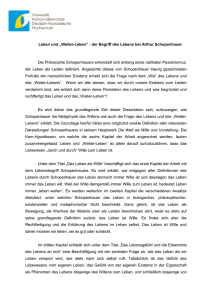Die Reisetagebücher Schopenhauers
Werbung
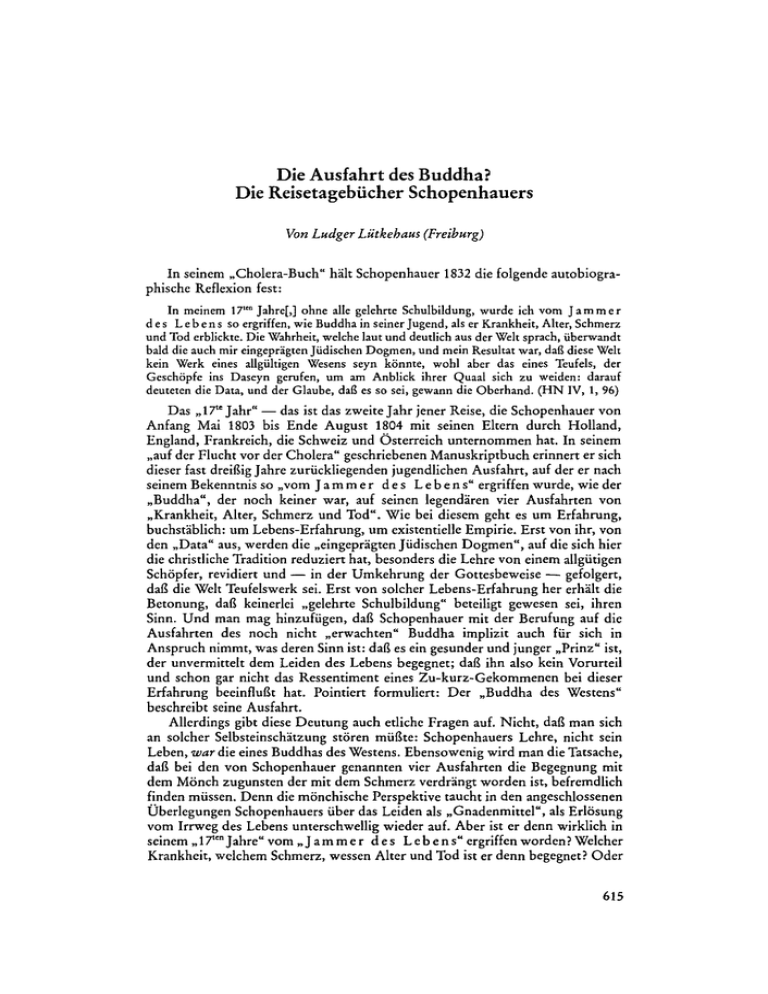
Die Ausfahrt des Buddha? Reisetagebücher Schopenhauers Die Ludger Lütkehaus (Freiburg) In seinem „Cholera-Buch" hält Schopenhauer 1832 die folgende autobiographische Reflexion fest: In meinem 17ten Jahre[,] ohne alle gelehrte Schulbildung, wurde ich vom Jammer des Lebens so ergriffen, wieBuddha inseiner Jugend, als er Krankheit, Alter, Schmerz und Tod erblickte. Die Wahrheit, welche laut und deutlich aus der Welt sprach, überwandt bald die auch mir eingeprägten Jüdischen Dogmen, und mein Resultat war, daß diese Welt kein Werk eines allgültigen Wesens seyn könnte, wohl aber das eines Teufels, der Geschöpfe ins Daseyn gerufen, um am Anblick ihrer Quaal sich zu weiden: darauf deuteten die Data, und der Glaube, daß es so sei, gewann die Oberhand. (HN IV,1, 96) — das ist das zweite Jahr jener Reise, die Schopenhauer von Das „17te Jahr" Anfang Mai 1803 bis Ende August 1804 mit seinen Eltern durch Holland, England, Frankreich, die Schweiz und Österreich unternommen hat. In seinem „auf der Flucht vor der Cholera" geschriebenen Manuskriptbuch erinnert er sich dieser fast dreißig Jahre zurückliegenden jugendlichen Ausfahrt, auf der er nach seinem Bekenntnis so „vom Jammer des Lebens" ergriffen wurde, wie der „Buddha", der noch keiner war, auf seinen legendären vier Ausfahrten von „Krankheit, Alter, Schmerz und Tod". Wie bei diesem geht es um Erfahrung, buchstäblich: um Lebens-Erfahrung, um existentielle Empirie. Erst von ihr, von den „Data" aus, werden die „eingeprägten Jüdischen Dogmen", auf die sich hier die christliche Tradition reduziert hat, besonders die Lehre von einem allgütigen Schöpfer, revidiert und gefolgert, in der Umkehrung der Gottesbeweise daß die Welt Teufelswerk sei. Erst von solcher Lebens-Erfahrung her erhält die Betonung, daß keinerlei „gelehrte Schulbildung" beteiligt gewesen sei, ihren Sinn. Und man mag hinzufügen, daß Schopenhauer mit der Berufung auf die Ausfahrten des noch nicht „erwachten" Buddha implizit auch für sich in Anspruch nimmt, was deren Sinn ist:daß es ein gesunder und junger „Prinz" ist, der unvermittelt dem Leiden des Lebens begegnet; daß ihn also kein Vorurteil und schon gar nicht das Ressentiment eines Zu-kurz-Gekommenen bei dieser Erfahrung beeinflußt hat. Pointiert formuliert: Der „Buddha des Westens" beschreibt seine Ausfahrt. Allerdings gibt diese Deutung auch etliche Fragen auf. Nicht, daß man sich an solcher Selbsteinschätzung stören müßte: Schopenhauers Lehre, nicht sein Leben, war die eines Buddhas des Westens. Ebensowenig wird man die Tatsache, daß bei den von Schopenhauer genannten vier Ausfahrten die Begegnung mit dem Mönch zugunsten der mit dem Schmerz verdrängt worden ist, befremdlich finden müssen. Denn die mönchische Perspektive taucht inden angeschlossenen Überlegungen Schopenhauers über das Leiden als „Gnadenmittel", als Erlösung vom Irrweg des Lebens unterschwellig wieder auf. Aber ist er denn wirklichin seinem „17ten Jahre" vom „Jammer des Lebens" ergriffen worden? Welcher Krankheit, welchem Schmerz, wessen Alter und Tod ist er denn begegnet? Oder — — 615 hat er so, wie die buddhistische Lehre sich in die Buddha-Legende von den vier Ausfahrten kleidet, nur a posteriori seinen Erkenntnis weg rekonstruiert? Und wenn es schon um den Jammer des Lebens gehen soll wie steht es dann mit seiner Erfahrung vor dem „17ten Jahre"? Ist ihm der junge Schopenhauer bei seiner Ausfahrt im dreizehnten Jahre (wie schon vorher im zehnten), die ihn doch zum Teil in dieselben Lebensbereiche geführt hat, noch nicht begegnet? Und schließlich: Beim Buddha beginnt mit den vier Ausfahrten der Auszug aus der „Heimat" in die „Heimatlosigkeit". Inwiefern gilt das aber schon von dem bürgerlichen „Prinzen", der so ausdrücklich seine erste Notiz vom 3.Mai 1803 seinen Platz zwischen seinem Vater und seiner Mutter einnimmt? Fließt deren „gelehrte" oder wie immer geartete Bildung nicht in seine Erfahrung ein, so wie doch auch ihm die „Dogmen" der Tradition eingeprägt worden sind? Und wenn ja: Was erfährt er von ihnen, zumal von der gebildeten und nicht nur literarisch sensibilisierten Mutter? Fragen genug also; sie werden im folgenden an die beiden Reisetagebücher gestellt, die der junge Schopenhauer inden Jahren 1800 und 1803/04 geführt hat. Fragen aber auch, die diesen Reisetagebüchern neben ihrem selbstverständlichen autobiographischen und kulturgeschichtlichen Wert jenes existentielle und philosophische Gewicht geben, das ihnen zukommt. Denn noch einmal: Der Buddha des Westens beschreibt seine Ausfahrt. — — — Die Reise, die von der Familie Schopenhauer einschließlich der dreijährigen Adele von Mitte Juli bis Mitte Oktober 1800 nach Carlsbad und Prag unternommen wurde, war eine Bäder-, Bildungs- und Vergnügungsreise. Die Reise von 1803/04 hingegen, bei der die Schwester zu Verwandten gegeben wurde, — verfolgte weitaus deutlicher, obwohl nicht ausschließlich, Bildungszwecke wie schon die erste Reise, die der junge Arthur 1797 mit seinem Vater über Paris nach Le Havre unternommen hatte. Und 1803 kam noch ein besonderer Anlaß hinzu: Der Sohn und Erbe mit seiner Neigung zum brotlos-dürftigen Gelehrtendasein (so der kaufmännische Realismus des Vaters) war vor die Wahl gestellt worden, entweder aufs Gymnasium oder auf eine große europäische Tour zu gehen und dabei seine „theuren Freunde" in Le Havre wiederzusehen, das allerdings mit dem Versprechen, sich anschließend dem Kaufmannsstande zu ergeben: gewiß eine gezielt beeinflußte Wahl, wenn man so will,eine Wahl mit Köder oder gar Bestechung; auf jeden Fall, mit den Worten des 1809 bei der Universität Berlin eingereichten Lebenslaufes, eine „Versuchung", der „das jugendliche Herz" nicht widerstehen konnte; aber eben doch eine Wahl, bei der sich der sonst überaus feste Wille des Vaters nicht über „die ihm angeborene Achtung vor der Freiheit jedes Menschen" hinwegsetzte, wie der Sohn an derselben Stelle dankbar vermerkt hat. Solcher Liberalität entsprechen denn auch die erzieherischen Modalitäten der Reise: Der nach seinem zweijährigen Aufenthalt in Le Havre schon früh selbständige Arthur kann sich miteinem beträchtlichen Maß an Unabhängigkeit bewegen. Mit den Elementen einer „schwarzen" Pädagogik, die den Willen brechen will,wird er nur inAbwesenheit seiner Eltern, während seines dreimonatigen Aufenthaltes im Haus des Reverend Lancaster in Wimbledon, im bigotten „Exil"also, bekannt. 616 Hinzu kommt: Der Sohn soll nicht in den Büchern, sondern im „Buche der Welt" lesen lernen. Die damit einhergehende Verzögerung der Ausbildung inden „klassischen Lehrfächern und Sprachen" ist von Schopenhauer zwar in dem zitierten Lebenslauf bedauert worden; dennoch hat er auch dort in aller Deutlichkeit der Anschauung und Erfahrung der Dinge vor dem Erlernen der nur zu oft leeren Worte und Meinungen den Vorzug gegeben. ImReisetagebuch von 1803/04 stehen zwei pädagogische Exkursionen dafür. Bei dem Besuch im Taubstummen-Institut des Abbé Sicard (108 ff.) beobachtet man, welch einfacher und zweckmäßiger Gebrauch dort vom „gestikulirten Wort" gemacht wird. Im Unterschied zu dem gesprochenen und geschriebenen gilt es dem jungen Schopenhauer als Medium der natürlichsten und eben deswegen allgemeinsten Rede. In ihr findet er die wahren sprachlichen Universalien, die zugleich die Kommunikation mit denen gestatten, die man sonst aus dem Bereich der Vernunft und der menschlichen Gesellschaft exkommuniziert. Das zweite Exempel bietet der Besuch im Institut des „berühmten Pestaluzzi" (213 ff.), der statt der Buchgelehrten den vorurteilslosen „gesunden Menschenverstand" der „niedrem Volcksklassen" zum Lehrmeister seiner „neuen Erziehungs-Methode" bestellt. Hier, unter normaleren, übertragbaren Bedingungen, ist es noch deutlicher das Absehen von der gelehrsamen Gedächtnisbildung, die Konzentration auf die Sachen selbst und ihre „sinnliche Vorstellung", die trotz einiger Bedenken das besondere Interesse des jugendlichen Beobachters findet. Und von ihm bis zum späten Schopenhauer herrscht eine erstaunliche Kontinuität. Das 28. Kapitel der „Parerga und Paralipomena" wird mit seiner scharfen Unterscheidung von anschauungsorientierter „natürlicher" und begriffsorientierter „künstlicher Erziehung" die frühe pädagogische Erfahrung und Wertung erneuern. Und in Schopenhauers Philosophie der Lebensalter räumt das Konzept einer „negativen" Erziehung, die das Kind vor „falschen Begriffen" und philosophischen oder religiösen „Hirngespinsten" zu bewahren sucht (PI,513 f.),noch schärfer mit aller „künstlichen Erziehung" auf. Diese „negative" Erziehung meint einerseits den pädagogischen und phänomenologischen Imperativ: „Zu den Sachen selbst!", insofern etwas Positives In bezug auf die einmal „eingeprägten Dogmen" der Tradition freilich fordert dieser Imperativ in der Tat die „negative" Befreiung von ihnen. Denn das ist nach Schopenhauers Philosophie der Lebensalter das „Erste, was die Erfahrung zu thun vorfindet". Die Ausfahrt, die ,Lektüre' im „Buche der Welt", die Emanzipation von den „Dogmen" und das Konzept einer „natürlichen" Erziehung stehen also in einem schlüssigen inneren Zusammenhang. Was die Erziehung Schopenhauers selber betrifft, stellt sich allerdings auch die Frage, wie sich denn in ihr der Imperativ „Zu den Sachen selbst" und diebei aller aufgeklärten Liberalität des Elternhauses auch ihm „eingeprägten Dogmen" miteinander vertragen haben. Generell darf man die Selbständigkeit des jugendlichen Tagebuchautors ohnehin nicht überschätzen. Der elterliche Einfluß spielt eine bedeutende Rolle, zumal der der Mutter. Die vergleichende Lektüre der Reisebeschreibungen, die sie auf der Grundlage der gleichzeitig mit dem Sohn geführten Tagebücher ein Jahrzehnt später publiziert hat, relativiert seine Originalität ganz ohne Frage an etlichen Punkten wenngleich gerade bei der gemeinsamen Begegnung mit dem Jammer des Lebens auf die spezifische Differenz zu achten sein wird. Die von . — 617 einer männlich präokkupierten Literaturgeschichtsschreibung verbreitete Mär, daß die weltläufige Mutter, deren Schriftstellern auch heute noch respektabel ist, die frühen Produkte ihres genialen Sohns schlicht ausgebeutet habe, kann man sowieso getrost zu den Akten legen. Ebensowenig darf man die Einschränkungen unterschätzen, die sich aus den Rahmenbedingungen der gemeinsamen familiären Bildungsreise ergeben haben. Um beurteilen zu können, was der Sohn schreibt und was er nicht schreibt und schreiben kann, muß man sich vorweg klarmachen, daß er nicht nur in der dauernden Kommunikation mit seinen Eltern geschrieben, sondern auch unter ihren Augen geschrieben hat. Ungeachtet aller Freiheiten sind seine Reisetagebücher auch so etwas wie eine permanente Hausaufgabe, eine Schreibübung, nicht zuletzt eine handschriftliche Übung gewesen. Und wenn die Mutter ihre Reisebeschreibungen literarisch stilisiert, so hat er seine Tagebücher zweifellos in gewissem Umfang zensiert. Familiäre Beziehungen und Emotionen klingen kaum an was freilich wiederum einschließt, daß er nicht zum Apportieren von Gefühlen erpreßt worden ist:Die lapidare Nüchternheit, mit der er, durchaus im Gegensatz zu der enthusiastischen Wiedersehensfreude in Le Havre, nach dem dreimonatigen „Exil"in Wimbledon bei London die befreiende Rückkehr der Eltern vermerkt; auch der Lakonismus, mit dem er die Zweisamkeit mit der Mutter während der abenteuerlichen Exkursion nach Chamonix quittiert, sprechen für sich. Und sonst: Leidenschaft, gar frühes Leid? Das Zusammensein des immerhin der in Pubertät befindlichen Tagebuchautors mit einer jungen Engländerin wird nur knapp berührt. Die Begegnung mit jenem mörderischen Folterinstrument, das auf den Namen „dieJungfer" getauft worden ist (239 f.), sagt dem Zwölfjährigen verständlicherweise überhaupt nichts. Aber auch der Fünfzehnjährige, der keineswegs blind ist für die Schönheit oder Häßlichkeit der Altersgenossinnen; der die Tänze „sehr zweydeutiger Damen" (57) sehr wohl registriert und zumindest inden Alpen die noch unbestiegene Jungfrau gern „ganz entschleiert" sieht (206 und 212), spricht explizit an keinem Punkt von dem, was er wenig später in seinem ersten eigenen Gedicht seine „Wollust" und seine „Hölle" nennt. Der scharfe Einschnitt, den Schopenhauer in seiner Philosophie der Lebensalter zwischen der sexuell noch nicht getriebenen, ungetrübten Kindheit und dem unruhigen und schwermütigen Jünglingsalter sieht, wird kaum spürbar; in diesem Sinn bleibt auch der Autor des zweiten Reisetagebuches, gewiß nicht das sexuelle Wesen, das mit ihm in einer Haut zusammenlebt, noch Kind. Kurz: Beide Tagebücher, entstanden in einem relativ freien, aber auch nüchternen familiären Milieu, sind alles andere als ein frühes „journal intime". „Zu den Sachen selbst" also, noch einmal: auch im eingeschränkten, entsubjektivierten Sinn. Aber zu welchen „Sachen"? Die Werke der Kunst, die Denkmäler—der Geschichte, die Sehenswürdigkeiten der Natur, die Spektabilitäten der Zeit alles scheint in der Beschreibung des jungen Schopenhauer unterschiedsund akzentlos ineinander überzugehen. In Weimar begegnet er zum Beispiel ohne weiteren Kommentar einem Mann namens Schiller, nachdem er zuvor den „höchstinteressanten Herrn Bertuch" kennengelernt hat. Im übrigen werden Parks und Paläste, Straßen und Städte, Sitten und Kleider von dem jugendlichen Richter, der sich noch einig mit den Fortschritten der „Jetztzeit" weiß, unnach- — 618 sichtig danach beurteilt, ob sie im altmodischen oder im modernen Geschmack sind. Auf die gute Gesellschaft und den „bon ton" wird genau geachtet. Und geht der Sohn mit seinen Eltern ins Theater, was er oft tut, dann sitzt er als Kritiker so streng zu Gericht wie er als Weltmann die Wirtshäuser taxiert. Aber auch, wo sich sein Geschmack spürbar entwickelt und die Distanz zur parvenühaften „Jetztzeit" zunimmt, spürt man immer noch eher die Altklugheit als ein Klüger- und Alter-Werden. Und wenn der junge Schopenhauer beim Wiedersehen mit Le Havre alles kleiner und sich größer geworden sieht (95), so gilt für das Tagebuch doch noch über weite Strecken, daß die Welt in dem Maße klein bleibt, wie sein Autor noch unentwickelt ist. Geht man gar auf die Suche nach den frühen Zeugnissen eines unverwechselbar „Schopenhauersehen" Geistes, so könnte man sich an etlichen signifikanten Punkten so desillusioniert fühlen wie der anspruchsvolle Jüngling, der seine Erwartungen immer wieder enttäuscht findet, ohne daß man das schon auf seine spätere Lehre vonder Unstillbarkeit des Willens durch jegliche.Präsenz beziehen müßte. Dem angeblich vomJammer des Lebens ergriffenen Buddha des Westens gehen die Zucht- und Tollhäuser lange Zeit ebenso kommentarlos vorüber wie mittelalterliche Folteranstalten, fürstliche Parforcejagden und andere Tierquälereien auch im Gegensatz zu dem mitleidig geschärften Blick der Mutter — jeneoder Fabrikanstalten, in denen er später sehr wohl die Galeeren der Industrie erkennt. Seine zunächst empört anmutende (schriftliche) Attacke auf einen sadistischen Ordnungshüter schreibt er im weiteren seiner Langeweile zu (62), wie öfters der blasierte Ennui oder ein touristischer Voyeurismus herrscht, den er in anderem Zusammenhang selber geißelt. Wo sich aber der Witz oder gar die Komik zu Wort meldet, wie etwa indem hinreißenden Selbstporträt des jugendlichen Königs Midas, dem die Ohren zu Eselsohren geschwollen sind (302 ff.), da ist eine selbstironische Selbstpreisgabe bestimmend, die wiederum für den später vorherrschenden Sarkasmus nichts weniger als typisch ist. So wird vor allem das erste Reisetagebuch, passagenweise auch noch das zweite, zum Dokument eines gleichsam vorgeburtlichen Zustandes, indem kaum etwas auf einen Philosophen namens Schopenhauer deutet. Das scheint mehr noch für andere Aspekte des späteren Werkes und Lebens zu gelten, etwa in bezug auf das Bilddes politischen Reaktionärs Schopenhauer, das bei Apologeten wie Kritikern so massiv die Schopenhauer-Rezeption bestimmt hat. Wird es durch die beiden Reisetagebücher gestützt? Zweifellos fehlt es inihnen wie inden Reisetagebüchern der Mutter trotz der anfänglichen Sympathie für die „grande révolution" nicht an harschen Angriffen auf die Auswirkungen des „terreur", der sowohl die Kunst wie die künstlerisch organisierte Natur wie die Gesellschaft zerstört und rebarbarisiert hat. Die Begegnung mit den Spuren der in Lyon verübten „unerhörten Gräuel" zumal (164) zeigt das, obwohl die Leidenswahrnehmung schon des jungen Schopenhauer hier wie auch sonst prinzipieller als die der Mutter ist. Andererseits beobachtet bereits der Zwölfjährige, der sich in Potsdam noch der preußischen Kriegsspiele erfreut, die „Armuth der Unterthanen", die im berüchtigten Hessen herrscht; ihren Haß und die Tyrannei, die ihn zu bändigen sucht (222). Was er hier vom Feudalismus bemerkt, sind die Relikte einer ganz und gar unromantisch gesehenen Ritterzeit. Beim Übertritt indas ebenso häßlich — 619 und finster anmutende wie verarmte und ausgesogene Österreich in Braunau (!) revoltiert der spätere Law-and-Order-Befürworter gegen die „cbicaneuseste, aller chicaneusen Polizeien" (253) und ihren wichtigtuerischen Bürokratismus, um wenig später das „ausgezeichnet dumme Gesicht" des Kaisers in Wien zu würdigen (258). Nicht weniger bissig schüttet der frühe Satiriker seinen Hohn über die „unaussprechlich kindischen und kleinen" Duodez-Kulturen aus (277/ 278). Und ungeachtet aller Kritikan der Revolution wird inParis die Bastille als „Schauplatz des ewigen Elends, der ungehörten Klagen, u. des hoffnungslosen Jammers" erlebt (92), wenngleich die jugendliche Einbildungskraft auch hier sogleich wieder die Wendung ins Prinzipielle nimmt. Man sieht: Dem Autor der beiden Reisetagebücher kann man noch keine klare politische Prognose stellen. Und wie steht es mit dem bekannten Misanthropen und Weltverneiner Schopenhauer, der mit allem und allen ins Gericht geht, nur mit sich nicht? In der Tat kommen etliche Nebenmenschen schon bei dem jugendlichen Tagebuchautor nicht besonders gut weg: die traurigen westfälischen Barbaren ebenso schlecht wie die groben und ausgezeichnet langsamen Schweizer oder die bereits beschriebenen Österreicher. Es ist aber allemal kein nationales Ressentiment, was sich hier außen. Österreich zum Beispiel wird gerade deswegen zum Skandal für ihn, weil es den Fremden keine Gerechtigkeit widerfahren läßt und keine gleichen Rechte gewährt. Wo aber Ehrlichkeit und Gutmütigkeit anzutreffen sind, da wird das höchst anerkennend registriert. Und den Bewohnern des Tales von Chamonix mit ihrer Gefälligkeit und Teilnahme, vor allem ihrem Gemeinsinn, der nicht konkurrierend aus allem sein Geld schlägt, wird wie von der Mutter ein geradezu enthusiastisches Denkmal gesetzt (190 f.). Hier in Chamonix ist es auch, wo der junge Reisende wie dann später im „göttlichen Thal" von Interlaken, auf dem Pilatus und auf der Schneekoppe begeistert der „großen Natur" begegnet, genauer: sich in der „großen Natur" bewegt; denn der jugendliche Bergbesteiger, ausgestattet mit einer beträchtlichen Portion Mut, ist wie später der energische Frankfurter Fußwanderer und Schwimmer das Gegenteil eines Sitzdenkers, eines Immobilitäts-Hypochonders gewesen. Die Bergwelt des Berner Oberlandes und des Mont Blanc zumal, mit dessen Beschreibung der Reisebericht der Mutter ihren End- und Höhepunkt findet, wirdüber viele Seiten hinweg, mit einer Gefühlsintensität sondergleichen gefeiert: als entsetzliches und furchterregendes Inbild des Ungeheuren der Natur zwar, mehr noch aber einer feierlichen Stille und Schönheit, die allen Begriff übersteigt. Gerade hier jedoch scheint sich die Wahrnehmung des jungen Schopenhauer auch am entschiedensten von der des reifen, des metaphysischen Pessimisten abzuheben. Denn hat der nicht dem Mont Blanc als Bild der „dem Genie beigegebenen Melancholie" ein durchaus anderes Denkmal gesetzt? Im zweiten Band der „Welt als Wille und Vorstellung" heißt es im Anschluß an die Erkenntnis, „daß der Wille zum Leben, von je hellerem Intellekt er sich beleuchtet findet, desto deutlicher das Elend seines Zustandes wahrnimmt": „Die so häufig bemerkte trübe Stimmung hochbegabter Geister hat ihr Sinnbild am Montblanc, dessen Gipfel meistens bewölkt ist" (W 11, 438). „Meistens bewölkt" und melancholisch hatte doch der junge Schopenhauer diesen Gipfel keineswegs gefunden. Und hatte er nicht auch in den Bergen des Berner 620 Oberlandes eine durchaus positive „creatio ex nihilo": eine „aus dem Nichts" lachend hervorgehende Welt erblickt? Muß es also nicht bei der These bleiben, daß es sich bei den beiden Reisetagebüchern um die Dokumente eines gleichsam vorgeburtlichen Zustands handle? Und hat der vom Jammer des Lebens ergriffene, erwachte, das heißt verdüsterte Buddha des Westens nicht sein frühes Gipfelerlebnis vollständig vergessen? Indessen weiß auch der Autor der „Welt als Willeund Vorstellung" noch von anderen Mont Blanc-Erfahrungen zu berichten: „aber wann bisweilen", fährt er an der zitierten Stelle fort, „zumal früh Morgens, der Wolkenschleier reißt und nun der Berg vom Sonnenlichte roth, aus seiner Himmelshöhe über den Wolken, auf Chamouni herabsieht; dann ist es ein Anblick, bei welchem Jedem das Herz im tiefsten Grunde aufgeht. So zeigt auch das meistens melancholische Genie zwischendurch die [. .] nur ihm mögliche, aus der vollkommensten Objektivität des Geistes entspringende, eigenthümliche Heiterkeit, die wie ein Lichtglanz auf seiner hohen Stime schwebt: in tristitia bilans, in hilaritate tristis." Umgekehrt hatte schon der junge Naturenthusiast am Mont Blanc plötzlich „das Unglück" erlebt, daß „alles [. .] weg" und „wie ein schöner Traum" vergangen war (189ff.) so wie indie Begegnung mit den Bewohnern des glücklichen Tals von Chamonix das Bild der buchstäblich wahnsinnig fröhlichen Cretins und der unglückseligen Albinos eingesprengt war (188 ff.). Der Akzent des Erlebnisses hat sich also wohl verändert; seine Elemente aber schließen einander nicht aus. Wichtiger: Schon der junge Schopenhauer kommt mit der interesselosen Objektivität des älteren darin überein, daß der ruhige Blick „von oben" es ist, der die „Dinge", die „unten", auf dem Boden der Sorgen, „Bemühungen u. Entwürfe" groß scheinen, tröstlich weit entrückt (226). Und eben dieser distanzierte Blick, das Übergewicht des Anschauens und Erkennens über das Wollen, des herrlichen „Sehns" über das schreckliche „Seyn", wird später als das tertium comparationis von Genie und Kindheit bestimmt. Diese Kontinuität aber ist gar nicht zu überschätzen. Denn sie besagt, daß bereits hier gleichsam das „klare Weltauge" der Anschauung, die den Willen wendet, sich öffnet und daß das, was das Reisetagebuch von 1804 mit dem überhaupt größten Enthusiasmus beschreibt: die Begegnung mit der „großen Natur", auf dieses Erlebnis führt. Allerdings läßt sich aller behaupteten Interesselosigkeit der reinen Anschauung zum Trotz auch schon hier der dynamische Zusammenhang zwischen „Sehen" und „Seyn" erkennen. Denn wie auch immer es mit der vollkommenen Objektivität des Genies stehen mag: Der jugendliche Beobachter weiß, daß der Blick „von oben" in dem Maße tröstlicher und nötiger ist, wie unten die Dinge größer und die Sorgen drückender sind. Gleichzeitig gibt Schopenhauers spätere Philosophie des Genies und der Lebensalter den hermeneutischen Schlüssel an die Hand, wie die wesentlichsten Passagen seiner jugendlichen Reisetagebücher zu verstehen sind: Wenn in ihnen gemäß der Maxime, im „Buche der Welt" zu lesen, die Anschauung der Reflexion vorhergeht, so meint das aus der Sicht dieser Philosophie eine dem Genie und der Kindheit gemeinsame platonische Anschauung, die ineinem Fall alle Fälle auffaßt, wenn auch noch nicht oder „nicht stets mit deutlichem . — . — 621 Bewußtseyn" (PI, 509). Dementsprechend sind die Tagebücher exemplarisch zu lesen: als Zeugnisse einer vor- oder halbbewußt generalisierenden Wahrnehmung. Und wo diese Wahrnehmung auf Formen des Leidens trifft,wird sie so, wie die beschriebene Begegnung mit der Geschichte sofort ins Prinzipielle geht, nicht von diesem oder jenem, sondern dem Jammer des Lebens ergriffen werden. Diese Art von Piatonismus hat freilich mit der Erkenntnis der Idee des Guten nichts mehr gemein; sie läuft vielmehr auf einen negativen, von Schopenhauer auf die Füße gestellten Piatonismus hinaus. Was diese generalisierende Wahrnehmung des Jammers des Lebens histo— risch, gesellschaftlich, psychologisch relativiert und woher sie sich rechtfertigt dieses zentrale Problem der Philosophie Schopenhauers läßt sich auf der Basis der Reisetagebücher nicht beantworten. Umgekehrt legitimiert aber die typisierende Anschauung das Erratische der aufgezeichneten Exempel; die Tatsache, daß der jugendliche Autor öfter zusammenhanglos, manchmal geradezu gefühllos wieder zur Tagesordnung überzugehen scheint. Der Leser muß die eingesprengten Bilder und die Aussage der Brüche nur verstehen lernen. Und dann sagen sie ihm in der Tat, daß der ausfahrende Buddha des Westens, wenn nicht die Krankheit und das Alter, so doch den Schmerz und den Tod erfährt. Woher aber läßt sich dabei, abgesehen von den Aufstiegen in der „großen Natur", der Blick „von oben" gewinnen, der die Dinge zugleich überblickt und entrückt? Die überhaupt erste Notiz des jugendlichen Tagebuchautors beginnt mit einem Bild,das symbolischer, auch provokativer kaum vorgestellt werden kann: Nach dem Übersetzen über die Elbe wenn man so will:der Stromüberschreibegegnet man einer „armen blinden Frau", deren Augen auf tung des Mythos dem Weg zur Taufe erfroren waren. Und Schopenhauer vermerkt: „Ich bedauerte die arme Frau, bewunderte aber die flegmatische Ruhe womit sie ihr Leid erträgt; sie hatte das Vergnügen ein Christ zu seyn theuer erkaufen müssen!" (211). Deutlich werden in dieser Notiz zentrale spätere Motive antizipiert: der Zusammenhang von geistlich bedingter Erblindung und „flegmatisch" ergebener Ruhe, von Leiden und Mit-Leiden. Und die ironische Schlußwendung, so sehr man in ihr auch die Mutter mithören mag, verweist in ihrer Bitterkeit, die man bei der Mutter vergeblich suchen wird, schon auf jenen ingrimmigen, existentiellen Sarkasmus, mit dem Schopenhauer später die Dogmen der religiösen Tradition und den Hurrahpatriotismus des Lebens quittieren wird. Fromm kann man den Zwölfjährigen trotz dieser auch ihm eingeprägten Dogmen ohnehin nicht mehr nennen, eher schon aufgeklärt. Die nachjosephinische Restauration von „Unwissenheit u. Aberglauben" statt der „Aufklärung" zum Beispiel wird von ihm durchaus übel vermerkt. Und generell erhält bei aller Neigung zur bildenden Kunst und besonders zur Chor-Musik, die für den Kargheit gewöhnten Protestanten die Besuche der katholischen Kirchen zu ästhetisch-kulinarischen Hochfesten macht, die „Bigotterie", gleich welcher Konfession, ihr sarkastisch Teil. Die aufgesperrten frommen Mauler mit ihrem gellenden Gesangsgeschrei; die Pikanterien des Reliquien-Wesens; die nach gusto gesottenen, gerösteten oder gespickten Märtyrer; die dicken Pfaffengesichter; der schwunghafte Ablaßhandel; schwer erreichbare Kirchen, bei denen allein die Kirchhöfe aussichtsreich sind sie alle kommen zu ihrem Recht. Mildernde Umstände werden gewährt, wenn etwa in Bordeaux die nachrevolutionär wie- — — — 622 derbelebte Religiosität nicht mehr als eine höfliche Anpassungsgeste verlangt (128). Verehrung findet allein der „göttliche Tempel der Natur" (239); das einzige explizite religiöse Bekenntnis zum Gott der Tradition wird abgelegt, als der junge Arthur den Pilatus besteigt, „um Gottes Wercke von oben zu betrachtraurigen Schauspiele des Lebens beiwohnt wie ten" (224). Wo er aber einem der — diesem „empörendsten Anblick" menschlicher einer englischen Hängeszene Gewaltsamkeit, wie der spätere Beccaria-Anhänger Schopenhauer mit der nöti, da wird gerade das Fehlen der „Arm-Sündergen Schärfe konstatiert Glocken, Sterbekleider u. dgl." als erleichternd empfunden (43 f.) Mehr noch: Es ist ein „jämmerlicher", keineswegs ein bußträchtiger Anblick, „zu sehn mit welcher Angst diese Menschen selbst den letzten Augenblick noch zum beten benutzen wollten" und einer der Gehenkten, schon tot, „noch ein Paar Mal" dieselbe Betbewegung macht: Das farcenhafte Bild erinnert an geschlachtete Hühner, die noch eine Weile buchstäblich kopflos im Hühnerhof umherrennen. Johanna Schopenhauer hat dergleichen nicht beschrieben. Der Autor der „Welt als Wille und Vorstellung" hingegen wirdsich noch mit „tiefem Grausen" und „herzzerreißendem Mitleid" an die entsetzliche Szene erinnern (W 11, 400). Religion, das heißt in den Reisetagebüchern also positiv: die Werke der Kunst und der Natur. Die fromme Todesangst aber pervertiert die realen Leiden des hingerichteten Lebens zu einer finalen Groteske, die mit vier emphatischen Gedankenstrichen gewaltsam beendet wird, um anschließend von dem nicht weniger grotesken Bildeines Bauchredners verdrängt zu werden (44). Man muß das menschenunwürdige Bild dieses noch posthum betenden Gehenkten mit jenen Göttern des Olymps kontrastieren, denen der junge Reisende im Louvre begegnet, urn seine Vorstellung eines auch der Menschen würdigeren Verhaltens zu haben: „alle Götter dcs Olymps leben hier noch, stehn wie sic vor Jahrtausenden standen, v. sehn mit ruhigem Blick den Wechsel der Zeiten urn sich herum" (87). Im Wechsel der Zeiten bleibt, dem Wechsel der Zeiten begegnet der „ruhige Blick", während der gewaltsam induzierte Terror dcs Todes im religiösen Horror seine Entsprechung, nicht seine Bewältigung findet. Der Tod ist auch sonst eines der ostinaten, wenn nicht zentralen Themen der beiden Reisetagebücher: der Tod in seinen gewaltsamen und in seinen natürlichen Formen, vor allem der Tod, der alles „unnütz" macht (27), als Exponent der Macht der Zeit. Ihr gilt während des Wimbledon- Aufenthaltes die jugendliche Meisterübersetzung von Mutons „On Time"; der Besuch der WestminsterAbtei und die Begegnung mit Garricks transzendentem Auftritt,mit Shakespeares und Gays Vergänglichkeitslyrik, in der die noch kurz zuvor mit Pope beschworene Kette der Wesen untergegangen war (49 ff.), hatten hier vorbereitend gewirkt. Mit der Erfahrung der Macht der Zeit aber wird auch die Zeitlosigkeit, die Schopenhauer später in seiner Philosophie der Lebensalter der Kindheit zuschreibt, zerstört: In diesem Sinn ist der Tagebuchautor, der sich sonst als „inkarniertes" Wesen still und tot stellt, alles andere als ein Kind. Gelegentlich wird man sich zwar fragen müssen, wie tief bei ihm das Todes- und Zeiterlebnis reicht, zum Beispiel beim Besuch des Bremer Bleikellers, den der Fünfzehnjährige mit ungerührter Sachlichkeit aufzeichnet, oder bei der Beschreibung des Luzerner Totentanzes (221), bei dem er sich über die nekro- — 623 Phile Wiederholung des „so einfachen Gedankens in so vielen Bildern" mokiert. Noch in der geschmacklosen Inszenierung des Ruinösen entdeckt der junge Schopenhauer aber die zerstörende Macht der Zeit (275). In der Pariser Augustinerkirche mißfällt ihm, daß man die Denkmäler der „Voraltern" aus ihrem angestammten Zusammenhang „weggerissen", also selbst noch die Monumente des Gedächtnisses in den Strom des Vergessens hineingerissen hat (105). Im Amphitheater von Nîmes überkommt ihn, durchaus im Widerspruch zu der optimistischeren Version der Mutter, der „Gedanke an die Tausende längst verwester Menschen [. .], die in diesen mannigfaltigen Jahrhunderten an allen ihren Tagen, so wie ich heute, über diese Ruinen hinwegschritten" (139). Mit diesem „so wie ich heute" wird die touristische Impression existentiell; der Gedanke an diejenigen, die über ihn hinwegschreiten werden, liegt nah. Und als er in Lyonmit der Geschichte des revolutionären „terreur" konfrontiert wird, da sind nicht so sehr die „unerhörten Gräuel merckwürdig", als vielmehr ihre Spurenlosigkeit, die „kaltblütige" Erinnerung der Nachfahren und die unbegreifliche „Macht der Zeit". Das erste wird auch die Mutter feststellen, und zwar noch schärfer. Nur bei dem jungen Schopenhauer aber wird aus den historisch bedingten gewaltsamen Formen des Todes eine prinzipielle Einsicht abgeleitet, die so, wie er nicht von diesem und jenem, sondern dem Jammer des Lebens ergriffen wird, der Macht der Zeit gilt. Was aber, wenn nicht der ruhige Blick der griechischen Götter, ist ihr gewachsen? Die christliche Tradition, allerdings in positiverer Form als in der Hängeszene, wird noch einmal aufgenommen, wenn der Tagebuchautor am Schluß seines ersten Heftes nach dem Gasthofverzeichnis, präziser: quer dazu in einem chaotischen Buchstaben- und Notengewirr notiert: . — From all the evils, that befall us may, The worst is death & death must have its day! In Coelo — Shakespear. K.Richard 11. quies tout finit icibas. Der Tod also als das größte und zugleich gewisseste aller Übel, generalisiert in dem Bewußtsein, daß hienieden alles endet, aufgehoben inder himmlischen Ruhe. Dem entspricht beim Westminster-Besuch der „schöne Gedancke" über die dort versammelten Dichter, Helden und Könige, „ob sie wohl Selbst jetzt so beysammen sind, dort wo nicht Jahrhunderte, nicht Stände, nicht Raum u. Zeit sie trennen: u. was wohl jeder von dem Glanz, von der Größe die ihn hier umgab, hinüber nahm: die Könige ließen Krön u. Szepter hier zurück, die Helden ihre Waffen, den Ruhm ließen die Dichter: doch die großen Geister unter ihnen allen, deren Glanz aus ihnen selbst floß, die ihn nicht von äußerlichen Dingen erhielten, die nehmen ihre Größe mit hinüber, s ie nehmen alles mit was sie hier hatten" (51f.). Allerdings ist hier die hypothetische und fragende Form des „schönen Gedanckens" zu beachten ebenso in der Handschrift, daß nicht die himmlische Ruhe, sondern die irdische Katastrophe eine fallende Kadenz beschließt. Im — 624 übrigen wirdim Sinn der antiken und klassischen Tradition ohnehin eher auf die immanenten Formen der Dauer gesetzt. Allein „im Vergleich mit der Dauer seiner Wercke" läßt „die Dauer des Menschen sich kurz nennen" (139f.). Die baufälligen Hütten der Lebenden lehnen sich an die „ehrwürdigen Mauern" von Ruinen, die der „zerstöhrenden Gewalt der Zeit auf eine wunderbare Art widerstanden" haben (121): so die symbolische Verschränkung von Vergänglichkeit und (relativer) Unvergänglichkeit. Der Autor der „Parerga und Paralipomena" wird das Thema mit dem ebenso paradoxen wie brillanten Gedanken weiter erörtern, daß, analog zu dem entrückenden Raum, gerade die entrükkende, vernichtende Zeit (P 11, 506) die Bedingung der Unsterblichkeit, des mit dem Leben „inkompatiblen"—Ruhmes sei. Insofern es aber um die Erinnerung an das Elend des Lebens geht was macht da der Lyoner Tagebuchschreiber, der Besucher des Bastille-Platzes schließlich anderes, als daß er im Widerspruch gegen die Vergeßlichkeit und die Fühllosigkeit der Menschen, gegen die Begrenztheit der Einbildungskraft und eben die Macht der Zeit seinerseits den „hoffnungslosen Jammer", das „ewige Elend" und die „ungehörten Klagen" vergegenwärtigt: Schon seine frühe Philosophie ist das Gedächtnis der Leiden der Menschheit. Dabei freilich findet sie in Zeit und Tod nicht nur ihre Antipoden, sondern gegebenenfalls auch den Grund ihres „ruhigen Blicks". Der Besuch im Bagno von Toulon, bei dem der junge Schopenhauer am meisten vom Jammer des Lebens ergriffen wird, steht dafür. Denn hier, angesichts einer Drei-KlassenGesellschaft von entmenschten, zu Last- und Arbeitstieren instrumentalisierten Galeeren-Sklaven, die sich nur durch die Dauer ihrer Strafe und die Schwere ihrer Fesselung unterscheiden, aber sich darin gleichen, daß sie in der Hölle und füreinander die Hölle sind; angesichts einer Hoffnungslosigkeit und eines Elends, das, schlimmer als in der englischen Hängeszene, das Leben nicht mit dem gewaltsamen Tod, sondern mit der Fortdauer des Lebens bestraft, ist es der Tod, der zur Erlösung vom Leiden des Lebens wird (154 ff.). Mit der im ganzen sehr viel eingehenderen und auch literarisch eindrucksvolleren Beschreibung der Mutter trifft der Bericht des jungen Schopenhauer hier zwar über weite Strecken überein. Er unterscheidet sich aber vonihr an zwei entscheidenden Punkten: Sie läßt keine Gelegenheit vorübergehen, die Insassen des Bagno zu dämonisieren; ja, sie spinnt ihren Besuch abschließend zu einer Angstphantasie aus, in der die ausbrechenden Höllenbewohner herfallen über die bürgerliche geordnete Welt. Andererseits, selbst angesichts des Infernos, wird so, wie die Mutter jede ihrer Leidensbeschreibungen optimistisch austariert, das Leben von ihr weiterhin mit dem Hoffen identifiziert. Er aber vergegenwärtigt, von mitleidendem Erschrecken getrieben, die vollständige Hoffnungslosigkeit. Im Bagno von Toulon, in seinem „17"" Jahre", wird so der ausfahrende Buddha des Westens in der Tat vom „Jammer des Lebens" ergriffen. Als solcher hat er freilich auch der fallenden Kadenz des jugendlichen Reisetagebuches die Fortsetzung geschrieben, die als Pendant zur vierten Ausfahrt des Buddhas des Ostens den Galeerensklaven des Lebens ihre Befreiung gewährt: „Tout finit..." wenn alles endet, dann endet mit dem Leben und — 625 dem Willen zum Leben auch das schlimmste aller Übel, das seinen Tag haben wird: Es ist der ganze Tod, der uns vom Sterben heilt. Und im Himmel, da ist nicht die Ruhe, sondern der „Himmel" ist allein, wenn Ruhe ist: die Ausfahrt des Buddha. Anmerkungen Die beiden Reisetagebücher werden zitiert nach der Ausgabe von Charlotte von Gwinner, Leipzig 1922 (Journal einer Reise von Hamburg nach Carlsbad, und von dort nach Prag; Rückreise nach Hamburg, in: Wilhelm von Gwinner: Arthur Schopenhauer aus persönlichem Umgang dargestellt, kritisch durchgesehen und mit einem Anhang neu herausgegeben von Ch. v.G.) bzw. Leipzig 1923 (Arthur Schopenhauer: Reisetagebücher aus den Jahren 1803-1804). Zum 200. Geburtstag Schopenhauers wird als Supplement der vom .Verf. im Haffmans. Verlag, Zürich,, herausgegebenen Werkausgabe nach den Fassum gen letzter Hand eine Neuedition der beiden Reisetagebücher erscheinen. Alle übrigen Schopenhauer-Zitate mit den üblichen Siglen. Vor der Edition durch Charlotte von Gwinner hat schon Wilhelm von Gwinner in seiner Schopenhauer-Biographie wie dann später alle weiteren Biographen Gebrauch vor allem von dem zweiten Reisetagebuch gemacht. Der Interpretationsspielraum, den beide Reisetagebücher eröffnen, wird einerseits durch die Einleitung Charlotte von Gwinners, andererseits durch die Besprechung von Hans Zint im 12. Jahrbuch der Schopenhauer-Gesellschaft (1923-25), S. 235-241, markiert.Charlotte von Gwinner betont die Unterschiede in der Betrachtungsweise von Sohn und Mutter (ihre Reisebeschreibungen in:Johanna Schopenhauer: Reise durch England und Schottland, Bde. 1 u. 2. Leipzig21818.2 1818. Reise von Paris durch das südliche Frankreich bis Chamony, Bd. 3, Leipzig 31824).3 1824). Der „Jüngling" habe, „sich — selbst noch unbewußt, schon die spätere Richtung seiner Weltanschauung" verraten. Hans Zinthingegen neigt in seiner kurzen, aber gehaltvollen Besprechung dazu, den Wert der Tagebücher zu relativieren. Es gehe um ein primär entwicklungsgeschichtlich bedeutsames, vorphilosophisches, unter der Schwelle der Reflexion bleibendes Material, von dem aus ohne Vorwissen um den Autor — nicht auf den späteren Denker und Menschen Schopenhauer geschlossen werden könne obwohl der, wie auch Zint zugesteht, seinen Jugendeindrükken großen Wert beigemessen hat. Der vorliegende Essay trifft sich mit den Beobachtungen und Thesen von Zint an einigen Punkten. Der zwischen der Überschätzung und der Unterschätzung der Reisetagebücher beschrittene „mittlere Weg" soll aber zeigen, daß gerade das Vorphilosophische und Vorbewußte dieser Texte mit ihren Materialmassen, in denen die Kernstellen spurenlos unterzugehen scheinen, zur „Sache selbst" gehört, wie sie sich aus der Sicht von Schopenhauers Philosophie der Lebensalter und des Genies ergibt. Und „die Sache selbst" das ist eben doch die (vierfache) Wurzel für das, wovon die Frage im Titel dieses Essays und die Antwort an seinem Schluß spricht. — 626 So zitieren wir Schopenhauer: ImSchopenhauer-Jahrbuch (= Jahrb., bzw. Jb.) wird Schopenhauer, zumindest in deutschen Texten, nach den historisch-kritischen Ausgaben zitiert.Dabei werden folgende Siglen verwendet: [I.] Arthur Schopenhauer: Sämtliche Werke. Hrsgg. von Arthur Hübscher. 7 Bände. Wiesbaden: F.A.Brockhaus 3. A. 1972 (= Werke) = Ueber die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden G Grunde (Werke Bd. I:Schriften zur Erkenntnislehre) = Ueber das Sehn und die Farben (Werke Bd. I:Schriften F zur Erkenntnislehre) = Die Welt als Wille und Vorstellung Bd. I(Werke Bd. II) WI = W II Die Welt als Willeund Vorstellung Bd. II(Werke Bd. III) = Ueber den Willen in der Natur (Werke Bd. IV [1]) \u039d = Die beiden Grundprobleme der Ethik (I.Ueber die FreiE heit des menschlichen Willens. 11. Ueber das Fundament der Moral. Werke Bd. IV [2]) = \u03a1 I und Paralipomena Bd. I(Werke Bd. V) Parerga = Parerga und Paralipomena Bd. II(Werke Bd. VI) \u03a1 II Bd. VIIder Werkausgabe enthält die Urfassung der Dissertation von 1813, Gestrichene Stellen, Varianten früherer Auflagen, Nachweis der Zitate mit Übersetzungen der fremdsprachigen Stellen und Namen- und Sachregister. [ll.] Arthur Schopenhauer: Der Handschriftliche Nachlaß. Hrsgg. von Arthur Hübscher. 5 Bände. Frankfurt am Main: Verlag Waldemar Kra— mer 1966 1975 (=HN). Seitengetreuer Nachdruck Deutscher Taschenbuchverlag 1985. = Bd. I:Die frühen Manuskripte 1804—1818 HNI = Bd. II:Kritische Auseinandersetzungen 1809—1818 HNII = Bd. III:Berliner Manuskripte 1818—1830 HN111 HNIV(1) = Bd. IV, 1: Die Manuskripte der Jahre 1830—1852 HNIV(2) = Bd. IV, 2: Letzte Manuskripte/Gracians Handorakel = Bd. V: Arthur Schopenhauers Randschriften zu Büchern HNV [lII.] Arthur Schopenhauer: Gesammelte Briefe. Hrsgg. von Arthur Hübscher. Bonn: Verlag Bouvier Herbert Grundmann = GBr [IV.] Arthur Schopenhauer: Gespräche. Hrsgg. von Arthur Hübscher. 2. stark erweiterte Auflage. Stuttgart-Bad Cannstatt: Friedrich Frommarm Verlag Günther Holzboog 1971 = Gespr(äche) [V.] Schopenhauer-Bildnisse. Eine Ikonographie von Arthur Hübscher. Frankfun am Main: Verlag Waldemar Kramer 1968 = Bildn(isse) * Die bei Diogenes erschienene lObändige Taschenbuchausgabe der Werke Schopenhauers (die sog. „Zürcher Ausgabe") ist ein textgetreuer Nachdruck der von Arthur Hübscher edierten historisch-kritischen Ausgabe. * Für das Englische sind die von E.F.J. Payne besorgten Übersetzungen maß geblich. 627