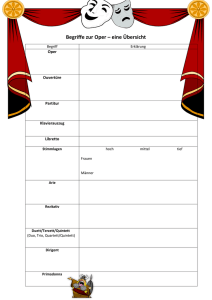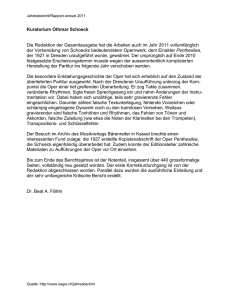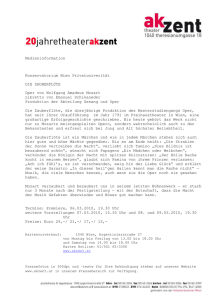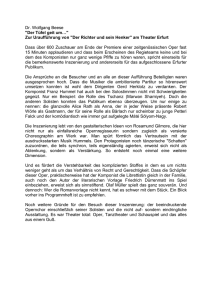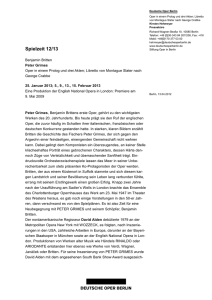pdf-Datei - der kulturchronist
Werbung

1 Jürgen Hartmann _______________________________________________________________ Journalist, Dramaturg, Autor, Drucksachen, Internet Nauheimer Straße 50 70372 Stuttgart Telefon 0711 5058934 und 0177 4915705 Internet www.kulturchronist.de e-mail [email protected] Texte zum Thema Oper 01 Eine Opernreise durch Belgien (Rezensionen, Reportage) 02 „Ich verdiene Verachtung“. Tschaikowsky zur Zeit des „Eugen Onegin“ 03 Eine unspektakuläre Revolution. Über Massenets „Werther“ 04 Die zwei Welten. Über Marschners „Hans Heiling“ 05 Heinweh, Heimat, Meer. Notizen zu Brittens „Peter Grimes“ 06 Zeit zu erinnern. Symbolik und Wirklichkeit in Rautavaaras „Sonnenhaus“ Eine Opernreise durch Belgien März 2002 - Langfassung eines Beitrags für die Stuttgarter Zeitung Wie silberne Fäden verschlingen sich die Stimmen von Oleg Riabets, Lawrence Zazzo und Alain Aubin zu einem Ornament, wie es schöner an keinem Brüsseler Jugendstil-Haus gedacht werden könnte. Nur dass musikalische Ornamente, wie sie die drei Countertenöre in Peter Eötvös' Oper „Tri Sestry“ kunstvoll gestalten, allzu schnell wieder zerfallen. Allzu vergänglich sind die Opernwunder, von denen „Tri Sestry“ am Königlichen Theater La Monnaie in der belgischen Hauptstadt ein ganz besonderes ist. Das Stagione-System kennt Ensembles nur für die einzelne Produktion und leidet nicht unter dem quantitativen Zwang, der das deutsche Opernleben prägt: Die Produktion der Eötvös-Oper wird in Brüseel gerade neun Mal gespielt. Bernd Loebe, derzeit noch künstlerischer Direktor der Brüsseler Oper und als ehemaliger HRRedakteur und designierter Frankfurter Intendant so etwas wie ein Bindeglied zur deutschen Musiklandschaft, weiß sehr genau um die Potenzen von La Monnaie. Das Stagione-System kennt Ensembles nur für die einzelne Produktion und leidet nicht unter dem quantitativen Zwang, der das deutsche Opernleben prägt: „Bei 80 Aufführungen pro Saison gibt es eigentlich keine Ausrede mehr für schlechte Qualität“, meint der betont lässig auftretende Theatermann schmunzelnd. Wenn Loebe seine Pläne für die Oper Frankfurt in seinem Brüsseler Büro erläutert, entfalten sich diese deutlich auf der Folie der paradiesischen Zustände, die die belgische Nationaloper (eine der wenigen Kulturinstitutionen, die in der zentralen Regie des 1994 in einen Bundesstaat umgewandelten Königreichs verblieben sind) vor allem den Künstlern bietet. „Das Haus kann sehr hohe Ansprüche beispielsweise an die Bühnentechnik erfüllen“, erzählt Loebe. Die 1986 beendete Grundsanierung und vor allem Ankauf und Sanierung eines heruntergekommenen 2 Gebäudekomplexes hinter der Oper, der jetzt Büros, Probebühnen und Werkstätten beherbergt, machen die Brüsseler Oper auch in dieser Hinsicht zum Ausnahmefall. Die Produktion von „Tri Sestry“ ist identisch mit der Uraufführung, die 1998 in Lyon herauskam und auch als CD-Mitschnitt verfügbar ist. Loebe und sein Intendant Bernard Foccroulle haben die Übernahme dieser Inszenierung erst vereinbart, nachdem sie den ungewöhnlichen Erfolg in Lyon erlebt hatten. Insofern handelt es sich nicht um eine echte, von mehreren Häusern gemeinsam konzipierte und vorbereitete Koproduktion. Aber auch solche Übernahmen sind gerade im Stagione-System, in dem herausragende Produktionen kaum dauerhafte Wirkung entfalten können, eine gute Sache. Da ein großer Teil der Brüsseler Besetzung an identisch mit der Uraufführung ist und einige andere Partien mit Interpreten besetzt wurden, die diese Produktion in Paris mitgestaltet hatten, reichten zehn Tage Proben aus. Es kommt hinzu, dass Peter Eötvös, der die acht Aufführungen selbst dirigiert hat, ein langjähriger Berater der Brüsseler Oper ist. Bernd Loebe schätzt ihn hoch: Man hänge an seinen Lippen, wenn er dem Orchester die Eigenarten seiner Komposition vermittle. „Ich gönne Eötvös seinen jetzigen Erfolg“, sagt Loebe über den Komponisten, der nach einigen mageren Jahren mit Aufträgen bis 2008 eingedeckt ist. Die Brüsseler Oper ist eine Pralinenschachtel, eins der Foyers trägt sogar den Namen „Bonbonnière“. In diesem Prachtstück würden sogar die „Jungen Wilden“ unter den Regisseuren und Bühnenbildnern zahm, erzählt Bernd Loebe. Er nimmt für sich in Anspruch, seinem Intendanten einiges vom deutschen Musiktheater schmackhaft gemacht zu haben, gesteht aber auch, dass zwei Seelen in seiner Brust wohnen. Vielleicht wirkt sich der genius loci also auch auf die Bühnenästhetik aus. „Ein Haus zum Wohlfühlen“ sei La Monnaie ohnehin, meint Loebe, dem die freundschaftlichen Beziehungen zu vielen Sängern aber auch die Möglichkeit geben, „Tacheles zu reden“. Die Besetzungspolitik folgt einem einfachen, aber wirkungsvollen Prinzip: „Sing heute eine kleine Partie, dann bekommst du morgen eine große.“ Auf diese Weise baute Loebe, der in seinem Fach neben (Stuttgarts) Pamela Rosenberg zu den „Headhuntern“ mit der besten Spürnase zählt, viele Sängerinnen und Sänger auf, die heute - berühmt geworden - für die halbe Gage nach Brüssel kommen. „Wenn es auch kein festes Ensemble gibt, wir schaffen auf jeden Fall die Atmosphäre eines Ensembles.“ Während es in der Region Brüssel, die im streitsüchtigen Belgien als zweisprachig etabliert ist, wohl keinen Satz im öffentlichen Raum gibt, der nicht in flämisch und französisch erscheint (sogar die Position der Übertitel bei „Tri Sestry“ wird in der Pause getauscht, um keiner Sprache einen Vorteil zu verschaffen), verzichtet die Vlaamse Opera, das Musiktheater der Region Flandern in Antwerpen mit Zweitsitz in Gent, fast gänzlich auf das Französische - bis auf eine kurze Inhaltsangabe im Programmheft. Antwerpen ist die Hochburg der flämischen Nationalisten, die sich die Zukunft ihrer prosperierenden Region durchaus als eigenständigen Staat innerhalb der EU oder als Bestandteil der Niederlande vorstellen können. In auffälligem Gegensatz zum Brüsseler Pralinenkästchen ist die Oper in Antwerpen auch optisch eine bürgerliche Gründung, bei der Fragmente des Jugendstils und überreiche symbolische Plastik im Zuschauerraum eine vom Aristokratischen abgegrenzte Atmosphäre der Repräsentation erzeugen. Die Vlaamse Opera wird derzeit von der „flämischen Gemeinschaft“ (also der Region Flandern) gemeinsam mit den Städten Antwerpen und Gent finanziert. Dies bedinge eine absolut paritätische Bedienung der Spielstätten, berichtet Intendant Marc Clémeur ist anders als sein Name erwarten lässt waschechter Flame und spricht als ehemaliger Kölner Theaterwissenschaftsstudent perfekt Deutsch. Christine Mielitz’ von der Wiener Volksoper übernommene Inszenierung von Wagners „Meistersingern“ gibt es fünf Mal hier und fünf Mal dort, obwohl die Nachfrage in Antwerpen, wo schon ab 1913 alljährlich der „Parsifal“ zum Karfreitag erklang, größer ist als in Gent. Sollten die aktuellen Überlegungen, die Finanzierung der Kulturinstitutionen zu entflechten und die Museen ganz in städtische, dafür die Oper in 3 regionale Obhut zu nehmen, aus der Vlaamse Opera ein Staatstheater machen, will Clémeur die Aufführungen nach dem Bedarf und nicht nach der äußerlichen Gleichberechtigung ansetzen. Die Opernhäuser in Antwerpen und Gent wurden erst 1989 fusioniert, nachdem Gérard Mortier in Brüssel mit hoher, international beachteter Qualität die Musiklandschaft Belgiens unter Zugzwang gesetzt hatte. Anders als bei den Fusionsprojekten in Deutschland seit 1990 zu beobachten, machte Belgiens damaliger Kulturminister in den beiden flämischen Städten tabula rasa - man ließ sogar Orchestermusiker neu vorspielen und stellte eine ganz neue Mannschaft zusammen. Feste Künstler gibt es auch an der Vlaamse Opera nicht, unter der bewusst unfestlichen, auf jeden Pomp verzichtenden Leitung von Friedemann Layer sangen einige Solisten, die bereits in Wien dabei gewesen waren, gemeinsam mit belgischen Eigengewächsen und weiteren internationalen Gästen. Die Freiheit vom Besetzungszwang ermöglichte es, nicht nur ein Liebespaar mit ungewöhnlich jugendlicher Ausstrahlung zu verpflichten (FMC und JD), sondern auch auf eine gemeinsame Auffassung vom Wagner-Gesang zu achten: Die helle, schlanke Tongebung aller Sänger ließ Wagners Textmassen ungewöhnlich klar über die Rampe kommen. Christine Mielitz hatte übrigens ihre in Wien erprobte Inszenierung, die aus Wagners zwiespältiger Komödie einen vergnüglichen Theaterabend macht, in Antwerpen sechs Wochen lang fleißig geprobt. Clémeur, der sich an deutschen Opernhäusern gut auskennt, hatte eine „kritische“ Inszenierung einkaufen wollen, die jedoch nicht - wie beispielsweise Neuenfels’ umstrittene Stuttgarter Produktion - „das Kind mit dem Bade ausschüttet“. Dem Anspruch, „mit dem halben Etat, aber dafür in zwei Städten Brüsseler Niveau zu erreichen“ (Clémeur), scheint die Flämische Oper mit dieser Produktion sehr nahe zu kommen, zumal Chor und Orchester beachtliche Strahlkraft besitzen. Auch Marc Clémeur kann sich eine künstlerische Entdeckung auf die Fahnen schreiben, hat er doch den Kanadier Robert Carsen als Opernregisseur schon früh nach Belgien verpflichtet und kontinuierlich aufgebaut. Dessen Puccini-Zyklus an der Flämischen Oper wurde durch Koproduktion und Übernahme auch ins deutsche Opernleben eingespeist: Neben der eher matten Hamburger „Tosca“ wurde auch Mannheim mit Carsens psychologisch interessanter „Turandot“ aus Belgien bedacht. Auf der Autobahn von Brüssel nach Lüttich durchquert man mehrfach die Sprachgrenzen, die den belgischen Staat nach seiner Föderalisierung zu einem nach außen kaum noch aussagekräftigen Gebilde gemacht haben. Da die Regionen eine nur einsprachige Ausschilderung als Ehrensache betrachten, wechselt also die Richtungsanzeige mehrfach von Liège nach Luik und zurück - wer nicht genau weiß, dass er ins französischsprachige Lüttich will, könnte durchaus in Verwirrung geraten (allerdings ist die flämische Bezeichnung für das nordfranzösische Lille, nämlich Rijsel, noch um einiges verwirrender). Gegenüber dem ausgefegten Brügge, dem quirligen Antwerpen und dem äußerst lebhaften Brüssel wirkt Lüttich wie das Stiefkind unter den belgischen Großstädten. Einzelne architektonische Glanzstücke aus jüngster Zeit können nicht über die noch immer herüberragende Vergangenheit als verfallende Industriestadt hinwegtäuschen. Auch das Opernhaus hat seine glanzvollen Tage bereits hinter sich und hätte eine optische Auffrischung nötig. Der österreichische Dirigent Friedrich Pleyer, seit 1994 musikalischer Chef der „Opéra Royal de Wallonie“, weiß die tückische, mehr ans Fernsehen als an ein Opernhaus gemahnende Akustik des Hauses aus Erfahrung zu nutzen. Die zweite Vorstellung der neuen Produktion von Richard Strauss’ „Elektra“ - vom Staatstheater Darmstadt übernommen - profitierte von dieser Erfahrung und präsentierte ein auffällig transparentes Klangbild. Rollendebütantin Martine Surais in der Titelpartie hat zwar hochdramatische Kraft, ist sprachlich aber nicht auf der Höhe des Hofmannsthalschen Librettos. Dagegen gibt die auch in Stuttgart bekannte Marcela de Loa als Chrysothemis ein Beispiel an genauer Textbehandlung und klarer Intonation. Die Inszenierung von Friedrich Meyer-Oertel bestätigte wieder einmal, dass die Treffsicherheit der eigentlichen Inszenierung durch eine altbackene Ausstattung (Heidrun Schmelzer) empfindlich beeinträchtigt werden kann. 4 In Lüttich, dessen Oper von der „französischen Gemeinschaft“, der Provinz und der Stadt finanziert wird, gibt es zehn Premieren pro Saison, davon sieben Neuinszenierungen, größtenteils als Koproduktionen. Ganz ähnlich sind die Verhältnisse in Brüssel und bei der Vlaamse Opera. Die belgischen Opernhäuser zusammen kommen auf rund 250 Aufführungen pro Saison. Verglichen mit den Gepflogenheiten des deutschen Repertoires ist das nicht viel - Stuttgart beispielsweise bietet in der aktuellen Spielzeit rund 160 Opernvorstellungen. Durchschnittliche und gute Abende gibt es überall. Aber Opernwunder wie Brüssels „Tri Sestry“? Sie erblühen unter den aktuellen Bedigungen im deutschsprachigen Raum doch nur selten. 5 „Ich verdiene Verachtung“ Peter Tschaikowskij zur Zeit der Entstehung seiner Oper „Eugen Onegin“ - Text für das Programmheft „Eugen Onegin“ am Theater Görlitz 1998 (Inszenierung Peter Wittig). Briefe zitiert nach Nikolai Kaschkin und Alexander Poznansky. Vom heutigen Tag an werde ich alles mögliche tun, um irgend jemanden zu heiraten. Ich weiß, dass meine Neigungen das größte und unüberwindlichste Hindernis für mein Glück sind, und ich muss mit allen meinen Kräften gegen meine Veranlagung ankämpfen. Ich werde Unmögliches zustande bringen, um mich noch in diesem Jahr zu verheiraten, und wenn ich dazu nicht genügend Mut aufbringe, werde ich in jedem Fall auf meine Gewohnheiten verzichten. Der Gedanke, dass jene, die mich lieben, sich meiner manchmal schämen, trifft mich tödlich. Es ist hundertmal geschehen und wird noch viele hundertmal geschehen … Mit einem Wort, ich möchte durch eine Heirat oder eine offizielle Verbindung mit einer Frau das ganze Pack zum Schweigen bringen, das ich zwar verachte, das aber den Menschen, die mir nahestehen, Kummer bereiten kann. Doch ich stecke zu tief in meinen Gewohnheiten und Vorlieben, als dass ich sie mit einem Schlag wie einen alten Handschuh wegwerfen könnte. Ich habe keinen sehr festen Charakter, und seit meinem letzten Kampf habe ich bereits dreimal meinen Neigungen nachgegeben. Tschaikowskij im Herbst 1876 an seinen Bruder Modest Initialzündung zur Oper „Eugen Onegin“ war die spontane Äußerung einer Professorenkollegin am Moskauer Konservatorium, die Puschkins Versdichtung im Gespräch als möglichen Opernstoff vorschlug. Tschaikowskij tat diese Idee zunächst als wahnwitzig ab, doch wie nicht selten blieb der zunächst vehement abgelehnte Gedanke virulent: der Komponist kaufte sich den Puschkin-Band, verschlang ihn und entwarf im Nu ein Szenarium (wie auch das spätere Libretto zu großen Teilen auf seine eigenen Ideen zurückging). Die Idee war in der Tat ungewöhnlich: Puschkins Dichtung schien und scheint auf den ersten Blick, und rein äußerlich betrachtet, nicht gerade eine geeignete Vorlage für eine bühnenwirksame Oper. Im distanziert berichtenden Erzählgestus verfasst, ermangelte sie jeglicher Grundlage für große Operntableaus, und durch Puschkins ironischen Ton scheinen seine Figuren dem Leser merkwürdig fern zu stehen. „Eugen Onegin“ wurde Tschaikowskijs Lieblings-, aber auch Schmerzenskind. Ohne durch konkrete Anwürfe dazu veranlasst zu sein, verteidigte er die entstehende Oper mehrfach: es sei ihm klar, dass sie nicht bühnenwirksam und vermutlich zum Misserfolg verurteilt sei. Der Komponist wollte sein Werk keiner großen Opernbühne zur Uraufführung anvertrauen, sondern orientierte auf eine Aufführung am Moskauer Konservatorium mit jungen, frischen, noch nicht von der Konvention verdorbenen Kräften. Die Bestrebungen, seinen „Onegin“ als etwas Besonderes darzustellen und gleichsam gegen die rauhen Stürme des Bühnenschlendrians zu schützen, sind sicher aller Ehren wert. Indessen: obwohl Tschaikowskijs Oper viele ungewöhnliche Elemente aufweist – vor allem im hohen Grad an musikalischer Psychologisierung unter Verzicht auf die Elemente konventioneller Operndramaturgie –; als Reformprojekt war dieses Werk nicht gedacht. Nein, es muss wohl ein anderer Grund gewesen sein, der Tschaikowskij dazu trieb, sich in diesen Stoff geradezu zu verbeißen und seine Oper im voraus gegen Widerstände und Missverständnisse zu verteidigen. Und tatsächlich ist die Entstehung der Oper „Eugen Onegin“ eng mit Tschaikowskijs Biographie verknüpft. Vom heutigen Tag an werde ich alles mögliche tun, um irgend jemand zu heiraten. Es klingt alles so entschlossen, dass man es geradezu in Frage stellen muss. Hatte doch der ältere Bruder dem jüngeren, ebenfalls homosexuellen Modest mehr als einmal dozierend die Vorteile „normalen“ Lebens dargestellt („Aber auch Du musst gut darüber nachdenken. Bougromanie [ein damals üblicher Ausdruck für Homosexualität] und Pädagogik können sich nicht miteinander vertragen“.) Der ältere Bruder wollte mit seinen Heiratsplänen wohl auch dem jüngeren ein Vorbild sein, um dessen Karriere er fürchtete. Auch dem zweiten Bruder, Anatolij, berichtet er offen über die 6 Auseinandersetzung mit seiner Veranlagung; allerdings schimmert hier ein gewisses Maß an Selbstmitleid durch. Und wahr ist auch, dass die verfluchte Homosexualität zwischen mir und den meisten Menschen einen unüberschreitbaren Abgrund bildet. Sie verleiht meinem Charakter Entfremdung, Angst vor Menschen, Furchtsamkeit, unermessliche Schüchternheit, mit einem Wort, tausend Eigenschaften, durch die ich mehr und mehr menschenscheu werde. Stell’ dir vor, dass ich jetzt häufig und längere Zeit hindurch bei dem Gedanken an ein Kloster oder etwas Ähnliches verweile. In dieser Seelenstimmung, die auch heute – besonders in der Phase der Selbstvergewisserung und bei „versteckt“ oder unter großem Leidensdruck lebenden Homosexuellen – nicht selten ist, wurde Tschaikowskij von Worten getroffen, die zwar Irritation und Verlegenheit auslösten, aber auch einen vermeintlichen Ausweg wiesen. Wo ich auch bin, nie werde ich Sie vergessen können, nie werde ich aufhören, Sie zu lieben. Was ich an Ihnen liebe, kann ich sonst nirgendwo finden, mit einem Wort, nach Ihnen will ich keinen anderen Mann mehr ansehen. So schrieb Antonina Iwanowna Miljukowa, eine unauffällige Schülerin des Konservatoriums, die sich in den Komponisten, der sich ihrer kaum mehr erinnerte, verliebt hatte. Auf die Briefe, die er im Sommer 1877 von ihr erhielt, reagierte Tschaikowskij höflich-kühl; verständnisvoll, doch abweisend – auf die eigentlichen Liebeserklärungen ging er gar nicht ein. Doch die junge Frau insistierte. Seit ich Ihren letzten Brief gelesen habe, liebe ich Sie noch viel mehr, und Ihre Fehler erschüttern mich nicht. … Ich brenne vor Verlangen, Sie zu sehen, ich kann es nicht abwarten. … Ich möchte Ihnen um den Hals fallen, Sie küssen. … Ich schwöre Ihnen, dass ich im wahrsten Sinne des Wortes ehrlich bin. Am 6. Juli 1877 heiraten Tschaikowskij und Antonina Iwanowna. Es wird eine kurze, katastrophale Ehe, eine tragische Episode in des Komponisten Leben, die ihn an den Rand des Freitodes brachte und zur fluchtartigen Abreise ins Ausland trieb. Denn die fixe Idee, sich um jeden Preis verheiraten zu wollen (einen Preis, den nicht nur er, sondern auch seine Frau zu zahlen hatte), konnte nur scheitern. Es folgen bittere, aber auch notwendige Worte (an Bruder Modest im Oktober 1877): Ich verdiene Verachtung, weil solch einen Wahnsinn, wie ich ihn vollbracht habe, nur ein ausgemachter Dummkopf, ein verrückter Waschlappen vollbringen kann. Diese „Selbstkritik“ war, wie auch anders, ein wichtiger Schritt zu abgeklärterer Einsicht, die er in einem Brief an Anatolij vom Februar 1878 – zu dem Zeitpunkt, an dem er die „Onegin“-Partitur gerade abschloss! – formuliert: Erst jetzt, besonders nach der Geschichte mit der Heirat, beginne ich endlich zu begreifen, dass es nichts Fruchtloseres gibt, als nicht der sein zu wollen, der man seiner Natur nach ist. Kein Zufall also, dass der „Onegin“-Stoff Tschaikowskij gerade in dieser Phase seines Lebens so gefangen nahm. Auf sehr differenzierte Weise gingen seine persönlichen Erfahrungen in die sensible Zeichnung der Figuren und Vorgänge seines Bühnenwerkes ein. Im „wirklichen Leben“ konnte von sublimer Tragik indessen keine Rede sein: Tschaikowskijs Frau reagierte auf die Trennung im September 1877 mit unerbittlicher, andauernder übler Nachrede.“Eugen Onegin“ wurde, nach einigen Verzögerungen, durch die Studenten des Konservatoriums am 17. März 1879 auf der kleinen Bühne des Maly-Theaters in Moskau uraufgeführt. Zwei Jahre später gelangte das Werk dann doch auf die kaiserliche Bolschoi-Bühne, darauf nach Sankt Petersburg, 7 Prag, später (1892) unter anderem auch nach Deutschland (Erstaufführung in Hamburg unter Gustav Mahlers Leitung, nachdem sich der Komponist mit „Unpässlichkeit“ entschuldigt hatte). Der Komponist ist nun ein weithin berühmter Mann und geachteter Künstler. Doch Verletzungen bleiben: Meine Seele ist … in einer Weise verwundet, dass ich mich davon – wie mir scheint – nie mehr erholen werde. Streng genommen glaube ich, dass ich als Mensch erledigt – un homme fini – bin. Ich werde natürlich am 1. September 1878 ins Konservatorium zurückkehren, ich werde wie ehemals Harmonielehre unterrichten, werde mich in der Umgebung von alten Freunden wohlfühlen, doch es wird nie wieder wie früher sein. Irgend etwas ist in mir zerbrochen, die Flügel sind gestutzt, und ich werde sicherlich keine großen Höhenflüge mehr unternehmen können. 8 Eine unspektakuläre Revolution Über Massenets „Werther“ - Text für das Programmheft Theater Görlitz 1997 „Winter 1774 auf 75 brannten in Deutschland viele Kerzen bei der Lektüre eines Buches herunter...“ – so erzählt ein Zeitgenosse von dem Leserausch, den Goethes Briefroman „Die Leiden des jungen Werthers“ auslöste. Und die Verinnerlichung dieses Buches ging weit über die bloße Lektüre hinaus: sogar von einer Selbstmordwelle ging die Rede. Goethes Aussage, dass ja die „Wertherzeit“ keine historische Epoche, sondern eine individuelle Lebensphase jedes Einzelnen sei, bestätigt sich nicht nur in dem bis heute reichenden (und hoffentlich auch in der Zukunft nicht gefährdeten) Bekanntheitsgrad des „Werther“, sondern auch darin, dass andere Künstler bis in unser Jahrhundert hinein sich von dem Buch immer wieder haben inspirieren lassen: aus Thomas Manns klugem Essay über Goethes Roman entstand schließlich sein eigenes Buch „Lotte in Weimar“, das eine fiktive Begegnung der „echten“ Lotte mit dem gealterten Goethe beschreibt (und übrigens auch den Rummel, den die Ankunft von „Goethes Lotte“ in der Stadt auslöst – der legendäre Hoteldiener Mager bezeichnet die Situation mit seinem höchsten Kompliment als „buchenswert“). Ein knappes Jahrhundert nach Massenet war auch möglich, was Eduard Hanslick in seiner Uraufführungskritik für ausgeschlossen hielt: in der 1986 in Schwetzingen uraufgeführten „Werther“-Oper des Komponisten Hans-Jürgen von Bose (geb. 1953) treffen Lotte und der Titelheld am Ende nicht mehr zusammen. Personal und Szenendisposition sind jedoch gegenüber Massenets Oper beträchtlich erweitert. Die Vorgeschichte wird ebenso erzählt wie das Kennenlernen Lottes und Werthers auf dem Ball; auch Werthers Außenseitertum wird viel stärker in den Mittelpunkt gerückt – es wird zu einer erklärten Grundhaltung des Skeptikers. Der Wechsel von realen und Traumszenen akzentuiert diese Sicht. Jules Massenet hatte 1885 sein Schlüsselerlebnis in Sachen „Werther“, und zwar ein doppeltes, sehr typisches „Deutschland-Erlebnis“. Auf der Rückreise von Bayreuth, wo er den „Parsifal“ gesehen hatte, nahm er in der „Werther“-Stadt Wetzlar Quartier. Der spätere Librettist Georges Hartmann machte Massenet nicht nur mit diesem Städtchen, sondern auch mit einer französischen Übersetzung des Romans bekannt. Massenets Reaktion mutet wie ein Echo vieler früherer an: „Ich konnte mich einfach nicht von der Lektüre jener glühenden Briefe wegreißen... Eine derartig wilde, verzückte Leidenschaft trieb mir die Tränen in die Augen. Diese aufwühlenden Szenen, diese fesselnden Bilder –!“ Der immerhin 43-Jährige wurde ein weiterer Jünger von Goethes Roman. Bis zur Uraufführung 1892 an der Wiener Hofoper – in der deutschen Übersetzung von Max Kalbeck, die kurz danach auch bei der deutschen Erstaufführung in der Goethe-Stadt Weimar verwendet wurde – war es jedoch noch ein langer Weg. Vom Werther-Erlebnis inspiriert, komponierte Massenet die Oper auf das von Georges Hartmann gemeinsam mit Edouard Blau und Paul Milliet erstellte Libretto zwar in Jahresfrist fertig; der Direktor des in Aussicht genommenen Uraufführungstheaters, der Pariser Opéra comique, äußerte sich jedoch skeptisch – ihm schien die neue Oper gegenüber der erfolgreichen „Manon“ allzu trist. „Werther“ blieb in Massenets Schublade, bis der Tenor Ernest van Dyck, verlockt von der Titelrolle, die Wiener Uraufführung in die Wege leitete. Irritierend mag auf Monsieur Carvalho vor allem gewirkt haben, dass Massenet bei der Vertonung des „Werther“ einen entscheidenden Schritt zur Literaturoper gegangen war. Zwar unterscheidet sich das Libretto von späteren, exemplarischen Literaturopern wie Debussys „Pelleas et Mélisande“ und Strauss’ „Salome“ grundsätzlich dadurch, dass es die literarische 9 Vorlage nicht „mit Haut und Haaren“ übernimmt (dies wäre indessen bei Goethes Briefroman auch ausgeschlossen gewesen). Entscheidend ist jedoch die neuartige Qualität des Wort-TonVerhältnisses und der formalen Gliederung der Oper: Dass der musikalische Fluss sich in bis dahin ungekanntem Umfang an die Besonderheiten der französischen Sprache anpasst und die szenisch-musikalischen Verläufe kein Nummernschema mehr erkennen lassen, sich vielmehr organisch in den Gesamtablauf einfügen, bedeutete gleichsam eine „Reform im stillen“ (Ulrich Schreiber), eine unspektakuläre Revolution, mit der Jules Massenet das Tor zu den „eigentlichen“ Literaturopern weit aufstieß. Es lag in der Natur der Sache, d.h. der literarische Vorlage, dass es einen prinzipiellen Unterschied zwischen Goethe und Massenet gibt: der Briefroman – wenn man so will, eine noch undramatischere Form als der erzählende Roman, der in aller Regel auch Dialoge enthält – ist der Gattung Oper geradezu diametral entgegengesetzt. Die Verwandlung der Erzählung in Briefen in eine wirksame Bühnenhandlung ist bereits eine hoch zu schätzende Leistung. Darüber hinaus schufen Massenet und seine Librettisten für die ersten Szenen ein passendes Ambiente mit verschiedenen neuen Nebenfiguren (wobei deren Anführer Johann und Schmidt gleichzeitig auch als bis zur Ironie vordringende „Spiegel“ der Haupthandlung dienen), und sie veränderten einige Goethesche Details in psychologisch wichtige Kernpunkte: aus dem Wunsch der Mutter, Charlotte möge Albert zum Manne nehmen (worauf sich später echte Gefühle gründen) wird ein Gelübde, das die sterbende Mutter ihrer Tochter abnimmt – ohne Rücksicht auf deren Gefühle. Die Übergabe der Pistolen, bei Goethe eher beiläufig, wird zum Ausdruck der Infamie Alberts: er weiß, wozu Werther die Waffen benötigt, und zwingt ohne Not Charlotte zur Übergabe. Auch die Aufwertung Sophies von einer bei Goethe am Rande erwähnten Elfjährigen zu einem heiratsfähigen Teenager (und damit auch einer denkbaren Alternative für Werther, wie Albert ihm halb treuherzig, halb misstrauisch nahelegt) fügt dem Drama eine wichtige Komponente hinzu. So wie in Gounods „Faust“ die Figur Gretchen vom Rand ins Zentrum des Dramas rückte, wird auch Charlotte – in der Form des Briefromans naturgemäß nur ein Objekt des Erzählens – in der französischen Goethe-Version eine aktive, starke Figur. Die wichtigste Erfindung der „Werther“Librettisten ist keineswegs nur eine Konzession an die Gepflogenheiten der Opernbühne: die Begegnung Charlottes mit Werther am Schluss der Oper. Die Befürchtung Charlottes, es könne „zu spät“ sein, erweitert ihre Geltung über das schlimme Ende des Geliebten hinaus auf die Einsicht, dass auch die eigene Selbstverwirklichung verloren ist – ebenso wie die wider besseres Wissen gehegte Hoffnung auf ein „stilles Glück“ mit Albert. Dennoch: dass Charlotte am Schluss über sich hinauswächst und sowohl ihrer Liebe als auch ihrer Verzweiflung freien Lauf lässt, emanzipiert die Opernfigur gleichsam von der Goetheschen Lotte, die sich von Leser und Betrachter nur als passive Besucherin von der Grabstelle Werthers verabschiedet. 10 Die zwei Welten Über Heinrich Marschners „Hans Heiling“ Für ein Programmheft des Theaters Görlitz, Spielzeit 1995/96 Ohne Ruh, immerzu wirken wir munte reicher und bunter wonach die Menschen ringen und wirken zum Nutzen und Schaden, zum Heil und Verderben. Chor der Erdgeister im Vorspiel Das Tragen und Hacken das Mühen und Placken hört heut' einmal auf. Drum lustig! ... Bauernchor 1. Akt Hans Heiling scheitert nicht „an den Menschen“, er scheitert als Mensch. Es ist nicht eindeutig, warum. Er ist laut Libretto halb Mensch, halb Geist. Es geht ihm also anders als Undine nicht darum, eine Seele zu erlangen - die besitzt er offenbar. Was also macht die beiden „Welten“ aus? Während die „Geister“ am Beginn der Oper als eine arbeitende Gruppe gezeigt wird und auch so singt - selbst wenn laut Heiling der „Sabbat“ gefeiert wird! -, ist die Oberwelt bäuerlich, geradezu idyllisch gezeichnet - dies geht soweit, dass sogar das Dorf zugunsten der einsam im Wald befindlichen Schenke oder Kapelle ausgeblendet wird. Die Unterwelt wird von der Oberwelt nicht nur gefürchtet, sondern gleichzeitig märchenhaft verklärt. Dies taucht in der frühen Romantik (die die Oper viel stärker prägt als ihr vorgespiegeltes Mittelalter; ja fast ausschließlich) häufig auf: ein Gegensatz von Idylle und Bedrohung häufig im Begriffspaar Ebene/Berg, wobei z.B. in Tiecks „Runenberg“ das Gebirge auf den Helden gleichzeitig unheimlich und anziehend wirkt; die Idylle, die jenseits des Gebirges liegt, aber nach dem Passieren des letzteren für diesen Helden nicht mehr wirklich funktioniert - er also im Wortsinne enttäuscht wird.Fast scheint es also, als sei das Unheimliche der Erdgeister ihnen von der vermeintlichen „Oberwelt“ angedichtet, als werde hier eine ebenfalls recht normale, zumindest durchaus menschliche TeilWelt erst als Gegensatz zur traditionell bestimmten Oberwelt erfunden. Es liegt also nahe, dem bäuerlich-idyllischen Milieu eine Teil-Welt der „Berge“ gegenüberzustellen, die folgerichtig schon industriellen Charakter hat. Nicht umsonst wird gerade der Bergbau unter Tage gleichzeitig verklärt und als bedrohlich empfunden - ganz analog zu jener „Geisterwelt“. Und macht nicht tatsächlich diese Situation - die Arbeit unter Tage oder mit Maschinen - die dort Arbeitenden zu Zwergen? Auch die Verknüpfung dieses recht profanen Ambientes mit märchenhaften Elementen zieht sich durch die romantische Literatur (vgl. z.B. E.T.A. Hoffmann, „Die Bergwerke von Falun“). In der Sagenwelt, in der „Hans Heiling“ auch wurzelt, gibt es den Topos der „anderen Zeit“ - Menschen, die mit Erdgeistern in Berührung gekommen sind oder sie auch nur gesehen haben, steigen sozusagen aus der Zeit aus, verlieren den Anschluss, altern rapide. „Andere Zeiten“ gelten auch in den beiden „Welten“: ob oben oder unten, ob in Dorf oder Stadt. Darüber hinaus steht die Unterwelt auch für eine geistige Welt: Die Maschine, in der die Gnome und Zwerge arbeiten, ist Resultat von Naturforschung und Erfindung und treibt den Wissenschaftler an, nach neuen Möglichkeiten zur Ausbeutung der Natur zu suchen, neue Entdeckungen und Erfindungen zu machen und technische Vervollkommnung zu erreichen. Diese Welt erzeugt (auch) geistiges Schöpfertum. Wobei dieser 11 Drang wohl auch Heiling auf die Erde und zu den Menschen getrieben haben mag, nicht nur seine biologische „Halbmenschlichkeit“. Historisch gesehen, erscheint die Welt der Geister als die progressivere. Hinsichtlich der Lebensqualität ist sie der Welt der Menschen jedoch unterlegen. Darüber hinaus deuten sich in dieser progressiveren Welt bereits soziale Gegensätze an, die im Vorspiel noch zu eher zweckfreier Aggressivität, später jedoch durchaus zur Aufmüpfigkeit gegenüber dem (abgedankten) Herrscher Heiling führen. Bestenfalls eine vage Ahnung von der Zwiespältigkeit dieses Mannes weht die Dorfbewohner an. Schnell ist der Fremdkörper, der Feind der dörflichen Idylle zumindest als mit „Geisterhaftem“ zusammenhängend in Verruf geraten, die Bedrohung des schon leicht brüchig gewordenen Gleichgewichts zumindest erahnt. Damit ist allerdings ein ganz „modernes“ Problem mehr als angedeutet: das Problem des Intellektuellen in einer wiederum ihm fremden, hier also bäuerlichländlichen, für ihn zu einfachen Umgebung. Das vermeintlich Geisterhafte an Heiling deutet auf anderes. Der „Gang“ zur Unterwelt als Nabelschnur nicht nur zur Mutter, sondern auch zur besseren, weil geistig bestimmten Welt (was Heiling wohl ahnt: wie gespalten ist sein Verhältnis zum „Zauberbuch“!). Die Faustsche Studierstube, die (bürgerliche) Innerlichkeit in Abgrenzung zur profanen Außen-, Gegen-Welt. Doch: Fremd wirst du den Menschen bleiben, und ihr enges Treiben scheint dir niedrig bald und leer, warnt ihn die Königin - und dies nicht aus bloßem Eigennutz, sondern aus Erfahrung. Es wird sich zeigen, dass für Heiling die Idylle der „Oberwelt“ nicht weniger beengend ist wie „seine“ eigentliche Welt. Aus den Widersprüchen der Welt an sich scheint keine Flucht möglich. All dies spielt jedoch eher für die Position Heilings in der „Ober-Welt“ eine Rolle. Ein weiteres Thema sind seine Schwierigkeiten mit den Menschen im einzelnen, und mit sich selbst. Dass Heiling gegenüber Anna viel mehr als Patriarch auftritt als Konrad, dass er ein deplaziertes bürgerlich-joviales Vokabular verwendet, dass er Gehorsam verlangt, ohne sein Inneres preisgeben zu wollen, ist bezeichnend. Zuhause scheint er schon früh „Gattenersatz“ an der Seite seiner Mutter gewesen zu sein und ist in dem eigentlich patriacharlischen System von ihr zu patriachalischen Verhalten gelenkt worden. Andererseits ist es aber seine Mutter, der der Sohn liebend zu folgen hatte. Aus dieser widersprüchlichen Biographie (nicht umsonst also beginnt die Oper noch vor der Ouvertüre mit einer Auseinandersetzung von Königin und Thronfolger, die fast wie die Fortsetzung eines Dauer-Streits anmutet) dürfte Heilings nahezu schizophrenes Pendeln zwischen Befehlen und „zu Füßen liegen“ Anna gegenüber resultieren. Heiling gibt jenen Verantwortungsdruck direkt an seine Verlobte weiter, wenn er ihr in seiner Arie in geradezu bedrohlicher, beschwörungsähnlicher Intensität die Auswirkungen seiner Liebe zu ihr und ihre daraus folgenden Pflichten schildert - allerdings ohne sich wirklich zu entblößen oder zu öffnen. Auch dass er nicht erkennt, daß Anna ihn bestenfalls verehrt und bewundert, aber nicht liebt (er aber an diese vermeintliche Liebe seine ganze Existenz klammert), ist Ergebnis der bereits genannten anerzogenen Ich-Bezogenheit und „mangelnder Erfahrung“ mit dem „Du“: Daß er das Mädchen liebt, läßt ihn voraussetzen, daß er wiedergeliebt wird - eben wie von seiner Mutter. Von dieser hat er sich losgesagt, sogar sein „Zauberbuch“ fortgeworfen; allerdings ohne anderswo wirklich anzukommen. Heiling scheitert nicht, weil er nur ein „halber Mensch“ ist; er scheitert ebenso als ganzer Mensch, weil er als solcher nicht funktioniert (was aber nicht an seiner angeblichen GeisterHälfte liegen muss). Schon seine Situation in der „Unterwelt“ ist zwiespältig. Die „Geister“ oder „Zwerge“ verhalten sich recht aufsässig gegenüber ihrem König - wobei nie ganz klar wird, welche institutionelle Position der Sohn gegenüber der Königin einnimmt! -, und bezeichnend ist, dass vor seiner Rückkehr in die Unterwelt Heiling das Zepter von seinen Geistern zurückerhält, also als ein König von Volkes Gnaden - jene „Ehre“, die Friedrich Wilhelm IV. nach der 12 Revolution gut zehn Jahre später nicht annehmen wollte - eine grundlegend andere, man hat zu vermuten schwächere Position einnimmt als vor seiner versuchten Flucht „nach oben“. Die Bewohner der Unterwelt sind gut informiert über Heilings Versagen, so dass man folgern könnte, die Mutter habe - Strategin, die sie ist! - ihre Spione den Weg ihres Sohnes verfolgen lassen; oder noch mehr: sie habe in einem groß angelegten pädagogischen Akt den untreu gewordenen Thronfolger geradezu „auflaufen“ lassen. In diesen Zusammenhang gehört auch der Mummenschanz gegenüber Anna , mit dem die „böse Schwiegermutter“ ihren Sohn als Geisterfürsten - der er ja strenggenommen nicht mehr ist, jedenfalls nicht mehr sein will denunziert. Sie nimmt sein Scheitern nicht nur in Kauf, sondern führt es mit herbei, um ihn schließlich als Gescheiterten auf ewig zu sich zurückzuholen. Dies hat sich schon im Vorspiel angedeutet, wenn sie Heiling vor der „unzureichenden“ Oberwelt warnt und er ihr fahrlässigerweise anvertraut, dass er zurückkehren werde, wenn er dort scheitern würde. Sogar der Racheakt Heilings wird von ihr verhindert, womit sie ihn sowohl vor der Hochzeitsgesellschaft, also den „Menschen“, als auch den Geistern (die eigentlich seine Untertanen sind) endgültig diskreditiert. Damit kehrt Heiling jedoch in gewissem Maße auch „zu sich selbst“ zurück, denn im Verhältnis von Königin und Heiling verknüpfen sich mythologische Elemente (der Sohn als Geliebter) mit der bürgerlichen Sphäre. Bürgerliche Familienbande sind dynastischer, nicht emotionaler Art. Die eheliche Verbindung hat nichts mit Liebe zu tun; umso mehr wird die Bindung zum Kind verstärkt und emotionalisiert. Verbunden ist damit eine Verengung, Verkürzung von Emotionen. Das bürgerliche Milieu ist zwar das „modernere“, aber auch ein reaktionäres; das Prinzip Familie funktioniert als Züchtigung, nicht als Chance zur Erweiterung. Eine außerfamiliäre Bindung dagegen funktioniert nicht einmal im Ansatz, weil Heiling viel zu stark auf jenes Prinzip Familie programmiert ist. Der zentrale Auftritt der Königin gegenüber Anna, der genau im richtigen Moment erfolgt, denn Heiling ist nach der ersten Niederlage beim Fest noch zur „Versöhnung“ bereit - hat aber noch eine weitere Funktion. Offensichtlich will sie prüfen, ob die Schwiegertochter in spe und Konkurrentin ihrem Sohn denn überhaupt ebenbürtig ist. Salopp gesagt: sie klopft Anna auf ein mögliches „Senta-Format“ ab, will heißen: auf den Erlösungs-Impetus, der Bestandteil der Zuneigung zu einem so komplexen Wesen wie Heiling sein müsste. Doch weit gefehlt. Anna ist ein einfaches Landkind, dem ein solches Erlösungsstreben und die damit verbundene Gedankenwelt höchst fremd, völlig unbekannt ist. Kaum hat sie ihre ersten Dialog-Worte im Stück gesprochen, fragt sie bereits ihre Mutter, ob denn die Verbindung zu Heiling wohl das Richtige ist, denn zarte Fäden zwischen ihr und dem Jäger Konrad dürften sich bereits andeuten. Auf Annas Lebensfreude scheint es Heiling in unklarer Form abgesehen zu haben; er hat sich das unbekümmertste Mädchen des Dorfes ausgesucht, ohne damit umgehen oder gar davon profitieren zu können. Mit ihren wahrhaft unbekümmerten Versuchen, ihren Verlobten aufzumuntern, ist Anna an der völlig falschen Adresse. Es bleibt auch recht unklar, warum die Untreue Annas für Heiling eine solche Katastrophe bedeutet, warum er nicht - reich und angesehen, wie er ist - sich ohne weiteres eine andere Lebensgefährtin suchen kann. Hier scheint die romantische Vorstellung der einmaligen und ewig währenden Liebe im Spiel zu sein; jede aufklärerische Skepsis ist längst vergessen. Bei Heiling ist selbst jene Vorstellung sogar noch übersteigert: vielleicht spielt auch der Erlösungsdrang des vorausgeahnten „fliegenden Holländers“ eine Rolle, der allerdings eben nicht auf seine Senta trifft. Heiling ist gleichsam „vorsichtshalber“ auf Anna fixiert, und redet fast nur mit Anna, die er liebt und von der er sich geliebt wähnt, was ihm zunächst Sicherheit gibt. Heiling will in die Menschenwelt, und will doch nur - dem gelebten Modell in der Unterwelt folgend - eine Insel in dieser Welt, also elitärer Außenseiter bleiben. Anna will aber auch in ihrer Beziehung zu Heiling Mensch unter Menschen bleiben. Dass sie mit Geistern in Berührung gerät - ob es stimmt oder nicht, ist sekundär; es reicht gleichsam das 13 „Wort als Requisit“ aus -, kann sie sich wohl im Wortsinne nicht vorstellen; der Appell an ihre Angst (nicht an ihr Verständnis, wie es aus den Worten der Königin manchmal heraustönt) reicht aus, um sich von Heiling zu distanzieren. Wie bei Heiling und der Königin, ist auch das Verhältnis von Anna zu ihrer Mutter ein kritisches Thema. Dass die - ebenfalls verwitwete - Mutter Gertrude ihrer Tochter einen Gatten aussucht, mag normal sein. Allerdings sind die Beweggründe immer wieder offensichtlich: von Schmuck lässt sich Gertrude leicht blenden, und womöglich übt der undurchsichtige Heiling auch auf sie durchaus Faszination aus. Dabei sind allerdings Gertrudes emanzipatorische Anwandlungen (wie das skandalträchtige Forcieren des Tanzes von Anna und Konrad) vor allem auf Naivität begründet und nicht etwa „modern“. Die überstürzte Hochzeit des noch verletzten Konrad mit Anna resultiert aus dem Glauben, dass der christlich sanktionierte Bund den „Geist“ bannt (und in der Tat: Paracelsus' Aussage, dass auch Geister von Gott geschaffene Kreaturen seien, bewahrheitet sich in der besänftigenden Wirkung, die der Choral kurzzeitig auf den rachsüchtigen Heiling ausübt). Ihr Liebesduett ist jedoch als solches auch recht praktisch bestimmt: im Grunde gleicht es dem sprichwörtlichen „Pfeifen im Keller“; Anna und Konrad versichern sich umständlich, dass die Gefahr vorbei und sie nun in Sicherheit seien. Konrad und Anna verabschieden Heiling mit „fahr' wohl“ - ergänzt durch „unter uns sei Frieden“. Ein unangenehmer Abschied, der offenbar zum Ziele hat, alle Irritationen unter den Tisch zu kehren und die Berührung mit der anderen Welt (seien es Geister oder „Zukünftige“, „Moderne“) möglichst folgenlos zu vergessen. „Allen Recht und allen Frieden“ lauten die letzten Worte – dies erinnert an „Ruhe ist die erste Bürgerpflicht“, womit 1806 ein preußischer Minister alle Reaktionen auf Niederlagen gegen Napoleon eindämmen bzw. gar nicht erst aufkommen lassen wollte. Und es erinnert an das typische „Laisser faire“, das nicht etwa liberal, sondern nur gleichgültig ist. Der Schluss der Oper als reaktionäre Glättung der Widersprüche? Wohl kaum, denn die Königin, die diesen Schluss diktiert, steht zumindest nicht nur für ein reaktionäres Prinzip. Das Wissen jedenfalls, wie schwankend (im Wortsinne) der Boden ist, auf dem die Idylle sich gründet, wie diese Idylle ausgehöhlt wird, wird sich nicht mehr ohne weiteres verdrängen lassen. Zwei Welten: Märchenhaft oder ideologisch? Historisch oder geographisch? Auch dies nicht. Vielmehr: zwei Seiten einer Welt und gleichzeitig zwei Seiten eines Menschen. 14 Heimweh, Heimat, Meer. Notizen zu Benjamin Brittens Oper „Peter Grimes“ - Für ein Programmheft des Theaters Vorpommern, Spielzeit 1994/95 Heimweh, so unvermutet es scheinen mag, war der Grund für die Entstehung der DebütantenOper „Peter Grimes“. Der knapp 30-jährige Benjamin Britten und der in etwa gleichaltrige Tenor Peter Pears, schon seit einigen Jahren Lebensgefährten, wurden von der Lektüre des GrabbeGedichtes „The Borough“ zu einer Zeit angeregt, zu der sie für nostalgisch-(heim)wehmütige Gefühle durchaus anfällig waren: 1942 im amerikanischen Exil, wohin sie als erklärte Pazifisten aus dem Krieg führenden Großbritannien „geflohen“ waren. Die Lektüre jenes Gedichtes ließ den Entschluss reifen, in die englische Heimat zurückzukehren. Darüber hinaus wurde eine Oper in Angriff genommen, die eine Episode aus Grabbes Dichtung zur Grundlage haben sollte: eben „Peter Grimes“.Heimat hätten die Geräusche des Meeres für ihn von Kind an bedeutet, notierte Britten einmal. Und in jene Landschaft, in der er das Licht der Welt erblickt hatte, zog es ihn auch zurück: Nach Aldeburgh, Suffolk, wo er sein Festival gründete und mit Peter Pears recht bürgerlich-unauffällig lebte. Der vermeintliche autobiografische Aspekt von „Peter Grimes“ ist häufig und gern in den Vordergrund gerückt worden; in Kurzform: Grimes ist ein Homosexueller, gar Pädophiler, der in seinem Lehrjungen ein - noch dazu grausam misshandeltes - Objekt höchst anfechtbarer Zuneigung sieht. Es scheint jedoch alles andere als ein Zufall zu sein, dass Britten erst in seiner letzten Oper, „Tod in Venedig“, das Thema der Homosexualität - nunmehr auf den Edelautor Thomas Mann zurückgreifend - offen thematisiert. In „Peter Grimes“ ist zumindest keine Rede davon, und Britten war in jungen Jahren durchaus kein kämpferischer Typ, der etwa in seinen Opern die Emanzipation von Minderheiten hätte propagieren wollen. Im Gegenteil: Der geschärfte Blick für einen Außenseiter, für den Konflikt zwischen „andersartigem“ Mit-Bürger und Gemeinschaft, mag zwar bei Britten durch eigene Erfahrung geschärft gewesen sein, verführte ihn jedoch nicht zur Vordergründigkeit. Vielmehr wird das Außenseiter-Thema subtil verallgemeinert, einiges auch bewusst im Unklaren gelassen. Peter Grimes mag der typische Außenseiter sein: eigenbrötlerisch, gescheit, ehrgeizig, vor allem unverstanden. Jedoch scheinen, auch dies sehr subtil und präzise beobachtet, dieser Außenseiter und die Gemeinschaft lebensnotwendig einander zu brauchen. Grimes richtet seine eigenen Pläne sehr wohl an den gutbürgerlichen Vorstellungen seines Dorfes aus; umgekehrt nutzt die Einwohnerschaft das bewährte Mittel der Pogromstimmung, um in der Hatz auf Grimes die eigenen Verwerfungen und Spannungen einzuebnen. Bezeichnenderweise ist selbst das Bordell in Gestalt von „Auntie“ und den beiden Nichten nahtlos in das Dorfleben integriert, in das der Außenseiter Grimes indessen nicht passen soll, nicht passen darf. Die Dorfgemeinschaft erklärt sich in zwei Grundsituationen: Kirche und Kneipe. Beide sind Hauptschauplätze des Dorflebens, und von beiden nimmt jeweils die Hetze auf Grimes ihren Ausgang. Dabei spielt die „Kirche“ zwar nur einmal als reales (Hintergrund-)Bild eine Rolle; unterschwellig allerdings erlangt sie wesentlich größere Bedeutung. Nicht nur wird das geplante Pogrom gegen Grimes von den Autoren als Prozession bezeichnet - auch die übersteigerte Religiosität in Gestalt des Methodisten Bob Boles trägt nicht gerade unwesentlich zur Stimmung gegen den Außenseiter bei. „Es war nur Täuschung unser Traum“, resümiert Ellen Orford nach dem Streit mit Peter, bei dem es nur vordergründig um den freien Tag für den Lehrjungen ging. Kurz darauf wird Grimes seine einzige Freundin schlagen und das Band zwisehen ihnen zerreißen (nicht ohne Gott nachher um Gnade anzuflehen). Auch hier bleibt unklar, um welchen Traum es sich genau 15 handelt; zumindest Ellen hat in dieser Richtung wenig verlauten lassen. Von einer kindlichen Unschuld waren dagegen Peters Pläne (wie auch seine Wechselhaftigkeit kindliche Züge trägt): Es stellt sich sogar die Frage, ob er Ellen weniger als aufrichtig Geliebte denn als Statussymbol begehrt - als endgültiges Zeichen einer Ehrbarkeit, die einen geradezu masochistischen Zug zur Anpassung an das Spießertum der Umgebung enthält. Ellen und Grimes - auch hier ein seltsam verwobenes Netz von Abhängigkeiten und gegenseitigen Ansprüchen. Ist Ellen für Peter mindestens als Statussymbol begehrenswert, so legt sie in ihre Beziehung zu ihm neben aufrichtigem Gefühl ein gerüttelt Maß an Erziehungsehrgeiz. Grimes' Situation appelliert an ihren pädagogischen Instinkt ebenso wie an ihre Solidarität zum Außenseiter - denn auch sie gehört als Lehrerin nicht ohne Weiteres der verschworenen Gemeinschaft des „Borough“ an (was wiederum durch ihre Neigung zu Grimes noch verstärkt wird). Der pädagogische Impetus und die ehrliche Zuneigung ergeben eine explosive Mischung, die sich vor der Kirche, während die Gemeinde im Hintergrund Choräle singt, entlädt: Bei einem Menschen wie Peter Grimes geht der Versuch, ihn zu ändern, nicht nur ins Leere; er provoziert die übersteigerte, gewalttätige Reaktion eines Egozentrikers. Die Stimmungsschwankungen des Außenseiters verstärken noch den erwähnten kindlich-naiven Zug, der sich gelegentlich ins Philosophische weitet. Doch in diesen „Gezeiten“ des Geistes offenbart sich auch der „Naturmensch“ Grimes, der wie kein anderer der Dorfbewohner mit dem Meer verbunden scheint: Wie das Meer nie gleich ist und doch niemals veränderlich, so entgleitet Peter Grimes' Charakter, unberechenbar und emotionsbetont, eindeutiger Kategorisierung. Und es ist bezeichnend für seine Verbundenheit mit dem Meer, dass er - ganz im Gegensatz zu seiner sonstigen Aufsässigkeit - dem eigentlich ungeheuerlichen Rat seines „väterlichen“ Freundes Balstrode, sich im Meer mit seinem Boot zu versenken, so widerspruchslos - ohne ein einziges Wort! - folgt: weil dieser Weg gleichsam „natürlich“ ist. Es ist keine neue Erkenntnis, dass der Zustand des Meeres seelische Zustände zu spiegeln im Stande ist, und doch ist dieser Zusammenhang in der dramaturgischen Ordnung wie in der Musik von Brittens Oper zu einem musiktheatralischen Höhepunkt verdichtet. Das Chaos des Meeres, dem dennoch eine unveränderliche Ordnung eignet, setzt sich über die teils lautmalerischen Orchesterzwischenspiele in den großen Chorszenen der Oper fort, in denen nicht nur häufig vom jeweiligen Zustand des „Meeres“ gesungen wird, sondern auch die Meute der Dorfbewohner sich zur meeresähnlichen, kaum noch kontrollierbaren Aktion formt. Im Mittelpunkt der Oper jedoch steht eine Szene, die auf den ersten (lesenden) Blick geradezu unauffällig ist: das Ensemble von Ellen, Auntie und den zwei Nichten nach dem Abmarsch der „Prozession“ gegen Grimes. Allein geblieben - ausgeschlossen von der pogromartigen Aktion und damit auch moralisch von dieser distanziert - resümieren sie ihren Standpunkt gegenüber der männlichen Welt : „Treibt der Sturm sie uns ans Herz, machen wir von Furcht sie frei“, sagt Auntie, der man leichthin nur „finanzielle“ Motive gegenüber der Männerwelt unterstellen könnte; und Ellen ergänzt lapidar: „Sie sind Kinder, weinen sie. Wir sind Mütter, kämpfen sie, und unsere eigenen Herzen wahren so den bitteren Schatz ihrer Liebe.“ Wiederum wenig eindeutig, ziehen die vier Frauen ihr Fazit aus den Ereignissen: „Lacht oder weint man dabei? Nein, wir warten, bis es vorbei.“ Auch eine Art Heim-Weh? 16 Zeit zu erinnern Symbolik und Wirklichkeit in Einojuhani Rautavaaras Oper „Das Sonnenhaus“ - Text zum Programmheft Theater Vorpommern 1994 (Deutsche Erstaufführung) „Alte“ und „neue“ Zeit; die Zeit an sich - schon am Personenverzeichnis der Oper „Das Sonnenhaus“ ist dies als Hauptthema zu erkennen. Aus der Zeitangabe des Librettos „1987 und 1917“ ergibt sich ganz folgerichtig, dass alle Personen (mit Ausnahme einer, was aber für das Stück nicht wesentlich ist) zweifach auftreten. Wirklich verdoppelt sind allerdings nur die Hauptfiguren Noora/Eleanor und Riina/Irene. Sie werden von jeweils zwei Darstellerinnen verkörpert, was die direkte Erinnerung an die eigene Vergangenheit ermöglicht. Die Erinnerung an die anderen Figuren -Familienmitglieder, Freunde, Lakaien - geschieht indessen nur indirekt, vermittelt durch das Erscheinen anderer Personen. Und dies wiederum abgestuft: Ist die Ähnlichkeit zwischen dem Vater John und dem Postboten Hermesson unverkennbar und wird von Noora mehrfach erwähnt, bleibt das Wiedererscheinen der Mutter als Haushälterin Turvonen oder des Bruders Victor als junger Dorfbewohner Vikke für die beiden alten Schwestern ohne Bedeutung, entfaltet „erinnernde“ Funktion also nur für den Zuschauer. Eine besondere Rolle spielt der Lakai Gregor, der die Ereignisse der Vergangenheit nüchtern berichtet, gleichsam ein Bote sowohl aus der Vergangenheit als auch aus der Zukunft. „Nicht die Zeit verging, sondern sie selbst, sie vergingen gegen deren ungerührt gleichmäßig hingehende Fläche“ Bis ins Textdetail, bis in die musikalische Struktur hinein ist „Das Sonnenhaus“ eine Oper nicht nur über die Zeit (und die Zeiten), sondern auch über das Erinnern - und über dessen Zwiespältigkeit. Die beiden Hauptfiguren, im wahrsten Wortsinne deplatzierte alte Frauen, werden vor verschiedene Hintergründe gestellt, die die „neue Zeit“ abbilden. Und zwar in mehrfacher Variation. Komik fließt ein mit dem Postboten Hermesson und Frau Turvonen, wobei Hermesson als ein Mann, dessen Belesenheit ihm das einfache Leben eher schwer macht - den beiden alten Frauen seelenverwandt ist. Frau Turvonens Einfalt als weiterer „Hintergrund“ wird dadurch verstärkt, dass ausgerechnet sie bei der Generalprobe zu Riccionis Empfang den Gast spielen muß und dabei kläglich versagt. „Moderne“, aber auch provinzielle Schlauheit verkörpern Rekku und Vikke ebenso wie der Rechtsanwalt Rissonen, dessen plakative Äußerungen über die neue Zeit als Kontrast zur Lebensweise von Noora und Riina schockierend wirken. Im Gegensatz zur wohlmeinenden Frau Turvonen wirken aber die beiden Jungs und der Rechtsanwalt wirklich zerstörerisch: Rissonen rein geschäftlich, indem er den Verkauf und die Umwidmung von Solgarden in ein Museum immerhin noch mit dem Angebot einer Stadtwohnung sozial verbrämt; Rekku und Vikke sogar direkter durch ihren Streich, den Strom abzuschalten - was (in Anlehnung an die „echten“ Schwestern Thiess) den Tod der beiden Frauen physisch mit herbeiführt. Wenn der Hintergrund verschwindet und Noora und Riina ganz bei sich sind, spielt die Zeit als reale Gegenwart keine Rolle. Die musikalisch weit ausgesponnenen Reflexionen über die Zeit, die Welt und den Menschen sind Inseln innerhalb der Oper, die in krassem Gegensatz zum rezitativisch behandelten Handlungsfortlauf stehen. Dabei werden die textlichen Motive, erstaunlich genug, schon von den jungen Eleanor und Irene angespielt, wiederum als „Folie“ zu Gregors Erzählung der Familiengeschichte: „Unsere Welt, ganz langsam wird sie leer.“ Dass der Fortgang der eigenen Geschichte derart passiv betrachtet wird; dass offenbar eine andere Entwicklung nicht einmal denkbar ist (sondern bestenfalls die Rettung durch die in der Erinnerung zu Helden verklärten Holstein und Riccioni erwartet wird), fügt den Figuren und dem Stück eine weitere tragische Perspektive hinzu. Musikalisch wird dies deutlich durch den beinahe minimalistischen Stillstand, der beim ersten - erinnerten - Auftritt der Familie eintritt. Ganz folgerichtig endet die Oper - und mit ihr die Familie - in einer Polonaise, deren langsame Rhythmen einen gespenstischen Totentanz abgeben, zu dem der Lakai Gregor die anderen Figuren pflichtgemäß 17 abmeldet. So wie lebende Personen zur Vergangenheit wurden, werden hier gestorbene Personen zur Gegenwart. Erinnerung und Hoffnung; zu Symbolen geronnen Das Leer-Werden der Welt - ihrer Welt, wie Gregor distanzierend betont -, das Entkleiden, Schwerelos-Werden, das Ausleeren des Kelchs: diese Sprach-Bilder formen einen symbolhaften Zusammenhang, in dessen Mittelpunkt das Erinnern - als Heraufbeschwören von Vergangenheit und Erwartung - steht. Schon das Ausleeren des Kelchs hat eine Doppelbedeutung als (zu ertragendes) Schicksal einerseits, als Heilsversprechen andererseits. Leer, entkleidet, schwerelos: Sehnsucht nach der tragisch verlorenen Harmonie. Eine Harmonie allerdings, die - wir erinnern uns - schon früh brüchig wurde. Aber eben auch: Erwartung des Endes. Das Haus Solgarden (ein „Haus der Sonne“, damit mit einem optimistischen Symbol befrachtet) ist, nach Victorias Urteil, „weiß wie eine große Taube“. Die weiße Taube - Reinheits- und Friedenssymbol -kehrt in Nooras und Riinas Erinnerungen wieder, zuletzt als Bote mit dem „Ölbaumzweig, des Lebens Botschaft“, den vermeintlichen Alessandro Riccioni ankündigend. Hier also wird die Rückkehr des „eigentlichen“ Lebens erwartet, ein Zeichen für Versöhnung und Frieden, aber auch wieder: ein Zeichen der Fruchtbarkeit - ein wahrhaftes Lebens-Zeichen für die auf ihrer „Arche“ isolierten Frauen. Dieses Bild wirft ein Schlaglicht auf deren Situation: gewollte Einsamkeit und Sehnsucht nach dem Leben. Das rätselhafte Ei Schließlich das Ei, dessen Diebstahl durch Rekku und Vikke - gepaart mit dem sehr realen Streich, den alten Damen den Strom abzustellen - die finale Katastrophe heraufbeschwört. Bereits in den ersten Sätzen der Oper erlangt dieses Ei große Bedeutung: „Das war des Zaren silbernes Osterei, daß der Zar ja selber Papa gegeben hat!“, weist Riina ihre Schwester zurecht, als diese mit dem wichtigen Requisit nach einer Ratte wirft. Um diees Ei bleibt ein nicht aufgehobener Widerspruch. Die Erinnerung, nach der es sich um eines der berühmt gewordenen „Zareneier“ des Hofjuweliers Fabergé handeln müsste, scheint nämlich zu trügen: In der Rückblende auf die Ankunft der Familie wird das in Solgarden gefundene Ei als Schutzgeist hofiert - demnach kann es eigentlich nicht als Geschenk des Zaren mitgebracht worden sein. Dieser Widerspruch aus realistischer Sicht ist als solcher unbedeutend, aber in anderer Hinsicht sehr aufschlussreich. Zunächst einmal scheint es sich hier um eine sehr typische, erinnernde Verklärung zu handeln. Noch mehr: die Verklärung wird gleichsam vorweggenommen. Das Ei nämlich, sei es nun ein wertvolles Mitbringsel oder ein zufälliger Fund, wird fast unbesehen zum Symbol stilisiert: Als Schutzgeist des Hauses wird ein Gegenstand inthronisiert (und sein Wert steigert sich offenbar mit dem Altern von Noora und Riina noch), dessen Symbolik wiederum auf Fruchtbarkeit und Vollkommenheit verweist, sogar die Auferstehung einschließt: Christus' Ausbrechen aus dem Grab wie aus einem Ei. Die derart umhüllende, wenngleich fragile Hülle deutet aber auch den Wunsch der beiden Schwestern an, sich zu verkriechen vor der Zeit; den kindlich-unschuldigen Zustand der Vergangenheit zu bewahren. Das Geflecht von teils symbolhaften, teils realistischen Sprach-Bildern und korrespondierenden Vorgängen, das die Oper durchzieht, ist ein seltsam schwebendes Gebilde. Die Bewertung der Vorgänge, des Verhaltens insbesondere von Noora und Riina, wird bewusst verweigert. Doch ganz am Ende, zum gespenstischen Abgesang, der Polonaise, setzt das Libretto einen irritierenden Schlußpunkt: „Es ist Zeit zu erinnern“, lauten die mehrfach wiederholten Schlussworte des Ensembles. Erinnern - jetzt erst?