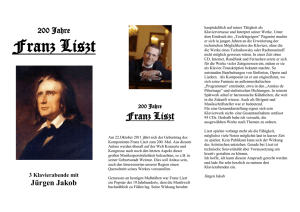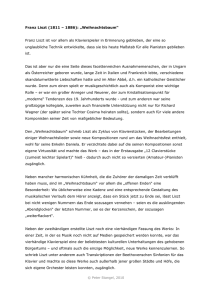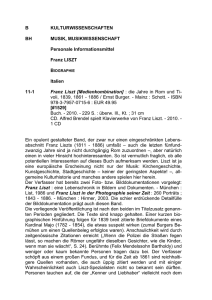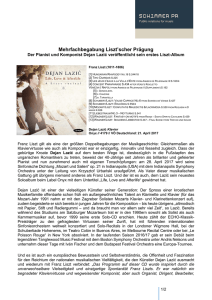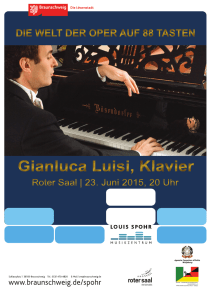SWR2 OPER
Werbung

SWR2 OPER Moderationsmanuskript von Ulla Zierau Franz Liszt: „Christus“, Oratorium Sonntag, 29.11.2015, 20.03 Uhr Bitte beachten Sie: Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR. 1 Heute, am ersten Adventsabend senden wir keine Oper, sondern ein Oratorium: „Christus“ von Franz Liszt. Das drei-teilige Werk für Soli, Chor, Orgel und Orchester ist jedoch kein Oratorium im herkömmlichen Sinne mit einer zusammenhängenden Erzählung, sondern es sind vielmehr meditative Betrachtungen und Durchdringungen einzelner Bilder und Stationen aus dem Leben Jesu und seiner Lehre, von der Geburt bis zum Tod und der Auferstehung. Das Heils- und Passionsgeschehen wird klingend, in weiten Teilen sinfonisch reflektiert. Die Idee zu diesem Oratorium kam sicher von der zunehmenden Verbreitung des Händel‘schen Messias und einiger Folgekompositionen, in deren Mittelpunkt Christus steht. Viele Jahre hat Liszt an diesem Werk gearbeitet, zum Teil in völliger Abgeschiedenheit in zwei kleinen Räumen im Kloster Madonna del Rosario auf dem Monte Mario unweit von Rom. Dort besuchte ihn sogar im Juli 1863 Papst Pius IX und ließ sich Ausschnitte aus dem Oratorium vorspielen. Die Texte hat Liszt selbst aus der Bibel und der katholischen Liturgie zusammengestellt, nachdem er lange nach einem Librettisten gesucht hatte. Mit Georg Herwegh war er im Gespräch, Peter Cornelius sollte einen Text der Fürstin Sayn-Wittgenstein bearbeiten. Doch diese Überlegungen blieben ergebnislos, so setzte sich Liszt selbst an den Schreibtisch. Auch mit der Form des Oratoriums haderte er, mischte verschiedene Stile und Kompositionsweisen, ebenso Instrumental- und Vocalabschnitte. Liszt hatte sich zuvor intensiv mit der Kirchenmusik auseinandergesetzt und nach neuen Wegen gesucht. Zukünftige Kirchenmusik sei zugleich dramatisch und heilig, prachtentfaltend und einfach, schrieb er und das trifft auf den Christus wahrlich zu: Immer wieder greift Liszt die Idee seiner „musique religieuse“ auf, die Verwendungen gregorianischer Motive sowohl in den Vocal- als auch in den gewichtigen Instrumentalteilen. Schließlich bezeichnete Liszt die Auseinandersetzung mit der Kirchenmusik und das Entwickeln seines neuen Kompositionsideals als seinen einzigen Kunst-Zweck, dem er alles andere zu opfern habe. Ursprünglich wollte er das Opus gar nicht der Öffentlichkeit preisgeben. Dann kam es aber doch zur Uraufführung, am 29. Mai 1873 in der Stadtkirche in Weimar. Liszt leitete ein dreihundert-köpfiges Ensemble. Der Komponist und Dirigent hatte zu kämpfen mit Intonationsschwächen des Chores und verpassten Einsätzen. Es folgten noch weitere Aufführungen. Einzelne Teile waren zuvor schon in Rom gespielt worden. Nach Liszts Tod geriet das opulente, fast drei-stündige Werk weitgehend in Vergessenheit, erst in den vergangenen Jahrzehnten wurde es wiederentdeckt, auf CD gebannt und vor allem im Liszt Jahr 2011 mehrfach aufgeführt. Der erste Teil ist überschrieben mit: „Weihnachtsoratorium“. Er besteht aus fünf Sätzen und beginnt mit einem Instrumentalteil, dem die gregorianische Melodie des Rorate-Introitus zugrunde liegt. Das „Rorate coeli“ ist dem Buch Jesaja entnommen. Die deutsche Übersetzung lautet: Tauet, ihr Himmel, von oben, ihr Wolken, lasst Gerechtigkeit regnen! Die Erde tue sich auf und bringe das Heil hervor, sie lasse Gerechtigkeit sprießen. Ich, der Herr, will es vollbringen.“ Danach folgt eine von weichen Holzbläsern bestimmte Pastorale mit der Verkündigung des Engels. Ein Solo-Sopran stimmt die gregorianische Weise „Angelus Domini ad pastores ait“ an, der Chor setzt zur Lobpreisung des Herrn ein. Der dritte Satz, das Stabat mater speciosa ist ein homophoner Chorsatz, der ganz schlicht und verhalten von der Orgel begleitet wird. Das darauffolgende rein instrumentale Hirtenspiel an der Krippe wird hingegen von Oboen und Klarinetten geführt. 2 Im abschließenden Marsch der heiligen drei Könige sorgen Streicher und Harfenklänge für majestätischen Glanz, der Stern von Bethlehem steigt mit einer Hornkantilene auf. Wir senden in SWR2 eine Eigenproduktion, die im Februar 1997 mit dem RadioSinfonieorchester Stuttgart, der Gächinger Kantorei unter der Leitung von Helmuth Rilling entstand. Die CD Version dieser Aufnahme erhielt den "Cannes Classical Award" in der Kategorie "Choral 19/20th Century". Die Solisten im ersten Teil sind: Henriette Bonde-Hansen (Sopran) und Michael Schade (Tenor). „Christus“, 1. Teil = 60‘10“ In SWR2 feiern wir den ersten Advent mit dem Oratorium „Christus“ von Franz Liszt. Das war der erste Teil „Weihnachtsoratorium“ mit der Geburt Jesu und dem Besuch der Heiligen drei Könige an der Krippe in einer Aufnahme mit der Gächinger Kantorei Stuttgart und dem Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR unter der Leitung von Helmuth Rilling. Während seiner Zeit als Dirigent hat sich Franz Liszt mit vielen geistlichen Werken befasst, u.a. mit „L’Enfance du Christ“ von Hector Berlioz. Sicher haben ihn diese Erfahrungen in der Entstehungsphase seines Christus beeinflusst und geleitet. Er hat aber auch auf eigene Werke zurückgegriffen. Die „Seligpreisung“ und das „Gebet des Herrn“ aus dem zweiten Teil hatte er schon vor einigen Jahren geschrieben und der Abschnitt „die Gründung der Kirche“ für Chor und Orchester basiert auf einem ehemaligen Orgelstück. Die Mischung aus alt und neu, die Kontrastierung unterschiedlicher Stile machen den Charakter des Oratoriums aus. Auf der einen Seite stehen klangvoll angelegte Instrumentalsätze, auf der anderen Seite schlichte einstimmige Chorsätze, orientiert an „acappella Gesängen“ der Gregorianik. Daneben gibt es aber auch komplexe Kombinationen von Chor, Soli und Orchester. All das verbindet Liszt mit motivischen und symmetrischen Verknüpfungen innerhalb der dreiteiligen Form, so dass am Ende eine Einheit entsteht. Der zweite Teil „Nach Epiphania“, also nach dem 6. Januar, der Offenbarung der Göttlichkeit des Herrn beginnt mit der „Seligpreisung“. Der Bariton singt, begleitet vom Chor, eine Litanei. Liszt greift darin den Choral vom Anfang wieder auf, „Rorate Coeli“. Darauf folgt ein Pater Noster. In diesem vorn der Orgel begleiteten „Vater unser“ verlässt Liszt die vorherrschende Homophonie und entschwindet gelegentlich in die Mehrstimmigkeit. In der darauffolgenden „Gründung der Kirche“ setzt er dann wieder das ganze Orchester ein, symbolisch für die Gemeinschaft der Gläubigen. Das anschließende Wunder beginnt mit einem Orchestervorspiel, darin braust ein Sturm auf dem See Genezareth auf, Liszt schildert das Toben in drastischer Dramatik. Durch die Kraft des Glaubens wird die Natur wieder beruhigt. Die verängstigten Jünger bitten um Gottes Hilfe. Jesus entgegnet ihnen: „Was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen“, eine der wenigen Stellen, in denen Jesus selbst auftritt. Mit einem triumphalen Marsch erfolgt der Einzug in Jerusalem „Hosanna, benedictus, qui venit in nomine Domini“. Der Chor und der Sopran stimmen in diesen farbenreichen Orchestersatz mit ein. Helmuth Rilling leitet das Radio-Sinfonieorchester Stuttgart und die Gächinger Kantorei. Solist in diesem zweiten Teil aus Franz Liszts Christus-Oratorium ist der Bass Andreas Schmidt sowie Henriette Bonde-Hansen (Sopran), Iris Vermillion (Mezzosopran) und Michael Schade (Tenor). 3 „Christus“, 2.Teil = 47‘28“ Christus-Oratorium von Franz Liszt am ersten Advent in SWR 2. Das war der zweite Teil „Nach Epiphania“ - zuletzt der feierliche Einzug in Jerusalem mit allen vier Solisten Henriette Bonde-Hansen (Sopran), Iris Vermillion (Mezzosopran), Michael Schade (Tenor) und Andreas Schmidt (Bass). Helmuth Rilling leitete das RSO Stuttgart und die Gächinger Kantorei. 1873 wurde Liszts Christus-Oratorium in Weimar zum ersten Mal aufgeführt, das war in der Stadtkirche St. Peter und Paul, der sogenannten Herderkirche in Weimar. Das kolossale Werk hinterließ einen mächtigen Eindruck und sorgte zugleich für Verwirrung. Liszts Tochter Cosima berichtete von der Reaktion Richard Wagners, damals schon ihr Ehemann und damit Liszts Schwiegersohn. „Richard machte alle Phasen der Entzückung bis zur äußersten Empörung durch, um zur tiefsten und liebevollsten Gerechtigkeit zu gelangen.“ Der dritte Teil des Christus heißt: Passion und Auferstehung. Zu Beginn platziert Liszt eindrucksvoll die einzige Solonummer seines Oratoriums „Tristis est anima mea“, „Meine Seele ist betrübt“. In einer emotionalen Arie gesteht Christus schmerzvoll seine Angst und legt sein Schicksal in Gottes Hand. Im sich ausbreitenden Stabat mater dolorosa werden die innigen Gedanken Jesu reflektiert. Liszt schlägt eine Brücke zum Stabat Mater speciosa aus dem ersten Teil. War es zur Geburt Jesu die schöne Mutter, ist es hier, in der Passion die schmerzensreiche. Über eine halbe Stunde nimmt sich Liszt für die Klage Marias Zeit. Die Mezzosopranistin beginnt, der Chor folgt und schließlich verbinden sich das Solistenquartett, der Chor und die dunklen Farben des Orchesters. Kontrastreich schließt sich der Osterhymnus „O filii et filliae“, ein kurzer Frauenchor an. Mit einem fulminanten Resurrexit endet das Werk. Liszt integriert eine Fuge, Kernthema ist das Motiv aus dem gregorianischen Gesang „Rorate Coeli“ Passion und Auferstehung aus dem Christus Oratorium von Franz Liszt mit: Henriette Bonde-Hansen (Sopran) Iris Vermillion (Mezzosopran, Alt) Michael Schade (Tenor) Andreas Schmidt (Bass) Gächinger Kantorei Stuttgart Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR Leitung: Helmuth Rilling „Christus“, 3. Teil = 54‘08 4