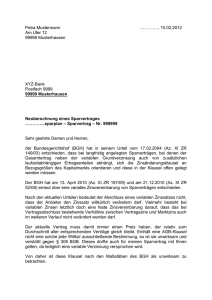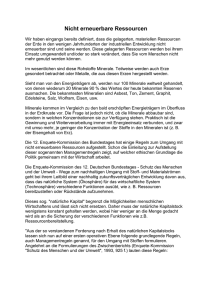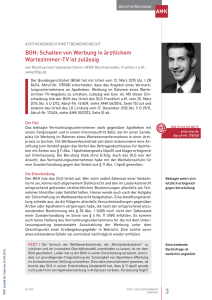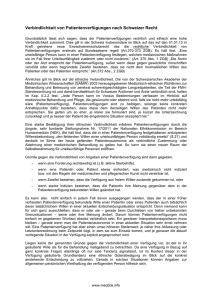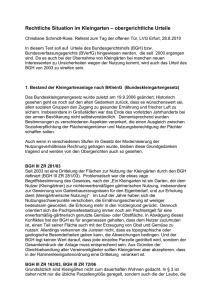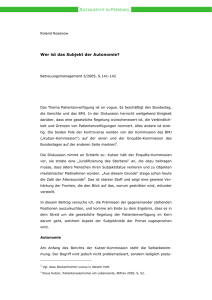dieses Beitrags - Caritasverband der Diözese Rottenburg
Werbung
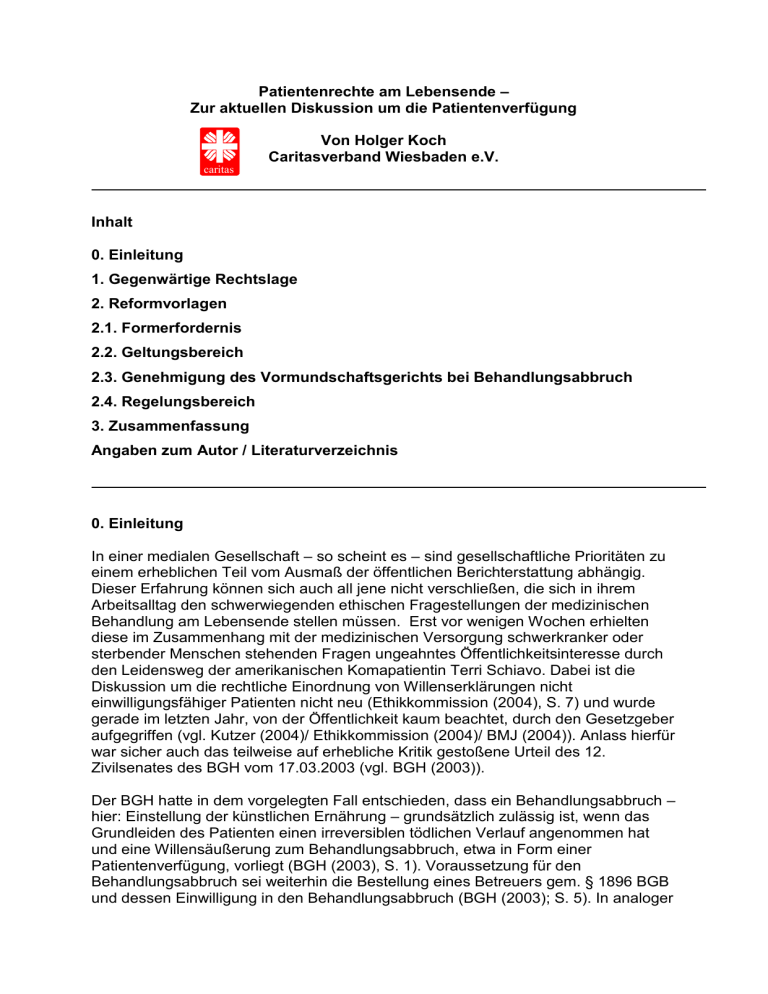
Patientenrechte am Lebensende – Zur aktuellen Diskussion um die Patientenverfügung Von Holger Koch Caritasverband Wiesbaden e.V. caritas Inhalt 0. Einleitung 1. Gegenwärtige Rechtslage 2. Reformvorlagen 2.1. Formerfordernis 2.2. Geltungsbereich 2.3. Genehmigung des Vormundschaftsgerichts bei Behandlungsabbruch 2.4. Regelungsbereich 3. Zusammenfassung Angaben zum Autor / Literaturverzeichnis 0. Einleitung In einer medialen Gesellschaft – so scheint es – sind gesellschaftliche Prioritäten zu einem erheblichen Teil vom Ausmaß der öffentlichen Berichterstattung abhängig. Dieser Erfahrung können sich auch all jene nicht verschließen, die sich in ihrem Arbeitsalltag den schwerwiegenden ethischen Fragestellungen der medizinischen Behandlung am Lebensende stellen müssen. Erst vor wenigen Wochen erhielten diese im Zusammenhang mit der medizinischen Versorgung schwerkranker oder sterbender Menschen stehenden Fragen ungeahntes Öffentlichkeitsinteresse durch den Leidensweg der amerikanischen Komapatientin Terri Schiavo. Dabei ist die Diskussion um die rechtliche Einordnung von Willenserklärungen nicht einwilligungsfähiger Patienten nicht neu (Ethikkommission (2004), S. 7) und wurde gerade im letzten Jahr, von der Öffentlichkeit kaum beachtet, durch den Gesetzgeber aufgegriffen (vgl. Kutzer (2004)/ Ethikkommission (2004)/ BMJ (2004)). Anlass hierfür war sicher auch das teilweise auf erhebliche Kritik gestoßene Urteil des 12. Zivilsenates des BGH vom 17.03.2003 (vgl. BGH (2003)). Der BGH hatte in dem vorgelegten Fall entschieden, dass ein Behandlungsabbruch – hier: Einstellung der künstlichen Ernährung – grundsätzlich zulässig ist, wenn das Grundleiden des Patienten einen irreversiblen tödlichen Verlauf angenommen hat und eine Willensäußerung zum Behandlungsabbruch, etwa in Form einer Patientenverfügung, vorliegt (BGH (2003), S. 1). Voraussetzung für den Behandlungsabbruch sei weiterhin die Bestellung eines Betreuers gem. § 1896 BGB und dessen Einwilligung in den Behandlungsabbruch (BGH (2003); S. 5). In analoger Anwendung des § 1904 BGB sahen die Richter zusätzlich das Erfordernis der vormundschaftsgerichtlichen Genehmigung (BGH (2003), S.1) 1. Gegenwärtige Rechtslage Patientenverfügungen sind Willensbekundungen einwilligungsfähiger Personen zu medizinischen und begleitenden Maßnahmen, die im Falle der Entscheidungsunfähigkeit ihre Wirkung entfalten sollen (vgl. Kutzer (2004), S. 15). Sie sind damit in die Zukunft gerichtete Willenserklärungen zur Sicherstellung des grundgesetzlich geschützten Selbstbestimmungsrechts jedes Menschen (Bauer/ Klie (2003), S. 51/ Ethikkommission (2004), S. 15). Aufgrund des hohen Statusses des individuellen Selbstbestimmungsrechts wird davon ausgegangen, dass für entsprechende Willensbekundungen keine Geschäftsfähigkeit, wohl aber eine grundsätzliche Einsichts- und Urteilsfähigkeit vorhanden sein muss (vgl. Bauer/ Klie (2003), S. 54) Gesetzliche Regelungen zu Form und Inhalt solcher Verfügungen existieren bisher nicht. Trotz teilweise unterschiedlicher Aussagen zur Bindungswirkung ist spätestens durch das BGH-Urteil vom März 2003 eindeutig geklärt, dass Patientenverfügungen grundsätzlich für Betreuer und auch behandelnde Ärzte verbindlich sind, soweit die eingetretene Situation mit der in der Verfügung geäußerten Willensbekundung deckungsgleich ist (vgl. BGH (2003), S. 8). Diese theoretische Klarheit stößt aber an viele praktische Grenzen. Es ist in der Regel nicht möglich, in einer Willenserklärung alle denkbaren Konstellationen für einen Fall der Entscheidungsunfähigkeit zu antizipieren. Wenn die Willenserklärung nicht eindeutig anwendbar ist, so hat der BGH entschieden, ist der mutmaßliche Wille des Betroffenen zu ermitteln, der aus den individuellen Wertvorstellungen und Überzeugungen abzuleiten ist (BGH (2003), S. 1). Doch wie soll dieser mutmaßlichen Willen in der Praxis ermittelt werden? Welche Entscheidungskriterien haben insbesondere im intensivmedizinischen Alltag die behandelnden Ärzte, die sich einem Patienten gegenübersehen, den sie in aller Regel nicht kennen? Angehörige sind in solchen Extremsituation ebenfalls häufig überfordert. Das BGH Urteil sieht hier die Lösung in einem vormundschaftsgerichtlichen Kontrollverfahren, das die adäquate Ermittlung des mutmaßlichen Willen überwachen soll. Allerdings stößt dieser Kontrollauftrag auch bei Vormundschaftsrichtern auf nachvollziehbare Kritik. In einer Umfrage bei deutschen Vormundschaftsrichtern der Universität Köln hielten immerhin 59 % der Richter das Rechtssystem bei Entscheidungen am Lebensende für überfordert (vgl. Machenbach/ Kirchhartz (2005), S. 54). Dieser kurze Abriss macht bereits deutlich, dass ein dringender Klärungsbedarf besteht. Dabei ist aber keine endgültige Klarheit und hundertprozentige Rechtssicherheit zu erwarten. Das Spannungsfeld von ärztlicher Behandlungsverpflichtung einerseits und Recht auf Selbstbestimmung des Patienten andererseits wird auch bei konkretisierenden Regelungen des Gesetzgebers weiter hohe Anforderungen an alle Beteiligten stellen. Dabei kommt insbesondere der Beratung und Unterstützung der Angehörigen von Betroffenen durch behandelnde Ärzte und Pflegekräfte eine herausragende Bedeutung zu. Nichts desto trotz ist der Gesetzgeber gefordert, eine weitgehende Rechtssicherheit für alle Beteiligten zu schaffen, um die immer wieder – häufig zu Unrecht – geschürten Ängste vor einer strafrechtlichen Verfolgung zu mindern. 2. Reformvorhaben In der derzeitigen Diskussion ist eine klare Tendenz erkennbar, die Konkretisierungen zu Anforderungen an Patientenverfügungen im bestehenden Rechtssystem durchzuführen. Dies liefe auf eine Änderung des Betreuungsgesetztes und gegebenenfalls eine Konkretisierung des § 216 StGB heraus. Die Überlegungen zur Schaffung eines eigenen Gesetzeswerkes wurden nicht aufgegriffen. Hier können nicht alle Aspekte der Diskussion wiedergegeben werden. Es sollen allerdings die zentralen Aspekte kurz beleuchtet werden. Im weiteren werden die Vorschläge der von Bundesjustizministerin Zypris eingesetzten Arbeitsgruppe „Patientenautonomie am Lebensende“ (Kutzer (2004)), die größtenteils in den Referentenentwurf zum 3. Betreuungsrechtsänderungsgesetz aufgenommen wurden, und der Zwischenbericht der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages „Ethik und Recht der modernen Medizin“ (Enquete-Kommission (2004)) gegenübergestellt. 2.1 Formerfordernis Bereits heute wird in der alltäglichen Beratungsarbeit dazu geraten, Patientenverfügungen schriftlich abzufassen. Diese sollten nach Möglichkeit mit einem Arzt besprochen und regelmäßig aktualisiert werden. Zusätzlich empfiehlt sich die Unterschrift des Hausarztes zur Sicherstellung der Einsichtsfähigkeit des Patienten zum Zeitpunkt der Abfassung der Patientenverfügung. Die Enquete-Kommission sieht in der Schriftform ein zwingendes Gültigkeitskriterium für Patientenverfügungen und möchte diese daher auch gesetzlich sanktionieren (Enquete-Kommission (2004), S. 40). Mündliche Erklärungen sollen maximal als Indiz bei der Ermittlung des mutmaßlichen Willens herangezogen werden (ebd., S. 45). Gegen eine solche Formerfordernis spricht sich die Arbeitsgruppe Patientenautonomie aus. Angeführt werden überwiegend rechtssystematische Gründe (Kutzer (2005), S. 51). Zurecht wird vor allem darauf verwiesen, dass auch die verbindliche Schriftform nicht von der Notwendigkeit zur Prüfung der Einsichtsfähigkeit zum Zeitpunkt der Abfassung und zur Aktualität der Willenserklärungen befreit (ebd. S. 51) Die Schriftform ist zur Nachweissicherung unbedingt zu empfehlen. Bei einer zwingenden Bindung von Patientenverfügungen an die Schriftform ist jedoch zu befürchten, dass gerade ältere Menschen, die sich vor der schriftlichen Abfassung sträuben oder nur unzureichend über die Möglichkeiten einer Abfassung informiert sind, benachteiligt werden. Die von ihnen gegenüber Angehörigen mündlich abgegebenen Verfügungen könnten nur unter großen Schwierigkeiten rechtliche Bindungswirkung entfalten. 2.2 Geltungsbereich Besonders kontrovers wird diskutiert, für welche Fallkonstellationen Patientenverfügungen überhaupt zulässig sein sollen. Während die EnqueteKommission lediglich für irreversible Grundleiden, die auch bei ärztlicher Behandlung zum Tode führen, Willenserklärungen über einen Behandlungsabbruch zulassen will (Enquete-Kommission (2004), S. 38), sieht die Arbeitsgruppe Patientenautonomie unabhängig vom Stadium einer Erkrankung die Notwendigkeit, Patientenverfügungen anzuerkennen. Damit würden auch für Fälle schwerer Demenz oder des Wachkomas Behandlungsabbrüche nach dem Willen des Patienten ermöglicht. Die Bestrebungen zur Einschränkung der Wirksamkeit sind primär von der nachvollziehbaren Absicht geprägt, Risiken einer Fehlauslegung zu minimieren und dem Lebensschutz in Zweifelsfällen Vorrang einzuräumen (Enquete-Kommission (2004), S. 38). Die Eingrenzung der Wirksameit solcher Willenserklärungn wird demnach auch als Schutzmechanismus verstanden, der die missbräuchliche Anwendung weitgehend verhindern soll. Befürworter einer weiteren Fassung des Geltungsbereiches sehen hierin eine nicht akzeptable Einschränkung der Patientenautonomie. Es dürfe einwilligungsunfähigen Patienten ebenso wenig, wie einwilligungsfähigen Patienten das Recht verweigert werden, auch außerhalb drohender Todesnähe über ihren Körper frei zu verfügen (Kutzer (2005), S. 51). Außerdem werde durch die vorgeschlagene Einschränkung gerade der Geltungsbereich eliminiert, der häufig Anlass für die Abfassung einer Patientenverfügung biete (ebd., S. 51) Gegen eine zu enge Fassung des Geltungsbereiches für Willensbekundungen zum Behandlungsabbruch sprich darüber hinaus, dass hiermit auch Erklärungen zu anderen Fragen der medizinischen Behandlung (Schmerztherapie/ Sterbeort/ Umgang mit Folgeerkrankung) für Einwilligungsunfähige erschwert oder gar gänzlich ausgeschlossen wären. Die Einschränkung des Geltungsbereiches führt außerdem zu Abgrenzungsproblemen z.B. über die Definition der Todesnähe oder der Irreversibilität der Erkrankung. 2.3 Genehmigung des Vormundschaftsgerichts bei Behandlungsabbruch Durch das Urteil des BGH vom März 2003 wurde das Vormundschaftsgericht als Kontrollinstanz bei Entscheidungen über einen Behandlungsabbruch – in analoger Anwendung des § 1904 BGB – eingeführt, wenn ein Betreuer die ärztlich angebotene Weiterbehandlung eines einwilligungsunfähigen Betreuten ablehnt (BGH (2003), S.1). Das Vormundschaftsgericht soll die korrekte Ermittlung des mutmaßlichen Willens überprüfen. In der Reformdiskussion besteht Einigkeit darüber, dass dieser Entscheidungsweg grundsätzlich – trotz der teilweise erheblichen Kritik – beibehalten werden soll (Enquete-Kommission (2004), S. 44/ Kutzer (2004), S. 48). Auch in diesem Punkt wählt die Enquete-Kommission einen deutlich restriktiveren Kurs. Danach sollen alle Entscheidungen über einen Behandlungsabbruch, die durch einen Betreuer oder einen entsprechend explizit Bevollmächtigten getroffen werden, erst nach der vormundschaftsgerichtlichen Prüfung und Genehmigung rechtswirksam werden. Zusätzlich wird eine konsiliare Beratung vor der Entscheidung gefordert. Im Konzil sollen der behandelnde Arzt, eine betreuende Pflegekraft, Angehörige und Betreuer/ Bevollmächtigter beteiligt sein. Begründet wird diese Regelung mit der Reichweite einer Abbruchsentscheidung und der Sicherstellung eines rechtsstaatlichen Verfahrens zur weitgehenden Fehlervermeidung (Enquete-Kommission (2004), S. 44). Darüber hinaus trage dieses Verfahren zur Entlastung des Betreuers/ Bevollmächtigten bei, der von der abschließenden Entscheidungsverantwortung und den möglichen Folgen ein stückweit befreit werde (ebd. S. 45) Der Vorschlag der Arbeitsgruppe Patientenautonomie unterscheidet zwischen verschiedenen Fallkonstellationen. Eine vormundschaftsgerichtliche Genehmigung soll danach nur dann erforderlich sein, wenn ein Dissens zwischen behandelndem Arzt und Betreuer über die korrekte Auslegung des Patientenwillens besteht. Bei Einigkeit zwischen Arzt und Betreuer und bei Entscheidungen eines ausreichend explizit Bevollmächtigten soll eine entsprechende Genehmigung überflüssig sein. Da sich im Übrigen weiterhin in allen kritischen Fällen die Möglichkeit der Anrufung des Vormundschaftsgerichts etwa zur Bestellung eines Kontrollbetreuers anbiete, wird ein weiterer Regelungsbedarf nicht gesehen (Kutzer (2004), S. 47 ff.) Zur Begründung wird angeführt, dass es rechtlich keinen Spielraum gebe, eindeutige Willensentscheidungen des Patienten zu „überstimmen“, sodass bei Einvernehmen von Arzt und Betreuer über den mutmaßlichen Willen des Entscheidungsunfähigen eine vormundschaftsgerichtliche Genehmigung ausscheide (Kutzer (2004), S. 48). Auch sollte die besondere Stellung der Bevollmächtigung dadurch herausgestellt werden, dass diese Personen, die explizit vom Patienten vorgesehen wurden, die schriftlichen Willenserklärungen zu interpretieren, von der Genehmigungspflicht befreit werden sollten. Abschließend wird auch die verpflichtende Einbindung eines Konzils als bürokratisches Hemmnis verworfen (Kutzer (2005), S. 52) Diese entsprechend in den Referentenentwurf des 3. BetrÄndG übernommene Reglung stieß auf heftige Kritik. Eine grundsätzliche Genehmigungspflicht bietet zwar nicht den erhofften Schutz vor weiterer Verfolgung, da im Rahmen eines zivilrechtlichen Verfahrens z.B. nicht die u.U. strafrechtlich betroffenen Tatbestände quasi vorab bewertet werden können, sie stellt allerdings ein gewisses Maß an Verfahrensklarheit dar, das für den Prozess der Entscheidungsfindung in einer entsprechenden Situation durchaus hilfreich sein könnte. Die Befürchtung der Verzögerung der Verfahren und einer unnötigen Bürokratisierung ist zwar nachvollziehbar, wird sich aber vermutlich auf die ohnehin auch nach Auffassung der Kutzer-Kommission genehmigungspflichtigen oder durch Kontrollbetreuer zu entscheidenden Fallgruppen (Dissens zwischen Arzt und Betreuer/ Mißbrauchsverdacht) beschränken. Hier wäre nur dann eine Vereinfachung denkbar, wenn jegliche Form der vormundschaftsgerichtlichen Kontrolle abgelehnt würde. 2.4 Regelungsbereich Strittig ist außerdem die Frage, ob in einer Patientenverfügung auch Maßnahmen der Basisversorgung (Verabreichung von Essen/ Trinken) geregelt werden dürfen. Dies lehnt die Ethik-Kommission ab (Enquete-Kommission (2004), S. 38). Die Arbeitsgruppe Patientenautonomie will auch solche Regelungen zulassen (Kutzer (2005), S. 51) Der Abbruch der Basisversorgung stellt sicher einen Extremfall dar. Sowohl Angehörigen, als auch einwilligungsfähigen Patienten wird ein solcher Schritt deutlich schwerer fallen, als die Verweigerung einer konkreten, lebensverlängernden Behandlung – etwa in Form einer künstlichen Beatmung. Es ist außerdem zu berücksichtigen, dass in solchen Fallkonstellationen unmittelbar Aspekte des Strafrechts berührt sind. 3. Zusammenfassung Entscheidungen am Lebensende erfordern vor allem eines: Respekt. Respekt vor den Entscheidungen der einwilligungsunfähigen Patienten, aber auch Respekt vor den ethischen Überzeugungen der Helfer und vor den Empfindungen der Angehörigen der Betroffenen. Ein respektvoller Umgang ist hier nur im Dialog möglich. Da die Betroffenen, die eben im Zentrum stehen, an diesem Dialog nicht oder nur sehr eingeschränkt mitwirken können, sollten ihre vorab abgefassten Willenserklärungen unbedingt Berücksichtigung finden. Eine hundertprozentige Rechtssicherheit ist dabei kaum herstellbar. Medizinische Entscheidungen sind von nur eingeschränkt überbrückbaren Informationsasymetrien zwischen Arzt und Patient und von prognostischen Unsicherheitsfaktoren geprägt. Niemand, weder Arzt, noch Betreuer/ Bevollmächtigter, noch Vormundschaftsrichter können zum Herrscher über Leben und Tod gemacht werden, wie dies in der öffentlichen Diskussion teilweise behauptet wird. Keine der genannten Gruppen würde dies auch ernsthaft anstreben. Es sollte daher ein Weg gewählt werden, der ausreichend Rahmen für Handlungssicherheit und ausreichend Freiheit für die Berücksichtigung des Individuums bietet. Eine große Herausforderung für den Gesetzgeber, aber auch für den gesellschaftlichen Diskurs. Es ist zu begrüßen, dass dieser verstärkt geführt wird. Der Schutz des Lebens und der Schutz der Würde des Lebens (und des Sterbens) sind hohe ethische Güter, die nicht gegeneinander aufgewogen werden können. Autor: Holger Koch, Caritasverband Wiesbaden e.V.. Mail: [email protected] Literatur: Bauer, Axel/ Klie, Thomas (2003): Patientenverfügungen/ Vorsorgevollmachten – richtig beraten? 1. Auflage, Heidelberg. BGH (2003): Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 17.03.2003, AZ.: XII ZB 2/03. Nachzulesen unter: www.bundesgerichtshof.de Enquete-Kommission (2004): Zwischenbericht der Enquete-Kommission Ethik und Recht der modernen Medizin – Patientenverfügungen. BT-Drucksache 15/3700. http://www.bundestag.de/parlament/kommissionen/ethik_med/berichte_stellg/04_09_ 13_zwischenbericht_patientenverfuegungen.pdf Zugriff am : 08.04.2005. Kutzer, Klaus (Vorsitz) (2004): Patientenautonomie am Lebensende. Ethische, rechtliche und medizinische Aspekte zur Bewertung von Patientenverfügungen. Bericht der Arbeitsgruppe „Patientenautonomie am Lebensende“ vom 10.06.2004. www.bmj.bund.de/media/archive/695.pdf Zugriff am: 01.04.2005-04-18 Kutzer, Klaus (2005): Patientenautonomie am Lebensende. In: BTPrax, 14. Jahrgang, Heft 2/ 2005, S. 50-52. Machenbach, René/ Kirchhartz, Jan (2005): Zu Bedeutung und Validitätsvoraussetzungen von Patientenverfügungen. In: BTPrax, 14. Jahrgang, Heft 2/2005, S.54-57