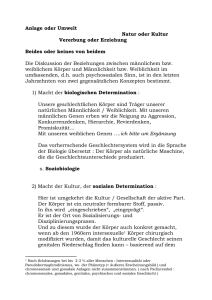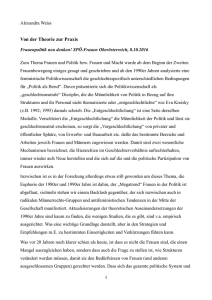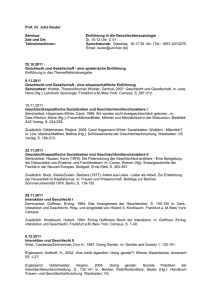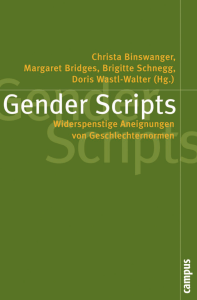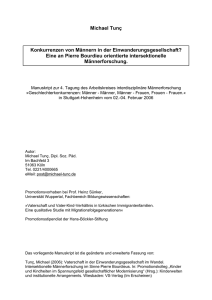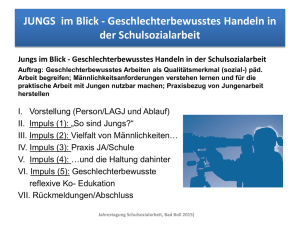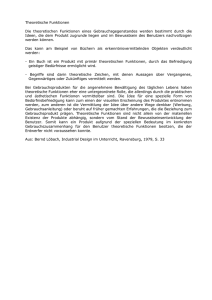Holger Brandes Der männliche Habitus
Werbung

Holger Brandes Der männliche Habitus Band 2 Männerforschung und Männerpolitik Holger Brandes Der männliche Habitus Band 2: Männerforschung und Männerpolitik Leske + Budrich, Opladen 2002 Gedruckt auf säurefreiem und altersbeständigem Papier. Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme Ein Titeldatensatz für die Publikation ist bei Der Deutschen Bibliothek erhältlich ISBN 978-3-8100-3258-4 ISBN 978-3-322-97542-3 (eBook) DOI 10.1007/978-3-322-97542-3 © 2002 Leske + Budrich, Opladen Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfaltigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Satz: Verlag Leske + Budrich, Opladen Inhalt Einleitung ........................................................................................... 7 Männerforschung und Männer-Erforschung ...................................... 13 Diesseits und jenseits des Ödipuskomplexes: Zur Psychoanalyse des Mannes ................................................... .................. ........... ........ 27 Männlicher Habitus und soziale Praxis: Ein theoretisches Rahmenkonzept ................................................................................. 47 Einstellungen und deren Wandel: Repräsentative Befragungen und ihre Interpretation ........ .................... .................................. ......... 89 Männlichkeiten und soziale Milieus: Unterschiedliche Deutungsmuster von "Männlichkeit" ........... ................ ............ .......... 111 Männliche Identität, Generation und Lebensalter (zusammen mit Wolfgang Menz) ..................................................... 135 Eine Frage der Ehre: "Männlichkeit" in unterschiedlichen Kulturen. 161 "Ostmänner" und "Westmänner": Hegemoniale Männlichkeiten in Deutschland ....................................................................................... 175 Männerbünde: Das "archaische männliche Erbe" und die mythopoetische Männerbewegung .................................................... 191 "Risikofaktor Männlichkeit"? Zum Gesundheitsverhalten von Männem ............................................................................................. 215 Männer in einem "Frauenberuf"? Konstruktionen von "Männlichkeit" in der Sozialen Arbeit .......... .............. ....................... 233 5 Vom "Fisch ohne Fahrrad" zum Tandem? Eine Standortbestimmung zu Männerpolitik und Geschlechterdemokratie ....... ....................... ... 251 Literatur ............................................................................................. 269 6 Einleitung Es gibt kaum etwas, was so schwer zu erschüttern ist wie alltagspsychologische Überzeugungen darüber, was Männer sind, was sie antreibt und was sie denken. Offensichtlich existiert ein tief verwurzeltes Bedürfnis, Männer und Frauen als "Gattungswesen" klar voreinander unterscheiden zu können und ihnen "von Natur aus" gegensätzliche Eigenschaften und Merkmale zuzuschreiben. Dieser tief verwurzelten Neigung, Geschlechtsunterschiede auf eine wie auch immer geartete "Natur" zurückzuführen, ist zu verdanken, dass biologische Argumentationen selbst dann, wenn es sich um reine Spekulationen handelt, von Massenmedien begierig aufgegriffen und zu verkaufsträchtigen Schlagzeilen aufgerüstet werden, während die sozialwissenschaftliche Geschlechterforschung der letzten Jahrzehnte eher wie ein Störfaktor in der öffentlichen Meinung und in unserem Weltbild wirkt. Tatsächlich bestehen aber seit den fünfziger Jahren gesicherte Erkenntnisse darüber, dass die biologische Festlegung von Verhaltens- und Erlebensunterschieden zwischen Männern und Frauen systematisch überschätzt wird. Dabei ist nicht in Abrede gestellt, dass die Anatomie der Körper und beispielsweise hormonelle Prozesse das Empfinden und Handeln der Individuen beeinflussen. Vieles spricht aber dagegen, dass es Sinn macht, von einer vorsozialen und quasi "rein" biologischen Körperlichkeit auszugehen. Je vorurteilsfreier und genauer wir Männer und Frauen in unterschiedlichen Kulturen und sozialen Milieus betrachten, desto deutlicher wird, dass wir es bei allen Fragen des Geschlechts mit komplexen sozialen Prozessen und Zusammenhängen zu tun haben, die gesellschaftliche Vorstellungen genauso beeinflussen wie das Denken, Handeln und Fühlen der Individuen. Dabei zeigt sich auch, dass genauso wenig, wie es ein biologisch begründetes Wesen des Mannes (oder der Frau) gibt, eine über Zeit und sozialen Raum unveränderliche Männlich7 keit (oder Weiblichkeit) existiert. Vielmehr bringen jede Kultur, jedes soziale Milieu und jede Generation ihre eigenen und spezifischen Interpretationen von "Männlichkeit" (und "Weiblichkeit") hervor. Es ist also schon lange keine Frage mehr, dass man weder als Frau noch als Mann "zur Welt kommt", sondern hierzu gemacht wird, wie Simone de Beauvoirs 1949 noch provokativ formulierte. Es geht auch nicht mehr darum, soziale Konsequenzen angeblich oder tatsächlich angeborener Geschlechtsunterschiede zu erklären. Die Frage ist vielmehr, um es in den Worten von Irving Goffmann auszudrücken, "wie diese Unterschiede als Garanten für unsere sozialen Arrangements geltend gemacht wurden (und werden) und, mehr noch, wie die institutionellen Mechanismen der Gesellschaft sicherstellen konnten, dass uns diese Erklärungen als stichhaltig erscheinen" (Goffmann 1994, 107). Seit nunmehr fast 15 Jahren verfolge ich in Theorie und Praxis Fragestellungen, die mit dem Geschlechterverhältnis und speziell der Frage männlicher Entwicklung zusammenhängen. Die Arbeitsergebnisse aus dieser Zeit sind für diese zweibändige Publikation unter dem Obertitel "Der männliche Habitus" umfassend überarbeitet, ergänzt und aufeinander bezogen worden. Dabei ist der erste Band (Brandes 2001) noch stark durch meine praktischen Erfahrungen mit Männergruppen geprägt. Der jetzt vorliegende zweite Band ist stärker theoretisch ausgerichtet und basiert auf einer Reihe von Aufsätzen und Vorträgen, die ich in den letzten Jahren verfasst oder gehalten habe und deren roter Faden und innerer Zusammenhang die Frage nach dem "männlichen Habitus" ist. Der Habitusbegriff ist von Pierre Bourdieu, einem französischen Soziologen und Ethnologen, entliehen. Für einen Psychologen mag der Rückgriff auf eine soziologische Theorie ungewöhnlich sein, Männerforschung lässt sich aber nicht in der herkömmlichen Grenzen wissenschaftlicher Fachdisziplinen betreiben, sondern bedarf nach meiner Auffassung eines interdisziplinären Ansatzes. Ausgehend vom Habituskonzept und neueren Diskussionen in der Männerforschung (insbesondere des Ansatzes von Robert Connell) versuche ich eine theoretische Sicht von "Männlichkeit" als Produkt sozialer (geschlechtlicher und vergeschlechtlichter) Praxis zu begründen. Innerhalb der deutschen Männerforschung bestehen hierbei in vielerlei Hinsicht Berührungspunkte mit Michael Meuser, der unabhängig von mir eine ähnliche Intention verfolgt. Aus meiner Sicht eröffnet das Habituskonzept eine theoretische Perspektive, die Sackgassen und Einseitigkeiten in der bisherigen Reflexion über Geschlechtsunterschiede und Geschlech8 terverhältnisse überwindet. Ihr größter Vorzug ist, dass sie erlaubt, Körperlichkeit und Gesellschaftlichkeit sowie Individualität und Kollektivität bezogen auf Geschlechterfragen zu verbinden. Hierdurch wird eine konzeptionellen Basis oder, mit anderen Worten, ein theoretisches Paradigma geschaffen, vor dessen Hintergrund kulturspezifische, milieuspezifische und generationsspezifische Formungen von Männlichkeit, männlichem Verhalten, Denken und Fühlen besser verstanden und in den Kontext der Frage nach den Möglichkeiten der Veränderung männlichen Verhaltens gestellt werden können. Insofern bringt uns das Habituskonzept der Lösung einiger vertrackter theoretischer Probleme näher, die sich im Nachdenken über Geschlechterverhältnisse und Geschlechterbeziehungen stellen und eröffnet nicht zuletzt eine differenziertere Sicht auf Männerpolitik als Teil von Gender-Mainstreaming und Geschlechterdemokratie. Dabei zentriert sich der erste Band auf individuelle Biographien, in denen die Habitusperspektive eher im Hintergrund durchscheint. Im Vordergrund stehen dort noch die einzelnen Individuen und der individuelle Formungsprozess dessen, was wir verallgemeinernd unter "Männlichkeit" fassen sowie das Leiden, was in diesen Lebensläufen durch biographische Ereignisse und die Bindung an konkrete Elternpersonen entsteht. Die theoretische Perspektive hierauf ist zwar schon angedeutet, aber nicht systematisch entwickelt, sondern wird in erster Linie bestimmt durch das empirische Material und die durch die dokumentierte Männergruppe aufgeworfenen Thematiken und Problemstellungen. Der vorliegende zweite Band soll diese theoretische Perspektive systematisieren und durch empirisches Material anderer Herkunft erweitern und fundieren. Dabei haben sich mir in meiner Lehr- und Vortragstätigkeit der letzten Jahre auch neue Fragestellungen aufgedrängt, die ich in dem Bewusstsein angehe, von einer erschöpfenden Antwort noch weit entfernt zu sein. Die ersten Kapitel dieses Bandes bilden eine Einheit: Ich beginne mit einem Überblick über die Entwicklung und den Stand der Männerforschung in Deutschland, der auf einen 2001 gehaltenen Vortrag in der Ringvorlesung der "Koordinierungsstelle Gender Studies" an der Evangelischen Hochschule in Dresden zurückgeht. Es schließt sich ein kritischer Blick auf die Psychoanalyse des Mannes an, der z.T. auf Überlegungen basiert, die ich bereits 1992 in einem Anhang des Buches "Ein schwacher Mann kriegt keine Frau" publiziert habe. Im dritten und umfangreichsten Kapitel dieses Bandes wird dann die für meine Arbeit zentrale theoretische Perspektive auf "Männlichkeit" aus Sicht des Habituskonzeptes entwickelt. Dabei werden Abgrenzungen vorgenommen von 9 und Verbindungen hergestellt zu wichtigen anderen Denkansätzen innerhalb der Geschlechter- und Männerforschung, insbesondere dem Konstruktivismus von Judith Butler und dem hegemonietheoretischen Ansatz von Robert Connell. Auf dieser Grundlage unterscheide ich im Weiteren zwischen unterschiedlichen Dimensionen von Männlichkeit: dem männlichen Habitus, männlicher Identität und Einstellungen zu Geschlechterfragen. Anschließend stelle ich in zwei Kapiteln die zwischenzeitlich vorliegenden wichtigsten quantitativen und qualitativen empirischen Studien zu männlichen Einstellungen, männlichen Deutungsmustern und Verhaltensweisen vor und versuche sie im Lichte der zuvor entfalteten theoretischen Perspektive zu würdigen. Dabei geht es mir besonders um die Entwicklung einer differenzierten Sicht auf Männlichkeiten in unterschiedlichen sozialen Milieus und Lebensräumen. Vorarbeiten hierzu sind erstmals in einem Folgeband zur empirischen Studie von ZulehnerNolz erschienen (Brandes 2000). Im Anschluss hieran greife ich eine bislang eher vernachlässigte Fragestellung auf, nämlich die nach dem Zusammenhang von Männlichkeit und Generationszugehörigkeit. Dieser Abschnitt ist in Zusammenarbeit mit Wolfgang Menz entstanden, der auf meine Anregung hierzu eine empirische Studie durchgeführt hat. Ebenfalls als Ergänzung des allgemeinen theoretischen Rahmens sind die folgenden Kapitel zu Männlichkeiten in unterschiedlichen Kulturen und zu den Unterschieden in der hegemonialen Männlichkeit in Ost- und Westdeutschland zu lesen. Diese kleineren Arbeiten sind erste und vorläufige Annäherungen an hochkomplexe und zum Teil vernachlässigte Aspekte des Zusammenhangs von Gesellschaft und Geschlechtlichkeit. Sie sind bislang unveröffentlicht mit Ausnahme des Abschnitts zur "Frage der Ehre", der als Vorabdruck im "männerforum" der EKD-Männerarbeit erschien (Brandes 2002). Die anschließenden Kapitel greifen in exemplarischer Absicht spezielle einzelne Fragestellungen und Problemkomplexe auf. An ihnen wird am deutlichsten, dass der von mir gewählte Zugang auf Fragen männlicher Lebensgestaltung und Identität noch keine abgeschlossene und ausreichend empirisch fundierte Theorie darstellt, sondern noch einen Zwischenstand markiert. Der erste Beitrag zu Männerbünden, dem "archaischen männlichen Erbe" und der mythopoetischen Männerbewegung ist die überarbeitete Fassung einer auch schon 1992 als Anhang publizierten Arbeit. Der Beitrag zum Zusammenhang von Männlichkeit und Gesundheitsverhalten geht auf einen Vortrag auf den ersten Dresdner Männergesundheitstagen 2001 zurück und wird hier erstmals publiziert. 10 Bislang unveröffentlicht ist auch die anschließende exemplarische Analyse von Männlichkeitskonstruktionen in der Sozialarbeit als einem Berufsfeld, das nach wie vor eher als "Frauenberuf" klassifiziert wird. Einige der hier zusammengestellten Überlegungen gehen auf einen 2000 gehaltenen Vortrag an der FR Neubrandenburg zurück. Den Abschluss bildet ein Vortrag, den ich 2001 auf dem internationalen Kongress der Männerarbeit der EKD zu Fragen der Geschlechterdemokratie gehalten habe. Besonders diese abschließende Arbeit verlängert die ursprünglich ausschließlich theoretische Perspektive in den politischen Raum. 11 Männerforschung und MännerErforschung "Männerforschung" - was für ein merkwürdiger Begriff. Die feministische Kritik hat in den siebziger und achtziger Jahren deutlich gemacht, dass in einer weitgehend geschlechtsblinden und sich geschlechtsneutral gebenden Forschung in den Geistes- und Sozialwissenschaften der Mensch unhinterfragt zumeist mit dem männlichen Menschen gleichgesetzt wurde. Insofern ist über sehr weite Strecken der weibliche Blick, die weibliche Lebenslage und damit überhaupt die Frau aus der forschenden Auseinandersetzung mit der Realität ausgeklammert geblieben. Carol Hagemann-White drückt einen Konsens in Feminismus und Geschlechterforschung aus, wenn sie Anfang der 90er Jahre schreibt: "Da in der bisherigen patriarchalen Geschichte der Diskurs der Frauen unterdrückt wurde, wissen wir über Männer, so wie sie sich uns heute darbieten, recht viel, über Frauen rein gar nichts." (1990, 30) Aus dieser Sicht betrachtet ist Forschung immer oder fast ausschließlich Männerforschung gewesen: Forschung von Männern über Männer und für Männer. Man kann aber auch eine andere Perspektive einnehmen. Soweit in den einschlägigen Disziplinen die Geschlechterdifferenz ausgeklammert wurde, blieb damit nicht nur die Frau als Forschungsgegenstand außen vor, sondern auch der Mann als Geschlechtswesen verschwand hinter dem Bild von einem Neutrum. "Es genügt", schreibt der französische Historiker Jacques Revel, "irgendeine der bedeutenden Habilitationsschriften zur Sozialgeschichte aufzuschlagen, um festzustellen, dass sie ihr Untersuchungsobjekt, das soziale Individuum, im Grunde nicht als geschlechtliches Wesen begreifen - man hat zwar oft das Gefühl, es sei männlich, aber es scheint mir im allgemeinen eher ein Neutrum zu sein." (1989,95) Der forschende männliche Blick schloss also nicht nur die weibliche Perspektive aus, sondern war auch blind gegenüber wesentlichen Seiten männlichen Lebens. Insofern meine ich, dass es zwar nachvollziehbar aber doch falsch ist, wenn wir annehmen, dass Männerforschung im Sinne eines männlichen Diskurses selbstverständlich auch Männer-Erfor13 schung einschließt. Insofern männlich und weiblich nur relational definiert werden können, sich also immer auf ein Verhältnis beziehen, kann die weitgehende Ausblendung des einen Geschlechts nicht ohne Auswirkungen auf die Wahrnehmung des anderen sein. Wenn ich von Männerforschung spreche, meine ich interdisziplinäre Forschung über Männer als Geschlechtswesen, über männliche Lebenswelten, über Männer und Männlichkeiten als "historisch, kulturell und sozial variierende und konstruierte Phänomene" (BauSteineMänner 1996, 5), und nicht zuletzt über die Konsequenzen männlicher Dominanz für beide Geschlechter!. In diesem Sinne ist Männerforschung auch heute noch ein extrem junger und geradezu exotischer Randbereich der Wissenschaft. Obwohl in den letzten 15 Jahren international wie national durchaus bemerkenswerte Publikationen hierzu zu verzeichnen sind, steht in Deutschland ihre Etablierung als anerkannte Forschungsrichtung im Unterschied zur Frauenforschung noch ganz am Anfang: Während es laut Ursula Müller (2000) inzwischen ca. 140 Stellen für Frauenforschung bzw. auf Frauenfragen ausgerichtete Geschlechterforschung an deutschen Hochschulen gibt, ist Männerforschung an den Universitäten kaum verankert und gibt es keine einzige für Männerforschung ausgewiesene Professur in Deutschland. Weder existiert eine Fachzeitschrift für Männerforschung, noch eine andere relevante Form institutioneller Anerkennung. Es bestehen lediglich zwei weitgehend informelle Netzwerkstrukturen, den aus der Männergruppenszene hervorgegangenen "Arbeitskreis Kritische Männerforschung", der heute locker mit der Heinrich-Böll-Stiftung verbunden ist und einen erst kürzlich gegründeten "Arbeitskreis für interdisziplinäre Männerforschung", der stärker akademisch ausgerichtet ist. Insofern ist die Feststellung von Geden und Moes zutreffend: ,,Die Erforschung von Männern und Männlichkeiten wird auf professoraler Ebene von ForscherInnen ohne entsprechende Denomination gestützt, nicht selten aber sind akademischer Mittelbau und Studenten auf sich allein gestellt" (2001, 14). Insofern bleibt das Paradoxon bestehen, dass in einer Wissenschaftswelt, die von Männern dominiert wird, ureigenste Fragen von Männlichkeit erst zuletzt und ausgeprägt zögerlich angegangen werden. Dort, wo Im Unterschied zu GedenlMoes (2000), die Männerforschung als "Forschung von Männem über Männer und Männlichkeit" definieren, halte ich es für wenig sinnvoll, Forschungssubjekt und -objekt zu verkoppeln und Frauen von der Männerforschung auszuschließen. Abgesehen davon sind in einigen Wissenschaftsdisziplinen zentrale Arbeiten von Frauen verfasst worden, beispielsweise in der historischen Forschung von Ute Frevert (l995a,b). 14 sich in den letzten zehn Jahren Geschlechterforschung etabliert hat, ist sie in aller Regel Frauenforschung gewesen, die auch von Frauen betrieben wurde. Dabei ist diese Geschlechterforschung zumeist den männlichen Gralshütern in den einzelnen Disziplinen mühsam abgerungen worden gleichzeitig hat es aber lange Zeit auch so etwas wie eine Delegation der Geschlechterforschung an Frauen gegeben. Diese Asymmetrie im Aufgreifen der Geschlechterfrage hat Gründe, die mit dem Gegenstand der Männerforschung unmittelbar zusammenhängen: Aus der Position derjenigen, die zuerst einmal von einem patriarchalen System profitieren, das wichtige Mittel zur Ausgestaltung der Individualität wie Bildung und Beruf in erster Linie für Männer reserviert, kommt es diesen überhaupt nicht in den Sinn, die Geschlechterfrage zu problematisieren und die Selbstverständlichkeit einer Arbeitsteilung infrage zu stellen, die aus ihrer Perspektive naturgegeben und darüber hinaus durch Leistung und Begabung begründet erscheint. Hinzukommt, dass Männer in der Logik dieser Arbeitsteilung zwischen Beruf und Familie so sozialisiert sind, dass sie sich in erster Linie als Ausführende ihrer Taten, Aufgaben und Pflichten sehen und es ihnen schwer fällt, sich als "Gegenstand, der sie sind" wahrzunehmen. Dem entspricht das im 17. Jahrhundert etablierte Wissenschaftsverständnis, das in erster Linie auf die Beherrschung von Natur und Umwelt abzielt. Einem solchen Wissenschaftsverständnis liegt die Untersuchung von Naturprozessen und selbst der Frau, insofern sie als Verkörperung der Natur verstanden wird (im Gegensatz zum Mann als Verkörperung des Rationalen), näher als das Hinterfragen der eigenen Person und ihrer Position im Geschlechterverhältnis. Pointiert ausgedrückt: Nichts liegt Männern so fern, wie sich und ihre Lebensweise zu hinterfragen und sich selbst zum Untersuchungs gegenstand zu machen. Zumindest gilt dies für Männer, die eine spezifische Form der Männlichkeit repräsentieren, die sich u.a. in Entdeckungswillen und dem Drang nach Beherrschung ihres Untersuchungsobjektes ausdrückt, die mit Dominanzfähigkeit und Ehrgeiz gekoppelt ist und damit für eine führende Position in Wissenschaft und Forschung, so wie sie bei uns organisiert sind, prädestiniert. 15 Ausgangspunkte der deutschen Männerforschung Die Männerforschung in Deutschland hat zwei Ausgangspunkte: Einmal im eigenen Land die Frauenbewegung und die feministische Kritik an Sexismus und männlicher Gewalt im Geschlechterverhältnis. Beeinflusst hierdurch entstanden Männergruppen und Männerbüros, die ihre Arbeit als patriarchatskritisch und antisexistisch verstanden. Hieraus entwickelten sich in den siebziger und achtziger Jahren Ansätze einer eng am Feminismus orientierte und stark politisch motivierten theoretischen Patriarchatskritik. In Büchern wie Volker Elis Pilgrim "Der Untergang des Mannes" (1973), Ernest Bornemann ,,Das Patriarchat" (1975) , Klaus Theweleits "Männerphantasien" (1977/78) und Wilfried Wiecks "Männer lassen lieben" (1987) spiegelte sich in erster Linie das Selbstverständnis der Männergruppenszene wider. Der zweite Ausgangspunkt sind die amerikanischen "men's studies", also die amerikanische Männerforschung, die bereits gut zehn Jahre Vorlauf gegenüber der deutschen Entwicklung hatte. Hier drückte sich viel deutlicher als in Deutschland zur selben Zeit eine in bestimmten Kreisen amerikanischer Mittelschichtmänner verbreitete Verunsicherung in der männlichen Identität und ein Leiden an der herkömmlichen Männerrolle mit ihrer Ausrichtung auf Leistung und Erfolg aus. Im Unterschied zur deutschen Entwicklung waren es in den USA dabei gestandene Akademiker mit Forschungshintergrund, die sich der Männerfrage annahmen. Ihr Ausgangspunkt waren die Verunsicherung vielen Männer angesichts der Frauenbewegung aber auch Verschleißsymptome der Männer in ihrer angestammten Rolle (wie höhere Krankheitsraten und die im Vergleich zu Frauen frühere Sterblichkeit der Männer). Hieraus leiteten sie ihre Kritik am gesellschaftlichen Männlichkeitsbild und auch den vorherrschenden affirmativen Rollentheorien ab. Zu den Pionieren dieser Männerforschung gehören Joseph Pleck, der ab 1973 etwa 50 Veröffentlichungen hierzu vorlegte und beispielsweise Herb Goldberg mit seinem Buch ,,Der verunsicherte Mann" (dt. 1979). Diese Forschungen wurden in Deutschland ab Ende der achtziger Jahre verstärkt antizipiert, wobei Walter Holsteins Buch "Nicht Herrscher, aber kräftig" (1988) bahnbrechend war, in dem er den amerikanischen Diskussionsstand einem deutschsprachigen Publikum zugänglich machte. Walter Holsteins Buch bildet für mich auch nach wie vor den Startpunkt einer sich langsam entwickelnden Männerforschung in Deutschland. Durch seine Popularisierung der amerikanischen men' s studies wurden Fragestellungen, die aus der Frauenbewegung angestoßen und von 16 Männergruppen aufgegriffen wurden, erstmals anschlussfähig an akademische Diskussionen in den Sozialwissenschaften. Die neunziger Jahre sind aus meiner heutigen Sicht das Jahrzehnt der schrittweisen Herausbildung einer Männerforschung in Deutschland. Dabei standen die ersten Jahre noch im Zeichen einer Auseinandersetzung zwischen der sich als patriachatskritisch und antisexistisch begreifenden Strömung aus der Männergruppenszene und denjenigen, die an den Interessen und der Identitätsproblematik der Männer ansetzten und den Anschluss an akademische Diskussionen suchten. In diese Phase fiel auch die Entstehung der mythopoetischen Bewegung in den USA, die als Gegenbewegung gegen die feministische Kritik die Rückkehr zu archaischen Wurzeln der Männlichkeit propagierte ("Der Krieger im Mann", Bly 1991) und als eine postmodern-konservative Bewegung sowohl die amerikanische als auch die deutsche Männergruppenszene in heftige Wirrungen stürzte. Langfristig bedeutsamer ist vermutlich, dass parallel hierzu und mit zunehmender Breite im akademischen Umfeld in verschiedenen Disziplinen (insbesondere Geschichtswissenschaft, Soziologie und Psychologie) eine zunehmend fundiertere theoretische und teilweise auch empirische Arbeit entstand, die an den Diskussionspunkten der feministischen Literatur und Frauenforschung und die internationalen Diskurse anknüpfte, aber auch eigene Akzente setzte. Quantitativ ist diese Forschung inzwischen nur noch schwer zu überschauen. Einschlägige Biographien führen fast 1000 Monographien zu Männerfragen auf, von denen aber nur ein geringer Teil im Sinne von Forschungsbeiträgen zu klassifizieren ist; schwer zu überblicken sind besonders Zeitschriftenbeiträge, da sie sehr verstreut erscheinen. Im internationalen Vergleich fällt als eine Besonderheit der deutschen Männerforschung ins Auge, dass sie auf eine Reihe repräsentativer empirischer Studien aufbauen kann, deren erste noch im Kontext von Frauen- und Geschlechterforschung in den siebziger und achtziger Jahren von Helge Pross und Metz-GöckellMüller erarbeitet wurden, auf die in den neunziger Jahren aber Studien von Hollstein und ZulehnerNolz folgten, die bereits im engeren Sinne zur Männerforschung gezählt werden können. Im ganzen englischsprachigen Raum bestehen keine vergleichbaren Studien, lediglich für Norwegen bestehen vergleichbare Studien, die aber keinen so langen Zeitraum abdecken. Diese Besonderheit hängt vermutlich mit der langen Tradition empirischer Sozialforschung in Deutschland zusammen, auf die Geschlechterforschung zurückgreifen konnte. 17 Damit besteht für den deutschen Raum eine empirische Datenbasis, die in Ergänzung durch qualitative Studien auch für die Entwicklung theoretischer Konzepte genutzt werden kann. Gesicherte Prämissen und theoretische Kontroversen Nach diesem kurzen historischen Überblick will ich versuchen, den gegenwärtigen Stand der Männerforschung in Deutschland wenigstens bezogen auf einige der wichtigsten inhaltlichen Konsense und Kontroversen skizzieren. Dabei beanspruche ich weder Vollständigkeit noch Objektivität, insofern ich selbst in diese Prozesse involviert und mitnichten neutral bin. Auf dem heutigen Stand hat die Männerforschung die vom Feminismus der siebziger Jahre beeinflusste Position einer Fundamentalkritik von Männern und Männlichkeit, so wie sie in Pilgrims programmatischem Satz: "Der Mann ist sexuell und emotional ein Idiot" (1973) zum Ausdruck kommt, überwunden. Männliche Selbstsichten, Lebenslagen und Interessen sind inzwischen als legitimer Ausgangspunkt von Forschungsfragen akzeptiert, ohne dass damit der Anspruch einer gesellschaftskritischen und selbstreflexiven Position aufgegeben wäre. Hierdurch wird der Blick auf Männer und Männlichkeit differenzierter und es kommen männliche Eigeninteressen an einer Veränderung bestehender Geschlechterverhältnisse in den Blick. Konkret heißt das: Die Zugehörigkeit zu einem ökonomisch, politisch und sozial privilegierten Geschlecht und die damit verbundene Teilhabe an der "patriarchalen Dividende", wie Connell es nennt, wird von vielen Männern mit einem hohen Preis bezahlt, der sich ausdrückt in persönlichem Leiden, emotionaler Vereinsamung, im Vergleich zu Frauen niedrigerer Lebensdauer, höherer Anfälligkeit bei vielen lebensbedrohlichen Krankheiten, höheren Suizidraten usw. Indem Männerforschung bei der Frage nach den Entstehungsbedingungen und den Veränderungsmöglichkeiten von Männlichkeit an diesem Widerspruch ansetzt, wird sie für neue und breitere Männerkontexte und auch etablierte wissenschaftliche Diskurse anschlussfähig. Damit verbunden ist ein weitgehender Konsens bezüglich der Relativität des Männlichkeitsbegriffes. Männlichkeit existiert nur in Relation zu Weiblichkeit und ist auch nur in Abgrenzung hierzu und im Bezug hierauf definierbar. Insofern ist Männerforschung auch nur als Teilbereich von Gender-Forschung zu begreifen und bedarf immer des Zusammen18 hangs zur Frauenforschung. Keineswegs ist ein Gegensatz von Männerund Frauenforschung konstruierbar. Andererseits ist Männlichkeit immer nur im Kontext konkreter historischer und sozialer Bedingungen erforschbar. "Über Männlichkeit als ein und dasselbe Wesen quer durch die Unterschiede von Ort und Zeit zu reden, bedeutet einen Abstieg ins Absurde". Diese Aussage eines international profilierten Männerforschers, Robert Connell (1995,30), kennzeichnet einen auch in Deutschland inzwischen erreichten Konsens. Damit ist eine Abgrenzungslinie gezogen zu allen Formen der Suche nach dem sogenannten "Wesen" der Männlichkeit und der Männer, sei es nun biologisch und soziobiologisch begründet oder durch einen unzulässig verallgemeinernden, weil den jeweiligen historischen und sozialen Kontext ignorierenden Rückgriff auf Mythen, Männlichkeitsbilder oder auch Verhaltensweisen. Vereinfacht ausgedrückt: Alle Aussagen in Form von sogenannten typischen Eigenschaften oder auch Wesenszuweisungen im Sinne von Sätzen wie: "Männer sind ... " gehören in den Bereich der reinen Spekulation und der unzulässigen Verallgemeinerung. Männerforschung geht folglich in Übereinstimmung mit modernen feministischen Positionen heute davon aus, dass Männlichkeit nicht gegeben ist, sondern in einem sozialen Prozess im Sinne von "doing-gender", in geschlechtlichem und vergeschlechtlichtem Handeln, hergestellt wird und dass es die eine zu erforschende Männlichkeit nicht gibt, sondern dass wir grundsätzlich vom Plural, von "Männlichkeiten" also, auszugehen haben. Vor dem Hintergrund dieses weitgehend abgesicherten Konsenses hat sich in den letzten Jahren einerseits eine zunehmend breitere empirische Forschung entwickelt, andererseits hat die theoretische Diskussion deutlich an Niveau gewonnen. Bezogen auf die theoretische Diskussion geht es dabei in der Männerforschung wie auch in der Geschlechterforschung insgesamt immer um das grundlegende Problem, wie eigentlich der Zusammenhang von Individuum und Gesellschaft und hierbei insbesondere der von Körperlichkeit und Gesellschaftlichkeit gedanklich erfasst werden kann. Hierbei sind meiner Einschätzung nach vier grundlegende theoretische Orientierungen in der Debatte: Zuerst einmal ist der heute schon fast traditionell zu nennende rollentheoretische Ansatz zu nennen. Ausgehend von der Unterscheidung zwischen biologischem Geschlecht (Sex) und sozialem Geschlecht (Gender) bietet sich natürlich auch für die Männerforschung an, Männlichkeit aus 19 der Perspektive einer gesellschaftlich definierten Geschlechtsrolle zu denken. Dieses Herangehen findet sich trotz verschiedener fundamentaler Kritik am Rollenkonzept auch noch in gegenwärtigen Beiträgen. Dabei wird von der Existenz eines sets wie auch immer definierter und verankerter "sozialer Erwartungen und Zumutungen" (BöhnischlWinter 1993, 102) ausgegangen, die den Individuen zuerst einmal äußerlich sind und an die sie sich im Laufe eines Sozialisationsprozesses anpassen. So plausibel dieser Denkansatz auch sein mag, problematisch bleibt dabei immer, dass zuerst einmal die Individuen und deren subjektive Realität von einer äußerlichen sozialen Realität getrennt gedacht werden und man anschließend vor dem Dilemma steht, diese beiden Seiten wieder vermitteln zu müssen. Dabei entsteht zum einen das Problem, erklären zu müssen, wie es zur gesellschaftlichen Definition solcher Rollen kommt und zum anderen müssen Bedingungen für die mögliche Verweigerung der Übernahme einer solchen Rolle angegeben werden, was neue theoretische Probleme aufwirft. Bei aller Plausibilität, die dem rollentheoretischen Ansatz auf den ersten Blick anhaftet, verführt er doch zum einen zu einer schematische Sichtweise von Geschlecht, zum anderen bleibt unbefriedigend, dass das biologische Geschlecht gänzlich außerhalb der sozialwissenschaftlichen Reflexion verbleibt. Seit einigen Jahren wird als eine zweite theoretische Orientierung auch in der Männerforschung der konstruktivistische Ansatz diskutiert, so wie er von Judith Butler u.a. in den feministischen Diskurs eingebracht wurde. Grundaussage dieses Ansatzes ist, dass "Geschlecht" eine soziale Konstruktion ist, die in Diskursen, d.h. im sprachlichen und schriftlichen Ausdruck hergestellt wird und dass diese Konstruktion so fundamental ist, dass sie auch unsere Wahrnehmung des Körpers und seines Sexus betrifft. Dabei wird die Anatomie des Körper für irrelevant für Konstruktionsprozesse erklärt, entscheidend sind nur die auf ihn bezogenen Begriffe. In der Konsequenz erweist sich die angebliche Natürlichkeit unserer polaren Definition des biologischen Geschlechts (im Sinne von entweder männlich oder weiblich) als eine in sozialen Diskursen hergestellte Fiktion. Damit eröffnen sich Perspektiven des Denkens einer Geschlechtlichkeit jenseits der Polarität von männlich und weiblich und Erklärungen für kulturelle Konstruktionen, die von drei oder mehr Geschlechtern ausgehen, wofür sich auch Beispiele in anderen Kulturen als der unsrigen finden lassen. Zum dritten wird zunehmend der kultursoziologische Ansatz von Pierre Bourdieu in der Männerforschung rezipiert. Im Unterschied zum rol- 20 lentheoretischen Konzept geht Bourdieu (1976, 1982, 1987) von einer grundlegenden Entsprechung subjektiv körperlicher und objektiv sozialer Strukturen aus, einem wechselseitigen Durchdringungsprozess, der dazu führt, dass es keine körperliche Geste oder Haltung gibt, die nicht zugleich sozial bedeutungshaltig ist, so wie es auch keine soziale Klassifikation gibt, die nicht fundamental auf den Körper und seine Struktur rückbezogen ist. Der zentrale Begriff bei Bourdieu ist der des sozialen Habitus, der die Schnittstelle zwischen Körper und Gesellschaft markiert. Im Habitus ist das Soziale im Sinne eines objektiven Sozial- und Symbolraumes in den Körper eingeschrieben, wobei dies in weitgehend unbewusster Weise geschieht und von den Akteuren nur sehr begrenzt willentlich beeinflussbar ist. Im Unterschied zu Butler verortet Bourdieu die Konstruktion von Geschlecht damit bereits vor dem Diskurs, nämlich dort, wo Soziales und Körperliches noch ungetrennt sind - auf der Ebene des spontanen, praktischen Handeins, das aufgrund seiner Körpergebundenheit immer einen hohen Anteil an Unbewusstheit enthält. Männlichkeit und Weiblichkeit, so wie wir sie als Geschlechtsrollen definieren oder in Diskursen an stereotypen begrifflichen Zuordnungen, vorgeblichen Eigenschaften und Bildern festmachen, basieren diesem Ansatz folgend auf einer Festlegung der Körperwahrnehmung und des Körperausdrucks, die bereits weitgehend vorsprachlich durch das Hineinwachsen in eine geschlechtlich, sozial, ethnisch und kulturell strukturierte Praxis gegeben sind. Wo bei Butler die Relativität und Veränderbarkeit der geschlechtlichen Zuordnungen und ihrer begrifflichen Kategorisierung betont werden, einschließlich der Fiktion einer gewissen Freiheit für ein willkürliches Durchbrechen der Diskurse, betont Bourdieu die Abhängigkeit der Selbst- und WeItsicht von der in den Körper eingeschriebenen sozialen Position und damit die Widerständigkeit geschlechts spezifischer Zuordnungen gegenüber willkürlichen Veränderungen. Hier wie dort wird die scheinbare "Natürlichkeit" der geschlechtlichen Zuschreibungen als Fiktion entlarvt, nur ist bei Bourdieu im Konstruktionsprozess der Körper selbst mit im Spiel, beim Konstruktivismus, so wie Butler ihn versteht, ist er außen vor und entgegen des eigenen Anspruchs kein Element der sozialwissenschaftlichen Analyse. Der als viertes Paradigma zu nennende Ansatz entstammt der amerikanischen Männerforschung und wird besonders von Robert Connell vertreten. Er weist erhebliche Berührungspunkte zu Bourdieu auf, als auch hier Männlichkeit als Produkt sozialer Praxis verstanden wird. Dabei hebt auch Connell hervor, dass die durch sozialstrukturelle und institutionelle 21