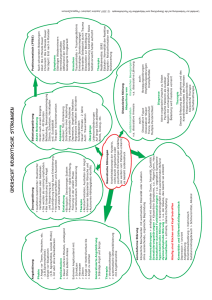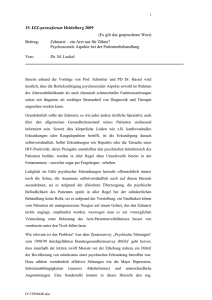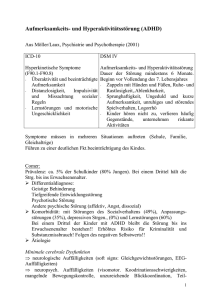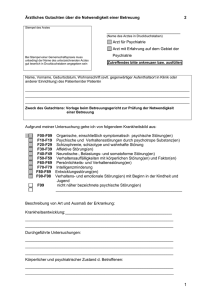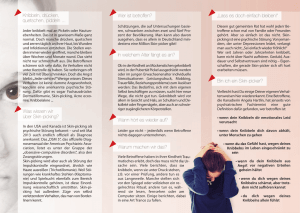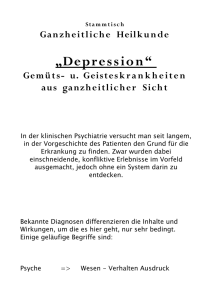Psychische Störungen bei Männern und Frauen
Werbung

Psychische Störungen bei Männern und Frauen Bachelorarbeit Medizinische Universität Graz Studium der Gesundheits- und Pflegewissenschaften Titel der Lehrveranstaltung: Gesundheitspsychologie, geschlechtsspezifisches Gesundheitshandeln Begutachterin: Dr.in Gabriele Kastner Walterstraße 14 3950 Gmünd Eingereicht von Denise Stadler geboren am 04. Oktober 1990 Graz, Juni 2013 Ehrenwörtliche Erklärung Ich erkläre ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst habe, andere als die angegebenen Quellen nicht verwendet habe und die den benutzten Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe. Weiters erkläre ich, dass ich diese Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt habe. Graz am 01. Juni 2013 Denise Stadler 2 Inhaltsverzeichnis Seite 1. Einleitung ............................................................................................................. 6 2. Modelle zur Erklärung psychischer Störungen .................................................. 7 2.1 Biomedizinisches Modell .......................................................................... 7 2.2 Psychoanalytisches Modell ....................................................................... 7 2.2.1 Unbewusster Konflikt ............................................................................ 8 2.2.2 Unbewusste Phantasie ............................................................................ 8 2.2.3 Pathogene Überzeugung ......................................................................... 8 2.2.4 Traumatisierung ..................................................................................... 9 2.2.5 Entwicklungshemmung .......................................................................... 9 2.2.6 Entwicklungsdefizit ............................................................................... 9 2.2.7 Selbstwertstörung ................................................................................... 9 2.2.8 Persönlichkeitsstörung ........................................................................... 10 2.3 Verhaltenstheoretisches Modell................................................................. 11 2.4 Kommunikationstheoretisch-systematische Ansätze .................................. 11 2.5 Diathese-Stress-Modell ............................................................................. 12 2.6 Salutogenetisches Modell .......................................................................... 12 3. Grundlagen zur Beschreibung psychischer Störungen ...................................... 13 3.1 Ätiologie ................................................................................................... 13 3.1.2 Biologische Ursachen............................................................................. 13 3.1.3 Psychosoziale Ursachen ......................................................................... 13 3.2 Klassifikation ............................................................................................ 13 3.2.1 International Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death .... 14 3.2.2 Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen............. 14 3 4. Angststörungen .................................................................................................... 15 4.1 Generalisierte Angststörung ...................................................................... 15 4.2 Panikstörung ............................................................................................. 15 4.3 Soziale Phobien ........................................................................................ 16 5. Zwangsstörungen ................................................................................................. 16 6. Posttraumatische Belastungsstörungen ............................................................... 17 7. Affektive Störungen ............................................................................................. 18 7.1 Unipolar Depression ................................................................................. 18 7.2 Bipolare Störung ....................................................................................... 19 8. Borderline-Persönlichkeitsstörung ...................................................................... 21 9. Schizophrenie ....................................................................................................... 22 10. Essstörungen ....................................................................................................... 24 10.1 Bulimia Nervosa ..................................................................................... 24 10.2 Anorexia Nervosa ................................................................................... 24 10.3 Adipositas ............................................................................................... 25 11. Sexualstörungen ................................................................................................. 25 11.1 Sexuelle Störungen im DSM-IV ............................................................. 25 11.2 Sexuelle Störungen im ICD-10 ............................................................... 26 4 11.3 Geschlechtsidentitätsstörungen ............................................................... 27 12. Somatoforme und dissoziative Störungen ......................................................... 27 12.1 Somatoforme Störungen .......................................................................... 28 12.1.1Somatisierungsstörung .......................................................................... 28 12.1.2 Konversionsstörung.............................................................................. 29 12.1.3 Hypochondrie....................................................................................... 29 12.2 Dissoziative Störungen ............................................................................ 30 12.2.1 Dissoziative Amnesie ........................................................................... 30 12.2.2 Dissoziative Fugue ............................................................................... 30 12.2.3 Dissoziative Identitätsstörung ............................................................... 30 12.2.4 Depersonalisationsstörung .................................................................... 31 13. Schlussfolgerung/Diskussion .............................................................................. 33 14. Literaturverzeichnis ........................................................................................... 34 1 Einleitung 5 Zwischen Frauen und Männern bestehen wesentliche Unterschiede in der Art der Erkrankung und der Art des Inanspruchnahmeverhaltens von gesundheitlichen Leistungen (Kämmerer 2001, S. 51). Gründe dafür sind unter anderem, dass Frauen anderen Risiken ausgesetzt sind als Männer. Frauen reagieren auch auf Signale des Körpers sensibler und rascher als Männer. Es sind auch meist die Frauen, welche in der Familie für die Gesundheit zuständig sind. So sind sie diejenigen, welche sich um Arzttermine oder Impfungen kümmern, einen gesunden Ernährungsplan aufstellen und für die Behandlung leichter gesundheitlicher Beeinträchtigungen zuständig sind. (Fischer 2005, S. 23). Männer hingegen sehen den Körper eher als Instrument, welches dazu dient den Anforderungen des täglichen Lebens gerecht zu werden. Die Funktion des Körpers steht dabei im Vordergrund. Sie klassifizieren auch die Krankheitssymptome nach „männlich“ und „unmännlich“ und regieren nur auf jene Symptome, welche dem männlichen Selbstbild gerecht werden. Dies führt unter anderem dazu, dass Männer bei Beschwerden erst relativ spät einen Arzt/eine Ärztin aufsuchen. Daraus ergibt sich, dass bei Männern häufiger somatische Diagnosen gestellt werden (Fischer 2005, S. 25). Hinblicken auf das Gesundheitsbewusstsein von Männern und Frauen lässt sich feststellen, dass dies die klassische Rollenverteilung widerspiegelt. Männer werden in der Gesellschaft als das „starke“ Individuum beschrieben, welches leistungsfähig, machtvoll, gesund und überlegen ist. Frauen hingegen gelten als das „schwache“ Geschlecht, welches einfühlsam, sensibel, sozial denkend, tendenziell untergeordnet und eher anfällig für Krankheiten ist (Fischer 2005, S. 22). Es ist auch zu erwähnen, dass sich Krankheitsverläufe und Krankheitsbewältigung zwischen den Geschlechtern unterscheiden (Kämmerer 2001, S. 51). Betrachtet man das psychische Erkrankungsbild, so lässt sich feststellen, dass viele psychische Störungen, im Hinblick auf die Lebenszeitprävalenz, viel häufiger bei Frauen als bei Männern vorkommen. Beispielsweise kommen Essstörungen, depressive Störungen sowie Angststörungen am häufigsten bei Frauen vor. Bei Männern hingegen finden sich meist Suchterkrankungen sowie Persönlichkeitsstörungen. Gründe für diese Differenzen sind unter anderem psychosoziale, biologische, kulturelle sowie interaktionelle Faktoren (Riecher-Rössler 2001, S. 13). In der folgenden Arbeit wird konkret auf die häufigsten psychischen Störungen bei Männern und Frauen eingegangen und untersucht, inwieweit sich die jeweiligen Erkrankungen geschlechtsspezifisch differenzieren. Ebenso werden Erklärungsmodelle zur Entstehung von psychischen Störungen sowie die wichtigsten Klassifikationssysteme angeführt. Die Arbeit beinhaltet lediglich einen Teil der häufigsten psychischen Störungen und keine Vollständigkeit. 6 Es ergibt sich folgende Forschungsfrage: Inwieweit unterscheiden sich psychische Störungen bei Männern und Frauen? 7 2 Modelle zur Erklärung psychischer Störungen 2.1 Biomedizinisches Modell Das biomedizinische Modell, welches auch biologisches, organisches oder medizinisches Modell genannt wird, stammt aus der Psychiatrie. Psychische Störungen werden laut diesem Modell als Krankheiten aufgefasst, die sich im Vergleich zum psychischen gesunden Erleben und Verhalten deutlich abgrenzen. Ursachen für das Entstehen einer solchen Krankheit sind somatische Prozesse, welche sich entweder aufgrund der genetischen Disposition oder durch erworbene Schädigungen entwickeln (Franke 2001, S. 24). Sobald ein Individuum als psychisch krank bezeichnet wird, dann bedeutet das, 1. dass es vom natürlichen Zustand des Organismus abweicht, also nicht gesund ist, 2. dass der Zustand der Krankheit in keinem Zusammenhang mit dem der Gesundheit steht, 3. dass die Krankheit eine spezielle Ursache haben muss und daher auch einen vorbestimmten Verlauf nehmen wird, 4. dass die Verhaltensweisen, also die Symptome, des/der PatientIn Zeichen für ihnen zugrundeliegende Prozesse sind, 5. dass ein medizinisches Fachpersonal sowie medizinische Hilfsmittel gebraucht werden, 6. dass es zu bemitleiden ist, da es als kranke Person eingestuft wird, 7. dass es sich von nun an in der sozialen Rolle des/der „PatientIn“ wiederfindet und 8. dass es für sein Verhalten nicht verantwortlich gemacht werden darf, weil es von der Krankheit heimgesucht wurde. (Franke 2001, S. 25). Für betroffene PatientInnen bedeutet das biologische Modell eine Entlastung, da sie sich, solange sie die PatientInnenrolle anerkennen und sich dementsprechend in ihrer/seiner Rolle verhalten, nicht für das als krank deklarierte Verhalten zu verantworten haben (Franke 2001, S. 25). 2.2 Psychoanalytisches Modell Dem psychoanalytischen Modell liegt die Annahme zugrunde, dass der Mensch ein im Kern triebhaftes und affektives Individuum ist, dessen Leben durch Konflikte gekennzeichnet ist. Der Mensch kann sich zwar um Einsicht und Rationalität bemühen, ausschlaggebend für sein Verhalten sind jedoch die Prozesse des Unbewussten. Psychische Störungen entwickeln sich nach diesem 8 Modell nicht aufgrund aktueller Lebensumstände, sondern werden durch lebensgeschichtlich frühere Ereignisse verursacht. Diese Störungsquellen werden als unbewusste Phantasien, unbewusste Konflikte, pathogene Überzeugungen, Entwicklungsdefizite, Traumatisierung sowie Hemmungen und Einschränkungen wichtiger Kompetenzen oder Störung des Selbstwerterlebens beschrieben (Franke 2001, S. 26). Im Folgenden wird ein Überblick über die Grundbausteine zentraler psychoanalytischer Krankheitskonzeptionen gegeben. 2.2.1 Unbewusster Konflikt Dies ist ein Konflikt, der aufgrund der Unvereinbarkeit kindlicher Impulse, Wünsche und elterlichen Anforderungen entsteht und dadurch meist zu Kompromissleistungen führt, welche durch einen symptomatischen Charakter gekennzeichnet sind. Der unbewusste Konflikt ist Grundlage des bewussten Konflikts (Franke 2001, S. 26f). 2.2.2 Unbewusste Phantasie Diese entsteht als kindlicher Lösungsversuch eines unbewussten Konflikts, beispielsweise wenn Geschwister ungerechter Weise mehr Spielzeug und Aufmerksamkeit bekommen und das betroffene Kind aber seine Wut nicht nach außen richten darf, weil es sonst die ganze Liebe seiner Eltern verlieren könnte. Dann kann es sich zumindest in der Phantasie ausmalen, wie es andere Menschen dafür bestrafen könnte (Franke 2001, S.27). 2.2.3 Pathogene Überzeugung Die pathogene Überzeugung entsteht als erlebte Reaktion auf elterliche Handlungen und Einstellungen im Bezug auf die Handlungen des Kindes (Franke 2001, S. 27). 9 2.2.4 Traumatisierung Eine Traumatisierung ist das subjektive Erleben von belastenden Ereignissen, welche die Bewältigungs- und Abwehrmechanismen eines Menschen überfordert haben. Differenziert werden dabei einmalige Traumatisierungen (Schocktrauma) und häufige bzw. permanente Traumatisierungen. Letztere können auch durch sogenannte Entwicklungstraumata ausgelöst werden, bei denen sich Eltern zu wenig auf altersangemessene Bedürfnisse des Kindes einstellen können (Franke 2001, S. 27). 2.2.5 Entwicklungshemmung Die vier oben genannten Grundbausteine unbewusste Konflikte, unbewusste Phantasien, pathogene Überzeugung und Traumatisierung führen zu Entwicklungshemmungen in spezifischen Entwicklungsbereichen (Franke 2001, S.27). 2.2.6 Entwicklungsdefizit Entwicklungshemmungen die aufgrund von unbewussten Konflikten, pathogenen Überzeugungen, unbewussten Phantasien und Traumatisierungen entstehen, können ebenso zu Entwicklungsdefiziten führen. Diese treten meist dann ein, wenn brachliegende Entwicklungskompetenzen wegen Mangel an Übung zu einem Defizit führen (Franke 2001, S.27). 2.2.7 Selbstwertstörung Eine Selbstwertstörung ist eine Reduzierung und Beeinträchtigung eines angemessen Selbstwertgefühls, die durch die oben genannten Grundbausteine unbewusste Konflikte, unbewusste Phantasien, pathogene Überzeugung, Traumatisierung und Entwicklungshemmungen hervorgerufen wird. Im schlimmsten Fall entsteht als Folge von selbstwertregulierenden Gegenmaßnahmen eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, im durchschnittlichen Fall ein beeinträchtigtes Selbstwerterleben, welches bei vielen neurotischen Konflikten und Persönlichkeitsstörungen vorhanden ist (Franke 2001, S. 27). 10 2.2.8 Persönlichkeitsstörung Hemmungen und Einschränkungen gesunder Erfahrungsmöglichkeiten, die daraus resultierenden neurotischen Phantasie- und Kompromissbildungen und die gestörte Selbstwertregulation führen bei neurotischen Menschen zur Ausbildung bestimmter persönlichkeitsstruktureller Eigentümlichkeiten, Persönlichkeitszügen (z.B. Eigenwilligkeit, Misstrauen, Rechthaberei und rivalisieren) sowie zur neurotischen Idealbildung und bestimmten neurotische Arten des Denkens und Erlebens. Die Ganzheit dieser Einstellungen und Haltungen lässt sich als Persönlichkeitsstörung bezeichnen (Franke 2001, S. 27f). Es können nach Franke (2001, S. 28f) drei große Gruppen, im Bezug auf alle psychoanalytischen Schulrichtungen, gebildet werden: a) Trieb-Konfliktmodell: Nach diesem Modell suchen libidinöse und aggressive Triebimpulse ständig nach Befriedigung, wobei es wegen unvermeidbaren Frustrationen (z.B. der Brustentwöhnung), sozialen Normen und Traumatisierungen (z.B. Geburt eines Geschwisters) zur Unterdrückung und Verdrängung von Triebimpulsen kommt. Weil die verdrängten infantilen Triebimpulse weiterhin nach Befriedigung streben, finden sie im neurotischen Symptom eine kompromisshafte „Dennoch-Befriedigung“ (Franke 2001, S. 28). b) Entwicklungsdefizit-Modell: Hierbei ergibt sich eine Störung, weil die Eltern und/oder andere wichtige Bezugspersonen wegen eigener Defizite nicht in der Lage waren, ausreichend gute Selbstobjekt-Funktionen für ihre Kinder zur Verfügung zu stellen. Daher wurden wesentliche Bedürfnisse nach Selbstkohärenz nicht befriedigt. Das Individuum, das in seiner Selbststruktur geschädigt ist, sucht im Verlauf seines Lebens nach übermäßiger Anerkennung und Personen, die es idealisieren kann. Bleiben die Bedürfnisse des Selbst unbefriedigt, so reagiert die Person mit der Entwicklung eines falschen Selbst, meist vor allem durch erlebnisaktivierende Tätigkeiten und durch Konsum berauschender Substanzen (z.B. Drogen, Alkohol, übermäßiges Arbeiten, exzessiver Sport) (Franke 2001, S. 28). c) Beziehungskonflikt-Modell: Dieses Modell fokussiert die interpersonelle Natur zwischenmenschlicher Beziehungen. Menschen organisieren aktiv ihre Entwicklung und stellen dabei kontinuierlich spezifische Beziehungsformen her. Dabei bevorzugen sie unbewusst die Beziehungsmuster, welche ihnen aus ihrer persönlichen Lebensgeschichte 11 vertraut sind und bringen mit Hilfe angepassten kommunikativen Signalen die Gegenüber dazu, sich entsprechend der alten Beziehungserfahrungen zu verhalten (Franke 2001, S. 28f). 2.3 Verhaltenstheoretisches Modell Psychische Störungen werden nach diesem Modell als gelerntes Verhalten definiert, welches entweder von der Person selbst oder von ihrer Umwelt als abweichend, störend oder belastend erlebt sowie bewertet wird. Dies als störend erlebte Verhalten selbst ist die Störung (Franke 2001, S. 29). Erlernen und Aufrechterhaltung von normalem und abweichendem Verhalten folgt laut dem verhaltenstheoretischen Paradigma den Lerngesetzen. Diese sogenannte Kontinuitätsannahme stellt eine wesentliche Differenzierung zum biologischen Modell dar. Während im biologischmedizinischen Modell bestimmte ätiologische Verlaufsprozesse für das kranke Verhalten genannt werden, bezieht sich das verhaltenstheoretische Modell einfach auf andere Bedingungen des Lernens und nicht auf ein grundsätzlich anderes Lernen. Für normales und abweichendes Verhalten gelten die Lernprinzipien klassische und operante Konditionierung sowie Modelllernen und kognitive Lernprozesse (Franke 2001, S 30). Weiters definiert das verhaltenstheoretische Paradigma Normalität und Störungen nur im sozialen Rahmen, in Abhängigkeit von sozialen und individuellen Normen. Ob ein Verhalten nun gestört ist, ergibt sich nicht aus der Art des Verhaltens, sondern dadurch, dass es zu selten, zu häufig, am falschen Ort oder zur falschen Zeit erfolgt und die betroffene Person selbst darunter leidet und sich deshalb so verhält und nicht anders (Franke 2001, S. 30). 2.4 Kommunikationstheoretisch-systematische Ansätze Als kommunikationstheoretisch-systematische Ansätze werden alle Gruppierungen und Richtungen zusammengefasst, welche sich auf soziale Gruppen beziehen und nicht primär auf eine einzelne Person. Nach diesem Modell werden psychische Störungen nicht als Kennzeichen oder Zustand einer Person betrachtet, sondern als Phänomen, welches sich im Zusammenhang mit bestimmten kommunikativen Strukturen und Beziehungen entwickelt und eine Funktion hat. Charakteristisch für diese Sichtweisen sind die Begriffe der identifizierten oder designierten PatientInnen durch 12 welche ausgedrückt werden soll, dass jener Person die Funktion zukommt, das soziale System vor einem Zusammenbruch zu bewahren (Franke 2001, S. 34). Die kommunikationstheoretisch-systematischen Ansätze machen grundsätzlich zu Gesundheit und Krankheit keine Aussage, die Symptome werden vielmehr als Lösungsversuch gesehen. Langfristig eignen sich diese Ansätze jedoch nicht und verursachen Leiden, aber im Anbetracht der realen Situation ist dies meist die bestmögliche Chance das Gesamtsystem vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Der Weg zu einem störungsfreieren Leben besteht aus systematischer Sicht nicht darin Traumata aufzuarbeiten oder neue Fähigkeiten und Sichtweisen zu erwerben, sondern brachliegende Potentiale zu fördern und Problemlösungsressourcen im System zu aktualisieren (Franke 2001, S. 34). 2.5 Diathese-Stress-Modell Dieses Modell, auch Vulnerabilitäts-Stress-Modell genannt, fokussiert auf die Wechselwirkungen zwischen belastenden Ereignissen und der Prädisposition für eine Krankheit. Psychische Störungen entstehen nach diesem Modell nur dann, „wenn unter dem Einfluss von Stressoren konstitutionell bedingte Vulnerabilitäten und Konstitutionen aktiviert werden.“ (Franke 2001, S.35). Ein Mensch mit Vulnerabilität für eine bestimmte Krankheit wird nur dann krank werden, wenn belastende Ereignisse seine Bewältigungsressourcen überfordern (Franke 2001, S. 35). 2.6 Salutogenetisches Modell Der Begriff „Salutogenese“ wurde vom Medizinsoziologen Aaron Antonovsky (1923-1994) definiert. Salutogenetische Modelle fokussieren sich auf das gesamte Spektrum von Gesundheit und Krankheit und konzentrieren sich darauf herauszufinden, wie Menschen am besten gesund werden. Sie gehen davon aus, dass Heterostase, Ungleichgewicht, Krankheit, Leid und Tod inhärente Bestandteile der menschlichen Existenz sind und beschäftigen sich mit der Frage wie Menschen mit Stress umgehen. Der menschliche Organismus wird als System gesehen, das dem Zerfall ausgeliefert ist. Es muss daher kontinuierlich Energie in das System gepumpt werden, damit es erhalten bleibt. Im salutogenetischen Modell ist Krankheit ein normales, übliches Ereignis. Menschen sind nicht entweder krank oder gesund, sondern immer und zu jedem Zeitpunkt beides. Krankheit ist damit nicht der Ausfall eines Systems, sondern sie wird als Ent-Gesundung 13 verstanden, involviert in die Geschichte eines Menschen (Franke 2001, S. 35f). 3 Grundlagen zur Beschreibung psychischer Störungen 3.1 Ätiologie 3.1.2 Biologische Ursachen Für einige psychische Erkrankungen wie Schizophrenie, Depression oder Alkoholismus werden genetische Ursachen vermutet. Diese allein sind jedoch nie die Ursache für die Entstehung einer psychischen Störung sondern entstehen in Kombination mit anderen Faktoren (Kryspin-Exner, 2007, S. 172f). 3.1.3 Psychosoziale Ursachen Je nach theoretischen Konzepten gibt es unterschiedliche Vermutungen bezüglich psychosozialer Ursachen für die Entstehung von psychischen Erkrankungen. Tiefenpsychologische Ansätze beispielsweise vermuten psychische Störungen als Resultat unbewältigter phasenspezifischer Aufgaben der frühkindlichen Libido-Entwicklung. In traumatischen Situationen im späteren Leben kommt es zu einer Reaktualisierung der verdrängten ungelösten Konflikte und es kann zu einer Manifestation psychischer Störungen kommen. Lerntheoretisch-kognitive Modelle versuchen die Entstehung psychischer Störungen durch lebenslange Lernprozesse wie Modelllernen, klassische und operante Konditionierung und Problemlösungsstrategien zu erklären. Sozialpsychologische Modelle nehmen an, dass psychische Störungen aufgrund von sozialen Defiziten entstehen. So können sich unzureichende soziale Unterstützung oder überengagierte aber feindselige Angehörige auf den Menschen auswirken und psychische Störungen verursachen (Kryspin-Exner 2007, S. 173). 14 3.2 Klassifikation Die Klassifikation dient zur Strukturierung psychisch auffälliger Symptome und erlaubt somit die Zuordnung eines Falles zu einer Klasse und eine Diagnosestellung. Die beiden weltweit gültigen Klassifikations- bzw. Diagnosesysteme sind die International Classification of Disease (ICD), welche von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelt wurde sowie das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), welches von der American Psychiatric Association entwickelt wurde. Bei Klassifikationssystemen werden Zuordnungskriterien aus Verlauf und Symptomen der Erkrankung bestimmt. Die Krankheitsbilder können aufgrund mehrerer Achsen und durch Kodierung des Ausprägungsgrades beschrieben werden. Mittels der Klassifikationssysteme sind auch Mehrfachdiagnosen möglich (Kryspin-Exner 2007, S. 174). 3.2.1 International Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death (ICD) Die Interational Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death wurde von der WHO entwickelt. Sie umfasst zehn Hauptgruppen und 398 Störungsdiagnosen und stellt ein hierarchisches System dar. Die in der ICD-10 angeführten psychischen Störungsbilder lauten: F0: organische Störungen F1: psychische Störungen sowie Verhaltensauffälligkeiten aufgrund von psychotropen Substanzen F2: schizophrene, schizotype und wahnhafte Störungen F3: affektive Störungen F4: neurotische sowie Verhaltens- und Belastungsstörungen F5: Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren F6: Verhaltens- und Persönlichkeitsstörungen F7: Intelligenzminderung F8: Entwicklungsstörungen F9: emotionale und Verhaltensstörungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (KryspinExner 2007, S. 175f) 15 3.2.2 Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen (DSM) 1952 wurde von der American Psychiatric Association (APA) erstmals das Diagnistic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) veröffentlicht. 1980 wurde das DSM-III entwickelt, danach das DSM-III-R. Die momentan aktuellste Version ist das DSM-IV. Das DSM beschreibt Störungen in 16 diagnostischen Hauptgruppen auf folgenden fünf Achsen: Achse 1: Klinische Störungen sowie andere klinisch relevante Probleme Achse 2: Intellektuelle Behinderungen und Persönlichkeitsstörungen Achse 3: Medizinische Krankheitsfaktoren Achse 4: psychosoziale sowie umgebungsbedingte Probleme Achse 5: Globale Erfassung des Funktionsniveaus (Kryspin-Exner 2007, S. 176) 4 Angststörungen Angststörungen gehören bei Frauen zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, bei Männern nach den Abhängigkeitsstörungen zu den zweithäufigsten. Bereits im Kindesalter sind die Geschlechtsunterschiede laut einigen Studien deutlich zu erkennen (Schneider 2001, S. 210). 4.1 Generalisierte Angststörung Hierbei handelt es sich um dauerhafte, übertriebene oder unrealistische Ängste oder Sorgen. Die Sorgen können von autonomen Symptomen wie Nervosität, Anspannung, erhöhter Erregung oder vegetativen Beschwerden begleitet werden. Betroffene geben an ihre Befürchtungen und Sorgen nicht kontrollieren oder abstellen zu können (Schneider 2001, S. 214f). Die Ängstlichkeit betrifft meistens bestimmte Lebensumstände, wie den Gesundheitszustand einer geliebten Person oder unbegründete Sorgen über die eigenen Finanzen (Gerrig & Zimbardo 2008, S. 558). Diagnostiziert wird diese Angststörung, wenn die betroffene Person über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten ein andauerndes Gefühl der Ängstlichkeit und Besorgtheit erlebt, ohne dass eine reale Bedrohung besteht. Ebenso müssen mindestens drei weitere Symptome wie Muskelspannung, Ruhelosigkeit, Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten oder Reizbarkeit vorliegen (Gerrig & Zimbardo 2008, S. 558). 16 Eine generalisierte Angststörung entwickelt sich meist zwischen dem zwanzigsten und dreißigsten Lebensjahr und verläuft chronisch (Schneider 2001, S. 215). 4.2 Panikstörung Charakteristisch für eine Panikstörung sind die plötzlich auftretenden Panikanfälle bzw. die dauerhafte Sorge vor dem erneuten Auftreten eines solchen Anfalles. Panikanfälle sind durch intensive Furcht oder Unbehagen gekennzeichnet und werden ebenso von einer Vielzahl körperlicher und psychischer Symptome und das Gefühl drohender Gefahr begleitet. Ein Panikanfall dauert im Durchschnitt dreißig Minuten, kann aber auch kürzer sein. Typische körperliche Symptome sind Herzklopfen, Herzrasen, Benommenheit, Magen-Darmbeschwerden, Dyspnoe, Zittern, Brustschmerzen, Schwindel sowie die Angst zu sterben, die Kontrolle zu verlieren oder verrückt zu werden. Solche Anfälle entstehen meist spontan und ohne für die PatientInnen ersichtliche Ursachen. Folglich kommt es meistens zu Vermeidungsverhalten, die Betroffenen schränken ihren Lebensstil ein und gehen nicht mehr an Orte, an denen sie einen Panikanfall erlitten haben (Schneider 2001, S 211). Studien zufolge haben Frauen im Vergleich zu Männern ein höheres Risiko ein Vermeidungsverhalten zu entwickeln und weisen ebenso häufiger komorbide Störungen wie Depressionen auf (Schneider 2001, S. 212). 4.3 Soziale Phobie Unter einer sozialen Phobie wird eine dauerhafte, intensive und unangemessene Furcht und Vermeidung von Situationen verstanden, in denen PatientInnen mit anderen Menschen in Kontakt treten und dadurch einer möglichen Bewertung ausgesetzt sind. Die Betroffenen fürchten sich lächerlich zu machen, durch ungeschicktes Verhalten gedemütigt zu werden oder zu versagen. Ein Beginn der Störung zeigt sich meist zwischen dem fünfzehnten und einundzwanzigsten Lebensjahr. Risikofaktoren für die Entwicklung einer sozialen Phobie sind unter anderem ein niedriger sozioökonomischer Status und eine einfache Schulbildung (Schneider 2001, S. 213). In therapeutischen Einrichtungen finden sich vermehrt Männern mit sozialen Phobien. Gründe hierfür könnten sein, dass Frauen durch die soziale Phobie weniger soziale Sanktionen erleben (Schneider 2001, S. 213f). 17 5 Zwangsstörung Bei einer Zwangsstörung verspüren die Betroffenen den subjektiven Drang bestimmte Dinge zu tun oder zu denken. Dieser Drang liegt aber außerhalb ihrer Kontrolle. Sie erleben diesen als etwas, das von ihnen selbst ausgeht, distanzieren sich aber mehr oder weniger stark von den Inhalten bzw. Handlungen. Daher versuchen die Betroffenen diesen Handlungsimpulsen oder Gedanken zu widerstehen (Lakatos 2001, S. 229f). Die am häufigsten verbreiteten Formen von Zwangsstörungen sind Putz- und Waschzwänge sowie der Kontrollzwang. Putz- und Waschzwänge sind meist mit der Furcht vor einer Ansteckung mit einer tödlichen Krankheit (z.B. AIDS) oder der Verunreinigung mit menschlichen Ausscheidungen verbunden. Charakteristisch hierfür ist, dass die Betroffenen fürchten durch den Kontakt mit diesen Stoffen zu erkranken, zu sterben oder andere Personen dadurch krank zu machen. Kontrollzwänge hingegen beziehen sich meistens auf Elektrogeräte wie Bügeleisen, Kaffeemaschine oder Herd, welche in der Vorstellung der Betroffenen einen Hausbrand verursachen könnten. Auch Türen und Fenster spielen bei Kontrollzwängen eine große Rolle, welche wegen der Gefahr eines Einbruchs unbedingt verschlossen sein müssen. Einer der häufigsten Auslöser für einen Kontrollzwang ist die Furcht einen Fehler begangen zu haben, welcher das soziale Ansehen und Leben zerstören könnte (Lakatos 2001, S. 232). Lange Zeit wurde geglaubt, dass vorwiegend Frauen an Zwangsstörungen erkranken. Der Grund hierfür war, dass hauptsächlich Frauen in stationären psychiatrischen Kliniken aufgenommen wurden. In den 1990er Jahren durchgeführte Studien ergaben jedoch, dass Zwangsstörungen bei den Geschlechtern beinahe gleichverteilt sind (Lakatos 2001, S. 236). Bezüglich der Inhalte der Zwangsstörungen lässt sich feststellen, dass vor allem Frauen unter den Zwangsgedanken leiden dem eigenen geliebten Kind etwas anzutun. Ebenso treten bei Frauen viel häufiger Putzzwänge auf, bei Männern hingegen kaum. Männer werden aber viel häufiger von Gedanken gequält im Beruf entscheidende Fehler gemacht zu haben und auch das Thema des sexuellen Missbrauchs ist eher charakteristisch für das männliche Geschlecht (Lakatos 2001, S. 236f). 18 6 Posttraumatische Belastungsstörung Eine posttraumatische Belastungsstörung wird diagnostiziert, wenn Erfahrungen vorliegen, welcher der Traumadefinition gleichen und eine spezifische Anzahl von Einzelsymptomen auftritt. Jene Symptome können sein: Quälende, unkontrollierbare Erinnerungen an das traumatische Geschehen, Vermeidung von Situationen, Kontakten, Gefühlen oder Gedanken, welche an das traumatische Ereignis erinnern könnten sowie erhöhtes Energieniveau, welches das Schlafverhalten und die Konzentrationsfähigkeit beeinträchtigt (Teegen, 2001, S. 265f). Studien zeigten, dass die Wahrscheinlichkeit eine posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln bei Frauen zweimal höher ist als bei Männern. Ebenso haben Frauen eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sich die Krankheit chronifiziert (Volgger 2011, S. 19). 7 Affektive Störungen Als affektive Störungen werden psychische Störungen verstanden, deren primäres Merkmal eine krankhafte Veränderung der Stimmlage ist. Zu unterscheiden sind unipolare und bipolare Depressionen (Kühner 2001, S. 166). 7.1 Unipolare Depression Als unipolare Depressionen werden die Major Depression und die Dysthyme Störung zusammengefasst. Nach dem DSM-IV wird eine Major Depression diagnostiziert, wenn mindestens fünf der folgend genannten Symptome vorhanden sind: Verlust an Interesse oder Freude, depressive Verstimmung, 19 verminderter Appetit oder Gewichtsverlust ohne Diät, psychomotorische Unruhe oder Verlangsamung, Schlaflosigkeit oder vermehrtes Schlafbedürfnis, Müdigkeit oder Energieverlust, Gefühle von Wertlosigkeit oder Schuldgefühle, verminderte Konzentrations- und/oder Entscheidungsfähigkeit sowie wiederkehrende Gedanken an den Tod oder Suizidgedanken Zur Diagnose müssen diese genannten Symptome in einem Mindestzeitraum von zwei Wochen gemeinsam auftreten und eine Beeinträchtigung in sozialen, beruflichen oder sonstigen Funktionsbereichen verursachen (Kühner 2001, S. 166f). Bei der Dysthymen Störungen liegt eine geringere Symptomschwere vor als bei der Major Depression, jedoch ist sie durch einen chronischen Verlauf gekennzeichnet. Für die Diagnose ist das Vorliegen einer depressiven Verstimmung die meiste Zeit des Tages an mehr als der Hälfte der Tage über einen Mindestzeitraum von zwei Jahren erforderlich. Innerhalb dieser zwei Jahre darf kein symptomfreier Zeitraum von mehr als zwei Monaten vorhanden sein und es darf keine Episoden einer Major Depression geben. Es müssen mindestens zwei der folgend genannten Symptome auftreten: Schlaflosigkeit oder übermäßiges Schlafbedürfnis, Appetitlosigkeit oder übermäßiges Bedürfnis zu essen, geringes Selbstwertgefühl, Erschöpfung oder Energiemangel, Gefühl der Hoffnungslosigkeit sowie Konzentrationsstörungen oder Entscheidungserschwernis (Kühner 2001, S. 167). 7.2 Bipolare Störung Als Bipolare Störung werden die Bipolar I und die Bipolar II Störungen sowie die Cyclothyme Störung zusammengefasst. 20 Eine Bipolar I Störung wird durch das Vorliegen einer oder mehrerer manischer Episoden oder gemischt manisch-depressiver Episoden charakterisiert. Diagnostiziert wird eine manische Episode nach DSM-IV durch das vorliegen von mindestens drei der folgend genannten Symptome: vermehrtes Schlafbedürfnis, übersteigertes Selbstwertgefühl oder Größenideen, erhöhte Ablenkbarkeit, vermehrte Gesprächigkeit oder Rededrang, gesteigerte Betriebsamkeit oder psychomotorische Unruhe, Ideenflucht oder subjektives Gefühl des Gedankenrasens sowie übermäßige Beschäftigung mit angenehmen Tätigkeiten, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit unangenehme Konsequenzen mit sich führen. Ebenso muss ein Zustand einer anhaltenden, abnorm gehobenen, expansiven oder reizbaren Stimmung über einen Zeitraum von mindestens einer Woche gegeben sein. Eine Bipolar II Störung beinhaltet wiederkehrende Episoden einer Major Depression mit hypomanen Episoden (Kühner 2001, S. 168). Die Cyclothyme Störung ist eine chronisch fluktuierende affektive Störung, bei welcher sich häufige Perioden mit hypomanen und leichteren depressiven Symptomen abwechseln. Zur Diagnostik müssen die Symptome mindestens zwei Jahre vorliegen und die symptomfreie Zeit darf den Zeitraum von zwei Monaten nicht überschreiten (Kühner 2001, S. 169). Im Vergleich zu Männern erkranken Frauen häufiger an einer Bipolar II Störung. Bipolar I und cyclothyme Störung liegen bei Männern und Frauen etwa gleich häufig vor. Auch bei unipolaren Depressionen ist die Prävalenz bei Frauen höher als bei Männern (Kühner 2001, S. 170). Fischer (2005, S. 166) beschreibt geschlechtsspezifische Erscheinungsbilder einer Depression. So neigen Männer eher zu Unzufriedenheit, Wutausbrüchen, Gereiztheit und erhöhter Risikobereitschaft, Frauen hingegen eher zu Antriebsstörungen, Schlafstörungen, sozialem Rückzug und Vernachlässigung der Körperpflege (Fischer 2005, S. 166). 21 8 Borderline-Persönlichkeitsstörung Die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist eine schwere psychische Störung, welche durch ein Muster von Instabilität in zwischenmenschlichen Beziehungen, in Affekten, im Selbstbild sowie von deutlicher Impulsivität gekennzeichnet ist. Für den/die DiagnostikerIn ist es eher schwierig eine entsprechende Diagnose zu stellen, da die Symptome einer Persönlichkeitsstörung oft weniger gut beobachtbar sind, weil sie stark mit dem Beziehungs- und Selbsterleben der Betroffenen verbunden sind und nicht selten von den PatientInnen als Symptom wahrgenommen werden (Dulz et al. 2011, S. 303). Betroffene haben oft starke Gefühlsschwankungen und handeln des Öfteren impulsiv und gefährden sich selbst (z. B. durch exzessiven Alkoholkonsum und/oder selbstverletzendes Verhalten). Eine Borderline-Persönlichkeitsstörung beginnt meistens im frühen Erwachsenenalter und wird anhand des Auftretens von mindestens fünf der folgenden Kriterien nach DSM-IV diagnostiziert: chronisches Gefühl von Leere, heftige, unangemessene Wut oder die Schwierigkeit diese Wut zu kontrollieren, vorübergehende paranoide Vorstellungen, welche durch Belastungen ausgelöst werden, wiederholte Suizidhandlungen, Selbstmordandeutungen oder –versuche sowie selbstverletzendes Verhalten, verzweifeltes Bemühen nicht verlassen zu werden, Identitätsstörung, Impulsivität in mindestens zwei potentiell selbstschädigenden Bereichen (Fressanfälle, Substanzmissbrauch, etc.) Affektive Instabilität infolge einer ausgeprägten Reaktivität der Stimmung (Renneberg, 2001, S. 401). Nach ICD-10 wird eine Borderline-Persönlichkeitsstörung anhand folgender Kriterien diagnostiziert: die inneren Erfahrungs- und Verhaltensmuster weichen deutlich im Bereich der Impulskontrolle und Handhabung von zwischenmenschlichen Beziehungen, Wahrnehmung und Affektivität von den kulturell erwarteten und akzeptierten Normen ab, die Abweichung in den obig genannten Bereichen ist so stark, dass das daraus resultierende Verhalten in persönlichen und sozialen Situationen unangepasst und unzweckmäßig ist, 22 durch diese Abweichungen kommt es zu einem persönlichen Leidendruck und/oder nachteiligem Einfluss auf die soziale Umwelt, es muss nachgewiesen werden können, dass das abweichende Verhalten von Dauer ist und im späten Kindesalter bzw. in der Adoleszenz begonnen hat, das abweichende Verhalten kann durch das Vorliegen oder durch die Folge einer anderen psychischen Erkrankung nicht erklärt werden, es muss ausgeschlossen werden, dass organische Erkrankungen, Verletzungen oder deutliche Funktionsstörungen des Gehirns Ursachen für die Abweichung sein könnten (Dulz et al. 2011, S. 305). Risikofaktoren für die Entstehung einer Borderline-Persönlichkeitsstörung sind unter anderem Depressionen, ausgeprägte Impulsivität, traumatische Lebensereignisse, sexueller Missbrauch und schizotypische Verhaltensweisen (Renneberg 2001, S. 408). Einige Studien zeigen, dass eine Borderline-Persönlichkeitsstörung hauptsächlich bei Frauen auftritt, bei Männern eher selten. Gründe hierfür sind unter anderem, dass Frauen häufiger Opfer sexuellen Missbrauchs werden und eine stärkere Intensität emotionalen Empfindens und Reagierens aufweisen, wodurch sie eher in Kombination mit anderen Einflussfaktoren an einer BorderlinePersönlichkeitsstörung erkranken (Renneberg 2001, S. 414). 9 Schizophrenie Nach der ICD-10 wird die Schizophrenie diagnostiziert, wenn über einen Zeitraum von mindestens einem Monat Symptome wie kommentierende oder dialogisierende Stimmen, Gedankenlautwerden, anhaltender bizarrer Wahn oder katatone Symptome vorhanden sind. Die Schizophrenie betrifft die gesamte Persönlichkeit der/des Betroffenen. Die Erkrankung kann alle psychischen Funktionen verändern. Sie manifestiert sich in einer unterschiedlichen Symptomatik, abhängig davon, ob es sich um eine akute oder chronische Erkrankungsphase handelt (Schmitt 2001, S. 143). 23 Es werden bei der Schizophrenie folgende Subtypen unterschieden: Paranoider Typus: Dieser Typ wird durch ausgeprägte akustische Halluzinationen oder Wahnphänomene charakterisiert. Oft findet sich auch ein Verfolgungswahn oder ein Größenwahn. Die Halluzinationen beiziehen sich inhaltlich auf das Wahnthema, dieser Typus tritt meist im späteren Lebensalter auf. Desorganisierter Typus: Charakteristisch für diesen Typus ist die desorganisierte Sprechweise, das desorganisierte Veralten sowie der verflachte Affekt. Meist kommt es bei diesem Typ zu einem Verlust der Zielorientierung und zu einer Einschränkung der Selbstständigkeit. Typisch sind auch unangemessene Heiterkeit und Albernheit aber auch eine Neigung zur Chronifizierung. Katatoner Typus: Leitsymptome des katatonen Typus sind ausgeprägte Störungen der Psychomotorik wie motorische Unbeweglichkeit, merkwürdige Willkürbewegungen oder das Wiederholen von bereits Gesprochenem. Ebenso können aber Erschöpfungszustände, selbst zugefügte Verletzungen oder Mangelernährung infolge der Störung auftreten (Schmitt 2001, S. 146f). In diversen Studien wurde festgestellt, dass Männer ein signifikant geringeres Ersterkrankungsalter als Frauen aufweisen. Frauen erkranken im Durchschnitt erst vier bis fünf Jahre später als Männer. Hypothesen für diese Unterschiede sind unter anderem, dass Frauen weniger dem beruflichen Stress ausgesetzt sind, da sie weniger in höheren Positionen vertreten sind. Ebenso heiraten Frauen im Durchschnitt früher als Männer und weisen dadurch eine bessere soziale Integration auf, welche vor der Erkrankung schützt. Diese Hypothesen könnte jedoch nicht belegt werden. Heute wird davon ausgegangen, dass Frauen durch die Östrogene vor einer früheren Erkrankung geschützt sind (Schmitt 2001, S. 150f). Es ist zu erwähnen, dass die sozialen Fähigkeiten bei schizophrenen Frauen besser ausgebildet sind als bei schizophrenen Männern. Jedoch halluzinieren Frauen im akuten Krankheitsstadium häufiger als männliche Schizophrene (Rädler & Naber 2007, S. 52). 24 10 Essstörungen 10.1 Bulimia Nervosa Gekennzeichnet ist die Bulimia Nervosa durch Heißhungeranfälle, wobei eine große Nahrungsmenge in einem bestimmten Zeitraum aufgenommen wird, mit anschließenden gewichtsreduzierenden Maßnahmen wie Erbrechen, Fasten und/oder Missbrauch von Laxantien und Appetitzüglern. Betroffene haben oft das Gefühl die Kontrolle über das Essverhalten zu verlieren (Franke 2001, S. 363f). Ein solcher Anfall wird häufig geplant. Die Betroffenen gehen eigens dafür einkaufen oder stellen sicher, dass genügend Nahrung zu Hause vorhanden ist. Das Essen findet dann meistens heimlich statt und endet damit, dass die Kapazitätsgrenze des Magens erreicht wurde oder die Betroffenen durch Einschlafen oder Gestörtwerden die Nahrungsaufnahme beenden. Die Kalorienaufnahme bei einem Anfall bewegt sich meist in einem Bereich von 3000 – 4000 Kilokalorien (Heinemann & Hopf 2008, S. 209). Nach dem Anfall fühlen sich die Betroffenen oft deprimiert und verachten sich selbst für das impulshafte Verhalten. Diese Gefühle von Depressivität, Selbstverachtung, Heimlichkeit und Scham führen oft zur sozialen Isolation und die enormen Kosten für die Nahrungsmittel bedingen meist finanzielle Schwierigkeiten (Heinemann & Hopf 2008, S. 209). Diverse Studien zeigten, dass bulimische Männer im Vergleich zu Frauen ein höheres Idealgewicht angeben. Ebenso leiden männliche Bulimiker weniger an ihren Essanfällen als Frauen (Kersting 2007, S. 181). 10.2 Anorexia Nervosa Hierbei handelt es sich um den dringlichen Wunsch der Betroffenen extrem schlank zu sein. Leitsymptome sind markanter Gewichtsverlust, Amenorrhoe, Verzerrungen im kognitiven Bereich sowie ein hohes Aktivitätsniveau. Weiters haben die Betroffenen extreme Angst vor einer Gewichtszunahme oder dick zu werden, obwohl Untergewicht besteht. Sie weigern sich, das Minimum des für ihr Alter und Körpergröße entsprechende Körpergewicht zu halten. Der Gewichtsverlust wird selbständig durch induziertes Erbrechen, übertriebene körperliche Aktivitäten, Gebrauch von Appetitzüglern, induziertes Abführen und/oder Vermeidung hochkalorischer Speisen herbeigeführt (Franke 2001, S. 361). 25 Als psychische Auffälligkeiten gelten vor allem depressive Symptome, Zwangsverhalten und bizarre Verhaltensweise, die sich ausschließlich auf das Essen beziehen (Franke 2001, S. 362). In Amerika wird eine Variante der männliche Anorexia nervosa beschrieben, die sogenannte „reverse anorexia“. Männer mit dieser Erkrankung sind wahnhaft davon überzeugt eine zu geringe Muskelmasse zu haben. Dadurch kommt es zu einem zwanghaften Bedürfnis durch muskuläres Aufbautraining das Muskelwachstum zu erhöhen (Kersting 2007, S. 181). 10.3 Adipositas Adipositas beschreibt einen Überschuss an Körperfett und wird ab einem Body Mass Index von über 30 diagnostiziert. Folgen von Adipositas sind unter anderem Schlaganfälle, Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, Gallensteine, Diabetes Mellitus, Bandscheibenvorfälle, Zyklusstörungen sowie Schwangerschaftskomplikationen. Ebenso wirkt sich die Adipositas oft auf das Selbstwertgefühl, die Zufriedenheit und Lebensqualität des/der Betroffenen aus. In einer Gesellschaft, die das Schlanksein propagiert, werden adipöse Menschen häufig von Freizeitveranstaltungen ausgeschlossen, haben wenig soziale Kontakte und des Öfteren Schuldgefühle zu dick zu sein. Sie halten sich für disziplinlos und zu schwach eine Diät zu beginnen oder durchzustehen und dadurch geht eine Adipositas auch oft mit einer depressiven Verstimmung einher. Die körperlichen Folgeerkrankungen werden dabei häufig als Strafe für die eigene Zügellosigkeit interpretiert (Franke 2001, S. 365f). 11 Sexualstörungen 11.1 Sexuelle Störungen im DSM-IV Das DSM-IV unterteilt die verschiedenen sexuellen Störungen in Störungen der sexuellen Erregbarkeit, Störungen der sexuellen Appetenz und in Orgasmusstörungen. Mit einbezogen werden auch Störungen mit sexuell bedingten Schmerzen, sexuelle Störungen aufgrund einer Krankheit und substanzinduzierte sexuelle Funktionsstörungen. Diagnostiziert wird eine sexuelle Störung laut der DSM-IV nur dann, wenn sie deutliches Leiden oder zwischenmenschliche Schwierigkeiten verursacht und die Störung nicht durch eine andere Störung erklärt werden kann (Kämmerer & Rosenkranz 2001, S. 333f). 26 Folgende sexuelle Störungen werden im DSM-IV klassifiziert: Störung mit sexueller Aversion: anhaltende oder wiederkehrende extreme Abneigung gegenüber genitalem Kontakt. Störung der sexuellen Erregung: keine Anschwellung der äußeren Genitale als Zeichen der Erregung wird erlangt oder dies bleibt bis zum Ende der sexuellen Aktivität nicht aufrechterhalten. Dyspaneurie: Wiederkehrende oder anhaltende Schmerzen während des Geschlechtsverkehrs. Vaginismus: Wiederkehrende oder anhaltende unwillkürliche Spasmen der Vaginalmuskulatur. Nymphomanie: gesteigertes sexuelles Verlangen Paraphilien/Störungen der Sexualpräferenz: wiederkehrende, intensive sexuell dranghafte Bedürfnisse, Phantasien oder Verhaltensweisen, welche sich auf ungewöhnliche Aktivitäten, Objekte oder Situationen beziehen (z.B.: Exhibitionismus, Fetischismus, Pädophilie, Masochismus, Sadismus, Voyeurismus, etc.) Orgasmusstörung: wiederkehrende oder anhaltende Verzögerung des Orgasmus bzw. vollständiges Ausbleiben eines Orgasmus nach normaler sexueller Erregung (Kämmerer & Rosenkranz 2001, S. 335). 11.2 Sexuelle Störungen im ICD-10 Bei dem ICD-10 liegt das Augenmerk darin, welche sexuelle Funktion durch die Störung beeinträchtigt ist. Folgende sexuelle Störungen werden nach dem ICD-10 unterschieden: Sexuelle Aversion: Die Vorstellung einer sexuellen Partnerbeziehung ist stark von negativen Gefühlen begleitet und erzeugt so viel Angst, dass sexuelle Handlungen vollständig vermieden werden. Mangel oder Verlust von sexuellem Verlangen Mangel an sexueller Befriedigung: Der Orgasmus wird ohne Lustgefühl erlebt. 27 Versagen genitaler Reaktion: Mangel oder Ausfall des genitalen Sekrets. Orgasmusstörung: Der Orgasmus tritt stark verzögert oder gar nicht ein. Nicht-organische Dyspaneurie: starke Schmerzen während des Geschlechtsverkehrs Nymphomanie: gesteigertes sexuelles Verlangen (Kämmerer & Rosenkranz 2001, S. 335). 11.3 Geschlechtsidentitätsstörung Eine Geschlechtsidentitätsstörung ist gekennzeichnet durch das anhaltende Unbehagen im eigenen, angeborenem Geschlecht und der starke andauernde Drang der Zugehörigkeit zum anderen Geschlecht. Damit verbunden ist die Ablehnung der eigenen Geschlechterrolle und der körperlichen Merkmale. Geschlechtsidentitätsstörungen sind weniger Störungen der Sexualität sondern der Identität, der Persönlichkeit und des Rollenverhaltens. Zur Diagnose einer Geschlechtsidentitätsstörung müssen folgende Kriterien gegeben sein: Dauerhafte gegengeschlechtliche Identifikation Andauerndes Unbehagen bezüglich der biologischen Geschlechtszugehörigkeit Nachweis eines klinisch relevanten Leidensdruckes oder Beeinträchtigung in beruflichen, sozialen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen (Krause et. al 2011, S. 82). Studien zeigten, dass vorwiegend Frauen unter dem Ausbleiben eines Orgasmus sowie unter mangelnder Lubrikation leiden, Männer hingegen Errektionsprobleme aufweisen (Sigusch 2007, S. 215f). Ebenso sind es vorwiegend Frauen, die aufgrund von sexueller Lustlosigkeit therapeutische Hilfe suchen. Die Patientinnen erleben diese Lustlosigkeit als persönliches Versagen und damit als sexuelle Störung (Kämmerer & Rosenkranz 2001, S. 339). Bezüglich der Prävalenz der Geschlechtsidentitätsstörung liegen keine epidemiologischen Daten vor. 12 Somatoforme und dissoziative Störungen Charakteristisch für somatoforme und dissoziative Störungen ist, dass körperliche Phänomene betrachtet werden, die nicht wegen physiologischer Verursachungen entstanden sind, sondern durch 28 seelische Phänomene wie dysfunktionale Gedanken und/oder konflikthafte Gefühle (Kämmerer 2001, S. 286). 12.1 Somatoforme Störungen Die Symptome einer somatoformen Störung verursachen Leiden und eine starke Beeinträchtigung in beruflichen, sozialen und oder anderen wichtigen Lebensbereichen. Es gibt für die Betroffenen keine Möglichkeit die Symptome kognitiv zu kontrollieren. Im ICD-10 sind die zentralen Kennzeichen einer somatoformen Störung die hartnäckigen Forderungen nach medizinischen Untersuchungen, obwohl jene bereits ein negatives Ergebnis lieferten (Kämmerer 2001, S. 286). Charakteristisch für somatoforme Störungen ist die fokussierte (Selbst-)Aufmerksamkeit auf den eigenen Körper bzw. auf die körperlichen Prozesse. Aufgrund einer Fehlbewertung der körperlichen Sensationen als Krankheitssymptome werden jene als unbeeinflussbar und unkontrollierbar von den Betroffenen erlebt. Diese kognitive Verzerrung ist mit emotionalen Beeinträchtigungen verbunden. So fühlen sich die PatientInnen niedergeschlagen, ängstlich, hilflos und spüren einen starken Leidensdruck. Durch diese emotionalen Belastungen können sich komorbide Störungsbilder wie Depressionen oder Angststörungen entwickeln (Kämmerer 2001, S. 287). 12.1.1 Somatisierungsstörungen Leitsymptome einer Somatisierungsstörung sind wiederkehrende, multiple, klinisch bedeutsame Beschwerden, welche immer eine ärztliche Untersuchung sowie die Einnahme von Medikamenten erfordern. Zur Diagnose darf das Alter der/des Betroffenen das 30. Lebensjahr nicht überschreiten und die Symptome müssen mindestens zwei Jahre anhalten. Im DSM-IV müssen mindestens acht Symptome aus vier Köper- oder Funktionsbereichen vorhanden sein: vier Schmerzsymptome (Kopf-, Abdomen-, Rücken-, Gelenk- und/oder Brustschmerzen), zwei gastrointestinale Schmerzen (Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Speisenunverträglichkeit, Völlegefühl), ein sexuelles Symptom (unregelmäßige Menstruation, sexuelle Gleichgültigkeit, Erektions- oder Ejakulationsstörungen, Erbrechen während der gesamten Schwangerschaft) sowie ein pseudoneurologisches Symptom (Schluckschwierigkeiten, lokale Muskelschwäche, Aphonie, Halluzinationen, Koordinations- und Gleichgewichtsstörungen). 29 Im ICD-10 müssen zur Diagnose mindestens sechs aus vier verschiedenen Kategorien vorliegen: gastrointestinale Symptome (Übelkeit, Gefühl der Überblähung, Bauchschmerzen, extrem belegte Zunge, Klagen über Erbrechen oder über häufigen Durchfall), kardiovaskuläre Symptome (Brustschmerzen, Atemlosigkeit ohne Anstrengung) urogenitale Symptome (unangenehme Empfindungen in und um den Genitalbereich, Dysurie, Klagen über vaginalen Ausfluss) sowie Haut- und Schmerzsymptome (Schmerzen in Gliedern, Gelenken oder Extremitäten, unangenehme Taubheit und Kribbelgefühle, Klagen über Farbveränderungen der Haut). Bei Untersuchungen können diese Symptome nicht medizinisch erklärt werden (Kämmerer 2001, S. 289f). 12.1.2 Konversionsstörung Eine Konversionsstörung äußert sich durch Ausfälle im willkürlich-motorischen und/oder sensorischen Funktionsbereich. Die häufigsten motorischen Symptome sind unter anderem Paralyse oder umschriebene Muskelschwäche, Schluckschwierigkeiten, Koordinations- und Gleichgewichtsstörungen, Aphonie oder Harnverhalten. Sensorische Symptome sind Blindheit, der Verlust der Berührungs- oder Schmerzempfindlichkeit, das Sehen von Doppelbildern, Halluzinationen und Taubheit. Der eigentliche Unterschied zur Somatisierungsstörung liegt darin, dass bei dieser eine Krankheit der inneren Organe vermutet wird, bei der Konversionsstörung jedoch motorische und neurobiologische Störungen erlebt werden (Kämmerer 2001, S. 291). 12.1.3 Hypochondrie Charakteristisch für die Hypochondrie ist eine nicht durch organische Befunde gestützt Angst oder Überzeugung eine ernsthafte Krankheit zu haben. Körperliche Empfindungen oder Zeichen werden als „Krankheitsbeweis“ fehlgedeutet, trotz ärztlicher Rückversicherung, dass keine Krankheit vorliegt. Aufgrund dieser Ängste besteht eine übermäßige Beschäftigung mit den eigenen Befürchtungen und Ängsten. Das hypochondrische Denken kann sich auf Schwitzen, Herzklopfen, gelegentliches Husten, kleine Wunden oder Darmperistaltik beziehen und kann sich durch Lesen oder Hören über Krankheiten oder durch einen Krankheitsfall im Bekanntenkreis entwickeln oder intensivieren. Diagnostiziert wird die Hypochondrie bei Vorliegen der Symptome über einem Zeitraum von mindestens sechs Monaten (Kämmerer 2001, S. 295). 30 12.2 Dissoziative Störungen Charakteristisch für dissoziative Störungen ist, dass Gedächtnis, Bewusstsein, das Gefühl der eigenen Identität sowie die Wahrnehmung der eigenen Person bzw. der Umwelt getrennt erlebt werden, also desintegriert sind. Eine dissoziative Störung kann plötzlich und akut oder chronisch auftreten (Kämmerer 2001, S. 298). 12.2.1 Dissoziative Amnesie Bei einer dissoziativen Amnesie ist der/die Betroffene unfähig, sich an wichtige persönliche Informationen zu erinnern. Meist handelt es sich bei diesen Informationen um traumatische oder belastende Ereignisse im Leben der/des Betroffenen, die nicht verbalisiert werden können (Kämmerer 2001, S. 299). 12.2.2 Dissoziative Fugue Leitsymptom bei dieser Störung ist, dass die Betroffenen plötzlich und unerwartet von zu Hause und/oder vom gewohnten Arbeitsplatz weggehen. Die Betroffenen sind verwirrt über die eigene Identität oder nehmen eine andere Identität an. Dadurch ist es für die Erkrankten unmöglich, sich an die gesamte oder an Teile der Vergangenheit zu erinnern. Die dissoziative Fugue steht oft im Zusammenhang mit traumatischen Ereignissen, kann aber auch durch akute persönliche Belastungen oder depressive Episoden ausgelöst werden (Kämmerer 2001, S. 299). 12.2.3 Dissoziative Identitätsstörung Hauptmerkmal dieser Störung ist das Vorhandensein von zwei oder mehr unterscheidbaren Identitäten oder Persönlichkeitszuständen. Diese Identitäten übernehmen für einen bestimmten Zeitraum die Kontrolle über das Verhalten der/des Betroffenen. Die betroffene Person ist ebenso nicht in der Lage sich an wichtige persönliche Erfahrungen und Informationen zu erinnern. Diese Störung spiegelt die Unfähigkeit wider, die unterschiedlichen Aspekte der Identität, des Bewusstseins oder des Gedächtnisses zu integrieren. Stattdessen teilt sich die betroffene Person in 31 Teilpersonen, welche jede für sich eigene Gewohnheiten, Eigenarten und sogar Lebensgeschichten aufweisen. Personen, die an einer dissoziativen Identitätsstörung erkrankt sind, leiden häufig auch unter affektiven Störungen und Angststörungen (Kämmerer 2001, S. 300f). 12.2.4 Depersonalisationsstörung Leitsymptom dieser Störung ist, dass immer wiederkehrende Gefühle des Losgelöstseins vom eigenen Selbst bzw. der Entfremdung des eigenen Ichs auftreten. Der/die Betroffene hat das Gefühl, von außen auf die eigene Person und die eigenen geistigen Prozesse oder Verhaltensweisen zu blicken. Ebenso verursacht eine Depolarisationsstörung leidvolle Erfahrungen und Einschränkungen in Alltagsleben (Kämmerer 2001, S. 301). Epidemiologischen Daten zufolge leiden mehr Frauen als Männer unter somatoformen und dissoziativen Störungen. Niedriger sozioökonomischer Status, Kinderlosigkeit und belastende Ereignisse im Lebensverlauf ist vor allem für Frauen ein deutlicher Risikofaktor an einer dissoziativen oder somatoformen Störung zu erkranken. Für Männer sind vorwiegend traumatische Lebensereignisse, wie Kriegseinsätze, Risikomerkmale an jenen Störungen zu erkranken (Kämmerer 2001, S. 305). 32 13 Schlussfolgerung/Diskussion In der heutigen Gesellschaft finden sich vermehrt psychische Erkrankungen. Gründe dafür sind unter anderem Stress, traumatische Lebenserfahrungen sowie der Einfluss der Medien bezüglich Gewalt und Schönheitsidealen. Ebenso wird der Mensch zunehmend mit Ereignissen konfrontiert, welche die unterschiedlichsten Gefühle auslösen. Ereignisse, die der Mensch nicht wahrhaben will werden verschwiegen, verleugnet und/oder unterdrückt und nur soweit geäußert, wie der gesellschaftliche Rahmen dies akzeptiert. Wenn der innere Druck durch Verleugnen und/oder Verschweigen dann zu groß wird, kann die Psyche darunter leiden. Vor allem die gesellschaftlichen Anforderungen können zu einer psychischen Erkrankung führen. Als Beispiel ist das Schönheits- und Schlankheitsideal durch die Medien anzuführen. Vor einigen Jahren waren beispielsweise Essstörungen noch reine „Frauensache“, heutzutage sind schon viele Männer davon betroffen. Dasselbe gilt auch für Depressionen, an welchen früher fast nur Frauen erkrankten. Heute erkranken gleich viele Männer wie Frauen an einer Bipolar I Störung. Ebenso sind vermehrt sexuelle Störungen anzutreffen. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich das Vorhandensein einer sexuellen Störung nicht vermehrt hat, sondern dass in der heutigen Zeit die Sexualität kein Tabu-Thema mehr ist und relativ offen darüber gesprochen wird. Im Bezug auf posttraumatische Belastungsstörungen ist zu erwähnen, dass durch vermehrte Naturkatastrophen aber auch durch zerrüttete Familienverhältnisse eine solche Belastungsstörung nicht abwegig ist. Als präventive Maßnahme ist vor allem die Beseitigung der Magermodels in den Medien zu nennen. Da sie als Vorbilder für viele Jugendliche gelten stellen sie einen hohen Risikofaktor für die Entstehung einer Essstörung dar. Auch der Stellenwert der Sexualität sollte in der heutigen Zeit nicht mehr so hoch sein. Männer, aber auch Frauen, werden dadurch oft unter Druck gesetzt und dadurch können beispielsweise Erektionsstörungen und/oder Lustlosigkeit entstehen. 33 Literaturverzeichnis Dulz, B, Herpertz, S, Kernberg, O & Sachsse, U 2011, Handbuch der Borderline-Störungen, 2. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, Schattauer GmbH, Stuttgart. Franke, A & Kämmerer, A 2001, Klinische Psychologie der Frau. Ein Lehrbuch, Hogrefe Verlag, Göttingen. Fischer, G 2005, Warum Frauen gesunder leben und Männer früher sterben, Beltz Verlag, Weinheim und Basel. Gerrig, R & Zimbardo, P 2008, Psychologie, 18. aktualisierte Auflage, Pearson Studium, München. Heinemann, E & Hopf, H 2008 Psychische Störungen in Kindheit und Jugend; SymptomePsychodynamik-Fallbeispiele-psychoanalytische Therapie, 3. Überarbeitete Auflage, Kohlhammer GmbH, Stuttgart. Kersting, A ´Essstörungen´ in: Marneros, A & Rohde, A 2007, Geschlechtsspezifische Psychiatrie und Psychotherapie. Ein Handbuch, W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart. Kühner, R ´Affektive Störungen´ in: Franke A, & Kämmerer, A 2001 Klinische Psychologie der Frau. Ein Lehrbuch, Hogrefe Verlag, Göttingen. Krause, W Weidner, W Sperling, H & Diemer, T 2011 Andrologie – Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane, 4. Auflage, Thieme Verlag KG, Stuttgart. 34 Kryspin-Exner, I ´Klinische Psychologie´ in: Deimann, P & Kastner-Koller, U 2007 Psychologie als Wissenschaft, 2. aktualisierte Auflage, Facultas Verlags- und Buchhandels AG, Wien. Rädler, T & Naber, D 2007 ´Schizophrenie´ in: Marneros, A & Rohde, A 2007, Geschlechtsspezifische Psychiatrie und Psychotherapie. Ein Handbuch, W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart. Renneberg, B ´Borderline-Persönlichkeitsstörung´ in: Franke A, & Kämmerer, A 2001 Klinische Psychologie der Frau. Ein Lehrbuch, Hogrefe Verlag, Göttingen. Rohde, A & Riecher-Rössler, A 2001, Psychische Erkrankungen bei Frauen, S. Karger GmbH, Freiburg. Schmitt, R ´Schizophrenie und postpartale Psychose´ in: Franke A, & Kämmerer, A 2001 Klinische Psychologie der Frau. Ein Lehrbuch, Hogrefe Verlag, Göttingen. Sigusch, V 2007, Sexuelle Störungen und ihre Behandlung, 4. überarbeitete und erweiterte Auflage, Thieme Verlag KG, Stuttgart. Teegen, F ´Traumatische Gewalterfahrungen und posttraumatische Belastungsstörungen´ in: Franke A, & Kämmerer, A 2001 Klinische Psychologie der Frau. Ein Lehrbuch, Hogrefe Verlag, Göttingen. Volgger, A 2011, Die posttraumatische Belastungsstörung – Probleme bei der Diagnostik. Diplomarbeit, Grin Verlag, Norderstedt. 35