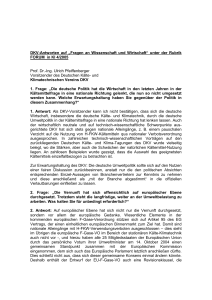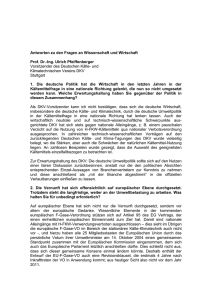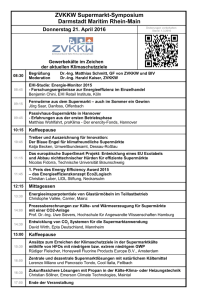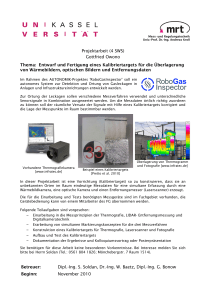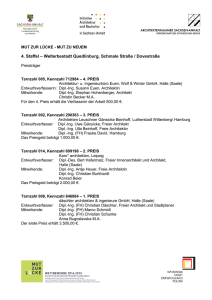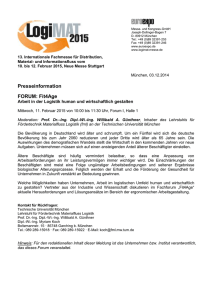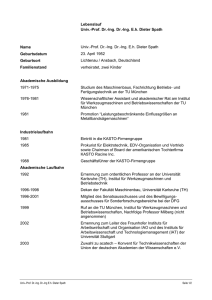Potenziale der Kälte-, Klima- und Wärmepumpentechnik für die (Ab
Werbung

Potenziale der Kälte-, Klima- und Wärmepumpentechnik für die (Ab)Wärmeerzeugung Prof. Dr.-Ing. Michael Arnemann Deutscher Kälte- und Klimatechnischer Verein e. V. (DKV) 4. März 2015 Berlin 1 Prof. Dr.-Ing. Michael Arnemann Gliederung • Funktion einer Wärme pumpende Anlage • Bedeutung der Kälte-, Klima- und Wärmepumpentechnik • Potenziale • Fazit 4. März 2015 Berlin 2 Prof. Dr.-Ing. Michael Arnemann Wirkungsweise einer Kälteanlage Wärmesenken-Temperatur Umgebungstemperatur Wärmestrom an eine Umgebung Konvektiver Wärmestrom Kälteanlage Antriebsleistung Strahlung Wärmestrom aus Kühlraum Wärmeerzeugung Nutz-Temperatur Temperaturniveau 4. März 2015 Berlin Wärmequellen-Temperatur 3 Prof. Dr.-Ing. Michael Arnemann Effizienz eines idealen Kälteerzeugungsprozesses 20 18 Beispiel COPC = TN / (TU - TN) ε Kideal = 40°C °C 40 10 °CHeizraumtemperatur -10 °C 30 °C Umgebungsbzw. 𝑡𝑡U ∆T = 20 K 16 theoretischer Effizienzgrad Effizienz 20 20°C °C 0 °C tU = -20 °C 14 12 TN 10 TU − TN 8 ∆T = 40 K 6 4 erhöhte Wärmesenkentemperatur führt zu kleinerer Effizienz 2 0 -60 ideal ε= ε Kideal + 1 W 4. März 2015 Berlin -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 tN in °C Kühlraum- bzw. Nutztemperatur 𝑡𝑡N in °C 4 30 40 Prof. Dr.-Ing. Michael Arnemann Effizienz eines idealen Kälteerzeugungsprozesses 20 18 Beispiel COPC = TN / (TU - TN) ε Kideal = 40 °C 10 °CHeizraumtemperatur -10 °C 30 °C Umgebungsbzw. 𝑡𝑡U ∆T = 20 K 16 theoretischer Effizienzgrad 20 20°C °C 0 °C tU = -20 °C 14 12 TN 10 TU − TN 8 ∆T = 40 K 6 4 höhere Wärmequellentemperatur führt zu höherer Effizienz 2 0 -60 ideal ε= ε Kideal + 1 W 4. März 2015 Berlin -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 tN in °C Kühlraum- bzw. Nutztemperatur 𝑡𝑡N in °C 5 30 40 Prof. Dr.-Ing. Michael Arnemann Funktion einer Wärme pumpenden Anlage Energieströme Kälteanlage E Q Umgebungstemperatur potenzielle Heizleistung Wärme pumpende Anlage Antriebsleistung Temperaturniveau Wärmequelle A Temperaturniveau 4. März 2015 Berlin Temperaturniveau Wärmesenke Kälteleistung 6 Prof. Dr.-Ing. Michael Arnemann Funktion einer Wärme pumpenden Anlage Erhöhung der Temperatur Heizleistung Wärme pumpende Anlage Antriebsleistung Temperaturniveau Wärmequelle A Temperaturniveau 4. März 2015 Berlin Temperaturniveau Wärmesenke Kälteleistung 7 Prof. Dr.-Ing. Michael Arnemann Funktion einer Wärme pumpenden Anlage Erhöhung der Heizleistung Heizleistung Antriebsleistung Heizleistung Wärme pumpende Anlage Temperaturniveau Wärmesenke Antriebsleistung Temperaturniveau Wärmequelle B aufgenommener Wärmestrom Temperaturniveau Wärmequelle A Temperaturniveau 4. März 2015 Berlin Kälteleistung 8 Prof. Dr.-Ing. Michael Arnemann Leistungen und Temperatur-Niveaus 𝑄𝑄̇ cu + 𝑄𝑄̇ cc 6 4 T 𝑄𝑄̇ ch 2 4 2 To 𝑃𝑃 7 5 Tc 6 1 7 Tmax THR TU TKR 8 1 𝑄𝑄̇ o 0 s 110906ar-27 4. März 2015 Berlin 9 Prof. Dr.-Ing. Michael Arnemann Leistungen und Temperatur-Niveaus 3a 𝑄𝑄̇ cc 𝑄𝑄̇ ch 3‘‘ 2 1 qiWT lg p 𝑃𝑃 3 4 qcc 3a Tc 3' To qo 3 𝑄𝑄̇ iWT 1a 4 20100514ar-04c 𝑄𝑄̇ o 4. März 2015 Berlin 10 qch 2 3'' 1a 1 qiWT wt h Prof. Dr.-Ing. Michael Arnemann VDMA 24019 - Entwurf Abwärmenutzung von Kälteanlagen 1 2 3 4 5 Anwendungsbereich Normative Verweisungen Begriffe Ziele und Motivation Einführung 8 Wärmeträger-Kreislauf 8.1 Enthitzungswärme und konditionierte Abwärme für eine Nutztemperatur 8.2 Enthitzungswärme und konditionierte Abwärme für zwei Nutztemperaturen 6 Abwärmenutzung 9 7 7.1 7.2 7.3 Möglichkeiten der Abwärmenutzung Passive Abwärmenutzung Konditionierte Abwärmenutzung Konditionierte Abwärme mit externer Wärmequelle 4. März 2015 Berlin Abwärmenutzung mit „aufgesetzter Wärmepumpe“ 9.1 Vergrößerung Abwärmestrom 9.2 Reduzierung Abwärmestrom 10 Zusammenfassung Anhang A Formelverzeichnis Anhang B Beispiele für konditionierte Abwärme 11 Prof. Dr.-Ing. Michael Arnemann Beispiel aus VDMA 24019 - Entwurf Abwärmenutzung von Kälteanlagen Zweistufige Kälteanlage, durch eine externe Wärmequelle erweitert, um die Abwärmeleistung zu vergrößern. • Der Zwischendruck wird durch die Saugvolumen-ströme der ND- und HDVerdichter beeinflusst. • Die Verdichtergrößen sind so auszuwählen, dass der Zwischendruck zur Temperatur der externen Wärmequelle passt. [VDMA 24019 – Entwurf, Bild 7] 4. März 2015 Berlin Anmerkung: • Wenn die Verdichter keine Leistungsregelung haben, stehen aufgenommener externer Wärmestrom, deren Temperatur und der Zwischendruck in einer Wechselwirkung. Der ND-Kältekreislauf wird davon beeinflusst. 12 Prof. Dr.-Ing. Michael Arnemann Gliederung • Funktion einer Wärme pumpende Anlage • Bedeutung der Kälte-, Klima- und Wärmepumpentechnik • Potentiale • Fazit 4. März 2015 Berlin 13 Prof. Dr.-Ing. Michael Arnemann Energiebedarf für die technische Erzeugung von Kälte, Statusbericht 22, DKV 2002; Kältetechnologien Deutschland, Studie Hochschule Karlsruhe, 2013 Anzahlen von Kälte-, Klimaund Wärmepumpenanlagen in Deutschland, 2010 Haushaltskältegeräte 61,2 % mobile Raumklimageräte Σ ≈ 110 - 120 Mio. 1,0 % 2,2 % 1,9 % 0,7 % Kälte- und Klimaanlagen in Gewerbe und Industrie steckerfertige Gewerbekühlgeräte Wärmepumpen 33,0 % 4. März 2015 Berlin Fahrzeug-Klima- und -Kühlanlagen 14 Prof. Dr.-Ing. Michael Arnemann Anzahl nicht-steckerfertiger Anlagen Zahlenquelle: VDMA: Branchenbericht. Deutscher Markt für Kältetechnik 2009, Bestand an Kältesystemen in Deutschland nach Einsatzgebieten Marktvolumen für kältetechnische Anwendungen, Frankfurt am Main, 15.12.2009 Bild: Hannover 21.11.2013 15 Elektroenergieverbrauch (TWh) Nationaler Elektroenergieverbrauch der Kälte-, Klima- und Wärmepumpentechnik Σ = 83,2 +24 % 10,7 +131 % Σ = 66,9 7,0 3,0 4,6 5,1 0,7 6,8 10,3 3,1 1,6 17,1 6,3 DKV 2002 (1999) -29 % 7,8 +24 % 22,7 18,6 Klima: Industrie +306 % Wärmepumpen +51 % Industriekälte +98 % Sonstige Kälte +38 % 12,2 6,4 6,0 Klima: GHD, Sonst. Lebensmittelindustrie Lebensmittelhandel +7 % Gewerbekälte +22 % Haushaltskälte HsKA 2013 (2010) Daten aus: Arnemann et al. : Kältetechnologien in Deutschland, Studie, Hochschule Karlsruhe, gefördert im Rahmen der Klimaschutzinitiative der Bundesregierung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Projetträger Jülich2013, Bild IceTeX 4. März 2015 Berlin 16 Prof. Dr.-Ing. Michael Arnemann Elektroenergieverbrauch, Netto, D (TWh) Nationaler Elektroenergieverbrauch 1999 - 2010 500 400 300 200 Anstieg Elektroenergieverbrauch 1999 - 2010 alle sonstigen Elektroenergieverbraucher +24 % 84 % +8 % 100 Kälte, Klima Wärmepumpen 0 1999 Sonstige 16 % 2010 Kälte, Klima, WP 2050 Monitoring‐Bericht "Energie der Zukunft", 4.4.2014, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie; Kältetechnologien Deutschland, Studie Hochschule Karlsruhe, 2013 4. März 2015 Berlin 17 Prof. Dr.-Ing. Michael Arnemann Entwicklung der nationalen Treibhausgase‐Emissionen Anteil der Kälte‐, Klima‐ und Wärmepumpenanlagen im Jahr 2010 [Studie der Hochschule Karlsruhe, 2013] Bild: 4. März 2015 Berlin 18 Prof. Dr.-Ing. Michael Arnemann Gliederung • Funktion einer Wärme pumpende Anlage • Bedeutung der Kälte-, Klima- und Wärmepumpentechnik • Potenziale • Fazit 4. März 2015 Berlin 19 Prof. Dr.-Ing. Michael Arnemann Endenergieverbrauch Deutschland 2012 nach Anwendungen Endenergieverbrauch Deutschland, 2012 Daten: BMWi 2014, DKV 2014 (Kälte) 2499 TWh 4. März 2015 Berlin 3,5 % Kälte 28,2 % Verkehr 2,3 % 3,4 % IuK-Technik Beleuchtung 55,2 % Wärme 7,3 % 21,4 % Prozesswärme 5,2 % Warmwasser 28,6 % mech. Energie Raumwärme 20 Prof. Dr.-Ing. Michael Arnemann Potenzial Abwärme Kälte/Klima ≈ 800 TWh thermisch 31 % ≈ 250 TWh thermisch Energiebedarf zur Raumheizung in D Abwärme aus Kälte- u. Klimaanlagen (D, 2010) (≈ 2900 PJ) (≈ 900 PJ) Vergleichende Betrachtung, zur Beurteilung der Größenordnungen. In dieser einfachen Betrachtung fehlt jedoch die wichtige Bewertung des Temperaturniveaus. 4. März 2015 Berlin 21 Prof. Dr.-Ing. Michael Arnemann Raumwärmebedarf und Potenziale der Kälte-, Klimatechnik in 2010 Energie in PJ 2000 1 Mrd kWh = 1 TWh = 3,6 PJ 1500 1000 Raumwärme 500 Potenzial 0 Industrie GHD Haushalte Quellen: zu Raumwärme: AGEB : Anwendungsbilanzen für die Endenergiesektoren in Deutschland in den Jahren 2011 und 2012 mit Zeitreihen von 2008 bis 2012, 2013-08 zu Potenzialen: M. Arnemann: KSI - Kältetechnologien in Deutschland, Hochschule Karlsruhe, 2013 4. März 2015 Berlin 22 Prof. Dr.-Ing. Michael Arnemann Theoretische Abwärmen der Kälte- und Klimatechnik Theoretische Abwärme (TWh) 300 300 business as usual Effizienz + Suffizienz 250 250 200 200 Klimaanlagen Klimaanlagen 150 150 100 50 100 Industriekälte 50 Supermarktkälte Gewerbekälte 0 1998 2004 2010 2016 2022 Industriekälte Supermarktkälte Gewerbekälte 0 1998 2004 2010 2016 2022 Energiebedarf für die technische Erzeugung von Kälte, Statusbericht 22, DKV 2002; Kältetechnologien Deutschland, Studie Hochschule Karlsruhe, 2013 4. März 2015 Berlin 23 Prof. Dr.-Ing. Michael Arnemann Fakultät Maschinenwesen Institut für Energietechnik, Bitzer-Stiftungsprofessur für Kälte-, Kryo- und Kompressorentechnik Energiespeicher – Kältetechnik / Wärmepumpe Motivation/Chancen: • Einfacher Energiespeicher • Bekannte Technologien Speicher • Dezentralisierung möglich Verbraucher • umweltfreundlich Technik: Kälte- / WP-Anlage • Kalt- / Warmwasserspeicher • PCM (Eis, Paraffin, PE, .. Verbraucher Speicher • Feststoff • Chemisch •… 2 Potentiale für thermische Energiespeicher 25. Mai 2012 [DKV IZW, Darmstadt, Prof. Dr. U. Hesse, Speicher, 2014] Speicherung zur Unterstützung (der Netze) bei Produktions- und Bedarfsspitzen Motivation für „Energiespeicher“ der Kälte-Klimatechnik: Kühl- und Tiefkühlhäuser Gebäudeklimatisierung − Vorhanden Einfacher Energiespeicher − Bekannte Technologien − Dezentralisierung möglich − Umweltfreundlichkeit Kalte Nahwärmesysteme WP Gebäudeheizung WP Warmwasser WP Wäschetrockner „SG Ready“ Produkte und Systeme Eisspeicher 4. März 2015 Berlin 25 Prof. Dr.-Ing. Michael Arnemann Gliederung • Funktion einer Wärme pumpende Anlage • Bedeutung der Kälte-, Klima- und Wärmepumpentechnik • Potenziale • Fazit 4. März 2015 Berlin 26 Prof. Dr.-Ing. Michael Arnemann Fazit Kälte-Klima-Wärmepumpen-Technik kann sinnvolle Abwärmenutzung anbieten kann im Gebäude Produktion und Verbrauch sinnvoll verbinden vorteilhafte Kombinationen thermisch und elektrisch angetriebener Systeme möglich installierte Systeme können als Speicher dienen Systeme müssen nur „smart“ ins Netz eingebunden werden kann „kalte“ Nahwärmenetze sinnvoll nutzen z. B. für dezentrale Wärmeversorgung ist ideale Ergänzung zur dezentralen Stromerzeugung (KWK) Weitere Forschung und Entwicklungen notwendig 4. März 2015 Berlin 27 Prof. Dr.-Ing. Michael Arnemann Gute Aussichten, für die Kälte-, Klima- und Wärmepumpentechnik! 2014-12-30 Arnemann Prof. Dr.-Ing. Michael Arnemann Deutscher Kälte- und Klimatechnischer Verein (DKV) e.V. Striehlstraße 11 30159 Hannover Prof. Dr.-Ing. Michael Arnemann Institut für Kälte-, Klima- und Umwelttechnik Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft Moltkestraße 30 76133 Karlsruhe T: +49(0) 511 897 0814 [email protected] www.dkv.org 4. März 2015 T: +49(0) 721 925 1914 [email protected] www.hs-karlsruhe.de Berlin 28 Prof. Dr.-Ing. Michael Arnemann