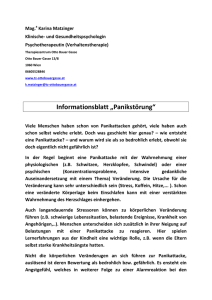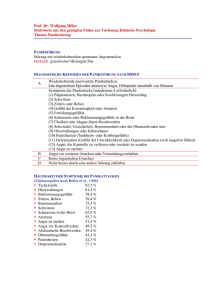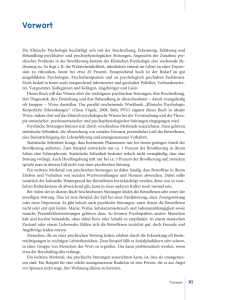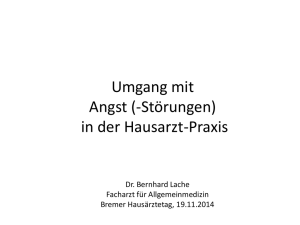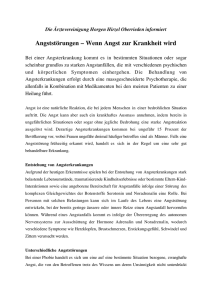Für weitere Informationen zum Thema Panikstörung klicken sie hier!
Werbung
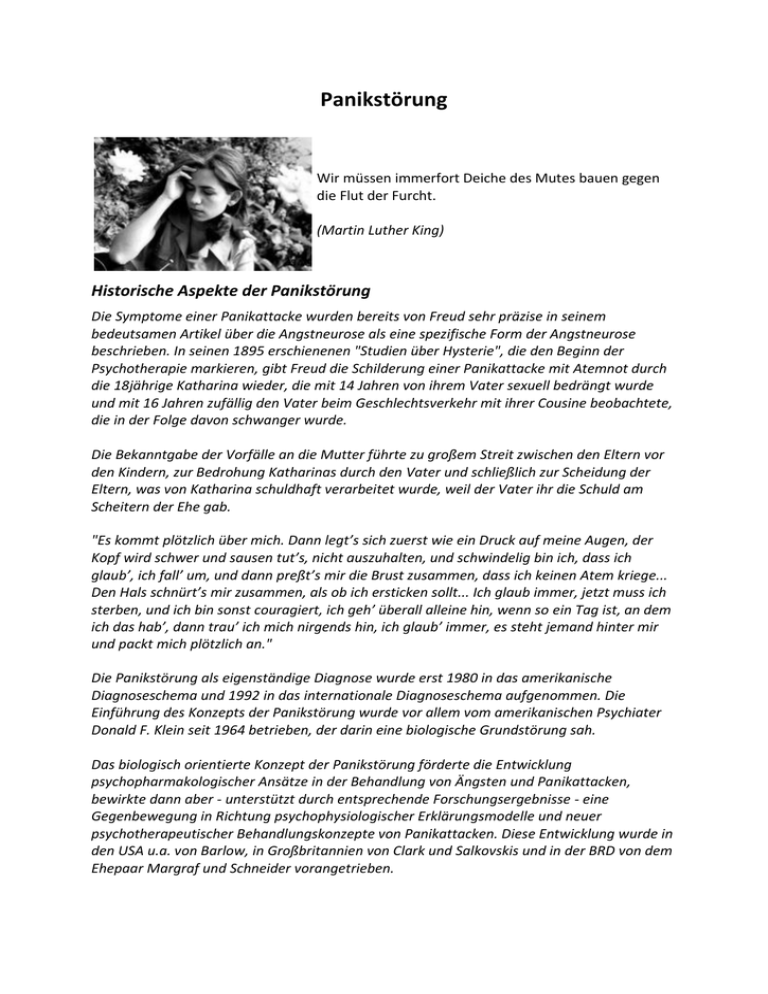
Panikstörung Wir müssen immerfort Deiche des Mutes bauen gegen die Flut der Furcht. (Martin Luther King) Historische Aspekte der Panikstörung Die Symptome einer Panikattacke wurden bereits von Freud sehr präzise in seinem bedeutsamen Artikel über die Angstneurose als eine spezifische Form der Angstneurose beschrieben. In seinen 1895 erschienenen "Studien über Hysterie", die den Beginn der Psychotherapie markieren, gibt Freud die Schilderung einer Panikattacke mit Atemnot durch die 18jährige Katharina wieder, die mit 14 Jahren von ihrem Vater sexuell bedrängt wurde und mit 16 Jahren zufällig den Vater beim Geschlechtsverkehr mit ihrer Cousine beobachtete, die in der Folge davon schwanger wurde. Die Bekanntgabe der Vorfälle an die Mutter führte zu großem Streit zwischen den Eltern vor den Kindern, zur Bedrohung Katharinas durch den Vater und schließlich zur Scheidung der Eltern, was von Katharina schuldhaft verarbeitet wurde, weil der Vater ihr die Schuld am Scheitern der Ehe gab. "Es kommt plötzlich über mich. Dann legt’s sich zuerst wie ein Druck auf meine Augen, der Kopf wird schwer und sausen tut’s, nicht auszuhalten, und schwindelig bin ich, dass ich glaub’, ich fall’ um, und dann preßt’s mir die Brust zusammen, dass ich keinen Atem kriege... Den Hals schnürt’s mir zusammen, als ob ich ersticken sollt... Ich glaub immer, jetzt muss ich sterben, und ich bin sonst couragiert, ich geh’ überall alleine hin, wenn so ein Tag ist, an dem ich das hab’, dann trau’ ich mich nirgends hin, ich glaub’ immer, es steht jemand hinter mir und packt mich plötzlich an." Die Panikstörung als eigenständige Diagnose wurde erst 1980 in das amerikanische Diagnoseschema und 1992 in das internationale Diagnoseschema aufgenommen. Die Einführung des Konzepts der Panikstörung wurde vor allem vom amerikanischen Psychiater Donald F. Klein seit 1964 betrieben, der darin eine biologische Grundstörung sah. Das biologisch orientierte Konzept der Panikstörung förderte die Entwicklung psychopharmakologischer Ansätze in der Behandlung von Ängsten und Panikattacken, bewirkte dann aber - unterstützt durch entsprechende Forschungsergebnisse - eine Gegenbewegung in Richtung psychophysiologischer Erklärungsmodelle und neuer psychotherapeutischer Behandlungskonzepte von Panikattacken. Diese Entwicklung wurde in den USA u.a. von Barlow, in Großbritannien von Clark und Salkovskis und in der BRD von dem Ehepaar Margraf und Schneider vorangetrieben. Symptomatik der Panikstörung Eine Panikattacke wird oft in folgenden oder ähnlichen Worten geschildert: "Mir wird plötzlich ganz schwindlig und übel. Meine Hände werden taub, im linken Arm entsteht ein eigenartiges Kribbelgefühl, meine Knie werden ganz weich. Ich habe Angst, umzufallen und ohnmächtig zu werden, dann dazuliegen, und niemand kommt mir zu Hilfe. Mein Herz beginnt zu rasen, ich spüre einen Druck auf der Brust und fürchte, dass ich einen Herzinfarkt bekomme und sterben muss. Mir wird ganz heiß, ich bekomme Hitzewallungen, das Blut steigt von unten nach oben. Ich beginne zu schwitzen, auf einmal überfällt mich ein Kälteschauer am ganzen Körper. Ich beginne zu zittern, am liebsten würde ich davonlaufen, aber ich fühle mich wie gelähmt. Meine Kehle schnürt sich zusammen, dass ich keine Luft mehr bekomme. Ich ringe um Luft, aber es reicht nicht, ich atme noch mehr und spüre, wie der Druck in meinem Brustkorb ansteigt. Ich bin dann gar nicht mehr richtig da und glaube, gleich überzuschnappen und verrückt zu werden. Alles erscheint so unwirklich. Wenn ich das Ganze überlebe, glaube ich, dass ich in die Psychiatrie komme. Die Panikattacke dauert etwa eine Viertelstunde. Wenn ich in dieser Zeit auf meine beiden kleinen Kinder aufpassen muss, denke ich, wer wird sich um die Kinder kümmern, wenn mir etwas passiert. Wenn mein Mann in der Nähe ist, beruhige ich mich schneller, als wenn ich allein bin. Das Erlebnis einer Panikattacke ist so belastend, dass ich manchmal noch immer nicht sicher bin, ob ich nicht doch eine körperliche Erkrankung habe, deren Ursache die Ärzte bisher nicht gefunden haben." Eine Panikattacke ist eine abgrenzbare Periode intensiver Angst und starken Unbehagens und besteht aus mehreren, plötzlich und unerwartet ("wie aus heiterem Himmel"), scheinbar ohne Ursachen in objektiv ungefährlichen Situationen auftretenden somatischen und kognitiven Symptomen von subjektiv oft lebensbedrohlichem Charakter. Eine Panikattacke als einzelne Episode von intensiver Angst oder Unbehagen beginnt abrupt, d.h. nicht vorhersagbar, erreicht innerhalb von einigen Minuten ein Maximum und dauert mindestens einige Minuten an (nach Forschungsergebnissen durchschnittlich eine knappe halbe Stunde). Eine Panikstörung besteht aus wiederholten, spontan und unerwartet auftretenden Panikattacken. Die Panikattacken sind nicht auf spezifische Situationen oder besondere Umstände bezogen, stehen in keinem Zusammenhang mit besonderen Anstrengungen, gefährlichen oder lebensbedrohlichen Situationen und sind auch nicht durch eine körperliche oder eine andere psychische Störung bedingt. Nach den Forschungskriterien des ICD-10 - des internationalen Diagnoseschemas der Weltgesundheitsorganisation (WHO) - treten bei einer Panikattacke mindestens 4 von 14 körperlichen und psychischen Symptomen auf (davon muss eines aus den ersten vier Symptomen der folgenden Liste stammen): Vegetative Symptome: 1. Herzrasen, Herzklopfen oder erhöhte Herzfrequenz, 2. Schweißausbrüche, 3. fein- oder grobschlägiges Zittern (Tremor), 4. Mundtrockenheit (nicht als Folge von Medikamenten oder Austrocknung). Symptome, die den Brustkorb oder den Bauch betreffen: 5. Atembeschwerden, 6. Beklemmungsgefühl, 7. Schmerzen und Missempfindungen in der Brust, 8. Übelkeit oder Missempfindungen im Magen. Psychische Symptome: 9. Schwindel, Unsicherheit, Schwäche oder Benommenheit, 10. Entfremdungsgefühl gegenüber der eigenen Person (Depersonalisation) oder Gefühl der Unwirklichkeit der Umwelt (Derealisation), 11. Angst die Kontrolle zu verlieren, verrückt zu werden oder "auszuflippen", 12. Angst zu sterben (die auftretenden Symptome lösen Todesangst aus). Allgemeine Symptome: 13. Hitzegefühle oder Kälteschauer, 14. Gefühllosigkeit oder Kribbelgefühle. Die Furcht vor einer weiteren, sehr bedrohlich und nicht kontrollierbar erscheinenden Panikattacke führt oft zu einer ausgeprägten Erwartungsangst, die das ganze Leben negativ beeinflusst. Als Folge davon entwickelt sich häufig eine "Platzangst" (Agoraphobie) mit einer massiven Einschränkung des Bewegungsspielraumes. Bei einer Panikstörung stehen die körperlichen Symptome – zumindest anfangs – derart im Vordergrund, dass viele Betroffene nicht den Eindruck haben, unter einer Angststörung, sondern unter einer unbekannten körperlichen Störung zu leiden. Das amerikanische psychiatrische Diagnoseschema DSM-IV erstellt folgende diagnostische Kriterien für eine Panikattacke: Eine klar abgrenzbare Episode intensiver Angst und Unbehagens, bei der mindestens 4 der nachfolgend genannten Symptome abrupt auftreten und innerhalb von 10 Minuten einen Höhepunkt erreichen: Herzstolpern, Herzklopfen oder beschleunigter Herzschlag, Schwitzen, Zittern oder Beben, Gefühl der Kurzatmigkeit oder Atemnot, Erstickungsgefühle, Schmerzen oder Beklemmungsgefühle in der Brust, Übelkeit oder Magen-Darm-Beschwerden Schwindel, Unsicherheit, Benommenheit oder der Ohnmacht nahe sein, Derealisation (Gefühl der Unwirklichkeit) oder Depersonalisation (sich losgelöst fühlen), Angst, die Kontrolle zu verlieren oder verrückt zu werden, Angst zu sterben, Parästhesien (Taubheit oder Kribbelgefühle), Hitzewallungen oder Kälteschauer. Die einzelnen Anfälle beginnen gewöhnlich ganz plötzlich, steigern sich innerhalb von Minuten zu einem Höhepunkt und werden trotz der eher kurzen Dauer von den Patienten sehr unangenehm und stark bedrohlich erlebt wegen der Intensität und Plötzlichkeit des Auftretens der vegetativen Symptome. Zwischen den Attacken liegen (in Abgrenzung zur generalisierten Angststörung) weitgehend angstfreie Zeiträume (Erwartungsangst ist jedoch häufig). Schwere, Häufigkeit und Verlauf der Störung können sehr unterschiedlich sein. Panikattacken dauern meistens nur einen kurzen Zeitraum (einige Minuten bis zu einer halben Stunde), manchmal auch länger (einige Stunden), sind dann aber nicht mehr so ausgeprägt. Laut Studien dauern Panikattacken durchschnittlich eine knappe halbe Stunde. Wenn Panikattacken länger als 30 Minuten anhalten, ist dies oft durch den Versuch bedingt, sie zu unterdrücken, zu stoppen oder zu analysieren, wodurch die Anspannung aufrechterhalten wird. Die Angst vor einer weiteren, unkontrollierbar erscheinenden Panikattacke führt rasch zu einer starken Erwartungsangst. Drei Symptome treten bei Panikattacken besonders häufig auf: Herzklopfen/-rasen, Schwindel/Benommenheit, Atemnot. Die Todesangst und die Angst, die Kontrolle zu verlieren oder verrückt zu werden, sind häufige psychische Reaktionsweisen auf die bedrohlichen körperlichen Symptome und angstmachenden Erfahrungen der Entfremdung (Depersonalisation und Derealisation). Bei unerwarteten Panikattacken zeigen sich häufiger die Symptome Angst zu sterben, verrückt zu werden oder die Kontrolle zu verlieren, und Missempfindungen wie Kribbeln oder Taubheitsgefühle als bei situativ ausgelösten Panikattacken. Diese Symptome sowie Atemnot, Schwindel-, Schwäche- und Unwirklichkeitsgefühle werden mehr von Menschen mit Panikattacken als von Personen mit anderen Angststörungen berichtet. Nach der Häufigkeit der Symptome (mindestens 4 oder weniger Symptome) unterscheidet man zwischen vollständigen und unvollständigen Panikattacken. Menschen mit unvollständiger Symptomatik hatten früher oft vollständige Panikattacken. Eine Panikattacke allein ist nach dem DSM-IV keine codierbare Störung. Codiert wird die Störung, innerhalb der die Panikattacken auftreten: Panikstörung ohne Agoraphobie oder Panikstörung mit Agoraphobie. Das DSM-IV unterscheidet nach dem Kontext des Auftretens drei Arten von Panikattacken: 1. Unerwartete (nicht ausgelöste) Panikattacken. Das Eintreten der Panikattacken hängt nicht von situativen Auslösern ab, sondern erfolgt spontan ("wie aus heiterem Himmel"). Diese Anfälle sind zur Diagnose einer Panikstörung erforderlich. 2. Situationsgebundene (ausgelöste) Panikattacken. Das Auftreten der Panikattacken erfolgt fast immer bei einer Konfrontation mit dem situativen Reiz oder Auslöser oder dessen Vorstellung (z.B. bestimmte Verkehrsmittel, Tiere, Menschen, soziale Situationen). Derartige Panikattacken sind charakteristisch für soziale und spezifische Phobien und zeigen den Schweregrad der entsprechenden Phobie an. 3. Situationsbegünstigte Panikattacken. Das Auftreten wird durch phobische Objekte oder Situationen zwar begünstigt, aber nicht sofort nach der Konfrontation ausgelöst (z.B. Panikattacken beim Autofahren erst nach längerer Zeit oder nur selten). Unter einer Panikstörung versteht man das wiederholte, unerwartete Auftreten von Panikattacken. Das ICD-10 fordert für die Diagnose einer Panikstörung innerhalb eines Zeitraums von etwa einem Monat mehrere schwere Angstattacken, die sich nicht auf eine spezifische Situation oder besondere Umstände beschränken und deshalb auch nicht vorhersagbar sind. Eine Panikstörung liegt auch dann vor, wenn nur ganz wenige Panikattacken spontan auftreten, die Person aber anhaltend von heftiger Sorge vor weiteren Anfällen geplagt wird (Angst vor der Angst) und bestimmte Situationen nur mit starkem Unbehagen ertragen kann. Das DSM-IV folgende diagnostische Kriterien für eine Panikstörung ohne Agoraphobie (für eine Panikstörung mit Agoraphobie gelten mit Ausnahme von B dieselben Kriterien): A. Sowohl (1) als auch (2): (1) wiederkehrende unerwartete Panikattacken... (2) bei mindestens einer der Attacken folgte mindestens ein Monat mit mindestens einem der nachfolgend genannten Symptome: a) anhaltende Besorgnis über das Auftreten weiterer Panikattacken, b) Sorgen über die Bedeutung der Attacke oder ihre Konsequenzen (z.B. die Kontrolle zu verlieren, einen Herzinfarkt zu erleiden, verrückt zu werden), c) deutliche Verhaltensänderungen infolge der Attacken. B. Es liegt keine Agoraphobie vor... Nach den Forschungskriterien des ICD-10, dem international gültigen Diagnoseschema der Weltgesundheitsorganisation (WHO), ist eine Panikstörung (F41.0) durch folgende Merkmale charakterisiert: A. Wiederholte Panikattacken, die nicht auf eine spezifische Situation oder ein spezifisches Objekt bezogen sind und oft spontan auftreten (d.h. die Attacken sind nicht vorhersagbar). Die Panikattacken sind nicht verbunden mit besonderer Anstrengung, gefährlichen oder lebensbedrohlichen Situationen. B. Eine Panikattacke hat alle folgenden Charakteristika: a. Es ist eine einzelne Episode von intensiver Angst oder Unbehagen b. sie beginnt abrupt c. sie erreicht innerhalb von Minuten ein Maximum und dauert mindestens einige Minuten d. Mindestes vier Symptome der unten angegebenen Liste, davon eins von den Symptomen 1. bis 4. müssen vorliegen Vegetative Symptome: 1. Palpitationen, Herzklopfen oder erhöhte Herzfrequenz 2. Schweißausbrüche 3. fein- oder grobschlägiger Tremor 4. Mundtrockenheit (nicht infolge Medikation oder Exsikkose) Symptome, die Thorax und Abdomen betreffen: 5. Atembeschwerden 6. Beklemmungsgefühl 7. Thoraxschmerzen oder -mißempfindungen 8. Nausea oder abdominelle Mißempfindungen (z.B. Unruhegefühl im Magen) Psychische Symptome:9. Gefühl von Schwindel, Unsicherheit, Schwäche oder Benommenheit 10. Gefühl, die Objekte sind unwirklich (Derealisation) oder man selbst ist weit entfernt oder "nicht wirklich hier" (Depersonalisation) 11. Angst vor Kontrollverlust, verrückt zu werden oder "auszuflippen" 12. Angst zu streben Allgemeine Symptome: 13. Hitzewallungen oder Kälteschauer 14. Gefühllosigkeit oder Kribbelgefühle C. Häufigstes Ausschlusskriterium: Die Panikattacken sind nicht Folge einer körperlichen Störung, einer organischen psychischen Störung (F0) oder einer anderen psychischen Störung wie Schizophrenie und verwandten Störungen (F2), einer affektiven Störung (F3) oder einer somatoformen Störung (F45). Die Diagnose einer Panikstörung soll nach übereinstimmender Aussage des ICD-10 und des DSM-IV nur dann gestellt werden, wenn die Panikattacken unerwartet auftreten, d.h. nicht auf Situationen begrenzt sind, in denen objektive Gefahr besteht oder die bekannt sind oder vorhersehbar Angst auslösen (z.B. im Rahmen einer Phobie). Menschen mit einer Panikstörung haben neben unerwarteten (spontanen, nicht ausgelösten) Panikattacken oft auch situationsgebundene und/oder situationsbegünstigte Panikattacken (letztere in häufigerem Ausmaß). Situationsgebundene Panikattacken zeigen dasselbe Erscheinungsbild wie spontane Angstanfälle. Panikattacken können nach dem DSM-IV nicht nur bei anderen Angststörungen, sondern auch bei anderen psychischen Störungen (z.B. Depressionen), körperlichen Erkrankungen oder Substanzmissbrauch auftreten. Panikattacken können als Zusatzkategorie zu den verschiedensten psychischen Störungen angeführt werden. Dies bedeutet eine Abkehr von der früheren amerikanischen Diagnostik, wonach spontane und unerwartete Panikattacken implizit als endogenes Geschehen angesehen wurden. Die erste Panikattacke stellt meist ein so intensives, existentiell bedrohliches und traumarisierendes Erlebnis dar, dass aufgrund der Erwartungsangst ein umfangreiches Vermeidungsverhalten entsteht. Sie tritt meistens außer Haus auf, weshalb sich oft mehr oder weniger rasch eine Agoraphobie entwickelt. In vielen Fällen besteht daher eine Agoraphobie mit Panikstörung. Durch das wiederholte Erleben einer Panikattacke werden oft existentielle Fragen und Ängste angesprochen (Tod als Ende oder Beginn einer anderen Existenzform, Sinn des Lebens, Dauerhaftigkeit von Beziehungen u.a.). Es ist wie nach einem schweren Unfall, den man nur mit viel Glück überlebt hat. Plötzlich verliert das Leben seine Selbstverständlichkeit. Das Urvertrauen in das Leben geht verloren. Man wird übermäßig vorsichtig aus Angst vor der Wiederholung einer derartigen Erfahrung, beobachtet und kontrolliert seinen Körper, auf den man sich früher einfach verlassen hat, und braucht die Versicherungen anderer (z.B. Angehöriger, Ärzte, Psychotherapeuten), um sich "in seiner Haut" wohl fühlen zu können. Es entwickelt sich oft ein extremes Sicherheitsbedürfnis, das risikoscheu macht, auch in Situationen, die man früher ohne langes Nachdenken problemlos bewältigen konnte. Menschen mit Panikstörung entwickeln hinsichtlich der Begleiterscheinungen und Konsequenzen von Panikattacken charakteristische Auffassungen, Ursachenzuschreibungen und Verhaltensweisen, die sich folgendermaßen zusammenfassen lassen: Bewertung der Symptomatik als gefährlich, was angstmachend wirkt. Neues "Körper-Bewusstsein", geprägt von der Angst vor einer lebensbedrohlichen Erkrankung (Herzinfarkt, Schlaganfall, Gehirntumor), weshalb schon leichte Symptome (Kribbeln, Kopfweh, Nebenwirkungen von Medikamenten) übermäßig ernst genommen werden. Die Aufmerksamkeit richtet sich nach innen, auf alle Zustände. Mangelnde Beruhigung trotz vieler organischer Untersuchungen mit negativem Befund, weil plausible Erklärungen für die Symptomatik ausbleiben. Demoralisierung als Folge der nicht bewältigbar erscheinenden Panikattacken. Angst, "verrückt" zu werden oder die Kontrolle zu verlieren. Diese Angst wird begünstigt durch Depersonalisationserfahrungen, situativ bedingten Sauerstoffmangel im Gehirn und großen inneren Druck, oft auch verstärkt durch die Angst, dass andere Menschen die plötzlichen Veränderungen bemerken könnten. Neben Todesängsten und Kontrollverlustängsten kann auch die Angst vor sozialer Auffälligkeit und dem Verlust des Sozialprestiges belastend sein. Folgenschwere Verhaltensänderungen (z.B. Kündigung der Arbeitsstelle, Einschränkung des Aktionsradius, Veränderungen im familiären Zusammenleben). Entwicklung von Erwartungsängsten und Vermeidungsverhalten (Agoraphobie). Psychologische Abhängigkeit von Hilfsmitteln (Mitnahme von Tabletten, Handy, Spazierstock u.a.) oder nahestehenden Personen. Substanzmissbrauch (Alkohol, Tranquilizer) zur Bewältigung der Angstzustände. Die relative Unabhängigkeit der spontanen Panikattacken von situativen Bedingungen bedeutet nach neueren Forschungsergebnissen nicht, dass die Anfälle völlig spontan, d.h. ohne Auslöser, auftreten. Unerwartete Panikattacken werden durch interne Reize ausgelöst. Dies erfolgt durch die Wahrnehmung körperlicher Symptome (z.B. Atemnot oder Herzklopfen), die als unmittelbar bevorstehende körperliche oder seelische Katastrophe interpretiert werden, aber auch durch bestimmte angstmachende Gedanken oder Vorstellungen. Im Gegensatz zu phobischen und agoraphobischen Syndromen, wo die Aufmerksamkeit auf angstmachende äußere Reize und deren Vermeidung gelegt wird, erfolgt bei Panikattacken eine Aufmerksamkeitslenkung nach innen, auf sich selbst: der Körper wird nach möglichen Anzeichen drohender Gefahr abgesucht. Bestimmte Situationen führen bei hierfür sensiblen Personen zu unangenehmen körperlichen Empfindungen, aus denen sich dann Panikattacken entwickeln können: Heißes oder schwüles Wetter begünstigt unangenehmes Schwitzen, Schwindel, Herz- und Kreislaufbeschwerden (Blutgefäßerweiterung mit Blutdruckabfall). Enge und geschlossene Räume bewirken das Gefühl, zuwenig Luft zu bekommen (erhöhte CO2-Sensitivität). Viele Menschen mit Panikstörung ohne Agoraphobie haben zumindest anfangs nicht das Gefühl, unter Ängsten zu leiden, außer der Angst vor einer neuerlichen Panikattacke. Nach der ersten Panikattacke gehen viele Betroffene aus verständlichen Gründen zum Arzt und lassen sich durchuntersuchen. Wegen der anfallsartig auftretenden körperlichen Symptome wie Herzrasen, Atemnot, Brustschmerz oder Schwindelgefühl wird Hilfe von praktischen Ärzten, Internisten, Lungenfachärzten, HNO-Ärzten und Neurologen erwartet, keinesfalls von Psychotherapeuten. Der Ausschluss organischer Ursachen aufgrund von oft sehr umfangreichen Untersuchungen bringt meistens keine Beruhigung, sondern gibt Anlass zur Sorge, letztlich an einer unbekannten und daher nicht behandelbaren Krankheit zu leiden. Panikpatienten glauben oft aufgrund der Intensität ihres Erlebens, dass die Mitmenschen ihre Panikattacken genau wahrnehmen können. Tatsächlich jedoch erkennen Außenstehende meist gar nicht, dass die Betroffenen eben eine Panikattacke erleben. Selbst Fachleute haben oft Schwierigkeiten, bei ihren Patienten eine Panikattacke zu erkennen. Panikpatienten zittern und beben nur innerlich, und Herzrasen kann man ohnehin nicht sehen. Die Betroffenen wirken nach außen hin oft nur etwas blass, manchmal mit ein paar Schweißtropfen auf der Stirn. Dramatisch wirkt dagegen eine Hyperventilation, das Ringen um Luft, der angstvolle Griff zum Herzen wie bei einem Herzinfarkt und das gelegentliche Sicht-Anklammern an den Partner aus Angst umzufallen. Die relative Unauffälligkeit bewirkt, dass Panikpatienten oft den Eindruck haben, ihre Partner stünden den Attacken verständnislos und wenig einfühlsam gegenüber. Panikpatienten nehmen ihre körperlichen Symptome stärker wahr als sie tatsächlich sind, wie ein Vergleich zwischen Selbstdarstellung und physiologischen Messungen mittels LangzeitEKG (tragbare Messgeräte) zeigt. Während bei 70% aller Anfälle Herzklopfen oder Herzrasen berichtet wird, ergeben sich bei den Messungen nur bei einigen Panikattacken leicht erhöhte Herzfrequenzen. In der bisher umfangreichsten Studie ergab sich ein durchschnittlicher Herzfrequenzanstieg von 11 Schlägen pro Minute bei spontanen und 8 Schlägen bei situativen Panikattacken. Die Betroffenen stellten ihre Panikattacken später als häufiger und stärker ausgeprägt dar, als sie diese unmittelbar nach dem Auftreten in einem Angsttagebuch vermerkt hatten. Eine deutliche Erhöhung des Herzschlags war nur bei situativen Panikattacken gegeben, und zwar schon 15 Minuten vor Beginn der Attacken. Noch immer wird gegenwärtig nach Ausschluss organischer Ursachen nicht sofort die richtige Diagnose gestellt, sondern - wie früher üblich - eine der folgenden Diagnosen: vegetative Dystonie, psychovegetatives Syndrom, Neurasthenie, nervöses Erschöpfungssyndrom, Hyperventilationssyndrom, psychomotorischer Erregungszustand, funktionelles kardiovaskuläres Syndrom, funktionelle Herzbeschwerden. Frauen werden oft als "hysterisch" und Männer als "hypochondrisch" abqualifiziert. Die richtige Diagnose gibt vielen Patienten das beruhigende Gefühl, dass ihre Störung einen Namen hat. Nach einer langen Zeit der Ungewissheit weiß man endlich, worunter man leidet. Im negativen Fall kann dies dazu führen, dass man sich mit seiner Identität als Panikpatient zufrieden gibt und im Laufe der Zeit verschiedene Psychotherapien wohl beginnt, bald jedoch ergebnislos abbricht. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn Psychotherapeuten nicht auf die Paniksymptomatik an sich eingehen. Wenn von den Ärzten die richtige Diagnose nicht gestellt und die angemessene Behandlung nicht eingeleitet wird, bleiben Panikpatienten oft über Jahre stark verunsichert. Beruhigungsmittel dämpfen zwar zeitweise die Erwartungsängste, lösen jedoch nicht das Problem der Panikstörung und führen oft zur Medikamentenabhängigkeit. Es gibt keine eindeutigen Laborbefunde zur Diagnostik einer Panikstörung. Bestimmte Panikpatienten reagieren jedoch bei verschiedenen Panikprovokationsmethoden (Natriumlaktat-Infusionen, Kohlendioxidinhalationen u.a.) häufiger mit Panikattacken als Menschen mit anderen Angststörungen oder gesunde Kontrollpersonen. Drei Beispiele sollen die Entwicklung einer Panikstörung veranschaulichen: Ein 47jähriger Manager mit hohem Blutdruck und verschiedenen Risikofaktoren (Rauchen, Übergewicht, ungesunde Ernährung, übermäßiger Stress), dessen Vater im Alter von 53 Jahren an einem Herzinfarkt verstorben ist, bekommt plötzlich am Abend im Bett vor dem Einschlafen eine Panikattacke. Nach einer ergebnislosen organischen Durchuntersuchung wird dem Betroffenen bewusst, dass er sich fürchtet, aufgrund eines ähnlichen Lebensstils wie sein Freund ebenfalls bald sterben zu müssen, noch dazu, wo er weiß, dass sein Vater nur einige Jahre älter wurde, als er selbst jetzt ist. Der Patient erinnert sich, dass er kurz vor Beginn der Panikattacke an den unerwarteten Herzinfarkt-Tod seines gleichaltrigen Freundes vor drei Monaten gedacht hatte. Der früher sehr sportliche Patient beginnt seine diesbezüglichen Aktivitäten (Tennis, ausgedehnte Rad- und Schitouren, oft auch allein) aus Angst vor Überforderung einzuschränken und entwickelt eine hypochondrische Form der Körperbeobachtung ("Wie schnell geht der Puls?", "Ist der Druck auf der Brust und das Kribbeln im linken Arm ein Anzeichen für einen bevorstehenden Herzinfarkt?"). Er beschäftigt sich vermehrt mit den Folgen seines möglichen Todes ("Wer wird meine Position in unserer Firma einnehmen, wenn niemand so plötzlich darauf vorbereitet ist, meine Tätigkeit fortzuführen?", "Was wird aus meiner Frau, die ohne richtige Ausbildung und Berufserfahrung sich nicht selbst erhalten kann?", "Wie wird sich mein 12jähriger Sohn ohne Vater entwickeln?", "Wie soll das Haus zu Ende gebaut werden und der Schuldenstand abgezahlt werden?"). Er stellt den gelegentlich übermäßigen Alkoholkonsum ein und reduziert den ständig erhöhten Kaffeekonsum, weil zwei dadurch ausgelöste Panikattacken im Laufe der nächsten Monate seine Todesängste nur verstärken, ist dadurch aber mit leichten Entzugssymptomen konfrontiert, die ihn erst wieder beunruhigen. Vor allem entwickelt er abends eine bisher nie gekannte Schlafstörung, so dass das Schlafdefizit seine körperliche und psychische Befindlichkeit weiter verschlechtert. Sein Hausarzt diagnostiziert eine Erschöpfungsdepression und verordnet ein Antidepressivum, und zwar einen selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, der auch geeignet erscheint, seine Panikattacken zu beseitigen. Durch die sensible Reaktion auf die Nebenwirkungen in den ersten zwei Wochen nach der Einnahme (möglicherweise anfangs zu hohe Dosierung des Medikaments) werden die körperbezogenen Ängste des Patienten jedoch nur verstärkt, so dass er bei fortgesetzter Einnahme, zu der ihn sein Arzt ermuntern kann, auf die Suche nach zusätzlichen Therapiemaßnahmen geht. Wegen seiner zunehmenden körperlichen Verspannungen erfolgt zuerst eine Überweisung an einen Masseur und anschließend auch zu einer Verhaltenstherapie. Hier wird ein weiterer möglicher Auslöser für die Panikattacken eruiert. Der Patient hatte begonnen, aus Angst vor den Panikattacken die seit längerem verordneten Beta-Blocker eigenständig zu erhöhen und dadurch einen für ihn ungewöhnlich niedrigen Blutdruck entwickelt, der möglicherweise die plötzlich erhöhte Neigung zu Panikattacken begünstigt hat. Eine Frau mit drei kleinen Kindern bekommt die erste Panikattacke kurz nachdem ihre Mutter sowie ihre beste Freundin, die zwei kleine Kinder hat, völlig überraschend die Information einer schweren Krebserkrankung mit Metastasenbildung erhalten hatten. Die Angst, ebenfalls an Krebs zu erkranken, war der Patientin durchaus bewusst, sie konnte anfangs jedoch nicht erkennen, dass die erste Panikattacke als "Angst aus heiterem Himmel" damit zu tun haben sollte, weil diese schließlich nicht in einem Moment der Sorge, sondern zu einem Zeitpunkt des Wohlbefindens auftrat, nämlich während eines Festes. Sie dürfte wohl unbewusst gedacht haben: "So etwas werde ich vielleicht nicht mehr erleben können." Die Angst vor einer neuerlichen Panikattacke mit Todesfolge steht plötzlich zumindest kurzfristig stärker im Mittelpunkt als die Angst vor einer tödlichen Krebserkrankung. Ein Arbeiter hat eine längere beruflich bedingte Stressphase hinter sich. Erfreut über die kommenden Tage der Entspannung legt er sich am Abend in sein Bett und bekommt nach einigen Minuten eine derart massive Panikattacke, dass er aus dem Bett aufspringt und in der Wohnung nervös umhergeht. Da die Symptomatik nach einigen Minuten nicht abklingt, ruft seine Gattin den Notarzt. Daraufhin beruhigt sich der Betroffene relativ rasch. Der herbeigeeilte Notarzt äußert den Verdacht auf eine Panikattacke, da organisch nichts Außergewöhnliches festzustellen ist, und verschreibt ein Beruhigungsmittel. Zwei Tage später setzt sich der Mann am Nachmittag im Wohnzimmer in ein Fauteuil und möchte fernsehen. Plötzlich wird er neuerlich von einer heftigen Panikattacke überrascht. Diesmal bleibt er nach Abklingen der Panikattacke beunruhigt, geht zum Hausarzt und lässt sich von ihm zur stationären Durchuntersuchung in ein Krankenhaus einweisen Auslöser der ersten Panikattacke Als Hintergrund, als Boden für die erste Panikattacke, gilt ein allgemein erhöhtes Stressniveau. Die erste Panikattacke tritt meistens in der Zeit einer erhöhten Stressbelastung auf (körperlich, psychisch, geistig, sozial, familiär, beruflich, finanziell). Vor der Auslösesituation der ersten Panikattacke finden sich oft Überlastungen oder chronische Konflikte (z.B. in der Partnerschaft oder am Arbeitsplatz). Die erste Panikattacke entsteht gewöhnlich im Rahmen einer Kombination von zwei Arten von Stressfaktoren: 1. Psychophysiologische (körperliche) Belastung: niedriger Blutdruck, Blutdruckabfall, Allergie, Genesungsphase nach einer Krankheit (z.B. plötzliches Aufstehen nach einer Grippe), prämenstruelle Phase, Schwangerschaft, Geburt, zuviel Kaffee, Alkohol oder Drogen, körperliche Aktivierung nach längerer Inaktivität usw. 2. Psychosoziale Belastung: völlig unerwarteter Todesfall oder schwere Erkrankung eines Angehörigen (oft Herzinfarkt oder Krebs), akute familiäre oder berufliche Konflikte, Trennungserlebnisse, Kündigung usw.Panikattacken lassen sich durch das Stressmodell erklären. In Phasen eines allgemein hohen Anspannungsniveaus kann schon eine alltägliche Stress-Situation (z.B. eine kleine Verletzung) zum Auslöser für eine Panikattacke werden. Panikattacken sind zu verstehen als besonders dramatisch ablaufende Alarmreaktionen auf Stress oder auf eine Häufung von Stressoren. Im Laufe der Zeit verselbständigt sich dieses Angsterleben aufgrund von kognitiven Prozessen als permanente Angst vor einem Panikanfall (Erwartungsangst), was die allgemeine Anspannung erhöht. Die Unfähigkeit, sich die Symptome erklären zu können (obwohl die psychosozialen Belastungen durchwegs als solche wahrgenommen werden), verstärkt die Ängste. Bei über 90% der Betroffenen beginnt die Panikstörung mit einer Panikattacke an einem öffentlichen Ort oder außerhalb von zu Hause bei einer bislang ganz normalen Betätigung. Der entsprechende Ort (z.B. Geschäft, Lokal, Kino, Arbeitsstelle, Wartesaal, Bus) wird fluchtartig verlassen und zukünftig angstvoll gemieden. Die erste Panikattacke beginnt häufig mit einem kollapsähnlichen Zustand bei geschwächter körperlicher Kondition und gleichzeitig gegebenem psychosozialen Stress, dem eine massive Kreislaufankurbelung zur Verhinderung einer Ohnmacht folgt. Nach der Münchner Verlaufsstudie wurden bei ca. 80% der Betroffenen vor der ersten Panikattacke schwerwiegende Lebensereignisse festgestellt, oft sogar mehr als eine Belastung. Zumeist handelte es sich um Tod oder plötzliche, schwere Erkrankung von nahen Angehörigen oder Freunden, Verlust durch Scheidung oder Trennung, Erkrankung oder akute Gefahr der Betroffenen, Schwangerschaft oder Geburt. Nach einer englischen Untersuchung an 1000 Agoraphobikerinnen entstand die erste Panikattacke bei 32% nach einem schwerwiegenden Ereignis (Trennung vom Partner, Arbeitsplatzverlust usw.), bei 27% nach dem Tod oder einer schweren Erkrankung eines Angehörigen oder Freundes, 6% der Patientinnen waren Zeugen des Unglücks anderer. Eine weitere englische Studie ergab, dass Panikpatienten im Jahr vor ihrer ersten Panikattacke zweimal häufiger von widrigen und unglücklichen Lebensumständen betroffen waren als gesunde Personen. Dazu zählten eigene Krankheit, Unfall und/oder Operation, Trennung vom Partner und finanzielle Schwierigkeiten. Panikpatienten haben nicht mehr Stress als die Normalbevölkerung zu bewältigen, sie bewerten die Belastungen jedoch viel negativer, weil sie aufgrund ihres größeren Sicherheitsbedürfnisses mit möglicher Bedrohung und Unsicherheit nicht gut umgehen können, was oft lebensgeschichtlich verständlich ist (z.B. ängstliche Mutter, Herzkrankheiten, Asthma, Schlaganfall, Krebs, unerwartete Todesfälle in der Familie oder Bekanntschaft). Am belastendsten ist jener Stress, den man gerne kontrollieren möchte, jedoch bei noch so viel Aufwand nicht kontrollieren kann. Als Folge davon entwickelt sich eine "erlernte Hilflosigkeit", die zu Resignation, depressiver Erschöpfung und vermehrten Erwartungsängsten führt. Auslösefaktoren für die erste Panikattacke (auch für spätere Panikanfälle) können zahlreiche körperliche, ernährungsbedingte, sozioökonomische, ökologische, soziale, familiäre und psychische Stressoren sein: Tod eines Angehörigen oder Bekannten. Andere Verlustereignisse: Trennung vom Partner, Auszug der Kinder, Umzug. Krankheitsängste: Krankheiten in der Familie, Verwandtschaft oder Bekanntschaft (Herzinfarkt, Asthma, Krebs), eigene Erkrankung, bevorstehende Operation. Massive familiäre Belastungen (durch Eltern, Partner, Kinder), Trennungsängste. Unverarbeitete Lebensereignisse: Gewalt, Missbrauch, Unfall, Scheidung der Eltern. Heftige Emotionen: Erregtheit, Ärger, Streit, Unterdrückung von Aggressionen. Massive Zukunftsängste oder berufliche/wirtschaftliche Sorgen: drückende finanzielle Sorgen, Unsicherheit des Arbeitsplatzes, Arbeitsplatzverlust oder wechsel. Stellvertretende Erfahrungen: Lesen von Artikeln, die medizinische Symptome, Krankheiten oder Katastrophen beschreiben, Miterleben von Schicksalsschlägen oder Symptomen bei anderen. Ungesunde, stressreiche Lebensführung ganz allgemein (übermäßiger Zeitdruck, berufliche Überlastung usw.), die zu Erschöpfung führen kann. Allergien: die gesteigerte Abwehr von verschiedenen auf den Körper einwirkenden Substanzen führt zu Entzündungen und Gefäßerweiterungen (bis zum Kollaps). Hormonelle Störungen: Schilddrüsenüberfunktion, Hormonstörungen bei Frauen. Bestimmte Krankheiten: Lebererkrankung, Virusinfektion, Mangel an Vitamin B1, Störungen im Kalziumhaushalt. Nebenwirkungen von Medikamenten: Blutdrucksenkung, allergische Reaktion u.a. Alkohol, Drogen, Koffein und Nikotin: übermäßiger Konsum bzw. Entzug. Unterzuckerung (Hypoglykämie): Zuckerabfall mit panikartigem Zustand, z.B. bei Abmagerungskuren, zuviel Alkoholkonsum, schwerer körperlicher Arbeit, bei Zuckerkranken wegen eines falsch eingestellten insulinpflichtigen Diabetes. Kreislaufschwankungen bzw. Kreislaufstörungen durch zuviel Koffein oder Nikotin, Kater, Alkohol- oder Medikamentenentzug, Zuckerabfall, Sportübungen, Müdigkeit oder Erschöpfung, Hitze bzw. schwüles Wetter, Krankheit, allergische Reaktionen, prämenstruelle Angespanntheit, Schwangerschaft. Generell niedriger Blutdruck (z.B. 95/65), der in Schrecksituationen noch weiter abfällt (Kollapsneigung), so dass Herzrasen blutdruckerhöhend wirkt, um eine weitere Sauerstoffunterversorgung und daraus folgende Ohnmacht zu verhindern. Langes Stehen ohne Bewegung (orthostatische Hypotonie): das Blut geht in die Beine, so dass im Kopf zuwenig Blut und Sauerstoff vorhanden sind. Hemmung der Fluchtreaktion in einer bestimmten Situation (Bus, Geschäft usw.) mit der Folge einer sog. vagovasalen Ohnmachtsneigung. Man kann bzw. will eine belastende Situation nicht verlassen, obwohl der Körper für eine Fluchtreaktion aktiviert ist. Es kommt dabei zu einer vermehrten Durchblutung der Muskulatur (spürbar als Muskelverspannung) und mangels Bewegung (oft Erstarrung im Schreck) zu einem verminderten Blutrückfluss zum Herzen, so dass weniger Blut in den Kreislauf gepumpt werden kann, was sich bereits nach Sekunden als Schwindel und später als Ohnmachtsneigung bemerkbar macht. Hyperventilation: in Belastungssituationen erfolgt oft ein zu rasches und zu flaches Atmen mit angstmachenden körperlichen Folgezuständen. Zwischen den Diagnosen Agoraphobie/Panikstörung und Hyperventilationssyndrom besteht eine Überlappung von etwa 60%. Epidemiologie, Verlauf und Folgen der Panikstörung In der BRD haben lebenszeitbezogen 2,4%, innerhalb der letzten 6 Monate 1,1% und innerhalb des letzten Monats 1,0% der Bevölkerung eine Panikstörung. Gelegentliche Panikattacken treten viel häufiger auf (z.B. in Wien lebenszeitlich bei 17,7%). Die groß angelegte amerikanische NCS-Studie erbrachte folgende Erkenntnisse: Gelegentliche Panikattacken treten lebenzeitbezogen bei 15,6% der Befragten auf, 3,8% erleben eine Panikattacke innerhalb des letzten Monats. Eine Panikstörung tritt lebenszeitbezogen bei 3,5%, innerhalb der letzten 12 Monate bei 2,5% und innerhalb des letzten Monates bei 1,5% der Befragten auf. 1,5% weisen lebenszeitlich und 0,7% innerhalb des letzten Monats eine Kombination von Panikstörung und Agoraphobie auf. Dies stellt einen Beleg dafür dar, dass ein beachtlicher Teil der Panikpatienten keine Agoraphobie entwickelt. Neben den 1,5% der Bevölkerung mit einer Kombination von Panikstörung und Agoraphobie gibt es lebenszeitlich 4,2% Personen in der amerikanischen Bevölkerung, die eine Agoraphobie ohne Panikstörung aufweisen (ein Teil davon hat jedoch laut Nachuntersuchung durch Experten eher eine spezifische Phobie als eine Agoraphobie). Diese epidemiologischen Daten bestätigen das ICD-10-Konzept der Agoraphobie als eigenständige Diagnose, während im amerikanischen Diagnoseschema der Panikstörung eine größere nosologische Bedeutung zukommt als der Agoraphobie. Eine Panikattacke führt zwar oft zu einer Agoraphobie, kommt aber auch bei völlig unterschiedlichen psychischen Störungen vor (z.B. bei affektiven, psychotischen, somatoformen und Substanzmissbrauchsstörungen). Panikstörungen treten im Laufe des Lebens bei 5,0% der Frauen und 2,0% der Männer auf, innerhalb der letzten 12 Monate bei 3,8% der Frauen und 1,7% der Männer, innerhalb des letzten Monats bei 2,0% der Frauen und bei 0,8% der Männer. 50% der Befragten mit Panikstörung wiesen keine Agoraphobie auf (in klinischen Stichproben ist die Kombination beider Störungen jedoch viel häufiger gegeben). Erste Studien bei Kindern und Jugendlichen zeigen, dass eine Panikstörung bereits in diesem Alter auftreten kann. Meistens zeigt sich ein durchschnittlicher Beginn kurz nach der Pubertät. Das Erscheinungsbild ist dabei der Symptomatik im Erwachsenenalter sehr ähnlich. Panikstörungen mit und ohne Agoraphobien haben im Vergleich zu phobischen Störungen und generalisierten Angststörungen einen durchschnittlich späteren Beginn. Panikstörungen treten meistens zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr erstmals auf, bei rund 20% bereits früher, bei 40% erst später. Das erstmalige Auftreten von Panikattacken nach dem 40. Lebensjahr wird von verschiedenen Autoren als Zeichen einer zugrundeliegenden Depression angesehen. Im Langzeitverlauf von Panikstörungen lassen sich 6 Stadien unterscheiden: 1. Attacken mit unvollständiger Symptomatik, 2. Panikattacken, 3. hypochondrische Klagen, 4. begrenztes phobisches Vermeidungsverhalten, 5. generalisiertes phobisches Vermeidungsverhalten, 6. sekundäre Depression. 15-20% der Panikpatienten wiesen bereits vor der Panikstörung leichte agoraphobische Tendenzen auf. Eine Agoraphobie beginnt keineswegs immer mit der ersten Panikattacke. Das Auftreten einer Panikattacke ist keine notwendige Voraussetzung für eine Agoraphobie. Eine Panikstörung mit Agoraphobie stellt in der Regel eine schwerwiegendere Beeinträchtigung dar als eine Panikstörung ohne Agoraphobie, denn sie beginnt früher, hält länger an und weist mehr psychosoziale Behinderungen auf. Obwohl bei über 80% der Agoraphobiker zu Beginn der Störung eine Panikattacke auftrat, sind insgesamt nur 31% der Panikattacken in typisch agoraphobischen Situationen zu finden. Nach einer Untersuchung an 195 Panikpatienten mit und ohne Agoraphobie ergab folgenden Befund: "Weder die Häufigkeit der Panikattacken (in den letzten drei Wochen) noch die Intensität der Paniksymptome waren signifikante Prädiktoren für den Schweregrad einer Agoraphobie. Entscheidend war vielmehr, ob die Patienten in den sogenannten agoraphobischen Situationen einen Panikanfall mit größerer Wahrscheinlichkeit erwarteten, ob sie sich durch die Panikattacken stärker beeinträchtigt fühlten und ob sie sich als generell ängstlicher beschrieben. Die Entwicklung einer Agoraphobie hängt also nicht primär von der Anzahl und Intensität der Panikattacken ab. Entscheidend ist neben der dispositionellen Ängstlichkeit vielmehr, wie diese Anfälle bewertet werden. Dies wird auch durch Untersuchungen bestätigt, welche die Häufigkeit und Intensität der Panikattacken nicht retrospektiv, sondern anhand von Tagebuchaufzeichnungen kontinuierlich erhoben haben ... Die Dissoziation von Panikattacken und Agoraphobie wird auch durch epidemiologische Studien gestützt, in denen eine relativ hohe Prozentzahl von Patienten beobachtet wurde, die eine intensive agoraphobische Vermeidung aufwiesen, ohne dass gleichzeitig eine Panikstörung vorlag. So beträgt die Einjahresprävalenz einer Agoraphobie ohne Panikstörung je nach Studie zwischen 2.8 und 5.8% ... Dies widerspricht allerdings nicht der häufig gemachten klinischen Beobachtung, dass fast 80% aller Agoraphobiker bereits früher eine oder mehrere Panikattacken erlebt haben, welche dann möglicherweise die Entwicklung einer Agoraphobie ausgelöst haben ... Die Aufrechterhaltung und der Schwergrad der agoraphobischen Vermeidung ist dagegen weitgehend unabhängig von der Häufigkeit und Schwere der aktuellen Panikattacken." Die Folgen von Panikattacken hängen nach einer deutschen Studie stark vom Alter der Betroffenen zum Zeitpunkt des ersten Auftretens einer Panikattacke ab: Panikattacken mit erstmaligem Auftreten vor dem 25. Lebensjahr führen oft zu einer anderen Angststörung (vor allem zu einer Agoraphobie oder einer spezifischen Phobie), seltener zu sekundärer Depression oder Substanzmissbrauch. Panikattacken mit erstmaligem Auftreten im höheren Alter führen oft und rasch (innerhalb eines Jahres) zu sekundärer Depression, Substanzmissbrauch oder Mehrfacherkrankung bzw. sind Ausdruck einer vorhandenen Mehrfacherkrankung. Nach der Münchner Verlaufsstudie ist der Verlauf der Panikstörung in der Durchschnittsbevölkerung meistens chronisch, wenn die Störung über ein Jahr bestanden hat und keine adäquate Behandlung erfolgte. Nach 7 Jahren Beobachtungszeit war bei 51% der Panikpatienten eine Verschlechterung und Chronifizierung eingetreten, 90% erfüllten noch immer die diagnostischen Kriterien für eine Panikstörung. Nur 14,3% der Panikpatienten und 19% der Agoraphobiker erreichten eine Spontanheilung. Bei unbehandeltem Paniksyndrom entwickelten 71,4% eine depressive Störung, 50% Alkoholmissbrauch und 28,6% Medikamentenmissbrauch. Unbehandelte Patienten mit einer Panikstörung mit Agoraphobie haben nach Meinung aller Fachleute einen chronischeren Verlauf ihrer Störung und eine langfristig schlechtere Prognose als Patienten mit depressiven Störungen. Situationsgebundene Panikattacken (z.B. bei einer Phobie) zeigen deutlich bessere Heilungschancen als spontan auftretende Panikattacken. Patienten mit Panikstörungen weisen gleichzeitig oft auch andere Störungen auf: Agoraphobie, generalisierte Angststörung, Depression und Dysphorie. Die Mischung von Panikstörung und Agoraphobie ist besonders häufig (bei rund 50%). Nur 20-30% der Panikstörungen sind reine Panikstörungen. Nach der Zusammenfassung des Forschungsstandes ergeben sich folgende Zahlen zum Langzeitverlauf von Panikpatienten aus Behandlungseinrichtungen: 6-10 Jahre nach der Behandlung sind ungefähr 30% der Betroffenen symptomfrei, 40-50% gebessert und 20-30% gleich schlecht oder verschlechtert. In klinischen Behandlungseinrichtungen finden sich bei Panikpatienten weitere Angststörungen in folgender Häufigkeit: generalisierte Angststörung bei 25%, soziale Phobie bei 15-30%, spezifische Phobie bei 10-20%, Zwangsstörung bei 810%. Eine Depression kommt bei 50-65% der Personen mit Panikstörung vor. Bei fast einem Drittel der Personen mit beiden Störungen geht die Depression der Panikstörung voraus. Bei zwei Dritteln tritt die Depression gleichzeitig oder nach dem Beginn der Panikstörung auf. Eine sekundäre Agoraphobie bei Patienten mit Panikstörung weist auf einen höheren Schweregrad der Panikstörung hin, oft auch charakterisiert durch einen früheren Beginn der Störung, eine schwerer ausgeprägte Symptomatik der Panikattacken und eine längere Gesamterkrankungsdauer. Die Kombination mit einer generalisierten Angststörung, einer wiederholt auftretenden depressiven Symptomatik, einer schweren psychosozialen Beeinträchtigung oder einer Persönlichkeitsstörung stellt einen prognostisch ungünstigen Verlauf dar. Verschiedene Studien, die allerdings nicht repräsentativ sind und zudem einige methodische Mängel aufweisen, zeigen eine familiäre Häufung der Panikstörung, wobei aufgrund der Datenlage allein nicht entschieden werden kann, ob dies für genetische Ursachen oder Lernfaktoren spricht. Erste Untersuchungen weisen darauf hin, dass Panikstörungen gelernt werden können in einem familiären Milieu, wo derartige Störungen gehäuft auftreten. Studien, in denen Kinder von Patienten mit Angststörungen untersucht wurden, belegen übereinstimmend, dass diese Kinder ebenfalls Angststörungen aufweisen. Umgekehrt zeigen auch Studien, in denen ausgehend von Kindern mit Angststörungen die Eltern untersucht wurden, einen Zusammenhang von kindlichen und elterlichen Angststörungen. Wenn eine Panikstörung nicht bewältigbar erscheint, sind oft folgende Gegebenheiten anzutreffen, die hier im Überblick zusammengefasst werden sollen: Chronische Erwartungsängste ("Angst vor der Angst"). Die Angst vor den Paniksymptomen führt zu Erwartungsängsten vor einem neuerlichen Anfall, auch wenn die Patienten aufgrund von körperlichen Durchuntersuchungen wissen, dass sie organisch gesund sind und keine schwere Erkrankung (Herzinfarkt, Schlaganfall, Gehirntumor, Kreislaufzusammenbruch mit Ohnmacht) zu befürchten brauchen. Ständige medizinische Durchuntersuchungen und Überbeanspruchung des medizinischen Versorgungssystems. Panikpatienten nehmen besonders in der Frühphase der Erkrankung verstärkt ärztliche Hilfe in Anspruch und lassen sich oft wiederholt bei verschiedenen Fachärzten bzw. stationären Aufenthalten durchuntersuchen. Die Betroffenen wirken durch die Symptomatik bzw. durch ihr ängstliches Verhalten auf Ärzte derart bedrängend, dass ständig aufwendigere und kostspieligere Untersuchungen sowie unnötige Krankenhausaufenthalte erfolgen, die nur kurzfristig beruhigend wirken. Die Ängste werden oft verstärkt durch grenzwertige Befunde ("am Rande der Norm", "leicht abnorm", "nicht sicher auszuschließen", "Verlaufskontrolle empfohlen"). Bei langem Suchen findet man häufig unbedeutende Unregelmäßigkeiten. Eine gründliche Durchuntersuchung zum Ausschluss organischer Ursachen ist jedoch vor Therapiebeginn dringend anzuraten. Panikpatienten weisen im Vergleich zu anderen Angstpatienten die höchste Inanspruchnahme stationärer oder ambulanter medizinischer Einrichtungen auf. Sie beanspruchen 3 mal so häufig unterschiedlichste somatisch-medizinische Einrichtungen wie andere Personen. Lange Krankenstandszeiten mit großem individuellen Leid und hohen volkswirtschaftlichen Kosten. Die Unberechenbarkeit bezüglich des Wiederauftretens der gefürchteten Panikattacken führt mangels effizienter Behandlungsmethoden oft zu unnötig langen Krankenstandszeiten, weil sich die Betroffenen noch nicht genug vorbereitet fühlen, einen neuerlichen Anfall zu bewältigen. Im Extremfall kann eine Berufsunfähigkeit eintreten. Depressive Erschöpfung und Resignation als verständliche Folge der nicht kontrollierbar erscheinenden Panikattacken. Missbrauch von Alkohol oder Benzodiazepintranquilizern, um die Erwartungsängste besser ertragen zu können. Angst vor dem Alleinsein. Im Extremfall können die Betroffenen nicht mehr allein sein, weil sie sich davor fürchten, den Symptomen hilflos ausgeliefert zu sein. Einschränkung der Bewegungsfreiheit im Sinne einer Agoraphobie. Menschen mit Panikstörung neigen im Laufe der Zeit vielfach dazu, verschiedene Situationen zu meiden, die als Auslöser für Panikattacken geeignet erscheinen. Abhängigkeit von einer Vielfalt von Helfern. Angstreduzierend wirkt das Wissen um die Nähe oder sofortige Erreichbarkeit von Helfern (Ärzte, Krankenhäuser, Psychotherapeuten, Verwandte, Bekannte). Oft sind schon Gespräche beruhigend, ohne dass neuerliche Untersuchungen nötig sind. Vorher selbstbewusste und lebenstüchtige Menschen verhalten sich plötzlich wie furchtsame kleine Kinder. Psychosoziale Beeinträchtigungen. Menschen mit einer Panikstörung weisen im Vergleich zu anderen Angstpatienten die meisten psychosozialen Beeinträchtigungen auf. Diese sind umso größer, je depressiver die Betroffenen gleichzeitig sind. Studien haben ergeben, dass Panikpatienten mit zusätzlicher depressiver Symptomatik ausgeprägtere Angstsymptome, eine ungünstigere Krankheitsentwicklung und größere psychosoziale Beeinträchtigungen erleben sowie eine schlechtere Behandlungsprognose und chronischere depressive Symptome aufweisen. Die sekundäre Entwicklung depressiver Episoden ist nach verschiedenen Untersuchungen hauptverantwortlich für die Entwicklung massiverer psychosozialer Integrationsprobleme. Die Kombination von Pharmakotherapie (Verabreichung eines selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmers) und anfänglich symptombezogener Psychotherapie (Verhaltenstherapie) kann auch in diesen Fällen zur Heilung führen. Übermäßige Schonhaltung aus Angst, die Symptome nicht zu provozieren, und ständige hypochondrische Selbstbeobachtung in der Hoffnung, die gefürchteten Symptome irgendwie verhindern zu können. Panikpatienten haben das Vertrauen in ihren Körper verloren und befürchteten Herzinfarkt, Ohnmacht oder Verrücktwerden. Sie zeigen seit dem ersten Anfall ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis bei allen Unternehmungen und möchten das kleinste Risiko eines Panikanfalls ausschalten. Aus falscher Schonhaltung schränken die Betroffenen, die früher oft sehr sportlich waren, körperliche Aktivitäten (Sport, Treppensteigen, anstrengende manuelle Tätigkeiten usw.) ein. Durch die fehlende Kondition werden erst recht jene Symptome begünstigt, die man vermeiden möchte. Unterscheidung zwischen Panikstörung und anderen Angststörungen Zwischen Panikattacken und anderen Angstformen bestehen keine qualitativen Unterschiede, wohl aber quantitative Besonderheiten. Charakteristisch für Panikattacken sind: das stärkere Vorherrschen somatischer Symptome (dieselben vegetativen Symptome sind bei anderen Angststörungen meistens nicht so ausgeprägt), der akute Zeitverlauf der Symptomatik (eine generalisierte Angststörung beginnt dagegen meist langsam), die Unmittelbarkeit der befürchteten Gefahren bzw. Folgen des Angstanfalls (andere Angststörungen werden wohl als sehr lästig und lebenseinengend, nicht jedoch als lebensbedrohlich erlebt), die Unvorhersehbarkeit der Angstanfälle (im Gegensatz zu den situationsbezogenen und daher vorhersehbaren Panikattacken bei sozialer oder spezifischer Phobie), die zentrale Bedeutung interner angstauslösender Reize (Phobien werden dagegen durch spezifische äußere Auslöser bewirkt). Panikstörung als Spektrum-Störung Das Panik-Agoraphobie-Spektrum-Modell stellt eine neue Sichtweise dieses Bereichs dar, die der klinischen Realität eher gerecht wird als die Kategorisierung nach den scheinbar klar voneinander abgrenzbaren Syndromen der psychiatrischen Diagnoseschemata. Die amerikanischen und italienischen Erforscher dieses klinischen Phänomens bringen ein typisches Beispiel für eine Panik-Agoraphobie-Spektrum-Störung. Ein junger Mann mit 20 Jahren erlebt ein paar Panikattacken mit begrenzter Symptomatik. Er begibt sich nicht in Behandlung, die erlebten Symptome verändern jedoch sein Leben auf eine ganz bestimmte Weise. Vor der ersten Panikattacke war er energisch, interessiert an neuen Erfahrungen und in sozialer Hinsicht recht gesellig. Nach den ersten Panikattacken wird er zunehmend ängstlich, passiv, von anderen abhängig, sozial zurückgezogen und besorgt um seine Gesundheit. Im Laufe der Zeit werden diese Tendenzen zu stabilen Persönlichkeitsmerkmalen. Mit 40 Jahren sucht er einen Arzt auf wegen einer depressiven Episode, die Paniksymptome hat er längst vergessen. Er macht den Eindruck eines ängstlichen Menschen mit hypochondrischer Färbung, der von anderen Menschen so abhängig ist, dass er nicht allein sein kann. Wenn der Arzt nur die Depression behandelt, wird die Panikattacke vor 20 Jahren als der Hauptgrund für die Angst, Abhängigkeit, Vermeidungstendenz und Hypochondrie des Patienten übersehen. Trotz erfolgreicher Behandlung der Depression leidet der Patient weiterhin unter einer Panik-AgoraphobieSpektrum-Störung mit den entsprechenden Beeinträchtigungen, wenn nicht gleichzeitig auch diese behandelt wird. Die Panik-Agoraphobie-Spektrum-Störung umfasst bestimmte Merkmalsbereiche, die wegen ihrer Bedeutsamkeit ausführlich dargestellt werden sollen. Paniksymptome Die DSM-IV-Kriterien zur Diagnose einer Panikattacke (mindestens 4 von 13 Symptomen) sind aus der Sicht der klinischen Praxis zu rigide. Zur Panik-Agoraphobie-Spektrum-Störung zählen auch zahlreiche Angstanfälle mit weniger als 4 Symptomen oder mit anderen, in den Konsequenzen jedoch ähnlich schwerwiegenden Symptomen. Neben den 13 typischen Paniksymptomen müssen folgende atypische Symptome zur PanikAgoraphobie-Spektrum-Störung gezählt werden: Gefühle der Verwirrtheit und Erstarrtheit, Gefühle der räumlichen Desorientierung, Empfindung, wie auf samtenem Boden oder auf Schaumgummi zu gehen, oder wie wenn die Beine geleeartig weich wären, Gefühl der mangelnden Stabilität, des ungeschickten Gehens oder wie wenn die Beine steif wären, Empfindung des Harndrangs und des "In-die Hose-Machens", Entwicklung depressiver Symptome, Gefühl des Kontrollverlusts, Kopfschmerzen, Überempfindlichkeit gegenüber Hitze, verbrauchter oder feuchter Luft, Überempfindlichkeit gegenüber Parfüm oder anderen Düften, Überempfindlichkeit gegenüber Licht, Überempfindlichkeit gegenüber Geräuschen, Unbehagen bei verschwommener Sicht (z.B. Nebel), Unbehagen in der Dunkelheit, Schwächezustand (Asthenie), Gefühl, als ob im Kopf oder im Körper etwas gebrochen wäre, Gefühl, als ob man blind oder taub wäre. Ängstliche Erwartung Die Erwartungsangst ("Angst vor der Angst", d.h. die Angst vor den körperlichen Symptomen) wird oft zur Hauptursache für eine massive Beeinträchtigung des allgemeinen Funktionsniveaus. Sie kann sich in zwei Formen äußern: Erwartungsangst hinsichtlich typischer oder atypischer Paniksymptome, ständige generelle Alarmbereitschaft, verbunden mit dem Gefühl der Unsicherheit, der Unfähigkeit oder der Bedrohung der physischen bzw. psychischen Integrität. Phobische und vermeidende Tendenzen In der klinischen Praxis hängen Panikstörung und Agoraphobie oft eng zusammen. Das ständige Vermeidungsverhalten stellt einen Bewältigungsversuch von Panikattacken und Erwartungsängsten dar. Hinter einer Klaustrophobie (Vermeidung von geschlossenen Räumen) steht oft die Überempfindlichkeit gegenüber potentiellen Einschränkungen der Atmung, inklusive der Einschränkung der Luftwege durch Sitzgurte im Auto, Kravatten, geschlossene oberste Hemdknöpfe, Schlucken von Tabletten. Diese Gegebenheiten passen zu der Theorie von Klein, dass Panikattacken durch Atemnot und Erstickungsgefühle (erhöhte CO2-Sensitivität) ausgelöst würden. Bestimmte Angstzustände sind in diesem Sinne eher der Panik-Agoraphobie-Spektrum-Störung zuzuordnen als einer spezifischen Phobie. Eine Liftphobie kann im Extremfall damit begründet werden, dass im Falle des Steckenbleibens des Aufzugs und fehlender Hilfe die Luft im Aufzug knapp werden könnte. Einige Sozialphobien zählen ebenfalls zur Panik-Agoraphobie-Spektrum-Störung. Eine soziale Vermeidungstendenz wird oft mit der Angst vor dem öffentlichen Auftreten von Paniksymptomen begründet, was als Verlust des Sozialprestiges gefürchtet wird ("Was werden sich die anderen denken, wenn sie sehen, welche Zustände ich plötzlich bekomme?", "Wie komme ich rechtzeitig davon, damit niemand meine Symptome sieht?"). Krankheitsängste und Hypochondrie hängen oft mit der Fehlinterpretation körperlicher Symptome als lebensgefährlich zusammen, wie dies bei Panikattacken typisch ist: Herzrasen als Zeichen eines Herzinfarkts, Kopfschmerzen als Vorboten eines Hirnschlags oder Kopftumors, leichte Atemprobleme als Vorzeichen eines Asthma- oder Erstickungsanfalls, Magenschmerzen als Zeichen von Magenkrebs. Die Beschäftigung mit medizinischen Themen (Lesen entsprechender Bücher oder Artikel, Gespräche oder Filme über Krankheiten) verstärkt oft krankheitsbezogene Ängste. Die Bewältigung dieses Problems wird jedoch nicht durch ständige Vermeidung, sondern nur durch angemessene Konfrontation mit den angstmachenden Inhalten gelingen. Die Fülle der medizinischen Informationen in diesem Buch ist für bestimmte Angstpatienten nicht beruhigend, sondern verstärkt angstmachend. Das Vermeiden von Medikamenten kann ebenfalls Ausdruck einer panikartigen Phobie sein. Verschiedene Panikpatienten reagieren auf jedes Medikament im wahrsten Sinn des Wortes "allergisch". Jede angeführte Nebenwirkung des Medikaments auf dem Beipackzettel wird gefürchtet oder bereits am eigenen Leib erlebt, was die Compliance (Verhalten entsprechend den ärztlichen Anordnungen) erschwert. Manchmal besteht gegenüber psychotropen Medikamenten sogar die irrationale Angst der Persönlichkeitsveränderung und des Verlusts der Selbstkontrolle. Hinter der Angst vor dem Einschlafen und der damit verbundenen Verzögerung des Schlafengehens verbirgt sich nicht selten die Angst vor einer Panikattacke oder sogar die Angst vor dem Tod im Schlaf. In gleicher Weise wird oft eine Narkose gefürchtet. Die Furcht vor bestimmten Wetterbedingungen (Gewitter, Stürme usw.) kann ebenfalls mit erlebten oder gefürchteten panikähnlichen Zuständen zusammenhängen. Bedürfnis nach Beruhigung durch andere Menschen mit Panikstörung und Agoraphobie verlassen sich aufgrund ihrer Unsicherheit und Angst gerne auf die Hilfe anderer, weshalb sie rasch davon abhängig werden. Ärzte und Therapeuten stellen ebenfalls überschätzte Sicherheitsgarantien dar. Psychotherapien können deswegen oft nicht beendet werden, weil die vertraute Sicherheit dadurch verloren gehen würde. Abergläubische Verhaltensweisen (z.B. bestimmte Gegenstände als Talisman) werden dann eingesetzt, wenn das Vertrauen in die eigenen Kräfte fehlt. Empfindlichkeit gegenüber Substanzen verschiedenster Art Die erhöhte Empfindlichkeit gegenüber bestimmten Substanzen ist ein typisches Merkmal bei vielen Panikpatienten. Mehrere Tassen Kaffee, etwas mehr Alkohol als gewöhnlich, eine geringe Menge bestimmter Medikamente (z.B. Antidepressiva) oder verschiedene Drogen (z.B. Ecstasy) können Panikattacken auslösen. Der Beginn einer Pharmakotherapie mit der Zieldosis ohne einschleichendes Vorgehen sowie ein relativ rasches Absetzen von Medikamenten wie Tranquilizern und Antidepressiva führt bei vielen Panikpatienten zu mehr Problemen als bei anderen Menschen. Viele Menschen mit einer Panikstörung neigen zu Panikattacken, wenn die üblichen Richtlinien zur Dosisreduktion von Tranquilizern angewandt werden, so dass vielfach ein langsameres Absetzen angebracht erscheint. Im Falle einer Alkoholentzugsbehandlung treten bei Panikpatienten ebenfalls eher Panikattacken auf als bei anderen Personen. Erhöhte Stressempfindlichkeit Unter Laborbedingungen reagieren Panikpatienten nicht stärker auf Stress als andere Versuchspersonen, verschiedene Studien haben jedoch ergeben, dass Panikpatienten für stressende Lebensereignisse besonders empfindlich sind. Ein geringer Alltagsstress kann bei einem Schlafdefizit, Überarbeitung u.a. zu Panikattacken führen. Die erhöhte Stressempfindlichkeit kommt auch in paradoxer Weise zum Ausdruck, und zwar durch das Auftreten von Panikattacken in der Phase der Entspannung nach einem stressreichen Ereignis (z.B. Herzrasen nach einer anstrengenden Autofahrt, Verlassen eines überfüllten Kaufhauses, Ausrasten nach einer sportlichen Betätigung, Hinlegen nach vollbrachter Arbeit). Erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Trennungs- oder Verlusterfahrungen Im klinischen Alltag fällt auf, dass viele Panikpatienten gegenüber Trennungs- und Verlusterfahrungen empfindlicher reagieren als andere Menschen, unabhängig davon, ob bestimmte traumatisierende Verlusterfahrungen in der Kindheit gegeben waren. Trennungsängste als Ausdruck der Panik-Agoraphobie-Spektrum-Störung können sich in der Kindheit als Schulphobie äußern oder als Unmöglichkeit, allein im Zimmer zu schlafen, insbesondere wenn kein Licht aufgedreht ist, im Erwachsenenalter als Unfähigkeit, wegen einer Arbeit das schützende Haus zu verlassen oder allein zu verreisen aus beruflichen oder privaten Gründen. Menschen mit erhöhter Sensibilität für Verluste reagieren oft bereits bei der Gefahr von Verlusten mit panikähnlichen Symptomen (z.B. nach einem heftigen Ehestreit, beim Gedanken an Trennung aus eigener Initiative oder bei der Befürchtung, der Partner könnte die Beziehung beenden, beim Gedanken an den möglichen Tod bestimmter Angehöriger). Partner werden nach dem Prinzip absoluter Verlässlichkeit ausgesucht. Partnerschaften sind daher entsprechend eng, um jedes Gefühl von Alleinsein zu vermeiden. Jede Bedrohung dieser symbiotischen Beziehung bewirkt panikartige Ängste. Gegenwärtig wird das Panik-Agoraphobie-Spektrum-Modell mit Hilfe eines speziellen Fragebogens empirisch zu überprüfen versucht. Es wurde bereits deutlich, dass die Komorbidität (gleichzeitiges Auftreten) mit einer Depression das Ausmaß einer PanikAgoraphobie-Spektrum-Störung verschärft. Die Berücksichtigung der Erkenntnisse zur Panik-Agoraphobie-Spektrum-Störung ermöglicht eine effizientere Pharmako- und Psychotherapie. Für die akut psychiatrische Behandlung dieser Patienten bedeutet dies in der Regel, dass im stationären Setting zuerst eine vorhandene Depression zu behandeln ist und in weiterer Folge eine entsprechende Angstbehandlung mit Medikamenten und/oder Psychotherapie einzuleiten ist. Das Modell der Panik-Agoraphobie-Spektrum-Störung kehrt das traditionelle Denken der europäischen Psychiatrie um. Es wird zwar eine dem aktuellen Störungsbild zugrunde liegende Basis angenommen, jedoch nicht im Sinne einer prämorbiden Persönlichkeitsstörung, sondern als konzentrierte Erfahrung bestimmter Symptome in der Kindheit oder Jugend, die die Persönlichkeit so geformt haben, wie sie bei Erwachsenen mit einer Panik-Agoraphobie-Spektrum-Störung in jeder Arztpraxis feststellbar ist. Autor: Dr.Hans Morschitzky