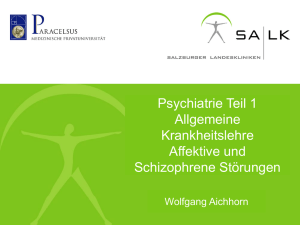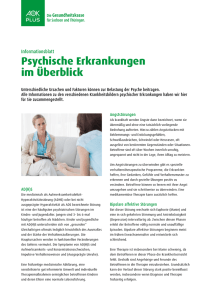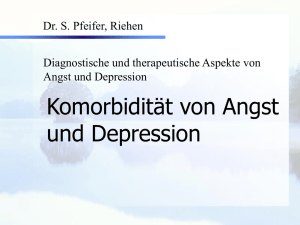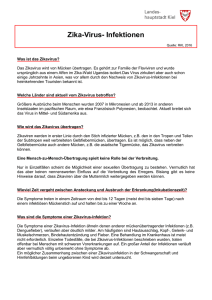KLINISCHE PSYCHOLOGIE
Werbung
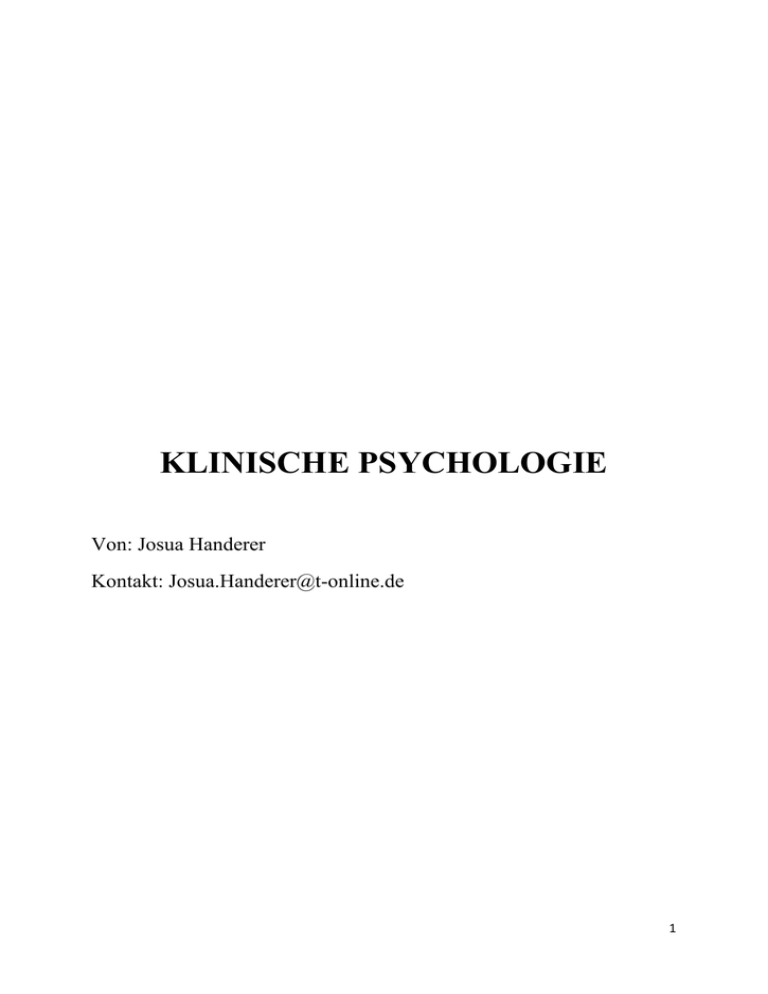
KLINISCHE PSYCHOLOGIE Von: Josua Handerer Kontakt: [email protected] 1 1. Einführung 1.1. Allgemeines: 1.1.1. Häufigkeit und Definition psychischer Störungen Die klinische Psychologie bzw. Psychopathologie beschäftigt sich mit den Ursachen und der Entwicklung gestörten (=abnormem) Verhaltens. Zur Häufigkeit psychischer Erkrankungen: a) Psychische Erkrankungen sind die vierthäufigste Ursache krankheitsbedingter Fehltage (AU-Tage = Ausfalltage am Arbeitsplatz); ihr prozentualer Anteil beträgt 9,8%! Zum Vergleich: die beiden häufigsten Gründe sind Erkrankungen am Muskel-Skelett-System (22,6%) oder Atmungssystem (15,5%) b) Die Häufigkeit psychischer Erkrankungen nimmt massiv zu (zw. 1997 und 2004 stieg ihr Anteil um 70%!) Die Definition psychischer Störungen und abnormen Verhaltens ist problemtisch; es bedarf dazu immer mehrerer Kriterien. 1) Statistische Seltenheit Abnormes Verhalten ist statistisch selten! Geistige Behinderung liegt z.B. bei einem IQ < 70 vor. Aber: - Nicht jedes seltene Verhalten gilt als „gestört“ (z.B. extreme Begabungen) 2) Verletzung sozialer Normen Abnormes Verhalten weicht von sozialen Normen ab und stellt damit eine Belästigung oder Bedrohung für das Umfeld dar. Aber: - Nicht jede Störung verletzt soziale Normen (z.B. Angst) Nicht jedes Verhalten, das soziale Normen verletzt, gilt als psychische Störung (z.B. Kriminalität) Soziale Normen sind stark vom kulturellen Kontext abhängig und in diesem Sinne relativ (z.B. Homosexualität, Drogengebrauch, Stimmen hören etc.) 3) Persönliches Leid Psychische Störungen fördern persönliches Leid! Aber: - Nicht jede psychische Störung beinhaltet Leid (z.B. Manie) Nicht alle Leiden (Hunger, Schmerz etc.) sind psychopathologisch! 4) Beeinträchtigung der Lebensführung Abnormität geht mit Einschränkungen in der Lebensführung einher (z.B. Flugangst etc.) Aber: - Gilt nicht für alle Störungen (z.B. Transvestismus) Nicht alle Einschränkungen (z.B. nicht singen können) sind psychopathologisch! 5) Unangemessenheit des Verhaltens Unangemessene Reaktionen auf Situationen (z.B. übertriebene finanzielle Sorgen trotz großen Reichtums) 2 FAZIT: Die Klassifizierung psychopathologischen Verhaltens hängt stark vom sozialen und kulturellen Kontext ab und ist dementsprechend wandelbar; dies spiegelt sich nicht zuletzt in den verschiedenen Überarbeitungen der diagnostischen Manuale (DSM, ICD) wider! Homosexualität z.B. galt in den ersten beiden Versionen des DSM (genauer: bis 1973) noch als Störung – und wird von manchen immer noch als solche angesehen („Habemus papam!“) 1.1.2. Wissenschaftstheoretisches In der klinischen Psychologie ist es aufgrund verschiedener Faktoren besonders schwer, das Ideal der Objektivität ist zu erreichen: Kulturellen und soziale Abhängigkeit psychischer Störungen (s.o.) Eigene Betroffenheit Schon gesundes Verhalten lässt sich nicht vollständig erklären Thomas Kuhn: Paradigmen beeinflussen, welche Art von „Rätseln“ untersucht wird, wie sie untersucht werden (Methoden), was dabei beobachtet wird und wie die Beobachtungsergebnisse interpretiert werden. Frühere Paradigmen der Psychopathologie (geschichtlicher Rückblick): Dämonologie (Mittelalter): Psychische Störungen als Besessenheit => „Therapie“: Exorzismus; Hexenverbrennung Asyle (ab 15.Jh): als Fluchtorte für psychisch Kranke Aktuelle Paradigmen in der Psychopathologie und –therapie (s.u.): 1) Das biologische Paradigma 2) Das psychoanalytische Paradigma 3) Das Humanistische bzw. existentielle Paradigma 4) Lerntheoretische bzw. behavioristische Paradigmen 5) Das kognitive Paradigma 6) Das Diathese-Stress-Modell (ein integratives Paradigma) Experiment zur Wirkung von Paradigmen (Langer und Abelson, 1974): Verhaltenstherapeuten und Psychoanalytikern wird ein Interview mit einem Mann präsentiert, der entweder als „Stellenbewerber“ (A) oder als „Patient“ (B) charakterisiert wird; Aufgabe der Therapeuten ist es, die „Angepasstheit“ dieses Mannes einzustufen. Ergebnis: In Bedingung A: kein Unterschied, in Bedingung B: Analytiker halten das Verhalten des „Patienten“ für wesentlich gestörter als die Verhaltenstherapeuten Erklärung: Analytiker beschränken sich bei ihrer Einschätzung nicht nur auf das gezeigte Verhalten, sondern gehen darüber hinaus! 3 2. Gegenwärtige Paradigmen der Psychopathologie 2.1. Das biologische Paradigma 2.1.1. Grundannahmen: Somatogene Hypothese: Alle psychischen Störungen sind organisch bedingt, sprich: auf somatische bzw. physiologische Ursachen zurückzuführen. Solche Ursachen können sein: a) Vererbung b) Biochemie des Nervensystems c) Fehlentwicklung oder Verletzung von Gehirnstrukturen Beispiele: Schizophrenie (=> genetische Disposition) Manie (=> Überschuss an Noradrenalin) Demenzen (=> Schädigung von Gehirnstrukturen) Interventionsmaßnahmen zielen auf die Beeinflussung biologischer Prozesse (Medikamente, chirurgische Eingriffe); die Wirksamkeit nichtbiologischer Interventionen (Psychotherapie) wird dabei jedoch nicht geleugnet; auch sie können körperliche Prozesse beeinflussen. 2.1.2. Forschungsansätze: Die Verhaltensgenetik: untersucht, inwiefern individuelle Unterschiede im Verhalten auf genetische Unterschiede zurückgeführt werden können. Sie bedient sich dabei folgender Methoden: 1) Familienstudien Dabei werden Personen, die eine Störung aufweisen (sog. „Indexfälle“), identifiziert und anschließend untersucht, ob Verwandte dieser Personen ein im Vergleich zur Normalpopulation höheres Risiko aufweisen, ebenfalls an dieser Störung zu erkranken (Prävalenzrate). Beispiel (Schizophrenie): Verwandte ersten Grades (50% genetische Übereinstimmung) haben ein 10 Mal höheres Risiko an Schizophrenie zu erkranken als die Normalpopulation (10% zu 1%)! 2) Zwillingsstudien Dabei werden ein- und zweieiige Zwillinge (100- und 50%ige Übereinstimmung) hinsichtlich einer Krankheit verglichen; stimmen sie darin überein, spricht man von Konkordanz! Ist die Konkordanz bei eineiigen Zwillingen höher als bei zweieigen, ist das ein Index für die Erblichkeit der betreffenden Krankheit, da ja sowohl eineiige-, als auch zweieiige Zwillinge jeweils denselben Umwelteinflüssen ausgesetzt sind (Annahme der gleichen Umwelt!) 4 3) Adoptionsstudien Dabei werden Kinder untersucht, die getrennt von ihren psychisch kranken Eltern aufwachsen. Vorteil: Anders als bei Familien- und Zwillingsstudien kann hier der Einfluss von Erziehungseinflüssen von vornherein ausgeschlossen werden. 4) Linkage-Analysen Untersuchung von vererbten genetischen Markern: Treten in Indexfamilien genetische Besonderheiten auf?! Zwischen Phäno- und Genotyp muss genau unterschieden werden: ersterer ist nicht statisch, sondern entwickelt sich in Abhängigkeit vom Genotyp und der Umwelt! Wichtig: Psychische Störungen sind Störungen des Phänotyps und nicht des Genotyps! Ob sie auftreten oder nicht, hängt dementsprechend nicht nur von der genetischen Disposition, sondern auch von Umwelteinflüssen ab! Biochemie des Nervensystems: Das Nervensystem besteht auf Neuronen, die sich ihrerseits aus Zellkörper, Zellkern (Nukleus), mehreren kurzen Dendriten und einem (oder mehreren) langen Axonen zusammensetzen; an letzteren befinden sich die „Endknöpfe“, die zusammen mit dem synaptischen Spalt und der postsynaptischen Membran eine Synapse bilden. Aktionspotenziale führen dazu, dass die synaptischen Vesikel in den „Endknöpfen“ eines Axons Neurotransmitter in den synaptischen Spalt freigeben; diese lagern sich an entsprechenden Rezeptoren der postsynaptischen Membran an und ermöglichen so die Weiterleitung des Signals an das folgende Neuron (Öffnung von Ionenkanälen Veränderung des Membranpotenzials). Ausgeschüttete Neurotransmitter, die sich nicht an Rezeptoren anlagern konnten, werden entweder abgebaut oder durch einen Wiederaufnahmemechanismus (ReUptake) in die präsynaptische Zelle zurückgeholt. Die im Zusammenhang mit psychischen Störungen wichtigsten Neurotransmitter sind: a) Noradrenalin b) Serotonin c) Dopamin d) Gamma-Aminobuttersäure (GABA) Psychopathologische Symptome werden meistens durch den Mangel oder Überschuss eines bestimmten Neurotransmitters verursacht. Ursachen für ein solches Ungleichgewicht können sein: Fehler in der Synthese des betreffenden Neurotransmitters (= gestörter Stoffwechselprozess) Gestörter Re-Uptake-Mechanismus Defekt, Mangel oder Überschuss postsynaptischer Rezeptoren 5 2.1.3. Bewertung: 2.2. Gefahr des Reduktionismus: Psychische Störungen sollten nicht auf ihre biologischen Grundlagen reduziert werden! 1) Wäre eine solche Reduktion willkürlich (man könnte ebenso gut noch eine Ebene „tiefer“ gehen und die Biologie auf Atomphysik reduzieren) 2) Ist das Ganze mehr als die Summe seiner Teile (Emergenzprinzip)! Ein biologisches Modell bedeutet in keinem Fall, dass psychotherapeutische Methoden unwirksam sind! Das lerntheoretische (behavioristische) Paradigma 2.2.1. Theoretischer Hintergrund: Historischer Hintergrund: Die Behavioristen (Watson etc.) wollten Anfang des 20.Jh. weg von der Introspektion, hin zu naturwissenschaftlichen Methoden; sie forderten daher, Bewusstseinsvorgänge ganz aus den psychologischen Überlegungen auszuklammern („Black Box“) und sich stattdessen ganz auf beobachtbares Verhalten zu konzentrieren (Reiz-Reaktions-Zusammenhänge)! Grundannahme: Pathologisches Verhalten ist genau wie normales Verhalten erlernt! Klassische Konditionierung (Pawlow, Watson): Die wiederholte Kopplung eines bedingten Reizes (CS) an einen unbedingten (UCS) führt zum Erlernen einer bedingten Reaktion (UCR => CR)! Beispiele: Der Pawlowsche Hund (Glocke + Futter => Speichelsekretion); Watson und der kleine Albert (Weiße Ratte + lautes Metallgeräusch => Angstreaktion); auch allergische Reaktionen sind z. T. kondioniert, deshalb fängt es oft schon an zu jucken, wenn man eine Katze nur sieht! Psychopatholgische Anwendung: v.a. bei emotionalen Störungen (z.B. Phobien) Operante Konditionierung (Thorndike, Skinner): fasst die Konsequenzen eines Verhaltens ins Auge (instrumentelles Lernen); positive Verstärkung = Hinzufügung eines positiven Reizes; negative Verstärkung = Entzug eines aversiven Reizes; „Shaping“ = sukzessive Annäherung an ein Zielverhalten durch Verstärkung Beispiel: „Skinner-Box“ (Ratten lernen, einen Hebel zu betätigen, um sich Futter zu verschaffen) Psychopathologische Anwendung: z.B. das Erlernen aggressiven Verhaltens im Kindes- und Jugendalter (durch Verstärkung); Zwei-Faktoren-Theorie der Angst (s.u.) Modelllernen bzw. stellvertretendes Lernen (Bandura): zeigt, dass Lernen auch ohne offene Reaktion oder direkte Verstärkung stattfinden kann „Zwei-Faktoren-Theorie der Angst“ (Mowrer & Miller): Das zugrundeliegende Experiment: Ratten lernen in einem Konditionierungsexperiment (Klingel + Stromschlag) nicht nur das Fürchten, sondern auch entsprechende Vermeidungsreaktionen. 6 Zwei Lernschritte bzw. Faktoren sind entscheidend: 1) In einem ersten Schritt wird durch klassische Konditionierung Angst als Reaktion auf einen Reiz gelernt Innere Schmerz- Furchtreaktion 2) Im zweiten Schritt wird die Angst durch operante Konditionierung zum Antrieb für das Erlenen von Vermeidungsverhalten, sofern letzteres durch die Reduktion der Angst negativ verstärkt wird Offene Vermeidungsreaktion Angst lässt sich vor diesem Hintergrund aus 2 Perspektiven betrachten: a) als emotionale Reaktion, die gelernt wird wie jede andere Reaktion b) als Stimulus bzw. Antrieb für Vermeidungsverhalten Drei-Ebenen-Modell: Psychische Störungen sind multidimensional; sie äußern sich auf 3 Ebenen: 1) Verhaltensebene 2) Physiologisch-humorale Ebene 3) Subjektiv-kognitive Ebene Bewertung des behavioristischen Paradigmas: Noch ist es nicht gelungen, psychische Störungen auf spezifische Lernprozesse zurückzuführen. 2.2.2. Interventionsmaßnahmen (Verhaltenstherapie) Die Verhaltenstherapie entstand in den 50er Jahren; sie verwendet Lernmethoden (klassisches und operantes Konditionieren sowie Modelllernen), um abnormes Verhalten, Denken und Fühlen zu verändern. Bekannte Interventionsmaßnahmen sind: Gegenkonditionierung: Löschung einer Reaktion A + Konditionierung einer neuen Reaktion B, indem unangenehme Reize an positive gekoppelt werden. Systematische Desensibilisierung (nach Wolpe): Aufstellen einer Angsthierarchie; Kopplung der angstbesetzten Reize an Entspannungsübungen => der Patient stellt sich, während er entspannt ist, die Reihe der angstauslösenden Situationen vor Aversives Konditionieren: Konditionierung von Angstreaktionen zur Blockierung unerwünschter Verhaltensweisen (Vgl. Clock-Work-Orange); z.B. bei Drogensucht; wird heute jedoch aus ethischen Gründen kaum noch angewendet Flooding / Implosionstherapie: Intensive Darbietung des angstauslösenden Reizes => Überstrapazierung des Angstreflexes => Körperliche Erschöpfung und Hemmung der Reflexbereitschaft Operante Konditionierung: SORCK-Gleichung von Kanfer und Phillips (s.u.) 7 2.3. Das kognitive Paradigma und sonstige Paradigmen 2.3.1. Das Kognitive Paradigma Wichtige Vertreter: BECK, ELLIS Kognitive Psychologen nehmen nicht nur das Verhalten, sondern auch die Kognitionen in den Blick. Kognitionen = Wahrnehmungsprozesse, Urteile, Attributionen etc. Auch Konditionierungsprozesse werden als kognitive Prozesse aufgefasst: das klassische Konditionieren z.B. als aktiver Lernvorgang, bei dem die Beziehung zw. zwei Ereignissen gelernt wird! Dysfunktionalen Kognitionen wird eine wichtige Rolle bei der Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen zugeschrieben. Sie zu verändern, gilt daher als Hauptziel psychotherapeutischer Intervention. Neben kognitiven Methoden werden aber auch immer verhaltenstherapeutische Maßnahmen eingesetzt ( daher: kognitive Verhaltenstherapie!) Rational-emotive Verhaltenstherapie (Ellis): zielt v.a. auf die „Austreibung“ irrationaler Überzeugungen Kognitive Umstrukturierung (Reattributionstrainings; Selbst-Instruktion etc.) 2.3.2. Sonstige Paradigmen Das psychodynamische Paradigma: Freud & Co. „Psychodynamisch“ bezieht sich auf die Wechselwirkung der drei Instanzen („Ich“, „Es“, „Über-Ich“) Das humanistische bzw. existentielle Paradigma: Rogers & Co. 2.4. Das Diathese-Stress-Modell Das Diathese-Stress-Modell ist ein integratives Modell; es berücksichtigt nämlich sowohl biologische als auch psychologische und umweltbedingte Faktoren. Grundannahme: Zur Ausbildung einer Störung bedarf es sowohl einer „Diathese“ als auch einer „Stress“-Komponente. Eine „Diathese“ ist eine Prädisposition für eine Krankheit; sie kann biologischer (z.B. Genetik, Infektionen, schlechte Ernährung etc.), psychologischer (z.B. kognitiver Stil) oder soziokultureller Art sein (z.B. Schlankheitswahn). „Stress“ meint schädliche oder ungünstige Umweltreize (z.B. der Tod eines Partners, ein Trauma, der Verlust des Arbeitsplatzes etc.) Vorhersagen: Wo keine Diathese vorliegt, ist die Stresskomponente meist irrelevant (sie führt zu keiner Störung), umgekehrt führt eine Diathese i.d.R. nur dann zu einer Störung, wenn entsprechende Umweltbelastungen hinzukommen. Vorteil: Das Diathese-Stress-Modell erlaubt es, die verschiedenen Paradigmen miteinander zu verknüpfen und deren Einseitigkeiten zu überwinden. Die verschiedenen Komponenten einer Störung (biologische, psychologische etc.) können je nach Art der Störung unterschiedlich gewichtet und bei der Behandlung berücksichtigt werden. 8 3. Klassifikation und Diagnostik 3.1. Die wichtigsten Klassifikationssysteme (DSM-IV und ICD-10) 3.1.1. Geschichte diagnostischer Systeme 1882: Der Statistik-Ausschuss der „Royal Medico-Psychological Association“ erstellt das erste Klassifikationsschema psychischer Krankheiten; es wird jedoch nicht einmal von den Mitgliedern allgemein anerkannt. 1939: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erweitert die „International List of Causes of Death“ (ICD) um psychische Störungen. 1952: Die „American Psychiatric Association“ (APA) veröffentlicht ihr eigenes „Diagnostic and Statistical Manual of mental diseases“ (DSM-I). Psychoanalytisch ausgerichtet 1980: Die APA veröffentlicht das DSM-III, das nicht nur wesentlich umfangreicher als seine Vorgänger ist (über 400 Seiten), sondern auch ansonsten zahlreiche Veränderungen aufweist: Der Begriff der „Neurose“ wird entfernt Um die Reliabilität zu steigern, werden statt beschreibender Definitionen („Prosa“) klare diagnostische Kriterien genannt Einführung des multiaxialen Systems: Jede Person soll im Hinblick auf 5 Dimensionen bzw. Achsen beurteilt werden 1992: Die WHO veröffentlicht die ICD-10 („International Classification of Diseases“, 10. Revision), die dem DSM-IV recht ähnlich ist. 1994: DSM-IV (s.u.) 2000: DSM-IV-TR (für Textrevision) ist die aktuellste Version des Diagnosehandbuchs, unterscheidet sich inhaltlich aber kaum vom DSM-IV 2010/11: Geplante Veröffentlichung des DSM-V 3.1.2. Das Wichtigste zum DSM-IV Allgemeines: Name: „Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen“ (DSM) Herausgeber: „American Psychiatric Association“ (APA) Verwendung: international; in Deutschland eher in forschungsorientierten Einrichtungen Grundannahme: Störungen können als Symptom-Gruppen (Cluster) beschrieben werden! Bei der Diagnose nach dem DSM-IV sind 5 verschiedene Dimensionen bzw. Achsen zu berücksichtigen (enorme Informationsmenge): 1) Achse I: Alle psychischen Störungen außer Persönlichkeitsstörungen und geistiger Behinderung die für die Diagnose wichtigste Achse enthält 14 verschiedene Störungsgruppen (s.u.): z.B. Affektive Störungen... 2) Achse II: Persönlichkeitsstörungen und geistige Behinderung enthält Langzeitstörungen und wird deshalb von Achse I unterschieden zu den versch. Arten von Persönlichkeitsstörungen: s.u. 3) Achse III: Medizinische Krankheitsfaktoren (= körperliche Störungen) Z.B. Diabetes; Herzerkrankungen etc. 9 Kodiert werden körperliche Störungen nur dann, wenn sie einen Einfluss auf die diagnostizierte psychische Störung haben (dieser kann z.B. auch darin bestehen, dass bestimmte Medikamente nicht verschrieben werden können) 4) Achse IV: Psychosoziale und umgebungsbedingte Probleme z.B. Eheprobleme, finanzielle Probleme, Tod eines Angehörigen etc. 5) Achse V: Globale Beurteilung des beruflichen und sozialen Funktionsniveaus (= Angepasstheit) Engl.: „Global Assessment of Functioning“ (GAF) Funktionsniveau (Leistungsfähigkeit, soz. Integriertheit etc.) wird auf einer Skala von 1-100 eingestuft, wobei zw. 91 und 100 eine hervorragendes, zw. 1 und 10 ein massiv gestörtes Funktionsniveau vorliegt! Die wichtigsten Kategorien der Achse I: 1. Störungen, die gewöhnlich zuerst im Kleinkindalter, in der Kindheit oder Adoleszenz diagnostiziert werden z.B. Trennungsangst, Aufmerksamkeitsdefizits-/Hyperaktivitätsstörung, Lernstörungen etc. (s.u.) 2. Delir, Demenz, amnestische und andere kognitive Störungen Delir = Bewusstseinstrübung; Demenz = Abbau der geistigen Fähigkeiten; amnestische Störungen = Störungen des Gedächtnisses, die weder auf Delir noch Demenz zurückgeführt werden können 3. Substanzinduzierte Störungen liegen vor, wenn die Drogeneinnahme die berufliche und soziale Leistungsfähigkeit beeinträchtigt 4. Schizophrenie und andere psychotische Störungen (gestörter Realitätsbezug…) 5. Affektive Störungen (bei massiven Gemütsschwankungen) 3 Unterarten: Major Depression, Manie, bipolare Störung 6. Angststörungen (bei irrationaler und überproportionaler Angst) 6 Unterarten: spezifische Phobien, Panikstörung, generalisierte Angststörung, Zwangsstörung, posttraumatische Belastungsstörung, akute Belastungsstörung 7. Somatoforme Störungen (körperliche Symptome ohne physiologische Ursache) 5 Unterarten: Somatisierungsstörung, Konversionsstörung, Schmerzstörung, Hypochondrie, körperdysmorphe Störung 8. Vorgetäuschte Störungen 9. Dissoziative Störungen (plötzliche Bewusstseinsänderungen, die das Gedächtnis und Identitätsgefühl beeinträchtigen) Unterarten: dissoziative Amnesie („Memento“), dissoziative Fugue („Stiller“), dissoziative Identitätsstörung („Fight Club“), Depersonalisationsstörung (Kafka) 10. Psychosexuelle Störungen Unterarten: Paraphilien (z.B. Exhibitionismus, Sadismus etc.), sexuelle Funktionsstörungen (Impotenz, EP etc.), Störungen der Geschlechtsidentität 11. Essstörungen 2 Hauptkategorien: a) Anexoria nervosa (Magersucht); b) Bulimia nervosa 12. Schlafstörungen 2 Hauptkategorien: a) Dyssomnien (Störung der Schlafquantität und -qualität); b) Parasomnien (ungewöhnliche Ereignisse während des Schlafs: Schlafwandeln, Alpträume etc.) 13. Störungen der Impulskontrolle, nicht andernorts klassifiziert z.B.: Intermittierende explosive Störung (Wutausbrüche), Kleptomanie, Pyromanie, pathologisches Spielen, Trichotillomanie (= Haare ausreißen) 10 14. Anpassungsstörungen Symptome in Folge von Belastungsfaktoren (z.B. Tod eines Verwandten) Kategorien der Achse II: Persönlichkeitsstörungen = überdauernde, tiefgreifende, unflexible und schlecht angepasste Verhaltensmuster und Erlebensweisen a) Paranoide PS Cluster b) Schizoide PS A c) Schizotypische PS d) Antisoziale PS e) Borderline PS Cluster f) Histrionische PS B g) Narzisstische PS h) Vermeidend-selbstunsichere PS Cluster i) Dependente PS C j) Zwanghafte PS Restkategorie (auf Achse I oder II?!): „Andere Zustände, die von klinischem Interesse sein können“ Darunter fallen alle möglichen Gründe, wegen derer man einen Therapeuten aufsuchen kann: z.B. Schulschwierigkeiten, antisoziales Verhalten, zwischenmenschliche Probleme (etwa zw. Geschwistern), Berufsprobleme (z.B. Unzufriedenheit mit der Arbeit) usw. usw. Allgemeines zur Diagnose: Zu jedem Krankheitsbild werden unter B. mehrere Symptome genannt, von denen immer eine bestimmte Mindestanzahl vorliegen muss, um eine Diagnose zu rechtfertigen. Darüber hinaus setzt jede Diagnose voraus, dass… a) …eine deutliche Einschränkung des sozialen und beruflichen Lebens vorliegt und/oder über subjektives Leiden geklagt wird (C.) b) …die Symptome nicht auf die direkte Wirkung einer Substanz oder eines medizinischen Krankheitsfaktors zurückgeführt- und nicht durch eine andere Störung besser erklärt werden können. 3.1.3. Das Wichtigste zum ICD-10 Allgemeines: Name: Die 10. Revision der International Classification of Deseases (ICD-10) Herausgeber: Weltgesundheitsorganisation (WHO) Aufbau: Die ICD umfasst möglichst alle Krankheiten; psychische Störungen werden im 5. Kapitel (Abschnitt F) behandelt Verwendung: eher im europäischen Raum, im dt. Gesundheitswesen weiter verbreitet als das DSM-IV Psychische Störungen werden in 10 Hauptgruppen gegliedert: F0: Organische, einschließlich psychischer Störungen Hirnverletzungen und –schädigungen unterschiedlichster Art F1: Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen F2: Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen F3: Affektive Störungen F4: Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen F5: Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren Essstörungen, nichtorganische Schlafstörungen, sex. Funktionsstörungen F6: Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen 11 F7: Intelligenzminderung F8: Entwicklungsstörungen F9: Verhaltens- und emotionale Störungen in der Kindheit und Jugend Kodierung: Allgemein: F = psychische Störung 1. Zahl nach dem F = Hauptgruppe (s.o.) 2. Zahl nach dem F = Nähere Spezifizierung Zahlen nach dem Punkt = Zusatzinfos Beispiel: F 32.2 = Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen 3 = Hauptgruppe 3 (Affektive Störungen) 2 = Depressive Episode .2 = mit psychotischen Symptomen Vergleich zum DSM-IV: Gemeinsamkeiten: Große Ähnlichkeit bezüglich der einzelnen Kategorien Unterschiede: Im Unterschied zum DSM-IV verlangt die ICD-10 keine multiaxiale Beurteilung; außerdem: andere Kodierung (s.o.) 3.1.4. Chancen und Probleme der Klassifikation Chancen: Diagnostische Systeme… …geben Auskunft über die Ursachen einer Störung …erlauben Prognosen …erleichtern die Auswahl einer optimalen Behandlungsmethode …bilden die Grundlage weiterer Forschung Klassifikationssysteme reduzieren Information, so dass zwangsläufig ein Teil der Einmaligkeit der untersuchten Person verloren geht. Aber: Klassifizieren ist ein unabdingbarer Teil menschlichen Denkens! Ob die für die Klassifikation berücksichtigten Infos die entscheidenden sind, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden; es könnte also durchaus sein, dass triviale Ähnlichkeiten überbetont und relevante Ähnlichkeiten (noch) vernachlässigt werden. Klassifikationen können zu Stigmatisierungen führen. Die Anzahl der zur Diagnose notwendigen Symptome (s.o.) ist mehr oder minder willkürlich! Sowohl das DSM-IV als auch die ICD-10 sind kategoriale Klassifikationssysteme, sie verlangen dem Kliniker also diskrete Ja-/Nein-Entscheidungen ab: Liegt eine Störung vor oder nicht? Dass sich „normales“ und „abnormes“ Verhalten auf einem Kontinuum bewegen und in verschiedenen Ausprägungen auftreten können, bleibt damit unberücksichtigt. Aber: Auch dimensionale Klassifikationen (Einstufung auf einer quantitativen Skala) haben Nachteile: 1. Müssen auch sie einen Grenzpunkt beinhalten, der eine diskrete Klassifikation erlaubt. 2. Liegt dimensionalen Variablen (wie z.B. Bluthochdruck) häufig eine diskrete Variable (z.B. das Vorhandensein eines Gens) zugrunde. Diagnostische Systeme implizieren, dass die von ihnen verwendeten Kategorien kulturell unabhängig sind (im DSM-IV wird eine solche Unabhängigkeit für manche Störungen sogar explizit postuliert). Zwar gibt es in der Tat kulturübergreifende Symptome (so z.B. Wahnvorstellungen bei Schizophrenie oder Energielosigkeit bei Depression), die 12 Beurteilung dieser Symptome kann jedoch in Abhängigkeit vom kulturellen Kontext variieren. Auch die Symptome selbst sind z.T. kulturabhängig: z.B. sind Schuldgefühle bei Depressionen in westlichen Gesellschaften sehr häufig, in Japan und im Iran dagegen eher selten. Sogar bestimmte Krankheiten als ganze können kulturell bedingt sein: Anorexia z.B. tritt (fast) nur in westlichen Gesellschaften auf. Trotz standardisierter Interviews bleibt auf Seiten des Therapeuten nach wie vor ein großer Ermessensspielraum und damit Raum für subjektive Verzerrungen: Was z.B. ist ein „übersteigertes Selbstwertgefühl“? Reliabilität = Genauigkeit, mit der ein Test ein bestimmtes Merkmal misst Drei Arten von Reliabilität lassen sich unterscheiden: 1. Interrater-Reliabilität: Übereinstimmungsgrad zw. 2 Beobachtern Sensitivität: Übereinstimmung darin, dass eine bestimmte Diagnose vorliegt! Spezifität: Übereinstimmung darin, dass eine bestimmte Diagnose nicht vorliegt! 2. Test-Retest-Reliabilität: Übereinstimmungsgrad zweier Messungen an derselben Person 3. Interne Konsistenz: Zusammenhang der Items eines Tests Die Reliabilitäten der DSM-IV und ICD-10-Diagnosen sind größtenteils zufriedenstellend; die meisten Kappa-Koeffizienten (um die zufällige Übereinstimmung bereinigte Interrater-Reliabilität) liegen über bzw. knapp unter .70 (=gut)! Tatsächliche Reliabilität (unter klinischen Alltagsbedingungen) vermutlich etwas niedriger! Validität = Genauigkeit, mit der ein Test das misst, was er messen soll Drei Arten diagnostischer Validität (=Konstruktvalidität): 1. Ätiologische Validität: ist gegeben, wenn für die Störung von Patienten mit gleicher Diagnose die gleichen lebensgeschichtlichen Umstände verantwortlich sind. Bei Schizophrenie z.B.: Genetische Prädisposition, aufreibende Vorkommnisse, virale Infektion der Mutter etc. 2. Übereinstimmungsvalidität: ist gegeben, wenn sich weitere Symptome, die nicht zur eigentlichen Diagnose gehören, als charakteristisch erweisen. Bei Schizophrenie z.B.: geringe soziale Fertigkeiten, Beeinträchtigung des Gedächtnisses etc. 3. Vorhersagevalidität: ist gegeben, wenn Patienten mit derselben Diagnose einen ähnlichen Verlauf aufweisen und ähnlich auf best. Behandlungsmethoden reagieren. Bei Schizophrenie z.B.: Episodischer Verlauf, gutes Ansprechen auf medikamentöse Therapien 13 4. Klinische Erhebungsverfahren 4.0. Allgemeine Vorbemerkungen Klinische Erhebungsverfahren dienen dazu, herauszufinden… …was mit einem Menschen nicht stimmt …wie sich die Störung auf den verschiedenen Ebenen äußert (emotional, kognitiv, auf der Verhaltensebene und auf der Persönlichkeitsebene) …wo die Ursachen der betreffenden Störung liegen könnten …welche Behandlungen präventiv oder kurativ wirksam sein könnten …wie wirksam therapeutische Interventionen sind Grundsätzlich kann zwischen psychologischen und biologischen Verfahren unterschieden werden. Welche Verfahren bevorzugt und wie sie im Einzelnen angewandt werden, hängt dabei nicht zuletzt vom zugrundegelegten Paradigma ab. Reliabilität und Validität der Verfahren ist unterschiedlich! 4.1. Psychologische Erhebungsverfahren 4.1.1. Klinische Interviews Ein „Interview“ ist jeder zwischenmenschliche Austausch, der zum Sammeln von Informationen genutzt wird. Unterschieden werden kann zwischen strukturierten und weniger strukturierten Interviews. In strukturierten Interviews sind sowohl die Formulierung als auch die Reihenfolge der Fragen vorgegeben (s.u.). Vorteil: Erhöhte Reliabilität; standardisierte Daten In der Praxis liegen klinischen Interwies jedoch meistens nur grobe Leitlinien zugrunde. Jeder Therapeut entwickelt so im Laufe seiner Berufszeit einen eigenen Interviewstil. Problem: Geringe Reliabilität einzelner Interwies; es muss jedoch bedacht werden, dass i.d.R. mehrere Interviews geführt werden. Strukturierte Interviews: sind z.B. das „Strukturierte Klinische Interview für die Achse I des DSM-IV“ (SKID-I) oder das „Diagnostische Interview bei psychischen Störungen“ (DIPS) Aufbau des SKID-I: Das SKID ist ein verzweigtes Interview, d.h. die Antwort des Patienten auf eine Frage bestimmt, welche Frage als nächstes gestellt wird (Entscheidungsbaum). Screening zur Erfassung der Kernsymptome Detaillierte Nachfrage zu Störungsbildern, bei denen die Kernsymptome vorliegen Beurteilung der Symptome auf einer dreistufigen Skala Dauer: 1 ½ Stunden, wenn keine gravierende Symptomatik vorliegt, entsprechend länger, wenn mehrere Problembereiche vorliegen Problem: kann ermüdend und belastend sein (z.B. Retraumatisierung) Merkmale eines klinischen Interviews: a) Beachtung non-verbalen Verhaltens Es geht in klinischen Interviews nicht nur darum, was der Patient antwortet, sondern auch darum, wie er antwortet. b) Einfluss des Paradigmas Das Paradigma des Interviewers bestimmt, was für Infos gesucht-, wie sie gewonnen- und wie sie interpretiert werden. 14 c) Bedeutung der Beziehung Ein klinisches Interview setzt auf Seiten des Patienten Vertrauen und auf Seiten des Therapeuten ein hohes Maß an Empathie voraus. d) Unklare Verlässlichkeit der Information Problematisch ist a) dass sich die Klienten über ihre eigene Lage oft nicht hinreichend bewusst sind, um sie zu erörtern und b) dass ihre Antworten in hohem Maß von situativen Faktoren abhängig sind (Erscheinungsbild des Therapeuten etc.) 4.1.2. Psychologische Tests Psychologische Tests sind standardisierte Prozeduren, um die Leistung oder Persönlichkeit einer Person zu messen; sie können ergänzende Infos für eine Diagnose liefern, wenn das Interview zu keinem eindeutigen Ergebnis führt. Dass psychologische Tests standardisiert sind, heißt, dass ihre Auswertung anhand statistischer Normen erfolgt, die aus der Normalpopulation gewonnen wurden. Unterscheiden werden kann zwischen: 1. Persönlichkeitsfragebögen (NEO-FFI etc.) 2. Projektiven Persönlichkeitstests (TAT etc.) 3. Intelligenztests (HAWIE, HAWIK, CFT etc.) 4. Spezifischen Tests (etwa zur Erhebung des dispositionellen und zustandsgebundenen Angstniveaus: State-Trait-Angstinventar) Beispiele für Persönlichkeitsfragebögen: Das „Minnesota Multiphasic Personality Inventory“ (MMPI) ist der im klinischen Kontext am häufigsten eingesetzte Persönlichkeitstest! Eher ein Inventar klinischer Störungen als ein allgemeiner Persönlichkeitstest. Die „Symptom-Checkliste-90“ (SC-90): enthält 90 Items und misst insgesamt 9 Skalen, nämlich: Somatisierung, Zwanghaftigkeit, soziale Unsicherheit, Depressivität, Ängstlichkeit, Aggressivität, phobische Angst, paranoides Denken und Psychotizismus. Generell geht es darum, die subjektiv empfundene Beeinträchtigung durch körperliche und psychische Symptome innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen zu erheben. Das Freiburger Persönlichkeitsinventar (FPI): erhebt mehrere Skalen; darunter: Lebenszufriedenheit, Leistungsorientierung, soziale Orientierung, Gehemmtheit, Aggressivität und Extraversion. Das NEO-Fünf-Faktoren-Inventar (NEO-FFI): basiert auf dem FünfFaktoren-Modell der Persönlichkeit („big five“), erhoben werden 1. Neurotizismus; 2. Extraversion; 3. Offenheit für Erfahrungen; 4. Verträglichkeit; 5. Gewissenhaftigkeit. Zu projektiven Tests: In projektiven Tests geht es um die subjektive Beurteilung mehrdeutigen Reizmaterials; die hinter den Tests stehende Grundannahme wird als „Projektionshypothese“ bezeichnet; sie besagt, dass in den Antworten der Pbn unbewusste Einstellungen und Motive zu Tage treten. Beispiele für projektive Tests: Rohrschach-Test: sammelt Assoziationen zu 10 Klecksbildern Thematischer Apperzeptionstest (TAT): Pbn schreiben zu einer Reihe bildhafter Szenen kurze Geschichten Scenotest: Mithilfe von Figuren und Gegenständen sollen Alltagsszenen aufgestellt werden Problem projektiver Tests: Schwierige Auswertung; fragliche Reliabilität 15 4.1.3. Beobachtungsverfahren Die klinische Verhaltensbeobachtung orientiert sich an dem sog. SORKC-Modell (Kanfer und Phillips): S (Stimuli): bezieht sich auf die Stimuli und Umgebungsfaktoren, die dem problematischen Verhalten vorausgehen Bei Schlafstörungen z.B. das Schlafzimmer O (Organismus): bezieht sich auf die relevanten psychologischen und physiologischen Faktoren innerhalb der Person, die den Umwelteinfluss moderieren. Bei Schlafstörungen z.B. eine hohe Erregung durch Ehe- oder Berufsprobleme R (Reaktion): bezieht sich auf die Verhaltensmuster, die das Problem bedingen bzw. damit einhergehen Bei Schlafstörungen z.B. wach im Bett liegen, etwas essen, fernsehen etc. K (Kontingenz): bezieht sich auf den Zusammenhang zwischen R und C. C (Konsequenzen): bezieht sich auf die Ereignisse, die der Reaktion folgen und diese verstärken bzw. bestrafen. Kurzfristige Konsequenzen: positive Verstärkung (interessanter Film, gutes Essen); negative Verstärkung (Ablenkung von Sorgen) Mittel- und langfristige Konsequenzen: „Bestrafung“ (Konzentrationsprobleme, Müdigkeit etc.) Prinzipiell kann zwischen direkten Beobachtungsverfahren und Selbstbeobachtungsverfahren unterschieden werden: Direkte Verhaltensbeobachtung: während der Sitzungen, bei Hausbesuchen oder im Rahmen sog. Verhaltensexperimente, wozu z.B. Rollenspiele, In-vivoExpositionen und „Behaviour Avoidance Tests“ (BAT) zählen. Ein BAT wäre z.B. die sukzessive Annäherung an einen phobischen Reiz (etwa eine Spinne). Erleichtert werden kann die direkte Beobachtung z.B. durch die Methode des „lauten Denkens“ Selbstbeobachtung: in Form von Selbstaussage-Fragebögen, Tagebucheinträgen oder Protokollen; erfolgt die Selbstbeobachtung in Echtzeit spricht man auch von einer „Ökologischen Momentaufnahme“ (ÖMA) Probleme: Gedächtnisverzerrungen, Reaktanz! Letztere ist jedoch nicht nur ein Nachteil, sondern therapeutisch von großem Nutzen! 4.2. Biologische Erhebungsverfahren 4.2.1. Bildgebende Verfahren Computertomographie (CT): ist ein Verfahren zur Darstellung von Gehirnstrukturen Dabei wird aus vielen einzelnen Röntgenaufnahmen (aus unterschiedlichen Winkeln und Schichten) ein Bild von der Dichteverteilung des Körper- bzw. Gehirngewebes errechnet! Es gilt: Je dichter das Gewebe => desto mehr Röntgenstrahlen werden absorbiert => desto heller das auf die Detektorplatte projizierte Bild Magnetresonanz- bzw. Kernspintomographie (MRT): ist ebenfalls ein Verfahren zur Darstellung von Gehirnstrukturen Durch elektromagnetische Impulse werden die Wasserstoffatome (genauer: deren Kerne => H+) zunächst in eine Richtung ausgerichtet („Alignment“) und anschließend ihr Eigendrehimpuls („Spin“) registriert (=elektromagnetisches 16 Signal). Auf diese Weise kann die Wasserstoffkonzentration und damit die Durchblutungsstärke der verschiedenen Hirnregionen sichtbar gemacht werden. Vorteile: MRT liefert nicht nur bessere Bilder als die CT, sondern benötigt auch weniger Strahlung! Funktionelle Kernspintomographie (fMRT): dient der Abbildung zerebraler Prozesse! fMRT basiert auf dem BOLD-Effekt („Blood Oxygenation Level Dependent Contrast“): In aktivierten Hirnregionen steigt der Anteil sauerstoffhaltigen Bluts („Oxyhämaglobin“); oxygeniertes (O2-haltiges) Blut ist dabei magnetischer als Deoxyhämaglobin und sendet dementsprechend ein stärkeres BOLD-Signal aus. Positronenemissionstomographie (PET): kann sowohl zur Abbildung von Hirnstrukturen, als auch zur (räumlichen und zeitlichen) Abbildung zerebraler Prozesse genutzt werden! Verschiedene stoffwechselrelevante Moleküle (z.B. Sauerstoff oder Glukose) werden chemisch mit kurzlebigen Radionukletiden markiert und in den Blutkreislauf injiziert; die so markierten Moleküle sammeln sich an den Orten des Stoffwechsels an und die durch ihren Zerfall ausgelöste (γ-) Strahlung wird aufgezeichnet. Viele Vorteile (geringe Strahlenbelastung, sehr genau, in-vivo-Untersuchungen etc.), aber: sau-teuer (wegen der Gewinnung der Radionukletiden) 4.2.2. Psychophysiologische Methoden Die Psychophysiologie befasst sich mit den physischen Prozessen, die als Begleiterscheinung psychischer Ereignisse auftreten oder mit den psychischen Merkmalen einer Person zusammenhängen. Somatisches Nervensystem: steuert bewusste Vorgänge (z.B. die Kontraktion von Muskeln) und kann willkürlich gesteuert werden Autonomes (=vegetatives oder viszerales) Nervensystem: steuert unbewusste Vorgänge (z.B. die Atmung oder Verdauung) und kann nur bedingt willkürlich gesteuert werden Unterteilt sich in Sympathikus (überwiegend exzitatorisch: Erhöhung der Herzfrequenz etc.) und Parasympathikus (überwiegend dämpfend: Verlangsamung des Herzschlages etc.) Elektrokardiogramm (EKG): misst die Aktionspotenziale des Herzmuskels und damit die Herzfrequenz Elektroenzephalogramm (EEG): misst die spontane oder evozierte elektrische Aktivität der Großhirnrinde Blutdruck: Systolischer Blutdruck (maximaler Wert während der Austreibungsphase): normalerweise bei ca. 120 mmHg (Millimeter Quecksilber) Diastolischer Blutdruck (minimaler Wert während der Füllungsphase): normalerweise bei ca. 80 mmHg Skin Conductance Response (SCR); Skin Resistance Response (SRR): gibt Auskunft über die Hautleitfähigkeit und damit über die Schweißproduktion: je mehr Schweiß, desto besser die Hautleitfähigkeit bzw. desto geringer der Hautwiderstand 17 4.2.3. Neurochemische Methoden Neurochemische Verfahren dienen dazu, die Menge der Neurotransmitter bzw. ihrer Rezeptoren zu messen. Bei Post-Mortem-Untersuchungen werden verschiedene Hirnregionen verstorbener Patienten mit Substanzen infundiert, die sich an bestimmte Rezeptoren binden, und anschließend die Bindungsmenge ermittelt. Eine andere Möglichkeit besteht darin, Blut, Urin oder Gehirn- und Rückenmarksflüssigkeit von Patienten auf Metaboliten zu untersuchen, um auf die Menge des entsprechenden Neurotransmitters zu schließen. Metaboliten sind Abbauprodukte von Neurotransmittern; der wichtigste Metabolit von Dopamin ist z.B. Homovanillinsäure (HVA), von Serotonin ist es 5-Hydroxyindolessigsäure (5-HTAA) 4.2.3. Neuropsychologische Verfahren Neuropsychologische Tests dienen dazu, anhand von Verhaltensstörungen bzw. kognitiven Defiziten auf Funktionsstörungen des Gehirns zu schließen. Haben recht hohe Validität, da die Kompensation neurologischer Störungen in den Testaufgaben weitaus schwieriger ist als bei Alltagstätigkeiten. Beispiele für neuropsychologische Tests: Die Halstead-Reitan-Batterie: umfasst vier Tests 1. Taktiler Leistungstest (Zeit): Einpassung unterschiedlich geformter Klötze in ein Formenbrett (mit verbundenen Augen natürlich!) 2. Taktiler Leistungstest (Gedächtnis): Das Formenbrett muss anschließend aus dem Gedächtnis gezeichnet werden => Test 1 und 2 sind Indikatoren für eine Läsion im rechten Parietallappen 3. Kategorientest: Erschließen von Kategorisierungsregeln anhand nonverbaler Rückmeldungen (Zuordnung von Bildern zu Zahlen zw. 1 und 4) => Allgemeiner Indikator für eine Hirnschädigung 4. Lautwahrnehmungstest: Zuordnung sinnloser Silbenreihen zu Worten => Funktion der linken Hemisphäre Die Luria-Nebraska-Batterie: besteht aus 11 Teilen und testet u.a. motorische Fertigkeiten, rhythmische, melodische und räumliche Fertigkeiten, Sprachverständnis, Ausdrucksvermögen und Gedächtnis. Der Uhren-Test (wird in der Demenzdiagnostik eingesetzt): Aufgabe ist es, auf einen Kreis eine bestimmte Uhrzeit samt Zahlen und Zeigern einzuzeichnen Maximal erreichbare Punktzahl beträgt 7: Ist die 12 oben => 2 Punkte; sind alle Zahlen eingezeichnet => 1 Punkt; sind Stunden- und Minutenzeiger vorhanden => 2 Punkte; entspricht ihre Position der vorgegebenen Uhrzeit => 2 Punkte Uni- bzw. kontralateraler Neglect: Aufmerksamkeitsstörung, bei der eine Körperhälfte inklusive Gesichtsfeld ignoriert wird; tritt meist nach rechtsseitiger Parietallappenschädigung auf und kann folgendermaßen getestet werden: Uhrentest => Neglectpatienten tragen alle Zahlen in einer Hälfte ein Halbierung horizontaler Linien => Neglectpatienten vernachlässigen die Linien auf der einen Seite ganz und „halbieren“ die beachteten Linien (bei rechtshemisphärischer Störung) rechts vom Mittelpunkt 18 6. Methoden zur Untersuchung gestörten Verhaltens 6.1. Wissenschaftstheoretisches 6.1.1. Was ist Wissenschaft? Wissenschaft ist das Streben nach systematisiertem Wissen durch Beobachtung. Dazu gehört einerseits die systematische Erhebung und Bewertung von Informationen, andererseits die Entwicklung von Theorien zur Erklärung dieser Informationen. Wissenschaftliche Aussagen müssen eine Vielzahl von Gütekriterien erfüllen; die wichtigsten sind: Sie müssen überprüfbar sein (=> präzise Formulierung und Falsifizierbarkeit) Sie müssen zuverlässig sein (=> Replizierbarkeit, Reliabilität und Objektivität) Sie müssen valide sein (=> d.h. auf die Wirklichkeit übertragbar sein) 6.1.2. Was sind Theorien und theoretische Konstrukte? Wissenschaftliche Theorien dienen dazu, Zusammenhänge zu erklären. Sie müssen empirisch überprüft werden („context of justification“); erlauben aber gleichzeitig die Bildung von Hypothesen und geben so der empirischen Forschung erst ihre Richtung („context of discovery“)! Theorien enthalten Konstrukte (z.B. das Konstrukt „Angst“), die sich zwar nicht unmittelbar beobachten lassen, dafür aber die beobachteten Zusammenhänge vereinfachen und damit überhaupt erst verständlich machen! Solche theoretischen Konstrukte überbrücken häufig Zeit-Raum-Beziehungen und können auf unterschiedliche Weise operationalisiert werden! „Angst“ z.B. kann erklären, warum Personen auf ganz unterschiedliche Situationen (Gewitter, Prüfung etc.) auf ähnliche Weise reagieren; das Konstrukt überbrückt somit die Lücke zwischen Situation und Reaktion und vereinfacht dadurch die beobachteten Zusammenhänge. Operationalisiert werden kann „Angst“ z.B. durch einen Fragebogen oder physiologische Maße (Zittern, Herzrate, Schweiß etc.). 6.2. Forschungsmethoden der klinischen Psychologie 6.2.1. (Einzel-)Fallstudien Eine Einzelfallstudie beruht auf der Sammlung von familiengeschichtlichen, biographischen und anderen krankheitsrelevanten Informationen zu einem einzelnen Patienten. Auf welche Art von Infos dabei besonders Wert gelegt wird, hängt vom zugrunde gelegten Paradigma ab. Eine berühmte Fallstudie ist Freuds Studie über „Anna O.“; sie bildete den Ausgangspunkt für Freuds Theorie der Hysterie und legte damit den Grundstein für die Psychoanalyse! Einzelfallstudien erlauben weder Kausalitätsaussagen, noch dürfen sie verallgemeinert werden. Trotzdem sind sie in bestimmten Zusammenhängen durchaus sinnvoll! Sie ermöglichen die detaillierte Darstellung eines seltenen Phänomens bzw. einer neuen Diagnose- oder Therapiemethode! Besonders zur dissoziativen Identitätsstörung (s.u.) gibt‟s viele Einzelfallstudien, da sie sehr selten und recht spektakulär ist! Entkräftung angeblich universal gültiger Aussagen einer Theorie! Entwicklung neuer Forschungshypothesen! 19 6.2.2. Epidemiologische Forschung Die Epidemiologie untersucht a) die Häufigkeit und b) die Verteilung einer Störung in einer Population; sie versucht dabei v.a., folgende 3 Merkmale zu bestimmen: 1) Die Prävalenz: ist eine Kenngröße für die Häufigkeit einer Krankheit; sie entspricht dem Anteil erkrankter Personen einer Population zu einem bestimmten Zeitpunkt bzw. über einen bestimmten Zeitraum. Berechnung: Anzahl der Kranken / Anzahl aller Untersuchten Drei Arten von Prävalenz können unterschieden werden: a) Punktprävalenz: Anteil der Kranken zu einem bestimmten Zeitpunkt b) Periodenprävalenz: Anteil der Kranken über einen bestimmten Zeitraum (z.B. im Jahr 2009) c) Die Lebenszeitprävalenz: Anteil derjenigen Personen, die bis zum Zeitpunkt der Befragung mindestens ein Mal von der Krankheit betroffen waren. 2) Die Inzidenz: entspricht der Anzahl der Neuerkrankten in einer definierten Population während einer bestimmten Zeit (üblicherweise einem Jahr)! Randbemerkung: Die so ermittelten Prävalenz- und Inzidenzraten sind jedoch keineswegs eindeutig, sondern hängen u.a. von der gewählten Population (Männer, Frauen, Jugendliche, Deutsche, Amis etc.), den zugrundegelegten Diagnosekriterien (DSM-IV, ICD-10 etc.) und den verwendeten Interviewverfahren zur Ermittlung der Symptome ab. Die Angaben schwanken daher z.T. enorm! 3) Risikofaktoren: Bedingungen, deren Vorliegen die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung erhöht! Z.B. Geschlecht; sozioökonomischer Status; genetische Vorbelastung etc. Eine Größe, die im Zusammenhang mit Risikofaktoren oft berechnet wird, ist der „Odds Ratio“: Ein „Odds“ entspricht der Erkrankungswahrscheinlichkeit innerhalb einer bestimmten Gruppe (p); geteilt durch die zugehörige Gegenwahrscheinlichkeit (1-p) Der „Odds Ratio“ ist der Quotient aus den Odds zweier Gruppen; ist das Risiko für die beiden untersuchten Gruppen (z.B. Männer und Frauen) gleich groß, liegt er bei 1! Zum Nutzen epidemiologischer Untersuchungen: Bilden die Grundlage für gesundheitspolitische Entscheidungen (Planung ausreichender Therapiemöglichkeiten, Initiierung präventiver Maßnahmen etc.) Erlauben die Generierung neuer Hypothesen (von den Risikofaktoren zu genaueren Erklärungen; z.B.: „Nicht der sozioökonomische Status selbst, sondern die schlechte Ernährung könnte entscheidend sein!“…) 6.2.2. Korrelationsstudien Die Korrelationsmethode untersucht, ob zwischen zwei oder mehr Variablen ein Zusammenhang besteht; anders als in einem Experiment wird dabei jedoch keine Manipulation vorgenommen; die Variablen werden also so untersucht, wie sie natürlich auftreten! Die Korrelationsmethode ist in der klinischen Psychologie weit verbreitet: Sie bildet beispielsweise die Grundlage für die Ermittlung von Risikofaktoren (s.o.): Korreliert die klassifikatorische Variable Krankheit (ja/nein) mit anderen 20 Variablen (wie z.B. dem Cortisolspiegel, dem sozioökonomischen Status oder der Reaktionsbereitschaft auf Stressoren)?! Wichtig: Die Korrelationsmethode findet keineswegs nur in der Feldforschung, sondern auch in Laboruntersuchungen Anwendung! Ein gängiges korrelatives Design ist der Vergleich zwischen einer Patientenstichprobe und einer gesunden Kontrollgruppe. Ob ein Zusammenhang statistisch signifikant ist, hängt zum einen von der Höhe der Korrelation, zum anderen von der Größe der Stichprobe ab. Dabei gilt: Je größer die Stichprobe, desto geringer kann r sein, um noch signifikant zu werden! Das Problem der Korrelationsmethode besteht darin, dass Korrelationen keine Aussagen über Kausalität erlauben. 1) Ist die Wirkrichtung nicht bekannt, sprich: selbst wenn ein kausaler Zusammenhang bestehen sollte, kann nicht geklärt werden, welche Variable welche verursacht! 2) Kann nicht ausgeschlossen werden, dass der gefundene Zusammenhang auf den Einfluss einer dritten Variable (= Kovariable) zurückgeht und dementsprechend gar nicht kausal ist! Dass die Anzahl der Kirchen in einer Stadt mit der Anzahl der dort begangenen Straftaten korreliert, liegt z.B. an der Einwohnerzahl! Vorteile von Korrelationsstudien: Korrelationsstudien ermöglichen die Generierung neuer Hypothesen! Korrelationsstudien können dazu genutzt werden, vorhergesagte Verursachungen zu wider-legen! Longitudinal angelegte Korrelationsstudien erlauben durchaus Aussagen über die Wirkrichtung des Zusammenhangs, schließlich wird die Ursache in ihnen vor der Wirkung erhoben. Das gängigste Design sind in diesem Zusammenhang sog. Risikostudien, bei denen die Pbn nach bestimmten Risikofaktoren ausgewählt - (z.B. schizophrenes Elternteil) und dann über einen längeren Zeitraum beobachtet werden. 6.2.3. Das Experiment Das Experiment erlaubt die Feststellung kausaler Beziehungen zwischen 2 oder mehr Variablen. Dazu müssen v.a. folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 1) Zufällige Zuteilung (Randomisierung) der Pbn zu den Versuchsgruppen (Experimentalgruppe und Kontrollgruppe) und Kontrolle von Störvariablen 2) Manipulation der unabhängigen Variable (UV = angenommene Ursache) 3) Objektive und reliable Messung der abhängigen Variable (AV = angenommene Wirkung) Die wichtigsten Schritte bei der Versuchsplanung: 1) Aufstellen einer experimentellen Hypothese z.B.: „Seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen hat einen positiven Effekt auf die Gesundheit!“ 2) Identifizierung und Operationalisierung der Experimentalvariablen UV (die Pbn Aufsätze über traumatische Ereignisse oder über Alltäglichkeiten schreiben lassen) AV (Anzahl der Besuche des Gesundheitszentrums in den Wochen vor dem Treatment und den Wochen nach dem Treatment) 3) Beurteilung der Messergebnisse (=> Signifikanztest) 21 Interne- vs. externe Validität: Interne Validität bedeutet, dass die gefundenen Effekte eindeutig auf die Manipulation der UV zurückführbar sind. Gewährleistet wird die interne Validität durch… Eine Kontrollgruppe, die abgesehen vom Treatment (also der UV) genauso behandelt wird wie die Experimentalgruppe(n). In Studien zur Wirksamkeit bestimmter Interventionsmaßnahmen werden meist Placebo-Kontrollgruppen eingesetzt, da bereits die Tatsache, dass eine Intervention vorgenommen wird (unabhängig davon, ob sie eine spezifische Wirkung hat oder nicht!) einen Einfluss auf den Genesungsprozess hat (was hilft, ist oft schon der Therapeutenkontakt an sich oder die Hoffnung auf Besserung). Solche Placebostudien sind freilich ethisch bedenklich und bedürfen einer vorherigen Einverständniserklärung! Eine andere Möglichkeit sind Kontrollgruppen, an denen gar keine Behandlung durchgeführt wird (sog. Wartelisten-Gruppen) Zufällige Zuordnung zu den besagten Gruppen Doppel-Blind-Methode (um den Rosenthal-Effekt auszuschließen) Nur bei Medikamentenstudien einsetzbar, da der Psychotherapeut schließlich wissen muss, was er tut! Kontrolle von Störvariablen Externe Validität bedeutet, dass sich die Ergebnisse einer Untersuchung über das unmittelbare Experiment hinaus verallgemeinern lassen! Besonders bei Labor- und Tierexperimenten ist die externe Validität oft fraglich. Ähnliche Untersuchungen unter neuen Bedingungen mit neuen Teilnehmern (Replikation) Feldstudien In der klinischen Psychologie werden experimentelle Designs v.a. dazu eingesetzt, die Wirksamkeit von Therapien zu untersuchen! Dabei ist Folgendes zu beachten: Unterscheidung zwischen Efficacy und Effectiveness: Efficacy-Studien sind experimentelle Laborstudien (RCT-Studien = Randomized Controlled Trials); ihr Vorteil besteht darin, dass sie eine hohe interne Validität aufweisen; ihre externe Validität ist jedoch fraglich! Effectiveness-Studien sind Feldstudien ohne randomisierte Gruppenzuteilung und Treatment-Manipulation (=> Post-hoc-Vergleiche). Ihr Vorteil besteht in der hohen externen Validität, ihre Schwachstelle ist die interne Validität! Auftretende Effekte: Verschlechterung, keine Veränderung, spontane Verbesserung, therapeutische Veränderung! Unterscheidung zwischen statistischer und klinischer Signifikanz: Eine statistisch signifikante Veränderung liegt vor, wenn sie mit einer hohen (meist 95%igen) Wahrscheinlichkeit nicht zufällig aufgetreten ist! Klinisch signifikant ist eine Veränderung nur dann, wenn sie darüber hinaus einen klinisch bedeutsamen Unterschied macht. Wenn Depressive sich nach einer bestimmten Therapie statistisch gesehen besser fühlen, aber trotzdem noch depressiv sind, ist das z.B. nicht der Fall! 22 6.2.4. Analogie-Experimente Viele wichtige Fragen, insbesondere was die Ursachen von Störungen betrifft, können aus ethischen Gründen nicht experimentell untersucht werden! Beispiele: Wie viel Stress muss induziert werden, damit jemand eine Schizophrenie entwickelt?! Entwickeln Kinder, mit denen nur wenig gesprochen wird, eher eine Depression? Etc. etc. Man versucht sich in diesen Fällen mit sog. Analogieexperimenten zu behelfen; kennzeichnend für diese Art von Experimenten ist, dass ein verwandtes Phänomen untersucht wird. Untersuchung von gesunden Pbn, die einer klinischen Stichprobe ähneln (weil sie z.B. hohe Werte auf einer Depressionsskala haben) Tierversuche Experimentelle Induktion von störungsspezifischen Symptomen: z.B. kann Angst induziert werden, indem man die Pbn einen Vortrag halten lässt) Das Problem von Analogieexperimenten ist die externe Validität, also die Frage, ob die durch sie gewonnenen Ergebnisse tatsächlich generalisierbar sind! 6.2.5. Experimentelle Einzelfalluntersuchung Bei der experimentellen Einzelfalluntersuchung werden einzelne Pbn verschiedenen Bedingungen ausgesetzt. Ein gängiges Vorgehen ist dabei die Umkehrtechnik (ABAB-Versuchsplan): Dabei folgt 2 Mal hintereinander auf eine Baselineerhebung (A) ein Treatment (B); ändert sich die AV (z.B. der Depressionsgrad) in Abhängigkeit von der jeweiligen Untersuchungsphase, spricht das für die Wirksamkeit des Treatments! Die experimentelle Einzelfalluntersuchung ist lediglich ein quasi-experimentelles Design: da es keine Kontrollgruppe gibt und lediglich eine Person untersucht wird (anstelle einer repräsentativen Stichprobe) ist weder die interne, noch die externe Validität gesichert. Trotzdem können experimentelle Einzelfalluntersuchungen unter bestimmten Bedingungen sinnvoll sein: Vorabuntersuchungen (zur Frage, ob eine größer angelegte Untersuchung sich überhaupt lohnen könnte) Kausalzusammenhänge können erschlossen, aber kaum verallgemeinert werden! 6.2.6. Gemischte Versuchspläne Gemischte Versuchspläne kombinieren korrelative und experimentelle Methoden; sie enthalten nämlich sowohl klassifikatorische, als auch experimentelle Variablen; manipuliert werden können lediglich letztere. Probanden aus 2 oder mehr diskreten Populationen (z.B. Schizophrene, Phobiker und Gesunde) werden zu gleichen Teilen den verschiedenen Versuchsbedingungen (z.B. verschiedenen Therapieformen) zugewiesen. Nutzen: Gemischte Versuchspläne können zeigen, dass experimentelle Variablen (z.B. Therapieform) je nach klassifikatorischer Variable (z.B. Krankheitsbild oder Störungsgrad) unterschiedlich wirken kann! 23 5. Affektive Störungen 5.1. Allgemeine Merkmale affektiver Störungen 5.1.0. Die wichtigsten affektiven Störungen im Überblick Affektive Störungen sind Störungen der Stimmungslage, die die Betroffenen stark beeinträchtigen. Zwei Hauptgruppen affektiver Störungen lassen sich unterscheiden: 1. Depressive Störungen (auch als unipolare Störungen bezeichnet): liegen vor, wenn nur depressive Symptome auftreten 2. Bipolare affektive Störungen: liegen vor, wenn sowohl depressive als auch manische, nur manische (sehr selten!) oder gemischte Episoden auftreten Darüber hinaus lassen sich 2 chronische affektive Störungen unterscheiden: 1. Dysthymie: chronische Depressivität 2. Zyklothymie: Chronischer Wechsel zwischen Phasen mit depressiven und solchen mit hypomanen Symptomen Das DSM IV unterscheidet zwischen: Affektiven Episoden: 1. Episode einer Major Depression (=> minore Depression = subklinisch) 2. Manische Episode 3. Gemischte Episode 4. Hypomane Episode Depressiven Störungen (monopolare Depression): 1. Major Depression: eine oder mehrere Episoden einer Major Depression 2. Dysthyme Störung: depressive Verstimmung über 2 Jahre, aber keine volle Major Depression-Episode Bipolaren Störungen: 1. Bipolare I-Störung: eine oder mehrere manische oder gemischte Episoden, meist durch depressive Episoden unterbrochen 2. Bipolare II-Störung: eine oder mehrere depressive Episoden, mind. eine hypomane Episode 3. Zyklothyme Störung: hypomane und depressive Symptome über 2 Jahre, die nicht die Kriterien eigener Episoden erfüllen Affektive Störungen nach dem ICD-10: F 30: Manische Episode F 31: Bipolare Störung F 32: Depressive Episode F 33: Rezidivierende depressive Störung F 34: Anhaltende affektive Störung F 38: Sonstige Affektive Störungen F 39: Andere affektive Störungen NNB F 43: Anpassungsstörung F53.0: Postpartum-Depression (in den ersten 4 Wochen nach einer Entbindung) F 06.3: Organische affektive Störung Früher unterschied man zw. endogenen- (= „von innen kommenden“); neurotischenund reaktiven Depressionen: erstere führte man auf rein biologische Ursachen zurück; letztere wurden als Reaktion auf aktuell belastende Ereignisse verstanden und die neurotischen Depressionen (auch als „Erschöpfungsdepression“ bezeichnet) wurden auf lang anhaltende Belastungen zurückgeführt. 24 5.1.1. Depressive Episoden Definition: Bei der Depression handelt es sich um einen emotionalen Zustand, der durch starke Traurigkeit und Niedergeschlagenheit, Gefühle der Wertlosigkeit und Schuld, sozialen Rückzug, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, mangelnde Libido sowie Interessen- und Freudlosigkeit gekennzeichnet ist. Sie tritt in Phasen auf, die unbehandelt zw. 6 und 8 Monaten andauern, und wird häufig von anderen psychischen Problemen (Konzentrationsproblemen, sexueller Dysfunktion etc.) begleitet. Verhalten/Motorik/Erscheinungsbild: Körperhaltung: kraftlos, gebeugt Bewegung: motorische Immobilität (Katatonie) oder ziellose Aktivität (Agitiertheit), sprich: nervöses Händereiben usw. Gesichtsausdruck: traurig, besorgt; starre, maskenhafte Mimik usw. Unfähigkeit, Alltagsprobleme zu bewältigen Vernachlässigung der Körperhygiene Affektive Symptome: Gefühle von Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, Hilflosigkeit, Schuld, Einsamkeit etc. Gefühl der Gefühllosigkeit und Distanz zur Umwelt Gefühl des Überfordert-Seins Interessen- und Freudlosigkeit Kognitive Symptome: Negatives Selbstbild, Pessimismus etc. Verlangsamtes Denken, Konzentrations- und Gedächtnisprobleme, Entscheidungsprobleme Z.T. Wahnvorstellungen (Erwartung von Katastrophen usw.) Motivationale Symptome: Misserfolgsorientierung; Hilflosigkeit; Antriebslosigkeit Suizidideen Physiologisch-vegetative Symptome: Innere Unruhe und Erregtheit oder Energieverlust Schlafstörungen Libidoverlust Appetit- und Gewichtsverlust Allg. vegetative Beschwerden (Verdauungsprobleme, Kopfschmerzen etc.) Veränderungen der sozialen Interaktion: Sozialer Rückzug Zunehmende Abhängigkeit von anderen Häufigkeit typischer Symptome bei Depression: Die fünf häufigsten Symptome sind Insomnie (bei 100%), traurige Verstimmung (bei 100%), Weinerlichkeit (bei 94%), Konzentrationsschwierigkeiten (bei 91%) und Suizidgedanken (bei 82%!) Recht selten sind: Selbstmordversuche (bei 15%) und akustische Halluzinationen (bei 6%) Morgens ist die depressive Verstimmung i.d.R. schlimmer! 25 Diagnostische Kriterien nach dem DSM-IV: Major Depression, einzelne Episode Die formale Diagnose einer Major Depression setzt das Vorhandensein einer depressiven Episode voraus, die mindestens 5 der folgenden Symptome über mindestens 2 Wochen erfüllt, wobei entweder die depressive Stimmung oder der Verlust an Interesse und Freude zu den Symptomen gehören muss: 1) Depressive Verstimmung an fast allen Tagen, die meiste Zeit des Tages Beachte: kann sich bei Kindern und Jugendlichen auch als reizbare ! Verstimmung äußern! ! 2) Deutlich vermindertes Interesse oder Freude an allen oder fast allen Aktivitäten 3) Verminderter Appetit und Gewichtsverlust oder gesteigerter Appetit und Gewichtszunahme Bei Erwachsenen: mehr als 5% des Körpergewichts in einem Monat! Bei Kindern: Ausbleiben der zu erwartenden Gewichtszunahme! 4) Schlafstörungen: Schlaflosigkeit (Insomnie) oder (seltener) vermehrter Schlaf an fast allen Tagen 5) Auffällige (= von anderen beobachtbare) Veränderung des Aktivitätsniveaus, genauer: psychomotorische Unruhe oder Verlangsamung 6) Müdigkeit oder Energieverlust an fast allen Tagen 7) Gefühl der Wertlosigkeit und/oder unangemessene (z.T. wahnhafte) Schuldgefühle an fast allen Tagen 8) Verminderte Denk-, Konzentrations- und Entscheidungsfähigkeit (entweder nach subjektivem Ermessen oder von anderen beobachtet) 9) Wiederkehrende Gedanken an den Tod oder einen Suizid Alle genannten Symptome müssen folgende Voraussetzungen erfüllen: a) Sie dürfen nicht die Kriterien einer gemischten Episode erfüllen b) Sie müssen Leiden verursachen und das berufliche oder soziale Leben des Betroffenen beeinträchtigen c) Die Symptome dürfen weder auf einen medizinischen Krankheitsfaktor (z.B. Hypothyreose), noch auf die direkte Wirkung von Substanzen (z.B. Medikamente oder Drogen) zurückgeführt werden können. d) Die Symptome dürfen nicht durch einfache Trauer besser erklärt werden können (dazu müssen sie z.B. nach einem Todesfall über 2 Monate andauern) Diagnostische Kriterien nach der ICD-10: Depressive Episode (F 32.X) Die Dauer einer depressiven Episode muss (genau wie nach dem DSM-IV) mindestens 2 Wochen betragen. In dieser Zeit müssen mindestens 2 der folgenden 3 Symptome vorliegen: 1. Depressive Stimmung 2. Interessen- und Freudlosigkeit 3. Verminderter Antrieb oder erhöhte Ermüdbarkeit Darüber hinaus müssen mehrere weitere Symptome vorliegen: Die im ICD-10 genannten Symptome entsprechen dabei weitgehend denen des DSM-IV, mit dem einzigen Unterschied, dass statt neun insgesamt zehn Symptome genannt werden: Verlust des Selbstwertgefühls und Schuldgefühle werden nämlich getrennt aufgeführt! Die ICD-10 unterscheidet im Unterschied zum DSM-IV zwischen… a) einer leichten depressiven Episode (F 32.0): bei insgesamt 4 Symptomen b) einer mittelgradigen depressiven Episode (F 32.1): bei 5 Symptomen c) einer schweren depressiven Episode (F 32.2): bei 7 Symptomen 26 4.1.2. Manische Episoden Definition: Die Manie ist ein emotionaler Zustand, der durch eine intensive, aber unbegründete Euphorie, Hyperaktivität, Geschwätzigkeit, Ideenflucht, Ablenkbarkeit, unrealistische Pläne und ziellose Aktivitäten gekennzeichnet ist. Sie entwickelt sich meist plötzlich, innerhalb von ein bis zwei Tagen, und kann einige Tage bis mehrere Monate andauern. Häufigkeit typischer Symptome bei Manie: Am häufigsten sind u.a.: Irritierbarkeit (bei 100%), ein übersteigerter Rededrang (bei 99%), Euphorie (bei 98%), Labilität (bei 95%), Ideenflucht (bei 93%), Insomnie (bei 90%) und Größenideen (bei 86%) Etwas seltener, aber immer noch recht häufig, treten u.a. Depressionen (bei 68%), Wahnideen (bei 48%) und eine gesteigerte Libido (bei 32%) auf. Promiskuität (11%) und Selbstmordgedanken (7%) sind eher selten. Diagnostische Kriterien nach dem DSM-IV: Manische Episode Eine mindestens einwöchige (bei Hospitalisierung auch kürzere) abgegrenzte Periode mit abnorm und anhaltend gehobener, expansiver oder reizbarer Stimmung. Während der Periode der Stimmungsveränderung bestehen mindestens 3 (bei nur reizbarer Stimmung min. 4) der folgenden Symptome in einem deutlichen Ausmaß: 1. Übersteigertes Selbstwertgefühl oder Größenideen 2. Vermindertes Schlafbedürfnis (nach 3 Stunden ausgeruht) 3. Vermehrte Gesprächigkeit oder Rededrang 4. Ideenflucht oder subjektives Empfinden des Gedankenrasens 5. Erhöhte Ablenkbarkeit 6. Psychomotorische Unruhe oder gesteigerte Betriebsamkeit (im sozialen, beruflichen oder sexuellen Bereich) 7. Übermäßige Beschäftigung mit angenehmen Aktivitäten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit unangenehme Konsequenzen nach sich ziehen (z.B. ungezügeltes Einkaufen, sexuelle Eskapaden, törichte Investitionen etc.) Alle genannten Symptome müssen folgende Voraussetzungen erfüllen: a) Sie dürfen nicht die Kriterien einer gemischten Episode erfüllen b) Sie müssen das berufliche oder soziale Leben des Betroffenen beeinträchtigen, eine Hospitalisierung erforderlich machen (Selbst- oder Fremdgefährdung) oder mit psychotischen Symptomen einhergehen. c) Die Symptome dürfen weder auf einen medizinischen Krankheitsfaktor (z.B. Hypothyreose), noch auf die direkte Wirkung von Substanzen (z.B. Drogen, Medikamente) zurückgeführt werden können. Vorsicht: Manieähnliche Symptome können auch durch somatische Behandlungen bei Depression (Antidepressiva, Lichttherapie etc.) hervorgerufen werden! Diagnostische Kriterien nach der ICD-10: Manische Episode (F 30) Definition ist dieselbe wie im DSM-IV; ebenso die Anzahl der erforderlichen Symptome (3 oder 4) Der einzige Unterschied: Statt 7 Symptomen werden im ICD-10 9 Symptome genannt: Verlust normaler sozialer Hemmungen Gesteigerte sexuelle Energie und sexuelle Taktlosigkeiten 27 4.1.3. Hypomane Episoden Definition: Bei einer Hypomanie (griech. „hypo“ = „unter“) handelt es sich um eine Veränderung von Verhalten und Stimmung, die weniger ausgeprägt ist als bei einer richtigen Manie. Diagnostische Kriterien nach dem DSM-IV: Hypomane Episode Über 4 Tage anhaltend gehobene, expansive oder reizbare Stimmung, auffällig gegenüber normaler Stimmungslage Vgl. manische Episode: Eine mindestens einwöchige (bei Hospitalisierung auch kürzere) abgegrenzte Periode mit abnorm und anhaltend gehobener, expansiver oder reizbarer Stimmung. Mindestens 3 Symptome einer manischen Episode (s.o.: z.B. Größenideen, verringertes Schlafbedürfnis etc.) müssen erfüllt sein (genau wie bei der Manie) – im Unterschied zur Manie sind die Symptome jedoch nicht so stark, dass es zu Funktionsstörungen kommt, eine Hospitalisierung erforderlich wäre oder psychotische Symptome auftreten. Die Symptome müssen lediglich für andere erkennbar sein und dürfen nicht auf die Wirkung einer Substanz oder eines Krankheitsfaktors zurückgeführt werden können. Kurz: Der Hauptunterschied zw. Manie und Hypermanie besteht darin, dass letztere zu einer weniger deutlichen Beeinträchtigung des alltäglichen Lebens führt! 4.1.4. Gemische Episoden Definition: Unter gemischten Episoden versteht man Phasen, in denen sowohl Symptome der Manie, als auch solche der Depression auftreten – und zwar in kurzem zeitlichen Abstand. 4.1.5. Depressive Störungen Major Depression, einzelne Episode: Vorhandensein einer einzelnen Episode eine Major Depression, wobei diese Episode keine andere Störung (z.B. eine Schizophrenie oder Psychose) überlagern darf. In der im Rahmen der Anamnese erhobenen Vorgeschichte des Patienten darf keine manische, hypomane oder gemischte Epsiode aufgetreten sein (es sei denn diese waren substanz-, behandlungs- oder krankheitsbedingt) Major Depression, rezidivierend (ICD-10: rezidivierende depressive Störung) Vorhandensein von mindestens zwei Episoden einer Major Depression, wobei diese Episoden keine andere Störung (z.B. eine Schizophrenie oder Psychose) überlagern dürfen. Als eigenständig betrachtet werden depressive Episoden, wenn sie durch ein mindestens 2-monatiges Intervall ohne gravierende Symptome voneinander getrennt sind. Ausschluss von manischen-, hypomanen- oder gemischte Episoden (s.o.). Dysthyme Störung: Depressive Verstimmung, die die meiste Zeit des Tages an mehr als der Hälfte aller Tage über einen mindestens 2-jährigen Zeitraum andauert. Beachte: Bei Kindern und Jugendlichen kann reizbare Verstimmung vorliegen und die Daher muss mindestens 1 Jahr betragen! Während der depressiven Verstimmung müssen mindestens 2 der folgenden Symptome vorliegen: Gewichtszunahme oder –abnahme, Schlafstörungen, Energiemangel, geringes Selbstwertgefühl, Konzentrationsund Entscheidungsschwierigkeiten, Hoffnungslosigkeit etc. 28 Innerhalb der ersten 2 Jahre darf weder eine Unterbrechung von 2 oder mehr Monaten-, noch eine Major Depression-Episode aufgetreten sein. Beachte: Vor der Entwicklung einer Dysthymen Störung kann eine MDEpisode aufgetreten sein, vorausgesetzt es fand eine vollständige Remission statt; nach den ersten 2 Jahren kann eine Dysthyme Störung durch MD-Episoden überlagert werden; in diesem Fall können beide Diagnosen gestellt werden. Zu keinem Zeitpunkt ist eine manische, hypomane oder gemischte Episode aufgetreten Die Störung tritt nicht ausschließlich im Verlauf einer chronischen psychotischen Störung auf! Sonderformen: Winterdepression (saisonal bedingt); post-partum Depression (nach der Schwangerschaft); psychotische Depression (Wahnideen und Hallos); Depressionen mit „somatischen“(ICD-10) bzw. „melancholischen“(DSM-IV) Merkmalen (bes. hohe Komorbidtät; Appetitlosigkeit; Symptome morgens am schlimmsten,…) 4.1.6. Bipolare Störungen Bipolar I-Störung: Eine oder mehrere manische oder gemischte Episoden, meist mit MD-Episoden Facts: In 90% der Fälle rezidiv Unbehandelt kommt es in 10 Jahren durchschnittlich zu 4 affektiven Episoden Nur manische Episoden – ohne MD-Episoden sind äußerst selten 60-70% der manischen Episoden treten unmittelbar vor oder nach einer MD-Episode auf Diagnostische Kriterien: Mindestens eine manische oder gemischte Episode in der Vorgeschichte Ausschluss einer schizoaffektiven Störung oder Schizophrenie Bipolar II-Störung: Rezidivierende Episoden einer Major Depression mit hypomanen Episoden Diagnostische Kriterien: Eine oder mehrere Episoden einer MD; mindestens eine hypomane Episode; keine manische oder gemischte Episode; nicht besser erklärbar durch schizoaffektive Störung oder Schizophrenie Innerhalb von 5 Jahren geht die Störung in 5-15% aller Fälle in eine Bipolar IStörung über! Zyklothyme Störung: Über 2 Jahre hypomane und depressive Symptome, die jeweils nicht die Kriterien einer handfesten Episode erfüllen. Diagnostische Kriterien: Über min. 2 Jahre zahlreiche Perioden mit hypomanen und depressiven Symptomen; aber keine Unterbrechung von 2 oder mehr Monaten und keine manische, gemischte oder Major-DepressionEpisode, keine schizoaffektive Störung oder Schizophrenie etc. In 15-50% der Fälle geht eine zyklothyme Störung in eine bipolare über! 29 4.1.7. Differentialdiagnose Differentialdiagnostisch müssen v.a. ausgeschlossen bzw. berücksichtigt werden: Organische Ursachen (Schilddrüsenunterfunktion, Eisenmangel etc.) Substanzinduzierte Störungen Andere affektive Störungen (Dysthymia, bipolare Störung, Anpassungsstörung…) Wichtig, weil die versch. Arten von Depressionen unterschiedlich behandelt werden müssen! Bei Wahnvorstellungen eine schizophrene oder schizoaffektive Störung 4.2. Epidemiologie und Verlauf 4.2.1. Major Depression Die Major Depression ist die am weitesten verbreitete affektive Störung; Frauen sind dabei rund doppelt so häufig von ihr betroffen wie Männer (2:1). Die Lebenszeitprävalenz liegt zw. 13 und 21%; sie ist in den letzten 50 Jahren kontinuierlich angestiegen! Bei Frauen: 10-25% [20-26%] Bei Männern: 5-12% Die Punktprävalenz: Bei Frauen: 5-9% Bei Männern: 2-3% Die Inzidenz liegt bei 2% (pro Jahr 2 Neuerkrankungen auf 100 Personen) Nach der „Burden of Disease“ - Studie der WHO (2001) ist die unipolare Depression in den Industrieländern die häufigste Ursache für mit Beeinträchtigung gelebte Lebensjahre; weitaus häufiger als z.B. Demenzen, Diabetes oder altersbedingte Sehschwächen. Es kann davon ausgegangen werden, dass in Deutschland ca. 4 Mio. Menschen an Depressionen leiden, davon sind zwar rund 60-70% in hausärztlicher Behandlung, nur bei wenigen wird die Depression jedoch erkannt und adäquat behandelt. Durch eine bessere Kooperation mit den Hausärzten und entsprechende Fortbildungen könnte die Versorgung demnach erheblich verbessert werden (großer Optimierungsspielraum)! Populationsspezifische Unterschiede in der Prävalenz: Geschlechtsunterschiede: Das Verhältnis Frauen-Männer ist ca. 2:1 (s.o.); ein weiterer Unterschied besteht darin, dass das Erkrankungsrisiko bei Frauen nach 45 (Wechseljahre etc.) noch einmal massiv zunimmt, während es bei Männern ab 40 kontinuierlich abnimmt! Kohortenunterschiede: Vor 40 Jahren lag das Durchschnittsalter bei Erkrankungsbeginn zwischen 29 und 30 Jahren; heute liegt es bei Mitte 20! Während die Suizidrate bei älteren Menschen (über 65) seit 1930 im Sinken begriffen ist, ist die Jugendlicher (15-24) seit den 60ern im Steigen begriffen (trotzdem ist erstere allerdings nach wie vor höher: s.u.) Die Prävalenz steigt nach der Pubertät von ca. 3% auf 6,4% an! Bei Künstlern und Schriftstellern ist die Prävalenz affektiver Störungen um ein Vielfaches höher als in der Normalpopulation! Nach den DSM-IV besteht keine Korrelation zwischen Major Depression und ethnischen Gruppen, Bildungsgrad, Einkommen oder Familienstand. Bei Verwandten ersten Grades ist die Prävalenz massiv erhöht (s.o.) 30 Verlauf: Den ersten Episoden einer Major Depression gehen häufig psychosoziale Belastungsfaktoren voraus (z.B. der Tod eines Angehörigen). Depressionen haben eine sehr hohe Komorbiditätsrate: In 77% aller Fälle liegt mindestens eine weitere Diagnose vor; am häufigsten sind: Angststörungen, substanzinduzierte Abhängigkeiten und somatoforme Störungen 2/3 der Patienten (50-65%) remittieren vollständig, 1/3 nur z.T. oder gar nicht Bei 10-20% chronischer Verlauf (> 2 Jahre)! Die erste Remissionsphase dauert ca. 2 Jahre, wird aber im Krankheitsverlauf kürzer. 50%-60% der Patienten haben nach einer ersten eine zweite MD-Episode, nach 2 Episoden sind es bereits 70%, nach 3 Episoden 90%! Je mehr Episoden erlebt werden, desto höher ist also die Wahrscheinlichkeit weiterer Episoden! Hohe Mortalitätsrate: 15% der Erkrankten begehen Suizid! 4.2.2. Die übrigen affektiven Störungen Dysthymie: Lebenszeitprävalenz: 2-4% Verhältnis Frauen-Männer: zw. 3:2 und 2:1 Übliches Alter bei Beginn: 10-25 Jahre Bipolare Störung: Lebenszeitprävalenz: 0,6- 3,3% Bei Störungstyp I im Allgemeinen etwas höher als bei Typ II Verhältnis Frauen-Männer: 1:1 Übliches Alter bei Beginn: 15-44 Jahre Verlauf: In 90% der Fälle rezidiv Zyklothymie: Niedrigste Prävalenz; Geschlechterverhältnis: 1:1; übliches Alter bei Beginn: 15-25 Jahre 4.3. Biologische Ätiologiefaktoren 4.3.1. Genetische Faktoren Diverse Familien-, Zwillings- und Adoptionsstudien zeigen, dass genetische Faktoren bei der Entstehung affektiver Störungen eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Familienstudien: Lebenszeitprävalenz ohne genetische Vorbelastung: Bipolare Störung: 0,8% Unipolare Depression: 5,4% Lebenszeitprävalenz bei Personen, die einen Verwandten ersten Grades mit bipolarer Störung haben: Bipolare Störung: 6% (rund 6 Mal höher!) Unipolare Depression: 12% * Bemerkenswert: Auch Verwandte von Patienten mit bipolarer Störung haben häufiger unipolare Depressionen als bipolare Störungen! Lebenszeitprävalenz bei Personen, die einen Verwandten ersten Grades mit unipolarer Depression haben: Bipolare Störung: 2,6% Unipolare Depression: 15% (knapp 3 Mal so hoch!) 31 Zwillingsstudien: Die Konkordanzrate der bipolaren Störung ist bei eineiigen Zwillingen deutlich höher (72-79%) als bei zweieiigen (14-19%), was ein klarer Hinweis auf eine genetische Komponente ist! Dasselbe gilt, wenn auch in weitaus schwächerem Maße, für die unipolare Depression: Auch hier sind die Konkordanzraten eineiiger Zwillinge (25-50%) höher als die zweieiiger Zwillinge (11-40%) Untersuchungen nach dem Diathese-Stress-Modell: Kendler et al. (1995): Die genetische Disposition für eine Major Depression kommt nur dann zum Tragen, wenn „Stressful Life Events“ hinzukommen. Nur dann ist das Risiko vorbelasteter Zwillinge nämlich deutlich erhöht! Caspi et al. (2003): Ein Transportergen für Serotonin, das in zwei Ausprägungen (=Allelen) auftritt, nämlich einer kurzen und einer langen Form, hat sich als genetischer Vulnerabilitätsfaktor für Depression erwiesen. Homozygote Träger des kurzen Allels (s/s) reagieren nämlich empfindsamer auf psychosoziale Stressbelastungen und haben damit nach schweren „Lifeevents“ (z.B. einer Misshandlung zw. 3 und 11 Jahren) ein bis zu doppelt so großes Risiko, an einer Depression zu erkranken, wie die homozygoten Träger des langen Allels (l/l). Wahrscheinlichkeit, nach einer Misshandlung zw. 3 und 11 Jahren an einer Depression zu erkranken: s/s (65%); s/l (45%); l/l (30%) 4.3.2. Biochemische Faktoren Die Noradrenalin- und die Serotonintheorie (auch „Monoaminmangel-Hypothese“ genannt) wurden in den 50er Jahren aufgrund der Wirksamkeit von bestimmten Medikamenten (s.u.) entwickelt. Die Serotonintheorie besagt, dass ein niedriger Serotoninspiegel Depression verursacht. Die Noradrenalintheorie besagt, dass ein zu niedriger Noradrenalinspiegel zu Depression, ein zu hoher zu Manie führt. Befunde, die für die Monoaminmangel-Hypothese sprechen: Die depressionslindernde Wirkung folgender Medikamente und Drogen spricht für die Bedeutsamkeit von Serotonin und Noradrenalin: Trizyklika (z.B. Imipramin, Handelsname: Tofranil) hemmen die Wiederaufnahme von Noradrenalin und Serotonin (Re-Uptake-Hemmer), so dass mehr Neurotransmitter im synaptischen Spalt zurückbleiben und die Transmission des jeweils folgenden Nervenimpulses erleichtert wird. Monoaminoxidase-Hemmer (z.B. Iproniazid): hemmen das Enzym Monoamionoxidase (MAO) und verhindern so den Abbau des wiederaufgenommenen Serotonins und Noradrenalins. Spezifische Serotonin-Reuptake-Hemmer, kurz: SSRIs (z.B. Fluoxetin, Handelsname: Fluctin) wirken selektiver und verhindern speziell die Wiederaufnahme von Serotonin. Amphetamine und Kokain: Erstere erhöhen die Ausschüttung von Noradrenalin und Dopamin, letzteres hemmt deren Wiederaufnahme. Die depressionsfördernde Wirkung folgender Substanzen weist unter umgekehrten Vorzeichen in dieselbe Richtung: AMPT (α-Methyl-p-Tyrosin) hemmt die Umwandlung von Tyrosin zu Dopa und blockiert damit die Synthese von Noradrenalin. Bei rund 70% remittierter Patienten führt die Gabe von AMPT zu einem Rückfall in die 32 Depression; verabreicht man ein Placebo, sind es dagegen nicht einmal 10%, die einen Rückfall erleiden! Durch die Gabe von Reserpin, das die Speicherung von Serotonin und Noradrenalin in Vesikeln hemmt, kann eine Depression induziert werden. Messungen der Transmitter- bzw. Metabolitenkonzentration im Urin, im Blut oder der zerebrospinalen Flüssigkeit (Problem der Validität: Da Neurotransmitter im ganzen Organismus eingesetzt werden, Serotonin z.B. v.a. im Darm, geben solche Messungen nicht unmittelbar die Transmitterkonzentration im Gehirn wieder). Der Noradrenalinspiegel im Urin nimmt bei bipolaren Patienten während depressiver Phasen ab und während manischer Phasen zu. Dasselbe gilt für die Konzentration der Metaboliten, von denen der wichtigste 3-Methoxy-4Hydroxyphenyl-Glykol (MHPG) ist! * Problem: Die erhöhte Konzentration von Noradrenalin (Metaboliten) während manischer Phasen könnte auch auf die erhöhte motorische Aktivität während solcher Phasen zurückzuführen sein! Der Zusammenhang zw. Noradrenalinspiegel und Depression bzw. Manie darf also nicht vorschnell kausal interpretiert werden! Um den Serotoninspiegel zu bestimmen, misst man einen seiner Hauptmetaboliten, die 5-Hdroxyindolessigsäure (5-HIAA); diese sind in der Zerebrospinalflüssigkeit von Depressiven deutlich reduziert. „Tryptophandepletionstest“: L-Tryptophan ist ein Serotoninvorläufer und wirkt depressionslindernd. L-Tryptophan-arme Ernährung führt bei Depressiven zu einer Verschlimmerung der Symptome und bei symptomfreien, aber genetisch vorbelasteten Personen (depressive Verwandte) zu einer Stimmungsverschlechterung. Bei unbelasteten Personen hat die Diät keinen Effekt. Neuere Einwände gegen die Serotonin- und Noradrenalintheorie: 1. MAO-Hemmer und Trizyklika erhöhen den NA- und Serotonin-Spiegel nur während der ersten Tage; ihre depressionslindernde Wirkung setzt jedoch erst nach 7-14 Tagen ein, also zu einem Zeitpunkt, zu dem der Transmitter-Spiegel sich schon wieder auf sein ursprüngliches Niveau eingependelt hat! 2. Neuere Antidepressiva (wie z.B. Lithium) wirken auch ohne direkte Einwirkung auf NA und Serotonin (s.u.). Ergo: Ein einfacher Anstieg des Noradrenalin- oder Serotoninspiegels ist keine hinreichende Erklärung dafür, warum die Medikamente Depression lindern! Aktuelle Forschung: Aufgrund der genannten Einwände konzentriert sich die neuere Forschung v.a. auf postsynaptische Prozesse. Vermutet wird, dass die Antidepressiva postsynaptisch wirken, indem sie a) die Sensibilität der Rezeptoren verändern, b) ihre Anzahl vergrößern oder c) die postsynaptische Transmission modulieren. Zu c: Die Wirkung von Lithium, das sowohl in manischen als auch in depressiven Episoden hilft, wird z.B. darauf zurückgeführt, dass es auf GProteine einwirkt. Letztere bestehen aus einer α-, β-, und γ-Untereinheit. Nach dem Andocken eines Transmitters an einen metabotropen Rezeptor (kein Ionenkanal => indirektes Gating), bindet dieser Rezeptor an der Innenseite der postsynaptischen Membran ein solches G-Protein; die α-Einheit des G-Proteins wird abgespalten und öffnet entweder direkt einen in der Nähe befindlichen Ionenkanal oder indirekt über ein Effektorprotein und die Aktivierung eines second messenger. Bei Patienten mit Manie wurden große Mengen an G-Proteinen-, bei Patienten mit Depression geringe Mengen davon festgestellt. 33 4.3.3. Neuroendokrine (=hormonelle) Faktoren Einschub: Basics zum hormonellen System Die endokrine Übertragung ist der klassische Weg der hormonellen Übertragung: Endokrine Zellen (die sich meist in Hormondrüsen befinden), schütten Hormone aus, die ihrerseits über die Blutbahn zu den z.T. weit entfernten Empfängerzellen gelangen, wo sie verschiedene biologische Prozesse auslösen (Proteinproduktion...) Andere hormonelle Übertragungswege sind die autokrine und die parakrine Übertragung: Bei ersterer sind Sender- und Empfängerzelle identisch, bei letzterer liegen sie nebeneinander. Der Hypothalamus (im Zwischenhirn gelegen) und die Hypophyse (daran angeschlossen) bilden das Zentrum des endokrinen Systems. Der Hypothalamus bildet die Schnittstelle zwischen neuronalem und endokrinem System und ist das Steuerungsorgan der Hormonproduktion. Durch die Ausschüttung von Inhibiting- oder Releasing-Hormonen reguliert der Hypothalamus die Hormonproduktion der Adenohypophyse (Hypophysenvorderlappen); durch die Versorgung mit Oxytocin und Vasopressin die Hormonausschüttung der Neurohypophyse (Hypophysenhinterlappen). Reguliert wird die Aktivität des Hypothalamus dabei v.a. vom limbischen System, aber auch v. höheren Gehirnzentren, Zeitgebern, dem Feedback… Die Hypophyse ist das Ausführungsorgan des Hypothalamus: Die Adenohypophyse segregiert in Abhängigkeit von den „Befehlen“ des Hypothalamus glandotrope Hormone, die die Produktion in anderen Drüsen (s.u.) anregen, und effektorische Hormone, die direkt am Zielorgan wirken (z.B. das Wachstumshormon) Die Neurohypophyse schüttet das vom Hypothalamus erhaltene Vasopressin und Oxytocin aus. Die wichtigsten Hormondrüsen und 34 Einschub: Basics zum hormonellen System Die wichtigsten Hormondrüsen (neben der Hypophyse) sind: die Schilddrüse (unterhalb des Kehlkopfs), die Bauchspeicheldrüse, das Nebennierenmark, die Nebennierenrinde und die Keimdrüsen (Eierstöcke bzw. Hoden); sie produzieren jeweils unterschiedliche Hormone und werden zum größten Teil durch die glandotropen Hormone der Adenohypophyse gesteuert. Die Bauchspeicheldrüse produziert Insulin und Glucagon und reguliert auf diese Weise den Blutzuckerspiegel. Das Nebennierenmark schüttet z.B. in Stresssituationen kurzfristig Adrenalin und Noradrenalin in die Blutbahn aus, was zu einer Funktionssteigerung verschiedener innerer Organe führt (=> Erhöhung der Herzfrequenz, Erweiterung der Bronchien etc.); reguliert wird die Hormonausschüttung des Nebennierenmarks durch den sympathischen Teil des autonomen Nervensystems. Die Nebennierenrinde (!) schüttet Glukokortikoide (v.a. Kortisol) aus, die einerseits für zirkadiane Regulationsmechanismen (wie z.B. die morgendliche Aktivierung nach dem Aufwachen), andererseits in psychischen und physischen Stresssituationen für die Energiebereitstellung (Glukose = Zucker) verantwortlich sind. Reguliert wird die Nebennierenrinde durch die Adenohypophyse (s.u.). Die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (kurz: „HPA-Achse“): ist ein Regelkreis, der v.a. langfristigen Stressreaktionen zugrundeliegt. Stressor limbisches System CRH (Cortikotropin- Hypothalamus CRH Releasing-Hormon) Adenohypohyse ACTH Cortisol: hemmt die CRH-Ausschüttung (=negative Rückkopplung) (Adrenocortikotropin) Nebennierenrinde Glukokortikoide fördern den Abbau von Glykogen (Stärke) aus der Leber und die Bildung von Glukose (Zucker) aus Fett und Proteinen; sie dienen damit der Bereitstellung von Energie. Ist der Kortisolspiegel jedoch über längere Zeit erhöht, hat das diverse Nebenwirkungen: Immunsuppression (Schwächung des Immunsystems); Schädigung der Serotonin- und noradrenergen Rezeptoren (=> depressive Verstimmungen; Beeinträchtigung des Gedächtnisses); Schlafstörungen etc. Es muss zwischen einer kurzfristigen und einer langfristigen (auf chronischen Stress folgenden) Stressreaktion unterschieden werden: Kurzfristige Stressreaktion: Stressor Gehirn Sympathisches Nervensystem Nebennierenmark Noradrenalin und Adrenalin Längerfristige Stressreaktion: Stressor Gehirn Hypophysenvorderlappen Nebennierenrinde Glukokortikoide (insbes. Kortisol) 35 Verschiedene Befunde legen nahe, dass die HPA-Achse bei Depression überaktiv ist: 1) Die vegetativen Symptome einer Depression (Appetit- und Schlafstörungen) könnten durch eine solche Überaktivität bedingt sein. 2) Tatsächlich zeigt sich, dass depressive Patienten einen erhöhten Kortisolspiegel aufweisen. Die Veränderung des Kortisolspiegels über den Tag hinweg ist zwar bei Depressiven und Gesunden im Großen und Ganzen recht ähnlich (Höhepunkt zw. 6:00 und 10:00; mehr oder minder stetiger Abfall bis 02:00), unterliegt bei Depressiven aber größeren Schwankungen. 3) Das sog. Cushing-Syndrom, das durch ein abnormes Wachstum der Nebennierenrinde und einen erhöhten Kortisolspiegel gekennzeichnet ist, geht häufig mit Depression einher. 4) Der erhöhte Kortisolspiegel bei Depressiven kann mit deren Monoaminmangel (s.o.) in Zusammenhang stehen. Eine übermäßige Sekretion von Kortisol kann nämlich sowohl die Dichte der Serotonin-Rezeptoren reduzieren, als auch die Funktion der noradrenergen Rezeptoren beeinträchtigen. 5) Depressive Patienten mit besonders erhöhtem Kortisolspiegel scheinen häufiger Suizid zu begehen. 6) Der Dexamethason-Suppressionstest (DST): s.u. Der Dexamethason-Suppressionstest (DST) ist ein biologischer Test für Depression. Dexamethason (DXM) wirkt auf den Hypothalamus wie Kortisol und reduziert so (durch negative Rückkopplung) die Ausschüttung von CRH. Normalerweise wird durch Dexamethason die Kortisolsekretion also unterdrückt. Bei manchen Depressiven tritt eine solche Suppression jedoch nur kurzfristig oder gar nicht auf. Erklärt wird dieser Effekt mit der Überaktivität der HPA-Achse. Nach einer depressiven Episode verschwindet er wieder. Studie von Salmon: Salmon verabreichte Depressiven und einer nichtdepressiven Kontrollgruppe um 23:00 Uhr Dexamethason und erhob in den folgenden 24 h die Entwicklung des Kortisolspiegels. Ergebnis: Während der Kortisolspiegel in der Kontrollgruppe bis 15h stark, danach schwach abfiel, fiel er bei den Depressiven nur bis 7:00 Uhr morgens ab, und stieg danach (zumindest bis 15:00 Uhr) erneut an. Cortikotropin-Releasing Faktor (CFT)-Theorie (von Nemeroff et al.): Der erhöhte Cortisolspiegel bei Depressiven ist durch eine übermäßige Ausschüttung des Cortikotropin-Releasing-Hormons bedingt. Der CRH-Spiegel ist in der Zerebrospinalflüssigkeit von Depressiven erhöht; bei Therapie normalisiert sich dieser Spiegel. Postmortem wurde bei Depressiven eine erhöhte Anzahl CRHproduzierender Neuronen beobachtet. CRH-Infusion ins Gehirn bedingt bei Ratten „depressive“ Symptome (Gewichtsverlust, Insomnie, Angst, reduzierte Libido) Eine CRH-Übersekretion ist auf frühe Traumata zurückzuführen (z.B. sexuellen Missbrauch in der Kindheit), bei vulnerablen Personen kann später auch bei mildem Stress eine Depression entstehen. Ein Stress-Diathese-Modell (Früher Stress kann eine Diathese hervorrufen!) Zusammenfassung: Die bei Depressionen beschriebene Dysregulation der HPA-Achse zeigt sich: a) in einer erhöhten basalen Sekretion von CRH, ACTH und Cortisol, b) in einer verminderten Suppression von Cortisol im Dexamethason-Suppressionstest und c) in einer verminderten ACTH-Sekretion nach Gabe von CRH (=CRF). 36 4.3.4. Schlaf Einschub: Basics zum Schlaf-Wach-Rhythmus 3 Arten von biologischen Rhythmen lassen sich unterscheiden: A) Circadiane Rhythmen: Periodenlänge ca. 24 h Z.B. Schlaf-Wach-Rhythmus (ca. 25 h); wird v.a. durch den Nucleus Suprachiasmaticus (SCN) im vorderen Teil des Hypothalamus gesteuert, der v.a. auf Licht reagiert und so die nächtliche Melatoninausschüttung der Epiphyse (Zirbeldrüse) reguliert B) Ultradiane Rhythmen: Periodenlänge deutlich kürzer als 24 h Z.B. der Wechsel von Tiefschlaf- (Slow-Wave-Sleep) und REM-Phasen (ca. 90 Minuten) C) Infradiane Rhythmen: Periodenlänge deutlich länger als 24 h Z.B. der monatliche Menstruationszyklus (rund 28 Tage) Die verschiedenen Schlafstadien: Anhand von EEG-Messungen lassen sich insgesamt 4 Schlafstadien unterscheiden: Wachzustand: alternierende Alpha- und Beta-Wellen Stadium 2 ist durch schnelle und niedrigamplitudige Aktivität gekennzeichnet und nimmt über 50% des Gesamtschlafs ein (v.a. in den letzten REM-NonREM-Zyklen stark vertreten) Stadium 3 und 4 sind durch langsame (niedrigfrequente) und hochamplitudige Delta-Wellen gekennzeichnet und bilden die Tiefschlafstadien (v.a. in der ersten Hälfte der Nacht). Die REM-Phasen sind, was das EEG betrifft, der ersten Phase sehr ähnlich (schnelle und niedrigamplitudige Beta- und Gamma-Aktivität) Besonderheiten der REM-Phasen: Schnelle Augenbewegungen, Muskelatonie (steht im Kontrast zur regen Hirnaktivität, weshalb der REM-Schlaf auch als „paradoxer Schlaf“ bezeichnet wird), verstärkte Genitaldurchblutung, lebendige Träume Wichtig für die Konsolidierung von Gelerntem! Eine REM-Non-REM-Periode dauert im Schnitt 90 Minuten; die REM-Phasen werden dabei mit fortschreitender Nacht länger (von 5-10 Minuten in der ersten bis zu 22 Minuten in der letzten Periode); der durchschnittliche Anteil der REMPhasen am Gesamtschlaf beträgt ca. 17 bis 24% Die Regulation der verschiedenen Schlafstadien erfolgt über sog. REM-on- und REM-off-Neurone. Die REM-on-Neurone liegen v.a. im Pons und sind cholinerg, sprich: der von ihnen freigesetzte Transmitter ist Acetylcholin (ACh); ihre Funktion besteht darin, den REM-Schlaf auszulösen und zu erhalten. Die REM-off-Neurone sind aminerg und liegen im Nucleus raphé (Serotonin) und Nucleus Coeruleus (Noradrenalin) Serotonin hemmt die Aktivität der REM-on-Neurone und löst damit Tiefschlafphasen (SWS) aus. Noradrenalin hemmt ebenfalls die Aktivität der REM-on-Zellen und wirkt darüber hinaus aktivierend auf das Vorderhin (=> fördert Wachheit) 37 Depressive zeigen (bedingt durch den Mangel an Serotonin und Noradrenalin) eine Vorverlagerung und Verlängerung der REM-Phasen sowie eine erhöhte Augenbewegungsdichte (REM-Intensität) Die aminerge Hemmung ist reduziert; die cholinerge Stimulation erhöht! Schlafentzug wirkt bei 60-70% der Depressiven depressionsmildernd! Wirkmechanismus: Nucleus Raphé setzt Serotonin frei, um SWS einzuleiten! Wird im therapeutischen Rahmen nur sehr selten eingesetzt; Ziel ist ein kurzfristiges Durchbrechen schwerer Depressionen! 4.3.5. Neuroanatomische Faktoren Mehrere Befunde sprechen dafür, dass die rechte Hemisphäre (genauer: der rechte Präfrontalkortex) bei der Verarbeitung und Generierung von Emotionen dominant ist: Das emotionale Ausdrucksverhalten (Mimik) beginnt linksseitig und ist dort auch deutlicher als rechts. Die Wahrnehmung und Nachahmung emotionaler Gesichtsausdrücke und Sprachäußerungen (Prosodie) ist nach rechtshemisphärischen Läsionen häufiger gestört als nach linkshemisphärischen. Trotzdem ist auch die linke Hemisphäre an der Emotionsverarbeitung beteiligt. Depressionen gehen häufig mit Läsionen im linken Frontallappen einher; Manien mit Läsionen im rechten Orbitofrontal- und Temporallappen. Davidsons Konzept der frontalen Asymmetrie des Kortex nimmt einer genauere Differenzierung der Hemisphären vor: Im linken Präfontalkortex werden nach Davidson eher positive Emotionen generiert (Annäherungssystem); im rechten dagegen eher negative (Vermeidungs- und Rückzugssystem). Vorgehen: Davidson induzierte positiven bzw. negativen Affekt, indem er Pbn entsprechende Videos präsentierte oder sie entsprechende Gesichtsausdrücke aufsetzen ließ. Parallel dazu leitete er ein Spontan-EEG ab und interpretierte die Alpha-Reduktion in den jeweiligen Regionen als Maß für deren Aktivierung. Alpha-Wellen überwiegen im entspannten Wachzustand (etwa bei geschlossenen Augen), Beta-Wellen überwiegen, wenn mentale oder körperliche Aktivität vorliegt. Ergebnis: Ob die Aktivierung im rechten oder linken Präfrontalkortex größer ist, hängt ab von: der Stimmung, der generellen Verhaltenstendenz („Affective Style“) und den präsentierten Stimuli. Ist die Aktivierung rechts stärker (geringere Alpha-Power),… liegt ein negativer Affekt vor ist die negative Reaktion auf einen unangenehmen Filmausschnitt intensiver (Vermeidungsverhalten, negativer Affekt) haben die betroffenen Pbn höhere Depressions-Werte nach dem „Beck Depression Inventory“ (BDI) Ist die Aktivierung links stärker (geringere Alpha-Power), ist es genau umgekehrt: positiver Affekt (z.B. bei echtem Lächeln); stärkere Tendenz zu Annäherungsverhalten usw. 38 4.4. Psychologische Ätiologiefaktoren 4.4.1. Kritische Lebensereignisse („Life-Events“) und Stress Depressive Episoden werden am besten vorhergesagt durch: Eine vorhergehende Episode Eine genetische (familiäre) Prädisposition Mehrere Studien haben jedoch gezeigt, dass auch kritische Lebensereignisse (sog. „Life-Events“) die Wahrscheinlichkeit einer depressiven Episode erhöhen. Pionierarbeit haben in diesem Zusammenhang Brown & Harris geleistet: Im Zuge einer Längsschnittstudie (Anfang der 80er) befragten sie z.B. Arbeiterfrauen aus Islington (Londoner Stadtbezirk) sowohl zu ihrem psychischen Befinden, als auch zu kritischen Lebensereignissen (LEDS: „Life Events and Difficulty Shedule“) und untersuchten, inwiefern das Auftreten einer Depression durch letztere vorhergesagt werden kann. Die wichtigsten Ergebnisse der „Islington-Studie“: Den meisten Manifestationen einer Depression gehen „Auslöser“ („provoking agents“) voraus: entweder ein schwerwiegendes bedrohliches Ereignis, das noch 10-14 Tage später präsent ist (z.B. Krankheit) oder eine größere Schwierigkeit von mind. 2-jähriger Dauer (z.B. Beziehungsprobleme). Von den 130 befragten Frauen hatten insgesamt 22% im Untersuchungszeitraum (1 Jahr) eine depressive Episode. Nahm man nur die Frauen, die mindestens ein schwerwiegendes Ereignis in einem Bereich ausgeprägten Engagements erlebt hatten, in den Blick, erhöhte sich dieser Anteil auf 40%. Von den Frauen, die so ein „Life Event“ nicht hatten, erlitten dagegen nur 14% eine depressive Episode. Ein schwerwiegendes „Life-Event“ scheint jedoch nur dann zu einer Depression zu führen, wenn ein zusätzlicher psychosozialer Vulnerabilitätsfaktor vorliegt: Fehlendes Vertrauen in der Kernbeziehung; mehr als 3 Kinder unter 14; Verlust der Mutter vor dem 11. Lebensjahr etc. Darüber hinaus haben Anzahl und Art der „Life-Events“ einen Einfluss auf die Depressionsrate. Je mehr kritische Lebensereignisse auftreten, desto höher die Wahrscheinlichkeit einer Depression. Demütigende Erfahrungen (Misserfolg, Missbrauch etc.) bergen dabei das größte-, Verlusterfahrungen (Tod, Trennung, liebgewonnene Idee, materieller Verlust etc.) das zweitgrößte Risiko. Gefahrenereignisse führen nicht zu Depressionen. Das Vorhandensein eines Risikofaktors (Kindheitsbelastung oder interpersonelle Probleme während der Depression) erhöht die Wahrscheinlichkeit eines chronischen Verlaufs: 44% (mit Risikofaktor) zu 7% (ohne Risikofaktor) Der Anteil von Patienten, bei denen ein positives Ereignis vor einer Remission zu beobachten war, liegt generell bei über 50%, hängt aber im Einzelnen davon ab, ob und wenn ja, welche Medikamente eingesetzt wurden. Schutz zu bieten scheinen u.a. ein außer-häusiger Beruf (Teilzeit oder Vollzeit), eine stabile Kernbeziehung und eine religiöse Überzeugung. Bedenke: Bei 25 % der depressiven Patienten liegt kein „kritisches Lebensereignis“ vor; darüber hinaus nimmt der Einfluss von „Life-Events“ mit zunehmender Anzahl der Episoden ab. 39 4.4.2. Kognitive Theorie der Depression nach Beck BECK führt Depressionen auf 3 sich wechselseitig bedingende Faktoren zurück: 1) Die „kognitive Triade der Depression“ (negative Beurteilung der eigenen Person, der Umwelt und der Zukunft) 2) Negative Schemata und dysfunktionale Annahmen 3) Kognitiven Verzerrungen / kognitive Fehler Negative Schemata werden durch negative Lebenserfahrungen (z.B. Verlusterlebnisse, Zurückweisung, Kritik oder depressive Modelle) in der Kindheit und Adoleszenz oder durch aktuelle Belastungen erworben und wirken meist unbewusst. Kognitive Schemata bestimmen die Reizwahrnehmung und Informationsverarbeitung, indem sie automatische Gedanken aktivieren. Ein Beispiel für ein solches Schema ist z.B. der Anspruch, immer perfekt zu sein oder von allen geliebt zu werden. Dysfunktional sind solche Annahmen bzw. Schemata deshalb, weil sie zu Fehlschlüssen bzw. kognitiven Verzerrungen führen, die ihrerseits die negativen Schemata zu bestätigen scheinen (=Teufelskreislauf)! So führt z.B. die unbewusste Annahme, immer perfekt sein zu müssen, bei Misserfolg zu der zweifelhaften Schlussfolgerung, wertlos zu sein (bewusst), was wiederum die Annahme verstärkt. Kognitive Verzerrungen sind Denkfehler, die durch negative Schemata bedingt werden. Typische Denkfehler sind z.B.: Übertriebene Verallgemeinerungen (Übergeneralisierung): Eine schlechte Note als Beweis für die eigene Dummheit! Über- oder Untertreibung: Positives klein reden, Negatives überbewerten. Voreilige bzw. willkürliche Schlussfolgerungen: Hans hat sich nicht gemeldet – er mag mich nicht! Dinge persönlich nehmen (Personalisierung): Dass ich die Praktikum nicht bekommen habe, liegt nicht daran, dass kein Platz mehr war, sondern daran, dass man mich nicht wollte! Alles-oder-nichts-Denken (= Schwarz-Weiß-Denken): Alles, was nicht der erste Platz ist, ist eine Niederlage! Zugrundeliegendes Menschenbild: Der Mensch ist nicht passives Opfer seiner Passionen (z.B. Freud) – diese unterliegen vielmehr seiner intellektuellen Kontrolle! Empirische Befunde und Evaluation: Dass depressive Patienten tatsächlich durch negative Schemata und kognitive Verzerrungen gekennzeichnet sind, konnte in einer Vielzahl von Studien nachgewiesen werden. Untersuchungen: „Skala Dysfunktionaler Einstellungen“ (DAS); Vp schenken traurigen Gesichtern größere Aufmerksamkeit als fröhlichen,… Problematisch ist jedoch Becks Annahme, dass diese kognitiven Faktoren die Depression kausal bedingen. Schließlich kann es sich bei ihnen genauso gut um eine Folge von Depression handeln! Allgemeine Studien zum Zusammenhang von Kognition und Emotion zeigen, dass sich die beiden Größen wechselseitig beeinflussen: Eine Manipulation der Kognitionen hat Einfluss auf den Affekt – umgekehrt hat aber auch die Manipulation der Stimmung Einfluss auf die Kognition! Die Ergebnisse prospektiver Studien sind meist nicht minder uneindeutig: Es konnte bisher also nicht belegt werden, dass negative Kognitionen depressiven Verstimmungen zwangsläufig vorausgehen. 40 Fazit: Am besten erscheint eine bidirektionale Sichtweise, der zufolge sich Kognition und Depression wechselseitig beeinflussen. Trotzdem kann aber davon ausgegangen werden, dass negative Denkmuster einen Risikofaktor darstellen! 4.4.3. Theorie der gelernten Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit Es gibt mehrere kognitive Theorien, die Depression auf eine generalisierte Hilflosigkeit bzw. Hoffnungslosigkeit zurückführen. 3 Varianten lassen sich unterscheiden: 1) Die ursprüngliche Theorie der gelernten Hilflosigkeit (von Seligman) 2) Die attributionsbezogene Umformulierung dieser Theorie (Seligman, Abramson) 3) Die Theorie der Hoffnungslosigkeit (Abramson, Metalsky & Alloy) Theorie der gelernten Hilflosigkeit (Seligman, 1974): Unangenehme Erfahrungen und Traumata, die ein Individuum erfolglos zu überwinden versucht hat, führen zu Passivität und Kontrollverlust auch in anderen Situationen Depression. Experimentelle Grundlage: Hunde, die in einer ersten Phase unkontrollierbare Elektroschocks erleiden mussten, lernen in einer zweiten Phase, in denen diese vermieden werden können, das dazu nötige Verhalten langsamer als Tiere, die zuvor keine unkontrollierbaren Schocks appliziert bekommen hatten. Erklärung: In den kognitiven, motivationalen und emotionalen Defiziten der „geschockten“ Hunde äußert sich eine „gelernte Hilflosigkeit“! Gelernte Hilflosigkeit + Attributionsstil: Da sich die Ergebnisse nicht 100%-ig auf Menschen übertragen ließen, legten Seligman und Abramson 1978 eine revidierte Fassung der Theorie vor: Darin wird davon ausgegangen, dass der Effekt durch den Attributionsstil einer Person moderiert wird. Probleme: Bei Versuchen mit Menschen zeigte sich, dass induzierte Hilflosigkeit auch dazu führen kann, dass nachfolgend die notwendigen Vermeidungshandlungen einfacher gelernt werden. Darüber hinaus schreiben sich viele Depressive selbst die Verantwortung für ihre Misserfolge zu - ein Umstand, der mit dem Begriff „Hilflosigkeit“ nur schwer zu vereinbaren ist! Lösung: Ob gelernte Hilflosigkeit auftritt oder nicht, hängt nicht nur von der Situation, sondern auch von deren Interpretation ab, genauer: davon, wie eine Person ihre eigenen Misserfolge attribuiert. Mit WEINER können Attributionen dabei anhand dreier Dimensionen unterschieden werden: 1. Internale vs. externale Attribution 2. Stabile vs. variable Attribution 3. Globale vs. spezifische Attribution Ein negativer Attributionsstil äußert sich in internalen (=> schlechter Selbstwert), stabilen (=> Hilflosigkeit) und globalen Ursachenzuschreibungen. (=> Verstärkung dieser beiden Aspekte) Die Mathearbeit war weder dumm gestellt (external, variabel, spezifisch), noch hab ich mich zu wenig angestrengt (internal, variabel). Stattdessen war ich zu dumm (internal, stabil) – und zwar nicht nur, weil ich mathematisch unbegabt bin, sondern weil ich generell nichts drauf habe (global). These: Machen Menschen mit einem negativen Attributionsstil (Diathese) negative Erfahrungen (Stress) sind sie besonders gefährdet, depressiv zu werden. Erstens: halten ihre negativen Gefühle nach solchen Erlebnissen länger an als bei Personen mit einem positiven Attributionsstil; zweitens: entwickeln sie eine „gelernte Hilflosigkeit“. 41 Hoffnungslosigkeit: Die neueste Fassung der Theorie erweitert das Konzept um den Begriff der Hoffnungslosigkeit; letztere äußert sich nicht nur im Gefühl der Hilflosigkeit (mangelnde Kontrollüberzeugung), sondern darüber hinaus in der pessimistischen Zukunftserwartung, dass positive Ereignisse ausbleiben, negative dagegen eintreten werden. Der Vorteil dieser Fassung besteht darin, dass neben dem Attributionsstil weitere Diathesen in Betracht gezogen werden: dazu zählen v.a. der erwähnte Pessimismus, zum anderen ein geringes Selbstwertgefühl. Darüber hinaus bietet die Theorie eine gute Erklärung für den engen Zusammenhang von Depression und Angststörungen: Pessimistische Erwartungen führen zu Angst; treten die erwarteten Ereignisse ein, kommt es zu Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit! Empirische Befunde und Evaluation: Positive Befunde: Tatsächlich zeigt sich, dass Pbn, die im „Attributionsstil-Fragebogen“ (ASQ) einen negativen Attributionsstil erkennen lassen, höhere Depressionswerte aufweisen! Studenten, die einen positiven Attributionsstil aufweisen, reagieren auf eine schlechte Note zunächst nicht minder enttäuscht als Studenten mit einem negativen Attributionsstil - ihre Enttäuschung hält jedoch nicht so lange an! Erklärung: unmittelbare emotionale Reaktion erfolgt vor den Attributionen! Probleme: Die meisten Studien sind Analogstudien: sie wurden also nicht an klinischen Stichproben erhoben, sondern an Studenten mit hohen Depressionswerten. Validität?! Das Modell wurde ursprünglich zur Erklärung reaktiver Depressionen entwickelt, ob es auch auf andere Typen von Depression anwendbar ist, wäre näher zu prüfen. Es ist fraglich, ob die Theorien depressionsspezifisch sind. Auf Angst oder Sorgen im Allgemeinen scheinen sie genauso zuzutreffen! Ob kognitive Prozesse, in dem Fall: die Attribution von Ereignissen, tatsächlich so entscheidend sind, wie es die Theorie nahelegt, ist streitbar. Schließlich gibt es viele Studien, die zeigen, dass der Mensch sich der Ursachen seines Verhaltens oft gar nicht bewusst ist und auch die Alltagserfahrung zeigt, dass wir nur selten so rational und überlegt vorgehen, wie es kognitive Modelle nahelegen. Die besagten Theorien gehen davon aus, dass es sich bei dem Attributionsstil um eine Diathese und damit um ein stabiles Persönlichkeitsmerkmal handelt; es konnte jedoch gezeigt werden, dass der negative Attributionsstil nach einer depressiven Episode wieder verschwindet! Wie bei Becks Theorie stellt sich die Frage, ob Hilf- bzw. Hoffnungslosigkeit tatsächlich die Ursache oder lediglich eine Folge von Depressionen ist. 42 4.4.4. Sonstige Theorien zur Depression Das Verstärker-Verlust-Modell von Lewinsohn (1974) ist ein verhaltenstheoretisches Modell: Depression wird dabei auf einen sich durch die Depression weiter verschärfenden Mangel an positiver Verstärkung zurückgeführt. Die Menge positiver Verstärkung hängt dabei von 3 Faktoren ab: 1) Der Anzahl und Qualität möglicher verstärkender Ereignisse Was wirkt auf eine Person zumindest potenziell verstärkend (ist es beruflicher Erfolg, Glück in der Liebe oder ein großer Freundeskreis?) 2) Der Erreichbarkeit solcher Verstärker in der Umgebung Ist die Person berufstätig und wenn ja, inwiefern besteht in diesem Beruf die Möglichkeit, für das eigene Handeln verstärkt zu werden (Arbeitsloser vs. Lehrer vs. Schauspieler)? Hat eine Person Familie?... 3) Dem instrumentellen Verhalten einer Person Ist eine Person dazu in der Lage, die potenziellen Verstärker in der Umgebung auch zu erhalten (berufliche Fähigkeiten, soziale Kompetenz etc.)? Wer über längeren Zeitraum keine Verstärkung erhält, befindet sich nach behavioristischer Theorie unter Löschungsbedingungen und hört im Extremfall ganz auf, irgendetwas zu tun. Die Folge ist eine Depression. Letztere lässt sich damit als Teufelskreislauf beschreiben: Ein Mangel an Verstärkern führt zu Depression – und diese führt wiederum zu einer weiteren Reduktion an Verstärkern (berufliches Desinteresse, sozialer Rückzug etc.). Interpersonale Theorien der Depression: bauen auf Lewinsohns Modell auf und betonen die negativen Reaktionen, die Depressive in ihrer Umwelt hervorrufen. In mehreren Studien (Telefongespräche oder Face-to-Face-Interaktionen) konnte gezeigt werden, dass das Verhalten von Depressiven (sogar unabhängig vom Inhalt) Ablehnung hervorruft. Depressive verfügen über geringere Sozialkompetenzen und leben meist in einem weitmaschigeren sozialen Netz. Multifaktorieller Ansatz: Am sinnvollsten ist es, die verschiedenen Theorien zu integrieren. In diesem Fall lassen sich folgende Einflussfaktoren unterschieden: 1. Genetische Prädisposition 2. Traumatische Erfahrungen („Life-Events“) 3. Persönlichkeitsfaktoren Gelernte Hilflosigkeit Attributionsstil Kognitive Schemata 4. Physikalische Einwirkungen Z.B. Lichtentzug 5. Aktuelle psychosoziale Belastungen (Stress) Alle diese Faktoren werden neurobiologisch vermittelt (Serotoninmangel etc.) und führen so zu einer Depression. 43 4.4.5. Psychologische Ursachen der bipolaren Störung Zur bipolaren Störung gibt es insgesamt weniger Forschung als zur unipolaren Depression. Was die depressiven Episoden betrifft, sind die Theorien dieselben! Was die manischen Episoden betrifft, wird allgemein davon ausgegangen, dass es sich dabei um einen Abwehr- bzw. Schutzmechanismus handelt, kurz: um der Depression zu entfliehen, stürzen sich die Patienten in die Manie! 4.4. Therapie: 4.4.1. Allgemeines [ Intervention] Interventionsebenen: Niederschwellige Maßnahmen: bei subklinischen (minoren) Depressionen Als „wirksam“ haben sich erwiesen: Bibliotherapie (Selbsthilfe mit Hilfe von Fachbüchern) und Kurzzeittherapie (einige Sitzungen) „Möglicherweise wirksam“ sind internetbasierte KVT-Programme Akuttherapie: beginnt meist am Tiefpunkt und dauert so lange, bis eine spürbare Besserung eingetreten ist (bis zu einem Monat) Als „wirksam“ haben sich erwiesen: Medikamentöse Behandlung (Antidepressiva); kognitive Verhaltenstherapie (KVT); Interpersonelle Psychotherapie (IPT); Psychodynamische Kurzzeittherapie (STPP); Kombinationstherapien (Antidepressiva + Psychotherapie) „Bislang ohne ausreichende Wirknachweise“: Psychoanalyse, psychodynamische Langzeittherapie und alle anderen Therapien Erhaltungstherapie: beginnt nach der Remission und dauert 3-6 Monate; Ziel ist die Verhinderung bzw. Hinauszögerung von Rückfällen Prophylaktische Therapie: kann je nach Schwere der Depression Jahre dauern 4.4.2. Pharmakologische Behandlung Drei Hauptkategorien von Antidepressiva lassen sich unterscheiden: 1) Trizyklika: hemmen die Wiederaufnahme der ausgeschütteten Neurotransmitter in die präsynaptische Zelle (Serotonin, Noradrenalin, Dopamin etc.) haben eine sehr breite (unspezifische) Wirkung ihr Name beruht auf der chemischen Struktur (drei Ringe) 2) MAO-Hemmer: hemmen den Abbau von Serotonin und Noradrenalin durch das Enzym Mono-Amino-Oxydase (MAO) haben die schwersten Nebenwirkungen und werden daher heute nur noch selten eingesetzt! 3) Selektive Wiederaufnahme-Hemmer (SSRI; NaRI; SNRI) Selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRIs) hemmen das Transportmolekül, das Serotonin wieder in seine Speicher zurückführt; wirken daher nur an den Synapsen, deren Übertragung mittels Serotonin erfolgt (spezifischer Wirkort). Weitere selektive Wiederaufnahme-Hemmer sind: NoradrenalinWiederaufnahme-Hemmer (NaRI) und Serotonin-NoradrenalinWiederaufnahme-Hemmer (SNRI) 44 Hinzu kommen atypische und pflanzliche Antidepressiva: 4) Atypische Antidepressiva: Erhöhen die Ausschüttung von Serotonin und Noradrenalin! 5) Johanneskrautpräparate: Die Wirksamkeit ist, zumindest bei leichten und mittelschweren Depressionen, empirisch belegt; der Wirkmechanismus jedoch nicht abschließend geklärt => Auch Johanneskraut scheint aber auf die neuronale Transmission einzuwirken! Darüber hinaus lassen sich Antidepressiva hinsichtlich ihrer Wirkung auf die Aktiviertheit des Patienten in 3 Typen unterteilen: Typ I: wirkt stärker sedierend Typ II: ist neutral Typ III: wirkt eher stimulierend und antriebssteigernd Eines der wichtigsten Kriterien bei der Medikamentenauswahl stellt das Nebenwirkungsprofil dar. Häufige Nebenwirkungen: Mundtrockenheit, Akkomodationsstörungen beim Sehen, Schwindel, Kopfschmerz, Erektionsstörungen, Gewichtszunahme, hypomane Nachschwankungen etc. etc. Problematisch sind v.a. solche Medikamente, die für suizidzwecke missbraucht werden können! Was ihre depressionslindernde Wirkung betrifft, sind Trizyklika, MAOHemmer und SSRIs mehr oder minder gleichwertig; der große Vorteil von letzteren besteht jedoch in der besseren Verträglichkeit (weniger Nebenwirkungen) Kleine Auswahl wichtiger Antidepressiva (inklusive Nebenwirkungen): Kategorie Substanz-Handelsname Nebenwirkungen Trizyklika Imipramin (Typ II) – Trofanil Amitriptylin (Typ I) - Saroten MAOHemmer Tranylcypromin (III) – Parnat SSRIs Fluoxetin (II) – Fluctin Erhöhtes Schlaganfall-/Herzinfarktrisiko; niedriger Blutdruck, Angst, Müdigkeit, unscharfes Sehen, trockener Mund, Verdauungsstörungen, Errektionsstörungen, Gewichtszunahme Möglicherweise letaler Bluthochdruck; trockener Mund; Übelkeit; Schwindel; Kopfschmerzen Nervosität, Schläfrigkeit, Schwindel, Kopfweh, Schlafstörungen, Magenbeschwerden 4.4.3. Nicht-medikamentöse, somatische Therapieformen: Wachtherapie (=Schlafentzug): Unterschieden werden kann zwischen partiellem (2.Nachthälfte) und totalem Schlafentzug. Wird v.a. bei schweren Fällen (im Rahmen stationärer Behandlung) angewandt und dient dazu, die Depression vorübergehend zu durchbrechen. Tatsächlich zeigt sich bei 60% der Patienten am Folgetag eine Stimmungsverbesserung; diese hält jedoch ohne begleitende Maßnahmen nicht lange an. Angenommener Wirkmechanismus: Nucleus Raphé setzt Serotonin frei, um SWS einzuleiten! 45 Lichttherapie: Regelmäßige Exposition mit Licht (bis zu mehreren Stunden täglich) V.a. bei saisonal abhängigen Depressionen (Winterdepressionen) indiziert Angenommener Wirkmechanismus: Erhöhung der Transmitterkonzentration (v.a. Serotonin) Elektrokrampftherapie (=Elektrokonvulsionstherapie; kurz: EKT): Elektrische Stimulation des Kortex löst epileptischen Krampfanfall aus; während die Stimulation früher ohne Betäubung und auf beiden Seiten (bilaterale EKT), wird heute meist nur noch eine Seite (die rechte) stimuliert und der Patienten vorher unter Vollnarkose gesetzt. Wird nur bei sehr schweren und behandlungsresistenten Depressionen angewandt Kann massive Nebenwirkungen haben: dauerhafte Verwirrung, Löschung von Gedächtnisinhalten etc. Wirkmechanismus: unbekannt! Transkranielle Magnetstimulation (TMS): Nicht-invasives Verfahren, bei dem bestimmte Gehirnregionen durch starke Magnetfelder stimuliert werden, was zu einer Steigerung der dortigen Gehirnaktivität führt. Mögliche Alternative zur EKT 4.4.4. Kognitive Verhaltenstherapie (KVT) Die Ansätze der kognitiven Verhaltenstherapie zur Behandlung von Depression basieren v.a. auf Becks Modell der negativen Triade und Lewinsohns „VerstärkerVerlust-Modell“. Sofern die KVT sowohl kognitive, als auch behaviorale Elemente enthält, kann sie als Kombinationstherapie beschrieben werden. Nach Hautzinger lässt sich der Ablauf einer kognitiven Verhaltenstherapie in 6 Phasen untergliedern: 1) Problemanalyse und Aufbau einer therapeutischen Beziehung Anamnese; Benennung der Schlüsselprobleme (Kriterien: Wichtigkeit, Dringlichkeit, Veränderbarkeit); Aufstellung einer Zielmatrix: was will der Patient kurz-, mittel- und langfristig in den verschiedenen Lebenskontexten (Beruf, Familie etc.) erreichen! Therapeutische Beziehung: Empathie, positive Wertschätzung, Kongruenz 2) Vermittlung des therapeutischen Modells und Psychoedukation bezüglich der jeweiligen Störung Grundannahmen der KVT: Verhalten, Denken und Fühlen beeinflussen sich wechselseitig, was in der Therapie passieren wird etc. pp. Aufklärung über die biologischen und psychologischen Grundlagen der Depression 3) Aktivitätsaufbau Einstieg: Erläuterung der „Depressionsspirale“ (soz. Rückzug und Passivität führen zu einer Reduktion positiver Verstärkung und damit zu einer Verschlimmerung der Depression => Ausweg: sich aufraffen und positive Aktivitäten aufsuchen!) Aufstellung eines Wochenplans, in dem sowohl die Aktivitäten als auch die damit einhergehenden Stimmungen protokolliert werden sollen => der Plan dient zunächst zur Erhebung des Ist-Zustandes (Baseline); in einem zweiten Schritt werden positiv erlebte Aktivitäten gesammelt und 46 zunehmend in den Plan integriert (langfristiges Ziel: Etablierung einer neuen Tagesstruktur)! Wichtig: Keine allgemeinen, sondern konkrete Aktivitäten (wie z.B. 2 Mal die Woche eine halbe Stunde spazieren gehen) 4) Bearbeitung und Modifikation kognitiver Muster Aufklärung über die Wirkweise von Kognitionen (automatisch, stimmungsinduzierend etc.) Beobachten und Erkennen automatischer Gedanken Vermittlung der ABC-Technik: Gefühle sind die Konsequenz (C) einer auslösenden Situation (A) und deren Bewertung (B), die meist automatisch abläuft. Entscheidend ist, das die auslösende Situation (Hans grüßt nicht) und deren Bewertung (er mag mich nicht) voneinander getrennt werden müssen, da es v.a. letztere ist, die das Gefühl auslöst! Wird dieser Zusammenhang erkannt, können alternative Bewertungen (B„) in Betracht gezogen und angenommen werden (Hans war wohl gerade gestresst), was wiederum zu einer veränderten Konsequenz (C„), einem anderen Gefühl, führt! Wichtig: Der Patient darf weder zu neuen Bewertungen überredet werden, noch dürfen seine gewohnten Bewertungen von vornherein als irrational abgetan werden. Stattdessen muss der Patient selbst zu seinen Einsichten kommen => Mögliche Methoden: „Sokratischer Dialog“ (gelenktes Fragen): Negative Schemata auf ihren Realitätsgehalt überprüfen: „Ich weiß von nichts bescheid!“ – „Von welchen Themen z. B.?“ – „Z. B. von Politik“ – „Wie viele Politiker werden sie wohl kennen, wenn ich ihnen etwas aus der Zeitung vorlese?!“ – „10 %“ – „Mal sehen: …“ Kognitive Verzerrungen erkennen und benennen: „Keiner mag mich!“ = Übergeneralisierung! Reattribuierung; Rollenspiele; eine Situation nicht nur aus der eigenen Perspektive, sondern auch aus der eines unbeteiligten „Dritten“ beurteilen usw. usw. 5) Verbesserung der sozialen Kompetenz Ziele: Erkennen und Durchsetzen eigener Wünsche, Äußern positiver Gefühle, Aufbau und Pflege sozialer Kontakte, Problemlösefähigkeit etc. Methoden: Verhaltensübungen, Rollenspiele (im stationären Setting meist in Gruppen) 6) Rückfallprophylaxe Sensibilität für Warnsignale um depressive Episoden frühzeitig zu bemerken; Training der gelernten Techniken; „Notfallkoffer“ (Karteikarten mit positiven Aktivitäten etc.),… „Booster-Sitzungen“: Bearbeitung aktueller Rückschläge, Auffrischen der gelernten Strategien 4.4.5. Weitere Therapieformen MBCT: Die „Mindfullness Based Cognitive Therapy“ (MBCT) wurde speziell für die Erhaltungstherapie bei unipolaren Depressionen entwickelt; sie enthält neben den kognitiv-behavioralen Elementen (Aktivitätsaufbau etc.) Achtsamkeitsübungen, die auf das bewusste Erleben von Situationen zielen (Yoga, Atemmeditation, Aufmerksamkeit auf alltägliche Handlungen) etc. MBCT ist „möglicherweise wirksam“ (Evidenzgrad II) 47 IPT: Die Interpersonale Therapie (IPT) ist als ambulante Kurzzeittherapie angelegt (12-20 Einzelsitzungen) und gehört zur Gruppe der psychodynamischen Kurzzeittherapien (STPP); sie zielt v.a. darauf die konkreten Lebensbezüge des Klienten zu verbessern; der Hauptfokus liegt dementsprechend auf der Bearbeitung zwischenmenschlicher und psychosozialer Probleme im Hier und Jetzt: Trauerbewältigung, Rollenwechsel/Lebensveränderungen, Einsamkeit, zwischenmenschliche Konflikte etc. IPT gilt bei Depressionen als „wirksam“ (Evidenzgrad I) 4.4.5. Therapie bei anderen affektiven Störungen Chronische Depressionen: Die einzige Therapieform, die speziell zur Behandlung von chronischen Depressionen und Dysthymie entwickelt wurde, ist das „Cognitive Behavioral Analysis System for Psychotherapy“ (CBASP); es vereint interpersonelle, psychodynamische, kognitive und behaviorale Strategien und zielt v.a. auf eine Erhöhung der sozialen Kompetenz und eine adäquatere Wahrnehmung der Umwelt ab. Als „wirksam“ erwiesen haben sich folgende Kombinationstherapien: KVT + Antidepressiva; CBASP + Antidepressiva Bipolare Störungen: Bei bipolaren Störungen ist eine Kombination aus Psychotherapie und Pharmakotherapie angeraten; erstere erhöht nicht nur die Medikamentencompliance, sondern fördert u.a. die Akzeptanz der Krankheit und eine Sensibilität für Warnsignale. Das Medikament, das bei bipolaren Störungen verschrieben wird, ist Lithium (Handelsname: Quilonium); es hilft sowohl in manischen als auch in depressiven Phasen (in letzteren sogar besser als herkömmliche Antidepressiva, was für den prinzipiellen Unterschied zw. bi- und unipolarer Störung spricht); die Einnahme des Medikaments sollte ständig erfolgen! Problematisch an Lithium sind dessen massive Nebenwirkungen: Tremor, Magenprobleme, Koordinationsstörungen, Schwindel, Herzrythmusstörungen, unscharfes Sehen, Schläfrigkeit => bei Überdosis: tödlich! 4.4.6. Wirksamkeit Die wichtigsten Evidenzen im Überblick: Die wirksamste Psychotherapie bei Depression ist (über alle Bedingungen hinweg: Akuttherapie, Erhaltungstherapie, Gruppensetting, Einzelsetting etc.) die kognitive Verhaltenstherapie (KVT), ebenfalls als wirksam erwiesen haben sich die Interpersonale Therapie (IPT) und (zumindest in der akuten Einzeltherapie) die psychodynamische Kurzzeittherapie (STPP) Keine Wirksamkeit konnte bisher für die klassische Psychoanalyse und alle anderen Therapieformen nachgewiesen werden. Was die kurzfristige Wirkung betrifft, sind psychotherapeutische (genauer: KVT und IPT), medikamentöse und kombinierte Interventionen gleichwertig! Sie alle sind einer Placebobehandlung überlegen! Verbesserung liegt im Schnitt zw. 60 und 65%! Langfristig sind jedoch psychotherapeutische (KVT / IPT) oder kombinierte Interventionen rein medikamentösen Behandlungen vorzuziehen, da bei ihnen die Abbrecher- und Rückfallquote geringer ausfällt und weniger Nebenwirkungen auftreten! 48 Die KVT ist auch bei schweren Depressionen der medikamentösen Behandlung nicht (unbedingt) unterlegen; trotzdem ist bei schweren Depressionen eine kombinierte Therapie die Methode der Wahl. Bei chronischen Depressionen ist eine Kombination von Pharmakotherapie und spezifischer Psychotherapie (KVT oder CBASP) angezeigt (Erhöhung der Medikamentencompliance, Verringerung der Abbrecherquote etc.). Bei subklinischer Symptomatik reichen meist Psychoedukation, Bibliotherapie oder kurzzeitige, kogitiv-verhaltenstherapeutische Gruppenbehandlung aus (Evidenzgrad I) Eine Metanalyse (2008!) zur Frage der Wirksamkeit von SSRIs und ob diese vom Schweregrad der Depression abhängt, erbrachte folgende Ergebnisse: SSRIs sind in ihrer Wirkung Placebos klinisch nicht signifikant überlegen! Die durchschnittliche Verbesserung auf der „Hamilton Rating Scale for Depression“ (HRSD) beträgt nach einer Behandlung mit SSRIs 9,6 Punkte, nach einer Placebo-Behandlung 7,8 Punkte. Dieser Unterschied (1,8 Punkte) ist zwar statistisch-, nicht aber klinisch signifikant. Placebos erreichen 80% der Medikamentenwirkung (zum Vgl.: bei Schmerzen lediglich 50%); Depressive scheinen also extrem gut auf sie anzusprechen! Ausnahme: Nur bei extrem schweren Depressionen wird der Unterschied klinisch signifikant; dieser Umstand ist allerdings nicht darauf zurückzuführen, dass besonders schwere Fälle besser auf die Medikation ansprechen würden, sondern darauf, dass schwere Fälle schlechter auf Placebos ansprechen. Die Wirkung der Medikation ist also vom Schwergrad der Depression mehr oder minder unabhängig; es besteht jedenfalls keine lineare Beziehung zwischen beidem! Fazit der Autoren: Antidepressiva sollten nur dann eingesetzt werden, wenn die Depression besonders schwer ist und/oder andere Interventionsformen keine Wirkung gezeigt haben! 49 5. Schizophrenie 5.1. Darstellung des Störungsbilds 5.1.1. Die wichtigsten Konzepte und Symptome Definition: Der Begriff „Schizophrenie“ umfasst eine Gruppe psychotischer Störungen, die durch massive Beeinträchtigungen des Denkens, emotionalen Erlebens und Verhaltens gekennzeichnet sind, die ihrerseits zu einem Bruch mit der Realität führen (Rückzug in eine Phantasiewelt aus Wahnideen und Halluzinationen). Denken: mangelnde Logik, mangelnder Realitätsbezug, Wahrnehmungsfehler und Aufmerksamkeitsstörungen Emotionales Erleben: Flacher oder unangemessener Affekt Verhalten: Motorische Störungen und/oder bizarres Verhalten Etymologie: Der Begriff „Schizophrenie“ kommt aus dem Griechischen und heißt übersetzt „gespaltene Seele“. Anders als oft angenommen wird, haben Schizophrene jedoch keine gespaltene Persönlichkeit (ein extrem verbreitetes Missverständnis)! Stattdessen bezieht sich der 1908 von Eugen Bleuler (s.u.) geprägte Begriff auf den fehlenden Zusammenhalt schizophrener Assoziationen, den dadurch bedingten Bruch mit der Realität und die Tatsache, dass bei Schizophrenen, anders als bei der Demenz, nicht alle, sondern nur ein Teil der kognitiven Funktionen verloren geht. Historisches: Das Konzept der Schizophrenie wurde erstmals Anfang des 20. Jh. von den beiden Psychiatern Emil Kraeplin und Eugen Bleuler formuliert. Emil Kraeplin: unterschied zwei Hauptgruppen von Psychosen: das manisch depressive Irrsein und die „Dementia praecox“. Zu letzterer zählte er die Störungsbilder, die heute als schizophren bezeichnet werden: nämlich die Paranoia, die Katatonie und die Hebephrenie (s.u.). Das gemeinsame Merkmal dieser heterogenen Störungsbilder sah Kraeplin in einer allgemeinen und im Unterschied zur Demenz nicht erst im Alter auftretenden „geistigen Schwäche“. Der Begriff „Dementia praecox“ zielt demnach a) auf den frühen Beginn der Störung (praecox) und b) auf den fortschreitenden geistigen Verfall (Demenz) Ein deskriptives, relativ eng gefasstes Konzept Eugen Bleuler: fasste dagegen weder das Alter bei Beginn, noch den progressiven geistigen Verfall als das Charakteristische der Störungen auf, sondern die mit ihnen einhergehende Zerrissenheit der Assoziationen. Vor diesem Hintergrund prägte er den Begriff „Schizophrenie“! Symptomgruppen: Die Symptome der Schizophrenie werden Allgemein in 2 Gruppen eingeteilt: „Positive Symptome“ sind durch eine Übersteigerung des normalen Erlebens gekennzeichnet; „negative Symptome“ durch dessen Einschränkung. In jüngerer Zeit wird darüber hinaus eine dritte Gruppe von Symptomen abgegrenzt, die ihrerseits v.a. durch Desorganisation gekennzeichnet ist. 1) Positive Symptomatik: kennzeichnet i.d.R. einen akuten schizophrenen Schub Halluzinationen und andere Wahrnehmungsstörungen Akustische Halluzinationen (sind am häufigsten: bei 70%): Gedankenlautwerden, kommentierende Stimmen, streitende Stimmen Außerdem: Optische Hallos (31%), taktile und olfaktorische Hallos 50 Inhaltliche Denkstörungen (=Wahnideen) Verfolgungswahn (ist am häufigsten: bei 60-70%) Religiöser Wahn (bei ca. 25%); Größenwahn (22%) etc. Gedankenlesen (34%): Patient hat das Gefühl, die Gedanken anderer lesen zu können! Gedankeneingebung (19%): Patienten haben das Gefühl, nicht die eigenen Gedanken, sondern die eines anderen zu denken! Gedankenentzug (17%): Patienten haben das Gefühl, ihre Gedanken würden aufgesogen. Gedankenausbreitung (14%): P. haben das Gefühl, ihre Gedanken würden auf andere übertragen, so dass diese sie lesen können. „Gemachte“ Körperempfindungen: Patienten haben somatische Empfindungen (Wärme, Prickeln etc.), die aus ihrer Sicht von einer äußeren Macht gesteuert werden. „Gemachte“ Gefühle: Patienten haben das Gefühl, die von ihnen erlebten Emotionen seien nicht die eigenen, sondern würden ihnen von anderen eingegeben bzw. aufoktroyiert! „Gemachte“ Handlungen: Patienten haben das Gefühl, dass ihre Handlungen ohne ihr willentliches Zutun vonstattengehen. „Gemachte“ Impulse: Patienten folgen Impulsen, die ihnen von einer äußeren Macht eingegeben werden („Pinkel aufs Buffet!“) Formale Denkstörungen Gelockerte Assoziationen und Entgleisungen (Überflutung mit vielfältigen Assoziationen; Schwierigkeit, beim Thema zu bleiben) Unlogisches oder tangentiales Denken Desorganisierte Sprache (den sprachlichen Äußerungen fehlt nahezu jeder inhaltliche Zusammenhang) wird heute oft zur dritten Symptomgruppe („Desorganisation“) gezählt: s.u. 2) Negative Symptomatik: hält auch über eine akute Episode hinaus an; bestimmt die Residualphase und stellt während der Behandlung ein großes Problem dar! Apathie (Antriebs- und Willensschwäche): Patienten fehlt es an Interesse und Energie (mangelnde Körperpflege, Vernachlässigung der Pflichten, sozialer Rückzug, chronisches „Nichtstun“ etc.) Alogie (Sprachverarmung): Patienten reden weniger (quantitative Sprachverarmung) oder inhaltlich Bedeutungsloses (inhaltliche Sprachverarmung) Anhedonie (Unfähigkeit, Freude zu erleben): Mangelndes Interesse an Freizeitbeschäftigungen, Beziehungen und Sex, wobei sich die Patienten durchaus bewusst sind, dass das mal anders war! Affektverflachung (bei 2/3 = 66% der Patienten): Patienten zeigen keine emotionalen Reaktionen mehr; das betrifft jedoch lediglich den äußeren Eindruck (eingeschränkte Mimik, verminderte Spontanbewegungen, tonlose Stimme etc.) und nicht unbedingt das Innenleben! Mangelnde Aufmerksamkeit 3) Weitere Symptome (oft als „desorganisierte“ Symptomatik bezeichnet): Katatonie: äußert sich in verschiedenen motorischen Auffälligkeiten; zum Beispiel dem katatonen Stupor (Körperstarre in ungewöhnlicher Haltung), Katalepsie (Beibehaltung der Körperstellung nach passiver Bewegung), einer wächsernen Biegsamkeit der Gliedmaßen, ungewöhnlichen Bewegungsmustern, Anfällen etc. 51 Inadäquater Affekt (eher selten, aber recht spezifisch für Schizophrenie): unangemessene emotionale Reaktionen und rascher Wechsel emotionaler Zustände Bizarre Verhaltensweisen: P. führen laute Selbstgespräche, hamstern Lebensmittel, sammeln Müll etc. [Desorganisierte Sprache] 5.1.3. Tests & Fremdbeurteilungsverfahren zur Diagnose und Verlaufsbeurteilung PANNS: Die „Positive and Negative Syndrome Scale“ (PANSS) erfasst nicht nur die Symptome als solche, sondern auch ihre jeweilige Ausprägung! Zur Anwendung des Tests liegt ein strukturiertes klinisches Interview (SCI-PANNS) vor, das genau vorgibt, was wann zu fragen ist. Fragen zur Skala „Wahnideen“ sind z.B.: „Geht es Ihnen gut?“; „Haben sie eine bestimmte Lebensphilosophie?“ „Manche glauben an den Teufel – Sie auch?“… Die Fähigkeit zu abstraktem Denken wird untersucht, indem man die Patienten Sprichwörter interpretieren lässt („Viele Köche verderben den Brei“ etc.). Auswertung: Den Angaben zu den verschiedenen Symptomen wird am Ende jeweils ein Punktwert zw. 1 („nicht vorhanden“) und 7 („extrem vorhanden“) zugeordnet! IMPS: Die „Impatient Multidimensional Psychiatric Scale“ (IMPS) ist ein Fremdbeurteilungsverfahren mit 90 operational definierten Symptomen. BPRS: Die „Brief Psychiatric Rating Scale” (BPRS) ist ebenfalls ein Fremdbeurteilungsverfahren und wird v.a. zur Verlaufsbeurteilung eingesetzt; es bietet einen Leitfaden zur Einschätzung von 18 Symptomen, wobei der Gesamtrohwert das Ausmaß der Störung wiedergibt! 5.1.3. Diagnostische Kriterien nach dem DSM-IV und der ICD-10 Wichtig: Anders als für andere Störungen gibt es für Schizophrenie kein zentrales Symptom, das für eine Diagnose vorhanden sein müsste; Ausprägung und Verlauf einer Schizophrenie können daher sehr heterogen sein. Hinzu kommt eine hohe Komorbidität mit Suchtmittelabhängigkeiten (50%!) und körperlichen Erkrankungen (stationär: 46-80%; ambulant: 20-43%!). Die Differentialdiagnose (s.u.) kann vor diesem Hintergrund äußerst schwierig sein! Diagnostische Kriterien nach dem DSM-IV: A) Mindestens 2 der folgenden 5 Symptome müssen (ohne Behandlung) für mindestens einen Monat vorhanden sein: 1) Wahn 2) Halluzinationen 3) Desorganisiertes Sprechen (z.B. häufiges Engleisen oder Zerfahrenheit) 4) Grob desorganisiertes oder katatones Verhalten 5) Negative Symptome, d.h. flacher Affekt, Alogie oder Willensschwäche Beachte: Sind die Hallos Stimmen oder ist der Wahn bizarr, reicht 1 Symptom! B) Soziale und/oder berufliche Leistungseinbußen C) Dauer: „Zeichen des Störungsbildes“ für mindestens 6 Monate; zwei der oben genannten Symptome für mindestens einen Monat (oder weniger, falls erfolgreich behandelt) 52 Diagnostische Kriterien nach der ICD-10: Schizophrenie (F 20) Für mindestens einen Monat muss mindestens eins der unter A genannten oder mindestens 2 der unter B genannten Symptome bestehen: A) 1. Gedankenlautwerden, Gedankeneingebung, -entzug oder –ausbreitung 2. Kontroll- oder Beeinflussungswahn; Gefühl des Gemachten; Wahnwahrnehmungen 3. Kommentierende oder dialogische Stimmen 4. Anhaltender, kulturell unangemessener oder unrealistischer Wahn B) 1. Halluzinationen 2. Gedankenabreißen oder -einschiebungen 2. Katatone Symptome (s.o.) 3. Negative Symptome (s.o.) 4. Auffällige Verhaltensänderungen (wie sozialer Rückzug, Trägheit etc.) Folgende Typen der Schizophrenie werden von der ICD-10 und dem DSM-IV unterschieden: ICD-10 F 20.0: Paranoide Schizophrenie F 20.1: Hebephrene Schizophrenie F 20.2: Katatone Schizophrenie F 20.3: Undifferenzierte Schizophrenie F 20.4: Postschizophrene Depression F 20.5: Schizophrenes Residuum F 20.6: Schizophrenia Simplex DSM-IV = Paranoider Typus = Desorganisierter Typus = Katatoner Typus = Undifferenzierter Typus = Residualer Typus Die 3 Hauptgruppen der Schizophrenie sind die ersten 3; sie treten am häufigsten auf und wurden bereits von Kraeplin unterschieden. Die paranoide Schizophrenie: ist am allerhäufigsten; betroffen von ihr sind v.a. Wahrnehmung und Denken; die typischen Symptome sind Halluzinationen und Wahnvorstellungen (meist Verfolgungswahn) Die hebephrene (= „jugendliche“) bzw. desorganisierte Schizophrenie: beginnt meist in der Adoleszenz (daher der Name); betroffen von ihr sind v.a. Emotion und Motivation; die typischen Symptome sind inadäquater Affekt, Albernheit, formale Denkstörungen, Ziel- und Planlosigkeit Der katatone Schizophrenie: ist eher selten; betroffen von ihr sind Motivation und Motorik; die typischen Symptome sind Wechsel von Stupor (Starre) und Erregung; Haltungsanomalien, Gedankenarmut und Antriebslosigkeit. Die Schizophrenia simplex: beginnt schleichend (zunehmende Verhaltensauffälligkeiten) und äußert sich v.a. in sozialem Rückzug, Affektverflachung und Antriebslosigkeit. Die Unterteilung der Schizophrenie in die besagten Untergruppen ist problematisch: 1) Sind die genannten Typen oft zeitlich instabil 2) Sind sie phänomenologisch eher unspezifisch 3) Sind sie nur begrenzt valide (d.h. sie haben kaum prognostischen oder therapeutischen Wert) In jüngerer Zeit wird daher zunehmend zw. folgenden Typen unterschieden: 1) Typ I-Schizophrenie: ist gekennzeichnet durch positive Symptome Prämorbide Anpassung: relativ gut Reaktion auf herkömmliche Neuroleptika: gut Endzustand der Störung (Prognose): günstig Biologische Merkmale: auffällige Neurotransmitteraktivität 53 2) Typ II-Schizophrenie: ist gekennzeichnet durch negative Symptome Prämorbide Anpassung: relativ schlecht Reaktion auf herkömmliche Neuroleptika: schlecht Endzustand der Störung (Prognose): schlecht Biologische Merkmale: strukturelle Gehirnauffälligkeiten 5.1.4. Differentialdiagnose Die folgenden organischen bzw. somatischen Krankheitsfaktoren müssen ausgeschlossen werden: Delir oder Demenz Epilepsie (insbes. im Temporallappen) Tumor (insbes. im Frontal- und Tempoallappen) Schädel-Hirn-Trauma ZNS-Infektion (z.B. Neurosyphilis, AIDS etc.) Chorea Huntington (wird autosomal-dominant vererbt - Nachkommen homozygoter Träger haben„s also 100%ig - und geht ebenfalls mit motorischen Störungen, Sprachverarmung, geistigem Verfall etc. einher) Intoxikationen (z.B. Schwermetallvergiftung) Substanzinduzierte Psychosen (durch Kokain, Halluzinogene, Alkohol etc.) … Darüber hinaus müssen die folgenden psychischen Störungen ausgeschlossen werden: Schizotypische Störung (F 21) bzw. schizotypische Persönlichkeitsstörung (Achse II; DSM-IV) Leichte Form der Schizophrenie (anderer Schweregrad also) Wahnhafte Störung (F 22) Ist sehr selten; Patienten leiden unter ständigen Wahnideen (Verfolgungswahn. Liebeswahn etc.), ihr Wahn ist jedoch weniger bizarr als der von Schizophrenen und sie weisen im Unterschied zu diesen weder eine desorganisierte Sprache noch Halluzinationen auf! Akute, vorübergehende psychotische Störungen (F 23) Daher die lange Dauer: 6 Monate (s.o.)! Schizoaffektive Störung (F 25) besteht aus einer Mischung von Symptomen der Schizophrenie und der affektiven Störungen Depressive Episode (Major Depression) Zwangsstörung Autismus Simulation … 54 5.2. Epidemologie und Verlauf 5.2.1. Epidemologie: Lebenszeitprävalenz: 1 % (unabhängig von Kultur und Rasse) Beginn der Störung: 20-25 Jahre (Männer); 25-30 Jahre (Frauen) Die Krankheit setzt also meist in der späten Adoleszenz bzw. im frühen Erwachsenenalter an, wobei Männer im Schnitt 3 Jahre früher betroffen sind als Frauen. Sie kann jedoch auch früher (Kindheit) oder später (bis 40-50) einsetzen! Geschlechterverteilung: 1:1 Inzidenzrate pro Jahr: 1/10.000 5.2.2. Verlauf: Schizophrenie verläuft in den meisten Fällen zyklisch, wobei sich 3 Phasen voneinander abgrenzen lassen: 1) Prodomalphase Zeitlich und inhaltlich variabel: In über 80% der Fälle erhöhte Nervosität und Angespanntheit Außerdem: Konzentrations- und Schlafstörungen; Depression etc. Deutliches Absinken des Leistungsniveaus Sozialer Rückzug 2) Akutphase Zeitlich variabel (min. ein Monat) Auftreten der positiven Symptomatik Meist mangelnde Krankheitseinsicht 3) Residualphase Variable, meist chronisch bleibende Restsymptomatik; meist negativ Im Einzelnen ist der Verlauf einer Schizophrenie sehr variabel; in der ICD-10 werden sechs Verlaufstypen unterschieden (F.20.X0-5): 1. Kontinuierlicher Verlauf: konstantes Vorhandensein der Symptome 2. Episodisch mit zunehmendem Residuum (schubförmig progredient): Die Symptomatik in den Residualphasen nimmt von Schub zu Schub zu 3. Episodisch mit stabilem Residuum (schubförmig): Zwischen den Schüben (Akutphasen) liegen gleichbleibende Residualphasen (Restsymptomatik) 4. Episodisch-remittierender (phasenhafter) Verlauf: zwischen den Krankheitsepisoden liegen Phasen vollständiger Remission 5. Unvollständige Remission 6. Vollständige Remission Zur Häufigkeit bestimmter Verläufe: 5-Jahres-Studie: Einzelne Episode mit vollständiger Remission: 22% Mehrere Episoden; Remission vollständig oder teilweise: 35% Kontinuierlicher Verlauf: 8% Episodisch-progredienter Verlauf: 35% Langzeitkatamnese: 25% „geheilt“; 45% leichte bis mittelschwere Residualzustände; 30 % dauernde schwere Invalidisierung Lebenserwartung 10 Jahre geringer als bei der Allgemeinbevölkerung; 10 Mal so hohe Suizidrate (10%) 55 Die Vermont-Längsschnittstudie (1987) untersuchte die Lebensbedingungen von 168 Patienten 32 Jahre nach der ersten Klinikbehandlung 50% in eigener Wohnung; 40% im Wohnheim; 10% stationär; nur 19% verheiratet; der Rest: ledig, geschieden oder verwitwet; nur 40% mit Job (meist ungelernt); nur 55% keine oder nur leichte Beeinträchtigungen! Prognose: Prädiktoren für einen günstigen Verlauf sind: Unauffällige Primärpersönlichkeit Höheres Ausbildungsniveau Bessere soziale Anpassung Ungestörte Familienverhältnisse (bei Frauen) Akuter Krankheitsbeginn (ohne Promodalphase) Erkennbare psychosoziale Auslösefaktoren Vermehrt affektive oder paranoide Symptome Prädiktoren für einen ungünstigen Verlauf sind: Soziale Isolation Späte Behandlung Unverheiratet Vorangegangene psychiatrische Behandlung Frühere Verhaltensauffälligkeiten Fehlende Beschäftigung 5.3. Biologische Ätiologiefaktoren 5.3.1. Genetische und psychophysiologische Faktoren Mehrere Studien belegen, dass es eine Prädisposition für Schizophrenie gibt, die genetisch weitergegeben wird: Während die Lebenszeitprävalenz in der Normalpopulation bei einem Prozent liegt (s.o.), liegt sie bei eineiigen Zwillingen (von denen ein Geschwisterteil erkrankt ist) bei knapp 50%, bei zweieiigen Zwillingen bei 17%! Adoptionsstudien zeigen ferner, dass auch Kinder, die nicht bei ihrer pathogenen Mutter aufwachsen (Umwelteinfluss), ein erhöhtes Erkrankungsrisiko haben. Darüber hinaus gibt es Hinweise, dass die Negativsyptomatik (Typ II) stärker von genetischen Faktoren abhängt als die Positivsymptomatik (Typ II) Ein genetischer Marker für Schizophrenie könnte die Fähigkeit zu Augenfolgebewegungen sein. Letztere ist bei Schizophrenen und 50% ihrer Angehörigen beeinträchtigt. Messen lässt sie sich, indem man Pbn ein Pendel beobachten lässt und dabei mittels Elektrookulographie (EOG) die Augenbewegungen (glatte Folgebewegungen und Antisakkaden) misst. Ein genetischer Marker sind DNA-Abschnitte deren Ort bekannt ist und mit deren Hilfe sich weitere Genorte entdecken lassen; die Fähigkeit, bewegten Objekten mit den Augen zu folgen, wird auf Chromosom 6 vermutet; neurologisch hängt sie v.a. mit dem Frontal- und Temporallappen zusammen; also Arealen, die bei der Schizophrenie oft geschädigt sind (s.u.) 56 Einschub: Das dopaminerge System Dopamin (DA) gehört zusammen mit Adrenalin und Noradrenalin zur Gruppe der Katecholamine; der Hauptbildungsort von Dopamin ist die „Substantia nigra“ (ein Nervenkern im Mesencephalon) Die Synthese erfolgt in mehreren Schritten mittels verschiedener Enzyme: L-Phenyalanin L-Tyrosin L-Dopa Dopamin Noradrenalin Adrenalin Der Dopaminabbau erfolgt über die Enzyme MAO (Monoaminooxidase) und COMT (Catechyl-O-Methyltransferase) zu Homovanillinsäure (HNA) Es lassen sich 5 Rezeptortypen unterscheiden: D1-D5; bei allen 5 handelt es sich um metabotrope Rezeptoren (indirektes Gating) Der D2-Rezeptor dient häufig als Autorezeptor in der präsynaptischen Membran und hemmt dort die Wiederaufnahme des ausgeschütteten Dopamins (?!). 4 dopaminerge Systeme lassen sich unterscheiden: 1) Mesostriatales System: Motorik Von der Substantia nigra aus wird das inhibitorisch auf Bewegungsimpulse wirkende Striatum (Teil der Basalganglien) mittels Dopamin gehemmt. Erhöhte Verfügbarkeit von DA im mesostriatalen System: Hyperaktivität und Verhaltensstereotypien Verminderte Verfügbarkeit: Parkinson-Symptomatik (Parkinson => Untergang der dopaminergen Neurone in der Substantia nigra) 2) Mesolimbisches System: Motivation und Verstärkung Vom ventralen Tegmentum (VTA) zum Nucleus accumbens, zur Amygdala, dem Hypothalamus und dem Hippocampus Erhöhte DA-Konzentration im mesolimbischen System: gesteigerte Nahrungsappetenz und Sexualität; positive Symptomatik der Schizophrenie (Halluzinationen etc.) 3) Mesokortikales System: Vom ventralen Tegmentum zum Neocortex, v.a. zu präfrontalen Gebieten Unteraktivität der mesokortikalen Bahn: Negativsymptomatik der Schizophrenie (Denkstörungen; Verflachung der Affekte etc.) 4) Tuberohypophysäres System: Hormonsteuerung Vom Hypothalamus zum Hypophysenhinterlappen 5.3.2. Biochemische Faktoren Die Dopamin-Hypothese: führt Schizophrenie auf einen Überschuss an Dopamin zurück! Sie stützt sich dabei v.a. auf folgende Befunde: 1) Die Wirkung von Neuroleptika: Neuroleptika (s.u.) hemmen die dopaminerge Aktivität und führen (dadurch?) zu einer Linderung der schizophrenen Symptome! 2) Die Nebenwirklungen von Neuroleptika: erinnern an die Parkinson-Krankheit (Muskelstarre; Muskelzittern= Tremor etc.), die ihrerseits durch einen Mangel an Dopamin bedingt ist (Untergang der dopaminergen Zellen in der Substania nigra). Zur Behandlung von Parkinson wird L-Dopa verabreicht, das seinerseits psychose-induzierend wirken kann! 3) Die psychose-induzierende Wirkung von Drogen: Amphetamine können einen Zustand erzeugen, der dem der paranoiden Schizophrenie sehr ähnlich ist (Paranoia, Hallos etc.); zurückzuführen ist diese Wirkung auf eine Erhöhung der Dopamin-Ausschüttung! 57 Probleme der klassischen Dopamin Hypothese und neuere Modifikationen: Anders als die klassische Dopamin-Hypothese vermuten ließe, liegt der Hauptmetabolit von Dopamin, die Homovanillinsäure (HVA), bei Schizophreniepatienten nicht in erhöhter Konzentration vor! Ergo: Bei Schizophreniepatienten sind vermutlich nicht die Dopamin-freisetzenden Neurone überaktiv, sondern die Dopamin-Rezeptoren. Tatsächlich wurde bei Schizophrenen post mortem eine erhöhte Anzahl von Dopamin-Rezeptoren, v.a. vom D2-Subtyp, gefunden (dieser Befund lässt sich allerdings auch auf die medikamentöse Behandlung der betreffenden Patienten zurückführen) Die negative Symptomatik kann durch Neuroleptika kaum verbessert werden! Amphetamine führen keineswegs bei allen Patienten zu einer SymptomVerschlechterung; bei manchen (nämlich denen mit überwiegend negativer Symptomatik) bewirken sie sogar eine Besserung! Neuere Ansätze ordnen die positive- und negative Symptomatik daher je unterschiedlichen DopaminSystemen zu. Die positive Symptomatik wird auf eine Überaktivität der mesolimbischen Nervenbahnen, die negative auf eine Unteraktivität der mesokortikalen Nervenbahnen zurückgeführt. Sowohl die mesolimbischen, als auch die mesokortikalen Nervenbahnen (s.o.) beginnen im ventralen Tegmentum (Teil des Mesencephalons). Während letztere von dort zum präfrontalen Kortex verlaufen, führen erstere jedoch zum Hypothalamus, der Amygdala, dem Hippocampus und dem Nucleus accumbens (=Belohnungs- und Verstärkungszentrum). Da präfrontaler Kortex und limbisches System ihrerseits wiederum durch dopaminerge Nervenbahnen verbunden sind, sind die beiden Systeme jedoch nicht unabhängig voneinander! Die Dopamin-Neuronen im präfrontalen Kortex wirken z.B. hemmend auf die Dopaminneuronen im limbischen Bereich! Zusammenfassung des Modells: Verletzung des PFC Geringe Aktivität der Dopaminneuronen im PFC Negative Symptome der Schizophrenie Geringere Hemmung der mesolimbischen DA-Neuronen Positive Symptome der Schizophrenie Bewertung der biochemischen Befunde: Auch die neuere Dopamin-Theorie vermag Schizophrenie letztlich nicht befriedigend zu erklären; darüber hinaus gilt sie vermutlich ohnehin nur für Typ II-Schizophrenien. Folgende Probleme sind nach wie vor ungeklärt: Allgemeine methodische Probleme: Die therapeutische Wirksamkeit von Medikamenten ist kein Beweis, da der Einfluss von Drittvariablen nicht ausgeschlossen werden kann! Darüber hinaus kann die dopaminerge Überaktivität bei Schizophrenen auch auf andere Faktoren, wie z.B. deren übermäßigen Substanzmissbrauch (Alkohol, Kaffee etc.), die Ernährung oder mangelnde körperliche Aktivität zurückgehen. 58 Neuroleptika blockieren die Dopaminrezeptoren schon kurz nach der Einnahme; ihre therapeutische Wirkung tritt jedoch erst nach Tagen oder Wochen auf! Möglicher Weise wirkt die Blockade der D2-Rezeptoren nicht als solche therapeutisch, sondern lediglich indirekt, indem sie Auswirkungen auf andere Gehirnregionen und Transmittersysteme hat! Rätselhaft ist auch, warum Neuroleptika den Dopaminspiegel bzw. die Aktivität der Dopaminrezeptoren unter das normale Niveau senken müssen, um therapeutisch wirksam zu sein! – Der Theorie zufolge müsste ein normales Niveau ausreichend sein! Es ist wenig wahrscheinlich, dass nur ein einziger Transmitter für die vielen versch. Symptome einer Schizophrenie verantwortlich sein soll! Atypische Neuroleptika (s.u.) wirken, obwohl sie die D2-Rezeptoren nur schwach blockieren. Fazit: Vermutlich sind mehrere Transmittersysteme an der Genese einer Schizophrenie beteiligt, so dass die dopaminergen Systeme lediglich einen modulierenden Teil der Krankheit darstellen. Vermehrt untersucht werden in jüngerer Zeit u.a. die Bedeutung von Serotonin und Glutamat (das bei Schizophrenen in niedrigerer Konzentration vorhanden ist als bei „normalen“ Pbn) 5.3.3. Neuroanatomische und neuropsychologische Faktoren Post-Mortem-, CT- und MRT-Untersuchungen haben folgende strukturellen Auffälligkeiten zu Tage gebracht: Erweiterte Ventrikel: Schizophrene Patienten haben oftmals erweiterte Ventrikel – und damit weniger subkortikale Gehirnzellen (betrifft v.a. den frontalen und temporalen Bereich). Studie: 12 von 15 eineiigen Zwillingen, die hinsichtlich der Schizophrenie diskordant waren, konnten anhand dieses Merkmals voneinander unterschieden werden. Aus dieser Studie folgt zweierlei: 1. Besteht zwischen der Erweiterung der Ventrikel und Schizophrenie ein Zusammenhang. 2. Kann die Erweiterung der Ventrikel nicht bzw. nicht nur genetisch bedingt sein. Auch wenn die Erweiterung der Ventrikel zu den am häufigsten nachgewiesenen Befunden zählt, ist sie weder notwendig, noch spezifisch für eine Schizophrenie. Nicht alle Schizophrenen haben also erweiterte Ventrikel und nicht alle, die erweiterte Ventrikel haben, sind schizophren (eine Erweiterung findet sich auch oft bei anderen Psychosen, wie z.B. der Manie) Hypofrontalität und präfrontale Athrophie (Gewebeschwund): Verschiedene Befunde sprechen dafür, dass Schizophrenie mit einer Unteraktivierung und/oder mangelnden Ausprägung des präfrontalen Kortex einhergeht. Der PFC ist u.a. bedeutsam für eine adäquate Handlungsplanung und -steuerung und die Regulation von Emotionen. Beide Funktionsbereiche sind bei Schizophrenen massiv beeinträchtigt! MRT-Untersuchungen an Schizophrenen weisen auf eine Abnahme der grauen Substanz im präfrontalen Kortex hin. Funktionale bildgebende Verfahren (fMRT etc.) zeigen, dass im PFC von Schizophrenen eine geringere Stoffwechselaktivität und Durchblutung 59 stattfindet – und zwar auch dann, wenn die Pbn psychologische Aufgaben bearbeiten, deren Bearbeitung bei gesunden Pbn zu einer Aktivitätssteigerung im PFC führt. Beispiel: Der „Wisconsin Cart Sorting Test“ (WCST) erfasst kognitive Flexibilität; Aufgabe ist es, Karten mit unterschiedlichen Farben, Symbolen und Zahlen nach wechselnden Regeln zu ordnen (entweder nach Farbe, Symbol oder Zahl); Schizophrene schneiden bei dieser Aufgabe nicht nur wesentlich schlechter ab, sondern weisen bei der Bearbeitung weniger Stoffwechselaktivität im PFC auf! Hippocampus-Veränderungen: Der Hippocampus ist paarig angelegt und liegt im medialen Temporallappen; seine Hauptfunktion besteht in der Konsolidierung und Koordinierung von Gedächtnisinhalten. Bei schizophrenen Patienten ist der anteriore (vordere) Hippocampus oft verkleinert; darüber hinaus weist er vielfach eine andere Zytoarchitektur auf: die in ihm enthaltenen Neuronen (in 3 Schichten von CA1- CA3) sind bei Schizophrenen nämlich oftmals nicht in eine Richtung ausgerichtet, sondern desorganisiert! Den neuroanatomischen Defiziten entsprechen verschiedene neuropsychologische Mängel: Die meisten Schizophrenen (80%) zeigen deutliche Aufmerksamkeits-, Arbeitsgedächtnis-, Wortflüssigkeits-, Handlungskontroll- und Intelligenzdefizite! Die Aufmerksamkeitsdefizite von Schizophrenen äußern sich in einer erhöhten Ablenkbarkeit durch irrelevante Reize; letztere ist vermutlich auf eine gestörte Reizselektion (sprich: einen defekten Aufmerksamkeitsfilter) zurückzuführen. Bei Tests zur Gedächtnisspanne mit ablenkenden Reizen schneiden Schizophrene schlechter ab als Gesunde; ihre Defizite hängen dabei v.a. mit dem ausbleibenden Primacy-Effekt zusammen. Ausbleibender Primacy-Effekt => Gestörter Enkodierungsprozess Auch beim „Continous Performance Test“ (CPT), der zur Testung der selektiven Aufmerksamkeit und der Daueraufmerksamkeit dient, sind Schizophrene schlechter. Die Pbn bekommen beim CPT über längere Zeit verschiedene Buchstaben dargeboten und sollen, immer wenn auf ein „O“ ein „X“ folgt, mit einem Tastendruck reagieren (s.u.). Die sog. „Prepulse Inhibition“ (PPI) fällt bei Schizophrenen deutlich geringer oder sogar ganz aus; man versteht darunter das Phänomen, dass die StartleReaktion auf einen Reiz (lauter Ton, Berührung etc.) geringer ausfällt, wenn diesem Reiz ein anderer Reiz (prepulse) unmittelbar vorangeht. Erklärung: Der erste Reiz (prepulse) muss erst fertig verarbeitet werden, bevor man sich ganz einem zweiten Reiz widmen kann (Schutz für Reizüberflutung = „sensory gating“). Dass die PPI bei Schizophrenen geringer ist, deutet auf eine gestörte Informationsverarbeitung hin: Jeder Reiz scheint als neu und bedeutsam erachtet zu werden. Nebenbemerkung: Bei Rauchern ist die PPI am höchsten; vielleicht rauchen auch deshalb so viele Schizophrene (zu Selbstheilungszwecken!) 50% der Schizophrenen (v.a. die mit negativer Symptomatik) zeigen auf harmlose Töne normaler Lautstärke keine elektrodermale Orientierungsreaktion (kurzfristige Erhöhung der Hautleitfähigkeit?). Die Orientierungsreaktion tritt normalerweise bei neuen Reizen geringer physikalischer Intensität auf; sie dient der Aufmerksamkeitsausrichtung und äußert sich u.a. in einem kurzfristigen Absinken der Herzrate. 60 Schizophrene begehen beim dichotischen Hörtest mehr Fehler, aber eher, weil sie relevante Reize einfach nicht beachten oder vergessen – und nicht so sehr, weil sie sich von der 2. Tonspur ablenken lassen. Schlussfolgerungen: Die genannten Befunde legen nahe, dass eine anticholinerge Medikation (wie sie gegen motorische Nebenwirkungen häufig eingesetzt wird) evtl. problematisch ist (schließlich spielt ACh auch für Aufmerksamkeitsprozesse eine entscheidende Rolle) Wie die Aufmerksamkeitsdefizite mit der sonstigen Symptomatik zusammenhängen, ist noch nicht wirklich geklärt. Es liegt jedoch nahe, sie zu den formalen Denk- und Sprachstörungen in Bezug zu setzen. 5.3.4. Sonstige biologische Faktoren Geburtskomplikationen: Bei Personen, die später schizophren werden, sind besonders häufig Geburtskomplikationen aufgetreten (Frühgeburt, vermindertes Geburtsgewicht, Sauerstoffunterversorgung etc.); darüber hinaus scheinen Infektionen während der Schwangerschaft (v.a. im 3-7 Monat => Entwicklung des Kortex) das Risiko für Schizophrenie zu erhöhen. Die meisten schizophrenen Patienten sind in den Wintermonaten (November, Dezember) geboren (Temperaturminderung; Infektionen; Medikamenteneinnahme etc. werden als mögliche Moderatoren diskutiert) Nach Influenza- und Grippeepidemien treten schizophrene Erkrankungen häufiger auf (dieser Effekt wird jedoch nicht in allen Studien gefunden) Problem und Lösung: Warum brechen Schizophrenien, wenn die sie bedingenden Gehirnläsionen schon während der Schwangerschaft oder bei der Geburt erfolgen, dann erst im frühen Erwachsenenalter aus? - Weil der präfrontale Kortex erst in der Adoleszenz voll ausreift und vorher noch nicht die entscheidende Rolle spielt, die er danach inne hat! Um mögliche Vulnerabilitätsfaktoren einer Krankheit zu ermitteln, lassen sich folgende Arten von Studien durchführen: 1) Prospektive High-risk-Studien: untersuchen die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit hohem Risiko (schizophrene Mutter); die bisher wichtigsten Ergebnisse solcher Studien: Pbn, die später tatsächlich erkranken, weisen oft eine verzögerte motorische Entwicklung und einen geringeren IQ auf; sie erbringen schlechtere Schulleistungen und werden eher als schwierig empfunden. Darüber hinaus sind bei ihrer Geburt häufiger Komplikationen aufgetreten (s.o.) als bei den Kontrollpersonen und denen, die nicht erkranken! Die Wahrscheinlichkeit einer negativen Symptomatik wird erhöht durch: Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen Elektrodermale Non-Responsivität (s.o.: Orientierungsreaktion) Die Wahrscheinlichkeit einer positiven Symptomatik wird erhöht durch: Unstabile Familienverhältnisse (Trennung der Eltern…) Vorübergehender Heimunterbringung 2) Retrospektive Studien (Follow-back-Studien): rekonstruieren nachträglich die Entwicklungsgeschichte von Schizophrenen (methodisch problematisch) Mehr Schuleinträge; stärkerer sozialer Rückzug; schlechtere Noten Analysen von Familienvideos zeigen, dass Schizophrene schon als Kinder weniger positive Emotionen zeigten und in der motorischen Entwicklung hinter normalen Kindern (z.B. ihren Geschwistern) zurück waren. 61 3) Kohorten-Studien: untersuchen gesamte Geburtskohorten über lange Zeiträume, so z.B. in England geschehen (5000 Vpn über 30 Jahre; 30 davon wurden schizophren) 5.4. Soziale und psychologische Ätiologiefaktoren 5.4.1. Labelling-Ansatz Der Labelling- bzw. Etikettierungsansatz (in den 60ern entstanden) geht davon aus, dass psychische Störungen die Folge gesellschaftlicher Stigmatisierungen sind. Menschen sind demnach nicht von sich aus „abnorm“, sondern werden erst durch die Gesellschaft in diese Rolle gezwängt; nur, wer von der Mehrheit als „gestört“ angesehen- und entsprechend behandelt wird, entwickelt tatsächlich eine bleibende „Störung“! Rosenhan-Experiment (1972): Rosenhan schickte 8 normale Personen an verschiedene Kliniken, um sich dort als „Patienten“ auszugeben und über akustische Halluzinationen zu klagen: Die betreffenden Personen wurden in fast allen Fällen eingewiesen und erst nach 19 Tagen (in einem Fall sogar 59 Tagen!) wieder entlassen. Obwohl sie sich nach dem Diagnosegespräch wieder völlig normal verhielten, wurde (außer von einigen Mitpatienten!) von niemandem bemerkt, dass sie gesund waren! Während des Klinikaufenthalts protokollierten die „Pseudopatienten“ genauestens, wie mit ihnen umgegangen wurde: Ihre Fragen wurden nicht ernst genommen, es wurden keine ernsthaften Gespräche geführt etc. etc. Kritik: Es gibt außer dem Rosenhan-Experiment kaum empirische Befunde, die den Labelling-Ansatz stützen könnten, dafür aber eine Vielzahl von Befunden, die gegen ihn sprechen. 1) Gibt es keine gesellschaftspezifischen Unterschiede, was die Häufigkeit von Schizophrenie betrifft 2) Bestehen, was die Zeit vor und nach einem Klinikaufenthalt betrifft, i.d.R. keine Unterschiede in sozialen Variablen wie dem Beruf oder Beziehungen; sprich: die Patienten sind nachher nicht weniger angepasst als vorher! 5.4.2. Sozioökonomischer Status Die Schizophrenierate ist in den untersten Sozial-Schichten (sprich: in Slums und Arbeitervierteln) am höchsten! Dazu gibt es 2 Erklärungen: 1) Soziogenetische Hypothese („social stress“): Das Leben unter den schlechten Bedingungen ist eine Ursache der Krankheit (mehr Stress, mehr kritische Life-Events, schlechtere Ernährung, schlechtere medizinische Versorgung, weniger Bildung etc.) 2) Social-Drift Hypothese („social selection“): Nicht die soziale Schicht bedingt die Krankheit, sondern die Krankheit die soziale Schicht. Schon im Vorfeld der akuten Krankheit driften Schizophrene aufgrund der Symptomatik der Promodalphase (Antriebslosigkeit, sozialer Rückzug etc.) in die unterste Schicht ab. Die empirischen Daten sprechen eher für die Social-Drift Hypothese (man braucht sich dazu nur die Herkunftsfamilien der Schizophrenen anzuschauen, die in den meisten Fällen einen besseren sozioökonomischen Status innehaben) 62 5.4.3. Familiäre Interaktion Familientherapeutische Ansätze führen Schizophrenien auf eine gestörte familiäre Interaktion zurück. Bateson, Watzlawick & Co (1956): stellten in diesem Zusammenhang die Theorie der „Doppelbindung“ („Double bind“) auf; sie verstehen darunter paradoxe Botschaften, auf die nicht adäquat reagiert werden kann; also z.B. wenn Mama mit Tränen in den Augen und zittriger Stimme (nonverbale Ebene) meint: „Nein, nein, du brauchst dir keine Sorgen machen; mir geht’s wunderbar!“ Die These: Werden Kinder von ihren Bezugspersonen gehäuft mit derartigen Double-Bind-Botschaften konfrontiert, entwickeln sie im Extremfall eine Schizophrenie; sie verlieren jedwedes Gespür für zwischenmenschliche Kommunikation! Singer et al. (1975): sprechen von „kommunikativer Abweichung“ („communication deviance“); ihre These ist jedoch letztlich dieselbe: Schizophrenien sind auf gestörte Kommunikationsformen in der Herkunftsfamilie zurückzuführen. Kritik: Die Gültigkeit der beiden genannten Ansätze ist empirisch nicht belegt! Auch wenn gestörte Kommunikationsmuster einen Risikofaktor darstellen sollten, ist dieser wohl kaum schizophreniespezifisch! 5.4.4. Das Vulnerabilitäts-Stress-Modell (VSM) und Expressed Emotion (EE) Das Vulnerabilitäts-Stress-Modell (von Liberman) geht von einer starken genetischen Komponente aus, betont aber, dass dispositionelle Vulnerabilitätsfaktoren nur im Zusammenspiel mit Umweltfaktoren zu einer Schizophrenie führen! Zu berücksichtigen sind dementsprechend nicht nur biologische, sondern auch psychosoziale und familiäre Faktoren! Ein zentraler Forschungszweig innerhalb des Vulnetabilitäts-Stress-Modells beschäftigt sich dementsprechend mit dem Einfluss, den die nächsten Angehörigen schizophrener Patienten auf deren Krankheitsverlauf haben. Als die entscheidende Variable wird dabei die „Expressed Emotion“ (EE) der Familie angesehen; die EE (~emotionales Klima) äußert sich in offener/verdeckter Feindseligkeit gegenüber dem kranken Familienmitglied (kritische Bemerkungen etc.) und/oder in emotionalem Überengagement (Überbehütung); ist sie hoch, besteht ein hohes Rückfallrisiko (ca. 50% nach 912 Monaten), ist sie niedrig, eher nicht (rund 20%!). Das „Camberwell Family Interview“ ist ein halbstandardisiertes Interview zur Erfassung des emotionalen Klimas in Familien psychisch kranker Menschen; es zielt dabei speziell auf die Messung der „Expressed Emotion“. Zu diesem Zweck werden die erhobenen Aussagen von ausgebildeten Ratern anhand von 4 Skalen beurteilt: a) Kritik (Ausdruck von Missbilligung, Ärger, Abneigung,… gegenüber dem Patienten) b) Feindseligkeit (Wird der Patient aufgrund überdauernder Persönlichkeitsmerkmale oder wegen umschriebener Verhaltensweisen missbilligt?) c) Emotionales Überengagement (extreme Sorgen um den Patienten, Aufopferung für den Patienten; übertriebene Fürsorglichkeit etc.) d) Wärme (Sympathie, Sorge,…) 63 Das CFI wird im klinischen Alltag bedauerlicherweise kaum eingesetzt, da zu zeitaufwendig (1-2 h) und kaum relevant für die Indikationsentscheidung! Weitere Ergebnisse zur EE: Der kausale Zusammenhang zw. EE und Krankheitsverlauf ist vermutlich bidirektional: Neuere Studien zeigen z.B., dass kritische Bemerkungen in Familien mit hoher EE durch bizarre Äußerungen des Patienten verstärkt werden, so wie umgekehrt, Patienten, die von ihrer Familie viel kritisiert werden, mehr bizarre Gedanken äußern! Der Zusammenhang von EE und Krankheitsverlauf ist nicht spezifisch für Schizophrenie, sondern findet sich auch bei anderen Störungen wie der Depression oder bipolaren Störungen! Das Ausmaß der EE ist kulturabhängig: In Indien z.B. ist der Anteil an Familien mit „high EE“ wesentlich geringer (22%) als im angloamerikanischen Raum (knapp 70%)! EE bzw. Stress allgemein wirkt vermutlich über die HypothalamusHypophysen-Nebennierenrinden-Achse (s.u.) Die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HPA): Stress aktiviert die HPA, die ihrerseits in einem bidirektionalen Zusammenhang zur dopaminergen Aktivität steht! Stress (etwa durch eine hohe EE) aktiviert die HPA und führt dadurch zur Sekretion von Kortisol. Kortisol wiederum erhöht die Dopaminaktivität und kann dadurch die Schizophreniesymptome verstärken. Darüber hinaus steigert eine erhöhte Dopaminaktivität die Aktivierung der HPA, was die Betroffenen besonders stressempfindlich macht! Stress (EE etc.) HPA Kortisol Dopaminaktivität Positive Rückkopplung Darüber hinaus führt Stress zu verstärktem Substanzmissbrauch; Drogen wiederum stimulieren die Dopaminsysteme (=> positive Symptomatik) Zusammenfassung: Robuste (in mehreren Studien nachgewiesene) Prädiktoren für den Verlauf einer Schizophrenie sind: Soziodemographische und familienbezogene Daten Gute Prognose: verheiratet, niedrige EE Schlechte Prognose: ledig/geschieden/getrennt; hohe EE Prämorbide Persönlichkeit und Anpassung Gute Prognose: gute Anpassung im Arbeits- und Freizeitbereich; extrovertierte oder zyklothyme Persönlichkeit Schlechte Prognose: Soziale Isolation Vorausgegangene Krankheitsepisoden Gute Prognose: seltener und von kürzerer Dauer Schlechte Prognose: häufiger und von längerer Dauer Art des Krankheitsbeginns Gute Prognose: akut Schlechte Prognose: schleichend; Negativsymptomatik 64 5.5. Behandlung 5.5.1. Medikamentöse Behandlung Neuroleptika (auch „Antipsychotika“ genannt) haben eine antipsychotische und sedierende Wirkung; sie sind daher bei der Behandlung von Schizophrenien und anderen psychotischen Störungen unverzichtbar! Neuroleptika werden sowohl zur Akutbehandlung, als auch zur Rückfallprophylaxe eingesetzt. Der biochemische Wirkmechanismus von Neuroleptika ist hochkomplex und noch immer nicht bis ins Letzte geklärt: Gemeinsam ist allen Neuroleptika ihre hemmende Wirkung auf die dopaminerge Übertragung; erreicht wird diese durch die antagonistische Besetzung der Dopaminrezeptoren; für die antipsychotische Wirkung ist dabei insbes. die Blockade der D2-Rezeptoren bedeutsam. Neuroleptika interagieren aber auch mit anderen Transmittersystemen: Rezeptoren für Serotonin (insbes. 5-HT2A), Acetylcholin (meist α1), Histamin und Noradrenalin z.B. werden von ihnen, wenn auch in geringerem Maße, teilweise ebenfalls blockiert! Neuroleptika haben eine Vielzahl von Nebenwirkungen – besonders ins Gewicht fallen dabei die extrapyramidal-motorischen Nebenwirkungen (s.u.), die sich folgendermaßen erklären lassen: Blockiert werden nicht nur die Dopaminrezeptoren des mesolimbischen und mesokortikalen Systems (schizophrene Symptomatik), sondern auch die des mesostriatalen Systems (Motorik) Parkinson-Symptomatik Wechselwirkung mit anderen Transmittersystemen, insbes. Verminderung der ACh-Aktivität im Striatum (die für die Motorik überaus wichtig ist) Je nachdem, ob die antipsychotische oder die sedierende Wirkung im Vordergrund steht (wovon zumindest bei den typischen Neuroleptika das Ausmaß der motorischen Nebenwirkungen abhängt), wird zwischen hoch-, mittel- und niedrigpotenten Neuroleptika unterschieden. Bei ersteren (z.B. bei Haloperidol) sind die antipsychotische Wirkung und damit die motorischen Nebenwirkungen im Verhältnis zur sedierenden Wirkung hoch, bei den niedrig-potenten Neuroleptika ist es umgekehrt! Alle Neuroleptika wirken symptomatisch; d.h. sie führen zu keiner Heilung im eigentlichen Sinne, sondern bekämpfen lediglich die Symptomatik! Zumindest die klassischen bzw. typischen Neuroleptika haben dabei kaum lindernde Wirkung auf die Negativsymptomatik, sondern können diese im schlimmsten Fall sogar noch verschlimmern! Neuroleptika bewirken keine Bewusstseinsveränderung und führen nicht zu Toleranzentwicklung und Gewöhnung! Geschichtliches: Früher (1. Hälfte des 20.Jh.): Zwangsjacken, Elektrokrampftherapie und präfrontale Lobotomie (Durchtrennung der Nervenbahnen zw. Frontallappen und den unteren Gehirnzentren)! 1. Revolution: Neuroleptika wurden erstmals in den 50ern (1952 in Europa, 1954 in den USA) eingesetzt; das erste Neuroleptikum war dabei Chlorpromazin. Der Anteil dauerhaft hospitalisierter Patienten wurde dadurch enorm reduziert (ein gigantischer Erfolg)! 2. Revolution: Seit rund 30 Jahren wird vermehrt auf atypische Neuroleptika gesetzt (s.u.); das erste atypische Neuroleptikum war Clozapin! 65 Zum Unterschied zwischen typischen (z.B. Chlorpromazin, Haloperidol,…) und atypischen (z.B. Clozapin und Risperidon) Neuroleptika: Letztere haben a) weniger Nebenwirkungen (v.a. die extrapyramidal-motorischen Störungen treten hier in den Hintergrund) und b) ein weiteres Wirkungsfeld, sofern durch sie auch die negative Symptomatik gelindert werden kann. Bezüglich ihrer chemischen Beschaffenheit sind sie jedoch äußerst heterogen (sie zu einer Gruppe zusammenzufassen ist daher nicht unproblematisch). Typische Neuroleptika: blockieren vorwiegend die Dopaminrezeptoren, und zwar insbes. die D2-Rezeptoren! Resultat: sämtliche Dopamin-Systeme werden mehr oder minder lahmgelegt (=> EPMS); die serotoninerge Übertragung bleibt dagegen weitgehend unbeeinflusst (=> Negativsymptomatik); Atypische Neuroleptika: blockieren zwar ebenfalls die D2-Rezeptoren, aber in wesentlich geringerem Ausmaß; darüber hinaus besetzten sie u.a. (und zwar recht umfassend) die serotinergen 5-HT2A-Rezeptoren. Bei letzteren handelt es sich um Autorezeptoren, die nicht nur die Serotoninausschüttung regulieren, sondern, zumindest indirekt, auch Einfluss auf die Freisetzung von Dopamin haben. Resultat: Da nicht alle D2-Rezeptoren besetzt werden, kommt es zu weniger extrapyramidalen-motorischen Störungen; durch die Blockade der 5-HT2A-Rezeptoren (=> vermehrte Serotoninfreisetzung) wird die Negativsymptomatik gelindert. Einige Neuroleptika (und Substanzgruppen) im Überblick: Trizykl.Neuroleptika Thioxanthene Chlorpromazin Promethazin (Propaphenin) (Atosil) Perazin (Taxilan) Butyrophenone Haloperidol Benperidol (Haldol) „Atypische“ N. Clozapin (Leponex) Risperidon (Risperidal) Zu den Nebenwirkungen: Extrapyramidale Nebenwirkungen: Parkinsonoide Symptomatik (bei 20-30% der Patienten): Rigor (Muskelstarre); Tremor (Muskelzittern); Hypokinese (Bewegungsarmut: kleinschrittiger Gang etc.), Akinese etc. Akute Dystonien = Verkrampfungen und Fehlhaltungen (ca. bei 20%; v.a. anfangs): Zungen-Schlund-Krampf; Blickkrämpfe; Retrocollis (Kopf durch Krampf nach hinten gebeugt); Torticollis („verdrehter Hals“),… Akathisie = „Sitzunruhe“ (bei ca. 20%) Früh- und Spätdyskinesien (bei ca. 20 %): unwillkürliche Bewegungen v.a. im Mundbereich; Spätdyskinesien sind dabei besonders problematisch; sie treten erst nach längerfristiger Medikation (manchmal erst nach Jahren) auf und sind oft irreversibel! „Malignes Postsynaptisches Syndrom“ (bei 1% der Patienten): Schwere Muskelstarre, begleitet von Fieber, Herzrasen und erhöhtem Blutdruck; in 20% der Fälle tödlich! Anticholinerge Nebenwirkungen: Mundtrockenheit; Miktionsstörungen (Probleme beim Pinkeln); Obstipation (chronische Verstopfung) Gewichtszunahme (vermutlich eine antiserotonerge Nebenwirkung, die v.a. bei atypischen Neuroleptika auftritt) Brustwachstum, Milchfluss, sexuelle Dysfunktionen 66 Zur Wirkung: Die Wirksamkeit von Neuroleptika ist eindeutig nachgewiesen: Sie führen nicht nur bei den meisten Patienten zu einer signifikanten Besserung der Symptome, sondern senken auch die Rückfallwahrscheinlichkeit (Erhaltungstherapie). Non-Responder: Lediglich 5-25% der Patienten sprechen auf Neuroleptika nicht an; dem Rest ist mit ihnen geholfen (wenn auch in unterschiedlichen Ausmaß). Zum Vergleich: Bei Placebo-Gabe kommt es lediglich (bzw. immerhin) bei 15% der Patienten zu einer Remission! Neuroleptika sind der wirksamste Faktor der Rückfallprophylaxe! Werden sie abgesetzt, erleiden auf Dauer 70-80% der Patienten einen Rückfall; das gilt auch, wenn die Medikation erst nach 1 bis 5 Jahren Symptomfreiheit beendet wird. Durch Symptomfreiheit wird das Rückfallrisiko also nicht reduziert; durch dauerhafte Medikation dagegen ganz gewaltig (zum Vergleich: unter Placebo gibt es mehr als doppelt so viele Rückfälle als unter Medikation!) Zur Anwendung: Frühinterventions- vs. Niedrigdosierungsstrategie Ersterer geht es darum, einer Verfestigung der Störung von vornherein den Boden zu entziehen; letzterer darum, die Nebenwirkungen so gering wie möglich zu halten! Problem: Mehr als die Hälfte der Patienten beendet die Medikation nach der Entlassung (Gründe: Nebenwirkungen; verzögerte Wirkung; Negativsymptomatik, fehlende Krankheitseinsicht etc.) Daher oft Depotgabe (Neuroleptikum wird intramuskulär appliziert, sprich: gespritzt, und bleibt dort, je nach Präparat, ein bis vier Wochen aktiv)! Außerdem: Psychotherapie (s.u.), da diese die Compliance erhöht „Konsensus-Richtlinien“: medikamentöse Rezidivprophylaxe nach Erstmanifestation für 1 Jahr, nach einer weiteren Episode für mindestens 5 Jahre! Risiken der Langzeitmedikation: Spätdyskinesien (s.o.) Verstärkung der „Minus-Symptomatik“ (kognitive Defizite, Affektverflachung etc.) 67 5.5.2. Psychotherapie Auch wenn auf Neuroleptika bei der Behandlung von Schizophrenien nicht verzichtet werden kann, sollte die Medikation immer von psychotherapeutischen Maßnahmen begleitet werden. Dass Psychotherapie die Effektivität medikamentöser Behandlung erhöht, konnte für folgende therapeutischen Programme nachgewiesen werden: 1) Interpersonale Therapie (Trainingsprogramme zur Verbesserung kognitiver und sozialer Fertigkeiten) 2) Psychoedukative bzw. verhaltenstherapeutische Familienbetreuung (nach Falloon et al.) 3) Kognitive Verhaltenstherapie Psychoanalyse, Tiefenpsychologie etc. haben sich dagegen als nicht wirksam erwiesen. Dass Psychotherapie wirksam ist, hat dabei v.a. folgende Gründe: 1. Erhöhung der Medikamenten-Compliance (=> Medikamente werden seltener abgesetzt => geringere Rückfallraten) 2. Senkung der „Expressed Emotion“ (=> weniger Stress für die Patienten => geringere Rückfallraten) 3. Bessere Reintegration der Patienten (durch eine Minderung der kognitiven und sozialen Defizite) 4. Besserer Umgang mit den Symptomen Die psychoedukative bzw. verhaltenstherapeutische Familienbetreuung (nach Falloon et al., 1984): basiert auf dem Vulnerabilitäts-Stress-Modell (von Libermann) und den Erkenntnissen der EE-Forschung: Ziel ist es, die Lage des Patienten zu beruhigen, indem die Lage der Familie beruhigt wird (=> Rückfallprophylaxe). Das Konzept umfasst dabei folgende Komponenten: 1) Neuroleptikamedikation 2) Diagnostik (Analyse familiärer Konflikte und Belastungen) 3) Psychoedukation (Information über Schizophrenie und Medikation) Um z.B. das nicht selten auftretende Missverständnis auszuräumen, der Patient könne seine Krankheit kontrollieren 4) Kommunikationstraining 5) Problemlösetraining 6) Bei Bedarf: Einzeltherapie Evaluation (nach Falloon): Während die Rückfallrate bei gängiger Einzeltherapie nach 2 Jahren bei über 60% lag, lag sie bei Familienbetreuung bei rund 30% (ist also weniger als halb so hoch)! Patienten mit Familienbetreuung wiesen seltener schizophreniespezifische Symptome auf und waren besser angepasst. Die Belastung in der Familie wurde von allen Beteiligten geringer eingeschätzt. Verbesserung der familiären Kommunikationsmuster Kostenreduktion (20-30%) Kognitiv-verhaltenstherapeutische Maßnahmen: können helfen, mit den Symptomen, die auch durch die Medikation nicht in den Griff zu bekommen sind, besser umzugehen. Bei 20-25% (!) der Patienten gehört zu diesen Symptomen auch das Stimmenhören; es tritt bei ihnen chronisch auf, weshalb es in der Therapie lediglich darum gehen kann, es „erträglicher“ zu machen. Focusing-Techniken Veränderung von Bewertungsprozessen (die Stimme als „Freund“) 68 Verbesserung der Bewältigungsstrategien 6. Essstörungen 6.1. Darstellung der Störungsbilder 6.1.1. Die verschiedenen Arten von Essstörungen Drei Hauptarten von Essstörungen lassen sich unterscheiden: 1) „Anorexia nervosa“ (= Magersucht): Essstörung, bei der der Betroffene sich weigert, ein normales Gewicht zu halten, starke Angst vor Gewichtszunahme und eine so gestörte Körperwahrnehmung hat, dass er sich noch immer zu dick fühlt, selbst wenn er abgemagert ist. Der Begriff „Anorexia“ meint einen schweren Appetitverlust; „nervosa“ bedeutet, dass die Gründe für diesen Gewichtsverlust emotionaler Art sind! 2) „Blulimia nervosa“ (=Bulimie): Essstörung, bei der der Betroffene Heißhungeranfälle erleidet und danach Ausgleichsmaßnahmen wie Erbrechen, Fasten oder übermäßige körperliche Betätigung ergreift, um eine Gewichtszunahme zu verhindern. Der Begriff „Bulimie“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie „Ochsenhunger“; der Unterschied zur Magersucht besteht darin, dass Bulimiker/innen keinen Gewichtsverlust erleiden! 3) „Binge-Eating-Disorder“: Essstörung, die durch unkontrollierbare Fressattacken gekennzeichnet ist, über die der Betroffene verzweifelt ist. Es kommt aber weder zu Gewichtsverlust (Magersucht), noch zu Gegenmaßnahmen (Bulimie) Fällt in der ICD-10 und im DSM-IV noch unter die „Nicht näher bezeichneten Essstörungen“, ist also noch keine formale Diagnose; wird aber zunehmend erforscht, wobei sich die Hinweise mehren, dass es sich um ein eigenständiges Störungsbild handelt. ICD-10 und DSM-IV unterscheiden zwischen folgenden Arten von Essstörungen: ICD-10 DSM-IV Anorexia nervosa (F 50.0) Anorexia nervosa Ohne aktive Maßnahmen zur Ge- Restriktiver Typus wichtsabnahme (F 50.00) „Binge-Eating / Purging“-Typus Mit aktiven Maßnahmen zur Gewichtsabnahme (F 50.01) Bulimia nervosa (F 50.2) Bulimia nervosa „Purging“-Typus Atypische Bulimia nervosa (F 50.3) „Non-Purging“-Typus Essattacken bei sonstigen psychischen Störungen (F 50.4) Erbrechen bei sonstigen psychischen Störungen (F 50.5) Sonstige Essstörungen (F 50.8) Nicht näher bezeichnete Essstörungen Nicht näher bezeichnete Essstörungen (F 50.9) 69 Einschub: „Normalgewicht“ und der Body-Maß-Index Das Normalgewicht wurde früher nach der sog. Broca-Formel berechnet: Normalgewicht (kg) = Körpergröße (cm) - 100 Heute wird der sog. Body Maß Index (BMI) berechnet: BMI = 𝐆𝐞𝐰𝐢𝐜𝐡𝐭 𝐢𝐧 𝐤𝐠 𝐊ö𝐫𝐩𝐞𝐫𝐠𝐫öß𝐞 𝐢𝐧 𝐌𝐞𝐭𝐞𝐫 ² Problem: Der BMI gibt keine Auskunft darüber, ob das Gewicht durch Muskelmasse oder Fettgewebe zustande kommt: Es kann daher derselbe Body-Maß-Index bei unterschiedlicher Statur vorliegen (=> Sportler und Bodybuilder gelten nach dem BMI z.B. oft als übergewichtig, was natürlich nicht stimmt). Welcher BMI als „normal“ gilt, hängt vom Geschlecht und vom Alter ab: Für die Altersgruppe zw. Mitte 20 und Mitte 30 gilt bei Männern ein BMI zw. 20 und 25-, bei Frauen zw. 19 und 24 als normal * Zum Vgl.: bei Personen über 64 liegen diese Werte zw. 24 u. 29! Was darunter liegt (< 20 bzw. 19) gilt als untergewichtig. Ein BMI, der über dem Normalgewicht und unter 30 liegt, wird als übergewichtig (bzw. als „Präadipositas“) klassifiziert. Ein BMI über 30, gilt als Adipositas (wobei je nach „Schwere“ zw. Adipostas 1., 2. und 3. Grades unterschieden wird). 6.1.2. Diagnostische Kriterien nach der ICD-10 und dem DSM-IV Die ICD-10 definiert „Anorexia nervosa“ (F 50.0): …als absichtlichen Gewichtsverlust, verbunden mit den folgenden Kriterien: 1) Drastische Gewichtsabnahme: Körpergewicht liegt mind. 15% unter dem Normalgewicht oder ein BMI < 17, 5 2) Gewichtsabnahme ist selbst herbeigeführt: z.B. durch Vermeidung hochkalorischer Speisen, selbstinduziertes Brechen, selbstinduzierte Abführung, übertriebene körperliche Aktivität oder den Gebrauch von Appetitzüglern oder Diurektika (=> Ausschwemmung von Wasser) 3) Körperschemastörung: überzogene Angst, dick zu werden; ungerechtfertigte Überzeugung, dick zu sein; übertriebene Beschäftigung mit dem eigenen Körper 4) Endokrine Störung: Bei Frauen => Amenhorroe (Ausbleiben der Menstruation), bei Männern => Libido- und Potenzverlust; bei Präpubertären Jugendlichen => Verzögerung der Pubertät Unterschieden wird zwischen: einer restriktiven Form (ohne aktive Maßnahmen zur Gewichtsabnahme) einer bulimischen Form (mit aktiven Maßnahmen zur Gewichtsabnahme) Das DSM-IV definiert „Aneroxia nervosa“: …als Weigerung, ein dem Alter und der Größe angemessenes Körpergewicht zu halten, verbunden mit folgenden Kriterien: A. Körpergewicht geringer als 85% des erwarteten Gewichts (= ICD-10) B. Ausgeprägte Ängste vor Gewichtszunahme trotz Untergewichts C. Störung der Körperwahrnehmung D. Bei Frauen: Amenhorroe oder verspätete Menarche (1. Regel) Unterschieden wird zwischen: restriktivem Subtypus: ohne Fressattacken und Kotzen 70 „Binge-Eating“ bzw. „Purging“-Subtypus: mit Fressattacken und Kotzen „Bulimia nervosa“ nach der ICD-10: Kriterien: 1) Andauernde Beschäftigung mit Essen, regelmäßige Heißhungeranfälle und „Fressattacken“ 2) Versuche, dem dickmachenden Effekt der Nahrung entgegenzuwirken: z.B. durch selbstinduziertes Erbrechen oder den Missbrauch von Abführmitteln, wiederkehrende Hungerperioden oder den Gebrauch von Appetitzüglern und Diurektika; bei Diabetikern: Vernachlässigung der Insulinbehandlung möglich 3) Krankhafte Furcht davor, dick zu werden „Bulimia nervosa nach dem DSM-IV: Kriterien: A. Wiederholte Episoden von „Fressanfällen“, wobei diese a) durch eine übertriebene Nahrundmenge in kurzer Zeit und b) durch Kontrollverlust über das eigene Essverhalten gekennzeichnet sind! B. Wiederholte Anwendung von unangemessenen, gegensteuernden Maßnahmen C. Dauer: Mindestens 3 Monate mit durchschnittlich 2 Attacken pro Woche D. Figur und Gewicht haben großen Einfluss auf den Selbstwert Subtypen: Purging-Typus: Zu den gegensteuernden Maßnahmen gehören Erbrechen oder der Missbrauch von Laxantien (Abführmittel) Non-Purging-Typus: andere gegensteuernde Maßnahmen wie Fasten oder körperliche Betätigung „Nicht näher bezeichnete Essstörungen“: Rest-Kategorie, zu der alle Essstörungen gehören, die nicht die vollen Kriterien einer spezifischen Störung erfüllen, bei denen aber dennoch Handlungsbedarf besteht: es fallen darunter z.B. Mädels, die zwar offensichtlich anorektisch sind, deren BMI aber noch über 17,5 liegt, oder die „BingeEating-Störung“, die von vielen als abgeschwächte Form der Bulimie angesehen wird, die sich aber in Zukunft evtl. als spezifische Störung etablieren wird. Merkmale der Binge-Eating-Störung (nach DSM-IV): A. Wiederholte „Fressattacken“ (siehe: Bulimie), die… B. …mit mindestens 3 der folgenden Symptome einhergehen: Übertrieben schnelles Essen Unangenehmes Völlegefühl Unabhängig vom Hunger Alleine essen (um nicht unangenehm aufzufallen) Ekel- und Schuldgefühle C. Deutliches Leiden unter den Fressanfällen D. Häufigkeit der Fressanfälle: mindestens an 2 Tagen/Woche über 6 Monate E. Fressanfälle gehen nicht mit dem regelmäßigen Einsatz gegensteuernder Maßnahme einher ( Bulimie) 71 6.1.3. Diagnostische Verfahren und Dokumentationshilfen Strukturierte Interviews: Strukturiertes klinisches Interview für DSM-IV (SKID): Vorteil: ermöglicht auch eine Klassifikation der Binge-Eating-Störung Nachteil: ist nicht sehr genau bei der Erfassung spezifischer psychopathologischer Merkmale essgestörter Patienten (Perfektionismus etc.) Eating Disorder Examination (EDE): Umfasst 4 Subskalen: 1) Restraint-Scale; 2) Eating-Scale; 3) Weight-Scale; 4) Shape-Concern-Scale Strukturiertes Interview für Anorexia und Bulimia Nervosa (SIAB): Enthält ein Experteninterview (SIAB-Ex) und einen Selbsteinschätzungsbogen (SIAB-S) Ermöglicht Diagnose von AN, BN und NNB und erfasst auch allgemeine psychopathologische Merkmale (Perfektionismus, Depression etc.) Selbstbeurteilungsbögen: Eating Disorder Inventory (EDI-2): für AN und BN Skalen: „Streben nach Dünnsein“; „Bulimie“; „Körperliche Unzufriedenheit“; „Ineffektivität“; „Perfektionismus“; „Zwischenmenschliches Misstrauen“; „Interzeption“ und „Angst vorm Erwachsenwerden“ Eating Attitudes Test (EAT): Maß für gestörtes Essverhalten und übermäßige Beschäftigung mit Essen Anorexia Nervosa Inventar zur Selbstbeurteilung (ANIS): Erfassung anorektischer Verhaltensweisen und Einstellungen Fragebogen zum Essverhalten (FEV): Erhoben werden folgende 3 Dimensionen: 1) kognitive Kontrolle des Essverhaltens; 2) Störbarkeit und Labilität des Essverhaltens bei Enthemmung durch situative Situationen; 3) Hungergefühle und Verhaltenskorrelate Test zur Erfassung des Körperschemas: den Pbn wird eine Skala vorgelegt, auf der verschiedene Körperstaturen (von extrem dünn bis beleibt) abgetragen sind; Aufgabe der Pbn ist es, a) einzutragen, wo auf der Skala sie ihre momentane Figur verorten würden, b) welches ihre Idealfigur ist und c) welche Figur ihrer Meinung nach vom anderen Geschlecht am attraktivsten gefunden wird. Pbn mit gestörtem Körperschema halten sich für dicker, als sie tatsächlich sind; und geben eine extrem dünne Idealfigur an (die noch weit unterhalb dessen liegt, was ihrer Ansicht nach vom anderen Geschlecht als attraktiv empfunden wird!) Bei normalen Pbn ist das nicht so: Die Einschätzung der eigenen Figur ist realistischer und ihre Idealfigur weniger dünn und nur geringfügig unterhalb dessen, was ihrer Ansicht nach vom anderen Geschlecht als attraktiv empfunden wird. 6.1.4. Körperliche Begleiterscheinungen und Komorbidität Körperliche Begleiterscheinungen: Bei Anorexia Nervosa: Schlechte Elekrolytwerte (z.B. Natrium, Kalium) => Beeinträchtigung des Hirnstoffwechsels => Müdigkeit, Schwäche, Herzrhythmusstörungen, im schlimmsten Fall: plötzlicher Tod 72 Gestörter Hormonhaushalt (Amenorrhoe; mangelnde Libido etc.) Außerdem: Niedriger Blutdruck, niedrige Herzfrequenz; Magen-Darmund Nieren-Probleme; trockene Haut, in manchen Fällen: Haarausfall und Laguna (weißer Flaum am ganzen Körper) etc. Bei Bulimia Nervosa: Häufiges Erbrechen (=> Kaliummangel); Abführmittel (=> Diarrhöe) => gestörter Elektrolythaushalt (s.o.) Häufiges Erbrechen => Verletzungen der Magen- und Rachenschleimhaut; Verlust von Zahnschmelz etc. Depression: Sowohl AN als auch BN gehen häufig (bei 50-75% der Patienten) mit einer Major Depression oder Dysthymie einher. Mögliche Erklärungen dafür: 1) Die besagten Störungen verursachen Depression (etwa durch biochemische Veränderungen oder die zum Krankheitsbild gehörenden Scham- und Schuldgefühle) 2) Depression führt zu Essstörungen (AN und BN als Sonderform der Depression; daher auch die ähnlichen Symptome: Gewichtsverlust; niedrige Serotoninwerte etc.) 3) Essstörungen und Depression gehen auf eine gemeinsame Disposition und/oder ähnliche Umwelteinflüsse zurück (z.B. eine gestörte familiäre Umgebung) Alle 3 Hypothesen sind plausibel, welche stimmt, kann bisher nicht mit Sicherheit gesagt werden. Persönlichkeitsstörungen (bei 42-75% der Patienten): Cluster B- Störungen: häufiger bei BN und der bulimischen Form der AN Cluster C- Störungen: bei beiden Störungen! Angststörungen: AN geht v.a. mit Zwangsstörungen einher (bis zu 25%); BN v.a. mit sozialer Phobie (30%) Substanzmissbrauch und –abhängigkeit: häufiger bei BN (30-37%); oft Folge der Essstörung Sexuelle Störungen: V.a. anorektische Patientinnen zeigen oft kein sexuelles Verlangen und hatten vielfach noch keinen Geschlechtsverkehr! 6.1.5. Differentialdiagnose Somatische Differentialdiagnosen: Ausgeschlossen werden müssen… Malabsorbationssyndrome (bestimmte Substrate können nicht aufgenommen werden => Gewichtsverlust) Gastritis (Magenschleimhautentzündung => die sich v.a. bei chronischen Verlauf nicht nur in Bauchschmerzen, sondern auch in Appetitlosigkeit äußern kann) Anämie (zu geringer Sauerstoffgehalt im Blut => Blässe, Spliss, brüchige Nägel etc.) Cushing-Syndrom (s.o.: zu hoher Cortisonspiegel im Blut) Diabetes (Insulinmangel => Überzuckerung des Bluts) Lebererkrankungen Außerdem: Darmparasiten, Tumorerkrankungen, Lebererkrankungen, Schilddrüsenfunktionsstörungen, chronische Infektionen, … Psychologische Differentialdiagnosen: Anorektische Reaktion oder psychogenes Erbrechen im Rahmen von Belastungs- und Anpassungsstörungen 73 Somatoforme und dissoziative Störungen Borderline-Persönlichkeitsstörung Zwangsstörungen Depressive Syndrome im Rahmen anderer Erkrankungen (z.B. einer MDEpisode) Schizophrene Psychosen oder andere wahnhafte Störungen 6.1.6. Epidemiologie und Verlauf Häufigkeit: Ansätze gestörten Essverhaltens (z.B. übertriebene Diäten) finden sich bei jungen Frauen (Adoleszenz; Studium) so häufig (bei über 2/3!), dass sie statistisch gesehen fast schon „normal“ sind. Die Kriterien für eine Diagnose erfüllen jedoch nur wenige: Prävalenz von Anorexia Nervosa: etwas unter einem Prozent (0,2-0,8%) Prävalenz von Bulimia Nervosa: 1-2% Verhältnis Frauen – Männer: 11 : 1 Risikogruppen: Balletttänzerinnen, Turnerinnen, Modells, Jockeys, etc. Krankheitsbeginn: Eine kritische Phase für die Entwicklung von Essstörungen stellt die Pubertät dar, sofern diese mit diversen körperlichen Veränderungen einhergeht, mit denen die Betroffenen oft nicht umgehen können. Die Anorexia Nervosa: setzt typischerweise in den frühen bis mittleren Jugendjahren ein; das Durchschnittsalter bei Krankheitsbeginn liegt zw. 15 und 16 Jahren (zweigipflige Verteilung mit Häufung bei 14,5 und 18 Jahren) Die Bulimia Nervosa: setzt meist etwas später ein; das Durchschnittsalter bei Krankheitsbeginn liegt zw. 18 und 19 Jahren; viele der Betroffenen waren vor Beginn der Störung leicht überwichtig – ihre ersten Fressanfälle setzten während einer Diät ein! Verlauf: Prinzipiell gilt: der Verlauf von Bulimie ist günstiger als der von Magersucht (geringere Mortalität, höhere Remissionsrate etc.)! Auch bei AN ist die Remissionsrate jedoch relativ hoch: Etwa 70% der in der Adoleszenz (!) erkrankten Patienten genesen wieder (wenn auch oft erst nach Jahren und mehreren Rückfällen) Aber bedenke: Anorexia Nervosa ist lebensgefährlich! Die Mortalität der Patienten (1,4 -16%) ist (aufgrund der Mangelernährung und Suizid) 10 Mal so hoch wie in der Allgemeinbevölkerung und doppelt so hoch wie bei anderen psychischen Störungen! Prognose: Prädiktoren für einen negativen Verlauf von AN: Niedriger BMI zu Behandlungsbeginn und bei Entlassung Später Beginn (> 20) Längere Krankheitsdauer Komorbide psychische Störungen (z.B. Depression) Höheres Ausmaß sozialer und psychischer Probleme (z.B. Perfektionismus, familiäre Konflikte) Heißhunger-Anfälle und Erbrechen („Purging“-Typus) Körperliche Folgeschäden Prädiktoren für einen negativen Verlauf von BN: Höhere Frequenz von Fressanfällen und Erbrechen bei Behandlungsbeginn Geringe bzw. langsame Reduktion dieser Frequenz während der Therapie (um weniger als 70% nach den ersten 6 Sitzungen) Impulsivität; Substanzmissbrauch 74 6.2. Zur Ätiologie von Essstörungen 6.2.1. Biologische Faktoren Genetik: Wie für fast alle psychischen Störungen liegen auch für AN und BN Belege für eine genetische Disposition vor. Befunde: Familienanamnesen zeigen, dass Essstörungen in Familien von Essgestörten gehäuft auftreten: Bei Verwandten ersten Grades tritt die Krankheit etwa viermal so häufig auf! Die Konkordanzrate bei monozygoten Zwillingen ist höher als die von zweieiigen Zwillingen. Interpretation: Genetische Faktoren haben einen Einfluss; wie stark dieser ist, ist jedoch noch nicht hinreichend geklärt. Die aktuellen Schätzungen bewegen sich zw. 30 und 85%! Geschlecht: Das Geschlecht stellt eindeutig einen Risikofaktor dar: Männer - Frauen (11:1) Erklärung: Frauen scheinen für kulturelle Schlankheitsideale (s.u.) anfälliger zu sein als Männer, was daran liegen könnte, dass sie häufiger nach ihrem Aussehen beurteilt werden. Neurochemie: Die Regulation von Hunger und Sättigung erfolgt u.a. durch endogene Opioide und Serotonin; erstere werden in Hungerphasen freigesetzt und heben die Stimmung; letzteres fördert das Sättigungsgefühl. Beide Substanzen scheinen bei Essgestörten in geringerer Konzentration vorzuliegen. Durch Hungern werden Opioide freigesetzt und damit das Hungern positiv verstärkt. Der Serotoninmangel könnte den Fressattacken von Bulemikern zugrundeliegen (essen, ohne satt zu werden) Fazit: Die biologischen Befunde zu Essstörungen sind bisher eher spärlich und z.T. noch recht spekulativ! 6.2.2. Soziokulturelle Faktoren In westlichen Gesellschaften lassen sich gegenwärtig zwei gegenläufige Trends ausmachen: Einerseits steigt der Anteil an Übergewichtigen (überreiches Nahrungsangebot, Bewegungsarmut) – andererseits wird die Idealfigur immer schlanker! Die Idealvorstellung gerät dadurch immer mehr in Konflikt mit der Realität! Letzteres zeigt sich z.B., wenn man das Durchschnittsgewicht von Pin-ups oder Misswahl-Siegerinnen zu dem der Normbevölkerung in Bezug setzt. Schönheitsideale sind kulturell bedingt und unterliegen damit einem stetigen Wandel. Während im Barock eher „pummelige“ Frauen als schön galten (Rubens), liegt das heutige Schönheitsideal (zumindest im Westen) unter dem Normalgewicht! Schlankheit wird dabei nicht zuletzt mit Erfolg und Selbstbeherrschung assoziiert. Vermittelt wird dieses Ideal v.a. über die Medien. Die Analyse von Modezeitschriften, Frauen- und Männermagazinen („Vogue“, „Playboy“ & Co) zeigt: das Gewicht der darin abgelichteten Frauen hat seit den 50ern kontinuierlich abgenommen. Die Diätindustrie („Weight Watchers“, Zeitschriftenartikel, Ratgeber etc.) ist in demselben Zeitraum enorm angewachsen. 75 Barbie-Puppen stellen ein unrealistisches Rollenmodell dar: Um ihre Figur zu erreichen, müsste die Durchschnittsfrau ihre Oberweite um ca. 30 Zentimeter vergrößern und ihre Taille um 25 cm reduzieren. Die Größe müsste ca. 2, 15 m betragen! Dass soziokulturelle Faktoren bei der Entstehung von Essstörungen tatsächlich eine große Rolle spielen, zeigen folgende Befunde: Essstörungen werden meist durch eine Diät eingeleitet (73 – 91% erkranken während einer Diätphase); das gilt v.a. für die Fressattacken bei Bulimie, die nahezu immer auf vorangegangene Diäten zurückzuführen sind („Disinhibition“-Effekt). Der Übergang zwischen gesellschaftlich akzeptierter Schönheitspflege und krankhaftem Schönheitswahn ist dementsprechend fließend! Essstörungen treten primär in westlichen Industrienationen auf; in Entwicklungsländern gibt es sie kaum! Noch gibt es diesbezüglich aber leider zu wenige Studien; die These, es gäbe kulturspezifische Unterschiede, ist daher nur bedingt empirisch abgesichert! Einfluss der Medien 6.2.3. Kognitiv-verhaltenstheoretisches Modell Das kognitiv-verhaltenstheoretische Modell versucht v.a., die aufrechterhaltenden Bedingungen von Essstörungen herauszuarbeiten, womit nichts anderes gemeint ist als die das gestörte Verhalten verstärkenden Faktoren. Grundannahme: Im Zentrum von Essstörungen stehen Probleme mit dem eigenen Gewicht und ein gestörtes Verhältnis zum Essen – ausgelöst werden Essstörungen jedoch meist durch andere Probleme (zwischenmenschliche Konflikte, mangelnde soziale Kompetenz, Belastungen in der Kindheit, übertriebener Perfektionismus etc.). Diese Probleme führen dazu, dass die Patientin sich selbst als inkompetent und unfähig erlebt und sich beim Auftreten konkreter Probleme (spezifische Auslöser) in die Essstörung „flüchtet“! Bei der restriktiven AN lassen sich folgende Verstärker ausmachen: Der vielleicht zentralste Verstärker ist der Erfolg bei der Nahrungseinschränkung selbst. Beides gibt den Patientinnen das Gefühl der Selbstkontrolle, was wiederum zu einem gesteigerten Selbstwert und Selbstwirksamkeitsgefühl führt. Darüber hinaus kompensieren die Patientinnen mit ihrer Kontrolle über das Essen vielfach den Kontrollverlust in anderen Lebensbereichen. AN-Patientinnen haben häufig ein hohes Maß an Perfektionismus, sie streben Gewichtsreduktion an wie andere Schulerfolg! Auf Pro-Ana-Seiten werden regelrechte Wettbewerbe ausgerufen! Ein weiterer Verstärker ist der mit erfolgreicher Nahrungseinschränkung einhergehende Gewichtsverlust. Je dünner die Patientinnen, desto schöner fühlen sie sich! Die permanente Auseinandersetzung mit Essen und Gewicht verhindert eine Auseinandersetzung mit anderen Schwierigkeiten und Defiziten, wodurch die Störung negativ verstärkt wird! Negativ verstärkend wirken außerdem die permanente Angst vor Gewichtszunahme und Kontrollverlust sowie die körperlichen Symptome nach vermehrter Nahrungsaufnahme (Völlegefühl, Blähungen etc.). 76 Bulimie und die bulimische Form der Anorexie lassen sich als Teufelskreislauf beschreiben: Geringes Selbstwertgefühl Diät, um sich besser zu fühlen (s.o.: positive Verstärkung) zu strake Nahrungsreduktion Diät wird nicht eingehalten; negative Affekte („Disinhibition“-Effekt) Fressattacke (emotionsregulierende Funktion) Schlechtes Gewissen und Angst vor Gewichtszunahme Kompensatorische Maßnahmen (Spannungsreduktion) körperliche, psychische und soziale Folgeschäden geringes Selbstwertgefühl … 6.2.4. Andere psychologische Modelle Psychodynamische Theorien: deuten Essstörungen als missglückten Ablöseversuch von den Eltern; einerseits gehe es den Betroffenen darum, Autonomie zu gewinnen und sich als selbstwirksam zu erleben; andererseits wollen sie nicht erwachsen werden. Letzteres zeigt sich nicht nur daran, dass sich ihr Autonomiestreben auf ein so infantiles Feld wie das Essen beschränkt; sondern auch daran, dass durch die Nahrungsverweigerung die sexuelle Reifung verzögert bzw. verhindert wird (Angst davor, einen weiblichen Körper zu bekommen). Systemische Theorien: betrachten essgestörte Patienten als „Symptomträger“ in einem dysfunktionalen Familiensystem; durch ihre Störung verhindern sie familiäre Konflikte (etwa zwischen den Eltern); die Krankheit hat demnach eine „positive“ Funktion. Merkmale essgestörter Familien (nach Minuchin): Übermaß an Bindung: Eltern sprechen und denken für ihre Kinder Überbesorgtheit: Die Familienmitglieder sind extrem um das gegenseitige Wohl besorgt Rigidität: Der Familie geht‟s um den Erhalt des Status quo; sie ist dementsprechend wenig flexibel und tut sich schwer mit Veränderungen Fehlende Konfliktlösung: Die Familie vermeidet entweder Konflikte oder befindet sich in chronischen Konflikten 6.2.5. Zusammenfassung (die wichtigsten Risikofaktoren) Risikofaktoren für Anorexie (in der Reihenfolge ihres zeitlichen Auftretens): Genetische Prädisposition Weibliches Geschlecht Ethnische Zugehörigkeit („westlich“ sozialisiert) Schwangerschaftskomplikationen Kindliche Schlafstörungen Überbehütender Erziehungsstil Sexueller Missbrauch Zwanghafte Persönlichkeitsstörung Perfektionismus Angststörung Negatives Selbstbild „Weight concerns“ (Gedanken über Gewicht) Adoleszentes Alter Spezifische Auslöser (Schulstress, Beziehungsstress, IdentitätsAutonomiekonflikte etc. … und 77 Risikofaktoren für Bulimie (in der Reihenfolge ihres zeitlichen Auftretens) Genetische Prädisposition Weibliches Geschlecht Ethnische Zugehörigkeit („westlich“ sozialisiert) Geburtskomplikationen Kindliches Übergewicht (erhöhter BMI) Adoleszentes Alter Elterliches Übergewicht Störungen der Eltern (z.B. Depression oder Alkoholismus) „Weight Concerns“ Soziale Phobie … 6.3. Behandlung: 6.3.1. Praktische Hinweise zu Diagnostik und Indikation Im Erst- bzw. Vorgespräch geht es um Folgendes: Der Therapeut: erstellt eine erste Diagnose (psychopathologischer Befund) und checkt die Therapie- und Veränderungsmotivation des Klienten ab. Die Erhebung des psychopathologischen Befundes sollte folgende Schritte umfassen: 1) Strukturierte Interviews (s.o.: SCID, EDE etc.) zur Erstellung einer Diagnose und zur Feststellung von Komorbiditäten 2) Liegen komorbide Störungen vor: Behandlungsart und -reihenfolge festlegen (parallel/eigenständig) Bei Substanzabhängigkeit erst mit Therapie beginnen, wenn Patient abstinent ist (Anti-Substanzvertrag) Bei schweren affektiven Störungen oder ausgeprägten Zwangsstörungen evtl. medikamentöse Zusatzbehandlung 3) Folgestörungen/–probleme und deren Schweregrad abklären Eine medizinische Untersuchung vor Therapiebeginn ist dabei aufgrund der vielfältigen gesundheitlichen Risiken von Essstörungen unumgänglich! Der Klient: erhält einen ersten Eindruck vom Therapeuten und der Therapie Beide: einigen sich auf einen Behandlungsauftrag mit spezifischen Zielen und erstellen ausgehend davon einen Behandlungsvertrag. Besonderheiten bei Anorektikerinnen: Leidensdruck, Therapie- und Veränderungsmotivation fehlen häufig (mangelnde Krankheitseinsicht) Meist ist die Haltung der Patienten/innen ambivalent: einerseits wollen sie eine Behandlung – andererseits haben sie große Angst vor Kontrollverlust und Gewichtszunahme Einigung auf ein Mindestnormalgewicht (BMI = 20) Transparenz im therapeutischen Vorgehen schaffen und den Patienten selbst Verantwortung übertragen (damit sie nicht das Gefühl haben, die Kontrolle zu verlieren) Normalisierung des Essverhaltens (s.u.) hochgradig angstbesetzt; v.a. unter Beobachtung fällt den Patienten das Essen meist schwer! 78 Besonderheiten bei BN-Patienten: Haben meist schon Mindestnormalgewicht und brauchen nicht zuzunehmen; wollen in der Therapie aber meist abnehmen! Muss überprüft und verhindert werden! Indikation: Grundsätzlich gilt: bei AN sollte die Behandlung stationär, bei BN ambulant erfolgen Unbedingt notwendig ist eine stationäre Behandlung bei AN, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: Verlust von mehr als 30% des Ausgangsgewichts, v.a. bei rascher Gewichtsabnahme (innerhalb von 3 Monaten oder weniger) BMI < 14 Ausgeprägte somatische Folgeerscheinungen (Elektrolytentgleisungen, Hypothermie, Niereninsuffizienz etc.) Schwerwiegende Begleiterscheinungen (z.B. bewusste Vernachlässigung der Stoffwechselkontrolle bei Diabetes) Problem: AN-Patienten sind meist nicht von einer stationären Behandlung überzeugt; eine ambulante Therapie muss in diesem Fall klar als Versuch herausgestellt werden, der an verschiedene Vereinbarungen gebunden ist: Behandlung nur, wenn Allgemeinärzte mit einbezogen werden Verpflichtende Therapieziele: Kontinuierliche Gewichtszunahme um min. 500g/Woche Aufgabe des restriktiven Essverhaltens und Einbezug bisher vermiedener Lebensmittel Zielgewicht: BMI = 20 Bei weiterer Gewichtsabnahme: Therapieabbruch, evtl. Zwangseinweisung Ist man in diesem Punkt nicht konsequent, besteht die Gefahr einer Chronifizierung! 6.3.2. Kognitive Verhaltenstherapie Die kognitive Verhaltenstherapie verfolgt 3 Ziele: 1) Normalisierung des Essverhaltens und des Gewichts Psychoedukation und Aufklärung über die Therapieziele Problemanalyse: Analyse auslösender und aufrechterhaltender Bedingungen Normalisierung des Essverhaltens (regelmäßiges Essen, Abbau der „schwarzen Liste“ etc.): v.a. durch operante Methoden 2) Bearbeitung relevanter Problembereiche Problemanalyse (Welche tieferen Probleme liegen der Krankheit zugrunde?) Zielorientierte Problembereichsbearbeitung Vermittlung kognitiver und anderer Techniken 3) Verbesserung der Körperwahrnehmung und –akzeptanz Körperübungen, Körpererfahrung Kognitive Techniken Psychoedukation und Aufklärung über die Therapieziele: Chronisches Diäthalten soll niedriges Selbstwertgefühl und andere Probleme kompensieren, führt aber zu keiner Lösung, sondern in einen Teufelskreislauf (s.o.), der durch die Therapie durchbrochen werden soll, indem die Funktion des gestörten Essverhaltens aufgedeckt und alternative Problemlösestrategien vermittelt werden! 79 Kurz: Die übermäßige Abhängigkeit des Selbstwertgefühls von Figur und Gewicht soll durch die KVT reduziert und dadurch das Essverhalten dauerhaft normalisiert werden. Die Notwendigkeit ein bestimmtes Gewicht zu erreichen und zu halten, muss den Patienten vermittelt werden. Dazu bietet es sich an, auf folgende Aspekte einzugehen: Set-Point-Theorie (Nisbett): Das Gewicht eines Menschen (Set-PointGewicht) ist genetisch vorprogrammiert; daraus folgt, dass es a) individuell verschieden ist und b) nur bedingt der willkürlichen Kontrolle unterliegt. Aufklärung über Folgeschäden: Menstruationsstörungen, gestörter Elektrolythaushalt, eingeschränkte Konzentrationsfähigkeit, sozialer Rückzug etc. etc. (s.o.) „Minnesota-Starvation-“ bzw. „Keys-Study“ (1944): Pbn wurden 1 Jahr in dem sog. „Hunger-Camp“ untersucht; nach 3-monatiger Baseline-Erhebung wurde für 6 Monate die Kalorienzufuhr für jeden der Teilnehmer individuell halbiert; in den letzten 3 Monaten wurde die Kalorienzufuhr sukzessive wieder an ihr Ursprungsniveau angepasst. Ergebnis: die Pbn zeigten ähnliche Symptome wie Essgestörte (mangelnde Konzentrationsfähigkeit, Depressionen, übermäßige Beschäftigung mit Essen, sozialer Rückzug, Heißhungeranfälle etc.)! Aufklärung über die Problematik kompensatorischer Maßnahmen: Restriktives Essverhalten ist der Auslöser für die Fressattacken! Trotz Erbrechens bleibt ein Großteil der während einer Fressattacke aufgenommenen Kalorien im Körper! Restriktives Essverhalten führt häufig zu verringerter Stoffwechselaktivität und damit zu schweren kognitiven Defiziten. Erbrechen führt schnell wieder zu Hunger! Abführmittel führen selbst in großen Mengen nur zu einer geringen Reduktion der Kalorienaufnahme Aufklärung über soziokulturelle Einflüsse (übertriebenes Schlankheitsideal) Problemanalyse: dient der Identifikation auslösender und aufrechterhaltender Bedingungen; man erhofft sich davon a) ein besseres Verständnis der Störung, insbes. was deren Funktionalität betrifft, b) mögliche Interventionsansätze und c) ein besseres Gespür für Rückfallsituationen (im Sinne einer Rückfallprophylaxe) Erfolgt durch Selbstbeobachtungsprotokolle und Anamnese (wozu natürlich auch die Familienverhältnisse usw. zählen) Oft werden in diesem Zusammenhang anamnestische Gewichtskurven aufgestellt: Wann hat der Patient wie viel gewogen und welche Ereignisse gingen mit Gewichtsschwankungen einher (Abitur, Beendigung einer Beziehung, Hänseleien etc. etc.)? Stationäre Maßnahmen zur Gewichtszunahme: bilden zumindest in der Anfangszeit der Schwerpunkt der Behandlung; es geht dabei einerseits um den Abbau restriktiven Essverhaltens, andererseits um den Aufbau normalen Essverhaltens. Die Methoden, die dabei verwendet werden, sind überwiegend operante Verfahren; meist werden Verträge ausgehandelt, in denen genau festgelegt wird, welche Konsequenz auf welches Verhalten folgt („ContractManagement“). Beispiel: wöchentliche Gewichtszunahme von min. 500 Gramm und Aufnahme bisher gemiedener Lebensmittel in den Speiseplan wird mit Besuchen, Telefonaten etc. belohnt. Zum Teil auch Expositionsübungen: Essen im Restaurant etc. 80 Etablierung eines regelmäßigen Essensplans (3 Hauptmahlzeiten + 2 Zwischenmahlzeiten); tägliche Kalorienaufnahme von min. 2000 kcal! In jeder Woche werden neue, vormals verbotene Lebensmittel in den Speiseplan aufgenommen! Therapeut als Modell (muss also selbst ein normales Verhältnis zum Essen haben) Die Erfahrung weniger zuzunehmen als erwartet führt zu dem positiven Gefühl, die Kontrolle zu behalten. Identifikation und Bearbeitung zugrundeliegender Problembereiche: Gerade bei BN werden die zugrundeliegenden Probleme häufig erst nach Reduktion der Symptomatik erkennbar; schließlich liegt in der Verschleierung der Probleme ja gerade die Funktion der Störung! Die häufigsten Problembereiche: Geringer Selbstwert, Leistungs- und Perfektionismusstreben, Kontrollund Autonomiestreben, Beziehungsprobleme, Ablösung vom Elternhaus, mangelnde Selbständigkeit, Angst vor Verantwortung Entlarvung und Aufhebung kognitiver Verzerrungen; Erschließung neuer Lebensbereiche, die eine selbstwertstabilisierende Funktion haben können etc. etc. Bearbeitung der Körperschemastörung: Ziel ist es, neue Erfahrungen mit dem eigenen Körper zu ermöglichen und die verzerrte Wahrnehmung des eigenen Körpers zu korrigieren, damit dieser besser akzeptiert werden kann. Besonders geeignet ist in diesem Zusammenhang gruppentherapeutische Settings, da hier direkte Vergleiche und Rückmeldungen möglich sind. Konkrete Beispiele: Übungen zur Kontaktaufnahme: sich und andere anfassen lernen Vertrauensübungen: sich von einem anderen auffangen oder führen lassen Übungen zur Körpererfahrung: bestimmte Körperregionen (z.B. Rücken) abtasten; Konfrontationsübungen vor dem Spiegel oder mittels Videoaufnahmen, Entspannungsübungen, Massagen etc. Übungen zum Körperausdruck: z.B. freies Tanzen oder Pantomime Stabilisierung, Rückfallanalyse und –prophylaxe: Schrittweises Ausblenden der Therapie an regelmäßige Kontrollen koppeln, Rückfallsituationen erkennen und entsprechende Strategien erlernen, mit ihnen umzugehen etc. 6.3.3. Zur Wirksamkeit: Zur Wirksamkeit von Therapien bei AN: gibt es leider nur wenig kontrollierte Studien; die Studien, die es bis dato gibt, zeigen Folgendes: Die Wirksamkeit verhaltenstherapeutischer (insbes. der operanten Verfahren) und familientherapeutischer Maßnahmen ist zumindest kurzfristig belegt! Pharmakologische Therapien haben dagegen nur geringe Effekte. Lediglich nach bzw. zusätzlich zur stationären Behandlung scheint der Einsatz von Fluoxetin (Antidepressivum) hilfreich! Zur Wirksamkeit von Therapien bei BN: liegen v.a. Studien zur (K)VT und IPT vor. Sowohl die KVT als auch die IPT erzielen langfristig positive Effekte (Reduktion der Heißhungerattacken und des anschließenden Erbrechens um durchschnittlich 75%!); die KVT wirkt jedoch etwas schneller. Die KVT ist der reinen VT (ohne Einstellungsänderung) überlegen. 81 Durch Exposition und Reaktionsverhinderung (nicht Kotzen dürfen) kann keine Verbesserung erzielt werden! Der Einsatz von Antidepressiva ist zwar wirksam, aber lange nicht so wie die KVT und IPT. Kombinationstherapien: sind einer reinen KVT leicht überlegen (was Symptomfreiheit, Rückfallrate und Sekundärsymptomatik betrifft), gehen aber mit erheblich größerem Drop-Out einher! Selbsthilfeansätze: nicht ganz so effektiv wie KVT, aber wirksam! Behandlungsformen bei BED: wurden überwiegend aus der BN-Behandlung abgeleitet. Prinzipiell gilt: Die Normalisierung des Essverhaltens (d.h. die Reduktion der Fressattacken) hat Priorität vor der Gewichtsreduktion. Als wirksam erwiesen hat sich – wie sollte es anders sein ;–) die KVT! Auch Psychopharmaka haben sich zumindest kurzfristig als wirksam erwiesen. 82 7. Substanzinduzierte Störungen 7.1. Allgemeines zu substanzinduzierten Störungen 7.1.1. Psychoaktive Substanzen und ihre Wirkung Psychoaktive Substanzen (=Rauschmittel) wirken auf das zentrale Nervensystem und werden i.d.R. als wohltuend empfunden! Sie werden in der ein oder anderen Form in nahezu allen Kulturen verwendet. Werden mehrere Substanzen parallel konsumiert, spricht man von „Polytoxikomanie“! Einige wichtige psychoaktive Substanzen und ihre Wirkung: Sedativa (Beruhigungsmittel bzw. Tranquilizer): verlangsamen die Aktivität des Körpers und mindern die Reaktionsbereitschaft Opiate bzw. dessen Derivate (Heroin, Morphium): binden an die sog. Opioidrezeptoren (körpereigene Opioide sind z.B. Endorphine); sie haben eine beruhigende, schmerzlindernde Wirkung und führen zu einem euphorischen, träumerischen Zustand (bei Heroin kommt unmittelbar nach der Injektion der sog. „Rush“ hinzu) Synthetische Sedativa (Barbiturate und Benzodiazepine wie Valium): wirken agonistisch auf die GABAA-Rezeptoren, verstärken also die GABAerge (=hemmende) Übertragung und haben damit eine schmerzlindernde, beruhigende, einschläfernde und angstlösende Wirkung! Stimulanzien: wirken anregend auf Gehirn und sympathisches Nervensystem und damit aktivierend. Kokain (=natürliches Stimulans): blockiert die Wiederaufnahme von Dopamin und Noradrenalin, insbes. im mesolimbischen Bereich => Wachheit, Euphorie Amphetamine (=synthetische Stimulanzien): fördern die Freisetzung von Dopamin und Noradrenalin und blockieren deren Wiederaufnahme => Wachheit, Euphorie Halluzinogene (LSD, Meskalin, Ecstasy etc.): führen zu Halluzinationen und Bewusstseinsveränderungen Alkohol (Ethanol): bindet an die Glutamat- und GABA-Rezeptoren (s.o) und hat sowohl eine stimulierende, als auch sedierende Wirkung (Zwei-PhasenWirkung) Nikotin: wirkt agonistisch auf die nikotinergen ACh-Rezeptoren (exzitatorisch) 7.1.2. Diagnostische Kriterien Einteilung substanzinduzierter Störungen: Der pathologische Konsum von psychoaktiven Substanzen gliedert sich in 2 Kategorien: 1. Substanzmissbrauch: liegt vor, wenn der Konsum das eigene Leben beeinträchtigt, sprich: zur Vernachlässigung der Pflichten oder Gefährdungen führt, ohne dass eine Abhängigkeit besteht. 2. Substanzabhängigkeit: liegt vor, wenn eine körperliche und/oder psychische Abhängigkeit von der betreffenden Substanz besteht. 83 Darüber hinaus gehören zu den substanzinduzierten Störungen: Substanzintoxikation: z.B. Alkoholvergiftung Substanzentzug: z.B. Delirium tremens (s.u.) Symptome diverser Achse-I-Störungen: Demenz, amnestische Störung, psychotische Störungen, affektive Störungen, Angststörungen und sexuelle Funktionsstörungen Kriterien für Substanzmissbrauch nach dem DSM-IV: Mindestens eines der folgenden 4 Kriterien muss innerhalb eines Jahres wiederholt aufgetreten sein: 1. Versagen bei der Erfüllung wichtiger Pflichten (z.B. Fernbleiben von der Arbeit oder Vernachlässigung der Kinder) 2. Körperliche Gefährdung (z.B. durch Alkohol am Steuer) 3. Probleme mit dem Gesetz (z.B. wegen ungebührlichen Verhaltens oder Verkehrsdelikten etc.) 4. Fortgesetzte soziale und zwischenmenschliche Probleme (z.B. Ehestreit wegen des Drogenkonsums) Es darf keine Abhängigkeit von der betreffenden Substanz bestehen! Kriterien für Substanzabhängigkeit nach dem DSM-IV: Mindestens 3 der folgenden 7 Kriterien müssen sich innerhalb eines Jahres manifestiert haben: 1. Toleranzentwicklung: äußert sich entweder in dem Verlangen nach Dosissteigerung oder in einer verminderten Wirkung bei fortgesetzter Einnahme derselben Dosis. 2. Entzugssymptome: äußern sich entweder in den charakteristischen psychischen und physischen Entzugssymptomen der jeweiligen Substanz oder darin, dass die betreffende Substanz eingenommen wird, um diese Symptome zu lindern oder zu vermeiden. 3. Ausmaß des Konsums: Die Substanz wird in größeren Mengen oder länger als beabsichtigt eingenommen. 4. Vergeblicher Umkehrversuch: Anhaltender Wunsch oder erfolglose Versuche, den Substanzgebrauch zu verringern oder zu kontrollieren. * Findet sich nicht im ICD-10: dort gilt stattdessen der starke Wunsch, die Substanz zu konsumieren, als ein Kriterium für Abhängigkeit! 5. Zeitaufwand: Es wird viel Zeit darauf verwendet, die Substanz zu beschaffen, zu konsumieren oder sich von ihren Wirkungen zu erholen. Im ICD-10 6. Einschränkung: Wichtige soziale, berufliche oder Freizeitaktivitäten ein Kriterium! werden aufgrund des Substanzkonsums aufgegeben oder eingeschränkt. 7. Irrationalität: Der Substanzgebrauch wird trotz der psychischen und körperlichen Probleme, die dieser verursacht, fortgesetzt (z.B. wird Kokain genommen, obwohl es zu regelmäßigen Depressionen führt) Körperliche Abhängigkeit wird diagnostiziert, wenn entweder (1) Toleranzentwicklung oder (2) Entzugssymptome zu den erhobenen Merkmalen zählen! 7.1.3. Epidemologie und Folgen Prävalenzraten (in Deutschland): Tabakabhängigkeit: ca. 10 Mio. 27% der Erwachsenenbevölkerung in Deutschland raucht! Die meisten durch Drogenkonsum verursachten Todesfälle gehen auf das Konto von Nikotin! Alkoholabhängigkeit: ca. 1,5 Mio. (2, 4%) 84 Männer: 4%; Frauen: 1% Alkoholmissbrauch: ca. 2, 7 Mio. (4%) Männer: 5%; Frauen: 2% Medikamentenabhängigkeit: ca. 1,4 Mio. (2, 3%) Abhängigkeit von illegalen Drogen: ca. 100.000 – 150.000 Lebenszeitprävalenz für den Konsum illegaler Drogen: über 16% Das Einstiegsalter liegt für alle Drogen (Tabak, Alkohol und illegale Drogen) meist in der Jugend bzw. im frühen Erwachsenenalter. Nach 24 fängt kaum noch jemand an zu rauchen, trinken, kiffen oder koksen. Rückfälle sind die Regel: Innerhalb der ersten 2 Jahre nach einer Remission werden je nach Substanz 50-70% rückfällig! 7.1.4. Zur Ätiologie substanzinduzierter Störungen Die Entstehung einer Abhängigkeit erfolgt meist in mehreren Stufen, wobei auf den verschiedenen Stufen jeweils unterschiedliche Faktoren wirksam sind. 1) Positive Einstellung Zunächst müssen die Betroffenen der Substanz gegenüber positiv eingestellt sein. Beeinflusst wird die Einstellung zu einer Substanz (z.B. Nikotin) u.a. durch die Familie (rauchende Eltern), die Medien (Werbung) und das generelle gesellschaftliche Klima (in einer Gesellschaft, in der viel geraucht wird, hält man Nikotin naturgemäß für weniger gefährlich). 2) Experimentieren s.u. 3) Regelmäßiger Konsum Wenn die Betroffenen eine positive Einstellung zu der Substanz entwickelt haben, beginnen sie, mit ihr zu experimentieren und sie schließlich regelmäßig einzunehmen. Von Bedeutung sind dabei v.a. die Verfügbarkeit der Substanz (Zigarettenautomaten etc.) und der von den Peers ausgehende Gruppendruck. Der Erstkonsum selbst führt nämlich i.d.R. noch nicht zu positiven Folgen („Hust! Würg!“) – verstärkend wirkt daher zunächst lediglich die Zuwendung der Bezugsgruppe („Ich gehör dazu!“) oder die Wirkung auf Dritte („Schau her, wie cool ich bin!“) 4) Starker Konsum Die Substanz selbst wirkt meist erst nach mehrmaligem Konsum verstärkend; dabei spielen sowohl biologische als auch psychologische und soziale Mechanismen eine Rolle (s.u.); sie führen dazu, dass der Anreiz der Substanz steigt und ihr Konsum automatisiert wird; die Folge ist ein zunehmend stärkerer Konsum! 5) Physische Abhängigkeit oder Missbrauch Ausbildung diskriminativer Stimuli für erneuten Drogenkonsum Stoffwechselmangel bei Fehlen der Droge => Entzugserscheinungen Verschiebung im Verhaltensrepertoire: Alles dreht sich um den Erwerb und Konsum der Droge Rückfallmodelle: Dass es so häufig zu Rückfällen kommt (nach 2 Jahren 50-70%!), kann folgendermaßen erklärt werden: 1) Lerntheoretisches Modell: konditionierte Auslöser (= diskriminative Stimuli) als Ursache (klassische Konditionierung) 2) Kognitives Modell: Fehlende Bewältigungsstrategien in kritischen Lebenssituationen und negative Einschätzung der eigenen Bewältigungsfähigkeit 85 3) Integratives Modell: Es gibt klassisch konditionierte Auslöser; sie führen jedoch nicht automatisch zu einem Rückfall, sondern nur im Zusammenspiel mit kognitiven Mechanismen! 7.1.5. Die Teufelskreise der Sucht (siehe genauer: 7.2.5) In Gang gesetzt wird Suchtverhalten durch die unmittelbar verstärkende Wirkung einer Substanz! Negative Verstärkung = Entspannung; Ablenkung etc. Positive Verstärkung = Stimmungsförderung, Stimulierung etc. In Gang gehalten wird eine Sucht dadurch, dass der Anreiz der Substanz kontinuierlich erhöht- und ihr Konsum zunehmend automatisiert wird! Dabei spielen sowohl psychologische, als auch biologische und soziale Mechanismen eine Rolle. Unterschieden werden kann dementsprechend zwischen… 1. Einem intrapsychischen Teufelskreis Beeinträchtigte Selbstwahrnehmung, unrealistische Wirkungserwartung, Copingdefizite, suchtbezogene Grundannahmen, Abstinenzverletzungssyndrom 2. Einem neurobiologischen Teufelskreis 1) Toleranzentwicklung, 2) Endorphinmangel, 3) Suchtgedächtnis 3. Einem psychosozialen Teufelskreis Gesellschaftliches Klima, veränderte Familieninteraktion, soziale Folgeschäden, Mangel an Alternativressourcen * Zur Auswirkung sozialen Stresses auf den Drogenkonsum: Ratten, die Isolationsstress ausgesetzt wurden, erhöhen ihren Kokainkonsum deutlich schneller als Kontrolltiere! 7.1.6. Der neurobiologische Teufelskreis Suchttheorie der positiven Verstärkung: Toleranzentwicklung und Entzugssymptomatik: lassen sich mit der Gegensatz-Prozess-Theorie erworbener Motivation erklären. Diese geht davon aus, dass jeder affektive Reiz nicht nur den Affekt, sondern zugleich den jeweiligen Gegenaffekt auslöst. Die affektive Reaktion entspricht der Summe aus diesen hedonisch gegensätzlichen Reaktionen. 1) Bei Darbietung eines affektiven Reizes (positiv oder negativ) wird zunächst der a-Prozess (Affekt) ausgelöst, der in der Dauer, Intensität und Qualität proportional zum dargebotenen Reiz ist. 2) Etwas zeitverzögert löst der a-Prozess die Aktivierung des gegensätzlichen b-Prozesses (Gegenaffekt) aus. Der b-Prozess weist die umgekehrte hedonische Qualität von a auf; setzt zeitversetzt ein, steigt langsamer an und hat (zumindest anfangs) eine deutlich kleinere Amplitude als der aProzess. 3) Sowohl die a- als auch die b-Komponente senden ihr Signal an einen Summator, wo die beiden Signale addiert (a-b) und so die Stärke des Affektes, der Motivation und des Verstärkerwertes bestimmt werden. Wird der Reiz zum ersten Mal oder nur selten dargeboten, hat die resultierende Kurve eine typische Form: Maximum der primären affektiven Reaktion (z.B. Freude) Adaptationsphase Gleichgewichtsniveau Affektive Nachreaktion (schaler Nachgeschmack) Entscheidend an dem Modell ist jedoch, dass der a-Prozess bei Wiederholung konstant bleibt, während der b-Prozess durch Wiederholung verstärkt wird. 86 Dadurch wird die Summe der affektiven Reaktionen bei häufiger Wiederholung kleiner (Toleranzentwicklung); die affektive Nachreaktion größer (Entzugssymptomatik). Beispiel Drogenkonsum: Einnahme wird bei häufigem Konsum weniger positiv erlebt (Toleranzentwicklung aufgrund Zunahme des negativen bProzesses) und von zunehmend längeren und stärkeren negativen Nachschwankungen begleitet (Entzugsymptome). Das Suchtgedächtnis: manifestiert sich in einer subkortikalen (im Belohnungszentrum angesiedelten) Hypersensibilität gegenüber substanzbezogenen Stimuli („Cue Reactivity“). Diese Hypersensibilität äußert sich auf verschiedenen Ebenen: Subjektive Ebene: erhöhtes Verlangen („Craving“) Physiologische Ebene: Anstieg der Herzrate, verringerte Startle-Reaktion (s.u.); Salivation (= Neuronale Ebene: Anstieg der BOLD-Response in best. Hirnregionen Verhaltensebene: Kontrollverlust Pauli et al. (2000): Experiment zur emotionalen Valenz rauchbezogener Bilder Rauchern und Nichtrauchern wurden negative, neutrale, positive und rauchbezogene Bilder dargeboten. Um die emotionale Valenz der rauchbezogenen Bilder zu messen, wurden folgende Maße erhoben: a) Subjektive Angaben b) Gesichtsausdruck (Corrugator: „Stirnrunzeln“; Zygomaticus „Lächeln“) c) Modulation des Schreck-Reflexes: dazu wurde kurz nach dem Erscheinen der Bilder lautes „weißes Rauschen“ eingespielt, um den Schreckreflex auszulösen, der mittels EMG (Aktivität des M. orbicularis oculi) gemessen werden kann. Je positiver die emotionale Valenz der Hintergrundreize, desto geringer die Startle-Reaktion! Ergebnisse: Nicht-Raucher: ordneten die rauchbezogenen Bilder beim subjektiven Rating zw. neutralen und negativen Bildern ein die Startle-Reaktion war kongruent dazu, d.h. schwächer als bei negativen und stärker als bei neutralen Bildern; dasselbe gilt für den Gesichtsausdruck Raucher: ordneten die rauchbezogene Bilder beim subjektiven Rating zw. neutralen und positiven Bildern ein die Startle-Reaktion war inkongruent dazu, sprich: bei rauchbezogenen Bildern geringer als bei positiven Bildern. Bei Rauchern gehen physiologische Reaktion u. subjektives Empfinden auseinander!!! Fazit: Bei starken Rauchern gehen physiologische Reaktion (Startlereflex/Gesichtsausdruck) und subjektives Empfinden auseinander! Die Cue-Reactivity wirkt subkortikal und ist dementsprechend nur bedingt steuerbar! Hinweisreize können aversiv und appetitiv wirken: „Craving“ (Verlangen / Drang): ist ein zentraler Bestandteil von Sucht; es bewirkt nicht nur die Aufrechterhaltung des Suchtverhaltens, sondern ist auch für Rückfälle verantwortlich! Sowohl im ICD-10, als auch im DSM-IV wird „Craving“ als wichtiges Kriterium genannt: Die ICD-10: spricht von einem „starken Wunsch oder einer Art Zwang“, eine bestimmte Substanz zu konsumieren. 87 Im DSM-IV: wird „Craving“ („unwiderstehlicher Drang“) zusammen mit Toleranzentwicklung und Entzugserscheinungen explizit als eines der zentralen Merkmale von Abhängigkeit genannt. Erfasst werden kann das „Craving“ entweder mit Hilfe von Fragebögen, z.B. dem „Questionaire on Smoking Urges“ (QSU), oder mittels biopsychologischer Methoden (s.o.: Modulation des Schreckreflexes in Abhängigkeit von der emotionalen Valenz der Hintergrundreize) Der QSU wurde von Mucha, Pauli u.a. ins deutsche übersetzt (QSU-G); er enthält 37 Items, die jeweils auf einer 7-stufigen Antwortskala (stimmt überhaupt nicht – stimmt völlig) beurteilt werden sollen. 4 a priori Skalen: Verlangen zu rauchen (z.B. „Ich muss jetzt rauchen!“) Erwartung einer sofortigen positiven Wirkung (z.B. „Ich würde eine Zigarette jetzt nicht genießen“) Erwartung einer sofortigen Reduktion von Nikotinentzug oder negativen Gefühlen (z.B. „Rauchen würde meine schlechte Stimmung deutlich verbessern.“) Absicht zu rauchen (z.B. „Ich werde rauchen, sobald ich die Möglichkeit dazu habe.“) Hohe Reliabilität (zw. 0.93 und 0.95) und Validität (gemessen an den Auswirkungen von Deprivation und Rauchen) Eine Faktorenanalyse zeigt, dass sich diese Skalen zu 2 Faktoren zusammenfassen lassen: 1. Absicht zu rauchen + Antizipation positiver Wirkung 2. Verlangen zu rauchen + Entzugsreduktion Rauchen (vorher/nachher) und Deprivation wirken stärker auf Skala 1 (Absicht zu rauchen/ positive Rauchwirkung) als auf Skala 2 (Verlangen zu rauchen / Entzugsreduktion), was diese Erkenntnis bringt, wissen Gott und Pauli allein! 7.1.7. Allgemeine Hinweise zur Therapie Die wichtigsten Therapieziele bei Sucht sind: Aufbau einer Veränderungsbereitschaft Problem: die schlimmsten Konsequenzen des Substanzmissbrauchs (körperliche Beschwerden etc.) klingen zu Beginn der Behandlung recht schnell ab, während die positiven Konsequenzen abstinenten Verhaltens (z.B. beruflicher Erfolg) meist erst nach längerer Zeit erfahrbar werden. Methode: kognitive Verfahren, wobei ein Schwerpunkt auf der positiven Bewertung abstinenten Verhaltens liegt) Behandlung begleitender Störungen „Harm Reduction“: dient der Sicherung des Überlebens und hat absolute Priorität Behandlung von Störungen mit Auslöserfunktion und sonstigen komorbiden Störungen (z.B. soziale Unsicherheit, Depression, Persönlichkeitsstörung, ungünstige Interaktionsmuster in der Familie etc.) Rückfallprävention Kombination von kognitiven und verhaltensübenden Verfahren, die dazu dienen, Rückfallrisiken zu erkennen und zu meiden bzw. besser zu „handlen“! 88 Wichtige Behandlungskomponenten sind: 1) Entzugsbehandlung (unter ärztlicher Aufsicht und mit medikamentöser Unterstützung; meist stationär; bei harten Drogen: Substitutionstherapie) 2) Entwöhnungsbehandlung (Aufbau einer stabilen Abstinenz) 3) Nachsorge (v.a. im ersten Jahr der Abstinenz wichtig; erfolgt z.B. in Form von Selbsthilfegruppen oder ambulanter Weiterbehandlung) Der Genesungsprozess kann in 4 Veränderungsphasen unterteilt werden: 1) Precontemplation Der Betroffene sieht keinen Anlass für Veränderung (mangelnde Krankheitseinsicht); stattdessen: Verleugnung und andere Abwehrmechanismen 2) Contemplation Beginn einer kritischen Auseinandersetzung mit dem eigenen Konsumverhalten; ambivalente Haltung und Abwägungsprozesse, wobei die Betroffenen zunächst meist zu oberflächlichen Lösungsversuchen neigen 3) Action Ernsthafter Abstinenzvorsatz und konkrete Umsetzungsversuche 4) Maintenence Stabilisierung der Abstinenz 7.2. Alkoholabhängigkeit im Speziellen 7.2.0. Einordnung der Störung Die ICD-10 unterscheidet 10 verschiedene alkoholbedingte Syndrome (F 10): 1) F 10.0: Akute Intoxikation (=akuter Rausch) 2) F 10.1: Schädlicher Gebrauch 3) F 10.2: Abhängigkeitssyndrom 4) F 10.3: Entzugssyndrom (z.B. Tremor, Schweißausbrüche etc.) 5) F 10.4: Entzugssyndrom mit Delir („Delirium Tremens“) 6) F 10.5: Psychotische Störung (z.B. Alkoholhalluzinose) 7) F 10.6: Alkoholbedingtes amnestisches Syndrom (z.B. Korsakow-Syndrom) 8) F 10.7: Alkoholbedingter Restzustand 9) F 10.8: Sonstige alkoholbedingte psychotische Verhaltensstörungen 10) F 10.9: Nicht näher bezeichnete alkoholbedingte psychische-/Verhaltensstörung 7.2.1. Beschreibung der Störung Lange Zeit wurde Alkoholismus als selbstverschuldetes Laster angesehen und obwohl Alkoholabhängigkeit seit 1968 gesetzlich als Krankheit anerkannt ist, herrscht in der Bevölkerung nach wie vor ein negatives Bild von Alkoholikern vor. Kurzdefinition von Alkoholabhängigkeit (als Faustregel, v.a. für die Kommunikation mit Patienten): Alkoholabhängig ist entweder, - wer den Konsum von Alkohol nicht beenden kann, ohne dass unangenehme Zustände psychischer oder körperlicher Art eintreten oder wer nicht aufhören kann zu trinken, obwohl er sich oder anderen immer wieder schweren Schaden zufügt. 89 Kriterien für das Alkoholabhängigkeitssyndrom nach der ICD-10 (F 10.2): Mindestens 3 der folgenden 6 folgenden Kriterien waren innerhalb des letzten Jahres vorhanden: 1. Starker Wunsch bzw. Zwang, Alkohol zu konsumieren 2. Verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, der Beendigung und der Menge des Konsums (s.o.) 3. Körperliches Entzugssyndrom bei Beendigung oder Reduktion des Konsums (s.o.) 4. Toleranzentwicklung (s.o.) 5. Vernachlässigung anderer Interessen und erhöhter Zeitaufwand, um Alkohol zu beschaffen, zu konsumieren bzw. sich von den Folgen des Konsums zu erholen (s.o.) 6. Anhaltender Alkoholkonsum trotz Nachweises schädlicher Folgen (s.o.) Typen von Alkoholabhängigkeit: Die wohl bekannteste Klassifikation stammt von Jellinek (1960): 1. Konflikttrinker (Alpha-Typ): trinken, um Konflikte und Probleme zu bewältigen (sind nicht alkoholkrank, aber sehr gefährdet, v.a. nach kritischen Life-Events) 2. Gelegenheitstrinker (Beta-Typ): trinken bei sozialen Anlässen große Mengen, bleiben aber sozial und psychisch unauffällig (aufgrund ihres alkoholnahen Lebensstils trotzdem gefährdet) 3. Rauschtrinker (Gamma-Typ): haben zwar immer wieder abstinente Phasen, verlieren aber in den Phasen, in denen sie trinken, die Kontrolle über ihren Alkoholkonsum, hören also auch dann nicht mit dem Trinken auf, wenn sie genug haben (sind alkoholkrank) 4. Spiegeltrinker (Delta-Typ): halten einen bestimmten Alkoholspiegel, um Entzugssymptome zu vermeiden und sind dementsprechend nicht abstinenzfähig (sind alkoholkrank) 5. Quartalstrinker (Epsilon-Typ): haben trotz abstinenter Phasen immer wieder Phasen exzessiven Alkoholkonsums (sind alkoholkrank) Cloninger unterscheidet zwischen Typ-A- und Typ-B-Alkoholikern: Typ-A-Alkoholismus: Neurotischer Suchttypus (Hauptziel des Trinkens ist die Angstminderung: „harm avoidance“); später Beginn (nach 25), tritt bei Frauen und Männern gleichermaßen auf; weniger ausgeprägte Suchtsymptomatik; sozial eher unauffällig; bessere Prognose Typ-B-Alkoholismus: Psychopathologischer Suchttypus (Hauptziel des Trinkens ist die Verstärkung des Vergnügen: „sensation seeking“); früher Beginn (vor 25); tritt familiär gehäuft (genetische Komponente) und überwiegend bei Männern auf; ausgeprägtere Suchtsymptomatik; sozial auffällig (antisoziales Verhalten, Aggressionen etc.); schlechtere Prognose 7.2.2. Zur kurz- und langfristigen Wirkung von Alkohol Alkohol (Ethanol) wirkt antagonistisch auf die NMDA- und auf GABAA-Rezeptoren. Erstere sind erregend (Glutamat), letztere hemmend (Gamma-Amino-Buttersäure); darüber hinaus erhöht Alkohol den Serotonin- und Dopaminspiegel. Was die kurzfristige Wirkung von Alkohol betrifft, kann vor diesem Hintergrund zwischen 2 Phasen unterschieden werden (2-Phasen-Wirkung): 1) Solange der Spiegel steigt, hat Alkohol eine stimulierende Wirkung; es überwiegen positive Emotionen. 90 2) Singt der Spiegel dagegen, hat Alkohol eine sedierende Wirkung und es überwiegen negative Emotionen. Randbemerkung: Die kurzzeitige Wirkung von Alkohol scheint, zumindest wenn nur geringe Mengen konsumiert wurden, nicht zuletzt von den Erwartungen des Trinkers anzuhängen. Gibt man Pbn ein nach Alkohol schmeckendes, aber in Wahrheit alkoholfreies Getränk, verspüren diese die von ihnen erwartete Wirkung (z.B. erhöhte Aggressivität und sexuelle Erregung) Zu den langfristigen Wirkungen von Alkohol gehören: Toleranzsteigerung und Entzugserscheinungen: Um die hemmende Wirkung des Alkohols auszugleichen, steigern bestimmte Nervenbahnen ihre Aktivität; wird kein Alkohol mehr zugeführt, fehlt seine hemmende Wirkung und es kommt zu einem Zustand der Übererregtheit! Letzterer äußert sich in Schlafstörungen, Ruhelosigkeit, Tremors etc. (F 10.3: Entzugssyndrom); in besonders schlimmen Fällen kann es zu einem „Delirium tremens“ (F 10.4: Entzugssyndrom mit Delir) kommen. Leberzirrhose: Absterben und Entzündung von Leberzellen Amnestisches Syndrom (auch Korsakow-Syndrom genannt): Vitaminmangel führt zu Gedächtnislücken Unterernährung: Da Alkohol hochkalorisch ist, nehmen Alkoholiker oft nur noch wenig Nahrung zu sich; das Problem ist jedoch, dass Alkohol trotz der hohen Kalorienzahl kaum Nährstoffe enthält! Alkohol während der Schwangerschaft: Alkoholembryopathie (kleiner Kopf, weit auseinanderstehende Augen, flache Nase, verminderte Intelligenz, geschwächtes Immunsystem etc.) Außerdem: Bluthochdruck und Gefäßerkrankungen (=> daher die roten Nasen); Schädigung von Hirnzellen etc. Gesellschaftliche und familiäre Auswirkungen des Alkoholkonsums: Die von Personen mit Alkoholproblemen verursachten Kosten für das Gesundheitssystem sind rund doppelt so hoch wie die Kosten, die Abstinente verursachen. Alkoholismus führt auf Dauer zu Arbeitsunfähigkeit und Frühberentung! Annähernd die Hälfte aller Autounfälle ist auf übermäßigen Alkoholkonsum zurückzuführen (die stärkste Risikogruppe sind junge Männer)! Kriminalität: Etwa ein Drittel aller Festnahmen erfolgt wegen oder unter Beteiligung von Trunkenheit; über die Hälfte aller Gewaltverbrechen (Mord, Vergewaltigung etc.) wird unter Alkoholeinfluss begangen! Alkoholismus ist nicht zuletzt eine „Familienkrankheit“ – schließlich leiden auch die Angehörigen von Alkoholikern unter den Folgen der Störung (Unzuverlässigkeit, Arbeitslosigkeit, sexuelle und gewalttätige Übergriffe etc.) und entwickeln in Folge dessen häufig selbst psychische Störungen! Konsequenz: Nahestehende Personen sollten in die Therapie mit einbezogen werden! 7.2.3. Komorbiditäten und Differentialdiagnose Alkoholismus weist eine extrem hohe Komorbiditätsrate auf: Die Lebenszeitprävalenz für zusätzliche psychiatrische Störungen (Angststörungen, Depression etc.) liegt bei Alkoholabhängigen bei 80%! Geschlechtsspezifische Unterschiede: Bei Frauen ist die Komorbiditätsrate insgesamt höher als bei Männern; besonders häufig sind dabei Angststörungen 91 und affektive Störungen. - Bei Männern geht Alkoholismus häufig mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung einher. Alkoholabhängigkeit geht meist mit der Abhängigkeit von weiteren Substanzen einher („Polytoxikomanie“); z.B. sind über 90% der Alkoholiker auch nikotinabhängig (was möglicherweise auf eine Kreuztoleranz von Alkohol und Nikotin zurückzuführen ist)! Hinzu kommen zahlreiche Begleit- und Folgeerkrankungen (z.B. alkoholinduzierte Psychosen, Suizidalität, Unterernährung etc.), die bei der Behandlung zwecks „Harm Reduction“ Vorrang haben (s.u.). Entzugssymptome: Patient fühlt sich ängstlich, depressiv, ruhelos, kann nicht schlafen; Tremor der Finger, Augenlider, Lippen und Zunge; Erhöhter Puls, erhöhter Blutdruck, erhöhte Körpertemperatur etc. Entzugssyndrom mit Delir (auch „Delirium tremens“ genannt): tritt bei 15% aller Alkoholabhängigen auf – und zwar 3 bis 4 Tage nach Beginn der Abstinenz; dauert 3 – 7 Tage und führt unbehandelt bei 10-20% der Fälle zum Tod (Herz-Kreislauf-Versagen)! Prodromalerscheinungen: Schlaflosigkeit, Unruhe, Angst, Zittern Symptome: Bewusstseinstrübung und Desorientierung, motorische Unruhe, überwiegend visuelle, z.T. aber auch taktile Halluzinationen (Patienten sehen die berühmten „weiße Mäuse“ und anderes Getier) Ein Delir ist ein akuter und lebensbedrohlicher psychiatrischer Notfall!! Alkoholabhängigkeit muss von riskantem bzw. schädlichem Alkoholkonsum unterschieden werden; bei letzterem kommt es laut ICD-10 zwar zu Schäden, es liegt aber keine Abhängigkeit vor. Faustregel (Grenzwerte): Frauen: max. 5 Mal in der Woche 20 g Alkohol/Tag (~ ½ l Bier) Männer: max. 5 Mal in der Woche 40g Alkohol/Tag (~ 1 l Bier) 7.2.4. Epidemologie, Verlauf und Prognose Häufigkeit (in Deutschland): Der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch reinen Alkohols liegt in Deutschland bei ca. 10 Litern; das entspricht einem halben Liter Bier und einem Glas Wein (0,2 Liter) pro Tag! 50 % dieses Verbrauchs gehen dabei auf 7% der Bevölkerung zurück! Epidemiologie: 1, 5 Mio. sind abhängig (= 2,4%) 2,7 Mio. betreiben Alkoholmissbrauch (= 4%) 7,9 Mio. legen einen riskanten Alkoholkonsum an den Tag (= 11%) Geschlechterspezifität: Männer trinken im Schnitt etwa 3 Mal so viel wie Frauen und sind daher auch wesentlich häufiger von alkoholbedingten Syndromen betroffen (s.o.). Alkoholabhängigkeit: 4 % zu 1% Alkoholmissbrauch: 5% zu 2% Fazit: Alkoholbedingte Störungen stellen bei Männern die häufigste, bei Frauen (nach Angststörungen) die zweithäufigste psychische Erkrankung dar! Kulturelle Unterschiede und aktuelle Tendenzen: Am höchsten ist der Alkoholkonsum in Nordamerika und Europa; auch dort bestehen jedoch zwischen den einzelnen Staaten z.T. große Unterschiede; am höchsten ist der Konsum in Gegenden, in denen viel Wein produziert wird (Italien, Frankreich, Californien etc.). 92 Längsschnittstudien zeigen, dass sich die Länderunterschiede im Westen in den letzten Jahrzehnten verringert haben; darüber hinaus war zumindest bis in die 80er in fast allen Ländern ein Anstieg des Alkoholkonsums zu beobachten. In den letzten 25 Jahren ist dagegen ein stetiger Rückgang des Alkoholkonsums zu verzeichnen. Dem entgegen steht jedoch ein dramatischer Anstieg akuter Alkoholvergiftungen unter Jugendlichen (Stichwort: „Komasaufen“!). Als Reaktion auf diese Entwicklung wurde in Deutschland 2004 eine Sondersteuer auf Alkopops eingeführt! Krankheitsverlauf: Während man die Entwicklung zum Alkoholismus früher als kontinuierliche Abwärtsspirale auffasste (vom Geselligkeitstrinker zum Spiegeltrinker), weiß man heute, dass es keinen einheitlichen Krankheitsverlauf gibt. Stattdessen muss zwischen 3 Verlaufsformen unterschieden werden: 1. Progrediente Verschlechterung 2. Wechsel zwischen Trinkexzessen und kontrolliertem Konsum bzw. Abstinenz 3. Spontanremission (bei ca. 20%): meist nach einschneidendem Ereignis (Geburt eines Kindes; spirituelles Erlebnis, Autounfall etc.) Alkoholiker haben ein um das 2-4-fache erhöhtes Mortalitätsrisiko (16.00040.000 pro Jahr) Geschlechtsspezifische Unterschiede: Frauen fangen in der Regel später an zu trinken als Männer und der Anlass ist sehr häufig ein belastendes Lebensereignis (Familienkrise, Tod des Ehemanns etc.) Im Schnitt vergehen 6 - 9 Jahre, bis Alkoholismus effektiv behandelt wird! Damit ist Alkoholismus eine der am schlechtesten behandelten Krankheiten! Prognose: Günstige Bedingungen für Suchtausstieg: „Ersatzabhängigkeiten“ (z.B. Religion, Hobbys, Anonyme Alkoholiker…) Rituelle Erinnerung an Bedeutung der Abstinenz (Selbsthilfegruppen) Soziale und medizinische Unterstützung (z.B. Reintegration) Wiederherstellung der Selbstachtung der Betroffenen Typische Rückfallauslöser: unangenehme Gefühle (Ärger, Trauer etc.), Konflikte, soziale Verführung Fazit: Eine sichere individuelle Prognose ist nicht möglich; am besten scheint eine abstinenzfördernde Lebensumstellung und ein gezieltes Training im Umgang mit Rückfallsituationen zu wirken! 7.2.5. Störungsmodelle Wie alle Drogen hat auch Alkohol eine verstärkende Wirkung: Er wirkt einerseits enthemmend und stimulierend (positive Verstärkung), andererseits dämpfend und beruhigend (negative Verstärkung). Darüber hinaus führt er zu einer Erhöhung der Dopaminkonzentration im Belohnungszentrum und zu vermehrter Endorphinausschüttung (s.o.). Die unmittelbar verstärkende Wirkung von Alkohol ist im Vergleich zu anderen Drogen jedoch verhältnismäßig gering (Zum Vergleich: Kokain führt zu einer ca. 35-fachen Erhöhung der Dopaminkonzentration, Alkohol lediglich zu einer Verdopplung) – die Wirkung von Alkohol ist dementsprechend nicht 93 nur biochemisch bedingt, sondern hängt nicht zuletzt von psychischen Faktoren (Lernprozessen, Erwartungshaltungen etc.) ab! Eine besondere Rolle spielen die Erwartungen, die man an die Wirkung von Alkohol knüpft (s.o.): Je positiver diese Erwartungen sind, desto positiver erscheint einem nämlich die tatsächliche Wirkung! Erwartung und Wirkung verstärken sich also (zumindest im unteren Dosis-Bereich) wechselseitig! Auch die spannungsmindernde Wirkung von Alkohol scheint nicht nur mit dessen Wirkung auf die GABA-Rezeptoren zusammenzuhängen, sondern nicht zuletzt von kognitiven Faktoren abzuhängen: Sofern durch Alkohol die Aufmerksamkeitskapazität reduziert wird, können Sorgen nämlich nicht mehr hinreichend verarbeitet werden – vorausgesetzt natürlich, es besteht eine Möglichkeit zur Ablenkung. Besteht eine solche Möglichkeit nicht, kann nämlich auch der gegenteilige Effekt eintreten, indem der Betroffene dann die gesamte, wenn auch eingeschränkte Verarbeitungskapazität auf unangenehme Gedanken richtet. Der intrapsychische Teufelskreislauf: Alkoholabhängigkeit wird aufrechterhalten, indem der Anreiz von Alkohol stetig erhöht und der Konsum desselben automatisiert wird. Das geschieht u.a. durch kognitive Mechanismen, die sich ihrerseits wechselseitig verstärken. Beeinträchtigte Selbstwahrnehmung (mangelndes Selbstwertgefühl, Unterschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit etc.): rechtfertigt den eigenen Alkoholkonsum und erhöht den Anreiz („Ich schaffe das nicht!“; „Ich kann mich an niemanden wenden!“ usw. Mir bleibt also gar nichts anderes übrig, als Alkohol zu trinken.“) Unrealistische Wirkungserwartung: verstärkt die Wirkung (s.o.) und führt zu vermehrtem Konsum („Alkohol beruhigt/hilft/macht mich originell/…“) Suchtbezogene Grundannahmen: werden reflexartig aktiviert und meist nicht bewusst reflektiert („Oh, das war stressig. Jetzt brauche ich erst mal ein Glas Schnaps!“ Dahinter steht die Grundannahme: „Alkohol hilft, Stress zu verarbeiten“) Coping-Defizite: Da keine anderen Lösungsstrategien außer Alkohol ausprobiert werden, Alkohol aber in Wahrheit keine Lösungs- sondern eine Vermeidungsstrategie darstellt, können die Betroffenen irgendwann tatsächlich nicht mehr mit Problemen umgehen. Zum einen fehlt es ihnen an einem entsprechenden Verhaltensrepertoire, zum anderen an der nötigen Resilienz (Widerstandsfähigkeit gegenüber aversiven Reizen)! Abstinenzverletzungssyndrom: Wenn ein Alkoholiker erst einmal gegen das eigene Abstinenzgebot verstoßen hat („lapse“ = Fehltritt, Ausrutscher), fällt er mit hoher Wahrscheinlichkeit ganz in seine alten Trinkgewohnheiten zurück („relapse“ = Rückfall)! Der dahinter liegende Mechanismus: Bleibt ein Alkoholiker auch in Risikosituationen (also bei negativen Gefühlen, Konflikten oder sozialen Verführungssituationen) standhaft, stärkt das seinen Selbstwert und die Abstinenzzuversicht; die Wahrscheinlichkeit, auch in der nächsten Situation standhaft zu bleiben, steigt. Bleibt er dagegen nicht standhaft, ist es genau umgekehrt: negativer Selbstwert, geringe Abstinenzzuversicht, soziale Zurückweisung etc. => erhöhte Rückfallwahrscheinlichkeit (nach dem Motto: „ist der Ruf erst ruiniert,…“) 94 Der neurobiologische Teufelskreislauf: Auf neurobiologischer Ebene tragen v.a. die Toleranzsteigerung, der Endorphinmangel und das Suchtgedächtnis zur Aufrechterhaltung der Abhängigkeit bei! Genau wie die kognitiven (und psychosozialen: s.u.) Mechanismen führen sie zu einer Erhöhung des Anreizes von Alkohol und zur Automatisierung des Alkoholkonsums. Toleranzentwicklung: Bei regelmäßigem Alkoholkonsum wird eine bis zum Faktor 2 erhöhte Menge für die gleiche Wirkung benötigt; bei abruptem Absetzen kommt es zu Entzugserscheinungen. Verantwortlich für diese Prozesse sind: a) Beschleunigung der entsprechenden Leberfunktionen, so dass der Alkohol schneller abgebaut werden kann b) Erhöhung der durch Alkohol gehemmten Neurotransmitteraktivitäten; Vermehrung von Rezeptoren; Neubildung von Synapsen c) Nach der Gegensatz-Prozess-Theorie (s.o.) die Verstärkung des b-Prozesses! Endorphinmangel: Da dauerhafter Alkoholkonsum zu einem Überschuss an Dopamin und Endorphinen führt, wird die köpereigene Produktion dieser Stoffe zurückgefahren. Mangelnde Selbstaktivierung des Belohnungssystems! Suchtgedächtnis: Dauerhafter Alkoholkonsum führt zu einer subkortikalen Sensitivierung Hypersensibilität des Belohnungszentrums für Alkoholstimuli („Cue-Reactivity“); es werden „Schlüsselreize“ gelernt, die Sichtverhalten auslösen. Der psychosoziale Teufelskreislauf: Problematische Trinkkultur in der Gesellschaft: Alkohol ist fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens (Sektempfänge, Stammtische etc.) und wird von den Medien z.T. glorifiziert (Werbung usw.) Gruppendruck Veränderte Familieninteraktion: Die Abhängigkeit eines Familienmitglieds hat Einfluss auf das Verhalten der anderen Familienmitglieder; vielfach geraten letztere in eine sog. „Co-Abhängigkeit“: sie übernehmen Aufgaben des Abhängigen, opfern sich für ihn auf und versuchen, dessen Abhängigkeit nach außen hin zu vertuschen. Dadurch wird die Abhängigkeit des Betroffenen latent oder direkt unterstützt („Enabling“)! Sozialer Abstieg: Alkoholismus führt häufig zu Scheidung, Arbeitsplatzverlust, Ablehnung durch die Umwelt und anderen Problemen, wobei diese negativen Erfahrungen erneut Anlass zum Trinken geben (Verwechslung von Ursache und Wirkung!) Mangel an Alternativressourcen: Ressourcen, die eine Alternative zum Alkoholkonsum darstellen (wie z.B. soziale Anerkennung oder beruflicher Erfolg) sind meist erst nach längerer Abstinenz verfügbar; durch diese Zeitverzögerung wird die Rückfallwahrscheinlichkeit enorm erhöht! Verhaltensökonomisches Rückfallmodell: Nicht die Suchtvergangenheit ist entscheidend, sondern die Lebensumstände im Anschluss an die Suchtbehandlung! Schlussfolgerungen für die Therapie: Motivationspsychologische Niederschwelligkeit Keine konfrontative Grundhaltung, sondern Verständnis Ziel muss es sein, möglichst viele Betroffene möglichst früh in ihrer Suchtentwicklung zu erreichen 95 Harm Reduction Die Sicherung des Überlebens und die Verhinderung bzw. Behandlung schwerer Folge- und Begleitschäden haben Vorrang! Beachtung subcortikaler Prozesse und eingeschränkter Willensfreiheit Ein gezieltes Training zur Überwindung des Suchtreflexes ist erforderlich Außerdem müssen Bewältigungsstrategien für Rückfallsituationen vermittelt werden Zukunftsorientierung der Behandlung Bedingungen im Anschluss an die Behandlung sind entscheidend (Abstinenzentwicklung); nicht zuletzt deshalb ist es sinnvoll, die Bezugspersonen in die Therapie mit einzubeziehen. 7.2.6. Praktische Hinweise zu Diagnose und Indikation Patienten kommen i.d.R. nicht aus freien Stücken, sondern aufgrund körperlicher Probleme oder auf Druck anderer (Arbeitgeber, Familie etc.) in die Therapie! Daraus ergeben sich folgende Konsequenzen: Der Therapeut wird vielfach nicht als Helfer, sondern als Verbündeter derjenigen gesehen, von denen der Patient zur Behandlung gedrängt wurde; es gilt also bereits im Vorgespräch, Widerstände abzubauen und Vertrauen aufzubauen! Im Rahmen der Diagnostik geht es also nicht nur um Informationsgewinnung, sondern zugleich darum, den Patienten zu motivieren. „First things first“: Die Behandlung von Folge- und Begleiterkrankungen hat Vorrang vor der eigentlichen Entwöhnungstherapie (s.o.) => Ziel: „Harm Reduction“! Mit betrunkenen Patienten zu arbeiten macht keinen Sinn => Patienten also immer vorher ausnüchtern lassen! Ob eine stationäre oder eher eine ambulante bzw. teilstationäre Behandlung vorzuziehen ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Beides hat vor- und Nachteile. Stationäre Behandlung: ermöglicht eine intensivere Therapie und bietet eine stärkere Entlastung von Alltagsproblemen Sie ist indiziert: bei behandlungsbedürftigen psychischen Störungen (z.B. Delir oder Psychose), wenn der Patient schon mehrere Therapien abgebrochen hat bzw. wiederholt rückfällig wurde und kein soziales Stützsystem vorhanden ist. Ambulante/teilstationäre Behandlung: ist billiger und ermöglicht eine leichtere Einbeziehung von Bezugspersonen Sie ist indiziert: wenn der Patient nicht weit weg wohnt, ein soziales Stützsystem vorhanden ist, und davon auszugehen ist, dass es ungünstig wäre, ihn aus der Familie oder dem Beruf herauszureißen! 7.2.7. Zur Behandlung von Alkoholismus Motivierung: Der erste und vielleicht wichtigste Schritt jeder Suchttherapie besteht darin, ein Problembewusstsein zu schaffen, sprich: Der Klient muss seine Sucht zugeben und beschließen, etwas dagegen zu unternehmen. Erreicht werden kann dieses Ziel durch die Methode des „Motivational Interviewing“ ( konfrontativer Interaktionsstil). „Motivational Interviewing“ (MI) ist eine motivierende Form der Gesprächsführung, im Zuge derer versucht wird, Ambivalenzen aufzuzeigen 96 und zu überwinden, um auf diese Weise (und nicht etwa durch Überredung oder Druck) beim Klienten eine Veränderungsmotivation zu erzeugen. Die Methode basiert auf folgenden 4 Prinzipien: 1. Empathie (nicht von der eigenen Wirklichkeit ausgehen, sondern von der des Patienten) 2. Herausarbeitung von Diskrepanzen (dem Patienten die Diskrepanz zwischen seinem aktuellen Verhalten und seinen Wunschzielen vor Augen führen, die negativen Konsequenzen des aktuellen Verhaltens herausarbeiten etc.) 3. Geschmeidiger Umgang mit Widerstand (Widerstand nicht auf den Patienten, sondern auf die Interaktion zurückführen und gegebenenfalls den eigenen Interaktionsstil ändern, etwa indem eine neue Perspektive eingenommen wird) 4. Stärkung der Änderungszuversicht (dem Patienten das Gefühl geben, selbst verantwortlich zu sein und es selbst in der Hand zu haben, etwas zu ändern => Selbstwirksamkeit vermitteln) Techniken der motivierenden Gesprächsführung: Offene Fragen (die nicht mit „ja“ oder „nein“ zu beantworten sind) Aktives Zuhören („mhmh“, „aha“; „sie meinen also, dass…“) Zusammenfassungen (um dem Patienten seine Äußerungen zu spiegeln) Würdigung und positive Wertschätzung (Verständnis und Lob äußern) Offener und sensibler Umgang mit Widerstand Förderung von „change talk“ (den Patienten darin bestärken, bejahend über die von ihm angestrebten Veränderungen zu sprechen) Förderung von „confidence talk“ (den Patienten darin bestärken, zuversichtlich über die Erfolgsaussichten seiner Vorhaben zu sprechen) Entgiftung: Vielfach ist eine Entgiftung notwendig; sie kann stationär oder ambulant durchgeführt werden und dauert ca. einen Monat; meist wird eine solche Entgiftung medikamentös begleitet (Tranquilizer, krampflösende Medikamente etc.), um die unangenehmen Entzugserscheinungen abzumildern. Medikamentöse Behandlung: kann psychotherapeutische Maßnahmen ergänzen, aber niemals ersetzen. Folgende Medikamente werden zur Behandlung von Alkoholismus eingesetzt: „Anti-Craving“-Medikamente (z. B. Acamprosat): haben eine erregungshemmende Wirkung und führen dadurch zu einer Reduktion des Alkoholverlangens; eingesetzt werden sie überwiegend im ambulanten Setting; da im stationären Setting eher auf die Vermeidung von Rückfallsituationen gesetzt wird; die Einnahmedauer liegt zwischen 6 und 12 Monaten (Problem: hohes Drop out!); verschrieben werden sollten sie nur, wenn trotz Cravings eine eindeutige Abstinenzmotivation vorliegt und mit einer regelmäßigen Einnahme gerechnet werden kann! Antabus (Wirkstoff: Disulfiram): blockiert den Alkoholmetabolismus und führt dadurch, sobald Alkohol konsumiert wird, zu Übelkeit; Probleme: hohe Abbrecherquote (80%); wird das Medikament nach dem Alkoholkonsum eingenommen, besteht Lebensgefahr! Zusätzlich: medikamentöse Behandlung komorbider Störungen (Antidepressiva, Tranquilizer etc.) 97 Der Einsatz von Medikamenten zur Behandlung von Alkoholismus ist aus 3 Gründen problematisch: 1. Ist die Leber von Alkoholikern meist beschädigt, so das die Metabolisierung des Medikaments gestört sein kann 2. Führen Medikamente leicht in erneute Abhängigkeiten 3. Ist die Behandlung eines Substanzmissbrauchs durch eine andere Substanz kaum dazu geeignet, ein Bewusstsein für neue Problemlösestrategien zu fördern! Wirksamkeit: Medikamentöse Behandlung ist durchaus wirksam, allerdings nur in Kombination mit Psychotherapie! Psychotherapeutische Maßnahmen: verfolgen im Wesentlichen 3 Ziele (s.o.), es geht ihnen a) um den Aufbau einer Veränderungsbereitschaft; b) um eine effektive Rückfallprävention und c) um die Behandlung begleitender Störungen! Verhaltenstherapeutische Maßnahmen: Aversionstherapie: Alkoholkonsum wird an aversive Reize (Elektroschocks, medikamentös erzeugte Übelkeit) geknüpft (Bestrafung). Andere operante Maßnahmen: Abstinenz, mäßiger Konsum (Nippen statt Schlucken, Verzicht auf harte Alkoholika etc.) und Vermeidung von Risikosituationen (Kneipenbesuche etc.) werden positiv verstärkt. Ablehnungstraining (Lernen, nein zu sagen) Expositionsübungen mit Reaktionsvermeidung Vermittlung alternativer Problemlösestrategien: Entspannungsübungen; Selbstsicherheits- und Sozialkompetenztrainings; Unterstützung bei der Arbeitssuche etc. Kognitive Maßnahmen: Informationsvermittlung & Auseinandersetzung mit Abhängigkeit (z.B. Aufklärung darüber, wie viel tatsächlich getrunken wird, da Alkoholiker dazu neigen, den Alkoholkonsum anderer zu überschätzen) Arbeit am Selbstbild (Konfrontation mit Videoaufzeichnungen von sich selbst im betrunkenen Zustand etc.) Familientherapeutische Maßnahmen: Verbesserung der familiären Interaktion Gruppentherapie: kann sehr motivierend wirken! „Anonyme Alkoholiker“ und anderen Selbsthilfegruppen: geht es darum, einen abstinenten Lebensstil und eine entsprechende Identität aufzubauen. Voraussetzung für die Aufnahme ist die Anerkennung der eigenen Sucht sowie die regelmäßige Teilnahme an den Treffen (bis zu 4 Mal die Woche!); meist dauert das Ganze ein Jahr (viele brechen jedoch vorher ab); die Mitglieder sind rund um die Uhr füreinander da und unterstützen sich in Risikosituationen (soziales Netz). Die AA fordern völlige Abstinenz und sind stark spirituell angehaucht; ihr 12-stufiges Programm basiert auf dem Glauben, dass letztlich nur Gott den Einzelnen aus seiner Sucht befreien kann und zielt auf ein „spirituelles Erwachen“. Wirksamkeit: Selbsthilfegruppen wie die AA haben sich insbesondere bei der Vermeidung von Rückfällen als wirksam erwiesen. Streitfrage: Die Frage, ob Abstinenz oder kontrolliertes Trinken Ziel der Behandlung sein sollte, ist umstritten. Nachdem lange Zeit ausschließlich für ersteres plädiert wurde, wird in jüngerer Zeit zunehmend auch die 2. Position vertreten. Mäßigen Alkoholkonsum anstatt völlige Abstinenz anzustreben, hat folgende Vorteile: 1) ist ein derartiges Behandlungsziel näher an der gesellschaftlichen Wirklichkeit; 2) kann dadurch das Abstinenzverletzungssyndrom abgemildert 98 werden, sofern ein „Ausrutscher“ nicht als komplette Niederlage angesehen werden muss; 3) fördert ein kontrollierter Umgang mit Alkohol die Selbstachtung. Das Problem ist jedoch, dass trotz vereinzelter Behandlungserfolge in den meisten Fällen eben doch die „Alles-oder-Nichts“-Devise zu gelten scheint! 99 8. Persönlichkeitsstörungen 8.1. Persönlichkeitsstörungen allgemein 8.1.1. Zur Diagnose von Persönlichkeitsstörungen Im DSM-IV werden Persönlichkeitsstörungen als überdauernde, unflexible und tiefgreifende Erlebens- und Verhaltensmuster definiert, die von den Erwartungen der soziokulturellen Umwelt abweichen. A. Dabei müssen sich ein solches Muster in mindestens 2 der folgenden Bereichen manifestieren: Kognition Affektivität Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen Impulskontrolle B. Es muss unflexibel und tiefgreifend sein (s.o.) und in vielen persönlichen und sozialen Situationen zum Tragen kommen. C. Leiden oder Beeinträchtigungen in wichtigen Funktionsbereichen D. Stabiles und lang andauerndes Muster mit Beginn im Jugend- oder frühen Erwachsenenalter Dient zur Abgrenzung von Persönlichkeitsveränderungen, die erst im Erwachsenenalter einsetzen und meist auf Substanzmissbrauch oder hirnorganische Schädigungen zurückgehen! Die Diagnose von Persönlichkeitsstörungen ist aus mehreren Gründen problematisch: 1) Persönlichkeitsstörungen treten oft komorbid mit anderen Störungen auf, wobei sie großen Einfluss auf deren jeweilige Ausprägung haben. M.a.W.: Persönlichkeitsstörungen können den Kontext für andere psychische Störungen bilden und diese auf verschiedene Weise prägen. 2) Das Phänomen der „Ich-Syntonie“: Persönlichkeitsstörungen werden von Patienten meist nicht als solche erkannt, sondern für normal gehalten. 3) Dem entspricht, dass Leute mit einer Persönlichkeitsstörung meistens nicht wegen der Persönlichkeitsstörung, sondern wegen einer anderen Störung (z.B. Depression) in die Behandlung kommen. Im DSM-IV werden Persönlichkeitsstörungen vor diesem Hintergrund auf einer getrennten Achse, der Achse II, angeordnet (s.o.). Dadurch soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass Persönlichkeitsstörungen oft zusätzlich zu anderen Störungen auftreten und daher einer gesonderten Diagnose bedürfen. 4) Komorbidität mehrerer Persönlichkeitsstörungen: Häufig erfüllen Patienten die Kriterien mehrerer Persönlichkeitsstörungen. Beispiel: Auf über 50 % der Patienten mit einer Borderline-Störung treffen auch die Kriterien für eine schizotypische-, antisoziale- oder histrionische Persönlichkeitsstörung zu! 5) Bei den Merkmalen einer Persönlichkeitsstörung handelt es sich um kontinuierliche Variablen, die bei „normalen“ Persönlichkeiten lediglich weniger stark ausgeprägt sind! Vor diesem Hintergrund wird diskutiert, ob im Zusammenhang mit Persönlichkeitsstörungen nicht ein dimensionaler Klassifikationsansatz passender wäre! 100 6) Die Restest-Reliabilitäten, die oft recht niedrig ausfallen, zeigen, dass keineswegs alle Persönlichkeitsstörungen so stabil sind, wie oft angenommen wird! Trotzdem ist die Postulierung verschiedener Persönlichkeitsstörungen sinnvoll. 1) Haben sie einen jeweils spezifischen Einfluss auf die Ausprägung anderer Störungen (Validität) 2) Sind die Interrater-Reliabilitäten durchweg hoch; versch. Diagnostiker kommen also meist zu demselben Ergebnis. 8.1.2. Die verschiedenen Persönlichkeitsstörungen im Überblick Insgesamt wird zwischen 10 verschiedenen Persönlichkeitsstörungen unterschieden. Im DSM-IV werden sie 3 Hauptgruppen bzw. Clustern zugeordnet: Cluster A: Persönlichkeitsstörungen mit absonderlichem oder exzentrischem Verhalten Paranoide Persönlichkeitsstörung (~ 1%) Schizoide Persönlichkeitsstörung (< 1%) Schizotypische Persönlichkeitsstörung (~ 3%) Cluster B: Persönlichkeitsstörungen mit dramatischem, emotionalem oder launenhaften Verhalten Borderline- oder emotional instabile Persönlichkeitsstörung (1-2%) Histrionische Persönlichkeitsstörung (2-3%) Narzisstische Persönlichkeitsstörung (< 1%) Dissoziale bzw. antisoziale Persönlichkeitsstörung (♂ ca. 3%; ♀ ca. 1%) Cluster C: Persönlichkeitsstörungen mit ängstlichem oder furchtsamen Verhalten Vermeidend-selbstunsichere, ängstliche Persönlichkeitsstörung (~1%) Dependente Persönlichkeitsstörung (> 1,5%) Zwanghafte Persönlichkeitsstörung (~1%) A) Cluster A Die Persönlichkeitsstörungen aus Cluster A zeichnen sich durch absonderliches oder exzentrisches Verhalten aus und gelten für gewöhnlich als weniger schwerwiegende Varianten der Schizophrenie. Sie zeichnen sich nämlich nicht nur durch Symptome aus, die denen der prodromalen bzw. residualen Phase der Schizophrenie ähneln, sondern treten bei Verwandten von Schizophrenie-Patienten besonders gehäuft auf, was für eine gemeinsame genetische Basis spricht! Im ICD-10 wird die schizotypische Persönlichkeitsstörung daher als schizotype Störung (F 21) zu den schizophrenen und paranoiden Störungen gezählt! Die paranoide Persönlichkeitsstörung (~1%): ist durch übertriebenes Misstrauen und einen ausgeprägten Pessimismus gekennzeichnet. Betroffene erwarten immer nur Schlechtes, zweifeln permanent an den Absichten ihrer Mitmenschen, sind extrem eifersüchtig und oft feindselig. Differentialdiagnose: Anders als bei der Schizophrenie und der wahnhaften Störung treten jedoch weder Halluzinationen, noch vollausgeprägte Wahnvorstellungen auf. Starke Überlappung mit den übrigen Cluster-A-, der Borderline- und der vermeidend-selbstunsicheren Persönlichkeitsstörung. Die schizoide Persönlichkeitsstörung (< 1%): zeichnet sich durch Emotionslosigkeit, Gleichgültigkeit und extreme soziale Zurückgezogenheit aus. Differentialdiagnose: Starke Überlappung mit den übrigen Cluster-AStörungen und der vermeidend-selbstunsicheren Persönlichkeitsstörung! 101 Die schizotypische Persönlichkeitsstörung (~3%): zeichnet sich durch soziale Ängste, extreme Zurückgezogenheit und verschiedene exzentrische Symptome aus, die an die Schizophrenie erinnern: besonders häufig sind paranoide Vorstellungen, massiver Aberglaube und Beziehungsideen (die Überzeugung, dass Ereignisse etwas mit einem selbst zu tun haben). Differentialdiagnose: starke Überlappung zu den übrigen Cluster-A-Störungen, der Borderline-, der narzisstischen- und der vermeidend-selbstunsicheren Persönlichkeitsstörung Laut ICD-10 keine Persönlichkeitsstörung, sondern eine schizophrene Störung (s.o.) B) Cluster B Die Borderline- oder emotional instabile Persönlichkeitsstörung (1-2%): zeichnet sich v.a. durch instabile, extrem wechselhafte Emotionen und Verhaltensweisen und ein hohes Maß an Impulsivität aus. Siehe: Kapitel 8.2. Die histrionische (früher: hysterische) Persönlichkeitsstörung (2-3%): zeichnet sich durch übertrieben dramatisches Verhalten, extreme Ich-Zentriertheit, Oberflächlichkeit und ein enormes Aufmerksamkeitsbedürfnis aus. Betroffene (meist Frauen) versuchen verzweifelt, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen: sie beschäftigen sich übermäßig mit ihrem Äußeren, sind gewollt verführerisch und übertreiben maßlos. Hohe Komorbidität mit der Borderline-Störung und Depression! Beispiel: Tessa! Die narzisstische Persönlichkeitsstörung (<1%): Betroffene haben ein unrealistisches Selbstbild, sind extrem arrogant und raumfordernd, enorm egoistisch und wahnsinnig empfindlich gegenüber jeder Form von Kritik. Darüber hinaus fehlt es ihnen an Empathie! Tritt in den meisten Fällen zusammen mit der Borderline-Störung auf. Bildet in der ICD-10 aufgrund der enormen Überlappungen zu anderen Persönlichkeitsstörungen keine eigenständige Kategorie. Beispiel: Tessa! Die dissoziale (ICD-10) bzw. antisoziale (DSM-IV) Persönlichkeitsstörung: zeichnet sich durch eine bereits vor Vollendung des 15. Lebensjahres einsetzende Störung des Sozialverhaltens aus; dabei müssen mindestens 3 der folgenden 7 Symptome vorhanden sein: Delinquenz, Falschheit, Impulsivität, Reizbarkeit und Aggressivität, Missachtung der eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer, Verantwortungslosigkeit und Mangel an Reue. Die Störung tritt v.a. bei Männern und in unteren sozialen Schichten auf und ist häufig komorbid mit anderen Diagnosen (insbes. Substanzmissbrauch) Ein der antisozialen Persönlichkeitsstörung verwandtes Konzept ist das der Psychopathie. Es sind jedoch keineswegs alle Personen mit antisozialer Persönlichkeitsstörung zugleich Psychopathen; bei letzteren spielen nämlich v.a. emotionale Defizite (Gefühllosigkeit) eine Rolle; darüber hinaus vermag auch drohende Strafe sie nicht von antisozialen Handlungen abzuhalten. 102 C) Cluster C Die vermeidend-selbstunsichere, ängstliche Persönlichkeitsstörung (~1%): wird von manchen als schwere Form der generalisierten Sozialphobie betrachtet. Betroffene haben ein schlechtes Selbstbild, lassen sich nur sehr zögerlich auf Beziehungen ein und haben große soziale Ängste. Hohe Komorbidität mit der dependenten- und der Borderline-PS sowie mit Depression und der generalisierten sozialen Phobie. Die dependente (=abhängige) Persönlichkeitsstörung (etwas über 1,5%): zeichnet sich durch fehlendes Selbstvertrauen, Entscheidungsunfähigkeit und eine hohe Abhängigkeit von anderen aus. Betroffene haben große Angst davor, verlassen zu werden, und ein starkes Bedürfnis danach, versorgt zu werden. Komorbiditäten mit nahezu allen Persönlichkeitsstörungen, der bipolaren Störung, Depressionen, Angststörungen und Bulimie. Die zwanghafte Persönlichkeitsstörung (~1%): Perfektionismus, Detailversessenheit, Entscheidungsunfähigkeit, Inflexibilität, Arbeit geht über Freizeit etc. Differentialdiagnose: Anders als bei der Zwangsstörung treten keine Zwangsgedanken und Zwangshandlungen auf! Komorbiditäten: Die zwanghafte PS betrifft nur bei einer Minderheit der Patienten mit Zwangsstörung! Am häufigsten tritt sie zusammen mit der vermeidend-selbstunsicheren Persönlichkeitsstörung auf! 8.2. Die Borderline-Störung im Speziellen 8.2.1. Geschichte des Störungsbegriffes: Adolf Stern (1938): Der Begriff „Borderline“ basiert auf der psychoanalytischen Grundannahme, dass sich psychische Störungen auf einem Kontinuum zwischen „neurotisch“ und „psychotisch“ bewegen, wobei Borderline-Patienten auf der Grenze („Borderline“) zwischen diesen beiden Zuständen angesiedelt wurden. Neurose = weniger schlimm, da nur einen Teil der Persönlichkeit betreffend und entwicklungsbedingt (nicht verarbeiteter Konflikt) Psychose = die gesamte Persönlichkeit betreffend, biologisch bedingt! Kernberg (1967): Patienten mit einer „Borderline-Persönlichkeitsorganisation“ unterscheiden zwar zwischen „gut“ und „böse“, haben in ihrer Kindheit aber nicht gelernt, das Selbst von anderen Objekten zu trennen. Einerseits projizieren sie eigene Gedanken und Gefühle in andere (projektive Identifikation), andererseits übernehmen sie die Gedanken und Gefühle anderer als ihre eigenen (Introjektion). Historisch lassen sich 4 Hauptströmungen unterscheiden: 1) Die Borderline-Störung als subschizophrene Störung (ca. 1920-1965) 2) Die Borderline-Störung als subaffektive Störung 3) Die Borderline-Störung als Störung der Impulskontrolle 4) Die Borderline-Störung als schwere Form der Posttraumatischen Belastungsstörung (wird v.a. in jüngster Zeit häufig vertreten) Seit dem DSM III (1980): operationalisierte Kriterien! 8.2.2. Diagnostik Diagnostische Kriterien nach dem DSM-IV: Die Borderline-Persönlichkeitsstörung beginnt i.d.R. im frühen Erwachsenenalter und ist durch ein hohes Maß an Impulsivität und extreme Instabilität in zwischenmenschlichen Beziehungen, im Selbstbild und in den Affekten gekennzeichnet. 103 Dabei müssen mindestens 5 der folgenden 9 Symptome vorliegen: 1. Verzweifeltes Bemühen, Verlassenwerden zu vermeiden 2. Intensive, aber instabile zwischenmenschliche Beziehungen, die durch einen Wechsel von Idealisierung und Entwertung gekennzeichnet sind 3. Identitätsstörung, genauer: Instabilität des Selbstbildes und der Selbstwahrnehmung 4. Impulsivität in mindestens 2 potenziell selbstschädigenden Bereichen 5. Wiederholte suizidale Handlungen, Selbstmordandeutungen und -drohungen oder Selbstverletzungen 6. Affektive Instabilität (z.B. erhöhte Reizbarkeit, Angstattacken usw.) 7. Chronisches Gefühl von Leere 8. Unangemessene oder unkontrollierbare Wut 9. Vorübergehende paranoide Vorstellungen oder schwere dissoziative Symptome (z.B. Depersonalisationsercheinungen) In der ICD-10 ist die Borderline-Störung keine eigene Persönlichkeitsstörung, sondern eine Unterform der „emotional instabilen Persönlichkeitsstörung“ (F 60.3), die sich in einen „impulsiven Typus“ (F 60.30) und einen „Borderline-Typus“ (F 60.31) unterteilt; die Kriterien für letzteren entsprechen weitegehend denen des DSM-IV. Die Symptomatik der Borderline-Störung lässt sich auf klinischer Ebene in 5 Problembereiche gliedern: 1) Affektregulation Niedrige Reizschwelle (=> Überempfindlichkeit) Hohes Erregungsniveau (=> sehr heftige Emotionen) Widersprüchlichkeit (=> aversive Spannungszustände) 2) Selbstbild Unsicherheit bezüglich der eigenen Identität und Integrität („weit entfernt von sich selbst“; „sich selbst ausgeliefert“); Patienten schwanken oft zwischen Minderwertigkeitskomplexen und Omnipotenzfantasien; haben widersprüchliche Überzeugungen, Werte usw. 3) Psychosoziale Integration Gefühl der Andersartigkeit und Einsamkeit Schwierigkeiten in der Nähe-Distanz-Regulation (Patienten haben einerseits Sehnsucht nach Nähe, andererseits Angst davor; sind anderen gegenüber oft verletzend, empfinden physische Abwesenheit als Verlassenheit etc.) „Passive Aktivität“ (Patienten demonstrieren Hilflosigkeit, um Aufmerksamkeit und Zuwendung zu bekommen) Überlastung der Sozialkontakte (Patienten erwarten zu viel von ihrem Umfeld und sind extrem anstrengend!) 4) Kognitive Funktionsfähigkeit Ca. 65% leiden unter ausgeprägter dissoziativer Symptomatik (Depersonalisations- und Derealisationserleben) Intrusionen (Erinnerung und Wiedererleben traumatischer Ereignisse) Pseudopsychotische Symptomatik (akustische und optische Halluzinationen, die jedoch als ichsynton, d.h. von innen kommend, erlebt werden; magisches und paranoides Denken; übertriebener Argwohn etc.) Extremes „Schwarz-Weiß-Denken“, so dass z.B. gute und schlechte Seiten eines Menschen nicht in ein Ganzes integriert werden können Neuropsychologische Leistungsfähigkeit ist nicht eingeschränkt 104 5) Verhaltensebene Selbstverletzungen bei 70-80% der Patienten (Schnittverletzungen, Brandverletzungen mit Zigaretten oder Bügeleisen; Head-banging etc.), wobei diese meist nicht als schmerzhaft, sondern als entspannend und beruhigend, in manchen Fällen sogar als euphorisierend (Kick) erlebt werden. Hochrisikoverhalten zur Regulation der Ohnmachtsgefühle (z.B. gefährliches Balancieren auf Brücken etc.) Impulsivität (z.B. im Geldausgeben oder sexuellen Kontakten) Zentrale Hypoxie (Sauerstoffreduktion im Gehirn) Störungen des Ess- und Trinkverhaltens 8.2.3. Epidemiologie und Komorbiditäten Epidemiologie: Die Lebenszeitprävalenz liegt zwischen 1 und 2 % (s.o.) 60-70% der Erkrankten sind Frauen; diese sind demnach deutlich häufiger betroffen als Männer! Ca. 80% der Erkrankten befinden sich in Behandlung Nur rund 1/3 der Betroffenen lebt in fester Beziehung oder ist verheiratet. Nur rund 1/3 steht im Berufsleben. Verlauf: Alter bei Erstmanifestation: bimodale Verteilung Bereits im Alter von 14 Jahren Verhaltensauffälligkeiten (Essstörungen, Suizidversuche, affektive Störungen, selbstverletzendes Verhalten) Im Alter von 24 Jahren Ausbruch der Störung Suizidrate: 7-10% Therapie-Abbruchquote: 75%!! Komorbiditäten: Komorbide Achse-I-Störungen: Depressive Störungen: Lebenszeitprävalenz ca. 98% Angststörungen: Lebenszeitprävalenz ca. 90% Schlafstörungen: 50% Substanzmissbrauch: Frauen: 40%; Männer: 60% Essstörungen: Frauen: 60% Psychotische Störungen: 1% Komorbide Persönlichkeitsstörungen: Dependente: 50% Ängstlich-vermeidende: 40% Paranoide: 40% (v.a. bei Männern) Antisoziale: 25% Histrionische: 15% 8.2.4. Praktische Hinweise zu Diagnostik und Therapie Stufenplan der klinischen Diagnostik: Leitsymptom (!): Häufig einschießende, äußerst unangenehme Spannung ohne differenzierte emotionale Qualität! Überprüfung der DSM-IV-Kriterien Evtl. unter Zuhilfenahme des IPDE („International Personality Disorder Eximination“) => strukturiertes Experteninterview zur allgemeinen 105 Diagnose von Persönlichkeitsstörungen, das die Kriterien des DSM-IV und der ICD-10 integriert! SKID-I zur Diagnostik von Komorbiditäten und evtl. Ausschluss schizophrener Erkrankungen Ausschluss organischer Faktoren Diagnostisches Interview für das Borderline-Syndrom, revidierte Fassung (DIB-R) => internationaler Standard! Borderline-Symptom-Liste (BSL) => dient zur Erfassung des Schwergrads und des Verlaufs! 8.2.5. Das neurobehaviorale Störungsmodell Das neurobehaviorale Modell der Borderline-Störung ist ein Diathese-Stressmodell, Es führt die Störung auf ein Zusammenspiel neurobiologischer und psychosozialer Variablen sowie negative Rückkopplungsprozesse zurück. (Frühe) Traumata Neurobiolologische Prädisposition - Frühe sexuelle oder körperliche Gewalt - Vernachlässigung durch die primäre Bezugsperson - Fehlende zweite Bezugsperson - Gewalt im Erwachsenenalter - Konkordanzen: EE (55%) vs. ZZ (14%) - Weibliches Geschlecht (oder Sozialisation?!) - Niedriger Seritoninspiegel (=> Impulsivität?) - Übersensibilität und Verkleinerung der Amygdala und des Hippocampus (~limbisches System) Störung der Affektregulation - Erhöhte Sensibilität gegenüber emotionalen Reizen, Verzögerung der Emotionsrückbildung und Schwierigkeiten, Emotionen zu differenzieren - Erhöhte Impulsivität Hohe Dissoziationsneigung (v.a. in Stresssituationen) Probleme beim kontextabhängigen, assoziativen Lernen - Wer sich selbst nicht als kohärente Einheit erlebt, kann aus den Konsequenzen des eigenen Handelns nichts lernen! Dysfunktionale Grundannahmen und inkompatible Schemata Mangelnde psychosoziale Realitätsorientierung Rückgriff auf dysfunktionale Bewältigungsstrategien (Selbstschädigung) 106 8.2.6. Behandlung: Die Dialektisch Behaviorale Therapie (DBT) Die dialektisch-behaviorale Therapie wurde von MARSHA LINEHAN speziell für die Behandlung von Borderline-Patienten entwickelt. Das Konzept basiert auf dem neurobehavioralen Störungsmodell und verbindet Elemente der kognitiven VT, der humanistischen Psychologie und des Zen-Buddhismus. Eine feste Behandlungsreihenfolge gibt es nicht; stattdessen ist das Programm bewusst so offen, dass es flexibel auf die Probleme des jeweiligen Patienten abgestimmt werden kann. Der Begriff „dialektisch“ bringt zweierlei zum Ausdruck: Erstens beschreibt er die paradoxe Haltung, die der Therapeut dem Borderline-Patienten gegenüber einnehmen muss: Der Therapeut muss letzteren nämlich nicht zu einer Veränderung seines Verhaltens bewegen, sondern ihn zugleich so annehmen, wie er ist (Rogers). Zweitens bringt der Begriff zum Ausdruck, worum es in der Therapie geht: nämlich die Gegensätze in der Welt des Patienten schrittweise aufzulösen und zu integrieren. Grundannahmen: Entscheidend für den Erfolg der Therapie ist die Grundhaltung des Therapeuten und dessen Beziehung zum Klienten; erstere muss im Sinne der humanistischen Psychologie empathisch, wertschätzend und kongruent sein. Der Therapeut muss sich darüber bewusst sein, dass Borderline-Patienten unter ihrer Störung leiden und sich bessern wollen, ihnen aber genau das besonders schwer fällt. Das Verhalten der Patienten macht im subjektiven Kontext des Patienten durchaus Sinn und darf daher nicht pauschal als „gestört“ abgetan werden. Stattdessen gilt es, die jeweiligen Auslöser und Konsequenzen sowie die zugrundeliegenden Schemata herauszuarbeiten! Die Patienten können in der DBT nicht versagen – die Therapeuten brauchen ihrerseits Unterstützung (Supervision) Die DBT umfasst 4 Module: 1. Einzeltherapie 2. Fertigkeitstraining in der Gruppe („Skills“-Gruppe) 3. Telefonberatung (in Notfällen) 4. Supervisionsgruppe für Therapeuten Die Beziehungsgestaltung: ist aus 2 Gründen eines der wichtigsten Elemente der Einzeltherapie. Erstens, sind Beziehungsprobleme ein Leitsymptom der BorderlineStörung! Zweitens, soll durch eine positive Beziehung ein vorzeitiger Therapieabbruch, der bei Borderline-Patienten beinahe die Regel ist (s.o.: 75%!), verhindert werden. Der Therapeut versteht sich als Coach (sprich: er übernimmt die Hauptverantwortung für Verlauf und Ergebnis der Therapie) Der Therapeut benennt seine eigenen Emotionen (auf diese Weise soll dem Patienten die Wirkung seines Verhaltens authentisch gespiegelt- und dabei geklärt werden, ob diese tatsächlich intendiert war) Der Therapeut achtet stärker auf die verbalen als auf die nonverbalen Signale (da letztere bei Borderline-Patienten oft beeinträchtigt sind und ihre tatsächlichen Emotionen nicht adäquat wiedergeben) Jede Sitzung wird auf Video oder Audiokassette aufgenommen (zur Nachbearbeitung durch den Patienten) Der Therapeut sorgt für „Objektkonstanz“ (z.B. durch das Aufnehmen von Tonbändern, um mit ihrer Hilfe Abwesenheitsphasen zu überbrücken) 107 Der Therapeut beachtet seine eigenen Grenzen (man ist nur zu bestimmten Zeiten telefonisch erreichbar, kann nur eine begrenzte Anzahl von Zusatzterminen anbieten etc.) Der Therapeut balanciert zwischen Akzeptanz und Drängen auf Veränderung Der Therapeut balanciert zwischen Einhaltung der Regeln und Flexibilität (um weder den therapeutischen Erfolg, noch die Beziehung zu gefährden) Der Therapeut balanciert zwischen stützender und zutrauender, fordernder Haltung Der Therapeut gibt eigene Fehler zu und dient dem Patienten dadurch als Modell! Der Therapeut ist optimistisch und ressourcenorientiert! Die Einzeltherapie: gliedert sich in eine Vorbereitungs- und drei Hauptphasen, wobei es in all diesen Phasen nicht zuletzt darum geht, eine positive Beziehung zum Klienten aufzubauen (s.o.). 0) Vorbereitungsphase: Aufklärung über das Störungsbild (Psychoedukation) und die Methodik der DBT Klärung gemeinsamer Behandlungsziele und –foki; Aufsetzen eines Behandlungsvertrages (Klient verpflichtet sich zur Einhaltung von Regeln, etwa dazu, keinen Suizid zu begehen, der Therapeut zu bestmöglicher Hilfestellung) Verhaltensanalyse des letzten Suizidversuchs / des letzten Therapieabbruchs 1) Die erste Therapiephase dient der Behandlung problematischer Verhaltensweisen Suizidales und parasuzidales Verhalten: hat oberste Priorität Ziel ist es, einen adäquaten Umgang mit suizidalen Krisen und Problemen zu fördern Therapiegefährdendes Verhalten: dazu zählen z.B. unentschuldigtes Fernbleiben, eine Überbeanspruchung des Therapeuten (nächtliche Anrufe, Drohungen etc.) Ziel ist es, die Compliance zu erhöhen! Verhaltensweisen, die die Lebensqualität einschränken: dazu zählen z.B. Drogenmissbrauch, Essstörungen, Dissoziationen etc. Ziel ist es, Verhaltensweisen, die die emotionale Balance und damit die Lebensqualität beeinträchtigen, zu reduzieren. (Methode: Vermeidung von Auslösereizen (z.B. Umfeld, Filme etc.) und besserer Umgang mit traumaassoziierten Emotionen) Verbesserung von Verhaltensfertigkeiten: erfolgt zwar primär in der Skillsgruppe; in der Einzeltherapie muss der Klient jedoch dazu angehalten werden, das dort Gelernte auch anzuwenden! 2) Die zweite Therapiephase dient v.a. dazu, traumatische Erfahrungen aufzuarbeiten, um dadurch deren negativen Konsequenzen für das Verhalten des Patienten zu reduzieren. Eine solche Aufarbeitung ist allerdings erst dann indiziert, wenn die Patienten bereits gelernt haben, ihre Emos einigermaßen zu regulieren und keine akute Suizidgefahr mehr besteht (Belastbarkeit). Identifikation traumassoziierter Schemata (Wochenprotokoll; Verhaltensanalysen etc.) Modifikation dieser Schemata (durch Methoden der kognitiven Umstrukturierung, Expositionsverfahren, Kontingenzmanagement etc.) Umgang mit Dissoziationen und „Stuck-States“ (Zuständen, in denen der Patient kognitiv und emotional nicht mehr zugänglich ist): Dissoziative 108 Zustände sind oft konditioniert, sofern sie durch spezifische Reize ausgelöst werden und zu einer kurzfristigen Spannungsreduktion führen. Unterbrochen werden können sie durch starke sensorische Reize (z.B. lautes Geräusch, Eiswürfel); wichtig ist: sie treten nur auf, wenn der Patient es zulässt! 3) Die dritte und letzte Therapiephase zielt auf die generelle Lebensführung des Klienten; Ziel dieser Phase ist es, das Gelernte zu integrieren und sich neu zu orientieren! Das Fertigkeitstraining in der Gruppe: erfolgt parallel zur Einzeltherapie und sollte möglichst von einem anderen Therapeuten durchgeführt werden (da das Skillstraining die therapeutische Beziehung gefährden kann). Das Programm gliedert sich in 4 Module (s.u.) à 8 Sitzungen und sollte 2 Mal komplett durchlaufen werden; 8-10 Teilnehmer, wobei Neueinsteiger immer zu Beginn eines neuen Moduls aufgenommen werden können. 1. Das Modul „innere Achtsamkeit“ zielt darauf, ein bewussteres Erleben des Alltags zu fördern sowie die Gefühle und Gedanken der Patienten miteinander in Einklang zu bringen (=> Einflüsse des Buddhismus)! Zu den „Was“-Fertigkeiten der inneren Achtsamkeit gehören die Komplexe „Wahrnehmen“, „Beschreiben“ und „Teilnehmen“, sprich: Die Klienten sollen lernen, sich etwas zuzuwenden (Gedanken, Objekte, Situationen), auch wenn es unangenehm ist (= wahrnehmen), das eigene Verhalten und die Umweltereignisse zu benennen (=beschreiben) und in einer Tätigkeit aufzugehen, ohne sich ablenken zu lassen (= teilnehmen) Zu den „Wie“-Fertigkeiten der inneren Achtsamkeit gehört a) die Fertigkeit, Ereignisse zu beobachten, ohne sie zu werten (erst die Bewertung macht die Emotion!), b) die Fertigkeit, sich von den eigenen Emotionen zu distanzieren („innerer Beobachter“) und c) die Fertigkeit zu wirkungsvollem Handeln. 2. Das Modul „Stresstoleranz“ zielt darauf, einen besseren Umgang mit Stresssituationen zu fördern. Zu diesem Zweck werden den Patienten verschiedene Strategien vermittelt, die auf insgesamt 4 Ebenen ansetzen. Sensorische Ebene: Angesprochener Sinn Fühlen Hören Riechen Schmecken Sehen Bei Hochstress Eiswürfel in die Hand oder d. Mund nehmen Laute, knallende Geräusche direkt am Ohr Ammoniak zufächeln Chilischoten kauen Bei moderatem Stress Schaumbad nehmen, sich massieren lassen Aufmunternde, rhythmische Musik Parfüm zufächeln Versch. Eissorten probieren Zeiger eines Me- Kunstband tronoms beobachten durchblättern etc. Physiologische Ebene: Haltungsübungen, Atmungsübungen, Sport etc. Kognitive Ebene: „Den Augenblick verändern“ Bei Hochstress: „Flick-Flacks“ (z.B. von 100 je 7 abziehen) Phantasie: z.B. Visualisierung eines Ortes, an dem der Patient sich geborgen fühlt („save place“) Gebet/Meditation: sich einem höheren Wesen anvertrauen Sinngebung (Absicht oder Sinn im Schmerz finden; Vgl. Frankl) Konzentration auf den Augenblick 109 Vergleichen (mit Leuten, denen es noch schlechter geht, z.B. den Kindern in Afrika) Optimistische Gedanken fördern Handlungsebene: „Überbrückung“ Ablenkende Aktivitäten (Freunde treffen, Holz hacken etc.) Mentaler „Kurzurlaub“ (für 20 Minuten) 3. Das Modul „Emotionsregulation“ zielt darauf, Fertigkeiten zur Emotionsregulation zu vermitteln. Dabei stützt sich das Modul auf die neurobehaviorale Emotionstheorie, der zufolge Emotionen das Resultat zweier Bewertungsprozesse sind. - Emotionale Reize führen zu physiologischer und neuronaler Erregung (Arousal), die ihrerseits eine kognitive Interpretation der betreffenden Reize erforderlich macht. - Dabei werden die eingehenden Reize in einem ersten Schritt danach beurteilt, ob sie angenehm oder unangenehm sind und ob sie wichtig oder unwichtig sind. - In einem zweiten Schritt wird geprüft, ob die eingehenden Reize bekannt- und wenn ja, wie sie genau einzuordnen sind, sprich: wie angenehm/unangenehm und wie wichtig sie sind! - Die aus diesen Bewertungsprozessen resultierende Emotion führt zu einem entsprechenden Handlungsentwurf, dessen Adäquatheit seinerseits an den zuvor gemachten Überlegungen überprüft wird. Aus diesem Modell ergeben sich 4 Möglichkeiten zur Emotionsregulation: a) Veränderung der Reizexposition Anders als Phobiker tendieren Borderline-Patienten dazu, traumarelevante Reize nicht zu vermeiden, sondern gezielt aufzusuchen; es gilt daher, sie einerseits zu aktiver Reiz-Prävention, andererseits zum bewussten Aufsuchen positiver Reize zu ermutigen (Problem: Borderliner haben oft das Gefühl haben, „es nicht zu verdienen“) b) Veränderung der zentralen neuronalen Reizverarbeitung Borderliner haben eine erhöhte Sensitivität für emotionale Reize (s.o.); diese kann jedoch durch so „banale“ Dinge wie Sport, eine ausgewogene Ernährung und eine vernünftige Tagesstruktur reduziert werden (Problem: den Patienten fehlt es dazu oft an der nötigen Motivation). c) Veränderung der Bewertungsprozesse Wenn ihre Interpretation offensichtlich unrealistisch ist, sollten die Patienten das Gegenteil von dem tun, was ihre Emotion ihnen vorgibt (verlangt viel Mut)! Wenn ihnen ihre Interpretation dagegen auch bei nochmaliger Überprüfung stimmig erscheint und nicht abzumildern ist, sollte diese nach dem Prinzip der „radikalen Akzeptanz“ angenommen werden! d) Umsetzung der Emotion in adäquate Handlungs- und Kommunikationsformen 4. Das Modul „zwischenmenschliche Fertigkeiten“ enthält Elemente gängiger Trainings zur Förderung der sozialen Kompetenz (Rollenspiele etc.)! Borderliner haben eigentlich gute soziale Fertigkeiten (Ressourcen), sie können diese aber in bestimmten Situationen nicht adäquat anwenden 110 (schwanken zwischen Konfliktvermeidung und radikaler Konfrontation etc.). Zur Wirksamkeit: DBT ist sowohl im ambulanten als auch im stationären Setting überaus effektiv. Schon nach 4 Monaten werden signifikante Verbesserungen erzielt und die Abbrecherquote ist deutlich niedriger als bei unspezifischen Therapien! Medikation: Die Datenlage zur Wirkung pharmakologischer Therapien ist überaus unbefriedigend; die am häufigsten eingesetzten Medikamente sind SSRIs und Benzodiazepine; sie dienen jedoch lediglich der Symptombekämpfung und haben zudem eine hohe Suchtgefahr! 111 9. Somatoforme und dissoziative Störungen 9.1. Somatoforme Störungen 9.1.1. Die verschiedenen Arten somatoformer Störungen Definition: Somatoforme Störungen (griech. „soma“ = „Körper“) äußern sich in körperlichen Symptomen, für die es bisher keine physiologische Ursache gibt und die sich nicht willkürlich kontrollieren lassen. Man nimmt an, dass sie psychische Ursachen haben und insbesondere mit Angst zusammenhängen. Im DSM-IV wird zwischen 6 Arten somatoformer Störungen unterschieden: 1) Eine Somatisierungsstörung: liegt vor, wenn vielfältige (!) körperliche Beschwerden über einen Zeitraum von mehreren Jahren (!) immer wiederkehren, ohne dass eine organische Ursache dafür angegeben werden könnte. 2) Eine undifferenzierte somatoforme Störung: liegt vor, wenn über einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten eine oder mehrere körperliche Beschwerden auftreten, ohne dass eine organische Ursache dafür angegeben werden könnte. Unterscheidet sich von der Somatisierungsstörung durch die Anzahl der Symptome und deren Dauer! 3) Eine Konversionsstörung: liegt vor, wenn sensorische oder motorische Symptome (z.B. eine Lähmung) auftreten, die zwar eine neurologische oder andere körperliche Ursache nahelegen, in Wirklichkeit aber mit psychologischen Faktoren in Zusammenhang stehen. Folgende Untertypen werden unterschieden: - Konversionsstörungen mit motorischen Symptomen oder Ausfällen: z.B. Lähmungen der Arme oder Beine, Koordinationsstörungen, Aphonie (Stimmverlust) etc. - Konversionsstörungen mit sensorischen Symptomen oder Ausfällen: z.B. plötzlicher Verlust des Sehvermögens, „Tunnelblick“ (Einschränkung des Gesichtsfelds), Anästhesie (Schmerzunempfindlichkeit / Verlust taktiler Empfindungen), Anosmie (Verlust des Geruchssinns); Gefühle des Stechens, Kribbelns oder Prickelns auf der Haut etc. - Konversionsstörungen mit Anfällen oder Krämpfen - Konversionsstörungen mit gemischtem Erscheinungsbild Konversationsstörungen (früher als „Hysterie“ bezeichnet) treten meist im Zusammenhang mit psychischen Belastungssituationen auf. Mögliche Ursachen: Aufmerksamkeitsbedürfnis, Vermeidungsreaktion (um bestimmten Anforderungen zu entgehen) => kurz: Angst und seelische Konflikte werden in körperliche Symptome umgewandelt bzw. „konvertiert“; wird heute im Ggs. zu Freuds Zeiten nur noch selten diagnostiziert! 4) Eine somatoforme Schmerzstörung: äußert sich in anhaltenden Schmerzen ohne organische Ursache 5) Hypochondrie: äußert sich in der Fehlinterpretation körperlicher Zeichen oder Empfindungen und in der daraus resultierenden, aber objektiv unbegründeten Angst oder Überzeugung, eine schwere Krankheit zu haben. Diese Angst hält trotz ärztlicher Rückversicherung an und dauert mindestens 6 Monate! 112 6) Eine körperdysmorphe Störung (Dsymorphophobie): äußert sich in der intensiven Beschäftigung mit einem eingebildeten oder übertriebenen Mangel der eigenen Erscheinung. Die Unzufriedenheit kann sich auf alle möglichen Körperteile und –eigenschaften beziehen (Behaarung, Brustgröße, Nasenform etc.), sie beginnt meistens gegen Ende der Pubertät und tritt bei Frauen häufiger auf als bei Männern; Schönheits-OPs helfen in aller Regel wenig! Manche Forscher halten die Dismorphophobie nicht für eine eigene Störung, sondern für ein Symptom, das bei mehreren Störungen auftreten kann (Zwangsstörung, Wahnstörung, Depression etc.); tatsächlich ist die Differentialdiagnose nicht ganz einfach (s.u.)! Im ICD-10 sind die aufgelisteten Diagnosen etwas spezifischer; darüber hinaus werden Konversionsstörungen unter den dissoziativen Störungen geführt! F 44: „Dissoziative Störung der Bewegung und der Sinnesempfindung“: „Dissoziative Bewegungsstörungen“; „Dissoziative Krampfanfälle“ etc. Halitophobie (auch somatoforme Halitosis genannt): ist die unbegründete Angst und Überzeugung, Mundgeruch zu haben. 9.1.2. Die Somatisierungsstörung Diagnostische Kriterien nach dem DSM-IV: A. Vorgeschichte mit vielen körperlichen Beschwerden, wobei diese vor dem 30. LJ begonnen- und über mehrere Jahre angehalten haben müssen. B. Erfüllung folgender 8 Kriterien: Vier Schmerzsymptome (z.B. Kopf-, Gelenk-, Rücken-, Bauch- oder Menstruationsschmerzen; Schmerzen Wasserlassen oder beim Geschlechtsverkehr = Dyspareunie) Zwei gastrointestinale Symptome (z.B. Völlegefühl, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall oder Unverträglichkeit bestimmter Speisen) Ein sexuelles Symptom (z.B. sexuelle Gleichgültigkeit, Erektions- oder Ejakulationsstörungen, unregelmäßige oder ungewöhnlich starke Menstruation, Erbrechen während der gesamten Schwangerschaft) Ein pseudoneurologisches Symptom (entweder ein Konversionssymptom wie z.B. Gleichgewichts- oder Koordinationsstörungen, Lähmungen, lokalisierte Muskelschwäche, Schluckschwierigkeiten, Aphonie, Hallos, Anästhesien, Blindheit oder Taubheit oder ein dissoziatives Symptom wie z.B. Amnesie) C. Keine organische Ursache; D. keine Simulation Die Kriterien des ICD sind etwas ungenauer: eine Somatisierungsstörung liegt hier vor, wenn mehrere verschiedene körperliche Symptome ohne ausreichende somatische Erklärung über mindestens 2 Jahre andauern. Der „Somatische Symptom-Index - 4/6“ (SSI – 4/6): dient zur Diagnose eines „Somatisierungssyndroms“, wobei deutlich weniger Symptome verlangt werden als im DSM-IV. Während letzterer den Cut-off-Wert für eine Somatisierungsstörung auf 8 Symptome festlegt, verlangt der SSI bei Männern lediglich 4-, bei Frauen 6 Symptome – und zwar über einen Zeitraum von 6 Monaten! Es hat sich gezeigt, dass Patienten oberhalb des SSI (ohne Erfüllung der vollständigen Kriterien einer Somatisierungsstörung) ähnliche Probleme haben wie Patienten mit einer vollständigen Somatisierungsstörung (Krankheitstage, Komorbiditäten, Arztbesuche etc.) 113 9.1.3. Hypochondrie Diagnostische Kriterien nach dem DSM-IV: A. Übermäßige Beschäftigung mit der Angst oder Überzeugung, eine ernsthafte Krankheit zu haben, was auf einer Fehlinterpretation körperlicher Symptome beruht. B. Die Beschäftigung mit den Krankheitsängsten bleibt trotz angemessener medizinischer Abklärung und Rückversicherung durch den Arzt bestehen. Unterschieden werden kann zwischen Patienten mit und solchen ohne Einsicht in die Unbegründetheit der eigenen Sorgen! C. Die Überzeugung ist weder von wahnhaftem Ausmaß ( Wahnhafte Störung), noch handelt es sich dabei um eine umschriebene Sorge über die äußere Erscheinung ( Körperdysmorphe Störung) D. Leiden und Beeinträchtigung E. Dauer: mindestens 6 Monate F. Nicht besser durch eine generalisierte Angststörung, Zwangsstörung, Panikstörung Major Depression oder andere somatoforme Störung zu erklären! Die „Illness Attitude Scale“ (IAS): ist ein Verfahren zur Erfassung von Hypochondriesymptomen. Die IAS umfasst 29 Items, die auf einer 5stufigen Skala (von „Nein“ bis „fast immer“) zu beantworten sind. Beispielitems: „Machen Sie sich über ihre Gesundheit Sorgen?“; „Beängstigt Sie der Gedanke an eine ernste Erkrankung?“; „Prüfen Sie ihren Körper, um herauszufinden, ob irgendetwas nicht stimmt?“ … Die Items lassen sich 8 Skalen zuordnen, die da sind: „Worry about illness“; „Concern about Pain“; „Health Habits“; „Hypochondrical Beliefs“; „Thanatophobia“ (=Angst vor dem Tod); „Disease Phobia“; „Bodily Preoccupation“; „Treatment Experience“ Hypochonder haben auf allen Subskalen erhöhte Werte! 9.1.4. Epidemiologie, Komorbiditäten und Differentialdiagnose Lebenszeitprävalenzen: Somatoforme Störungen generell: 12-13% Verhältnis Frauen – Männer: 2:1 Häufig auftretende somatische Beschwerden wie Brustschmerz, Erschöpfung, Schwindel, Kopfschmerz oder Rückenschmerzen, haben in den seltensten Fällen organische Ursachen! Somatisierungsstörung: unter 0,1% (am seltensten!) Undifferenzierte somatoforme Störung: ca. 9% Konversionsstörung: weniger als 1% Hypochondrie: ca. 0,2% Die häufigsten psychosomatischen Symptome sind: Rückenschmerzen, Kopf- und Gesichtsschmerzen, Schweißausbrüche, leichte Erschöpfbarkeit, Bauchschmerzen, Völlegefühl/Blähungen, Palpitationen (ein vom Patienten als unregelmäßig und ungewöhnlich stark empfundener Herzschlag), Druckgefühl im Bauch. Alle diese Symptome treten bei über 50% der Patienten einer psychosomatischen Klinik auf! Komorbiditäten: Nur 23% der Personen, die an einer somatoformen Störung leiden, haben keine weitere Diagnose; in den meisten Fällen sind somatoforme Störungen also komorbid! 114 Am häufigsten treten somatoforme Störungen zusammen mit Depressionen auf (Lebenszeitprävalenz für eine MD: 47%; für Dysthymia: 40%). Aber auch Zwangs- und Angststörungen (insbes. Panikattacken und Agoraphobie) sowie Alkoholmissbrauch treten bei Personen mit somatoformer Störung gehäuft auf! Diagnose- und Dokumentationshilfen: Das „Screening für somatoforme Störungen“ (SOMS): ist ein Fragebogen, bei dem der Patient selbst Angaben über körperliche Beschwerden macht. „In den vergangenen 2 Jahren habe ich unter folgenden Beschwerden gelitten [ja/nein]“: Erbrechen, Bauch- und Unterleibsschmerzen, Übelkeit, Blähungen, Durchfall, Schwindel, etc. Differentialdiagnose: Simulation (vorgetäuschte Störung) Organische Ursachen Der Ausschluss organischer Ursachen ist bei somatoformen Störungen natürlich ganz besonders wichtig; das gilt insbesondere für Konversionsstörungen, die früher oft zu Unrecht als psychische Störungen diagnostiziert wurden. Es bedarf dementsprechend immer einer eingehenden medizinischen Untersuchung (Röntgenaufnahmen, Spiegelungen, CT etc.)! Beispiel: Hysterische Anästhesien können von neurologischen Dysfunktionen dadurch unterschieden werden, dass sich die Bereiche, in denen sie auftreten, meist nicht mit den Bereichen neuronaler Innervation decken! Ist dem so, fehlt ihnen eine anatomische Grundlage! Hysterische Anästhesien treten häufig auf: an Händen und Unterarmen; im Gesicht; im Bereich der Knie; an den Waden und Füßen; am Hinterkopf und dem oberen Teil des Rückens! Psychische Faktoren, die medizinische Krankheitsfaktoren beeinflussen Affektive Störungen Angststörungen Wahnhafte Störung (mit körperbezogenem Wahn) 9.1.5. Risikofaktoren Genetische Risikofaktoren: Alkoholismus, Soziopathie (= dissoziale Persönlichkeitsstörungen), affektive Störungen und somatoforme Störungen in der Familie Epidemiologische Risikofaktoren: Weibliches Geschlecht (2:1-Verhältnis) Niedriger Sozialstatus Kulturkreis (somatoforme Störungen treten besonders häufig bei Leuten mit lateinamerikanischem Background und in Kulturen auf, in denen Emotionen nicht offen gezeigt werden) Entwicklungspsychologische Risikofaktoren: Sexuelle Übergriffe Familiäre Krankheitsmodelle Organmedizinisch orientierter Gesundheitsbegriff Auslösende Faktoren: Kritische Lebensereignisse (Missbrauch, Trennung etc.) Organische Erkrankungen Psychische Dauerbelastungen (Ehekonflikte etc.) 115 Tägliche Belastungen (= „Mikrostressoren“ bzw. „Daily hazzles“) Aufrechterhaltende Faktoren: Inadäquate Coping-Strategien Verstärkende Bedingungen in der familiären oder partnerschaftlichen Interaktion Z.B. wenn psychische Probleme ein Tabuthema sind oder physische Probleme mit vermehrter Fürsorge belohnt werden Z.B. wenn die Frau keinen Sex mehr will – und die körperlichen Beschwerden sie vor selbigem beschützen! Soziale Vorteile Fehlendes soziales Stützsystem 9.1.6. Modelle zur Entstehung und Aufrechterhaltung somatoformer Störungen Allgemeines Modell (nach Rief): Umweltfaktoren: Reduzierte externale Stimulation (bedingt durch Depression oder Ängste) Modelle für Krankheitsverhalten Verstärkung von Krankheitsverhalten Biologische Faktoren: - Genetische Prädisposition - Erhöhte psychophysiologische Reaktivität (z.B. durch Aufmerksamkeit anderer oder indem die Symptome als Entschuldigung für schlechte Leistungen genutzt werden, einen aus der Verantwortung entlassen, andere Konflikte überlagern etc.) Störungsspezifische Einstellungen und Bewertungsmuster (z.B.: „Ernste Krankheiten werden von Ärzten oft übersehen!“) Gewalterfahrungen Störungen der Körperwahrnehmung Verstärkte Wahrnehmung der Beschwerden Aufmerksamkeitsfokussierung erhöhtes Erregungsniveau Schon- und Vermeidungsverhalten Reduzierte externe Stimulation Verstärkung dysfunktionaler Annahmen Bewertung als krankhaft Erhöhtes Arousal und Aufmerksamkeitsfokussierung Somatoforme Beschwerden Werden durch „Checking-Verhalten“ (z.B. ständiges Schlucken, Betasten etc.) verschlimmert 116 Entstehung und Aufrechterhaltung der Hypochondrie: Vorgeschichte: z.B. Krebserkrankung und Tod der Eltern Entwicklung dysfunktionaler (=irrationaler) Annahmen: z.B. „Wenn ich nicht ständig meinen Körper beobachte, wird etwas Furchtbares passieren.“; „Ernste Krankheiten werden von Ärzten oft übersehen“; „Ängste können keine Symptome auslösen.“ Psychische Probleme: z.B. chronische Überforderung mit der Erziehung der Kinder, Ängste etc. Auslöser / Trigger: z.B. eine Reportage über Krebs, einzelne „Symptome“ (verschieden große Brüste etc.), Krankheit etc. Aktivierung der dysfunktionalen Annahmen => erhöhte Aufmerksamkeit und erhöhtes Arousal Körperliche Veränderungen: z.B. Unwohlsein, Schmerzen in der Brust etc. Automatische negative Gedanken und Vorstellungen => Fehlinterpretation der Symptome („Das muss Krebs sein!“) Gesundheitsängste: Verhaltensebene: Vermeidung und Schonung; Selbstbeobachtung; Suche nach Rückversicherung; Arztkonsultationen; Medikamenteneinnahme Affektive Ebene: Angst; Dysphorie („banale Alltagsverstimmung“) etc. Kognitive Ebene: Fokussierung der Aufmerksamkeit auf den eigenen Körper Physiologische Ebene: Symptomverschlechterung; erhöhtes „Arousal“ 9.1.7. Empirische Studien Windacher Studie Pauli et al.: Bildvalenz und Druckschmerz Durchführung: 24 Pbn (12 Frauen; 12 Männer) bekamen jeweils 7 positive, neutrale, negative und schmerzbezogene Bilder dargeboten, während der Darbietung (à 8 Sek.) wurden sie einem objektiv gleichbleibenden Druckschmerz (650 g) ausgesetzt, den sie per manuellem Schieber (0-50) raten sollten. Die Bilder wurden dem „International affective Picture System“ (IAPS) entnommen Ergebnis: Wie stark der Schmerz empfunden wurde, hing von der Valenz der Bilder ab: am stärksten war der wahrgenommene Schmerz bei schmerzbezogenen Bildern, am zweitstärksten bei negativen Bildern und am geringsten bei positiven Bildern. Pauli et al.; Hypochondrie und Gedächtnis (recall): Getestet wurde, inwiefern sich die Gedächtnisleistung von Hypochondern und/oder Patienten mit somatoformer Schmerzstörung von denen gesunder Pbn unterscheidet – und zwar in Abhängigkeit vom Inhalt der zu merkenden Wörter. Durchführung: Die Pbn bekamen positive, neutrale, negative und schmerzbezogene Wörter dargeboten und sollten diese unmittelbar danach und nach einer gewissen Verzögerung noch einmal wiederholen (immediate und delayed Recall). Ergebnisse: Die Hypochonder und die Patienten, die sowohl an Hypochondrie als auch an einer somatoformen Schmerzstörung litten, merkten sich von den positiven weniger - und von den schmerzbezogenen Wörtern mehr als die Kontrollgruppe! Interpretation: Das Gedächtnis von Hypochondern ist verzerrt (signifikanter „memory bias“) 117 Hautzinger, Pauli et al.: Effekte von hypochondrischen Einstellungen auf das Krankheitsverhalten am Beispiel von Patienten mit funktionellen Herzbeschwerden Durchführung: Fragebogenstudie an einer Patientenstichprobe mit funktionellen Herzbeschwerden Ergebnisse: Der Ausprägungsgrad der Hypochondrie korreliert hoch mit Todesangst, Gesundheitssorgen, Beunruhigung über Schmerzen und Arztbesuchen! Hypochonder fühlen sich nach Mitteilung des negativen Untersuchungsergebnisses weniger erleichtert als die Kontrollgruppe und haben häufiger vor, sich noch weiteren Untersuchungen unterziehen zu lassen. Gesetz von Pennebaker: f (Intensität der internalen Signale / Intensität der externalen Signale) 9.1.8. Zur Behandlung somatoformer Störungen: Haltung des Patienten: Patienten mit somatoformen Störungen begeben sich meistens nur widerwillig in psychologische Behandlung; schließlich sind sie davon überzeugt, dass ihre Beschwerden physiologische Ursachen haben! Somatoformen Störungen liegen meistens Ängste oder Depressionen zugrunde; sie lassen sich in dem Fall indirekt behandeln, indem die Ängste und Depressionen angegangen werden. Es muss darauf geachtet werden, dass der Patient durch eine plötzliche Besserung nicht das Gesicht verliert (etwa vor seinen Angehörigen oder Arbeitgebern) Haltung des Therapeuten: Es geht nicht darum, dem Patienten zu vermitteln, was sein Problem nicht ist, sondern darum, ihm aufzuzeigen, was sein Problem ist! Die körperlichen Beschwerden des Patienten dürfen nicht geleugnet, sondern müssen ernst genommen werden! Zwischen psychogenem und somatogenem Schmerz zu unterscheiden, ist ohnehin nicht sonderlich sinnvoll, da Schmerz immer beide Aspekte umfasst! Die Annahmen des Patienten dürfen nicht pauschal verworfen, sondern müssen mit ihm zusammen kritisch überprüft werden. Es geht nicht darum, den Patienten zu etwas zu überreden, sondern darum, ihn durch geschicktes Fragen zu eigenen Einsichten zu bewegen (sokratischer Dialogstil) Behandlungsrichtlinien bei somatoformen Störungen Ausschluss organischer Ursachen?! Anamnese und Diagnose Motivation für eine zeitlich befristete Therapie schaffen und Zielhierarchie aufstellen Kognitive Maßnahmen: Gesundheitsbegriff des Patienten hinterfragen und modifizieren (meist liegt ein zu enger Gesundheitsbegriff vor) Krankheitsbegriff hinterfragen und modifizieren (behutsame Einführung psychologischer Begriffe wie Angst, Belastung, Stress etc.) Modifikation dsyfunktionaler Annahmen Arbeit am Selbstbild ... 118 Behaviorale Maßnahmen: zur Modifikation des Krankheitsverhaltens Symptomverstärkende Wirkung des Krankheitsverhaltens verdeutlichen Operante Maßnahmen (evtl. unter Einbezug der Bezugspersonen) Biofeedback (anhand dessen die Patienten lernen sollen, Körperfunktionen wie Herzschlag oder Atmung willentlich zu kontrollieren) … 9.4. Dissoziative Störungen 9.4.1. Die verschiedenen Arten dissoziativer Störungen Definition: Dissoziative Störungen sind durch einen Bruch des Bewusstseinszusammenhangs von Identität, Gedächtnis und Wahrnehmung gekennzeichnet. 1. Dissoziative Amnesie: Partieller oder vollständiger Verlust des Gedächtnisses nach einer belastenden Erfahrung Die Dauer einer amnestischen Episode kann stark variieren (Stunden bis Jahre); die Inhalte des deklarativen Gedächtnisses (Weltwissen) bleiben erhalten, betroffen ist also lediglich das episodische Gedächtnis bzw. Teile davon. 2. Dissoziative Fugue: Vollständiger Gedächtnisverlust, im Zuge dessen die Patienten ihre gewohnte Umgebung verlassen und eine neue Identität annehmen (Vgl. „Stiller“) Wird i.d.R. durch belastende bzw. traumatische Ereignisse ausgelöst, ist aber äußerst selten! 3. Depersonalisationsstörung: Abrupte Veränderung der Selbstwahrnehmung und des Selbsterlebens (man kommt sich plötzlich fremd vor, erkennt seine eigene Stimme nicht wieder, betrachtet sich von außen etc. etc.) 4. Dissoziative Identitätsstörung (Multiple Persönlichkeit): Existenz von 2 oder mehr verschiedenen, unabhängig voneinander handelnden Persönlichkeiten innerhalb eines Individuums Die Existenz dieser Störung ist trotz berühmter Fallbeispiele sehr umstritten; Kritiker behaupten, die versch. Persönlichkeiten würden den Patienten erst in der Therapie eingeredet! 9.4.2. Therapie Sowohl psychodynamische als auch verhaltenstherapeutische Ansätze betrachten dissoziative Störungen als Abwehr- bzw. Verdrängungsmechanismus; verursacht werden sie durch schwerwiegende Belastungen bzw. traumatische Erfahrungen (insbes. sexuellen Missbrauch in der Kindheit!). Diese Erfahrungen aufzuarbeiten, ist ein wesentliches Ziel der Therapie! Nicht selten werden dabei Hypnosetechniken eingesetzt! Bei der Behandlung der dissoziativen Identitätsstörung geht es um die sukzessive Integration der verschiedenen Identitäten. 119 10. Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom (ADHS) 10.1. Darstellung des Störungsbildes 10.1.1. Diagnostische Kriterien Definition: ADHS äußert sich in häufiger Unaufmerksamkeit, übermäßiger motorischer Aktivität und erhöhter Impulsivität. Ob die besagten Merkmale tatsächlich störungsspezifisch sind oder sich noch im Rahmen des „Normalen“ bewegen, hängt dabei vom Entwicklungsstand bzw. Alter des jeweiligen Kindes ab. Diagnostische nach dem DSM-IV: Das DSM-IV unterscheidet zwischen 3 Arten der „Aufmerksamkeits/Hyperaktivitätsstörung“: 1. Einem vorwiegend unaufmerksamen Typus 2. Einem vorwiegend hyperaktiv-impulsiven Typus 3. Einem Mischtypus Dem entspricht die Unterscheidung zwischen 2 Arten von Symptomen, nämlich a) Symptomen der Unaufmerksamkeit und b) Symptomen von Hyperaktivität und Impulsivität. Für eine Diagnose müssen über einen Zeitraum von 6 Monaten mindestens 6 Symptome aus einer der beiden Gruppen vorhanden gewesen sein. Zu den Symptomen der Unaufmerksamkeit gehören u.a.: Nichtbeachten von Einzelheiten oder Flüchtigkeitsfehler Probleme mit der Daueraufmerksamkeit (sprich: damit, sich länger auf eine Sache zu konzentrieren) Ablenkbarkeit Vergesslichkeit Häufiger Verlust von Dingen Organisationsschwierigkeiten Probleme beim Zuhören Zu den Symptomen der Hyperaktivität und Impulsivität gehören u.a.: Ruhelosigkeit / Getriebenheit …redet übermäßig Hyperaktivität …zappelt oder rutscht auf dem Stuhl herum …steht oft auf, wenn Sitzenbleiben erwartet wird …platzt mit Antworten zu früh heraus Impulsivität …kann kaum erwarten, an die Reihe zu kommen (Ungeduld) …unterbricht und stört andere Zumindest einige dieser Symptome müssen nach dem DSM-IV schon vor dem 7. Lebensjahr aufgetreten sein; darüber hinaus müssen sie in mindestens zwei Bereichen (z.B. Schule, Familie, Peers) zu Beeinträchtigungen führen! Diagnostische Kriterien nach der ICD-10: Die ICD-10 spricht anders als das DSM-IV von „hyperkinetischen Störungen“ (F 90), wobei v.a. zwischen einer „einfachen Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung“ (F 90.0) und einer „hyperkinetischen Störung des Sozialverhaltens“ (F 90.1) unterschieden wird. Bei beiden Störungen handelt es sich um ADHS; die „hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens“ zeichnet sich lediglich dadurch aus, dass zu den Aufmerksamkeitsdefiziten und hyperaktiven Symptomen noch eine Störung des Sozialverhaltens hinzutritt! 120 Für eine Diagnose müssen sowohl Symptome der Unaufmerksamkeit, als auch der Hyperaktivität vorliegen, wobei offen gelassen wird, wie viele. Entscheidend ist, dass sie situationsübergreifend (also z.B. nicht nur bei langweiligen Aufgaben) auftreten, über längere Zeit andauern und bereits vor dem 6. Lebensjahr einsetzen! Die wichtigsten Unterschiede zwischen dem DSM-IV und der ICD-10: Die Kriterien des ICD-10 sind strenger, da für eine Diagnose sowohl Unaufmerksamkeit als auch Hyperaktivität vorausgesetzt werden! Die anhand der DSM-IV-Kriterien ermittelten Prävalenzen liegen dementsprechend deutlich über denen des ICD-10! Während die Symptome laut DSM-IV vor dem 7. Lebensjahr begonnen haben müssen, müssen sie laut ICD-10 schon vor dem 6. Lebensjahr einsetzen! Während das DSM-IV zwischen 3 Subtypen unterscheidet kann zur ADHS lediglich eine Störung des Sozialverhaltens hinzutreten, wobei letztere ersterer klar untergeordnet wird! Im DSM-IV wird zumindest sprachlich zwischen Hyperaktivität und Impulsivität differenziert, in der ICD-10 nicht – hier ist lediglich von Hyperaktivität die Rede! Die Vorgaben des DSM-IV sind detaillierter als die der ICD-10: Es wird genau festgelegt, welche Symptome und wie viele davon im Einzelnen diagnostiziert werden müssen; darüber hinaus wird festgelegt, dass die Symptome in mindestens zwei Bereichen zu Beeinträchtigungen führen müssen! Diagnose bei Erwachsenen: In der ICD-10 wird darauf hingewiesen, dass das hyperkinetische Syndrom auch im Erwachsenenalter diagnostiziert werden kann. Die Kriterien sind dabei dieselben; es müssen lediglich die zur der Beurteilung der Symptome herangezogenen Normen an das Erwachsenenalter angepasst werden! Die Wender-Utah-Kriterien für ADHS wurden speziell für das Erwachsenenalter entwickelt; neben einer Aufmerksamkeitsstörung und motorischer Hyperaktivität (die sich im Erwachsenenalter auch als eine „innere Unruhe“ äußern kann), müssen laut diesen Kriterien mindestens 2 der folgenden 5 Symptome vorliegen: 1. Affektlabilität (Stimmungsschwankungen, Niedergeschlagenheit etc.) 2. Desorganisiertes Verhalten (z.B. im Studium, in der Arbeit oder im Haushalt) 3. Verringerte Affektkontrolle (erhöhte Reizbarkeit, niedrige Frustrationsschwelle etc.) 4. Impulsivität (Ungeduld, Dazwischenreden usw.) 5. Emotionale Überreagibilität (Patienten sind schnell gestresst, oft ängstlich…) Die „Adult ADHD Self-Repost Scale” (ASRS): ist ein Screeningfragebogen für Erwachsene; der Fragebogen umfasst 18 Fragen, die auf einer 5-stufigen Skala zu beantworten sind (von „nie“= 0 bis „sehr oft“ = 4) Beispielfragen: „Wie oft verlegen Sie Dinge zu Hause oder bei der Arbeit?“ „Wie oft fühlen Sie sich ruhelos oder zappelig?“ Auswertung (max. Punktzahl: 4 × 18 = 72): Bei 0-16 Punkten: ist ADHS eher unwahrscheinlich Bei 17-23 Punkten: ist ADHS möglich Bei über 24 Punkten: ist ADHS recht wahrscheinlich 121 10.1.2. Epidemiologie und Verlauf Epidemiologische Daten: ADHS ist einer der häufigsten Gründe, derentwegen sich Eltern an Erziehungsberatungsstellen oder schulpsychologische Dienste wenden. Die Störung ist jedoch bei weitem nicht so weit verbreitet, wie oft von Lehrern und Eltern angenommen wird! Die Prävalenz liegt in Deutschland bei Schulkindern zwischen 3 und 8 %, bei Erwachsenen bei ca. 3%! Jungen scheinen dabei häufiger betroffen zu sein als Mädchen (die Schätzungen bewegen sich zwischen 2:1 und 9:1!). Es könnte aber auch sein, dass Jungen, die unter ADHS leiden, lediglich häufiger in Behandlung kommen, weil sie aggressiver sind und mehr soziale Probleme haben als Mädchen mit ADHS! ADHS ist keine kulturbedingte Störung: Sie taucht nicht nur in westlichen, sondern auch in anderen Kulturkreisen auf! Zum Verlauf der Störung: Säuglings- und Kleinkindalter: Fütter-, Schrei- und Schlafstörungen Entwicklungsverzögerungen Vorschulalter: Motorische Unruhe Starkes Mittelpunktsstreben Mangelhafte Regeleinhaltung und oppositionelles Verhalten Gestörtes Beziehungsverhalten (werden von Gleichaltrigen nicht sonderlich gemocht, streiten sich oft etc.) Geringere Spieldauer und -intensität Schulalter: hier wird die Störung meistens erstmals diagnostiziert! Hausaufgabenkonflikte Schulische Lern- und Leistungsprobleme Aggressives Verhalten Erziehungsstil: negative Interaktion, kontrollierend Jugendalter: Dissoziales Verhalten Suchtmittelmissbrauch (früher, länger und doppelt so häufig!) Selbstwertprobleme Erwachsenenalter: Dissoziale Persönlichkeitsstörung Gestörte Selbstorganisation Berufliche Probleme Suizidalität Erhöhte Unfallgefahr (50% der Fahrradunfälle werden angeblich von Leuten mit ADHS verursacht => Wer„s glaubt, wird selig! Schließlich wird wohl nach den wenigsten Fahrradunfällen eine ADHS-Diagnostik durchgeführt!) Die hyperaktive Symptomatik geht im Erwachsenenalter stark zurück (sie äußert sich dann v.a. in „innerer Unruhe“) 122 10.1.3. Komorbiditäten und Differentialdiagnose Die wichtigsten Komorbiditäten: Störungen des Sozialverhaltens (40-60%) Angststörungen / Depression (25%) Tics (bis zu 30%) Umschriebene Entwicklungsstörungen: z.B. Lese-Rechtschreibschwäche, Dyskalkulie etc. (10-40%) Differentialdiagnose: Zur Diagnose von ADHS bedarf es einer multiaxialen Diagnostik; unbedingt berücksichtigt werden müssen: Klinisch-psychiatrische Syndrome (Tics, Depression etc.) Umschriebene Entwicklungsstörungen (Legasthenie etc.) Intelligenzniveau Körperliche Symptomatik (sehen, hören etc.) Aktuelle abnorme psychosoziale Umstände Vorrang haben Affektive Störungen, Angststörungen und reaktive Störungen (bei plötzlichem Einsetzen); liegen sie vor, wird keine ADHS diagnostiziert, sondern lediglich eine durch diese Störungen bedingte Unruhe „attestiert“. Nachrangig sind dagegen Störungen des Sozialverhaltens. 10.1.4. Praktisches Vorgehen bei der Diagnose Grundsätzlich gilt: Viele ADHS-Symptome (Zappeln, übermäßiges Reden etc.) sind gerade bei jungen Kindern durchaus „normal“! Bei der Diagnose muss daher äußerst vorsichtig vorgegangen werden: zum einen muss immer der jeweilige Entwicklungsstand berücksichtigt werden, zum anderen sollte eine Diagnose nur bei wirklich extremen und hartnäckigen Fällen vergeben werden. Gerade Lehrer neigen dazu, Kinder vorschnell eine ADHS zu attestieren! Die Diagnostik bei ADHS umfasst mehrere Schritte: 1. Exploration (Befragung) der Eltern und der Erzieher/Lehrer: Welche Probleme liegen vor, in welchen Kontexten treten sie auf, wann haben sie begonnen etc. etc. Z.B. Conners-Fragebogen für Eltern, Lehrer und Erzieher: Beurteilung mehrerer Items auf einer 4-stufigen Skala (von „überhaupt nicht“ bis „sehr stark“) „Ist unruhig oder übermäßig aktiv.“; „Ist erregbar oder impulsiv“; „Ist unaufmerksam oder ablenkbar“; „Beendet angefangene Aufgaben nicht“ etc. etc. 2. Exploration des Kindes bzw. Jugendlichen Auch dafür stehen natürlich Fragebögen und standardisierte Interviews zur Verfügung 3. Testpsychologische Untersuchung und Verhaltensbeobachtung Intelligenztests, evtl. weitere Tests zum Abchecken von Komorbiditäten (Lese-Rechtschreibtests etc.) Spezifische Tests wie der „Continuous Performance Test“ (CPT), der sowohl die Daueraufmerksamkeit als auch die Impulsivität misst. Die Pbn bekommen dabei über längere Zeit verschiedene Buchstaben dargeboten und sollen, immer wenn auf ein „O“ ein „X“ folgt, mit einem Tastendruck reagieren (s.o.). Drücken sie den Knopf, ohne dass dem „X“ ein „O“ vorangegangen ist, spricht das für ihre Impulsivität (=> Unfähigkeit zur 123 Verhaltenshemmung); drücken sie die Taste nicht, obwohl sie müssten, spricht das für eine eingeschränkte Daueraufmerksamkeit! Einschub: Der CPT kann auch in ein „virtuelles Klassenzimmer“ integriert werden (die Buchstaben erscheinen dann auf der Tafel und es gibt ablenkende Reize); dadurch werden a) realitätsnähere Bedingungen geschaffen und b) die Möglichkeit eröffnet, Auslösefaktoren auszumachen. Noch handelt es sich dabei jedoch um ein Forschungsprojekt, das sich in der Diagnostik und Therapie noch nicht etabliert hat! 4. Körperliche / neurologische Untersuchung Seh- und Hörfähigkeit überprüfen, neurologische Ursachen ausschließen... Eine eingehende neurologische Untersuchung ist v.a. vor medikamentöser Behandlung erforderlich! 5. Verlaufskontrolle Wie wirkt die Therapie (Schulleistung, Verhalten in der Familie etc.)? 10.2. Theorien und Erklärungsmodelle 10.2.1. Ätiologiefaktoren Grundsätzlich gilt: Bei der Ätiologie von ADHS wird neurologischen und genetischen Faktoren i.d.R. mehr Einfluss zugeschrieben als psychologischen Faktoren. Biologische Ätiologiefaktoren: Es besteht eine genetische Prädisposition für ADHS: Die Konkordanzraten liegen bei eineiigen Zwillingen zwischen 55 und 70% und Kinder, deren Eltern ADHS haben, erkranken 8 Mal häufiger! Risikoallelle liegen u.a. auf dem Dopamintransporter-Gen (DAT1); einem Serotonintransporter-Gen, dem Gen MAO-A… Pränatale Einflüsse: Rauchen und Trinken während der Schwangerschaft wirken auf das dopaminerge System des Kindes und erhöhen die Wahrscheinlichkeit für ADHS um den Faktor 2 – 3! Lebensmittelzusatzstoffe: Von Feingold (1973) stammt die These, dass bestimmte Lebensmittelzusatzstoffe zur Entstehung von Hyperaktivität beitragen (sofern sie das Nervensystem beeinträchtigen); diese These war lange Zeit sehr populär ( Verschreibung zusatzstofffreier Diäten), gilt aber vermutlich nur für einen sehr kleinen Teil der Betroffenen ( nur äußerst wenige Kinder sprechen nämlich positiv auf die besagten Diäten an) Psychologische Ätiologiefaktoren Chronische Konfliktsituationen und verminderter familiärer Zusammenhalt Psychopathologische Auffälligkeiten auf Seiten der Eltern (insbes. der Mutter) Modelllernen Operantes Lernen (Hyperaktivität wird mit erhöhter Aufmerksamkeit belohnt) 124 10.2.2.: Integrative Modelle Das biopsychosoziale Modell nach Döpfner: geht von einer Wechselwirkung zwischen biologischen und psychosozialen Faktoren aus. 1. Genetische und erworbene biologische Faktoren führen zu Genetische Störungen der neuronalen Verarbeitung Faktoren Betroffen sind dabei insbesondere das dopaminerge und das noradrenerge System. Erworbene biol. 2. Störungen der Selbstregulation (=mangelnde Inhibition): Faktoren Einschränkung der Daueraufmerksamkeit und des Arbeitsgedächtnisses, mangelnde Impulskontrolle und vermehrte Suche nach neuen Reizen, schlechte Aufmerksamkeitslenkung, beeinträchtigte Affektregulation, Mangel an metakognitivem Wissen, Störungen der Handlungsorganisation. Zur Handlungsorganisation: Betroffene führen nur unvollständige Problem- und Zielanalysen durch, prüfen selten alternative Lösungsmöglichkeiten und sind kaum dazu in der Lage, ihr Verhalten strategisch zu planen. 3. ADHS-Symptomatik: Unaufmerksamkeit, Impulsivität, Hyperaktivität Ungünstige fam. 4. Negative Interaktionen mit Bezugspersonen und Umwelt: und schulische Misserfolge, Frustrationen, Sanktionen, soziale Isolation etc. Bedingungen 5. Komorbide Symptome: Leistungsstörungen, Aggression, emotionale Störungen Die komorbiden Symptome sind z.T. als ungeschickte Kompensationsversuche zu verstehen Das Endophänotypen-Konzept der ADHS: beschreibt die Störung auf 4 Ebenen Genotyp-Ebene: Bestimmte Varianten (Allele) des Dopamintransporter-Gens (DAT1), eines Serotonintransporter-Gens, des Gens MAO-A... Neurobiologische Ebene: Hypoplasie (Verkleinerung) und Hypofunktion des Frontallappens und des ventralen Striatums (beide Regionen sind entscheidend für die Exekutivfunktionen des Gehirns: Planung, Regulation von Emotionen, Impulskontrolle etc.) Dysregulation der dopaminergen und noradrinergen Aktivität Beeinträchtigung des Verstärkungssystems (mesolimbisches System, ventrales Striatum) Endophänotypenebene (Endophänotypen = psychologische Konstrukte) Exekutivsystem: inhibitorische Defizite bei der Impulskontrolle Exekutivsystem: Defizite bei der Regulation des zentralnervösen „Arousals“ [aufgrund neurobiologischer Defizite (s.o.) können die Betroffenen ihre zentralnervöse Aktiviertheit („Arousal“ bzw. „geistige Wachheit“) nicht oder nur unzureichend auf die Anforderungen der jeweiligen Situation ausrichten, so dass es immer wieder zu Phasen der Über- und Unteraktivierung kommt] Verstärkungssystem: „Delay-Aversion“ (ist ein Motivationsmuster, genaueres: s.u.) Manifestationsebene: Unaufmerksamkeit (insbes. gestörte Daueraufmerksamkeit) Hyperaktivität/Impulsivität Mischtypus 125 10.2.3.: Das 2-Pfad-Modell nach Sonuga-Barke Das 2-Pfad-Modell nach Sonuga-Barke (2003) führt ADHS einerseits auf ein gestörtes Verstärkungssystem (ventrales Striatum und mesolimbisches System), andererseits auf ein gestörtes Exekutivsystem (dorsales Striatum, Thalamus, Frontallappen) zurück. Verstärkungssystem: Verkürzter Verzögerungsgradient [ Elternverhalten ] Delay Aversion ADHS Genauer: Kinder mit ADHS weisen einen verkürzten Verzögerungsgradienten auf; sie haben also nur eine geringe Toleranz gegenüber Zeitverzögerungen und daher Probleme damit, eigene Reaktionen hinauszuschieben bzw. die Reaktionen anderer abzuwarten. Aus diesem Grund neigen sie entweder zu Impulsivität oder dazu, die Wartezeit zu überbrücken, indem sie z.B. ihre Aufmerksamkeit auf andere Reize richten (=> Unaufmerksamkeit/Hyperaktivität); diese Verhaltensweisen rufen negative Reaktionen hervor (Elternverhalten), die wiederum die „Delay Aversion“ verstärken. Letztere ist nichts anderes als eine extreme Abneigung gegenüber Belohnungsverzögerungen und –aufschüben; sie äußert sich etwa darin, dass Betroffene lieber sofort eine kleine Belohnung nehmen, als auf eine große zu warten. Exekutivsystem: Inhibitorische Defizite Exekutive Dysfunktionen (Planung, Impulskontrolle, Emotionsregulation etc.) ADHS Befunde zum Verstärkungssystem: Die Aktivierung im ventralen Striatum ist bei ADHS-Patienten während der Antizipation einer Belohnung (0$, 1$, 5$) insgesamt geringer und weniger von der Höhe der Belohnung abhängig als bei Kontrollprobanden. Die Amygdala-Aktivierung (deren Ausmaß als Hinweis für negative Emotionen interpretiert werden kann) ist bei ADHS-Patienten bei verzögerten Reizen deutlich höher als bei unmittelbar hintereinander dargebotenen. Bei Kontrollprobanden ist es umgekehrt! Befunde zum Exekutivsystem: ADHS-Patienten schneiden in Aufgaben zur Impulskontrolle (Go/No-GoTasks, Stop-Signal-Tasks) schlechter ab; darüber hinaus zeigen EEG- bzw. ERPUntersuchungen (ERP = Event-related Potenzial), dass ihre frontalen N2-Peaks (=Inhibitionsmerkmal) geringer ausfallen. 10.4. Zur Therapie von ADHS Grundsätzlich gilt, dass die Heterogenität des Störungsbilds ein stark individualisiertes Vorgehen notwendig macht. Insbes. vor medikamentöser Behandlung sind neurologische Untersuchungen vonnöten. An der Würzburger Uni-Klinik gibt‟s eine Spezialambulanz für ADHS! 10.4.1. Medikamentöse Therapie Bei ADHS werden v.a. 2 Arten von Medikamenten verschrieben: Stimulanzien (die die dopaminerge Aktivität erhöhen) und Noradrenergica (die die noradrenerge Aktivität erhöhen). 1) Stimulanzien: Das am häufigsten verschriebene Präparat ist Methylphenidat (Handelsnamen: Ritalin, Concerta etc.); darüber hinaus können Amphetamine verschrieben werden; die Wirkdauer von Methylphenidat liegt bei ca. 3h 126 (Retard: 7-12 h); für Erwachsene sind Stimulanzien nicht zugelassen, möglich ist jedoch eine „off-label“-Verschreibung (die Krankenkasse bezahlt bis zu einem Alter von max. 25 Jahren) Nebenwirkungen: Kopf- und Bauchschmerzen, Appetitminderung, Schlaflosigkeit, Benommenheit 2) Noradrenergica: das am häufigsten verschriebene Präparat ist Atomoxetin (ein selektiver Noradrenalin-Wiederaufnahme-Hemmer); weitere Präparate sind Desipramin und Clonidin; die Wirkdauer liegt bei ca. 12 h (nach 1-2 Wochen) Appetitminderung, Benommenheit, Dermatitis (Ekzeme), Dyspepsie (Verdauungsstörungen) Zur Wirksamkeit: Durch die genannten Medikamente kann die Konzentrationsfähigkeit und das störende Verhalten der betroffenen Kinder signifikant verbessert werden! Die Effektstärken liegen bei ca. 0.8! Nur ca. 10% reagieren nicht auf die Gabe von Stimulantien (sog. „NonResponder“) Es handelt sich bei der pharmakologischen Behandlung um eine symptomatische Behandlung ohne Ätiologiebezug. Warum genau die Medikamente wirken, ist nach wie vor unklar! 10.4.2. Verhaltenstherapie Probleme auf familiärer Ebene: Inkonsistente Erziehung, mangelnde Kontrolle, negative Beziehung Interventionen: Psychoedukation Eltern-Kind-Therapie: Verbesserung der Eltern-Kind-Interaktion durch wenige, aber dafür klare und konsequent durchgehaltene Regeln, die Einführung von Routinen und Ritualen, evtl. Einführung von Tokenprogrammen, geeignete Situationsgestaltung (geordneter Arbeitsplatz, Entfernung ablenkender Reize etc.) Eltern- bzw. Paartherapie Probleme auf der Ebene des Kindes: Hyperaktivität, Impulsivität, Aufmerksamkeitsstörung, Störungen des Sozialverhaltens, Schulleistungsstörungen Interventionen: Psychoedukation Spieltraining (genaues Hinschauen und Hinhören) Selbstinstruktionstraining („Halt! Stopp! Erst nachdenken!“; „Jetzt mache ich mir einen Plan!“; „Jetzt fange ich an!“ etc. etc.) Selbstmanagement (durch verbale Selbstinstruktion und Verstärkung) Probleme auf institutioneller Ebene (Schule/Kindergarten): negative LehrerSchüler-Beziehung, Disziplinprobleme, Misserfolge etc. Interventionen: Psychoedukation und Tipps an den Lehrer: Klar strukturierte Unterrichtsmaterialien, unmittelbares Feedback, Token-Programme etc. Wirksamkeit - nach der Kölner Multimodalen Interventionsstudie (COMIS): Durch VT können hyperkinetische, aggressive und emotionale Auffälligkeiten signifikant reduziert werden, wobei die gefundenen Effekte über 18 Monate hinweg stabil waren Rund 60% zeigen nach der Therapie nur noch minimale Verhaltensauffälligkeiten in der Schule und zuhause 127 30% benötigen11. zusätzlich Stimulanstherapie Angststörungen 11.1. Angststörungen allgemein 11.1.1. Allgemeines zu Emotionen: Paul Ekman postuliert 7 Basisemotionen; ihnen entsprechen jeweils spezifische Gesichtsausdrücke, die in allen Kulturen gleich sind (lediglich was das öffentliche Zeigen der Emotionen betrifft, gibt es kulturelle durch sog. „Display rules“ bedingte Unterschiede)! Die 7 Basisemotionen sind: 1. Freude 4) Angst 7) Verachtung 2. Trauer 5) Überraschung 3. Ärger 6) Ekel Manche halten auch Verlegenheit für eine Basisemotion! Circumplex-Modell der Emotionen (Russell): Die Verschiedenen Emotionen lassen sich anhand zweier Dimensionen (nämlich „Ruhe-Erregung“ und „Lust-Unlust“) kategorisieren: „Angst“ zeichnet sich z.B. durch ein Höchstmaß an Erregung und verhältnismäßig starke Unlust aus. „Besorgtheit“ ist im Vergleich dazu durch ein geringeres Maß an Erregung, dafür aber mehr Unlust gekennzeichnet. Zwei-Faktoren-Theorie der Emotion (Schachter und Singer): Welche Emotion durch einen Reiz ausgelöst wird und wie stark diese ist, hängt von 2 Faktoren ab: Die physiologische Erregung (Arousal) ist unspezifisch und bestimmt die Emotionsintensität; die kognitive Interpretation bzw. Attribution der Erregung bestimmt die Art der Emotion bzw. die Emotionsqualität. 11.1.2. Allgemeines zu Angst Unterschieden werden muss zwischen Angst und Furcht: Angst: ist eine ungerichtete (diffuse) motorische, peripher-physiologische, zentralnervöse und subjektive Überaktivierung bei der Antizipation von Gefahr! Furcht: ist eine spezifische motorische, peripher-physiologische, zentralnervöse und subjektive Reaktion bei der Identifikation einer Gefahr, die zur Auslösung einer Bewältigungsreaktion führt! Kurz: Furcht ist im Unterschied zur Angst objektbezogen und hat dementsprechend immer einen konkreten Anlass! Wie alle Emotionen äußert sich Angst bzw. Furcht auf 3 Ebenen: 1. Verbal-kognitive (= subjektive) Ebene Dazu zählt sowohl das kognitive als auch das emotionale Erleben! 2. Motorisch-behaviorale Ebene Mimik, Gestik, Vermeidungsverhalten etc. 3. Physiologische Ebene Z.B. Kortisolausschüttung etc. Von pathologischer Angst spricht man, wenn folgende Kriterien gegeben sind: Die Angstreaktionen des Betroffenen sind der Situation nicht angemessen. Die Angstreaktionen sind überdauernd (d.h. chronisch). Der Betroffene hat keine Möglichkeit, die Angst zu erklären, zu reduzieren oder zu bewältigen (Mangel an Copingstrategien). Die Angstreaktionen führen zu einer massiven Beeinträchtigung des Lebensvollzugs! 128 11.1.3. Neuronale Verarbeitung der Furcht Neuronale Verarbeitung von Furcht: Die Amygdala bildet das Zentrum der Furchtkonditionierung; hier werden CS (kortikal) und UCS (Amygdala) assoziativ miteinander verknüpft! Die Amgydala (auch Mandelkern genannt) ist ein paarig angelegtes Kerngebiet im medialen Teil des Temporallappens; sie ist Teil des limbischen Systems (zu dem darüber hinaus der Hippocampus, der Fornix, die Corpora mamillarae und der Gyrus Cinguli gehören) Traditionell ging man davon aus, dass sensorische Informationen im Neokortex semantisch interpretiert- und erst dann an die Amygdala weitergeleitet werden. LeDoux (1996) hat jedoch entdeckt, dass die Infos vom Thalamus auch direkt an die Amygdala weitergeleitet werden können („Low route“), weshalb zwischen 2 Arten der emotionalen Informationsverarbeitung zu unterscheiden ist: „Low Road“: Durch die direkte Weiterleitung emotional relevanter Infos vom Thalamus zur Amgydala wird der Körper in Alarmbereitschaft versetzt (wir schrecken vor einer Gummischlange oder einem Ast zurück, weil die Umrisse dieser Gegenstände Gefahr signalisieren) „High Road“: Erst in einem zweiten Schritt werden die sensorischen Infos im Neokortex genauer verarbeitet! Reiz „High road“ SENSORISCHER THALAMUS „Low Road” NEOKORTEX - Primärer sensorischer Kortex (Umrisse) - unimodaler Assoziationskortex (Objekte) - polymodaler Assoziationskortex AMYGDALA (Konzepte) (Kontexte) emotionale Wirkungen Entorhinaler Kortex Hippocampus Subiculum Outputsysteme der Amygdala: Die Informationen (Afferenzen) kommen im lateralen Nucleus der Amygdala an (s.o.) und werden von dort über den basalen Nucleus zum Zentralen Nucleus („Output-Kern“) der Amygdala weitergeleitet. AMYGDALA (Zentraler Nucleus) 1) Nucleus Reticularis Pontis caudalis Potenzierung des Startle-Reflexes 2) Dorsales zentrales Grau Verteidigung, Kampf, Flucht 4) Hypothalamus Autonomes Nervensystem Blutdruck, Herzrate,... 5) Locus coeruleus Noradrenalin (Vigilanz) 3) Ventrales zentrales Grau 6) Ventrales Tegmentum (VTA) „Freezing“ (Verhaltensstarre) Dopamin (Verhaltenserreg.) 129 Keine konditionierte Furcht ohne Amygdala: Anders als bei gesunden Tieren folgt bei Tieren ohne Amygdala keine SCR auf einen konditionierten Reiz (sondern nur auf den unkonditionierten). Bei Ratten ohne Amygdala kann der Startle-Reflex nicht potenziert werden! Bei einer Läsion der Amygdala führen weder explizite konditionierte Reize, noch konditionierte Kontextreize zu einer entsprechenden Reaktion; bei einer Kortexläsion erfolgt die konditionierte Reaktion sowohl auf Kontext- als auch auf explizite Reize (keine Beeinträchtigung); bei einer Läsion des Hippocampus ist nur die Reaktion auf Kontextreize beeinträchtigt! 11.1.4. Die 3 Ebenen der Angst/Furcht Verbal-kognitive Ebene: Emotionales Empfinden: Furcht vor bestimmten Stimuli; Erwartungsangst (Angst vor angstbesetzten Situationen); evtl. Ekel (z.B. bei Spinnenphobie); Hilflosigkeit etc. Gedanken, Befürchtungen und Fantasien, die meist „automatisch“ auftreten, nicht kontrollierbar erscheinen und sich immer wieder aufdrängen und das emotionale Erleben begleiten! Unterschieden wird zwischen Befürchtungen, die von einem Objekt bzw. einer Situation ausgehen (z.B. Angst vor öffentlichen Plätzen), und Befürchtungen, die sich auf die Furchtreaktion beziehen (Angst umzufallen). Kognitive Verzerrungen zugunsten der Verarbeitung furchtassoziierter Reize in Wahrnehmung, Gedächtnis und Bewertung (s.u.) Motorisch-behaviorale Ebene (=Verhaltensebene): Mimik, Gestik Vermeidungsstrategien (können offen oder verdeckt sein) Physiologische Ebene: Symptome des autonomen Nervensystems: Herzrate und –variabilität: beschleunigter Herzschlag; Palpitationen (bewusste Wahrnehmung des eigenen Herzschlags) Atmung: erhöhte Atemfrequenz (Kurzatmigkeit); Zunahme des CO2Partialdrucks (Atemnot; Erstickungsgefühle) Magen/Darm: Elektrogastrogramm (EGG) misst die Aktionspotenziale der Magenmuskulatur; bei Angst (z.B. Lügendetektor): Reduktion der Magenaktivität => Magen-Darm-Beschwerden; Übelkeit Haut: Hautleitfähigkeit (Skin Conductance Response) nimmt bei Angst zu (erhöhte Schweißproduktion); Parästhesien (Hitzewallungen, Kälteschauer, Kribbeln etc.) Protektive Reflexe: Schreckreflex (=Startle-Response) Hormonelle Veränderungen (Erhöhte Cortisolausschüttung; messbar am Cortisolgehalt im Speichel) Zentralnervöse Korrelate (EEG, fMRT) Untersuchungsbeispiele: 1. Tunnelphobiker und Kontrollprobanden werden in virtueller Realität mit furchtauslösenden Stimuli (geschlossener Tunnel, halboffener Tunnel = Galerie) konfrontiert; dabei werden zu verschiedenen Zeitpunkten sowohl physiologische Reaktionen (Herzrate, Schreckreflex), als auch die subjektive Reaktion (Angstrating von 1 bis 100) erfasst! Das subjektive Angstempfinden: nimmt bei Phobikern im Tunnel sukzessive zu (bis zu 70) und fällt danach schlagartig ab; in der Gallerie nimmt die Angst 130 im Vgl. zur offenen Straße zwar ebenfalls zu, fällt dann aber noch in der Gallerie allmählich ab. Die Herzrate (bpm: „beats per minute“): ist im Tunnel im Vergleich zur offenen Straße deutlich erhöht (ca. 66 bpm vs. 75 bpm) Der Schreckreflex fällt im Tunnel stärker aus als auf offener Straße und in der Gallerie! Fazit: Anhand des Angstratings und der Herzrate ist eine gute Trennung zwischen Phobikern und Kontrollpersonen möglich: 96% Sensitivität; 100% Selektivität; sprich: 96% der Phobiker werden als solche erkannt und kein Nicht-Phobiker wird zu Unrecht für einen gehalten. Angstrating: 93% Sensitivität; 100% Selektivität (Spezifität) Herzrate: 79% Sensitivität; 100% Selektivität Hautleitfähigkeit: n.s. 2. Spinnenphobikern, Flugphobikern und Kontrollprobanden werden neutrale und phobische Bilder (z.B. Pilze, Spinnen, Flugzeugabstürze) dargeboten; gemessen wird die Hautleitfähigkeit, der Schreckreflex und die Hirnaktivität (EEG) 11.1.5. Die verschiedenen Angststörungen Angststörungen lassen sich in 6 Hauptkategorien unterteilen (Vgl. DSM-IV und ICD-10): 1. Phobien: Angst vor Gegenständen, Situationen oder Plätzen, die keine objektive Gefahr darstellen. Spezifische Phobien Soziale Phobie Agoraphobie (tritt aber nur selten in Reinform auf, sondern meistens als eine Komponente der Panikstörung) 2. Panikstörung: Wiederholte Panikattacken mit plötzlichem Auftreten physiologischer Symptome (wie z.B. Schwindel, Herzrasen etc.) und panischer Angst Tritt meist zusammen mit Agoraphobie auf (s.u.) 3. Generalisierte Angststörung: Anhaltende unkontrollierbare Besorgnis, häufig über belanglose Dinge 4. Zwangsstörung: Die Erfahrung unkontrollierbarer Gedanken, Impulse oder Vorstellungen (Zwangsgedanken) und stereotyp ausgeführte Verhaltensweisen (Zwangshandlungen) 5. Posttraumatische Belastungsstörung: Angstzustände nach schwer belastenden Erlebnissen (erhöhte Erregbarkeit, Vermeidung bestimmter Reize etc.) 6. Akute Belastungsstörung: Die gleiche Symptomatik wie bei der posttraumatischen Belastungsstörung, aber kürzere Dauer (nur bis zu vier Wochen) Häufigkeit: Insgesamt leiden in Deutschland knapp 20% aller Frauen und ca. 9% aller Männer an einer Angststörung. Die häufigste Angststörung sind dabei spezifische Phobien Frauen: knapp 14% (Davison: 16%) Männer: ca. 6% (Davison: 7%) Soziale Phobien Frauen: knapp 4% Männer: rund 2% Panikstörungen Frauen: ca. 3% Männer: knapp 2% 131 Agoraphobie Frauen: ca. 3% Männer: ca. 1% Generalisierte Angststörung Frauen: ca. 2% Männer: ca. 1% Komorbidität: Angststörungen treten sehr häufig zusammen mit Depressionen und/oder Substanzmissbrauch auf. Das zeigen u.a. die „Münchener Follow-up-Studie“ (1981) und das „National Comorbidity Survey“ (1991)! Lebenszeitprävalenzen bei Generalisierter Angststörung: Depression: 50-60% Substanzmissbrauch: ca. 30% Lebenszeitprävalenzen bei spezifischen Phobien: Depression: ca. 40% Substanzmissbrauch: 20-30% Lebenszeitprävalenzen bei Panikstörungen: Depression: über 60% Substanzmissbrauch: 30-40% Lebenszeitprävalenzen bei posttraumatischer Belastungsstörung: Depression: knapp 50% Substanzmissbrauch: 50% In den allermeisten Fällen (ca. 80%) geht die Angststörung der Depression voraus (sekundäre depressive Episoden)! Erblichkeit: Angststörungen sind weniger erblich als z.B. Schizophrenie oder Depression! Trotzdem sind genetische Faktoren nicht völlig unbedeutend! Angststörungen, insbesondere Panikstörungen, treten familiär gehäuft auf (Odds ratios von 4 - 6); dass diese Häufig genetische Ursachen hat, wird durch Zwillingsstudien nahegelegt; Adoptionsstudien gibt es jedoch nicht! Die durch Vererbung erklärbare Varianz liegt für Angststörungen zw. 30 u. 40%; dieser Anteil ist signifikant geringer als z.B. für Schizophrenie oder Depression. Der größte Varianzanteil wird durch Umweltfaktoren erklärt! 132 11.2. Spezifische Phobien 11.2.1. Diagnostik und Epidemiologie Definition: Unter einer Phobie versteht man ein beeinträchtigendes, angstvermitteltes Vermeidungsverhalten, das in keinem Verhältnis zu der Gefahr steht, die von dem gemiedenen Gegenstand oder der gemiedenen Situation ausgeht, und das die Betroffenen auch als grundlos erkennen. Der Begriff „Phobie“ leitet sich vom griechischen Gott „Phobos“ ab, der seinen Feinden Angst machte! Im DSM IV werden 3 Arten von Phobien unterschieden: Spezifische Phobien (s.u.) Soziale Phobie: anhaltende, irrationale Angst vor sozialen Anforderungssituationen (z.B. Angst davor, in Gegenwart anderer zu essen, vor anderen zu sprechen etc.); beginnt meist im Kindes- und Jugendalter Agoraphobie (tritt meist zusammen mit der Panikstörung auf): Angst vor und Vermeidung von Orten und Situationen, aus denen eine Flucht schwierig wäre (z.B. Menschenmengen, öffentliche Plätze, U-Bahn, Warteschlangen etc.) Spezifische Phobien sind unbegründete Ängste, die durch spezifische Gegenstände oder Situationen bzw. deren Antizipation ausgelöst werden. Die DSM-Kriterien zur Diagnose spezifischer Phobien: A) Durch die Anwesenheit oder Erwartung eines spezifischen Objekts bzw. einer spezifischen Situation ausgelöste Furcht bzw. Angst B) Die Konfrontation mit dem phobischen Reiz löst fast immer eine unmittelbare Furchtreaktion aus, die die Form einer Panikattacke annehmen kann. C) Die Phobischen Reize werden vermieden oder nur mit starker Furcht ertragen. D) Die Person erkennt, dass die Angst/Furcht bzw. das Vermeiden übertrieben und unvernünftig ist! E) Ausgeprägtes Leiden und Beeinträchtigung der beruflichen und/oder privaten Funktionsfähigkeit! F) Bei Personen unter 18 Jahren hält die Furcht/Angst über mindestens 6 Monate an!“ Differentialdiagnose: Die Furcht/Angst darf nicht im Zusammenhang mit einer anderen psychischen Störung stehen, wie z.B.: mit Wahnvorstellungen oder Zwangsgedanken mit der Angst vor Verunreinigung (Zwangsstörung) mit der Angst vor Objekten/Situationen, mit denen der Patient traumatische Erfahrungen gemacht hat (Posttraumatische Belastungsstörung) mit der Vermeidung sozialer Situationen aufgrund der Angst vor Peinlichkeit (Sozialphobie) mit der Angst vor Panikattacken (Paniksyndrom) Je nach Auslöser können verschiedene Arten spezifischer Phobien unterschieden werden: Tier-Typus: z.B. Spinnenphobie, Schlangenphobie, Hundephobie etc. Umwelt-Typus: z.B. Angst vor Gewittern oder Dunkelheit Blut-Spritzen-Verletzungs-Typus Schulphobien 133 Situativer Typus: z.B. Angst vorm Autofahren, Tunneln, Fliegen, Höhen, engen Räumen usw. Acrophobie = Höhenangst Aviophobie = Flugangst Klaustrophobie = Platzangst Sonstiger Typus: Angst vor Erbrechen; Angst vorm Ersticken, Angst, lebendig begraben zu werden etc. etc. Epidemiologie: Spezifische Phobien sind die mit Abstand am häufigsten vorkommende Angststörung; ihre Lebenszeitprävalenz liegt für Frauen bei 16%, für Männer bei 7% Die am häufigsten auftretenden spezifischen Phobien sind Tierphobien! Verwandte ersten Grades von Indexfällen haben ein erhöhtes Erkrankungsrisiko, das gilt insbesondere für die Agoraphobie! 11.2.2. Ätiologie Zur Ätiologie von Phobien gibt es verschiedene Theorien: Nach Rachman gibt es 3 Möglichkeiten, eine Phobie zu erwerben; sie alle beruhen auf assoziativen Lernprozessen. 1. (Klassische und operante) Konditionierung 2. Stellvertretendes Lernen (Modelllernen) 3. Informationen In jüngerer Zeit wird betont, dass Phobien auch auf angeborenen Ängsten beruhen können und daher nicht unbedingt auf assoziativem Weg zustande kommen müssen (s.u.: Nicht-assoziative Modelle). Vier Modelle lassen sich unterscheiden: 1. Konditionierungsmodelle 2. Preparedness-Theorie 3. Nichtassoziative Modelle 4. Kognitive Modelle Konditionierungsmodelle: beruhen auf der 2-Faktoren-Theorie der Angst von Mowrer und Miller (s.o.); danach entstehen Phobien durch klassische Konditionierungsprozesse (1. Faktor => Akquisition) und werden durch operante Konditionierung aufrechterhalten (2. Faktor => Aufrechterhaltung); da das Vermeidungsverhalten negativ verstärkt wird, kann die konditionierte Angstreaktion nämlich nicht gelöscht werden! Beispiele: Hund (CS) + Hundebiss (UCS) Hundephobie; Party (CS) + Kotzen im Wohnzimmer (UCS) Soziale Phobie; Ratte (CS) + lautes Geräusch (UCS) Rattenphobie (Vgl. der kleine Albert!) Diathese-Stress-Modell: Nur bei Vulnerabilität bzw. Prädisposition (z.B. Neurotizismus) und zusätzlicher Stresserfahrung (z.B. Trauma) entsteht eine Phobie. Dabei gilt: Je geringer das Trauma (Biss, Kotzen etc.), desto größer muss die endogene Sensibilität sein, damit eine Phobie entstehen kann! Untersuchung von 7500 Zwillingen; erhoben wurde a) der Grad an Neurotizismus (als Marker für die endogene Sensibilität); b) Art und Ausmaß der Phobie (5 Subtypen) und c) mögliche Entstehungsursachen (schweres vs. leichtes Trauma; Beobachtung eines Traumas; Beobachtung von Furchtreaktionen; Anweisung/Information; keine Erinnerung bezüglich der Ursachen) 134 Hypothesen: Genetische Ursachen spielen eine Rolle! - Die Geschwister von Indexfällen, die sich an keine Ursache erinnern können, sollten daher überzufällig häufig ebenfalls unter einer Phobie leiden! - Wenn der phobische Indexpatient eine traumatische Ursache erinnert, sollte dessen Bruder bzw. Schwester dagegen kein erhöhtes Risiko für eine Phobie haben. - Sollte Neurotizismus tatsächlich eine Diathese sein, sollten v.a. die phobischen Pbn ohne Trauma hohe Neurotizismuswerte aufweisen! Ergebnisse: 49% (!) der phobischen Patienten hatten keine Ursachenerinnerung und lediglich 36% erinnerten sich an ein erlebtes Trauma. Dieser Befund widerspricht der Konditionierungshypothese! Auch der Zusammenhang zwischen endogener Sensibilität und Erblichkeit (Hypothesen a und b) konnte nicht bestätigt werden. Ergo: Das Diathese-Stress-Modell, das von einer Wechselwirkung zwischen angeborener Sensibilität und Konditionierungsprozessen ausgeht, ist zwar plausibel, vermag die Entstehung von Phobien aber nicht hinreichend zu erklären! Preparedness-Theorie oder Theorie des vorbereiteten Lernens (Seligman): Nicht alle Reize können gleich gut konditioniert werden. Stattdessen besteht für manche Reize (z.B. Spinnen, Schlangen, Dunkelheit oder Höhe) eine evolutionär bedingte und dementsprechend angeborene Lernbereitschaft („preparedness“). „Neutrale“ Reize, die sich leicht mit aversiven Reizen assoziieren lassen, sind durch folgende Charakteristika gekennzeichnet: 1. Rasche Aneignung von (phobischem) Vermeidungsverhalten, oft schon nach einmaliger Konfrontation („ease of acquisition“) 2. Erhöhte Löschungsresistenz („resistance to extinction“) 3. Vorbereitete Assoziationen können durch kognitive Instruktionen nur wenig beeinflusst werden; vorbereitetes Lernen wird daher als eine primitive, nonkognitive Lernform interpretiert („irrationality“) Die Theorie des vorbereiteten Lernens wird durch verschiedene empirische Befunde gestützt: Wird Ratten nach dem Konsum eines süßen Getränks ein Elektroschock verpasst, meiden sie in der Testphase zwar den Trinkbehälter, an dem wie in der Konditionierungsphase ein Licht und ein Lautsprecher angebracht sind; sie assoziieren den Schock jedoch nicht mit dem Geschmack des Getränks, sondern trinken auch in der Testphase das gesüßte Wasser. Bei Ratten, bei denen mit Hilfe von Röntgenstrahlen Übelkeit induziert wurde, ist es dagegen umgekehrt: Sie präferieren in der Testphase das ungesüßte Wasser (Geschmack) und ignorieren Licht und Ton! Kurz: Ratten lernen zwar schnell, Geschmack mit Übelkeit zu assoziieren (Preparedness), nicht aber mit einem Stromschlag! Diskriminatives Konditionieren: In der einen Versuchsgruppe werden neutrale Reize (z.B. Pilzbilder) an einen aversiven Reiz gekoppelt, angstrelevante Reize (z.B. Spinnenbilder) dagegen nicht („normales“ Lernen); in der anderen Versuchsgruppe ist es umgekehrt (vorbereitetes Lernen) 135 Die Ergebnisse bestätigen die Preparedness-Theorie: Bei angstrelevanten Reizen wird die CR (Finger-Puls-Volumen) schneller gelernt und ist schwerer zu löschen! Emotionsauslösung ohne bewusste Ursache: Furchtreaktionen können unbewusst ausgelöst werden. Der erste empirische Hinweis auf ein implizites (unbewusstes) Furchtgedächtnis stammt von Edouard Claparède (1873-1940): Er stach einen Amnesiepatienten bei der Begrüßung mit einem Reißnagel in die Hand; bei darauffolgenden Treffen mit dem Patienten hatte dieser zwar keine explizite Erinnerung an das vorangegangene Treffen, verweigerte aber den Handschlag! Öhman et al. (1997): Schlangen-Phobikern, Spinnen-Phobikern und Kontrollprobanden wurden verschiedene Bilder (Schlangen-, Spinnen- und neutrale Bilder) dargeboten, allerdings nur für so kurze Zeit, dass sie diese nicht bewusst wahrnehmen konnten (subliminale Reizdarbietung): Bild SOA (Stimulus Onset Asynchrony): 13-30 Ms Maskierungsreiz Ergebnis: Obwohl die Pbn die Bilder nicht bewusst wahrnehmen konnten, zeigten die Spinnen-Phobiker bei Spinnenbildern und die Schlangen-Phobiker bei Schlangenbildern eine erhöhte Hautleitfähigkeit (z.T. war die Reaktion sogar noch deutlicher als bei bewusster Wahrnehmung!) Interpretation: Phobische Reize werden automatisch (unbewusst) verarbeitet! Vgl. LeDoux‟s „Low Road“! Kritik: Es gibt Hinweise, dass Phobiker phobische Reize schneller erkennen als Nicht-Phobiker; evtl. haben sie die Bilder also doch bewusst wahrgenommen! Modelllernen: Phobische Reaktionen können nicht nur durch eine unangenehme Erfahrung mit dem gefürchteten Gegenstand oder der gefürchteten Situation erlernt werden, sondern auch durch Nachahmung der Reaktion anderer. Kleinkinder zeigen ursprünglich keine Angst vor Schlangen oder Spinnen. Sie scheinen diese erst durch Beobachtung und Informationen „beigebracht“ zu bekommen. Gerull (2002): Kleinkinder bekommen eine Gummischlange und eine Gummispinne dargeboten; die anwesende Mutter reagiert darauf entweder mit positivem (fröhlich, ermutigend) oder negativem emotionalen Ausdruck (Ekel, Furcht)! Ergebnis: Nach negativer Reaktion der Mutter zeigen die Kinder (insbes. Mädchen) bei erneuter Darbietung der Gegenstände stärkere Furcht- und Vermeidungsreaktionen Interpretation: Furcht wird durch Modelllernen bzw. „Social referencing“ gelernt! Ähnliche Befunde gibt es aus Tierversuchen: Mineka: Rhesusaffen, die im Labor aufgewachsen sind, zeigen keine Angst vor Schlangen; bietet man ihnen jedoch Videos dar, in denen andere Affen sich vor einer Schlange fürchten, zeigen sie danach ebenfalls Angst vor Schlangen. Interessant: Werden Videos dargeboten, in denen sich die anderen Affen vor einem neutralen Reiz (nämlich Blumen) fürchten, überträgt sich diese Furcht nicht. Ergo: Genetische Prädisposition und Modellernen wirken zusammen! 136 Lernen durch Information: Phobien können auch durch Informationen über den betreffenden Gegenstand bzw. die betreffende Situation erzeugt werden. Kinder zwischen 6 und 9 Jahren bekommen Bilder von 3 unbekannten australischen Tieren gezeigt, dabei werden ihnen zu den Bildern entweder positive, negative oder keine Informationen gegeben (kurze Geschichte). AVn: a) Einstellungsfragebogen; b) Impliziter Assoziationstest (IAT); Vermeidungsverhalten (Touch box) direkt nach der Geschichte! Ergebnis: Signifikante Beeinflussung aller abhängigen Variablen durch positive und negative Informationen! Interpretation: an sich wenig überraschend; interessant ist jedoch der Aspekt, dass durch explizite Infos auch implizite, sprich: unbewusste, Einstellungen verändert werden können! Nicht-assoziative Modelle: gehen davon aus, dass die meisten Phobien evolutionär bedingt sind; die ihnen zugrunde liegenden Ängste sind dementsprechend angeboren (Angst vor Vergiftung etc.) und ihrem Ursprung nach adaptiv; ob sie sich zu einer Phobie entwickeln, hängt davon ab, wie oft man in einer kritischen Phase mit den betreffenden Reizen (z.B. Schlangen) konfrontiert wurde. Bei ungenügender Exposition kommt es zu keiner Habituation; die Folge ist eine Phobie! Bedenkt man, dass phobische Ängste ihrem Ursprung nach adaptiv sind, ist eher eine „Hypophobia“ (Mangel an Angst) problematisch! Empirische Belege für die nicht-assoziative Theorie bieten sowohl retrospektive als auch prospektive Studien: Retrospektive Fragebogenstudie: zeigt, dass sich die meisten Phobiker nicht an ein Konditionierungserlebnis erinnern können. Problem: mögliche retrospektive Verzerrungen (Erinnerungsverzerrungen, Neubewertungen etc.) Höhenphobie: 56% non-assoziative Entstehung; 11% Konditionierungserlebnis; außerdem: Nicht-ängstliche Personen hatten insgesamt mehr schmerzhafte Stürze und Verletzungen! Spinnenphobie: Unter 228 Befragten nur 3 mit direktem Konditionierungserlebnis Wasserphobie (Elternbefragung): 56% der Eltern geben an, ihr Kind hätte schon immer Angst vor Wasser gehabt ( Konditionierung) Prospektive Studie (von Dunedin): Mehrfache Untersuchung von über 1000 Kindern (und zwar von Geburt an bis zum 18. LJ)! Höhenphobie: Stürze mit Brüchen, Verrenkungen und ernsthaften Verletzungen bis zum Alter von 9 Jahren reduzieren die Wahrscheinlichkeit einer späteren Phobie (mit 18 Jahren)! Wasserphobie: Schwimmerlebnisse bis zum 9. Lebensjahr sind nicht mit einer Wasserphobie mit 18 Jahren assoziiert! Aber: Karies bis zum Alter von 15 Jahren ist ein Prädiktor für eine Zahnarztphobie im Alter von 18 Jahren; hier scheinen Konditionierungsprozesse also sehr wohl eine Rolle zu spielen! Kognitive Theorien: führen Phobien auf kognitive Verzerrungen bei der Verarbeitung emotional relevanter Reize zurück; solche Verzerrungen fungieren dabei nicht nur als Diathese, sondern führen zugleich zur Aufrechterhaltung einer Phobie. Die wichtigsten Paradigmen zur Erfassung kognitiver Verzerrungen sind: a) der (emotionale) Stroop-Test; b) das Dot-Probe-Paradigma; c) Suchaufgaben (s.u.: „spider in the grass“); d) Blickbewegungsmessung und e) der implizite Assoziationstest (IAT) 137 4 Arten von Verzerrungen können unterschieden werden: 1) Der Aufmerksamkeitsbias; 2) der Erwartungsbias; 3) der Kovariationsbias und 4) der Gedächtnisbias! Fazit: Eine einheitliche Erklärung für die Entstehung von Phobien gibt es nicht! Konditionierungsprozesse scheinen nur für bestimmte Phobien (z.B. Zahnarztphobie) verantwortlich zu sein. 1. Führt nicht jedes Trauma zu einer Phobie 2. Haben nur wenige Phobiker tatsächlich ein traumatisches Ereignis erlebt! 3. Können nicht alle Phobien gleich gut konditioniert werden (angeborene Lernbereitschaften) Dasselbe gilt für mangelnde Habituation aufgrund fehlender Exposition; auch dieser Mechanismus kann keineswegs alle Phobien erklären! 11.2.3. Kognitive Verzerrungen Die Ausrichtung der selektiven Aufmerksamkeit kann aktiv (= zielgerichtet und willentlich kontrolliert) oder passiv (= reizgesteuert und unwillkürlich) erfolgen! In letzterem Fall spricht man vom Pop-out-Effekt! Er tritt u.a. bei bedrohlichen Reizen auf (und ist in diesem Fall adaptiv, sofern er die Überlebenswahrscheinlichkeit erhöht)! Aufmerksamkeitsbias: Alle Menschen haben die Tendenz, phylogenetisch furchtbesetzte Reize (wie Spinnen oder Schlangen) schneller wahrzunehmen als neutrale Reize (Pop-outPhänomen!) Öhman: „Snake in the grass“ (Suchaufgabe) Phobische und nicht-phobische Vpn bekommen eine 2 x 2 oder 3 x 3 Matrix mit Bildern von Schlangen, Spinnen, Blumen und Pilzen dargeboten und sollen mit einem Tastendruck reagieren, wenn der Targetreiz enthalten ist; letzterer ist entweder ein neutraler Reiz oder ein angstbesetzter Reiz! Ergebnisse: - Sowohl hochängstliche als auch niedrigängstliche Vpn finden den angstrelevanten Reiz in der 3 x 3-Matrix genauso schnell wie in der 2 x 2-Matrix; bei neutralen Reizen brauchen sie bei der 3 x 3-Matrix dagegen länger (serielle Suche)! - Hochängstliche Vpn sind dabei, wenn das Target ein angstbesetzter Reiz ist, noch schneller als niedrigängstliche! Interpretation: Es gibt einen allgemeinen Pop-Out-Effekt für phylogenetisch angstbesetzte Reize; sie werden nicht seriell, sondern parallel gesucht! Phobiker haben Probleme damit, den emotionalen Gehalt phobischer Reize zu ignorieren (die „Neutral target representation“ wird durch die „threat representation“ gehemmt). Emotionaler Stroop-Test: Spinnen-Phobiker brauchen im Vgl. zu Kontrollprobanden und neutralen Wörtern signifikant länger, wenn sie die Farbe von Wörtern benennen sollen, die mit dem Begriff „Spinne“ assoziiert sind (z.B. „Spinne“, „haarig“, „Tarantel“ etc.). Hohe State- und Trait-Angst führt zu einer Verzerrung der selektiven Aufmerksamkeit hin zu angstbesetzten Reizen! Dot-Probe I: Vpn bekommen für kurze Zeit (ca. 500ms) zwei Bilder dargeboten, eines davon ist neutral (z.B. Pilz), eines ist angstbesetzt (z.B. Spinne); Aufgabe der Vpn ist es, auf einen unmittelbar nach den Bildern in einer der beiden Bildschirmhälften erscheinenden Reiz (z.B. einen Punkt) 138 mit einem entsprechenden Tastendruck zu reagieren. Erscheint dieser Reiz hinter dem Bild, auf das der Pb zuvor seine Aufmerksamkeit gerichtet hatte, gelingt ihm das schneller! Ergebnis: Ängstliche Vpn reagieren signifikant schneller, wenn der der Punkt an der Stelle erscheint, an der zuvor der angstbesetzte Reiz eingeblendet wurde. Dot-Probe II: Um zu testen, ob dieser Effekt auf erhöhte Vigilanz für bedrohliche Reize oder reduziertes „Disengagement“ zurückzuführen ist, wird lediglich ein Bild verwendet. Ergebnis: Ursache oder Wirkung: Sind Aufmerksamkeitsverzerrungen nur ein Epiphänomen emotionaler Zustände oder verursachen sie diese?! Die empirischen Befunde sprechen eher für letzteres. Dreistufige Untersuchung (Mathews & MacLeod, 2002): 1. Prä-Test: Dot-Probe Task und Stresstest (30 Anagramme unter Zeitdruck lösen + Befindlichkeitstest!) 2. Lernphase: Dot-Probe-Task, wobei der Dot entweder immer hinter dem bedrohlichen oder hinter dem neutralen Reiz erscheint (experimentelle Manipulation der Aufmerksamkeitsausrichtung!) 3. Post-Test: Dot-Probe-Task (mit neuen Reizen) und Stresstest (s.o.) Ergebnisse: a) Die Lerndurchgänge hatten deutlichen Einfluss auf die die Aufmerksamkeit, nicht aber auf die Stimmung und Angst! b) ABER: Wenn der Dot in der Lernphase immer hinter dem bedrohlichen Reiz erschien, zeigten die Pbn eine erhöhte Stressreaktion im Stresstest; umgekehrt konnte die Trait-Angst hochängstlicher Patienten reduziert werden, indem der Dot in der Lernphase immer hinter dem neutralen Reiz erschien. Interpretation: Aufmerksamkeitsprozesse haben einen Einfluss auf die Stressverarbeitung, woraus folgt, dass sie zumindest indirekt zur Entstehung und Aufrechterhaltung von Angststörungen beitragen! Hypervigilanz-Vermeidungs-Hypothese: Der Umgang mit phobischen Reizen erfolgt bei Phobikern in zwei zeitlich aufeinander folgenden Schritten: Auf anfängliche Hypervigilanz (Aufmerksamkeitsfokussierung auf bedrohliche Reize) folgt der Versuch, die bedrohlichen Reize zu vermeiden. Durch Eye-Tracking-Studien (bei denen die Pbn z.B. Spinnen suchen müssen) wird die Hypervigilanz-Vermeidungshypothese bestätigt. Kovariationsbias: Pbn bekommen neutrale und phobische Bilder gezeigt (z.B. Pilze, Spinne, Flugzeugabsturz), denen jeweils in 50% der Fälle ein lauter Ton folgt, um einen Startle-Reflex auszulösen. Zur Überprüfung des Kovariationsbias werden die Pbn anschließend gefragt, wie oft nach den einzelnen Bildern der Ton kam. Mühlberger et al.: Der Kovariationsbias tritt lediglich bei Spinnenphobikern (phylogenetische Phobie), nicht aber bei Flugphobikern (ontogenetische Phobie) auf! 139 11.2.4. Therapie Generell gilt: Patienten mit spezifischen Phobien begeben sich eher selten in Behandlung (meist nur, wenn ein konkreter Anlass vorliegt); die Behandlungsmöglichkeiten bei spezifischen Phobien sind jedoch äußerst effektiv. Verblüffend: Öst behauptet, er brauche bei den meisten spezifischen Phobien nur 2 bis 7 Stunden, um sie zu heilen! Die am häufigsten angewandten Therapiemethoden sind: Systematische Desensibilisierung (nach Wolpe) Konfrontationstherapie (in vivo oder virtuell) Flooding Teilnehmendes Modelllernen 140 11.3. Panikstörung und Agoraphobie 11.3.1. Darstellung des Störungsbildes Panikstörung und Agoraphobie sind eng miteinander verknüpft! Ca. 2/3 aller Panikstörungen gehen mit einer Agoraphobie einher! Die Betroffenen meiden bestimmte Situationen, weil sie befürchten dort eine Panikattacke zu bekommen („Angst vor der Angst“). Umgekehrt geht auch die Agoraphobie meist mit Panikattacken, in jedem Fall aber mit Paniksymptomen einher! Sowohl mit als auch ohne Panikstörung geht die Agoraphobie mit der Angst vor einer Attacke einher. Im ICD 10 wird zwischen Agoraphobie mit und ohne Panikstörung unterschieden (F 40) und einer reinen Panikstörung (F 41) unterschieden; im DSM IV zwischen Panikstörung mit und ohne Agoraphobie und Agoraphobie ohne Panikstörung. IM ICD-10 wird dementsprechend die Panikstörung-, im DSM IV die Agoraphobie etwas höher gewichtet; dieser Unterschied ist jedoch marginal! Definition: Eine Panikstörung ist durch plötzliche und unerklärliche (= situationsunabhängige) Panikattacken gekennzeichnet; letztere umfassen einerseits somatische Symptome wie Herzrasen, Atemnot, Übelkeit, Schwindel oder Schweißausbrüche, andererseits kognitive Komponenten wie die Furcht vor Kontrollverlust oder sogar Todesangst; hinzu kommen können außerdem Gefühle der Depersonalisation und Derealisation! Klassifikationskriterien nach der ICD-10: Wiederholte Panikanfälle, die oft spontan auftreten und nicht ausschließlich auf eine spezifische Situation, ein spezifisches Objekt, eine reale Gefahr oder besondere Anstrengungen bezogen sind. Die besagten Attacken beginnen abrupt, erreichen innerhalb weniger Minuten ihren Höhepunkt und klingen meist nach einigen Minuten wieder ab. Sie können u.a. folgende Symptome umfassen (mindestens vier!): Palpitationen, erhöhte Herzfrequenz Schweißausbrüche Fein- oder grobschlägiger Tremor Mundtrockenheit Atembeschwerden Beklemmungsgefühl Thoraxschmerzen Derealisation oder Depersonalisation Angst vor Kontrollverlust oder verrückt zu werden Angst zu sterben … Mittelgradige Panikstörung (F 41.00): mindestens 4 Panikattacken in 4 Wochen Schwere Panikstörung (F41.01): mindestens 4 Panikattacken pro Woche über einen Zeitraum von 4 Wochen Anmerkung: Über 80% der Patienten mit einer anderen Angststörung (z.B. einer spezifischen Phobie) erleben ebenfalls Panikattacken, aber nicht so häufig und spontan, dass die Diagnose einer Panikstörung gerechtfertigt wäre! 141 Definition: Unter Agoraphobie versteht man die Angst vor weiten oder öffentlichen Plätzen (griech. „agora“ = „Marktplatz“) bzw. davor, keine Fluchtmöglichkeit zu haben (z.B. in der Mitte eines Kinos) oder im Notfall keine Hilfe zu bekommen (z.B. auf Flugreisen oder im Wald). Klassifikationskriterien nach der ICD-10: Eine deutliche und anhaltende Furcht vor oder Vermeidung von mindestens 2 der folgenden Situationen: Menschenmengen (z.B. Warteschlangen, Einkaufsstraßen etc.) Öffentliche Plätze (z.B. Supermarkt, Kino, Straßenbahn etc.) Alleine Reisen Reisen mit weiter Entfernung von Zuhause Mindestens ein Mal nach Beginn der Störung müssen mindestens zwei Angstsymptome der Panik-Symptome (s.o.) gleichzeitig vorhanden gewesen sein – und zwar im Zusammenhang mit den gefürchteten Situationen (s.o.) Anmerkungen: Agoraphobiker verlassen, wenn überhaupt, nur selten ihre Wohnung, brauchen meist Begleitung, achten darauf, möglichst immer Medikamente oder die Telefonnummer des Arztes bei sich zu haben („Sicherheitssignale“) etc. etc. 11.3.2. Diagnostik Differentialdiagnose: Abgrenzung von anderen Angststörungen: Da Panikattacken auch bei anderen Angststörungen auftreten (s.o.: in 80% der Fälle!), ist es wichtig, a) die Häufigkeit der Attacken zu beachten und b) ihren Kontext und zentrale Befürchtungen herauszuarbeiten! Panikstörung: Angst vor körperlichen und/oder geistigen „Katastrophen“ („Ich werde sterben!“; „Ich werde verrückt!“) Soziale Phobie: Angst vor Bewertung und Blamage Spezifische Phobien: Angst vor spezifischen Situationen (situationsgebundene Befürchtungen) PTSD: Angst vor Reizen und Situationen, die an das Trauma erinnern Zwangsstörung: Angst für Objekt der Zwangsvorstellung! Die Abgrenzung von organischen Erkrankungen: ist bei der Panikstörung besonders wichtig, da sie sich v.a. in physiologischen Symptomen äußert und die meisten Patienten von einer physiologischen Ursache überzeugt sind! Hier nur einige Beispiele, was alles ausgeschlossen werden muss: Lungenerkrankungen (Atemnot, Enge-Gefühl etc.) => Röntgen und internistische Untersuchung Hyperthyreose (Schilddrüsenüberfunktion: Herzklopfen, Schwitzen, Angst, Atemnot etc.) => Laboruntersuchung Herzinfarkt (Brustschmerzen, Unruhe, Atemnot, Vernichtungsgefühl etc.) … Diagnostische Messinstrumente (klinische Fragebögen): „Agoraphobic Cognitions Questionnaire“ (Ehlers & Margraf): Fragebogen zu angstbezogenen Kognitionen, z.B. bezüglich körperlicher Krisen, Kontrollverlust oder Vermeidung. Wie oft („nie“ bis „immer“) haben sie folgende Gedanken, wenn sie nervös bzw. ängstlich sind: „Ich muss mich gleich übergeben!“; „Ich muss einen Hirntumor haben!“ etc. 142 „Body Sensations Questionnaire“ (Ehlers & Margraf): Fragebogen zur Angst vor körperlichen Symptomen Wie viel Angst („gar nicht“ bis „extrem“) haben sie vor folgenden Empfindungen: Herzklopfen, Taubheit in Armen und Beinen etc. „Angst-Sensitivitäts-Index“ (ASI): misst ebenfalls, wie ängstlich Menschen auf ihre körperlichen Empfindungen reagieren. „Ungewöhnliche Körperempfindungen machen mir Angst“; „Ich bekomme Angst, wenn ich mich schwach fühle“ etc. „Mobilitätsinventar“ (Ehlers & Margraf): misst das Ausmaß agoraphobischen Vermeidungsverhaltens. Pbn müssen anhand einer 5-stufigen Skala (von „niemals“ bis „immer“) angeben, wie oft sie bestimmte Orte (z.B. Kinos oder Theater, Supermärkte etc.) alleine und in Begleitung vermeiden! „Marburger Angst- und Aktivitäts-Tagebuch“ (Margraf & Schneider): misst a) Anzahl und Ausmaß der Panikattacken, b) globales Angstniveau und c) das Ausmaß an Aktivitäten! a) Panikanfälle: Wann und in welcher Situation traten sie auf? Wie viele und welche Symptome traten auf? Was waren die ersten Anzeichen? etc. etc. b) Tagesbewertung: durchschnittliche Augst auf einer Skala von 1 bis 10 c) Aktivitätstagebuch: ist v.a. deshalb wichtig, weil die Angst oft durch agoraphobisches Vermeidungsverhalten, nicht aber durch Genesung ausbleibt; erfasst wird, wann mit wem was gemacht wurde und wie groß die Angst dabei war! Angst-Tagebuch ist v.a. deshalb wichtig, weil bei der nachträglichen Beschreibung von Panikattacken meist retrospektive Verzerrungen auftreten: v.a. bei Fragebögen, aber auch bei Interviews wird die Anzahl der Symptome im Nachhinein überschätzt! Darüber hinaus haben Tagebücher nicht nur eine diagnostische, sondern auch eine therapeutische Funktion! 11.3.3. Epidemiologie und Verlauf Epidemiologie: Patienten mit Panikstörung und/oder Agoraphobie machen den größten Anteil an Panikpatienten aus. Die Lebenszeitprävalenz liegt für die Panikstörung zwischen 2 und 3%, für Agoraphobie (mit und ohne Panikstörung) bei 5,7%. Das Geschlechterverhältnis (Frauen : Männer) liegt in etwa bei 2 : 1 Verlauf: Der Krankheitsbeginn ist variabel, liegt aber meist zwischen 20 und 30 Jahren; bei Männern gibt es was Panikattacken betrifft einen zweiten Peak nach dem 40. Lebensjahr! In 80% der Fälle gehen dem erstmaligen Auftreten einer Panikstörung schwerwiegende Lebensereignisse voraus! Prognose: Eher schlecht; nur in rund 14% der Fälle kommt es zu einer Spontanremission Komorbidität: Nur eine Minderheit der Panikpatienten (rund 14%) weisen keine Komorbidität auf! Am häufigsten sind: - Affektive Störungen 71, 4% - Alkoholmissbrauch: 50% - Medikamentenmissbrauch: rund 29% 143 11.3.4. Ätiologie Das psychophysiologische Modell der Panikstörung (von Ehlers und Margraf): beschreibt die Entstehung von Panik als einen durch positive Rückkopplung vermittelten Teufelskreis: Ein Anfall beginnt in der Regel mit körperlichen (Schwindel, Herzrasen etc.) und/oder psychischen Veränderungen (Gedankenrasen, Attribution von Kontrollverlust etc.), die ihrerseits durch interne oder externe Stressoren hervorgerufen werden. Diese Veränderungen werden wahrgenommen und mit Gefahr assoziiert, woraufhin der Betroffene mit Angst bzw. Panik reagiert, was wiederum mit physischen und/oder psychischen Veränderungen einhergeht, die als solche wahrgenommen und erneut mit Gefahr assoziiert werden etc. etc. Konkretes Beispiel: Wahrnehmung des eigenen (normalen) Herzschlags => Assoziation mit Gefahr => Angst => Erhöhung der Herzrate => … Die physiologischen Reaktionen von Panikpatienten auf Stresssituationen unterscheiden sich kaum von denen gesunder Personen; sie interpretieren diese lediglich anders! Beeinflusst wird dieser Prozess außerdem durch individuelle Prädispositionen (z.B. Interozeptionsfähigkeit; Angstsensitivität etc.) und situative Faktoren (z.B. Hitze, Koffein etc.). In diesem Sinn ist das psychophysiologische Modell ein Diathese-StressModell! Beendet wird eine Attacke entweder durch Bewältigungsstrategien (Vermeidung, Hilfe suchen etc.) oder durch negative Rückkopplungsprozesse (Habituation, Ermüdung), die irgendwann automatisch einsetzen, allerdings sehr viel langsamer vonstatten gehen als die positive Rückkopplung zwischen Panik und psychischen bzw. physischen Veränderungen! Die Zwei-Faktoren-Theorie der Angst (von Mowrer und Miller) wird auch zur Erklärung der Agoraphobie herangezogen. Erweiterung der Zwei-Faktoren-Theorie durch Chambless & Goldstein: Agoraphobiker haben nur selten Angst vor einer Situation als solcher (einfache Form); stattdessen ist es meist die „Angst vor der Angst“ (komplexe Form), die sie umtreibt. Sie meiden z.B. öffentliche Orte meistens nur deshalb, weil sie Angst davor haben, dort eine Panikattacke zu erleiden! Ein wichtiger Faktor bei der Entstehung von Panikattacken ist die „Angstsensitivität“ einer Person. Man versteht darunter, die Tendenz, körperliche Empfindungen als Hinweis auf Bedrohung oder Krankheit zu werten und dementsprechend ängstlich darauf zu reagieren! Schmidt et al. (1997): Angehenden US-Soldaten wurde vor der Grundausbildung der ASI vorgelegt und die erzielten Werte zum späteren Stressempfinden (Anzahl der Panikattacken, Angstund Depressionsfragebogen etc.) in Bezug gesetzt. Die Pbn, die hohe ASI-Werte hatten, hatten auch in den späteren StressMessungen signifikant höhere Werte; insbesondere die Frequenz von Panikattacken ließ sich durch Werte auf dem ASI vorhersagen! Kognitive Verzerrungen bei Panikpatienten: Aufmerksamkeitsbias: Stroop-Test: Panikpatienten brauchen bei der Farbbenennung länger als Kontrollprobanden, wenn die Wörter sich auf Angst, körperliche Empfindungen oder Katastrophen beziehen. Am deutlichsten ist die Verzögerung bei Katastrophenwörtern! 144 Erwartungs- und Kovariationsbias: Pbn bekommen Bilder aus 4 unterschiedlichen Kategorien (Erotik, neutral, Spinnen, Unfälle) gezeigt, die in 50% der Fälle von einem lauten Ton begleitet werden; dabei sollen sie einmal vorab (Erwartungsbias) und einmal danach (Kovariationsbias) einschätzen, bei welchen Bildern der Ton am häufigsten auftritt. Ergebnis: Sowohl a priori als auch a posteriori überschätzen Panikpatienten die Kovariatin bei Unfallbildern! Biologische Theorien und Thesen: Die Tatsache, dass Panikstörungen familiär gehäuft auftreten sowie die Tatsache, dass die Konkordanz bei monozygoten Zwillingen höher ist als bei dizygoten, sprechen für eine genetische Diathese! Panik wird durch eine übermäßige Aktivität der noradrenergen Systems verursacht. Die Stimulation des Locus coeruleus (im Pons gelegen) scheint bei Affen Panikattacken auszulösen. ABER: Substanzen, die die Aktivität des Locus coeruleus blockieren, haben sich bei der Behandlung von Panikstörungen bisher nicht als wirksam erwiesen! Ley: Panikattacken werden durch Hyperventilation (schnelles, flaches Atmen) hervorgerufen; Hyperventilation aktiviert nämlich das autonome Nervensystem und kann dadurch die einschlägigen körperlichen Symptome hervorrufen, die ihrerseits die Panik und die damit verbundene Rückkopplungsschleife auslösen. Klein: Panikattacken könnten auch durch überempfindliche CO2-Rezeptoren ausgelöst werden (=> Erstickungsgefühl => Positive Rückkopplung) Durch die Gabe kohlendioxid-angereicherter Luft können Panikattacken ausgelöst werden, allerdings nur bei Panikpatienten bzw. Pbn mit hohen ASIWerten! Darüber hinaus kommt es nach einiger Zeit zu einer Habituation, sprich: die subjektive Angst nimmt bei längerer Gabe CO2-angereicherter Luft wieder ab! Einfluss der Einstellung: Insgesamt scheint Panik weniger durch die physiologischen Reaktionen an sich, als vielmehr durch deren Interpretation ausgelöst zu werden. Durch Laktat (ein Salz der Michsäure und Abbauprodukt der Muskeltätigkeit) können Panikattacken ausgelöst werden, allerdings nur, wenn vorher entsprechende Erwartungen geschürt werden, sprich: wenn den Pbn gesagt wird, sie müssten mit angstvoller Spannung (anstatt angenehmer Erregung) rechnen. Dasselbe gilt für die Gabe CO2-angereicherter Luft. Wird den Pbn gesagt, CO2 führe zu starker Erregung, reagieren sie öfter mit Panik als wenn ihnen gesagt wird, CO2 führe zu Entspannung! 11.3.5. Therapie Pharmakologische Behandlung: Einsatz von Antidepressiva (SSRIs, Trizyklika) und Anxiolytika (Benzodiazepine wie z.B. Tavor) Nachteile: Erneutes Auftreten der Symptome nach Absetzen Abbruch der Behandlung wegen Nebenwirkungen (Gewichtszunahme, Herzrasen etc.) Bei Benzodiazepinen besteht eine hohe Suchtgefahr! 145 Psychotherapeutische Behandlungen: umfassen nahezu immer die folgenden 3 Komponenten: Konfrontation mit internen und externen Reizen Vermittlung von Bewältigungsstrategien (Entspannungstraining etc.) kognitive Umstrukturierung Das kognitiv-verhaltenstherapeutische Behandlungsprogramm nach Margraf und Schneider zielt darauf, das Sicherheits- bzw. Vermeidungsverhalten zu reduzieren und umfasst folgende Komponenten: 1. Informationsvermittlung (psychophysiologischer Teufelskreislauf: s.o.) 2. Kognitive Maßnahmen: Aufdeckung typischer Fehlinterpretationen: eine erhöhte Herzfrequenz ist kein Hinweis auf einen Herzinfarkt; Schweißausbrüche führen nicht zum Tod etc. 3. Konfrontation mit angstauslösenden Reizen: und zwar zuerst mit internen und dann mit externen Reizen (Verhaltensexperimente) Exploration der Symptome und Konzentration auf das Leitsymptom Bei Herzrasen => z.B. Treppensteigen, Kniebeugen oder Koffeinkonsum Bei Atembeschwerden => Hyperventilationstest (s.u.) oder die Aufforderung, die Atmung willentlich zu stoppen Bei Schwindel => Hyperventilationstest (s.u.) oder Drehstuhl Der Hyperventilationstest erfolgt in mehreren Schritten: Exploration der Symptome während eines typischen Panikanfalls Erläuterung des Hyperventilationstests Durchführung: Zwei Minuten Brustatmung mit einem Atemzug pro Sekunde! Danach: Introspektion Eine Metaanalyse von Clum (1993) zur Effektivität unterschiedlicher Behandlungsformen bei Panikstörungen mit und ohne Agoraphobie ergab folgende mittleren Effektstärken: Kognitiv-verhaltenstherapeutische Programme: 1.41 (am wirksamsten!) Flooding: 1.36 Antidepressiva: 0.82 Hochpotente Benzodiazepine: 0.29 146 11.4. Zwangsstörung 11.4.1. Darstellung des Störungsbildes und Diagnose Definition: Die Zwangsstörung (engl.: „Compulsive Obsessive Disorder“) ist eine Angststörung, bei der das Bewusstsein von beständigen und unkontrollierbaren Gedanken (Zwangsgedanken) überflutet wird und/oder das Individuum sich dazu genötigt sieht, bestimmte Handlungen (z.B. Putzen oder Händewaschen) immer und immer wieder auszuführen (Zwangshandlungen). Diagnosekriterien nach der ICD-10: Es treten über mindestens 2 Wochen an den meisten Tagen entweder Zwangsgedanken (Obsessionen) oder Zwangshandlungen (Compulsionen) auf, die ihrerseits durch folgende Merkmale gekennzeichnet sind: Sie werden als Produkte des eigenen Geistes betrachtet (keine Eingebungen durch andere)! Sie treten wiederholt auf, werden als unangenehm empfunden und vergeblich zu unterdrücken versucht. Mindestens eine Obsession oder Compulsion wird als übertrieben oder unangemessen erkannt. Beeinträchtigung der beruflichen und privaten Funktionsfähigkeit Nicht auf andere psychische Störungen wie Schizophrenie oder affektive Störungen zurückführbar! DSM IV: Insgesamt genauere Beschreibung der Zwangsstörung und strengere Kriterien Ausschlusskriterien sind z.B. besser umschrieben (Drogenmissbrauch und körperliche Krankheiten) Spezifikation: Zwangsstörungen gehen oft mit wenig Einsicht einher! Keine Unterscheidung zwischen Zwangsgedanken und Zwangshandlungen (?!) Erscheinungsform: 80% der Patienten leiden sowohl unter Zwangsgedanken als auch unter Zwangshandlungen. Dabei ist der Zusammenhang i.d.R. so, dass die Zwangsgedanken beängstigend sind - und die Zwangshandlungen dazu dienen, diese Angst zu reduzieren. Zwangsgedanken… sind ungewollt, belastend und rufen inneren Widerstand hervor sind ich-fremd (ichdyston) und unkontrollierbar (= Intrusionen) werden als sinnlos bzw. irrational erkannt (Einsicht) haben häufig aggressive oder sexuelle Inhalte Zwangshandlungen… sind stereotype und ritualisierte Verhaltensweisen, die als unangenehm und unkontrollierbar empfunden werden werden als sinnlos bzw. irrational erkannt (Einsicht) Formen der Vermeidung: - Passive Vermeidung: Vermeidung von Situationen und Stimuli, die Zwangsgedanken (z.B. Angst vor Kontamination) und –handlungen (z.B. Händewaschen) hervorrufen könnten (z.B. werden bestimmte Objekte nicht mehr angefasst, etwa alles, was braun ist) - Aktive Vermeidung: Zwangshandlungen (z.B. ständiges Kontrollieren oder Waschen) - Neutralisierende Gedanken: dienen dazu, die durch die Zwangsgedanken ausgelöste Angst zu reduzieren. 147 Beispiele für Zwangsphänomene: Angst vor Kontamination (z.B. durch Schmutz, Keime, Blut, Gift oder Radioaktivität) Ständiges Waschen des eigenen Körpers, Sterilisieren der Wohnung, häufige Arztbesuche (man könnte sich ja beim Friseur Aids eingefangen haben…) etc. Angst vor eigener oder fremder physischer Gewalt (z.B. „Ich werde mein Kind verletzen!“) Es wird vermieden, mit dem Kind allein zu sein; Messer werden weggesperrt etc. Angst davor anderen unbemerkt Schaden zugefügt zu haben (z.B. „Ich habe jemanden überfahren ohne es zu merken!“) Anrufe bei Kliniken und Polizei, wiederholtes Abfahren der Strecke; Absuchen des Autos nach Beulen Sexuelle Ängste (z.B. „Ich werden jemanden vergewaltigen!“) Es wird vermieden, allein mit Frauen zu sein, Unterdrückung sexueller Gedanken etc. Religiöse Ängste (z.B. Angst vor blasphemischen Gedanken oder religiösem Zweifel) Ständiges Beten, Beichten etc. Zur Häufigkeit einzelner Zwangsphänomene: Zwangsgedanken Kontamination: 45% Pathologische Sorge (z.B. um körperliche Fehlfunktionen): 42% Aggressive Zwangsgedanken: 28% Multiple Obsessionen: 60% Zwangshandlungen Kontrollieren: 63% Waschen: 50% Zählen (z.B. die Badfließen): 36% Sammeln/Horten: 18% Multiple Zwangshandlungen: 48% (am häufigsten ist die Kombination aus Wasch- und Kontrollzwang) Diagnostische Verfahren: SKID-I: „Strukturiertes Klinisches Interview für die Achse I des DSM-IV“ DIPS: „Diagnostische Interview bei psychischen Störungen“ Y-BOCS: „Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale” Strukturiertes Interview, bestehend aus 10 Items misst die Schwere der Zwangssymptome und Therapieeffekte wird eher zur Therapieplanung als zur Diagnose eingesetzt MOCI: „Maudsley Obsessive-Compulsive Inventory“ Umfasst 30 Items die mit „richtig” oder „falsch“ zu beurteilen sind: z.B.: „Ich vermeide es, öffentliche Telefone wegen möglicher Beschmutzung zu benutzen.“ 11.4.2. Epidemiologie und Verlauf Die wichtigsten epidemiologischen Daten: Lebenszeitprävalenz: ca. 2% Geschlechterverteilung: 1:1 Männer leiden häufiger unter Kontrollzwang, Frauen häufiger unter Reinigungszwang Beginn der Störung: meist zwischen 20 und 25 Jahren , in seltenen Fällen vor dem 10. oder nach dem 40. Lebensjahr Oft gehen belastende Lebensereignisse voraus (z.B. Schwangerschaft, Ehekonflikt oder Probleme am Arbeitsplatz) Männer bekommen die Störung i.d.R. früher als Frauen 148 Verlauf und Prognose: Drei Verlaufstypen können unterschieden werden: - Kontinuierlicher Verlauf (am häufigsten: 85%) - Verschlechterung - Episodischer Verlauf (am seltensten: 2%) Häufige Folgeprobleme: Depression, Alkoholmissbrauch, Beziehungsprobleme Prinzipiell gilt: Unbehandelt verlaufen Zwangsstörungen meist chronisch und selbst mit Behandlung kann vielen Patienten nicht wirklich geholfen werden! Die Zwangsstörung gilt daher als eine der am schwersten zu behandelnden psychischen Störungen. Es treten nur äußerst selten Spontanheilungen auf und je länger die Krankheit bereits dauert (> 1 Jahr), desto unwahrscheinlicher ist eine Spontanremission! Rund 30% aller Betroffenen lehnen eine Behandlung ab und nur bei 15-40% derjenigen, die sich einer Behandlung unterziehen, können klinisch relevante Verbesserungen erzielt werden (Vgl. dazu Katamnesestudien)! Für eine gute Prognose sprechen folgende Faktoren: Guter psychischer und physischer Gesundheitszustand vor dem Auftreten der Zwangsstörung („prämorbide Anpassung“) Episodischer Verlauf der Zwangssymptomatik (Phasen vorübergehender Besserung) „Atypische“ Zustände (wie z.B. extreme Angst oder Depression), die ihrerseits Ansatzpunkte für die Therapie bieten Kurze Dauer (nicht unbedingt geringe Intensität) Identifikation kritischer Lebensereignisse (ist umstritten) Für eine schlechte Prognose sprechen folgende Faktoren: Prämorbide Störung (z.B. Depression) Lange Dauer der Störung bei Beginn der Therapie Unverheiratet „Overvalued Ideas“: wenn der Patient meint, dass seine Ängste im Kern eine berechtigte Grundlage haben! 11.4.3. Störungstheorien und -modelle Bedeutsam sind v.a. zwei Modelle: nämlich das lerntheoretische Modell und das kognitive Modell; darüber hinaus gibt es Theorien zu biologischen Ätiologiefaktoren. Das lerntheoretische Modell: basiert auf der 2-Faktoren-Theorie von Mowrer und geht dementsprechend davon aus, dass Zwangsstörungen durch klassische Konditionierung gelernt und durch operante Konditionierung aufrechterhalten werden. Die Theorie: 1. Klassische Konditionierung: UCS (eine aversive Konfliktsituation) + NS bzw. CS (z.B. Schmutz) CR (gelernte Angstreaktion) Der gewalttätige Stiefvater (UCS) hat am Bau gearbeitet und kam daher immer dreckig (CS) nach Hause! 2. Operante Konditionierung: Zwangshandlungen werden negativ verstärkt, sofern durch sie die gelernte Angst vermieden wird! Durch ständiges Waschen wird die Angst, die durch Schmutz hervorgerufen wird, reduziert! Kritik: Der erste Faktor (klassische Konditionierung) ist problematisch: erstens führen nicht alle Traumata zu einem Zwang; zweitens lassen sich nur bei wenigen Zwangsstörungen Traumata identifizieren! Der zweite Faktor (operante Konditionierung) ist dagegen hilfreich! 149 Die wichtigste Implikation der Theorie: Die Angst wird auch (bzw. nur) dann abnehmen oder sogar verschwinden (Extinktion), wenn das Vermeidungsverhalten bzw. die Zwangshandlungen nicht(!) ausgeführt werden! Die Zwei-Faktoren-Theorie bildet damit die Grundlage für Expositionsverfahren mit Reaktionsverhinderung (z.B. einen Türgriff anfassen, ohne sich danach die Hände zu wachsen) Das kognitive Modell von Salkovskis: greift die Zwei-Faktoren-Theorie auf, erweitert sie aber um kognitive Faktoren Unterscheidung zwischen sich aufdrängenden Gedanken (= Zwangsgedanken bzw. Intrusionen) und automatischen Gedanken. Intrusionen: sind irrational, ichdyston und nicht kontrollbierbar (sie treten in unterschiedlichem Ausmaß bei allen Menschen auf!) Automatische Gedanken: werden durch die Intrusionen ausgelöst und werden durch dysfunktionale Überzeugungen (z.B. „Was ich denke, wird auch passieren!“) bestimmt. Im Gegensatz zu den Intrusionen sind automatische Gedanken ichsynton und direkt beeinflussbar! Annahme dysfunktionaler Überzeugungen: Überschätzung der Bedeutung von Zwangsgedanken (z.B.: „Was ich denke, wird auch passieren!“) Überschätzung der Wahrscheinlichkeit der Folgen eines Ereignisses (z.B.: An einem Kamm können HI-Vieren sein“) Überschätzung der eigenen Verantwortlichkeit Bedürfnis nach Perfektion Fehleinschätzung der Konsequenzen der Angst Annahme verschiedener Rückkopplungsschleifen: 1) Aufdringlicher Gedanke (Intrusion): - z.B. „Ich könnte ein Kind verletzen!“ + 2) Automatischer Gedanke (Bewertung) - z.B. „Dieser Gedanke ist fürchterlich!“ + 3) Emotionale Reaktion - Unruhe, Angst, Erregung (Arousal) 4) Neutralisierung/Abwehr (Zwangshandlung) - z.B. Wegsperren von Messern - Die Zwangshandlung führt zwar zur kurzfristigen Reduktion der Angst, verstärkt aber zugleich die dysfunktionalen Annahmen und erhöht die Bedeutsamkeit bzw. Häufigkeit intrusiver Gedanken! Durch die emotionale Reaktion werden die automatischen Gedanken verstärkt und durch die automatischen Gedanken (z.B. „Ich darf so etwas nicht denken!“) die Intrusionen. Der Versuch, die Intrusionen zu unterdrücken, wirkt nämlich paradox! 150 Experimentelle Bestätigung: Salkovskis (2003): Patienten mit Zwangsstörung werden mit ihren individuellen auf Tonband aufgenommenen Intrusionen konfrontiert; in der ersten Phase sollen sie sich entweder durch Zählen ablenken oder das übliche neutralisierende Verhalten zeigen (UV), in der zweiten Phase dürfen sie sich weder ablenken, noch neutralisierendes Verhalten zeigen. Ergebnisse: - Zu Beginn der ersten Phase ist die Angst („Discomfort“) in beiden Gruppen gleich stark, im Gegensatz zur Ablenkungsgruppe nimmt sie in der Neutralisierungsgruppe jedoch bis zum Ende dieser Phase stark ab. - In der zweiten Phase nimmt die Angst in der Neutralisierungsgruppe bis zum Ende massiv zu, in der Ablenkungsgruppe dagegen nicht! Interpretation: Zwangshandlungen sind zwar kurzfristig effektiv, langfristig wirken sie jedoch verstärkend auf die Angst! Ansatzpunkte für die Therapie: Automatische Gedanken / dysfunktionale Überzeugungen: Neubewertung / Entkatastrophisierung der Intrusionen Emotionale Reaktion: Emotionale Distanzierung Zwangshandlungen: Konfrontation mit Reaktionsvermeidung Biologische Theorien: Serotoninhypothese: Die (wenn auch nur sehr begrenzte) Wirksamkeit von Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmern spricht dafür, dass Zwangsstörungen mit einem Serotoninmangel zusammenhängen. Überaktivität des Frontallappens Defekt der Basalganglien 13.4.5. Experimentelle Befunde: Patienten mit Zwangsstörung haben ein geringeres Vertrauen in sich selbst und das eigene Gedächtnis! Gibt man Zwangsgestörten (mit zwanghaftem Kontrollverhalten) einen Allgemeinwissenstest vor und lässt sie a) nach jedem Item einschätzen, wie sicher sie sich bei der Antwort sind und b) nach dem Test einschätzen, wie gut sie insgesamt abgeschnitten haben, unterschätzen sie ihre Leistung in beiden Maßen! Zwangsstörungen hängen kausal mit der empfundenen Verantwortlichkeit zusammen. Patienten mit Zwangsstörung und Kontrollprobanden bekommen die Aufgabe, Pillen der Farbe nach zu ordnen; einem Teil wird dabei vermittelt, dass diese Aufgabe sehr wichtig sei (hohe Verantwortlichkeit), einem anderen nicht (niedrige Verantwortlichkeit). Ergebnis: Das Kontrollverhalten und das subjektive Empfinden von Zwang waren in der Bedingung mit hoher Verantwortlichkeit bei Zwangspatienten signifikant höher als bei den Kontrollprobanden! 151 13.5. Posttraumatische Belastungsstörung 13.5.1. Beschreibung des Störungsbildes und Diagnose Hintergrundinfo: Die posttraumatische Belastungsstörung wurde erst verhältnismäßig spät als eigenständiges Störungsbild (an)erkannt. Die Symptome wurden erstmals Ende des 19./ Anfang des 20. Jahrhunderts beschrieben. Anlass waren schwere Eisenbahnunfälle, die Weltkriege und später die Holocaustopfer! Entscheidende Ereignisse waren: der Vietnamkrieg (zahllose „unehrenhafte Entlassungen“ gestörter Soldaten) und die Frauenbewegung (offenerer Umgang mit sexuellem Missbrauch) Definition: Die posttraumatische Belastungsstörung ist eine auf extreme Belastungserfahrungen zurückgehende Angststörung, die durch folgende Kernsymptome gekennzeichnet ist: 1. (Ungewolltes) Wiedererleben des traumatischen Ereignisses im Gedächtnis, Tagträumen oder Träumen Das Wiedererleben ist dabei durch extreme Realitätsnähe gekennzeichnet! 2. Vermeidung von Aktivitäten und Situationen, die mit dem Trauma assoziiert sind und Unterdrückung der Erinnerung an das Trauma (bis hin zur Amnesie). 3. Symptome autonomer Überregung (Hypervigilanz, übertriebene Schreckreaktion, Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafstörungen etc.) 4. Emotionale Stumpfheit, Teilnahmslosigkeit und Anhedonie Kriterien nach der ICD-10: Traumatisches Ereignis, das „bei fast jedem eine tiefe Verstörung hervorrufen würde“ Problematisch, da weniger die objektiven Merkmale eines Traumas, als vielmehr dessen subjektive Bedeutung entscheidend für die Entstehung einer posttraumatischen Belastungsstörung sind! Typische Traumata sind: Vergewaltigung, sexueller Missbrauch, Raubüberfälle, Kriegseinsätze, schwere Unfälle, Naturkatastrophen etc. Symptome: notwendig: Beharrliches Wiedererleben des Traumas (s.o.) typisch: Vermeidung; vegetative Überregung; Gefühlstaubheit Dauer: Die Symptome treten i.d.R. innerhalb von 6 Monaten nach dem Ereignis auf und dauern mindestens einen Monat an! Die Komorbidität bei der PTB ist sehr hoch: In 80-90% der Fälle liegen weitere Störungen vor; am häufigsten sind affektive Störungen, weitere Angststörungen, Substanzmissbrauch und Somatisierung (die zeitliche Abfolge ist ungewiss) Diagnostische Verfahren: Semistrukturierte Interviews zur Diagnose und Erfassung der Komorbiditäten: DIPS, SKID-I Strukturiertes Interview zur Erfassung des Schweregrades der Störung: CAPS („Clinician Administered PTSD Scale“) Differentialdiagnose: Ausgeschlossen werden müssen… Anpassungsstörung (liegt vor, wenn das traumatische Ereignis weniger drastisch ist und die Kriterien für die posttraumatische Belastungsstörung nicht ganz erfüllt werden: z.B. nach dem Tod eines geliebten Menschen) Trauerreaktion 152 Akute Belastungsstörung (liegt vor, wenn die Symptome der PTB weniger als einen Monat andauern) Andauernde Persönlichkeitsveränderung nach einem Trauma (liegt bei einer Dauer von mindestens 2 Jahren vor) Andere Angststörungen und Depressionen: Falls schon vor dem traumatischen Erlebnis eine Depression oder Angststörung vorlag, muss geklärt werden, ob die Symptome (Vermeidung, Gefühlstaubheit etc.) lediglich eine Verschlimmerung der bestehenden Störung darstellen! Hirnverletzungen 13.5.2. Epidemiologie und Verlauf Die Mehrheit der Bevölkerung erlebt im Lauf des Lebens mindestens eine traumatische Situation! Männer erleben dabei im Schnitt häufiger traumatische Ereignisse (berufsbedingt) als Frauen; trotzdem liegt das Geschlechterverhältnis bei 2:1, was wohl daran liegt, dass Frauen mehr Ereignisse mit traumatischer Wirkung erleben! Knapp 13% aller amerikanischen Frauen wurden nach Schätzungen mindestens ein Mal in ihrem Leben vergewaltigt. Die Wahrscheinlichkeit, nach einer Vergewaltigung eine PTSD zu entwickeln liegt bei ca. 50% Vorlesung: Die Lebenszeitprävalenz liegt zw. 5% (Männer) und 10% (Frauen)! Davison: Lebenszeitprävalenz liegt zwischen 1 und 3%! Die Schätzung der Lebenszeitprävalenz ist bei der PTSD natürlich stark kohortenabhängig; in Kriegszeiten beispielsweise ist sie höher als in Friedenszeiten! Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit einer PTSD nach einem traumatischen Ereignis erhöhen, sind: Unvorhersehbarkeit und Unkontrollierbarkeit des traumatischen Ereignisses Heftigkeit der initialen Reaktion auf das Ereignis „Sich-Aufgeben“ in der Trauma-Situation Dissoziative Symptome (z.B. Depersonalisation oder Derealisation) während des traumatischen Ereignisses Vulnerabilität (frühkindliche Traumata, Anzahl bereits erlebter Traumata etc.) 13.5.3. Störungsmodelle A) Kognitives Modell nach Ehlers und Clark Die Angst von PTB-Patienten unterscheidet sich von anderen Ängsten dadurch, dass sie nicht auf eine zukünftige Bedrohung gerichtet ist, sondern aufgrund eines vergangenen Ereignisses entsteht. Eine chronische posttraumatische Belastungsstörung entsteht dabei dann, wenn das traumatische Ereignis so verarbeitet wird, dass der Betroffene das Gefühl hat, gegenwärtig bedroht zu sein! Die Wahrnehmung einer gegenwärtigen Bedrohung basiert nach Ehlers und Clark auf 2 Prozessen: Zum einen auf der Interpretation des Traumas und seiner Konsequenzen, zum anderen auf den Eigenheiten des Traumagedächtnisses. 1. Personen, die eine PTB entwickeln, interpretieren das traumatische Ereignis und dessen Konsequenzen durchweg negativ. Trauma: „Ich wurde vergewaltigt, weil man mir ansieht, dass ich ein leichtes Opfer bin.“; „Es kann jederzeit wieder passieren!“ etc. 153 Konsequenzen: Reizbarkeit: „Ich habe mich als Person zum Negativen hin entwickelt!“; Alpträume: „Ich werde nie darüber hinwegkommen!“; Konzentrationsprobleme: „Mein Hirn hat Schaden genommen!“; Unterstützung durch andere: „Ich werde mich anderen nie wieder nahe fühlen!“ etc. 2. Das Traumagedächtnis ist durch folgende Merkmale gekennzeichnet: - Ungenügende Elaboration (Verarbeitung) der Inhalte und mangelnde Einbettung in das sonstige autobiographische Gedächtnis: Traumatische Erinnerungen sind dementsprechend meist ungeordnet, bruchstückhaft und kontextlos; einzelne Aspekte werden dafür umso lebhafter wiedererlebt! - Starke Reiz-Reiz- und Reiz-Reaktions-Assoziationen: Die Inhalte im Traumagedächtnis sind besonders eng und vielfältig miteinander verknüpft und können dementsprechend leicht getriggert werden (z.B. löst ein Donner die Erinnerung ans Schlachtfeld aus, die wiederum mit Flucht assoziiert ist etc. etc.) - Starkes Priming: Reize, die ein Wiedererleben des Traumas auslösen können, werden besonders leicht bemerkt und schlecht diskriminiert (sind also wenig spezifisch)! Verhaltensweisen und kognitive Verarbeitungsstrategien, die zur Kontrolle bzw. Vermeidung der gegenwärtigen Bedrohung dienen, halten die Störung aufrecht und sind daher dysfunktional! 1. Erzeugen sie viele Symptome der PTSD (paradoxer Effekt der Gedankenunterdrückung, Gefühlstaubheit etc.)! 2. Verhindern sie die Veränderung der negativen Interpretation des Traumas und seiner Konsequenzen! 3. Verhindern sie die Elaboration des Trauma-Gedächtnisses! Beispiele für dsyfunktionale Einstellungen von Patienten mit PTSD: …fühlen sich verletzt und verletzbar …halten die Welt für bedeutungslos, unverständlich und unkontrollierbar …betrachten sich selbst als beschädigt und wertlos B) Zwei-Faktoren-Theorie der Angst (zum tausendsten Mal!) PTSD entsteht durch klassische Konditionierung und wird durch operante Konditionierung aufrechterhalten! Beispiel: Klassische Konditionierung: UCS (z.B. Vergewaltigung) + CS (z.B. Stadtpark/braunhaarige Männer/Dunkelheit etc.) => CR Operante Konditionierung: Betroffene vermeidet Spaziergänge im Park, Dunkelheit und braunhaarige Männer Neuere Befunde legen nahe, dass die PTSD darüber hinaus durch Konditionierungsprozesse zweiter Ordnung (CS + NS => CR) aufrechterhalten wird: Traumarelevante Hinweisreize (z.B. Stadtpark) scheinen von Patienten mit PTSD nämlich schnell mit neuen Reizen assoziiert zu werden (z.B. Herr P., der immer im Park spazieren geht); die auf diese Weise neu konditionierten Reize weisen darüber hinaus eine hohe Löschungsresistenz auf! Patienten mit PTSD, Personen mit traumatischer Erfahrung, aber ohne PTSD und gesunden Kontrollprobanden werden zwei Bilder mit jeweils unterschiedlichen geometrischen Formen dargeboten. Auf eines dieser Bilder folgt dabei immer ein (un)konditionierter Reiz (nämlich ein Trauma-Bild), auf das andere nie. Die eine Form ist somit ein „Sicherheitssignal“, die andere ein „Warnsignal“; erhoben 154 wurde die subjektiv eingeschätzte Valenz der 3 Bilder, das Arousal (SCR, Herzrate, Startle) und EEG. Ergebnisse: - Sowohl die PTSD-Patienten als auch die Personen mit traumatischer Erfahrung lernten, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß, zwischen den beiden Hinweisreizen zu diskriminieren (das Warnsignal wurde nach einigen Durchgängen schlechter bewertet, führte zu höherem Arousal und einem anderen EKP); bei den Kontroll-Pbn war das nicht der Fall. - Die PTSD-Patienten unterschieden sich von den trauma-erfahrenen Pbn ohne Störung dadurch, dass die konditionierte Reaktion auf das Warnsignal bei ihnen wesentlich löschungsresistenter war! C) Biologische These Ein kleineres Volumen des Hippocampus scheint ein Vulnerabilitätsfaktor für die Entstehung einer posttraumatischen Belastungsstörung zu sein. Je geringer das Hippocampus-Volumen von Kriegsveteranen mit PTSD, desto ernster die Symptomatik! Dass das geringe Hippocampusvolumen dem Trauma vorausging und nicht erst durch dieses ausgelöst wurde, konnte dadurch sichergestellt werden, dass man sich auch die Zwillingsbrüder der Soldaten anschaute, die nicht im Krieg waren, und feststellte, dass auch sie ein geringeres Hippocampusvolumen aufwiesen. 13.5.4. Prävention gegen PTSD bei Einsatzkräften Eine epidemiologische Studie der LMU München zur Belastung von Feuerwehrmännern in Bayern brachte folgende Ergebnisse: 2-3% der Befragten erfüllten die Diagnosekriterien einer PTSD! Damit ist das Risiko einer PTSD bei Feuerwehrmännern 3 Mal so hoch wie bei Männern (≤ 25 Jahren) der Allgemeinbevölkerung! Im Durchschnitt litten die Betroffenen bereits seit 6 Jahren an der Störung! (Risiko-)Faktoren, die die Entstehung einer PTSD begünstigen, waren: Hohe Einsatzzahlen (Allgemeine Belastung) Persönliche unmittelbare Betroffenheit Führungsaufgaben (besonderer Dienstgrad) Negative Bewertung eines Einsatzes und Selbstvorwürfe Diese Faktoren klärten jedoch lediglich 40% der Gesamtvarianz auf! Die größte Ressource ist Unterstützung durch Kameraden Es besteht der Wunsch nach angemessener Beratung Ein Problem ist, dass Einsatzkräfte die Symptome einer PTSD selten eingestehen: Zum einen aus Angst davor, gekündigt zu werden, zum anderen weil solche Symptome dem Stereotyp des tapferen Feuerwahrmanns widersprechen! Prävention: Es lassen sich 2 Arten von Prävention unterscheiden: 1. Primäre Prävention: Vermittlung spezifischen Wissens und spezifischer Fertigkeiten an Risikogruppen, Stärkung vorhandener Ressourcen und Etablierung von Hilfsnetzwerken! Bisher gibt es dazu in Deutschland kaum übergreifende Konzepte 2. Sekundäre Prävention: Psychosoziale Akutversorgung nach belastenden Einsätzen Bisher sind die Nachbesprechungen nach Feuerwehreinsätzen in Deutschland vorwiegend technischer Art! 155 Experimentelle Befunde: Eine ebenfalls von der LMU durchgeführte Studie zur Wirksamkeit sekundärer Prävention bei der freiwilligen Feuerwehr zeigte, dass es zwischen verschiedenen Formen des „Debriefings“ (Nachbesprechung) keine(!) signifikanten Unterschiede gibt: Verglichen wurden a) eine Kontrollgruppe ohne Nachsorge („Screening“, b) „Standard Debriefing“, c) eine abgewandelte Form dieses Debriefings und e) eine unspezifische Nachsorge. Ergebnis: Die PTSD-Symptomatik war 6 Monate nach dem Einsatz in allen Gruppen mehr oder weniger gleich (wie gut, dass man so eine Studie in die Vorlesung mit aufnimmt!)! 13.5.5. Therapie Die wichtigsten Behandlungsziele sind: 1. Elaboration des Traumagedächtnisses und kontextuelle Einordung der traumatischen Gedächtnisinhalte, um auf diese Weise die Intrusionen zu reduzieren! 2. Veränderung der problematischen Interpretationen, die das Gefühl aktueller Bedrohung hervorrufen! 3. Aufgabe der dysfunktionalen Verhaltensweisen und kognitiven Verarbeitungsstrategien, mit Hilfe derer die Patienten das Gefühl der Bedrohung zu kontrollieren bzw. zu vermeiden versuchen! Die Methode der Wahl sind Expositionsverfahren (in vivo, in sensu oder in virtueller Realität) Vorgehensweise: Z.B. mit einem Vergewaltigungsopfer an den Tatort zurückkehren und den Tathergang rekonstruieren Wirkweise: Habituation an traumarelevante Reize, Löschung der konditionierten Furchtreaktion, Aufgabe des Vermeidungsverhaltens, Elaboration und kognitive Umstrukturierung (Gefahr wird nicht mehr übergeneralisiert, zwischen „damals“ und „heute“ kann besser unterschieden werden,…) etc. Probleme: Starke Widerstände auf Seiten des Patienten; vorübergehende Belastungssteigerung; es besteht die Gefahr, den Kontakt zum Hier und Jetzt zu verlieren; viele traumatische Ereignisse lassen sich nur schwer simulieren (z.B. Umweltkatastrophen, Krieg etc.) => Lösung: Virtuelle Realität! Expositionsverfahren in virtuellen Realitäten haben sich bei unterschiedlichen Traumata als äußerst wirksam erwiesen: 11. September: graduelle Exposition in 11 Stufen (1. Stufe: Tag in New York mit Blick aufs WTC 11. Stufe: vollständige Simulation des Anschlags) Ergebnis: Bei 5 von 9 Patienten (von denen 6 mit Hilfe traditioneller Verfahren nicht geheilt worden waren) konnten die Symptome in 14 Sitzungen so weit reduziert werden, dass sie keine Diagnose mehr erfüllten! Ähnlich positive Ergebnisse konnten z.B. mit Vietnam-Veteranen (virtuelles Kriegsszenario) und Verkehrsunfallopfern erreicht werden! 156 13.6. Generalisierte Angststörung 13.6.1. Das Wichtigste in vier Sätzen: Definition: Die generalisierte Angststörung (auch frei fluktuierende Angst genannt) ist durch übermäßige Sorgen und Angst gekennzeichnet – und zwar bezogen auf mehrere, meist alltägliche Situationen (Krankheit, Arbeitsplatz, soziale Beziehungen etc.) Weitere Symptome: Ruhelosigkeit, vegetative Übererregtheit, erhöhte Muskelanspannung, Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten etc. Das Hauptsymptom der generalisierten Angst ist die Sorge; sofern sie von negativen Emotionen ablenkt wird sie negativ verstärkt! Epidemiologie: Die Prävalenz der Störung liegt bei etwa 5%; nur wenige begeben sich aber in Behandlung! Das Geschlechterverhältnis liegt bei 2:1 (Frauen sind also doppelt so häufig betroffen wie Männer) Ätiologie: Kognitiv-Lerntheoretischer Ansatz: Generalisierung konditionierter Angstreaktionen, negative Verstärkung der Sorge; gelernte Hilflosigkeit! Biologischer Ansatz: Blockierung des GABA-Systems, aufgrund derer die Angst nicht mehr gehemmt werden kann! Therapie: Entspannungstraining Vermittlung von Kompetenz und Selbstwirksamkeit Entkatastrophisieren Anxiolytika (z.B. Benzodiazepine wie Valium) 157 14. Sonstige Störungen 14.1. Psychophysiologische Störungen: 14.1.1. Allgemeines: Definition: Psychophysiologische Störungen haben im Gegensatz zu somatoformen Störungen tatsächlich eine physiologische Grundlage, ihre Entstehung und Verschlimmerung wird jedoch durch psychische Faktoren, insbesondere Stress, stark beeinflusst. Beispiele sind: Tinnitus, Asthma, Neurodermitis, Magen-Darm-Geschwüre, kardiovaskuläre Erkrankungen (Störungen des Herzkreislaufsystems)! Im DSM-IV und der ICD-10 bilden psychophysiologische Faktoren keine eigene Kategorie, sondern werden unter physiologischen Krankheiten geführt. Im DSM-IV gibt es die Möglichkeit, psychophysiologische Störungen auf Achse III („medizinische Krankheitsfaktoren“) zu kodieren. Psychophysiologische Störungen werden v.a. durch Stress hervorgerufen bzw. verschlimmert (s.o.): Über die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrindenachse kann Stress auf lange Sicht zu einer Beeinträchtigung des Immunsystems führen. Um Stress adäquat zu verarbeiten und die subjektive Belastung möglichst gering zu halten, bedarf es geeigneter Copingstrategien (kontraproduktiv sind Flucht und Vermeidung) 14.1.2.Konkrete Beispiele Kardiovaskuläre Erkrankungen (Störungen des Herz-Kreislauf-Systems): Bluthochdruck (essentielle Hypertonie): erhöht die Wahrscheinlichkeit für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall; ein prädisponierender Faktor für die Entwicklung von Hypertonie scheint Ärger zu sein! Koronare Herzkrankheiten (Angina Pectoris und Herzinfarkt => Durchblutungsstörungen): Risikofaktoren sind ein hohes Alter, männliches Geschlecht, Nikotin- und Alkoholkonsum, hoher Blutdruck (s.o.), erhöhter Cholesterinspiegel, Fettleibigkeit und Bewegungsarmut sowie ein stark leistungs- und wettbewerbsorientierter Lebensstil (Typ-A-Verhaltensmuster) Asthma: Wird meist durch Allergene oder Infektionen ausgelöst, wird aber auch durch psychische Faktoren beeinflusst! Chronische Schmerzen: Eine rein medizinische Behandlung chronischer Schmerzen reicht nicht aus; darüber hinaus muss den Patienten beigebracht werden, mit den Schmerzen besser zu leben (Training kognitiver Bewältigungsstrategien, Vermittlung von Copingstrategien, Entspannungsübungen, Biofeedback etc.) Aids: Hier kann die Psychologie präventiv wirksam werden! 158 14.2. Sonstiges 14.2.1.Sexuelle Störungen: Im DSM-IV und ICD-10 werden 3 Hauptgruppen von sexuellen Störungen unterschieden: 1. Geschlechtsidentitätsstörung („Transsexualität“): Personen, die sich i.d.R. von früher Kindheit an dem entgegengesetzten Geschlecht zugehörig fühlen. Als Ursachen werden diskutiert: hormonelle Einflüsse und Sozialisationseinflüsse Behandlung: Operative Geschlechtsumwandlung und/oder psychotherapeutische Begleitung 2. Paraphilien: Liegen vor, wenn sich die Betroffenen für ungewöhnliche („para“=„neben“) Objekte und/oder Praktiken begeistern („philia“=„Liebe“) Beispiele: Fetischismus (sexuelle Attraktion unbelebter Objekte), Transvestismus (Frauenkleider), Exhibitionismus, Pädophilie, Voyeurismus, sexueller Masochismus, sexueller Sadismus, Nekrophilie etc. Behandlung: kognitiv-behavioral, medikamentös 3. (Nichtorganische) sexuelle Funktionsstörungen: Sexuelle Störungen sind Störungen des normalen sexuellen Reaktionszyklus (Masters & Johnson: Appetenzphase => Erregungsphase => Orgasmusphase => Entspannungsphase); sie werden in vier Gruppen unterteilt: Störungen der sexuellen Appetenz (z.B. Lustlosigkeit) Störungen der sexuellen Erregung (z.B. Erektionsprobleme) Orgasmusstörungen (z.B. Ejaculatio Praecox) Störungen mit sexuell bedingten Schmerzen (z.B. Vaginismus) 14.2.2. Störungen in Kindheit und Jugend Geistige Behinderung (DSM-IV) / Intelligenzminderung (ICD-10): Diagnosekriterien: deutlich unterdurchschnittlicher IQ IQ zwischen 55 und 70: leichte geistige Behinderung IQ unter 25: schwerste geistige Behinderung eingeschränkte Anpassungsfähigkeit Beginn vor dem 18. Lebensjahr Ursache meist organischer Art: z.B. Drogenkonsum während der Schwangerschaft; Hirnhautentzündung; Trisomie 21 (=Down-Syndrom) etc. Umschriebene Entwicklungsstörungen: Lernstörungen: Legasthenie und Diskalkulie Kommunikationsstörungen: was der Name sagt Störungen der motorischen Fertigkeiten: was der Name sagt Tiefgreifende Entwicklungsstörungen: ausgeprägte und tiefgreifende Beeinträchtigung in mehreren Bereichen Frühkindlicher Autismus: Manifestiert sich vor dem 3. Lebensjahr Die Kernsymptome sind: - Starke Beeinträchtigung der sozialen Interaktion - Starke Beeinträchtigung der Sprach- und Kommunikationsfähigkeit 159 - Stark eingeschränkte (stereotype und repetitive) Interessen und Verhaltensweisen (zwanghaftes Festhalten an Ritualen etc.) Geht meist mit drastischer Intelligenzminderung einher! Asperger Syndrom: Manifestiert sich nach dem 3. Lebensjahr Soziale Interaktion, Kommunikationsfähigkeit und Interessen sind zwar ebenfalls eingeschränkt, aber: keine gravierende Beeinträchtigung der Sprachentwicklung und meist normale bis überdurchschnittliche Intelligenz (Hochbegabung!) Unterkontrollierte Verhaltensstörungen: Störungen mit unterkontrolliertem Verhalten ADHS: siehe oben Störung des Sozialverhaltens Störung mit oppositionellem Trotzverhalten Überkontrollierte Verhaltensstörungen: Trennungsangst Phobische, überempfindliche, depressive Störungen Störungen der Nahrungsaufnahme und der Ausscheidung: Fütter- und Essstörungen im Säuglings- oder Kleinkindalter Enuresis (Bettnässen) Wird u.a. mit Hilfe von Warnsystemen behandelt (klassisch: das „Klingelkissen“); außerdem: Training der Beckenbodenmuskulatur, operante Verfahren etc. Ticstörungen: Vorübergehende Ticstörungen Chronische motorische oder vokale Ticstörungen Kombinierte vokale und multiple motorische Ticstörung (Tourette-Syndrom) Störungen sozialer Funktionen: Z.B. selektiver Mutismus Darüber hinaus können die meisten Störungen, die üblicherweise erst im Erwachsenenalter auftreten (substanzinduzierte Störungen, Schizophrenie, Angststörungen etc.), auch schon im Kindesalter einsetzen! 14.2.3. Psychische Störungen im Alter Unter Demenz versteht man eine progressive Verschlechterung der intellektuellen Fähigkeiten. Demenzen können verschiedene Ursachen haben: Alzheimer (der häufigste Grund): fortschreitende Atrophie der Großhirnrinde durch Proteinablagerungen (sog. Plaques) in den Zellkörpern der Neuronen; starke genetische Komponente (Mutation des Chromosoms 21) Fronto-temporale Demenzen: Atrophie von Neuronen im Frontal- und Temporallappen Vaskuläre Demenzen: durch Durchblutungsstörungen im Gehirn hervorgerufen (Risikofaktoren sind dieselben wie bei kardiovaskulären Erkrankungen: s.o.) 160 Abgegrenzt werden müssen Demenzen von Depressionen und Delirien: bei letzteren handelt es sich um plötzliche Bewusstseinstrübungen, die mit massiven Denk-, Gefühls- und Verhaltensstörungen einhergehen. Im Ggs. zu Demenzen sind Delirien, wenn ihre Ursache (z.B. Fieber, Mangelernährung, Substanzmissbrauch) frühzeitig erkannt wird, meist reversibel. Die Häufigkeit psychischer Störungen ist in der Altersgruppe der über 65-Jährigen zwar am geringsten; trotzdem leiden ca. 20% unter Depression, Angst oder anderen Störungen. Die Suizidrate ist bei den über 65-Jährigen (Männern) um das 3-fache erhöht! Die häufigsten Gründe sind: körperliche Krankheiten, finanzielle Bedrängnis, Verlust geliebter Menschen, soziale Isolation und Depression! The End 161