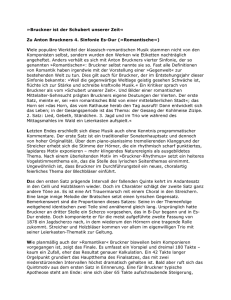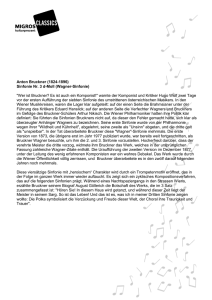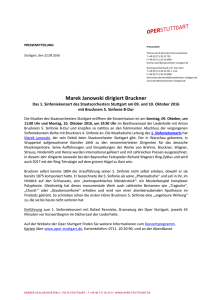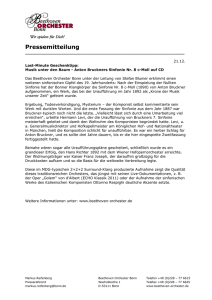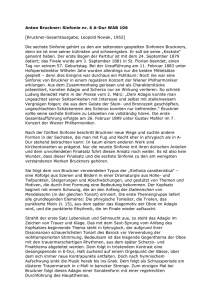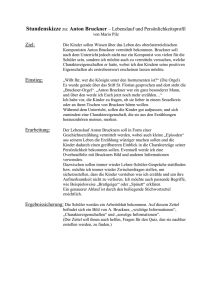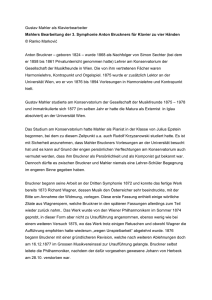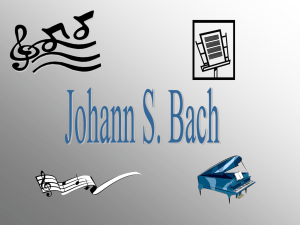ANTON BRUCKNER UND DER BAROCK
Werbung

ANTON BRUCKNER UND DER BAROCK VERSUCH EINER VERGLEICHENDEN KÜNSTEBETRACHTUNG VON WERNER GROSS Adolf Hildebrand: Wer möchte in einen Tizian heute eine moderne Figur hineinmalen? Man fand es gut, ja für einzig richtig: Anton Bruckners f-Moll-Messe in einem Barockmünster aufgeführt, das gewaltige Tonwerk des Meisters von St. Florian mit einem monumentalen Sakralraum verschmolzen. (Das Folgende knüpft sich an Aufführungen, die Prof. Ludwig Berberich in den Jahren 1946 und 1947 mit seinem Münchner Domchor in der Klosterkirche von Fürstenfeld in Oberbayern veranstaltet hat.) Was solchem Meinen und Vorhaben zugrunde liegt, läßt sich unschwer erraten. Es ist die verbreitete Auffassung, daß der Barock, zumal der süddeutsche, die Kunst des Großformigen und rauschend Bewegten sei; daß sich eine Totalität in ihm entfalte, in der inniges Gefühl mit äußerem Glanz, irdisches Sehnen mit himmlischer Verzückung im Einklang stehe. Und so ergäbe es sich wie von selbst, daß dies Barocke zusammenstimme mit der Brucknerischen Musikform, diesem inbrünstigen Strömen der Töne, das aus Abgründen zu höchsten Verklärungen führt und das Anhören dieser Musik zum religiösen Erlebnis macht. Jenes Sursum corda, das die Tonwelt des Symphonikers erfülle, sei es, was gleichermaßen die gewaltigen Formgebilde des barocken Raums verkörperten, so war auch von der Kanzel herab gesprochen worden, um dem Konzert in der Kirche seine Begründung zu geben. Bruckners Musik die ideale Erfüllung des Barockraumes, dieser der wahrhaft gemäße Aufführungsort für sie, jedermann sollte dabei der innerste Zusammenhang der beiden Kunstwelten aufgehen. Die Konzertbesucher haben, wie sich damals feststellen ließ, eine solche Auffassung auch allgemein geteilt, ja begeistert aufgenommen. Mehr noch mußte zu denken geben, daß die Aufführenden selbst und gewichtige Musiker unter den Zuhörern überzeugt davon waren, daß eben ein solcher Barockkirchenraum und nicht der Konzertsaal dem Werk Bruckners zur wahren Verwirklichung helfe. Dem Kunsthistoriker also, der Zeuge des Geschehnisses ist, stellt sich bei solch einhelliger Meinungskundgabe die Frage, ob er ihr folgen oder, wenn nicht, wie er ihr auf wissenschaftliche 260 Weise begegnen könne. Denn geschähe das letztere, bedeutete es eine Pauschalvergleichung nicht nur von weitgetrennten Kunstzeiten sondern auch von sehr verschiedenen Kunstarten. Ein wissenschaftlich kaum begangener Weg müßte beschritten werden. Da es sich im folgenden in der Tat um den entschiedenen Widerspruch zu der geschilderten Auffassung handelt, so ist jener ungewöhnliche Schritt nicht zu vermeiden. Er wird hier im vollen Bewußtsein des Wagnisses und der Bestreitbarkeit des dafür gewählten Vorgehens getan. Die Erörterung beginnt, um die Vergleichsbasis möglichst breit anzulegen, mit der Wiedergabe eines allgemeinsten, vom besonderen des Ton-bzw. Bauwerks noch absehenden Eindrucks. Was ist es, das sich begibt, wenn das Auge auf der barocken Formenpracht des Kircheninnern ruht und unser Ohr gleichzeitig die ersten Klänge der Brucknermesse vernimmt? Auffällig ist zunächst, daß die Töne von allem Anfang an nicht eigentlich in dem Raum sind, in dem wir uns befinden. Sie steigen als leichte Nebel aus dem Boden auf, andere kommen wie von draußen herein, durchdringen die Öffnungen, schmelzen die Wände auf. Verstärken sich die Klänge, so dringen sie unmittelbar auf uns ein. Wie Schwerter durchschneiden Akkorde und Rhythmen den Raum, durchstoßen, zerwühlen ihn. Dann wieder sinkt das Tonelement in sich zusammen, wird zum hauchartigen Nichts, um rasch von neuem anzuschwellen. Wolkenartig verhüllt es das Sichtbare, entschwebt dem festen Raum, den Hörer unaufhaltsam nach sich ziehend. Immer mehr wird der Ort, dessen Gegenwart er sich versichert glaubte, von den Tönen überflutet, und so schließt er die Augen, um sich jenen allein hinzugeben, im Glauben, der gebaute Raum könnte ihm ganz entgleiten, aber auch aus Furcht, er werde, von seinem Anblick abgelenkt oder ernüchtert, aus dem Tongeschehen gerissen. Darnach aber, wenn der Sturm der Töne zu Ende gekommen ist, und wir wieder unseres Augensinnes mächtig werden, stellt sich noch eine andere, nicht weniger seltsame Empfindung ein. Fängt der von den Tönen überwältigte Raum wieder auf uns zu wirken an, werden wir nach und nach seiner tausendfältig verkörperten Gestalt gewahr, so ist es, als hätte er einen Orkan überstanden oder als sei der Rausch des Symphonischen mit der Gewalt eines Kriegsmittels über ihn hinweggegangen. Und dankbar versichert sich der Zuhörer des unberührt gebliebenen Bauwerks und der überdauernden Kraft der Bildwelt. I Soweit eine erste, von Übertreibung nicht frei erscheinende Impression. Findet sie im Nahblick Bestätigung, läßt sich auf ihr aufbauen, eine These aus ihr gewinnen? Wir stellen die Frage zurück und wenden uns 261 der speziellen Form der beiden Begegnungspartner zu. Es sei dabei dem Bauwerk als dem älteren und den Aufführungsort bezeichnenden Formgebilde der Vortritt gegeben. (Abb. I) Betreten wir einen Raum wie die Kirche der einstigen Fürstenfelder Zisterziensermönche, so wird uns zunächst, ganz im Sinn des geschilderten Allgemeinurteils, seine Macht und Größe überwältigen. Der Blick geht, vom Abschlußgitter unter der Empore erregt und nur scheinbar zurückgehalten, in eine reich belebte Tiefe und ermißt beim Zurückgleiten eine überraschende, durch die Emporenwölbung noch gesteigerte Höhe. Vordergründig ist es das gestaffelte Hintereinander rot leuchtender Säulenpaare vor den Kapellenpfeilern, im langen Chorhals dann die engere Folge von Pilasterpaaren, was Tiefe in anschaulichster Form empfinden läßt. Über den Säulengebälken bringen steile Attikaglieder und die aus ihnen hervorschwingenden Gurtenpaare den Eindruck von Höhe majestätisch zum Ausdruck. Überdies strömt aus vielen Fenstern helles Licht und läßt den weitgedehnten Raum bis in seine fernsten Winkel deutlich werden. Architekturgewalt, Licht und die starken Farben auf weißem Grund sind aber nicht nur die Interpreten der Größe, sondern auch einer reichen Bewegtheit des Rauminnern, jenem Element des Innigen und Rauschenden, dem man sich in Barockräumen so gerne zu überlassen pflegt. In der Tat schwingen die kühn gestreckten Bögen des Hauptschiffes und der hohen Seitennischen in größter Freiheit zuund gegeneinander, strömen die Säulenpaare dahin und quillt es allseitig über von reichstem Zierat. Ja, wer mit vollem Blick das Raumganze mitsamt seinen Altären, Kanzeln, Gestühlen und Stuckmotiven umfaßt, wird vor und zwischen dem eigentlich architektonischen Raum einen zweiten entdecken, der eben aus diesen Ausstattungselementen sich bildet. Ihm fehlt zwar ein greifbarer Zusammenhang, aber zusammengesehen ergeben jene eine Girlandenform, die sich als Schleierraum, wie es Wilhelm Pinder ausdrückte, in den Hauptraum hineinschmiegt. Hinzu kommen als eine Art dritten Raumes breite Schwaden von Lichtern und Schatten, Farb- und Formspiegelungen, welche die festen Formen umspielen oder sich in Gebälken und Altären zu kräftigen Akzenten sammeln. Tragende Weite, Fülle und starke Bewegtheit scheinen also Hauptmerkmale des ereignisreichen Raumes zu sein und wollen jener Deutung rechtgeben, die eine Musik von der Art der brucknerischen als Gestaltverwandte empfindet. Doch wäre es wohl verfrüht, schon an diesem Punkt der Betrachtung den Vergleich mit dem Musikwerk aufzunehmen und dem Endurteil zuzusteuern; denn noch hat jene nicht viel mehr als eine erste, unkontrollierte Bestandsaufnahme ergeben. Das, was die geschilderte Größe, Fülle und Bewegtheit des Fürstenfelder Innenraumes erst faßbar macht, ist mit ihr noch nicht berührt. Warum, so ist zu fragen, schwindelt uns nicht beim Anblick der hohen Wölbungen, was läßt das Auge fest in der Raumtiefe 262 Abb. 1. Fürstenfeld (Oberbayern), Zistiterzienserklosterkirche Inneres gegen Osten, entstanden 1701—1766 Abb. 3. Regensburg, Alte Kapelle, nach der Barockisierung 1747/72 i Abb. 4. Freising, Dom. Entwurfsstich für die Barockisierung von Cosmas Damian Asam, 1724 ii haften, welche Kräfte geben dieser den greifbaren Stand, uns das Gefühl der Sicherheit? Und weshalb verläßt uns bei aller Fülle und Bewegtheit des Erschauten nie das Bewußtsein, in einem zusammenhängenden Ganzen geborgen zu sein, in dem von den vielen anmutigen Figuren und Schmuckgebilden nicht eines stürzt oder untergeht? Haltgebend ist offenbar zunächst das kräftige, vom Licht wie getragene Architektursystem, das der räumlichen Größe auch die nötige Fülle und Standfestigkeit verleiht. Auch in Fürstenfeld, dem Spätwerk des Antonio Viscardi, ist der an einer plastischen Tektonik festhaltende südliche Baugeist noch lebendig, der zu seiner Zeit schon dahinschwindet. Auch spürt man in seinem Werk ein wohliges Sichentsprechen von Bauformat und Bausubstanz. Von dieser ist das Innenbild durchgehend begrenzt, die Figuren- und Farbenbewegung ist in eine feste Schale gebettet. Im Gegensatz zur Klangwelt Bruckners – um diese ein erstes Mal einzubeziehen – wird man sagen können, daß hier der Raum keineswegs willkürlich dahinflutet, ins Unendliche verströmt, uns umwirft. Seine Größe begegnet nicht absolut, die Fülle und Bewegung überflutet nicht. Speziell die Bewegung scheint nicht sein Eigentlichstes, Mächtigstes zu sein. Es sind vielmehr kräftig hervortretende, voll überschaubare Glieder und Gelenke, die Auge und Gefühl den ersten Anhalt geben und sie nicht aus dem spürbar Konkreten einer geformten Bauschale entlassen. Doch könnte nach diesen Kennzeichnungen der Eindruck entstehen, als handle es sich in Fürstenfeld um eine ausschließlich körperplastische, spezifisch michelangeleske Architektur. Viscardis Bauglieder verhalten sich jedoch weder untereinander noch zu den breit ausgespannten Wandflächen in Fürstenfeld kontrapostisch. Im Bauzusammenhang gesehen sind sie weniger herrschende als dienende Bestandteile eines Wandganzen, das in den Seitennischen und im Langchor auch greifbar zutage tritt. Der Blick auf die dortigen dünnen Wände, die, von Fenstern weit aufgeschlitzt, dennoch die mächtigen Tonnenwölbungen tragen, belehrt aber darüber, daß es weder die Gliederordnung allein noch auch die Wände als solche sein können, welche dem Raum letztlich Halt geben. Auch daß dieser in Fürstenfeld durchmeßbar und in sich vergleichlich ist, kann von jenen her kaum verstanden werden. Es muß neben dem Wand- und Gliederelement noch ein anderer Faktor wirksam sein, der das Bewegte bindet, das Raumganze hält und es faßlich macht. (Abb. 4) Unser modernes, auf sinnfällig durchgreifende Strukturen geschultes Auge läßt uns hier allerdings im Stich. Denn bei den Haltekräften besonderer Art, um deren Erfassung es sich nunmehr handelt, spielen jene nicht die einzige Rolle. Zwar besitzt, wie sich weiter unten ergeben wird, auch das Pfeiler- und Gurtensystem von Fürstenfeld noch andere als vordergründig strukturelle Eigenschaften. Wir bemerken sie jedoch erst, wenn jenes mit einer Formenwelt zusammengesehen wird, deren mittragende 263 Funktion bisher noch wenig beachtet ist. Wir meinen das in der sog. antiken Säulenordnung mitenthaltene System von Sockeln, Schäften, Kapitellen und Gesimsen in seinem Zusammenwirken mit den dazwischen gelagerten Schmuckfeldern, Bildrahmungen, Nischen und Deckenstücken. Hält sich das Auge an diese Sekundärformen, greift es von Profil zu Profil, von Feld zu Feld, und bezieht es deren an sich unverknüpfte Rechtecke und Kurvengebilde aufeinander, so entdeckt es eine Ordnung, die strenger geometrisch und wesentlich detaillierter ist als die antikischgroßformige, die zumeist für einzig bestimmend gehalten wird. Die Sekundärformenwelt hat demnach für den Bauzusammenhalt eigene Bedeutung. Diese liegt offenbar darin, daß sie, obwohl formal unarchitektonischer Art, dank ihres engen Verbundenseins mit dem speziell architektonischen System ebenfalls, jedoch wesentlich konsequenter, tektonisch wirksam ist. Deutlich wird dies am Verhältnis der statischen zu den dynamischen Elementen. Es kann kein Zweifel sein, daß in Fürstenfeld das Übergewicht der dynamischen bei den sog. Architekturgliedern liegt (siehe deren offene Kreisbogenstücke bei den großen Nischen, den Tonnen, den Halbsäulen etc.), das der statischen bei dem über- und hintergreifenden System der (geschlossenen!) Felder. Wirksam im festigenden Sinn sind am auffälligsten die hohe Attikazone, die die Gurtbögen quasi begradigenden Rechtecke in deren Bogenscheitel, und die in die Tonnenlünetten eingeschobenen „Hängeemporen” im Schiff, die Kreisfensterreihen im Chor. Im Augenblick nun, wo man das Bauganze als ein primär von einem Kleinformensystem Getragenes erkennt, entdeckt sich auch jener schon angedeutete zweite Sinn der Großformenstruktur. Während sein erster offenbar ist, das Räumliche gleichsam in Schwung zu bringen, ist es jener, den Bau im Verein mit den Kleinformen meß- und vergleichbar zu machen. Denn hierzu bedurfte es neben der Detaillierung auch der Akzentuierung im Großen. Dank dieser wird es dann möglich, das Schiff zum Chor, die Wände zur Wölbung in Verhältnis zu sehen, oder die gewaltige Raumhöhe in fester Entsprechung zur Raumlänge zu empfinden. Aus all dem ergibt sich, daß für die in Fürstenfeld so stark sprechenden statischen Gleichgewichte weniger Baumaterie und Bauglieder als die Eigenschaften der großen und kleinen Ordnungselemente maßgebend sind. Mit solchen Feststellungen ist über die hohe tektonische Beschaffenheit des Fürstenfelder Innenraumes zwar manches ermittelt, jedoch bezieht es sich nur auf dessen Bauschale. Die Frage, inwieweit er auch räumlich „gestaltet” ist, wurde also nur mittelbar berührt. Für deren Beantwortung genügt es zweifellos nicht, das Vorhandensein von Ordnungselementen, und seien sie noch so zahlreich und greifbar, festzustellen. Es muß vielmehr gefragt werden, auf welche Weise sie optisch wirksam gemacht sind. Den vermutlich wichtigsten Anhaltspunkt dafür bildet die Art, wie in Fürstenfeld die Formen im einzelnen behandelt und ins Licht gesetzt wurden. Faßt man jene ins Auge, so ergibt 264 sich, daß sie durchgehend, ob Groß- oder Kleinglieder, knapp und sauber geschnitten sind und daß ihnen infolge der Lichtfülle des Raumes eine subtile, die Formen klar voneinander abhebende Licht- und Schattenzeichnung eignet. Auf den farb- und lichtfunkelnden Interieurs süddeutscher und österreichischer Barockkirchen, die Adolf Menzel in seinen Reise-Skizzenbüchern hinterließ, finden wir davon freilich nichts, jedoch um so mehr auf den Architekturstichen der Barockzeit selbst. Diese geben zwar kaum etwas von dem malerischen Reiz wieder, den Menzel und seine Nachfolger im Barockinnenraum entdeckten und die auch viele der heutigen Barockfreunde als deren Eigenstes empfinden; sie bekunden im Gegenteil statt Raumpoesie eine fast ernüchternde Trockenheit. Aber dieser „trockene” Charakter des Architekturstiches, dessen Formwerte zu würdigen der Bauhistoriker bisher zumeist den Graphikfreunden überläßt, bedeutet zweifellos mehr als die Garantie einer exakten Bauaufnahme. Denn, wie uns scheint, basieren auf ihrer Wiedergabeform Wesenszüge der barocken Baugestalt, die für die Erfassung ihrer Raumwerte maßgeblich sind. Es sind dies einmal das Ausgeprägt- und Abgesetztsein der Einzelformen wie der Flächen und Raumkuben, zum anderen die Durchsichtigkeit des Raumganzen. Jene Lichter und Schatten, die bei Menzel zusammen mit der Farbe die totale Verschleifung von Form und Raum vollführen, läßt der Barockstecher – bei strenger Perspektivdarstellung – die Bauschale nur eben streifen. Damit präzisieren sich nicht nur deren plastische Werte, es werden auch räumliche Distanzen festgelegt. Ein Pilaster setzt sich durch seine Schattierung mit scharfer Deutlichkeit von seiner Rücklage ab, diese von dem dahinterliegenden Pfeiler, der selbst wieder von den Wänden abgehoben ist. Steht die Wand als Ganzes im Schatten, so zieht dessen präzise Tonlage die Bauglieder in eine Dunkelzone zusammen. (Abb. 2 und 4) Tonlagen, Schlaglichter und -schatten sind es auch, welche die Raumabschnitte klären und herausarbeiten. Gleiches gilt bekanntlich von der Wiedergabe der Ausstattung, zumal ihres Figürlichen und Gemalten. Während sie bei Menzel ein besonders beliebtes Vehikel der Auflösung und Durchbrechung der Raumkonsistenz bildet, gehört sie in den Stichen zu der den Raum stufenden Körperwelt wesentlich mit. Indem eine modellierende Beleuchtung sie vollrund erscheinen läßt oder Schlaglichter und Schattentönungen ihre Zusammenfassung in geschlossene Komplexe bewirken, wird zur Tiefenbildung Entscheidendes beigetragen. Daß der Raum nicht unbestimmt fließt, sondern steht und zugleich in die Tiefe gestaffelt ist, verdankt er somit wesentlich seiner Beleuchtungsweise. Man wird sie demnach als einen selbstbedeutsamen Faktor der Baustruktur aufzufassen haben. Denn ihr Kennzeichen ist, um das Gesagte zusammenzufassen, offenbar das planmäßige Zusammenwirken genau unterschiede- 265 ner Lichtbahnen, und dies heißt wohl nichts anderes, als daß die Lichtordnung demselben Geist der Tektonik gehorcht, der auch die übrigen Ordnungsfaktoren bestimmt. Für ihn sind allerdings die Architekturstiche aufschlußreicher als die realen Räume selbst, in denen durch neuzeitliche Fensterverglasung und andere Veränderungen die ursprünglicheLichtführung entstellt ist. (Abb. 3 und 4) Das besondere Verhältnis von Form und Raum, das durch die tektonische Lichtordnung entsteht, bekundet sich unter anderem darin, daß das Rauminnere dem Bühnenbild verwandt erscheint. Bei den Altären und Deckenbildern der Zeit ist dieser Zusammenhang stets empfunden worden (im besonderen bei den Asams, bei Mathäus Günther und Tiepolo), aber er beschränkt sich offenbar nicht auf sie, sondern betrifft das architektonisch-bildnerische Ensemble im ganzen. Gäbe es nicht neben der Kulissenbahn aus Pfeilern und Bögen auch das klar ausformende Kulissenlicht, so würden sich die reichdrapierten Altäre und lichterfüllten Deckenbilder wie bei Menzel in Wolkendünsten verlieren, während sie in Wirklichkeit im engsten Zusammenhang mit der gebauten, geschnitzten und stukkierten Körperwelt verbleiben, diese nur immer reicher und feiner abstufen. Im Barocken das Verschwimmende und Stimmungshafte – typische Werte des 19. Jahrhunderts – zu erleben, enthüllt sich demnach als zeitbedingte Sicht, die den Charakter der älteren Raumarchitektur verkennt. Aus dem Gesagten dürfte hervorgehen, daß die im Architekturstich (und ähnlich in der damaligen Architekturzeichnung) überlieferte Licht-und Schattenbehandlung auch darüber Aufschluß gibt, wie das Rangverhältnis der Ordnungsfaktoren bezüglich der Raumgestaltung beschaffen ist. Licht und Schatten stehen da offenbar an höchster Stelle, denn es ist zweifellos die von der Lichtführung ausgehende Raumgliederung im großen und nicht die Bauschale, die dem Barockinterieur die spezifisch geformte Tiefe verleiht. Daß es diesen räumlichen Gestaltcharakter tatsächlich besitzt, er ihm nicht bloß unterstellt wird, mag sich aus der keineswegs selbstverständlichen Tatsache erklären, daß in einem Bauwerk von der Art der Kirche in Fürstenfeld trotz seiner Überfülle an Gliederung und Ausstattung kein Gefühl der Überladenheit aufkommt. Die Klarheit der Distanzen hält die Gegenstandsfülle auseinander, die Durchsichtigkeit läßt auch den üppigsten Schwellungen des Geschnitzten und Stukkierten ihre volle Entfaltung. Füllt sich der Raum mit Menschen, wie es ein Gottesdienst oder die erwähnten Konzerte beobachten lassen, so entsteht nicht jener Eindruck von Gedränge, der uns in heutigen Räumen berauschen, aber auch beängstigen kann. Und während es der Hallen- und Zeltcharakter solcher Gegenwartsbauten mit sich bringt, daß die Menge sich reziprok dazu ballt oder in Masse verwandelt, verblüfft es, wie selbstverständlich sie sich in den Barockräumen verteilt und gruppiert. Wo dort der Raum die Menge 266 verschlingt oder umgekehrt die Menge den Raum, empfinden wir hier schon beim Eintreten eine Geräumigkeit, in der eine Menschenmenge spielend aufgenommen erscheint. (Abb. 4) Diese ans Wunderbare grenzende Aufnahmebereitschaft, die den Barockräumen gewiß zu Recht zugeschrieben wird, läßt sich für das Beispiel Fürstenfeld noch aus einer weiteren Eigenschaft ableiten. Das Erschließungsmotiv für sie ist die dortige Sockelzone. Es legt sich hier bis in Kopfhöhe hinaufreichend ein Band aus kräftig roten Marmorplatten um den ganzen Raum und hält diesen gleichsam am Boden fest. Die natürliche Folge davon ist, daß die darüber erscheinende helle Raumzone über ihre reale Abmessung hinaus sich weitet, aufsteigt, fast wie in einen andern Aggregatzustand übergeht. Die Ebene materieller Schwere und Gebundenheit scheint schon zufolge des entschiedenen Farbgegensatzes bis zu einem gewissen Grad verlassen, es beginnt ein Bereich, in dem die Gewichte abnehmen, die Gesetze des Tektonischen sich freier handhaben lassen. So fällt von daher auch noch einmal Licht auf die Art der Ordnungselemente in Fürstenfeld. Daß sich an ihre „Architektur“-glieder auch elastische Sekundärformen gleichrangig anschließen können, läßt annehmen, daß auch der Baustruktur im ganzen ein Grundzug von Elastizität eignet, dessen sichtbarster Ausdruck das Schweben und Gleiten der in ihr lebenden Figurenwelt ist. In all dem verdeutlicht sich von einer neuen Seite die spezifische Dynamik dieser Struktur. Wir verstehen, warum die Bewegung in ihr ohne Ungestüm bleibt, warum sie den Raum durchwaltet, ohne ihn zu überwältigen. (Abb. 4) Auch die im ersten Untersuchungsgang erwähnten Farbakzent- und Schleierräume möchten sich aus dieser Binnendynamik erklären. Denn ihr Wesen bezeichnet es, sowohl elastisch als gezügelt zu sein, ihr höchstes Ziel aber scheint darin zu bestehen, den Raum in einen Schwebezustand zu versetzen, dank dessen sich alles leichter und gefälliger in ihm ordnet als in der Wirklichkeit. Versucht man daraufhin den Gehalt einer solchen Architektur zu bestimmen, so läßt sich sagen, daß sie Teilhabe schenkt an einer Gegenwart, in der eine heiter und zwanglos wirkende Ordnung alle Unrast in belebte Ruhe verwandelt, das Lastende in leichtes Stehen oder Schweben, das Krause und Viele der Welt in schöne Mannigfaltigkeit. Die Säulen scheinen sich wie in Wonne zu strecken oder aneinanderzuschmiegen, die Gewölbe heben sich so leicht wie Segel. Schwebende Engel und tanzende Heilige sind dann die selbstverständlichen Bewohner dieser Räume, und Gegensätze, die im natürlichen Bereich hart aufeinanderstoßen oder sich ausschließen würden, etwa der Strom der vielen Senkrechten und Waagrechten im Gebälk oder das feurige Rot und Gold der Säulen und Altäre, harmonieren wie durch ein Wunder. Die Dinge verschönern und verklären sich in diesem Bereich, auch wenn oder gerade weil sie im Material 267 nicht immer echt, aus Stuck und Flitter sind. Und sicher ist es kein Zufall, daß auch das Licht, ob kulissenhaft verdeckt, oder durch Gitter und geschliffenes Glas gefiltert, wesentlich an der Idealisierung des Ganzen beteiligt ist. So dringt der Wechsel der Tageszeiten und Jahreszeiten nicht mit harter Unmittelbarkeit ins Innere, erscheint der Morgen in seiner Leuchtkraft gesteigert, der Mittag gemildert, der Abend verklärt. Lassen wir uns endlich auf Ausdruck und Gehalt der darstellenden Formenwelt ein, so erscheint es nicht weiter verwunderlich, daß auch sie in ihrem Wesen gehoben, vornehm, schönheitlich ist. Lässige Grazie bei den Heiligenfiguren, höfisches Pathos in den beiden Kaisergestalten am Choreingang, der unaufhörliche Jubel von Putten und Engelwesen, solche und andre Merkwürdigkeiten muten in ihrer Umgebung vollkommen selbstverständlich an. Und dies gilt auch für die natürlich-übernatürlich bewegte Szene der Deckenbilder. Der scheinbar wirkliche Himmel, in den sie überführt, ist zwar leicht verletzlich im Stoff, doch zwingend in seiner idealen Erscheinungskraft. Fragen wir schließlich nach der Teilhabe des Menschen an dieser Welt, so gehört er ihr zweifellos zu, verkörpert er sie doch mit in vielfacher Gestalt. Auf Cosmas Damian Asams Barockisierungsentwurf für den Freisinger Dom spiegelt der Einzug des Fürstbischofs das Gehaben der Deckenfiguren dermaßen genau wider, daß der Betrachter die irdische Szenerie von der himmlischen kaum unterscheidet. Aber wie der barocke Raum mehr ist als sein bloß Baumaterielles, so bedeutet auch die menschliche Gestalt in ihm nicht nur das natürliche, irdisch bedingte Wesen, sondern zugleich ein mit höheren Möglichkeiten und Kräften begabtes Geschöpf, belebt, geläutert und über sich hinausgetragen durch all das, was es selbst sich an Schönem und Göttlichem andichtet. Und dementsprechend ist es Bewohner und Mitgestalter einer Welt, die, aus seiner Perspektive geschaffen, ihm als ein Schöneres und in höherer Gesetzlichkeit Stehendes zugleich gegenübertritt. So ist es vielleicht der glücklichste, vom Glauben an ein göttliches Regiment in Welt und Menschheit vollerfüllte Augenblick des Abendlandes, den der barocke Raum verkörpert. (Abb. 4) Im Bayerischen Fürstenfeld aber, der Lieblingsstiftung der Wittelsbacher, stellt er sich besonders überzeugend dar, als ein Dasein, das Sakrales und Profanes, Höfisches und Bäuerliches, Irdisches und Himmlisches ideal vereinigt, das aber, wenn die Spannung zwischen den Extremen nachläßt oder zu groß wird, ein plötzliches Ende nehmen muß und es auch fand, in Revolution, Aufklärung und Säkularisierung. II Hier also, in der idealen, später „zopfig” verschrieenen Räumlichkeit des sog. Barock soll es nun sein, wo Anton Bruckners Messewerk sinngemäß 268 erklänge, eine Musik, von der wir immerhin soviel vorauswissen, daß sie nach dem Zusammenbruch dieser Barockwelt und ihres bejahenden Weltgefühls entstand, ihr Wesen also von dieser Tatsache mitgeprägt sein muß. Doch empfiehlt sich auch für den nunmehr folgenden Vergleich des Bauwerks mit dem Musikwerk der Weg der Einzelbetrachtung, und nicht der Spekulation. Er verweist uns zunächst auf einen zusammenfassenden Rückblick, der dem Formcharakter der Fürstenfelder Kirche zu gelten hat. Hält man sich nochmals ihre auch für die Barockzeit außergewöhnliche Größe vor Augen, so mag man es von daher wohl begründet finden, den Bau mit jenem Voluminösen, das aus dem ersten Eindruck der Brucknermesse spricht, in Verbindung zu bringen. Doch haben die Beobachtungen in Fürstenfeld gezeigt, daß das dortige Volumen ein äußerst modifizierter Wert ist. Seine Merkmale sind in exemplarischer Weise die Überschaubarkeit und Abmeßbarkeit, das Durchgliederte und doch Unerschütterliche, das Belebte und doch Gezügelte. Unsere spezielle Aufgabe wird es also sein, das ähnlich auffällige Volumen des Musikwerks auf sein Quale zu untersuchen. Erst danach werden wir nach dessen Vereinbarkeit mit dem Architekturwerk fragen können. Den Schwierigkeiten und Gefahren, die sich beim Vergleichen einer Komposition als einer Kunstform der Zeit mit einem Gebilde des Raumes ergeben, sei dadurch begegnet, daß eine gleichartige und beiden gemeinsame Form, die des Anfangens, zum Ausgangspunkt des Vergleichs genommen wird. Wie war es beim Eintritt in Fürstenfeld gewesen? Das Rauminnere hatte sich, vom Eingangsgitter ans Auge geholt und in der Wirkung gesteigert, als ein großes geschlossenes Bild aufgetan. Der Eindruck ist dem klaren, kernhaften Thema vergleichbar, mit dem die ältere Musik beginnt, näher noch jenen breiten Akkordfolgen, die wie hohe Tore am Eingang Händelscher Oratorien und Mozartscher Opern stehen. Bruckners Messe beginnt, nicht anders als seine Symphonien, fast unhörbar im Gestaltlosen. Man vernimmt zuerst nur eine Art Streichquartett mit undeutlichen Tonfolgen, aus weiter Ferne kommend. Dann, mit dem Hinzutreten der Singstimmen, nähert sich die Musik fast plötzlich und nimmt deutlichere Gestalt an. Auf „Kyrie eleison” gesungen erklingt eine in vier Schritten von der Tonika zur Dominante breit absteigende Folge der f-Moll-Tonleiter, ein Stück Treppe gleichsam, von bestimmter Tongestalt, doch ins Unbestimmte führend. Die Bewegung mündet nicht zur Tonika zurück, sondern wendet sich in der Wiederholung immer wieder ins Abgründige des Dominantbereiches, von ihm aus sich lastvoll höher stützend. Im mehrfachen Neuansetzen wird der Tonraum weiter und füllt sich mit dem immer mächtigeren Klang des Chores und vollen Orchesters auf. Dabei wandelt sich das Motiv der „Treppe” in unserer Vorstellung in diejenige von Armen, die sich weit auftun, die ganze Menschheit mit dem Erbarmensruf des Messe-Einganges umfassend. Doch kaum hat sich das Eleison- 269 motiv zu voller Mächtigkeit erhoben, so wird es von anderen Tonformen abgelöst. Diese tragen neue unabsehbare Empfindungswelten an uns heran, in denen der Anfangsgedanke untertaucht. Schon hier haben wir den Eindruck, daß es mehr als ein Raum ist, der sich vor uns öffnet. Und die Gebärde, die ihn auftut, umgreift ihn nicht, reißt ihn nur auf oder deutet ihn an. Wie anders also entwickelt sich die Form als in Fürstenfeld! Dort hatte sie den Sinn, die Formate genau zu bezeichnen und sie in anmutige, klare Distanz zu rücken. Hier bei Bruckner nähern sich die Töne und ihre Gestalten zwar aus weiter Ferne, aber nicht, um in höfisch gemessenem Abstand zu bleiben. Der ahnungsvolle Grund, aus dem die Klänge wachsen, ist aufgetan, das Näherkommen über die weiten Räume zu einem bezwinglichen Vorgang des Andringens und Verschlingens gemacht. So ist es schon diese die Distanzen einreißende Form des Werkbeginnes, die uns anzeigt, daß wir uns bei Bruckner auf einem dem Barock fremden, ja ihm womöglich feindlichen Boden befinden, und daß es revolutionäre Vorgänge gewesen sein müssen, die diese Wendung im künstlerischen Gestalten bewirkt haben. Denn die aufwühlende, den Hörer gewaltsam mitfortreißende Macht der Töne läßt uns nun während des ganzen musikalischen Formverlaufes nicht los. Dies bekundet sich darin, daß die einzelnen Stadien der Messe nicht wie früher sich zu selbständigen Gebilden formen, sondern ohne Zäsur ineinander übergehen. Ohne Pausen und Absätze trägt uns der Strom des musikalischen Geschehens, als erlebten wir ein Wandern, bei dem wie im Traum die Bilder und Erinnerungen ineinanderfließen und unser Inneres in beständiger lustvollschmerzlicher Bedrängnis halten. Dieser Eindruck eines gewaltigen, im einzelnen wohl eng verflochtenen, im ganzen aber unübersehbaren Vorgangs gründet sich auf die Struktur der Brucknerischen Musik. Mit ihr hängt es zusammen, daß wir uns keinen Augenblick aus dem beständigen Sich-Neuformen und wieder Zerfließen der Tongebilde und dem damit verbundenen Wechsel der Gemütsbewegungen entlassen fühlen. Hierfür ist zunächst das Verhältnis von Thematik und Harmonik bei Bruckner bezeichnend. Erstere ist, wie schon aus dem Anfangsmotiv deutlich wird, von prägnanter und zugleich abgerissener, bruchstückhafter Form – man kann an den skizzenhaften Pinselstrich der gleichzeitigen Malerei denken. Und diese im Grunde flüchtige Form finden wir wesentlich bestimmt und fortgetragen von der alles durchdringenden Gewalt der harmonischen Bewegungen. Diese sind nun aber ihrerseits, dank ihrer scheinbar unbegrenzten Labilität und Freiheit, in unaufhörlicher Verwandlung begriffen. Zwischen den oft konvulsivisch starken thematischen Gestaltbildungen und den vorwärtsdrängenden Kräften des harmonischen Elements besteht offenbar ein latenter Spannungszustand. Die Tongestalten bekommen durch ihn etwas Molluskenhaftes, grundsätzlich Fluktuierendes, so daß kaum einmal eine endgültige 270 Form des Themas oder eine klare harmonische Schlußbildung entsteht. Während des ganzen Tonablaufes befindet sich das musikalische Geschehen im Zustand der Umwälzung. Demzufolge liegen die Form und das Ziel der Tonbewegungen und inneren Vorgänge nicht mehr klar vor uns, wie dies in der Musik des 18. Jahrhunderts durch eine knappe thematische Periodisierung und häufige ruhepunktschaffende Kadenzbildungen der Fall war. Vielmehr bedeutet es gerade die eigentliche Kraft dieser Musik, daß ihr Fortgang Tausenden von Möglichkeiten offen bleibt und daß sie sich nur augenblicksweise in eine letzte thematische oder harmonische Gestalt einschränkt. Ihr Wesen ist die grundsätzliche Bewegung und Verwandlung. Gewaltige Ausweitungen wechseln sich mit engsten Zusammenziehungen ab, es kommt zu Ballungen und Explosionen größten Ausmaßes, denen dann Zustände der völligen Erschöpfung folgen. Charakteristisch für diese Musik sind daher die weit ausholenden Anläufe und die alles überschwemmenden Durchbrüche in mehrfacher Wiederholung. Es gibt für diese Phasen der musikalischen Entfaltung in allen Werken Bruckners eigens erfundene Themen und Rhythmen, auch werden sie meist von bestimmten orchestralen Farben getragen. Steigerung und Entladung sind es auch, die das eigentliche symphonische Gefüge bestimmen, da sie sowohl das lineare Stimmengeflecht wie den klanglichen Apparat zur höchsten Entfaltung treiben. Es entsteht dabei eine unabschätzbar reiche Skala dynamischer Abstufungen, die von den zartesten bis zu den brutalsten Klängen reicht. Aber nicht nur klangmateriell und in seinen Abläufen, auch gewissermaßen räumlich ist der Tonkörper ins Unendliche ausgeweitet. Sein vertikaler Klangaufbau entzieht sich – wie auch das Partiturbild ausweist – der genauen Kontrolle, so hoch verliert er sich nach oben, so weit reicht die Tonmasse in die Tiefe. Als gewaltiger Koloß wälzt sie sich einher oder stürmt dahin, aber auch in ihren plötzlichen Verkürzungen, wenn sie in höchste Höhen oder tiefste Abgründe verlagert ist, empfindet man ihren Umfang als ein Unermeßliches, oft Erschreckendes. Zusammenziehung und Ausladung folgen sich dabei oft in schroffstem Wechsel und bedeuten uns auch von dieser Seite, daß es ein grundsätzlich umwälzendes, revolutionäres Geschehen ist, dem wir beim Anhören unterworfen sind. Nach diesen Feststellungen braucht kaum ausdrücklich gesagt zu werden, daß wir es in Bruckners Werk mit einer andern Art von Volumen zu tun haben als beim Innenraum in Fürstenfeld. Der Begriff Volumen, für die Barockarchitektur sowieso wenig gebräuchlich, dürfte besser überhaupt aus deren Kennzeichnung herausgelassen werden. Denn mit ihm verbindet sich die Vorstellung einer in Größe und Struktur unbestimmten und wechselnden Raumart, die der Gestaltlichkeit der Barockarchitektur entgegengesetzt ist. Um so mehr aber gilt diese Volumenvorstellung für die Form Bruckners, ja, sie wird man als spezifisch voluminös bezeichnen. Die 271 Gegensätzlichkeit der Raumarten hier und dort ist also offensichtlich. Die Frage lautet nun, ob sie eine Vereinigung von Barockraum und Brucknermusik ausschließen muß. Bekanntlich ist im Bereich des Formalen der reine Gegensatz nicht notwendig ein negativer, er kann künstlerisch sogar ein erwünschter Faktor sein. Die hier verfolgte These von der Unvereinbarkeit beider Kunstwelten wird also, beschränkt sie sich auf die Formbetrachtung, kaum überzeugen. Man mag sie im Gegenteil der Prinzipienreiterei verdächtigen und in der spontanen Zustimmung der Konzertbesucher den Beweis eines unverbildeten Kunsturteils erblicken. Die Gegenfrage wäre, ob wir es hier wirklich mit einer Antinomie künstlerischer Art zu tun haben. Denn für sie gilt als Voraussetzung, daß eine Vergleichlichkeit besteht, die das Aufgehen der Gegensätze in einer höheren Einheit ermöglicht. Die Schroffheit, mit der sich in unserem Fall die Unterschiede gegenüberstehen, deutet jedoch auf deren Fehlen hin. Doch läßt sich in dieser Richtung schlecht weiterargumentieren, weshalb es fruchtbarer erscheint, die Betrachtung auszuweiten, um dadurch wieder überprüfbares Gelände zu gewinnen. Die Verbreiterung der Betrachtungsebene ergibt sich insofern aus der Sache selbst, als wir unsern Blickpunkt nur von der Gestaltungsweise auf die Gestaltungsträger zu verlagern brauchen. III Es konnte sowieso den Leser befremden, daß unsere Werkanalysen sich lediglich auf das Geschaffene selbst bezogen und deren Urheber außer Betracht ließen, so als wären diese von geringer Bedeutung. Was das Bauwerk betrifft, so schien in der Tat dessen Erbauer nur insoweit bedeutsam, als ihm die baukörperliche Substanz und das südliche Wohlverhältnis zwischen Bauschale und Raumgröße zu danken ist. Wollte man jedoch den Urheber des Bauwerks im ganzen benennen, so würde der bei dieser Gelegenheit erwähnte Name nicht genügen. Der kurfürstlich Bayerische Hofarchitekt Viscardi war zwar der nachweisliche Bauplaner, jedoch nicht einmal der Ersteller des Rohbaues, der erst nach seinem Tode, infolge des Spanischen Erbfolgekrieges, in Gang kam. Auch ist von dem (nicht erhaltenen) Bauplan während der Jahrzehnte dauernden Ausführung offenbar nur die allgemeine Anlageform verwirklicht worden. Alles übrige, was, wie wir zeigen wollten, den Raumeindruck mitentscheidet, entstammt hier den Händen einer Vielzahl von Dekorateuren, Stukkateuren, Bildhauern, Malern, Möbelschreinern usw., die damals bekanntlich auch sonst das Bauwerk mitzugestalten pflegten. Den einen, für das Ganze verantwortlichen Werkschöpfer oder Auftraggeber hat es in Fürstenfeld jedenfalls nicht gegeben, ganz so, wie es auch für andere Hauptwerke der Zeit zutrifft. Die Frage nach dem Zustandekommen des Werks führt in Fürstenfeld also nicht in erster Linie auf den oder die Schöpferpersonen, son- 272 dern auf das Werk selbst und die Beteiligung an ihm. Erklärt dies einerseits, daß es viele sind, die es verantworten, so deutet es andrerseits darauf, daß das Werk nicht der subjektiven Vorstellung Einzelner oder eines Einzelnen entsprang, sondern daß es ein diesem Gegenüber- oder Über-ihm-Stehendes, Objektives ist, was seine Gestalt voraus bestimmt. Anders verhält es sich beim Musikwerk Bruckners. Diesem fehlt ganz offenbar die Allgemeinheit und Verbindlichkeit des Gegebenen. Alles erscheint bewirkt von dem Willen und inneren Müssen eines Einzelnen. So breit und umfassend Anlage und Ablauf seines Tonwerks sind, allein die Plötzlichkeit der tonlichen Wandlungen läßt erkennen, daß es Produkt eines nicht von außen gegebenen, sondern inneren Anlasses ist. Von diesem wird der musikalische Kosmos bis in alle Einzelheiten und bei jedem Werk wieder anders, aber jeweils völlig neu geprägt. Es ist daher bei dieser Musik auch nicht denkbar, daß sie sich, wie es in der Barockzeit selbst bei den Größten geschah, Anleihen aus fremder Quelle bediente oder auch nur Varianten und Wiederholungen aus dem eigenen Schaffen erlaubte. Jedes schon Vorgeformte, und sei es das Thema von Variationen, mußte für einen solchen individuellen Gestaltungswillen ausscheiden. Der Quell, aus dem er schöpfte, konnte nur das Schöpferinnere in seiner ganzen Unergründlichkeit sein. Nicht auf die Darstellung eines objektiv Schönen und Richtigen also, sondern auf Unmittelbarkeit und Wahrhaftigkeit der Aussage mußte sein Streben sich richten. Man wird kaum einen Zufall darin sehen dürfen, daß trotz des unüberbrückbar erscheinenden Gegensatzes der Person, Richard Wagner, der stärkste Vertreter dieses künstlerischen Individualgeistes, es war, der das große künstlerische und auch menschliche Ereignis im Leben Bruckners bedeutete. Wohl handelt es sich bei Bruckner nicht um Wagners vorwiegend den menschlichen Leidenschaften zugewandte Ideen- und Empfindungswelt. Denn die seinige ist mehr auf das Kosmische und Religiöse gerichtet. Das beiden Gemeinsame und für Bruckner erlösend vorbildliche Moment besteht jedoch in der Art der Darstellung dieser verschiedenen Bereiche. Bei beiden ist sie unmittelbarer, leidenschaftlicher Natur. Darauf deutet bei Bruckner eben jener Formcharakter, den wir hier pauschal revolutionär genannt hatten, und weist im besonderen das, was in Wagners Tonsprache seinen eigentlichen Ursprung hat, das gewaltige Espressivo dieser Musik, ausgedrückt in den großen Crescendi, den Pressungen und Auflockerungen des Klanges, dem breiten Hinauf und Hinab der Tonbewegungen. Jene Anpassung der musikalischen Abläufe an das Auf und Ab der menschlichen Gefühle und Einbildungen – eben das also, was die Theoretiker seiner Zeit an Wagner zutiefst entsetzte –, sie bestimmte nicht nur die wagnerische, sondern auch die zwar voluminösere, aber deshalb nicht weniger emotionelle brucknerische Tonstruktur: Dies bestätigt sich bei Bruckner durch die Tatsache, daß auch bei ihm, beinahe 273 noch stärker als bei Wagner, die musikalische Entwicklung den Weg des zunehmend gesteigerten Gefühlsergusses gegangen ist. Während die Frühwerke noch eine fast starre, heftig gegensätzliche Formensprache haben, löst und schmeidigt sich diese von Werk zu Werk und gelangt in der letzten Symphonie (Scherzo!) zu einem fast wilden, das Orgiastische streifenden Überschwang. Zur Frage der zeitlichen Inauguration dieser Musik sei auf den Satz Nietzsches in „Wagner und Bayreuth” verwiesen: Beethoven „zuerst ließ die Musik eine neue Sprache sprechen, die bisher verbotene Sprache der Leidenschaft reden”. Ihre historische Ansatzstelle liegt also schon vor Bruckner und Wagner, aber auch weit hinter der Barockphase. Suchen wir nach Verwandtem in den bildenden Künsten, so finden wir es am ehesten in der wetterleuchtenden, proteushaften Gestaltlichkeit Daumiers oder Rodins. Und zu den Ahnen dieser Musik wird man neben Beethoven und Schubert jene inbrünstige, stimmungsmächtige Landschaftsdarstellung rechnen müssen, die wir erstmals in den Werken Caspar David Friedrichs antreffen. Man denke besonders an dessen im Augenblicksausdruck wie gefangenen Nacht- und Ruinenbilder oder an jene im Eisigen erstarrte, extreme Situation des in der Arktis gestrandeten Schiffes. Damit aber befinden wir uns mitten in der vom Subjektivismus beherrschten Sphäre des 19. Jahrhunderts – und weitab von der klar objektivierenden Kunstwelt des Barocks. Denn wenn wir das Gemeinsame zwischen Bruckners Musik und den Entsprechungen in der bildenden Kunst zu bezeichnen suchen, so ist es der fast heilige Drang zur Unmittelbarkeit und Wahrhaftigkeit der Aussage. (Daß die Wahrheit des Ausdrucks das höchste in der Kunst sei, hat vor allem Wagner immer wieder ausgesprochen.) Der Gegensatz solcher Überzeugungen zur Kunst des Jahrhunderts, zu ihrer ganz aus der Mittelbarkeit kommenden, auf geschliffene Schönheitlichkeit hinzielenden Formensprache, könnte nicht offener zutage liegen. Während wir aber in der Malerei und Plastik des 18. Jahrhunderts neben den Ausdruckskünstlern, also vorwiegend den sog. Romantikern und den Realisten, noch eine am Älteren festhaltende „klassizistische” Tradition lebendig sehen, steht im Zentrum des musikalischen und zumal des Brucknerischen Gestaltens nicht mehr das Darstellen sondern das Erleben. Nicht wie die Welt außer uns ist, nicht also das, was man die leonardeske Seite des Daseins nennen könnte, sondern die menschliche Innenwelt bildet jetzt das Hauptanliegen der Kunst. Dementsprechend handelt es sich in Bruckners Musik nicht mehr um ein Verkörpern und Verdichten, sondern – speziell in den Tuttistellen und Coda-formen – um ein gewaltiges Aufbrechen- und Verdampfenlassen der Form. Kein Wunder, daß uns diese Musik so eminent „musikalisch” anmutet, als Höhepunkt einer Entwicklung, bei der aus den Möglichkeiten des Formablaufs in der „Tiefe” der Zeit letzte Folgerungen gezogen sind. Während in Renaissance und Barock sich alles Innere nur insoweit auftat, 274 als es am Körperhaften sichtbar und verklärbar zu machen ist, geschah bei Bruckner das entgegengesetzte: das Innere verwirklichte sich nunmehr unmittelbar, als spezifisch Inneres, und damit war dem lediglich Hörbaren, der musikalischen Ausdrucksform also, eine bisher unbekannte Bedeutung verliehen. Und ein weiteres gefährlich Folgenreiches entstand daraus: nur noch in der erlebenden Person, nicht mehr im objektivierenden „Bild” hängen jetzt äußere und innere Welt zusammen. Fragen wir uns nach diesen Feststellungen, welch einen Raum die Musik Bruckners zur Aufführung wohl verlange, so kann es wohl nur einer sein, der dieser Tatsache des Auseinanderbruchs von äußerer und innerer Welt entspricht. Er müßte es erlauben, daß wir uns in ihm ganz dem Hörbaren, Inneren hingeben, selbst gewissermaßen Inneres werden können. Zu den wenigen Musikern, die sich zum Aufführungsraum erstmals Gedanken machten, zählt wohl nicht zufällig Richard Wagner. Um „das Publikum zu der Andacht zu stimmen, ohne die kein wirklicher Kunstgenuß möglich ist”, lehnte er bekanntlich für Bayreuth das Logentheater als zu gesellschaftlich ab. Und die Versenkung des Orchesters unter das Parkett begründete er nicht akustisch, sondern mit der Störung, die „der unerläßliche Anblick der mechanischen Hilfsbewegungen beim Vortrage der Musiker und ihrer Leitung” verursacht. Den möglichst nackten Raum also, ein durch nichts ablenkendes Neutrum hätte Wagner wohl auch als Konzertraum gefordert, von der Art vielleicht jenes völlig kahlen Ateliers, in dem wir C. D. Friedrich, von seinem Freunde Kersting gemalt, vor der Staffelei versunken stehen sehen. Es ist derselbe Friedrich, dessen Forderungen an den Künstler in dem Satze münden: „Schließe Dein leibliches Auge, damit Du mit dem geistigen Auge sehest dein Bild”. Dies Bekenntnis und der Raum, in dem Friedrich seine Forderung zu erfüllen trachtete, könnten nicht genauer zusammenstimmen. Das haben schon die Zeitgenossen empfunden und auch dies, daß etwas erschreckend Neues damit ausgesprochen sei. (Siehe darüber die „Erinnerungen eines alten Mannes” von Wilhelm Kügelgen.) So ist also der bildende Künstler schon am Beginn des 19. Jahrhunderts gegen den eigentlich geformten und ausgestatteten Raum empfindlich geworden. Um wieviel mehr muß oder müßte es der Musiker und sein Zuhörer von heute sein! Demnach also eigentlich kein Raum oder eben nur ein neutrales, den inneren Welten verträgliches „Innen” wäre das Zugehörige nicht nur zur Musik Bruckners sondern zu derjenigen seiner ganzen Zeit – und Räume wie die Pariser Salle Pleyel, die neue Stuttgarter Liederhalle oder auch das moderne Lichtspielhaus versuchen dieser Forderung neuerdings nachzukommen. Die kahle, der bloßen Hörgelegenheit dienende Form stellt nun zweifellos den denkbar größten Gegensatz zu dem dar, was uns an der Raumform in Fürstenfeld begegnet ist. Am allerwenigsten also, müssen wir daher folgern, kann für die Aufführung Brucknerischer Musik ein Raum des späten 275 Barocks mit seiner betonten Gestaltlichkeit, seiner Fülle und seinem das Auge fesselnden Glanz das gemäße sein; und so wären wir bereits ans Ende der eingangs gestellten Frage gekommen. IV Darf man sich jedoch kraft dieser Gegenüberstellungen des hier eingenommenen Standpunktes schon sicher fühlen? Wurde mit Vergleichungen, die lediglich Barockarchitektur einerseits, Musik und Kunst des 19. Jahrhunderts andrerseits betreffen, nicht viel zu einseitig verfahren? Gibt es nicht vielleicht doch manches, was an der ernüchternden Negativität des bisherigen Ergebnisses zweifeln läßt, oder uns wenigstens eine Hintertür öffnet, durch die das ästhetische Gewissen einen Ausweg aus dem Getrennthaltenmüssen der beiden Bereiche fände? Zum mindesten ein Einwand gegen unsere bisherigen Deduktionen ist schnell bei der Hand: die Musik der früheren Jahrhunderte. Gab es nicht auch schon in ihnen, also gerade zur Zeit der barocken Raumarchitektur mit all ihrer „ablenkenden” Pracht und Fülle eine sehr innerliche, rein musikalische Musik? Man wird dabei an Bach, aber auch an Palestrina, die Niederländer und die Spanier des 16. Jahrhunderts denken. Und ist diese damalige Musik nicht ausdrücklich in die barocken Räume hineinkomponiert worden? Indem diese Fragen ausgesprochen werden, bringen sie uns zum Bewußtsein, daß unsere bisherigen Erörterungen sehr wohl in einer groben Antithetik befangen geblieben sein können. Hier nur Äußerlichkeit und Bildcharakter zu sehen, dort nur Musikalität und Innerlichkeit, unterstellt Gegensätze zwischen den Epochen und Kunstwelten, wie sie in solcher Ausschließlichkeit kaum bestehen können und wohl auch tatsächlich nie bestanden haben. Denn bekanntlich „überwindet” keine Kunstzeit radikal ihre Vorgängerin, umfassen auch Kunstarten weit mehr, als es ihre Gattungsgrenzen möglich erscheinen lassen. Waren etwa, um nur einige Beispiele herauszugreifen, der sächsische Hof- und Goldschmied Johann Melchior Dinglinger oder der Porzellanbildner Bustelli nur Kunstgewerbler oder nicht vielmehr führende Plastiker ihrer Zeit, muß der bayerische Oberhofbaumeister François Cuvilliés d. Ä. nicht auch zu den größten Ornamentikern und Dekorateuren gezählt werden? Und haben nicht Bach und Schütz, Dürer und Rubens in ihrer Schöpferperson Zeiten und Nationen umfaßt? Betrachten wir also den Zweifel am Fazit der bisherigen Darlegungen als eine Gelegenheit, das Verhältnis der festgestellten Gegensätze in der kunstgeschichtlichen Realität zu untersuchen. Im Blick auf sie dürfte es am nächsten liegen, die mögliche Beziehung des Musikalischen zum Bildkünstlerischen zuerst ins Auge zu fassen. Denn daß Bild und Musik zur künstlerischen Vereinigung gebracht werden können, ist uns von der Oper her längst geläufig. Weniger allgemein bekannt ist die Tatsache, daß auch 276 die Kirchenmusik eine Zeit hatte, in der sie im szenischen Gewande auftrat. Neben den zeitgenössischen Berichten beweisen es zahlreich erhaltene Stiche, daß zum Beispiel Händel seine Oratorien wie Opern inszeniert hat, wobei die reich kostümierten Solisten und Chöre ein prächtiges Schaubild abgegeben haben müssen. Wir dürfen ferner annehmen, daß schon bei Schütz und dann bei der Wiedergabe von Bachs Passionen die räumliche Verteilung der Mitwirkenden (auf den noch heute vorhandenen Emporen der beiden Leipziger Hauptpfarrkirchen St. Thomas und St. Nikolai) mit dem räumlichen Bau seiner Musik im Zusammenhang gestanden hat. Bildwerden und plastisch-räumliches Vergegenwärtigen der Musik waren also damals nicht nur Sache des Operntheaters sondern auch des kirchlichen Aufführungswesens. Wichtiger aber als ihre äußere Aufmachung ist die Frage nach der inneren Bildkräftigkeit der damaligen Musik. Betrachten wir dazu die innerlichste Tonsprache der Barockzeit, die Bachsche Kirchenmusik. Ein Werk wie die Matthäuspassion gliedert sich bekanntlich in fünf verschiedene Teilnehmergruppen. Den Rahmen bilden die die „Tochter Zion” verkörpernden großen Eingangs- und Schlußchöre. In ihm eingebettet erscheinen als die dramatisch führenden Gestalten der Evangelist und die von ihm aufgerufenen Personen der Passionsgeschichte, miteinander verbunden durch die ihnen gemeinsame Mitteilungsform des Rezitativs. Ihnen zunächst fungieren die an der „Geschichte” mitbeteiligten Chorpersonen der Jünger, der Juden und des Volkes, während die in den Arien sich leidenschaftlich-dramatisch äußernde Tochter Zion und die im Choral ideal vergegenwärtigte, innig sprechende christliche Gemeinde verschiedene Gruppen von Anteilnehmenden verkörpern. Das reiche Ensemble stuft und verflicht sich vielschichtig wie ein monumentales Relief und repräsentiert eine von der Erde bis in den Himmel reichende ideale Welt. Die Verwandschaft zum sichtbaren barocken Raum, zu dessen reich gestaffelter und ideal bewegter Szenerie, ist zu spüren. Wie genau das Gesetz der Gruppensonderung und -Entsprechung eingehalten ist, erkennen wir daran, daß ihm die Einheitlichkeit der Gesamtstimmung des Werkes ohne weiteres aufgeopfert ist oder richtiger gesagt, daß eine solche Gesamtstimmung bei Bach um der Klarheit der Gruppenzusammenhänge willen noch gar nicht angestrebt ist. Bachs Werk wie das seiner Zeitgenossen steht damit im denkbar großen Gegensatz zu jener vollendeten Kunst der Übergänge und des Ineinanderstimmens, die ein Hauptanliegen des 19. Jahrhunderts war und die selbst der hassende Nietzsche noch seinem einstigen Idol Wagner hoch angerechnet hat. So geschieht es in der Matthäuspassion, daß (wie bei der Flötenarie „Aus Liebe will mein Heiland sterben”) in die zart versponnene Zuständlichkeit einer langen, verhaltenen Klage die abrupte Turbulenz eines wilden Chorsatzes („laß ihn kreuzigen") scheinbar „stimmungstötend” einbricht, 277 ein Kontrast, der in heutigen Aufführungen des Werks durch gewaltsame Zusammenziehung der Formen dramatisch zu motivieren gesucht wird, während er zweifellos aus dem episch begründeten Wechsel starker, in sich gefestigter Bilder entwickelt werden müßte. (Das Vielschichtige von Bachs Passionstyp zeigt sich auch in seinem episch-dramatischen Mischcharakter.) Bezeichnend für das heutige noch stark romantikverhaftete Bachverständnis ist, daß die Arien, die auf den freieren Erguß arioser Rezitative folgen, von den Dirigenten oftmals gestrichen werden. Man schätzt es nicht, daß der ergreifende Gefühlston von „Mein Jesu schweigt zu falschen Lügen stille” sich in der darauffolgenden herrlichen Arie keineswegs fortsetzt, sondern dort unvermittelt in die drastische Schilderung des Stechens und Falschklingens der „Lügen” (auf den Text „Geduld, Geduld, wenn mich falsche Lügen stechen”) umschlägt. Das rein textliche Moment der Falschheit scheint hier äußerlich betrachtet das einzig Verbindende zu sein. Es ist aber wohl für Bachs musikalisches Denken sehr bezeichnend, daß die im freier behandelten Rezitativ hervorbrechende, fast naturalistisch stockende Gefühlssprache des von der Falschheit betroffenen Gemüts sofort in der gebundeneren Form der Arie aufgefangen wird – während wir es allerdings seit der Wagner-Bruckner-Zeit nur allzusehr gewöhnt sind, aus einem Gefühlserguß in den andern zu gleiten. Auch im Bereich der Empfindung erleben wir dort den kräftigen Wechsel von frei und gebunden, aus dem die großen Kunstzeiten ihre Wirkungen ziehen. So wenig sich die ekstatisch bewegten Engel und Heiligen im barocken Raum auflösen, verströmen Bachs Gefühlswelten ins Unendliche. Vielmehr werden sie immer wieder in fast nüchtern anschauliche Formen, ja Bilder gestaut. Denn die innere Verwandtschaft zwischen damaliger Kunst und Musik, wie sie sich im Kompositionellen ergibt, stellen wir auch in der Einzelformung hier und dort fest. In Arie, Arioso, Chorfuge, Choral und Rezitativ begegnen wohlabgegrenzte, plastisch anmutende Gebilde. Ihre starke Anschaulichkeit liegt schon in der Thematik begründet, die dicht und sinnfällig in der Form, in der Bewegung „rund“ ist (sie fließt stets zum Ausgangspunkt zurück). Dieser Eindruck des Knappen, Plastischen verstärkt sich wesentlich dadurch, daß die Themen oft an ein konkretes Bild oder einen Vorgang anknüpfen (in der Passion: Strömen der Menge, Weinen, Geißelschläge, Kreuzform u. a.) und daß diese Bildbeziehung auch in der „Durchführung” des Themas festgehalten wird (während wir bei Bruckner gerade das ständige Sichwandeln solcher „Bilder” feststellen). Nicht nur die vokale, auch Bachs instrumentale Musik lebt trotz oder gerade wegen ihrer Empfindungsfülle aus dieser spezifischen Bilderfreudigkeit, die nichts anderes als eine Konsequenz ihrer gezügelten Kraft darstellt (die naturalistischen Bilder der sog. Programm-Musik haben damit verglichen etwas Ausschweifendes). Denn jene Bachsche Bilderfülle würde in ihrer Bedeutung verkannt, wollte man sie als 278 etwas Einmaliges oder gar Abseitiges einschätzen. Vielmehr ist sie ein zeitübliches, durch Bachs Phantasiekraft allerdings wunderbar nuanciertes Ausdrucksmittel, erwachsen aus der aller damaligen Musik eigenen „Figürlichkeit”. Unter dem Eindruck der gewaltig ornamentalen Kräfte in Bachs Instrumentalmusik stehend, mag allerdings die hier hervorgehobene Beziehung zum Bild, wie sie in Bachs Vokalwerken besteht, nicht jedem einleuchten. In der Tat sind das Ornamentale und das Bildliche Mächte, die in den uns geläufigen Kulturen (zumal den frühen) sich eher ausschließen als dulden oder gar sich vereinigen (siehe den Orient und das frühe Mittelalter). Auch bei dieser Frage hilft ein Blick auf die gleichzeitige Kunst zum Verständnis mit: In den Asamschen Altar- und Gewölbedekorationen bilden Figur und Ornament unlösliche Formgeflechte, und im Kaisersaal der Würzburger Residenz ist es möglich, daß die großen venezianischen Bilderszenen Tiepolos sich mit der „absoluten” Raumarchitektur Balthasar Neumanns verbinden. Es sind offenbar die reifen Kunstzeiten, in denen Verschmelzungen von Bild und Ornament zustande kommen, ja offenbar zum Bedürfnis werden. In diesen Zusammenhang gehört, daß die Bildersprache bei Bach offenbar mit im Dienste der Gruppenbeziehungen steht. Denn es mag kein Zufall sein, daß etwa das klagend sich fortwälzende Zusammenströmen der Menge im großen Eingangschor der Matthäus-Passion (Sekundenfortschritte und Fugierungsweise des düstern e-Moll-Themas) im Wegfliehen der Jünger am Schlusse des ersten Passions-Teiles sich löst (fließende Sechzehntelfigur im hellen E-Dur der orchestralen Einbettung des Chorals „O Mensch, bewein dein Sünde groß“), ebenso wie das ängstliche Suchen nach dem gefangen weggeführten Heiland (in der Chorarie des beginnenden zweiten Teils „Ach, wo ist mein Jesus hin”) über alle nachfolgenden Passionsereignisse hinweg in dem mächtigen Beweinungsbilde des Schlußchores seine endliche Beruhigung findet. Aus der Einheit von Bild und Ausdruck gewinnt das Werk seine den Schmerz verklärende Kraft, man könnte wohl auch sagen, seine Schönheit. Anschaulich in diesem plastisch-figürlichen Sinne ist aber nicht nur die Einzelerfindung dieser Musik, sondern auch ihr musikalischer Verlauf in der Zeit, die Durchführung der Motive, selbst wenn diese, zumal bei Bach, noch so sehr ins große geht. Denn nirgends wird, wie es bei Wagner und Bruckner der Fall ist, der Themenkern verletzt, aufgespalten oder gar aufgelöst, und stets bleibt nach der harmonischen Seite, wenn auch oft unbewußt, die Beziehung zum Grundton gegenwärtig. Man könnte diese Gebundenheit des Formablaufs mit der Kontinuität und axialen Artikulation des barocken Raumes und seiner Figuren in näheren Vergleich stellen. Wohl ist gerade bei Bach die Tonsubstanz vermöge ihrer Dichte stets in 279 starker, durch die Tonarten sich windender Bewegung, bei Händel wiederum strotzt sie von rhythmischer und akkordlicher Fülle. Doch verliert sie bei beiden nie das spürbar Plastische, wie es ja auch bei der Wiedergabe ihrer Musik auf gußreine Sauberkeit, Ebenmäßigkeit und „Vollrundheit” ankommt. (Wagner und Richard Strauss haben dagegen bekanntlich den Orchestern zur Ausführung massiger und rein farbiger Wirkungen ausdrücklich das „Schmieren” beigebracht – aber schon in Beethovens Klavierwerken gibt es Glissandostellen; die den Meistern des „perlenden” Spiels ein Greuel gewesen sein müssen.) Dies Runde und gewissermaßen Greifbare der Form ist neben vielem anderen auch dadurch gestützt, daß der Tonbereich der damaligen Musik selten über mehr als drei Oktaven hinausreicht und zumeist die Mittellage einhält. (Siehe auch die an den „Rändern” häufig „umgebogene” Stimmführung. Entsprechend dazu bewegt sich die harmonische „Durchführung” der Hauptthemen und ihrer Gegenspieler in einem festen, gleichsam vorgegebenen Tonartenzirkel, der das oft uferlose Modulieren der nachklassischen Musik unmöglich macht. So bestätigt sich auch vom Harmonischen her, dem eigentlichen Bereich des Emotionellen und Subjektiven in der neueren Musik, der objektive, mehr darstellende als ausdrückende Charakter der Barockkünste. Eine geradezu räumliche Gebahntheit der harmonischen Bewegung ergibt sich im besonderen aus der bekannten Rolle des Generalbasses, der dem Stimmengefüge nicht nur die feste Grundlage schafft, dessen einfache und harmoniegesetzlich streng geregelte Fortschreitungen auch den musikalischen Verlauf kontrollierbar halten. Phraseologische Ablaufgesetzlichkeiten wie die der choralischen Liedform, der A-B-AStruktur in den Arien, der Variationen- und Fugenform bestätigen das Bild einer Formenwelt, die bei all ihrem äußeren Umfang und dem inneren Reichtum des Ausdrucks so kristallinisch rein gebildet ist wie – das darf jetzt wohl gesagt werden – die damalige Architektur. Gewiß, die äußeren „Bilder” von Konzert oder Oratorium und barockem Innenraum differieren weit und lassen sich schlecht miteinander „vergleichen”. Sobald wir aber die tieferen Schichten der Formbildung herausheben, strömen uns die Vergleichspunkte zu und bestätigen ein Gefühl, das den Zusammenhang der Künste innerhalb der Epochen, vollends in der Einheitskunst des Barocks, herausspürt. Natürlich bestehen große Unterschiede der Art und des Nährbodens innerhalb der verschiedenen musikalischen Bereiche bzw. der kirchlichen oder profanen Raumbildungen. Den sehnigen und gestreckten Tonfiguren der protestantischen Kirchenmusik etwa entspricht es sehr, daß sie in den karger ausgestatteten, strukturell härteren Räumen Norddeutschlands (zumal den gotisch gebliebenen) zu Hause sind, während wir der reicheren und klingenderen Räumlichkeit des deutschen Südens die farbige Welt der Oper zugehörig empfinden. Aber jeder, der beim Musikhören nicht in 280 Abgründe versinkt, wird die Erfahrung machen, daß z. B. ein Bachsches Konzert oder Orgelwerk gerade auch in sehr festlichen Kirchenräumen – es sei an Ottobeuren mit seinen herrlichen alten Orgeln, aber auch an italienische Barockkirchen erinnert – besonders „lebendig”, figürlich lebendig wird, daß hier also die Musik mit dem Figürlichen der sichtbaren Formen aufs schönste harmoniert. Man wird dabei die in diesem Zusammenhang wichtige „Beobachtung” machen, daß die Bewegungen der Musik samt den von Wagner aus dem Blickfeld verbannten „mechanischen Hilfsbewegungen” der Ausführenden durchaus innerhalb des gebauten Raumes bleiben. Da sie an die plastisch-gegenständliche Art ihrer Form und Bewegungsweise gebunden sind, neigen sie nicht dazu, aufzuquellen und in Unendliches zu zerfließen (wie dann im 19. Jahrhundert), sondern sich im Gegenteil zu verdichten und ineinanderzuschlingen, so daß es dann beim Erklingen des letzten Tones ist, als sei eine aus festem Sockel hochgewundene Formfigur zu ihrem Ausgangspunkt zurückgeführt. (Wie unendlich dagegen dünken uns die Räume, die wir nach dem Anhören einer modernen Symphonie durchmessen haben.) Wohl nicht von ungefähr spricht man da, wo in der Fuge die Themeneinsätze sich hintereinanderstauen, von „Engführung”, ein Ausdruck, der bei den (äußerlich verwandten) themenkoppelnden Stellen in Bruckners Werk kaum anwendbar wäre. Denn hier erleben wir die Akkumulierung der musikalischen Substanz gerade als die Phase der größten Formausweitung. Während also im einen Fall das kontrapunktische Prinzip dazu erfunden erscheint, den Formverlauf zu runden, ihn bei aller „Verinnerlichung” nur immer mehr zu verdichten, reißt es im anderen Fall die Form auf, „vertieft” sich diese, indem sie eine Ausweitung ins Unendliche erfährt. Ein ähnliches Phänomen hat Theodor Hetzer in der Malerei festgestellt. Er verwies darauf, daß wir in vielen Bildern der Barockzeit an kompositionell wichtiger Stelle eine Vase, einen Obilisken oder sonst einen kubisch festen Gegenstand finden, an dem sich auch die bewegteste Szene beruhigt, während diese Dinge im 19. Jahrhundert aus dem Bild verschwinden und an ihre Stelle eine betonte Öffnung der Bildfläche tritt. So stehen sich also nicht nur beim Vergleich von Barockkirche und Brucknermusik, sondern auch innerhalb der Musik- und Kunstentwicklung Ausweitung und Verdichtung als Gegensätze der neueren zur älteren Zeit gegenüber. Und manche andere Polarität dieser Art ließe sich hier anschließen. Denn Verdichtung, das ist ja zugleich Basis und Ausdrucksweise des Körperhaften, Bildkräftigen, Darstellenden – Ausweitung, sie führt zur Auflockerung, Subjektivierung, Verflüchtigung. Demgemäß bleibt die Musik des 18. Jahrhunderts stets „im Bilde”, in dem sie als Hörbar-Sichtbares mitschwingt, während sich die Musik der Folgezeit von ihm trennt und damit naturnotwendig dem Nur-Hörbaren verfällt – womit dann allerdings die Oper für diese Zeit unmöglich geworden wäre! 281 V Eine solche Folgerungsmöglichkeit führt nun allerdings vor eine Frage, die unsere ganze bisherige Beweisführung zweifelhaft erscheinen läßt. Denn die Entwicklung der Oper hat ja mit dem Ende des 18. Jahrhunderts keineswegs zu existieren aufgehört, vielmehr gerade zu Lebzeiten Bruckners einen ganz neuen Aufschwung erlebt. Bemühen wir uns also noch um diese Gegenprobe, zumal die kunstvergleichende Betrachtung auf dem Felde der Oper besonders naheliegt, wenn sie im Hinblick auf Bruckner auch nur mittelbare Bedeutung haben kann. Halten wir uns dabei an das Werk Wagners, da es demjenigen Bruckners im Wesen so stark verwandt erscheint. Zudem gelangen wir dabei in die spezielle Problematik der modernen Oper hinein. Denn bekanntlich ergeben sich aus den Berührungen des musikalischen mit dem szenischen Raum in der Wagneroper nicht nur für Regisseure und Bühnenbildner, sondern auch für das unbefangene Publikum mancherlei Überraschungen. Greifen wir eine von vielen heraus. Während es in einer Mozartschen Oper nicht im geringsten geniert, wenn der Chor in der Rolle des mehr oder weniger munteren Statisten verharrt (das Wort ist stammgleich mit Statik), verursacht seine „Belebung” bei Wagner stets die größten Schwierigkeiten. Denn der Chor hat hier (besonders im „Lohengrin” und in der „Götterdämmerung”) eine seelendramatische Funktion, die ein nicht ganz entsprechendes sichtbares Mitgehen zur peinlichsten Illusionsstörung werden läßt. (Nietzsche hat im speziellen Hinblick auf Wagner den Ausspruch getan, daß „niemand seine feinsten Sinne mitbringt, wenn er ins Theater geht“.) In der Tat ist uns der hinter einer Säule sitzende, ganz in die Partitur oder ins Hören versunkene Theaterbesucher gerade in Wagneraufführungen ein vertrautes Bild, während es bei einer Gluck- oder Mozartoper kaum jemanden einfallen würde, den Blick länger von der Bühne zu wenden. Warum das dort einen so breiten Raum einnehmende Ballett im Wagnerdrama eine Unmöglichkeit ist, gehört wohl mit in diesen Zusammenhang. Doch lassen wir die Frage hier beiseite und halten uns an die tatsächlichen szenischen Vorgänge bei Wagner. Es besteht wohl wenig Zweifel darüber, widerspricht aber zunächst ganz dem historisch zu Erwartenden, daß das Bühnenbildliche bei Wagner keineswegs weniger bedeutet, als in der älteren Oper. Ja, was szenischen Aufwand, räumliches Ausmaß und farbige Entfaltung anbelangt, so haben ich bei jener die Ansprüche gegenüber früher außerordentlich gesteigert. Dies würde mit dem vergrößerten Klangapparat des Orchesters, der Steigerung des stimmlichen Aufwands (Vermehrung der dramatischen Tenöre), der neuen Breite und Fülle des Symphonischen in Wagners Musik übereingehen und findet seine Entsprechung in den über die Barockzeit weit fortgeschrittenen bühnentechnischen Möglichkeiten und Ver- 282 lockungen. Aber auch umgekehrt: das weitausholende, im Rhythmus der menschlichen Empfindung schwingende symphonische Geschehen verlangt offenkundig danach, daß die Szene von starken und gegensätzlichen Bildern, intimen Interieurs und dann wieder ausgesprochen elementaren, romantisch übersteigerten Vorgängen und Zuständen erfüllt ist. So nimmt es nicht wunder, daß in Wagners Musikdrama vor allem die Naturereignisse, Sonnenauf- und untergänge, Gewitterstürme und andere bewegte außenräumliche Vorgänge eine große Rolle spielen und durch ihren Gegensatz zu den ihrerseits intimisierten Interieurszenen gesteigert hervortreten. Dabei ist es nun für die Bühnenvorgänge der Wagneroper bezeichnend, daß viel stärker als in der Barockoper, und zweifellos im engen Einvernehmen mit den musikalischen Ereignissen, das Hintergründige mitspielt und sich häufig die Szene unterwirft. Der „mystische Abgrund”, aus dem die Orchestertöne kommen, hat hier seine Entsprechung auf der Szene, öffnet sich auch in der bildlichen Sphäre. (Nach Auffassung des Bühnenbildners Emil Preetorius ist es bei Wagner das Orchester selbst, was sich in allem der Szene überordnet.) So bilden bereits im „Fliegenden Holländer” das Meer und die Schiffe in Einheit mit dem Schicksal des Seefahrers eine szenische Macht, die die biedermeierliche Vordergrundswelt Sentas immer stärker bedroht und schließlich überwältigt. Untrennbar sind im zweiten Akt des „Tristan” die duftende Sommernacht, König Markes fernher tönende Jagd und die innere dramatische Situation der Liebenden ineinander verwoben. Welch fast zerreißende Spannung entsteht im „Lohengrin” bei der Annäherung des Gralsritters und mit welchem Glanz erfüllt sein endliches Erscheinen die von einem König und seinem Gefolge beherrschte Szene – oder soll es dies wenigstens tun. Denn hier, beim Auftauchen des Schwans, aber auch bei manchen anderen, das Hintergründige zum theatralischen Effekt steigernden Momenten seiner Oper, wird deutlich, wie leicht bei Wagner das Erhabene ins Lächerliche umschlagen kann, wie abhängig die Szene gerade da, wo das Geheimnisvolle und Abgründige ins Rampenlicht tritt, von Zufällen und vom Geschmack der Mitwirkenden abhängt, wie heikel mit einem Wort die gegenüber der Barockzeit so ungemein gesteigerte Theatralik Wagners beschaffen ist. Hier, in der „Darstellung einer imaginären Welt, jenseits aller Wirklichkeit, jenseits aller Verwirklichung” sieht auch Preetorius als der erfahrene Bayreuther Bühnengestalter das eigentliche Problem. Denn indem die sichtbare Szenerie durch die Macht ihrer landschaftlichen oder interieurhaften Stimmungen, Verzauberungen, Elementarwirkungen mit der inneren Dramatik der handelnden Personen und symphonischen Vorgänge Schritt zu halten sucht, überschreitet sie zwangsläufig die Grenzen nicht nur der bühnenbildlichen und -technischen, sondern überhaupt der optischen Möglichkeiten. Die geflissentliche Aufdeckung der bei Wagner stets zum äußersten gesteigerten Seelenvorgänge muß mit der Starrheit, 283 „Realität” und räumlichen Begrenztheit der Bühnenszenerie in Konflikt kommen. Äußere und innere Dramatik, Illusion und musikalische „Abgründigkeit” treten dann peinlich auseinander und lassen den Hörer, der den Bühnenvorgängen mit dem Auge folgt, aus einer Ernüchterung in die andere fallen. Es ist die echte romantische Illusionszerstörung, die wir in Wagners Oper trotz ihres engen Anschlusses an die Natur oder vielmehr gerade dessentwegen erleben oder wenigstens befürchten müssen. Kein Regisseur kann es hindern, daß die ihr Roß Grane hochpathetisch ansingende Brünhilde komisch wird, wenn diesem etwas „Menschliches” passiert. Auch Preetorius sieht die Problematik, die hier besteht, mit aller Schärfe. Wenn er aber einerseits der Meinung ist, daß Wagners Musik als „tragenden Hintergrund einen gewissen Naturalismus, Blitz und Donner, Regenbogen, Rheinwogen, Mondschein, Wolkengebilde, Sonnenglanz und Waldesflimmern zur sinnvollen Ergänzung verlange”, Bilder, die „mit voller Illusion” wiedergegeben werden müßten, und andererseits fordert, daß „die äußere Natur zugleich mit der inneren Sicht vereinigt werden müsse” und jene also nur „symbolische” Darstellung finden dürfe, so stellt er damit sich selbst und die ihm folgenden Bühnenbildner vor eine unlösbare Aufgabe. Kein Zweifel nach alledem: die Schwierigkeit liegt in der Sache selbst. Und so bleibt wohl keine andere Wahl, als den gesteigerten szenischen Aufwand bei Wagner – nach Preetorius der notwendige äußere Halt für seine „Gehörvisionen” – als eine Gewaltlösung anzusehen. (Wagner hatte sich Makart als Bühnengestalter gewünscht.) Das symphonische Element war in seiner Musik genau wie in derjenigen Bruckners so übermächtig geworden, daß der Bruch zwischen äußerer und innerer Vorstellung unvermeidlich werden, die szenisch-musikalische Einheit der alten Oper zerreißen mußte. Sie nachträglich wiederherzustellen, mag dem Genie des Bühnenbildners vielleicht in frei visionärer Gestaltung, jedoch schwerlich mit naturalistischen oder den nur abstrahierenden Darstellungsmitteln des heutigen Bayreuth gelingen. Bis zu welchem Grade übrigens Wagner selbst das Bild fragwürdig wurde, beweist seine Vorliebe für Naturvorgänge, die die Szene vollständig aus einem Zustand in den andern überführen. Allein in der Götterdämmerung gibt es drei breit ausgesponnene Sonnenaufgänge. Der wandelnde Wald im Parsifal und Siegfrieds auf der Bühne mitvollzogene Rheinwanderung sind optische Vorgänge, die das Bild deutlich dem Wandel innerer Zustände unterworfen zeigen. (Im Orchester findet bezeichnenderweise an diesen Stellen eine große Steigerung statt.) Das Bühnengeschehen geht also ins Filmische über und berührt sich damit eng mit jenen traumhaften Vorstellungen, die in Bruckners Musik vor unser inneres Auge treten. Es steht damit zweifellos im stärksten Gegensatz zu der 284 reinen Bildstatik, die als das Eigentümliche sowohl der Barockoper wie des Fürstenfelder Raumes erscheint. Vergegenwärtigen wir uns hierzu nochmals die Art und Weise, wie die Musik Bruckners sich „im Raume” bewegt. Sie kommt, das hatte die Analyse der Messe gezeigt, aus weiter Ferne, aus den Hohlräumen von Quinte und Oktave, oder sie entsteht aus einem unfaßbaren Tongeflirre. Ganz eigentlich außerhalb des sichtbaren Raumes geboren, ist sie spürbares Produkt innerer Eingebung. In breitem Wogen oder auch in plötzlichem Ruck nähert sie sich an, in beiden Fällen überschwemmend, umwerfend, den Raum sprengend im Gegensatz zur völlig an den Raum gebundenen Bewegung in Fürstenfeld. Schon die brucknerische Introduktion ist also wie ein revolutionärer Akt. Folgen wir dann den anschließenden Episoden, jenen Phasen, in denen die schon in sich gespaltenen Empfindungswelten stetige Steigerung erfahren, in schwindelnde Höhen tragen oder in steile Abstürze führen, so wird auch von diesen Bewegungen das Feste in allen Richtungen aufgehoben. Das Wort des Musikinterpreten bleibt zur Veranschaulichung dessen notgedrungen, aber sinnwidrig in der dritten Dimension. In Wirklichkeit hat hier die Kunst die einfach räumliche Vorstellung verlassen und längst ehe sie wissenschaftlich entdeckt wurde, eine weitere Dimension erschlossen. Vergegenwärtigen wir uns hierzu nochmals das ältere Kompositionsprinzip. Wir hatten bereits festgestellt, daß die Themen bei Bach und seinen Zeitgenossen stabile, harmonisch eindeutige Gebilde sind. Als solche sind sie, den Generalbaß nicht ausgeschlossen, autonome, zielsichere Beweger des Formenablaufs, die sich zwar miteinander eng verschränken können, das harmonische Element aber stets voll beherrschen. Selbst die Tonarten erscheinen wie aus dem Thema geboren. Von daher wohl hat die ältere Musik ihre tief beruhigende, des Wohlklangs sichere Wirkung. (Der Mensch ist hier vermöge einer klaren Beziehung zur Umwelt Herr seiner Kräfte.) Bei Wagner und Bruckner haben sich die Dinge geradezu umgekehrt. Wohl bilden auch hier die Themen noch „Motive”, zugleich aber sind sie ihrerseits bewegte, von dem inzwischen mächtig gewordenen harmonischen Element unaufhaltsam Fortgetriebene. Im einen Fall bleiben die Bewegungen einschichtig und damit auch die Gefühle, verlaufen beide in festen Bahnen, im andern Fall potenzieren sie sich. Denn nicht nur die Motive selbst wieder sind ein Bewegtes, auch die bewegenden Harmonien überlagern sich gegenseitig und treiben in schwer entwirrbarem Prozeß dahin – verwandt den Sonnensystemen, in denen unsere Erde eingesponnen und mit denen sie in unendlicher Bewegungsmultiplikation fortgewälzt wird. (Der Mensch muß sich dabei als willenloses Atom in einem unendlich weiten und bewegten Massen-Mechanismus fühlen.) Nach den Parallelerscheinungen hierzu in der bildenden Kunst braucht man nicht lange zu suchen. Kein Jahrhundert hat so sehr die Massensze- 285 nen geliebt wie das neunzehnte, denken wir an die Bilder von Goya, Delacroix Daumier und Menzel. Auch hier sind Bewegungen entfesselt, die den Beschauer überwältigen sollen. Das lever en masse der französischen Revolution ist als Bildsujet eindeutig genug. In breiter Front kommt die Menge auf uns zu und wälzt sich gleichzeitig dem Horizont entgegen. Dagegen wirkt jede Menschenansammlung auf Bildern früherer Zeit wie ein lockeres Gruppendasein – selbst noch die flüchtig hingetupfte Menge auf Guardis Markusplatzbildern – oder sie ornet sich unwillkürlich zur Prozession. Ähnlich gewandelt sehen wir im 19. Jahrhundert die Landschaft. Sie hat sich gegenüber früher ungemein mit Bewegung und Atmosphäre gesättigt. Courbets berühmte „Welle“ überbordet den Uferstreifen, bei Renoir weben Figuren und Bildraum in farbigen Dünsten. Auf Menzels Farbskizze vom Innenraum der Alten Kapelle in Regensburg läßt sich das Urbild nur mit Mühe feststellen (und blieb darum bis vor kurzem unerkannt), sicherlich auch deshalb weil auf der Wiedergabe alle Raumbarrieren (Triumphbogen, Chorbrüstung, Kanzel usw.) von Licht, Farbwolken und herausströmender Menge wie weggeschmolzen erscheinen. Aus Kurt Badts Buch über „Wolkenbilder und Wolkengedichte der Romantik“ (1960) ermitteln wir, daß das Atmosphärische seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts fast plötzlich Eigenbedeitung bekommt und Steigerung erfährt; die Entwicklung, die er zeigt, führt von Constable und Goethe über Blechen und Dahl zu den französischen Impressionisten, schließlich zu Corinth und Kokoschka, also von der Frühromantik über den Naturalismus bis zum Expressionismus. Auf andere Weise bezeichnend sind die verwandten Symptome in der Architektur. Schon bei Friedrich und Blechen gibt es die Vorliebe für jene merkwürdigen bildarchitektonischen Vorwürfe, auf denen ein zerstörtes Kircheninnere mit offenen Gräbern und unterirdischen Gewölben dem Betrachter fast peinlich nahegerückt ist, wo ihn das Dach. und Bodenlose, Totenluft und Ruinenschauer von allen Seiten umgibt. Eine solche Häufung des Abgründigen, Reduzierten, Verwesten wäre in aller Malerei der vergangenen Jahrhunderte undenkbar. (Siehe dazu H. Sedlmayrs über die bloße Feststellung hinausgeführte Interpretation im „Verlust der Mitte“, 1948) (Abb. 2 und 3) Aber auch die real gebaute Architektur, und gerade die idealistisch gerichtete, im Gewand der Gotik oder der Antike erscheinende, hat dies Aufgerissene, im Grunde Revolutionäre der Zeit. Anders als bei Perraults Louvrefassade schließt hinter der mageren Kolonnade von Schinkels Altem Museum kein salonhaft intimer Balkon die Front, sondern es gähnt ein Hohlraum, der als leere Quint die weitgestellte Säulenreihe zu verschlingen droht. Denken wir schließlich an jene unheimlichen Räume des 19. Jahrhunderts, auf deren glatt polierter Bodenfläche man schwimmt oder gar strauchelt (so etwa in Mussolinis ehemaligem Audienzsaal im Palazzo Venezia in Rom) oder an die Riesentreppenhäuser in Amtsgebäuden, 286 in deren gotischer oder sonst wie phantastischer Labyrinthigkeit man sich wie verloren fühlt. Mit solchen Raumungeheurn und ebenso mit einem ruhelos allseitigen Fassadenbilden steht die Architektur offenbar in einem unglücklichen Wettbewerb zu dem nur der Musik wirklich wesensgemäßen Prinzip des Potenzierens. VI All dies oft Seltsame, ins Rohe und Formlose Abgeglittene in den bildenden Künsten ist die Entsprechung zu der Tatsache, daß seit damals in allen Kunstzweigen das Bewegte, Tonliche und Hintergründige über das Ruhende, Feste und Greifbare Macht gewinnt. Will man alle diese Veränderungen unter einen Gesichtspunkt fassen, so drängt sich der des Musikalischen geradezu auf. Es weist auf ihn schon die Tatsache, daß keine der übrigen Künste im 19. Jahrhundert sich so kraftvoll und neuartig entwickelt hat wie eben die Musik. Sowohl quantitativ nach Produktions- und Aufführungszahl als auch in ihrer seelischen Gewalt ist diese jetzt etwas so Bestimmendes geworden, daß sie nicht nur die festgebaute und wohlabgegrenzte Welt des Barock, sondern die bisher geltenden Prinzipien des Bildkünstlerischen überhaupt in Frage stellte. Denn machen wir uns bewußt, was dieses Musikalische eigentlich ist, das hier die Krise und dort den ungeheuren Auftrieb bewirkt, so kommen wir von jeder Seite her immer wieder auf den gleichen Begriff, den des inneren Bewegtseins: Bewegung als das Elementare, das jede Form ins Zeitliche drängt, das tief aus dem Innersten quillt und alles daraus Geborene wieder in dieses Innere zurückschlingt. Kein Wunder, daß das dergestalt entwickelte Musikalische der Feind aller zum Festen und Dauernden strebenden Künste werden muß. So wurde denn auch schon zu Goethes Zeiten, ziemlich genau mit dem ersten Erklingen von Beethovens Symphonien, das Bildkünstlerische zum Problem – man hat ihm damals schon etwas Unmögliches, das motivisch Bedeutende als Ersatz für das Schöne, abgefordert –, und an dieser Problematik hat sich bis heute wenig geändert, wie nicht zuletzt die komisch gewordene Diskussion über „entartet” oder nicht beweist. Mag auch der Streit noch immer um „schön”, „richtig” und „verständlich” gehen, der tiefere Grund für die Erschütterung unseres heutigen Kunstgefühls liegt woanders, kommt aus jenen Tendenzen, die wir über die dreidimensionale Objektivierung des Daseins über das „Leonardeske” der Kunst, hinausdrängen sahen. Während die im Unsichtbar-Zeitlichen sich bewegende Musik durch sie ihre tiefste Rechtfertigung erfuhr, mußte alles Bildliche und zumal das Abbildende gründlich fragwürdig werden, ja schlimmer noch, es mußte jene für das Gleichgewicht der menschlichen Dinge wesentliche Klammer, die die äußere und innere Welt zusammenhält, verlorengehen. Ein Abgrund ist aufgetan, den so mancher sich verantwortlich Fühlende heute als ein tiefes Verhängnis empfindet und den 287 zu schließen, sei es schaffend oder erkennend, zu unseren vornehmsten Aufgaben gehört. Es wäre in diesem Zusammenhang wohl der Mühe wert, einmal nachzuprüfen, welche Rolle die Musik Beethovens und seiner Nachfahren bei denjenigen gespielt hat, die damals das Purifizieren der Kirchen und das Einreißen der Stadtmauern betrieben. Bedeutete dieses praktisch die Zerstörung der Stadt als Bild und setzte den Anfang der großen europäischen Städtevernichtung, so sollte jenes den Barock ausrotten und hat zu einer kaum abzumessenden Einbuße an Kultur geführt. Nicht minder aufschlußreich wäre dann auch die Antwort darauf, welche geistigen und künstlerischen Wandlungen es gewesen sind, die zur Wiederentdeckung und Wiederschätzung des Barocks gelangen ließen. Damit wären wir zum Ausgangspunkt unserer Betrachtung gekommen. Denn darf nicht Anton Bruckner, als der Meister von St. Florian, für einen wiedergeborenen Barockmenschen gelten? – womit am Ende doch noch der Zusammenhang zwischen seiner Musik und dem Barock hergestellt wäre! Gewiß, der Wunsch Bruckners, unter der Orgel von St. Florian begraben zu sein, mag mehr der Nähe zum jahrelang gespielten Instrument als zum dortigen Kirchenraum gegolten haben. Aber wir brauchen uns deshalb Bruckner nicht ohne eine innere Beziehung zu dem berühmten Kloster und seiner Kirche zu denken, wenn auch nichts Eindeutiges darüber aus seinem Munde überliefert ist. So hätten wir uns zum Schlusse mit einem Faktum auseinanderzusetzen, das alles bisher Festgestellte über Bruckner und sein Verhältnis zum Barock zu guter Letzt über den Haufen zu werfen droht. Unter den schwierig zu beantwortenden Fragen dieser Abhandlung dürfte damit wohl an eine der diffizilsten gerührt sein. Denn wird sich bei einem Menschen wie Bruckner je entscheiden lassen, ob er deshalb soviel von Wien nach St. Florian gepilgert ist, weil es ihn tief innerlich, aus einem schöpferischen Drang dorthin zog, oder ob es nicht einfach eine Heimatbindung war, die ihn dabei leitete? Denkt man an den Menschen Bruckner, so möchte man doch eher das Zweite vermuten. Denn kann es etwas Gegensätzlicheres geben als den urtümlich-modern beschaffenen, von seinen Eingebungen wie von Visionen geschüttelten Dorfschulmeisterssohn aus Ansfelden und das anmutig weltläufige Barock des alten Österreichs? Jedoch, wir haben im Falle des Genies mit allem zu rechnen, zumal mit dem schöpferischen Mißverständnis. Und so sei denn die Frage nochmals in einem speziellen Sinne aufgegriffen, indem wir diejenigen Momente in Betracht ziehen, die aus Gründen einer gewissen Formverwandtschaft auf eine Beziehung zwischen Bruckner und der Barockkunst deuten könnten. Tut man das Nächstliegende und sucht die Antwort in der Richtung des sonstigen Wiederverständnisses der Barockarchitektur, so ist das Ergebnis nicht eindeutig. Dieses Verständnis knüpft sich offenbar – denn sicher 288 nicht zufällig wurde der Brock in Deutschland und an der deutschen Architektur entdeckt – an sein dynamisches Element. Nun, Bewegung ist zweifellos gerade ein Grundelement der Brucknerischen Musik. Eine allgemeine innere Affinität zum Barock ist also bei Bruckner durch das Gemeinsame der Bewegung vorhanden. Und vielleicht war es diese sogar, die ihrerseits bei den Jüngern seiner (und vor allem auch der Wagnerschen) Musik einem ersten Verständnis des Barock den Boden bereitete. Aber man wird sich, nach allem, was wir festgestellt haben, darüber klar sein müssen, daß es höchsten das halbe Phänomen war, das damals entdeckt wurde, entdeckbar war. Denn Bewegung ist nicht der Barock als Ganzes, ist nur etwas in ihm Miteingeschlossenes, bei ihm Sublimiertes. Auch wird man sich fragen müssen, ob eine Beziehung Bruckners zum Barock auf dieser Basis Spezifiziert genug ist, da Bewegung ja nicht nur ein Element des Barocks sonder der nordischen Kunst überhaupt ist. Zwei Dinge außerdem sind es, die im Hinblick auf die eindeutige Sprache von Bruckners Werk wie die des Barock nicht übersehen werden dürfen. Einmal der völlig andere Charakter der Bewegung hier und dort. Wir bemerkten, im Barock ist sie relativ, gebunden an Raum und Form, ein Ausdruck des Leichten, Feinen, Schwebenden, Idealen, Bewegung ist Beweglichkeit. Bei Bruckner dagegen ist die Bewegung absolut geworden, herrscht sie generell, fessellos, ist sie außerdem schwer und massig. Infolge dieser letzten Eigenschaft ist aber die Bewegung bei Bruckner – und damit sind wir beim zweiten Unterscheidungspunkt – kein eigentliches Spezifikum. Zum Unterschied vom Barock sowohl wie vor allem auch zur Musik seiner eigenen Zeit hat die Brucknersche Bewegung nichts Schnelles, Bewegliches, sondern ist ausgesprochen breit und bedächtig. Gewiß, die gleichsam schraubenförmig gewundene Chromatik seiner Themenentwicklungen mag an den Krümmungsreichtum barocker Ornamentik und Raumbildung denken lassen. Doch sind eben die Bewegungen dieser Kurvaturen bei Bruckner ungemein ausladend und unterscheiden sich grundsätzlich sowohl von der hastenden und hitzigen Eile in der Musik des 19. Jahrhunderts wie auch von der Geschmeidigkeit des Barock. Mit Recht gilt denn auch als Bruckners stärkste und eigenste Form sein breit dahinströmendes Adagio. Man könnte also auf Grund des Feierlichen und Gemessenen der Adagiobewegung bei Bruckner eher auf eine Beziehung zum eigentlichen, richtig verstandenen Barock schließen, zu den lagernden und festlich hingebreiteten Bautrakten eines Klosters, wie es gerade in St. Florian unberührt erhalten geblieben ist. Doch wird man dabei nicht übersehen dürfen, daß die Breite hier und dort verschiedenen Impulsen entspringt. Während sie im Barock der Ausdruck eines in der Gottesgewißheit ruhenden und darum statischen Daseinsgefühles ist, kommt sie bei Bruckner aus einem unruhigen, gepreßten Herzen, das inbrünstig um Antwort aus 289 höheren Welten ringt. Ist also die Breite dort der Ausdruck heiteren Wohlgefühls, so hier der Bedrängnis oder des Erlösungsjubels. Auch ein anderes Unterscheidungsmerkmal von Bruckners Musik zu der des übrigen 19. Jahrhunderts, das jene dem Barock nähern möchte, stellt sich nur als eine Scheinbeziehung heraus, ich meine jenes Voluminöse, Geballte seiner Formgebilde, das sich grundlegend von der zum Diffusen, Flüchtigen, „Formlosen” neigenden Tonsprache seiner Zeit unterscheidet. Gewiß, wenn Bruckners Themen breit anheben und sich zum Sprung ducken, wenn dann die großen Zusammenstöße geschehen, so ist es, als würden Gewitterwolken am Horizont heraufziehen und sich darnach in Blitz und Donner entladen. Aber gerade ein solches Bild bringt auch zum Bewußtsein, daß die Brucknersche Themenballung und -Entladung nur eine andere, wuchtigere Form der naturalistisch-leidenschaftlichen Tonsprache seiner Zeit ist. Denn ob nun die musikalischen Vorgänge in rasch fließender oder gepreßter Bewegung ablaufen, in beiden Fällen wird jenes Gebilde nur aufgebaut, um sogleich wieder zerstört oder verflüchtigt zu werden. Wo also im echten Barock das Feste, Voluminöse dazu dient, die Gestalten und Bilder in dauerndem Glanz aufzurichten, tauchen diese im nur scheinbaren Barock des 19. Jahrhunderts lediglich auf, um sogleich wieder zu vergehen. Nochmals sei hier an die gleichzeitige Malerei erinnert, an Menzels rein malerisch, nicht mehr baulich aufgefaßten Barockinterieurs, überhaupt an die diesem Jahrhundert eigene, dem Auge mehr entgleitende als greifbare Gegenstandswelt. (Ob und wieviel Bruckners Musikform mit dem ihr fast gleichzeitigen „wilhelminischen Barock” zu tun habe, sei als ketzerische Frage an den Rand gesetzt.) Beziehen wir uns zurück auf jenes Motiv der „Treppe”, das sich eingangs beim Kyrie eleison der Brucknermesse in Gedanken eingestellt hatte. Wohl erinnert es für sich genommen an die barocke Architektur, die in Treppenanlagen bekanntlich schwelgte. Aber bei Bruckner bleibt es beim kurzen Bild, beim flüchtigen „Motiv”, das sofort wieder von neuen Eindrücken verschlungen wird. Und während es der Sinn der von Podest zu Podest führenden Barocktreppen ist, das Feste der Ebenen, die sie verbinden, nur immer wieder zu betonen, treibt das gleiche Motiv bei Bruckner von einer Unendlichkeit zur anderen, bildet es die nur flüchtige Verdichtung innerhalb eines Ganzen, das in ständigem Fließen und Sichwandeln begriffen ist. Nicht das Barocktreppenhaus, sondern allenfalls Filmbilder von ihm, der Film überhaupt, bilden Entsprechungen dazu. Und ähnlich ist es mit der Klanglichkeit bei Bruckner bestellt. Zwar mag sie noch am ehesten, wenigstens in ihren lichteren Tönen und Farbmischungen auf einen unmittelbaren Eindruck vom Barock deuten. Aber auch hier darf es wohl nur als ein Berührtwerden wie im Traum erachtet werden. Denn die Klarheit der Klangflächen erzeugt bei Bruckner keine feste, statisch gebundene Farbordnung wie im Barock, sondern dient ledig- 290 lich der Schärfung der Kontraste. Die leuchtenden Helligkeiten, zu denen Bruckner seinen Orchesterklang zu steigern vermag, stehen grell vor düsteren Hintergründen, die im kaleidoskopischen Wechsel der Stimmungen den lichten Ausblicken die Herrschaft streitig machen. So mögen im Hörer beim Erfassen der Brucknerschen Tongestalten wohl auch Bilder von barocken Bauten und Räumen auftauchen, mag überhaupt gelegentlich die heitere Landschaft der Donauklöster mit ihren Kuppeln und Türmen als beglückende Vision vor dem inneren Auge erscheinen, festhalten lassen sie sich kaum. Sie erlauben in der vergleichsweise idyllischen Welt des Barock höchstens ein flüchtiges Ausruhen und Erinnern, aber kein wirkliches Existieren. Jener Ausspruch Nietzsches über Beethoven, seine Symphonien seien „Musik über Musik, verklärte Erinnerungen aus der besseren Welt” mag auch die möglichen Barockassoziationen in Bruckners Musik erläutern: auch sie sind nicht mehr die Dinge selbst, sondern nur deren flüchtiges, schmerzlichsüß anklingendes Erinnern. Es muß mit ihnen gehen wie mit allen Illusionen und aller Romantik: beim Zusammenstoß mit der Wirklichkeit, in unserem Fall also beim Erklingen im sichtbar gegenwärtigen barocken Raum, verursachen sie nicht Beglückung, sondern Enttäuschung. Die vergleichende Betrachtung der zwei Kunstwelten, denen die Kirche von Fürstenfeld und Bruckners Werk angehören, ergibt nach dem Gesagten, daß diese sich schlecht, wenn nicht unmöglich, miteinander vertragen. Sollte das Verlangen nach ihrer Verschmelzung trotzdem Geltung erlangen, muß es wohl zu den mancherlei Gewalttaten gerechnet werden, die für unsere Zeit wohl bezeichnend, aber deshalb noch nicht verzeihlich sind. 291