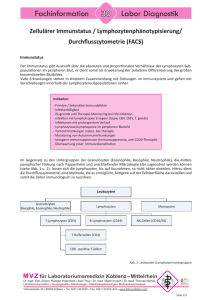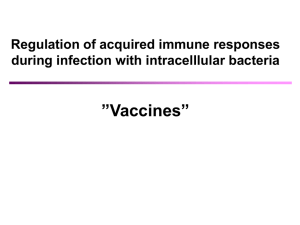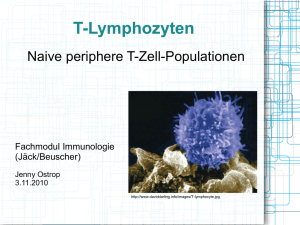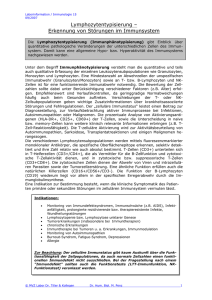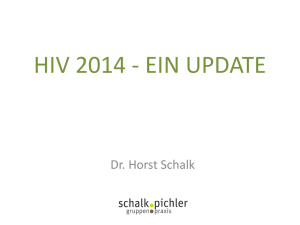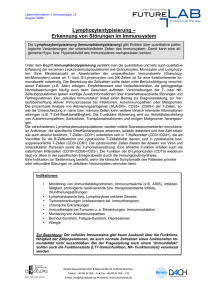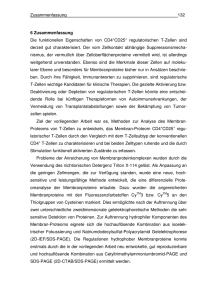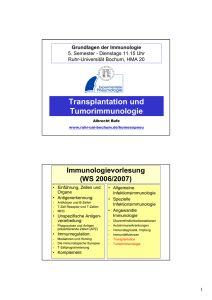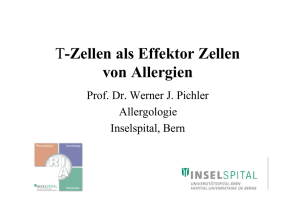Rolle von CD4 CD25 regulatorischen T
Werbung

Aus der Medizinischen Universitätsklinik - Abteilung Innere Medizin II Der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau Rolle von CD4+CD25+ regulatorischen T-Zellen bei der chronischen HCV-Infektion INAUGURAL-DISSERTATION zur Erlangung des Medizinischen Doktorgrades der Medizinischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau Vorgelegt: 2005 von: Tobias Elmar Böttler geboren in: Berlin Dekan: Prof. Dr. med. Christoph Peters 1. Gutachter: Prof. Dr. med. Drs. h.c. Hubert E. Blum 2. Gutachter: Prof. Dr. med. Hans-Hartmut Peter Jahr der Promotion: 2007 meiner Familie 4 Inhalt 1 Abkürzungsverzeichnis 6 2 Einleitung 7 2.1 T-Zell-Immunologie 7 2.2 Das Hepatitis C Virus 8 2.3 T-Zell-Antwort bei der Hepatitis C Virusinfektion 9 2.4 Regulatorische T-Zellen 9 2.5 Regulatorische T-Zellen bei Infektionskrankheiten 11 2.6 Zielsetzung 14 3 3.1 Material und Methoden Studienpopulation 15 15 3.2 Zellkulturarbeiten 3.2.1 Isolierung von Lymphozyten 3.2.2 Zellselektionen 3.2.3 Antikörperfärbungen 3.2.4 Transwell®-Assays 3.2.5 Zytokin-Neutralisations-Assays 16 16 16 18 19 19 3.3 Antigenspezifische Untersuchungen 3.3.1 Antigenspezifisches Wachstum 3.3.2 Tetramer-Färbung 3.3.3 Intrazelluläre Zytokin-Färbung 3.3.4 CFSE-Färbung 20 20 21 22 24 3.4 Durchflusszytometrie 25 3.5 Statistik 25 5 4 Ergebnisse 26 Die Depletion von CD4+ Zellen führt zu einer gesteigerten in vitro Expansion von HCV-spezifischen CD8+ T-Zellen bei Patienten mit einer chronischen HCV-Infektion 26 CD4+CD25+ Treg-Zellen hemmen die in vitro Expansion HCVspezifischer CD8+ T-Zellen 27 Treg-Zellen hemmen die IFN-γ Produktion von HCV-spezifischen CD8+ T-Zellen 28 4.4 Treg-Zellen vermitteln ihre Wirkung dosisabhängig 29 4.5 Die Suppression durch Treg-Zellen ist Zell-Zell-Kontakt abhängig 31 4.6 Die Inhibition durch Treg-Zellen ist unabhängig von IL-10 und TGF-β 32 4.7 Einfluss von IL-2 auf die Wirkung von Treg-Zellen 33 4.8 Stärkere Inhibition virusspezifischer T-Zell-Antworten bei Patienten mit chronischer HCV-Infektion im Vergleich zu gesunden Probanden und Personen, die das Virus eliminiert haben 35 Erhöhte Frequenz von Treg-Zellen bei Patienten mit chronischer HCVInfektion 37 4.1 4.2 4.3 4.9 5 Diskussion 39 6 Zusammenfassung 46 7 Literatur 47 8 Originalarbeiten 52 9 Danksagung 53 10 Lebenslauf 54 1 Abkürzungsverzeichnis 1 6 Abkürzungsverzeichnis Ak Antikörper APC Allophycocyanin (FACS-Fluoreszenz) APZ Antigen präsentierende Zellen CD Cluster of Differentiation Cy-7 Cychrome-7 (FACS-Fluoreszenz) FACS Fluorescence Activated Cell Sorting FCS Fetal Calf Serum Flu Influenza FITC Fluorescein Isothiocyanate (FACS-Fluoreszenz) HCV Hepatitis C Virus HIV Humanes Immundefizienz Virus HLA Humanes Leukozyten Antigen IFN Interferon Ig Immunglobulin IL Interleukin i.v. intravenös MACS Magnetic Cell Sorting MHC Major Histocompatibility Complex n.u. nicht untersucht PBMC Peripheral Blood Mononuclear Cells PBS Phosphate Buffered Saline PE Phycoerythrin (FACS-Fluoreszenz) PMA Phorbol Myristate Acetate RNA Ribonucleotid Acid RPMI+++ Zellmedium mit definierten Zusätzen (Material und Methoden) rpm revolutions per minute TGF Transforming Growth Factor Treg-Zellen CD4+CD25+ regulatorische T-Zellen TZR T-Zell-Rezeptor 2 Einleitung 2 Einleitung 2.1 T-Zell-Immunologie 7 Der Mensch ist ständig einer Vielzahl von potenziell krankheitserregenden Mikroorganismen ausgesetzt. Der Körper ist jedoch in der Lage, die meisten dieser Erreger zu eliminieren, ohne dass es zu einer Erkrankung kommt. Für die Elimination der Erreger ist das Immunsystem des Menschen verantwortlich. Es wird zwischen einer unspezifischen und einer spezifischen Immunabwehr unterschieden. Zum unspezifischen oder angeborenen Immunsystem gehören natürliche Barrieren wie die Haut, die Schleimhäute oder epitheliale Grenzschichten. Weiterhin werden antimikrobielle Enzyme und Mediatoren wie Interferone, Lysozym oder C-reaktives Protein (CRP) zu der angeborenen Immunabwehr gezählt. Beim spezifischen Immunsystem wird zwischen humoraler und zellulärer Abwehr unterschieden. Spezielle B-Zellen (Plasmazellen) sind als Teil der humoralen Immunität in der Lage, spezifische Antikörper zu bilden. Diese binden den Fremdkörper (Antigen), der anschließend phagozytiert oder durch das Komplementsystem inaktiviert wird. Die zelluläre Immunabwehr wird vor allem durch T-Zellen vermittelt. T-Zellen werden vereinfacht in CD4+ T-Helferzellen und CD8+ zytotoxische T-Zellen eingeteilt. Die THelferzellen haben ihre Bedeutung in erster Linie in der T-Zell-B-Zell-Kooperation und der Regulierung der CD8+ T-Zell-Antworten. Die CD4+ T-Zellen erkennen Antigene, die ihnen von professionellen Antigen-präsentierenden Zellen (APZ, u.a. Makrophagen, dendritische Zellen, B-Zellen) über MHC-Klasse-II Moleküle präsentiert werden. Diese präsentieren exogen aufgenommene Antigene, die in Phagolysosomen zu Peptiden fragmentiert werden. CD8+ T-Zellen erkennen Antigene, die von MHC-Klasse-I Molekülen präsentiert werden. MHC-Klasse-I Moleküle werden von allen kernhaltigen Körperzellen exprimiert und präsentieren den CD8+ T-Zellen zellinternes Antigen, das im Proteasom zu Peptidfragmenten prozessiert wurde. CD8+ T-Zellen können zytotoxische und nichtzytotoxische Effektorfunktionen ausüben. Die zytotoxische Wirkung beruht vor allem auf der Sekretion von Perforin. Perforin zerstört die 2 Einleitung 8 Zellmembran der Zielzelle, wodurch diese abstirbt. Der nichtzytotoxische Effekt wird u.a. über die Produktion von Zytokinen wie Interferon-γ vermittelt, wodurch der Erreger abgetötet wird, ohne die infizierte Zelle zu zerstören. Das Zusammenspiel der beiden T-Zell-Subpopulationen ist für die Entstehung sowie die Aufrechterhaltung einer suffizienten T-Zell-Antwort von elementarer Bedeutung, wie sie für die Elimination von vielen Krankheitserregern, z.B. dem Hepatitis C Virus (HCV), notwendig ist. 2.2 Das Hepatitis C Virus Das Hepatitis C Virus ist ein hepatotropes RNA-Virus, das zur Familie der Flaviviren gehört. Es wird überwiegend parenteral übertragen. Zu den Risikogruppen für eine HCV-Infektion zählen vor allem i.v. Drogenabhängige (kontaminierte Nadeln), medizinisches Personal (Nadelstichverletzungen) und Patienten, die Bluttransfusionen erhalten, aber auch Promiskuität gilt als Risikofaktor. In 50-70% der Fälle kann die körpereigene Immunabwehr das Virus nicht eliminieren und es kommt zur Ausbildung einer chronischen Infektion. Zurzeit ist die chronische HCV-Infektion mit weltweit ungefähr 200 Millionen Erkrankten eine der häufigsten Erkrankungen überhaupt. In Deutschland wird die Zahl der Virusträger auf 500.000 Personen geschätzt (RobertKoch-Institut). Das klinische Spektrum der chronischen HCV-Infektion reicht von einem asymptomatischen oder milden Verlauf bis hin zu einer chronisch aktiven Hepatitis. So entwickeln ca. 20% der Patienten mit chronisch aktiver HCV-Infektion im Laufe der Jahre eine Leberzirrhose, auf deren Boden sich ein hepatozelluläres Karzinom entwickeln kann [Moradpour et al., 2004]. Die Standardtherapie einer chronischen HCV-Infektion besteht zurzeit aus einer Kombination von Interferon-α und Ribavirin, die aber bei nur 50-80% der Patienten zu einer Elimination des Virus führt. Eine prophylaktische oder therapeutische Vakzinierung steht bei der HCV-Infektion derzeit nicht zur Verfügung und ist das Ziel zahlreicher Forschungsarbeiten. 2 Einleitung 2.3 9 T-Zell-Antwort bei der Hepatitis C Virusinfektion Die grundlegenden Mechanismen, die zur Elimination oder aber der Persistenz des Virus führen, sind noch weitgehend ungeklärt. Der HCV-spezifischen T-Zell-Antwort wird aber allgemein eine entscheidende Rolle zugesprochen. So ist die Elimination des Virus in der akuten Phase der Infektion mit einer multispezifischen T-Zell-Antwort assoziiert, die sich in der virusinfizierten Leber anreichert [Diepolder et al., 1995; Lechner et al., 2000; Thimme et al., 2001]. Weiterhin konnte durch Depletionsstudien von CD4+ und CD8+ T-Zellen die entscheidende Rolle der T-Zellen bei der Viruselimination direkt bewiesen werden [Grakoui et al., 2003; Shoukry et al., 2003]. Bei Patienten mit chronischer HCV-Infektion werden unterschiedliche Gründe für ein Versagen der T-Zell-Antwort diskutiert. Eine Möglichkeit ist das Auftreten von viralen Escape-Mutanten. Das Virus entgeht dabei der virusspezifischen T-Zell-Antwort durch Veränderung der Aminosäurenstruktur innerhalb von Epitopen, die von den T-Zellen erkannt werden, es entstehen sogenannte virale Escapemutationen. Außerdem sind die HCV-spezifischen T-Zell-Antworten bei der chronischen HCV-Infektion meistens schwach ausgeprägt und weisen häufig Dysfunktionen auf, wie einen Defekt in der Proliferationsfähigkeit oder aber ein Unvermögen, antivirale Zytokine wie Interferon-γ zu sezernieren [Gruener et al., 2001; Wedemeyer et al., 2002]. Die Mechanismen, die den Dysfunktionen HCV-spezifischer T-Zellen zu Grunde liegen sind bisher nicht bekannt und sind u. a. Gegenstand dieser Doktorarbeit. So sollte in dieser Arbeit der mögliche Einfluss von regulatorischen T-Zellen auf die Persistenz des Hepatitis C Virus untersucht werden. 2.4 Regulatorische T-Zellen Bereits in den 70er Jahren wurde die Existenz immunregulatorischer T-Zellen postuliert [Gershon et al., 1970]. Es gelang jedoch nicht, eine Population zu charakterisieren, die für die beobachteten immunregulatorischen Effekte verantwortlich gemacht werden konnte. Dies hat dazu geführt, dass dieses Feld für viele Jahre aus dem Fokus der immunologischen Forschung verschwunden ist. Mitte der neunziger Jahre konnten Sakaguchi et al. zeigen, dass die Depletion von CD25+ Zellen zur Entstehung von Autoimmunerkrankungen in Mäusen führt [Sakaguchi et al., 1995]. 2 Einleitung 10 Mittlerweile wurde für viele verschiedene T-Zellsubpopulationen ein regulatorisches Potenzial beschrieben. Die am besten charakterisierten regulatorischen T-Zellen sind die CD4+CD25+ T-Zellen. CD4+CD25+ regulatorische T-Zellen (Treg-Zellen) werden vereinfacht in natürlich vorkommende Treg-Zellen, die im Thymus reifen, und induzierte Treg-Zellen eingeteilt. Induzierte Treg-Zellen entstehen aus CD4+CD25- Zellen, die nach Antigenkontakt das CD25-Molekül, die α-Kette des Interleukin-2-Rezeptors, exprimieren und ihr regulatorisches Potenzial somit erst in der Peripherie, also außerhalb des Thymus, erhalten. Die Mechanismen, über die Treg-Zellen ihre suppressive Wirkung ausüben, sind bislang nur unzureichend charakterisiert. Diskutiert wird die Beteiligung inhibitorischer Zytokine, wie Interleukin-10 und TGF-β, und eine Zell-Zell-Kontakt abhängige Wirkung. Nahezu alle verfügbaren in vitro Studien aus humanen Modellen beschreiben eine Zell-Zell-Kontakt abhängige Suppression durch Treg-Zellen, die auch durch die Zugabe von neutralisierenden Antikörpern gegen IL-10 und TGF-β nicht aufgehoben werden kann [O'Garra et al., 2004]. Viele Arbeiten mit in vivo Modellen schreiben inhibitorischen Zytokinen wie IL-10 und TGF-β eine Rolle bei der Treg-Zellvermittelten Inhibition zu [Shevach, 2002]. Insgesamt scheinen Treg-Zellen über unterschiedliche Mechansimen zu verfügen, über die sie ihren inhibitorischen Effekt, abhängig von der biologischen Situation, vermitteln. Da das CD25-Molekül als Teil des IL-2-Rezeptors auch von nicht regulatorischen, aktivierten T-Zellen exprimiert wird, ist es kein spezifischer Marker für Zellen mit regulatorischem Potenzial. Bisher ist es jedoch noch nicht gelungen, einen Oberflächenmarker zu identifizieren, der hochspezifisch für Zellen innerhalb der CD4+CD25+ Population mit regulatorischem Potenzial ist. Als bester intrazellulärer Marker konnte in Mäusen das forkhead box protein P3 (Foxp3) identifiziert werden. Seine Relevanz für die Charakterisierung von humanen Treg-Zellen ist jedoch umstritten [Morgan et al., 2005]. Im Folgenden werden einige Studien dargestellt, in denen die Funktion von Treg-Zellen in unterschiedlichen Modellen untersucht wurde. So beschäftigen sich viele Arbeiten mit der Rolle von Treg-Zellen in Autoimmunerkrankungen. Bereits Anfang der 80er Jahre konnte gezeigt werden, dass Mäuse, denen am dritten Lebenstag der Thymus entfernt wurde, an einem schweren Polyautoimmunsyndrom erkrankten [Kojima et al., 2 Einleitung 11 1981]. Bei einer späteren Thymektomie wurde jedoch kein Polyautoimmunsyndrom beobachtet. In einer weiteren Arbeit konnte diese Beobachtung dem Fehlen von CD4+CD25+ Zellen in den thymektomierten Mäusen zugeordnet werden, da sich durch die Gabe von CD4+CD25+ Zellen die Entstehung eines Polyautoimmunsyndroms bei früh thymektomierten Mäusen verhindern ließ [Asano et al., 1996]. Viglietta et al. zeigten, dass Treg-Zellen bei Patienten mit Multipler Sklerose eine deutlich schwächere inhibitorische Funktion aufweisen als bei gesunden Probanden. Somit konnte auch in einem humanen Modell gezeigt werden, dass Dysfunktionen von Treg-Zellen zur Entstehung oder Aufrechterhaltung bestimmter Autoimmunerkrankungen beitragen können [Viglietta et al., 2004]. In den letzten Jahren sind die immunmodulatorischen Eigenschaften von Treg-Zellen auch im Gebiet der Transplantattoleranz untersucht worden. In Mausmodellen konnte z.B. gezeigt werden, dass Treg-Zellen sich an ihrem Wirkort, also dem Transplantat, anreichern und Transplantattoleranz vermitteln [Waldmann et al., 2004; Wood et al., 2003]. Inwiefern Treg-Zellen auch im humanen System in der Lage sind Transplantattoleranz zu vermitteln ist momentan Gegenstand der Forschung [Sakaguchi, 2005]. Auch in der Tumorimmunologie wurde eine Rolle von Treg-Zellen beschrieben. Bereits 1999 konnte gezeigt werden, dass die Depletion von CD4+CD25+ Zellen bei Mäusen, denen unterschiedliche Tumorzellen injiziert wurden, zu einem vollständigen Rückgang der Tumoren führte. In den nicht depletierten Kontrollmäusen zeigte sich jedoch ein progredientes Tumorwachstum, das zum Tod der Mäuse führte [Onizuka et al., 1999; Shimizu et al., 1999]. In unterschiedlichen Tumormodellen konnte mittlerweile gezeigt werden, dass Treg-Zellen die Funktion und die Proliferation autologer, tumorspezifischer T-Zellen in vitro inhibieren [Ormandy et al., 2005; Unitt et al., 2005; Wang et al., 2004]. 2.5 Regulatorische T-Zellen bei Infektionskrankheiten Wie bereits erwähnt, besteht eine der Hauptaufgaben des Immunsystems in der Kontrolle verschiedener Infektionen. Zur Elimination der Krankheitserreger bedarf es einer starken und multispezifischen Immunantwort des Körpers. Diese starken Immunantworten können jedoch nicht nur potenziellen Krankheitserregern, sondern 2 Einleitung 12 auch dem eigenen Körper erheblichen Schaden zufügen. Deshalb müssen solche Immunantworten einer adäquaten Kontrolle unterliegen. Verschiedene Arbeiten haben gezeigt, dass Treg-Zellen in der Kontrolle dieser Immunantworten eine entscheidende Rolle spielen können [Belkaid et al., 2005; Mittrucker et al., 2004]. Als Beispiel einer bakteriellen Infektion ist die Rolle von Treg-Zellen bei der Helicobacter pylori-Infektion aufgezeigt worden. T-Zell-defiziente Mäuse erhielten entweder CD4+ T-Zellen oder ausschließlich CD4+CD25- T-Zellen (also keine TregZellen) bevor sie oral mit H. pylori infiziert wurden. In der Gruppe, die CD4+CD25- TZellen erhalten hatten, konnte anschließend eine deutlich geringere Kolonialisierung des Keims als in der ersten Gruppe nachgewiesen werden. Allerdings erkrankten diese Mäuse an einer massiven Entzündung des Magens [Raghavan et al., 2003]. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Anwesenheit von CD4+CD25+ Treg-Zellen zu einer schwächeren T-Zell-Antwort führt, die den Keim nicht eliminieren kann, aber so die Magenschleimhaut vor einer überschießenden Immunantwort geschützt wird. Auch im humanen System konnte gezeigt werden, dass Treg-Zellen Helicobacter-spezifische T-Zell-Antworten in einem in vitro System inhibieren [Lundgren et al., 2003]. Bei parasitären Infektionen konnte ebenfalls eine Wirkung von Treg-Zellen nachgewiesen werden. So scheinen Treg-Zellen eine wichtige Rolle bei der Persistenz von Leishmania major zu spielen, indem sie am Ort der Infektion akkumulieren und dort die T-Zell-Antworten limitieren [Belkaid et al., 2002]. Weiterhin wurde kürzlich gezeigt, dass Mäuse, denen vor der Infektion mit einem letalen Stamm von Plasmodium yoelii die CD4+CD25+ Treg-Zellen depletiert wurden, überleben, während nicht depletierte Kontrollmäuse versterben. Dieser Schutz ist bedeutenderweise mit einem massiven Ansteigen der pathogenspezifischen T-ZellAntworten assoziiert [Hisaeda et al., 2004]. Diese Beobachtung zeigt, dass die Versuchstiere in der Abwesenheit von Treg-Zellen eine stärkere T-Zell-Antwort generieren konnten. Eine Vielzahl von Arbeiten hat sich mittlerweile mit der Rolle von Treg-Zellen bei chronisch viralen Erkrankungen beschäftigt, insbesondere bei der HIV-Infektion. Durch Depletionsassays oder Kokultivierung verschiedener T-Zell-Subpopulationen wurde in 2 Einleitung 13 diesen Arbeiten gezeigt, dass Treg-Zellen die Expansion von CD4+ und CD8+ Effektor T-Zellen sowohl antigenspezifisch als auch unspezifisch inhibieren [Aandahl et al., 2004; Andersson et al., 2005; Kinter et al., 2004; Weiss et al., 2004]. Ein ähnlicher Effekt von Treg-Zellen auf die virusspezifische T-Zell-Expansion konnte auch für die CMV-Infektion gezeigt werden [Aandahl et al., 2004]. Zu Beginn dieser Doktorarbeit lagen keine Arbeiten vor, die sich mit dem Einfluss von Treg-Zellen auf die HCV-spezifische Immunantwort beschäftigt haben, daraus ergab sich folgende Zielsetzung. 2 Einleitung 2.6 14 Zielsetzung Ziel dieser Doktorarbeit war es, den Einfluss von CD4+CD25+ regulatorischen T-Zellen (Treg-Zellen) auf die CD8+ T-Zell-Antwort bei der chronischen HCV-Infektion zu untersuchen. Hierzu sollten folgende Fragestellungen untersucht werden: 1. Haben Treg-Zellen einen inhibitorischen Effekt auf die Expansion und die IFN-γProduktion von HCV-spezifischen CD8+ T-Zellen? 2. Ist die Wirkung von Treg-Zellen dosisabhängig? 3. Wird die Wirkung von Treg-Zellen durch inhibitorische Zytokine vermittelt, oder bedarf es bei der Wirkung von Treg-Zellen einem direkten Zell-Zell-Kontakt? 4. Welche Rolle hat das Zytokin Interleukin-2 bei der Wirkung und der Proliferation von Treg-Zellen? 5. Ist die Wirkung von Treg-Zellen bei gesunden Probanden und Personen, die das Virus eliminiert haben, vergleichbar mit der von Patienten mit chronischer HCV-Infektion? 6. Ist der Effekt von Treg-Zellen auf HCV-spezifische T-Zellen beschränkt? 7. Unterscheidet sich die Frequenz von zirkulierenden Treg-Zellen im Blut von Patienten mit chronischer HCV-Infektion von der von gesunden Probanden und Personen, die das Virus eliminiert haben? Insgesamt war es somit das Ziel dieser Doktorarbeit, die biologische Relevanz von CD4+CD25+ Treg-Zellen bei der chronischen HCV-Infektion zu untersuchen. 3 Material und Methoden 15 3 Material und Methoden 3.1 Studienpopulation Vollblutproben von Patienten mit chronischer HCV-Infektion, von Personen, die das Hepatitis C Virus entweder spontan oder therapieinduziert eliminiert haben und von gesunden Blutspendern wurden nach Aufklärung und Einverständnis der Spender zu einer Aufnahme in diese Studie entnommen. Ein positives Votum der lokalen Ethikkommission für diese Untersuchungen liegt vor. Alle in die Studie eingeschlossenen Personen waren positiv für das humane-Leukozyten-Antigen-A2 (HLA-A2). Eine Zusammenstellung der laborchemischen und virologischen Daten zeigt Tabelle 3.1. Tabelle 3.1 Daten der Patienten Patient (chron. HCV) Alter Geschlecht C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 38 41 25 47 49 30 39 46 F M M F F M M M Person (HCV eliminiert) Alter R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 44 31 43 49 53 36 53 27 ALT (U/l) HCV PCR Genotyp Viruslast (GE/ml) 59 109 62 83 14 41 100 150 + + + + + + + + 1 1 1 1 1 1 1 1 500.000 29.000.000 150.000 1.700.000 2.000.000 n.u. 900.000 5.000 Anti-HCV Geschlecht Ak F M M M M M F F + + + + + + + + HCV PCR Elimination - Therapie spontan Therapie spontan spontan Therapie Therapie spontan 3 Material und Methoden 3.2 Zellkulturarbeiten 3.2.1 Isolierung von Lymphozyten 16 EDTA-antikoagulierte Vollblutproben wurden im Verhältnis 1:1 mit PBS (Invitrogen, USA) gemischt. Anschließend wurden 15 ml Röhrchen mit je 5 ml Lymphozyten Separations Medium (PAA, Österreich) gefüllt. Das verdünnte Blut wurde vorsichtig in 10 ml Portionen auf das Separationsmedium geschichtet und bei 2000 rpm 20 min. ohne Bremse zentrifugiert. Lymphozyten, Granulozyten und Monozyten (zusammen PBMC: Mononukleare Zellen des Peripheren Blutes) wurden durch die Zentrifugation über den Gradienten von den anderen zellulären Bestandteilen (Erythrozyten, Thrombozyten etc.) und dem Plasma getrennt und konnten so nach der Zentrifugation zwischen Plasma und Separationsmedium vorsichtig entnommen werden. Da bei der Entnahme stets sowohl etwas Plasma als auch Separationsmedium mit entnommen werden, wurden die PBMC zweimal in 50 ml PBS gewaschen. Die Zellen wurden anschließend in PBS gelöst, bei 1600 rpm für 10 min. mit Bremse abzentrifugiert und erneut in PBS resuspendiert. Nach dem zweiten Waschen wurde das Zellpellet in 20-30 ml PBS resuspendiert. Ein Teil der Zellen wurde im Verhältnis 1:4 mit 0,4 % Trypan-Blau gefärbt und in einer Neubauer Zählkammer gezählt. 3.2.2 Zellselektionen CD4 Depletion: CD4+ Zellen wurden mit zwei unterschiedlichen Methoden von den PBMC getrennt: CD4 Dynabeads (Dynal Biotech, Norwegen): Es wurden je 107 Zellen in 1 ml DynalPuffer (PBS + 1% FCS) gelöst und 144 µl CD4 Dynabeads hinzu gegeben. Nach einer Inkubation von 30 min. bei 4°C unter stetiger Rotation wurde das Röhrchen mit der Zellsuspension in einen Dynal-MPC-Magneten gestellt. Die CD4 depletierte Fraktion konnte anschließend am Boden des Röhrchens entnommen werden. CD4+CD25+ Regulatorische T-Zellen Isolations Kit (Miltenyi Biotec, USA): Die zu selektionierenden Zellen wurden in 90 µl MACS- Puffer (PBS, pH 7,2 plus 0,5% BSA (bovine serum albumine) und 2mM EDTA) je 107 Zellen gelöst. Im ersten AntikörperSchritt wurden alle nicht CD4+ Zellen mit Biotin- Antikörpern markiert. Hierzu wurden 10 µl Antikörper Cocktail (Antikörper gegen: CD8, CD14, CD16, CD19, CD36, CD56, 3 Material und Methoden 17 CD123, TZR γ/δ und Glycophorin A) je 107 Zellen zur Suspension hinzu gegeben und die Zellsuspension für 10 min. bei 4°C (im Kühlschrank) inkubiert. Im zweiten Antikörper-Schritt wurden Anti-Biotin MicroBeads verwendet, die gegen Biotin gerichtet sind und so an die Biotin-markierten Zellen binden. An die Anti-Biotin Antikörper sind kleine Magneten (MicroBeads) gekoppelt. Nach einer Inkubation von 15 min. im Kühlschrank wurde die Suspension mit 10 ml MACS Puffer gewaschen. Der Überstand wurde abgenommen und das Pellet erneut in 1 ml MACS Puffer gelöst. Zur Vorbereitung der Separation wurde eine LD-Säule in einen MidiMACS-Magneten eingehängt, die die antikörpermarkierten Zellen im Magnetfeld halten soll. Die Säule wurde zunächst mit 2 ml MACS-Puffer gespült, anschließend wurde ein 15 ml Röhrchen unter der Säule platziert, in der die unmarkierten Zellen (CD4+ Zellen) aufgefangen werden sollten. Die Zellsuspension wurde anschließend auf die Säule pipettiert. Nachdem die Suspension durch die Säule gelaufen war, wurde diese zweimal mit je 1 ml MACS-Puffer gewaschen. Die in der Säule verbliebenen antikörpermarkierten Zellen wurden dann in einem zweiten Röhrchen aufgefangen. Dazu wurde die Säule aus dem Magnetfeld entfernt und nach Zugabe von 2 ml Puffer mit einem dazugehörigen Stopfen durchfahren. Somit wurden die CD4 Zellen von der Säule getrennt und in einem separaten Röhrchen aufgefangen (Abbildung 3.1, 1-3). CD25 Selektion: CD4+ T-Zellen wurden für 15 min. in 90 µl MACS- Puffer und mit 10 µl Anti-CD25-MicroBeads je 107 Zellen bei 4° C inkubiert. Nach ausführlichem Waschen wurden die Zellen in 500 µl MACS- Puffer resuspendiert. Für die Selektion wurde eine MS-Säule in einen MiniMACS-Magneten gehängt. Die Suspension wurde auf die Säule gegeben und die CD25- Fraktion aufgefangen. Die CD25+ T-Zellen wurden wie oben beschrieben aus der Säule entfernt und in einem getrennten Gefäß aufgefangen (Abbildung 3.1, 4-6). 3 Material und Methoden 18 CD4CD4+ CD25+ CD4+ CD25- 1. 4. Magnet Magnet 2. CD4+ Zellen 3. CD4 depletierte Zellen 5. CD4+CD25- Zellen 6. CD4+CD25+ Zellen Abbildung 3.1 Schema der Zellselektionen mit paramagnetischen Microbeads (MACS). 1-3: Trennung der CD4+ Zellen von CD4- Zellen; 4-6: Isolierung der Treg-Zellen aus der CD4+ Population 3.2.3 Antikörperfärbungen Um die Reinheit der Selektionen oder die Frequenz von zirkulierenden CD4+CD25+ TZellen im Blut zu bestimmen wurden Antikörperfärbungen durchgeführt. PBMC oder selektionierte T-Zell-Subpopulationen wurden in PBS gelöst und je 0,1 – 0,5 x 106 Zellen auf einer 96-Loch-Platte ausplattiert. Mit einem Blocking-Antikörper (IgG1, BD PharMingen, USA) wurden die unspezifischen Bindungsstellen blockiert (15 min. Inkubation). Anschließend wurden die Zellen für 5-10 min. mit Antikörpern gegen CD25 (PE, Miltenyi Biotec) und CD4 (FITC, Miltenyi Biotec) inkubiert. Parallel dazu wurden stets Isotype-Kontrollfärbungen durchgeführt. Nach ausführlichem Waschen wurden die Zellen mit je 100 µl CellFIX (BD PharMingen) fixiert. Anschließend wurden die Proben durchflusszytometrisch gemessen (siehe Kapitel 3.4). Die Reinheit der einzelnen T-Zell-Subpopulationen lag immer über 85% (repräsentativer Plot von selektionierten CD4+CD25+ Treg-Zellen, Abbildung 3.2). 19 10 2 100 10 1 CD4 FITC 10 3 10 4 3 Material und Methoden 10 0 10 1 10 2 103 104 CD25 PE Abbildung 3.2 Density Plot einer Population von CD4+CD25+ Treg-Zellen zur Kontrolle der Zellselektion 3.2.4 Transwell®-Assays Versuche mit Transwell-Platten ermöglichen eine Aussage über die Notwendigkeit von direktem Zell-Zell-Kontakt für immunologische Zell-Zell-Interaktionen, da zwei definierte Zellpopulationen im gleichen Medium kultiviert werden können, ohne dass ein Zell-Zell-Kontakt besteht. Beide Populationen werden durch eine Membran getrennt deren Porengröße 0,4 µm beträgt. Zytokine, die evtl. sezerniert werden, können sich gleichmäßig im Medium verteilen und ihre Zielzellen erreichen. CD4 depletierte PBMC wurden als CD8+ angereicherte Effektorpopulation in dem Medium suspendiert und in eine Vertiefung einer 24-Loch-Platte gegeben. Treg-Zellen wurden auf die Membran gegeben, die anschließend in die Vertiefung mit der Zellsuspension gegeben wurde. Stimulation und Kultur erfolgten wie in Kapitel 3.3.1 ausführlich beschrieben. 3.2.5 Zytokin-Neutralisations-Assays Mithilfe von Antikörpern, die gegen definierte Zytokine gerichtet sind, ist es möglich, die von den entsprechenden Zytokinen vermittelten Signalwege zu unterbinden. Diese 3 Material und Methoden 20 Technik wurde angewandt, um den möglichen Einfluss bestimmter Zytokine auf die CD4+CD25+ T-Zell-vermittelte Inhibition zu untersuchen. Dazu wurden den Kokulturen von CD4 depletierten PBMC und Treg-Zellen Antikörper gegen Interleukin 10 bzw. TGF-β hinzu gegeben. Stimulation und Kultur wurden wie in Kapitel 3.3.1 ausführlich beschrieben durchgeführt. 3.3 Antigenspezifische Untersuchungen Zellselektionen PBMC CD4 depletierte PBMC (CD8+ angereichert) CD4+ CD4+CD25- CD4+CD25+ (Treg-Zellen) Kokulturen CD4 depletierte PBMC plus CD4+CD25CD4+CD25+ (Treg-Zellen) HCV-Peptid Stimulation und 7 Tage Kultur Abbildung 3.3 Schema der Zellselektionen und der Kokulturen 3.3.1 Antigenspezifisches Wachstum Je 2 x 106 PBMC oder CD4 depletierte PBMC wurden in 1 ml RPMI+++ Zellmedium (Invitrogen, USA; Zusätze: 10% FCS, 1,5% Hepes-Puffer (1M) und + Penicillin/Streptomycin) gelöst und alleine oder mit CD4 CD25 + 1% T-Zellen oder CD4+CD25- T-Zellen in einem bestimmten Verhältnis (z.B. 3:1 oder 10:1) in einer 48Loch-Platte kultiviert (Abbildung 3.3). Die Stimulation erfolgte mit 0,5 µg/ml antiCD28 und mit 10 µg/ml synthetischem HCV- oder Influenza-Peptid. Die Aminosäuresequenzen und die Position aller in der Studie angewandten Peptide ist in 3 Material und Methoden 21 Tabelle 3.2 angegeben. In einigen Versuchen wurden die CD4+CD25+ T-Zellen unmittelbar vor der Kultur bestrahlt (30Gy), hierdurch werden Zellteilungen unmöglich gemacht. In einem Experiment wurden die Kokulturen mit 2 U/ml, 20 U/ml und 200 U/ml rekombinantem Interleukin-2 (Hoffmann-La Roche, Schweiz) stimuliert. Nach einmaligem Mediumwechsel am dritten Tag wurden die Zellkulturen nach 7 Tagen mit einem der folgenden antigenspezifischen Nachweisverfahren analysiert. Tabelle 3.2 Immundominante Peptide Virus HCV HCV HCV Influenza 3.3.2 Peptid 1 2 3 4 Aminosäuresequenz CINGVCWTV KLVALGINAV ALYDVVTKL GILGFVFTL Position NS3 1073 NS3 1406 NS5 2594 Matrix 58 Tetramer-Färbung Mit dieser Methode ist es möglich, antigenspezifische Zellen direkt zu markieren, so dass sie mit der Durchflusszytometrie detektiert werden können. Die T-Zelle erkennt Antigene, die an MHC-Moleküle gebunden sind. Ein Tetramer besteht aus vier solcher Komplexe, hierdurch wird die Avidität der Wechselwirkung zwischen T-Zell-Rezeptor und MHC-Peptid-Komplex erhöht. Die vier MHC-Peptid-Komplexe sind an eine Fluoreszenz gekoppelt, die es ermöglicht Tetramer-markierte antigenspezifische Zellen mithilfe der Durchflusszytometrie zu visualisieren. Die verwendeten Tetramere korrespondieren mit den in Tabelle 3.2 angegebenen Peptiden. Abbildung 3.4 zeigt das Prinzip einer Tetramer-Färbung und eine entsprechende FACS-Analyse. Für jede T-Zell-Kultur (z.B. PBMC oder CD4 depletierte PBMC + CD4+CD25+) wurde eine Isotype-Kontrolle, eine CD8-Kontrolle ohne Tetramer und 1-2 Proben mit CD8Färbung und Tetrameren angesetzt. Dazu wurden je 0,2 x 106 Zellen pro Vertiefung in 200 µl PRMI+++ Medium gelöst und auf eine 96-Loch-Platte gegeben. Nach 20-minütiger Zentrifugation bei 13000 rpm wurden in jede Vertiefung 0,5 µl Tetramer (APC markiert) und 50 µl Stain- Buffer (SB) gegeben und für 20 min. bei 37°C und 5,0% CO2 inkubiert. Anschließend wurden alle Proben zweimal mit je 100 µl SB gewaschen und mit einem Blocking-Antikörper (IgG1, BD PharMingen), der die 3 Material und Methoden 22 unspezifischen Bindungsstellen belegt, inkubiert. Nach einer Inkubation für 20 min. bei 4° C wurde die CD8-Färbung entweder mit einem PE- oder Cy-7 PE-markierten CD8Antikörper (BD PharMingen) durchgeführt. Dementsprechend wurde neben dem APC Isotype-Ak entweder ein PE oder ein Cy-7 PE Isotype-Ak verwendet. Die Inkubation erfolgte wie beim Blocking-Ak. Anschließend wurden die Proben dreimal mit 100 µl SB gewaschen und für die Messung an der FACS- Maschine mit je 100 µl CellFIX (BD PharMingen) fixiert. B TZR MHC-Klasse-I Molekül 3 2 1 0 APC CD8 10 10 10 10 10 TZR Cy7 PE-markierter CD8 Antikörper APC-markiertes Tetramer Tetramer APC 4 A 0 10 1 10 2 10 3 10 CD8 Cy7 Peptid Abbildung 3.4 Tetramer-Färbung. (A) Schema einer Tetramer-markierten CD8+ T-Zelle (B) FACSAnalyse einer CD8+ Tetramer+ T-Zell-Population (rechter oberer Quadrant) 3.3.3 Intrazelluläre Zytokin-Färbung Da die Interferon-γ produzierenden Zellen das gebildete Zytokin aus der Zelle sezernieren, ist es schwierig zu bestimmen, welche Zellen das Zytokin produzieren und welche nicht. Bei der intrazellulären-Interferon-γ-Färbung wird die Zytokinfreisetzung durch Zugabe von Golgi-Plaque (Brefeldin A) gehemmt, die Zellmembran permeabilisiert und ein Antikörper gegen IFN-γ hinzu gegeben, der somit die Zellen markiert, die auf eine Peptidstimulation mit einer IFN-γ Produktion reagiert haben. Mit dieser Methode können Zellen, die peptidspezifisch IFN-γ produzieren, durchflusszytometrisch erfasst werden. Eine IFN-γ-Färbung ist in Abbildung 3.5 schematisch dargestellt. 4 10 3 Material und Methoden 23 Die Zellen wurden wie schon bei der Tetramer-Färbung nach 7 Tagen in Kultur in eine 96-Loch-Platte gegeben. Für jede T-Zell-Kultur wurden 4-5 unterschiedliche Färbungen angefertigt. • Eine Isotype-Kontrolle. • Eine Negativ-Kontrolle, um zu bestimmen, wie viel Prozent der CD8+ T-Zellen ohne erneute Peptid-Stimulation IFN-γ produzieren. • Jeweils ein Ansatz für jedes Peptid, mit dem die Kultur zu Beginn stimuliert wurde, so dass die Peptid-induzierte IFN-γ Produktion gemessen werden konnte (max. 2 Peptide). • PMA als Positiv-Kontrolle, dies stimuliert die IFN-γ Produktion von T-Zellen unabhängig vom T-Zell-Rezeptor. Nach dem Ausplattieren wurden die Ansätze mit den entsprechenden Peptiden und PMA für 5 Stunden inkubiert. Außerdem wurde den Zellen noch das Zellgift Brefeldin A hinzu gegeben. Nach 5 stündiger Inkubation bei 37°C und 5% CO2 wurde die 96-Loch-Platte abzentrifugiert. Anschließend wurden die Proben zweimal mit je 100 µl SB gewaschen. Anschließend wurde in alle Vertiefungen ein Blocking-Antikörper (IgG1, BD PharMingen) gegeben, der die unspezifischen Bindungsstellen belegt. Nach einer 20minütigen Inkubation bei 4°C wurde die CD8-Färbung mit einem PE-markierten CD8Antikörper (BD PharMingen) durchgeführt. Die Inkubation erfolgte wie beim BlockingAk. Nach der CD8-Färbung wurden die Zellen abzentrifugiert, gewaschen und für die intrazelluläre Zytokinfärbung fixiert und permeabilisiert. Hierfür wurden die Zellen mit Cytofix/Cytoperm (BD PharMingen) für exakt 15 min. bei 4°C inkubiert. Anschließend wurden die Zellen erneut gewaschen und mit FITC-markiertem Antikörper gegen intrazelluläres IFN-γ inkubiert. Parallel wurden bei allen Antikörper-Schritten die analogen Isotype-Kontrollfärbungen durchgeführt. Nun wurde die Platte dreimal mit 100 µl SB gewaschen und für die Messung an der FACS- Maschine mit je 100 µl CellFIX (BD PharMingen) fixiert. 3 Material und Methoden 24 B 104 A data.018 IFN-γ FITC CD8 Intrazellulärer FITC-markierter IFN−γ Antikörper 100 PE-markierter CD8 Antikörper 101 102 103 IFN−γ 100 100 101 101 102 CD8 PE 102 10 3 103 104 104 CD8 PE Abbildung 3.5 Intrazelluläre Zytokin-Färbung (A) Schema einer Interferon-γ produzierenden, Antikörper-markierten CD8+ T-Zelle (B) FACS-Analyse einer CD8+ IFN-γ+ T-ZellPopulation (rechter oberer Quadrant) 3.3.4 CFSE-Färbung Das Proliferationsverhalten von Zellen in einer Kultur lässt sich mit der CFSE-Färbung untersuchen. Die Zellen werden zu Beginn der Kultur mit CFSE (5-(und-6)Carboxyfluorescein diacetat succinimidyl Ester, Molecular Probes, USA) beladen, die jede Zelle bei der Zellteilung gleichmäßig an beide Tochterzellen weitergibt. Da diese Substanz fluoreszierende Eigenschaften hat, kann mittels Durchflusszytometrie über die Farbintensität indirekt darauf geschlossen werden, wie viele Zellteilungen eine Zelle in einer Kultur hinter sich hat. Abbildung 3.6 zeigt schematisch das Prinzip der CFSEFärbung. Je 107 CD4 depletierte PBMC wurden in 1 ml PBS resuspendiert und mit 1 µmol/l CFSE für 10 min. bei 37°C inkubiert. Anschließend wurden die Zellen dreimal in 10 ml RPMI Zellmedium gewaschen und in unterschiedlichen Verhältnissen mit unmarkierten CD4+CD25+ Treg-Zellen oder mit CD4+CD25- Zellen kultiviert. Stimulation und Kultur erfolgte wie in Kapitel 3.3.1 beschrieben. Für die Auswertung der Kultur wurde eine Tetramer-Färbung durchgeführt. 3 Material und Methoden 25 B CFSE 100 101 1. Zellteilung CD8 Cy7 PE 102 103 104 A 100 101 102 CFSE 103 104 2. Zellteilung Abbildung 3.6 CFSE-Färbung (A) Schema der Weitergabe von absorbiertem CFSE bei Zellteilungen (B) FACS-Analyse nach Kultur zeigt CD8+ T-Zellen, die proliferiert haben (linker oberer Quadrant) und CD8+ T-Zellen, die nicht proliferiert haben (rechter oberer Quadrant) 3.4 Durchflusszytometrie Die einzelnen Proben wurden nach den Antikörperfärbungen in spezielle FACSRöhrchen überführt. Die Messungen wurden an einem FACSCalibur-Gerät (BD Biosciences) mithilfe von Cell Quest Software (BD Biosciences) durchgeführt. Bei den Auswertungen wurden ausschließlich Zellen im Lymphozyten-Gate berücksichtigt. 3.5 Statistik Die statistische Signifikanz der Ergebnisse aus den Kapiteln 4.8 und 4.9 wurde mit dem Mann-Whitney U-Test geprüft, wobei p<0,05 als Signifikanzschwelle festgelegt wurde. 4 Ergebnisse 26 4 Ergebnisse 4.1 Die Depletion von CD4+ Zellen führt zu einer gesteigerten in vitro Expansion von HCV-spezifischen CD8+ T-Zellen bei Patienten mit einer chronischen HCV-Infektion CD4+ Zellen werden einerseits für das Priming und die Expansion HCV-spezifischer CD8+ T-Zellen benötigt um das Virus zu eliminieren [Kalams et al., 1998], andererseits gibt es eine Subpopulation von CD4+ Zellen, der in verschiedenen Modellen ein inhibitorisches Potenzial bezüglich der Proliferation und Funktion antigenspezifischer CD8+ T-Zellen zugeschrieben wird [Shevach, 2002]. Zuerst sollte untersucht werden, ob CD4+ Zellen bei der chronischen HCV-Infektion die Expansion von HCVspezifischen CD8+ T-Zellen unterstützen oder eine inhibitorische Funktion aufweisen. Hierzu wurden sowohl PBMC als auch CD4 depletierte PBMC mit HCV-Peptid stimuliert und für 7 Tage kultiviert. Anschließend wurde die Expansion HCVspezifischer T-Zellen durch eine Tetramer-Färbung bestimmt. Interessanterweise führte die Depletion von CD4+ Zellen zu einer deutlich stärkeren Expansion von virusspezifischen CD8+ T-Zellen (Abbildung 4.1). Dieser Effekt konnte bei allen Patienten mit chronischer Hepatitis C Virusinfektion nachgewiesen werden, bei denen eine CD8+ T-Zell-Antwort gegen eines der immundominanten Epitope mittels Tetramer-Technologie nachweisbar war. Bei einer Patientin (C1) konnten wir diesen Effekt sogar für zwei unterschiedliche Epitope zeigen. Diese Ergebnisse deuten somit darauf hin, dass bei der chronischen HCV-Infektion eine inhibitorische Funktion innerhalb der CD4+ Zellen überwiegt. 4 Ergebnisse 27 9 8 % tetramer+/ CD8+ 7 6 5 4 3 2 1 0 Patient/ Peptid C1/2 C1/3 C2/3 C3/2 C4/1 C5/2 C6/2 C7/3 C8/1 Abbildung 4.1 Depletion von CD4+ Zellen steigert die Expansion der HCV-spezifischen CD8+ TZellen. PBMC (weiße Balken) und PBMC nach Depletion der CD4+ Zellen (schwarze Balken) wurden mit HCV-Peptid stimuliert und 7 Tage kultiviert. Bei allen untersuchten Patienten war die HCV-spezifische CD8+ T-Zell-Expansion nach Depletion der CD4+ Zellen verstärkt. 4.2 CD4+CD25+ Treg-Zellen hemmen die in vitro Expansion HCV-spezifischer CD8+ T-Zellen Um der Frage nachzugehen, ob Treg-Zellen für den inhibitorischen Effekt innerhalb der CD4+ Zellpopulation verantwortlich sind, wurde die CD4+ Zellpopulation von der CD4Zellpopulation getrennt. Die CD4+ Zellen wurden in CD4+CD25- Zellen und in CD4+CD25+ (Treg-Zellen) Zellen aufgetrennt. Nach diesen Selektionsschritten resultieren nun drei Zellpopulationen: CD4 depletierte PBMC, CD4+CD25- Zellen und Treg-Zellen. CD4 depletierte PBMC wurden alleine, in Anwesenheit von CD4+CD25Zellen (Verhältnis 3:1) oder Treg-Zellen (Verhältnis 3:1) in Kultur genommen und mit HCV-spezifischen Peptiden sowie anti-CD28 Antikörpern stimuliert (Abbildung 3.3). Nach 7 Tagen Kultur erfolgte die Auswertung durch Tetramer-Färbungen. Interessanterweise führte die Kokultivierung von CD4 depletierten PBMC mit autologen CD4+CD25- Zellen zu einer deutlichen Steigerung der Expansion von HCVspezifischen CD8+ T-Zellen verglichen mit der Kultur ohne CD4+ Zellen. Im Gegensatz 4 Ergebnisse 28 dazu zeigte sich in Gegenwart von Treg-Zellen eine deutliche Inhibition der HCVspezifischen Expansion (Abbildung 4.2). Diese Ergebnisse zeigen, dass ein Teil der CD4+ Zellpopulation, nämlich die CD4+CD25+ Treg-Zellen, einen inhibitorischen Effekt auf die Proliferation von CD8+ TZellen hat, wohingegen die CD4+CD25- Zellen die HCV-spezifische Expansion der CD8+ T-Zellen unterstützen. 1,8 14 10 1 % tetramer+/ CD8+ 5 0 0 Patient C1 / Peptid 2 1 1,8 Patient C1 / Peptid 3 1 0,5 0 0 Patient C2 / Peptid 3 Patient C3 / Peptid 2 Abbildung 4.2 Treg-Zellen inhibieren die Expansion HCV-spezifischer CD8+ T-Zellen. CD4 depletierte PBMC wurden allein (graue Balken), in Anwesenheit von CD4+CD25Zellen (schwarze Balken) oder Treg-Zellen (weiße Balken) nach HCV-PeptidStimulation für 7 Tage kultiviert. Die Zugabe von CD4+CD25- Zellen steigert die HCVspezifische Expansion von CD8+ T-Zellen, die Zugabe von Treg-Zellen inhibiert die Expansion im Vergleich zu allein wachsenden CD4 depletierten PBMC. 4.3 Treg-Zellen hemmen die IFN-γ Produktion von HCV-spezifischen CD8+ TZellen Als nächstes untersuchten wir, ob Treg-Zellen auch die intrazelluläre IFN-γ Produktion der CD8+ T-Zellen inhibieren. Dazu wurde der gleiche Versuchsansatz wie in Kapitel 4.2 beschrieben verwendet. Nach der Kultur erfolgte die Auswertung jedoch durch eine intrazelluläre IFN-γ-Färbung. 4 Ergebnisse 29 Es zeigte sich, dass die durch HCV-Peptid-Stimulation induzierte Produktion von IFN-γ in vergleichbarer Weise durch die Wirkung von Treg-Zellen beeinflusst wird wie die Proliferation. Die intrazelluläre Produktion dieses Zytokins durch CD8+ T-Zellen wird hingegen in der Anwesenheit von CD4+CD25- Zellen verstärkt. Der immunmodulatorische Effekt von Treg-Zellen auf HCV-spezifische Effektorzellen konnte also sowohl für die Proliferationskapazität als auch für die Zytokinproduktion nachgewiesen werden (Abbildung 4.3). CD4 depletierte PBMC plus CD4+CD25- - 10 2 10 3 CD8 PE 4 3 10 2 1 10 0 100 104 101 102 103 CD8 PE 10 10 1 4,5% 10 10 1 10 0 10 100 data.043 10 4 10 26% 2 10 2 10 1 10 10 0 IFN-γ data.038 10 3 21% 3 10 4 data.033 CD4+CD25+ 104 100 101 102 103 CD8 PE 104 CD8 Patient C1 / Peptid 3 Abbildung 4.3 Treg-Zellen inhibieren die IFN-γ Produktion von HCV-spezifischen CD8+ T-Zellen. CD4 depletierte PBMC wurden allein (graue Balken), in Anwesenheit von CD4+CD25Zellen (schwarze Balken) oder Treg-Zellen (weiße Balken) nach HCV-Peptid Stimulation für 7 Tage kultiviert. Die Zugabe von CD4+CD25- Zellen steigert die HCVspezifische IFN-γ Produktion von CD8+ T-Zellen, die Zugabe von Treg-Zellen inhibiert die IFN-γ Produktion im Vergleich zu allein wachsenden CD4 depletierten PBMC. 4.4 Treg-Zellen vermitteln ihre Wirkung dosisabhängig Um der Frage nachzugehen, ob der prozentuale Anteil von Treg-Zellen in einer Kultur entscheidend für das Ausmaß der suppressiven Wirkung ist, wurden CD4 depletierte PBMC in Anwesenheit unterschiedlicher Konzentrationen von Treg-Zellen peptidspezifisch kultiviert. Die CD4 depletierten PBMC wurden zunächst mit dem Proliferationsmarker CFSE beladen. Anschließend wurden Treg-Zellen in unterschiedlichen Verhältnissen zu der CD4- Effektorpopulation hinzugegeben. Da bereits mit einem Verhältnis von 3:1 (CD4 depletierte PBMC: Treg-Zellen) eine nahezu komplette Inhibition der HCV-spezifischen T-Zell-Proliferation beobachtet wurde 4 Ergebnisse 30 (Kapitel 4.2), wurden für diesen Versuch Verhältnisse von 10:1 (9% Treg), 15:1 (6,25%), 30:1 (3,2%) und 100:1 (0,99%) gewählt. Nach 7 Tagen in vitro Kultur wurde die Expansion der HCV-spezifischen CD8+ T-Zellen mithilfe einer Tetramer-Färbung ermittelt. Eine nahezu maximale Inhibition zeigte sich bei einem Verhältnis von 3:1 und bei einem Verhältnis von 10:1 (CD4 depletierte PBMC: CD4+CD25+ Treg-Zellen). Weiterhin zeigte sich, dass ein geringer werdender Anteil von Treg-Zellen in der Kultur zu einer stärkeren peptidspezifischen CD8+ T-Zell-Expansion führte. Mit der CFSEFärbung konnte gezeigt werden, dass bei Verhältnissen von 3:1 und 10:1 (CD4 depletierte PBMC: CD4+CD25+ Treg-Zellen) nur ein geringer Anteil Tetramer+ CD8+ TZellen proliferiert hat. Ab einem Verhältnis von 15:1 kam es zu einer Zunahme der HCV-spezifischen CD8+ T-Zell-Proliferation (Abbildung 4.4). Dieser Versuch konnte also auf der Einzel-Zell-Ebene zeigen, dass Treg-Zellen die Proliferation HCVspezifischer CD8+ T-Zellen dosisabhängig inhibieren. 4 Ergebnisse 31 % tetramer+/CD8+ 5 2,5 0 102 CFSE 103 104 100 101 102 CFSE 103 104 102 CFSE 103 104 20 counts M1 0 5 counts M1 5 101 85 % 15 15 71 % 0 100 data .020 10 20 20 10 counts 0 5 10 counts 0 101 100:1 data .016 M1 5 10 counts 0 100 54 % M1 M1 30:1 data .012 15 17 % 15 15 18 % 15:1 data .008 20 20 data.020 5 counts 10:1 10 3:1 100 101 102 CFSE 103 104 100 101 102 CFSE 103 104 CFSE Patient C1 / Peptid 3 Abbildung 4.4 Treg-Zellen hemmen die Proliferation HCV-spezifischer CD8+ T-Zellen dosisabhängig. Bei nachlassender Anzahl von Treg-Zellen kommt es zu einer Zunahme der Proliferation HCV-spezifischer CD8+ T-Zellen. Die abgebildeten Plots zeigen ausschließlich CD8+ Tetramer+ T-Zellen. 4.5 Die Suppression durch Treg-Zellen ist Zell-Zell-Kontakt abhängig Als nächstes untersuchten wir, ob ein direkter Zell-Zell-Kontakt für die inhibitorische Wirkung von Treg-Zellen notwendig ist. Wie bereits in Kapitel 3.2.4 beschrieben, ist es mit einer Transwell®-Membran möglich, zwei Zellpopulationen im gleichen Medium zu kultivieren, ohne dass ein direkter Zell-Zell-Kontakt besteht; ein Austausch von Zytokinen wird hierdurch nicht verhindert. CD4 depletierte PBMC wurden als Effektorpopulation alleine und in der Anwesenheit von Treg-Zellen kultiviert. Zusätzlich wurde noch eine Kokultur angelegt, in der beide Zellpopulationen durch eine Membran getrennt wurden. Die Kulturen wurden anschließend mit HCV-Peptiden stimuliert und für eine Woche kultiviert, bevor eine Tetramer-Färbung durchgeführt wurde. 4 Ergebnisse 32 Dieser Versuch zeigte, dass Treg-Zellen, die aufgrund der Membran keinen Zell-ZellKontakt mit CD8+ T-Zellen eingehen können, nicht in der Lage sind, die Expansion der Effektorzellen zu inhibieren. Wenn beide Zellpopulationen aber ohne Membran gemeinsam kultiviert wurden, war wiederum eine deutliche Reduktion der CD8+ T-ZellExpansion zu beobachten (Abbildung 4.5). Diese Ergebnisse zeigten somit, dass ein direkter Zell-Zell-Kontakt für die von Treg-Zellen vermittelte Suppression der Expansion HCV-spezifischer T-Zellen notwendig ist. CD4 depletierte PBMC plus CD4+CD25+ (3:1) kein Zell-Zell-Kontakt 10 4 4 10 2 10 1 10 0 10 0 10 1 10 2 10 3 CD8 Cy7-PE 10 4 10 10 1 10 2 10 3 CD8 Cy7-PE 1.67% 10 10 10 1 10 0 10 10 0 data.019 3 4 9.80% 2 10 2 10 1 10 10 0 tetramer CD4+CD25+ (3:1) Zell-Zell-Kontakt data.011 10 9.44% 3 data.003 3 10 4 - 10 0 10 1 10 2 10 3 CD8 Cy7-PE 10 4 CD8 Patient C1 / Peptid 3 Abbildung 4.5 Inhibition durch Treg-Zellen ist Zell-Zell-Kontakt abhängig. CD4 depletierte PBMC wurden allein (links), in Anwesenheit von Treg-Zellen aber durch eine Membran getrennt (Mitte) und in Anwesenheit von Treg-Zellen mit direktem Zell-Zell-Kontakt kultiviert (rechts). 4.6 Die Inhibition durch Treg-Zellen ist unabhängig von IL-10 und TGF-β Verschiedene Arbeiten haben auf eine mögliche Rolle von Zytokinen wie Interleukin 10 und TGF-β in der Inhibition von Effektorzellen durch Treg-Zellen hingewiesen. Um den Einfluss dieser Zytokine auf die Treg-Zell-vermittelte Inhibition zu untersuchen, wurden den Kokulturen von CD4 depletierten PBMC und Treg-Zellen neutralisierende Antikörper gegen IL-10 und TGF-β hinzu gegeben, bevor sie mit HCV-Peptiden stimuliert und für eine Woche kultiviert wurden. Anschließend wurde eine TetramerFärbung durchgeführt. 4 Ergebnisse 33 Diese Versuche zeigten, dass die Zugabe neutralisierender Antikörper nur einen sehr geringen Einfluss auf die Inhibition der HCV-spezifischen CD8+ T-Zell-Expansion durch Treg-Zellen hat (Abbildung 4.6). Dies deutet daraufhin, dass die Inhibition von HCV-spezifischen CD8+ T-Zellen durch Treg-Zellen unabhängig von Interleukin-10 und TGF-β ist. keine Antikörper anti TGF-β 50 anti IL-10 % Inhibition 100 0 Patient C1 / Peptid 3 Abbildung 4.6 Inhibition durch Treg-Zellen ist unabhängig von IL-10 und TGF-β. Kokulturen von Treg-Zellen und CD4 depletierten PBMC wurden neutralisierende Antikörper gegen IL10 und TGF-β hinzugegeben. Hierdurch wurde die inhibitorische Kapazität der TregZellen nicht aufgehoben. 4.7 Einfluss von IL-2 auf die Wirkung von Treg-Zellen Treg-Zellen exprimieren konstitutiv die α-Kette des Interleukin-2 Rezeptors CD25 auf ihrer Oberfläche. Somit stellt sich die Frage nach der Rolle von Interleukin-2 bei der Treg-Zell-vermittelten Suppression. Einige Arbeiten haben beschrieben, dass die Zugabe von exogenem IL-2 die inhibitorische Wirkung von Treg-Zellen aufhebt, andere Arbeiten haben dies aber nicht bestätigen können. Um den möglichen Einfluss von IL-2 auf die Wirkung von Treg-Zellen in unserem System zu untersuchen, wurden CD4 depletierte Zellen mit Treg-Zellen, wie in Kapitel 4.2 beschrieben, kultiviert und zusätzlich mit 2 U/ml, 20 U/ml oder 200 U/ml 4 Ergebnisse 34 Interleukin-2 stimuliert. Die Zugabe von steigenden Mengen exogenem IL-2 hatte jedoch nahezu keinen Einfluss auf die Treg-Zell-vermittelte Inhibition der virusspezifischen CD8+ T-Zell-Expansion. Anschließend sollte das Proliferationsverhalten von Treg-Zellen untersucht werden. Dazu wurden CD25+ T-Zellen mit CFSE beladen und in Kultur gebracht. Die Stimulation erfolgte entweder nur mit anti-CD28 oder mit anti-CD28 und rekombinantem IL-2. An den Tagen 2, 4, 5 und 7 wurde über eine CD4-Färbung untersucht, wie viel Prozent der CD4+CD25+ Treg-Zellen proliferiert haben. Nur in den Kulturen, die mit IL-2 stimuliert wurden, proliferierten Treg-Zellen, aber nur zu einem geringen Anteil von 14%. In den Kulturen, die nur mit anti-CD28 stimuliert wurden, zeigte sich keine Proliferation von Treg-Zellen (Abbildung 4.7). Diese Versuche zeigen somit, dass Treg-Zellen Interleukin-2 zum Wachstum benötigen, doch trotz massiver Zugabe von Interleukin-2 (200 U/ ml an Tag 0 und Tag 4) proliferierten nur 14% der Treg-Zellen. A B anti-CD28 + IL-2 data.004 15 anti-CD28 + IL-2 anti-CD28 100 CD4 % Proliferation der CD4+CD25+ T-Zellen 14% 10 101 102 103 CFSE FITC 104 anti-CD28 data.002 <1% 5 0 1 2 3 4 5 6 7 100 101 102 103 CFSE FITC 104 Tage in Kultur CFSE Abbildung 4.7 Treg-Zellen sind nur nach Zugabe hoher Dosen von Interleukin-2 in der Lage zu proliferieren. (A) CD25+ Zellen wurden mit CFSE beladen und in Kultur gebracht. Stimulation erfolgte entweder nur mit gelöstem anti-CD28 oder zusätzlich mit rekombinantem IL-2. Nach 7 Tagen zeigte sich, dass Treg-Zellen nur nach Zugabe von IL-2 proliferieren. (B) Dot plots beider Kulturen nach 7 Tagen. 4 Ergebnisse 35 Weiterhin untersuchten wir, ob in den Kokulturen eine Proliferation von Treg-Zellen notwendig ist, um suppressiv auf CD8+ T-Zellen zu wirken. Hierfür wurden Treg-Zellen nach der Selektion mit 30 Gy bestrahlt. Dadurch wird den Zellen die Proliferationsfähigkeit genommen. Anschließend wurden die bestrahlten Treg-Zellen gemeinsam mit CD4 depletierten PBMC in Kultur gebracht. Interessanterweise hatte die Bestrahlung aber keinen Einfluss auf die suppressive Kapazität von Treg-Zellen (Abbildung 4.8). Somit scheint die Proliferation von Treg-Zellen für die Inhibition der % tetramer+/ CD8+ CD8+ Effektorzellen nicht notwendig zu sein. 3 1 1,5 0,5 0 0 Patient G1 / Peptid 4 Patient G2 / Peptid 4 Abbildung 4.8 Bestrahlte Treg-Zellen verlieren nicht ihre inhibitorische Kapazität. CD4 depletierte PBMC wurden alleine (schwarze Balken), mit Treg-Zellen (weiße Balken) und mit bestrahlten Treg-Zellen (schraffierte Balken) kultiviert. Bestrahlte Treg-Zellen behalten ihre suppressive Wirkung. 4.8 Stärkere Inhibition virusspezifischer T-Zell-Antworten bei Patienten mit chronischer HCV-Infektion im Vergleich zu gesunden Probanden und Personen, die das Virus eliminiert haben Mit den folgenden Experimenten sollte untersucht werden, ob die Suppression von virusspezifischen T-Zellen spezifisch für die chronische Hepatitis C Virusinfektion ist. Hierfür wurden neben Patienten mit chronischer HCV-Infektion auch Personen untersucht, die HCV entweder spontan oder therapieinduziert eliminiert haben. Weiterhin sollte untersucht werden, ob die Treg-Zell-vermittelte Inhibition spezifisch für das persistierende Antigen ist, oder ob sich auch eine Hemmung anderer virusspezifischer T-Zellen nachweisen lässt. Als Kontrollantigen wurde hierfür ein immundominantes Peptid des Influenza Virus verwendet. 4 Ergebnisse 36 CD4 depletierte PBMC wurden in Anwesenheit von CD4+CD25- Zellen (Verhältnis 3:1) oder CD4+CD25+ Treg-Zellen (Verhältnis 3:1) in Kultur gebracht und mit HCVspezifischen und Influenza-spezifischen Peptiden sowie anti-CD28 Antikörpern stimuliert. Nach 7 Tagen Kultur erfolgte die Auswertung durch Tetramer-Färbungen. Um die Stärke der jeweils beobachteten Inhibition vergleichen zu können, wurde die prozentuale Inhibition berechnet. Es zeigte sich, dass die Proliferation von Influenza-spezifischen CD8+ T-Zellen bei chronisch HCV-infizierten Personen nahezu gleich stark inhibiert wurde wie die von HCV-spezifischen CD8+ T-Zellen. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich die Wirkung von Treg-Zellen nicht auf das persistierende Antigen beschränkt. Auch bei Personen mit ausgeheilter HCV-Infektion zeigte sich eine gleich starke Hemmung von HCV-spezifischen und Influenza-spezifischen T-Zellen. Interessanterweise war die Inhibition der CD8+ T-Zellen bei Personen mit ausgeheilter HCV-Infektion und gesunden Probanden aber deutlich schwächer als bei Patienten mit chronischer HCVInfektion (Abbildung 4.9). Zusammenfassend konnte gezeigt werden, dass die Wirkung von Treg-Zellen bei der chronischen HCV-Infektion verstärkt, aber nicht spezifisch für das persistierende Antigen ist. 4 Ergebnisse 37 chron. HCV HCV eliminiert gesund p=0.018 100 89.2% 87.4% % Inhibition 80 60 55.0% 52.6% 50.8% 40 20 p=0.028 p=0.018 0 HCV Peptid Flu Peptid HCV Peptid Flu Peptid Flu Peptid Abbildung 4.9 Stärkere Inhibition durch Treg-Zellen bei Patienten mit chronischer HCV-Infektion als bei Personen mit ausgeheilter HCV-Infektion und gesunden Kontrollpersonen. Für die Berechnung der prozentualen Inhibition wurde folgende Formel angewandt: 100 – (Prozentzahl Tetramer+ CD8+ T-Zellen in Gegenwart von Treg-Zellen geteilt durch die Prozentzahl Tetramer+ CD8+ T-Zellen in Gegenwart von CD4+CD25- T-Zellen) x 100. Chronische HCV: HCV-Peptid (C1[2 Epitope], C2, C3 und C4), Flu-Peptid (C1, C2, C3, C4 und C5); HCV eliminiert: HCV-Peptid (R1, R2[2 Epitope], R3, R7 und R8[2 Epitope]), Flu-Peptid (R2, R3, R4, R5 und R6) und 6 gesunde Probanden. 4.9 Erhöhte Frequenz von Treg-Zellen bei Patienten mit chronischer HCVInfektion Um die biologische Relevanz von Treg-Zellen bei der chronischen Hepatitis C Virusinfektion weiter zu charakterisieren, sollte die Frequenz der zirkulierenden TregZellen im peripheren Blut untersucht werden. Mithilfe von FACS-Färbungen wurde der Anteil CD4+CD25+ Treg-Zellen an den Lymphozyten von Patienten mit chronischer HCV-Infektion ermittelt. Als Kontrollgruppen dienten erneut Personen, die das Hepatitis C Virus eliminiert haben und gesunde Kontrollpersonen. Wie in Abbildung 4.10 dargestellt zeigte sich, dass Treg-Zellen bei Patienten mit chronischer Infektion in 4 Ergebnisse 38 signifikant höherer Prozentzahl im peripheren Blut zirkulieren als bei den beiden Kontrollgruppen. p=0.0004 % CD4+CD25+ Lymphozyten 6 5 4 3.7 3 2.6 2.3 2 1 p=0.009 0 chron. HCV n=10 HCV eliminiert n=9 chron. HCV Gesunde Spender n=10 HCV eliminiert 2,8% 2,5% CD4 4,1% gesund 100 10 1 102 CD25 PE 103 104 100 10 1 102 CD25 PE 103 104 100 10 1 102 CD25 PE 103 104 CD25 Abbildung 4.10 Erhöhte Frequenz von Treg-Zellen im Blut von Patienten mit chronischer HCVInfektion verglichen mit Personen, die das Virus eliminiert haben und gesunden Kontrollpersonen Treg-Zellen im Blut von Patienten mit chronischer HCV-Infektion, Personen mit ausgeheilter HCV-Infektion und gesunden Probanden (oben); Repräsentative density plots aus jeder Population (unten) 5 Diskussion 5 39 Diskussion Die chronische HCV-Infektion geht typischerweise mit Dysfunktionen der HCVspezifischen T-Zellen, wie einer gestörten Proliferationsfähigkeit, verminderter Zytokinsekretion und reduzierter zytotoxischer Funktion, einher [Gruener et al., 2001; Ulsenheimer et al., 2003; Wedemeyer et al., 2002]. Die Mechanismen, die den Dysfunktionen der HCV-spezifischen T-Zellen bei der chronischen Infektion zu Grunde liegen, sind bislang noch ungeklärt. In dieser Arbeit wurde die Wirkung von CD4+CD25+ Treg-Zellen auf die Funktion von CD8+ T-Zell-Antworten bei der chronischen HCV-Infektion untersucht. Mithilfe von vorbeschriebenen, immundominanten, HLA-A2-restringierten Peptiden wurde der Einfluss von Treg-Zellen auf die HCV-spezifischen CD8+ T-Zellen untersucht. Insgesamt konnten wir zeigen, dass Treg-Zellen die Proliferation sowie die Zytokinproduktion (am Beispiel von Interferon-γ) von virusspezifischen CD8+ T-Zellen inhibieren. Außerdem konnten wir zeigen, dass die Inhibition durch Treg-Zellen dosisabhängig ist und nicht durch inhibitorische Zytokine, wie TGF-β und Interleukin-10, vermittelt wird (Abbildung 4.6). Treg-Zellen benötigen für ihre inhibitorische Wirkung direkten Zell-Zell-Kontakt zu den CD8+ Effektorzellen (Abbildung 4.5). Die biologische Relevanz von Treg-Zellen bei der chronischen HCV-Infektion wird durch zwei zusätzliche Beobachtungen unterstützt. Zum einen liegen CD4+CD25+ TregZellen bei Patienten mit chronischer HCV-Infektion in signifikant höherer Frequenz vor als bei Personen nach HCV-Infektion oder gesunden Kontrollpersonen (Abbildung 4.10). Zum anderen ist die Treg-Zell-vermittelte Suppression von CD8+ T-Zellen in der chronischen Phase der Infektion stärker ausgeprägt als bei Personen mit ausgeheilter HCV-Infektion oder gesunden Probanden. So konnten gesunde Kontrollpersonen und Personen, die das Hepatitis C Virus eliminiert haben, in Anwesenheit von Treg-Zellen stärkere virusspezifische CD8+ T-Zell-Antworten generieren als Patienten mit chronischer Infektion ( Abbildung 4.9). Diese Beobachtung ist überraschend, da das Verhältnis von Effektorzellen zu Treg-Zellen in den Experimenten bei allen Gruppen gleich war. 5 Diskussion 40 Deshalb kann diese Beobachtung nicht dadurch erklärt werden, dass sich die Frequenz der zirkulierenden Treg-Zellen in den einzelnen Gruppen unterscheidet. Dieses Ergebnis lässt vermuten, dass sich die Treg-Zellen von Patienten mit chronischer HCV-Infektion von denen der Personen mit ausgeheilter HCV-Infektion unterscheiden. Diese Vermutung kann jedoch nicht mit abschließender Sicherheit verifiziert werden, da momentan noch kein Marker bekannt ist, der hochspezifisch für Treg-Zellen ist. Das CD25-Molekül kann, als Teil des Interleukin-2 Rezeptors, auch von aktivierten CD4+ Zellen ohne regulatorisches Potenzial exprimiert werden. Auf der Suche nach einem spezifischen oder zumindest besseren Marker für Treg-Zellen sind bereits einige Vorschläge gemacht worden [Bruder et al., 2004; Lechner et al., 2001; Takahashi et al., 2000], das CD25-Molekül ist jedoch nach wie vor der Marker mit der höchsten Spezifität. In Mausmodellen konnte das forkhead box protein 3 (Foxp3) als typischer Marker für Treg-Zellen etabliert werden, seine Rolle im humanen System ist jedoch umstritten [Fontenot et al., 2003; Morgan et al., 2005]. Folglich kann im humanen System derzeit noch nicht ermittelt werden, welcher Prozentsatz an CD4+CD25+ TregZellen tatsächlich über ein regulatorisches Potenzial verfügt. Gleichwohl deuten unsere Ergebnisse darauf hin, dass der Prozentsatz an solchen „echten regulatorischen TZellen“ innerhalb der CD4+CD25+ Population bei Patienten mit chronischer HCVInfektion höher ist als bei Personen mit ausgeheilter HCV-Infektion und gesunden Probanden. Insgesamt stützen diese Beobachtungen die These, dass chronische Viruserkrankungen zu einer Expansion von Treg-Zellen führen, die die antivirale Immunantwort inhibieren [Aandahl et al., 2004; Iwashiro et al., 2001; MacDonald et al., 2002; Sugimoto et al., 2003]. Dieser Vorgang könnte einen physiologischen Schutzmechanismus darstellen, der den Körper vor einer überschießenden Immunantwort schützt. Andererseits könnte die Induktion von Treg-Zellen einen viralen Escape-Mechanismus darstellen, mit dem sich das Virus vor einer starken T-Zell-Antwort schützt. Es wird daher interessant sein, festzustellen, zu welchem Zeitpunkt der Infektion es zu einer Expansion von Treg-Zellen kommt. Überraschenderweise scheint die Treg-Zell-vermittelte Suppression bei chronisch HCVinfizierten Patienten jedoch nicht ausschließlich HCV-spezifisch zu sein. So konnten 5 Diskussion 41 wir mithilfe eines Influenza-Antigens zeigen, dass die Stärke der Inhibition von CD8+ T-Zellen durch Treg-Zellen bei HCV-spezifischen und bei Influenza-spezifischen CD8+ T-Zellen ein ähnliches Ausmaß hat. Es ist bisher noch nicht klar, ob die chronische HCV-Infektion zu einer Aktivierung und Expansion Antigen-unspezifischer Treg-Zellen, oder zu einer Induktion antigenspezifischer Treg-Zellen führt, die nach ihrer Aktivierung, z.B. durch HCV-Antigen, auch Immunantworten gegen andere Liganden, durch einen sogenannten Bystander-Effekt, supprimieren [Taams et al., 2002; Tanchot et al., 2004; Wang et al., 2004]. Diese Überlegung wird durch Beobachtungen aus unterschiedlichen in vitro Modellen unterstützt, die zeigen, dass Treg-Zellen über ihren T-Zell-Rezeptor spezifisch aktiviert werden müssen, bevor sie ihre inhibitorische Aktivität anschließend antigenunspezifisch vermitteln [Homann et al., 1999; Thornton et al., 2000]. Weiterhin konnten Suvas et al. zeigen, dass die akute Herpes simplex Virus Typ 1 Infektion mit einer gesteigerten Treg-Zell-Aktivität einhergeht, die CD8+ TZell-Antworten sowohl virusspezifisch als auch unspezifisch inhibieren [Suvas et al., 2003]. Die in vitro Beobachtung einer identisch starken Inhibition von HCV- und Influenzaspezifischen CD8+ T-Zellen ist jedoch nicht unbedingt mit der Situation in vivo gleichzusetzen. So wird z.B. bei der chronischen HCV-Infektion kein genereller Immundefekt beobachtet und betroffene Patienten leiden nicht vermehrt an Infektionskrankheiten wie Influenza. Es ist durchaus denkbar, dass sich Treg-Zellen in vivo hauptsächlich an solchen Orten mit hoher Antigenlast - wie der virusinfizierten Leber - anreichern, um vor allem dort ihre suppressive Wirkung zu entfalten. Auf diese Weise könnte sichergestellt werden, dass die Wirkung von Treg-Zellen auf die biologisch relevanten Kompartimente beschränkt bleibt. Interessanterweise konnte bisher tatsächlich in anderen Infektions- und Tumormodellen gezeigt werden, dass TregZellen an Orten mit hoher Antigenlast akkumulieren [Belkaid et al., 2002; Groux et al., 1997]. Auch Rushbrook et al. konnten zeigen, dass die Frequenz von Treg-Zellen in der Leber von chronisch HCV-infizierten Patienten höher ist als im peripheren Blut [Rushbrook et al., 2005]. Deshalb könnte das Verhältnis von CD8+ Effektorzellen zu Treg-Zellen, das für eine starke Inhibition benötigt wird (3:1 und 10:1, Abbildung 4.4), tatsächlich die intrahepatische Situation in vivo widerspiegeln. Um dieser wichtigen Frage nachzugehen, bedarf es jedoch zusätzlicher Studien, in denen die Funktion und 5 Diskussion 42 der Phänotyp intrahepatischer Treg-Zellen bei Patienten mit chronischer HCV-Infektion eingehend untersucht werden müssen. Treg-Zellen exprimieren konstitutiv die α-Kette des Interleukin-2-Rezeptors CD25. Somit haben sie eine höhere Affinität zu IL-2 als die Zellen, die nur die ß-Kette (CD122) und die γ-Kette (CD132) des IL-2-Rezepors exprimieren [Malek et al., 2004]. Einige Arbeiten haben beschrieben, dass Interleukin-2 eine entscheidende Rolle bei der Entstehung und Aktivierung von Treg-Zellen aufweist [Bayer et al., 2005; de la Rosa et al., 2004]. Inwiefern die Anwesenheit von Interleukin-2 jedoch die in vitro Funktion von Treg-Zellen beeinflusst, ist sehr umstritten. So haben einige Arbeiten einen kompletten Abbruch der Treg-Zell-vermittelten Suppression nach der Zugabe von exogenem IL-2 [Camara et al., 2003] oder schon nach der Zugabe von anti-CD28, welches die endogene IL-2 Produktion bestimmter T-Zellen stimuliert [Thornton et al., 2004], beschrieben. Diese Ergebnisse konnten jedoch in anderen Studien nicht reproduziert werden [Piccirillo et al., 2001]. In unseren Kulturen erfolgte die Stimulation nur mit anti-CD28, nicht aber mit exogenem IL-2, so dass von einer geringen Konzentration an verfügbarem IL-2 auszugehen ist. Wir haben daher untersucht, ob der Mechanismus der Suppression durch Treg-Zellen durch ihre hohe Affinität für IL-2 erklärt werden kann, über die sie den CD8+ T-Zellen einen entscheidenden Wachstumsfaktor nehmen würden. Unsere Ergebnisse zeigen aber, dass dies nicht der Fall ist. So konnten wir beobachten, dass die Zugabe von exogenem IL-2 zu den Kulturen nicht zu einem Abbruch der Treg-Zell-vermittelten Suppression führt. Darüber hinaus haben wir in unseren Transwell®-Assays keine Suppression der CD8+ T-Zell-Expansion beobachtet. Wenn aber die Konkurrenz um IL-2 der in vitro Mechanismus der Suppression durch Treg-Zellen wäre, hätte man auch in diesen Versuchen einen suppressiven Effekt beobachten müssen, da beide Zellpopulationen im gleichen Medium kultiviert wurden. Weiterhin haben wir die Proliferationskapazität von Treg-Zellen in vitro untersucht. Wie bereits von Jonuleit et al. beschrieben [Jonuleit et al., 2001] konnten auch wir zeigen, dass nur die Zugabe von exogenem IL-2, nicht aber von anti-CD28, zu einer Proliferation von Treg-Zellen führte (Abbildung 4.7). Außerdem konnten wir zeigen, dass bestrahlte Treg-Zellen, also Treg-Zellen, die nicht mehr proliferieren können, weiterhin in der Lage sind, die virusspezifische CD8+ TZell-Expansion zu inhibieren (Abbildung 4.8). Insgesamt zeigen unsere Ergebnisse 5 Diskussion 43 somit, dass die Anwesenheit von Interleukin-2 zu einer Proliferation von Treg-Zellen führt, ohne ihnen dabei ihre suppressive Kapazität zu nehmen. Darüber hinaus ist eine Proliferation von Treg-Zellen in unserem System nicht notwendig, um ihre suppressive Wirkung zu vermitteln. Interessanterweise beobachteten wir, dass die Depletion von CD4+ Zellen bei chronisch HCV-infizierten Patienten zu einer gesteigerten Expansion HCV-spezifischer CD8+ TZellen führt (Abbildung 4.1). Diese Ergebnisse sind überraschend, da den CD4+ Zellen allgemein eine entscheidende Rolle bei der Entstehung und Aufrechterhaltung einer potenten CD8+ T-Zell-Antwort zugesprochen wird [Kalams et al., 1998]. In mehreren Arbeiten konnte bereits gezeigt werden, dass periphere aber auch intrahepatische CD4+ T-Zell-Antworten mit der Elimination des Virus in HCV-infizierten Menschen oder Schimpansen assoziiert sind [Diepolder et al., 1995; Gerlach et al., 1999; Missale et al., 1996; Thimme et al., 2002]. Diese Arbeiten haben sich mit der Rolle von CD4+ TZellen bei der akuten HCV-Infektion beschäftigt. In unserer Arbeit wurden jedoch Patienten mit einer chronischen HCV-Infektion untersucht. Die hier vorgestellten Daten legen die Vermutung nahe, dass die CD4+ Zellpopulation bei der akuten und bei der chronischen HCV-Infektion deutlich unterschiedliche Funktionen wahrnehmen. Bei der akuten Infektion sind CD4+ Zellen für die Entstehung und Aufrechterhaltung einer starken und multispezifischen CD8+ T-Zell-Antwort und somit für die Elimination des Virus mitverantwortlich. Bei der chronischen HCV-Infektion hingegen scheinen CD4+ Zellen die Stärke der CD8+ T-Zell-Antworten zu reduzieren. Zusammenfassend lässt sich von diesen Ergebnissen das folgende Modell über die Rolle von CD4+ Zellen bei der HCV-Infektion ableiten: Im Rahmen der akuten HCV-Infektion überwiegt die Wirkung von CD4+CD25- T-Zellen innerhalb der CD4+ Population, in der chronischen Phase der Infektion scheint jedoch die Wirkung von CD4+CD25+ Treg-Zellen im Vordergrund zu stehen (Abbildung 5.1). 5 Diskussion 44 CD4+ CD25- Akute Infektion Aktivierung Antigenpresentation! CD8+ Inhibition Effektorfunktionen Chronische Infektion CD4+ CD25+ Abbildung 5.1 Modell der Rolle von CD4+ Zellen bei der HCV-Infektion. Bei der chronischen HCV-Infektion überwiegt die inhibitorische Wirkung der CD4+CD25+ Treg-Zellen innerhalb der CD4+ Population auf die CD8+ Effektorzellen. Bei der akuten HCVInfektion überwiegt die unterstützende Wirkung der CD4+CD25- Zellen. Kürzlich ist eine Arbeit erschienen, die sich ebenfalls mit der Rolle von Treg-Zellen bei der chronischen HCV-Infektion beschäftigt und interessanterweise sehr ähnliche Beobachtungen beschreibt [Cabrera et al., 2004]. So konnte gezeigt werden, dass die Frequenz von Treg-Zellen im Blut von Patienten mit chronischer HCV-Infektion höher ist als bei Personen mit spontan ausgeheilter HCV-Infektion und gesunden Probanden. Auch die Beobachtung, dass Treg-Zellen die Expansion HCV-spezifischer T-Zellen dosisabhängig und Zell-Zell-Kontakt-abhängig inhibieren, wird in dieser Arbeit beschrieben. Lediglich bei der Frage nach der Rolle von TGF-β bei der Treg-Zellvermittelten Suppression unterscheiden sich die Ergebnisse dieser Studie von den hier vorgestellten Daten. So führt in der Studie von Cabrera et al. die Zugabe von neutralisierenden Antikörpern gegen TGF-β zu einem Abbruch der Suppression durch Treg-Zellen. Dies steht jedoch auch im Widerspruch zu einer anderen Arbeit, die sich ebenfalls mit dem Einfluss von Treg-Zellen auf die T-Zell-Antwort bei der chronischen HCV-Infektion beschäftigt und gemeinsam mit unserer Studie eingereicht und publiziert wurde. So konnten Rushbrook et al., analog zu unseren Resultaten, keine Veränderung der suppressiven Aktivität von Treg-Zellen nach Zugabe von neutralisierenden 5 Diskussion 45 Antikörpern gegen TGF-β beobachten [Rushbrook et al., 2005]. Insgesamt unterstützen aber alle diese Arbeiten die These einer wichtigen biologischen Bedeutung von TregZellen bei der chronischen HCV-Infektion. 6 Zusammenfassung 6 46 Zusammenfassung Die chronische HCV-Infektion ist mit einer schwachen, insuffizienten und dysfunktionellen HCV-spezifischen T-Zell-Antwort assoziiert. Die Mechanismen, die diesen T-Zell-Dysfunktionen zu Grunde liegen und somit wahrscheinlich zur Persistenz des Virus beitragen sind bisher kaum bekannt. In der vorliegenden Doktorarbeit wurde die Rolle von CD4+CD25+ Treg-Zellen bei der chronischen Hepatitis C Virusinfektion untersucht. Durch Depletions-Versuche und Kokultur-Experimente konnte gezeigt werden, dass die peptidspezifische Expansion und Interferon-γ Produktion von HCVspezifischen CD8+ T-Zellen durch Treg-Zellen inhibiert wurden. Dieser inhibitorische Effekt durch CD4+CD25+ T-Zellen war dosisabhängig, abhängig von direktem ZellZell-Kontakt und unabhängig von den Zytokinen IL-10 und TGF-β. Darüber hinaus wurde beobachtet, dass CD4+CD25+ T-Zellen bei Patienten mit chronischer HCVInfektion in signifikant höherer Frequenz vorliegen als bei Personen mit ausgeheilter HCV-Infektion und gesunden Kontrollpersonen. Außerdem war die Inhibition der HCV-spezifischen CD8+ T-Zell-Expansion durch Treg-Zellen bei Patienten mit chronischer HCV-Infektion stärker ausgeprägt als bei Personen mit ausgeheilter Infektion und gesunden Probanden. Hierbei beschränkt sich die inhibitorische Wirkung von Treg-Zellen nicht nur auf das persistierende Antigen. So wurde die Influenzaspezifische CD8+ T-Zell-Expansion sowohl bei Patienten mit chronischer HCVInfektion als auch bei Personen mit ausgeheilter HCV-Infektion genauso stark inhibiert wie die HCV-spezifische CD8+ T-Zell-Expansion. Insgesamt lassen diese Ergebnisse vermuten, dass die chronische HCV-Infektion zu einer Expansion von Treg-Zellen führt, was möglicherweise zu einer reduzierten HCV-spezifischen T-Zell-Antwort und somit zur Persistenz des Virus beiträgt. 7 Literatur 7 47 Literatur Aandahl EM, Michaelsson J, Moretto WJ, Hecht FM and Nixon DF (2004) Human CD4+ CD25+ regulatory T cells control T-cell responses to human immunodeficiency virus and cytomegalovirus antigens. J Virol 78: 2454-2459 Andersson J, Boasso A, Nilsson J, Zhang R, Shire NJ, Lindback S, Shearer GM and Chougnet CA (2005) Cutting edge: The prevalence of regulatory T cells in lymphoid tissue is correlated with viral load in HIV-infected patients. J Immunol 174: 3143-3147 Asano M, Toda M, Sakaguchi N and Sakaguchi S (1996) Autoimmune disease as a consequence of developmental abnormality of a T cell subpopulation. J Exp Med 184: 387-396 Bayer AL, Yu A, Adeegbe D and Malek TR (2005) Essential role for interleukin-2 for CD4(+)CD25(+) T regulatory cell development during the neonatal period. J Exp Med 201: 769-777 Belkaid Y, Mendez S, Lira R, Kadambi N, Milon G and Sacks D (2000) A natural model of Leishmania major infection reveals a prolonged "silent" phase of parasite amplification in the skin before the onset of lesion formation and immunity. J Immunol 165: 969-977 Belkaid Y, Piccirillo CA, Mendez S, Shevach EM and Sacks DL (2002) CD4+CD25+ regulatory T cells control Leishmania major persistence and immunity. Nature 420: 502-507 Belkaid Y and Rouse BT (2005) Natural regulatory T cells in infectious disease. Nat Immunol 6: 353-360 Bruder D, Probst-Kepper M, Westendorf AM, Geffers R, Beissert S, Loser K, von Boehmer H, Buer J and Hansen W (2004) Neuropilin-1: a surface marker of regulatory T cells. Eur J Immunol 34: 623-630 Cabrera R, Tu Z, Xu Y, Firpi RJ, Rosen HR, Liu C and Nelson DR (2004) An immunomodulatory role for CD4(+)CD25(+) regulatory T lymphocytes in hepatitis C virus infection. Hepatology 40: 1062-1071 Camara NO, Sebille F and Lechler RI (2003) Human CD4+CD25+ regulatory cells have marked and sustained effects on CD8+ T cell activation. Eur J Immunol 33: 34733483 de la Rosa M, Rutz S, Dorninger H and Scheffold A (2004) Interleukin-2 is essential for CD4+CD25+ regulatory T cell function. Eur J Immunol 34: 2480-2488 Diepolder HM, Zachoval R, Hoffmann RM, Wierenga EA, Santantonio T, Jung MC, Eichenlaub D and Pape GR (1995) Possible mechanism involving T-lymphocyte response to non-structural protein 3 in viral clearance in acute hepatitis C virus infection. Lancet 346: 1006-1007 Fontenot JD, Gavin MA and Rudensky AY (2003) Foxp3 programs the development and function of CD4+CD25+ regulatory T cells. Nat Immunol 4: 330-336 7 Literatur 48 Gerlach JT, Diepolder HM, Jung MC, Gruener NH, Schraut WW, Zachoval R, Hoffmann R, Schirren CA, Santantonio T and Pape GR (1999) Recurrence of hepatitis C virus after loss of virus-specific CD4(+) T-cell response in acute hepatitis C. Gastroenterology 117: 933-941 Gershon RK and Kondo K (1970) Cell interactions in the induction of tolerance: the role of thymic lymphocytes. Immunology 18: 723-737 Grakoui A, Shoukry NH, Woollard DJ, Han JH, Hanson HL, Ghrayeb J, Murthy KK, Rice CM and Walker CM (2003) HCV persistence and immune evasion in the absence of memory T cell help. Science 302: 659-662 Groux H, O'Garra A, Bigler M, Rouleau M, Antonenko S, de Vries JE and Roncarolo MG (1997) A CD4+ T-cell subset inhibits antigen-specific T-cell responses and prevents colitis. Nature 389: 737-742 Gruener NH, Lechner F, Jung MC, Diepolder H, Gerlach T, Lauer G, Walker B, Sullivan J, Phillips R, Pape GR and Klenerman P (2001) Sustained dysfunction of antiviral CD8+ T lymphocytes after infection with hepatitis C virus. J Virol 75: 55505558 Hisaeda H, Maekawa Y, Iwakawa D, Okada H, Himeno K, Kishihara K, Tsukumo S and Yasutomo K (2004) Escape of malaria parasites from host immunity requires CD4+ CD25+ regulatory T cells. Nat Med 10: 29-30 Homann D, Holz A, Bot A, Coon B, Wolfe T, Petersen J, Dyrberg TP, Grusby MJ and von Herrath MG (1999) Autoreactive CD4+ T cells protect from autoimmune diabetes via bystander suppression using the IL-4/Stat6 pathway. Immunity 11: 463-472 Iwashiro M, Messer RJ, Peterson KE, Stromnes IM, Sugie T and Hasenkrug KJ (2001) Immunosuppression by CD4+ regulatory T cells induced by chronic retroviral infection. Proc Natl Acad Sci U S A 98: 9226-9230 Jonuleit H, Schmitt E, Stassen M, Tuettenberg A, Knop J and Enk AH (2001) Identification and functional characterization of human CD4(+)CD25(+) T cells with regulatory properties isolated from peripheral blood. J Exp Med 193: 1285-1294 Kalams SA and Walker BD (1998) The critical need for CD4 help in maintaining effective cytotoxic T lymphocyte responses. J Exp Med 188: 2199-2204 Kinter AL, Hennessey M, Bell A, Kern S, Lin Y, Daucher M, Planta M, McGlaughlin M, Jackson R, Ziegler SF and Fauci AS (2004) CD25(+)CD4(+) regulatory T cells from the peripheral blood of asymptomatic HIV-infected individuals regulate CD4(+) and CD8(+) HIV-specific T cell immune responses in vitro and are associated with favorable clinical markers of disease status. J Exp Med 200: 331-343 Kojima A and Prehn RT (1981) Genetic susceptibility to post-thymectomy autoimmune diseases in mice. Immunogenetics 14: 15-27 Lechner F, Wong DK, Dunbar PR, Chapman R, Chung RT, Dohrenwend P, Robbins G, Phillips R, Klenerman P and Walker BD (2000) Analysis of successful immune responses in persons infected with hepatitis C virus. J Exp Med 191: 1499-1512 Lechner O, Lauber J, Franzke A, Sarukhan A, von Boehmer H and Buer J (2001) Fingerprints of anergic T cells. Curr Biol 11: 587-595 7 Literatur 49 Lundgren A, Suri-Payer E, Enarsson K, Svennerholm AM and Lundin BS (2003) Helicobacter pylori-specific CD4+ CD25high regulatory T cells suppress memory Tcell responses to H. pylori in infected individuals. Infect Immun 71: 1755-1762 MacDonald AJ, Duffy M, Brady MT, McKiernan S, Hall W, Hegarty J, Curry M and Mills KH (2002) CD4 T helper type 1 and regulatory T cells induced against the same epitopes on the core protein in hepatitis C virus-infected persons. J Infect Dis 185: 720727 Malek TR and Bayer AL (2004) Tolerance, not immunity, crucially depends on IL-2. Nat Rev Immunol 4: 665-674 Missale G, Bertoni R, Lamonaca V, Valli A, Massari M, Mori C, Rumi MG, Houghton M, Fiaccadori F and Ferrari C (1996) Different clinical behaviors of acute hepatitis C virus infection are associated with different vigor of the anti-viral cell-mediated immune response. J Clin Invest 98: 706-714 Mittrucker HW and Kaufmann SH (2004) Mini-review: regulatory T cells and infection: suppression revisited. Eur J Immunol 34: 306-312 Moradpour D and Blum HE (2004) [Hepatitis C]. Ther Umsch 61: 493-498 Morgan ME, van Bilsen JH, Bakker AM, Heemskerk B, Schilham MW, Hartgers FC, Elferink BG, van der Zanden L, de Vries RR, Huizinga TW, Ottenhoff TH and Toes RE (2005) Expression of FOXP3 mRNA is not confined to CD4+CD25+ T regulatory cells in humans. Hum Immunol 66: 13-20 O'Garra A and Vieira P (2004) Regulatory T cells and mechanisms of immune system control. Nat Med 10: 801-805 Onizuka S, Tawara I, Shimizu J, Sakaguchi S, Fujita T and Nakayama E (1999) Tumor rejection by in vivo administration of anti-CD25 (interleukin-2 receptor alpha) monoclonal antibody. Cancer Res 59: 3128-3133 Ormandy LA, Hillemann T, Wedemeyer H, Manns MP, Greten TF and Korangy F (2005) Increased populations of regulatory T cells in peripheral blood of patients with hepatocellular carcinoma. Cancer Res 65: 2457-2464 Piccirillo CA and Shevach EM (2001) Cutting edge: control of CD8+ T cell activation by CD4+CD25+ immunoregulatory cells. J Immunol 167: 1137-1140 Raghavan S, Fredriksson M, Svennerholm AM, Holmgren J and Suri-Payer E (2003) Absence of CD4+CD25+ regulatory T cells is associated with a loss of regulation leading to increased pathology in Helicobacter pylori-infected mice. Clin Exp Immunol 132: 393-400 Rushbrook SM, Ward SM, Unitt E, Vowler SL, Lucas M, Klenerman P and Alexander GJM (2005) Regulatory T Cells Suppress In Vitro Proliferation of Virus-Specific CD8+ T Cells during Persistent Hepatitis C Virus Infection. J. Virol. 79: 7852-7859 Sakaguchi S (2005) Naturally arising Foxp3-expressing CD25+CD4+ regulatory T cells in immunological tolerance to self and non-self. Nat Immunol 6: 345-352 Sakaguchi S, Sakaguchi N, Asano M, Itoh M and Toda M (1995) Immunologic selftolerance maintained by activated T cells expressing IL-2 receptor alpha-chains (CD25). 7 Literatur 50 Breakdown of a single mechanism of self-tolerance causes various autoimmune diseases. J Immunol 155: 1151-1164 Shevach EM (2002) CD4+ CD25+ suppressor T cells: more questions than answers. Nat Rev Immunol 2: 389-400 Shimizu J, Yamazaki S and Sakaguchi S (1999) Induction of tumor immunity by removing CD25+CD4+ T cells: a common basis between tumor immunity and autoimmunity. J Immunol 163: 5211-5218 Shoukry NH, Grakoui A, Houghton M, Chien DY, Ghrayeb J, Reimann KA and Walker CM (2003) Memory CD8+ T cells are required for protection from persistent hepatitis C virus infection. J Exp Med 197: 1645-1655 Sugimoto K, Ikeda F, Stadanlick J, Nunes FA, Alter HJ and Chang KM (2003) Suppression of HCV-specific T cells without differential hierarchy demonstrated ex vivo in persistent HCV infection. Hepatology 38: 1437-1448 Suvas S, Kumaraguru U, Pack CD, Lee S and Rouse BT (2003) CD4+CD25+ T cells regulate virus-specific primary and memory CD8+ T cell responses. J Exp Med 198: 889-901 Taams LS, Vukmanovic-Stejic M, Smith J, Dunne PJ, Fletcher JM, Plunkett FJ, Ebeling SB, Lombardi G, Rustin MH, Bijlsma JW, Lafeber FP, Salmon M and Akbar AN (2002) Antigen-specific T cell suppression by human CD4+CD25+ regulatory T cells. Eur J Immunol 32: 1621-1630 Takahashi T, Tagami T, Yamazaki S, Uede T, Shimizu J, Sakaguchi N, Mak TW and Sakaguchi S (2000) Immunologic self-tolerance maintained by CD25(+)CD4(+) regulatory T cells constitutively expressing cytotoxic T lymphocyte-associated antigen 4. J Exp Med 192: 303-310 Tanchot C, Vasseur F, Pontoux C, Garcia C and Sarukhan A (2004) Immune regulation by self-reactive T cells is antigen specific. J Immunol 172: 4285-4291 Thimme R, Bukh J, Spangenberg HC, Wieland S, Pemberton J, Steiger C, Govindarajan S, Purcell RH and Chisari FV (2002) Viral and immunological determinants of hepatitis C virus clearance, persistence, and disease. Proc Natl Acad Sci U S A 99: 15661-15668 Thimme R, Oldach D, Chang KM, Steiger C, Ray SC and Chisari FV (2001) Determinants of viral clearance and persistence during acute hepatitis C virus infection. J Exp Med 194: 1395-1406 Thornton AM, Donovan EE, Piccirillo CA and Shevach EM (2004) Cutting edge: IL-2 is critically required for the in vitro activation of CD4+CD25+ T cell suppressor function. J Immunol 172: 6519-6523 Thornton AM and Shevach EM (2000) Suppressor effector function of CD4+CD25+ immunoregulatory T cells is antigen nonspecific. J Immunol 164: 183-190 Ulsenheimer A, Gerlach JT, Gruener NH, Jung MC, Schirren CA, Schraut W, Zachoval R, Pape GR and Diepolder HM (2003) Detection of functionally altered hepatitis C virus-specific CD4 T cells in acute and chronic hepatitis C. Hepatology 37: 1189-1198 7 Literatur 51 Unitt E, Rushbrook SM, Marshall A, Davies S, Gibbs P, Morris LS, Coleman N and Alexander GJ (2005) Compromised lymphocytes infiltrate hepatocellular carcinoma: the role of T-regulatory cells. Hepatology 41: 722-730 Viglietta V, Baecher-Allan C, Weiner HL and Hafler DA (2004) Loss of functional suppression by CD4+CD25+ regulatory T cells in patients with multiple sclerosis. J Exp Med 199: 971-979 Waldmann H, Graca L, Cobbold S, Adams E, Tone M and Tone Y (2004) Regulatory T cells and organ transplantation. Semin Immunol 16: 119-126 Wang HY, Lee DA, Peng G, Guo Z, Li Y, Kiniwa Y, Shevach EM and Wang RF (2004) Tumor-specific human CD4+ regulatory T cells and their ligands: implications for immunotherapy. Immunity 20: 107-118 Wedemeyer H, He XS, Nascimbeni M, Davis AR, Greenberg HB, Hoofnagle JH, Liang TJ, Alter H and Rehermann B (2002) Impaired effector function of hepatitis C virusspecific CD8+ T cells in chronic hepatitis C virus infection. J Immunol 169: 3447-3458 Weiss L, Donkova-Petrini V, Caccavelli L, Balbo M, Carbonneil C and Levy Y (2004) Human immunodeficiency virus-driven expansion of CD4+CD25+ regulatory T cells, which suppress HIV-specific CD4 T-cell responses in HIV-infected patients. Blood 104: 3249-3256 Wood KJ and Sakaguchi S (2003) Regulatory T cells in transplantation tolerance. Nat Rev Immunol 3: 199-210 8 Originalarbeiten 8 52 Originalarbeiten Im Rahmen dieser Doktorarbeit ist folgende Publikation entstanden: Tobias Boettler, Hans Christian Spangenberg, Christoph Neumann-Haefelin, Elisabeth Panther, Simonetta Urbani, Carlo Ferrari, Hubert E. Blum, Fritz von Weizsäcker, and Robert Thimme T cells with a CD4+CD25+ regulatory phenotype suppress in vitro proliferation of virus-specific CD8+ T cells during chronic hepatitis C virus infection Journal of Virology, 2005 Jun; 79(12):7860-7 Teile dieser Arbeit wurden auf folgenden Kongressen präsentiert: 59. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für VerdauungsStoffwechselkrankheiten (DGVS), 1.-4. September 2004, Leipzig und 55th Annual meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), October 29th – November 2nd 2004, Boston, USA 21. Jahrestagung der German Association for the study of the liver (GASL), 28.-29. Januar 2005, Ulm XVI. Kongress der Südwestdeutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, 2.-4. Juni 2005, Heidelberg 9 Danksagung 9 53 Danksagung Mein herzlicher Dank gilt Herrn Prof. Dr. Drs. h.c. Hubert E. Blum für die Möglichkeit, in seiner Abteilung zu promovieren und für die wertvolle Unterstützung bei der Ausarbeitung der Publikation und der Kongressbeiträge. Herrn Prof. Dr. Hans-Hartmut Peter danke ich für die freundliche Übernahme des Zweitgutachtens. Mein ganz besonderer Dank gilt Herrn Prof. Dr. Robert Thimme für die Überlassung dieses spannenden Themas und für die herausragende Betreuung zu jedem Zeitpunkt dieser Arbeit. Durch sein außerordentliches persönliches Engagement hat er meine Begeisterung für die Immunologie zunächst geweckt und später gefördert. Ferner danke ich ihm für die Möglichkeit, Teile dieser Arbeit bei nationalen und internationalen Kongressen präsentieren zu können. Ich danke außerdem Dr. Hans Christian Spangenberg, der die initiale Idee zu dieser Arbeit hatte und mir bei der Umsetzung immer mit Rat zur Seite stand. Dr. Christoph Neumann-Haefelin und Dr. Elisabeth Panther danke ich für zahlreiche Diskussionen und Anregungen und ihre andauernde Hilfsbereitschaft. Nadine Kersting und Natalja Nazarova möchte ich für ihre Geduld, ihren immensen Einsatz und die gute Zusammenarbeit danken. Thomas Killinger und Bertram Bengsch danke ich für ihren Beitrag zu einer hervorragenden Arbeitsatmosphäre. Meinen wichtigsten „gesunden Probanden“ Steffen Heeg und Alexander von Werder danke ich für viele Aderlässe, ohne die ein Teil der Experimente nicht durchführbar gewesen wäre. Max, Flo, Philipp, dem Mat und Boschi danke ich für Tipps, Anregungen und geduldiges Zuhören, wenn ich mal wieder von meiner Arbeit erzählt habe. Meinen Eltern und Geschwistern danke ich für ihre fortwährende Unterstützung und obwohl fachfremd – für ihr reges Interesse an dieser Arbeit. Petra danke ich für ihr Interesse an meiner Arbeit und ihre andauernde Unterstützung. 10 Lebenslauf 10 54 Lebenslauf Persönliche Daten: Name: Geburtstag: Geburtsort: Familienstand: Konfession: Eltern: Geschwister: Tobias Elmar Böttler 27. November 1979 Berlin-Zehlendorf verheiratet mit Dr. med. Petra Böttler evangelisch Winfried Böttler, Theologe Angelika Böttler, Lehrerin Jonas Böttler, Politologe Simon Böttler, Tonmeisterstudent Schulbildung: 1985 – 1989 1989 – 1992 1992 – 1999 Juli 1999 Christian-Morgenstern-Grundschule, Berlin Spandau Helmut-von-Moltke-Grundschule, Berlin Charlottenburg Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium, Berlin Spandau Abitur Zivildienst: 1999 – 2000 Universitätskinderklinik Freiburg i. Br. Studium: Seit 2000 September 2002 August 2003 Studium der Humanmedizin an der Albert-LudwigsUniversität Freiburg i. Br. Physikum Erster Abschnitt der Ärztlichen Prüfung Famulaturen: März/April 2003 September/Oktober 2004 März 2005 Innere Medizin, Helios-Klinik, Breisach Pädiatrie, CUB Campus Benjamin-Franklin, Berlin Dermatologie, Universitätsklinik Freiburg Sonstiges: 2003 – 2004 Seit 2005 Wissenschaftliche Hilfskraft Abteilung Klinische Chemie Wissenschaftliche Hilfskraft Medizin II AG Prof. Thimme