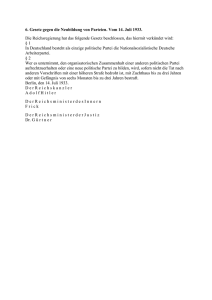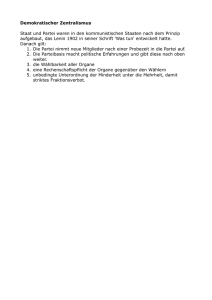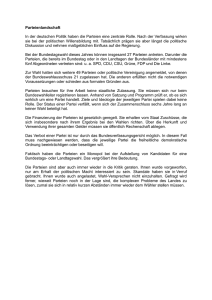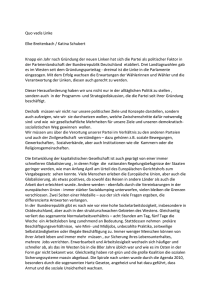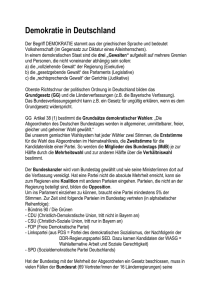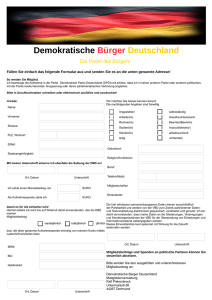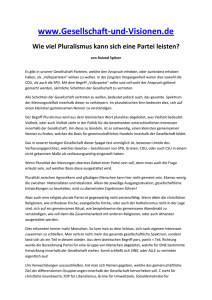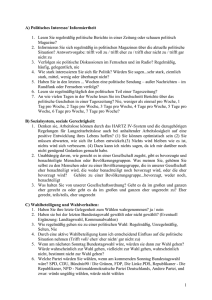Marxistisches Forum
Werbung

Marxistisches Forum Heft 48 Möglichkeiten politischer Gegenmacht heute Von der Beratung des Marxistischen Forums am 30. April 2004 Mit Beiträgen von Edeltraut Felfe, Harald Neubert, Angela Klein,Birger Scholz, Uwe-Jens Heuer,Peter Kroh, Heinz Niemann und Horst Trapp Marxistisches Forum Heinz Behling†, Michael Benjamin†, Joachim Bischoff, Gerhard Branstner, Wolfgang Brauer, Erich Buchholz, Stefan Doernberg, Ernst Engelberg, Edeltraut Felfe, Susi Fleischer, Gert Friedrich, Kuno Füssel, Günter Görlich, Erich Hahn, Heidrun Hegewald, Manfred Hegner, Horst Heininger, Uwe-Jens Heuer, Klaus Höpcke, Helga Hörz, Detlef Joseph, Herbert Hörz, Ernstgert Kalbe, Heinz Kallabis, Horst Kellner, Hermann Klenner, Horst Kolodziej, Adolf Kossakowski, Dieter Kraft, Hans-Joachim Krusch†, Volker Külow, Daniel Lewin, Ekkehard Lieberam, Peter Ligner, Renato Lorenz, Moritz Mebel, Harald Neubert, Harry Nick, Eberhard Panitz, Kurt Pätzold, Wilhelm Penndorf, Siegfried Prokop, Wolfgang Richter, Fritz Rösel, Ekkehard Sauermann, Gregor Schirmer, Walter Schmidt, Horst Schneider, Arnold Schölzel, Günter Schumacher, Hans-Joachim Siegel, Gisela Steineckert, Gottfried Stiehler, Armin Stolper, Wolfgang Triebel, Wolfram Triller, Ingo Wagner, Günter Wendel, Laura von Wimmersperg, Dieter Wittich, Winfried Wolf Redaktion: Kurt Pätzold, Hans-Joachim Siegel Berlin, Juli 2004 Preis 2,00 Euro Möglichkeiten politischer Gegenmacht heute Beratung des Marxistischen Forums am 30. April 2004 Inhalt: 1. Prof. Dr. Edeltraut Felfe 2. Prof. Dr. Harald Neubert 3. Angela Klein 4. Birger Scholz 5. Prof. Dr. Uwe-Jens Heuer 6. Dr. Peter Kroh 7. Prof. Dr. Heinz Niemann 8. Horst Trapp *) Angela Klein Birger Scholz Horst Trapp Inhaltsverzeichnis Möglichkeiten politischer Gegenmacht heute Zur Einführung in die Diskussion Bemerkungen zur Gründung der Partei der Europäischen Linken (PEL) Die Europäische Antikapitalistische Linke Ein Ansatz zur Neuformierung einer sozialistischen Linken Perspektiven einer wahlpolitischen Alternative Gegenkräfte und marxistisches Staatsverständnis (Nachdruck aus der Jungen Welt) Interessen sozialer Akteure und Entwicklung von Gegenmacht 10 Anmerkungen zum Thema „Möglichkeiten politischer Gegenmacht heute“ Ein Begriff wird wieder modern: Gegenmacht Gegenkräfte bündeln Zum Perspektivenkongress Seite 2 Seite 3 Seite 7 Seite 9 Seite 11 Seite 13 Seite 16 Seite 18 Sozialistische Zeitung, Köln Initiative „Berliner Wahlalternative“ und Attac Berlin Initiative für einen Politikwechsel, Frankfurt/Main 1 Edeltraut Felfe Möglichkeiten politischer Gegenmacht heute Zur Einführung in die Diskussion Am 3. April demonstrierte etwa eine halbe Million Menschen gegen mannigfaltige asoziale Folgen neoliberaler Politik und Gesellschaftsentwicklung in Deutschland. Viele Menschen waren spontan und ohne organisatorische Bindung gekommen, die meisten aber sammelten sich unter Transparenten, Fahnen, Losungen, Forderungen in bereits organisierten Formen. Manche schienen in Konkurrenz zueinander zu agieren. Mir war - auch später nicht erkennbar, wie derartige Bewegung in einen gemeinsamen politikrelevanten Strom zusammengeführt werden könnte. Mehr und mehr Menschen spüren, dass eine kleine Minderheit ihren Willen gegen elementare Interessen von immer mehr Menschen in der Bundesrepublik, in Europa, weltweit durchsetzen kann. Diese Minderheit übt geistige und sozialpsychologische Führerschaft, Zwang und Gewalt, auch nichtstaatlicher Art, aus. Sie hat das Potenzial, gesellschaftlich bindende Entscheidungen für uns alle zu treffen. Sie ist mächtig und zunehmend herrschend. Nachgewiesen ist auch - und für viele wird es immer deutlicher erkennbar - dass derartige Macht wesentlich aus privatem Großeigentum an Produktionsmitteln und damit aus der Ausbeutung fremder Arbeitskraft, aus der sprunghaft gestiegenen Kapitalakkumulation, aus riesigen Bankund Spekulationsvermögen erwächst. Macht ist also wesentlich Ausdruck von Klasseninteressen. Gegenmacht wäre dann der Aufbau und die Organisation von Widerstand der Arbeiterklasse, der die bürgerliche Macht ernsthaft bedrohen und Alternativen zu ihr bieten kann. Diese Definition bietet das Historisch-Kritische Wörterbuch des Marxismus an (Hrg. Fritz Haug, Bd.4, 1999, S.1358). Es geht um unversöhnliche Interessen, die innerhalb des kapitalistischen Gesellschaftssystems durch Gegenkräfte zur herrschenden Macht nicht auszubalancieren sind, um elementare Lebensinteressen der übergroßen Bevölkerungsmehrheit zu sichern. Gegenmacht meint in der notwendigen Perspektive von heute und morgen also weder die Checks and balances der bürgerlichen Politologie noch die entsprechende reformerische Interpretation verschiedener Herkunft. Heute Gegenmacht entwickeln, heißt noch immer die sich verändernde Arbeiterklasse als einen wesentlichen Akteur, als Subjekt der Veränderung zu begreifen. Zugleich geht es darum, äußerst differenzierte Interessen von allen sozialen Klassen, Gruppen und Schichten, Frauen und Männern, jungen und älteren Menschen, die vom gegenwärtigen neoliberalen kriegerischen Kapitalismus mit Füßen getreten werden und ständig bedroht sind, zu bündeln und in politikfähige Alternativen umzusetzen. Und dies über die eigenen kleineren Lebensräume, über nationale Grenzen und Regionen hinweg. Wir sind uns sicher einig, dass wir in dem Sinne noch weit von der Entwicklung einer Gegenmacht entfernt sind. 2 Wäre als wichtiger Schritt dorthin nicht wesentlich Aufklärung als Schaffung eines politischen Bewusstseins sozialer Bewegung gegen Auswirkungen des Neoliberalismus zu fassen? Dies vor allem durch eine politische Praxis des Widerspruchs, des Widerstandes, der vielfältigsten Aktionen gegen die herrschende Macht in allen Gesellschaftsbereichen, wie wir es mit Studentenaktivitäten, der Initiative gegen den Berliner Bankenskandal, mit Widersprüchen gegen Rentenbescheide, zivilem Ungehorsam etc. erleben. Zum Aufbau von Gegenmacht gehören Anstrengungen zur Entwicklung einer Gegenöffentlichkeit, einer Gegenkultur, Anstrengungen, sich jeglicher Zusammenarbeit zur Durchsetzung neoliberaler Politik durch die bürgerliche Staatsmacht, zu entziehen. Auch massenhaftes individuelles Bemühen, gegen herrschenden Geist und Geld - bestimmte Existenz in dieser Gesellschaft anzuleben (z. B. in unserer Eigenschaft als Konsumenten) könnte politisch wirksam werden, also Einfluss auf Machtverhältnisse nehmen. Ein bisschen richtiges im falschen Leben. Dennoch bleibt ganz wesentlich: Entwicklung von Gegenmacht kann nicht in der Zivilgesellschaft verbleiben. Sie muss anhand täglicher Lebenserfahrung und widerständischer Praxis der Benachteiligten Illusionen über die bürgerliche Staatsmacht und massenhafte Irreführung mit dem Begriff der „Demokratie“ bekämpfen und sich selbst auch institutionalisieren. Erfolge im Ringen um geistige Hegemonie, Aktionen, Demonstrationen und Proteste allein veranlassen die Herrschenden in Wirtschaft und Politik offensichtlich nicht zur Mäßigung. Vielmehr beschleunigen sie neben dem Ausbau ihrer ökonomischen und sozialen Macht auch die autoritäre und repressive staatliche Absicherung ihres Kurses. Um die objektiv interessierten Kräfte gegen diese verhängnisvolle Entwicklung zu mobilisieren, braucht es das wird immer deutlicher - eine gesamtgesellschaftliche Alternative. Deshalb gehört zur Debatte um Gegenmacht auch die Auseinandersetzung um mögliche demokratische sozialistische Gesellschaften, um Wege und Strukturen für Übergänge. Hier haben wir Bisheriges zu analysieren, zu lernen, zu suchen und Schlüsse für neue Qualitäten von Gegenmacht zu ziehen. Ob es dann überhaupt noch „Macht“ mit ihren Hierarchien und Zentralismen wäre oder ob es neue noch zu entdeckende, besser: in politischer Praxis zu schaffende staatliche und nichtstaatliche Strukturen und Beziehungen selbstbestimmten Lebens der Mehrheit der Menschen wären? Suchender Streit darüber soll verbinden und uns vor allem nicht hindern, heute Mögliches zu tun. Unter den Akteuren zur Entwicklung von politischer Gegenmacht spielen linke politische Parteien trotz aller Wandlungen in der Funktionsweise des bürgerlichen Nationalstaates, eine besondere Rolle. Sie ist unter Aktiven selbst, wesentlich abhängig von ihrem Staats-verMarxistisches Forum 48/2004 ständnis, durchaus umstritten. Aber sicher können Wirkungsmöglichkeiten linker politischer Parteien im gegenwärtigen parlamentarischen System auch nicht durch die neue Qualität sozialer Bewegungen realisiert oder anderweitig ersetzt werden. Zugleich integrieren Fallstricke und Fesseln jeglicher menschlicher Organisation und der bürgerliche Parlamentarismus im besonderen eben auch jene Parteien, die Gegenmacht entwickeln und transportieren woll(t)en. Übrigens lehrt die Zeit, dass auch Nicht-regierungsorganisationen, Initiativen und Foren des Widerstandes vor Einbindung und Verlust des Veränderungspotenzials nicht gefeit sind. Das ist das Spannungsfeld, in dem Machtressourcen gegen das Kapital immer wieder absorbiert werden. In Zukunft wird es wesentlich darum gehen, wie Parteien, Bewegungen und andere außerparlamentarische Organisationsformen sich wandeln und ihre jeweils spezifischen Aufgaben in produktivem Miteinander wahrnehmen werden. Dabei wird der selbstbestimmte, gleichberechtigte, gleichverpflichtete und kontrollierende persönliche Einsatz von immer mehr Menschen entscheidend sein: in der einen wie in der anderen Form und Art des Widerstandes. Wir freuen uns, dass wir im folgenden drei Vorträge zu aktuellen Strömungen im Fluss der Gegenbewegung hören werden. Heutige Diskussionen im Marxistischen Forum sollen übers Jahr fortgeführt werden. Harald Neubert Bemerkungen zur Gründung der Partei der Europäischen Linken (PEL)1 Eine Alternative zur neoliberalen Politik und Entwicklungsrichtung in den integrierten europäischen Ländern im Sinne eines wirklichen sozialen Fortschritts ist nur denkbar, wenn erstens die zersplitterten linken, systemkritischen und antikapitalistischen Kräfte sich als fähig erweisen, sich als Gegenkraft zu etablieren, Mehrheiten zu gewinnen und zielgerichtet zu agieren; wenn zweitens diese Gegenkraft international organisiert und handlungsfähig ist und ausreicht, die herrschenden Kräfte zu substantiellen politischen Zugeständnissen zu zwingen; wenn es drittens gelingt, die Profitlogik, d. h. die Gesetze der kapitalistischen Reproduktion, in den gesellschaftlichen Bereichen des Gemeinwohls zurückzudrängen und den Staat zu zwingen, seiner sozialen Verantwortung gerecht zu werden. Selbst wenn das alles gelänge, wären die linken Kräfte noch sehr weit von einem neuen Sozialismus entfernt. Man muß kein Pessimist sein, wenn man feststellt, daß die europäischen Linkskräfte sogar weit davon entfernt sind, selbst diese unmittelbaren Erfordernisse zu realisieren. Dennoch: Als positiv zu nennen sind drei Formen und Ebenen internationaler Kooperation linker Kräfte, die die Grundlage intensiverer und erweiterter Zusammenarbeit bilden können: das Forum der Neuen Europäischen Linken (NELF); Konföderalen Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken und der Nordischen Grünen Linken (GUE/NGL) im Europa-Parlament; die in der Formierung begriffene Partei der Europäischen Linken, das Zusammenwirken in Gestalt der antikapitalistischen Linken. Zu erwähnen ist auch das Europäische Sozialforum und Attac. Die Gründung der Partei Europäischen Linken wird am 8. und 9. Mai dieses Jahres in Rom stattfinden. Zur Notwendigkeit der Europäischen Linkspartei, zum bisherigen Prozeß, den Problemen und Schwierigkeit ihrer Formierung einige Bemerkungen. Es handelt sich um ein stark gekürztes Resümee einer Studie, die ich für die PDSGruppe im Europa-Parlament angefertigt habe und über die Rosa-Luxemburg-Stiftung per Internet einzusehen ist. I. Die spezifischen Gründe und Aufgaben, die die PEL erforderlich machen Aufgrund der Widersprüchlichkeit und der neoliberalen Ausrichtung der europäischen Integration im Interesse der großen Banken und Wirtschaftsverbände ist es dringend notwendig, daß die Linkskräfte übereinstimmende konkrete Vorstellungen über eine linke, demokratische, sozialgerechte Alternative zur jetzigen Verfaßtheit und Entwicklung der EU auszuarbeiten und für deren Realisierung gemeinsam kämpfen. Es geht dabei um ein Alternativprogramm, dessen Ziele sich allein aus einer nationalstaatlichen Perspektive nicht durchsetzen lassen, da sie die Union als Ganzes betreffen und da diejenigen Kräfte, die die jetzige Ausgestaltung des Integrationsprozesses bestimmen - die großen Konzerne, Wirtschaftsverbände und die ihnen dienenden Politiker - einen international organisierten Machtfaktor darstellen. Wesentliche programmatische Ziele hierfür könnten sein: - Da die Kompetenz der Politik gegenüber der Ökonomie auf den zweiten Platz gerückt ist, was bedeutet, daß die Politik die Steuerungsfunktion gegenüber den großen Konzernen und Banken in beträchtlichem Maße verloren hat, ist aus der Sicht der Linkskräfte eine Umkehrung des Verhältnisses von Politik und Wirtschaft notwendig. 1 Der Vortrag wurde am 30. April 2004 gehalten, also vor der am 8./9. Mai 2004 stattgefundenen Gründungskonferenz der Partei der Europäischen Linken. Die Probleme und Ergebnisse der Gründungskonferenz wurde bei der Überarbeitung des Vortrags nicht berücksichtigt. Edeltraut Felfe 3 - Dies wiederum erfordert die Formierung eines demokratisch verfaßten politischen Überbaus der Europäischen Union. In ihm muß dem Europäischen Parlament ein größeres Gewicht eingeräumt werden. Gewisse Fortschritte sind in dieser Hinsicht im Verfassungsentwurf zu verzeichnen, die eine Unterstützung verdienen. Notwendig ist die uneingeschränkte Kontrollkompetenz des Europa-Parlaments gegenüber der Kommission und dem Ministerrat der EU. - Eine vorrangige Aufgabe besteht im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit, verbunden mit sozial verträglichen Regelungen des internationalisierten Arbeitskräftemarktes, um der Praxis der kapitalistischen Unternehmen entgegenzuwirken, die Unterschiede im Lohnniveau und im Arbeitskräftepotential aus Konkurrenzgründen und zur Erzielung von Maximalprofit auszunutzen. Anstrengungen im nationalstaatlichen Rahmen reichen nicht aus, um hierbei Erfolge zu erzielen. - Ein unzureichend gelöstes strukturelles Problem besteht in einer klaren, demokratischen Erfordernissen entsprechenden Regelung und Abstimmung der unterschiedlichen Kompetenzen der EU als Ganzes, der einzelnen Mitgliederstaaten, der Regionen und Kommunen, um einem dirigistischen Zentralismus und der Bürokratisierung der EU-Organe entgegenzuwirken. - Notwendig ist die Durchsetzung eines gleichberechtigten, mehr oder weniger autonomen Verhältnisses der EU gegenüber den USA. Vor allem müssen sich die EUStaaten aus der Unterordnung unter die imperialistische Sicherheits- und Militärpolitik der USA befreien, Strukturen einer eigenen friedlichen Sicherheitspolitik schaffen. Die linken Kräfte müssen in diesem Zusammenhang entschieden gegen den bereits begonnenen Prozeß der Militarisierung der EU-Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik kämpfen, wie er auch im Verfassungsentwurf festgeschrieben werden soll. Dies ist einer der wesentlichen Gründe für die Ablehnung dieses Verfassungsentwurfs. Die linken Kräfte müssen in diesem Zusammenhang entschieden Pläne und Konzepte der herrschenden Eliten der EU ablehnen, mit militärischen Interventionen außerhalb der EU ökonomische und Machtinteressen wahrnehmen und Konfliktlösungen betreiben zu wollen. - Notwendig ist die rechtsverbindliche Durchsetzung der europäischen Sozialcharta, die Regelungen für den Arbeitskräftemarkt, für den Angleich der Lebensverhältnisse der verschiedenen Mitgliedsländer und Regionen, für die Sicherung der sozialen Menschenrechte, für die reale Gleichberechtigung der Geschlechter wie auch nationaler Minderheiten usw. gewährleisten muß. - Dringend geboten sind im Rahmen der EU Regelungen auf dem Gebiete der Haushalts-, Finanz- und Steuerpolitik, um eine Angleichung zu erzielen und auch, um Kapitalflucht, Steuerhinterziehung, Finanzmanipulationen, Korruption usw. zu unterbinden. Anzustreben ist die Einführung der Tobin.Steuer. - Notwendig sind Gegenkonzepte und Initiativen für die Durchsetzung einer konsequenten ökologischen Aus4 richtung der EU sowie die Beachtung der Nachhaltigkeit in der Wirtschaft. - Die EU-Erweiterung erfordert die gleichberechtigte Einbeziehung der neuen Beitrittsländer, um die langfristige Überwindung der Entwicklungsunterschiede und den Angleich der Lebensverhältnisse, um eine verträgliche Bewältigung der jetzigen negativen Konsequenzen der Entwicklungsunterschiede zu gewährleisten, um die faktische Kolonialisierung der neuen EU-Länder in Ostund Südosteuropa zu verhindern usw. - Es bedarf der Ausarbeitung von strategischen Konzepten, in welcher Weise die EU an der Globalisierung in der Welt teilnimmt und wie man in der EU den negativen Zwängen als Folge der neoliberalen Globalisierung entgegenwirken kann. - Die EU besitzt eine große Verantwortung für die Länder der sogenannten Dritten Welt, die sie insgesamt und ihre einzelnen Mitgliedsländer bisher nicht in erforderlichem Maße wahrnehmen. - Da die EU-Länder nur einen Teil Gesamteuropas darstellen, folgt daraus das Erfordernis der Klärung des Verhältnisses der EU zu den europäischen Nichtmitgliedsländern, der gegenseitig nutzbringenden Kooperation und einer möglichen späteren Einbeziehung dieser Länder. Von besonderer Bedeutung ist dabei das Verhältnis zu Rußland, zur Ukraine, zu Weißrußland. II.Zur Vorgeschichte der PEL-Gründung In Anerkennung der Notwendigkeit waren seit Jahren einige Parteien bemüht, die Formierung einer Europäischen Linkspartei zu betreiben. Die Überlegungen über Notwendigkeit, Charakter und Zielsetzungen einer europäischen Linkspartei fanden in jener Zeit Niederschlag in verschiedenen Dokumenten und Stellungnahmen, von denen nur einige genannt seien: Erwähnt seien - ein vom PDS-Vorstand gebilligtes Thesen-Papier vom Februar 2002, - ebenso vom Februar 2002 ein Brief Hans Modrows an verschiedene europäische Linksparteien mit dem Vorschlag, auf einer Zusammenkunft über die Gründung einer gemeinsamen Linkspartei zu beraten, - Antworten der PDS auf eine entsprechende Initiative der griechischen Synaspismos vom März 2003, - 15 Thesen des Vorsitzenden der italienischen Partei Rifondazione comunista, Fausto Bertinottis vom November 2002, - zwei Positionspapiere der KPÖ vom Februar 2002 und vom November 2003. An der Initiative zur Gründung einer europäischen Linkspartei waren auch die Französische KP und die spanische Izquierda Unida, der die KP Spaniens angehört, beteiligt. Einige von diesen Parteien hatten sich seit 2003 als Initiativgruppe zur Gründung der Europäischen Linkspartei Marxistisches Forum 48/2004 formiert und seither mehrere Zusammenkünfte durchgeführt, die der unmittelbaren Vorbereitung der Parteigründung dienten.. Am 10. und 11. Januar 2004 fand in Berlin ein Treffen von 22 linken Parteien und politischen Organisationen statt, auf dem 11 der teilnehmenden Parteien einen Gründungsappell verabschiedet haben. Das Treffen von Berlin spiegelte das zunächst in Frage kommende linke Parteienspektrum und ihre Haltung zur Gründung einer Europäischen Linkspartei wider. Den Appell hatten die Vertreter folgender Parteien und Organisationen unterzeichnet: Estnische Sozialdemokratische Partei der Arbeit Französische Kommunistische Partei SYNASPISMOS (Griechenland) Partei der kommunistischen Wiedergründung (Italien) Die Linke (Luxemburg) Kommunistische Partei Österreichs Kommunistische Partei der Slowakei Vereinigte Linke (Spanien) Kommunistische Partei Böhmens und Mährens Partei des Demokratischen Sozialismus (Tschechische Republik) Partei des Demokratischen Sozialismus (Deutschland) III. Probleme, Vorbehalte und Widerstände in bezug auf eine Partei der Europäischen Linken Die Probleme, Vorbehalte und Widerstände im Prozeß der Formierung der PEL ergeben sich daraus, daß die betreffenden Parteien einen unterschiedlichen Ursprung, ein unterschiedliches Parteiverständnis und unterschiedliche programmatische und ideologische Orientierungen haben und die Europäische Union unterschiedlich einschätzen. So gibt es Parteien, die sich weiterhin - allerdings in einigen von ihnen verbunden mit parteiinternen Meinungsverschiedenheiten - zu ihrer kommunistischen Vergangenheit, zu ihrer heutigen kommunistischen Identität und zum Marxismus als ideologisch-theoretischem Bezug bekennen, wie zum Beispiel die Französische KP, die Partei der Italienischen Kommunisten, die KP Spaniens, die Portugiesische KP, die KP Griechenlands, die zyprische AKEL, die KP Österreichs, die KP Böhmens und Mährens, die Deutsche KP (die allerdings bisher in den Prozeß der Parteigründung nicht einbezogen wurde). Eine Reihe von Parteien sind entweder aus der kommunistischen Bewegung hervorgegangen und haben inzwischen den Charakter einer linkssozialistischen Parteien angenommen oder sie sind Neugründungen ohne direkten kommunistischen Ursprung. Sie haben vorwiegend ein pluralistisches Parteiverständnis und betrachten sich nicht oder nicht ausdrücklich als revolutionäre, sondern als reformatorische bzw. reformistische Parteien. Manche von ihnen haben mehr den Charakter einer politischen Bewegung als den einer politischen Partei. Zu den Unterschieden zwischen den Parteien gehört auch, wie an anderer Stelle schon erwähnt, die unterschiedliche Harald Neubert Einschätzung der gescheiterten sozialistischen Ordnungen und der Ursachen des Scheiterns. Worin bestehen wesentliche konkrete Vorbehalte gegen die Gründung einer gemeinsamen Partei der Europäischen Linken, die bisher zutage getreten sind? - Im linken Parteienspektrum gibt es Kräfte, so zum Beispiel in den linken nordischen Parteien, in der KPÖ, die generell die europäische Integration und somit die Existenz der Europäischen Union ablehnen und den Austritt ihrer Länder aus der EU fordern. Da die Partei der Europäischen Linken sich den rechtlichen Vorgaben des Europäischen Parlaments gemäß, was den Charakter, die Voraussetzungen, die Verfaßtheit und die Finanzordnung betrifft, konstituieren muß, sehen diese Kräfte in der Parteigründung eine Legitimierung der EU in ihrer derzeitigen Verfaßtheit und eine Anpassung der PEL an die dominierenden Zwänge in der EU. Es wird hierbei offenkundig ignoriert, daß der europäische Integrationsprozeß nicht nur ein von den herrschenden Kräften betriebener Prozeß ist, sondern auch objektive Ursachen besitzt und somit irreversibel ist. Und das bedeutet, daß die linken, pro-sozialistischen Kräfte gar nicht umhin kommen, das integrierte Europa als ein notwendigen Aktionsfeld anzunehmen, sich in ihm länderübergreifend politisch zu organisieren und für Veränderungen zu kämpfen, die national nicht mehr durchsetzbar sind. - Kontroverse Auffassungen existieren darüber, ob die Gründung der Partei der Europäischen Linken tatsächlich zur Integration der europäischen Linkskräfte beiträgt oder die Spaltung fördert. Diejenigen Parteien, die die Gründung der Partei befürworten, lassen sich von der Überzeugung leiten, daß die Partei zur - wenn auch schrittweisen - Vereinigung der europäischen Linkskräfte beiträgt und mit ihr auf die Richtung des Integrationsprozesses Einfluß genommen werden muß und auch kann. Parteien wie die KP Griechenlands, die AKEL Zyperns, die Portugiesische KP, die Partei der Italienischen Kommunisten und auch Kräfte innerhalb einiger anderer Parteien wie zum Beispiel in der KP Böhmens und Mähren, in der KPÖ bezweifeln, daß die PEL die europäischen Linkskräfte zu einigen vermag. Deshalb lehnen sie die Gründung der PEL gänzlich oder zum gegebenen Zeitpunkt als verfrüht ab, und zwar entweder, weil aus ihrer Sicht bisher nicht alle Fragen in bezug auf die Struktur, die Funktion, die Ziele dieser Partei geklärt seien, oder weil bisher nicht alle europäischen kommunistischen und Linkspartei einbezogen sind bzw. sich nicht beteiligen wollen, oder weil sie sich einen Zusammenschluß mit einer gewissen einheitlichen ideologischen Plattform kommunistischer Ausrichtung wünschen, oder weil sie aus dem einem oder anderem Grunde in dieser Parteigründung nicht einen Schritt zur Vereinigung, sondern eben einen Akt der Spaltung der linken, pro-sozialistischen Kräfte Europas sehen. - Widersprüchlich ist am 6. und 7. März 2004 eine internationale Konferenz europäischer kommunistischer und anderer linker Parteien nach Prag verlaufen, an der 33 5 Parteien, darunter 9, die den Berliner Gründungsaufruf für die PEL unterzeichnet hatten, teilnahmen. Die einladende KP Böhmens und Mährens zeigte sich hinsichtlich der Europapartei gespalten zwischen dem Vorsitzenden Miroslav Grebenicek und dem Leiter der Internationalen Abteilung, Hasan Charfo, die eine ablehnende Position einnahmen, und dem stellvertretenden Parteivorsitzenden Miloslav Ransdorf, der in Berlin den Gründungsappell unterzeichnet hatte, die Gründung der PEL also befürwortet.. - Dem Zusammenschluß steht ein kontroverses Internationalismus-Verständnis entgegen. Es sei betont: Die heutige Realität erlaubt nur eine gemeinsame Partei auf der Grundlage eines neuen Internationalismus, wie es auch ihrem Gründungsaufruf, ihrem Programm- und Statutenentwurf entspricht. Es kann sich nur um programmatisch heterogene Parteien mit einem unterschiedlichen Parteiverständnis und unterschiedlicher ideologischer Ausrichtung handeln, die ihre Autonomie bewahren. Demgegenüber gibt es jedoch Parteien und Kräfte, die als Grundlage des engeren Zusammenwirkens verschiedener Parteien fundamentalistisch einen „kommunistischen Internationalismus“ fordern Der Unterschied im Internationalismus-Verständnis besteht also darin, daß zu einem neuen Internationalismus Prinzipien wie die Anerkennung von Pluralität, der Offenheit, der Autonomie der beteiligten Parteien sowie der kritischer Solidarität gehören müssen, während kommunistischer Internationalismus sich offenbar auf ideologische Einheitlichkeit als Bedingung des Zusammenwirkens gründen soll. - Einige Parteien hegen aufgrund der angestrebten breiten, pluralen Zusammensetzung der PEL die Befürchtung, sie könnten ihre Identität und Autonomie verlieren, indem Parteien mit einer bestimmten Ausrichtung eine hegemoniale Funktion beanspruchen und durchzusetzen beabsichtigen. Gedacht dabei wird z. B. an die deutsche PDS, die italienische Partei Rifondazione comunista, die Französische KP. - Probleme existieren auch bei Parteien, in deren Ländern es nicht nur eine Linkspartei, sondern wo es sozusagen Parallelparteien, zum Teil gleichen Ursprungs, gibt, die sich in einem nationalen Konkurrenzverhältnis befinden und wo zum Teil auch ein Ausschließlichkeitsanspruch bzw. die Furcht vor einer Vereinnahmung oder vor einem Identitätsverlust vorherrscht. Das betrifft zum Beispiel in Griechenland Synaspismos und KP Griechenlands, in Italien Rifondazione comunista und Partei der Italienischen Kommunisten, in Portugal Kommunistische Partei und Linksblock, in Deutschland PDS und DKP. - Die Sozialistische Linkspartei Norwegens betrachtet sich zugleich als rote (sozialistische) und grüne (ökologische) Partei und orientiert sich darauf, einen Beobachterstatus sowohl bei der PEL wie bei der Europäischen Föderation Grüner Parteien wahrzunehmen. Im Sinne einer skandinavischen Parteiensolidarität, die 6 inzwischen zur Konstituierung der Nordischen Grünen Linksallianz geführt hat, erklärte in Berlin auch der Vertreter des Finnischen Linksbundes, der PEL nicht als Mitglied beizutreten. - Unterschiedliche Positionen existieren hinsichtlich der Frage danach, wer Mitglied der PEL sein kann bzw. sein darf - nur Parteien und politische Organisationen oder möglicherweise auch Einzelpersönlichkeiten. So hat sich der Vertreter der AKEL auf der jüngsten Konferenz in Prag erneut dafür ausgesprochen, daß nur Parteien Mitglied der PEL werden dürften, nicht aber auch politische Organisationen, wie es der Sache nach geboten ist und im Statutenentwurf auch vorgesehen ist. IV. Mit welchem Profil und Charakter kann bzw. soll die Partei der Europäischen Linken den Erfordernissen und Möglichkeiten gerecht werden? Die PEL soll keine streng organisierte Partei sein, die Beschlüsse bzw. Direktiven faßt, die für die Mitgliedsparteien verbindlich sind. Es ist deshalb verständlich, daß Profil und Charakter der Partei Gegenstand intensiver und teils kontroverser Diskussionen waren und noch immer sind. Eine Entscheidung fällt erst mit der Annahme eines Statuts auf dem Gründungskongreß, der bisher nur als Entwurf vorliegt. Einige allgemeine Überlegungen zum Profil und zum Charakter der Partei der Europäischen Linken: - Entsprechend den Prinzipien eines neuen Internationalismus muß die PEL pluralistisch verfaßt sein. Das bedeutet, daß die Mitgliedsparteien mit ihrem unterschiedlichen Parteiverständnis, ihrer unterschiedlichen Programmatik und ihrer unterschiedlichen praktischen Politik ihre Autonomie uneingeschränkt beibehalten und daß es nur Beschlüsse der zentralen PEL-Gremien geben kann, die die Zustimmung aller Mitgliedsparteien erhalten. Die notwendige gemeinsame Aktions- und Programmplattform, die alle Mitgliedsparteien verbindet, d. h. verbinden muß, um die Handlungsfähigkeit der PEL zu gewährleisten, kann demnach nur Positionen enthalten, die die einzelnen Parteien billigen können und deren Parteiverständnis, deren Programmatik und Politik nicht beeinträchtigen. - Die Partei muß als offenes Projekt konzipiert sein und als solches fürderhin existieren. Das bedeutet, daß Parteien, die sich erst später der PEL anschließen wollen, dies tun können, sofern sie die Modalitäten und die Verfaßtheit der Partei anerkennen. Das bedeutet aber auch, daß die statuarischen und programmatischen Grundlagen der PEL nicht ein für allemal festgeschrieben werden, sondern auf den Parteitagen in Übereinstimmung mit veränderten Situationen, mit veränderten Aufgaben, mit einem möglicherweise veränderten Selbstverständnis überprüft und neu gefaßt werden können. Es muß Konsens erreicht und deshalb gewährleistet werden, daß aus Ländern, in denen mehrere Linksparteien bestehen, diese gleichberechtigt Mitglied der Partei der Marxistisches Forum 48/2004 Europäischen Linken werden können und die PEL nicht genutzt wird, um nationale Zwistigkeiten und Konkurrenz auszutragen. - Ein noch nicht endgültig entschiedenes Problem besteht darin, ob auch Einzelpersönlichkeiten aus EU-Ländern, die keiner der Mitgliedsparteien angehören, unter den erforderlichen Voraussetzungen Mitglied der PEL werden können. Die Französische KP, die zuvor die Aufnahme von Einzelpersönlichkeiten generell abgelehnt hat, soll dieser Möglichkeit unter der Bedingung zustimmen wollen, daß es der jeweiligen Mitgliedspartei obliegt, über Einzelmitgliederbewerbungen aus ihrem Lande zu befinden. - In der Vorbereitungszeit des Gründungskongresses am 8. und 9. Mai 2004 oder gar erst auf dem Kongreß selbst sind noch einige entscheidende Fragen zu klären, die voraussichtlich in Rom die Überwindung ernsthafter Interessenunterschiede und Meinungsverschiedenheiten erforderlich machen werden. Das betrifft in erster Linie die Person des bzw. der Vorsitzenden der PEL,2 die Zusammensetzung und Kompetenz der Führungsgremien und nicht zuletzt das Problem der Parteifinanzen. Da die vom Europa-Parlament zustehenden finanziellen Mittel nicht ausreichen werden, um die Existenz der Partei materiell zu gewährleisten, bedarf es einer Einigung über die von jeder Mitgliedspartei einzubringenden Beiträge, über die Modalität der Beitragszahlung und über die sodann anstehende Verteilung der Mittel. Angela Klein Die Europäische Antikapitalistische Linke Ein Ansatz zur Neuformierung einer sozialistischen Linken Der Entstehungsprozess der Europäischen Antikapitalistischen Linken (EAL) geht zurück auf die Zeit um 1989. Damals gründete sich die Rot-Grüne Allianz in Dänemark aus der Linkspartei, der Kommunistischen Partei Dänemarks und der SAP, die dänische Sektion der IV.Internationale. Die RGA ist von den Parteien, die aus Fusionsprozessen hervorgegangen sind, die älteste unter denen, die heute die EAL bilden. Vorläufer bei diesem damals neuen und etwas unerhörten Versuch, unterschiedliche, um nicht zu sagen: ehemals verfeindete Organisationen zusammenzubringen, gab es in Gestalt der Vereinigten Sozialistischen Partei (VSP, 1986) in der BRD, die sich aus der ehemaligen GIM (IV.Internationale) und der ehemaligen KDP/ML (Albanien) zusammensetzte, sowie der baskischen Organisation Zutik, die das Ergebnis einer Fusion von LCR (IV.Internationale) und der aus maoistischer Tradition stammenden MCE war. Die Organisation Zutik gibt es noch, die VSP nicht mehr. Dieser Prozess des Aufeinander Zugehens hat immer eine kritische Sichtweise auf den Staatskommunismus vorausgesetzt, wie er in der Sowjetunion oder in China oder Albanien praktiziert wurde. Er war zugleich vom Bestreben geprägt, mit der Kritik an der konkreten Realisierung nicht auch das sozialistische Ziel selbst über Bord zu werfen und die Fehler, die gemacht worden sind, gemeinsam aufzuarbeiten - in der Perspektive, neuen Boden für den gemeinsamen Kampf gegen den neoliberal gewendeten Kapitalismus zu finden. Dies setzte eine Situation voraus, wo sich die westlichen kommunistischen oder maoistischen Organisationen von der Orientierung auf die Doktrinen aus Moskau, Peking und Tirana zu lösen begannen und die Losung vom Neuen Denken neue „Luft zum Atmen“ gab und Reflexionsprozesse in Gang setzte. Eine solche Situation wurde durch Maos Tod und den Amtsantritt Gorbatschows geschaffen. Bis heute ist eine der vier Bedingungen, der EAL beizutreten, der Nachweis der Fähigkeit, mit anderen antikapitalistischen Organisationen in der Perspektive der gemeinsamen Organisierung zusammenarbeiten zu können. Im engeren Sinne entstand die Europäische Antikapitalistische Linke am Rande einer Konferenz des portugiesischen Bloco de Esquerda im März 2000, was zufällig oder auch nicht das Datum des EU-Gipfels war, auf dem der Prozess von Lissabon, die Agenda 2010, beschlossen wurde. Der Bloco hatte die LCR (französische Sektion der IV.Internationale), die RGA und die SSP eingeladen. Auch die Scottish Socialist Party war in den 90er Jahren als Produkt der Konvergenz verschiedener Strömungen entstanden, allerdings vor einem anderen Hintergrund. Ihren Kern bildete die Militant-Gruppe, eine trotzkistische Strömung innerhalb der Labour-Party, die in den frühen 90er Jahren eine führende Rolle in der Kampagne gegen die verhasste Kopfsteuer spielte, die Reiche wie Arme gleichermaßen belasten sollte. Vor allem in Schottland traf das Vorhaben auf wütenden Massenprotest und konnte nicht durchgesetzt werden. Die prominentesten Vertreter der Kampagne verließen später auf Grund von politischen Meinungsverschiedenheiten ihre Organisation, Scottish Militant Labour. Sie gründeten zunächst zusammen mit anderen politischen Kräften das Wahlbündnis Scottish Socialist Alliance, später, nach beachtlichen Wahlerfolgen, die Scottish Socialist Party. Die Organisation vereinigt revolutionäre ebenso wie reformistische Strömungen. Der Bloco de Esquerda hingegen geht auf die Initiative dreier Organisationen der radikalen Linken zurück. Eine von ihnen, die UDP (Demokratische Volksunion, proalbanisch) wurde nach dem Sturz der Diktatur 1975 die stärkste Kraft unter den Organisationen links von der KP Por- 2 Auf dem Gründungskongreß in Rom wurde diese Frage einvernehmlich entschieden: Als Vorsitzender der PEL wurde Fausto Bertinotti von der Ita- lienischen Rifondazione comunista gewählt. Harald Neubert 7 tugals und errang in den Folgejahren eine bemerkenswerte Verankerung in den sozialen Bewegungen. Sie löste sich im Laufe der 80er Jahre von ihrer proalbanischen Identität und setzte sich zunehmend für eine zu den traditionellen Linksparteien alternative Neuformierung der Linken ein. 1995 errang sie ein Abgeordnetenmandat im Parlament. Sie bildete 1997 mit der PSR (IV.Internationale) und Política XXI (eine Gruppe von Intellektuellen, die 1991 aus der PCP ausgetreten war), sowie mit unabhängigen Linken eine gemeinsame Wahlliste zu den Kommunalwahlen in Lissabon. Der Bloco wurde 1999 gegründet. Von den vier Gründungsorganisationen war die LCR die einzige, die nicht aus einem Fusionsprozess hervorgegangen oder in einem solchen engagiert war. Dies war allerdings nicht ihre Schuld - seit der Abspaltung der JuquinGruppe von der KPF hatte sie mehrfach Versuche in dieser Richtung unternommen, die aller erfolglos geblieben waren. Erst die gemeinsame Kandidatur mit der zweiten in Frankreich bedeutenden trotzkistischen Organisation, Lutte Ouvrière, 1999 zu den Europawahlen brachte ein positives Ergebnis. Die Liste erhielt über 5% der Stimmen und neun Abgeordnete im Europaparlament. Es schien, dass diese erstmalige Präsenz einer revolutionären Liste im EP zum Kristallisationspunkt für die Herausbildung einer europäisch organisierten antikapitalistischen Kraft werden könnte. Zumal auch die anderen drei Parteien auf die eine oder andere Weise in Parlamenten vertreten waren und vom relativen Aufschwung, den die radikale Linke in den späten 90er Jahren zu verzeichnen hatte, profitiert hatten. Die EAL gründete sich zu einem Zeitpunkt, wo die meisten Regierungen in der EU von sozialdemokratischen Parteien geführt waren und in einigen westeuropäischen Ländern große kommunistische Parteien mit in der Regierung saßen - so die KPF, Rifondazione Comunista, die PDS in Mecklenburg-Vorpommern. Die zunehmende Durchsetzung neoliberaler Programme in der Regierungspolitik führten jedoch zu keiner linken Flügelbildung bei den Parteien der Regierungslinken. Die wachsende Opposition unter Linken und in der Bevölkerung drückte sich in Massenmobilisierungen und einem Anstieg der Wahlerfolge der radikalen Linken nieder. Die Alternative zum Kurs der Regierungslinken war also die Sammlung der antikapitalistischen Kräfte. Sie verständigten sich auf folgende Punkte: das Einstehen für ein antikapitalistisches Programm; die Ablehnung der Beteiligung an Regierungen mit neoliberalem Programm; die Verankerung in sozialen Bewegungen und die Beförderung der Massenproteste; die Akzeptanz des Pluralismus der Meinungen und Strömungen in diesem Rahmen; die Beteiligung an Parlamentswahlen. Seit dem ersten Treffen im März 2000 trifft sich der Kreis etwa zweimal im Jahr, zuerst am Rande von Mobilisierungen gegen den EU-Gipfel, dann am Rande der Europäischen Sozialforen. Mitgliedsorganisationen sind neben den Genannten: der Bloque Nacionalista Galego (Galizien); déi Lenk (Lux); Espacio Alternativo (SP); Mouvement pour le Socialisme (CH); Özgürlük ve Dayanisma Partisi (TK); Socialist Workers Party (GB); Respect 8 (GB); solidaritéS (CH); Zutik (Euskadi). Mit beobachtendem Status nehmen teil: DKP (D); Esquerra Unida i Alternativa (Katalonien); IU (SP); KPÖ (A); Rifondazione Comunista (I); Socialist Party (GB); Socialist Party (Irl); Synaspismos (GR). Das achte Treffen fand in Brüssel im April 2004 statt. Die Treffen werden regelmäßig mit einer inhaltlichen Erklärung beschlossen. Die gemeinsame programmatische Basis ist die Ablehnung der Verträge von Maastricht und Amsterdam sowie der EU-Verfassung; der positive Bezug auf die globalisierungskritische Bewegung, die Notwendigkeit der Beförderung europäischer Mobilisierungen und der Herstellung einer europaweiten Handlungsfähigkeit der sozialen Bewegungen und der Gewerkschaften sowie eine „tief reichende Erneuerung der sozialen, Gewerkschafts- und Bürgerbewegung“. Die EAL versteht sich als Teil der sozialen Linken. Sie sucht die Zusammenarbeit „auf einer radikalen, einheitsorientierten und pluralistischen Basis“. Sie steht für eine sozialistische und demokratische, selbstverwaltete und von unten bestimmte Gesellschaft, ohne Ausbeutung der Arbeit und Unterdrückung der Frauen, basierend auf nachhaltiger Entwicklung und nicht auf einem ,Wachstumsmodell', das den Planeten bedroht.“ Ihre „Strategie schließt eine soziale Orientierung ein, der es sehr um das Alltagsleben der arbeitenden Männer und Frauen zu tun ist…“ (Alle Zitate aus der Erklärung der 7.Konferenz der EAL am 11./11.November 2003 in Paris). Die EAL hat zu den Europawahlen ein Manifest herausgebracht, das die EU-Verfassung rundherum ablehnt und die Organisierung von Volksentscheiden unterstützt. Sie konnte jedoch die Bedingungen, die die EU-Richtlinien für die Bildung einer europäischen Partei vorsehen, zu den Europawahlen 2004 nicht erfüllen. Es kandidierten von ihr der Bloco de Esquerda, die Liste LCR-LO, die SSP, déi Lenk. Mitglieder der Enhedslisten kandidierten auf Listen der Volksbewegung bzw. auf den Junilisten. Die Wahlerfolge waren unterschiedlich. Bislang ist die EAL weder das Ergebnis starker Linksströmungen, die aus den großen traditionellen Arbeiterparteien herausgetreten sind, noch offensiver Arbeitskämpfe. Sie ist das Ergebnis eines politischen Willens, der Bilanz zieht von einem Vierteljahrhundert Niederlagen und dem Scheitern der sozialdemokratischen wie auch der kommunistischen Bewegung. Der Versuch, die sozialistische Linke neu zu formieren, damit ein neuer Versuch für eine sozialistische Massenpartei gewagt werden kann, findet vor einem anderen Hintergrund statt als Ende des 19. oder Anfang des 20.Jahrhunderts. Die großen Konzentrationen der Arbeiterbewegung werden heute geschleift durch Standortschließungen, Outsourcing und Prekarisierung der Beschäftigungsverhältnisse, die Gewerkschaften geschwächt und zusätzlich mit der Internationalisierung der Produktion und der Schaffung des EU-Binnenmarkts vor die Aufgabe gestellt, sich vor allem auf europäischer Ebene Streik- und Tariffähigkeit erst erkämpfen zu müssen. Neue Formen des Widerstands, neue Strukturen der Solidarität müssen gefunden werden, die Arbeitsweise der sozialen Bewe- Marxistisches Forum 48/2004 gungen im Hinblick auf die Wiedergewinnung einer sozialen Verankerung überprüft, die Konzeption von Gewerkschaftsarbeit reformiert werden. Ohne diese Veränderungen im sozialen Raum hilft es gar nichts, nur eine Wahlalternative oder eine neue Linkspartei aufzustellen, die wiederholt, was andere vor ihnen schon häufig gesagt und verraten haben: Wir machen es besser; wir sind in den Parlamenten das Sprachrohr der sozialen Bewegungen. Immerhin muss man bedenken, dass die Generation derer, die heute 40 oder 50 sind, die Degeneration zweier Parteien, die eben dies von sich behauptet haben, live miterlebt haben: bei den Grünen und bei der PDS. An einem dritten Experiment dieser Art besteht kein Bedarf; es kostet zu viel Kraft und verschleißt zuviel wertvolle Menschen. Der Fehler liegt nicht darin, dass das Bewegungsstandbein gegenüber dem parlamentarischen Spielbein zu schwach geworden wäre. Der Fehler liegt in dem Konzept selbst, in der alten, sozialdemokratischen, Arbeitsteilung zwischen Partei und Gewerkschaften (sozialen Bewegungen). Die Bewegungen wären demnach zuständig für die soziale Mobilisierung, während die Partei zuständig wäre für die Arbeit in den Institutionen und die Vermittlung des Wählerwillens in die Parlamente. Das ist ein bürgerliches Konzept, das der Bevölkerung in der Ausübung ihrer staatsbürgerschaftlichen Funktionen eine ausschließlich passive Rolle zuschreibt, während die Parteien das Monopol der Willensvermittlung in den parlamentarischen Raum haben, der damit zugleich als der eigentlich politische Raum definiert wird. Mit diesem Konzept muss gebrochen werden. Weder beschränkt sich der Ort der Politik auf die staatlichen Institutionen, noch kann man hinnehmen, dass Bewegungen keinen unmittelbaren Einfluss auf die Institutionen nehmen können, noch kann man die Hierarchie von der Bewegung unten zur Partei oben akzeptieren. Bewegungen sind kein Transmissionsriemen, sondern ein eigenständiges Subjekt, das seinen Willen unmittelbar und unverfälscht zum Ausdruck bringen will. Das Verhältnis zwischen Partei und Bewegung muss in diesem Sinn von Grund auf neu überdacht werden. Das ist eine der zentralen Aufgaben, vor die uns das Scheitern der beiden großen Traditionslinien der Arbeiterbewegung stellt. Birger Scholz Perspektiven einer wahlpolitischen Alternative Auf der großen Demo am 3. April waren die LinksruckSchilder unübersehbar: Wir brauchen eine neue Linkspartei! Keine Frage, die „Linkspartei“ ist nach der dritten Wandlung der Sozialdemokratie hin zum Neoliberalismus überfällig. Die realen Ablösungsprozesse von Teilen der Gewerkschaften von der SPD sind eben nicht nur die Götterdämmerung der Regierung Schröder, sondern beschließen die längst vergangene Epoche des fordistischen Klassenkompromisses. Das Potential für eine politische Formierung links der SPD ist immens. Seit 1998 verließen über 130.000 Sozialdemokraten die Partei. Wir erleben also nicht nur die Neoliberalisierung der SPD, sondern auch ihre Implosion als Mitglieder- und Volkspartei. Das Schröder-Vorbild Tony Blair hat es vorgemacht und die Mitgliederzahlen der Labour-Party seit der Regierungsübernahme halbiert. Schröders Politik führt in Deutschland unweigerlich zur Machtübernahme eines bürgerlichen Blocks, da die ehemaligen Stammwähler überwiegend demoralisiert zu Hause bleiben. Zugleich gibt es im parteipolitischen Raum keinen wahrnehmbaren Akteur mehr, der die Lüge der Alternativlosigkeit neoliberaler Kürzungspolitik entschieden zurückweist. Hierin liegt eine der Kernaufgaben einer sozialen wahlpolitischen Alternative, nämlich sich zum Sprachrohr der Enttäuschten zu machen. Damit ist aber auch die inhaltliche Ausrichtung vorgezeichnet. Es ist keine explizit sozialistische oder antikapitalistische, sondern eine dezidiert soziale, gewerkschaftsorientierte und anti-neoliberale Orientierung. Nur so - und nicht anders - wird es gelingen, das breite Bündnis vom Enttäuschten Mitglied des CDU-Arbeitnehmerflügels bis zum Arbeitslosen-Aktivisten zu schmieden. Die WahlalAngela Klein ternative formuliert dies wie folgt: „Das Neue der gegenwärtigen politischen Situation besteht darin, dass nicht nur radikale antikapitalistische Kräfte sich von der SPD abwenden, sondern Kernbereiche ihrer bisherigen sozialen Basis und insbesondere der gewerkschaftlich organisierten abhängig Arbeitenden eine neue politische Interessenvertretung suchen. Auch sozial engagierte bisherige AnhängerInnen von Bündnis 90/Die Grünen und CDU/CSU finden sich durch diese Parteien nicht mehr vertreten. Dies muss aufgegriffen werden, ohne die Leute mit verbalradikalen Parolen oder unpassenden Diskussionsbeiträgen über die (Un-)Reformierbarkeit des Kapitalismus abzuschrecken. Gesellschaftliche Formierungsund Lernprozesse müssen am Bewusstseinsstand der Menschen ansetzen und brauchen Zeit.“ (www.wahlalternative.de : Zu einigen Fragen und Einwänden, 22.04.04) Eine aktuelle Umfrage der ARD-Sendung Panorama verdeutlicht das Potential. Demnach können sich insgesamt 38 Prozent der Wahlberechtigten vorstellen, ihre Stimme einer „Initiative für Arbeit und Soziale Gerechtigkeit“ zu geben. Sechs Prozent der Befragten antworteten auf eine entsprechende Frage mit „ja, sicher“, 32 Prozent mit „ja vielleicht“. Im März dieses Jahres beantworteten nur 24 Prozent die entsprechende Frage mit „ja vielleicht“. Der Parteienforscher Franz Walter hält einen gehörigen Schuss „Linkspopulismus“ für dringend geboten, um die von der SPD mental abgekoppelten Unterschichten und Geringverdienern zu erreichen. Die Erfolge rechtspopulistischer Formationen in Europa, aber auch in Deutschland im Fall der Schill-Partei, zeigt das Potential. Allein fehle es der Wahlalternative an charismatischen Persönlichkei- 9 ten, die zu einem „Linkspopulismus“ taugen. Auch, um den Wettlauf mit rechtspopulistischen Alternativen zu gewinnen. „Gibt es ihn, so werden die Karten in der Republik neu gemischt“, so Walter (Süddeutsche Zeitung v. 22.3.04). Diese Aussage muss in ihrer Absolutheit nicht geteilt werden, zeigt aber ein bisheriges Defizit der Wahlalternative. Allein mit dem Typus des biederen und kreuzbraven linken Gewerkschaftsfunktionär ist kein Wahlkampf zu führen. Populäre Figuren, die begeistern können, sind rar gesät. Doch sollte bei allen Debatten um Wahlalternativen die Betonung auf „neu“ liegen. Denn eine Wiederauflage der Sozialdemokratie, nur eben ein bisschen sozialer und demokratischer, eine USPD oder auch Gewerkschaftspartei, wäre kein Schritt nach vorne, sondern bestenfalls zur Seite. Besonders deutlich wurde dies bei der Gründung der Socialist Labour Party (SLP) in den 1990ern durch den ehemaligen Vorsitzenden der Bergarbeitergewerkschaft Arhur Scargill. Heute führt die SLP ein Sektendasein. Old Labour alleine reicht eben nicht. Neue Zeiten denken, heißt das breite Bündnis wagen. Gelingen muss das „come together“ von alter Arbeiterbewegung und den sozialen Bewegungen. Denn ohne die Entstehung der globalisierungskritischen Bewegung, die seit den Protesten in Genua 2001 einen alternativen Diskurs in der breiten Öffentlichkeit initiierte, wäre eine wahlpolitische Alternative kaum denkbar. Daher muss eine wahlpolitische Alternative Ausdruck und Instrument der realen sozialen Bewegungen sein, um deren glaubwürdige Opposition ins Parlament zu tragen. Denn die Notwendigkeit neoliberale Politik auch wahlpolitisch anzugreifen, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass betrieblicher Widerstand, Streiks und die Pluralität außerparlamentarischer Kämpfe die notwendige Bedingung - wenn auch nicht notwendigerweise die hinreichende - für eine reale Veränderung der Kräfteverhältnisse ist. Die Chancen dafür stehen gut. Die Demonstration des 1. November 2003 gegen die Agenda 2010, die von einem breiten Bündnis von (links-)gewerkschaftlichen Basisstrukturen und sozialen Initiativen organisiert wurde, verdeutlichte das neue Protestpotential und ermöglichte erst die DGB-Demos am 3. April diesen Jahres. Im Ursprungspapier der Wahlalternative heißt es korrekt: „Politisch geht es klar um Opposition, nicht um mögliche Beteiligung an einer Regierungskoalition.“ Eine Wahlalternative erfüllt ihren Zweck, wenn es ihr gelingt, Menscher unterschiedlicher sozialer und politischer Herkunft zusammen zu bringen, um gesellschaftliche Kräfteverhältnisse zugunsten abhängig Beschäftigter und sozial Benachteiligter zu verändern. Insofern ist der Begriff „Linkspartei“ unzureichend. Vielfach wird daher die Frage gestellt, ob die Wahlalternative überhaupt ein Projekt für Marxisten oder Sozialisten sei. Die internationale sozialistische linke (isl), die Teil des deutschen EAL-Projekts ist (siehe Beitrag von Angela Klein) hat dazu folgendenden Beschluss gefasst: „Die Diskussion über eine Wahlalternative und die Herausbildung einer neuen politischen Kraft, wie sie in der „Wahlalternative Arbeit und soziale 10 Gerechtigkeit“(WASG) geführt wird, ist für uns ein wichtiger Prozess, an dem wir uns beteiligen (...)Eine neue politische Kraft der Linken muss die antikapitalistischen Kräfte mit einschließen.“ Ähnlich argumentiert auch die Organisation Linksruck, die ebenfalls Teil des EAL-Prozesses ist und sich aktiv an der Formierung der Wahlalternative beteiligt. „Gesellschaftliche Formierungs- und Lernprozesse müssen am Bewusstseinsstand der Menschen ansetzen und brauchen Zeit. Sozialistische Positionen - von denen es wiederum ein breites Spektrum gibt können ein Ergebnis dieser Prozesse sein, aber nicht vorausgesetzt oder erzwungen werden“, argumentieren die Initiatoren der Wahlalternative (www.wahlalternative.de : Zu einigen Fragen und Einwänden, 22.04.04) Sozialisten und Marxisten haben in diesem Prozess die Chance, aus dem gesellschaftlichen Ghetto heraus zu kommen und in einem Prozess der realen Kämpfe und Aktivität ein sozialistisches Profil der Wahlalternative zu entwickeln. In Anbetracht der unwiderruflichen Aufkündigung des Sozialstaatskompromisses durch das Kapital stehen die Chancen dafür nicht schlecht. Wer in diesem Prozess als Marxist oder Marxistin abseits steht, verbleibt freiwillig in der gesellschaftlichen Marginalisierung. Interessant sind in diesem Zusammenhang die Parallelen in Großbritannien. Anfang 2004 hat sich um den Labour-Parteiausschluß des populären Kriegsgegners und Abgeordneten George Galloway mit respect ein neues Sammlungsprojekt links von Labor konstituiert (Vgl. jW vom 14.01.04). Nur 20 Wochen nach der Konstituierung erhielt respect bei den Europawahlen in England und Wales bereits über 252.000 Stimmen (1,7%). Bei den Londoner Bürgermeisterwahlen gewann respect-Kandidatin Lindsey German 87.533 Stimmen (4,57%). Das Wachstum des neuen Bündnisses ist dynamisch wird zunehmend von regionalen Gewerkschaftsgliederungen unterstützt. Auch hier wird das verbindende, nämlich die Ablehnung des Irak-Krieges und des Sozialabbaus, und nicht das Trennende in den Fordergrund gestellt. So sind Marxistinnen und Marxisten stark vertreten, ohne aber respect in kürzester Zeit in eine sozialistische Arbeiterpartei transformieren zu wollen. Die Wahlalternative für Arbeit und soziale Gerechtigkeit focussiert klar auf die Bundestagswahl 2006. Das ist auch völlig richtig. Sollte es nicht gelingen, bis 2006 eine wählbare Alternative zum neoliberalen Einheitsblock zu bilden, wird es nach der Bundestagswahl um so schwerer. Die SPD wird sich in der Opposition schnell kosmetisch wenden und wieder links blinken. Es gilt also das Zeitfenster zu nutzen. Aus zwei Gründen wäre es verhängnisvoll im Vorfeld der Bundestagswahl eine gemeinsame Liste mit der PDS aufzustellen. Erstens ist die PDS bei den Aktivisten aus der außerparlamentarischen Bewegung wegen ihrer Regierungsbeteiligungen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern völlig diskreditiert. Gerade auch Gewerkschafter wissen nur zu gut, wem sie die Erosion der einheitlichen Tarifverträge im öffentlichen Dienst zu verdanken haben. Zweitens ist die PDS im Westen auch in ihrer besseren Zeit nicht wirklich angekommen und wird als das wahrgenommen, was sie nunmehr auch ist: eine ostdeutsche Regionalpartei. Marxistisches Forum 48/2004 Trotzdem wird diese Debatte kommen. Denn die klügeren Strategen um Michael Brie wissen, dass sich das gute Abschneiden bei der Europawahl bei einer Bundestagswahl mit doppelt so hoher Wahlbeteiligung nicht wiederholen lässt. Erst recht nicht, wenn die Wahlalternative alternativ antritt. Schon im Vorfeld der Europawahl gab sein Papier „PDS plus“ die strategische Marschrichtung vor. Allerdings ist vor allem im gewerkschaftlichen Milieu der Initiative Arbeit & soziale Gerechtigkeit der bayerischen IG-Metaller keinerlei Bereitschaft zur Kooperation erkennbar. Auch wenn manche der Initiatoren der Wahlalternative, die z.T. noch PDS-Mitglied sind, mit einem PDS-Deal liebäugeln, um 2006 die 5%-Hürde zu nehmen, werden die Karten nach der Vereinsgründung und der Etablierung demokratischer Strukturen sowieso neu gemischt. In der Berliner Regionalgruppe jedenfalls gibt es wenig bis keinerlei Bereitschaft, in irgendeiner Weise mit der PDS ins Bett zu hüpfen. Im Lande haben sich mittlerweile über 100 Orts- und Regionalgruppen der Wahlalternative gebildet. Zum Teil auch aus bestehenden linken Wählergemeinschaften. In NRW beginnt bereits die Debatte, ob bei der Landtagswahlen 2005 angetreten werden soll. In Berlin steht die Frage auf der Agenda, ob 2006 bei der parallel zur Bun- destagswahl stattfindenden Abgeordnetenhauswahl nicht auch kandidiert werden soll. Dies hieße explizit gegen die Berliner PDS. Eine gemeinsame Liste auf Bundesebene wäre da schon einigermaßen kurios, zumal sich viele Aktive der Berliner Wahlalternative aktiv am Volksbegehren zur Abwahl des SPD-PDS-Senats beteiligen, das gemeinsam mit den Gewerkschaften GEW und GdP organisiert wird. Will die Wahlalternative erfolgreich wachsen, muss sie kampagnenfähig werden, bundespolitisch wie kommunal. Nur in realer Aktivität und Mobilisierung kann der Gefahr des Stellvertretertums („die da oben machen das schon“) einer rein parlamentarischen Partei wirksam begegnet werden. Schon jetzt ist absehbar, dass die Gruppen vor Ort auch gegen die konkreten Schweinereien in den Kommunen wie Privatisierungen aktiv werden wollen. Denn nur in der konkreten Arbeit und Interessensvertretung - und nicht allein mit medialer Präsenz - wird es gelingen, eine glaubwürdige Interessenvertretung aufzubauen. Es ist müßig, die Wahrscheinlichkeiten für Scheitern oder Erfolg benennen zu wollen. Zumindest besteht die Aussicht auf Erfolg. Und den hatte die deutsche Linke schon lange nicht mehr. Uwe-Jens Heuer Gegenkräfte und marxistisches Staatsverständnis Am 12. und 13. Mai wurde in der „Jungen Welt“ von Christoph Jünke (IV. Internationale) eine Debatte um ein sozialistisches Übergangsprogramm und das Zusammenwirken von Linken eröffnet. Bei den Stalinisten, also denen, die der Sowjetunion anhingen, bleibe bis heute die gewaltige „Hypothek von Gewalt und Verbrechen“. Die Geschichte, schließt er, habe uns „jahrzehntelang nicht zu Unrecht bis aufs blutige Messer geschieden“. Ihm antworteten, ihre damalige Position verteidigend, von der DKP Hans-Heinz Holz (11. Mai) und Willi Gerns (26. Mai). Manuel Kellner sekundierte Jünke am 2. Juni, wenn auch wesentlich zurückhaltender. Uwe-Jens Heuer kritisierte am 11. Juni die Verweigerung einer gleichberechtigten Bilanz durch Jünke und Kellner, vermißte aber bei allen den von Jünke geforderten Schritt zur „Erhellung der Gegenwart“. Nur so könne „statt eines Schlagabtauschs eine sinnvolle Strategiediskussion geführt werden.“ Wir dokumentieren im Folgenden sein Angebot für eine solche Diskussion. (aus Junge Welt vom 11. Juni 2004 (http://www.jungewelt.de)) Zu diesem Zweck sind die Feststellungen von Marx und Engels wieder aufzunehmen, dass dem herrschenden System auf der Ebene der Weltpolitik entgegengetreten werden muß. Der Ausbruch eines einzelnen Landes erfolgte 1917 in einer historisch einmaligen Situation. Heute wird die Welt von einer weltweiten neoliberalen, exakter imperialistischen, Offensive auf ökonomischem, ideologischem und militärischem Gebiet bestimmt. Schwieriger ist es mit der Antwort auf die Frage nach der Alternative. Marx und Engels sahen als Alternative den Birger Scholz Sozialismus, also eine Ordnung, in der das Privateigentum an den Produktionsmitteln aufgehoben war. Dass eine solche Gesellschaft möglich ist, hat die Geschichte gezeigt, dass sie schließlich nicht konkurrenzfähig war, ebenfalls. Die gegenwärtige weltweite Offensive des Kapitals verstärkt die Gefahr des Rückfalls in die Barbarei, bevor eine sozialistische Alternative in greifbare Nähe rückt. Wenn wir also auch nicht wissen, ob die sich zuspitzenden Widersprüche der kapitalistischen Gesellschaft rechtzeitig Kräfte hervorbringen, die eine neue sozialistische Gesellschaft schaffen, wann und auf welchem Wege dies geschieht, so bleibt das Wachhalten der Vorstellung einer möglichen - nicht sicheren - Alternative Voraussetzung jeglichen konsequent antikapitalistischen Kampfes und der glaubwürdigen Ausarbeitung von Reformalternativen. Zur Frage nach dem Weg könnte unsere Geschichtsdebatte einen Beitrag leisten. Der rationelle Kern dieser Debatte scheint mir, aller Schuldvorwürfe entkleidet, die Auseinandersetzung um die Rolle des Staates zu sein. War die mit der Oktoberrevolution eingeleitete Staatswerdung (eines Teils) der Arbeiterbewegung ein Fortschritt oder ein Irrweg? Wenn es sich um eine Niederlage aller Linken handelte (Kellner), muß da doch trotz aller Mängel, Defizite usw. etwas Positives, Wertvolles verloren gegangen sein. Und weiter gefasst, welche Bedeutung können staatliche Konflikte generell in der heutigen Welt, im Kampf gegen den Imperialismus haben? Es genügt also m. E. nicht, wie Kellner jetzt, einfach wieder die Stunde der Pariser Kommune schlagen zu lassen. Es gibt in dieser Frage theoretisch Aufzuarbeitendes nicht nur für uns Ost11 belastete, sondern auch für die in sich vielfältig gespaltene Westlinke. Das geht nicht ohne einen kritischen Rückblick auf Marx und Lenin. Marx hatte 1844 die Notwendigkeit einer radikalen Revolution entwickelt, die das Privateigentum beseitigt, die politische zur sozialen Revolution macht, und dann die politische Hülle wegwerfe (MEW 1/408 f.). 27 Jahre später, 1871, sieht er in der Pariser Kommune eine Bestätigung dieser theoretischen Konzeption. Es war möglich, wenn auch nur für72 Tage, eine Ordnung ohne die alte bürokratisch-militärische Maschinerie zu gestalten. Die Arbeiterklasse hatte spontan Formen entwickelt, die den Staat ersetzen konnten. Die Kommunalverfassung würde „dem gesellschaftlichen Körper alle die Kräfte zurückgegeben haben, die bisher der Schmarotzerauswuchs <Staat>, der von der Gesellschaft sich nährt und ihre freie Bewegung hemmt, aufgezehrt hat“. (MEW 17/341) Marx hat das Gesamtgebäude dieses Entwurfs der neuen politischen Ordnung ohne Staat auf einem unsicheren Grund errichtet. Das betraf nicht nur die einmalig günstigen Umstände, sondern vor allem die zu bewältigenden politischen und ökonomischen Widersprüche. Er hatte Gewaltanwendung gegen die Feinde der Kommune gefordert, die Diktatur des Proletariats, aber war sie mit der konsequenten unmittelbaren Demokratie zu vereinbaren? Die Probe auf die Realität, auf die dauerhafte Lebensfähigkeit war noch abzulegen. In den berühmten Aprilthesen, die Lenin unmittelbar nach seiner Ankunft in Rußland verkündete, nahm er das Projekt der Kommune voll auf. Er forderte statt der parlamentarischen Republik „Abschaffung der Polizei, der Armee, der Beamtenschaft,. Entlohnung aller Beamten, die durchweg wählbar und absetzbar sein müssen, nicht über den Durchschnittslohn eines guten Arbeiter hinaus“ (LW 24/ 5-6). Lenin zitierte sogar die Formulierung von Engels, dass sie in mancher Hinsicht „schon kein Staat im eigentlichen Sinne mehr“ sein werde (ebenda 52 f.). Auch in dem im August 1917 verfaßten Werk „Staat und Revolution“ stand erneut das Projekt der Kommune im Mittelpunkt, war allerdings mit widersprechenden konkreten Forderungen verbunden. „Die gesamte Gesellschaft wird ein Büro und eine Fabrik mit gleicher Arbeit und gleichem Lohn sein“(LW 25/488). An anderer Stelle war davon die Rede, den Kommunestaat mit den Errungenschaften des Staatskapitalismus zu verbinden. (ebenda 369 f.). Lenin wollte einerseits den tiefsten Sehnsüchten der unter dem Krieg, dem reaktionären Beamtentum, der Herrschaft der Gutsbesitzer leidenden Menschen entsprechend den „Schmarotzer Staat“ verabschieden und damit die Massen zur Revolution aufrufen. Auf der anderen Seite wollte er in der internationalen Diskussion der Marxisten „seine“ Revolution legitimieren. Und schließlich wußte er, dass es ohne Diktatur, ohne staatliches Eigentum nicht abgehen würde, was notwendig der Selbstregierung widersprach. Schon wenige Monate nach der Oktoberrevolution war offensichtlich, dass es ohne einen Staatsapparat, ohne eine Schicht von „Bürokraten“ nicht gehen werde. Der Bürgerkrieg, begleitet vom Kriegskommunismus, bedurfte der 12 Bürokratie. Lenin wußte, daß Rußland nicht reif für den Sozialismus war. Die Neue Ökonomische Politik sollte das Überleben der Sowjetmacht unter den Bedingungen einer nach wie vor kapitalistisch beherrschten Welt sichern. Man mußte mit dem Apparat auskommen, wie er war. Im Entwurf einer Rede Lenins Ende 1922 ist zu lesen: „Der Staatsapparat überhaupt: er ist unter aller Kritik; unter dem Niveau der bürgerlichen Kultur“. In seinen letzten Aufzeichnungen, hielt er, verzweifelt, fest, die Forderung nach Einheit des Apparats werde „von demselben Apparat gestellt, den wir „vom Zarismus übernommen und nur ganz leicht mit Sowjetöl gesalbt haben“ (LW 36/572, 590). Der Weg der NÖP wurde bald abgebrochen. Die drohende Intervention, die letzte lag erst 10 Jahre zurück, die Kulakenstreiks, die Kulturlosigkeit und fehlende Rechtsstaatlichkeit im Verein mit Charaktereigenschaften Stalins machten die sich dann entwickelnde exzessive Herrschaft der Bürokratie schrittweise unvermeidlich. Der neue Anlauf nach 1945, volksdemokratischer Weg, XX. Parteitag der KPdSU, Demokratisierungsversuche und neue ökonomische Systeme brachte grundlegende Verbesserungen. Der entscheidende Kampf wurde auf dem Feld der wissenschaftlich-technischen Revolution ausgefochten und ging verloren. Die sozialistischen Staaten Europas hatten sich vor allem durch den Rüstungswettlauf und die Unfähigkeit zu strukturellen Reformen immer mehr den Gesetzen des Weltmarktes untergeordnet, ohne der Konkurrenz des Westens standhalten zu können. Jedenfalls zwei Thesen von Marx sollten wir jetzt für historisch widerlegt ansehen. Das betrifft einmal das rasche Fortwerfen der politischen Hülle nach der siegreichen proletarischen Revolution. Der Verlauf des „großen Ausbruchs“ gab kaum Anhaltspunkte für die Herausbildung eines Staates „im nicht eigentlichen Sinne“. An die Stelle der vom Privateigentum hervorgebrachten Übel waren andere getreten, die mit der Übermacht des Staates verbunden waren. Der Staat ist nicht minder zählebig als die Gesetze des Marktes. Selbst Ernest Mandel schrieb: „In letzter Instanz kann das Problem nur dann richtig gestellt und gelöst werden, wenn die vereinfachende Gegenüberstellung von <schwarz> (Bürokratisierung) und <weiß> (Selbstherrschaft der Arbeiter) ersetzt wird durch ein dialektisches Verständnis“ (Geld und Macht, Köln 2000 S. 104). Wir sollten uns wohl für die absehbare Zukunft von dem Ziel einer Gesellschaft ohne Macht und Herrschaft verabschieden, wie es im Marxschen Modell der Pariser Kommune formuliert worden war, aber neu über Demokratisierung nachdenken. Widerlegt sind zweitens die Annahmen von Marx und Engels von der sich ständig verstärkenden Zentralisierung des bürgerlichen Staates und die damit verbundene Auffassung, dass es keine demokratischen Verbesserungen geben könne, aber auch die Vorstellung Bernsteins und Kautskys von der ständigen Entwicklung der Demokratie. Erst nach 1945 entwickelte sich erstmals für eine längere Periode eine in bestimmtem Umfang auf Integration zielende Staatsmacht in Gestalt der bürgerlichen repräsenta- Marxistisches Forum 48 tiven Demokratie. Das war dem Scheitern des Faschismus, den Kämpfen der linken Bewegung, der Entwicklung des Wohlfahrtsstaates, aber auch der Systemkonkurrenz geschuldet. Gegenwärtig ist die Chance möglicher Gegenkräfte in den kapitalistischen Metropolen nicht groß. Wenn der parlamentarische Kampf nicht mit einer kräftigen außerparlamentarischen Bewegung verbunden ist, dann besteht die große Gefahr, dass jeder Zuwachs an echter oder scheinbarer Macht in den bestehenden Strukturen zu einem Verlust an linker Kraft und schließlich zur völligen Selbstaufgabe. führt. Auch die Regierungsbeteiligungen der PDS zeugen von dieser Problematik. Die innerimpialistischen Widersprüche können, wie die letzten Jahre zeigen, eine bestimmte Einschränkung USamerikanischer Ambitionen bewirken, eine prinzipiell andere Politik nicht herbeiführen. Der internationale Hauptgegensatz aber ist heute der Nord-Süd- Gegensatz, der durch die kapitalistische Globalisierung vertieft wird. Marx und Engels hatten seiner Zeit alles auf das Proletariat und zwar auf das Proletariat der führenden Industriestaaten gesetzt. Lenin sah das schon erheblich differenzierter, bezog die Widersprüche zwischen diesen Staaten und den Ausgebeuteten und Unterdrückten in den Kolonien, ja sogar der dortigen Bourgeoisie mit ein. In der Welt wächst das Proletariat weiterhin. Gleichzeitig ist die Reduzierung auf eine einzige Gegenkraft fast immer unzulässig. Der islamische Fundamentalismus ist auch ein Produkt der weltweiten neoliberalen Offensive. Es gibt eine Vielzahl sogenannter Nichtregierungsorganisationen, die sich gegen die kapitalistische Globalisierung wenden. Von erheblichem Gewicht bleiben die Nationalstaaten. Vor allem der Krieg gegen den Irak hat deutlich gemacht, mit welchem Argwohn die staatliche Etablierung von Gegenkräften betrachtet wird. Die ständig überarbeitete Liste von Schurkenstaaten ist dafür ein deutliches Indiz Dazu gehört Kuba oder das Bündnis von Militär und Armen in Venezuela unter Hugo Chávez. Die langfristige Besorgnis der USA aber richtet sich auf Rußland und noch stärker auf China. Die geschichtliche Entwicklung des Sozialismus lehrt uns, die Gefahren, die von einer Übermacht des Staates ausgehen können, nicht zu unterschätzen. Andererseits ist und bleibt der Staat, neben - seltenen - unmittelbaren Massenaktionen die einzige Kraft, die sich dem ungebrochenen Wirken der ökonomischen Gesetze entgegen zu stellen vermag. Noch wird vor allem auf ökonomische Kraft und militärische Lösung gesetzt. Auf die Dauer aber wird mit diesen Methoden der sich vertiefende Konflikt zwischen den USA sowie ihren Verbündeten und den „Barbarenvölkern“ (Zbigniew Brzezinski) nicht zu lösen sein. Früher oder später wird der Druck auf eine andere Lösung, vor allem auf die Herstellung einer neuen Weltwirtschaftsordnung so zunehmen, dass der Norden über eine grundlegende Wende nachzudenken gezwungen sei wird. Dann kann es allerdings schon zu spät sein. Ich habe hier ein Angebot gemacht. Nicht der Kampf bis aufs blutige oder ideologische Messer, nur der Streit um Analysen kann noch Hoffnung geben. Peter Kroh Interessen sozialer Akteure und Entwicklung von Gegenmacht 10 Anmerkungen zum Thema „Möglichkeiten politischer Gegenmacht heute“ 1. „Die ökonomischen Verhältnisse einer gegebenen Gesellschaft stellen sich zunächst dar als In-teressen“1, sagt Engels. Gesellschaftliche Verhältnisse entstehen und bestehen nur dadurch, dass Menschen sich verhalten. Verhältnisse sind geronnenes Verhalten. Um das Verhalten sozialer Akteure zu verstehen, muss man Interessen aufdecken. 2. Machen wir dreifach die Probe: Zum ersten: Welches Verhalten legten die Metall-Unternehmer in der jüngsten Tarifauseinandersetzung Anfang 2004 an den Tag? Sie forderten 5 zusätzliche, unbezahlte Arbeitsstunden. Darin ist das Interesse erkennbar: Es ist gut für den Profit, (d.h. für uns, wenn der stets erzielbare relative um den absoluten Mehrwert ergänzt werden kann. Gibt es leider im Moment ein wirtschaftliches Nullwachstum, dann wird unser Profit eben dadurch wachsen, dass Löhne und Gehälter sinken und Sozialeistungen gekürzt werden. [Für die Bewertung wichtig: 5 unbezahlte Stunden Mehrarbeit entsprechen (bei einer 35-h-Woche =100%) einer Lohnkürzung von 14,3 %.] Wie verhielt sich die (potentielle) „Gegenmacht“ in der Tarifauseinandersetzung? Die Gewerkschaftler forderten nicht die 30-h-Woche, sondern „einen Lohn, der zum Leben reicht“. Das dahinter stehende Interesse: Als Partner im Bündnis für Arbeit dürfen/ können wir nichts fordern, was die Verwertungsbedingungen des Kapitals entscheidend schmälert. Das Ergebnis: 2,2 % Lohnsteigerung zum 1.3.2004 und noch mal 2,7% zum 1.3. 2005. Davon gehen jeweils 0,7 % in die so genannte ERA-Strukturkomponente (Angleichung der Entgelte von Arbeitern und Angestellten). [Für die Bewertung wichtig: Die reale Steigerung beträgt 1 F. Engels: Zur Wohnungsfrage. In: MEW, Bd. 18, S.274 Uwe-Jens Heuer 13 1,5 bzw. 2%. Sie wird schon von erhöhten Zuzahlungen im Gesundheitswesen mehr als aufgefressen.] Fazit: Gewerkschaften, die so agieren, fallen als reale Gegenmacht nicht ins Gewicht. Sie werden dann wieder Teil einer auf die Verschiebung des politischen Kräfteverhältnisses gerichteten Gegenmacht sein, wenn sie die Interessen ihrer Mitglieder unverfälscht aufnehmen und um deren Durchsetzung kämpfen. Zum zweiten: Die AGENDA 2010 ist der Verhaltenskodex der Bundesregierung. Sie regelt Rentenkürzung für jetzige Rentner, Rentenabschaffung für die heutige junge Generation, verstetigt die Massenarbeitslosigkeit, macht Zwangsarbeit zur Norm, reduziert das Weihnachtsgeld, erhöht die Zuzahlungen bei gekürzten Gesundheitsleistungen, kürzt das Arbeitslosengeld für die auf der einen Seite der Gesellschaft und sichert Steuergeschenke für die andere Seite, für die Konzerne, Versicherungen und Banken. Welche Interessen entäußern sich in diesem Verhalten? Ungeachtet einer - bei den Akteuren dieser Politik auch individuell geprägten - Vielzahl von Interessen läßt sich herausheben: Damit wir die Regierenden bleiben, ist die Bevorzugung der Interessen der (wenigen) Mächtigen vor den Interessen des Gemeinwohls, den Interessen der (vielen) lohn- und gehaltsabhängig Beschäftigten geboten. Fazit: Politiker einer Sozialdemokratischen Partei, die so agieren, schalten die Partei insgesamt als Akteur von Gegenmacht aus. Die SPD wird dann wieder Teil einer auf die Verschiebung des politischen Kräfteverhältnisses gerichteten Gegenmacht sein, wenn sie die Traditionen von Bebel, Liebknecht, Luxemburg für wichtiger nimmt als die Interessen des Kapitals. Zum dritten: Der SPD/PDS-Senat in Berlin will Mitbestimmung der Personalvertretungen bei außerordentlichen Kündigungen abschaffen. Die Rot-Roten setzen in Berlin Kürzungs- (Sozial-Ticket, Blindengeld, Telebus) und Privatisierungspolitik radikal durch. Der Berliner DoppelHaushalt beinhaltet tiefe Einschnitte in die soziale Infrastruktur der Stadt, die erst sukzessive spürbar werden. Rot-Rot in Berlin drängt die Beschäftigten in den landeseigenen Krankenhäusern- bei Androhung ihrer Privatisierung - und bei der BVG zum Lohnverzicht in Höhe von bis zu 30 Prozent. Die SPD/PDS-Regierung in M-V stellte jüngst Landesbedienstete vor die Alter-native „15%Lohnverzicht oder betriebsbedingte Kündigung“. In all dem steckt objektiv - das heißt , unabhängig davon, ob PDS-Minister/Senatoren und -Abgeordnete das wissen, wollen oder auch nur wahr haben wollen - das Interesse :Wir räumen dem marktwirtschaftlichen Wettbewerb und der betriebswirtschaftlichen Rationalität eine höhere Priorität ein als den Interessen der Beschäftigten und den Werten und Zielen der Partei. Fazit: Objektiv ist auch die PDS in Regierungsverantwortung Element des Systems. Sie kann sich (kaum bis gar) nicht als Teil von Gegenmacht politisch artikulieren und profilieren. Sie wird wohl dann wieder vollständig (Mit)Subjekt zur Schaffung von Gegenmacht werden, wenn sie ihre strategische Orientierung weniger von Wahlarithmetik als von einer realistischen Analyse der Interessen sozialer Akteure leiten läßt. 3. Alle drei Beispiele zeigen, es geht stets um alternative Interessen. - entweder mehr Profit oder mehr Lohn; - entweder für die Mehrheit der lohn- und gehaltsabhängig Beschäftigten oder für die Reichen dieser Gesellschaft; - entweder Stärkung der Selbstbestimmung oder der Ohnmacht der Menschen; - entweder Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum oder Ausgrenzung davon; - entweder Mündigkeit oder Einflusslosigkeit der Massen; - entweder die Wirtschaft als Mittel für gesellschaftliche Zwecke oder als Profitsteigerungs-mittel für die Privatbesitzer von Produktionsmitteln . 4. Nichts demonstriert so klar die Untauglichkeit des jetzigen Wirtschaftssystems für die Lösung menschlicher Probleme wie der schreiende Widerspruch, dass die Bundesrepublik wegen 6 Millionen Beschäftigter mit Niedriglöhnen, aufgrund von (offiziell gezählten) 4,6 Millionen Arbeitslosen sowie infolge der Deindustrialisierung im Osten Jahr für Jahr Exportweltmeister ist. Immer deutlicher wird: Der Sozialstaat war nie Gegensatz zur Marktwirtschaft, sondern immer nur Zusatz, zeitlich und räumlich begrenzt. 5. Die Interessen der Mächtigen und Herrschenden werden so rigoros wie nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik durch die Regierung erfüllt. Die Interessen der Ohnmächtigen und Beherrschten werden erst vernachlässigt, dann unterdrückt. Die einen setzen ihre ökonomischen Interessen auch politisch durch und sind deshalb Macht. Die anderen werden nur zur Gegenmacht, wenn sie ihre Interessen ebenfalls politisch artikulieren. Anzunehmen, die Interessen der einen ließen sich mit den Interessen der anderen auf einen Nenner bringen, ist contrafaktisch gedacht. Darauf basierende Politik ist contrarealistisch. Denn: „Die 'Idee' blamierte sich immer, soweit sie von dem 'Interesse' unterschieden war.“2 . Gegenmacht ist von denen nicht zu erreichen, die ein guter Verwalter der kapitalistischen Geschäftsordnung sein wollen. 6. Das Maß der Kritik am Kapitalismus und das Tempo des Veränderns der Gesellschaft durch die Mächtigen und Regierenden müssen sich zueinander verhalten wie kommunizierende Röhren, wenn aus der Notwendigkeit und Möglichkeit einer Gegenmacht eine Wirklichkeit werden soll. Das können Parteien nicht leisten. Deshalb werden es m.E. basisdemokratische Bewegungen sein, von denen eine wirkliche Änderung der Zustände ausgeht. Nur sie gehen den Weg vom Protest zum Widerstand konsequent. 2 Friedrich Engels und Karl Marx: Die heilige Familie. In MEW, Band 2, S.85 14 Marxistisches Forum 48/2004 Nur sie lehnen konsequent ab, das gesamte Leben des einzelnen wie der Gesellschaft zu ökonomisieren. Die Parteien können das nicht leisten, denn sie sind alle (mal weniger, häufiger mehr) ins System eingebunden. Ihre Entscheidungen sind zu-nehmend bürgerfern. Die parlamentarischen Rechte wurden zudem langfristig ausgehöhlt. Auch mit direkter Demokratie, z.B. mit Volksentscheiden, die nach allen Landesverfassungen in der BRD möglich sind, wird es keine qualitative Veränderung der Verhältnisse geben. Die konkreten Paragraphen sind eher Verhinderungs- Direktiven (hohe Quoren, administrativ-bürokratische Hürden zur Ingangsetzung, zu viele AusschlussGründe). 7. Realistische erste Schritte für die Gewinnung neuer Möglichkeiten politischer Gegenmacht sind deshalb das Praktizieren von vielfältigen Formen des zivilen Ungehorsams. Es ist nicht länger zuzulassen, dass vermeintliche Sachzwänge (das sind von Menschen getroffene Entscheidungen!) Millionen daran hindern, menschenwürdig zu leben. Wo uns Unzumutbares zugemutet wird, ob im Rathaus, am Arbeitsplatz, auf dem Sozialamt - lehnen wir es ab und reden laut darüber. Auf der Kundgebung am 3.4.2004 in Köln war von einem der Vertreter einer Bewegung der Satz zu hören: „Wie kann jemand Mensch sein wollen und nicht Antikapitalist sein?“ Es muß der Nerv der Macht getroffen werden, wenn Gegenmacht sich konstituieren soll. 8. An Gegenmacht Interessierte müssen raustreten aus den Schatten der Sachzwänge. Ausmaß und Kraft von Gegenmacht sind abhängig , wie zum einen deutlich und klar benannt wird , was wirklich passiert und zum anderen tabulos, phantasievoll und in vielfältigen Aktionen die Einhaltung des Grundgesetzes und der sozialen Menschenrechte gefordert wird. Gegenmacht wird nur Wirklichkeit, wenn soziale Akteure die Kraft und den Mut haben, die Prinzip-Frage zu stellen. Solange die Fetische der kapitalistischen Verhältnisse und die darin liegenden Interessen unberührt bleiben, stehen nicht politische und soziale Alternativen, sondern die weitere Reduzierung sozialer Standards auf der Tagesordnung. Für die Konstituierung von Gegenmacht ist auch unverbindliche Systemschelte nicht hilfreich. Nicht bittende Demut oder liebevoller Diskurs führt uns näher ans Ziel einer Gegenmacht, sondern die entschieden begründete Möglichkeit und Notwendigkeit der Alternative. 9.Gegenmacht muß mit ihren Alternativen im Alltag ansetzen, aber keine punktuelle Reparatur der Zustände Peter Kroh sein, sondern helfen, die Logik der Konkurrenz, der Unterwerfung, der Entfremdung zu überwinden. Nicht der Sozialstaat ist einzudampfen, sondern die Wirtschaftsziele sind neu zu begründen. An die Stelle der totalitären, alles in Geld bezifferbaren Verwertbarkeitskalkulation ist ein absoluter Bruch mit der asozialen Impertinenz der radikal-kapitalistischen Wirtschaftspolitik erforderlich. Es ist heute mehr denn je notwendig, Möglichkeiten von Gegenmacht jenseits von Profitgeilheit, Kriegslüsternheit, sozialer Kälte und Massenverblödungsindustrie zu suchen. Dem stehen „lediglich“ die Interessen einer gesellschaftlichen Minderheit von Profit-orientierten im Wege. Fordern wir z.B. tabulos und phantasievoll die Einhaltung und Gewährleistung der Bürger- und sozialen Menschenrechte auf ein Leben, dass die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sichert. Möglich ist das durch eine solidarische Ökonomie und politische Vorgaben an die Wirtschaft. Nur solche und andere basisdemokratische Ansätze können und werden die kapitalistische Expertenund Stellvertreterpolitik (und ihre Funktion als „Türöffner“ der so genannten Realpolitik mit ihren „Sachzwängen“) überwinden. 10. Die Mächtigen und Regierenden fordern bekanntlich dazu auf, bei Wahlen die Stimme abzugeben. Gegenmacht könnte da anfangen, wo Menschen die eigene Stimme erheben, sich ihre eigenen sozialen Verhältnisse praktischgegenständlich aneignen und so vermenschlichen. Das ist der wesentliche politische und strategische Unterschied zwischen Macht und Gegenmacht. Wer für die Entwicklung letzterer radikal politisch denkt, der steht vor einem doppelten Auftrag: Zum einen: wir lassen uns darauf ein, - als Menschen und politische Subjekte jetzt und hier - uns zu den bestehenden Verhältnissen praktisch-politisch zu verhalten. Die radikal-kritische Haltung darf und kann sich nicht als illusorische Weltflucht äußern. Vielmehr ist unermüdlich danach zu suchen, was zu tun ist, um politisch handlungsfähig zu bleiben bzw. zu werden und Menschen erniedrigende Umstände zu verändern. Zum anderen: mit dem elementaren Gegensatz zu den herrschenden Verhältnissen ist konsequent Ernst zu machen, weil nur so die Chance zu gewinnen ist, aus unübersehbaren Notwendigkeiten und durchaus vorhandenen Möglichkeiten eine neue Wirklichkeit zu gewinnen. Gegenmacht entsteht langsam und widersprüchlich - durch Suche, also durch Zweifel, d.h. durch das für möglich gehaltene Gegenteil von dem, was ist; prinzipiell also durch das Hinausdenken über das Bestehende. 15 Heinz Niemann Ein Begriff wird wieder modern: Gegenmacht Man kann nicht wissen, ob Galbraith, als er den Begriff der Gegenmacht in den Diskurs einbrachte, dabei Gramcis wesentlich produktiveren Begriff der „geistig-kulturellen Hegemonie“ im Hinterkopf hatte. Gemeint sind von beiden auf jeden Fall wesentlich unterschiedliche gesellschaftliche Erscheinungen. Während Galbraith darunter lediglich die Gewerkschaften als Widerpart gegenüber den Unternehmern verstand, die er als Gegenmacht im akzeptierten Verbandspluralismus des modernen kapitalistischen Industriestaates definierte, war Gramcis Hegemonie-Konzept als eine wesentliche Vorraussetzung und Bedingung einer durch Gegenmacht bewirkten gesellschaftlichen Umwälzung angelegt. Bei späteren westlichen Linken wurde der Begriff immerhin in Zusammenhang mit „systemüberwindenden Reformen“ gebracht. Ein solcher Zusammenhang geht sicher noch weiter. Mit dem Hegemonie-Konzept dürfte die wesentlichste Anforderung benannt sein, die man an die sich gegenwärtig vollziehende gesellschaftliche Protestbewegung stellen müsste, wenn man sie als gesellschaftspolitische Gegenmacht ansehen wollte bzw. sie das werden will: ihre Politik und alle ihre Aktivitäten so gestalten, dass sie zur Erringung einer solchen geistig-kulturellen Hegemonie führen bzw. beitragen. Politische und parlamentarische Mehrheiten - und ich setze hier die Existenz eines bürgerlich-demokratischen Verfassungsstaates voraus - sind ganz offensichtlich nicht zu erringen, wenn sie nicht von einer gesellschaftlichen Mehrheit getragen würden, die ohne Dominanz im Zeitgeist kaum zu haben sein dürfte. Der Vertreter von ATTAC hat völlig zutreffend auf die Frage, worin denn der Grundkonsens dieser Bewegung bestehe, geantwortet: In der Ablehnung des neoliberalen Kurses und der monopolkapitalistischen Form der Globalisierung. Dazu käme dann noch die Ablehnung der Parteiform für diese Bewegung. Beides entspricht dem gegenwärtigen Selbstverständnis, ist aber unzureichend. Offensichtlich gibt es ein hohes Maß an Spontaneität, an moralischer Empörung, die sich um eine essentielle Grundidee - „Gegenmacht“ - entfaltet, und beim Herantasten an die Formierung eines nicht parteiförmigen „Wählerbündnisses“. Kämen noch eine charismatische Führerfigur hinzu, ein Lied wie eine Hymne und ein Schlachtruf (Wir sind das Volk!) - dann könnte sich eine gesellschaftliche Massenbewegung beträchtlichen Ausmaßes entfalten, die Strasse beherrschen und selbst die neoliberale Dominanz in den bürgerlichen Medien zurückdrängen. Bis sich die Bewegung erschöpft haben dürfte, weil zwei unverzichtbare Dinge fehlten: das Programm, wofür man kämpft, weil es auf Dauer nicht trägt, nur gegen etwas zu sein. „Weg mit Schröder“ ! Und dann? „Arbeit für alle“! Aber wie? Es ist mithin zum ersten notwendig, dass sich die spontane gesellschaftliche Bewegung mit gleichgesinnten institutionalisierten, politisch organisierten Mächten verbündet. Dies sogar, wenn sie sich selbst irgendwann dazu 16 durchringen sollte, sich auch in Parteiform zu organisieren. Dagegen scheint zu sprechen, dass die Entwicklung von der plebiszitären zur Parteiendemokratie die jüngere Geschichte aller westlichen Verfassungsstaaten bestimmt. Parteiendemokratie ist - neben der meist weitgehenden Verweigerung von allen Formen der direkten Demokratie - dadurch geprägt, dass der Wille der jeweiligen Parteienmehrheit nicht nur die Politik der durch sie gebildeten Regierung bestimmt, sondern zugleich als Gesamtwille des Volkes ausgegeben wird. Über direkten oder indirekten Fraktionszwang wird darüber hinaus das Parlament unter den so erzeugten Gesamtwillen gepresst. Es wird zum Schauplatz von Scheingefechten degradiert, denn die Funktion als Kontrollorgan der Regierung entfällt weitgehend, da die Abgeordneten als Mehrheitsbeschaffer der Regierung fungieren, erst jüngst durch „Machtworte des Kanzler“ demonstriert. Die Doppelfunktion vieler Mandatare als Abgeordneter und Regierungsmitglied unterläuft zudem das Prinzip der Gewaltenteilung. Die Funktion der Opposition als Kontrollinstanz und Regulator ist außerdem oft dadurch beschränkt, dass sich die Oppositionsparteien auch nur als Regierungsparteien im Wartestand verstehen. So verständlich die Ablehnung des Parteiensystems angesichts dessen ist, so naiv ist die Hoffnung, ein moderner bürgerlicher Verfassungsstaat könne ohne konkurrierendes Parteiensystem funktionieren, solange das bestehende privatkapitalistische Wirtschaftssystem die Existenz widerstreitender Interessengruppen bedingt. Der meist rein emotionalen Ablehnung parteiförmiger Strukturen liegt offenbar ein Missverständnis zugrunde. Der Zwang, sich im bestehenden System an der Willensbildung in den jeweiligen Formen und Institutionen beteiligen zu müssen, wird als unvereinbar mit der Wahrnehmung einer stringenten Oppositionsrolle betrachtet. Das ist insofern verständlich, als die Geschichte des bundesdeutschen Parlamentarismus im Prinzip keine Beispiele liefert, wo eine radikal-demokratische und systemkritische Opposition nachweisbaren Einfluss auf diesen politischen Willensbildungsprozess genommen hätte. Die Assimilationskräfte des bestehenden Parteiensystems - an den Grünen neuerlich zu studieren - sind erheblich, und auch die PDS ist spätestens 1998 ihr Opfer geworden. („Schröder verhindern“) Dass sich 2004 eine linke Bewegung rebellierender Sozialdemokraten, Gewerkschaftler und Sozialisten neben, und zwar „links“ und in Abwehr zur PDS entfaltet, ist wie eine Bankrotterklärung für diese Führung. Wieder einmal, wie schon mehrfach in Frankreich, Italien oder in Skandinavien versucht, schlägt eine Politik des Mitregierens unter dem Banner des „kleineren Übels“ auf die traditionelle Linke zurück. Hinzu kommen einige sehr praktische Fakten: Große politische Vereinigungen kommen nicht ohne Repräsentations- und Organisationsformen aus. Sie brauchen zumal in der existierenden Mediendemokratie Geld und Öffent- Marxistisches Forum 48/2004 lichkeitspräsenz. Ihr Funktionieren benötigt zudem bestimmte qualifizierte Funktions- und Amtsinhaber, die alsbald Nutznießer einer hierarchisch gegliederten Privilegienstruktur werden. Die Geschichte der größten Partei der deutschen Arbeiterbewegung ist zugleich eine Geschichte der Verbürokratisierung und der Etablierung einer verbürgerlichten Funktionärskaste als hierarchische Führungsschicht der Partei, die immer wieder mal zu einem Krisenfaktor geworden ist. Ich erfahre im Landtagswahlkampf in Brandenburg, wie durch die verschiedenen Bürger- und Wählerinitiativen, die zur Landtagswahl antreten werden, die Weigerung schon gar nicht mit der SPD, aber auch nicht mit der PDS zusammenzugehen, genau mit dieser Argumentation begründet wurde und wird. „Wir wählen nicht noch einmal immer dieselben Bonzen“! Jedes Gerangel um Diätenträchtige Listenplätze wird hämisch kommentiert, (was nicht davor bewahrt, es dann ähnlich zu betreiben.) Es war ein Aha-Erlebnis, als die ebenfalls um eine Listenvereinigung ringenden GRAUEN PANTHER darauf verweisen konnten, dass ihre Satzung möglichen Mandatsinhabern auferlegt, ihre nicht amtsbedingt verbrauchten Nettodiäten an die Parteikasse abzuführen. Übrigens wäre es auch eine der bewahrenswerten KPD-Traditionen, deren Abgeordnete nur einen sehr knapp bemessenen Anteil ihrer Diäten per Beschluss behalten durften. Man lebte für die Politik, aber nicht von ihr. Man unterschätze solche sekundären Probleme nicht, sie gehörten zu einer Parteireform, die m.E. eine unverzichtbare Voraussetzung wäre, wenn die PDS zu einem der institutionalisierten Bündnispartner der Bewegung werden will. Wesentlicher ist sicher die zweite Frage, welches positive Programm, welches zukunftsträchtige Konzept braucht eine solche Bewegung und welche Verantwortung hätte eine linke Opposition wahrzunehmen?! Ohne hier auf einzelne Programmelemente eingehen zu wollen, wären drei grundlegende Aspekte zu beachten. Erstens müsste begriffen und praktiziert werden, dass eine linke systemkritische Partei per se zur Opposition berufen, zur stringenten Alternative verdammt ist. Die Geschichte beweist, dass aus der Opposition mehr reale progressive Reformen erkämpft werden konnten als durch Koalitionen oder andere Formen des Mitregierens. Politik ist in ihrem Kern auf Macht, Regierungsmacht gerichtet, und so muss auch eine linke Partei die Regierung anstreben, aber niemals das „Mit-Regieren“ in einem bürgerlichen Bündnis. (Nur ein Mehrheitsbeschafferin wie die FDP gerät dabei nicht dauerhaft unter die Räder.) Sich auf stringente Oppositions- und Protestpolitik einzustellen ist zweifellos noch keine Garantie, bereits in den nächsten Bundestag einzuziehen, weder für die einen wie für die anderen. Aber es könnte so die sozialistische Identität der PDS, ihre Lebens- und Bündnisfähigkeit - zu mindestens im Osten - gerettet werden. Ihre spezifische Verantwortung und Rolle müsste in der Ausarbeitung eines marxistisch begründeten Programms für die gesamte Bewegung sein. Gerade für eine weltanschaulich pluralistische Partei ist die Bewahrung der historisch-materialistisch begründeten Zielvorstellung Heinz Niemann einer anderen, gerechteren Gesellschaft eine Lebensfrage. Es gibt kein Beispiel in der Welt, dass eine linke Partei ihren Charakter als sozialistische Programmpartei bewahrt hätte, nachdem sie sich von der marxistischen Gesellschaftstheorie losgesagt hatte. Es gibt kein Beispiel einer sozialistischen/kommunistischen Partei, welche ihren gesellschaftlichen und parlamentarischen Einfluss und politische Stärke vergrößert hätte, nachdem sie ihre antikapitalistische Systemopposition durch pragmatische Tagespolitik ersetzt hatte. Was es gibt ist der Zerfall solcher Massenparteien wie der IKP oder FKP u.a., auch wenn sie dafür als Erfüllungsgehilfen zeitweilig am Regierungstisch Platz nehmen durften. U-J. Heuer hat gerade in seinem Buch „Marxismus und Politik“ einen verdienstvollen Versuch vorgelegt, wo er die Unverzichtbarkeit marxistischer Theorie und Methode und sozialistischer Weltanschauung für die Politik einer linken Partei begründet.) Es wäre das gesamte Agieren auf die Erkämpfung der oben genannten „geistig-kulturellen Hegemonie“ in der Gesellschaft auszurichten. Gesellschaftliche Gegenmacht und parlamentarische Opposition gemeinsam müssten die zwei Standbeine der Bewegung bilden. Die andere Seite derselben Verantwortung wäre durch die Partei der sozialistischen Linken mit der Ausarbeitung eines konkreten alltagstauglichen und zugleich zukunftsweisenden Konzeptes einer gesellschaftlichen Umwälzung wahrzunehmen. (Damit wird weder der weltanschauliche Pluralismus der Linken hinsichtlich ihrer persönlichen Motive, sich als Sozialisten zu verstehen, infrage gestellt noch ignoriert, dass es einen den unterschiedlichen Bedingungen in der Welt entsprechenden pluralen Marxismus geben muss.) Kernstück müsste ein wirtschaftspolitisches Konzept sein, welches von den grundlegenden Erkenntnissen ausgeht, die Marx schon in den „Theorien über den Mehrwert“ analysiert und dargestellt hat. Wenn es um die „Grenzen“ des globalisierten Kapitalismus, seine inneren Widersprüche geht, von deren Existenz und Wirkungsweise letztlich die Ausrichtung und Zielorientiertheit wirklich sozialistischer Politik abhängt, muss man dem Wesen der „Naturgesetzlichkeit“ des modernen Kapitalismus auf der Spur bleiben. Marx hat vor 150 Jahren die ökonomischen Triebkräfte heutiger Globalisierung, der Ursachen von dauerhafter Massenarbeitslosigkeit, Niedriglohndruck, Shareholder Values, wachsender Armut und des ganzen ideologischen Spuks der Neoliberalismus aufgedeckt: „In dem Maße (aber), wie die große Industrie sich entwickelt, wird die Schöpfung des wirklichen Reichtums abhängig weniger von der Arbeitszeit und dem Quantum angewandter Arbeit, als von der Macht der Agenzien, die während der Arbeitszeit in Bewegung gesetzt werden und die selbst wieder - deren powerfull effectiveness - in keinem Verhältnis steht zur unmittelbaren Arbeitszeit, die ihre Produktion kostet, sondern vielmehr abhängt vom allgemeinen Stand der Wissenschaft und dem Fortschritt der Technologie, oder der Anwendung dieser Wissenschaft auf die Produktion.“ (MEW, Bd. 42, S.600) Hier steckt die Antwort auf die Frage, wieso einerseits bald nur noch 20 Prozent der arbeitsfähigen Bevölkerung weltweit 17 gebraucht werden, dauerhafte Massenarbeitslosigkeit „naturgesetzlich“ wird und der Wert der Ware Arbeitskraft sinkt, trotzdem die scheinbar irre Idee der Arbeitszeitverlängerung herumspukt usw. Allen Illusionen über die „Zurückdrängung der Profitlogik“ sind klare gesellschaftlich bedingte Grenzen gewiesen. Will eine anti-kapitalistische und Anti-Globalisierungsbewegung ein realistisches Wirtschaftskonzept ausarbeiten, muss sie sowohl den Kampf um die gesellschaftliche demokratische Verfügungsgewalt über Produktion und Verteilung (Wirtschaftsdemokratie) begründen als auch die Eigentumsfra- ge stellen. Radikale Arbeitszeitverkürzung, Verbot von Überstunden und Kinderarbeit, Finanzierung gesellschaftlich nützlicher Arbeit in den großen „Not-Profit-Bereichen“ und gesetzlicher garantierter Mindestlohn wären verständliche und populäre Forderungen, die im direkten Gegensatz zur „naturgesetzlichen“ Logik der Ökonomie stehen und deshalb nur politischen Kampf gegen die Herrschaft des Monopolkapitals durchsetzbar wären und letztlich wieder sehr wahrscheinlich an die Eigentumsfrage heranführen würde. Horst Trapp Gegenkräfte bündeln Zum Perspektivenkongress Der Perspektivenkongress "Es geht auch anders! Perspektiven für eine andere Politik" tagte vom 14. bis 16. April in der TU Berlin. Veranstalter war ein Spektrum von 70 Träger- und Unterstützerorganisation aus Gewerkschaften, Sozialverbänden, kirchlichen Gruppen, Friedensorganisationen, Erwerbsloseninitiativen und attac. An den 125 Podiumsdiskussionen, Foren und Workshops beteiligten sich 250 Referenten und Moderatoren aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Mit etwa 2.000 Teilnehmern war der Kongress gut besucht, was auf das wachsende Bedürfnis zurückgeführt werden kann, nach Alternativen zur herrschenden neoliberalen Politik zu suchen. Nach den europaweiten Demonstrationen vom 3. April war der Kongress als weiteren Schritt gedacht, um Gewerkschaften, Verbände, kirchliche Gruppen und viele andere zur Verteidigung sozialer Errungenschaften und zur Wiederbelebung emanzipatorischer Politik zusammenzubringen. Gewerkschaften und soziale Bewegungen gingen unvoreingenommen aufeinander zu und diskutierten miteinander. Kontakte gab es schon länger. Sie kamen erstmals bei der Vorbereitung und Durchführung des Europäischen Aktionstags gegen Sozialabbau zum Tragen. Zwar hakte es hier und da noch, zwar gab es im Nachhinein die Beschwerde, die Partner der Gewerkschaften wären bei den Auftritten in Berlin, Stuttgart und Köln nicht gleichberechtigt behandelt worden, aber insgesamt gab es eine positive Beurteilung dieses ersten großen Mobilisierungserfolgs gegen die Angriffe auf soziale Besitzstände. Vorausgegangen war die Demonstration am 1. November 2003 mit 100.000 Teilnehmern, die nur von Teilen der Gewerkschaften unterstützt wurde, weil die negativen Mobilisierungserfahrungen des 24. Mai 2003 vielen demonstrationsbereiten Gewerkschaftern noch in den Knochen saß. Aus heutiger Sicht lässt sich sagen, dass damals die Auswirkungen des Sozialabbaus noch nicht so klar erkennbar waren, und viele einfach nicht glauben mochten, dass "ihre" Regierung so mit ihnen verfahren würde. Sicherlich spielte auch die Unsicherheit darüber eine Rolle, ob die Gewerkschaften eine regierungskritische Auseinandersetzung wirklich wagen würden. 18 Nun sind die Zeiten anders. Der Shareholder-Kapitalismus lässt eine Rückkehr zu einer kooperativen Gewerkschaftspolitik nicht mehr zu. Also muss grundlegend umgedacht werden. Ein neues Bewusstsein bildet sich heraus, wonach eigene gewerkschaftliche Kraftanstrengungen unerlässlich sind. Und nun der Perspektivenkongress. Die unterstützenden Gewerkschaften nahmen ganz offiziell als Organisation an dieser gemeinsamen Veranstaltung teil, was durch die Mitwirkung der Gewerkschaftsvorsitzenden Frank Bsirske, ver.di, Jürgen Peters, IG Metall, Klaus Wiesehügel, BAU und Eva-Marie Stange, GEW unterstrichen wurde. Bewusst wurde für den Kongress eine Arbeitsform übernommen, die das Weltsozialforum in Porto Alegre entwickelt hat, und die beim Europäischen Sozialforum erfolgreich war. Dabei bringen gesellschaftliche Gruppen ihre Beiträge in selbst verantworteten Veranstaltungen ein. Die zentralen Punkte der gegenwärtigen Auseinandersetzungen wie Wege zur Beschäftigung, Finanzierung des Sozialstaates, existenzsichernde Arbeit, Demokratie, Bildung und Wissen, Umwelt, öffentliche Güter sowie Krieg und Frieden wurden ausgiebig diskutiert. Am Ende des Kongresses stand eine Verabredung über das weitere gemeinsame Vorgehen. Dabei zeigte sich, dass die Konkretisierung des Vorgehens nicht so einfach ist. Während des Kongresses überwogen die Gemeinsamkeiten. Ein wesentliches Ziel war, wie es nach dem 3. April weitergehen soll, wie die in Ansätzen erreichte Bewegung gegen die herrschende Politik der Unterwerfung der Gesellschaft unter die Logik des Marktes erhalten und weiter ausgebaut werden soll. Neben der Analyse von politischen und wirtschaftlichen Zusammenhängen sowie der inhaltlichen Diskussion ging es immer wieder um die Suche nach Aktionsschwerpunkten und politischen Zuspitzungen für weitere gemeinsame Aktivitäten. Auf dem Kongress fanden vier elementare Forderungen, vorgetragen von Frank Bsirske, allgemein Zustimmung: Erwerbsarbeit darf nicht arm machen und soll gerecht verteilt werden, die Rente muss auskömmlich sein, in der Bildung darf es keine Klassenschranken geben und starke Marxistisches Forum 48/2004 Schultern müssen mehr tragen als schwache. Viele der Anwesenden hätten es vor geraumer Zeit vermutlich nicht für möglich gehalten, wechselseitige teilweise gepflegte Vorbehalte beiseite zu schieben. Die gemeinsame Betroffenheit wurde zum Lehrmeister. Denn, so die Erkenntnis, wenn der Protest nicht gebündelt wird, dann bleibt er wirkungslos. Neben den neuen Antworten auf die gegenwärtigen Herausforderungen gab es selbstverständlich auch viele alte, die heute noch richtig und gültig sind. So kann die Einsicht, dass der gesellschaftliche Reichtum gerechter verteilt werden muss, nicht genug wiederholt werden. Ebenso, dass genug Geld da ist, um ein Leben in Armut zu verhindern. Neben der gemeinsamen Betonung dessen, was gut und richtig ist, wurden auch entwickelte Konzepte für einzelne Politikbereiche vorgestellt. Ein Beispiel dafür ist die von Experten von ver.di, der Memogruppe und attac ausgearbeitete "solidarische Einfachsteuer", die das Steuersystem entrümpeln und mehr Steuergerechtigkeit schaffen soll. Hier wird bis in Einzelheiten gehend konkretisiert, wie eine einheitliche Steuerprogression für die verschiedenen Einkommensarten funktionieren müsste. Die Bürger sollen entlastet, Ausnahmen gestrichen, Möglichkeiten, Gewinne durch Tricks klein zu rechnen eingeschränkt und die Kapitalflucht ins Ausland gestoppt werden. Zudem soll mehr Geld - die Einnahmen werden dem Vorschlag zur Folge verbessert - für öffentliche Zukunftsaufgaben verwendet werden. Der Perspektivenkongress ist Ausdruck für eine sich allmählich formierende politische Opposition, deren Träger neben den sozialen Bewegungen aus den Gewerkschaften kommen. Was die Gewerkschaften betrifft, so hat das insbesondere mit ihrem Verhältnis zur SPD zu tun. Der immer wieder angesprochene Bruch ist keineswegs endgültig. Es ist auch nicht so, dass fortschrittlichen Mitgliedern durchweg zögerliche Vorstände gegenüberstehen. Vielmehr wächst allgemein die Ratlosigkeit darüber, wie mit dem einstmaligen parlamentarischen Arm, der SPD, künftig umzugehen ist, und was man von ihr noch erwarten kann. Während Schröder die Gewerkschaften wie normale Lobbyisten behandelte, hört Müntefering ihnen wenigstens zu. Aber politisch soll es keine Änderungen geben, keine Abstriche an der Agenda 2010, die das seit langem gestörte Verhältnis noch einmal deutlich verschlechterte. Dies alles, obwohl die Politik, die zur Entfremdung führte, und zu der es angeblich keine vernünftige Alternative gibt, gemessen an den regierungsoffiziellen Zielen alles andere als erfolgreich ist. Die Arbeitslosigkeit wächst, der Aufschwung bleibt weiter in der Ferne. Über die verschiedenen Optionen des Umgangs mit den Mitgliederinteressen der Gewerkschafter gibt es deshalb sehr grundsätzliche Diskussionen. Soll man durch soziale Horst Trapp Bewegungen die Regierungspolitik zu ändern versuchen, die Partner von gestern und die Nochgenossen unter Druck setzen? Liegt das Heil in der Gründung neuer Parteien? Oder sollte man sich mit Formen der direkten Demokratie wie Bürgerbegehren und Volksabstimmungen auseinandersetzen? Unabhängig davon sollte sich niemand über die Bindewirkung der SPD täuschen. Man mault, geht nicht mehr zur Wahl (meine Partei kann ich nicht mehr wählen), man resigniert, aber der Bruch wird nur von wenigen vollzogen. Vielleicht kommen wieder bessere Zeiten und die anderen, die sind noch viel schlimmer. So ist es begrüßenswert, dass der IG Metall Vorsitzende Peters beim Perspektivenkongress ein "Arbeitnehmerbegehren für eine soziale Politik" ankündigte, das inzwischen zu einer Aktion auch anderer Gewerkschaften geworden ist. Damit soll der gesellschaftliche Protest gegen den Sozialabbau kanalisiert werden, um die Regierung zu einem Politikwechsel zu drängen. Zu den sechs Forderungen an die Regierung, worunter massenhaft Unterschriften gesammelt werden, gehören ein gerechtes Steuersystem, eine solidarische Bürgerversicherung, Chancengleichheit bei Bildung und Ausbildung, statt Arbeitszeitverlängerung humane Arbeitszeiten und Einkommen, die zum Leben reichen. Die Frage wird nun sein, ob aus der Vielzahl der Einzelaktivitäten sowie der Diskussionsergebnisse und Forderungen des Perspektivenkongresses einigende Druckpunkte oder Zuspitzungen gefunden werden, um gemeinsam aktions- oder gar kampagnefähig zu werden. Die Arbeit daran begann mit einem Vernetzungstreffen der Trägerorganisationen unmittelbar nach dem Kongress. Horst Schmitthenner von der IG Metall hatte im Auftrag des Kongressvorbereitungskreises einen Vorschlag zur Weiterarbeit vorgelegt, worin die Fülle der Inhalte in vier Themengruppen gebündelt ist. Unter den Überschriften Beschäftigungspolitik, Arbeitszeit, Standortpolitik und Privatisierungswahn war der Versuch unternommen worden, die zahlreichen Einzelkonzepte verschiedener Organisationen und Gruppierungen zu bündeln. Dieses Bemühen wird im Rahmen einer Tagung im Juli auf der Grundlage einer Überarbeitung weitergeführt. Eine künftige weitere Zusammenarbeit wird einmal dadurch erschwert, dass die Partner extrem unterschiedlich stark sind. Zwar nahm sich Frank Bsirske auf dem Kongress glaubwürdig zurück, indem er ausdrücklich nicht mit der Größe seiner Organisation argumentierten wollte. Es ist aber auch bekannt, dass innergewerkschaftlich kompliziertere Entscheidungsfindungsprozesse ablaufen, als etwa bei einer Bürgerinitiative. Dafür ist Verständnis erforderlich. Und den Verdacht, dass die alle wieder umfallen, spätestens bei der nächsten Bundestagswahl, muss man nicht unbedingt regelmäßig äußern. 19 Schließlich hängt die Entscheidung darüber davon ab, inwieweit es gelingt, effektiv zusammen zu arbeiten. Soziale Bewegungen unterscheiden sich von fest gefügten Organisationen dadurch, dass sie kein "Oberkommando" haben. Im Idealfall diskutieren sie so lange, bis sie einen Konsens gefunden haben. Das dauert manchmal länger. Mit machtpolitischen Mitteln ist da nichts zu erreichen, sondern nur durch die Überzeugungskraft der Argumente. Das ist ebenso zu berücksichtigen wie die unterschiedlichen Interessen in zahlreichen Einzelfragen, die nicht zum Kriterium der Zusammenarbeit gemacht werden dürfen. Zu den sich abzeichnenden Aktionsschwerpunkten für weitere gemeinsame Aktivitäten gehören solche im Bereich der Beschäftigungs- und Arbeitszeitpolitik, der Kranken- und Altersversorgung sowie der Absage an weitere Privatisierungen. Mindesteinkommen, Bürgerversicherung und Beibehaltung der Arbeitslosenhilfe sind in der Diskussion. Entscheidend wird sein, ob ein Aktionsprojekt gefunden werden kann, dass sich um einen Kernpunkt der gesellschaftlichen Auseinandersetzung herum gruppiert und kampagneförmig Massenunterstützung gewinnen kann. Darüber hinaus geht es um die nächsten Schritte. Denn der Protest darf nicht zerfleddern. Ein Aktionsherbst bedarf der Vorbereitung. Neben der Bildung regionaler und lokaler Bündnisse sind gemeinsame dezentral Aktionstage rund um den Buß- und Bettag im November und ein deutsches Sozialforum im Gespräch. Das Arbeitnehmerbegehren der Gewerkschaften bietet die Voraussetzung, den Protest in die Betriebe zu tragen. Es sollte deshalb auch von denjenigen unterstützt werden, denen einiges daran nicht gefällt. Nicht zuletzt gilt es, in die Zusammenarbeit Menschen aus weiteren gesellschaftlichen Bereichen sowie Gruppierungen einzubeziehen. So bilden sich beachtliche Widerstandspotentiale in den Kirchen heraus, die Umweltver- 20 bände waren in Berlin unterrepräsentiert, auch Jugendund Studentenorganisationen wäre eine intensivere Zusammenarbeit anzutragen, und natürlich muss die Friedensbewegung kraftvoller ins Boot. Obwohl die erfolgreich gestartete Initiative des Bundesausschusses Friedensratschlag "Abrüstung statt Sozialabbau" die richtigen Zusammenhänge herstellt, fand das Rüstungsthema beim Perspektivenkongress nur unzureichend statt. Dies obwohl das gegenseitige Verständnis zwischen Friedensund Gewerkschaftsbewegung in letzter Zeit wieder wuchs. Noch beim Ostermarsch demonstrierten zahlreiche Gewerkschafter mit, und wurde die Bereitschaft unterstrichen, den 1. Mai gemeinsam zu unterstützen. Es mag zahlreiche Gründe geben, die Themen Sozialabbau und Aufrüstung vielerorts noch getrennt zu behandeln. Beim Perspektivenkongress war es einfach so, dass sich zu wenig Friedensbewegte mit ihren spezifischen Themen meldeten. Der Perspektivenkongress, der vielfach auch als eine Art Volksuni bezeichnet wurde, hat wichtiges angestoßen, was nun weiter zu führen ist. Die dabei aufgekommene Aufbruchstimmung hat Mut gemacht. Wenn auch die Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Kräften, welche die wachsende Ungerechtigkeit zu verantworten haben, ebenso wie über die wichtige Friedensfrage, und sicherlich über vieles mehr, nicht hinreichend geführt wurde so hat sich doch gezeigt, dass manches voneinander zu lernen ist. Eine neue Kultur der politischen Verständigung muss her. Vielleicht sollten alle mal über die Worte von Fausto Bertinotti, dem Vorsitzenden der Partei der italienischen Rifundazione comunista nachdenken, der beim Sozialforum in Porto Alegre meinte, die Linken müssten aufhören in Kategorien von politischer Vorherrschaft und Avantgardismus zu denken und zur Kenntnis nehmen, dass dies ein ex-cathedra-Verhalten ist, das niemand mehr hinzunehmen bereit ist. Marxistisches Forum 48/2004 Weitere Hefte aus den Publikationen des Marxistischen Forums Heft 21/22 Der historische Platz der DDR Beiträge aus zwei Debatten im Marxistischen Forum GNN Schkeuditz 1999, ISBN 3-932725-44-1, Preis: 3,50 Euro, 40 S. Heft 38 Gerdhard Branstner Die neue Weltofferte Was Marx nicht wußte - Eine Blütenlese GNN Schkeuditz 2002, ISBN 3-89819-114-1, Preis: 2,00 Euro, 28 S. Heft 23 Ingo Wagner Für einen neuen Sozialismus als historischgesellschaftliche Alternative zum Kapitalismus GNN Schkeuditz 1999, ISBN 3-89819-018-8, Preis: 2,00 Euro, 32 S. Heft 39 Die Welt nach dem 11. September und dem 7. Oktober 2001 GNN Schkeuditz 2002, ISBN 3-89819-118-4, Preis: 2,00 Euro, 16 S. Heft 40/41 Heft 24 Gerd Friedrich Auf dem Weg zum "globalen Kapitalismus" GNN Schkeuditz 2000, ISBN 3-89819-025-5, Preis: 2,00 Euro, 28 S. Krieg, neue Weltordnung und sozialistische Programmatik - 100 Jahre John A. Hobson: Der Imperialismus GNN Schkeuditz 2002, ISBN 3-89819-133-8, Preis: 3,50 Euro, 48 S. Heft 25 Gerdhard Branstner Marxismus der Beletage GNN Schkeuditz 2000, ISBN 3-89819-029-3, Preis: 2,00 Euro, 28 S. Heft 42 Heft 26/27 Beiträge zur Diskussion über Programmdebatten in der deutschen Linken in Vergangenheit und Gegenwart auf einer Tagung des Marxistischen Forums der PDS am 27. November 1999 in Berlin GNN Schkeuditz 2000, ISBN 3-89819-033-1, Preis: 3,50 Euro, 56 S. Ingo Wagner In welcher Epoche leben wir eigentlich? - Versuch einer Annäherung GNN Schkeuditz 2002, ISBN 3-89819-134-6, Preis: 2,00 Euro, 28 S. Heft 43 Die Linke nach der Bundestagswahl Konferenz des Marxistischen Forums Sachsen, der KPF Sachsen und der Plattform International am 5. Oktober 2002 in Leipzig GNN Schkeuditz 2002 ISBN 3-89819-138-9, Preis: 2,00 Euro, 27 S. Heft 44/45 Finale? Zur Programmdebatte der PDS GNN Schkeuditz 2003 ISBN 3-89819-151-6, Preis: 2,00 Euro, 30 S. Heft 46 Was erwarten wir vom 21. Jahrhundert? Wissenschaft - Hoffnung - Traum Colloqium aus Anlass 75. Geburtstag U.-J. Heuer GNN Schkeuditz 2003 ISBN 3-89819-175-3, Preis 2,00 Euro, 35 S. Heft 47 Europäische Union in guter Verfassung? Beratung des Marxistischen Forums am 12. Januar 2004 GNN Schkeuditz 2004 ISBN 3-89819-176-1, Preis 2,00 Euro, 20 S. Heft 28/29 Heft 30/31 Beiträge zur Konferenz des Marxistischen Forums Sachsen am 4. März 2000 in Leipzig GNN Schkeuditz 2000, ISBN 3-89819-035-8, Preis: 3,50 Euro, 56 S. Ingo Wagner Auf der Suche nach sozialer Gerechtigkeit Plädoyer für eine soziale Gerechtigkeitskonzeption der Partei des Demokratischen Sozialismus aus marxistischer Sicht. GNN Schkeuditz 2000, ISBN 3-89819-048-X, Preis: 3,50 Euro, 40 S. Heft 32/33 Zur Programmdebatte der PDS Positionen Probleme - Polemik Konferenz des Marxistischen Forums am 16. September 2000 in Berlin. GNN Schkeuditz 2000, ISBN 3-89819-060-9, Preis: 3,50 Euro, 80 S. Heft 34/35 Ehrenfried Pößneck, Ingo Wagner Eduard Bernstein, Rosa Luxemburg und der Sozialismus der Moderne GNN Schkeuditz 2001, ISBN 3-89819-066-8, Preis: 3,50 Euro, 36 S. Heft 36/37 Reformalternative als Gesellschaftsalternative Beiträge zur Theoretischen Konferenz des Marxistischen Forums Sachsen am 9. Juni 2001 in Leipzig GNN Schkeuditz 2001, ISBN 3-89819-095-1, Preis: 3,50 Euro, 52 S. Auch die Hefte 1 -20 sind noch lieferbar, ein Verzeichnis kann beim Verlag kostenfrei angefordert werden. Über den GNNBuchversand ist ein Dauerbezug der Hefte möglich, der jederzeit kündbar ist. Dauerbesteller erhalten das jeweils neueste Heft sofort nach dem Druck zum Heftpreis zuzüglich Porto. Alle bereits erschienen Hefte sind über den GNN Buchversand aber auch über den Buchhandel zu beziehen. GNN Buchversand, Badeweg 1, 04435 Schkeuditz, Telefon 03 42 04 / 6 57 11, Fax 03 42 04 / 6 58 93 www.gnn-verlag.de, [email protected] Impressum ISBN: Herausgeber: Marxistisches Forum der PDS Verlag: GNN Verlag Sachsen/Berlin m.b.H., Schkeuditz Redaktionsschluß: 30. Juni 2004 Ziel des Marxistischen Forums ist es, einen Beitrag zur theoretischen Profilierung der Politik der PDS zu leisten. Dazu soll die Schriftenreihe einen Beitrag leisten. Die veröffentlichten Beiträge stellen die Auffassung der Autoren dar.