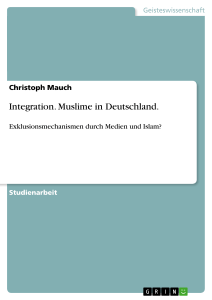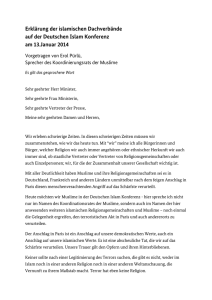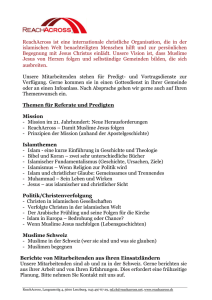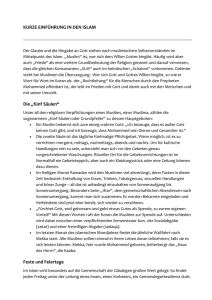Alltag von Muslimen in Niedersachsen
Werbung

6 SACHL CH Schriftenreihe der Ausländerbeauftragten des Landes Niedersachsen Alltag von Muslimen in Niedersachsen Alltag von Muslimen in Niedersachsen Inhaltsverzeichnis Vorwort von Gabriele Erpenbeck 4 Toleranz und Glauben – ein Überblick von Konrad Baer 6 Der Zentralrat der Muslime ist ein Partner von Dr. Nadeem Elyas 8 Eine Frage der Ehre von Dr. Dursun Tan 10 Junge muslimische Männer in Deutschland von Nikolas Kaye 12 Die Balance zwischen Tradition und Moderne von Katharina Ayroud-Peter 14 Die Vielfalt der Lebenswege muslimischer Frauen von Daniela Schulz 16 Eine offene Moschee und ihre nichtmuslimische Nachbarschaft von Halima Krausen 19 Christentum und Islam – Facetten einer spannungsvollen Beziehung von Dr. Ralf Geisler 21 Das Wagnis Toleranz von Rena Bürger 24 Alevitischer Islam – Hand in Hand mit dem Dede von Dany Schrader 26 Besuch in einer unbekannten Welt: Die Moschee in Hannovers Stiftstraße von Solveig Vogel 27 Grundbegriffe, Literatur und Adressen zusammengestellt von Dr. Ralf Geisler 30 Autorenverzeichnis und Impressum 34 Vorwort von Gabriele Erpenbeck 4 Die erste Woche der Muslime in Niedersachsen 2000 war ein Experiment. Nach allen Rückmeldungen, die mich erreicht haben, war es ein gelungenes Experiment. Neu daran war, dass die Initiative von verschiedenen Kommunen in Niedersachsen ausging. Inzwischen ist von mehreren Seiten angeregt worden, das Projekt weiter zu verfolgen. Mit dieser neuen Ausgabe in der Reihe „Sachlich“ wird die Dokumentation der Auftaktveranstaltung der ersten Woche der Muslime vorgelegt. Während der hier dokumentierten Veranstaltung konnten natürlich nicht alle wichtigen Einzelthemen behandelt werden. Weitere Fragen wurden bei Diskussionen, Fortbildungen und Informationsveranstaltungen unterschiedlichster Art in Braunschweig, Diepholz, Gifhorn, Hannover, Osnabrück, Wilhelmshaven oder Wolfsburg angesprochen. Im Mittelpunkt standen überall die Fragen, die im Alltag und vor Ort im Zusammenleben von Muslimen und Nichtmuslimen eine Rolle spielen, Fragen, die durch Missverständnisse, mangelnde Informationen oder festsitzende Vorurteile zu Problemen führen können. Modelle islamischen Religionsunterrichts, die bisher existieren, wurden vorgestellt, Erziehungsstile in türkischstämmigen Familien sowie die Situation der jungen Frauen und Männer aus diesen Familien diskutiert, nach Möglichkeiten der interreligiösen Erziehung gefragt, historische und kulturgeschichtliche Fragestellungen bearbeitet, Malwettbewerbe für Kinder und Jugendliche durchgeführt oder im Rahmen einer Fachtagung die Situation von Muslimen im Gesundheitswesen untersucht. Zusätzlich fanden viele Begegnungen in den Moscheen statt, die sich aus Anlass der Woche geöffnet hatten. Kultur- und Musikveranstaltungen rundeten das Angebot ab. Die Vorbereitung haben Verantwortliche aus den Städten und Gemeinden gemeinsam mit Fachleuten – Muslimen und Nichtmuslimen – aus verschiedenen Bereichen geleistet. Dass auch nicht organisierte Muslime einbezogen waren, hat neue Impulse für die weitere Arbeit vor Ort gebracht. Ziel war es, Menschen aus dem islamisch geprägten Kulturkreis, die z. T. schon seit vielen Jahren in Deutschland leben, Möglichkeiten zu eröffnen, in einer interessierten und auch Fachöffentlichkeit gleichberechtigt über Probleme und Lösungsansätze zu diskutieren in Fragen, die im Schul- und Bildungsbereich, in der Kinder- und Jugendarbeit, im Gesundheitswesen, in Behörden und Verwaltungen, im Stadtviertel und in vielen anderen Bereichen des Alltags immer wieder auftauchen. Wichtig ist, dass im gesamten Bildungsbereich, in den verschiedenen Diensten, in der Verwaltung, in den Medien und in der konkreten Alltagsgestaltung interkulturelle und damit auch multireligiöse Aspekte berücksichtigt werden. Das bedeutet nicht, dass allen in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz oder wo sonst immer alles über den Islam bekannt sein muss. Der Islam und die Muslime sind nicht monolithisch. Alles wissen zu sollen oder zu wollen, wäre eine Überforderung. Für die Mehrheit ist es nach meiner Überzeugung am wichtigsten, das eigene Fundament und die eigenen Wurzeln zu kennen, sie immer wieder neu zu akzeptieren und sich neu zu eigen zu machen. Wer weiß, woher er selbst kommt und auf welchem Fundament er steht, kann selbstbewusster, toleranter und vorurteilsfreier mit Menschen anderer Herkunft umgehen und zusammenleben. Auch dann können durchaus kulturell bedingte Konflikte entstehen. Aber: Lösungswege sind leichter von einer sicheren Basis aus zu finden. Dann gibt auch eine bessere Chance der im wahrsten Sinne des Wortes tödlichen Falle zu entgehen, nämlich der Versuchung, gesellschaftliche oder soziale Konflikte an den Grenzlinien von Religionen, Kulturen oder Ethnien zu eskalieren. Es bleibt keine Wahl, als zu akzeptieren, dass wir nicht in einer homogenen Gesellschaft leben. Die kulturelle, religiöse und ethnische Vielfalt wird eher zu- als abnehmen. Die Fähigkeit damit umzugehen kann gelernt werden. In den Niederlanden gibt es gute Erfahrungen mit Trainingskursen, die die kulturübergreifende Verständigung, interkulturelle Konfliktfähigkeit und Toleranz fördern. In dieser Hinsicht können wir von den Nachbarländern in Europa lernen; denn entscheidend ist, dass die einheimische Bevölkerung sich ihrerseits einem beiderseitigen Integrationsprozess öffnen will. Dazu gehört, dass auch den Menschen aus dem islamisch geprägten Kulturkreis, die in Deutschland ihren Lebensmittelpunkt gefunden haben, ein deutliches Signal zu geben, dass sie zu dieser Gesellschaft gehören. Es sind nicht allein die fremdenfeindlichen und rassistischen Übergriffe auf Menschen anderer Herkunft und ihre Gotteshäuser oder Friedhöfe, die zu verfolgen und zu ächten sind. Es sind auch die Diskriminierungen unterschiedlicher Art, die sie immer wieder im Alltag erfahren. Diese Diskriminierungen müssen abgebaut werden. Sie brauchen wie alle anderen eine Perspektive in dieser Gesellschaft. Dazu sollten die hier dokumentierte und alle anderen Veranstaltungen im Rahmen der ersten Woche der Muslime in Niedersachsen dienen. 5 Toleranz und Glauben – ein Überblick von Konrad Baer Durch die Arbeitsmigration der 60er und 70er Jahre sind die Muslime nach Deutschland gekommen. Mittlerweile ist der Islam hier die drittgrößte Religionsgemeinschaft nach den christlichen Konfessionen mit rund drei Millionen Anhängern. Die vieldiskutierte „multikulturelle“ Gesellschaft ist vor allem auch eine „multireligiöse“ Gemeinschaft. Und das ist schwierig in einem Land, in dem selbst die Akzeptanz und Zusammenarbeit von christlichen Konfessionen untereinander noch immer nicht selbstverständlich ist. In vielen ländlichen Gebieten meint das Wort „Mischehe“ noch heute die Heirat eines katholischen und eines evangelischen Partners. Die notwendige „Einbürgerung des Islam“, von der die Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen spricht, trifft oft auf Vorurteile und Ängste. Der Islam wird als einheitlicher Block wahrgenommen. Aleviten, Sunniten und Schiiten unterscheiden sich aber in vielen Punkten grundlegend. Die folgenden Texte sollen unter anderem auch dazu beitragen, den Blick zu schärfen. Die multikulturelle und multireligiöse Gesellschaft ist mehr, als ein bloßes Nebeneinander. Vielfalt fordern von allen Seiten Veränderungen. Allein das ständige Bewußtsein von der Möglichkeit des Anders-Seins und die Notwendigkeit von Toleranz kann Konflikte mit engen festgefügten Weltbildern auslösen. 6 Ein besonders heikler Bereich ist das Verhältnis der Geschlechter. Der Islam wird häufig mit Patriarchalismus und der Unterdrückung der Frau gleichgesetzt. Die auch in unserer Gesellschaft bis vor kurzem noch sehr deutlichen patriarchalen Tendenzen werden dagegen oft verdrängt. Streng moslemische Familien wären mit dem geschlechtertrennendem Schulsystem der 50er Jahre in der Bundesrepublik gut zurechtgekommen. Die Paradoxie vieler Diskussionen zeigt sich darin, dass es zum großen Teil die sozialen Milieus sind, die sich für die Gleichberechtigung der Geschlechter eingesetzt haben und einsetzen, die sich auch um die Integration von Migranten in die bundesrepublikanische Gesellschaft bemühen. Die vorliegenden Texte gehen auf Referate und Diskussionen während der „Woche der Muslime“ zurück. Unter dem Motto „Halbmond zwischen Ems und Elbe“ hatten die Niedersächsische Landeszentrale für Politische Bildung und die Ausländerbeauftragte des Landes Niedersachsen im November 2000 zum Gespräch eingeladen. Nicht alle aktuellen Fragen werden hier behandelt. Religiös vorgeschriebene Schlachttechniken, das Problem, eine Baugenehmigung für eine Moschee zu bekommen oder das Verhältnis des Islam zu Kunst und Kultur sind an anderer Stelle zu vertiefen. Nadeem Elyas stellt den Zentralrat der Muslime dar, eine Dachorganisation, die die Mehrheit der in Deutschland lebenden „Konfessionen“ des Islam in ihren Interessen vertritt. Dursun Tan und Nicolas Kaye beschäftigen sich in ihren Beiträgen mit dem Gewaltpotential, dass in der Öffentlichkeit männlichen muslimischen Jugendlichen zugeschrieben wird. Dabei wird insbesondere die Frage behandelt, zu welchem Anteil die Religion und zu welchem Anteil andere gesellschaftliche Einflüsse zu auffälligem Verhalten führen. Katharina Ayround-Peter beschreibt, wie sich traditionelle Familienverhältnisse von moslemischen Migranten in Deutschland verändern. Die Religion ist dabei ein wichtiger Faktor, eine Identität auszubilden, aber sie ist nicht die allein prägende Kraft. Daniela Schulz beschäftigt sich mit den Lebenswegen muslimischer Frauen in Deutschland. Dabei wird klar, dass für muslimische Frauen die Kenntnis des Koran zum Teile eine Hilfe sein kann, sich gegen männliche Unterdrückung in der Familie zu wehren. Andere muslimische Verhaltens-Vorschriften für Frauen erscheinen, zumindest aus aufgeklärter europäischer Sichtweise, repressiv. Halima Krausen berichtet von den Erfahrungen einer schiitischen Hamburger Moschee. Gespräche miteinander statt übereinander haben geholfen, viele Konflikte mit Nicht-Muslimen zu lösen oder aber zumindest zu entschärfen. Pastor Ralf Geisler plädiert für die Wahrnehmung von religiösen Gemeinsamkeiten von Islam und Christentum. Denn dadurch entstehen nach seiner Meinung Gefühle von familienartiger Zusammengehörigkeit, die auch die Unterschiede im jeweiligen Glauben aushalten lassen. Wer Religionen nur mit der weltlichen säkularen Brille betrachtet, meint der Theologe, werde dem „Kern“ und Selbstverständnis der jeweiligen Glaubensrichtung nicht gerecht. Toleranz setzt den Mut voraus, sich auf das jeweils Andere und Fremde einzulassen, ist das Fazit des Textes von Rena Bürger. Nicht jede Kommunikationsversuch zwischen Christen und Muslimen gelingt. Die Diskussion, über die Rena Bürger berichtet, ist dafür ein anschauliches Beispiel. Konflikte kann man erst dann überwinden, wenn es beiden Seiten gelingt, Toleranz zu entwickeln und Andersartigkeit nicht als Bedrohung für die eigene Identität zu sehen. Dany Schrader berichtet über den Alevismus. Sie hat Professor Ali Ucar in einer Diskussionsrunde mit Moslems und Christen begleitet. Der Text gibt erste Einblicke in den wenig bekannten alevitischen Islam und er macht Konflikte dieses Bekenntnisses mit den anderen großen moslemischen Glaubensrichtungen deutlich. Solveig Vogel hat einen Besuch von Christen in der Moschee in Hannovers Stiftstraße beobachtet. Die Gastfreundschaft und das offene Gespräch waren für die Besucher beeindruckend. Durch Begegnungen wandelt sich Misstrauen in gegenseitiges Verständnis, ohne Unterschiede und Konflikte zuzudecken. Ralf Geisler hat am Ende dieses Heftes Grundbegriffe des Islam stichwortartig zusammengefasst und Literatur und Adressen zusammengestellt. Die gesellschaftliche und individuelle Auseinandersetzung mit Religion ist eine wichtige Voraussetzung für die Integration von Migranten. Der absolute Wahrheitsanspruch von Religion kann sicher konfliktverschärfend wirken, das gilt auch für andere umfassende Weltdeutungen. Wichtig ist die Erinnerung, dass das Christentum in seiner Geschichte fundamentalistische Ausprägungen gehabt hat (und in Teilen noch immer hat). Echte Begegnung kann nicht in der Atmosphäre gegenseitiger Missionierung, sondern nur im Klima von Toleranz und Akzeptanz gelingen. Die „Woche der Muslime“ war dafür ein Beispiel. Auch die neue Ausgabe von „Sachlich“ will mit dazu beitragen, ein solches Klima zu fördern. 7 Der Zentralrat der Muslime ist ein Partner von Dr. Nadeem Elyas Die Muslime sind Teil der deutschen Gesellschaft. Der Zentralrat der Muslime in Deutschland ist Partner im gesellschaftlichen Leben und der Politik. Der Zentralrat geht den Weg des Miteinanders mit anderen Gruppen und Personen der Gesellschaft und lehnt sowohl Abgrenzung als auch Ausgrenzung ab. Für islamische Belange ist er: Gesprächspartner, Anlaufstelle und ein einheitlicher Ansprechpartner in Deutschland. Er nimmt Stellung zu wesentlichen Fragen der Gesellschaft im Allgemeinen und der Muslime im Besonderen. Das deutsche Wirtschaftswunder zog viele ausländische Arbeitskräfte an. Mit den sogenannten Gastarbeitern kamen auch viele Muslime ins Land. Spätestens seit den sechziger Jahren ist der Islam in Deutschland nicht mehr wegzudenken. So, wie die meisten Muslime in Deutschland eine neue Heimat gefunden haben, ist auch der Islam hier heimisch geworden. Mit einem Anteil von ungefähr drei Prozent an der Gesamtbevölkerung sind wir zwar nur wenige. Hinter den Christen bilden wir aber die zweitgrößte Religionsgemeinschaft in Deutschland. Aus den anfänglichen islamischen Bürgerinitiativen und Selbsthilfegruppen bildeten sich islamische Gemeinden. Der rasche Wandel der Anforderungen stellte sowohl für die inneren Strukturen der Gemeinden als auch für die Gesellschaft, die Politiker und die Verwaltung unüberschaubare Herausfor- 8 derungen dar. Aus den Bedürfnissen von „Hinterhof-Moschee-Gemeinden“, die zunächst nur lokaler Natur waren, wuchsen gemeinschaftliche islamische Belange, die die Grenzen der Kommunen und der Bundesländer überschritten. Fragen, wie beispielsweise die Einführung eines islamischen Religionsunterrichts an öffentlichen Schulen, die Einrichtung eines geregelten, veterinärmedizinisch überwachten Schlachtbetriebes nach islamischem Ritus oder die Probleme der Muslime der zweiten und dritten Generation können nur noch gemeinsam von den Muslimen angepackt werden. Unterdessen gibt es schätzungsweise mehr als hunderttausend deutschstämmige Muslime. Immer mehr ausländische Muslime streben die deutsche Staatsbürgerschaft an. Auch den Muslimen ist mit der Zeit bewusst geworden, dass der Islam eine dauerhafte Religion in Deutschland geworden ist. Diese rasche Entwicklung bringt für alle Beteiligten Probleme mit sich. Im Jahr 1986 trafen sich deswegen die Vertreter der großen islamischen Dachverbände, Organisationen und Kulturzentren, um sich dieser gemeinsamen Aufgaben zustellen. Aus unverbindlichen Koordinierungs- und Gesprächskreisen entwickelte sich der Islamische Arbeitskreis, aus dem im Dezember 1994 der „Zentralrat der Muslime in Deutschland“ hervorging. Es ist sein Ziel, „den islamischen Gemeinschaften in Deutschland zu dienen, den kulturellen und interreligiösen Dialog zu pflegen und sich für eine konstruktive Kooperation zum Wohle der islamischen Gemeinschaft und der ganzen Gesellschaft einzusetzen“. (Aus der Präambel des Zentralrates der Muslime in Deutschland). Der Zentralrat der Muslime in Deutschland versteht sich somit als integraler Bestandteil der pluralistischen Gesellschaft Deutschlands. Er geht den Weg des Miteinanders mit den anderen Teilen unseres Landes und lehnt deswegen Abgrenzungen und Ausgrenzungen ab. Dies gilt sowohl für das Verhältnis des Zentralrates zu nichtmuslimischen Gruppen, wie auch für islamische Gemeinden und Organisationen, die nicht dem Zentralrat angehören. In seiner breiten Vielfalt tritt der Zentralrat dem häufig den Muslimen gegenüber erhobenen Vorwurf entgegen, dass sie keinen Ansprechpartner unter den Muslimen finden und zu stark zersplittert seien. Ein Zusammenwirken mit den anderen Gruppen und Institutionen der Gesellschaft ist aber nur auf der Basis gegenseitigen Vertrauens und Achtung und mit beiderseitigem Willen zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit möglich. Der Zentralrat ist hierzu bereit. Um diese Basis zu schaffen, ist es erforderlich, dass sich beide Seiten besser verstehen lernen. Der Zentralrat leistet deswegen Aufklärungsarbeit über den Islam und die Muslime in der Öffentlichkeit – aber auch im Innenverhältnis gegenüber den Mitgliedern über die deutsche Gesellschaft. Feindbilder müssen auf beiden Seiten abgebaut werden. In diesem Rahmen ist es ein Anliegen des Zentralrates der Muslime in Deutschland mit allen Gruppen – insbesondere aber mit den Juden und Christen – in unserem Land einen konstruktiven Beitrag zu leisten und am Aufbau einer neuen ethischen Kultur und eines moralischen Grundgerüstes mitzuwirken. Wir denken konkret aber auch an die Probleme der Jugend, der Arbeitswelt, der sozial Benachteiligten, der alten Menschen oder die Bewahrung der Schöpfung; und es gilt ganz im Sinne unserer Religion, Frieden zu stiften. Der Zentralrat ist den ethischen Forderungen des Islams und seiner Lehre verpflichtet. Zur Erfüllung seiner Aufgaben bemüht er sich nach besten Kräften, sich an die Regeln seiner Religion und Glaubensüberzeugung zu halten. Darüber hinaus sind sich alle dem Zentralrat angeschlossenen Vereinigungen auch darin einig, ihre Religion auf dem Boden und im Rahmen der bundesdeutschen Verfassung und im Einklang mit den deutschen Gesetzen zu praktizieren. 9 Eine Frage der Ehre von Dr. Dursun Tan Angehörige der islamischen Religion bilden in Deutschland eine ethnische und religiöse Minderheit. Der Umgang mit dem Thema „Gewalt, Ehre und Religion“ ist daher anders zu führen als in den Ländern, in denen der Islam „religiös“ und „kulturell“ dominant ist. Das ist der Tatsache geschuldet, dass die Erklärungen von Phänomenen und Handlungen immer auch davon abhängen, welcher „Diskursrahmen“ gewählt wird. Jeder Diskursrahmen blendet bestimmte Tatsachen aus und rückt andere in den Mittelpunkt und wirkt damit auf die Inhalte ein. Die folgenden Ausführungen folgen dem Grundsatz, dass die Funktion von Erklärungen und das Erschließen von Zusammenhängen, sich einerseits nicht der Verantwortung ihrer Nebenfolgen entziehen kann, andererseits aber die Resultate nicht beschönigen und entschuldigen sollten. Die Thematisierung von muslimischen Jugendlichen erfolgt in der Regel einseitig, unter dem Aspekt von Gewalt, Kriminalität, Fundamentalismus und Fanatismus. Die meisten Analysen zeugen von Distanz und Abwehr. Man sieht in muslimischen, männlichen Jugendlichen die zukünftigen Machos oder Patriarchen, die die Frauen an ihrer Entwicklung hindern oder diskriminieren und ihre Schwestern und Ehefrauen unterdrükken. Ehrvorstellungen von männlichen Jugendlichen werden unwissentlich und einseitig dem Islam zugeordnet. Tatsache ist aber, dass die Ehrvorstellungen im Koran andere sind, als die aus einer männlich geprägten Kultur. 10 Entwicklungspotentiale, die Vielfältigkeit innerhalb der muslimischen Jugendkultur, die sozialen und schichtspezifischen Differenzen innerhalb der Jungendlichen sowie der Unterschied von „frommen“ und „nichtfrommen“ Formen des Islams werden kaum wahrgenommen. Die Analysen (wie z.B. die von Wilhelm Heitmeyer u.a. oder Christian Pfeiffer) zum Gewaltpotential männlicher, muslimischer Jugendlicher vernachlässigen aus meiner Sicht auch den Aspekt, dass es sich bei den Jugendlichen zunächst um Jugendliche handelt, mit all den Problemen, Wünschen, Vorstellungen und Eigenschaften, die typisch für eine bestimmte Altersgruppe sind. Auch gehen sie zuwenig auf die Bedingungen des Aufnahmelandes und die Rolle der Mehrheitsgesellschaft bei der Produktion des Gewaltpotentials von männlichen, muslimischen Jugendlichen ein. Dagegen messen sie den aus der Herkunftskultur „mitgebrachten“ Gewaltpotentialen zuviel Bedeutung bei. Tradierte Gewaltpotentiale vermischen sich aber unter Bedingungen des Ziellands mit den vorgefundenen Bedingen und Struktureigentümlichkeiten zu neuen Formen von Gewalt. Sie können daher nicht mehr allein dem Mitbringen tradierter Rollen aus dem Heimatland zugeschrieben werden (z.B. Pfeiffer). Sie oszilieren mit subjektiv empfundener Diskriminierung und Marginalisierung sowie der Erosion ehemals tradierter familiärer Rollen und damit einhergehender Wert- und Normenvorstellungen (vgl. Heitmeyer) zu neuen Formen. Der Islam soll in seiner Prägekraft nicht verleugnet werden, jedoch handelt es sich bei den Problemen, die die männlichen, muslimischen Jugendlichen haben, auch und in erster Linie um typische Probleme von männlichen Jugendlichen bzw. Heranwachsenden. Diese sind: • Probleme, unter Bedingungen kultureller Widersprüchlichkeiten, Individualisierung und divergierender Wertvorstellungen, eine stabile Geschlechtsidentität auszubilden. • Probleme, über Sexualität zu sprechen (statt dessen Protzen sie darüber und werten das weibliche Geschlecht ab). • Probleme, unter Bedingungen von „Freizügigkeit“, „Erotisierung des Alltags“, „Erosion traditioneller Rollenvorstellungen“, ein partnerschaftliches Verhältnis zu Mädchen bzw. Frauen aufzubauen. • Probleme, von Erwachsenen angenommen, akzeptiert, respektiert und geliebt zu werden. • Schulstress, Stress mit Eltern, Geldnöte, Versagungsängste, Sorge kein Ausbildungsplatz oder Arbeitsplatz zu bekommen, Angst, von Mädchen nicht für attraktiv befunden zu werden. • Angst, für schwach und für nicht männlich gehalten zu werden. • Angst, den (widersprüchlichen) gesellschaftlichen Erwartungen nicht gerecht werden zu können. • Angst, von der Aufnahmegesellschaft diskriminiert zu werden und kein Heimatgefühl ausbilden zu können. Bei vielen, durchaus kritisierbaren bzw. nicht hinnehmbaren Einstellungen und Handlungen handelt es sich auch um Kompensation. Diese erfolgt durch unterschiedliche Ansätze: • Selbstethnisierung (markante Devisen: „Alle Deutschen hassen die Türken“, „weil wir Türken sind“, „einem Türken wird nur ein anderer Türke Freund sein können“ etc). • Religiöser Übereifer (markante Devisen: „Sie, die Deutschen bzw. Europäer sind technisch überlegen, aber moralisch bzw. kulturell verkrüppelt“, „sie glauben an Geld, wir an Gott“, „Sie werden von Gott bestraft, ich belohnt werden“ u.ä.). • Ablehnung des deutschen Umfelds; z.B. Sprachverweigerung (Bewusstes provokatives Ausländerdeutsch). • Selbstviktimisierung und Pariabewusstsein (Zelebrieren von Leiden und Entwicklung einer Leidkultur, mit dem Bedürfnis, getröstet oder eines Tages erlöst oder errettet zu werden, teilweise erfolgt daraus auch „Gewaltlegitimation“). • psychische Auffälligkeiten, mit Neigung zu „Wahnvorstellungen“ (Verfolgungs- und/oder Größenwahn). • Abrutschen ins kriminelle Milieu: (Glückspiel, Hehlerei, Dealerei, Jungenstrich, Rotlichtgewerbe). Öffentlich bekannt ist bisher, dass es seit dem Jahr 1978 in Berlin in Deutschland zu keinem Gewaltakt gegenüber Andersdenkenden bzw. Andersgläubigen gekommen ist, der sich explizit auf den Islam bezieht. Gleichwohl wird immer wieder davon berichtet, dass „einige fundamentalistische Gruppen“ in Deutschland muslimische Jugendliche indoktrinieren und als „Kämpfer für den Jihat“ zu rekrutieren versuchen. Gleichzeitig wird darüber berichtet, dass politische Funktionäre (z.B. aus der Türkei oder Algerien) islamische Gemeinden in Deutschland als Rückzugsfeld für ihren Kampf in den Heimatländern nutzen und die Gemeinden als zusätzliche politische Masse für ihre Ziele ansehen. 11 Junge muslimische Männer in Deutschland von Nicolas Kaye Haben männliche muslimische Jugendliche in Deutschland eine erhöhte Gewaltbereitschaft? Haben sie trotz ihres Andersseins faire Möglichkeiten sich zu entwickeln? Ann-Christin Jürgensen erzählt von ihren Erfahrungen. Die deutsch-dänische Doppelpass-Besitzerin arbeitet seit sechs Jahren als Streetworkerin mit männlichen deutschen und ausländischen Jugendlichen im BrennpunktStadtteil Vahrenheide (Hannover). Sie ist außerdem Vorsitzende des „Vereins für Straßensozialarbeit in Niedersachsen und Schleswig-Holstein“. Nach anfänglichen Kontaktschwierigkeiten der Streetworker zu den Jugendlichen in Vahrenheide, „da hatte ich auch mal einen Messer am Hals“, konnte sie durch „erlebnispädagogisches Klettern im Ith“, Vertrauen zu den Jugendlichen aufbauen. „Nach der Fahrt war es uns möglich, mit denen eng zusammen zu arbeiten“. Bald darauf hieß es unter den Jugendlichen, „da kannst du hingehen, da helfen sie dir“. In den sechs Jahren hat Jürgensen viele Jugendliche im Stadtteil kennen gelernt und in dem schwierigen Altersabschnitt begleitet. Die meisten ihrer ausländischen muslimischen Jugendlichen sind türkischer oder kurdischer Herkunft, einige kommen aus dem Libanon und Marokko. Die Erfahrungen der Streetworkerin zeigen, dass männliche muslimische Jugendliche in Deutschland mit massiven Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Von einer gelungenen Integration kann nicht die Rede sein. Zu den Schwierigkeiten der Jugendphase gesellen sich die Probleme von Migranten in einer fremden deutschen Kultur. Havva Mermertas, (Ausländerbeirat Hannover, Mitglied im Stadtelternrat und Vorsitzende des Vereins „Eltern türkischer Kinder“) stellt fest, „dass die JVA Hameln voll ist mit ausländischen muslimischen Jugendlichen“. Verschiedene Untersuchungen lassen vermuten, dass bei männlichen muslimischen Jugendlichen ein erhöhtes Gewaltpotential vorhanden ist. Die Gründe für Gewalt und Kriminalität sind aber unklar und umstritten. In der Religion wurden keine direkten Ursachen für erhöhte Gewaltbereitschaft gesehen. Verschiedene Teilnehmer der Woche der Muslime betonten 12 den friedlichen Wesenskern des Koran. Ein türkischer Moslem bringt es folgendermaßen auf den Punkt: „Dass Gewalt religiös motiviert ist, das kann man so nicht stehen lassen. An sich ist der Koran friedlich und legitimiert keine Gewalt. Religion kann aber missbraucht und benutzt werden, um Gewalt zu legitimieren“. Hassan Dehne (Muslimische Jugend Deutschlands) meint, dass in der öffentlichen Diskussion die Religion mit der traditionellen Kultur verwechselt wird“. Unwissentlich werden von den meisten Deutschen tradierte Ehrenvorstellungen einer männlich geprägten Kultur dem Islam zugeordnet. In den traditionellen Kulturen werden dagegen Gründe vermutet, die das Gewaltpotential der Jugendlichen verstärken. Jose Torrejon (Katholische Sozialarbeit für zugewanderte Jugendliche) fragt: „Wie ist das Verhältnis der jeweiligen muslimischen Bürger zu einer demokratischen Kultur und inwieweit wird Gewalt in den Familien oder in der Politik toleriert? Der Begriff der „Ehre“ wird der traditionellen Kultur zugeordnet. „Ehre ist kein theologische Begriff“ (Dr. Obeidullah Mogaddedi). Der Begriff der Ehre blieb in der Diskussion nebulös. Im Kern geht es den Jugendlichen mit dem Begriff der Ehre um ihre Selbstbehauptung und um Anerkennung durch die Gesellschaft in der sie aufwachsen. Die „Ehre“ kann aber außerdem vortrefflich als Entschuldigung für eigenes (Fehl-)Verhalten dienen. „Ehre, Ehre immer nur diese Ehre, die wird vorgeschoben als Ausrede für alles Mögliche“, meinte ein Teilnehmer nach dem Ende der Gesprächsrunde. In Bezug auf die Kulturen wurde von verschiedenen Teilnehmern angemahnt zu differenzieren und nicht alle muslimisch geprägten Kulturen gleichzusetzen. Beispielsweise leben indonesische Muslime andere Traditionen, als türkische. „Die Muslime gibt es nicht“ (Mermetas). In der Diskussion nahm das Themenfeld Ausgrenzung, Diskriminierung und Rassismus gegenüber muslimischen Jugendlichen breiten Raum ein. Jürgensen hält die „Ausgrenzung für alltäglich“ und sieht keinen Erfolg bei der Integration der ausländischen Moslems: „Integration findet nicht statt“. Insbesondere Jugendliche reagieren empfindlich, wenn sie sich nicht von der Gesellschaft akzeptiert fühlen und offensichtlich benachteiligt werden. Sie reagieren schnell mit Gewalt. Das ist bei deutschen Jugendlichen nicht anders. Die Liste der Mängel bei den Bemühungen um Integration ist lang: Das reicht von der Schule und die Betriebe über die Polizei bis zur Justiz. An den Schulen kritisiert die Streetworkerin Jürgensen, dass viele Lehrer in Bezug auf muslimische Jugendliche voller Vorurteile sind. In den Gesamtschulen ist es auch nicht besser als in den anderen Schulen. Noch schlimmer sieht es in den Lehrbetrieben aus, „dort geht es häufig rassistisch zu“. Die in der schulischen Elternmitarbeit aktive Türkin Mermentas stellt fest: „Die Klischees werden hochgehalten. Besonders schwer haben es die türkischen Jungs. Sie werden über ein Kamm geschoren und alle für Machos gehalten, die ihre eigenen Schwestern an Ihrer Entwicklung hindern“. Ein Fehltritt werde dramatisiert und dadurch würden Vorurteile zementiert. Die Jungs werden auf der Basis dieser Vorurteile vermehrt auf die Sonderschule geschickt. Auch in der Justiz haben männliche muslimische Jugendliche mit Diskriminierung zu kämpfen, so der pensionierte Uelzener Jugendrichter Peter Brandler, der im Landespräventionsrat tätig ist. „Schwierig ist für die Richter, sich in die Situation der Jugendlichen einzuarbeiten“. Sie haben zuerst mal Sprachschwierigkeiten, dazu fehlt das Wissen über die andere Kultur. Es bleibt ein Dunkelfeld, und Dunkelfelder werden mit Angst ausgefüllt. Das führt zu Strafen. Angemerkt wurde auch, das im Justizbereich keine Weiterbildungsmöglichkeiten in Bezug auf muslimische Kulturen bekannt sind. Die Ausgrenzung der Jugendlichen gegenüber dem Arbeitsmarkt führt auch zu Unzufriedenheit bei den Jugendlichen. Ein Türke schilderte, wie er früher als Jugendlicher sich um Arbeit bemühte. Die Arbeitsvermittlerin sagte ihm, er könnte nur Arbeit erhalten, wenn die Deutschen und die EG-Bürger die jeweilige Arbeitsstelle nicht beanspruchen. Er drohte daraufhin, dass er eine Bank überfallen würde, wenn er keine Arbeit bekäme. Nur aufgrund des Drucks, sagte er, wäre ihm doch noch eine Arbeitsstelle vermittelt worden. Frau Jürgensen betont dazu, dass die mangelnde Integration im Arbeitsmarkt nicht als alleiniger Grund anzu- sehen ist für die Kriminalität bei den Jugendlichen. „Jeder Einzelfall ist unterschiedlich“. Nur zwei von 18 türkischen Jugendlichen in Vahrenheide hätten eine Lehre absolviert und trotzdem sei keiner kriminell geworden. Es wurden nicht nur die mangelnden Integrationsbemühungen der Deutschen und ihrer Institutionen bemängelt. Kritik äußerten muslimische Frauen auch an den muslimischen Gemeinden in Deutschland. Havva Mermetas fragt sich, warum so viele Jugendliche hier kriminell werden? Sie sieht, neben der Kritik an den deutschen Integrationsbemühungen, auch Gründe in den Familien. „Viele der Eltern verstehen ihre Kinder nicht mehr. Die Eltern sind verzweifelt und haben das Gefühl, sie können nichts machen“. Es bestehe eine Beziehungskrise zwischen den Kindern, die in der modernen westlichen Welt aufwachsen, und den Eltern, die von den religiösen und kulturellen Traditionen ihres Heimatlandes geprägt sind. Weiterhin sieht sie einen Mangel an selbstkritischem Denken: „Die Eltern sollten sich weiterbilden, wir stagnieren, wir sind verpflichtet, uns mit der aktuellen und der zukünftigen Situation auseinander zu setzen“. Eine türkische Studentin der Sozialarbeit beklagt mangelnde Offenheit: „Die muslimisch-türkische Gesellschaft öffnet zu wenig die Türen für die deutsche Gesellschaft.“ Sie schlägt Tage der offenen Türen vor, wo die Nicht-Muslime den Islam kennen lernen können und ihre Fragen beantwortet werden. Jugendlichen vor Gericht zu betreuen. Sie nahm die Rolle einer Vermittlerin zwischen Gericht und Jugendlichen ein, die versucht Licht ins „Dunkelfeld“ zu bekommen. Viele loben die präventive Sozialarbeit und ein Modellprojekt zur Unterstützung der straffälligen Jugendlichen in der JVA Hameln. Es wird eine Ausweitung der Präventionsarbeit gewünscht. Als wichtig wird die Kontinuität solcher Arbeit erachtet, damit Beziehungen entstehen können zwischen Jugendlichen und Sozialarbeitern. Gewünscht werden mehr Migranten, die in der Sozialarbeit mitwirken. Insgesamt sind mehr Integrationsbemühungen von allen Seiten zu verlangen. Fortbildungsmöglichkeiten sollten mehr genutzt werden. Jürgensen verlangt von der Polizei, Justiz und Schule, dass sie sich informieren. Nicht nur die Institutionen sind gefordert. „Jeder muss an sich arbeiten, die Ausgrenzung ist alltäglich“. Auch patriarchische Muster werden beklagt. Auf die Forderung eines türkischen Mannes nach türkischen Sozialarbeitern in Deutschland, frage sie zurück: „Welcher türkische Mann würde eine türkische Frau unterstützen, die Sozialarbeit studieren möchte“. Neben den Anforderungen an die muslimische Gemeinden hat die Arbeitsgruppe über weitere Lösungsansätze nachgedacht, wie die Integration von muslimischen Migranten verbessert werden kann. Jugendrichter Brandler möchte auf den jährlichen Richtertagungen in Trier den Mangel an Weiterbildung in Bezug auf muslimische Migranten ansprechen. Vorgeschlagen wurde, muslimische Schöffen an den Jugendgerichten zu fördern. Jürgensen macht gute Erfahrungen damit, als Streetworkerin ihre 13 Die Balance zwischen Tradition und Moderne von Katharina Ayroud-Peter 14 „Die Grenzen, an die wir im zwischenmenschlichen Umgang, in der Verständigung und in der Zusammenarbeit, zwischen deutschen und türkisch – islamischen Mitmenschen stoßen, sind häufig durch mangelnde Kenntnis über die jeweils andere Kultur entstanden.“ Doris Bonkowski, Koordinatorin für Ausländerfragen bei der Stadt Braunschweig, sieht mangelnde Integration als Herausforderung für Pädagoginnen und Pädagogen. Aus einer Verbindung von sachlicher Information mit Empa- Sag „dass die Familie der zentrale Bezugspunkt in der türkisch – islamischen Gesellschaft ist. Die Funktionen dieser Gemeinschaft gehen weit über eine bloße physiologische Versorgungs- und Reproduktionsfunktion hinaus. Vielmehr gibt es innerhalb der Familie klare Positions- und Funktionszuschreibungen, die in der dörflichen Gemeinschaft um die Sippenzugehörigkeit ergänzt werden. Der persönliche Status innerhalb dieser Gemeinschaft ist hierbei weniger von der thie und Sympathie scheint es ihr jedoch möglich, die Bewältigung gegenwärtiger Konflikte zu realisieren. Ein Vortrag von Emir Ali Sag, Geschäftsführer des Ausländerbeirats der Stadt Bielefeld, zu Ursprung, Entwicklung und Veränderungsprozessen türkisch – islamischer Familien in Deutschland soll notwendige Sachkenntnisse liefern. Als Ausgangspunkt wählt Sag die Bedeutungen, der türkischen Worte „aile“ und „hane“, die zur Bezeichnung einer familiären Gemeinschaft benutzt werden. „Aile“ steht auch für Frau und „hane“ für Haus (-gemeinschaft). „Das macht deutlich“, betont wirtschaftlichen Situation, als vielmehr von der Ehrenhaftigkeit im Sinne des islamischen Glaubens abhängig. Sag erläutert: Wenn ein Familienmitglied etwas tut, was gegen die Regeln der islamischen Gemeinschaft verstößt, z.B. kriminell wird, so muss die Familie alles tun, um die Ehre wieder herzustellen. Dabei kommt es schon mal zu einer Zwangsheirat mit einer jungen Frau aus der Heimat, die noch unberührt ist und den moralischen Wertvorstellungen entspricht“. Um die Situation türkisch – islamischer Familien in Deutschland verstehen zu können, bedarf es neben dem Ver- ständnis für kulturelle und religiöse Unterschiede auch der Betrachtung der Entstehung dieser Familien in Deutschland. Sag erinnert an den historischen Zusammenhang: „Türken kamen als Gastarbeiter nach Deutschland, sie hatten zu diesem Zeitpunkt kein Interesse, hier mit ihren Familien sesshaft zu werden“. Zunächst waren es ohnehin nur die Männer, die von der deutschen Wirtschaft angeworben wurden. „Sie hatten nur ein Ziel. Hart arbeiten und viel Geld für die Familien in der Heimat verdienen“. Die Zukunft lag in der Heimat, nicht in Deutschland, wo sie sich vielfach nur geduldet, nicht erwünscht fühlten. Viel anders war es von bundesdeutscher Seite auch nicht vorgesehen. Sag macht an dieser Stelle deutlich: „Oft hat es über zehn Jahre gedauert, bis die Familienzusammenführung ermöglicht wurde“. Das blieb natürlich nicht ohne Folgen für die Familien. Es kam zum Verlust der Sicherungs- und Fürsorgefunktion der Väter für die Familien. Sie können ihre Erziehungsfunktion wegen der überwiegenden Abwesenheit nicht mehr ausfüllen. „Die Kinder nehmen ihre Väter nicht mehr ernst, achten deren Autorität nicht mehr“. Für viele Männer bedeutet das nicht nur die Verschiebung der Positionen innerhalb der Familie, sondern einen weitreichenden kulturellen Funktionsverlust. „Du kannst arbeitslos oder auch Alkoholiker sein, aber du musst in der Öffentlichkeit dein Gesicht wahren“ weist Sag nochmals den Bedeutungszusammenhang von familiärem und öffentlichem Leben hin. Die Situation in der türkisch – islamischen Familie in Deutschland nach der Zusammenführung sieht nicht viel besser aus. Die Vorstellungen, die man vom Wohlfahrtsstaat Deutschland hatte, lassen sich nicht lange aufrechterhalten. „Viele Familien müssen auf engstem Raum zusammenleben. Manchmal bis zu zehn Personen in einer Zwei-Zimmerwohnung“ beschreibt Sag die Wohnsituation. Daraus entstanden nicht nur zahlreiche Konflikte zwischen den Generationen. Diese Verhältnisse verhinderten auch die Umsetzung religiöser Werte und Normen. Hierzu zählt die Trennung der Geschlechter ab dem 6. Lebensjahr. „Es war nicht immer möglich, dass Brüder und Schwestern in getrennten Räumen schlafen“. Auch das gewohnte Zusammenleben mit mehreren Generationen konnte nicht immer realisiert werden. „Man war froh, wenn man Frau und Kinder nach Deutschland holen konnte. An unsere Eltern durften wir nicht denken, das war zu schmerzhaft, sie in der Heimat allein zu lassen“. Die türkischen Familien sahen sich vor die Aufgabe gestellt, ihre Familien neu zu strukturieren und zu organisieren. Hierzu gehörte auch, sich in die Infrastruktur der „neuen Heimat“ zu integrieren. Doch daraus erwuchsen neue Probleme. Die Kinder kamen mit einer freiheitlich – demokratischen und an christlichen Werten orientierten Erziehung in Kontakt, die in zahlreichen Punkten in Widerspruch zu den Erziehungsinhalten in der eignen Familie stand. Eine Erzieherin bringt dies so zum Ausdruck: „Wir haben in unserer Kindertagesstätte immer wieder Konflikte mit türkischen Eltern, wenn wir die Kinder im Sommer nackt im Garten spielen lassen“. Das Unverständnis ist hier auf beiden Seiten. Die Erzieherin beruft sich darauf, dass die Eltern bei der Aufnahme über die Regeln der Einrichtung informiert wurden und sich auch damit einverstanden erklären müssen. „Wenn sie das nicht wollen, dann müssen sie ihr Kind in eine andere Einrichtung geben, oder zu Hause behalten“, so die Schlussfolgerung der Pädagogin. Auch andere Teilnehmerinnen berichten über ähnliche Konfliktsituationen. Es ist der verzweifelte Versuch, Tradition und Moderne miteinander zu verbinden. Einen „Ausweg“ oder kurzzeitige Rückzugsmöglichkeiten sehen viele nur noch im Aufbau einer „ethnischen Infrastruktur“. Sie schließen sich mehrheitlich in bestimmten Wohngebieten zusammen, eröffnen türkische Geschäfte mit landesüblichen Speisen, gründen Kultur- und Begegnungszentren und bemühen sich um die Erhaltung und Weitergabe ihrer Glaubensgrundsätze. Doch die zweite und besonders die dritte Generation teilen immer seltener die Vorstellungen der Eltern und Großeltern. „Wir sind hier geboren, die deutsche Kultur ist uns näher, als die türkische. Dem Vater gehorchen wir zu Hause, damit es nicht dauernd Stress gibt“, zitiert Sag die vielfachen Aussagen türkischer Jugendlicher heute. Das Autoritätsverhältnis in der Familie wird auch an anderer Stelle umgekehrt. Im Gegensatz zur sprachlichen und sozialen Integration türkischer Kinder und Jugendlicher, die durch schulische und berufliche Ausbildung gefördert wird, können die Eltern häufig – auch nach langjährigem Aufenthalt in Deutschland – die Sprache nur teilweise sprechen und verstehen. „Ich habe dann auch schon mal meine Entschuldigung für die Schule selbst geschrieben. Meine Mutter musste mir glauben, was sie da unterschrieb, verstehen konnte sie es nicht“ erzählt eine türkische Teilnehmerin. Der Versuch die traditionellen Werte zu erhalten gipfelt heute in der „Passfamilie“. Sag erklärt: „Der Ehepartner wird aus der Heimat importiert. Die Söhne werden mit jungen Mädchen von 15 oder 16 Jahren verheiratet. Diese haben, wie man bei uns sagt: Die Augen noch geschlossen. Sie entsprechen dem Bild einer treuen und fleißigen Ehefrau“. Weitere Motivationen eine Familie in dieser Form zu gründen beruhen auf dem Bestreben, die Volkszugehörigkeit zu stärken und das erworbene ökonomische Kapital nicht in „fremde“ Hände gelangen zu lassen. Sag selbst sieht dieses Verhalten eher kritisch: „Dadurch wird das weitere Heranwachsen einer Parallelgesellschaft gefördert“. Auch Bonkowski ist der Ansicht, dass ein Zusammenwachsen der Kulturen sich nur im gegenseitigen Austausch entwickeln kann: „Beide Seiten müssen sich verstärkt mit den institutionellen Aufträgen von Bildungs- und Erziehungseinrichtungen auseinandersetzen“. Sag sieht die momentanen Entwicklungen und Strömungen als „Übergangssituation“. „Die jüngere Generation hat begonnen sich zu fragen, wie sie ihren Kindern hier die Möglichkeit geben kann, zufrieden zu leben“. Damit ein Dialog statt finden kann, muss jedoch die Bereitschaft aller beteiligten Parteien geklärt werden. „Gibt es ein übergeordnetes gesellschaftliches oder politisches Interesse für einen solchen Dialog?“ lautet hierzu die Frage einer Teilnehmerin. Sag bestätigt, dass es dringend notwendig ist, gleiche Bedingungen für deutsche und ausländische MitbürgerInnen zu schaffen. „Wir brauchen ein Antidiskriminierungsgesetz, ein Zuwanderungsgesetz und interkulturelle Konzepte für pädagogische Institutionen“. Die Diskussion macht deutlich, dass eine deutsch – türkische Zukunft im gemeinsamen Dialog entwickelt und mit gestärkt werden muss. 15 Die Vielfalt der Lebenswege muslimischer Frauen von Daniela Schulz Ein Film über drei junge Frauen um die Zwanzig: Sie lachen zusammen, tuscheln, lachen wieder. Die Kamera begleitet die drei, wie sie Hand in Hand durch Berlin schlendern. Zwei von ihnen haben ihre Seidenkopftücher tief ins Gesicht gezogen und tragen lange, den Körper verhüllende Gewänder. Die dritte im Bunde ist eine attraktive Dunkelhaarige in modisch-knappem Top gen muslimischen Familie aufwuchs, beachtet sie sorgsam die Regeln des Koran. Die Familie, das bedeutet „bei uns nicht nur, dass die Eltern etwas zu einem sagen, wie bei den Deutschen, sondern auch Onkel, Tanten, Großeltern“, weiß Gülcin. Seit ihrem elften Lebensjahr tragen sie und ihre Schwester Gülcem Kopftücher. Zunächst weil die Eltern es so wollten, später aus eigener Überzeugung. Gülcem, die in dem Film gerade ihr Abitur macht, studiert mittlerweile Bauingenieurwesen. Ihre ältere Schwester Gülcin bereitet sich auf ihr Medizinexamen vor. „Ich bin hierher gekommen, um einiges aus dem Film richtig zu stellen“, erklärte Gülcin. Ihrer Meinung nach sind die Filmemacherinnen nicht sorgsam genug mit ihrer Privatsphäre umgegangen. „Ich wollte zeigen, dass es machbar ist, religiös zu leben, das Kopftuch zu tragen und dennoch selbständig zu sein und sich zu bilden, ohne dass der Bruder mit der Keule hinter einem her rennt“, erklärt die Medizinstudentin ihre Motivation zu dem Filmprojekt. und Jeans. Äußerlich so verschieden wie nur möglich sind Gülcem, Gülcin und Meyrem trotzdem Freundinnen. Die westlich gekleidete Meyrem versorgte schon als Kind ihre jüngeren Geschwister. „Mit sieben konnte ich schon Windeln wechseln und Babybrei kochen“, erinnert sie sich in dem Dokumentarfilm von Jana Matthes und Andrea Schramm „Kopftuch und Minirock – Junge Türkinnen zwischen Koran und Karriere“ aus dem Jahr 1998. „Ihre Mutter arbeitet täglich zwölf Stunden in einem Gemüseladen und hat keine Zeit, sich um die jüngeren Geschwister zu kümmern“, erklärt dazu Gülcin Yilmiz. So kam es auch, dass Meyrem in relativer Freiheit von der fest geregelten Welt einer islamischen Familie aufwuchs. Äußerlich führt sie einen westeuropäischen Lebensstil. Käme sie mit einem deutschen Freund nach Hause, „würde meine Mutter mich umbringen“, sagt sie. „Wozu auch“, kontert ihre Freundin Gülcin, „wenn es hier über zwei Millionen Türken gibt?“. Für Gülcin käme ein deutscher Mann niemals in frage: Da sie in der allgegenwärtigen Obhut einer strenggläubi16 Und das will sie sich und anderen nicht zuletzt durch ihr Studium beweisen. Zwölf Stunden am Tag zu büffeln oder in der Pathologievorlesung Leichen zu sezieren kann der ehrgeizigen jungen Frau nichts anhaben. Unangenehm ist ihr dagegen die hierzulande übliche Begrüßung durch Hände schütteln. „Das ist haram“, sagt sie. (Im Arabischen bedeutet haram soviel wie „verboten“). Islamische Frauen dürfen Männern nicht die Hand geben, denn dadurch könnten „in dem Mann bestimmte Gefühle entstehen“, erklärt Gülcin. Und das soll gemäß dem Koran auf alle Fälle vermieden werden. Die bei Deutschen als völlig unverfänglich geltende Höflichkeitsgeste ist für sie deshalb verboten. Außerdem, fügt die künftige Ärztin hinzu, finde sie Händeschütteln unhygienisch. Gülcins jüngere Schwester Gülcem wollte nach ihrem überdurchschnittlichen Abitur zunächst nicht zum AbiBall gehen. Mit Männern zu tanzen ist muslimischen Frauen ebenfalls nicht erlaubt; außer mit dem eigenen, versteht sich. Meyrem zuliebe ist sie dann doch mit gegangen. Der Dokumentar-Film zeigt Gülcem mit ihrer Freundin Meyrem auf dem Fest. Hier sitzt die gläubige Muslimin mit Kopftuch verschleiert am Tisch, die Tanzaufforderungen ihrer Klassenkameraden muss sie ablehnen. Die Freundin hingegen kommt im super-kleinen Schwarzen und genießt ausgelassen das Fest. Allerdings ist auch sie im Film nicht mit Männern zu sehen. Die Ausstrahlung des Films im Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) vor zwei Jahren hatte für Meyrem trotzdem unangenehme Folgen. Gülcin berichtete, dass ihre Freundin seither auf der Straße sowohl von türkischen als auch von deutschen Männern als „Schlampe“ tituliert werde. Mit ihrer eigenen Familie bekam sie wegen ihrer Kleidung auf dem Abi-Ball ernste Schwierigkeiten. Gülcin: „Seit dem Film kann sich Meyrem nicht mehr so anziehen, wie sie es zuvor tat, und sie kann sich nicht mehr so frei bewegen“. Entgegen vorheriger Absprachen, so Gülcin, hätten die Filmemacherinnen auch Szenen benutzt, die die jungen Frauen nicht gesendet haben wollten. Die Türkinnen wollen nun anwaltlich gegen die weitere Vermarktung des Films vorgehen. Die Folgen der Dokumentation für Meyrem werfen in drastischer Weise ein Schlaglicht auf die Problematik der Kleiderordnung für Musliminnen. „Die Frau soll ihre Reize verstecken und sich verhüllen, so steht es im Koran“, erklärt Gülcins und Gülcems Bruder. So dürften von einer Frau lediglich Gesicht, Hände und Füße zu sehen sein. Der Vater, der in der Türkei am Schwarzen Meer lebt, sieht es so: „Es gibt hier Männer, die ihre Grenzen nicht kennen, und sich deshalb europäisch gekleideten Frauen gegenüber schlecht benehmen“. Gülcin sagt: „Ich bin für Männer haram..., darum will ich vermeiden, dass ich Männer reize“. Im engeren Familienkreis jedoch sei es ihr gestattet mit offenem Haar und kurzen Kleidern herumzulaufen. Nach den Regeln des Islam sei es Frauen außerdem verboten, sich zu schminken, sagt Gülcin. Viele Musliminnen hielten sich zwar nicht daran, man könne sich aber nicht nur an das halten was einem passe. Ob Studium oder Religion, für die Studentin gilt in beiden Bereichen „ganz oder gar nicht“. Man könne, so sagt sie, auch nicht Medizin studieren, wenn man nicht bereit sei, zwölf Stunden täglich zu lernen. Ähnlich verhalte es sich mit dem Glauben. Meyrem erzählt in dem Film, dass ihre Brüder ihr vor einigen Jahren den Schminkkasten zertreten hätten. Sie brachte genügend Mut und Kraft auf, sich über die strengen Vorschriften hin- wegzusetzen und gewann den Machtkampf. Die Familie musste akzeptieren, dass sie sich schminkte und alleine – ohne brüderliche Bewachung – ausging. „Heute bin ich stolz darauf, dass ich mich durchgesetzt habe“, sagt sie in dem Film. Inwieweit darf eine Frau sich zeigen? Diese Frage bestimmte völlig die sich an den Film anschließende Diskussion. Manch eine der älteren Teilnehmerinnen wunderte sich, dass nach Jahrzehnten des Kampfes für die Rechte der Frauen solch eine Frage überhaupt noch gestellt werde. In den Ländern, in denen der Islam die vorherrschende Religion ist, wird die Auseinandersetzung um das Erscheinungsbild der Frau inzwischen zum Kulturkampf. Eine aus Ägypten stammende Muslimin berichtete vom extremen Auseinanderdriften der ägyptischen Gesellschaft: „Entweder man ist völlig religiös oder gar nicht“. Diese Teilung der Gesellschaft in traditionell-religiös und modernatheistisch spiegele sich im Aussehen der Frauen wider: So trügen die Ägypterinnen „entweder das Kopftuch und ein langes Kleid oder Minirock – und den sehr, sehr kurz“. Ähnliches spiele sich in Syrien ab, sagte eine mit einem syrischen Arzt verheiratete Deutsche. Die jungen Frauen gingen dort zwar im langen Mantel aus dem Haus, darunter aber trügen sie ihren Minirock. Der Mantel werde ausgezogen, sobald man sich in sicherer Entfernung vom Elternhaus befinde. Eine aus Tunesien stammende Teilnehmerin plädierte dafür, „sich so anzuziehen, wie man möchte“. Akshed Tash, aus einer deutschen Familie stammend, entschied sich für die andere Richtung. Sie legte vor acht Jahren die traditionellen islamischen Frauengewänder an. „Ich habe eine türkische Familie geheiratet, bin konvertiert und bereue es nicht“, erzählte sie: „Ich finde Freude, Friede und Ruhe in der Religion“. Der in der Türkei lebende Teil der Familie sei allerdings nicht gerade begeistert gewesen von ihrer Entscheidung, das Kopftuch zutragen: „Die verbanden mit der Heirat mit einer Deutschen die Hoffnung auf eine westlich eingestellte Frau...“. Während erwachsene Frauen sich mehr oder weniger selbst für oder gegen das Kopftuch entscheiden können, unterliegen junge Mädchen dem Machtwort der Eltern. Die Leiterin eines Flüchtlingswohnheimes in Neustadt berichte- te von einem Mädchen, das seit seinem elften Geburtstag dazu gezwungen werde, das Kopftuch zu tragen. Das Kind wehre sich mit aller Kraft dagegen. Es könne nicht verstehen, warum es sich nun verschleiern muss. „Ich habe damit Probleme, wenn ein Kind zu mir kommt und weinend erzählt, es dürfe nicht mehr schwimmen gehen, und es dürfe nicht auf Klassenfahrt mitfahren“, gesteht die Asylheimleiterin erschüttert. An die anderen Diskussionsteilnehmerinnen gewandt, fragte sie: „Wie kann man Kindern etwas verbieten, was sie gerne tun?“ Aus dem Forum kam der als „Hilfestellung“ gedachte Kommentar, „Druck auf die Eltern auszuüben, dass sie das Kind in den islamischen Religionsunterricht schicken sollen“. Dort solle ihm die Entscheidung der Eltern erklärt werden, sofern die selbst dazu nicht in der Lage seien. Dem Kind und seinem Wunsch nach Freiheit solle niemand beistehen. Kinder aus Migrantenfamilien seien in der Religion einem sehr großen Druck ausgesetzt, so die Erfahrung mehrerer Sozialarbeiterinnen. Grund hierfür sei das Gefühl der Entwurzelung, das die Eltern hätten: „Man hat fast alles verloren, und so klammert man sich an den Glauben, der noch mit zu Hause verbindet.“ Auch für Gülcin Yilmiz und ihre Familie bietet die Religion eine Heimat, die sie in Deutschland nicht gefunden haben. Die junge Frau spielt mit dem Gedanken in die Türkei zurückzukehren, wenn auch „nur mit einem Beruf“. Dennoch weiß sie: „In der Türkei hätte ich nicht ein Zehntel der Rechte, die ich hier habe“. Dort ist das Kopftuch in Schulen und Universitäten verboten. Zwar ist das Kopftuch in der Universität hierzulande erlaubt, trotzdem machte Gülcin die Erfahrung, dass das Kopftuch eine Hürde darstellt. Als sie sich in einem Supermarkt als Kassiererin vorstellen wollte, bot man ihr ungefragt die ebenfalls freie Stelle als Putzfrau an, obwohl sie Abitur hatte. „Den Job als Kassiererin bekam eine geschminkte und gestylte Frau angeboten“, erinnert sie sich. Als Gülcin einen Ferienjob im Krankenhaus suchte, musste sie ebenfalls eine Menge Absagen hinnehmen. Schließlich bekam sie doch eine Zusage von einer Klinik im vornehmen Berliner Stadtteil Wannsee. „Der Leiter sah mich an und schmunzelte“, erzählt sie. 17 „Als er mich fragte, ob ich Blut abnehmen könnte, antwortete ich mit ja – und da hatte ich den Job“. Die Patienten hätten auf sie in der Mehrzahl sehr höflich und freundlich reagiert, berichtet sie. Der Dokumentarfilm ließe allerdings nur einen älteren Patienten zu Wort kommen, der sich an ihrem Kopftuch störte, kritisiert Gülcin die Filmemacherinnen. Äußerlich gelassen ertrug die Medizinstudentin die penetranten Frotzeleien des Mannes. „Allerdings kotzt es mich an, jedes Mal für die Putzfrau gehalten zu werden“, beschwert sie sich in Hannover entnervt. „Das Kopftuch gilt als Sinnbild der dummen, unterdrückten muslimischen Frau“, brachte es eine Teilnehmerin auf den Punkt. Monika Gödecke, die Diskussionsleiterin, sah daher einen hohen Aufklärungsbedarf. Damit sei auch das Arbeitsamt gefordert, wandte sie sich an den Ausländerreferenten des Arbeitsamtes Hannover, Dieter Reinhard. Der bezweifelte, dass die Aufklärung, die das Arbeitsamt leisten könne, ausreichend sei. Vielmehr müssten die Medien aktiv werden. Ein Firmenleiter stehe auf dem Standpunkt: „Der, den ich einstelle, muss für uns attraktiv sein“. Eine neue Studie der Ruhruniversität Bochum belege zudem, „dass die Chancen für Mädchen mit Kopftuch äußerst begrenzt sind... Da geht sehr viel Potential verloren“, bedauerte der Ausländerreferent. „Die Vorurteile sind da und eben auch sehr groß“. Die Frage stelle sich daher „was machen Mädchen mit Abitur und guten Noten, die das Kopftuch tragen?“. „Gibt es da Kompromisse?“, wollte Reinhard von der Diskussionsrunde wissen. Gülcin erklärt überzeugt: „Auf keinen Fall“. Dennoch wusste der Arbeitsamtsvertreter auch von vielen Mädchen, die sagen, „ich trage das Kopftuch, aber die Eltern haben nichts dagegen, wenn ich im Beruf kein Kopftuch trage“. In der Tat wünschen sich viele türkische Eltern für ihre Kinder eine bessere Schulbildung, als sie selbst sie bekommen hatten. So erlaubte Gülcins und Gülcems Vater den Mädchen zu studieren. „Die Eltern wollen, dass ihre Töchter was lernen, damit sie nicht als Putzfrauen enden“, so Gülcin. Jobs im Reinigungsgewerbe seien typisch für die erste Generation der Migranten und 18 Migrantinnen, wirft eine Teilnehmerin ein. Jetzt, wo die zweite und mittlerweile dritte Generation in Deutschland lebe, solle diese es besser haben. Außer einer guten Schulbildung sei auch das Vertrauen wichtig, so Gülcin. Obwohl ihr Vater vor einigen Jahren in die Türkei zurückgekehrt sei, dürfen die Schwestern hier allein in einer eigenen Wohnung leben. Keine Selbstverständlichkeit. Auch beim Thema Klassenfahrt zeigt sich der Vater tolerant. Zwar war er zunächst dagegen, dass Gülcin im Gymnasium mit Lehrern und Mitschülern – ohne Eltern – wegfahren wollte, doch die Tochter konnte den Vater umstimmen. Heute sagt die junge Frau jedoch selbst: „Ich würde meine Töchter da nicht mitfahren lassen“. Es habe dort zu viele alkoholische Exzesse der Jungen gegeben, außerdem hätten Jungs im Mädchenschlafzimmer geschlafen und umgekehrt. Ihr persönlich habe das alles nicht gefallen. „Wenn ich möchte, dass meine Tochter nach der Religion lebt, muss ich dafür sorgen, dass mein Sohn auch nach der Religion lebt“, bemerkte dazu eine aus Ägypten stammende Bauingenieurin. In der Tat würden viele Eltern – egal ob türkische oder deutsche – ihren Söhnen mehr Freiheiten gestatten als ihren Töchtern. Ihrer Meinung nach werde die Religion oft instrumentalisiert, um die Töchter in Schach zu halten. Auch Gülcin gibt zu: „Bei islamischen Jugendlichen hüpfen die Jungs durch zehn Betten, aber geheiratet wird eine Jungfrau“. Ihre Freundin Meyrem, die sich das Recht erkämpft hatte, alleine ausgehen zu dürfen, hätte von ihrer Familie zu hören bekommen: „Geh wie ein Mann und komme wieder wie ein Mann“. Dieser zunächst unverständlich klingende Satz solle heißen, das die junge Frau körperlich genau so „unversehrt“ nach Hause kommen solle, wie ihre Brüder – als Jungfrau. Nur könne bei Männern keiner deren Jungfräulichkeit nachprüfen, im Gegensatz zu Frauen. „Es ist nicht nur der Islam, es gibt auch frauenunterdrückende Tendenzen in christlichen Religionen“, berichtete eine aus einer spanischen Familie stammende Sozialarbeiterin von ihren Erfahrungen. So seien beispielsweise ihre Verwandten nicht damit einverstanden gewesen, dass sie alleine ohne familiäre Aufsicht in Deutschland studierte. Sie seien sehr um ihren Ruf besorgt gewesen, erinnerte sie sich. Oft seien Musliminnen nicht über ihre Rechte informiert, fügte Gülcin hinzu. So sei der Ehemann nach den islamischen Vorschriften verpflichtet, materiell für die Familie zu sorgen. Er müsse der Ehefrau genügend finanzielle Mittel an die Hand geben, um den Haushalt führen können. „Oft erfahre ich solche Dinge von deutschen muslimischen Frauen“, erzählte die mittlerweile mit einem Türken verheiratete Frau kopfschüttelnd. Eine andere Teilnehmerin, die früher mit einem Muslim verheiratet war, berichtete ebenfalls von ihrer Unwissenheit hinsichtlich ihrer Rechte. „Dieser Mann sorgte überhaupt nicht für mich“, stellte sie fest. Gülcin forderte daher eine stärkere Aufklärung der islamischen Mädchen. Die soll jedoch im Religionsunterricht stattfinden. Sie selbst habe nie solchen Unterricht genossen und entdecke nun immer mehr Defizite. Diese Wissenslücken bezögen sich sowohl auf ihre rechtliche Situation als auch auf ihre Kenntnis des Koran. Die Suche nach dem Glauben beschäftigte auch die männlichen Diskussionsteilnehmer. So berichtete einer: „Ich habe meine Religion erst in Deutschland kennen gelernt und bin diesem Land sehr dankbar dafür“. Aus der Türkei stammend habe er erst im Alter von 15 Jahren angefangen nach dem Islam zu leben. Auch er sieht einen hohen Aufklärungsbedarf: „Die Gesellschaft fordert, dass wir ihr erklären, was wir machen“. Als Resümee der Diskussion könnte schließlich das Plädoyer einer jungen Frau aus marokkanischem Elternhause stehen: „Man muss die Nationen mehr zusammenbringen, damit sie sich verstehen“. So habe sie auf der Weltausstellung EXPO 2000 beobachtet, dass es dort „völlig normal war, mit der Djellabah herumzulaufen“. Die Djellabah ist ein marokkanischer Mantel mit Kapuze. Während der EXPO hätten ihre Eltern nicht mehr „diese überraschten, komischen Blicke“ geerntet, wie in der Zeit davor. Die junge Frau hofft, „das der Weltausstellungs-Effekt anhält“. Eine offene Moschee und ihre nichtmuslimische Nachbarschaft von Halima Krausen Als vor ein paar Jahren der 3. Oktober zum „Tag der offenen Moschee“ erklärt wurde, haben wir im Islamischen Zentrum Hamburg leicht das Gesicht verzogen: Noch ein Termin? Bei uns ist doch jeder Tag ein „Tag der offenen Moschee“! Oder? Die Moschee liegt direkt am Alsterufer in einer Straße namens „Schöne Aussicht“. Das ist durchaus wörtlich gemeint. Vom Anlegesteg aus sieht man nicht nur den See, manchmal mit Segelboten, und eine wunderschöne Parklandschaft, sondern auch das gesamte Panorama von Hamburg. Folgerichtig hält dort im Sommer alle paar Minuten ein Rundfahrtbus und nach einem kurzen Blick auf das Hamburger Panorama, oft durch eine Kameralinse, kommen die Touristen auch zu uns herüber. Manchmal in Shorts und Top und mit Eis und Zigaretten und nicht immer nett und höflich, aber sie sind neugierig. Inzwischen haben wir es so eingerichtet, dass sie vom Vortragsraum aus einen Blick in den Gebetsraum werfen können, ohne die Schuhe ausziehen zu müssen, wenn sie keine Zeit haben „richtig“ herein zu kommen. Das Islamische Zentrum ist die älteste Moschee in Hamburg und bislang die einzige, die von Anfang an als solche gebaut wurde. Die Idee stammte aus den 50er Jahren, als es im Hamburg nur wenige muslimische Kaufleute und Studenten gab – die Kaufleute hatten das Geld, die Studenten Ideen und kreative Initiative, und das Zentrum wurde als das gebaut, was es bis heute ist: Ein internationales Begegungszentrum für Muslime aller islamischen Richtungen aus dem Großraum Hamburg und weit darüber hinaus. Erst nach der Grundsteinlegung 1961 begann die Welle der Arbeitsmigration mit dem Ergebnis, dass die Moschee, als sie fertig wurde, auch schon zu klein war. Heute gibt es in Hamburg rund 120.000 Muslime mit ca. 40 Moscheen und Gebetsräumen, meist umfunktionierte Wohnungen, Häuser oder Lagerhallen mit vor allem stadtteilbezogener Bedeutung, wo man sich in der Nachbarschaft überwiegend mit Menschen derselben Muttersprache zum Gebet trifft, die Kinder den Koranunterricht besuchen, man die Feste in der Ausprägung feiert, mit der man aus dem Herkunftsland vertraut ist. Was tun wir nun in unserem Alltag? Bei uns gibt es in deutscher Sprache und unabhängig von der kulturellen Prägung und Rechtsschulenzugehörigkeit ein weitreichendes Angebot. Da ist einmal der Bereich Seelsorge und Beratung. Da gibt es Unterrichtsangebote für Kinder und für Erwachsene, die bis hin zur theologischen Weiterbildung für alle ungeachtet der Religionszugehörigkeit offen sind. Da gibt es Gesprächskreise, öffentliche Vorträge, kulturelle Veranstaltungen, und dann natürlich die Auseinandersetzung mit aktuellen Fragen der Praxis: Muslime im Krankenhaus, im Kindergarten, in der Schule, Begräbnisplätze, Schächten, Diskriminierung am Arbeitsplatz und in der Ausbildung. Dabei sind wir Ansprechpartner im ganzen norddeutschen Raum und darüber hinaus, für Muslime aus verschiedenen Herkunftsländern mit verschiedenen Problemen, viele von ihnen aus bikulturellen und bireligiösen Familien. Da ist „multikulturell“ gar kein Ausdruck! Ja, selbstverständlich gibt es Spannungen und Konflikte. Das gibt es ja sonst auch überall da, wo Menschen zu verschiedenen gesellschaftlichen Berufsund Interessengruppen gehören. Es gibt Spannungen zwischen Ehepartnern, zwischen den Generationen, im Zusammenhang mit verschiedenen Nationalitäten und oft genug sprachliche Missverständnisse. Da ist zunächst geduldiges Zuhören erforderlich um festzustellen, worum es eigentlich geht. Mancher Konflikt ist symptomatisch. Bei der Diskussion beispielsweise um das Kopftuch geht es nicht um das Stückchen Stoff, sondern um grundlegende Ängste um die eigene Identität, und zwar auf beiden Seiten. Wenn man da Brücken bauen will, gibt es verschiedene Ansätze. Manchmal ist es schon damit getan, Missverständnisse zu klären. So redet man oft aneinander vorbei, wenn etwa in Verbindung mit dem Begriff „Islam“ ein Muslim versucht, seine ethischen Prinzipien und Ideale zu erläutern, während sein nichtmuslimischer Gesprächspartner mit demselben Wort als Betrachter von außen einen Missstand in einem Krisengebiet der Welt ansprechen möchte, an dem Muslime beteiligt sind: Beide haben ein berechtigtes Anliegen, reden aber aneinander vorbei. Oft ist es bei Spannungen und Konflikten notwendig, das Selbstvertrauen und Identitätsgefühl zu stärken und damit Ängste abzubauen. Dies kann nur von innen her und auf der Grundlage der jeweils eigenen Werte gesche19 hen, nicht durch Abgrenzung oder gar Feindbilder. Es ist auch wichtig, gemeinsame Perspektiven aufzuzeigen: Ein gemeinsames Anliegen kann zur Grundlage einer punktuellen Zusammenarbeit werden, bei der man Unterschiede nebeneinander stehen lassen, tolerieren oder sogar verstehen lernen kann. Und schließlich ist es manchmal sogar möglich, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen, das allerdings wie ein Gefäß ist, das Liebe und Sorgfalt bei der Herstellung erfordert, aber leicht zerbrechen kann. Unsere Nachbarschaft in der Schönen Aussicht ist nicht ein Industriegebiet oder ein Wohnviertel mit einem hohen muslimischen Bevölkerungsanteil, wie bei den meisten Moscheen im Stadtzentrum. Beim Dialog mit den Nachbarn ging es also zunächst schlicht und einfach um Lärm – sei es der, der bei uns zustande kommt wenn Veranstaltungen spätabends zu Ende gehen (vor allem im Ramadan), sei es der, der aus Nachbars Stereoanlage oder vom Segelclub herüberschallt, während bei uns eine Trauerfeier stattfindet. An einem „Tag der offenen Tür für Nachbarn“ bei Kaffee und Kuchen konnten wir uns darüber aussprechen, und seitdem klappt es mit der Verständigung. Inzwischen haben sich auch Kontakte mit der benachbarten Kirchengemeinde ergeben, die sich in gegenseitigen Besuchen und gelegentlichen gemeinsamen Veranstaltungen äußern. Da unsere Moschee eine lange Tradition der deutschsprachigen Arbeit hat, gibt es regelmäßig Besuche von Schulklassen, Studentengruppen, Bundeswehr oder Vereinen, oft in Verbindung mit der Arbeit an speziellen Themen. Abgesehen davon, dass unsere theologischen MitarbeiterInnen oft als Referenten zu Informationsveranstaltungen über den Islam eingeladen werden, finden auch bei uns immer wieder auch interreligiöse Gespräche statt. Darüber hinaus sind wir an verschiedenen Projekten beteiligt wie dem christlich-islamischen Arbeitskreis der Evangelischen Kirche Deutschlands, der jüdisch-christlich-muslimischen Konferenz, wo es darum geht, längere Tagungen zu organisieren, bei denen Juden, Christen und Muslime sich bei Vorträgen, Diskussionen, Projektgruppen und Gottesdiensten näherkommen, und dem Arbeitskreis Interreligiöser Dialog an der Universität Hamburg, der seit nunmehr fast 18 Jahren jedes Semester themenbezogen in die tatsächliche Begeg20 nung von Buddhismus, Judentum, Christentum und Islam einführt und aus dem eine Reihe von anderen Projekten hervorgegangen sind. Andere Moscheen in Hamburg hatten eine zeitlang in den 70ern und frühe 80ern eine Zeit der Verschlossenheit und Selbstbesinnung. Bei der ersten Generation der Arbeitsmigranten hatte man meist die Vorstellung, dass man nach einigen Jahren in die Heimat zurückkehren würde. Und als es sich erwies, dass es wohl um einen dauernden Aufenthalt gehen würde, hatte man mit Anfragen an das Selbstverständnis, mangelnden Sprachkenntnissen und dem Aufbau einer Infrastruktur zu ringen. Mit der jüngeren Generation, die über einen besseren Bildungsstand gute Deutschkenntnisse hat und mit der deutschen Kultur vertraut ist, kam es zu einer allmählichen Öffnung sowohl für den innerislamischen als auch für den interreligiösen Dialog, der zu vielen neuen Ansätzen führte. Im Laufe der Zeit entstand aus der spontanen Selbsthilfe eine effektivere Struktur, die bei allen Muslimen auch sehr viel mehr Selbstsicherheit bewirkt hat. Zur gemeinsamen Interessenvertretung nach außen wurden Foren und später die bereits erwähnten Dachverbände gebildet, die der internen Vielfalt Rechnung tragen. In der unmittelbaren Nachbarschaft kam es vor allem in Krisenzeiten (2. Golfkrieg, Bosnienkrieg) spontan zu einer Verständigung mit benachbarten Kirchengemeinden mit abwechselnden Gesprächsveranstaltungen und multireligiöse Gebetsund Meditationsveranstaltungen für den Frieden. Sicherlich haben diese Erfahrungen dazu beigetragen, dass außer dem bundesweiten „Tag der offenen Moschee“ Initiativen zustande kommen konnten wie die gegenseitigen Einladungen im Ramadan/Advent im vergangenen Dezember, die sicher vielen Christen und Muslimen ganz neue Erfahrungen nicht nur der Unterschiede, sondern auch der Gemeinsamkeiten ermöglicht haben und die dieses Jahr fortgesetzt werden sollen. Die Öffnung geschieht durchaus von zwei Seiten her. Gleichzeitig geschah nämlich auch eine Öffnung des traditionell evangelischen Religionsunterricht in Richtung auf einen dialogischen „Religionsunterricht für alle“, bei dem es darauf ankommt, mehr authentische Beiträge aus nichtchristli- chen Religionen mit einzubeziehen, sei es in Form von Unterrichtsmaterial, bei dessen Erstellung wir inzwischen mitarbeiten, sei es durch Besuche von Moscheen und Gespräche mit denen, die da lehren. Nun gibt es so ein geflügeltes Wort, das besagt: „Wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein“. Ja, da gibt es auch Dinge, die wir nicht wollen. Das ist nämlich eine „Gleichschaltung“. Ich benutze mit Absicht diesen Ausdruck für eine starke Vereinheitlichung der Gesellschaft. Kreative Dynamik in der menschlichen Gemeinschaft entsteht immer durch die Verschiedenheit, in der Menschen einander ergänzen und bereichern und eine organische Einheit bilden, eine Einheit in der Vielfalt. Soweit unsere Aktivitäten aus meiner Sicht. Wenn ich allerdings die Berichterstattung in der Presse oder im Fernsehen betrachte, erkenne ich mich oft selbst nicht mehr wieder. Sie konzentriert sich nämlich eher auf die Spannungen und Konflikte, die auch vorkommen, aber nicht unser Alltag sind. Ich würde mir wünschen, dass die gelungenen Ansätze zu Gesprächen und Zusammenarbeit mehr in den Vordergrund gerückt würden, und dass wir mehr miteinander reden als übereinander. Christentum und Islam – Facetten einer spannungsvollen Beziehung von Dr. Ralf Geisler Sich als christlicher Theologe über einige Facetten der spannungsvollen Beziehung zwischen Christentum und Islam zu äußern, kann nur heißen, einen ersten Überblick über die religiöse Verhältnisbestimmung beider Religionen zueinander zu vermitteln! Zwei Dinge sind damit von vornherein ausgeschlossen: • Ich kann keine Aufarbeitung der spannungsvollen gemeinsamen Geschichte zwischen Christentum und Islam leisten, auch wenn daraus Licht auf viele aktuelle Spannungen fiele. • Bei allem Bemühen um Objektivität ist meine Darstellung natürlich nicht religionswissenschaftlich neutral, falls es so etwas in Reinform überhaupt gibt, sondern ich spreche als Christ. Ein Muslim bzw. eine Muslimin würde möglicherweise andere Facetten betonen. • Mein Ziel wäre erreicht, wenn es mir gelingen würde, eine Perspektive zu eröffnen für die friedliche Koexistenz von Christen und Muslimen bei uns. Ich setze ein mit einer Merkwürdigkeit, ja geradezu einer paradoxen Situation hinsichtlich unserer Wahrnehmung des Islams: Einerseits rechnet man den Islam ganz selbstverständlich zu den fünf großen „klassischen“ Weltreligionen, als da sind Judentum, Christentum, Islam, Hinduismus und Buddhismus. Das lernt man schon in der Schule. Andererseits: Beobachtet man, wo und wie der Islam bei uns zum Thema wird, etwa in den Medien, so kann man vom Islam als Religion so gut wie nichts entdecken! Denn thematisiert wird der Islam vornehmlich als machtpolitischer Faktor in bestimmten Krisensituationen oder auch unter sozialpolitischer Perspektive als Gegenstand von Integrationsbemühungen in eine herrschende Leitkultur, stets also aus einem politischen Blickwinkel. Oder aber man wendet sich dem Phänomen „Islam“ unter ökonomischen Gesichtspunkten zu: Da geht es dann um die Erdölvorräte am Persischen Golf, um Tourismus in islamische Länder und um die Eigenart von „Islamic Banking“. Großer Beliebtheit erfreut sich ferner eine kulturhistorische Betrachtungsweise, die sehr viele schöne Bücher über islamische Architektur und Ornamentik hervorgebracht hat. Längst hat auch der politische Feminismus den Islam als Gegner von Fraueninteressen ausgemacht. Westliche Feministinnen haben den Islam als ein atavistisch-patriarchalisches Herrschaftssystem entlarvt, das seine Züge von repressiver Intoleranz vor allem gegenüber dem weiblichen Teil der Menschheit entfaltet. Sie sehen: Der Islam wird bei uns vornehmlich durch die säkulare Brille betrachtet! Man meint, dem kulturell fremdartigen Phänomen „Islam“, wie gewohnt, mit dem geläufigen Arsenal säkularer Sezierwerkzeuge zu Leibe 21 rücken zu können. Aber bis zum „Kern“, also bis zum Wesen des Islams dringt man damit leider nicht vor! Das, was den Islam von seinem Selbstverständnis her prägt und was die Gläubigen in ihm sehen und an ihm haben, dessen wird man mit der säkularen Brille auf der Nase gerade nicht gewahr: Dass uns nämlich mit dem Islam neben dem, was er alles sonst noch ist, zunächst und vor allem eine andere Religion begegnet!. Muslime repräsentieren eine von der jüdischen und christlichen Version spezifisch unterschiedene, aber eben auch eine Form des Gottesglaubens. Erst wenn wir die säkulare gegen die religiöse Brille getauscht haben, werden wir erstaunt erkennen können, wie viel – neben allen Eigenheiten und bleibenden Unterschieden – den Islam mit dem jüdischen und dem christlichen Glauben verbindet. Erst eine sachgemäße religiöse Betrachtungsweise eröffnet die Möglichkeit, vordergründige kulturelle Differenzen zwischen westlicher und orientalisch geprägter Lebensweise als sekundär einzuordnen und dahinter die zahlreichen Gemeinsamkeiten zu entdecken, die den Islam an die biblische Tradition anknüpfen lässt und ihn mit ihr verbindet. Wir müssen uns bewusst machten, dass Judentum, Christentum und Islam geschichtlich in ein und denselben Traditionsstrang gehören. Sie sind nach einander – allerdings in großem zeitlichen Abstand – in ein und demselben geographischen Raum entstanden. Das ergibt bereits eine Nähe und aufeinanderfolgende Beeinflussungen. Für das Verhältnis von Christentum und Judentum ist uns das relativ deutlich: Jesus war Jude und seine Jünger ebenfalls. Für Christen ist er der verheißene Messias – das sehen Juden anders! Christen und Juden haben die hebräische Bibel, von den Christen Altes Testament genannt, mit den 10 Geboten sowie den Psalmen gemeinsam. Der Gott, zu dem Jesus die Menschen führt und den Christen als seinen Vater bekennen, dieser Gott ist auch der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Viel ferner liegt meist schon die Einsicht, dass auch der Islam in diesen Traditionsstrang gehört. Bekanntlich aber ist der Islam auf der arabischen Halbinsel durch Offenbarungen an Moham- 22 med im 7. Jh. nach Chr. entstanden. Zu jener Zeit lebten in diesem Gebiet sowohl Juden als auch Christen verschiedener Prägungen. Mohammed hatte intensiven Kontakt gehabt zu Juden und Christen. Von daher lässt sich jüdischer und christlicher Einfluss im Koran ohne weiteres belegen. Diese historische Sichtweise der drei Religionen ist die eine Sache. Sie nimmt aber unmittelbaren Einfluss auf das Selbstverständnis der einen Religion im Verhältnis zu den beiden anderen. Das Judentum kann sich als die älteste der drei Traditionen verstehen, und von daher ist leicht einsehbar, wenn es in seinen Nachfolgern, Christentum und Islam, Fehlentwicklungen des eigenen richtigen Weges sieht. Das Christentum steht in der Mitte, erkennt seine Wurzeln und bleibende besondere Verbundenheit mit dem Judentum an, hat jedoch dem Islam eine geschwisterliche Anerkennung aufgrund seines eigenen Absolutheitsanspruches bisher im Großen und Ganzen verweigert. Der Islam andererseits als jüngste Entwicklung verweist oft auf den gesunden Menschenverstand, der doch stets die neuesten Entwicklungen und Erfindungen als das Modernste und Fortschrittlichste und damit Gültige akzeptiert. In diesem Sinn will sich der Islam als die modernste Ausformung des Glaubens an den einen Gott verstanden wissen, während Judentum und Christentum entsprechend zurückgeblieben und überwunden seien. Dieses Selbstverständnis unterstreicht der Islam damit, dass er behauptet, Judentum und Christentum hätten die Offenbarung Gottes verändert und erst er Islam habe wieder zu dem ursprünglichen Gottesglauben zurückgeführt. Das ist das besondere Offenbarungsverständnis im Islam, wie es bereits im Koran niedergelegt ist. Denn dort begegnen uns eine ganze Reihe von Gestalten, die schon aus der jüdischchristlichen Bibel bekannt sind: Adam, Noah, Abraham, Isaak, Ismael, Moses und Jesus (Mit Jungfrauengeburt und Wundern!). Dahinter verbirgt sich die Vorstellung, Gott habe im Laufe der Menschheitsgeschichte, also seit der Schöpfung, immer wieder einzelnen Propheten und als solchem auch Jesus eine Offenbarung seines göttlichen Willens zukommen lassen. Die Menschen aber hätten diese Offenbarung im Laufe der Zeit verändert und verfälscht, so dass nicht mehr auseinander zu halten gewesen sei, was Offenbarung war und was menschliche Zutat. Darum sei die Offenbarung schließlich an Mohammed ergangen und – das ist wichtig – sofort unverfälscht im Koran aufgeschrieben worden. Da Gott zu seinen früheren Offenbarungen unverändert stehe, sei es doch einsichtig, dass früher ergangene Offenbarungen nun in der authentischen Form auch an Mohammed übermittelt worden seien. Ähnliche Inhalte wie im Judentum und Christentum seien also nicht auf irdisch-geschichtliche Abhängigkeit zurückzuführen, sondern sie erklärten sich aus der gnädigen Offenbarung Gottes. Der Koran aber sei ohne jedes Zutun von Menschen geoffenbart worden – Mohammed habe im Übrigen gar nicht ein so göttlich schönes Arabisch schreiben können, und von daher sei der Koran wortwörtlich Gottes eigenes Wort. Die Botschaft des Koran zeichnet sich also auch nach dem Selbstverständnis der Muslime nicht durch ihre besondere Originalität aus, sondern durch ihre Authentizität; das heißt Mohammed offenbarte nur, was Moses und Jesus auch schon offenbart hatten, nur eben unverfälscht und authentisch! Lassen Sie uns als bisheriges Zwischenfazit festhalten: Der gemeinsame historische Traditionsstrang weist Judentum, Christentum und Islam als monotheistische Religionen aus, in denen jeweils nur der eine höchste Gott verehrt wird. Gemeinsam ist den drei Religionen der Glaube an diesen Gott als Schöpfer, der seine Schöpfung auch heute noch durch „Rechtleitung“, also die Kundgabe seines Willens erhält. Gemeinsam ist der Glaube an ein letztes Gericht, vor dem sich jeder persönlich für sein Leben verantworten muss. Gemeinsam ist schließlich die Kenntnis bestimmter Propheten als Verkünder des göttlichen Willens. Die große Anfrage des Islam an das Christentum bezieht sich auf die Einhaltung des monotheistischen Prinzips in der Gottesvorstellung. Der religiöse Grundgedanke des Islam ist die Hingabe an den einen Gott, in der der Mensch Frieden findet. Alles dreht sich letztlich um die TAVHID, um die Einzigkeit Gottes. Er ist der EINE im Sinne: Gott ist der EINZIGE wie auch der EINHEITLICHE und EINZIGARTIGE Gott. Von dem strikten Bekenntnis des Islam zu dem einen Gott aus erscheint die christliche Trinitätslehre als ein Glaube an drei Götter. Und selbst wenn hier gröbste Missverständnisse inzwischen überwunden sein sollten – auch Muslime erkennen in der Regel an, dass Christen wohl immer nur den einen Gott meinen, wenn sie von dem dreieinigen Gott sprechen – das christliche Bekenntnis zu Jesus Christus als Sohn Gottes ist für Muslime unannehmbar. Zwar wird Jesus als ein großer Prophet verehrt; zwar spricht auch der Koran von Jesus als dem WORT GOTTES und er wird GEIST GOTTES genannt. Von seinen Taten wird rühmend berichtet. Aber bei aller Verehrung kann der Islam in Jesus keine wirkliche Heilsbedeutung sehen. Die christliche Bezeichnung Jesu als Gottessohn wird von daher als Gotteslästerung empfunden: Hier werde Gott mit menschlichen Kategorien beschrieben und damit werde eine Göttlichkeit angetastet! Wenn der Islam die Gottessohnschaft Jesu verwerfen muss, weil sie seinem Verständnis von Gott widerspricht, so ist nun genauso der Bericht von der Kreuzigung Jesu aus islamischer Sicht eine gotteslästerliche Angelegenheit. Gott in seiner Macht kann es einfach nicht zulassen, dass sein großer Prophet Jesus, der nach dem Koran so stark über alle anderen Propheten herausgehoben ist, von den Menschen misshandelt und gar noch gekreuzigt wird: Sie töteten an seiner Stelle einen anderen, heißt es darum im Koran (Sure 4, 156ff). Man kann den Unterschied zwischen dem christlichen und dem islamischen Gottesglauben in Bezug auf Jesus am besten so auf den Punkt bringen: Nicht Gott offenbart sich (wie die Christen glauben, in dem Juden Jesus aus Nazareth), sondern Gott teilt den Menschen seine Offenbarungen mit – unter anderem durch Jesus! Dieser Unterschied im Gottesglauben lässt die Frage aufkommen, ob Christen und Muslime überhaupt an denselben Gott glauben. Zunächst wird man feststellen, dass jede der beiden Religionen einen anderen Zugang zu Gott hat, dass man sich jeweils von einer anderen Seite her Gott nähert und darum auch eine jeweils verschiedene Ansicht von Gottes Wesen gewinnt. Das Bild, das Christen sich von Gott machen, ist dabei nicht abzulösen von Jesus Christus. Das bedeutet: Man kann christlicherseits nicht unterscheiden zwischen einem allgemeinen Gottesbild und einem speziellen, in das nachträglich erst die spezifisch christlichen Züge eingezeichnet werden. Dazu kann der Islam eigentlich nur sagen: Das ist nicht der wahre Gott. Und umgekehrt müssten Christen den Muslimen sagen: Ihr glaubt nicht an den ganzen Gott. Und doch beziehen sich beide, Christen wie Muslime, auf den einen selben Gott, beten nur ihn an dienen ihm allein. Ich lasse dieses Paradox so stehen, vielleicht reizt es ja zum Weiterdenken. Sie haben sich für eine Weile die religiöse Brille aufsetzen lassen und einen ersten, zugegebenermaßen recht oberflächlichen Blick auf die spannungsvolle religiös-theologische Beziehung zwischen Christentum und Islam geworfen. Diese stete Spannung resultiert aus der einmaligen Mischung von Nähe und Verwandtschaft einerseits sowie von charakteristischer Distanz und Unterschiedenheit zwischen beiden Religionen andererseits. Ich bin der festen Überzeugung: Die Rückbesinnung auf die religiöse Ebene ist von ausschlaggebender Bedeutung für eine friedliche Nachbarschaft beider Religionen in Deutschland und dem künftig erweiterten Europa. Auch die Republik Türkei genießt ja seit dem 10.12.99 den offiziellen Beitrittskandidatenstatus zur EU. Der Karlsruher Soziologe Fuad Kandil hat vor einigen Jahren richtig gesehen, dass für jedes interkulturelle Lernen ein gewisses Maß an Empathie und Sympathie Voraussetzung ist. Beides aber würde „im Falle des Islam hierzulande noch weitgehend fehlen.“ Kandil spielt damit auf die andauernde kulturelle Fremdheit islamischer Lebensäußerungen in der Öffentlichkeit an, die stets erneut für Irritationen und lebhafte Mediendebatten sorgen (Kopftuch, Moscheebau, Muezzin-Ruf usw.). Von dieser kulturellen Fremdheit ist besonders die türkischstämmige Bevölkerung betroffen, die häufig schon äußerlich sichtbar kulturelle Andersartigkeit repräsentiert und damit immer wieder zur Zielscheibe von rassistischen Übergriffen wird. So mussten wir am Beginn dieser ersten niedersächsischen Islamwoche mit Entsetzen erfahren, dass deutsche Jugendliche grundlos eine türkische Familie im Kreis Uelzen überfallen hatten. Und plötzlich werden die Erinnerungen an die grauenvollen Morde von Mölln und Solingen bei vielen wieder wach. Die Wiederentdeckung der religiösen Ebene und der Umgang miteinander auf dieser Ebene, also das, was man interreligiöser Dialog nennt zwischen Christen und Muslimen und auch Juden, ist ein gangbarer Weg, um die Mauer kultureller Fremdheit zu durchbrechen und eben jene erforderliche Empathie und Sympathie füreinander wachsen zu lassen. Wo religiöse Gemeinsamkeiten entdeckt werden, entstehen Gefühle von familiärer Zusammengehörigkeit, die auch die Unterschiede im jeweiligen Glauben aushalten lassen. Auf diese Weise können sich gegenseitige Achtung und ein wechselseitiger Respekt entwickeln, die zu echter Toleranz führen. An dieser Stelle, um diesen Prozess der religiösen Umgangs miteinander zu fördern, haben die christlichen Kirchen, aber ebenso die religiösen Organisationen der Muslime eine gemeinsame wichtige Aufgabe. Mit Freude konnte ich in den letzten Jahren beobachten, dass sich die Einsicht in die Wahrnehmung dieser Verantwortung sowohl auf christlicher wie auf islamischer Seite immer stärker durchsetzt. Auf allen Ebenen gibt es so mittlerweile viele erfreuliche Beispiele für gelungene Kommunikation und Kooperation, auch hier bei uns zwischen Ems und Elbe. 23 Das Wagnis Toleranz von Rena Bürger Wer einen beschaulichen Austausch über Weltanschauungen und unterschiedliche Standpunkte erwartet hatte, der sollte in der Diskussion „Begegnung zwischen Muslimen und Christen“ eine Überraschung erleben. Pastor Hermann Bremer beginnt seine Ausführungen zunächst mit zwei Texten, die die Einstellung des Christentums zum Islam verdeutlichten sollen. In einem Text aus dem Jahre 1913 wird der Islam als Erbfeind des Christentums bezeichnet. Die „tiefstehende Sittenlehre“ und der Fanatismus, die kennzeichnend für diese Religion seien, hätten zu den schlimmsten Greueltaten geführt. Allein durch den Monotheismus und seine „Bildungselemente“ führte der Islam „viele orientalische Völkerschaften aus den niedrigsten religiösen Anschauungen zu einer höheren Stufe empor und bildete für sie auf diese Weise eine entfernte Vorbereitung, ein Übergangsstadium für das Christentum“. Im II. Vatikanischen Konzil von 1965 zeigt sich bereit seine ganz andere Einstellung der katholischen Kirche zum Islam. Hier werden die Gemeinsamkeiten beider Religionen hervorgehoben. Man betrachte, so heißt es, die Muslime mit Hochachtung und sei um ein gegenseitiges Verstehen bemüht. „Hier wird sehr gut deutlich, wie sich die Einstellung von Christen gegenüber dem Islam im Laufe eines halben Jahrhunderts grundlegend gewandelt hat“ so Bremer. Während er in seinem Vortrag fortfährt, werden die Zuhöre- 24 rInnen zunehmend unruhiger und äußern schließlich offen ihren Unmut. Herrmann Bremer wird vorgeworfen, er würde zu theoretisch an die Problematik herangehen. Er selbst vertritt dagegen die Ansicht, dass es vorab notwendig sei, bestimmte Begriffe und Standpunkte zu erklären, die immer wieder im Dialog zwischen Muslimen und Christen zu Missverständnissen führten. Er hat große Schwierigkeiten, den Teilnehmern die Notwendigkeit seiner Einführung zu vermitteln und nach wiederholten Unterbrechungen, in denen immer wieder gefordert wird, nun doch endlich mit dem Dialog zu beginnen, gibt er schließlich das Wort an Kemal Schahin. Schon seit vielen Jahren ver- sucht dieser gemeinsam mit Pastor Bremer Christen und Muslime an einen Tisch zu bringen und das Gespräch zwischen den beiden Gruppen zu fördern. Er betont, dass die meisten Muslime diesen Kontakt wünschen und auch offen sind für gemeinsame Veranstaltungen. So hat Pastor Bremer schon mehrmals eine muslimische Gemeinde zum gemeinsamen Fastenbrechen in seine Kirche eingeladen. „Die Angst vor dem Anderen muss überwunden werden“, so Schahin, und das geht am besten, wenn man die Gelegenheit hat, die Anderen und einen Teil ihrer Kultur im persönlichen Austausch kennen zu lernen. „Aber was ist denn nun mit dem Dialog?“ Die Teilnehmer werden erneut unruhig und es ist offensichtlich, dass sie nicht mehr zuhören, sondern selbst von ihren eigenen Erfahrungen berichten wollen. Es geht kreuz und quer, alle reden gleichzeitig und ein roter Faden ist nicht zu erkennen. Auf der einen Seite des Raumes fragt gerade jemand, ob es denn nun eigentlich der gleiche Gott sei, an den Muslime und Christen glauben. Die Gemüter erhitzen sich an der dieser Frage, bis jemand einwendet, dass jetzt nicht der geeignete Zeitpunkt sei, theologische Fragen zu diskutieren und dass man sich lieber auf die alltäglichen Probleme konzentrieren sollte. Eine Frau berichtet daraufhin über die Schwierigkeiten in ihrer täglichen Arbeit an der Schule. Sie ist selbst Muslima und wird immer wieder mit dem Problem konfrontiert, dass muslimische Mädchen nicht am Schwimmunterricht teilnehmen dürfen. „Ich akzeptiere ja, dass die Eltern nicht wollen, dass sie sich im Badeanzug zeigen, aber es müsste eine Spezialkleidung geben, die mehr vom Körper verdeckt. Sie nicht am Unterricht teilnehmen zu lassen ist unverantwortlich, denn im Zweifelsfall setzen sie damit ihr eigenes Leben oder das eines anderen Menschen aufs Spiel. Warum wird den Mädchen so vieles verwehrt und Jungen dürfen alles?“. An der Reaktion auf dieses Beispiel wird die Vielfalt der Meinungen deutlich. Eine muslimische Frau ist empört über den Vorschlag ihrer Vorrednerin und vertritt die Ansicht, Jungen und Mädchen sollten am besten auf verschiedene Schulen gehen, um nicht „voneinander in Versuchung geführt zu werden“. Zwei deutsche Frauen erheben sich und wollen den Raum verlassen. „Das hören wir uns nicht länger an. Davon bekommt man ja Magenschmerzen“. Ein muslimischer Mann wirft ein, dass die Ansichten der Muslima schon längst nicht mehr zeitgemäß seien und man den Glauben nicht an Äußerlichkeiten festmachen sollte: „Glauben findet im Herzen statt“, beendet er seinen Kommentar. Ein anderer muslimischer Mann versucht zu vermitteln und schlägt vor, Jungen und Mädchen zumindest getrennten Schwimmunterricht zu geben. So wür- de den Regeln des Korans genügt und gleichzeitig den Mädchen die Möglichkeit eröffnet, das Schwimmen zu lernen. „Aber wie soll das praktisch funktionieren?“, wendet jemand ein. „Man kann doch nicht für eine Handvoll Mädchen ein ganzes Schwimmbad schließen“. Eine deutsche Frau fragt, was denn die Muslime befürchteten, was den jungen Mädchen zustoßen würde, wenn sie sich im Badeanzug zeigten. „Unsere Kinder, Jungen wie Mädchen, sind so erzogen, dass sie recht gut damit umgehen können einander so zu sehen, ohne sich sofort aufeinander zu stürzen. Sie sind es seit jeher gewohnt und es ist deshalb nichts Besonderes für sie“. Die Uneinigkeit besteht nicht nur zwi- schen Muslimen und Christen, sondern auch innerhalb der beiden Gruppen. Es wird deutlich, dass weder die einen noch die anderen eine homogene Einheit darstellen. Die meisten scheinen sehr überrascht zu sein, bei der jeweils anderen Gruppe auf eine solche Vielschichtigkeit von Ansichten zu treffen. Man kann nicht von den Muslimen oder den Christen sprechen. Dies klar zu erkennen bedeutet, von einer ganzen Reihe von Vorurteilen und Stereotypen Abschied nehmen zu müssen. Was dann übrig bleibt ist der Mensch als solcher, mit seinen ganz individuel- len Bedürfnissen, Beweggründen und Anschauungen. Kemal Schahin betonte, dass eine Voraussetzung für ein friedliches Zusammenleben die Nächstenliebe sei. Aus der Sympathie füreinander entsteht Respekt und Achtung vor den Dingen, die für den Anderen von Bedeutung sind. Erst das Wissen über andere Religionen und Kulturen kann dazu beitragen, die nötige Toleranz zu schaffen. Um dieses Wissen zu erlangen, müssen wir lernen einander zuzuhören. Kommunikationskonflikte, die oftmals unüberbrückbar erscheinen, können wir überwinden, wenn es uns gelingt die Sorge um den Verlust der eigenen Identität sowie der vertrauten Werte und Normen zu verlieren. Wie schwierig das sein kann wurde in dieser Diskussion nur allzu deutlich. Toleranz setzt jedoch den Mut voraus, sich auf das Fremde einzulassen. Wenn wir der Verschiedenartigkeit der Menschen nicht mit Angst begegnen, sondern offen für das Andere, das Fremde sind, können sich daraus Perspektiven für eine friedliche Koexistenz entwikkeln, lautet ein Fazit der Diskussion. 25 Alevitischer Islam – Hand in Hand mit dem Dede von Dany Schrader Zahlreiche Muslime gehören dem Alevitentum an – einer Glaubensrichtung, die bisher wenig Aufmerksamkeit findet. Ali Ucar, Professor für Erziehungswissenschaften an der Humboldt-Universität Berlin, versuchte in der „Woche der Muslime“ diese Form des Islam bekannter zu machen. Auf dem Bildschirm ist ein anatolisches Dorf in de Nähe von Antalya zu sehen. „Jetzt wird es ernst“, sagt Ali Ucar, als er den Film in den Videorecorder einlegt. Während die Teilnehmer aufmerksam zusehen, erklärt der Erziehungswissenschaftler die einzelnen Rituale des Cem, der religiösen Versammlung alevitischer Islamisten. Männer, Frauen und Kinder jeden Alters bekennen ihren Glauben an den monotheistischen Gott Allah dabei gemeinsam. Begleitet wird das Cem auch in dem kleinen anatolischen Dorf von Musik, Gesang und Tanz. Im Film, der bei einem Besuch Ucars mit einer Berliner Schulklasse in der Türkei entstanden ist, heben die Aleviten gerade beim Tanz im Wechsel zunächst die rechte Hand und halten sie einem Spiegel gleich vor das Gesicht, während sie mit der Linken symbolisch das eigene Herz berühren. Auch bei einem späteren Filmausschnitt, der die Teilnehmer der Arbeitsgemeinschaft wieder nach Deutschland führt, wird deutlich, wie sehr die Ausübung des Glaubens von Symbolen geprägt ist: Beim El-ele-el-Hakka, fassen sich die Mitglieder einer Gemeinde an der Hand und bilden so eine Kette vom einfachen Mitglied bis hin zu ihrem religiösen Führer, der in Verbindung mit Gott steht. Eng ist der Kontakt zwischen den Menschen selbst beim Massen-Cem im Kölner Stadion, wo Mikrofone und Lautsprecher die Musik der Saiteninstrumente und den Gesang in die Menge transportieren. In der Mitte steht ein schamanengleicher alter Mann, dessen Kappe und Gewand reich mit Ornamenten verziert sind. „Das“, sagt Ali Ucar und deutet auf den Alten, „das ist der Dede, der religiöse Führer“. Anders als Schiiten, Sunniten und Kadschiten verehren die Aleviten nicht Mohammed. Ihre Heiligen sind die zwölf Imame, die Söhne des Religionsbegründers Ali, mit denen der Dede, der weise Führer einer Religionsgemeinde, geistig in Verbindung steht. „Die Aleviten gehen davon aus, dass Allah in ihnen und ihren Herzen Ist“, erklärt Ucar. 26 Pilgerfahrten nach Mekka unternehmen sie nicht und auch die Versammlungen werden anstatt in einer Moschee in unregelmäßigen Abständen im Haus eines Gemeindemitgliedes abgehalten. Überhaupt sei das Alevitentum durch eine enge Gemeinschaft der Angehörigen geprägt. „In den kleinen Dörfern in der Türkeit gibt es keine Familie, die nicht mit einer anderen eine spirituelle Brüderschaft geschlossen hat und sich daraufhin gegenseitig unterstützt“, berichtet Ucar. Dass der Alevismus nicht auf die fünf Säulen des Islams aufgebaut ist, sei hingegen der Grund, weshalb diese Glaubensrichtung von Muslimen nur schwer akzeptiert würde. Dennoch gehören immerhin 30 Prozent der türkischen Bevölkerung dieser Konfession an, in Deutschland leben derzeit etwa 600.000 Aleviten, die sich seit Beginn der Neunziger Jahre auch in eigenen Gemeindezentren organisieren. Verbreitet ist der Glaube jedoch weit über die Türkei hinaus, bisher fehlen jedoch Untersuchungen zu Zahlen und Verbreitungsgebieten der Anhänger, die unter anderem auch im ehemaligen Jugoslawien leben. „Dieser Bereich des Islam ist einfach noch viel zu wenig erforscht“, sagt Ucar. Erst seit 1990 gäbe es nach und nach Bestrebungen, Literatur über das Alevitentum zu veröffentlichen. Einen Vergleich mit den übrigen islamischen Konfessionen will der Professor, der 1960 als erster türkischer Lehrer an einer deutschen Schule in Berlin unterrichtete, innerhalb der Arbeitsgruppe nicht anstellen. Auch die Versuche einiger Teilnehmer in der anschließenden Fragerunde, das Alevitentum in Konfessionen einzuordnen, lehnt er ab. Vielmehr will er einen Einblick geben in das sensible Thema, dem seiner Ansicht nach noch viel zu wenig Beachtung geschenkt wird. Zu Beginn hatte Ucar daher alle Teilnehmer gebeten, eigenes Wissen und eigene Vorstellungen über den Alevismus in Stichpunkten auf einem Zettel zu notieren. Und ebenso vielfältig wie die Antworten darauf, ist laut Ucar auch die Religion selbst. Bereits bei der Ernennung von Mohammeds Schwiegersohn Ali um 650 fand das Alevitentum seinen Ursprung. Schon nach Mohammeds Tod hatte dieser dessen Nachfolge als Kalif antreten wollen, Osman und Omar waren ihm jedoch zuvor gekommen. Obwohl auch mit Alis Antritt der Koran weiter- hin die Glaubensgrundlage für die Aleviten bildete, entwickelte sich dieser Teil des Islams stetig in eine andere Richtung als die Schiiten, Kadschiten und Sunniten. Anstelle der drei Fastenmonate des Ramadan, üben die Aleviten nur zwölf Tage im Jahr Verzicht, auch das tägliche Gebet wird durch die unregelmäßig veranstalteten Cems ersetzt. Darüber hinaus finden sich in den Regionen und Gruppen der Aleviten zahlreiche Bräuche und Riten aus Naturreligionen wie Zaratustra, Mazdeismus und Buddhismus. „Der Dede ist beispielsweise eine Art Schamane“, sagt Ucar. Und auch die Reinkarnation ist fester Bestandteil des Glaubens, auch Ali soll nach seinem Tode wieder auferstanden sein. „Trotz seiner mystischen Interpretation des Korans zählen sich die Aleviten zum Islam“, sagt Ucar am Ende seines Vortrags. Die zum Teil widersprechenden Teilnehmer verweist der Professor auf eine Aussage des Theologen Ralf Geisler von der Evangelischen Landeskirche: „Warum reicht es den Aleviten nicht, ihrer eigenen Religion anzugehören und warum widersprechen die Islamisten, wenn die Aleviten zu ihnen gehören? Können diese Glaubensrichtungen nicht zusammenarbeiten?“ Die Grundlage aller sei schließlich noch immer der Koran, sagt Ali Ucar. Besuch in einer unbekannten Welt: Die Moschee in Hannovers Stiftstraße von Solveig Vogel Vor mehr als dreißig Jahren ist der Islam mit den Arbeitsmigranten nach Deutschland gekommen. Viele der jetzt Dreißig- bis Vierzigjährigen sind schon mit den Kindern dieser ersten Einwanderergenerationen zur Schule gegangen. Doch selbst solche einstigen Klassenkameraden sind sich mit ihren verschiedenen Kulturen und Religionen oftmals bis heute fremd geblieben. Christentum und Islam hatten in Deutschland bisher nur wenige Berührungspunkte. In Hannover gab es Islamkunde zum Anfassen. Fulya Kurun, Mittlerin für ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger in der Polizeidirektion Hannover, begleitet eine Gruppe zu einer Führung durch die Moschee in der Stiftstraße im Zentrum von Hannover. Zum Islam gehört unbedingt die Gastfreundschaft. Das war die erste Erfahrung, die die knapp 20 Männer und Frauen bei ihrer Exkursion in die Moschee machten. Denn die hannoverschen Mitglieder der Türkisch Islamischen Union der Anstalt für Religion (DITIB) bereiteten ihnen einen herzlichen Empfang in ihrem Versammlungsraum. Ergin Okan und Huseyin Dumlu, die beiden Vorsitzenden von DITIB in Hannover, servierten höchstpersönlich Tee und Börek, während der Referent Abdullah Güldogan den interessierten Gästen derweil schon Rede und Antwort zum Verein wie auch zur islamischen Religion stand. Anfangs stellten die Besucher, trotz der warmherzigen Begrüßung, noch eher formelle Fragen, etwa nach der Rolle der Imame, ihrer Ausbildung oder ihrer Position innerhalb der türkischen Gesellschaft. Der Imam, der Vorbeter einer muslimischen Gemeinde, sorgt dafür, dass der Koran richtig verstanden wird. Er übersetzt die Botschaft Allahs aus dem arabischen Original in die Alltagssprache der Gläubigen. „Das ist vor allem für die Kinder wichtig“, erklärte Güldogan. Die benötigten in den ersten Jahren unbedingt diese religiöse Führung. Erst später, wenn sie reifer seien, dürften sie sich ihre eigenen Gedanken über das Wort Allahs machen – immer unterstützt jedoch durch den Imam. Damit Gläubige aus nicht arabischen Ländern den Koran ebenfalls lesen können, ist er inzwischen zwar auch in zahlreichen anderen Sprachen zu haben. „Doch da sich Arabisch nicht exakt übersetzten lässt, sind das alles schon Interpretationen, die vom Origi- 27 überzeugt. Gebetet wird deshalb grundsätzlich in Arabisch: Die kleinen Muslime lernen in der Koranschule die Suren, die Gebetsverse, auswendig, ohne eigentlich deren Sinngehalt zu verstehen. Die Aufgabe des Imams ist es, ihnen die Bedeutung der Verse zu vermitteln. Wer sich darüber hinaus noch mit den Texten befassen will, kann zusätzlich in einer Übersetzung nachlesen. Im Laufe des Nachmittags wagten sich die Moscheebesucher allmählich zu kritischeren Fragen vor. „Warum sind die Imame Beamte, wenn die Türkei doch ein weltlicher Staat ist“, wollte einer wissen. Ein anderer fragte, ob das Gehalt des muslimischen Vorbeters in Deutschland wesentlich höher liege als das eines Amtskollegen im Heimatland. Kurun, selber in der Bundesrepublik aufgewachsene Türkin, wusste solche Fragen anschaulich zu beantworten. So verwies sie beispielsweise auf die geographische Lage der von muslimischen Nachbarstaaten umgebenen Türkei. „In dieser Situation will der türkische Staat der Religion einen festen Rahmen geben“, erklärte sie. Weil die Türkei trotz der Stärke des Islams ein säkularer Staat sein und bleiben wolle, setze sie auf verbeamtete Imame. So sichere sich die Politik die Vormachtstellung vor der Religion und verhindere, dass diese aus dem Ruder laufe – selbst im fernen Deutschland. Dort falle die monatliche Bezahlung eines muslimischen Vorbeters übrigens im Vergleich zwar wesentlich höher aus als das des Kollegen naltext abweichen“, ist der Referent 28 in der Türkei. „Aber in der Bundesrepublik entspricht es lediglich der untersten Besoldungsgruppe von Beamten“, berichtet Kurun. 300 Mitglieder zählt DITIB in der niedersächsischen Landeshauptstadt. „Aber wir sind bestimmt vielmehr Muslime hier, denn es lassen sich längst nicht alle bei uns registrieren“, ist sich Güldogan sicher. Deutlich werde das manchmal, wenn zu den Freitagsgottesdiensten der Platz in der Moschee nicht ausreiche. An Spitzentagen müssten sie auf dem ganzen Innenhof des Gebäudekomplexes von DITIB Gebetsteppiche auslegen, damit alle Gläubigen an der Feier teilhaben können, beschreibt der Referent. Angesichts der Vielzahl muslimischer Mitbürger in Hannover hat DITIB es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, auch Deutsche über die islamische Religion zu informieren und heißt Gäste in der Moschee grundsätzlich herzlich willkommen. „Ich sage immer: kommt nur alle rein mit euren Käsefüßen“, berichtet Güldogan schmunzelnd in Anspielung darauf, dass ein muslimisches Gotteshaus nur ohne Schuhe betreten werden darf. Die Gäste entledigten sich folglich ebenfalls ihrer Stiefel und Schuhe um danach bestrumpft in die vollständig mit Gebetsteppichen ausgelegte Moschee zu gehen. Und als hätten sie mit ihrem Schuhwerk auch den letzten Rest distanzierte Förmlichkeit abgelegt, kam nun ihr Wissensdrang viel unvermittelter zum Vorschein. Was stellt das Mu- einer Gemeinde an ihren Vorbeter neigte sich der Nachmittag in der Moschee dem Ende zu. Pfarrer Andreas Probst aus Oldenburg haben die Stunden bei DITIB gefallen. „Das war sehr viel konkreter als nur ein Vortrag über den Islam“, lobte er. Da er als Seelsorger in der Flüchtlingshilfe arbeite, hatte er sich einen Einblick in das islamische Denken verschaffen wollen. Seine Kollegin Gitta Schmidt zeigt sich zudem davon beeindruckt, dass nicht Frauen, sondern Männer die Gäste bedient hatten. ster auf den Teppichen dar, wollten sie etwa wissen. Oder: Wie viele Perlen hat eine Gebetskette und welche Bedeutung haben diese? Während die Teilnehmer im Halbkreis auf dem Boden saßen, machte Güldogan ihnen die Moschee begreifbar – und das oft genug im Wortsinn. So durfte etwa jeder eine Gebetskette in die Hand nehmen, sie betasten und mit ihr spielen. „Die haben in der Regel 33 Perlen, zu jeder von ihr spricht der Gläubige einen anderen Namen für Gott, damit lobpreist er ihn“, erklärte der Muslim. Der weiche, aus der Türkei stammende Teppich, ist in viele kleine Rechtecke aufgeteilt, die alle das gleiche Motiv zeigen: Die Konturen einer Moschee, deren Spitze gen Osten in Richtung Mekka zeigt – und auf den Platz des Immans. Der wartete an diesem Nachmittag schon, mit weißer Kappe und weißem Gewand bekleidet, auf seinen Vorführ-Einsatz für die Gäste. „Von seinem erhöhten Platz aus verkündet er aber nicht nur die Botschaft des Koran, sondern nimmt auch Stellung zu gesellschaftlichen Problemen oder gibt unsere Präventionsveranstaltungen bekannt“, berichtete Mittlerin Kurun lächelnd. Nicht nur das Gotteshaus und seine Einrichtung konnten die Besucher hautnah und zum Anfassen erleben. Während sie noch fragend religiöse Rituale und deren Bedeutung erkundeten, kamen immer wieder gläubige Muslime zum Gebet in die Moschee. Einige von ihnen setzten sich nur für die innere Zwiesprache mit Gott, wohingegen andere ein wenig verweilten und zuhörten, wie Güldogan den Wissensdurst seiner Zuhörer stillte. Jeder dieser eintretenden Gläubigen bereicherte die Führung mit Lebendigkeit und Wärme. Das klingelnde Handy des DITIP-Vorsitzenden Okan ermittelte zudem einen Eindruck davon, dass selbst nicht religiöser Alltag Einzug in die Moschee halten kann. Und der allgegenwärtige Geruch nach Rasier- und Duftwasser erzählte den Anwesenden leise Geschichten von den Männern, die sonst zu Gebet und Gottesdienst dorthin kommen. Wohlgemerkt: Es handelte sich um Herrendüfte. Denn die Frauen haben normalerweise in der Stiftstraße keinen Zutritt zur Moschee. Sie kommen stattdessen in einem eigenen Raum in der oberen Etage des Hauses zusammen und verfolgen den Gottesdienst von dort aus über Lautsprecher. In diesem Raum unterrichtet der Imam auch die Koranschüler. Wo die Kinder zur Religionsstunde an kleinen hölzernen Pulten hocken und etwa arabische Laute sprechen lernen, ließen sich an diesem Nachmittag die Gäste aus dem Dasein eines Vorbeters erzählen. Der sollte mitten im Leben stehen und nicht anders leben als andere Menschen, erklärte Güldogan. „Ein Zölibat wie in der katholischen Kirche kennen wir nicht“. Vielmehr sei es sogar erwünscht, dass der Imam verheiratet sei und Kinder habe. So könne er der Gemeinde am ehesten seine menschlichen Qualitäten zeigen, unterstrich der Referent. Mit dem Einblick in die Erwartungen 29 Grundbegriffe, Literatur und Adressen zusammengestellt von Dr. Ralf Geisler Islam in Deutschland – ein Überblick Islamisch-türkische Organisationen Der Islam ist nach den beiden christlichen Konfessionen die drittgrößte Religionsgemeinschaft in Deutschland. Nach neueren Schätzungen leben gegenwärtig etwa 2,9 Millionen Muslime in der Bundesrepublik. Rund 75% kommen aus der Türkei, die anderen aus dem Nahen Osten, Iran, Südostasien, Nordafrika und, bedingt durch den Krieg im ehemaligen Jugoslawien, aus Bosnien. Die Zahl der deutschen Muslime wird, je nach Interesse, mit 48000 bis 100000 angegeben. Obwohl die Geschichte der Anfänge des Islams ins 18. Jahrhundert zurückgeht, hat sich die islamische Gemeinde in Deutschland in ihrer heutigen Form vor allem durch Arbeitsimmigranten, aber auch durch den Zustrom von Asylsuchenden entwickelt. Die ersten repräsentativen Moscheen entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg in Aachen und München, Hamburg wurde das Zentrum des schiitischen Islam in Deutschland. Die drei großen Dachverbände des türkischen Islams haben ihren Sitz in Köln: Verband Islamischer Kulturzentren (VIKZ)/Islam Kültür Merkezieri Birligi e.V., der bereits in den sechziger Jahren gegründet und später umbenannt wurde. Diese Organisation wird von der SüleymancilarBewegung bestimmt, deren Gründer Süleyman Hilmi Tunahan (1881 – 1959) dem Nakschibendi-Orden angehörte. Seine Anhänger vertreten eine sunnitisch-hanefitische Erneuerungsbewegung hierarchischer Struktur mit teils fundamentalistischen, überwiegend traditionsorientierten Zügen, mit der Zielsetzung, Koranunterweisungen überall sicherzustellen und das Kalifat wiederzuerrichten (vgl.: Christoph Elsas, Identität – Veränderungen kultureller Eigenarten im Zusammenleben von Türken und Deutschen, Hamburg 1983, S. 88). Herkunftsländer der in Deutschland lebenden Muslime Türkei 2.049.060 Bosnien 340.526 Iran 111.084 Nahost/Arab. Länder 115.000 (Syrien, Irak, Jordanien, Libanon) Nordafrika 150.000 (Ägypten, Algerien, Libyen, Marokko, Somalia, Sudan, Tunesien) Zentral- und Südostasien 95.000 (Afghanistan, Bangladesh, Indonesien, Malaysia, Pakistan) 30 Zusammen mit der Nurculuk-Bewegung, eine Erweckungsbruderschaft zur Wiedergewinnung des Glaubens (Gründer war Said Nursi, 1873 – 1960) stellt sie den konservativen Flügel des türkischen Islam Deutschlands dar. Ende der siebziger Jahre wurde heftige Kritik an den Koranschulen geübt, insbesondere von linksorientierten und säkularen Gruppen. Der VIKZ e.V. betreut etwa 250 Gemeinden. Seit 1999 ist der VIKZ in Landesverbänden organisiert (LVIKZ). Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (DITIB)/Diyanet Isleri Türk-Islam Birligi Im Zusammenhang mit der politischen Entwicklung 1980 wurde die DITIB in Deutschland als religiöse Instanz aktiv, ihr Zentrum in Köln wurde 1985 eröffnet. Sie betreut etwa 700 Gemeinden mit insgesamt 110.000 Mitgliedern. Konservative türkische Muslime sehen in der Existenz dieser obersten staatlichen Religionsbehörde einen Widerspruch zur laizistischen Staatsidee, die Trennung zwischen Staat und Religion beinhaltet. Vereinigung der neuen Weltsicht in Europa (IGMG)/Islamische Gemeinschaft Milli Görüs Diese Vereinigung bestand bereits seit Mitte der siebziger Jahre als Union national-religiöser Gruppierungen. 1985 hat sie sich in ihrer jetzigen Form konstituiert und ist mit etwa 70.000 Mitgliedern in 300 Gemeinden der größte nichtstaatliche Dachverband. Erst in den achtziger Jahren ist eine Differenzierung des Islam und der mit ihm zusammenhängenden Gruppierungen sowie auch der nichtmuslimischen Gruppen, die unter den Arbeitnehmern aus der Türkei leben, eingetreten. Mehr als 500.000 muslimische Kinder besuchen die deutschen Schulen. Für die Lehrer war es mitunter schwierig, bestimmte durch die Religion geprägte Verhaltensweisen der Kinder zu verstehen. So nehmen nach einer Repräsentativumfrage nur 40% der Mädchen am Schulsport teil. Schüler aus strenggläubigen Elternhäusern empfinden auch den Musikund Kunstunterricht als unislamisch. Verehrung oder Anbetung von Bildnissen sind im Islam verboten. In Hamburg befindet sich das schiitische Zentrum mit der Imam-Ali-Moschee. Als Folge der islamischen Revolution im Iran leben bei uns fast 80.000 Iraner, die meisten sind Flüchtlinge vor dem Mullah-Regime. Andere Schiitengruppen stammen aus dem Libanon und dem Irak. Gelegentlich kommt es zu Spannungen unter den hier lebenden Muslimen und auch zwischen ihnen und der übrigen Bevölkerung, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem gegen den muslimischen Schriftsteller Salman Rushdi verhängten Todesurteil wegen seines Buches Die Satanischen Verse. Auch der Golfkrieg bekam durch die Ausrufung des Heiligen Krieges von Seiten des irakischen Präsidenten eine religiöse Dimension. Erst kürzlich hat der Vertreter des Islamischen Pressedienstes Berlin, H. Mohammed Herzog, die Anerkennung des Islam als gleichwertige Religionsgemeinschaft in Deutschland gefordert. Toleranz im Sinne einer Duldung sei nicht ausreichend, die Muslime in Deutschland wünschten sich die Anerkennung islamischer Wertvorstellungen in Bezug auf Familie und Gesellschaft. Dazu gehörte nach ihrer Meinung auch die Mög- lichkeit des Religionsunterrichts an den öffentlichen Schulen. Ausdrücklich wurde betont, dass Muslime, die in Deutschland leben, nicht für alle Vorfälle in der islamischen Welt mitverantwortlich gemacht werden sollten. (Gekürzte und aktualisierte Fassung aus Einheit in der Vielheit. Weltreligionen in Berlin, Berlin 1993) Kontakte zu Moscheen Moscheen (Gebetsräume), die mehrheitlich türkisch geprägt sind, finden sich mittlerweile auch in vielen kleineren Städten. Allein 68 Moscheen in Niedersachsen und Bremen gehören dem Dachverband der DITIB an, des staatsoffiziellen türkischen Islam. Anschriften/Kontakte können über das für die Bundesländer Niedersachsen und Bremen zuständige Generalkonsulat vermittelt werden: Generalkonsulat der Republik Türkei Attaché für Religiöse Angelegenheiten An der Christuskriche 3, 30167 Hannover Tel.: (0511) 14330 In Hannover befindet sich die Hauptmoschee der DITIB in der Stiftstraße 11, Tel.: (0511) 1318568. Der Religionsattaché kennt in der Regel auch die Moscheen, die zu den beiden anderen Dachverbänden des türkischen Islams in der Bundesrepublik gehören. Deren Hauptmoscheen in Hannover sind: IGMG (Islamische Gemeinschaft Milli Görüs) Aya Sofya Moschee Weidendamm 9, 30167 Hannover Tel.: (0511) 7011323 LVIKZ (Landesverband der Islamischen Kulturzentren Niedersachsen e.V.) Alte Stöckener Str. 42, 30419 Hannover Tel.: (0511) 2715569; Fax: (0511) 2718472 Daneben gibt es unabhängige Moscheen, die aufgrund des Konkurrenzkampfes der islamischen Dachverbände entschieden haben, sich von politischen Festlegungen freizuhalten. Vertreter aller genannten Moscheevereine sind nach Absprache gern zu Führungen durch die Räumlichkeiten und zu Gesprächen über den islamischen Glauben bereit. 31 Literatur zum Islam Einführungen Begegnung mit dem Islam Eckhart von Vietinghoff, Hans May (Hrsg.) (Protestantische Beiträge zu Fragen der Zeit, Bd. 1) Hannover: Lutherisches Verlagshaus 1997 Der Islam. Ein Lesebuch Maria Haarmann (Hrsg.in), (Beck’sche Reihe, Bd. 479) München: Beck 1992 Der Islam. Religion – Ethik – Politik Peter Antes u.a., Stuttgart/Berlin/Köln: Kohlhammer 1991 Islam verstehen Hrg. vom Studienkreis für Tourismus e.V., Starnberg 1992/1993 (Sympathie Magazin Nr. 26) Die Welten des Islam. Neunundzwanzig Vorschläge, das Unvertraute zu verstehen Gernot Rotter (Hrsg.), Frankfurt a.M.: Fischer 1993 (Fischer TB 11480) Was jeder vom Islam wissen muss Hrsg. vom Lutherischen Kirchenamt der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands und vom Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland, (Gütersloher Taschenbücher Bd. 786), Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, Gerd Mohn 51996 Mohammed und der Koran Der Koran. Einführung – Texte – Erläuterungen Tilman Nagel, München: Beck 1983 Der Koran Übersetzt von Max Hennig. Mit einem Vorwort von Annemarie Schimmel, Stuttgart: Reclams Universal-Bibliothek Die Religion des Islam - Eine Einführung Richard Hartmann, mit einem Nachwort zur Neuausgabe von Annemarie Schimmel, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1992 Der Koran Übersetzung von Adel Theodor Khoury. Unter Mitwirkung von Muhammad Salim Abdullah. Mit einem Geleitwort von Inamullah Khan, Generalsekretär des Islamischen Weltkongresses, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn 1987 Geschichte der islamischen Theologie Von Mohammed bis zur Gegenwart Tilman Nagel, München: Beck 1994 Der Koran Übersetzung von Rudi Paret, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz: Kohlhammer ²1980 Nachrichten von Taten und Aussprüchen des Propheten Muhammad Sahih al-Buhari, Stuttgart: Reclams Universal-Bibliothek 1991 So sprach der Prophet. Worte aus der islamischen Überlieferung Ausgewählt und übersetzt von Adel Theodor Khoury (Gütersloher Taschenbücher, Bd. 785), Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn 1988 Geschichte des Islams Der Islam I. Vom Ursprung bis zu den Anfängen des Osmanenreiches Claude Cahen, Frankfurt a.M.: Fischer Weltgeschichte, Bd. 14 Mohammed Maxime Rodinson, Luzern/Frankfurt a.M. 1997 Mohammed und der Koran Rudi Paret, (Urban-Taschenbücher Bd. 32), Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz: Kohlhammer 5 1980 Die Schia Heinz Halm, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1988 Deutsche Koranübersetzungen Geschichte der arabischen Welt Ulrich Haarmann (Hrsg.), München: Beck ²1991 Religiöse Grundlagen Die Glaubenslehren des Islam Hermann Stieglecker, Paderborn: Schöningh 1983 (1962) 32 Der politische Harem. Mohammed und die Frauen Fatema Mernissi, Frankfurt a.M.: Dagyeli 1989 Die Frau in der türkischen Gesellschaft Nermin Abadan-Unat (Hrsg.in), Frankfurt a.M. 1985 Texte der Überlieferung (Sunna) Der Islam II. Die islamischen Reiche nach dem Fall von Konstantinopel G.E. von Grunebaum (Hrsg.), Frankfurt a.M.: Fischer Weltgeschichte, Bd. 15 Al-Quran Al-Karim und seine ungefähre Bedeutung in deutscher Sprache Hrsg. von M.A. Rassoul, Köln: IB Verlag Islamische Bibliothek ³1988 Frauen im Islam Ich bin eine Frau aus Ägypten Jehan Sadat, München: Heyne 1991 O ihr Musliminnen ... Frauen in islamischen Gesellschaften Ina und Peter Heine, Freiburg 1993 Schwestern unterm Halbmond. Muslimische Frauen zwischen Tradition und Emanzipation Naila Minai, Stuttgart: Klett 41991 Gegenwärtiger Islam Der Islam als Alternative Murad Wilfried Hofmann, mit einem Vorwort von Annemarie Schimmel, München: Diederichs 1992 Der Islam als politischer Faktor Peter Antes, herausgegeben von der Landeszentrale für politische Bildung, Hannover 1997 Der Islam im Aufbruch? Perspektiven der arabischen Welt Michael Lüders (Hrsg.), München/Zürich: Piper ²1993 Der Islam in der Gegenwart Werner Ende, Udo Steinbach (Hrsg.), München: Beck 41994 Der Islam und das Problem der kulturellen Bewältigung sozialen Wandels Bassam Tibi, Frankfurt a.M.: Suhrkamp ²1991 (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft Bd. 531) Der politische Auftrag des Islam, Programme und Kritik zwischen Fundamentalismus und Reformen. Originalstimmen aus der islamischen Welt Andreas Meier, Wuppertal: Peter Hammer 1994 Die Krise des Modernen Islams. Eine vorindustrielle Kultur im wissenschaftlichen-technischen Zeitalter Bassam Tibi, München: Beck 1981, (Beck’sche Reihe Bd. 228) Islam in Deutschland Geschichte des Islams in Deutschland Muhammad Salim Abdullah, (Islam und westliche Welt, Bd. 5), Graz/Wien/Köln: Styria 1981 In fremder Erde. Zur Geschichte und Gegenwart der islamischen Bestattung in Deutschland Gerhard Hopp, Gerdien Jonker (Hrsg.), Berlin: Das Arabische Buch 1996 (Arbeitshefte Bd. 11) Islamischer Religionsunterricht an staatlichen Schulen in Deutschland Praxis-Konzepte-Perspektiven, Dokumentation eines Fachgespräches, Nr. 8 Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen, 11017 Berlin, Sept. 2000 Islamische Organisationen in Deutschland Dr. des. Thomas Lemmen, Sankt Augustin, herausgegeben vom Wirtschafts- und sozialpolitischen Forschungs- und Beratungszentrum der Friedrich-Ebert-Stiftung, Abt. Arbeit und Sozialpolitik, Juli 2000 Muslime in Deutschland Nebeneinander oder Miteinander? Ursula Spuler-Stegemann, (Herder Spektrum Bd. 4419) Freiburg/Basel/Wien: Herder 1998 Das Schwert des Experten. Peter Scholl-Latours verzerrtes Araber- und Islambild Verena Klemm, Karin Hörner (Hrsg’in.), Vorwort von Heinz Halm, Heidelberg: Palmyra 1993 Allahs Plagiator. Die publizistischen Raubzüge des Nahostexperten Gerhard Konzelmann Gernot Rotter, Heidelberg: Palmyra 1992 Christlich-islamische Begegnung Das Eigene als Fremdes. Chancen und Bedingungen des christlich-islamischen Dialogs Ralf Geisler, Hannover: Lutherisches Verlagshaus 1997 (Mensch – Natur – Technik Bd. 1) Zusammenleben mit Muslimen in Deutschland Eine Handreichung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, hg. vom Kirchenamt der EKD, Gütersloh: Mohn 22000 Zwischen Kirche und Moschee. Muslime in der kirchlichen Arbeit Hans-Christoph Goßmann (Hrsg.), Rissen: E.B.V. 1994 Nachschlagewerke und Medien Der Islam. Einführung in Glaube, Gesetz und Geschichte Barbara Huber, mit 81 Farbfolien und Erläuterungen, Frankfurt a.M.: CIBEDO 1993 (Bezug: CIBEDO, Postfach 170427, 60078 Frankfurt/M., Tel.: 069/726491 Islam-Lexikon. Geschichte – Ideen – Gestalten Adel Theodor Khoury, Ludwig Hagemann, Peter Heine, drei Bände, Freiburg/Basel/Wien: Herder 1991 Türkisch-islamische Vereinigungen in der Bundesrepublik Deutschland Metin Gür, Frankfurt a.M.: Brandes & Apsel 1993 Was will der Islam in Deutschland? Muhammad Salim Abdullah, (Gütersloher Taschenbücher Bd. 797), Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn 1993 Zum Islambild in den deutschen Medien 33 Autorinnen- und Autorenverzeichnis Impressum Ayroud-Peter, Katharina Baer, Konrad Bürger, Rena Elyas, Nadeem Erpenbeck, Gabriele Geisler, Dr. Ralf Kaye, Nicolas Krausen, Halima Schrader, Dany Schulz, Daniela Tan, Dr. Dursun Vogel, Solveig Sozialpsychologin Journalist und Autor Sozialwissenschaftlerin Zentralrat der Muslime Ausländerbeauftragte des Landes Niedersachsen Theologe, Evangelische Landeskirche Landespfleger Imam Ali Moschee Journalistin Journalistin Univeristät Hildesheim Journalistin Herausgeberin und Redaktionsanschrift (ViSdP): Niedersächsisches Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales – Ausländerbeauftragte – Postfach 141 30001 Hannover Telefon (0511) 120 30 24 Redaktion und Produktion: M. Katerina Agsten, Konrad Baer, Antonio Bilbao (verantwortlich) Satz & Gestaltung Angel and Co. Druck: Sponholtz, Hannover Erscheinungsweise unregelmäßig Erscheinungsdatum: für die vorliegende Nr. 6, Dezember 2000 Bereits erschienen: Nr. 1, Oktober 1996 Nr. 2, Mai 1997 „Fremd – Na und? – Medien und interkultureller Alltag“ „35 Jahre Arbeitsmigartion zwischen der Republik Türkei und der Bundesrepublik Deutschland“ Nr. 3, November 1997 „Interkulturelles Lernen mit Kindern“ Nr. 4, Dezember 1997 „Jugendliche in Niedersachsen“ Nr. 5, Dezember 1998 „25 Jahre Anwerbestopp“ Bezugpreis: Die Broschüre kann gegen einen Kostenbeitrag von DM 5,– zzgl. Versandkosten bezogen werden. Bei Klassensätzen sind die Lieferbedingungen zu erfragen. Nachdruck nur mit Genehmigung der Herausgeberin (wird gern erteilt). Alle Rechte vorbehalten. © Die Ausländerbeauftragte des Landes Niedersachsens. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht in jedem Falll die Meinung der Herausgeberin und der Redaktion wieder. Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Material.