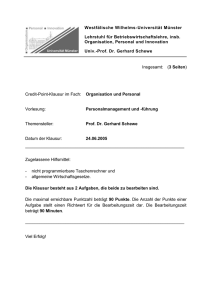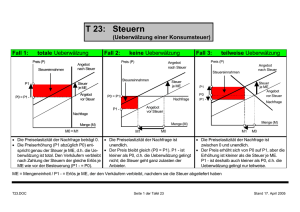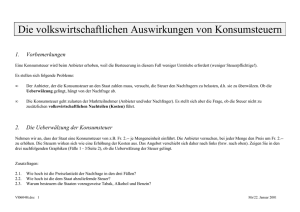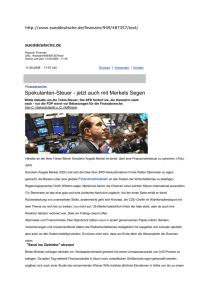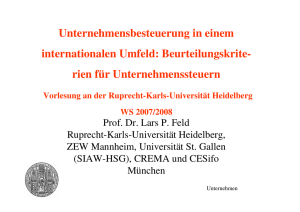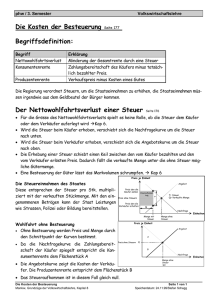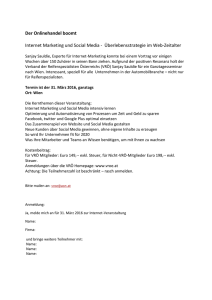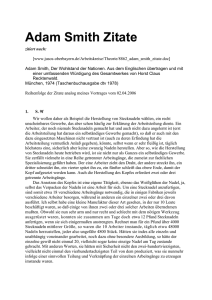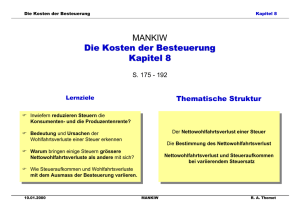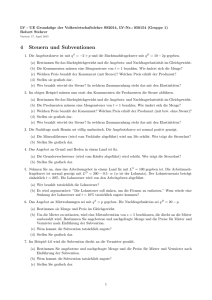Analyse des bestehenden Steuersystems Kapitel 1: Ziele und Mittel
Werbung
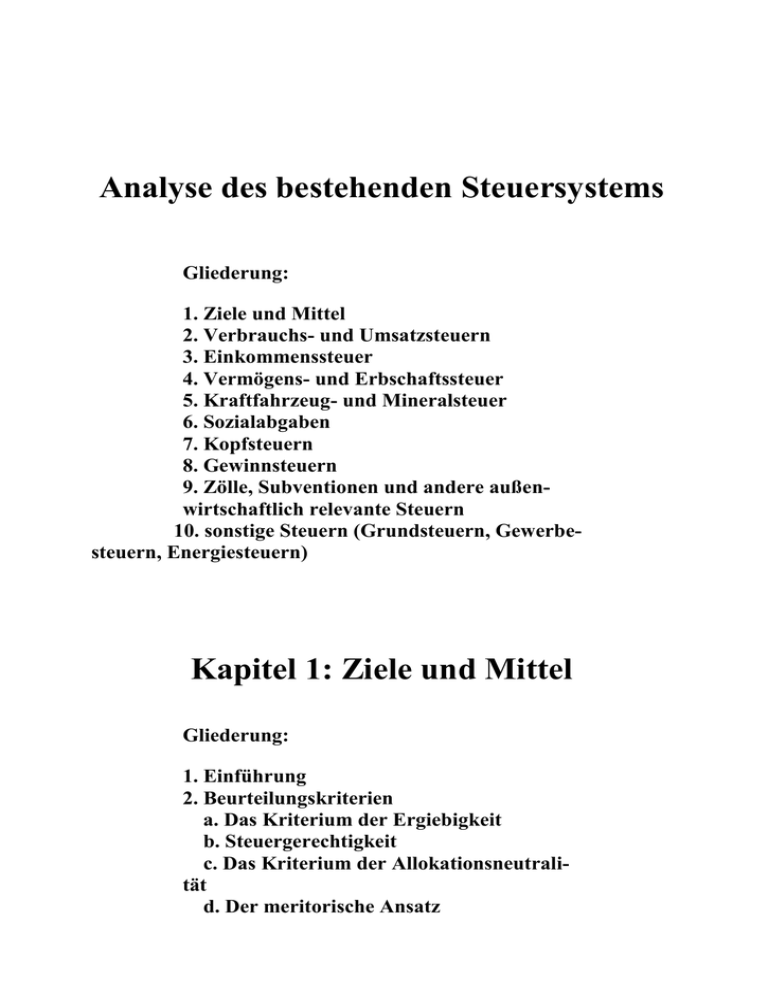
Analyse des bestehenden Steuersystems Gliederung: 1. Ziele und Mittel 2. Verbrauchs- und Umsatzsteuern 3. Einkommenssteuer 4. Vermögens- und Erbschaftssteuer 5. Kraftfahrzeug- und Mineralsteuer 6. Sozialabgaben 7. Kopfsteuern 8. Gewinnsteuern 9. Zölle, Subventionen und andere außenwirtschaftlich relevante Steuern 10. sonstige Steuern (Grundsteuern, Gewerbesteuern, Energiesteuern) Kapitel 1: Ziele und Mittel Gliederung: 1. Einführung 2. Beurteilungskriterien a. Das Kriterium der Ergiebigkeit b. Steuergerechtigkeit c. Das Kriterium der Allokationsneutralität d. Der meritorische Ansatz e. Das Kriterium eines optimalen Kollektivgüteranteils f. Neutralität im Hinblick auf die gesamtwirtschaftlichen Ziele g. Fiskalpolitik 3. Das Instrumentarium der Besteuerung 1. Einführung Ich möchte mit diesem Artikel eine Serie von mehreren Artikeln starten, in denen das bestehende Steuersystem der Bundesrepublik kritisch analysiert werden soll. Hierbei geht es mir weniger darum, konkrete Vorhaben der einzelnen Parteien zu einer Reform einzelner Steuern zu untersuchen und hierbei die Ausgestaltung einzelner beabsichtigter Steuergesetze zu besprechen. An dieser Stelle soll vielmehr eine systematische und kritische Analyse des bestehenden Steuersystems vorgestellt werden. Wir wollen uns mit der Frage befassen, inwieweit denn die einzelnen konkreten Steuern überhaupt in der Lage sind, die Ziele zu realisieren, um derentwillen sie in der Vergangenheit eingeführt wurden. Hierbei gilt es zweierlei zu berücksichtigen. Wir müssen stets mit der Möglichkeit rechnen, dass einzelne Steuern zumeist zur Lösung konkreter Probleme eingeführt wurden und dass hierbei nur die Frage diskutiert wurde, inwieweit diese Steuer in der Lage ist, das vorliegende Problem zu lösen, ohne dass ausreichend berücksichtigt wurde, dass sich nahezu jede politische Maßnahme nicht nur auf das Ziel auswirkt, um derentwillen sie eingeführt wurde, sondern gleichzeitig andere Ziele der Gesellschaftspolitik gefährden kann. Wir haben also immer bei der Einführung politischer Maßnahmen sowohl eine Effizienzanalyse als auch eine Analyse der unerwünschten Sekundärwirkungen durchzuführen, wobei die Effizienzanalyse dazu dient, zu überprüfen, ob das angestrebte Ziel auf diese Weise überhaupt erreicht wird bzw. ob gerade die gewählte Maßnahme unter einer Vielzahl möglicher Alternativen die höchstmögliche Effizienz aufweist. Die Analyse der möglichen Sekundärwirkungen hingegen hat die Aufgabe, festzustellen, inwieweit denn über diese Maßnahme andere Ziele der Wirtschafts- und Sozialpolitik gefährdet werden. Die bloße Feststellung, dass unerwünschte Sekundärwirkungen zu befürchten sind, ist hierbei nicht das Wichtigste. Wie bereits erwähnt, gibt es wohl kaum politische Maßnahmen, von denen keine unerwünschten Sekundärwirkungen ausgehen. Der Hinweis auf unerwünschte Sekundärwirkungen dient vielmehr allein dazu, die politische Frage vorzubereiten, ob der durch eine Maßnahme angestrebte gesamtwirtschaftliche Nutzen im Hinblick auf die Zielgröße als größer angesehen wird als der durch eben diese Maßnahme auch zu befürchtende Schaden. Während die Frage nach der Effizienz und nach den einzelnen Sekundärwirkungen eindeutig im Rahmen einer empirischen Wissenschaft, zu der auch die Wirtschaftstheorie zählt, im Grundsatz geklärt werden kann, ist die Frage nach der Bewertung dieser Wirkungen stets eine politische Frage, die im Rahmen einer empirischen Wissenschaft nicht entschieden werden kann, sondern stets aufgrund einer politischen Willensäußerung gefällt werden muss. Wenn wir hierbei von Schaden und Nutzen sprechen, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass sich ein- und dieselbe Maßnahme auf unterschiedliche Personen oder Personengruppen auch unterschiedlich auswirken kann. Wir haben davon auszugehen, dass handelnde Personen in allererster Linie Maßnahmen ergreifen, um ihr Eigenwohl zu mehren. Hier in diesem Artikel geht es hingegen allein um die Frage, wie sich eine konkrete Maßnahme auf das Gemeinwohl auswirkt. Wir wollen also mit anderen Worten überprüfen, welche positiven und negativen Wirkungen von konkreten Steuern auf das Wohl der gesamten Volksgemeinschaft ausgehen. Das Wort „Steuer“ hat in der deutschen Sprache einen doppelten Sinn: Auf der einen Seite bezieht sich dieser Begriff auf eine von der öffentlichen Hand erhobene Zwangsabgabe, auf der anderen Seite wird jedoch das gleiche Wort auch für ein Lenkungsinstrument gebraucht, so z. B. für das Steuerruder eines Schiffes, aber auch ausgedehnt auf den Versuch der Politiker, mit Hilfe dieses Lenkungsinstrumentes die Ergebnisse des wirtschaftlichen und politischen Systems nachhaltig zu beeinflussen. Obwohl es sich also bei beiden Begriffen (Steuer im Sinne von Abgaben an den Staat und im Sinne eines Lenkungsinstrumentes) zunächst um zwei grundverschiedene Begriffsinhalte ein und desselben Wortes handelt, die auf ihre Bedeutung bezogen zunächst nichts miteinander zu tun haben, lässt sich trotzdem feststellen, dass der Staat mit ein- und demselben Mittel: der Steuer oftmals zwei Aufgaben zu lösen versucht, die mit diesen beiden Begriffen zum Ausdruck gebracht werden. Der Staat erhebt in erster Linie Steuern um auf diese Weise die Finanzierungsmittel zu erhalten, welche er zur Realisierung seiner Ausgabe4n benötigt. Gleichzeitig wird jedoch vor allem seit Anbruch der Neuzeit mit dem gleichen Instrument das Ziel verfolgt, auf diese Weise Einfluss auf das wirtschaftliche Ergebnis des Wirtschaftssystems zu nehmen. So hat z. B. der Merkantilismus, die Wirtschaftsdoktrin der absolutistischen Herrscher im ausgehenden 18. Jahrhundert, den Versuch unternommen, über die Einführung von Zöllen, welche eine spezielle Abgabenart darstellen, eine aktive Handelsbilanz (also einen Überschuss der Exporteinnahmen über die Importeinnahmen) zu erzielen, um auf diese Weise die einheimische Industrie vor ausländischer Konkurrenz zu schützen, gleichzeitig um die umlaufende Geldmenge zu vergrößern und damit das wirtschaftliche Wachstum zu stimulieren. Aber natürlich strebte der absolutistische Staat mit der Einführung von Zöllen gleichzeitig an, Finanzierungsmittel für seine vielfältigen Ausgaben zu erhalten. Da die direkten Steuern jedoch vom Ständeparlament genehmigt werden mussten und da der absolutistische Herrscher das Ziel verfolgte, den Einfluss der Stände zu reduzieren, führte er mit den Zöllen eine Steuerart ein, die er ohne Zustimmung des Ständeparlamentes erheben konnte. Oder um ein zweites Beispiel zu bringen: Die Einführung der Mineralölsteuer in jüngster Zeit sollte auf der einen Seite dem Staat Finanzierungsmittel bringen, auf der anderen Seite jedoch auch die Autofahrer dazu zu bewegen, weniger zu fahren und damit die Umweltbelastung zu reduzieren. Hierbei gilt es sich darüber klar zu werden, dass beide Ziele einer Steuer (Erlangung von Finanzierungsmitteln und Steuerung der Volkswirtschaft) in ihrem Ansatz in einem Konfliktverhältnis zueinander stehen und zwar in dem Sinne, dass das eine Ziel (Erlangung von Finanzierungsmittel) um so weniger erreicht wird, je mehr das andere Ziel (Steuerung der Volkswirtschaft) realisiert wird. Je stärker die einheimische Wirtschaft im Rahmen einer Schutzzollpolitik des Merkantilismus vor der ausländischen Konkurrenz geschützt wird, um so geringer ist das Importvolumen und dementsprechend das Aufkommen der Importsteuer. Weiterhin gilt: In dem Maße, indem die Verbraucher dem beabsichtigten Anreiz der Mineralölsteuer folgen und damit das Ziel der Verringerung in der Umweltbelastung erreicht wird, gehen die Einnahmen aus der Mineralölsteuer automatisch zurück. Betrachten wir die Funktion einer Besteuerung als Finanzierungsmittel etwas genauer. Knut Wicksell hat die Steuer als Preis für die Kollektivgüter bezeichnet. Genauso wie der Preis eines Individualgutes vom jeweiligen Käufer an den Verkäufer gezahlt werden muss, genauso muss der Bürger für die Inanspruchnahme der Kollektivgüter in Form von Steuern ein Entgelt: die Steuern zahlen. Genauso wie der Preis eines Individualgutes letzten Endes darüber entscheiden soll, wie viel der knappen materiellen Ressourcen für ein bestimmtes Individualgut verwendet werden soll, genauso entscheidet unter normalen Bedingungen die Steuerhöhe ebenfalls über den Umfang der nachgefragten Kollektivgüter. Je höher nämlich die Steuereinnahmen sind, um so mehr kann der Staat Kollektivgüter anbieten, sofern wir einmal davon ausgehen, dass der Staat Kollektivgüter in normalen Zeiten nicht mit Krediten finanzieren darf. Wenn die Wähler eine Partei wählen, welche einen höheren Steuersatz einführen wollen als die konkurrierenden Parteien, so geben sie damit gleichzeitig kund, dass sie wünschen, dass der Anteil der Kollektivgüter am Inlandsprodukt vergrößert wird. Nur dadurch, dass die Kollektivgüter mit Steuern finanziert werden, wird den Wählern vor Augen geführt, auf wie viel Individualgüter sie verzichten müssen, wenn sie für eine Zunahme des Kollektivgüterangebotes stimmen. Dies bedeutet jedoch, dass die Wähler nur dann ihre Präferenzen für die Kollektivgüter verwirklichen können, wenn Kollektivgüter grundsätzlich mit regulären Steuereinnahmen finanziert werden. Allerdings bestehen auch wesentliche Unterschiede zwischen den Preisen der Individualgüter und der Steuer als Preis für die Kollektivgüter. Während die privaten Unternehmer mit der Produktion das Ziel verfolgen, mit den Erlösen aus dem Verkaufspreis nicht nur die Kosten zu decken, sondern darüber hinaus einen Gewinn, also einen Überschuss der Erlöse über die Kosten zu erzielen, fließen etwaige Überschüsse bei der Finanzierung der Kollektivgüter über Steuern nicht den Politikern zu. Auch wird die Höhe des Steuersatzes autonom und einseitig vom Staat festgesetzt, es gibt keinen Marktwert der Kollektivgüter, in der amtlichen Statistik wird der Wert der Kollektivgüter mangels eines Marktwertes nach den Kosten berechnet, welche der Staat für die Erzeugung der Kollektivgüter aufwendet. Ein weiterer Unterschied zwischen den Preisen für Individual- und Kollektivgütern besteht darin, dass jeder einzelne Konsument darüber entscheidet, wie viel er von den einzelnen Gütern kaufen möchte, unabhängig davon, welche Güter ein Nachbar konsumieren möchte, während bei den Kollektivgütern der Staat entsprechend dem Mehrheitswillen entscheidet, wie die Steuererträge auf die einzelnen Kollektivgüter aufgeteilt werden können, jeder Bürger steht demselben Kollektivgut gegenüber, unabhängig davon, wie stark die einzelnen Präferenzen der Bürger differieren. 2. Beurteilungskriterien Ich habe dieses erste Kapitel der Vorlesung über das bestehende Steuersystem ‚Ziele und Mittel‘ überschrieben. Wir wollen uns in diesem Kapitel auf der einen Seite einen Überblick darüber verschaffen, welche Ziele denn mit Hilfe der Steuern verwirklicht werden sollen und auf der anderen Seite aufzeigen, auf welchem Wege diese Ziele realisiert werden können und welche Arten der Besteuerung zur Verfügung stehen. Im Hinblick auf die Zielsetzungen haben wir allerdings – wie bereits erwähnt – zu berücksichtigen, dass von nahezu allen politischen Maßnahmen, so auch vom jeweiligen Steuersystem nicht nur die Zielvariablen beeinflusst werden, sondern gleichzeitig auch andere Ziele berührt werden. Es muss stets damit gerechnet werden, dass von Steuern gleichzeitig eine unerwünschte Wirkung auf andere Ziele der Politik ausgehen. Dies bedeutet, dass zur Beurteilung eines Steuersystems nicht nur die Effizienz einer Steuer im Hinblick auf das angestrebte Ziel untersucht werden muss, sondern dass gleichzeitig auch nach möglichen, negativen Sekundärwirkungen gefragt werden muss. Mit anderen Worten: Die Kriterien zur Beurteilung einer speziellen Steuer haben stets die Wirkungen einer Besteuerung auf alle Ziele der Politik zu überprüfen und dürfen sich nicht nur auf die Ziele beschränken, welche mit Hilfe eben dieser Steuer angestrebt werden. Die einzelnen Steuern werden in dieser Analyse stets als Mittel und nicht als Selbstzweck angesehen. Und genauso, wie für jedes politische Ziel in aller Regel mehrere Mittel zur Verfügung stehen, gilt auch für das Besteuerungssystem, dass der Staat seine politischen Vorhaben mit recht unterschiedlichen Steuerarten realisieren kann. Wir wollen uns deshalb in diesem Kapitel auch zweitens einen Überblick über die wichtigsten Steuerarten verschaffen, bevor wir in den weiteren Kapiteln dazu übergehen, die einzelnen Steuerarten kritisch zu analysieren. Beginnen wir unsere Analyse damit, dass wir uns einen Überblick über die wichtigsten Beurteilungskriterien eines Steuersystems verschaffen. Hierbei können wir diese Beurteilungskriterien danach unterscheiden, ob sie die Beschaffung oder die Verwendung der Steuern zu überprüfen haben. Hier sollen in erster Linie die Kriterien untersucht werden, welche die Beschaffung von Steuereinnahmen zum Ziel haben. a. Das Kriterium der Ergiebigkeit Steuern werden erstens vor allem von den Politikern, allen voran den Finanzministern, danach beurteilt, wie ergiebig sie sind, ob also damit gerechnet werden kann, dass die Einführung einer Steuer auch tatsächlich dem Staat beachtliche Mehreinnahmen verschafft. Wir haben davon auszugehen, dass der Staat zur Erhebung von Steuern selbst Kosten aufwenden muss, sodass die Einführung einer Steuer dem Staat nur dann Mehreinnahmen verschafft, wenn die zusätzlichen Steuereinnahmen die hierdurch notwendig gewordenen Kosten übersteigen. Zu diesen Kosten zählen die Einrichtung einer Steuerbehörde und damit Beschäftigung von Beamten, weiterhin die Erhebung von Statistiken, welche den Politikern Kenntnis darüber geben, inwieweit die einzelnen Bürger die Kriterien erfüllen, welche der Besteuerung zu Grunde liegen. Bei einer Einkommenssteuer, welche den geschuldeten Steuerbetrag von der Höhe des individuellen Einkommens abhängig sein lässt, müsste z. B. zunächst die Einkommenshöhe jedes Bürgers ermittelt werden. Selbstverständlich müssen auch Kosten aufgebracht werden, um eine mögliche Steuerhinterziehung zu erkennen und wirksam verfolgen zu können. Bisweilen sind die Erhebungskosten bei Einführung einer neuen Steuer so hoch, dass sie die zu erwartenden Steuererträge übersteigen. So ist z. B. der Erhebungsaufwand bei Einführung einer Vermögenssteuer so hoch, da die traditionellen Einkommensstatistiken nicht über die Verteilung der Vermögen aussagen, dass die Erträge aus einer solchen Steuer die Kosten nur dann übersteigen, wenn auch die Empfänger mittlerer Vermögen und nicht nur die Millionäre besteuert werden. Aus der Sicht des Finanzministers mag dieses Kriterium der Ergiebigkeit verständlich erscheinen. Der Finanzminister ist dafür verantwortlich, dem Staat die Finanzmittel zu beschaffen, welche zur Realisierung der politischen Vorhaben benötigt werden. Es ist nur natürlich, dass der Finanzminister in Realisierung dieser Aufgabe nach solchen Steuern Ausschau hält, die besonders ergiebig erscheinen. Hier in diesem Artikel geht es jedoch um die Frage, ob eine Steuer aus gesamtwirtschaftlicher Sicht als erwünscht angesehen werden kann. Es interessiert weniger die Frage, wie ergiebig eine Steuer ist, sondern die ganz andere Frage, ob die angestrebten Ziele auf diesem Wege (mit dieser Steuer) erreicht werden können, ohne dass andere Ziele so stark verletzt werden, dass der gesamtwirtschaftliche Schaden größer ausfällt als der gesamtwirtschaftliche Nutzen. Ergiebigkeit und Gesamtwohl fallen jedoch nicht zusammen. Es ist denkbar, dass eine bestimmte Steuer als besonders ergiebig angesehen werden kann, dass sie aber im Hinblick auf das Gemeinwohl unerwünscht ist, da ihr volkswirtschaftlicher Schaden den möglichen Nutzen übersteigt. Andererseits muss auch mit der Möglichkeit gerechnet werden, dass ein bestimmtes politisches Ziel auch dann erreicht wird, wenn eine spezielle Steuer dem Staat keine oder nur wenige Steuereinnahmen verschafft. Wir brachten oben das Beispiel eines Prohibitivzolls, bei der ein Importzoll so hoch angesetzt wird, dass jeder Import verhindert wird. Hier erzielt der Staat aus dieser speziellen Steuer (auch ein Zoll stellt eines spezifische Steuer dar) überhaupt keine zusätzlichen Einnahmen. Trotzdem konnte das Ziel einer Schutzzollpolitik voll erfüllt werden. Das Ziel einer solchen Politik besteht in dem Schutz der einheimischen Industrie vor ausländischen Konkurrenten. Bei einem Prohibitivzoll wird dieser Schutz hundertprozentig erreicht. Halten wir also fest: Die Ergiebigkeit einer Steuer ist weder eine notwendige noch eine ausreichende Voraussetzung dafür, dass aus dem Gesichtspunkt des Gemeinwohls diese Steuer als erwünscht angesehen werden kann. Sie ist nicht notwendig, weil bei bestimmten Steuerarten der Erfolg der Besteuerung um so größer ist, je weniger die Steuereinnahmen betragen. Sie ist nicht ausreichend, weil trotz oder vielleicht sogar gerade wegen der hohen Ergiebigkeit der Erfolg ausbleibt. Dass dieses Kriterium auch in finanzwissenschaftlichen Lehrbüchern Eingang gefunden hat, obwohl es also über die gesamtwirtschaftliche Erwünschtheit einer Steuer nicht viel aussagt, dürfte damit zusammenhängen, dass dieses Kriterium von der Kameralistik in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt wurde, die Kameralistik war eine Abart der Wirtschaftslehre des Absolutismus in Deutschland, während sich die Wirtschaftslehre des Absolutis- mus in Frankreich als Merkantilismus ( also als eine Art Handelslehre) niedergeschlagen hat. Der Ausspruch: ‚L'État, c'est moi‘, der Staat, das bin ich, wird zwar vermutlich fälschlicher Weise Ludwig XIV. in den Mund gelegt, bringt jedoch das Staatsverständnis des absolutistischen Herrschers deutlich zum Ausdruck. Es wird noch nicht – wie dann später beim Liberalismus – zwischen den Interessen des Königs und den Interessen seiner Bevölkerung unterschieden. So ist es auch zu verstehen, dass die Kameralistik als Wirtschaftslehre des Absolutismus in der Ergiebigkeit einer Steuer das wichtigste Kriterium zur Beurteilung der Erwünschtheit einer Steuerart gesehen hatte. b. Steuergerechtigkeit Eines der wichtigsten Ziele jeder Besteuerung überhaupt liegt darin, die Steuerlasten gerecht auf die einzelnen Bürger aufzuteilen. Zunächst könnte man vermuten, dass eine Steuerart gerade dann als gerecht eingestuft werden könnte, wenn alle Bürger unabhängig davon, wie reich oder wie arm sie sind, einen gleichen Steuerbetrag zu entrichten haben. In der Tat verbietet das Prinzip der Steuergerechtigkeit, einzelnen Bevölkerungsgruppen oder auch einzelnen Personen ohne ausreichenden Grund Steuerprivilegien einzuräumen, sie also von der allgemeinen Verpflichtung, Steuern zu zahlen, teilweise oder ganz zu entbinden. Steuerbefreiungen dürfen nie nur in der Person des betroffenen Bürgers begründet sein, sie sind nur soweit berechtigt, als Kriterien benannt werden, welche eine Reduzierung der geforderten Steuersumme zur Folge haben, Kriterien, die dann für alle Bürger angewandt werden müssen, sofern diese Kriterien zutreffen. Trotzdem würde eine Steuer, welche die gleiche Steuersumme von allen Bürgern verlangen würde und welche üblicher Weise als Kopfsteuer bezeichnet wird, als ausgesprochen ungerecht angesehen werden. Der Grund hierfür liegt darin, dass der Nutzen, den einem Bürger dadurch entgeht, dass er Einkommensteile als Steuer an den Staat abführen muss, bei gleicher Steuersumme um so größer ist, je geringer das individuelle Einkommen ausfällt. Entsprechend dem Gesetz vom abnehmenden Nutzenzuwachs (Grenznutzen) steigt bei jeder Einkommenseinheit, den ein Bürger zusätzlich erhält, zwar der Gesamtnutzen, aber der Nutzenzuwachs verringert sich mit wachsendem Einkommen. Geht man also davon aus, dass wir nur dann von einer gerechten Steuer sprechen können, wenn jedem Bürger ein gleiches Opfer (ein gleicher Nutzenentgang) abverlangt wird, muss die abzuführende Steuersumme und darüber hinaus auch der Steuersatz mit wachsendem Einkommen überproportional ansteigen. Nun ist allerdings die These, dass der Nutzenentgang einer bestimmten Steuersumme bei unterschiedlichen Einkommen unterschiedlich groß ist, wissenschaftlich umstritten. Nach Vilfredo Pareto lässt sich nämlich der Grenznutzen verschiedener Personen gar nicht mit einander vergleichen, da es sich beim Grenznutzen um eine subjektive Größe handelt. Eine einzelne Person kann zwar feststellen, dass der ihm selbst zugewachsene Nutzengewinn bei jeder Erhöhung des Einkommens um eine Geldeinheit zurückgeht. Aus dieser Feststellung könne jedoch nicht der Schluss gezogen werden, dass deshalb der Grenznutzen eines Reicheren kleiner sei als der Grenznutzen eines Ärmeren. Als subjektive Größe sei der Grenznutzen nicht interpersonell vergleichbar. Also könne man auch nicht mit wissenschaftlicher Eindeutigkeit feststellen, dass das Opfer einer Geldeinheit als Steuer an den Staat abgeführt, um so geringer ausfällt, je höher das individuelle Einkommen ist. Obwohl die überwiegende Mehrheit der Wirtschaftswissenschaftler, welche sich mit diesen wohlfahrtstheoretischen Fragen befasst hat, der These Paretos gefolgt ist, entspricht dieser Opfergedanke sehr wohl einem sehr großen Teil der Bevölkerung. Die These, dass einem Millionär ein Geldverlust von 100 € sehr viel weniger Kummer bereitet als einem Bürger, dessen Einkommen nur knapp über dem Existenzminimum liegt, wird in der Öffentlichkeit kaum bestritten. Wir wollen also dieser OpferThese trotz des Votums von Pareto folgen, zumal ja die von Pareto entwickelte Wohlfahrtstheorie lediglich feststellt, dass es sich mit wissenschaftlichen Methoden nicht einwandfrei belegen lässt, dass ein Reicher von einer Geldeinheit einen geringeren Nutzenzuwachs erfährt als ein Armer, die ganz andere Frage, ob von der Bevölkerung dieser Nutzenzuwachs des Reicheren tatsächlich geringer eingeschätzt wird als der Nutzenzuwachs eines Ärmeren, wird durch diese Aussage überhaupt nicht berührt. Es ist etwas anderes, festzustellen, dass wir eine bestimmte Aussage nicht beweisen können als zu behaupten, diese Aussage entspreche der Wahrheit. Die Steuergerechtigkeit ist auch angesprochen, wenn man die Forderung erhebt, dass der mit der Steuer verbundene Nutzenentgang dem Nutzen entsprechen muss, den die einzelnen Bürger durch das Kollektivgüterangebot des Staates erfahren. So hatte sich z. B. Friedrich Engels zugunsten einer Progression in der Einkommensbesteuerung ausgesprochen, nicht etwa um ein gleiches Steueropfer sicher zu stellen – diese Forderung wurde erst im Rahmen der neoklassischen Steuerlehre erhoben – sondern einfach deshalb, weil das Kollektivgüterangebot des Staates in viel stärkerem Maße den Reichen als den Ärmeren zugute komme, sodass es nur gerechtfertigt sei, dass die Reicheren für das größere Kollektivgüterangebot auch dementsprechend mehr an Steuern zu zahlen hätten. In der Tat muss man davon ausgehen, dass zu Beginn der Industrialisierung der größte Teil der Kollektivgüter vorwiegend nur den Reichen zugute kam, der Staat schützte durch eine starke Polizei vorwiegend das Vermögen der Reichen, die Armen hatten kein Vermögen und bedurften deshalb auch in dieser Hinsicht keines Schutzes, auch die Infrainvestitionen des Verkehrswesens und des Bil- dungswesens kamen fast ausschließlich den Reicheren zugute. In dieser Frage hat sich die Ausgangslage entscheidend gewandelt. Der größte Posten im Haushalt der öffentlichen Hand stellt das Sozialbudget dar, deren Ausgaben gerade den Ärmeren dieser Gesellschaft zugute kommen. Auch erfahren in der Zwischenzeit auch die Klasse der Empfänger mittleren Einkommen vermehrt Nutzen aus den Infrastrukturinvestitionen im Verkehrs- und Bildungswesen. Unsere bisherigen Überlegungen zur Steuergerechtigkeit bezogen sich allein auf die Forderung, die Steuerlast gerecht auf die einzelnen Bevölkerungsgruppen zu verteilen. Bisweilen wird jedoch von den Politikern auch das Ziel verfolgt, auf dem Wege der Besteuerung die Einkommensverteilung im nachhinein umzuverteilen und zwar in dem Sinne, dass den Reicheren höhere Steuern abverlangt werden und diese Steuergelder dann als Transfereinkommen den Ärmeren gewährt werden. Man versucht deshalb auf diese Weise den Differenzierungsgrad der Einkommen ex post zu reduzieren. Man spricht hierbei auch von sekundärer Umverteilung. Im Gegensatz zur primären Verteilung, welche auf den Märkten festgelegt wird, geht es im Rahmen der sekundären Einkommensverteilung darum, auf dem Wege der Besteuerung das privat verfügbare Einkommen der Reicheren zu reduzieren. Als Gegenstück zur Forderung, über differenzierte Steuersätze den Differenzierungsgrad der Einkommen zu verringern, geht es im Rahmen der negativen Einkommenssteuer ganz im Gegenteil darum, nicht das Einkommen der Reichen zu schmälern, sondern das privat verfügbare Einkommen derjenigen anzuheben, welche ein Erwerbseinkommen beziehen, das unter dem Existenzminimum liegt. Natürlich handelt es sich hierbei in Wirklichkeit gar nicht um eine Besteuerung, es wird ja auf diesem Wege den Begünstigten ein Transfereinkommen ausgezahlt. Trotzdem ist es zweckmäßig, diese Einflussnahme des Staates auf die Einkommensverteilung im Zusammenhang mit dem Steuersystem zu behandeln, es sind – wie bereits der Name ausdrückt – negative Steuern. Trotz dieses Unterschiedes gehen zwar von Transfereinkommen entgegengesetzt gerichtete Einflüsse als von den Steuern aus, aber ansonsten gleicht dieses Instrument einer Besteuerung: In beiden Fällen geht es darum, die Einkommensverteilung gerechter zu gestalten. c. Das Kriterium der Allokationsneutralität Von Steuern können im Rahmen marktwirtschaftlicher Systeme nicht nur Einflüsse auf die Verteilung der Einkommen, sondern auch auf die Ausrichtung der Produktion auf den Bedarf der Konsumenten (im Weiteren kurz als Allokation bezeichnet) ausgehen. Während es bei der Einkommensverteilung um die Frage geht, wie das gesamte Volkseinkommen auf die einzelnen Bevölkerungsgruppen aufgeteilt wir, geht es im Rahmen der Allokation der Produktionsfaktoren um die Frage, wie die knappen materiellen Ressourcen einer Volkswirtschaft auf die einzelnen zu produzierenden Güter aufgeteilt werden. Es steht also bei der Allokationsfrage die Lenkung der Produktionsfaktoren zur Diskussion. Ausgangspunkt ist die Knappheit der materiellen Ressourcen. Dies bedeutet, dass der Vorrat an Ressourcen nicht ausreicht, alle erwünschten und benötigten Güter zu produzieren. Vorrangiges Ziel jedes Wirtschaftssystems besteht darin, die Knappheit zu bewältigen und zwar in dem Sinne, dass mit dem gegebenen Vorrat an materiellen Ressourcen ein Maximum an Nutzen erzielt wird. Man spricht hierbei auch vom wirtschaftlichen Prinzip, wonach mit dem gegebenen Bestand an Produktionsfaktoren ein Maximum an Ertrag erzielt wird oder – was das gleiche bedeutet, nur von einer anderen Seite aus gesehen – wonach eine bestehende Nachfrage nach einem Gut mit einem Minimum an Produktionsfaktoren befriedigt werden kann. Damit überhaupt diese Forderung nach Realisierung des wirtschaftlichen Prinzips Bedeutung erlangen kann, bedarf es zweierlei Voraussetzungen. Auf der einen Seite muss es möglich sein, dass ein und dasselbe Gut mit unterschiedlichen Techniken, also z. B. arbeits- oder kapitalintensiv produziert werden kann. Nur in diesem Falle ist es notwendig, sich die Frage zu stellen, auf welche Weise ein bestimmtes Gut produziert werden soll, bzw. welches Verfahren die geringsten Kosten erfordert. Gäbe es nur eine Technik, mit Hilfe derer ein bestimmtes Gut hergestellt werden könnte, würde sich auch die Frage nach dem kostengünstigsten Verfahren erübrigen. Wir sprechen hierbei von der Forderung nach Kosteneffizienz. Auf der anderen Seite kann im Allgemeinen davon ausgegangen werden, dass mit dem bestehenden Bestand an materiellen Ressourcen recht unterschiedliche Güterarten produziert werden können. Hier geht es dann um die Frage, welche Güter denn produziert werden sollen, wobei es niemals darum geht, den Bestand an Produktionsfaktoren nur für das eine Gut einzusetzen, es geht vielmehr stets darum, einen bestimmten Mix an Gütern zu produzieren und die Frage lautet dann, bei welchem Mix ein Maximum an Wohlfahrt erzielt werden kann. Hier spricht man von der Allokationseffizienz im engeren Sinne. Auch hier ist es klar, dass sich diese Frage nicht stellen würde, wenn mit den einzelnen Produktionsfaktoren immer nur ein ganz bestimmtes Gut und kein anderes erstellt werden könnte. Das marktwirtschaftliche System zeichnet sich nun dadurch aus, dass dieses wirtschaftliche Grundproblem im Sinne der Konsumentensouveränität zu lösen ist. Der Konsument ist in diesem System der Souverain, der zu bestimmen hat, wie diese beiden wirtschaftlichen Forderungen zu lösen sind. Jeder private Haushalt verfügt in diesem System über ein Einkommen, das er grundsätzlich nach freiem Ermessen (natürlich im Rahmen der Gesetze) auf die einzelnen Konsumgüter aufteilen kann. Dadurch, dass der private Haushalt mit seinem Einkommen nicht nur Konsumgüter nachfragt, sondern gleichzeitig die Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital anbietet, entscheidet er zusätzlich darüber, wie viel von den einzelnen Ressourcen zur Verfügung gestellt wird und damit letzten Endes auch darüber, welche technischen Verfahren überhaupt möglich werden. Deshalb ist auch der Begriff der Konsumentensouveränität nicht präzise. Es geht in einer Marktwirtschaft nicht darum, dass sich der Anbieter von Produktionsfaktoren (also z. B. von Arbeit) dem Diktat des Konsumenten beugen solle. Vielmehr zeichnet sich eine Marktwirtschaft dadurch aus, dass die privaten Haushalte darüber zu befinden haben, was und wie produziert wird. Die privaten Haushalte fragen jedoch nicht nur Konsumgüter nach, sondern bieten gleichzeitig Produktionsfaktoren (Arbeit und Kapital) an. Es ist somit in einer reinen Marktwirtschaft grundsätzlich der Haushalt, der darüber entscheidet, wie die einzelnen Haushaltsmitglieder ihre Zeit auf erwerbswirtschaftliche Zeit und auf Freizeit aufteilen und wie viel Arbeit sie deshalb anbieten. Weiterhin entscheidet der private Haushalt darüber, wie viel Einkommen für den Ankauf von Konsumgütern verwendet werden soll und welcher restliche Teil dann gespart wird und als Kapital Banken oder Unternehmungen angeboten wird. Kommen wir nun zu der Frage, inwiefern denn diese Allokationsfunktion des Marktes überhaupt durch die Art der Besteuerung beeinflusst wird und inwiefern über das Besteuerungssystem letztlich die Erfüllung dieser Funktion behindert werden kann. Steuern werden zum größten Teil von den Unternehmungen an den Staat abgeführt. Dies gilt für alle Verbrauchssteuern einschließlich der Mehrwertsteuer, aber auch für die Einkommenssteuern. Selbst die Lohneinkommenssteuer wird zwar vom Bruttolohneinkommen abgezogen, aber vom Unternehmer unmittelbar an das Finanzamt abgeführt. Für Unternehmungen bedeuten jedoch Steuern immer Kosten und sie sind stets bemüht, Kosten auf den Preis abzuwälzen. Dieser Versuch gelingt immer dann, wenn auch die Konkurrenten ebenfalls diese Steuer zahlen müssen und deshalb ebenfalls diese Steuern nach Möglichkeit an den Kunden weiterwälzen werden. In diesem Falle aber entstehen den Unternehmern durch diese Weiterwälzung der Steuerlast auf ihre Kunden keine Wettbewerbsnachteile. Sie haben nicht zu befürchten, dass wegen dieser Preiserhöhung Kunden zur Konkurrenz abwandern, da ja auch diese ihre Preise erhöhen. In diesem Falle gelingt also die Preisüberwälzung und die Unternehmer sind dann nicht mehr die eigentlichen Steuerträger, sondern nur noch Steuerzahler, mit anderen Worten: Die Besteuerung belastet dann nicht mehr die Unternehmer. Werden nun nur auf einzelne Güter Verbrauchsteuern erhoben oder ist der Steuersatz für die einzelnen Güter unterschiedlich hoch, so werden auch als Ergebnis dieser Überwälzung die Preisrelationen verändert. Diese Veränderungen in den Preisrelationen sind nun die Ursache dafür, dass die Ausrichtung der Produktion am Bedarf der Konsumenten behindert wird. Dass nämlich in einer funktionierenden Marktwirtschaft die Produktion an den Bedürfnissen der Konsumenten ausgerichtet wird, hängt damit zusammen, dass der Markt – allerdings nur unter gewissen Bedingungen (vor allem eines vollständigen Wettbewerbs) – die Preisrelationen an der relativen Knappheit der einzelnen Güter ausrichtet. Wird z. B. ein bestimmtes Gut knapper als bisher, führt dies in einer freien Marktwirtschaft zu einer Preissteigerung, der gestiegenen Knappheit entspricht deshalb auch ein gestiegener Preis. Diese Preissteigerung bewirkt nun auf funktionierenden Wettbewerbsmärkten zweierlei: Auf der einen Seite wirkt die Preissteigerung für die Anbieter dieses Gutes als Anreiz, die Produktion auszuweiten. Die Preissteigerung ist für die Anbieter ein Indiz dafür, dass durch Ausweitung der Produktion ein Gewinn erzielt werden kann. Auf der anderen Seite sehen sich die Nachfrager aufgrund der Preissteigerung veranlasst, zu überprüfen, ob sie ihren Nutzen nicht dadurch vermehren können, wenn sie ihre Nachfrage weniger auf die Güter richten, die im Preis gestiegen sind und für den hierdurch eingesparten Betrag andere Güter nachfragen, welche zu den bisher nachgefragten Güter in einem Substitutionsverhältnis stehen. Im Allgemeinen können wir davon ausgehen, dass ein und dasselbe Bedürfnis von verschiedenen Produkten befriedigt werden kann. Ich kann z. B. das Bedürfnis nach Kohlehydraten durch Kartoffel, Teigwaren oder Reis befriedigen. Dadurch, dass nun Verbrauchsteuern auf einzelne Güterpreise überwälzt werden, weichen die Preisrelationen von den Knappheitsrelationen ab und verhindern deshalb eine optimale Ausrichtung der Produktion am Konsumentenbedarf, da Preissteigerungen auch dann stattfinden, wenn die Knappheit dieses Gutes gar nicht angestiegen ist. d. Der meritorische Ansatz Wir gingen bisher von der Forderung aus, dass der marktwirtschaftliche Prozess durch die Art der Besteuerung möglichst wenig beeinflusst und damit gestört werden sollte. Zumindest entspricht dies dem marktwirtschaftlichen Credo. Es gibt jedoch in Literatur und Politik auch Vorstellungen, in denen umgekehrt mit der Besteuerung die Hoffnung verbunden wird, dass der Staat unter anderem auch durch die Art der Besteuerung massiv in das Geschehen des Marktes eingreifen und damit die Ergebnisse des Marktes korrigieren sollte. Zwei unterschiedliche Leitideen stehen hinter solchen Forderungen. Auf der einen Seite wird die Auffassung vertreten, dass die Konsumenten zumindest zu einem großen Teil bei weitem überfor- dert seien, ihre wahren Interessen zu vertreten, hier sei es Aufgabe des Staates, an die Stelle der Konsumenten zu treten und in meritorischer Absicht, Entscheidungen den Bürgern abzunehmen und zugunsten der Bürger in den Marktprozess einzugreifen. Dahinter steht weiterhin die Vorstellung, dass der Staat – vertreten durch seine Beamten – es besser als die Betroffenen wissen, was für letztere gut sei. Diese Idee wird dann dadurch gerechtfertigt, dass der Staat ja über das gesamte kollektive Wissen verfüge und deshalb bei seinen Entscheidungen dem größten Teil der Bürger überlegen sei. Es ist klar: Diese Idee steht in krassem Widerspruch zu dem Leitbild des Liberalismus. Adam Smith, der Begründer der modernen Wirtschaftswissenschaft und einer der maßgebendsten Vertreter des Frühliberalismus im ausgehenden 18. Jahrhundert, hat dafür plädiert, dass jeder Einzelne die Verantwortung für sein eigenes Leben selbst übernehmen sollte, dass es sogar immer noch besser sei, wenn ein Einzelner bisweilen im Hinblick auf sein eigenes Interesse fehlerhaft handle. Die Übernahme der Eigenverantwortlichkeit sei ein Wert für sich und aus Fehlern könne man langfristig lernen. Adam Smith war auch der Überzeugung, dass die marktwirtschaftliche Ordnung, welche dem Einzeln die Verantwortung für sich selbst überlässt, gerade auch aus der Sicht des Wohls der Allgemeinheit auf lange Sicht die besseren Ergebnisse herbeiführe als eine vom Staat gelenkte Planwirtschaft. Er sprach in diesem Zusammenhang von der unsichtbaren Hand, die ohne Zutun der Einzelnen das Gesamtergebnis so steuere, das es zu einer optimalen Lösung führe. Friedrich von Hayek hat diesen meritorischen Ansatz als Anmaßung von Wissen seitens der staatlichen Behörden gegeißelt. Der Wirkungsmechanismus einer modernen, global miteinander vernetzten Volkswirtschaft sei so komplex, dass niemand, auch nicht die Beamten des Staatsapparats, in der Lage sei, all das Wissen bei ihren Entscheidungen zu be- rücksichtigen und zu verarbeiten, das eigentlich notwendig sei, um einigermaßen befriedigende Ergebnisse herbeizuführen. Es sei gerade der anonyme Marktprozess, in dem dieses notwendige Wissen – aufgeteilt auf eine Vielzahl einzelner Teilnehmer – in Wirklichkeit zum Zuge komme. Nur der Markt ermögliche es, dass uno actu auf der einen Seite die Nachfrage an den Preisen ausgerichtet werden könne, dass aber auf der anderen Seite gerade diese Preise selbst wiederum davon abhängen, welche Nachfrage die einzelnen Haushalte ausüben. Nur der Markt sei in der Lage, Preise und erforderliche Mengen simultan festzulegen. Diese Leitvorstellung von Adam Smith korrespondiert übrigens mit dem von der christlichen Soziallehre propagierten Subsidiaritätsprinzip. Dieses Prinzip verlangt, dass jeweils die untersten Entscheidungsträger (also die Familien vor der Gemeinde, die Gemeinde vor den Ländern, die Länder vor dem Bundesstaat) solange die Entscheidungsbefugnis behalten sollten, solange diese nicht überfordert seien. Erst dann, wenn klar sei, dass die jeweils untere Instanz überfordert wäre, diese Entscheidungen sachgerecht zu fällen, sollte die jeweils übergeordnete Instanz eingreifen und die Entscheidungen an sich ziehen. Aber selbst hier wird davon ausgegangen, dass in aller Regel die übergeordnete Instanz sich darauf beschränken könne und auch solle, den untergeordneten Entscheidungsträgern lediglich eine Hilfe zur Selbsthilfe zu gewähren. In dieselbe Richtung weist eine weitere, zweite Leitidee: Dass nämlich der Marktprozess eine Vielzahl von Mängeln, ja sogar Versagen aufweise und dass eben diese in der Realität auftretenden Unvollkommenheiten den Staat verpflichte, korrigierend (z. B. über das System der Besteuerung) in den Markt einzugreifen und somit überhaupt erst die optimalen Ergebnisse ermögliche, welche zwar dem Markt als Aufgabe übertragen wurden, welche jedoch in der Realität stets mehr oder weniger verfehlt werden. Dass kein reales Marktsystem jemals in der Lage ist, jeweils optimale Ergebnisse zu liefern, ist sicherlich unbestritten. Es kann nicht bezweifelt werden, dass die konkreten Märkte immer wieder von den optimalen Ergebnisse abweichen, ja sogar ihr Ziel oftmals in starkem Maße verfehlen. Die entscheidende Frage besteht nun aber darin, welche Schlussfolgerungen aus diesen Erkenntnissen zu ziehen sind. Es ist ein grundlegender Irrtum zu meinen, dass bei einem Fehlverhalten des Marktes jeder staatliche Eingriff zu einer Verbesserung der Situation führt. Nicht nur der Markt, sondern in gleicher Weise auch die staatliche Planungswirtschaft weist Mängel und größtes Versagen auf, sodass sogar damit gerechnet werden muss, dass durch Übertragung bestimmter wirtschaftlicher Aufgaben an die staatlichen Behörden die Ergebnisse des Wirtschaftssystems um ein weiteres verschlechtert werden. Es lässt sich zeigen, dass in zahlreichen Fällen der Staat die Ziele verfehlt, die er sich mit seinem Eingreifen in den Wirtschaftsprozess vorgenommen hatte, dass aber andere Ziele der Gesellschaftspolitik auf diese Weise zusätzlich beeinträchtigt werden. Der Neoliberalismus hat aus diesen Marktunvollkommenheiten einen ganz andern Schluss gezogen, dass nämlich die Marktergebnisse auch dadurch von Seiten des Staates korrigiert werden können, dass der Staat die wirtschaftlichen Daten, welche das Handlen der privaten Wirtschaftssubjekte bestimmt, beeinflusst, dass aber die eigentlichen wirtschaftlichen Entscheidungen über die anzubietenden und nachzufragenden Gütermengen nach wie vor die privaten Wirtschaftssubjekte selbst bestimmen sollten. Walter Eucken führte in diesem Zusammenhang den Begriff der Marktkonformität ein. Marktkonform sind Maßnahmen des Staates immer dann, wenn sie sich darauf beschränken, die wirtschaftlichen Daten zu beeinflussen, wenn jedoch die eigentlichen wirtschaftlichen Entscheidungen nach wie vor den privaten Haushalten und Unternehmungen verbleiben und somit die Freiheit der privaten Entscheidungen gewahrt bleibt. Rein formal gesehen stellt zwar jede Besteuerung zunächst nur eine Änderung der wirtschaftlichen Daten dar. Wenn aufgrund einer Verbrauchssteuer z. B. der Preis dieses Gutes so stark ansteigt, dass für die meisten Verbraucher die Nachfrage nach diesem Gut drastisch verringert wird, erfolgt diese Verringerung der Nachfrage formal gesehen aus freien Stücken der betroffenen Konsumenten. Es ist ihre freie Entscheidung, von diesem Gut weniger nachzufragen, sie hätten rein rechtlich gesehen durchaus die Möglichkeit gehabt, ihre Nachfrage trotz drastischer Erhöhung des Preises im bisherigen Umfang beizubehalten. Eine tiefer gehende Analyse zeigt jedoch, dass in diesem Falle trotzdem der Marktprozess entscheidend gestört wird und dass deshalb auch in diesem Falle von marktinkonformen Maßnahmen gesprochen werden sollte. Walter Eucken hatte in seinen Grundzügen der Wirtschaftspolitik mehrere Prinzipien formuliert, welche konstitutiv, also unerlässlich sind. Ohne deren Einhaltung würde das marktwirtschaftliche System entscheidend gestört oder vielleicht sogar zerstört werden. Zu diesen Prinzipien zählt auch, dass die marktwirtschaftlichen Preisrelationen die Knappheitsrelationen der einzelnen Güter zu widerspiegeln haben. Wir haben gesehen, dass aber gerade über bestimmte Steuerarten dieser Allokationsmechanismus außer Kraft gesetzt wird. Fortsetzung folgt!