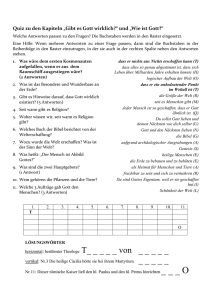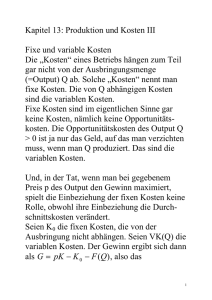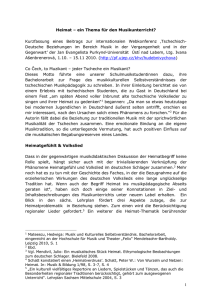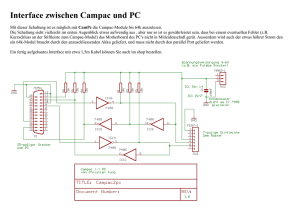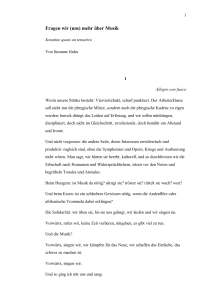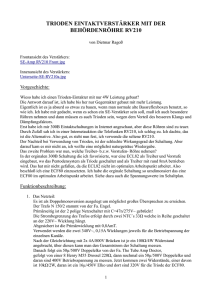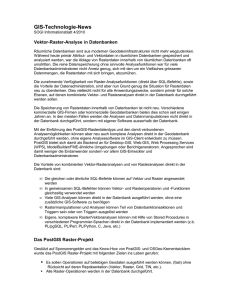Medialität und Momentform - film-text
Werbung
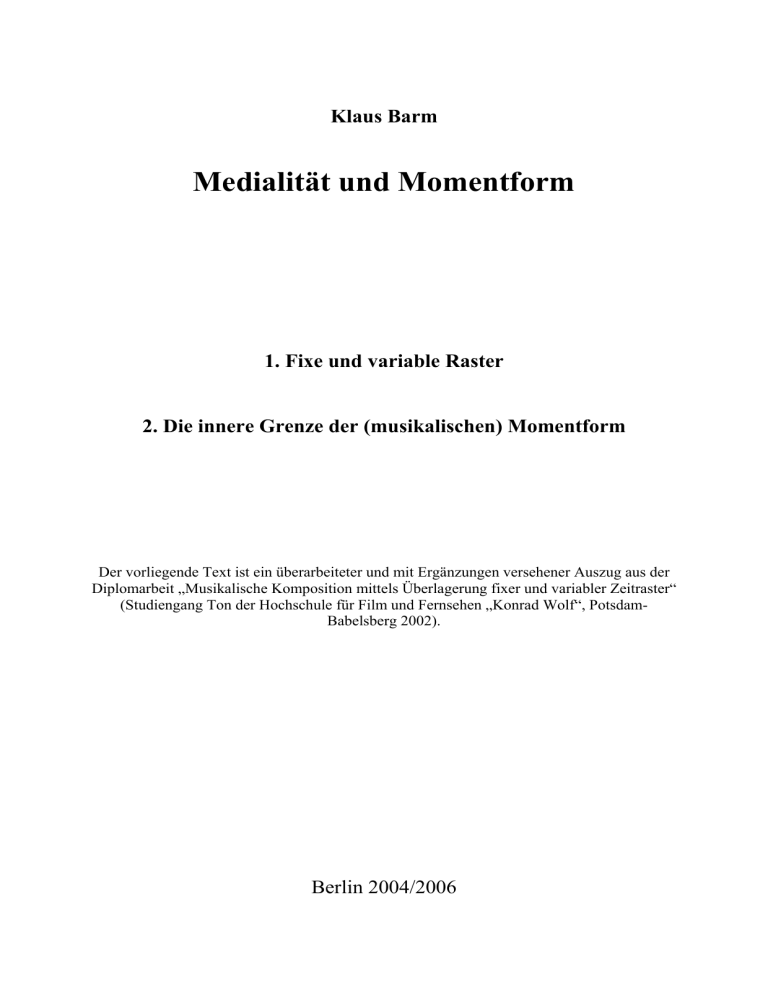
Klaus Barm Medialität und Momentform 1. Fixe und variable Raster 2. Die innere Grenze der (musikalischen) Momentform Der vorliegende Text ist ein überarbeiteter und mit Ergänzungen versehener Auszug aus der Diplomarbeit „Musikalische Komposition mittels Überlagerung fixer und variabler Zeitraster“ (Studiengang Ton der Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“, PotsdamBabelsberg 2002). Berlin 2004/2006 1 1. Fixe und variable Raster Wir sind umgeben von Bildern1. Folgt man der Argumentation, wie sie Henri Bergson in seinem 1896 entstandenen Buch „Materie und Gedächtnis“ entwickelte2, so existieren diese Bilder als Teile der gesamten Materie unabhängig davon, ob wir sie wahrnehmen oder nicht. In der Selbstwahrnehmung erscheint der eigene Körper als Träger der sinnlichen Organe herausgehoben aus der Masse der Bilder und prägt das innere Bild des Leibes: die Affektion. Bergson wendet sich gegen das dem Idealismus und dem Materialismus gemeinsame Postulat eines der Wahrnehmung inhärenten spekulativen Interesses3 und entwirft demgegenüber das Bild des Nervensystems als sensomotorisches Zentrum, dessen einzige Aufgabe darin besteht, zwischen den äußeren Reizen und den mit ihnen korrespondierenden Reaktionen zu vermitteln4. Als treibende Kraft der Wahrnehmung erscheint die allen Lebewesen eigene Nützlichkeitserwägung. Herausgeschnitten aus der Fülle des Universums, entsteht das Wahrnehmungsbild als Bezeichnung der Punkte, auf die die körperliche Bewegung Einfluss nehmen könnte5. Seinem Wesen nach ist es somit als virtuelles Bild in Bezug zu einem realen zu betrachten6. Die Höherentwicklung des Lebens besteht in der Erweiterung des räumlichen und zeitlichen Reaktionsrahmens und damit Entscheidungsraums, innerhalb dessen die auf das Wahrnehmungsbild bezogene Tat aufgeschoben oder ausgeführt werden kann7. Dem wachsenden Einfluss des Geistes entspricht ein komplexerer Organisationsgrad des Nervensystems, dies zieht die Vermehrung potentieller Möglichkeiten der Vermittlung zwischen Wahrnehmung und Tat nach sich, und hier wäre letztlich auch der Begriff der menschlichen Freiheit anzusiedeln. Ich möchte an den soeben skizzierten Aspekt der Untrennbarkeit von Wahrnehmung und Handeln anknüpfen, um auf den Begriff der Haltung zu sprechen zu kommen, wie er unser Verhältnis zu den äußeren Bildern beschreibt und dabei selbst zum Bild wird. Insoweit unser eigener Körper Teil der Menge aller Bilder ist, handelt es sich nämlich um ein zweiseitiges Verhältnis: Es geht einerseits um die Bilder, die wir wahrnehmen und andererseits um die Bilder, die wir von uns abgeben. Somit ist „Haltung“ mehrdeutig zu verstehen, d. h. sowohl in politischer als auch in körperlicher Hinsicht. Wo ist sie zu verorten? Um dies beantworten zu können, versetzen wir uns zunächst in die Lage eines äußeren Beobachters, indem wir dessen eigene Haltung unberücksichtigt lassen. Räumlich offenbart sich die Haltung des oder der Beobachteten an der Schnittstelle zwischen deren Körpern und den ihn oder sie umgebenden äußeren Bildern. Ihr zeitlicher Rahmen ist die Gegenwart. Ihre Evidenz verdankt sie nicht allein den aus der Vergangenheit schöpfenden Mustern psychologischer, politisch-historischer oder anderer Natur, in deren Sinne sie etwa zu deuten wäre. Sie schöpft vielmehr aus der Faktizität des Augenblicks. Indem eine Situation – auch im übertragenen Sinn – „wörtlich“ genommen wird, entsteht ein Bild, welches gerade in seiner Oberflächlichkeit die präzisesten Auskünfte über die gegenseitigen Kräfteverhältnisse der Wahrnehmenden und Handelnden, also über die gesellschaftlichen, – oder auch politischen – Zustände zu geben imstande ist. 1 Ich verwende den Begriff „Bilder“ im Folgenden unabhängig von deren sinnlicher Qualität, sei sie nun optischer, akustischer oder taktiler Natur. 2 Henri Bergson, Materie und Gedächtnis. Eine Abhandlung über die Beziehung zwischen Körper und Geist, S. 1 ff., Hamburg 1991 3 Ebd., S. 12 f.: „…Aber für die einen wie für die anderen bedeutet Wahrnehmen vor allem Erkennen.“ 4 Die Funktion des Nervensystems ist es, „Reize aufzunehmen, motorische Apparate zusammenzusetzen und einem gegebenen Reize die größtmögliche Zahl dieser Apparate zur Verfügung zu stellen.“ Ebd., S. 15 5 Vgl. ebd., S. 26 6 Bergson verwendet in diesem Zusammenhang die Metapher der Totalreflexion; vgl. ebd., S. 22 7 Ebd., S. 17: „Die Wahrnehmung beherrscht den Raum genau in dem Verhältnis, in dem die Tat die Zeit beherrscht.“ 2 Eine Haltung kann sich auf Text8 ebenso beziehen wie auf optische und akustische Situationen. Ein Beispiel liefert uns Siegfried Kracauer in seinem 1927 in der Frankfurter Zeitung veröffentlichten Essay „Das Ornament der Masse“9. Darin beschreibt er anhand der von Tiller initiierten und nach ihm benannten Synchrontanzgruppen, sowie von Massendarbietungen in Stadien das Massenornament als Struktur, welche die „gegenwärtige Gesamtsituation“10 widerspiegelt. Als Massenglieder sind „die Menschen Bruchteile einer Figur“11. Das Muster, das aus ihrer Anordnung resultiert, lässt sich nicht mehr als plastische Darstellung organischen Lebens betrachten. Beispielweise steht die „Massenbewegung der Girls […] im Leeren, ein Liniensystem, das nichts Erotisches mehr meint, sondern allenfalls den Ort des Erotischen bezeichnet“12. Die das sensomotorische Zentrum durchquerenden Bilder, die nicht zuletzt dieses Zentrum selbst beinhalten, vermitteln weniger das Signum des Körpers als potentiellen (psychologisch, historisch usw. beschreibbaren) Ort des Zugriffs, als dessen im Zeichen mathematischer Gesetze stehende, vergesellschaftete Realität. Die Geometrie des Massenornaments verweist auf die Abstraktheit kapitalistischer Vernunft, die als „getrübte Vernunft […] von einem bestimmten Punkte ab die Wahrheit im Stich [lässt], an der sie einen Anteil hat. Sie begreift den Menschen nicht ein.“13 Die von Kracauer beschriebenen Ornamente resultieren aus einer Struktur, die mit der fabrikmäßigen Arbeitsorganisation zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt ein Bild der Haltung des vergesellschafteten Körpers abgibt. Diese Struktur ist sowohl politischer als auch ästhetischer Natur14. Die Fabrik verlangt die Zergliederung der Arbeit und damit des Lebendigen, die Neuordnung der Teile unter dem Gesichtspunkt der Einheitlichkeit und ihre Konzentration an bestimmten Orten15. Die so erreichbare Messbarkeit und Steigerung der ausbeutbaren Arbeitsleistung be- 8 Während einer meiner Fahrten zur Filmhochschule von Berlin nach Babelsberg äußerte ein Fahrgast über einen stark alkoholisierten Obdachlosen in der S-Bahn: „Der ist ja schon tot“. Man könnte diese Aussage psychologisch deuten, etwa unter dem Aspekt von Verdrängung eigener Ängste. Wörtlich genommen, kommentiert dasselbe Statement den Status des nicht Verwertbaren unter dem Diktat des Verwertungszwanges (Tod = nicht existent) und schlägt – als Negation des Physischen – in verschärfter Form auf den Aussagenden zurück. 9 Wieder veröffentlicht in: Siegfried Kracauer, Das Ornament der Masse, S. 50 ff., Frankfurt 1977 10 Die gegenwärtige Gesamtsituation orientiert sich am Wertgesetz: „Der kapitalistische Produktionsprozess ist sich Selbstzweck wie das Massenornament“; ebd., S. 53 11 Ebd., S. 51 12 Ebd., S. 52 13 Ebd., S. 57 (Hervorhebung im Original) 14 Kracauer benennt das Massenornament als den „ästhetischen Reflex der von dem herrschenden Wirtschaftsstem erstrebten Rationalität“; zit. nach: ebd., S. 54 15 Dahinter verbirgt sich der Glaube an Effizienz, der sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts in einer Verdichtung des Diskurses über die Rationalisierung der Arbeitsorganisation niederschlug. Bereits im 19. Jahrhundert hatte der Experimentalphysiker Maxwell dargelegt, wie ein komplexer Vorgang in Einzelschritte zerlegt werden konnte, um das Lernen zu vereinfachen. In Deutschland fungierte der VDI (Verein deutscher Ingenieure) als Ort des Diskurses um Betriebsorganisation. 1911 veröffentlichte der US-Amerikaner Frederick W. Taylor sein Buch „Principle of scientific management“. Seine Vorschläge zielten auf Zentralisierung und Funktionalisierung in Bezug auf Arbeitsaufteilung und -organisation, basierend auf planmäßiger Ermittlung der Zeit, die zur Verrichtung bestimmter Tätigkeiten notwendig ist. Effizienz sollte daraus erwachsen, „einen besten Weg“ (Taylor wird stets mit seinem Leitmotiv „one best way“ zitiert) zu erkunden, wie ein Arbeitsvorgang zu organisieren sei. Dasselbe Ziel versuchte das amerikanische Ehepaar Gilbreth mit Hilfe von filmischen Bewegungsstudien, so genannten „Mikrobewegungsstudien“ zu erreichen. Ihre Überlegungen mündeten in ein pädagogisches System, das im Gegensatz zu Taylors Ansatz, Motivation extrinsisch, d.h. über monetäre Anreize zu wecken, kaum zu praktischer Umsetzung gelangte. 1913 führte die amerikanische Autofabrik Ford das Fließband ein. Bis zur Mitte der 20er-Jahre war aus der Firma ein weltweit operierendes Unternehmen geworden, dessen Produktionsweise einerseits eine Überwindung des Taylor’schen Systems bedeutete, wo sie den maschinengerechten Menschen durch die Maschine ersetzte. Andererseits konnte sie an Taylors Planungen anknüpfen: Ein möglichst reibungsloses 3 ruht auf der Überschaubarkeit vorhersehbarer Orientierungspunkte oder Schnitte16. Diese bilden räumliche und – insoweit die Zeit zumindest scheinbar manipulierbar wird17 - zeitliche Raster. Wir nennen sie fixe Raster, weil sie durch Überlagerung endlich vieler periodischer Einzelraster beschrieben werden können, deren Orientierungspunkte in einem eindeutigen und fixen Verhältnis zueinander stehen. Bedingt durch die Endlichkeit ihrer Elemente bilden fixe Raster ein Netz, das stets Lücken aufweist. Die Entstehung dieser Lücken kann analog der Genese fixer Raster von zwei Seiten aus betrachtet werden: Man kann sie einerseits als Residuum eines positiven Gestaltungsmechanismus’ begreifen, als Abstand zwischen bevorzugten Orten, die einem beliebig ausgedehnten, leeren Raum zugewiesen werden. Andererseits können die Lücken auch unter dem Aspekt eines Ausdünnungsprozesses gesehen werden. Hierbei findet innerhalb eines beliebig ausgedehnten Ganzen ein Vorgang der Optimierung statt, der zwischen den dadurch bevorzugten Orten Leere hinterlässt. Als Beispiel sei in diesem Zusammenhang auf die mathematischen Operationen von Integration und Mittelwertbildung verwiesen, der sich die Attraktivität der Models in der Werbeindustrie verdankt18. In diesem Zusammenhang lässt sich ein Wandel beobachten, der Rückschlüsse auf die Dynamik der gesellschaftlichen Entwicklung des letzten Jahrhunderts erlaubt. Gemeint ist die Tendenz, die Exklusivität der Models zu relativieren, indem an ihrer Seite immer mehr „gewöhnliche“ Menschen erscheinen, deren Attraktivität weniger auf Komposition denn auf ihrer behaupteten Authentizität beruht. Dieser Prozess mag schubweise, oder auch unter Einbeziehung von scheinbaren Rückschritten verlaufen, insoweit die Models nicht von den Werbeflächen verschwinden werden. Ihre Funktion selber aber hat sich gewandelt: Mehr als Zitat ihrer selbst denn als mathematisch und psychologisch ermittelte Attraktion treten sie uns entgegen. Doch wollen wir diesen, aus sekundären Prozessen heraus ableitbaren Tatbestand nicht weiter verfolgen19 und stattdessen versuchen, die Bedeutung zu ermessen, die dem imaginären, öffentlichen Auftritt des durchschnittlichen Menschen zukommt, der sich im Übrigen nicht auf die Werbung beschränkt. Er lässt sich vielmehr in eine Tendenz zu „dokumentarischer Authentizität“ einordnen, wie sie weite Teile der Medienwelt bestimmt. Darunter lassen sich so unterschiedliche Modeerscheinungen wie das Aufkommen der Doku-Soap ebenso fassen, wie das Prozedere der Personenauswahl bei den diversen TV-Talkshows20, aber auch die Techniken, die das Gewöhnliche, Alltägliche zu erfassen imstande sind: Die freien Kamerabewegungen (z. B. Handkamera), die veränderten Montagetechniken (Jump-Cut, evtl. abgemildert durch Weißblitz), die geschmeidige Zusammenarbeit zwischen Kamera- und (Original-) Tontechnik21 . Miteinander von Mensch und Maschine wurde dadurch garantiert, dass Arbeitsabläufe in kleinste, monoton zu wiederholende Elemente zerlegt wurden. 16 Ein Schnitt besitzt die Eigenschaft, selbst dimensionslos zu sein; vgl. S.11. 17 Eine wesentliche Rolle spielt hierbei die Kinematografie. Zeit wird durch sie zunächst indirekt – als Bild von Bewegung – repräsentierbar, indem sie mit dem Raum ins Verhältnis gesetzt wird. 18 Klaus Barm, Das Bild der Arbeit, in: jour fixe initiative berlin, Klassen und Kämpfe, S.175, Münster 2006. Ich zitiere dort eine psychologische Studie, derzufolge Gesichter, die aus mehreren einzelnen Fotografien komponiert wurden, stets höher in der Skala der Attraktivität abschnitten als die Einzelportraits selbst. Optimierung kann demnach durch eine Auswahl erzielt werden, die der Kondensierung räumlicher Linien und Flächen zu Durchschnittswerten Rechnung trägt. 19 Zum veränderten Verhältnis des Menschen zu seinem Abbild vgl. ebd, S.175ff. 20 „Im Quiz mit Jörg Pilawa (ARD-Talkmaster, Anmerkung d. Verf.) setzt man daneben auf human touch. Es soll tüchtig menscheln.“ Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 13.5.2002, S. 47 21 Ich beobachte bei einigen, aufs Dokumentarische setzenden Filmen die Tendenz zur Großaufnahme, in Verbindung mit hyperpräsentem Originalton. Ich vermute, dass die Bildgestaltung hier auf den akustischen Bereich Rücksicht nimmt, der wesentlich intimere Ansichten des Motivs erlaubt, als es das optische Medium zulassen würde. Als Beispiel kann Andreas Veiels´ 2001 fertig gestellte Dokumentation „Blackbox BRD“ gelten, ein 4 Was geschieht mit den aus Einzelgliedern gebildeten geometrischen Rastern, wo bleiben die zu nivellierenden Mittelwerten zusammengezogenen Integrale? Diese lösen sich auf in ihre einzelnen Linien, die wiederum in Punkte zerfallen, die als (materielle) Potentiale ins (virtuelle) Ganze eingehen, bzw. als (virtuelle) Differentiale ein (materiell vorhandenes) Total bilden. Das ästhetische Gefallen am Massenornament oder an der Schönheit der Models verliert ebenso wie die (ästhetische, arbeitstechnische, usw.) Bevorzugung besonderer Augenblicke und Konstellationen an Bedeutung. Unter Vorbehalt lässt sich die Entwicklung in der Vorstellung zunehmender Verdichtung der Menge von Orientierungspunkten bzw. Schnitten in den fixen Rastern verbildlichen. Liegen diese Stellen schließlich so dicht beieinander, dass sie ein „Quasi-Kontinuum“ bilden, so können die Raster nicht mehr durch eine begrenzte Anzahl von Einzelrastern beschrieben werden. Allenfalls können obere und untere Grenzen angegeben werden, innerhalb derer die Verhältnisse von Zahlen (z.B. die Anzahl der Orientierungspunkte) oder von Maßen (z.B. Streckenlängen) variieren. Unabhängig von der Einengung durch solche Grenzen sprechen wir von variablen, nicht oder nur teilweise kontrollierbaren Rastern. Sie stehen mit den fixen Rastern in folgendem Verhältnis: Obere und untere Grenzen als Grenzen der Variabilität bilden selbst fixe Raster ab, während diese als Gesamtheit – wie bereits angedeutet – zunehmend in variablen Rastern aufgehen und unkenntlich werden. Dabei wird – um an das Massenornament zu erinnern – das Bild der Masse zur opaken Fläche22. Warum? Um dies zu beantworten, muss die Rolle der Haltung unter den sich verändernden Bedingungen näher betracht werden. Zunächst stellen wir fest: Das Massenornament als Zeichen eines fixen Rasters stellt eine vorübergehende Erscheinung der Geschichte dar. Die Haltung, die der Einzelne in einer solchen Struktur zum Zeitpunkt ihrer Gegenwart einnehmen kann, zeugt von seiner Freiheit und bewegt sich zwischen den Polen Widerstand und Resignation. Das Bild der Vergesellschaftung bildet immer das Bild der Einzelnen ab, wie umgekehrt. Am Schnittpunkt zwischen beiden lässt sich der Klassenkampf in seiner allgemeinen Form verorten: Es ist der Kampf der Menschen um ihren Körper und dessen Produktion einerseits und der im kapitalistischen Wertgesetz sich niederschlagenden, kollektiven Vernunft andererseits, welche den Tauschwert körperlicher Produktion dem Grenzwert 0 zuzutreiben versucht23. Das Bild, das diesem dynamischen Prozess zu jedem Zeitpunkt entspringt, bezeugt dessen Zwiespältigkeit. So zeigen die Massenbilder zum einen noch die Rationalität, die zur Abrechnung mit „gottgewollten“ feudalen Ordnungsverhältnissen führte, während sie anderseits die Entfremdung des Fabrikarbeiters im Arbeitsprozess dokumentieren. Diese Betrachtung hilft uns dabei, das gegenwärtige Bild der unter nicht veränderten Besitzverhältnissen stattfindenden Arbeit zu erkennen: In ihm finden die Klassenkämpfe der zweiFilm über das mutmaßliche RAF-Mitglied Wolfgang Grams und den von der RAF getöteten, ehemaligen Chef der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen. Laut Filmheft (erhältlich unter www.film-kultur.de) zielt er „ auf das subjektive Moment von Geschichte und aufs „menschlich Individuelle“ (S. 10). Laut Express online Filmkritik vom 21.6.2001 bezieht er „eine Position für die Verdeckung von Widersprüchen, für die Annäherung der Gegner im Bild des einsamen Mannes und für das Verschwinden in der Blackbox zugunsten des Friedens der Gegenwart“. Mit welchen (tontechnischen) Mitteln arbeitet der Film, um dieses Ziel zu erreichen? Den ins Bild gesetzten Interviews mit Traudl Herrhausen darf kein noch so nebensächliches Geräusch entgehen, das ihr Sprechen begleitet. Auch das Zerplatzen der Spuckefäden findet das dokumentarisch inspirierte Interesse des Filmemachers. Über die Großaufnahme der Gesichter lässt sich mit Jean Baudrillard sagen: „Die Großaufnahme eines Gesichtes ist ebenso obszön wie ein von nahe betrachtetes Geschlechtsteil. Es ist ein Geschlechtsteil. Jedes Bild, jede Form, jedes Körperteil, das man aus der Nähe besieht, ist ein Geschlechtsteil.“ (Jean Baudrillard, Videowelt und fraktales Subjekt, in: ders. et. al., ars electronica (Hg.), Philosophien der neuen Technologie, S. 116, Berlin 1989) 22 In A. Veiels Dokumentarfilm „Blackbox BRD“ fließen die oben genannten Effekte von Differentialisierung und Unkenntlichwerdung ineinander: als Subjektivierung der Geschichte auf der einen und Verwischung der gesellschaftlich vorhandenen Gegensätze auf der anderen Seite; vgl. Fußnote 21 23 Vgl. Karl Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, Band 1, in: MEW 23, S. 226 ff., Berlin 1986 5 ten Hälfte des 20. Jahrhunderts, insbesondere das Ringen um körperliche Selbstbestimmung ebenso ein Zeichen wie die Erfordernisse der Dienstleistungsgesellschaft, die die entsprechenden politischen Anliegen in ein Vermarktungskonzept integriert hat, das dem hoch entwickelten technischen Fortschritt adäquat ist24. Versuchen wir nun jedoch, dieses „aktuelle Bild der Arbeit“ mit den Organen der Anschauung zu fixieren, so werden wir dabei scheitern. Wir sind bei den bisherigen Überlegungen stillschweigend von der isolierten Position eines Beobachters ausgegangen, der sich gegenüber seinem beobachteten Objekt in einem distanzierten Verhältnis bewegt. Die als Objekt beobachtete Haltung der Anderen setzt wiederum deren Distanz zu ihrer Umgebung voraus: Erst die Tribünen der Stadien erlauben den Zuschauern den Blick aufs Massenornament. Im Unterschied zum „neutralen“ Beobachter nehmen diese jedoch eine Haltung innerhalb einer Konstellation ein: Sie bewegt sich innerhalb eines Spektrums von Möglichkeiten, die von der mythologischen Restauration des Körpers (wie beispielsweise im Nationalsozialismus geschehen) bis hin zur Auflehnung gegen die entfremdete Arbeit reicht. Diese Haltung ergibt sich aus der einfachen Tatsache heraus, dass ein Zuschauer im Kreuzungspunkt zwischen dem Bild des Massenornaments und der alltäglichen Arbeitserfahrung in Büro und Fabrik steht. Er empfindet nun neben der geometrischen Zwanghaftigkeit, in der sich die Eingliederung in den Arbeitsprozess spiegelt, eine andere, differente Größe, etwas, was „mehr“ – genau genommen „alles“ – ist, und was gleichzeitig, im Augenblick der Mustererkennung „nicht“ ist. Nimmt er diese Empfindung ernst, so wird sich seine Haltung als Störung im fixen Raster abbilden. Die bisher postulierte fiktive Distanz zu den Dingen im Allgemeinen, den Menschen der Arbeitsgesellschaft im Besonderen war verbunden mit der Abstraktion vom Körper eines Beobachters. Sie erlaubte uns, mit Leichtigkeit in die gedankliche Welt einer anderen Zeit, eines anderen Textes zu schlüpfen, um uns einen bequemen Blick auf eine vergangene Zeit zu verschaffen. In Wirklichkeit haben wir dadurch kein sensomotorisches Bild im eingangs erwähnten Sinne gewonnen, allenfalls ein „Erinnerungsbild“ an eine vergangene Epoche25. Dessen Aktualisierung im hier und jetzt steht jedoch aus. Wir konnten uns diese Vorgehensweise mit einer gewissen Berechtigung erlauben, insofern die Abstraktheit dieser Distanz ihren materiellen Niederschlag in Kracauers Text fand, der als Bild einst selbst eine Haltung im Sinne einer Störung im gesellschaftlichen Raster verkörperte, gewissermaßen „daneben“ stand26. Als Bild kann er wiederum auf ein anderes einwirken, das wir zunächst mit einem neutralen Beobachter bezeichnen wollen, usw. Betrachten wir den Begriff „Text“ als Variable, so können wir an seiner Stelle ebenso gut das Wort „Film“, oder allgemein „Medium“ setzen. Dadurch haben wir im Übrigen die Möglichkeit der gegenseitigen Durchdringung von Materie gegeben, die sich außerhalb der menschlichen Sphäre bewegt, was umgekehrt die Betrachtung jeglicher 24 „Und so antwortet nun McDonalds der Forderung nach Gleichberechtigung der Frauen mit der Schaffung öffentlicher Billigrestaurants, in denen das bisher unter dem Schirm der ehelichen Liebe Gekochte in Tauschwert verwandelt wird, die der Arbeiter nach mehr Geld beantwortet die Industrie mit Entlassung und Verweis auf entgarantierte Arbeit, und der nach Selbstverwirklichung begegnen die neu entstandenen Betriebe aus dem Informationstechnologie-, Medien- und Kulturbereich mit der Anforderung, sich ganzheitlich kreativ in den Arbeits- und Konsumtionsprozess einzubringen.“ (Vgl. Klaus Barm, Das Bild der Arbeit, S.10, www.film-textmusik.de) 25 Zur Theorie des Gedächtnisses und zum Erinnerungsbild vgl. Bergson, S. 66 ff. und 127 ff. (Zusammenfassung) 26 Um den Begriff der „Haltung“ näher zu konturieren, sei betont, dass diese Distanz nicht ironisch gemeint ist. Der Duktus von Kracauers Text ist dadurch gekennzeichnet, dass er den Gegenstand seiner Betrachtung ernst nimmt, um Erkenntnis zu gewinnen. Auch stellt er sich nicht hierarchisch über diesen Gegenstand: „Die Gebildeten, die nicht alle werden, haben den Einzug der Tillergirls und der Stadionbilder übel vermerkt. Was die Menge unterhält, richten sie als Zerstreuung der Menge. Entgegen ihrer Meinung ist das ästhetische Wohlgefallen an den ornamentalen Massenbewegungen legitim. Sie in der Tat gehören zu den vereinzelten Gestaltungen der Zeit, die einem vorgegebenen Material die Form verleihen.“ (Hervorhebungen im Original, vgl. Kracauer, S. 54). 6 Gegenstände in unsere bisherigen und künftigen Überlegungen einschließt, auch wenn weiterhin von den Bildern der Gesellschaft die Rede sein wird. Was geschieht, wenn sich das Verhältnis zwischen fixen und variablen Rastern im Bild der Arbeit verändert, wenn gar die fixen Raster im Meer der variablen zu versinken scheinen und unkenntlich werden? Mit den fixen Rastern verschwindet auch die Anschaulichkeit der Differenz zwischen der Ausdehnung des Körpers und der Zwanghaftigkeit der Situation, in der er sich befindet. Mögen neue, mathematisch fundierte Bilder für die Massendarstellung gefunden werden (evtl. als Modelle für Strömungsverhalten?), so beziehen sie sich nun auf die variablen Raster allein und vermögen keiner neuen Differenz zur Anschauung zu verhelfen. Das differentielle Element, das im Widerspruch gegen den Zwang zu „Allem“ wird, wo es unter dessen Wirkung zum „Nichts“ implodiert, verliert seinen Ort im real ausgedehnten Körper und wird zur rein geistigen Größe. Im neuen Bild der Arbeit erscheint es spiegelverkehrt: Wo es in positiver Form „alles“ zu verkörpern scheint, löst sich sein Einspruch in nichts auf. Es impliziert Affirmation, Zustimmung zum Bestehenden, während eine „Haltung“ einzunehmen obsolet zu werden droht. Die oben angedeutete Kette von aufeinander einwirkenden Bildern bricht zusammen, insofern ihre Glieder einander quantitativ und qualitativ angeglichen werden. Der Einzelne mag ein Bild nach außen tragen. Es ist jedoch nur ein differentieller Punkt unter vielen, der zudem ununterscheidbar von seinem Ebenbild im Bild der Arbeit bleibt, das so zur Travestie der Wirklichkeit wird. Das ihm auf die Stirn geschriebene „Kauf mich“ ist eben nicht nur politisch-ökonomisch zu begreifen, wir haben es dabei vielmehr mit einem strukturellen Phänomen zu tun. Es geht in der jetzigen Form der Organisation von Arbeit nicht mehr darum, geometrisch oder auf sonstige Arten berechnete Linien in die Fülle27 einzuzeichnen, sondern darum, einen Raum zu schaffen, in dem die Elementarteilchen der Fülle die Funktion des Wertgesetzes erfüllen. Das heißt zum einen, ihre (im wörtlichen oder im übertragenen Sinne) motorische Arbeitskraft ausbeuten zu lassen (das zeigt sich in der Differenz zwischen dem Wert der geleisteten Arbeit und dem erhaltenen Lohn28), zum anderen, tendenziell zu verschwinden.29 Die Einheit des Bildes der Arbeit zerbricht somit im gleichen Maße wie die motorische Ordnung, mit der es verknüpft ist30. Es wird, um einen viel verwendeten Gemeinplatz 27 Ich benütze diesen Begriff hier in Bezug auf das Bild der Menge der Menschen, möchte an dieser Stelle aber schon die Möglichkeit seiner Erweiterung im Sinne des auf S. 6 erwähnten Medienbegriffs andeuten. 28 Zum „Exploitationsgrad der Arbeitkraft“ vgl. Marx, S.226 ff. 29 Die Metapher hierfür sind die „unnützen Esser“. Sie erscheint beispielsweise wieder im Hass auf Migranten. In ihr drückt sich nichts weiter als der inhärente Zwang der Marktwirtschaft zur Maximierung des Mehrwerts aus. Verweigert man die ideologisch begründete Personifizierung (die im Übrigen nichts weiter als eine restaurative Mythologisierung des Körpers bedeutet), so finden wir an ihrer Stelle die Rate des Mehrwerts als Quotient Mehrwert/variables Kapital (= nötiges Kapital zur Reproduktion der Arbeiter). Diese Rate ist der wirkliche Motor der Verwertung und erhöht sich durch Vergrößerung des Zählers ebenso wie durch Verkleinerung des Nenners, womit beide oben genannten, auf die Arbeitskraft zielenden Kräfte Kehrseiten derselben Medaille sind. Hier finden wir auch die innere Schranke des Kapitalismus: Triebe er sein Spiel konsequent zu Ende, müsste das variable Kapital im Verhältnis zum Mehrwert unendlich klein werden, mithin die physische Arbeitskraft verschwinden, womit das System der Ausbeutung sich aber der eigenen Grundlage berauben würde. Zum Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate, das in diesem Zusammenhang zu nennen wäre, vgl. Karl Marx, Das Kapital Band 3, in: MEW 25, S. 221 ff., Berlin 1984 30 Das lässt sich am Beispiel der Geschichte der Sportstadien illustrieren. Henning Eichberg beschreibt die heutige Situation in einem Beitrag für das „Lexikon Populäre Kultur“ folgendermaßen: „Zudem verändert sich der Blick, den das Publikum herkömmlicherweise von den Tribünen auf das Sportfeld richtete. Durch Großschirme wird das Hinschauen teils fokussiert und damit das Panoptische verstärkt, teils aber auch gesplittet, indem die Ereignisse auf dem Stadionfeld teils herangezoomt und teils kommentiert werden. Es entsteht eine neue virtuelle Realität. Schirme auf den einzelnen Plätzen und der Einsatz interaktiver Television zeichnen sich als nächste Möglichkeiten ab. Durch eine Hybridisierung des Stadions mit der Screen-Kultur nähert man sich dem Blick des Zapping.“ (Henning Eichberg, Das Stadion als Ort populärer Kultur, http://www.ifo-forsk.dk/qHE1999, Download vom 4.6.2002) 7 zu zitieren, fragmentarisch. Um den inhaltlichen Wandel des Begriffs „Fragment“ aufzuzeigen, seien drei unterschiedliche Kontexte betrachtet, in denen er uns begegnet: 1. in der Romantik, 2. als Paradigma der Kunst im 20. Jahrhundert, 3. im Zusammenhang mit den vernetzten Medien des Computerzeitalters. Das romantische Fragment ist als vollendete Form angedacht, die gleichsam über sich hinausweist. Als Beispiel sei auf einen Aphorismus Friedrich Schlegels verwiesen, der offensichtlich in formaler Hinsicht Geschlossenheit aufweist. Darüber hinaus enthält er in der Bestätigung vaterländischen Stolzes einen in sich vollständigen Kern, der gleichzeitig die Keimzelle seiner eigenen Infragestellung bildet31: „Die Deutschen, sagt man, sind, was die Höhe des Kunstsinns und des wissenschaftlichen Geistes betrifft, das erste Volk in der Welt, gewiss; nur gibt es sehr wenige Deutsche.“ Charles Rosen erkennt im romantischen Fragment eine „in sich geschlossene Struktur. Seine Geschlossenheit ist aber reine Formsache.“ Auf welche Art und Weise diese Form ein Bild der Wirklichkeit erzeugen soll, und welche Auffassung von Wirklichkeit an sie geknüpft ist, sei im Folgenden skizziert: 1. Die u. a. im romantischen Fragment verwendeten Techniken arbeiten mit der Vieldeutigkeit von Zeichen. Michael Parmentier erwähnt in einem 1993 erschienen Aufsatz das Ziel der Frühromantiker um Schelling, „das Phantom eines zentralen und eindeutigen Sinns aus dem Bedeutungsgeflecht des Textes [zu] vertreiben, damit der Rezipient unter Druck gerät und schließlich seine begriffliche Interpretationssicherheit verliert.“32 Der Leser „soll in der semantischen Unausschöpflichkeit des Gedichts spüren, was ihn von der Unendlichkeit trennt.“33 Parmentier weist im selben Artikel darauf hin, dass die Frühromantiker „die Orientierung an dem Ideal einer vollständigen Erkenntnis der Dinge und des ‚wahren Selbst’ nie aufgegeben“ haben. Um „die Wirkung eines Ideals zu thun“, darf es jedoch „nicht in der Sfäre der gemeinen Realität stehn.“34 So wirkt es als „kontrafaktische Antizipation, als regulative Idee, die im erkennenden Subjekt die Empfindung eines Mangels, einer Lücke im Dasein erzeugt. Die Frühromantiker reagierten auf diese Lücke […] mit einer unstillbaren Sehnsucht, der berühmten ‚Sehnsucht nach dem Unendlichen’35 […]. Die einzige Möglichkeit, diese Sehnsucht zu stillen, die Lücke zu schließen, den Mangel zu beseitigen, bietet die Kunst.“36 Mit anderen Worten: Nur in der – prozesshaft verfahrenden – Kunst kann das „Ich“ in der Auffassung der Romantik zur eigenen und allgemeinen Wirklichkeit finden. 2. Der somit ideell aufgefassten Wirklichkeit nähert sich die (in sich) geschlossene Form des Fragments, indem sie vieldeutige Bezüge herstellt. Das Fragment scheint auf eine denkbar adäquate Weise imstande zu sein, das Verhältnis zum Ganzen im Sinne des Verhältnisses zur Natur auszudrücken. Dieses Ganze stellt sich zunehmend im Zeichen eines chaotischen Zustandes dar.37 Das Verhältnis der Kunst zum Unkontrollierten, Ungeordneten, zur Nichtlinea31 Zit. nach Charles Rosen, Musik der Romantik, S. 73 f., Salzburg und Wien 2000 Michael Parmentier, Anmerkungen zum Ich-Begriff der Frühromantik, S. 190, Köln 1993. Parmentier verweist darüber hinaus auf eine Variante der Technik der „Polysemierung“: den schnellen Wechsel von Kontrasten, deren Zweck laut Ludwig Tieck in der „beständigen Zerstreuung der Aufmerksamkeit“ und in einer „gewissen Verwirrung“ der Phantasie bestehe. 33 Ebd. 34 Novalis, Das philosophische Werk I, S. 259, Stuttgart 1981 35 Friedrich Schlegel: Kritische Ausgabe in 35 Bänden. Bd. 18, 418, Nr. 1168, hg. v. Ernst Behler et. al., Paderborn/München/Wien 1958, zit. nach Parmentier, S. 188 36 Parmentier, ebd. 37 Bettina Skrzypczak weist in „Die Notwendigkeit, ein System zu haben und zugleich keines. Form als Prozess bei den Frühromantikern und bei Iannis Xenakis“ (in: Dissonanz Nr. 62, S. 16, Lausanne, November 1999) auf 32 8 rität wird vermehrt thematisiert. Schlegel bemerkt 1802: „Vegetabilisch = chaotisch ist der Charakter des Modernen“.38 Das ist jedoch nicht gleichbedeutend mit dem Einbruch des Chaos´ in die künstlerische Form selbst. So erscheint das Fragment offen, indem es auf das Chaos als Möglichkeit verweist, selbst jedoch weiterhin die Geschlossenheit wahrt und beispielsweise den Gesetzen der Symmetrie gehorcht. In der Kunst der Moderne zerbricht diese Form39: „Kunst obersten Anspruchs drängt über Form als Totalität hinaus, ins Fragmentarische.“40 Adorno macht dies anschaulich an der „Schwierigkeit von Zeitkunst […] zu enden; musikalisch im so genannten Finalproblem, in der Dichtung in dem des Schlusses.“41 Mit dem Verschwinden der Konvention kann das Kunstwerk nicht mehr so tun, „als ob die Einzelmomente mit dem Schlußpunkt in der Zeit sich auch zur Totalität der Form zusammenfügten.“42 Der Ausweg kann weder in der kunstvollen Gestaltung der offenen Form noch in der künstlichen Einheit des „Mannigfaltigen“ bestehen: „An ihrer vermittelten Totalität kranken die Werke nicht weniger als an ihren Unmittelbarkeiten.“43 Eine interessante Wendung findet dieses Problem bei Karlheinz Stockhausen. Er beschreibt die offene (musikalische) Form als dezentrale Struktur aus einzelnen Momenten, welche, zeitlich betrachtet, einen (statischen) Zustand, einen (dynamischen) Prozess oder eine Kombination aus beiden verkörpern können.44 Sie enthüllen sich an jedem Zeitpunkt der Gegenwart, ohne sich als Vermittlung zwischen Vergangenheit und Zukunft rechtfertigen zu müssen. Das aber unterscheidet die offene von der dramatischen, finalen Form: Folgt diese verschiedenen Stadien einer Entwicklung, die auf eine erwartete und damit vorbereitete Klimax hinsteuern, so bezieht jene ihre Spannung aus zu jedem Zeitpunkt gleich intensiven Momenten, deren Entwicklungsrichtung nicht aus dem Gegenwärtigen heraus vorhersagbar ist. Sie können eigenständig bestehen. Die Formen, die diese Momente begründen, sind potentiell unendlich, denn sie bestehen aus Elementen, „die immer schon angefangen haben und unbegrenzt so weiter gehen könnten45“. Dies hat nicht die Atomisierung der Form zur Folge, es findet vielmehr eine „Hyperdeterminierung“ der Momente statt, die „ständig neue Formzentren bilden können, die mit allen anderen konvergieren.“46 Im Unterschied zu „finalen“ Werken, die durch den Vorgang des Anfangs beginnen und durch ein Ende beschlossen werden, sind „bei derartigen Werken Beginn und Schluß offen.“47 Konsequenterweise tendieren sie zur „Momentform“, zum Werk mit unendlicher Dauer.48 Auf merkwürdige Weise kehren an diesem Punkt der Moderne Elemente des romantischen Fragments wieder, nur in veränderter Art und Weise. Die Sehnsucht nach dem Unendlichen die sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts verändernde Weltsicht hin: „Das newtonsche Paradigma einer mechanisch erklärbaren Ordnung wird in Zweifel gezogen. Die Hauptidee der klassischen Mechanik lag in der Zurückführung des Komplexen auf einfache, universale Naturgesetze, eine Vorstellung, die das Naturverständnis lange Zeit dominierte und viele Bereiche von Wissenschaft bis zu Theologie, aber auch die Kunst beeinflusste. An eine deutliche Grenze mußte das newtonsche Weltbild da stoßen, wo es um die Existenz von Lebewesen ging; [ …]“ 38 Zit. nach Charles Rosen, S. 125 39 Sie zerbricht u. a. an ihren eigenen Konsequenzen, wie im Verlauf des fis-Moll-Streichquartetts op.10 von Arnold Schönberg in statu nascendi nachvollziehbar. 40 Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie, S. 221, Frankfurt am Main 1995 41 Ebd. 42 Ebd. 43 Ebd. 44 Vgl. Karlheinz Stockhausen, Momentform, in: ders., Texte zur elektronischen und instrumentalen Musik Bd. 1, S. 200 f., Köln 1963 45 Ebd., S. 199 46 Ebd., S. 209 47 Ebd., S. 199 48 Vgl. ebd., S. 205 9 entspringt nun augenscheinlich der Eigengesetzlichkeit des Kunstwerks selbst, das konsequenterweise nicht zum Ende finden kann. Nicht mehr verweisen Anfang und Ende des (fragmentarischen) Zeitkunstwerks auf die Unendlichkeit des Davor und Danach49, vielmehr wirken Beginn und Ende50 als letztlich willkürliche Zäsuren im unendlichen Fluss der Klänge. Kurios sind deren zugrunde liegende Umstände, wie Stockhausen sie selbst nennt: Der Musik äußerliche Begleiterscheinungen, beispielsweise „eine vom Veranstalter oder von den Mitwirkenden festgelegte Aufführungsdauer“51 werden als Gründe des Abbruchs der Arbeit angeführt52, aber auch die Tatsache, dass „bei Verwendung bestimmter musikalischer Mittel und Techniken das Material irgendwann erschöpft beziehungsweise ein optimaler Beziehungsreichtum erreicht ist.“53 Damit wird auf eine Selbstverständlichkeit hingewiesen, die der Momentform gleichwohl zum Widerspruch gerät: Als Produkt menschlicher Arbeit ist sie in ihrer Ausdehnung begrenzt. Betrachten wir die Momentform im Bergson’schen Sinne als sensomotorisch vermitteltes „Bild“, so erfolgt diese Begrenzung von zwei Seiten aus, d. h. sowohl von der Seite des sich realisierenden Kunstwerks, als auch von der Warte desjenigen, der ihm begegnet. Führen wir ein Gedankenexperiment durch: Sei die zur realen Aufführung gelangende, endliche Momentform ein Stück mit der zeitlichen Ausdehnung von Moment A nach Moment Z, so ist mit diesen Punkten eine Hörerfahrung der Intensität A’ bzw. Z’ verbunden.54 Das Verhältnis zwischen diesen Intensitäten wollen wir als Potential bezeichnen. Als „reine“ oder unteilbare Dauer55 entfaltet sich die Hörerfahrung im „Hörbild“, welches zugleich Abbild des zwischen A’ und Z’ aufgespannten Potentials und damit der musikalischen Zeit56 ist. Das musikalische Werk folgt dieser Linie haargenau und erhält zwischen A und Z das musikalische Potential als finale Form. Damit verletzt es aber seinen Anspruch, reale Momentform zu sein. Wollte es diese bloß als Möglichkeit entwerfen, so landeten wir beim romantischen Fragment und seiner Paradoxie, als endliche Form das Unendliche nur anzudeuten57. 49 Dies kann anhand von Schumanns erstem Lied der „Dichterliebe“ verdeutlicht werden (vgl. Fußnote 86). Stockhausen verwendet die Begriffspaare Anfang/Ende und Beginn/Schluss, um ersteres der dramatischen, finalen Form zuzuweisen und letzteres der offenen Form; vgl. ebd., S. 207. 51 Ebd., S . 199 52 Stockhausen schreibt: „Die Kompositionen ‚Gesang der Jünglinge’ und ‚Kontakte’ hatte ich beide zunächst mit einer festgelegten Dauer geplant; im Verlauf der Arbeit stellte es sich jedoch heraus, daß die Form ganz offen wurde und kein Ende vorauszusehen war; beide Werke wollte ich zu einem bestimmten Zeitpunkt aufführen, und bei beiden habe ich die Arbeit unmittelbar vor der Aufführung abgebrochen, […]; es will mir heute so scheinen, als komponierte ich noch jetzt am ‚Gesang’ oder an den ‚Kontakten’, wenn ich nicht durch die Entscheidung zur Aufführung den Schluss herbeigeführt hätte.“ (ebd., S. 200) 53 Ebd., S. 199 54 Vgl. dazu Bergsons Theorie der wahrgenommenen Begleitumstände; Henri Bergson, Materie und Gedächtnis, S. 80 55 Die Unteilbarkeit bezieht sich auf den Bereich zwischen definierten Punkten. In diesem Zusammenhang sei auf Bergsons Postulat der unteilbaren Dauer verwiesen, die er in „Zeit und Freiheit“ bzw. „Materie und Gedächtnis“ entwickelt: Die Unterteilung der Zeit erfolgt demgemäß nur mittels Einbildungskraft und über den Umweg räumlicher Vorstellungen; vgl. Bergson, Materie und Gedächtnis, S. 184 ff. 56 Die musikalische Zeit kann unterschiedliche Formen annehmen: Verläuft sie im „klassischen“ Sinne linear, d. h. im Rahmen eines geordneten Ablaufs von sich transformierenden Figuren, so kann sie in neueren Werken zyklisch, d. h. genauer genommen spiralförmig verlaufen, Sprünge abbilden, usw. In einem solchen Fall ist das Potential nur scheinbar 0, in Wirklichkeit drückt es sich direkt als Bild der Zeit aus: Der Kreis führt nicht direkt zum Ausgangspunkt zurück, sondern beschreibt die räumliche Kurve einer Spirale, deren Punkte sich an keiner Stelle kurzschließen. 57 Stockhausen hat dies Problem wohl erkannt. Er konnte es jedoch nicht anders lösen, als das Kunstwerk selbst hinwegzudefinieren, indem er es zur bloßen Auslegung seiner ihm zugrunde liegenden Gesetze herabstufte: „Und doch betrachte ich diese offenen Formen nicht als Fragmente; sie lassen ahnen, wie es hätte weiter gehen können, ohne Ende: sich ständig und unvoraussehbar erneuernd im Bereich der jedem dieser Werke zugrundegelegten, formbildenden Gesetze.“ Stockhausen, S. 200 50 10 Um der Verdichtung der musikalischen Substanz in den einzelnen, die Gesamtstruktur bildenden Momenten gerecht zu werden58, müssen wir zwischen A und Z weitere Punkte B, C, D usw. vermuten, die in einem quantitativen Verhältnis zu den Abschnitten stehen, wie sie durch die Intensitäten der einzelnen Momente gebildet werden. Dabei entsteht aus der Abfolge der Punkte A, B, C, usw. ein endlich strukturiertes Raster, welches wir, um einen bereits oben eingeführten Begriff aufzugreifen59, ein fixes Zeitraster nennen wollen. Wir könnten dieses Raster auch als mehr oder weniger komplexe Überlagerung verschiedener Raster begreifen, ohne dass sich an der Sache etwas ändern würde. Wir können nun bequem von A nach B, von B nach C, usw. gelangen, und jedes zwischen den Punkten aufgespannte Potential nachvollziehen, genauer gesagt: sind wir an Punkt C angekommen, so können wir die Bewegung von B nach C retrospektiv nachvollziehen, entsprechendes gilt für das Verhältnis zwischen allen übrigen beieinander liegenden Stellen. Dem entspricht eine Form, die erst im Nachhinein erkennbar ist. Pierre Boulez spricht in diesem Zusammenhang von einem „Hörwinkel“, der sich nachträglich einstellt60. Die von uns eingeführten Punkte bedeuten Schnitte im Klangmaterial, die als solche keine zeitliche Ausdehnung besitzen. Die Zeit, die wir zur Einstellung unseres „Hörwinkels“ benötigen, würde aber eigentlich einen Moment des Innehaltens erfordern, um das wahrgenommene Klangmaterial in Beziehung zu unserem Gedächtnis zu setzen. Wir nennen sie im Folgenden „Hörzeit“. In Bezug auf deren Ausdehnung erscheinen die vom fixen Raster gesetzten Punkte virtuell. Was haben wir mit der Einführung eines fixen Zeitrasters gewonnen? Wir haben die Unteilbarkeit der Entität A-Z aufgehoben und ihm ein Raster unterschoben, das jedoch nach wie vor aus unteilbaren Untereinheiten zusammengesetzt ist. Genauso gut hätten wir ein anderes, kleineres A-Z nehmen können, um es mit weiteren A1-Z1, A2-Z2, usw. zu einem großen Potpourri zusammenzufügen, das ein Ganzes ergibt: Mit der Einführung eines fixen Rasters wird die musikalische Zeit- zur Montageform. Die „Umdrehung“ des Hörwinkels verweist lediglich auf eine Konstellation, bei der sich das Hörgedächtnis aus dem Werk selbst speist, anstatt das Werk an einer von vornherein geprägten Erwartungshaltung zu messen. Nach wie vor bezieht er sich auf Entitäten, seien sie noch so klein. Immerhin haben wir mit der Montageform eine neue Art und Weise der Strukturierung gefunden, welche das Werk einer Hierarchisierung unterzieht. Das zwischen A und Z gespannte Potential bezieht sich nicht mehr nur auf die äußeren Punkte der Begrenzung, sondern auch auf die Potentiale in den unterteilten Abschnitten. Diese wiederum bilden im Hörbild eine Entwicklung ab, die innerhalb ihrer vom Raster gesetzten Grenzen ihren Lauf nimmt. Wollten wir wirklich jeden Zeitpunkt der Momentform als gleichberechtigt neben anderen zur Entfaltung bringen, müssten wir mit Stockhausens Worten „eine horizontale Zeitvorstellung quer durchdringen bis in die Zeitlosigkeit“, um zu einer Ewigkeit zu gelangen, „die nicht am Ende der Zeit beginnt, sondern in jedem Moment erreichbar ist.“61 Dies ist, um das oben erwähnte Bild des Potpourris aufzugreifen, letztendlich gleichbedeutend mit der schon erwähnten Komposition unendlicher Dauer: Entweder, wir rücken die Punkte A, B, C, D,… des fixen Rasters immer näher aneinander. Dann verkürzen wir die Abschnitte des Zeitrasters, bis sie sich dem Grenzwert der Punkte annähern, mithin virtuell werden. Oder wir fügen durch Vermehrung der Schnitte weitere Abschnitte ein, was gleichbedeutend mit der Erweiterung der 58 Stockhausen beschreibt diese Verdichtung als Überzentrierung „…- gleich einer Materie, die sich durch konzentrischen Druck derart verdichtet, bis sie explodiert, ihre Energie freigibt und sich mit anderer Materie verbindet.“ Ebd., S. 209 59 Vgl. S. 4 60 Pierre Boulez, Musikdenken heute Bd. 2, S. 59 f., Mainz 1985 61 Stockhausen, ebd., S. 199 11 montierten Form gen unendlich ist. In beiden Fällen stoßen wir auf Grenzen, die durch vom menschlichen Körper gesetzte Maße bestimmt sind: die Zeit, die wir als Produzenten/ Konsumenten mit einem musikalischen Werk verbringen (und damit im Extremfall die Lebenszeit62), die musikalische Geschicklichkeit und die Auffassungsfähigkeit. Immerhin müssen wir feststellen, dass diese innerhalb eines bestimmten Rahmens veränderlich sind. Für die Fortentwicklung der Auffassungsgabe liefert beispielsweise die Veränderung des musikalischen Hörens (und Komponierens), die in Arnold Schönbergs „Harmonielehre“ als Grundlage zunehmender harmonischer Diversifizierung erwähnt wird, genügend Beispiele.63 Wir haben das „unendliche Zusammenrücken“ der Punkte gleichgesetzt mit dessen unendlicher Ausdehnung. Das entspräche – mathematisch betrachtet – der Umkehrung einer Division durch die Zahl 0. Ziehen wir in Betracht, dass eine solche Operation unerlaubt ist, so können wir doch mit Fug und Recht von der Annäherung an einen Grenzwert sprechen. Bewegen wir uns auf diesen kontinuierlich zu, so stoßen wir, wie bereits erwähnt, auf die Grenzen, die uns unser Körper setzt. Das lässt sich ganz einfach an einem anderen Beispiel erläutern: dem Kino, dessen illusionäre Erzeugung einer Bewegung durch Verschmelzung von Einzelbildern hinlänglich bekannt sein dürfte.64 Damit sind wir, indem wir den Weg in Richtung eines Kleinsten mit dem Grenzwert 0 gegangen sind, unversehens auf eine Tatsache gestoßen, die uns weiter beschäftigen wird. Wir wenden also die kinematografische Betrachtung auf unsere musikalische Momentform an und stellen fest, dass es im akustischen Bereich ebenfalls einen Verschmelzungseffekt geben müsste, den wir uns als Überlappungserscheinung der zur Einstellung des Hörwinkels benötigten Hörzeit vorstellen können: Bei kontinuierlicher Verkleinerung des Rasters werden Klänge oder „Gruppen“65 zunächst noch innerhalb der Rasterabschnitte unterkommen. Bei noch weiterer Verengung des Rasters werden sie zerschnitten, so dass die Hörzeit die Rasterbreite überragt. Wir stellen nun fest, dass die Punkte A, B, C, D,… sich nicht mehr ohne weiteres in den Intensitäten A´, B´, C´, D´,… widerspiegeln, dass die Gesamtform A – Z also nicht mehr dem Hörbild A’ – Z’ als Summe der ihm untergeordneten Potentiale entspricht. Sie wird potentiell Trägerin einer anderen, von A, B, C, D,… unterschiedlichen Information und erhält somit einen Verweischarakter. Mit anderen Worten: Bei größtmöglicher Verdichtung der fixen Raster wird die musikalische Zeitform zum potentiellen Medium. Die theoretisch angedachte Momentform trägt in sich gleichzeitig Tendenzen von größtmöglicher Verdichtung musikalischen Sinns und dessen Verschwinden. Der inneren, durch die erforderliche Hörzeit bestimmten Grenze entspricht eine Begrenzung der äußeren Dauer durch die Lebenszeit. Sowie es keinen Hinderungsgrund dafür gibt, die Momentform unendlich zu verdichten, sowenig spricht dagegen, sie unendlich auszudehnen. Erfordert nicht das Vermögen der einzelnen Formzentren, sich auf unendliche Weise mit anderen verknüpfen zu können, die Ausdehnung des Werkes auf Längen, die jedes Vorstellungsvermögen überschreiten? Wäre nicht das abrupte Abschneiden ein willkürlicher Eingriff, der entweder der Konsti62 Die Grenze humaner Lebenszeit versucht ein „jüngst“ gestartetes Projekt zu überschreiten: Auf einer Orgel in Halberstadt findet seit 5.9.2001 eine automatisch gesteuerte Aufführung des Stücks „As Slow As Possible“ von John Cage statt, die 639 Jahre lang dauern soll. 63 Unter der Überschrift „Harmoniefremde Töne“ zeichnet Schönberg diesen Weg nach: Von der Nachahmung der Obertonverhältnisse über deren Vernachlässigung im „Waffenstillstand“ des temperierten Systems, die Schönberg als Vernachlässigung des Vorbilds der Natur deutet, hin zum Aufkommen vagierender Akkorde als reine Kunstgebilde, die in sich den Keim des Sturzes des (tonalen) Systems tragen. Vgl. Arnold Schönberg, Harmonielehre, S. 379 ff., Wien 1986. Zur zeitlichen Beschleunigung der Auffassung bzgl. der Modulation vgl. ebd., S. 432 f. unter „Kürzung von Wendungen durch Weglassung des Wegs“ 64 Genau genommen ist das Kino keine Zeitkunst, es entsteht als solche nur durch Integration der abgespulten Bilder im Auge. Im Gegensatz zur Musik ist das Kino per se medial: „Bewegung ist im […] Durchschnittsbild unmittelbar gegeben.“ Vgl. Gilles Deleuze, Das Bewegungs-Bild, S. 14, Frankfurt 1990 65 Vgl. K. H. Wörner, Karlheinz Stockhausen Werk und Wollen 1950 – 1962, S. 58, Rodenkirchen 1963: In Stockhausens „Gruppen“ sind Töne durch übergeordnete charakteristische Erscheinungen (Intensität, Farbigkeit, Register, usw.) zusammengefasst. 12 tuierung des Kunstwerks als geschlossene, im romantischen Sinne fragmentarische Form gleichkäme, oder aber das Kunstwerk selbst in Frage stellen würde? Lassen wir uns auf das Gedankenexperiment der unendlichen Momentform ein, so tritt sie uns als Form gegenüber, innerhalb derer an jedem Moment alles zur Erscheinung kommen könnte, und, zu einem unendlich entfernten Zeitpunkt, alles zur Erscheinung gekommen sein würde. Insoweit sie somit die Fülle des Universums in sich trägt, gleicht sie sich diesem mimetisch66 an. Wo jeder noch so kleine Moment die Unendlichkeit beinhaltet, können Ereignisse nicht mehr auf fixe Punkte bezogen werden, so diese selber im Moment aufgehen. Die Dauer, die sich im Hörbild niederschlägt, kann zu jedem Moment verschiedene Längen annehmen. Um eine Vorstellung davon zu erlangen, muss die horizontale, geradlinig oder sonst wie verlaufende Zeitlinie um eine Dimension erweitert werden. In der entstehenden Fläche lässt sich ein Bereich angeben, innerhalb dessen sich die Längen möglicher Dauern bewegen und in dem mit den Dauern assoziierte Punkte variabel sind. Bezogen auf Schnitte im Klang markieren diese Punkte variable Zeitraster, die Musik als Möglichkeitsform strukturieren können, mit den tatsächlichen Intensitätsverläufen der musikalischen Zeitform jedoch in keinem quantitativ eindeutig feststellbaren Bezug stehen. Erinnern wir uns kurz daran, in welchem Zusammenhang fixe und variable Raster oben bereits erwähnt wurden: Die variablen Raster erschienen als Störmuster im geometrisch geordneten Massenbild. Die zunehmende Verdichtung fixer Strukturen führte zu deren Auflösung in den variablen Rastern. Wir wollen zunächst wie auch immer geartete Analogien zwischen den – verschiedene Lebensbereiche strukturierenden – „fixen und variablen Rastern“ unterstellen, um die Verwendung ihrer Begriffe einer Präzisierung zu unterziehen. Was die fixen Raster betrifft, scheint die Sache klar zu sein. Zum einen wurden sie als mathematische Konfigurationen gesehen, die sich einem Raum einschrieben. Zum anderen erschienen sie uns als Referenzmuster gegenüber einem zeitlich-musikalischen Verlauf von Intensitäten. Die variablen Raster hingegen wurden einsichtig, indem sie auf eine zeitlich offene Situation bezogen wurden: Die Störmuster folgen einer gesellschaftlichen Situation, die ‚noch nicht ist’, die variablen Raster in der Musik markieren ‚reine Möglichkeiten’, insoweit sie sich auf die Unendlichkeit beziehen. Wir können nun feststellen, dass die Variabilität rein virtuell ist: Ihre Realisierung ist auf die Zukunft ausgerichtet, doch im Moment ihrer Aktualisierung in der Gegenwart findet eine tatsächliche Entscheidung statt, die die variablen Raster in Form mehr oder weniger komplexer fixer Raster zur Geschichte werden lässt. Der Ort dieser Entscheidung ist im menschlichen Körper. Das heißt nicht, dass die variablen Raster utopisch sind: Sie sind da, wir können sie formulieren, sie finden sich in unseren Plänen. Doch sind sie nicht zu denken ohne den Moment ihrer Einschreibung in die von uns erinnerbare Vergangenheit, den Vorgang des Umschlags ins Fixe. Wir haben das Bild der Arbeit aufgespürt in Strukturen, in denen sich das Gesellschaftliche selbst imaginierte, um sodann festzustellen, dass der Blick, der diesem Bild folgt, ebenso in Bewegung ist wie das Gesellschaftliche selbst, das wiederum diesen Blick strukturiert. Wir haben in der Mannigfaltigkeit der chaotischen Existenz, die sich der straffen Ordnung der Arbeitsgesellschaft widersetzt, ein Moment des Klassenkampfes entdeckt, das diesen vorantrieb, während es im gleichen Atemzug den Stoff zur Transformation ebendieser Arbeitsgesellschaft hin zur Diktatur der Selbstverwirklichung und Eigenverantwortung innerhalb der als selbstverständlich vorausgesetzten Ausbeutung lieferte. Wir stellten fest, dass die allumfassende Vermarktungsmöglichkeit zur Macht- und Bewusstlosigkeit des differentiellen, dem Bestehenden widersprechenden Elements führt. Wir registrierten schließlich die Fragmentierung des sensomotorischen Bildes der Arbeit. Müssen wir an diesem Punkt, an dem Medien66 Indem wir den Menschen an dieser Stelle der Betrachtung aus der Kunst ausgeblendet haben, kommen wir zum Mimesisbegriff als Kurzschluss zwischen Kunst und Realität. Dies ist nur möglich im Rahmen unseres Gedankenexperiments. 13 technologie und gesellschaftliche Tendenz sich schneiden, resignieren? Und: Worin besteht diese Resignation? Um diesen Fragen nachzugehen, sei zunächst eine weitere schematische Betrachtung vorgenommen. Als Ort des Umschlags der variablen in die fixen Raster fungiert der menschliche Körper, als Zeitpunkt des Umschlags die Gegenwart, welche Zukunft und Vergangenheit trennt. Wir können nun ergänzen, dass dieselbe Trennlinie nicht nur variable von fixen Rastern, sondern auch fixe von fixen Rastern trennt. Wenn wir der Vereinfachung halber ein lineares Zeitmodell unterstellen, so erhalten wir folgendes Schema: Abbildung 1: Fixe und variable Raster. Der Körper markiert den Zeitpunkt der Gegenwart, der Bereich rechts davon die Zukunft, links davon die Vergangenheit. Zwei Fälle sind denkbar: a) Der Körper bewegt sich mit dem Zeitfluss Dann bewegen sich die Raster ungehindert durch ihn hindurch. Die variablen Raster als Möglichkeitsform der Zukunft verfestigen sich im Moment der Gegenwart zu bisher noch nicht gewesenen fixen Rastern, die fixen Raster jedoch gehen ungehindert hindurch und spiegeln sich unverändert in der Erinnerung. b) Der Körper verändert seine Position im Verhältnis zum Zeitfluss Nun erfahren die den Körper passierenden Raster eine zeiträumliche Veränderung, die im Verhältnis zur Bewegung des Körpers steht: Den variablen Rastern wird diese hinzuaddiert, den fixen aus der Zukunft ebenfalls. Letztere verhalten sich jetzt in Bezug zum Körper, als ob sie selbst variabel gewesen seien. Die Figur, die sich in die Erinnerung einschreibt, kann somit variable Raster ebenso reflektieren wie fixe Raster, denen sich der Körper als bewegliche Größe entgegenstellt. Im letzteren Fall kommt nur die Wahrnehmung der eigenen Variabilität im Bild der Affektion hinzu. Wir erkennen dreierlei. Erstens: Zum Leben gehört offensichtlich Veränderung in Bezug zur Zeitbewegung. Im Fall a) wäre nämlich in Abwesenheit eines lebendigen Körpers genau dasselbe passiert: Die variablen Raster hätten sich verfestigt. Beobachten wir entfernte Sterne, so erblicken wir in der Zeit eingefrorene Vorgänge, die vor Jahrmillionen stattgefunden hatten. Zweitens: Variable Raster ordnen wir eher dem Lebendigen, fixe eher dem Toten zu. Das hängt mit der Selbstwahrnehmung zusammen: Indem wir uns bewegen und dabei ins Verhältnis zu einem Nichtlebendigen setzen, erkennen wir dieselbe relative Bewegung wie bei unserer passiven, d. h. unbewegten Betrachtung eines Lebendigen. In der Selbstsetzung als Lebendes identifizieren wir im zweiten Falle das Wahrgenommene als Lebendes. Wo, wie im Massenornament, Lebendes als Totes vorgeführt wird, geraten wir in einen Konflikt, der uns zwingt, Stellung zu beziehen, eine Haltung einzunehmen. Bewegen wir uns mit der Zeit und damit synchron zum Raster, lassen wir das Tote passieren und passen uns ihm gleichzeitig an. Umgekehrt führt asynchrone Bewegung unsererseits zur Änderung des fixen Rasters im Moment seines Einschreibens in die Vergangenheit. 14 Daraus ergibt sich drittens die oben bereits angedachte Problematik: Was geschieht, wenn es dem Toten gelingt, uns als Lebendiges entgegenzutreten, mithin das Leben virtuell wird? In diesem Fall schiene eine Haltung, die sich auf den Zeitfluss bezöge, obsolet zu sein, ginge sie doch selbst sofort wieder in dasjenige ein, was sie sensomotorisch reflektierte. Eine solche Rückkopplungsschleife begegnet uns in Form der heutigen Informationstechnologien: der Gentechnologie, den Computernetzwerken, den vielfältigen Medien. Bevor wir daran anknüpfen, sei Folgendes noch bemerkt: Die musikalische Momentform existierte stets nur als Idee. In der Praxis waren die Werke von Stockhausen und die seiner Zeitgenossen zwar in der Gesamtform gebrochen, realisierten sich aber eben doch als Entitäten. Was in ihnen angedacht war, lässt sie aus heutiger Sicht auf der Kippe stehend erscheinen: Aus Stockhausens Überlegungen, wie „unendliche Werke“ zur praktischen Aufführung gelangen könnten, wird ersichtlich, dass die Tendenz zur „Medialisierung“ nicht nur einem Gedankenexperiment entspringt, sondern sich durchaus in handfesten Planungen niederschlug. Wir finden also Ideen dargelegt, die das Formatradio67 ebenso vorwegnehmen wie die medial vermittelte Dauerberieselung68. Was geschieht mit den Menschen, die das unendliche Werk spielen oder hören? Sie geraten zwangsläufig in Verwirrung, denn die Musik, die sie hören oder spielen ist nicht die, die gemeint ist. Und dennoch steckt in der medialisierten Momentform gleichzeitig ein Stück emanzipatorischen Gedankens, weshalb wir uns davor hüten sollten, hinter diese Entwicklung zurückzufallen, um etwa die Rückkehr zu geschlossenen Formen zu fordern. Die Fülle, die in der unendlichen Form potentiell zum Tragen kommt, ist vom Menschen gemacht und kündet von seiner Bewegung. Die variablen Raster benennen nicht den Körper, sondern dessen Veränderungspotential. Dies spiegelt sich konkret in der Weiterentwicklung des Hörens und Musizierens wider. Als Werke jedoch sind die Momentformen gealtert, bevor sie verstanden werden konnten. Ihre konkrete Umsetzung ist abgelöst worden von den Gegenwartsbildern in der Werbung und in den technischen Medien der Neuzeit. Die unendliche Verdichtung der Materie, die uns um die Ohren fliegt, bis wir blind und taub werden, finden wir wieder in den Werbeplakaten, in denen das Wesen der variablen Raster selbst zum Vorschein kommt: Die Kunst, gleichzeitig da und fort zu sein69. Wir haben bei unseren bisherigen Überlegungen stets Mechanismen betrachtet, die sich aufs Ganze bezogen: das romantische Fragment bezog sich darauf, indem es als begrenzte Form die Sehnsucht nach dem Unendlichen erzeugen wollte, die Kunst der Moderne stellt insoweit 67 „Es wäre viel sinnvoller, Sendungen bestimmten Charakters ausschließlich auf ein- und dieselbe Welle zu legen, so dass jeder Interessierte weiß, er findet das, was er sucht, auch zu jeder Zeit an einer bestimmten Stelle. Das heißt also Konzertmusik auf einer bestimmten Welle, Unterhaltungsmusik auf einer anderen und Sprachsendungen auf einer dritten. Dieser Sendeform entsprächen am ehesten unendliche Formen von Musik, in die man sich frei einschalten kann, und die man nach Belieben lange hört.“ Stockhausen, zit. nach Wörner, S. 60 68 Er schlägt vor, dass „solche Werke [gemeint sind unendliche Musikformen, d.Verf.] an einem bestimmten Ort permanent während längerer Perioden wiedergegeben beziehungsweise gespielt werden, ganz gleich, ob jemand zuhört, oder nicht: die Hörer können kommen und gehen, wenn es sie danach verlangt und wann sie wollen.“ Stockhausen, S. 205 69 Einige Werbekampagnen der letzten Jahre spielen und spielten auf den Abgrund zwischen Leben und Tod an, indem sie durch die Behauptung von Authentizität einerseits, durch „wörtliche“ Ästhetisierung der Negation andererseits Wirkung zu erreichen versuchten. Die Negation, die bei den von Toscani (italienischer Werbegrafiker) zur Schau gestellten Todeskandidaten amerikanischer Gefängnisse (vgl. Barm, Das Bild der Arbeit) noch im Kopf des Betrachters stattfinden sollte, findet bei der 2003 gestarteten Kampagne „Bringen Sie einen Leprakranken zurück ins Leben“ (vgl. www.dahw.de, Download vom 23.2.2004) ihren grafischen Ausdruck in einem Raum simulierenden Riss, der den Körper eines (toten?) Kindes umrandet. Die dabei suggerierte Umkehrung der Zeitlinie findet sich auch wieder bei einer animierten Folge von Bildern, die derzeit auf Bildschirmen in Berliner U-Bahnen erscheint. Zunächst werden Fotos von jugendlichen Drogentoten gezeigt. Bedeckt von einem weißen Leintuch, scheinen sie friedlich zu schlafen. Am Ende der Serie simuliert ein Bildschnitt, wie ein scheinbar totes Opfer plötzlich die Augen öffnet. 15 eine Übergangsform dar, als sie einerseits in der Montage eine Begrenzung enthielt, andererseits zur leeren Form des unendlichen Mediums tendierte. Die kapitalistische Arbeitsorganisation erschien als Versuch, das Ganze der Arbeiterschaft zu bändigen: Als das Phänomen ihrer Masse zum Problem wurde, gelang es den Wissenschaftlern, über Zerlegung des Raumes die Herrschaft ihrer Geldgeber zu stabilisieren, um den Preis, dass es neben dem „One best way“70 andere Wege gab, die in der Lage waren, Unruhe ins geordnete System zu bringen. Diese Unruhe Gewinn bringend zu nutzen, ist das Verdienst der Computertechnologie. Sie schafft es, über Rückkopplungsschleifen den Arbeiter zur „Momentform“ als Travestie seines ganzen Ichs auflaufen zu lassen, um ihn widerstandslos in die Wirtschaftskreisläufe zu integrieren. Dies wird besonders deutlich in Arbeitsbereichen, die in der Unterhaltungs-, Medien- und Computerbranche angesiedelt sind. Aus eigener Erfahrung sei das Berufsfeld eines Toningenieurs erwähnt. Eine Vielzahl der dort anzutreffenden Tätigkeiten hat sich mit der Digitaltechnik enorm vereinfacht, technische Fertigkeiten und akustische Aufmerksamkeit (wie sie z.B. beim analogen Tonbandschnitt erforderlich waren) sind immer weniger gefragt. Überspitzt könnte man formulieren, dass jeder heute in der Lage ist, die noch nötigen Arbeitsabläufe zu verrichten. Man kann an dieser Stelle entgegnen, dass der Beruf des Toningenieurs selbst sich wandele, dass die Technologie ihm nun den Raum ließe, kreativ zu werden, beispielsweise Sounddesign zu machen. Das hieße jedoch lediglich, das Problem auf eine begriffliche Ebene zu verschieben: Was ist ein Sounddesigner? In der Praxis versteht man darunter denjenigen, der die gestalterische Verantwortung für die klangliche Seite eines Mediums, beispielsweise eines Spielfilms übernimmt. Damit ist aber nichts anderes gesagt, als dass er eine Unterabteilung der Regie leitet. Legt er selbst Hand an die Tongestaltung an, so nimmt er die Aufgaben eines Komponisten oder eines Geräuschemachers wahr. Ist er organisatorisch tätig, betritt er Gebiete der Produktion. Auf der anderen Seite bleiben die „primitiven“ Tätigkeiten übrig, das „Pixelputzen“71, das monotone Überwachen von Aufnahmeschleifen, das Herausfinden von Übertragungsfehlern. Wir sehen im Ergebnis also eine Aufspaltung dessen, was früher einmal einen Toningenieur ausmachte: Ein mit allen Wassern gewaschenes Allround-Talent steht einem völlig unterforderten Gelegenheitsarbeiter gegenüber. Der Beruf des Toningenieurs hat sich nicht gewandelt, er ist, wenn man obiger Argumentation folgt, vielmehr verschwunden. Wesentlich erscheint: In beiden Fällen erscheint die Komplexität des Wahrnehmens und Handelns nicht wirklich auf die – entfremdete – Tätigkeit bezogen. Die Komplexität bestand und besteht beim Sounddesigner nicht darin, seine mannigfaltigen Tätigkeiten parallel oder sukzessive innerhalb einer bestimmten Zeit auszuführen. Das ist aufgrund der damit verbundenen Menge von Aufgabenbereichen auch kaum noch möglich. Sie findet vielmehr ihren Niederschlag in seiner Fähigkeit, einander widerstrebende menschliche Eigenschaften zu bündeln und überzeugend nach außen zu tragen: Beispielsweise künstlerische Begabung in verschiedenen Bereichen, organisatorisches Talent und handwerkliches Geschick. Doch unterliegt auch der „Pixelputzer“ dem Zwang, sich als Mensch zu verkaufen. Gerade angesichts der Primitivität seiner Tätigkeit wächst die Anforderung an ihn, sich keine Mühe anmerken zu lassen, die Arbeit quasi unter dem Einsatz seiner ganzen Person zum Verschwinden zu bringen. Auch in diesem Fall beschränkt sich also die Arbeit, wie sie sich im 70 Gemeint ist der von Frederick W. Taylor in „Principle of scientific management” untersuchte „One best way” zur Optimierung der Arbeitsorganisation; vgl. Fußnote 15 71 Normalerweise im Zusammenhang mit der digitalen Bildverarbeitung verwendeter, ironischer Begriff. Er steht für die langweilige Kleinarbeit, ein Bild quasi „Pixel für Pixel“ nachträglich zu manipulieren, Fehler zu entfernen, usw. Entsprechende Arbeiten findet man aber auch bei der digitalen Tonbearbeitung. Sie werden durch grafische Software wesentlich erleichtert. 16 Alltag darstellt, nicht auf das Abspulen stupider Vorgänge, sondern erweist sich als Spiel, in dem es darum geht, die eigene Persönlichkeit überzeugend nach außen zu tragen. Also setzt die Datenverarbeitung die Komplexität menschlichen Handelns im Arbeitsalltag frei. Indem sie entweder die – in den Wertprozess eingehende – Arbeit72 im Verhältnis zur Zeit ins Unermessliche ausdehnt oder diese im Verhältnis zur investierten Zeit ins Unerkennbare verkleinert, wird Arbeit – so sie sich als sensomotorischer Vorgang in einem Bild einschreibt – medial. Genauer gesagt: sie erscheint als Medium, indem sie unsere sensomotorischen Grenzen über- oder unterschreitet. Das Bild, das sich durch die medialisierte Arbeit vermittelt, ist die Travestie des menschlichen Körpers (und damit der Arbeitskraft) als Vermittler zwischen Wahrnehmung und Handeln. Damit ist weniger gemeint, dass dem Einzelnen das subjektive Gefühl zu arbeiten verloren geht. Dieses steht jedoch in keinem – positiv oder negativ beschreibbaren – Verhältnis mehr zum gesellschaftlichen Charakter der Arbeit. Hier handelt es sich eben weder um die – negativ, d. h. als Mangel erfahrbare – Entfremdung des Arbeiters vom Produktionsprozess, noch um einen – positiv erfahrbaren – Stolz aufs eigene Handwerk. Wir haben es vielmehr mit einem Zwang zur Authentizität zu tun, durch den das Ganze einer Person mit dem Ganzen der Arbeitsgesellschaft rückgekoppelt wird. Dies wird durch die Technologie ermöglicht, nicht aber unbedingt verursacht. Die Entwicklung der letzten Jahre lässt sich eher durch ein gegenseitiges Wechselspiel beschreiben, innerhalb dessen sich technische Vernetzung und Veränderungen im Denken, Handeln und Fühlen der Menschen parallel zueinander entwickelten und in einer neuen Form der Arbeitsorganisation integriert wurden. Die „Medialität“ des Bildes der Arbeit folgt nicht aus der Fragmentierung des Blicks durch „Implantation“ technischer Möglichkeiten in den Arbeitsprozess, sondern hat sich in der Ausweitung des Denkens in Bezug auf den Körper selbst einen Keim gelegt, dessen Saat zusammen mit der Ausweitung technologischer Möglichkeiten im Beet des „Medienzeitalters“ aufgeht. Das Problem ist nicht in der Begegnung Mensch / Maschine zu sehen, sondern im Umgang der Menschen miteinander, in den nach wie vor bestehenden Ausbeutungsverhältnissen.73 Die Bilder, die uns umgeben, scheinen alles zu repräsentieren, weil wir uns selbst in der Arbeit als Ganzes erfahren. Die „Sehnsucht nach dem Unendlichen“ als ins Ideelle projizierte Seinssuche der Romantiker kehrt wieder in den Lobpreisungen, die einige Medientheoretiker dem Virtuellen angedeihen lassen. Der Unterschied besteht darin, dass jene der (Unmöglichkeit von) Erkenntnis immerhin eine emotionale Empfindung zubilligten und ihr so ein Hintertürchen offen ließen, während diese in der positiven Setzung der Leere Erkenntnis zur Information transformieren, die als Möglichkeit an sich gefeiert wird.74 Hinter der damit verbundenen „Diskursivierung“ der 72 Wir wollen, um die Betrachtung nicht zu verkomplizieren, uns auf hoch technisierte Arbeit beschränken. Mit Arbeit sei hier ein sensomotorischer, abbildbarer Vorgang gemeint, innerhalb dessen ein Mensch Entscheidungen trifft, die sich auf einen – im Übrigen durch fixe Raster beschreibbaren – Gegenstand beziehen. Abstrakt betrachtet, erkennen wir im momentanen Arbeitsprozess den Moment der Gegenwart, an dem ein Umschlag zwischen variablen und fixen Rastern stattfindet. 73 Indem er die Frage der Entfremdung aus dem Verhältnis zwischen Mensch und Maschine entwickelt, begeht beispielsweise Baudrillard den Fehler, den Arbeitsbegriff aus seinem „Diskurs“ auszuklammern : „Im Verhältnis des industriellen Arbeiters zu technischen Gegenständen und Maschinen gibt es keinerlei Ungewissheit: der Arbeiter steht der Maschine stets in irgendeiner Weise fremd gegenüber und ist durch sie entfremdet; er wahrt den Eigenwert der Entfremdung. Durch die virtuellen Maschinen und die neuen Technologien bin ich jedoch keineswegs entfremdet. Sie bilden mir einen integrierten Schaltkreis ( dies ist das Prinzip des Interface ). Großund Mikrocomputer, Fernsehen, Video und selbst der Fotoapparat sind wie Kontaktlinsen, durchsichtige Prothesen, die derart in den Körper integriert sind, dass sie schon fast genetisch zu ihm gehören, […].“ Jean Baudrillard, Videowelt und fraktales Subjekt, in: ders. et. al., ars electronica (Hg.): Philosophien der neuen Technologie, S. 125, Berlin 1989 74 So schreibt Norbert Schläbitz unter dem Titel „Wie sich alles ‚erhellt’ und ‚erhält“ ein bisschen „Von der Musik der tausend Plateaus oder ihrem Bau“: „Der Mensch als ‚Projekt’ ist gerade deshalb möglich geworden, weil die Ratio auf der Suche nach dem Kern der Dinge die objektive Welt der Inhaltsleere überführt hat und das 17 Medien steht der Irrtum, dem Verhältnis von Mensch zu Maschine eine zentrale Bedeutung beizumessen. Der so zum Selbstzweck deklarierten Information wird der Warencharakter abgesprochen, die damit verbundenen Besitzverhältnisse ideologisch verklärt. Was in der Momentform Stockhausens bereits als Problem formuliert wurde: die bloße physische Anwesenheit des Komponisten75, der Interpreten und der Zuhörer76, die jede Verbindung mit der Arbeit am musikalischen Werk verloren hat, wird in den das „Verschwinden des Interpreten und des Komponisten“ bzw. die „Emanzipation des Hörers“ verkündenden Texten von Kunst- und Medienkritikern wie Peter Weibel oder Norbert Schläbitz zur positiv gesetzten Wunschvorstellung.77 Nicht das Herbeizaubern alter Wertbegriffe und Hierarchien wäre hier zu fordern. Indem man jedoch den Begriff der (künstlerischen) Arbeit einebnet78, verschwindet mit dieser auch der Mensch als Entscheidungsinstanz und wird zur digitalen Kategorie, der es entweder beschieden ist, da oder nicht da, also fort zu sein.79 Den „Halt“, den die von N. Schläbitz avisierte Netzwerkkunst angeblich der Musik nimmt, nimmt sie in Wirklichkeit dem Verstand des Menschen.80 Dieser aber vermittelt zwischen zwei Kategorien: den ‚haltlosen’ variablen Rastern, die die Zukunft bedeuten, und den zu Vergangenem geronnenen ‚fixen’ Rastern, die sich zum Gedächtnis formieren. Die von Weibel und anderen bejubelte „Emanzipation des Hörers“ bedeutet entweder Rückfall hinter die schlimmsten Manifestationen archaischen Werkcharakters81, oder sie misst sich an der Arbeit eines Künstlers und verliert dadurch ihre eigene Unendlichkeit. Die unbedingte Aufrechterhaltung dieser Unendlichkeit schlägt um in die Zwanghaftigkeit, sich zwischen Präsenz und Abwesenheit entscheiden zu müssen. Die Freude am Techno ist in den Abgründen seines lediglich aus „0“ und „1“ bestehenden Rhythmus zu suchen, der in der Hypostasierung des ‚da’ Gefühl im Umgang mit dem Unbestimmten über reichhaltige Kompetenz verfügt. Technik und Phantasie im Zusammenstand verführen und führen zum Unerhörten!“ Der nämliche Autor lässt uns glücklicherweise nicht im Dunkeln über das Ergebnis solcher Verführung. Lauschen wir ein wenig in die unerhörten Tiefen des Internets: „Netzwerkmusizieren erinnert an eine Plauderei, an ein Gespräch.“ Falls das „Belauschen seinen Reiz“ verlieren sollte, „sagt man selbst etwas. Irgendetwas“. Glücklicherweise muss man sich nicht mit Plauderei begnügen, wirken doch auch echte Profis im Netz. Daher zum Abschluss ein Musiktip von Norbert Schläbitz: „Virtopera, die Internet-Oper von Schoener, fordert[…] zur Mitwirkung auf.“ (http://www.akirarabelais.com/narcissine/ schlaeb.html, Download vom 13.6.2002, Google-Archiv). Anhand von Soundfiles und Noten konnte ich mich davon überzeugen, dass das Ergebnis purer Kitsch ist, der zudem nichts von einer offenen Form hat. 75 Vgl. die bereits oben erwähnte Zufälligkeit der Beendigung der Komposition, Stockhausen, S. 200 76 Indem er dem Publikum einerseits die Verantwortung des Programmwechsels zubilligte, andererseits den Interpreten bzw. der Programmplanung die Entscheidung darüber, was einem zufällig anwesenden Publikum dargeboten wird, überließ, verschob Stockhausen das Moment des dem Werk zugekehrten Bewusstseins, der Aneigungsarbeit und -leistung einmal da- einmal dorthin. Das Problem musste in der angedachten Form zwangsläufig in der Schwebe bleiben. Vgl. Stockhausen, S. 206 77 Vgl. S. 27, sowie N. Schläbitz, ebd.: „Wo der Zufall als konstitutives Moment des Neuen wirkt und sich gegen eine geplante Ordnung stellt, wie dies im Zusammenspiel von ‚global-playern’ sich darstellt, sind Autoren und Komponisten wie die ‚global-player’ gleichermaßen als planende Gestalter im Grunde nicht in dem verantwortlichen Maße tätig, wie allgemein ihnen gerne zugeschrieben wird.“ 78 Nichts anderes bedeutet die Gleichsetzung der Arbeit eines DJs mit der eines Komponisten, wie sie N. Schläbitz in seinem Text betreibt. Dass DJ Westbam seine Arbeit als Alleinunterhalter und Monteur industriell hergestellter musikalischer Fertigbauteile zusätzlich als „Record Art“ verkaufen möchte, erscheint als Werbegag plausibel. Dass Schläbitz die Argumentation, dies sei „ein Komponieren neuer Stücke anhand vorhandener Platten“ in seiner theoretischen Arbeit übernimmt, ist eine andere Sache; vgl. ebd. 79 Weil Norbert Schläbitz sich nicht damit begnügen kann, die Gegenwart zu verdrehen, muss er zusätzlich die Vergangenheit in seinem Sinne interpretieren. So findet Satie angeblich in den tontechnischen Spielereien von Akira Rabelais zu sich: „In dem Moment, wo Satie ‚ist’, ‚ist’ er zugleich auch nicht.“ (Rabelais verfremdet Aufnahmen seines Klavierspiels nachträglich tontechnisch); vgl. ebd. 80 „Mit dem Schritt ins Netz beginnen Netzwerkreisende der unbedingten Kunst Musik nun den letzten Halt zu nehmen, den in den Partituren der Aufschreibarbeit und in den Orten der traditionellen Aufführung sie noch hatte.“ Vgl. N. Schläbitz, Weltenklang oder: Das Werk im Netz, http://www.musik.uniosnabrueck.de/veranstaltungen/klangart/kong99.htm#fricke, Download vom 14.6.2002 81 Vgl. die in Fußnote 74 erwähnte Oper von Schoener. 18 und ‚fort’ als Simulation der letztmöglichen Haltung den Beteiligten das Gefühl vermittelt, Gast der heutigen Zeit gewesen zu sein. Im Zuge einer resignativen Wendung wird die ästhetische Äußerung und Wahrnehmung der Menschen kurzgeschlossen mit der (scheinbar) technologisch erschlossenen Wirklichkeit. Das nun zur offenen Form deklarierte Fragment steht in keinem Verhältnis zum menschlichen Körper. Nicht mehr angebunden ans sensomotorische Zentrum erlischt der ästhetische Blick auf die Wirklichkeit. Es erscheint daher heute aus zweierlei Gründen schwierig, künstlerisch „etwas“ zu machen, das „neben“ den digitalen Kategorien Bestand haben kann: der Kategorie des Allumfassenden, dem als virtuell nur möglichen bereits das „Nichts“ eingeschrieben ist, und der Kategorie des „Nichts“, das sich hinter der scheinbaren Unmöglichkeit verbirgt, „etwas“ zu machen. Zum einen scheint das produzierte „Etwas“ stets schon von der Faktizität der Verwertungslogik eingeholt zu sein, die in der Ästhetik der Werbung oder in der Darstellungsästhetik der Wissenschaften ihren – die „avancierte“ Kunst beerbenden – Niederschlag findet. Zum anderen scheint ein der Kunst innerer Zwang zum Unendlichen zu bestehen, der in Selbstabschaffung zu terminieren droht. Es muss derzeit mehr denn je darum gehen, der in Teilen der Gesellschaft verbreiteten, sich hinter der virtuellen „Authentizität“ verbergenden Resignation entgegenzuwirken. Es ist durchaus berechtigt, Bilder daran zu messen, inwieweit sie der scheinbar unausweichlichen Logik des Verschwindens widerstehen. Ein Weg könnte sein, die aufs Unendliche bezogene Denkfigur an der Arbeit zu relativieren, mit der wir uns unsere Umgebung aneignen. Damit erlangt der Moment des Umschlags von variablen in fixe Raster eine große Bedeutung. Als Bild von – künstlerischer – Arbeit schlägt sich dieser Moment ästhetisch nieder und ist gleichzeitig Ausdruck von einer Haltung82. 82 Beispiele dazu finden wir bei den Filmen von Jean-Marie Straub und Danielle Huillet, in denen die Spuren der Arbeit nie getilgt wurden. Beispiel: Klassenverhältnisse. Die dem Film eigene Form der sprachlichen Umsetzung verlangt von jedem Schauspieler eigene Formen der Umsetzung, die sich zwangsläufig von filmindustriell geprägten Zuweisungen unterscheiden müssen. Das führt dazu, dass hier Laiendarsteller neben Filmstars agieren können, ohne sich gegenseitig auszustechen. 19 2. Die innere Grenze der (musikalischen) Momentform Die im ersten Teil durchgeführte Betrachtung hat versucht aufzuzeigen, in welchem Verhältnis technische Reproduktion der Wirklichkeit und ästhetische sowie politische Emanzipation stehen. Am Schluss stand die Frage, inwieweit es dem Menschen unter den daraus resultierenden Bedingungen noch möglich ist, sich gegenüber der Welt als Wahrnehmender und sich Äußernder zu positionieren bzw. – mit anderen Worten – eine Haltung einzunehmen. Dabei wurde vorausgesetzt, dass der diesbezügliche Zugang zur Welt auf der Existenz sensomotorisch übertragener Bilder basiert, deren „Wahrheitsgehalt“ zum einen ein Oberflächenphänomen darstellt, zum anderen stets in der Gegenwart, also in einem punktuellen „Moment“ zu suchen ist. Um den Begriff der Medialisierung genauer zu fassen, wenden wir uns nun der Musik als Zeitkunst und ihrer Offenheit gegenüber der akustischen Wirklichkeit zu. In diesem Zusammenhang sei an Ivan Wyschnegradskys Konzept der „Pansonorité“ (Allklanglichkeit) erinnert83, welches den musikalischen Raum und seinen zeitlichen Verlauf als unendliches Kontinuum beschreibt. Dieses Kontinuum zerfällt nach Wyschnegradsky sowohl in eine ideelle als auch in eine materielle Komponente84: „Aktual“ ist der musikalische Raum, insofern er in der Vorstellung in unendlicher und kontinuierlicher Weise präexistent ist. „Virtuell“ ist er im Sinne seiner „Möglichkeitsform“, als realer, unendlicher physikalischer Raum, innerhalb dessen zu jeder Zeit und an jedem Ort ein Ton installiert sein kann. Bildet der aktuale Raum als amorphes Ganzes eine Masse, die zu strukturieren ist, so fungiert der virtuelle Raum als leere Form, die erst gefüllt werden muss. Der Verlauf des aktualen Raums ist kontinuierlich zu denken. Die Abwesenheit von Grenzen ist gleichbedeutend mit der Gleichzeitigkeit einer unendlichen Menge von Tönen, deren Abstände zueinander gegen „0“ tendieren. Die materielle Komponente der Musik hingegen ist diskontinuierlich. Hier sei an den Moment des Umschlags variabler in fixe Raster (Kap. 1, Abb. 1) erinnert: der Schnitt in die Zeitgerade bezeichnet die Gegenwart, zu der die variablen sich in fixen Rastern niederschlagen, mithin die in der Zukunft angedachte Form materiell wird. Dies geschieht um den Preis des Verlusts ihrer (in der Möglichkeit vorhandenen) Kontinuität. Beispielsweise steht ein Glissando für einen zeitlichen Verlauf innerhalb eines Startund eines Endpunktes, zwischen denen sämtliche Frequenzen kontinuierlich erklingen. Tatsächlich erfolgt die technische Umsetzung diskontinuierlich: Das Gleiten des Fingers auf dem Griffbrett einer Violine, die sukzessive Erhöhung der Abtastgeschwindigkeit bei einem Sample, aber auch die mit der Übertragung des Tones in Luft oder die mit dem Hören verbundenen Vorgänge implizieren winzige Sprünge. Das Glissando, das wir letztendlich wahrnehmen, ist die Interpretation eines diskontinuierlichen Verlaufs im Sinne einer Idee von Kontinuität. Den Idealfall des unendlichen musikalischen Raumes bildet ein unendlich ausgedehntes Rauschen. Hier ist zu jedem Zeitpunkt alles Akustische möglich und wird auch zu irgendeinem Zeitpunkt eintreffen. In Bezug auf die (unendlichen) Möglichkeiten der akustischen Ereignisse zu jedem Moment sei im Folgenden der Begriff „akustische Fülle“ verwendet. Die abendländische Musik tendierte stets zur Eroberung dieser Fülle, d.h. zur bewussten Strukturierung des amorphen musikalischen Raumes. Diese Tendenz führt zum einen zu einer immensen Steigerung dessen, was Musik hervorzubringen vermag, zum anderen schlägt sie ab einem bestimmten Punkt um und bedeutet Ohnmacht gegenüber der konkret geschaffenen Form. Dieser Prozess sei, beginnend mit der Romantik, im Folgenden kurz skizziert. Die sich verändernde Weltsicht der Romantik (vgl. S. 8) schlug sich nieder in der kompositorischen Technik des mittleren 19. Jahrhunderts. Während die Konventionen und Hierarchien 83 Ivan Wyschnegradsky, La loi de la pansonorité, Genève 1996 Vgl. auch Barbara Barthelmes, Raum und Klang. Das musikalische und theoretische Schaffen Ivan Wyschnegradskys, S. 28 f., Fulda 1995 84 20 der Dur-Moll-Tonalität prinzipiell unangetastet blieben, wurde fortwährend versucht, deren Grenzen auszuloten und die Deutungsmöglichkeiten zu vervielfachen. Bereits in den Klaviersonaten Schuberts wird der klassische Sonatensatz ausgehöhlt, das thematische Vorwärtstreiben durch ein Verfahren ersetzt, das kleinste Zellen (harmonisch) ständig in neuem Licht vorstellt85. Ungewöhnliche Anfänge und Enden, harmonische Uneindeutigkeit und Veränderung des Verhältnisses zwischen Singstimme und Klavierbegleitung beispielsweise bei Schumanns Liedern86 machen die musikalische Form instabil und setzen den Prozess gedanklicher Unendlichkeit in Gang, der dem romantischen Fragment zu eigen ist. Die konsequente Weiterverfolgung der in der Romantik angewandten musikalischen Techniken (z.B. tonale Mehrdeutigkeit, Alteration von Vielklängen, über vier oder fünf Töne hinausgehende Klangschichtungen) bedeutete die Lockerung tonaler Bindungen. In Kompositionen wie im zweiten Streichquartett Fis-Moll von Arnold Schönberg erscheinen Dissonanzen, deren Auflösung in konsonante Verhältnisse nicht mehr obligatorisch ist. Diese Entwicklung führte schließlich zur Gleichberechtigung der Verhältnisse zwischen den zwölf Tönen der Tonleiter. Ob – wie in dodekaphonischen Verfahren – die sukzessive Verwendung aller zwölf Töne in der Komposition tatsächlich erfolgt, oder ob sie lediglich potentiell einem aleatorisch oder sonst wie bestimmten Ablauf zugrunde liegt, d. h. eine Auswahl stattfindet, ist hinsichtlich eines Aspekts nicht von Belang: Um den aus der harmonischen Enthierarchisierung resultierenden Verlust an Spannung aufzufangen und die damit verbundene Gefahr von Monotonie zu bannen, mussten die Komponisten neue, starke und bisweilen derbe Mittel finden und zur Anwendung bringen. Den „Prométhée“87 musikalisch voranzutreiben, erreichte Alexander Skrjabin beispielsweise durch schnelle Wechsel in Dynamik und Klangfarbe sowie durch häufige Wechsel und durch Überlagerung von Transpositionsstufen. Gegen Ende wertete er die Coda durch überraschenden Choreinsatz auf und beschleunigte das Tempo. Durch den Wegfall tonaler Hierarchie wird die Geschlossenheit der Form in Frage gestellt88. Der Versuch, diese Geschlossenheit zu retten, gerät der Musik in der beginnenden Moderne zum Problem. Das macht sich bemerkbar an der Hinzuziehung von Verfahrensweisen, die der Struktur der jeweiligen Komposition äußerlich sind. Nichts spricht dafür, den PrometheusAkkord in einen Dur-Akkord aufzulösen, wie dies am Ende des „Prométhée“ geschieht. Willkürlich erscheinen auch die klassischen Formschemata, die Arnold Schönbergs auf Zwölftönigkeit basierenden Stücken aufgeprägt sind oder eine Figur wie das zwingende Ostinato, das den ersten Satz von Schönbergs drittem Streichquartett so einprägsam erscheinen lässt. Vieldeutigkeit wird in der modernen Musik total, insofern alles mit allem korrespondiert und somit Vieldeutigkeit nicht mehr ins Verhältnis zur Eindeutigkeit einer ordnenden Kraft gesetzt werden kann. Fragmentarisch zu sein, bedeutet nicht mehr die Andeutung des Ganzen durch die Form, sondern dessen Eindringen in die Form selber. Der auf die Evozierung des 85 Als Beispiel mag die „wandernde Harmonie“ im Durchführungsteil des 1. Satzes der Klaviersonate B-Dur (D960) dienen. Modulation durch mehrere ≅ - Tonarten führt dort schließlich zu Eses – Moll, welches in DMoll umgedeutet wird (Durchführungsthema dann in F-Dur). 86 „Im wunderschönen Monat Mai“, das erste Lied von Schumanns „Dichterliebe“ bleibt stets in der Schwebe zwischen A-Dur und Fis-Moll und beginnt ebenso unvermittelt (in einer scheinbaren Schlusskadenz von FisMoll) wie es endet (mit unaufgelöstem Dominant-Septakkord); vgl. auch Charles Rosen, Musik der Romantik, S. 91 ff., Salzburg und Wien 2000 87 Der „Prométhée“ von Skrjabin basiert auf dem „Prometheus-Akkord“ C-Fis-B-E-A-D, der in sich gleichzeitig die Merkmale von Tonika, Dominante und Subdominante birgt. Das zeitliche Voranschreiten der Komposition ergibt sich aus vertikaler Verschiebung (Transposition) dieses Akkords und Überlagerung des dabei entstandenen Materials. Die Transpositionsstufen können beliebig aufeinander folgen, sind also potentiell aleatorisch und damit frei von Hierarchie. 88 In „klassischer“ Musik sind Geschlossenheit der Form und Tonalität untrennbar miteinander verzahnt. Thematische Arbeit und tonale Spannung bedingen einander, treiben das musikalische Geschehen voran und legitimieren die Finalität der Form. 21 Ganzen zielende gedankliche Prozess verlagert sich sukzessive vom Hörer in die musikalische Form. Die Spannung zwischen ihrer – durch „äußere“ Verfahrensweisen herbeigeführten – Geschlossenheit und ihrer im Material gründenden Offenheit kündet von Konsequenzen, die allerdings erst bei maximaler Erweiterung des musikalisch Verfügbaren zutage treten (vgl. unten). Zeitgleich mit dem Zerfall der tonalen Ordnung kamen Gedanken auf, die bevorzugte Rolle in Frage zu stellen, die den zwölf Halbtönen einer Oktave bei der Unterteilung des Tonraums zukommt. 1906 beklagte Ferruccio Busoni in seinem „Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst“ die Begrenztheit herkömmlicher Musikinstrumente und forderte eine Musik, „die nicht an die Sklaverei der Tonleitern, der Intervalle, des Rhythmus und der Harmonie gebunden ist, sondern in der die Töne hervorschießen, gleiten, wie Vögel in der Luft, Fische im Meer und in der Änderungen der Tonhöhe und Tonstärke so sanft und allmählich vor sich gehen können wie in der Natur…“89. 1912 schrieb Nikolaj Kulbin unter dem Titel „Die freie Musik“ im blauen Reiter: „Die Musik der Natur – das Licht, der Donner, das Sausen des Windes, das Plätschern des Wassers, der Gesang der Vögel – ist in der Auswahl der Töne frei. Die Nachtigall singt nicht nur nach Noten der jetzigen Musik, sondern nach allen, die ihr angenehm sind. […]. Der Künstler der freien Musik wird wie die Nachtigall von den Tönen und Halbtönen nicht beschränkt. Er benutzt auch die Viertel- und Achteltöne und die Musik mit freier Auswahl der Töne.“90 Was in diesen Texten angesprochenen wurde, schlug sich in vielfältiger Weise in der Musik des letzten Jahrhunderts nieder. Die u. a. von Alois Hàba, Julián Carillo und Ivan Wyschnegradsky theoretisch und kompositorisch vorangetriebene Mikrotonalität erweiterte das auf Halbtönen beruhende Tonsystem um Drittel-, Viertel- , Achtel-, Sechzehnteltöne, um nur einige der verwendeten Bruchteile zu erwähnen. Obwohl die Mikrotonalität eine Annäherung an den „pansonoren“ akustischen Raum bedeutet, kann hier noch keinesfalls von der Eroberung der unendlichen akustischen Fülle die Rede sein. Die Unterteilung des Tonraums erfolgt stets noch auf der Basis rationaler Zahlen, deren Zähler und Nenner abzählbar sind. In der Praxis ist sie auf wenige Brüche beschränkt, die Vielfache einer kleinsten Einheit sind91. Mit den Glissandi kommt auf zweierlei Weise ein (mathematisch gesehen) irrationales Moment in das musikalische Material hinein. Zum einen sind sie zwar (mit Hilfe von Hüllkurven) in ihren Grenzen beschreibbar, jedoch ist ihre genaue Struktur unbestimmbar. Der oben beschriebene, diskontinuierliche Verlauf eines Glissandos ist zwar endlich, aber nicht vorhersehbar. In „Amériques“ von Edgard Varèse ist selbst die Hüllkurve, die als statistischer Verlauf dem Ereignis übergeordnet ist, nur bei den Instrumenten (z. B. Streichern, Blechbläsern) durch Noten fixiert, während der Tonumfang des Sirenenglissandos allenfalls von der Länge abhängt, in der es ertönt. Iannis Xenakis legte seine beispielsweise in „Metastaseis“ erscheinenden Glissandi mit Hilfe von mathematischen Gesetzen fest. Ihre Beschreibung erfolgte durch einen Start- und einen Endpunkt, durch die Geschwindigkeit der Frequenzänderung v = df / dt und durch ihr Register (maximale Ausdehnung)92. Ist die Geschwindigkeit v = 0, so erreicht das Glissando einen Grenzzustand, der einem konstanten Ton entspricht. Ist v = unendlich, so entsteht ein Knacken, d. h. ein Geräusch. Damit kann ein Glissando als Übergangszustand zwischen den Kategorien Ton und Geräusch angesehen werden. Die Annäherung ans Geräusch offenbart den zweiten Aspekt, unter dem das Glissando irrationale Züge aufweist. 89 Zit. nach Grete Wehmeyer, Edgard Varése, S. 40, Regensburg 1977 In: Kandinsky / Marc (Hg.), Der blaue Reiter, S. 125, München 1912, Neudruck München 1965 91 Bei Wyschnegradsky ist der Zwölftelton, der z. B. zwischen Dritteln und Vierteln vermittelt, die kleinste Einheit 92 Vgl. Iannis Xenakis, Formalized Music, S. 33, Indiana University Press 1972 90 22 Erst mit der völligen Einbeziehung des Geräuschs ins kompositorische Kalkül kann jedoch wirklich von einer Annäherung an die akustische Fülle gesprochen werden: alle periodischen Töne und Klänge werden nun zu Spezialfällen eines akustischen Geschehens, das völlig offen in seiner horizontalen und vertikalen Ausbreitung ist. Die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Geräusch erfolgte zunächst außermusikalisch bzw. in musikalischen Grenzbereichen – wenn man von der lautmalerischen und symbolischen Verwendung von Geräuschen in der bisherigen Musik absieht. In seinem 1913 veröffentlichten Manifest „l’arte dei rumori“, schrieb der italienische Futurist Luigi Russolo: „Das Leben der Vergangenheit war Stille. Mit der Erfindung der Maschine im 19. Jahrhundert entstand das Geräusch. Heute triumphiert und herrscht das Geräusch souverän über die Sensibilität der Menschen. Wir nähern uns so immer mehr dem Ton-Geräusch. Diese Entwicklung in der Musik geht parallel mit dem Anwachsen der Maschinen. Wir müssen die unendliche Vielfalt der ‚Geräusch-Töne’ hinnehmen!“93 Zusammen mit Ugo Piatti baute Russolo eine Reihe von Geräuschinstrumenten, die er als „intonarumori“ („Lärmtöner“) bezeichnete. Diese länglichen, mit Schalltrichtern, Kurbeln und Hebeln versehenen Holzkästen unterschiedlicher Größe waren im Grunde die ersten elektrischen Musikinstrumente, denn sie nutzten zur Klangerzeugung neben mechanischen Klangquellen auch Schwachstrom und Summer mit Unterbrechern. 1930 fertigte der Regisseur des Films „Berlin, Sinfonie einer Großstadt“, Walter Ruttmann, eine Collage als Hörspiel fürs Radio an, in der Geräusche, Sprachfetzen und Instrumentalklänge einander ergänzen. Auch der sowjetische Filmregisseur Dziga Vertov arbeitete bereits früh an Geräuschkompositionen, wie er in seiner Autobiografie erwähnt: „In meinem ‚Laboratorium des Gehörs’ machte ich sowohl dokumentarische Kompositionen wie auch musikalisch literarische Wortmontagen.“94 Einen ersten umfassenden Ansatz zur musikalischen Verwendung von Geräuschen unternahmen Pierre Schaeffer und seine Mitstreiter, deren Produktion unter dem Namen „Musique concrète“ bekannt wurde. Ihnen ging es darum, ein empirisches Verständnis des Klanges zu verteidigen, im Gegensatz zur abstrakten „Klangkomposition“, wie sie beispielsweise im Serialismus vertreten wurde. Ausgangspunkt der Strukturierung „konkreter“ Musik ist das Klangobjekt. Nicht per se musikalisch, ist es dennoch innerhalb des kompositorischen Prozesses zu verorten: „Das Objekt ist klanglich, bevor es musikalisch wird: Es stellt ein Fragment der Wahrnehmung dar, aber wenn ich eine Wahl unter den Objekten treffe, wenn ich einige isoliere, kann ich vielleicht Zugang zum Musikalischen finden. Das musikalische Objekt wäre dann das Musikalische in seinem Ursprung erfasst, in der Funktion der Objekte, die diese Bezeichnung verdienen, das heißt beinahe am Nullpunkt der Musikalität“.95 Ausgehend von den Klangobjekten stellt sich die Frage nach ihrer Weiterverarbeitung und sukzessiven Anordnung. Begnügt sie sich damit, herauszufinden, wie Geräusche zueinander „passen“, so gerät Komposition schnell zum Sounddesign, insbesondere wenn die technischen Schwierigkeiten bei ihrer Bearbeitung derart gering sind, wie es heute der Fall ist. Die Radikalität der Komposition von und mit Geräuschen liegt nicht in deren Katalogisierung und Verfügbarmachung.96 93 Zit. nach: Armin Köhler, Von den Sprengmeistern des musikalischen Universums. Das Geräusch als kompositorische Kategorie, Teil 1, http://www.swr2.de/hoergeschichte/sendungen/000619_26_sprengmeister/ komponisten.html, Download vom 28.7.2002 94 Zit. nach: Wolfgang Beilenhoff (Hg.), Schriften zum Film, S. 158, München 1973 95 Pierre Schaeffer, zit. nach: Jean-Yves Bosseur, Die konkrete Musik und die Bildenden Künste, in: Helga de la Motte-Haber, Inventionen ’98, 50 Jahre Musique concrète, S. 77, Berlin 1999 96 Genauso wenig war die Verwendung aller zwölf Halbtöne bei Schönberg oder den im Umfeld von Skrjabin wirkenden Komponisten Obuchov, Lourié, Roslavec oder Aleksandrov das wirklich „Neue“ (auch in Bachs „wohltemperiertem Klavier“, Fuga 24 sind Zwölftonfelder zu finden), sondern die potentielle Gleichzeitigkeit aller Töne an jedem Moment. 23 John Cage sah das Problem bereits im systematisierenden Ansatz von Schaeffer: „Was mir von Anfang an an Schaeffers Werk Unbehagen bereitete, war sein Interesse an Beziehungen – insbesondere die Beziehungen zwischen Klängen. […] Wir kommen unvermeidlich zu den Klängen zurück, im ‚musikalischen’ Sinne des Wortes: Geräusche die nur zu bestimmten Geräuschen passen und nicht zu anderen. Außerdem war, was ich erreichen wollte, genau das Gegenteil: nicht die Wiederholung einer uns bekannten Situation, […] sondern eine vollkommen neue Situation, in der überhaupt irgendein Klang oder Geräusch mit irgendeinem anderen auftritt.“97 Cage erkannte, dass mit dem Einbruch des Geräusches in die Komposition kein Stein auf dem anderen bleiben konnte. Das Geräusch stellt einen Ausschnitt der akustischen Fülle dar. Seine zeitliche und räumliche Struktur ist der Möglichkeit nach kontinuierlich, d. h. aus unendlich vielen Einzelmomenten bestehend. Seine Elemente stehen in irrationalen Verhältnissen zueinander, die nicht auf regelmäßig wiederkehrende Muster zurückzuführen sind98. Um dem Rechnung zu tragen und nicht in die „Permutation von Warenproben“99 zu verfallen, muss Komposition sich in weitaus größerem Maß öffnen, als dies bisher der Fall gewesen ist. Im Ergebnis entsteht eine Situation, die an irgendeiner Stelle einen Scheidepunkt zwischen (akustischer) Fülle und Auswahl enthält. Um an diesen Scheidepunkt zu gelangen, muss gewährleistet sein, dass die akustische Fülle nicht von vornherein eingeschränkt oder gefiltert wird, beispielsweise durch die Gewohnheiten der am akustischen Prozess Beteiligten (Komponisten, Musiker, Zuhörer). Dies bedeutet die Schaffung einer offenen Situation, die idealerweise stets neue Ergebnisse hervorbringt. John Cage versuchte solche Situationen auf unterschiedliche Weise zu erreichen, wobei der Zeitpunkt der Determination und damit der Auswahl jeweils an unterschiedlichen Stationen im musikalischen Prozess positioniert ist. Meistens beziehen sich die von ihm verwendeten Verfahren der Indetermination nur auf Teilaspekte der Musik (z. B. zeitliche Abfolgen ansonsten vorbestimmter Aggregate) und setzen an verschiedenen Stellen an. Das von Cage während der Komposition verwendete Zufallsprinzip setzt den Zeitpunkt der Festlegung als Grenze zwischen den gedanklichen Prozess und die kompositorische Umsetzung. In „Music of Changes“ entschieden Münzwurf bzw. gezogene Spielkarten über die Auswahl von Klängen (aus einer Menge von 32 vorgegebenen Klangkomplexen100), die Dauer und Dynamik der Klänge sowie über das Tempo der betreffenden Abschnitte, deren Grenzen im Voraus festgelegt wurden101. In „Fontana Mix“ und den verschiedenen „Variations“ findet die Festlegung zu einem späteren Zeitpunkt statt, nämlich vor der Interpretation. Sie zerfällt in zwei wesentliche Schritte: Die endgültige grafische Notation entsteht in dem Moment, an dem die auf transparenten Folien getrennt eingetragenen Linien, Punkte und/ oder Raster sich zu einem Gesamtmuster fügen, indem die Folien in beliebiger Position übereinander gelegt werden. Anschließend obliegt es in einem zweiten Schritt den Interpreten, den Linien musikalische Parameter zuzuordnen und die im Muster angelegten Kreuzungspunkte für jeden Parameter quantitativ auszuwerten. Während in „Fontana Mix“ die Differenzierung auf zwanzig Stufen beschränkt ist, 97 John Cage, Für die Vögel, S. 84, Berlin 1984 Regelmäßige Muster kommen beispielsweise bei der Überlagerung von Einzeltönen zu Klängen vor. 99 Vgl. Pierre Boulez, Musikdenken 1, S. 36 f., Mainz 1963. Boulez betont die Individualität geräuschhafter Klänge (im Gegensatz zur Neutralität unbearbeiteter Klänge im Rohzustand). Er folgert: „Es ist nicht leicht, den heiklen Punkt zu finden, wo die Verantwortlichkeit der Strukturen und die Persönlichkeit der Objekte im Gleichgewicht stehen. Das Geräusch stellt übrigens das im organischen Zustand dar, was ein Komplex ‚formulierter’ Töne auf einer höheren Ebene der Verarbeitung wiedergibt.“ Tatsächlich kann die Menge solcher komponierter Komplexe nur eine Annäherung an die akustische Fülle bedeuten. 100 Dies bedeutet, dass Zufallsprinzip und Determination sich nicht gegenseitig ausschließen müssen. 101 Vgl. Stefan Schädler, Transformationen des Zeitbegriffs in John Cages Music of Changes, in: Heinz-Klaus Metzger und Rainer Riehn, Musik-Konzepte Sonderband John Cage II , S. 192 f., München 1990 98 24 bleibt es den Interpreten der „Variations“ selbst überlassen, den Differenzierungsgrad für jeden Parameter bezogen auf das verwendete Instrument zu bestimmen.102 Bis zum Letztmöglichen wird die offene Situation bei „4’33’’“ aufrechterhalten: Hier wird aufs Komponieren ebenso wie aufs Interpretieren weitgehend verzichtet103. Komposition findet gewissermaßen in Echtzeit statt und wird mit dem Hören kurzgeschlossen. Dabei erhält jeder Zeitpunkt des Geschehens maximale Freiheitsgrade: Alles wird potentiell möglich. Umgekehrt lässt sich genauso gut behaupten, dass nichts möglich werde: Sowie „alles“ in Echtzeit entstehen kann, so ist es auch in Echtzeit vergänglich. Die mit dem Komponieren und dem Hören verbundene Arbeit erfordert für jeden musikalischen Moment eine Zeitspanne, die bei einer „Echtzeitkomposition“ nicht zur Verfügung steht. Die Allmacht („Alles ist möglich“) der Echtzeit-Komposition ist virtuell. Die Verschmelzung der distinkten Einzelpunkte ist jedenfalls nicht identisch mit dem Echtzeit-Kunstwerk. Was wir hören, ist von der Alltagswahrnehmung nicht zu trennen: Wind, Regentropfen und Flüstern (vgl. Fußnote 103) stehen in keinerlei geplanten Zusammenhang mit dem Notenblatt. Betrachtet man kompositorische Arbeit als Tätigkeit, die zwischen der akustischen Fülle und der hörbaren Welt vermittelt, so ist diese aus dem musikalischen Prozess verschwunden (ebenso wie Hörarbeit und die Arbeit eines Musikers). Dennoch kann man sagen, dass sie in Verbindung mit der Intention der Aufführung stehen: Sie stülpen sich gewissermaßen als real wahrgenommene Information über das befreite Kunstwerk. Dieses wirkt als Transportmittel für die wahrgenommenen Geräusche und verschwindet gleichzeitig hinter diesen. Es wird mit anderen Worten zum Medium. In der durch Zufall gesteuerten „Echtzeitkomposition“ begegnen wir also dem Prozess der Medialisierung wieder, der im ersten Teil dieses Textes als Konsequenz musikalischer Verdichtung in der Momentform beschrieben wurde. Was in der von Stockhausen gedachten Momentform Ergebnis eines Aufbruchs der linearen, im doppelten Sinne einer „Geschichte“ verpflichteten musikalischen Ordnung war, ist in der „Echtzeitkomposition“ Resultat eines vom Komponisten geschaffenen, zeitlich begrenzten Rahmens104, der Platz für jegliche akustische Struktur bietet. Der potentiellen Unendlichkeit der Momentform im Sinne Stockhausens entspricht die „innere Unendlichkeit“ einer innerhalb eines gegebenen Rahmens dissozi- 102 vgl. Peter Böttinger, Vom Außen und Innen der Klänge, in: Heinz-Klaus Metzger und Rainer Riehn, MusikKonzepte Sonderband John Cage II , S. 16, München 1990 103 Die Uraufführung fand 1952 in Woodstock statt. Ausführender war der Pianist David Tudor: „(Dieser) …legte das handgeschriebene Notenblatt, welches konventionell mit leeren Takten notiert war, auf das Klavier und saß bewegungslos da, während er eine Stoppuhr benutzte, um die Länge von jedem Satz zu messen. Das Notenbild zeigte drei stille Sätze unterschiedlicher Länge an, die zusammen 4 Minuten 33 Sekunden ergaben. Tudor signalisierte den Beginn durch Herunterklappen des Flügeldeckels. Der Klang des Windes in den Bäumen durchzog den ersten Satz. Nach 30 bewegungslosen Sekunden öffnete er den Deckel, um das Ende des ersten Satzes zu verkünden. Er wurde dann für den zweiten Satz geschlossen, während dem Regentropfen auf Dach plätscherten. Die Noten umfassten einige Seiten, daher blätterte er ab und zu um, während er immer noch überhaupt nichts spielte. Der Klavierdeckel wurde wieder gehoben und gesenkt für den letzten Satz, während dem das Publikum flüsterte und murmelte.“ (aus: Larry J. Salomon, the Sounds of Silence, http://www.azstarnet.com/~solo/4min33se.htm, Download vom 3.2.2003, Übersetzung aus dem Englischen durch den Autor des vorliegenden Textes). 104 Daher insistierte John Cage auf der Verwendung einer Partitur zur Aufführung ebenso wie auf Einhaltung der Dreisätzigkeit des Stückes. In diesem Sinne äußerte sich auch der Pianist David Tudor: “It is very important to read the notation. It presents the impression that time is passing.” ( zit. nach: ebd.) 25 ierten Zeit105, die jede Aufführung zum einmaligen Ereignis werden lässt. Das Gemeinsame dieser Vorgehensweisen besteht in der Gleichwertigkeit, welche jedes musikalische Moment (bzw. Element) gegenüber den anderen genießt. Dies führt zur Hyperdeterminierung der Einzelmomente und damit zur Verdichtung der gesamten Struktur. Da auf jedes Element sogleich ein anderes folgt, können die einzelnen Elemente sich nur in Echtzeit abbilden. Unter diesem Aspekt gehen die (ideal gedachte, d.h. unendlich verdichtete) Momentform und die „Echtzeitkomposition“ ineinander über. Akustische Produktion und Wahrnehmung finden ausschließlich auf der Ebene der Gegenwart statt. Die mit der Umsetzung von Information benötigte Verarbeitungszeit kann sich nicht mehr entfalten, wodurch der damit verbundene Arbeitsprozess keine Verbindung mit dem musikalischen Ereignis eingehen kann. Als Ergebnis des soeben skizzierten Prozesses der Medialisierung haben wir alle Informationen der Welt zur Verfügung, ohne sie verarbeiten zu können. Dies führt zum bereits beschriebenen Verlust des sensomotorischen Zugriffs auf die einzelnen Elemente, die sich zu anderen Ebenen der Information zusammenschließen. Räumlich kann dies am Beispiel des MoiréEffekts beobachtet werden, ein die Zeit betreffendes Beispiel liefern Kino und Fernsehen in der Illusion des Bewegungsbildes. Wesentlich ist in diesem Zusammenhang, dass der Prozess der Medialisierung unendlich ist: Die übergeordneten Ebenen (wie die Bewegungsbilder des Fernsehens) schließen sich selbst wiederum zu medialen Aggregaten zusammen, deren Anzahl gegen Unendlich tendiert usw. Die enorme Ausweitung des technisch Machbaren hat die Hypertrophie der Bilder ermöglicht bis hin zur penetranten, an Obszönität grenzenden Durchdringung der Alltagswelt, die in der Ununterscheidbarkeit zwischen der Wirklichkeit und deren medialer Travestie und damit in der Bewusstlosigkeit gegenüber der Welt gipfelt. Mit der Überforderung der menschlichen Sensomotorik106 ist jedoch die innere Grenze der unendlich verdichteten Momentform noch nicht beschrieben. Die Überschreitung menschlicher Grenzen (durch zeitliche Ausdehnung oder im Gegenteil Kontraktion des Zeitfaktors) bildet allenfalls eine Vorraussetzung für die Medialisierung selbst. Die Inkorporierung des Geräuschs in die Musik konnte nach der bisherigen Betrachtung von zwei Seiten aus erfolgen: Die von den Serialisten wie Stockhausen oder Boulez vorangetriebene Vervielfältigung der Beziehungen eines musikalischen Gliedes mit den übrigen führte zu steigender Unvorhersehbarkeit der einzelnen Momente und damit zur Verdichtung der Strukturen im Sinne auskomponierter „Klanggeräusche“. Die von John Cage entworfenen Zeiträume hingegen operierten von vornherein mit der Unvorsehbarkeit, indem sie den Zufall einschlossen, der im Idealfall ein „dokumentarisches“ Abbild der Wirklichkeit lieferte. Bei aller Unterschiedlichkeit der Verfahrensweisen und der tatsächlich entstandenen kompositorischen Produkte treffen sich beide Wege in der Idee der unendlich verdichteten bzw. ausgedehnten Momentform. Was hier nur virtuell zum Tragen kommt, wird von einigen Theore- 105 In den meisten mir bekannten Stücken von Cage ist das konventionelle Metrum ersetzt durch zeitliche Rahmungen, die in den verschiedenen Phasen der musikalischen Umsetzung unterschiedlich verräumlicht werden: Beispielsweise durch die Äquivalenz von Zentimetern und Viertelnoten in der Partitur der „Music of Changes“ (nach: Stefan Schädler, Transformationen des Zeitbegriffs, in: Heinz-Klaus Metzger und Rainer Riehn (Hg.), Musik-Konzepte Sonderband John Cage II, S. 196, München 1990), oder durch kreisende Armbewegungen des Dirigenten, die eine Uhr imitieren (Zu „Atlas Eclipticalis“ schreibt Michael Nyman: „Die Funktion des Dirigenten ist einfach die einer Uhr – seine Arme beschreiben einen Kreis von 360 Grad, der die Länge eines Systems ausmacht: 8 Minuten. Jeder Spieler muß seine Klänge analog ihrem Ort auf der Seite innerhalb dieser Uhrzeigerbewegung ‚placieren’.“ In: Heinz-Klaus Metzger und Rainer Riehn (Hg.), Musik-Konzepte Sonderband John Cage I, S. 58, München 1995). 106 Diese ist im Übrigen selbst ein im Fließen begriffenes Phänomen, insofern sie vom Kenntnisstand, der Musikalität, der Auffassungsgabe, der investierten Arbeit usw. des Einzelnen abhängig ist. 26 tikern Teilbereichen der Medienkunst zugeschrieben. So sah der heutige Leiter des ZKM107 Karlsruhe, Peter Weibel, in einem 1987 entstandenen Text in der Klangskulptur Tendenzen der Entwicklung westlicher Musik des 20. Jahrhunderts verwirklicht, die er wie folgt benannte: „I) Neue Instrumente, eigens gebaute Geräte, wo der Unterschied zwischen musikalisch und nicht-musikalisch gefallen ist, sowie der zwischen musikalischen und nicht musikalischen Tönen. (Anm. des Verfassers: Damit entfällt die Crux der „Musique Concrète“, Geräusche „passend“ zu klopfen.) II) Inkorporierung der Geräusche, der Töne, des Lärms, des Schweigens der Umwelt. III) Verschwinden des Interpreten und des Komponisten. (…) VII) Emanzipation des Hörers (nach der Emanzipation der Pause durch Webern und der Emanzipation des Schweigens durch Cage). Der Rezipient wird zum Partizipient.“108 Die Behauptung, dass all dies irgendwo zur faktischen Umsetzung käme, erweist sich angesichts der Widersprüchlichkeit, die der Momentform innewohnt, als fragwürdig. Dies wird deutlich bei der in vielerlei Hinsicht radikalsten Umsetzung, wie sie in „4’33’’“ erfolgte. Die hier erscheinende Form erweist sich als Ergebnis eines Emanzipationsprozesses nach zwei Seiten hin, die in enger Relation zueinander stehen: Zum einen erfolgt die Emanzipation des Geräuschs als Befreiung aus der Abhängigkeit von musikalischen Gesetzen, die enge Grenzen setzten. Zum anderen verändert die damit verbundene Schaffung einer offenen Situation das Verhältnis zwischen dem Komponisten, dem Interpreten und den Hörern grundlegend. Der Hörer beispielsweise wird unabhängig von der Macht – aber auch der Kompetenz des Komponisten. Die Emanzipation als Befreiung von Abhängigkeiten bleibt jedoch lediglich auf die unendliche Möglichkeitsform der akustischen Fülle bezogen. Sich mit dem faktischen Zustand zu verbinden, erscheint ihr mit dem Verschwinden der Arbeit aus dem musikalischen Prozess versagt. Im Gegenteil. Mit der Medialisierung tritt die Alltagswelt in den künstlerischen Ablauf ein, die zu affirmieren die letzte Operation ist, die den daran Beteiligten übrig bleibt. Das Bestehen der Momentform zu garantieren erfordert andere Maßnahmen als beim formal abgeschlossenen Kunstwerk. Diese sind gegenüber dem Geschaffenen heteronom109. Das zufällig Entstandene muss zum Kunstwerk deklariert werden: „Wherever we are, what we hear is mostly noise. When we ignore it, it disturbs us. When we listen to it, we find it fascinating.“110 Musik wird zum theatralischen Akt. Auf die Frage, worin der Unterschied zwischen gewöhnlichem Türöffnen und dem Türöffnen als künstlerischer Akt bestehe, antwortete John Cage 1966: „If you celebrate it, it’s art: if you don’t, it isn’t“.111 Die Deklaration tritt als autoritäre Geste an die Stelle musikalischer, zwischen den Beteiligten vermittelnder Arbeit. Der Versuch der Vermittlung, der aus einem schriftlich fixierten Regelwerk spricht, weicht einer Setzung, die autoritärer ist, als eine Komposition mit Werkcharakter es je sein könnte. Diese Setzung kennt kein Dazwischen, keinen relativierenden Einwand: Die digitalen „Kategorien“ 1 (=Zustimmung) und 0 (=Ablehnung) bleiben als einzige Möglichkeiten der Wertung übrig. Die sich in diesem Zusammenhang stellende Frage ist nicht: „Was geschieht in der Kunst?“, sondern: „Geschieht Kunst, ja oder nein?“. 107 Zentrum für Kunst und Medientechnologie zit. nach: Peter Weibel, Der freie Klang zwischen Schweigen, Geräusch und Musik, http://www.aec.at/20jahre/katalog.asp?jahr=1987&band=1, Download vom 14.6.2002 109 Darauf wurde im Zusammenhang mit Stockhausens Überlegungen zur Präsentation von Momentformen sowie deren zeitliche und räumliche Rahmung schon im ersten Teil des Textes hingewiesen (vgl. S. 10). 110 John Cage, zitiert nach: Sabine Sanio, Das Rauschen: Paradoxien eines hintergründigen Phänomens, in: Christian Scheib (Hg.), Das Rauschen, S. 60, Graz 1995 111 zit. nach: Rainer Riehn, Noten zu Cage, in: Heinz-Klaus Metzger und Rainer Riehn (Hg.), Musik-Konzepte Sonderband John Cage I, S. 97, München 1995 108 27 Hierarchie durchdringt die Momentform. Die Rolle des Komponisten in diesem Spiel ist die eines Eventmanagers, der die Menschen an einem bestimmten Ort zu konzentrieren versucht. Musiker und Hörer bleiben auf den Zustand reiner Anwesenheit (=1) oder Abwesenheit (=0) beschränkt. Letztendlich entfällt mit der Deklaration eines zufällig entstandenen Geräusches zum Kunstwerk auch die Basis der Momentform als Manifestation akustischer Fülle. Indem ein Aspekt aus der unendlichen Vielzahl zum Besonderen wird, wird die Momentform als Negation des Besonderen selbst ad absurdum geführt. Lediglich als virtuelle Konstruktion kann sie bestehen. Wie bereits oben betont, kann es nicht darum gehen, hinter den Stand der Emanzipation zurückzufallen und die Forderung nach der Restauration des künstlerischen „Werkbegriffs“ zu erheben. Dass gerade Produkte der Medienkunst häufig diesen Titel für sich in Anspruch nehmen, kann als Paradoxie gelten. Vielleicht spiegelt sich darin der oben beschriebene Umschlag ins Autoritäre wider, Resultat einer Strategie der Abgrenzung vom Alltäglichen in einer Zeit, in der die „Momentform“ längst zur Außenhaut der Ware geworden ist. Die Verdichtung räumlicher Aktion in der Zeit, die einen kritischen Punkt über- oder unterschreitet, erwies sich als Vorraussetzung der Medialisierung, an deren Kontrolle die gesellschaftliche Machtfrage geknüpft ist. Mit der Realisierung einer „Kunst-Zeit“ ist Zeitkunst in der Lage, zumindest die formalen Umstände der Medialität zu kontrollieren. Eine Frage, die sich Komponisten heute stellt, ist nicht die, wie viele Stunden in einen Tag zu packen sind112, sondern die nach der Negation einer allgemeingültigen Zeit. Doch daran anknüpfend etwas zu behaupten, was über einen allgemein gültigen Rahmen hinausgeht, ist nicht mehr Sache der Theorie. Literatur Adorno, Theodor W.: Ästhetische Theorie. Frankfurt am Main 1995 Baudrillard, Jean et. al., Ars Electronica (Hg.): Philosophien der neuen Technologie. Berlin 1989 Beilenhoff, Wolfgang (Hg.): Dziga Vertov. Schriften zum Film. München 1973 Boulez, Pierre: Musikdenken heute 1. In: Darmstädter Beiträge zur neuen Musik 5. Mainz 1963 Boulez, Pierre: Musikdenken heute 2. In: Ernst Thomas (Hg.). Darmstädter Beiträge zur neuen Musik. Mainz 1985 Barthelmes, Barbara: Raum und Klang. Das musikalische und theoretische Schaffen Ivan Wyschnegradskys. Fulda 1995 Bergson, Henri: Materie und Gedächtnis. Eine Abhandlung über die Beziehung zwischen Körper und Geist. Hamburg 1991 Cage, John: Für die Vögel. John Cage im Gespräch mit Daniel Charles. Berlin 1984 De la Motte-Haber, Helga et. al.: Inventionen ‘98. 50 Jahre Musique Concrète. Berlin 1999 112 „Schönberg beschwerte sich immer, dass seine amerikanischen Schüler zu wenig arbeiteten. Da war vor allem ein Mädchen in der Klasse, die wirklich kaum etwas tat. Er fragte sie eines Tages, warum sie nicht mehr zustande bringe. Sie sagte: ‚Ich habe keine Zeit’. Er sagte: ‚Wie viele Stunden hat ein Tag?’ Sie sagte: ‚Vierundzwanzig’. Er sagte: ‚Unsinn. Der Tag hat so viele Stunden, wie sie hineinpacken.’“ John Cage, zit. nach: Larry J. Salomon, the Sounds of Silence, http://www.azstarnet.com/~solo/4min33se.htm, Download vom 3.2.2003 (Übersetzung aus dem Englischen durch den Autor des vorliegenden Textes) 28 Deleuze, Gilles : Das Bewegungs-Bild. Kino 1. Frankfurt 1990 jour fixe initiative berlin (Hg.): Klassen und Kämpfe. Münster 2006 Kandinsky, Wassily und Franz Marc (Hg.): Der blaue Reiter. München 1912, Neudruck München 1965 Kracauer, Siegfried: Das Ornament der Masse. Frankfurt am Main 1977 Marx, Karl: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Band 1, in: Karl Marx, Friedrich Engels, Werke, Band 23 (MEW 23), Berlin 1986 und Band 3, in: MEW 25, Berlin 1984 Metzger, Heinz-Klaus und Rainer Riehn (Hg.): John Cage I und II. München 1995 und 1990 Novalis: Schriften Bd. 2. Das philosophische Werk I. Hg. von Richard Samuel. Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1981 Parmentier, Michael: Anmerkungen zum Ich-Begriff der Frühromantik. In: Oskar Anweiler et. al. (Hg.). Bildung und Erziehung. Köln, Weimar, Wien. 46. Jahrg.1993 Rosen, Charles: Musik der Romantik. Salzburg und Wien 2000 Scheib, Christian (Hg.): Das Rauschen. Aufsätze zu einem Themenschwerpunkt im Rahmen des Festivals „Musikprotokoll ´95 im Steirischen Herbst“. Graz 1995 Schönberg, Arnold: Harmonielehre. Wien 1986 Skrzypczak, Bettina: Die Notwendigkeit, ein System zu haben und zugleich keines. Form als Prozess bei den Frühromantikern und bei Iannis Xenakis. In: Dissonanz Nr. 62. Lausanne. November 1999 Stockhausen, Karlheinz: Texte zur elektronischen und instrumentalen Musik Band 1. Köln 1963 Wehmeyer, Grete: Edgard Varèse, Regensburg 1977 Wörner, Karl H.: Karlheinz Stockhausen. Werk und Wollen 1950-1962. Rodenkirchen 1963 Wyschnegradsky, Ivan: La loi de la pansonorité. Genève 1996 Xenakis, Iannis : Formalized Music. Thought and Mathematics in Composition. Indiana University Press 1972 Internetquellen Barm, Klaus: Das Bild der Arbeit; http://www.film-text-musik.de/das_bild_der_arbeit.pdf Eichberg, Henning: Das Stadion als Ort populärer Kultur; http://www.ifoforsk.dk/qHE1999. Download vom 4.6.2002 Salomon, Larry J.: The Sounds of Silence, http://www.azstarnet.com/~solo/4min33se.htm. Download vom 3.2.2003 Schläbitz, Norbert: Wie sich alles ‚erhellt’ und ‚erhält’. Von der Musik der tausend Plateaus oder ihrem Bau; http://www.akirarabelais.com/narcissine/schlaeb.html. Download vom 13.6.2002 (Google-Archiv) Schläbitz, Norbert: Weltenklang oder: Das Werk im Netz; http://www.musik.uniosnabrueck.de/veranstaltungen/klangart/kong99.htm#fricke. Download vom 14.6.2002 Weibel, Peter: Der freie Klang zwischen Schweigen, Geräusch und Musik; http://www.aec.at/20jahre/katalog.asp?jahr=1987&band=1. Download vom 14.6.2002 29