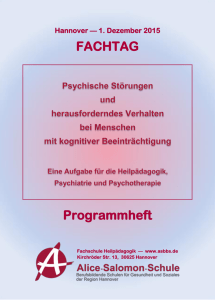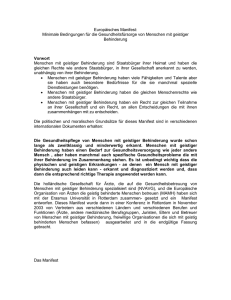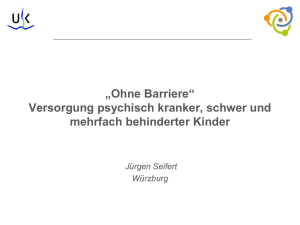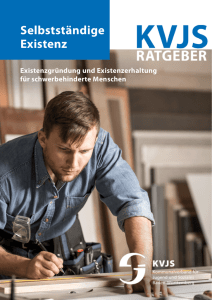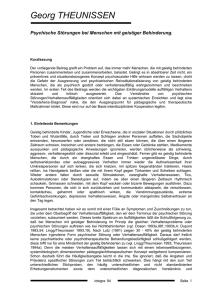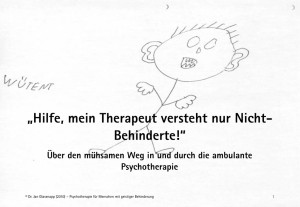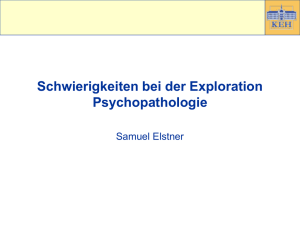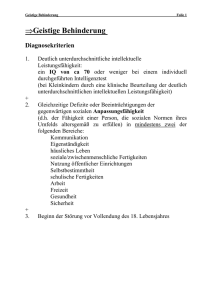1,13MB 10 Jahre Behandlungszentrum für mit
Werbung

??? | KEH-Report Seite 1 | ??? | Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité KEH REPORT 16 | Sonderausgabe | Juni 2010 10 JAHRE Behandlungszentrum Wo kommen wir her, wo stehen wir, wo gehen wir hin? 2 Interpersonelle Psychotherapie der Depression (IPT) 5 Alt, älter, abgeschoben 6 Skillstraining im BHZ 12 Außerhalb der gängigen Behandlungspfade 14 KEH-Report | Juni 2010 Seite 2 | ??? | | 10 Jahre Behandlungszentrum | Zehn Jahre Behandlungszentrum Wo kommen wir her, wo stehen wir, wo gehen wir hin? A m 1. Juli 2010 ist das Behandlungszentrum für psy­ chisch kranke Menschen mit geistiger Behinderung zehn Jahre alt geworden. In seinem vollstationären Bereich, bestehend aus zwei Stationen mit 32 Betten im Haus 9 auf dem Gelände des Evangelischen Krankenhauses Königin Elisabeth Herz­ Patientenfragebogen aus berge (KEH), hat es im Jahr 2009 378 Patienten versorgt. dem Jahr 2003 (rechts) Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Jahr 2000, als die damalige I. Allgemeinpsychiatrische Abteilung des KEH nur für die Aufnahme von psychisch kranken Menschen mit geistiger Behinderung zuständig war, die aus einem Einzugsgebiet stammten, das ungefähr dem ehemaligen Ostteil Berlins entsprach. Mit der Übernahme des Versorgungsauftrages für die­ se Klientel für Gesamtberlin im Jahr 2000, nahm der Anteil von Patienten aus entfernter gelegenen Stadtbezirken zu. Behandlungsvielfalt Auch aus ande­ren Bundesländern waren zunehmend Ein­ unter einem Dach – weisungen zu ver­­­­zeichnen. Eine kleine teil­­­­­­­sta­tio­näre Struktur­ansicht des BHZ Be­­hand­­lungs­möglichkeit wurde im Jahr 2003 er­ lle Diag öffnet (mit 24 Pa­tien­­ten in 2009). ne no io s st s Als ausgesprochen er­­­­folgreich erwies ik fe o un r d Psychiatrischtl ip sich die Eröffnung der »Spe­zial­am­­bulanz Th u psychologische er m ap e für psychisch kranke Menschen mit Diagnostik ex ie l p m geis­ti­ger Behinderung« am Gartentherapie Seelsorge Ko 1. März 2005, mit zunächst Sozialarbeit Physiotherapie Musiktherapie zwei Patien­ten, angebun­ Psychotherapie Kunsttherapie den an die Psychiat­ Pharmakologische Therapie Bezugspflege Ergotherapie rische Institutsambu­ Spezialambulanz lanz (PIA): im Haus 11 P7 P8 konnten im I. Quartal Epilepsie Autismusbehandlung DBT somatische KAT-Gruppe Skills-Training, 2010 380 Patienten Erkrankungen Canistherapie 5-Sinne-Gruppe ambulant behandelt Basisstimulation Amb. DBT, GefühlsGefühlsgruppe Angebote nach gruppe, Skillstraining soziale Fertigkeiten werden. Ein Kennzei­ Suchtprojekt (HPA) TEACCH Kreativtanz AutismusBELA Psychoedukation chen der Arbeit der diagnostik PMR, Sportgruppe Spezialambulanz, wie EKT IPT-Aufwärtsgruppe Aromatherapie Snoezelen,Gesünder Essen« auch des Behandlungs­ zentrums insgesamt, ist Berliner Behandlungszentrum für Menschen mit geistiger Behinderung und psychischer Erkrankung der multidisziplinäre An­satz, der eine ganz­ BeschwerdeAusbildungsstätte für HEP‘s, Gremienarbeit heitliche Diagnostik management (DGPPN, BDK, VIA-Beirat) Krankenpflege, PPiA‘s, Ärzte, Heilpädgogen und Therapie unserer Angehörigenarbeit Interne Fortbildung Patienten ermöglicht. (AMDP, Reanimation, Externe Fortbildung Deeskalation, Kultursensible Pflege) (Lobetal, VIA, Lebenshilfe etc.) Inhalt 2 Zehn Jahre Behandlungszentrum 3 Editorial 5 Interpersonelle Psychotherapie der Depression (IPT) 6 Alt, älter, abgeschoben 7 Grußwort zum 10jährigen Jubiläum 8 Das ist ein Erfolg 9 Grußwort 10 Therapieangebote 12 Skillstraining im BHZ 13Krisenintervention bei geistig behinderten Menschen mit einer Störung der Impulskontrolle Wichtig war immer die intensive Kooperation mit Patien­ ten, Angehörigen, Betreuern und behandelnden Ärzten. So wurde im Jahr 2003 auf einer der beiden Stationen im Behandlungszentrum ein Zufriedenheitsfragebogen für unsere Patienten eingeführt, dessen Beantwortung sehr gerne wahrgenommen wurde. Seit 2007 gibt es im gesam­ ten Behandlungszentrum ein standardisiertes Beschwerde­ management, das koordiniert ausgewertet wird. In der Spezialambulanz wurde Wert darauf gelegt, dass die Überweisungen immer durch einen Nervenarzt, Neuro­ logen oder Psychiater erfolgten, um den Patienten zu er­ möglichen, nach der Evaluation im BHZ auch wieder zu den ihnen vertrauten Behandlern zurückkehren zu können. Die wichtigste Neuerung auf der Personalebene war wohl die Integration von Heilpädagogen und Heilerzie­ hungspflegern in die Teams des Behandlungszentrums, womit im Jahr 2000 mit einer Heilerziehungspflegerin begonnen wurde; im Jahr 2010 liegt der Anteil der Heil­ erziehungspfleger an sämtlichen Pflegekräften im BHZ bei 40 Prozent. Auch wurde die Einbeziehung anderer Berufsgruppen erweitert, so dass nunmehr auch Musik­ therapeuten, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, eine Kunsttherapeutin und eine Gartentherapeutin tätig sind. Waren zur Eröffnung nur eine Ärztin und eine Oberärztin (mit einem Stellenanteil von 20 Prozent) im BHZ, arbeiten derzeit inzwischen 3,5 Assistenzärzte sowie 1,5 Oberärzte. Die Gestaltung der Gartenanlage und eines Therapiegar­ tens, der Ausbau von Snoezelen-Möglichkeiten, der ergound musiktherapeutischen Räumlichkeiten, die Integration eines Bällchenbades und eines Time-Out-Raumes auf der 14 Außerhalb der gängigen Behandlungspfade 15 Herzlichen Glückwunsch 16Psychiatrische Institutsambulanz am Berliner Behandlungszentrum 17Autismus bei erwachsenen Menschen mit Intelligenzminderung 17 Weniger Fixierungen 18 Musiktherapeutische Behandlungsmöglichkeiten 19 Ernährungsberatung im Behandlungszentrum 20 Wirkung über die Region hinaus 20 Ausgewählte Publikationen Impressum Sonderheft zum Jubiläum des BHZ Herausgeber: Ev. Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge gGmbH, Geschäftsführung und Kranken­hausbetriebsleitung, Herzbergstr.79, 10365 Berlin Gestaltung/Produktion: Baumgardt Consultants, Gesellschaft für Marketing & Kommunikation bR Bildnachweis: Titelbild: Bert Rademacher; Elbracht (Bethel) S. 3 (r.), 8 – 10, 13, 14, 18, 19; J. Lehmann (KEH)) S. 3 (o.), 7; Historisches Archiv: S. 10 (u.); Fotolia, K. Sutyagin S. 6; Kunsttherapie BHZ S. 11; (M.); Jörg Langnas S. 17; V.i.S.d.P.: Johannes Lehmann Anregungen und Kritik an: [email protected] Der KEH-Report erscheint viermal jährlich. Juni 2010 | KEH-Report Seite 3 | ??? | Editorial Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leserinnen und Leser, Station für Menschen mit schwererer geistiger Behinde­ rung und psychischen Erkrankungen runden das Bild ab. Inhaltliche Schwerpunkte Von Beginn an wurde die Arbeit an Hand mehrerer Achsen konzipiert; zwei sollen an dieser Stelle genannt werden: • Entsprechend dem erfolgreich in Colorado (USA) eingesetz­ ten Vorgehen bzw. in Anlehnung an das DSM IV der ameri­ kanischen operationalisierten psychiatrischen Klassi­fikation, sind wir bestrebt, auch bei nichtsprachfähigen Menschen mit geistiger Behinderung eine psychiatrische Diagnose zu stellen. Verhaltensauffälligkeiten und/oder psychische Stö­ rungen werden nicht pauschal »als Teil der geistigen Behin­ derung« gesehen. Dies geschieht leider immer noch oft und führt zu mangelhaften Diagnosen, vor allem aber zu falscher Behandlung mit häufig hoch dosierter Neuroleptikatherapie, die zumeist der Ruhigstellung von Klienten dient. • Schon sehr früh erfolgte die Orientierung am entwick­ lungspsychologischen Ansatz von Prof. Anton Dosen aus den Nieder­landen (sog. SEO-Bogen). Dieser zielt darauf ab, Diskrepanzen im sozio-emotional-kognitiven Entwicklungs­ niveau der Patienten als mögliche Problembereiche zu iden­ tifizieren und das Behandlungsvorgehen bzw. die Betreuung entsprechend zu konzipieren. Bereits im Jahr 2002 haben wir, unter tatkräftiger Hilfe von Frau Prof. Dr. Mattheis, der ehemaligen Vorsitzenden des Ethikkomitees der Berliner Ärz­ tekammer, den SEO aus dem Niederländischen ins Deutsche übersetzt und wenden ihn nunmehr seit fast zehn Jahren an. Klarer sozialpsychiatrischer Ansatz Im Laufe der Jahre haben die Außenaktivitäten des BHZ in Form von Vorträgen, Kursveranstaltungen, größeren und kleineren Konferenzen innerhalb und außerhalb des KEH – allein oder mit vielen Kooperationspartnern – stetig zugenommen (vgl. Liste von Publikationen und Vorträgen auf Seite 20). Daran waren alle Berufsgruppen des BHZ in vorbildlicher Weise beteiligt. Diese Aktivitäten haben einen hohen Stellenwert, denn die rein auf das Krankenhaus be­ schränkte Arbeit einer psychiatrisch-psychotherapeutischen Abteilung greift notwendig zu kurz: Psychiatrie ist immer auch Sozialpsychiatrie. Die Therapie im Krankenhaus legt die Basis für die Gesundung. Gesund wird und bleibt die/ der Behandelte allerdings nur in der eigenen Häuslichkeit! Leider stehen dem gerade bei Menschen mit geistiger Be­ hinderung immer noch vielfältige Vorurteile hinsichtlich der Möglichkeiten von Integration entgegen. So war es zudem erforderlich, dass sich Vertreter des BHZ auch berufspoli­ tisch engagiert haben, z. B. im Rahmen des Ar­­beitskreises Geistige Behinderung der Bundesdirektorenkonferenz der Leiter psychiatrischer Krankenhäuser oder im Referat Geis­ tige Behinderung der Deutschen Gesellschaft für Psychia­ Das Team des BHZ mit Chefarzt Prof. Dr. Albert Diefenbacher (Mitte) Aus unserer klinischen Erfahrung haben wir die Überzeugung gewonnen, dass es gerade psychotherapeutische Verfahren sind, die bei psychisch kranken Menschen mit geistiger Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten zum Einsatz kommen sollten, und nicht – wie dies leider auch im ärztlich-psychotherapeutischen Bereich immer noch verbreitet der Fall ist – der Einsatz von Medikamenten. Literatur zur Clearingstelle: Tatjana Voß, Elke Millauer, Katrin Herberger, Sabine Woskobojnik, Abschlussbericht des Modellprojektes Berliner Clearingstelle für Menschen mit geistiger Behinderung, Bethel Verlag, Bielefeld 2009, Epub diese Sonderausgabe des »KEH-Report« widmet sich einem besonderen Jubiläum: Das Behandlungszentrum für psychisch kranke Menschen mit geis­­tiger Behinderung am KEH (BHZ) begeht sein zehnjähriges Bestehen. Die Entwicklung einer kompetenten, innovativen, vor allem aber humanen Perspektive im Umgang mit Menschen mit geis­ tiger Behinderung ist einer der Grundpfeiler der von Bodelschwinghschen Stiftungen, die im Jahr 1867 gegründet worden sind. Das BHZ hat sich würdig in diese Tradition eingereiht und vollstationär wie teilstationär, vor allem aber im ambulanten Bereich (Spezialambulanz) für seine Patienten einen Standard erreicht, der für die Region BerlinBrandenburg beispielhaft ist und sowohl überregional als auch international wahrgenommen wird. In enger Kooperation mit unserer »Schwesterklinik« Mara in Bielefeld, die sich auf die Behandlung chirurgischer und internistischer Krankheiten bei Menschen mit geistiger Behinderung spezialisiert hat, ist seit dem vergangenen Jahr ein Projekt für die chirurgische Behandlung von Menschen mit geistiger Behinderung in unserem Haus begonnen worden. In Anerkennung seiner Dr. Rainer Norden, Vorsitzender Geschäftsführer hohen Fachkompetenz hat das BHZ im Jahr 2007 vom Berliner Senat den Auftrag bekommen, eine Clearingstelle zu gründen, mit deren Hilfe die Arbeit für Menschen mit geistiger Behinderung im komplementären Bereich verbessert werden konnte. Auch wenn die Entgelte für die aufwändige Arbeit noch nicht den Arbeitserfordernissen angepasst sind, hoffen wir, dass dies mit der Entwicklung eines neuen Entgeltsystems in der Psychiatrie ausgeglichen wird und werden als Träger die Entwicklung der Einrichtung weiter unterstützen. Ich gratuliere allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des BHZ zu ihrem Erfolg und wünsche allen Lesern eine interessante Lektüre. Dr. Rainer Norden Vorsitzender Geschäftsführer Station P7 Station P8 50 KEH-Report | Juni 2010 Seite 4 40 30 | ??? | 20 10 trie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN). Dies alles hat dazu geführt, dass sich unser Behandlungszen­ trum einen überregionalen und sogar internationalen Ruf im deutschsprachigen Raum erarbeiten konnte und nicht selten Besuch von Fachleuten aus anderen Einrichtungen erhält, die hier hospitieren. Wichtig und anregend sind auch die Teilnahmen an nationalen und internationalen Kongressen, wo die Ergebnisse der klinischen und wissen­ schaftlichen Arbeit des BHZ vorgestellt werden können. So wurden unsere Arbeiten aus dem Bereich der Arzneimittel­ sicherheit (AMSP) mit großem Interesse auf dem Weltkon­ gress der IASSID (International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities) in Kapstadt in 2008 wahr­ genommen. Auch die Präsentation unserer Modifikation des dialektisch behavioralen Therapieprogramms für Pa­ tienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen auf dem EAMHID-Kongress (European Congress of Mental Health in Intellectual Disability) 2009 in Amsterdam führte zu wich­ tigen Kontakten. Psychiatrie und Somatik Von großer Bedeutung ist auch der Kontakt zum Arbeits­ kreis Ärzte für Medizin für Menschen mit geistiger Behin­ derung (BAG), da nicht nur im Bereich der psychiatrischpsychotherapeutischen Versorgung unserer Klienten ein deutliches Verbesserungspotential zu erkennen ist, sondern auch im Bereich der körperlich-medizinischen Versorgung. Im Rahmen unserer klinischen Arbeit mussten wir zuneh­ mend feststellen, dass ein großer Anteil unserer Patienten, die wegen Verhaltensauffälligkeiten überwiesen worden waren, körperliche (und keine psychiatrischen) Ursachen dafür aufwiesen. So wurden im Jahr 2009 z. B. 56 Pa­tienten des BHZ in der Inneren Abteilung des KEH gastroenterolo­ gisch untersucht, und bei 51 Patienten konnte eine behan­ delbare Erkrankung festgestellt werden (v. a. Refluxösopha­ gitiden), die mit Verhaltensauffälligkeiten, z. B. nächtlichen Unruhezuständen, einhergegangen war. Vor diesem Hintergrund wurde im Jahr 2009, ange­ regt von unserer »Schwesterklinik« Mara der von Bodel­ schwinghschen Stiftungen in Bielefeld, die seit Jahren körperlich kranke Menschen mit geistiger Behinderung behandelt, ein neues Projekt begonnen: der Aufbau eines Bereichs Behindertenmedizin, zunächst konzentriert auf die chirurgische Behandlung von (nicht psychisch kranken) Menschen mit geistiger Behinderung, die z.B . eine Fraktur o. ä. erlitten hatten. Seit 1996 nehmen wir am Projekt »Arz­ neimittelsicherheit in der Psychiatrie« (AMSP) teil, an dem sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz derzeit insge­samt etwa 50 psychiatrische Krankenhäuser beteiligen. Von Beginn an haben wir Meldungen über unerwünschte Arzneimittelwirkungen aus dem BHZ beigesteuert und tra­ gen dazu bei, dass bei der Gabe von Psychopharmaka an Patienten mit geistiger Behinderung sensibler agiert wird. Weitere Projekte, die begonnen wurden, sind u. a. •der Aufbau eines Schwerpunktes für Menschen mit geistiger Behinderung und Autismus sowie •die Kooperation mit der Heilpädagogischen Ambu­ 0 F20 Schizophrenie F33 rezidiv. depressive Störung F32 depresseive Episode F43 Anpassungsstörungen F31 Bipolare affektive Störung Häufigste psychiatrische Hauptdiagnosen 2008 nach ICD 10 Häufigste somatische Nebendiagnosen (2008) • auf der Station P7: Adipositas (38 Fälle), essentielle Hypertonie (20), Epilepsie (18), sonstige Hypothyreose (16), Diabetes mellitus (12), Gastritis und Duodenitis (10) • auf der Station P8: Gastritis und Duodenitis (25), Gastroösophag. Refluxkrankheit (9), Epilepsie (8), Downsyndrom (6), Vorsätzliche Selbstbeschädigung (6). Kritische oder mit Anregungen versehene Rückmeldungen haben wir all diese Jahre für unsere Arbeit immer positiv als Verbesserungsvorschläge betrachtet und sie gern aufgegriffen. Wir würden uns freuen, wenn uns auch weiterhin dieses rege Interesse erhalten bleibt. Literatur Diefenbacher, A. »Verbesserung der Mitarbeiter­zufriedenheit. Das Beispiel eines Behandlungszentrums für akut psychisch Kranke mit geistiger Behinderung.« Masterarbeit im Studiengang MBA-Health Care Management, FHW Berlin 2004 Monika Steffen ist Krankenschwester und Stationsleitung P8, Uwe Bergander ist Heilpädagoge und Stationsleitung P7 lanz Berlin. Hier wird im Rahmen eines bundeswei­ ten Modellprojektes die ambulante Entwöhnung von leicht geistig behinderten Menschen mit Alkoholab­ hängigkeit untersucht. Die erfolgreiche Entwicklung der Arbeit des BHZ ging aber auch einher mit Problemen, von denen exemplarisch drei genannt werden sollen: • Die frühere Behandlung von geistig behinderten Men­ schen im ehemaligen Fachkrankenhaus Herzberge hatte einen schlechten Ruf. Daraus resultierende Vorurteile konn­ ten erst durch intensive Außenaktivitäten sowie durch die jederzeit gegebene Möglichkeit, unsere Arbeit vor Ort zu besichtigen, beseitigt werden. • Es bestand die Notwendigkeit, zum Teil durchgreifende Veränderungen in der personellen Besetzung des BHZ vorzunehmen. Bis zum Jahr 2002 wurden z. B. 75 Prozent der Stellen des Pflegepersonals neu besetzt. • Der Bereich war auch für in Ausbildung befindliche Ärzte attraktiv zu machen. Leider ist es bislang nicht gelungen, durch die psychiatrische Fachgesellschaft DGPPN ein Zerti­ fikat »Psychiatrie für Menschen mit geistiger Behinderung« zu entwickeln, was u. E. einen zusätzlichen Anreiz für die Arbeit in Behandlungszentren wie dem unseren für Assi­ stenz- und Fachärzte darstellen könnte. Begrüßenswert ist der Entschluss der BAG vom November 2008, ein Zer­ tifikat »Medizin für Menschen mit geistiger Behinderung« vorzuschlagen, den wir durch die Bereitstellung von Hospi­ tantenplätzen im BHZ praktisch unterstützen. Die weitere Entwicklung des Behandlungszentrums wird darauf abzielen, den beschrittenen Weg weiterzugehen. Bei der Entwicklung störungsspezifischer, für unsere Klien­ ten modifizierter Psychotherapieformen haben wir mit ent­ sprechenden Programmen für die Interpersonelle Therapie der Depression – u. a. in Zusammenarbeit mit der Klinik Warstein in Westfalen – Neuland betreten. Gerade hier ist auch die Zusammenarbeit mit dem komplementären Be­ treuungsbereich zu intensivieren. Innerhalb unserer Abteilung werden wir die Koopera­ tion des BHZ mit dem gerontopsychiatrischen Funktionsbe­ reich intensivieren. Wie in der internationalen Fachöffent­ lichkeit diskutiert, soll überprüft werden, inwieweit sich die Bereiche »nichtverbalisierungsfähige Menschen mit schwerer geistiger Behinderung« und »Demenzpatienten mit Verhaltensauffälligkeiten« hinsichtlich der Entwicklung von psychotherapeutischen Verfahren bzw. Behandlungs­ konzepten gegenseitig befruchten können. Besonderes Interesse liegt dabei auf der älter werdenden Klientel von Menschen mit geistiger Behinderung, die häufig früher als bei nicht geistig behinderten Menschen eine Demenz vom Alzheimer-Typ entwickeln. Albert Diefenbacher / Monika Steffen / Uwe Bergander Juni 2010 | KEH-Report Seite 5 | Psychotherapie | Interpersonelle Psychotherapie der Depression (IPT) Modifizierte Version für die Behandlung von Menschen mit geistiger Behinderung und Depression D as Konzept der Interper­ sonellen Psychotherapie (IPT) für Patienten mit De­ pressionen wurde von Kler­ man, Weissman, Rounsaville u. Chevron (1984) entwickelt und von Schramm (1996) als deutsche Version bearbeitet. Dabei handelt es sich ur­ sprünglich um eine Kurzzeittherapie für die ambulante Depressions­behandlung, bei der vorwiegend im »Hier und Jetzt« gearbeitet wird. In der IPT wird davon ausgegangen, dass depressive Erkrankungen in einem psychosozialen und interperso­ nellen Kontext erklärbar sind. Unabhängig von den Ur­ sachen sind die Beziehungen der Erkrankten zu anderen Menschen und ihre damit verbundenen sozialen Rollen immer mit betroffen: Belastende Ereignisse können de­ pressive Symptome auslösen, und umgekehrt können De­ pressionen zu zwischenmenschlichen Problemen führen oder schon vorhandene verschlimmern. Ziele der Behandlung sind die Rückbildung der depres­ siven Symptomatik sowie die Entwicklung von Strategien zur Bewältigung der sozialen und zwischenmenschlichen Schwierigkeiten, die mit dem Auftreten der Erkrankung zusammenhängen. Die IPT kann eigenständig oder par­ allel zu einer medikamentösen (antidepressiven) Be­ handlung eingesetzt werden. Der psychotherapeutische Schwerpunkt liegt auf den interpersonellen Aspekten, die mit der aktuellen depressiven Erkrankungsphase verbun­ den sind. Diese werden in vier Modulen bearbeitet. Im Behandlungszentrum für Menschen mit geistiger Behin­ derung und psychischen Erkrankungen werden depressive Patienten mit leichter bis mittelschwerer geis­tiger Behin­ derung mit einer modifizierten Version der IPT behandelt. Geistig behinderte Menschen leben oft in einem spezi­ fischen Lebensumfeld: in Einrichtungen der Behinder­ tenhilfe (Wohngemeinschaften, Heime), im elterlichen Haushalt und/oder haben ein Betreuersystem zur Un­ terstützung für das Leben in der eigenen Wohnung. Die depressive Erkrankung steht auch hier nicht losgelöst von den zwischenmenschlichen Beziehungen der Betroffenen: Oft führen Änderungen in den gewohnten Lebensbedin­ gungen, Trennungssituationen, unbewältigte zwischen­ menschliche Konflikte oder mangelnde Fertigkeiten zur Kontaktgestaltung zu Überforderungssituationen und wirken so als Auslöser oder verstärkende Faktoren für de­ pressive Symptomatik. Das therapeutische Vorgehen ist an den vier Modu­ len der IPT orientiert und zielt auf die Verarbeitung der erlebten emotionalen Belastungen und auf das Erkennen Im BHZ werden depressive Patienten mit leichter bis mittelschwerer geistiger Behinderung mit einer modifizierten Version der IPT behandelt, mit dem Ziel der Rückbildung der depressiven Symptomatik sowie der Entwicklung von Bewältigungsstrategien bei sozialen und zwischenmenschlichen Problemen, die aufgrund der Depression auftreten. Der psychotherapeutische Schwerpunkt liegt auf den interpersonellen Aspekten, die in vier Modulen bearbeitet werden. Heika Kaiser ist Diplompsychologin, Psychologische Psychotherapeutin und Aktivieren der Ressourcen der Betroffenen. Es erfolgt in einer einfachen, verständlichen Sprache mit kurzen Sät­ zen, z. T. mit Hilfe von Piktogrammen und Visualisierungen. Der Themen- u. Zeitumfang der einzelnen Sitzungen wird überschaubar kurz gehalten: Eine Sitzung dauert 30 Minuten. Zu Beginn der Sitzung schätzt jeder Teilnehmer seine heutige Stimmung mit einer fünfstufigen Skala ein. Meist werden dabei schon Einflüs­ se aus dem aktuellen Geschehen im Zusammenhang mit der Gefühlslage genannt. Dies bietet einen lebensnahen Einstieg zum Austausch über Stimmungsschwankungen, deren Auslöser und Bewältigungsmöglichkeiten. Durch langsames Vorgehen mit Beispielen aus dem Erlebens­ bereich der Betroffenen, durch Wiederholungen und ein­ prägsame Zusammenfassungen am Sitzungsende können Lerneffekt, Motivation, Durchhaltevermögen, aktive Mit­ arbeit und Erfolgserleben unterstützt werden. Im Modul 1 lernen die Patienten ihre Beschwerden als Krankheitssymptome zu erkennen und in ihre gegenwär­ tige Lebenssituation einzuordnen (»Was ist passiert?«). Sie erarbeiten im Austausch eigener Erfahrungen Strategien zur Entlastung/Bewältigung oder Verminderung depressiver Symptome unter der Fragestellung: »Was hilft mir?«. Ge­ nauso wichtig ist das Erkennen von Depression fördernden Denk-Verhaltensweisen (»Was sollte ich nicht tun?«) Im Modul 2 stehen sozialer Rückzug bzw. Einsamkeit und Kontaktgestaltung im Mittelpunkt. Die Bedeutung von Bezugspersonen und Sozialkon­ takten für die Lebenszufriedenheit und zur Unterstützung in Problemsituationen wird erarbeitet. Konkretes gegen­ seitiges Erleben und der zwischenmenschliche Umgang im Stationsalltag (z. B. Wünsche äußern, um Hilfe bitten, sich abgrenzen) bieten hier Übungsbeispiele für Rollen­ spiele. Im Modul 3 liegt der Fokus auf dem Erkennen und Bewältigen zwischenmenschlicher Konflikte, was am an­ schaulichsten an aktuellen Beispielen besprochen und ge­ übt wird. Die Patienten üben, ihre Meinung zu äußern, zu sagen, was sie stört oder was sie vom Anderen erwarten, ebenso wie das aktive Zuhören. Lösungsmöglichkeiten für häufige Konfliktbeispiele werden zusammengetragen, dis­ kutiert und bewertet. Anschließend können als geeignet befundene Lösungen im Rollenspiel geübt werden. Im Modul 4 werden einschneidende Lebensereignisse wie z. B. Umzug, Arbeits-/Werkstattwechsel, Tod einer nahe stehenden Person oder Trennungssituationen the­ matisiert, die in zeitlicher Nähe der Erkrankung stattfan­ den. Vielen Betroffenen wird erst am Beispiel der Mitpa­ tienten deutlich, welche Zusammenhänge mit Verlusten oder Rollenwechseln es auch in ihrer Krankheitsentwick­ lung gibt. Die Verarbeitung der mit den Veränderungen einher­ gehenden Gefühle wie Trauer, Hoffnungslosigkeit, Ohn­ macht oder Wut bildet die Basis für die Annahme der neuen Lebenssituation und die Orientierung auf neue Per­ spektiven. Heika Kaiser KEH-Report | Juni 2010 Seite 6 | Gerontopsychiatrie | Alt, älter, abgeschoben Anforderungen an die Versorgung von älteren Menschen mit geistiger Behinderung A uch geistig behinderte Seniorinnen und Senioren haben entsprechend der allgemeinen soziodemo­ graphischen Entwicklung eine gestiegene Lebenserwar­ tung, d. h. heute werden Menschen mit geistiger Be­ hinderung in Deutschland alt und älter. Dieser Erfolg in der Betreuung von Menschen mit Behinderungen – mit hohem wie mit niedrigem Hilfebedarf – ist ein Resultat auch medizinischen Fortschritts. Andere Län­ der sind Deutschland in der Entwicklung notwendiger Hilfen für diese Personengruppe allerdings voraus, weil in Deutschland durch die Euthanasie während der Herrschaft der Nationalso­ zialisten frühere Genera­ tionen von Menschen mit Behinderungen ermordet worden sind. Aktuelle Studien gehen davon aus, dass derzeit die Lebenserwartung eines Menschen mit einer Intelli­ genzminderung in den Industrienationen etwa 60 Jahre beträgt, für leicht geistig behinderte Menschen ohne zusätzliche körperliche Erkrankungen ist dabei von ei­ ner der üblichen Bevölkerung entsprechenden Lebens­ erwartung auszugehen. Bei schwerer geistiger Behinderung ist die Lebens­ erwartung bis zu 20 Jahre geringer, denn für schwer geistig behinderte Menschen besteht noch immer eine fünffach erhöhte Sterbewahrscheinlichkeit bis zum Al­ ter von 40 Jahren. Bei der Generation der jetzt alt werdenden Men­ schen mit geistiger Behinderung in Deutschland handelt es sich um Personen, die auf Grund ihrer spezifischen Le­ benssituation in der Nachkriegszeit unter erschwerten Bedingungen aufgewachsen sind und gelebt haben. Sie blicken auf andere biographische Erfahrungen zu­ rück als der sonst alt werdende Bürger unseres Landes. Ihnen wurde z. B. in der Regel keine Gelegenheit ge­ geben, für sich Lebenspläne zu schmieden. Sie hatten verminderte Chancen auf eine adäquate schulische För­ derung, ganz abgesehen davon, dass ihnen persönliche Partnerschaften aber auch intime Beziehungen vorent­ halten worden sind. Der Lebensentwurf, der Ihnen als Ihrer Behinderung gemäß zugeschrieben wurde, war der eines zeit seines Lebens arbeitenden, partner- und kinderlosen Erwachsenen. Älter werdende und alte Menschen mit geistiger Behinderung stellen – wie in der Normalbevölkerung auch – eine heterogene Gruppe dar: es gibt Menschen, die einen altersspezifischen Bedarf an Pflege haben und schon sehr früh Alterserkrankungen wie Demenz oder Altersdepression entwickeln. Dagegen gibt es andere, die hoch betagt über eine gute geistige und körperliche Leistungsfähigkeit verfügen. Senioren mit geistiger Behinderung unterscheiden sich in ihrer materiellen Lage maßgeblich von der Normalbevölkerung: Sie gehören zeitlebens zu den Armen unserer Gesellschaft. Auch wenn ihre Lebenserwartung in Deutschland als Resultat medizinischen Fortschritts und entsprechend der soziodemographischen Entwicklung gestiegen ist, sind andere Länder in der Entwicklung notwendiger Hilfen für diese Personengruppe wesentlich weiter. Die Besonderheiten bei der Versorgung von älteren Menschen mit geistiger Behinderung auch im Bereich der psychischen Alterserkrankungen werfen daher ein Licht auf einige grundlegende Probleme bei älteren Menschen mit geistiger Behinderung: 1. Senioren mit einer geistigen Behinderung unterschei­ den sich in ihrer materiellen Lage maßgeblich von der Normalbevölkerung: Sie gehören, insbesondere wenn sie in einer vollstationären Einrichtung der Behinder­ tenhilfe leben, zeitlebens zu den Armen unserer Gesell­ schaft und bleiben auch nach ihrem Ausscheiden aus der Werkstatt stets auf finanzielle Hilfen der Gesellschaft angewiesen. Dabei sind die sozialen und materiellen Ausgangsbedingungen in Verbindung mit Schwere und Ausprägung der Behinderung ein ausschlaggebender Faktor in der medizinischen Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderung. 2. In Deutschland fehlen gesicherte empirische Daten, Untersuchungen, Erfahrungen und Empfehlungen für die Begleitung von Senioren mit geistiger Behinde­ rung. Was geschieht, wenn ein alternder Mensch mit geistiger Behinderung keiner Vollbeschäftigung mehr in einer Werkstatt für behinderte Menschen nach­ gehen kann, d. h. nach der Verrentung oder im Ru­ hestand? Können er oder sie auch weiterhin in ihrem angestammten Wohnumfeld verbleiben? Was passiert, wenn älter werdende Menschen mit geistiger Behinde­ rung stärker pflegebedürftig werden? In zunehmendem Maße werden alte Menschen mit geistiger Behinderung auf Pflegeheime verwiesen. Aber auch wenn theoretisch das Leben alternder und alter Menschen mit geistiger Behinderung in Alten- und Altenpflegeheimen als Lebensorte unter integrativen Aspekten als ein Stück Normalität betrachtet werden Juni 2010 | KEH-Report Seite 7 | Gerontopsychiatrie | könnte, bietet diese Wohnform in der Praxis keine geeignete Alternative zur Berücksichtigung der be­ sonderen Bedürfnisse dieses Personenkreises. Denn auf eine ganzheitliche Lebensbegleitung, die neben somatischen Problemen auch die kognitiven und sozia­ len Kompetenzen eines Menschen umfasst, sind diese Alten­pflegeheime nicht eingestellt. lterserkrankungen bei älter werdenden und A alten Menschen mit geistiger Behinderung Durch die Zunahme älterer Menschen mit geistiger Be­ hinderung kommen auf die Hausärztinnen und Haus­ ärzte, aber auch auf die psychiatrisch-nervenärztlichen Fachärzte eine Reihe von neuen gesundheitlichen Fragestellungen hinzu. Für die Alterserkrankungen bei Menschen mit geistiger Be­ hinderung, wie z. B. demen­ zielle Erkrankungen, Alters­ de­pression und Suizidalität, fehlen bisher noch geeignete Ge­­sundheitsvorsorge- und Be­­treuungskonzepte. Die haus- und fachärztliche Versor­ gung geistig behinderter Menschen, vor allem bei chro­ nischen Erkrankungen ist ggw. ein ungelöstes Problem. Der Zugang zu personal-, zeit- und deshalb auch kosten­ intensiver, teils nur in Narkose möglicher Diagnostik ist erschwert und begrenzt. Bei älteren Menschen mit geistiger Behinderung kommt es im Vergleich zu nicht behinderten Menschen dabei häufiger zu • Epilepsien, • Ess-Störungen (Kau- und Schluckstörungen), • Gastroenterologie: Refluxerkrankungen (30 bis über 50 Prozent häufiger als in der Gesamt­ bevölkerung), • Seh- und Hörstörungen, Dr. Brem bei seinem Besuch im Jahr 2008 im KEH Somatische Erkrankungen, psychiatrische Störungen, Einschränkungen der Mobilität und sensorische Einschränkungen können bei älteren Menschen mit geistiger Behinderung als Demenzerkrankungen missverstanden werden. Deshalb ist neben Anamneseerhebung und multiprofessionellem Assessment eine qualifizierte, erfahrene Diagnostik unverzichtbar. Dr. med. Tatjana Voß ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie • Muskel- und Skelettproblemen. • Megakolon (hypotones Kolon, Obstipation, evtl. sogar mechanischer Ileus wegen Fremdkörper­ ingestion). • Urologie: Neurogene Harnblasenfunktionsstörung, vor allem beim Down-Syndrom. • Schilddrüse: Häufig subklinisch Hypothyreose. • Herz-Kreislauferkrankungen: Koronare Herzerkran­ kung seltener, dafür mehr Fehlbildungen. • Respirationstrakt: Aspirationsgefahr, Pneumonie teils schwerer erkennbar. ltern und psychische Störungen bei A Menschen mit Intelligenzminderung Bereits 1997 veröffentlichte Cooper ihre epidemio­ logische Studie über psychischen Erkrankungen bei älteren Menschen mit Behinderung. Bei den über 65-Jährigen zeigten sich im Vergleich zu der jüngeren Kontrollgruppe höhere Raten von Demenz (22%), ge­ neralisierten Angststörungen (9%) und Depressionen (6%). Insbesondere zu der Fragestellung der Verbindung zwischen Demenz vom Alzheimer-Typ und Down-Syn­ drom erschienen in den vergangenen Jahren zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen. Die Verbindung zwischen Down-Syndrom und Alzheimer-Erkrankungen gilt somit theoretisch inzwischen als gesichert. Insbesondere die Differentialdiagnose zur Depres­ sion stellt sich bei geistig behinderten Menschen dabei als außerordentlich schwierig dar. Von daher sollte ne­ ben der Anamneseerhebung und multiprofessionellem Assessment auf eine qualifizierte, erfahrene Diagnos­ tik nicht verzichtet werden. Somatische Erkrankungen, psychiatrische Störungen, Einschränkungen der Mobili­ tät und sensorische Einschränkungen können funktio­ nelle Abbauprozesses zur Folge haben und als Demenz­ erkrankungen missverstanden werden bzw. mit ihnen gleichzeitig auftreten. Dr. med. Tatjana Voß Grußwort Als Präsident der »Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft von Ärzten für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung SAGB/ ASHM« (www.sagb.ch) entbiete ich dem »Berliner Behandlungszentrum für Menschen mit geistiger Behinderung und psychischer Erkrankung am Evangelischen Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge GmbH« ganz herzliche Glückwünsche zum zehnjährigen Jubiläum. In verschiedenen Kontakten und Besuchen, und auch beim Lesen von Publikationen, waren wir von der hohen Professionalität der geleisteten Arbeit, die sich an modernen Erkenntnissen und neuen Sichtweisen orientiert, beeindruckt. Die Kompetenz des Behandlungszentrums strahlt weit über Berlin hinaus, und wir hier in der Schweiz erhielten zahlreiche wertvolle Impulse. Wir wünschen dem Behandlungszentrum von Herzen für die Zukunft die verdiente Anerkennung, die sich unter anderem auch in einem angemessenen Verständnis und der zur Verfügungstellung genügender Ressourcen zeigen möge, und verbleiben mit besten kollegialen Grüßen Dr. med. Felix Brem Facharzt Psychiatrie/Psychotherapie FMH Ärzte im Zentrum Weinfelden, Schweiz KEH-Report | Juni 2010 Seite 8 | Abhängigkeitserkrankungen | Das ist ein Erfolg Suchtberatung und ambulante Rehabilitation für Menschen mit geistiger Behinderung und Suchtproblematik M enschen mit geistiger Behinderung haben in den letzten Jahren immer mehr an Selbständigkeit und Unabhängigkeit gewonnen. Sie orientieren sich stärker an nicht behinderten Menschen, weil sie genauso »normal« sein wollen wie sie. Den Genuss von Alkohol erleben sie in unserer Gesellschaft als eine weit verbreitete Selbst­ verständlichkeit. Das Trinken wird von ihnen als soziale Aufwertung wahrgenommen. Alkohol wird oft zur Kom­ pensation der Behinderung genutzt. Das ist ein Problem. Aufgrund ihrer intellektuellen Einschränkung können Menschen mit geistiger Behinderung die Folgen eines fortgesetzten Alkoholkonsums häufig nicht hinreichend einschätzen. Das Erlernen eines verantwortungsvollen Umgangs mit Alkohol ist deshalb erschwert. Daher gewinnen spezifische Angebote für Menschen mit geistiger Behinderung und Suchtproblematik immer mehr an Be­ deutung. Die Heilpädagogische Ambulanz Berlin e. V. (HpA) hat dieser Zunahme von Ratsuchenden mit substanzbe­ zogenen Störungen Rechnung getragen und bietet bereits seit 2007 eine spezifische Suchtberatung und ambulante Rehabilitation für Menschen mit geistiger Behinderung und Suchtproblematik an. Damit hat sie in Deutschland Neuland betreten und als erste Einrichtung eine Lücke in der ambulanten sozialen und suchtthe­ rapeutischen Versorgung geschlossen, da in der klas­ sischen Suchtkrankenhilfe bisher spezifische Hilfen für Menschen mit geistiger Behinderung fehlten. Ihr Ange­ bot ist nach dem Modell der Integrativen Therapie modi­ fiziert und zielgruppenorientiert für Konsumenten der im Behindertenbereich vorrangig konsumierten Droge Al­ kohol. Aufgrund der Besonderheiten von Menschen mit geistiger Behinderung ist die ambulante Rehabilitation (Suchttherapie) der HpA spezifisch auf deren besondere Bedürfnisse, ihre Möglichkeiten des Verstehens und der Kommunikation, zugeschnitten. Die HpA ist in die Behindertenhilfe und in das Ber­ liner Drogenhilfesystem integriert. Diese Schnittstellen­ funktion ermöglicht eine dezidierte Öffentlichkeitsarbeit, um Klienten sowie deren Angehörige und Helfer für die Problematik der Kombination aus geistiger Behinderung und Sucht zu sensibilisieren und ein Problembewusstsein zu schaffen. Neben dieser Zielgruppenansprache dient die Zusammenarbeit mit Einrichtungen der Behinder­ tenhilfe, Sozialpsychiatrischen Diensten, Hochschulen, Krisendiensten und Selbsthilfegruppen einer möglichst optimalen Vernetzung. In medizinischen Fragen kooperiert die HpA eng mit dem Berliner Behandlungszentrum für Menschen mit geistiger Behinderung und psychischer Erkrankung Die Heilpädagogische Ambulanz Berlin e. V. (HpA) hat mit ihrer seit 2007 angebotenen spezifischen Suchtberatung und ambulanten Rehabilitation für Menschen mit geistiger Behinderung und Suchtproblematik in Deutschland Neuland betreten und als erste Einrichtung eine Lücke in der ambulanten sozialen und suchttherapeutischen Versorgung geschlossen. In medizinischen Fragen kooperiert die HpA eng mit dem BHZ; psychiatrische Komorbiditäten können hier stationär behandelt werden, wenn dies indiziert erscheint. (BHZ) an der Abteilung für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Krankenhauses Königin Elisabeth Herzberge (KEH). Deren Chefarzt, Prof. Dr. med. Albert Diefenbacher, begleitet die ambulante Suchtrehabilita­ tion der HpA fachärztlich. Haben sich Klienten der HpA nach initialer Motivationsarbeit zu einer stationären Ent­ giftungsbehandlung entschlossen, so erfolgt diese kurz­ fristig im BHZ. Auch eventuelle, die Suchterkrankung unterhaltende, psychiatrische Komorbiditäten können im BHZ stationär behandelt werden, wenn dies indiziert erscheint. Dieses dezidierte, stationäre Behandlungsan­ gebot hat sich als sinnvoll erwiesen, da unsere Klienten in anderen, nicht für Menschen mit geistiger Behinde­ rung spezialisierten Krankenhäusern und den dortigen, unspezifischen Therapieprogrammen häufig überfordert waren. Menschen mit geistiger Behinderung sind oft nicht ausreichend in der Lage, sich eigenständig Hilfe zu or­ ganisieren und bedürfen zuweilen der Unterstützung der unmittelbaren Bezugspersonen in ihrer Entscheidungs­ findung. Daher scheint es manchmal so, als gehe die Motivation zu einer Suchttherapie eher von Betreuern oder sozialen Diensten statt von den Klienten aus. Auch der Therapievertrag ist in der Regel ein Dreiecksvertrag zwischen Patient, Suchttherapeut und Betreuer(n). Wir machen jedoch die Erfahrung, dass im Verlauf meist eine hinreichende Selbstmotivation des Klienten zu Tage tritt. Dabei spielt die als stabil und positiv erlebte Beziehungs­ erfahrung zum Suchttherapeuten eine wesentliche Rolle, da sie eine Korrektur der bisherigen, oftmals negativen Erfahrungen ermöglicht. Die ambulante Suchtrehabilitation der HpA gliedert sich in eine Eingewöhnungs- und Orientierungsphase über bis zu sechs Wochen, in eine Haupttherapiephase über acht Monate sowie eine Ablösungsphase über bis zu sechs Wochen. Sie stützt sich auf folgende, wesentliche Eckpfeiler: Juni 2010 | KEH-Report Seite 9 | ??? | Einzeltherapie Die ambulante Rehabilitation beginnt mit einem einzel­ therapeutischen Angebot, welches in der Regel über den gesamten Zeitraum zur Verfügung steht. Auf der Basis einer vertrauensvollen und therapeutisch wirksamen Beziehung können die vereinbarten Therapieziele indivi­ duell und auf die Person des Menschen mit geistiger Be­ hinderung abgestimmt und modifiziert durchgearbeitet werden. Die Auseinandersetzung mit dem Konsum- und Suchtverhalten steht zunächst im Vordergrund der Re­ habilitation, Techniken der Rückfallprophylaxe werden angeboten und trainiert. Für die Bearbeitung der psychosozialen Probleme kommen behindertenspezifische multimodale (z. B. un­ terstützende Kommunikation, didaktische Rollenspiele) und andere therapeutische modifizierte Interventions­ formen zum Einsatz, die sich an den individuellen Bedürf­ nissen, der konkreten Lebensgeschichte, der aktuellen Situation der Patienten und an ihren kognitiven Fähig­ keiten im Rahmen der geistigen Behinderung orientieren. Gruppentherapie Das gruppentherapeutische Angebot hat in der Rehabilita­ tion Suchtkranker eine herausragende Bedeutung erlangt und bildet ein Kernstück der Maßnahme. Die Erfahrung von Solidarität und Gemeinschaft von Menschen mit ähn­ lichen Problemlagen und Lebenshintergründen erleichtert die Auseinandersetzung mit den eigenen Schwierigkeiten. Besonders für unsere Klienten, die häufig ausgrenzende bis traumatisierende Erfahrungen haben, ist die Teilnah­ me an einer Gruppe mit weiteren Menschen mit geistiger Behinderung im geschützten Rahmen für die Entwicklung eines positiven Selbstwertgefühls hilfreich. Hier kommt die besondere Bedeutung des spezifischen Ansatzes der HpA zur Geltung. Dr. med. Brian Fergus Barret ist Stationsarzt der Station P7 Christian Knuth ist Bereichsleiter Sucht in der Heilpädagogischen Ambulanz Berlin e. V., (www.HPA-Berlin-eV.de) Familien- und Bezugspersonengespräche In Familien- und Betreuergesprächen können »süchtige Interaktionsmuster« thematisiert und als ein beziehungsre­ gulierendes Verhalten verstanden werden. Durch gezielte systemisch-orientierte therapeutische Unterstützung wer­ den alternative Interaktionsformen im Bezugssystem an­ geregt. Die Mitwirkung von wichtigen Bezugspersonen im therapeutischen Prozess gelingt besser, wenn diese nicht als »Koabhängige« pathologisiert, sondern als Koopera­ tionspartner gesehen werden. Zudem können wir insbe­ sondere die Betreuer zum Ausbau von Möglichkeiten zur Selbstbestimmung der Klienten anregen und gemeinsam Alternativen finden. Christian Knuth, Gruss zum 10-jährigen Jubiläum des BHZ Liebe Kolleginnen und Kollegen aus Berlin Ich freue mich, dass ich mich auf solch prägnante Weise nochmals für meinen Aufenthalt im BHZ Berlin bedanken kann. Ich verstehe dies auch als Ausdruck meiner Hochachtung vor Ihrer Kompetenz in der Arbeit mit Menschen mit Intelligenzminderung am BHZ. Während meines Aufenthaltes im Sommer 2009 haben Sie mir vertiefte Einblicke in ihre wertvolle Arbeit gewährt. In vielen persönlichen Gesprächen hat mich Ihr Engagement für die Menschen mit zusätzlichen Handicaps immer wieder beeindruckt. Für mich als Schweizer ist mir Ihr Ernstnehmen der Menschen mit Intelligenzminderung besonders in Erinnerung geblieben, auch wenn ich manchmal leer geschluckt habe, wie konsequent Sie dieses Ernstnehmen umgesetzt haben. Der Aufenthalt im BHZ war für mich, der ich doch lange Erfahrung in der Arbeit mit Menschen mit Intelligenzminderung und psychischen Störungen habe, beeindruckend. Ich habe mich aufgrund der gleichen Vorannahmen und Grundhaltungen rasch heimisch gefühlt. Die Zusammenarbeit mit Ärzten und Pflege war wertschätzend und konstruktiv. Dass mir sogar die Möglichkeit geboten wurde, die Arbeitsweise unserer Klinik in St. Urban/Kt. Luzern vorzustellen, zeugt davon. Ich denke sehr gerne an die Zeit in Berlin zurück. Zum Glück haben sich auch einige Kontakte ergeben, die mich auf fachlicher und menschlicher Ebene weiter begleiten. Der Aufenthalt in Berlin hat zur Folge, dass wir versuchen, mit unseren Ressourcen die Entwicklung unserer Konzepte voranzutreiben, die die Erkenntnisse während und auch nach dem Aufenthalt am BHZ in Berlin ausgelöst haben. Dafür bin ich den Kolleginnen und Kollegen am BHZ dankbar. Dr. med. Brian Fergus Barrett Ein chinesisches Sprichwort sagt: » Willst du eine Stunde glücklich sein, trinke ein Glas Wein. Willst du ein Jahr glücklich sein, heirate. Willst du ein Leben lang glücklich sein, lege dir einen Garten an.« Ich möchte dieses Sprichwort ergänzen mit: Willst du glücklich sein bei der Arbeit und neue Erkenntnisse gewinnen, fahre nach Berlin ins BHZ, die haben einen Garten und gärtnern mit vielen spannenden Menschen. In diesem Sinne gratuliere ich dem BHZ zum 10-jährigen Jubiläum und wünsche ihm alles Gute für die Zukunft. Ich bin überzeugt, dass das BHZ weiterhin kompetente und engagierte Arbeit leistet und eine führende Rolle in der Arbeit mit Menschen mit Intelligenzminderung im deutschsprachigen Raum beibehält. Alois Grüter, Heilpädagoge Luzerner Psychiatrie, Stationäre Dienste St. Urban, Schweiz KEH-Report | Juni 2010 Seite 10 | Therapienangebote | »Hund mit reinnehmen« Nach inzwischen zwei Jahren Canis-Therapie fühlen sich die Therapiehunde im BHZ des KEH zu Hause. Hündin Clara wälzt sich beim Betreten des Therapieraums, als wäre es ihr Wohnzimmer, und Rüde Joschi springt begeistert den wartenden Klienten auf den Schoß, wenn nicht schon vorher eine ehemals schüchterne Klientin auf den Hundeführer zukommt und ihm die Leine aus der Hand nimmt, um mit Joschi spazieren zu gehen. Auf dem folgenden Spaziergang fragt ein kleiner Junge die Klientin: »Darf ich den Hund streicheln?« Es folgt die klare und selbstbewusste Antwort: »Ja!«. Für den Jungen ist die Frau mit dem Hund eine kompetente Ansprechpartnerin, von ihrer Behinderung hat er nichts bemerkt. Ohne Hund an der Leine hat die Klientin große Angst alleine zu gehen und braucht für denselben Weg dreimal so lange. Typische »Clara-Klienten« sind mo­­torisch unruhige und teilweise aggressive Patienten. Wenn Clara auf dem Sitzsack neben ihnen liegt und ganz von sich aus, ohne Anweisung des Hundeführers, ihre Pfoten auf die Beine der Klienten legt, kommen sie zur Ruhe. Und die Klienten finden Therapeutischer Nutzen von Pflanzen Sie strömen Düfte aus, geben bei Berührung Aromen ab, verursachen Geräusche (Großgräser, Kiefernzapfen, reife Leinpflanzen), locken mit ihren Nektarien Insekten an »Schmetterlingsstrauch« – Buddleja L.), bieten Vögeln Nahrung (Maho­ nienfrüchte, Sonnenblumen). Ein Garten bietet viele sinnliche Erfahrungen und eine Vielzahl alltagsrelevanter Tätigkeiten. Der Therapiegarten kann dem Hospitalismus entgegenwirken. Das ist besonders dann der Fall, wenn die Verweildauer in der Klinik sich oft über Wochen, nicht selten über Monate erstreckt. Gartentherapie ist ein geplanter, zielgerichteter Prozess, bei dem hierfür weitergebildete Fachkräfte pflanzenund gartenbezogene Aktivitäten und Erlebnisse nutzen, um die Gesundheit und Lebens-qualität von Menschen zu erhalten und zu fördern. Mit der Sorge und Pflege für Pflanzen ist der Patient nicht mehr der Betreute, er wird selbst zum Betreuer. Eine welke Pflanze hat enorm hohen Aufforderungscharakter. Sie ist ein lebendes Wesen. Pflanzen haben ein großes Spektrum an Eigenschaften, die sie als therapeutisches Mittel prädestinieren: Blattfarben. Blütenfarben, Blattformen, Blütenformen, Fruchtfarben, Fruchtformen, Habitus, Wuchshöhen, Blattgrößen, Blütengrößen, Oberflächenstrukturen (behaart, glatt, ledrig, bestachelt). »Der kürzeste Weg zur Gesundheit ist der Weg in den Garten.« Gärtnerische Tätigkeiten sind den Patienten aus den Einrichtungen, in denen sie leben, bekannt. Viele Häuser haben einen Garten, eine eigene Worte, um auszudrücken, wie die Canis-Therapie bei ihnen ankommt: »Ich glaub, es gefällt mir bei dir, ich komme wieder!« Oder, wie Joschis Lieblingsklient mit Autismusspektrum-Störung zu sagen pflegt: »Hund mit reinnehmen.« Jorka Schweitzer Canis-Therapeutin www.lebenmittieren.de Terrasse oder einen Balkon. Nicht wenige unserer Patienten haben beruflich gärtnerisch gearbeitet. Oft erzählen sie bei gemeinsamer Tätigkeit im Therapiegarten von ihren Erfahrungen. Bei einer Aussaat kann vorhandenes Wissen praktisch umgesetzt werden. Das stärkt das Selbstwertgefühl und das Vertrauen in die eigenen Kräfte. Das gärtnerische Umfeld hat motivierende Wirkung, die oft von natürlichen Prozessen vorgegeben wird. Bei reduzierter Frustrationstoleranz ist therapeutische Begleitung zur Planung bewältigbarar Aufgaben und Arbeitspausen wichtig. Die körperliche Betätigung im Freien und der sinnliche Umgang mit Pflanzen können die Wahrnehmung des eigenen Körpers fördern. »Wer einen Garten hat, braucht weder Fitnessstudio noch Urlaub.« Für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen ist die Gartentherapie ein aktives, erlebnisorientiertes Lernverfahren im Rahmen der Erhaltung von Alltagskompetenzen und der Fähigkeitsentwicklung allgemein. Sylvia Wermke Gartentherapeutin Fotografischer Rückblick: So sahen die Räumlichkeiten (Haus 9) der Arbeitstherapie in den 1960er Jahren aus. Juni 2010 | KEH-Report Seite 11 | ??? | | Therapienangebote | Kunsttherapie Seit 2005 gehört die Kunsttherapie im BHZ, neben anderen nicht medikamentösen, nicht sprachbezogenen Therapieformen zum Behandlungs-Setting. Sie ist Teil des Therapie-Angebots auf beiden Stationen und im ambulanten Bereich. Die Kunsttherapie arbeitet ausdrucks- und ressourcenorientiert. Sie ist gerade für Menschen, die kognitiv und verbal eingeschränkt sind, besonders geeignet. Sie kann Ventil für Angst, Trauer und Wut sein, aber auch eine Möglichkeit zu deren Überwindung bieten. Das Selbstwertgefühl wird durch das Erleben der eigenen Kompetenz gestärkt. Unsere Patienten haben in der Kunsttherapie die Möglichkeit, sich in fördernder und wertschätzender Atmosphäre nonverbal durch Farbe, Form und Linie auszudrücken. Durch behutsames Heranführen an verschiedene Materialien und Techniken kommt dabei oft eine erstaunliche schöpferische Aktivität in Gang. Dies konnte in verschiedenen Ausstellungen von Patientenbildern in- und außerhalb des KEH eindrucksvoll dokumentiert werden. Rosemarie Camatta Kunsttherapeutin Behandlungszentrum für Menschen mit geistiger Behinderung und psychischer Erkrankung KEH-Report | Juni 2010 Seite 12 Arbeitsmaterialien – Gefühlsgruppe Spannungskurve | ??? | 1 Behandlungszentrum für Menschen mit geistiger Behinderung und psychischer Erkrankung 2 3 4 5 100% 5 70% Arbeitsmaterialien – Gefühlsgruppe 4 Grundgefühle KEIN ZURÜCK 3 2 1 Stolz Angst Trauer Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte bleiben der Ev. Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge gGmbH, Berliner Behandlungszentrum für Menschen mit geistiger Behinderung, vorbehalten. Die Vervielfältigung und die Verbreitung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist nicht zulässig. Zuwiederhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechts 2007 Druck_KEH_Gefühlsprotokoll.indd 4 Freude 15.03.10 16:58 Scham Wut Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte bleiben der Ev. Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge gGmbH, Berliner Behandlungszentrum für Menschen mit geistiger Behinderung, vorbehalten. Die Vervielfältigung und die Verbreitung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist nicht zulässig. Zuwiederhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechts 2007, Fotos: © H. D. Beyer Druck_KEH_Gefühlsprotokoll.indd 1 15.03.10 16:58 Skillstraining im BHZ D as Erlernen der Fähigkeiten oder Fertigkeiten (Skills) zur »Gefühlswahrnehmung« und »Gefühls­ kontrolle« gemäß einer Dialektisch Behavioralen Therapie (DBT) von Menschen mit geistiger Behinderung nimmt in der Regel großen zeitlichen Raum in den ersten Behand­ lungswochen ein. Skills sind Fertigkeiten, welche wir alle bereits besitzen und beherrschen. In der therapeutischen Situation zeigen wir unseren Patienten, wie sie selber diese Fertigkeiten bei einer erhöhten inneren Anspannung anwenden können, um diese zu senken. Es kann sich hierbei um eine akute Situation handeln oder auch zur Senkung einer grundsätz­ lich erhöhten Grundspannung dienen. Der Patient erlebt und erlernt, wie er effektiv einen »Reiz« über eine hohe in­ nere Anspannung setzen kann. Das ist z. B. möglich durch • sich ablenken durch Gedanken • sich zurückholen durch Körperempfindungen • sich zurückholen durch Aktivitäten • sich regulieren durch zwischenmenschliche Fertigkeiten. Diese Übungen führt auf der Station das dafür speziell geschulte Pflegepersonal durch. Im Einzelkontakt oder in einer passenden Kleingruppe erfolgt die Vermittlung in kleinen Zeiteinheiten zwei- bis dreimal täglich. Mitunter sind sehr individuelle zeitliche Absprachen nötig und ver­ langen eine erhöhte zeitliche Flexibilität der Pflege. Bereits am ersten stationären Tag erhält die Patientin im günstigsten Falle durch die für sie zuständige Bezugs­ pflege wichtige Arbeitsmaterialien, d. h. Arbeitsblätter wie • die Skillsliste • und die Spannungskurve. Entsprechend der Dialektisch Behavioralen Therapie (DBT) von Menschen mit geistiger Behinderung gehört das Erlernen der Fähigkeiten oder Fertigkeiten (Skills) zur »Gefühlswahrnehmung« und »Gefühlskontrolle«, das Skillstraining, zu den wichtigen therapeutischen Bausteinen in den ersten Behandlungswochen. Diese Arbeitsblätter berücksichtigen das Sprachniveau und die kognitiven Fähigkeiten unserer Patienten, d. h. sie sind in einfacher Sprache verfasst. Zur Steigerung der Eigenverantwortung und zur Motivation werden Skills­ übungen als Hausaufgabe erteilt und im Verlauf nach­ gefragt. Der Patient wird ermutigt, jeden der aufgeführten Skills einmal auszuprobieren, für sich zu bewerten und die entsprechende Spalte zu markieren. Ziel der Skillsübungen ist es, den Patienten zu befähi­ gen, nicht nur Selbstverletzungsverhalten, Sachaggressi­ onen und Fremdverletzungsverhalten zu verringern und im Verlauf zu verhindern, sondern auch, sich dadurch besser zu fühlen und so mehr Lebensqualität zu gewin­ nen. Die Patienten sollen für einen »neuen Umgang« mit sich selbst sensibilisiert werden. Spannungskurve Bei diesem Arbeitsblatt haben wir dem Kurvenverlauf unterschiedliche Piktogramme zugeordnet. Somit ge­ lingt eine gute Visualisierung und die schrittweise Einfüh­ rung in den abstrakten Bereich der inneren Anspannung. Dabei erhielt sie Mimik- und Emotionspiktogramme und farbliche Markierungen nach dem Ampelsystem • Grün: spannungsfrei • Gelb: geringe Spannungszustände • Orange: mittlere Spannungszustände • Rot: hohe Spannung, aber regulierbar • Farblos mit Kreuz: dysfunktionales Verhalten. Weiterhin ermöglicht sie eine gezielte Zuordnung von Skills an das Spannungsniveau, was individuell mit einem farblichen Kennzeichnen der Skills auf der persönlichen Skillsliste visualisiert werden kann und was so über die Zeit eine individuelle Sammlung enstehen lässt. Spannungsprotokoll Stündlich und im Verlauf zweistündlich werden Span­ nungen protokolliert und bei Bedarf Skillsanwendungen durchgeführt. Carmen Lassahn ist Krankenschwester und stellvertretende Stationsleitung P7 Carmen Lassahn Dr. med. Tatjana Voß Juni 2010 | KEH-Report Seite 13 | Krisenintervention | A nlass für eine stationäre Einweisung in das Berliner Behandlungszentrum können je nach Ausprägung und Quantität mannigfaltige Formen von Aggressionen sein. Diese können sich durch impulsive Übergriffe auf Mitbewohner, Angehörige und Betreuer sowie verschie­ dene Formen der Selbstverletzung und Selbstschädigung charakterisieren. Die Ursachen und Gründe für impulsive Hand­ lungen sind vielschichtig und können nicht immer unmittelbar eruiert werden. Somatische Beschwer­ den, psychiat­rische Erkran­ kungen, Traumatisierun­gen, Verlusterleb­nisse oder Verän­ de­­rungen im so­zialen Um­ feld, können zu einer deutlich verminderten Stresstoleranz und einer damit begründeten prägnant erhöhten Belastung des Individuums führen. Nicht zuletzt durch die Ansprüche, die ihnen im Alltag besondere Leistungen abverlangen, werden häufig die Grenzen eigener Fähig- und Fertigkeiten erreicht. Menschen mit einer Intelligenzminderung verfügen dabei oftmals über unzureichend ausgeprägte CopingStrategien, um Zustände von Anspannung, Wut und Frus­ tration kompensieren zu können. Der Mangel an innerer Selbstwahrnehmung und bei der Differenzierung emotio­ naler Zustände führt häufig zu einem subjektiv erlebten, unerträglichen Gefühl und lässt Situationen eskalieren. Um eine akute Krise deeskalieren zu können, sind insbe­ sondere die individuellen Ressourcen und Defizite des Pa­ tienten zu berücksichtigen und sollten stetig präsent sein. Bevor jedoch eine psychiatrisch-therapeutische Inter­ vention erfolgen kann, müssen zwingend mögliche Ur­ sachen und Auslöser für impulsive dysfunktionale Ver­ haltensweisen erfasst werden. Eine Krisenintervention erfolgt der Symptomatik entsprechend auf mehreren Ebenen. Zum einen kann eine vorübergehende medika­ mentöse Behandlung zur Linderung der vorherrschenden, situativ belastenden Symptomatik sehr hilfreich sein. An­ dererseits sollte innerhalb kürzester Zeit eine möglichst gute und tragfähige Beziehung zum Patienten hergestellt werden, die die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Zu­ spitzung und Eskalation verringert. Dennoch können trotz enger struktureller Einbindung in das stationäre Setting und intensiver Beziehungsarbeit akute Krisen und Belastungssituationen entstehen. Diese erfordern neben einem transparenten Regelwerk und ei­ ner anschaulichen Struktur, ein hohes Maß an Flexibilität und Anpassung der individuellen Bedingungen durch das therapeutische multiprofessionelle Team (Bohus, 2002). Die klinische Erfahrung zeigt, dass überstürzte, hek­ tische und unzureichend strukturierte Deeskalationsbe­ mühungen wenig zielorientiert und ineffektiv sind. Eher wird aus Sicht des erregten, aufgebrachten Patienten eine zusätzliche Unruhe und Unsicherheit produziert, die mit einem Gefühl der Angst und Ausweglosigkeit erneute Eskalation deutlich wahrscheinlicher macht. Die Krisenintervention bei geistig behinderten Menschen mit einer Störung der Impulskontrolle Bei Menschen mit einer Intelligenzminderung führt der Mangel an innerer Selbstwahrnehmung häufig zu einem subjektiv erlebten, unerträglichen Gefühl und lässt Situationen eskalieren. Die klinische Erfahrung zeigt, dass überstürzte und unzureichend strukturierte Deeskalations­ bemühungen wenig effek­­tiv sind. Funktionale Analysen von Eskalationssituationen erweisen sich in diesem Zusammenhang als außerordentlich produktiv. Christian Feuerherd ist DiplomHeilpädagoge auf der Station P7 im Behandlungszentrum Patienten erleben eine massive Zunahme an innerer An­ spannung, Wut, Angst, Unsicherheit und Überforderung, deren Unerträglichkeit ausschließlich durch eine emotio­ nale Überreaktion kompensiert und gelöst werden kann. Das Maß innerer affektiver Beteiligung ist derart aus­ geprägt, dass ein Steuern eigener Handlungen, einher­ gehend mit der daraus resultierenden Reduzierung der kognitiven Leistungsfähigkeit, kaum oder nicht mehr möglich ist. In diesen Situationen ist es besonders schwer, einen Zugang zu den betroffenen Personen zu finden. Mit Ver­ ständnis, Authentizität, Empathie, Sicherheit, Struktur und dem entsprechenden Einfühlungsvermögen kann es gelingen, einen Kontakt herzustellen. Zu berücksichtigen ist zudem die individuelle emotionale Beteiligung der Professionellen. In etwaigen Situationen spielen eigene Ängste und Unsicherheiten eine ebenso wichtige Rolle, da sie unmittelbare Entscheidungen für das augenblick­ liche Handeln maßgeblich beeinflussen. Umso wichtiger ist es, schwierige Situationen im Nach­ gang auszuwerten. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass es in der Analyse nicht darum geht, mögliche Defizite einzelner Interventionen zu erfassen und diese den Betref­ fenden zuzuordnen, sondern es geht ausschließlich um die Betrachtung einer komplexen Situation, die durch vie­ lerlei Faktoren geprägt und beeinflusst ist. Die Zielstellung einer solchen Aufarbeitung ist zum einen, eine mögliche Verbesserung und Optimierung eigener Handlungsmuster und Interventionen zu erwirken, um somit optionale Risi­ ko- und Beeinflussungsfaktoren zu erkennen. Zum ande­ ren ist es notwendig, dass unmittelbar beteiligte Professio­ nelle derart belastende und schwerwiegende Situationen abschließen können, um die eigene Sicherheit wiederzu­ erlangen, so dass künftige Ereignisse erneut objektiv und professionell gestaltet werden können. Unsere Erfahrung zeigt uns, dass Funktionale Analy­ sen von Eskalationssituationen außerordentlich produk­ tiv sind und ein erheblicher Rückgang an fremdaggres­ siven Übergriffen verzeichnet werden kann. Wir bieten unseren Patienten die Möglichkeit, ihre Gefühlswahrnehmung zu stärken und somit entstehen­ de Krisen und deren Ursprung besser zu verstehen. Das hat zur Folge, dass krisenbeladene Situationen rechtzei­ tig erkannt und eigenverantwortlich mitgestaltet und re­ duziert werden können. Christian Feuerherd KEH-Report | Juni 2010 Seite 14 | Chirurgisches Behandlungszentrum | Außerhalb der gängigen Behandlungspfade Das Chirurgische Behandlungszentrum für Menschen mit geistiger Behinderung am KEH N ach Angaben des statis­ tischen Bundesamtes nehmen Zahl und Altersdurch­ schnitt der Menschen mit geis­ tiger Behinderung in Deutsch­ land stetig zu. Somit wird ihr Anteil auch in den Kranken­ häusern immer größer. Umso erstaunlicher ist es, dass die meisten Kliniken kaum auf die­se Patientenklientel vorbereitet sind. Viele Patienten mit geistiger Behinderung können nicht ohne weiteres den gängigen Behandlungspfaden zugeordnet werden. Sowohl Anamnese und körperliche Untersuchung als auch technische Befunde und notwendige Therapien erfordern einen höheren Zeitaufwand. Gegebenenfalls sind auch unkonventionelle Methoden und Behandlungsformen ge­ fragt, um die gewünschten Resultate zu erzielen. Das Chirurgische Behandlungszentrum für Men­ schen mit geistiger Behinderung am KEH wurde ein­ gerichtet für Menschen mit geistiger Behinderung, die sich einem chirurgischen Eingriff unterziehen müssen. In diesem Funktionsbereich der Abteilung für Chirurgie wird den Bedürfnissen dieser Patienten in Bezug auf Milieugestaltung und ein möglichst wenig traumatisie­ rendes Vorgehen Rechnung getragen. Das Kernteam besteht aus Fachärzten für Chirurgie, Krankenschwe­ stern und -pflegern sowie aus Sozialarbeitern. Bei zu­ sätzlichen psychiatrischen Fragestellungen wird die Kompetenz des Behandlungszentrums für Menschen mit geistiger Behinderung und psychischen Erkran­ kungen (BHZ) in Anspruch genommen. Nach einem ausführlichen Basis-Assessement wird mit dem Patienten und dem amtlichen Betreuer ein in­ dividuell angepasstes therapeutisches Angebot verein­ bart. Es berücksichtigt körperliche, psychologische und soziale Faktoren, um nach der Heilung des physischen Leidens soweit wie möglich zur sozialen Rehabilitation beitragen zu können. Alle ärztlichen und pflegerischen Mitarbeiter des Chirurgischen Behandlungszentrums für Menschen mit geistiger Behinderung wurden für ihre Aufgaben speziell geschult. Von Vorteil war dabei die jahrelan­ ge Erfahrung des Pflegepersonals und der Ärzte bei der Behandlung von Patienten, die aus der Abteilung für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik zuge­ wiesen worden waren. Im Rahmen eines Pilotprojektes erfolgten Schulungen über Besonderheiten geistiger Behinderung sowie mögliche komorbide Verhaltens­ auffälligkeiten und psychiatrische Erkrankungen durch das BHZ. Im Zentrum standen dabei mögliche verän­ derte Verhaltensweisen infolge chirurgischer Eingriffe. In Praxis­seminaren wurde der Umgang mit eventuell auftretenden Besonderheiten trainiert. Das Chirurgische Behand­ lungszentrum für Menschen mit geistiger Be­­hinderung am KEH wurde eingerichtet, um den Bedürfnissen von Menschen mit geistiger Behinderung, die sich einem chirurgischen Eingriff unterziehen müssen, Rechnung zu tragen und ein möglichst wenig traumatisierendes Vorgehen zu garantieren. Dafür wurde ein in vier Phasen aufgeteilter Behandlungsprozess etabliert. Darüber hinaus erfuhr der Behandlungsbereich tech­ nische Veränderungen: Rollstuhlbreite Türen, Dusche und WC mit leichtem Zugang, größere Waschbecken und erweiterte Überwachungsmöglichkeiten gehören nun zur Standardausrüstung. Als Ergebnis des Projektes konnte ein in vier Phasen auf­ geteilter Behandlungsprozess etabliert werden. Bei der Anmeldung erfolgt die Klärung der organi­ satorischen Belange mit Hilfe einer Checkliste. In der prästationären Phase werden die Patienten – abhängig vom Grad der geistigen Behinderung und psychiatrischer Komorbidität – einer von vier Behand­ lungskategorien zugeordnet: •Psychiatrisch unauffällige Patienten mit geistiger Behinderung •Patienten mit geistiger Behinderung und psychiat­ rischer Behandlung in der Vorgeschichte •Psychiatrisch auffällige Patienten mit geistiger Be­ hinderung, die in der Chirurgie behandelt werden können •Psychiatrisch auffällige Patienten mit geistiger Be­ hinderung, die nicht in der Chirurgie behandelt werden können. Juni 2010 | KEH-Report Seite 15 | Chirurgisches Behandlungszentrum | In einer speziell für die prästationäre Phase eingerich­ teten Sprechstunde im Ambulanten Zentrum des KEH sind Chirurg, Ambulanzschwester und eine Pflegekraft der Station anwesend. Nach Notwendigkeit wird ein Psychiater hinzugezogen. Während die Patienten der ersten drei Kategorien in der Chirurgischen Abteilung behandelt und betreut werden, erfolgt die Betreuung von Patienten der Kategorie vier im BHZ. Die weitere Vorbereitung zur Operation, von der Untersuchung bis hin zur Aufklärung des Patienten, er­ folgt unter Berücksichtigung des Grades der geistigen Behinderung. Notwendige Zusatzuntersuchungen wer­ den nach Möglichkeit ebenfalls prästationär durchge­ führt, so dass eine stationäre Aufnahme am Morgen des OP-Tages erfolgen kann. Falls erforderlich, steht eine zusätzliche Pflegekraft für die Betreuung der Patien­ten zur Verfügung. In der perioperativen Phase wird der Patient zu­ nächst in den Aufwachraum verlegt und anschließend wieder dem speziell geschulten Pflegepersonal überge­ Herzlichen Glückwunsch zum zehnjährigen Bestehen des »Behandlungszentrums für akut psychisch kranke Erwachsene mit geistiger Behinderung« Und ein großes Dankeschön für die ausgezeichnete psychiatrische Betreuung der Bewohner und Klienten der Rehabilitationszentrum Berlin-Ost gGmbH (RBO) und die gute Zusammenarbeit mit unseren Teams. Warum wir gerne gratulieren Menschen mit geistiger Behinderung leiden im Vergleich zur übrigen Bevölkerung deutlich häufiger an psychischen Erkrankungen. Das betrifft auch insbesondere von uns betreute Bewohner und Klienten. Allerdings ist es häufig auch für die Ärzte schwer, diese psychischen Erkrankungen zu erkennen, wenn die Patien­ten geistig schwer behindert sind, sich sprachlich nicht äußern können bzw. ein eingeschränktes Sprachverständnis haben. So wurden in früheren Jahren vielfach Verhaltensauffälligkeiten eher mit den Einschränkungen durch geistige Behinderung begründet, denn als psychische Erkrankung erkannt und behandelt und damit aber auch die Bemühungen der Eltern und der Mitarbeiter in Frage gestellt – denn es wurde häufig als ein rein pädagogisches Problem betrachtet, das als solches aber nicht zu lösen war. Eltern waren sehr verzweifelt – und Mitarbeitern ging es manchmal auch nicht anders. ben. Die Dauer des stationären Aufenthaltes richtet sich nach dem Heilungsverlauf. Die Entlassung in die gewohnte Umgebung erfolgt unter Berücksichtigung des seelischen Zustandsbildes sowie nach Planung und Absprache mit den betreuen­ den Personen. Das gemeinsame Projekt der Abteilung für Psychiat­ rie, Psychotherapie und Psychosomatik sowie der Chi­ rurgischen Abteilung des KEH konnte 2009 erfolgreich beendet und in die Praxis überführt werden. Unseres Wissens gibt es in der Bundesrepublik nur wenige Ein­ richtungen, die sich der Herausforderung einer chirur­ gischen Behandlung von Menschen mit geistiger Behin­ derung stellen. Wir freuen uns daher, den betroffenen Patienten in Berlin und Brandenburg dieses Angebot unterbreiten zu können. Dies hat sich – Dank der Arbeit der Ärzte des Behandlungszentrums und der Spezialambulanz – grundlegend geändert. Psychische Auffälligkeiten werden als solche diag­­nostiziert, andere Ursachen für akute Verhaltensauffälligkeiten werden als solche erkannt und entsprechend medizinisch behandelt. Dies können unter Umständen auch schwere und bedrohliche somatische Erkrankungen sein, die bei schwer geistig behinderten Menschen, die sich nicht anders als über ihr Verhalten ausdrücken können, zu psychischen Auffälligkeiten führen. Damit eröffnen sich in der Betreuungsarbeit wieder neue Sichtweisen, denn sind die Ursachen der Verhaltensauffälligkeiten bekannt und klar, stellt sich umgehend im Wohnen wieder ein normaler Alltag ein, der sich an den Wünschen, Bedürfnissen und Vorstellungen der betroffenen Bewohner orientieren kann. Ein Beispiel von vielen für die gute Zusammenarbeit ist die Entwicklung von Herrn E., der auf Grund einer schweren psychischen Erkrankung sehr häufig stationär behandelt wurde, aber letztendlich nicht mehr am Arbeitsleben teilnehmen konnte. Dank der guten Zusammenarbeit zwischen den Ärzten und den Mitarbeitern der Wohngruppe gelang es, Herrn E. einerseits durch entsprechende Umfeldbedingungen (Strukturierung des Tagesablaufes, Orientierung am TEACCH Konzept) und andererseits eine sehr wirksame psychiatrische Behandlung nach sieben Jahren wieder in die Werkstatt zu integrieren. Dr. med. Georg Decker Chefarzt der Abteilung Chirurgie Winfried Höhn Facharzt für Chirurgie Aus unserer Sicht hat sich in den zehn Jahren des Bestehens des Behandlungszentrums eine offene und vor allem auch vertrauensvolle Zusammenarbeit entwickeln können, die für eine gute rehabilitationspädagogische Betreuung der Bewohner und Klienten von großer Bedeutung und sehr hilfreich ist. Mehr als 80 Bewohner werden inzwischen von der Spezialambulanz kontinuierlich behandelt. Die Bewohner werden fast alle in ihrem Zuhause aufgesucht. Dadurch hat sich ein gutes Verhältnis zu den Ärzten und Mitarbeitern der Spezialambulanz entwickelt, aber insbesondere ist auch bei den Bewohnern ein Vertrauensverhältnis gewachsen. Mit diesem zusätzlichen ambulanten Angebot konnten stationäre Aufenthalte im Behandlungszentrum verkürzt oder sogar vermieden werden. Bewohner konnten auf einen notwendigen geplanten Aufenthalt im Krankenhaus entsprechend vorbereitet werden. Durch die kontinuierliche ärztliche Betreuung gibt es wesentlich weniger Einweisungen in einer akuten Krisensituation. Dafür herzlichen Dank und weiterhin gute Zusammenarbeit. Karin Stopp, Dipl.-Psychologin, Psychologische Psychotherapeutin Ariane Siebert, Heilpädagogin, Teamleiterin KEH-Report | Juni 2010 Seite 16 | Spezialambulanz | Psychiatrische Institutsambulanz am Berliner Behandlungszentrum K onzentrierte sich in den ersten Jahren des Be­ stehens die Arbeit des Be­ handlungszentrums auf den vollstationären Bereich, so zeigte sich im Laufe der Zeit, dass auch ein hoher Bedarf für ein ambulantes Behand­ lungsangebot bestand. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, entwickelte die Psychiatrische Institutsam­ bulanz ein spezielles Behandlungsangebot für diese Patienten. Sie begann ihre Arbeit im ersten Quartal 2005 mit wenigen Patienten – gegenwärtig werden im Quartal ca. 380 Patienten therapiert. In erster Linie werden hier Patienten behandelt, bei denen auch im ambulanten Bereich ein multiprofessionelles komplexes Diagnose- und Therapieangebot erforderlich ist. Neben ärztlichen Mitarbeitern besteht das Behandlungsteam aus einer Psychologischen Psychotherapeutin, zwei Heilerziehungspflegerinnen, einem Heilpädagogen, einem Sozial­arbeiter, einem Physiotherapeuten, einer Musik- und einer Kunsttherapeutin. Ein Hauptanliegen der ambulanten Arbeit ist es, stationäre, psychiatrische Aufenthalte zu verkürzen oder zu vermeiden. Der weitaus größte Teil der Patien­ ten wird aufsuchend versorgt (80 %), dadurch ist es möglich, die Patienten in ihrem gewohnten Umfeld zu erleben. Die beschriebenen Verhaltensauffälligkeiten können so direkt beobachtet und systemische Einflüsse mit in die diagnostischen und therapeutischen Überle­ gungen einbezogen werden. Häufig wird so der Arztbe­ such als weniger belastend erlebt. Die ambulante Tätigkeit der Psychiatrischen Institutsambulanz (PIA) soll stationäre psychiatrische Aufenthalte verkürzen oder vermeiden helfen. Für Menschen mit psychischer Erkrankung und geistiger Behinderung wurden spezielle Diagnoseund Therapieangebote entwickelt. Die PIA kooperiert dabei mit verschiedenen Instituten und bietet eine Sprechstunde in der Friedrich von BodelschwinghKlinik in Berlin-Wilmersdorf an. Folgende Patientenklientel stellt bisher den größten Teil der in der Spezialambulanz behandelten Fälle dar: •Patienten mit schweren Verhaltensauffälligkeiten im Rahmen von Psychosen, affektiven Störungen, Persönlichkeitsstörungen, stationäre Problempa­ tienten (Drehtürpatienten, chronisch rezidivieren­ der Verlauf), • Patienten mit Demenz und geistiger Behinderung, •Patienten mit nicht sicher diagnostizierbaren psychischen Erkrankungen, • Patienten mit Komorbiditäten, z. B. Epilepsie, • Patienten mit Autismus-Spektrum-Störungen. Nach drei bis vier Patientenkontakten und der erforder­ lichen somatischen und neuropsychologischen Diag­ nostik wird eine vorläufige Diagnose gestellt und ein individueller Behandlungsplan entworfen. Dieser wird mit dem Patienten und dem Bezugssystem besprochen und abgestimmt. Zur Diagnosesicherung und zur Ver­ laufsbeurteilung der Behandlung wird häufig ein in der Oberarzt Dr. med. Christoph Schade ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Leiter der Institutsambulanzen der Abteilung für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik Psychiatrischen Institutsambulanz entwickelter Beob­ achtungsbogen eingesetzt, der auf die Strukturen der komplementären Einrichtungen ausgerichtet ist. In den vergangenen fünf Jahren wurden speziell für Menschen mit psychischer Erkrankung und geistiger Behinderung verschiedene Diagnose- und Therapiean­ gebote entwickelt. Zu diesen gehören: •fachärztliche psychiatrische Diagnostik (einschließlich EKG, Blutentnahmen, neuro-physio­ logische Untersuchungen und Therapien), •psychologische Diagnostik (u. a. Leistungsdiagnos­ tik, Persönlichkeitsdiagnostik, Autismusdiagnostik) und in Einzelfällen Therapie (schwerpunktmäßig verhaltenstherapeutisch ausgerichtete Psychothe­ rapie), •sozialpsychiatrische Beratung (z. B. Klärung der Wohnsituation, Angehörigenberatung), Fertig­ keiten­training (Skillstraining für Menschen mit emo­­tional-instabiler Persönlichkeit, adaptierte Form der dialektisch-behavioralen Therapie der Borderlinestörungen nach Marsha Linehan), • basale Stimulation, • Kontakt- und Aktivitätentraining, • Ernährungsberatung (für Patienten und Betreuer), • Physiotherapie (Adipositasgruppe), • Kunst- und Musiktherapie. Darüber hinaus besteht ein gemeinsames fachüber­ greifendes Ambulanzprojekt mit dem Epilepsie Zentrum Berlin Brandenburg. Aktuell wird ein konzeptionelles Vorgehen zur Diag­ nostik von Autismus-Spektrum-Störungen bei erwach­ senen Menschen mit geistiger Behinderung entwickelt. Nach der Diagnosestellung erfolgt eine Beratung zur individuellen Therapie und Förderplanung unter Berücksichtigung der autistischen Denk- und Wahrneh­ mungsbesonderheiten und des individuellen Leistungs­ profils. Im Rahmen dieses Projektes kooperiert die Psychiatrische Institutsambulanz mit verschiedenen In­ s­ti­tuten, z. B. dem Medizinisch-Psychologischen Institut für Bildungswissenschaften Berlin, der Universität der Künste Berlin, Autea Gelsenkirchen und Autismus e. V. Berlin. Das Behandlungsangebot der Psychiatrischen Insti­ tutsambulanz ist primär auf den Berliner Versorgungs­ bereich ausgerichtet. Um auch für Patienten in den westlichen Bezirken Berlins ein wohnortnahes Angebot zu schaffen, bietet die Ambulanz eine Sprechstunde in der neu eröffneten Friedrich von Bodelschwingh Klinik, Landhausstraße 33–35 in Berlin-Wilmersdorf an. Die Entwicklung dieses ambulanten Bereiches zeigt, dass trotz einer guten ambulanten nervenärztlichen/psy­ chiatrischen Versorgung in Berlin ein hoher Bedarf für solch ein spezialisiertes Angebot besteht. Dabei ist die Zusammenarbeit und Kooperation mit den niedergelas­ senen Nervenärzten besonders wichtig. Dr. med. Christoph Schade Juni 2010 | KEH-Report Seite 17 | Autismus | Autismus bei erwachsenen Menschen mit Intelligenzminderung A Dr. med. Tanja Sappok ist Ambulanzärztin, Fachärztin für Nervenheilkunde und Neurologie, Psychotherapie Professioneller Betreuer: SEA, FSK/aktuell Pflegepersonal: Verhaltensbeobachtung Alltagssituationen: Verhaltensbeobachtung Familie: ADI-R, FSK/Lebenszeit Autismus diagnose Therapeuten: Verhaltensbeobachtung z. B. in der Musiktherapie Weniger Fixierungen Durch die kontinuierliche, störungs­spezifische multiprofessionelle heil- und psychotherapeutische Arbeit im BHZ konnte in den vergangenen zwei Jahren erneut die Anzahl an freiheitsentziehenden Massnahmen um weitere 90 Prozent von 2000 Stunden auf unter 200 Psychologe: ADOS Arzt: Klinische Diagnostik (ICD-10-Kriterien) Stunden pro Jahr reduziert werden. Auch die Anzahl an Stunden, die ein geistig behinderter Patient im so genannten Time-Out-Raum verbracht hat, ist in diesen drei Jahren signifikant gesunken. Auf der Station P 8 konnte dieses Ergebnis nur durch eine erhebliche Steigerung der individuellen, modifizierten therapeutischen Angebote, oftmals in pflegerischer Eins-zu-einsBetreuung, erzielt werden. Diese Zahlen belegen nachdrücklich, dass auch bei schwer oder schwer mehrfach behinderten Patienten keine Rechtfertigung für einen therapeutischen Nihilismus besteht. Und Eine Klausurtagung des Behandlungszentrums im März 2008 beschäftigte sich schwerpunktmäßig mit dem The­ ma »Autismus bei erwachsenen Menschen mit Intelli­ genzminderung«. Aus dieser Klausurtagung entwickelte sich eine interdisziplinäre Arbeitsgemeinschaft, der un­ terschiedliche Berufsgruppen des Behandlungszentrums angehören. Es finden wöchentliche Fallbesprechungen zu einzelnen Patienten mit Autismusverdacht statt. Hier werden die Krankengeschichte, die Verhaltensbeobach­ tungen der wesentlichen Bezugspersonen und die Ergeb­ nisse standardisierter psychologischer Untersuchungen zusammengetragen, ausgewertet, und die Diagnose »Autismus« wird gestellt bzw. verworfen. Für einzelne Patienten, bei denen die Einordnung der Beschwerden besonders schwer fällt, finden vier­ teljährlich Fallbesprechungen unter fachkundiger An­ leitung durch Frau Prof. Schumacher, Professorin für Musiktherapie der Universität der Künste in Berlin, statt. Die Erfahrungen aus der klinischen Arbeit werden in Kooperation mit verschiedenen Partnern, z. B. Frau Dr. Dziobek, Projektleiterin »Neurobiologische Korre­ late der Empathiefähigkeit« des Instituts »Cluster Lan­ guages of Emotion« der FU Berlin und Frau Dipl. Psych. Symalla, Geschäftsführerin bei AUTEA und Leiterin des Fachdienstes Autismus in Bethel, wissenschaftlich aus­ gewertet, um die diagnostischen Möglichkeiten bei den Betroffenen weiter zu entwickeln. Autismus selbst ist nicht heilbar. Aber aus einem kranken Menschen mit Autismus kann ein gesunder Mensch mit Autismus werden. Dr. med. Tanja Sappok dass es in spezialisierten Einrichtungen auch für sehr verhaltensauffällige, schwer behinderte Menschen durchaus möglich ist, diese ohne lange Fixierungen zu untersuchen, therapeutisch durch ihre Krisen zu begleiten und sie bei ihrer Genesung zu unterstützen. Dr. med. Tatjana Voß Auswertung Fixierungen Station P8 in Stunden Zeitraum: 2007 bis 2009 Fixierungen Time out 1:1-Betreuung 2009 2008 2007 utismus tritt in der Nor­ malbevölkerung selten auf (Prävalenz < 1%), wird je­ doch bei Menschen mit Intelli­ genzminderung deutlich häu­ figer diagnostiziert (8 – 40 %). In der Betreuung und Be­­handlung von psychisch kranken oder verhaltensauffälligen Menschen mit In­ telligenzminderung ist es daher wichtig, die Störung zu erkennen. Dadurch verändert sich die Akzeptanz für bestimmte Verhaltensauffälligkeiten. Die Umwelt der betroffenen Menschen kann entsprechend deren Denk- und Wahrnehmungsbesonderheiten gestaltet werden. In der Therapie- und Förderplanung können für Autismus typische Stärken genutzt und es kann an individuellen Schwächen gearbeitet werden. Darüber hinaus treten bei Menschen mit Autismus bestimmte psychische Erkrankungen häufiger auf, die dann leichter erkannt und behandelt werden. 2033 229 352 1746 117 60 119 82 1544 KEH-Report | Juni 2010 Seite 18 | Musiktherapie | Musiktherapeutische Behandlungsmöglichkeiten von erwachsenen Menschen mit Autismus und geistiger Behinderung N ach neuesten Unter­ suchungen hat jeder vierte Mensch mit einer gei­ stigen Behinderung eine Autismus-Spektrums-Störung. Menschen mit Autismus sind fundamental in ihren Möglichkeiten, mit anderen in Kontakt zu treten, ein­ geschränkt, neigen zu Stereotypien (z. B. ständiges Wiederholen von Wörtern und Sätzen oder Hand- und Fingerbewegungen), haben ausgeprägte Sonderinte­ ressen und zeigen zwanghaftes Verhalten sowie eine Vorliebe für Rituale. Darüber hinaus neigen viele die­ ser Menschen zu selbst- und fremdverletzendem Ver­ halten. Die Grundlage dieser Störung liegt in Defiziten in der Wahrnehmungsverarbeitung und -koordination, Defiziten in der Handlungsplanung, dem Erfassen von Bedeutungszusammenhängen und einem fehlenden Konzept von »dem Anderen« – was nicht primär durch die geistige Behinderung (gB) bedingt ist, sondern noch als zusätzliche Störung anzusehen ist. Autismus als tief­ greifende Entwicklungsstörung ist nicht medikamentös behandelbar und der adäquate Umgang mit diesen Menschen stellt eine große Herausforderung dar, noch dazu, da viele Betroffene nicht oder nur kaum sprechen. Um überhaupt einen Zugang zu diesen Menschen zu finden und sie aus ihrer sozialen Isolation befreien zu können, braucht es viel Gespür und ein Sich-Einlassen auf die Welt – d. h. die Denk- und Wahrnehmungsstruk­ tur – dieser Menschen. Hier hat sich ein musikalischer Zugang als sehr hilfreich erwiesen. Musik mit ihren Elementen Rhythmus, Klang, Melo­ die, Dynamik und Form stellt eine Art nicht-sprachliche Kommunikationsform dar, in etwa vergleichbar mit dem vorsprachlichen Dialog mit einem Baby. In dieser »Babysprache« geht es weniger um konkreten Informa­ tionsaustausch, als um ein Sich-aufeinander-Beziehen, ein Teilen von Freude, ein Trösten – d. h. ein Regulieren von inneren Spannungszuständen, ein gemeinsames Richten der Aufmerksamkeit auf z. B. eine Rassel etc. Im gemeinsamen Musizieren sind alle diese Aspekte auch mit erwachsenen Menschen möglich und es bietet sich somit die Möglichkeit, an diesen vorsprachlichen Dialog anzuknüpfen und einen »Draht« zu diesen Menschen zu finden. Da ein enger Kontakt für Menschen mit Au­ tismus oft schwer auszuhalten ist, haben Instrumente als »dritte Objekte« im Beziehungsgeschehen eine ent­ lastende Funktion, sie können angemessene Distanz schaffen und es braucht nicht den Blickkontakt, den wir beim Sprechen mit einem Menschen suchen und der von den meisten Menschen mit Autismus gemie­ den wird. Die Beeinflussung von Rhythmus und Klang Um Menschen mit Autis­ mus, die in ihren Möglichkeiten der Kontaktaufnahme zu anderen fundamental eingeschränkt sind, aus ihrer sozialen Isolation zu befreien, leistet Musik als Zugangsmedium große Hilfe. Mit ihren Elementen Rhythmus, Klang, Melodie, Dynamik und Form ermöglicht sie eine Art vorsprachlichen Dialog mit dem Patienten. Seminare Thomas Bergmann, Linda Kienitz. Auto- und fremdaggressives Verhalten bei Menschen mit Autismus. VIA Berlin 26.04.2010 Thomas Bergmann, Tanja Sappok, Karin Schumacher, Albert Diefenbacher. Musiktherapeutischer Behandlungsansatz bei erwachsenen Menschen mit Autismus und geistiger Behinderung. DGPPN Berlin 26./27.11.2009; Wissenschaftliche Tagung Autismus-Spektrum (WTAS) 18./19.2.2010, Frankfurt a. M. auf vegetative Funktionen (Atmung, Puls, Muskeltonus) ermöglicht Entspannung und Kontaktaufnahme auf basaler körperlicher Ebene. Hierfür stehen große und resonierende Instrumente zur Verfügung, wie die Bass­ schlitztrommel, Klangschalen oder die Körpertambura, die sogar für hörgeschädigte und sensorisch einge­ schränkte Menschen bestens geeignet sind. Ein zentrales Element in der Arbeit mit Menschen mit Autismus ist die Synchronisation. Das Erleben von Gleichzeitigkeit verschiedener Sinneswahrnehmungen (Hören, Tasten, Sehen...) und des inneren Erlebens führt zu einer Aktivierung und Verknüpfung von Nerven­ bahnen und Hirnarealen, die gerade bei diesen Men­ schen gestört oder fehlentwickelt sind. Diese Synchro­ nisation betrifft die Selbstwahrnehmung, aber auch die Abstimmung mit dem Anderen. Dieses kann sich z. B. durch Momente der Gleichzeitigkeit bei einem Trommel­ rhythmus zeigen oder dem Abstimmen der Lautstärke beim gemeinsamen Spiel auf dem großen Gong. Syn­ chronisation kann als Basis für jede Form einer weiteren Entwicklung des Lernens, des Kommunikations- und In­ teraktionsverhaltens und der Regulierung von Emotio­ nen und inneren Spannungen gesehen werden. Diese Entwicklungen stellen eine grundlegende Verbesserung der Lebensqualität dar. Musiktherapie bei Menschen mit Autismus findet vorwiegend im Einzelsetting statt, da nur eine bere­ chenbare soziale Situation Ausgangsgangspunkt für eine therapeutische Beziehungsgestaltung sein kann. Auf der Station P8 wird vorwiegend stationär, im di­ rekten Umfeld des Patienten gearbeitet. Darüber hinaus steht ein neu eingerichteter Snoezelraum zur Verfü­ gung, der als reizarme Umgebung dem Bedürfnis der Patienten nach Ruhe und Überschaubarkeit entgegen kommt. Für die Patienten der Station P7 und der Spe­ zialambulanz steht ein großer und gut ausgestatteter Juni 2010 | KEH-Report Seite 19 | Musiktherapie | Ernährung | Musiktherapieraum zur Verfügung. Bei der ambulanten Behandlung sind die Bezugspersonen eingeladen, be­ obachtend teilzunehmen. Dieses bietet einerseits dem Patienten mehr Sicherheit in der ungewohnten Umge­ bung, andererseits den Beobachtern die Möglichkeit, den Patienten in einer alltagsfernen Situation zu erle­ ben. Das gibt Anlass für ein therapeutisches Nachge­ spräch, in dem Förderplanung, spezifischer Umgang mit dem Patienten, Krisensituationen etc. thematisiert werden können. Diese Form der Zusammenarbeit bewährt sich zu­ nehmend im Sinne von Austausch und Nachhaltigkeit therapeutischer Effekte. Den größten Einfluss auf die Entwicklung und die Lebensqualität von Menschen mit Autismus haben jene, die tagtäglich mit ihnen umge­ hen und zu ihrem engeren Lebensumfeld gehören. Ich versuche, sie bei dieser verantwortungsvollen Aufgabe zu unterstützen. Thomas Bergmann Dipl.-Musiktherapeut Abbildungen: Behandlungsmöglichkeiten im neuen Snoezelraum Ernährungsberatung im Behandlungszentrum M enschen mit geistiger Behinderung, die vorran­ gig institutionalisiert leben, zeigen sehr häufig Störungen des Ess- und Gewichtsverhaltens. Oftmals wird nicht nur von den Patienten, sondern auch von den Betreuern das seelische Wohlbefinden über »gutes Essen« definiert. Verstärkt wird diese Problematik bei Menschen mit psychischer Erkrankung und geistiger Behinderung durch den Einsatz von Psychopharmaka, die das Sättigungsgefühl stark beeinflussen. Das Behandlungszentrum bietet in einzigartiger Form eine adaptierte Version des BELA-Programms an. BELA steht für Bewegung, Ernährung, Lernen, Akzep­ tieren und es handelt sich dabei um ein psychoeduka­ tives Trainingsprogramm speziell für psychisch kranke Menschen. Die Teilnehmer bekommen in acht Modulen Grundkenntnisse über gesunde und ausgewogene Er­ nährung vermittelt, wobei die Theorie einfach aufge­ baut ist und durch zahlreiche praktische Handlungen ergänzt wird. Die Inhalte der Module sind auf die speziellen Be­ lange der Patienten abgestimmt, bieten z. B. Strategien gegen Heißhungerattacken an. Die Kurse werden in der Regel einmal wöchentlich in Gruppen mit sechs bis zehn Teilnehmern gehalten, außerdem gehört zu BELA ein regelmäßiges Bewegungsangebot. Der Kurs wird in kleinen Schritten und in einfacher Sprache durch­ geführt, häufige Wiederholungen und Raum für viele Fragen unterstützen den Lernerfolg und heben den Spaßfaktor. »Bewegung, Ernährung, Lernen, Akzeptieren« (BELA) heißt das psychoedukative Trainingsprogramm, das speziell für psychisch kranke Menschen entwickelt wurde und im BHZ angeboten wird. In acht Modulen werden sowohl Patienten als auch Betreuern Grundkenntnisse über gesunde und ausgewogene Ernährung vermittelt. Die Theorie wird durch praktische Übungen ergänzt. Neben der visuellen Veran­ schaulichung kommt auch das gemeinsame Kochen nicht zu kurz. Ergänzend wer­ den durch einen Physiothera­ peuten zweimal wöchentlich Bewegungsübungen in einer Adipositasgruppe angeboten. Das Augenmerk liegt hier auf der Steigerung der Aus­ dauer sowie der gezielten Fettverbrennung bei stän­ diger Pulsüberwachung. Von entscheidender Bedeutung für die Fortführung einer gesunden Ernährung ist, dass auch die Wohn­ gruppenbetreuer entsprechend geschult werden. Da­ her werden im Behandlungszentrum spezielle Kurse an­ geboten, welche auf diese Berufsgruppe ausgerichtet sind. Diese fungieren in den Wohngruppen als »Multi­ plikatoren« und sorgen für die Nachhaltigkeit des Trai­ ningsprogramms. Bisher wurden vier Patientenschulungen mit insge­ samt 22 Patienten und drei Betreuerschulungen durch­ geführt, die Mehrzahl der Patienten nahm kontinuierlich am Kurs teil und äußerte, Freude an den Lerninhalten sowie deren Umsetzung zu Hause zu haben. Es hat sich bewährt, durch lustbetonte und abwechslungsreiche Kursinhalte das Interesse der Patienten an einer Ernäh­ rungsumstellung zu wecken und weniger Beachtung dem Gewicht zukommen zu lassen. Trotzdem nahm die Mehrzahl der Patienten deutlich an Gewicht ab. Dr. med. Christoph Schade KEH-Report | Juni 2010 Seite 20 | Informationen | | ??? | MECKLENBURGVORPOMMERN UCKERMARK Wirkung über die Region hinaus PRIGNITZ OSTPRIGNITZRUPPIN BARNIM Patienten aus dem Berliner Umland im Zeitraum 2005 bis 2009 OBERHAVEL MÄRKISCH ODERLAND HAVELLAND I n seinem vollstationären Bereich hat das Behand­ lungszentrum im Jahr 2009 378 Patienten versorgt. Die »Spezialambulanz für psychisch kranke Menschen mit geistiger Behinderung« konnte im I. Quartal 2010 bereits 380 Patienten ambulant behandeln. Mit Übernahme der Versorgung der Patienten­ klientel für das gesamte Land Berlin im Jahr 2000 kam es zu einer Erhöhung des Anteils von Patienten aus entfernter gelegenen Berliner Stadtbezirken. Multidiszi­ plinärer Ansatz, ganzheitliche Diagnostik und Therapie der Patienten führten auch zu wachsendem Interesse an Einweisungen aus dem Land Brandenburg und an­ deren Bundesländern. Bislang wurden ca. 300 Patien­ ten aus überregionaler Zuweisung behandelt. Die violetten Kreise in der nebenstehenden Grafik symbolisieren die Anzahl der Einweisungen von einem Patienten bis hin zu 72 Patienten. BERLIN BRANDENBURG FRANKFURT POTSDAM ODER-SPREE POTSDAMMITTELMARK TELTOW-FLÄMING DAHME SPREEWALD NORDRHEINWESTFALEN COTTBUS SACHSEN SACHSEN-ANHALT SAARLAND THÜRINGEN SPREE-NEISSE ELBE-ELSTER SPREEWALDLAUSITZ Ausgewählte Vorträge und Veröffentlichungen aus dem BHZ Publikationen Diefenbacher A: Psychiatrie außerhalb der psychiatrischen Versorgung – das Allgemeinkrankenhaus als »virtueller psychiatrischer Versorgungssektor«. Gemeindenahe Psychiatrie, Bertuch-Verlag 2009, Heft 3, S. 135-144 Sappok T, Barrett B, Voß T, Diefenbacher A, Schade C: HashimotoThyreoiditis mit Hypothyreose und Hypokal­ziämie – Differentialdiagnostische Erwägungen bei Demenz und Down Syndrom. Medizin für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung, 2009, 6(1), S. 40 – 44 Sappok T, Bergmann T, Kaiser H, Diefenbacher A: Autismus bei erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung. Der Nervenarzt (akzeptiert zur Publikation) Sappok T , Voß T, Millauer M, Schade C, Diefenbacher A: Psychotherapie bei Menschen mit Intelligenzminderung: Ein Überblick am Fallbeispiel der Hundephobie. Der Nervenarzt 2010, Epub, Schade C, Sappok T, Diefenbacher A: Besonderheiten in der Diag­­nostik und Therapie psychischer Erkrankungen bei Menschen mit geistiger Behinderung. Berliner Ärzteblatt 2008 (9)121, S. 23 – 26 Voß T, Diefenbacher A: Demenz bei geistiger Behinderung In: Mahlberg R, Gutzmann HW (Hrsg.): Demenzerkrankungen. Erkennen, behandeln und versorgen. Deutscher Ärzte-Verlag (Köln) 2009, S.96 – 100 Voß T, Schade C, Kaiser H, Jeschke C: »Und es geht doch« – Stationäre Psychotherapie bei Menschen mit geistiger Behinderung, Psychotherapie im Dialog 2008 (2), S. 132-37 Vorträge Barrett B: Modified Dialectical Behavior Therapy for Individuals with Intellectual Disabilities. Workshop 7th European Congress of Mental Health in Intellectual Disability (EAMHID), 3.– 5.9.2009, Amsterdam und 1st International Congress on Borderline Personality Disorder, 1. – 3.7.2010, Berlin Diefenbacher A: Psychiatrische und psychotherapeutische Behandlung von Menschen mit geistiger Behinderung und psychischen Erkrankungen. Fachtagung Menschen mit Intelligenzminderung und psychischen Erkrankungen: Behandlungskonzepte und Einrichtungen, Caritasverband Freiburg in Zusammenarbeit mit der Psychiatrischen Universitätsklinik Freiburg, 21.3.2009, Freiburg Feuerherd C: Wohin mit meiner Wut? – Ambulante Gruppenarbeit. Workshop 5. Fachtagung »Therapie bei Menschen mit geistiger Behinderung – Seelische Traumata und Traumafolgestörungen«, 13.11.2009, Berlin Feuerherd C: Borderline-Persönlichkeitsstörung und geistige Behinderung, Workshop 15.6.2010, Lebenshilfe Bildung gGmbH, Berlin Kaiser H: Autismus und Traumata. Vortrag und Workshop 4. und 5. Fachtagung »Therapie bei Menschen mit geistiger Behinderung« – Seelische Traumata und Traumafolgestörungen«, 24./25.11.2008 und 13.11.2009, Berlin Sappok T, Bergmann T, Diefenbacher A: Prävalenz und Diagnostik von Autismus bei erwachsenen Menschen mit Intelligenzminderung. Wissenschaftliche Tagung Autismus-Spektrum, 19.2.2010, Frankfurt a. M. Voß T, Barrett B: Somatisch krank in der Psychiatrie? Fehlplatzierung von Menschen mit geistiger Behinderung in der Psychiatrie auf Grund nicht diagnostizierter körperlicher Erkrankungen. Fachtagung Gesundheit fürs Leben, Bundesvereinigung Lebenshilfe, 15./16.5.2009, Potsdam