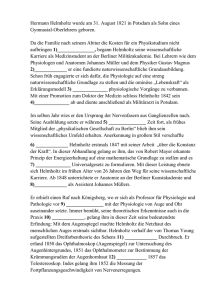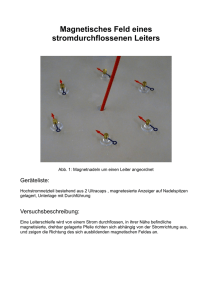102
Werbung

1 Die visuelle Sphäre von Matthias Thoma (3.Fassung vom Okt. 2016) 2 Inhalt Einleitung ….....................................................................................................S.3 1. Visuelle Illusion, Gestaltpsychologie und erste Bilder.................................S.5 Wahrnehmungskonstanz, Vision ist fächenhaft, keine Wahrnehmung der Sinnesorgane, Form der Retina, Entdeckung der visuellen Illusion, FigurGrund Phänomen, Zeichen und Symbole, Nachahmung der Natur 2. Entwicklung der linearen Perspektive aus der euklidischen Optik …........S.17 Euklids Erfahrungssätze und Theoreme, Panofskys symbolische Form, Raumdarstellungen des Mittelalters, Erfndung der Zentralperspektive, kritischer Diskurs in der Renaissance, Weiterentwicklung zur linearen Perspektive, Fotografe 3. Das Weltbild und die physiologische Optik …..........................................S.39 Die visuelle Sphäre als Erfahrungsprodukt, frühe Darstellungen, Himmelsgewölbe und Weltbild, Gesichtsfeld nach Helmholtz, Machs Raumdefnitionen, Gibsons Bewegungsbilder 4. Die kurvenlineare Perspektive …...............................................................S.63 Kunstgeschichtliche Vorläufer, Theorien von Hauck, Herdman und Flocon, Anwendungen Zusammenfassung ….....................................................................................S.72 Anhang ….......................................................................................................S.73 Anmerkungen, Literatur, Liste der Abbildung 3 Einleitung Wie sehen wir den Raum und wie können wir ihn darstellen? Auf den ersten Blick scheint es leicht dies zu beantworten. Aber schon die Defnition des Sehens birgt ungeahnte Probleme, an denen wir uns seit Jahrtausenden abarbeiten. Woraus besteht eigentlich das Bild, das wir von der Welt haben? In der Antike glaubten die Gelehrten, unsere Augen würden Strahlen aussenden und damit die Welt gleichsam abtasten. Die im Zusammenhang mit dieser Sehstrahlentheorie verwendeten Begriffe gehören heute noch zu unserem Sprachgebrauch. So verliert ein Mensch sein Augenlicht, wenn er erblindet und wir werfen auch mal einen Blick. Nach einer später entwickelten Idee sollten unsere Augen eine Art Sensor sein. Die Lichtempfndung und das Denken wurden getrennt untersucht. Auch diese Theorie ist immer noch Teil unseres kulturellen Erbes. Der Vorgang des Sehens wird heute noch sehr oft erklärt, indem unsere Augen mit dem Aufbau und der Funktion einer Kamera verglichen werden. In dem aktuellen Erklärungsmodell ist unser Blick auf die Welt nicht mehr objektiv. Wir gehen von einer Konditionierung der sinnlichen Wahrnehmung aus, die nicht nur Signale empfängt und verarbeitet, sondern gleichzeitig Vorstellungen generiert. Beim Sehen fndet eine geistige Projektion statt, deren Bilder unsere Sinnesempfndung überlagern. Hinzu kommt der Umstand, dass wir unsere sinnliche Wahrnehmung nicht „sehen“, sondern nur ein Bewusstsein von deren Wirkung haben. Bereits im 1. Jahrhundert v. Chr. fragte Lukrez (in: Über die Natur der Dinge), ob das Auge sieht, oder der Geist. Lukrez entschied, dass der Geist sieht und die Augen als offene Türen zum Geist fungieren. Er stellte aber auch fest, dass uns unser „Gefühl“ sagt, dass wir mit den Augen sehen. Diese Eigenschaft des Sehens ist wesentlich dafür verantwortlich, dass in der Antike die Idee von den Sehstrahlen in die Welt gesetzt wurde, die sich hartnäckig bis in die Neuzeit halten konnte. Es ist die Grundlage für die Entwicklung der euklidischen Optik auf deren Basis die lineare Perspektive entwickelt wurde. Fotografsch erzeugte Bilder entsprechen grundsätzlich dem Prinzip der linearen zentralperspektivischen Konstruktion. Nach wie vor wird allgemein angenommen, diese lineare Perspektive entspräche dem räumlichen monokularen Sehen. Aber es gibt auch genügend Einsprüche gegen diese scheinbar gesicherte Wahrheit. Immer wieder kommt der Verdacht auf, mit der linearen Perspektivlehre stimme etwas nicht. In dem Konfikt scheint aber meist Uneinigkeit über die Aufgabenstellung einer Abbildung enthalten zu sein. Die Erwartung an ein Abbild besteht einerseits in der möglichst perfekten Nachahmung der sinnlichen Wahrnehmung und andererseits in der Übersetzung in eine Darstellung des Geistigen. Letztendlich hat sich der Gesichtssinn des Menschen jedoch nicht entwickelt um Bilder zu betrachten, sondern damit wir uns im natürlichen Raum zurecht fnden können. Die Analyse der daran beteiligten Physiologie und Refexion führt zu einer Raumvorstellung, die mit dem linearen Denken der Antike nur in Teilen vereinbar ist. Neben zahlreichen anwendungsbezogenen Raumbetrachtungen, wie etwa dem Begriff vom sozialen Raum, der Fragen des Zusammenlebens der Menschen an einem bestimmten Ort behandelt, 4 bestehen heute drei grundlegende Raumkonzepte, deren Eigenschaften sich teilweise überschneiden und durchdringen. Der physikalische Raum soll unabhängig von der Wahrnehmung des Menschen existieren, obwohl er natürlich auch ein Produkt seiner Vorstellungskraft ist. In ihm herrschen Naturgesetze, die nicht interpretiert, sondern nur erkannt werden können. Der physiologische Raum geht ausschließlich vom erkennenden Subjekt aus, das sich immer in dessen Zentrum befndet und in seinen Eigenschaften dessen wahrnehmenden und vorstellenden Bewusstsein unterliegt. Die Koordinaten des physiologischen Raums sind von seiner Mitte aus gedacht und mit den subjektiven Qualitäten links und rechts, oben und unten, nah und fern, sowie vorne und hinten aufgeladen. Der geometrische Raum ist dagegen eine reine Abstraktion, die ihre Wurzeln jedoch im physiologischen Raum hat. Er ist in alle Richtungen gleich beschaffen und unendlich. Die Koordinaten des geometrischen Raumes sind rein quantitativ und neutral. Sie defnieren nur die drei Raumdimension Länge, Breite und Höhe. Eine Gerade ist eine reine Abstraktion, weil sie per Defnition nur aus einer Dimension besteht. In der Welt meiner Vorstellungen, d.h. in dem Bild, dass ich mir von der Welt mache, kann es so etwas wie eine Gerade in ihrer ideellen Form nicht geben, denn jedes darin enthaltene Element existiert nur in einer räumlichen und zeitlichen Ausdehnung und ich nehme aufgrund meiner Erfahrungen an, dass es in der Natur ebenfalls so ist. Ich kann mir eine Gerade zwar als einen Strich auf einem Blatt Papier, oder als einen gespannten Faden vorstellen, aber nicht als eindimensionales geometrisches Element. Das es jedoch möglich ist, bereits mit wenigen Strichen eine räumliche Vorstellung auszulösen, zeigt wie sehr unsere Wahrnehmung darauf konditioniert ist Dinge im Raum zu erkennen. Es geht tatsächlich so weit, dass Raumwahrnehmungen kurzerhand impliziert werden, auch wenn de facto nur ein Blatt Papier mit ein paar Strichen vorliegt. Nur deshalb ergeben Abbildungen für uns überhaupt einen Sinn. Erstaunlich das dieser fundamentale Akt unseres Bewusstseins erst vor gerade einmal einhundert Jahren durch die Gestaltpsychologie defniert worden ist. Wir sehen den Raum nicht, wir sehen Dinge. Wir können Dinge darstellen, Räume könne wir jedoch nur vorstellen. 5 1. Visuelle Illusion, Gestaltpsychologie und erste Bilder Als ich mit dem Zeichnen begann, ganz ohne Anlass und Ausbildung, wie es wohl die meisten Zeichner am Anfang tun, hatte ich große Schwierigkeiten mit der Raumdarstellung. Der „weite Blick“ auf die Welt war für mich nicht ohne seltsame Verzeichnungen zu realisieren. Also beschäftigte ich mich mit der Theorie zu dem Thema, denn ich wusste dass es eine Methode gab, mit der ich meine Schwierigkeiten überwinden konnte. Ich lernte die Regeln der linearen Perspektive, die in einem einfachen Lehrbuch als das ultimative Instrument beschrieben wurde. Sobald ich die Regeln korrekt umgesetzt hatte, musste ich erkennen, dass ich zwar die seltsamen Verzeichnungen meiner ersten Versuche losgeworden war, dafür ergaben sich neue Schwierigkeiten in Form von Verzerrungen, die zum Rand meiner Zeichnungen immer unnatürlicher wurden. Dieser Effekt ergab sich zwangsläufg aus der strengen Umsetzung der linearen Perspektivlehre. Auch empfand ich die Tiefenwirkung, die eine Fluchtpunktkonstruktion erzeugt, als überspitzt und nicht im Geringsten als Abbild meiner Raumwahrnehmung. Es zeigte sich ausgerechnet bei den weitwinkligen Ansichten eine Bildanmutung, die ich als Tunnelblick bezeichnen würde. Noch heute ist es so, dass ich beim perspektivischen Zeichnen einen gewissen Widerstand überwinden muss, um die Theorie korrekt umsetzen zu können. Etwas im Bereich der Wahrnehmungspsychologie stäubt sich gegen die starre Form der linearen Perspektive. Mittlerweile beschäftigt mich das Thema seit über 30 Jahren und mir ist klar, dass dieser Widerstand damit zu tun hat, dass alle visuellen Medien zwangsläufg Tatsachen außer acht lassen müssen, die zwar Vorstellungen motivieren, die jedoch nichts mit Optik zu tun haben. Um zunächst nur ein Beispiel zu nennen, hier ein Kommentar von Voltaire: „Man beweist uns, dass der Sehwinkel in meinem Auge doppelt so weit ist, wenn ich einen Menschen aus einer Distanz von vier Fuß betrachte, als wenn ich den selben Menschen aus acht Fuß Entfernung sehe, und trotzdem sehe ich den Menschen immer als gleich groß; woher kommt es nur, dass mein Gefühl dem Mechanismus meines Sehorgans so widerspricht? ...“1 Der Begriff „Sehwinkel“ verweist auf das euklidische Winkelaxiom, das bezüglich der Lage und Größe eines Objektes im Raum zu Voltaires Zeiten offenbar immer noch allgemeiner Konsens war. Die Formulierung „Mechanismus meines Sehorgans“ entstammt wohl der so genannten Auge-Kamera Analogie.2 Die Aussage Voltaires, nach der die halbierte Distanz zu einem Objekt im Raum einen doppelt so großen Sehwinkel bedingt, ist jedoch falsch. Die Beziehung ist zwar umgekehrt, aber nicht im linear gleichen Verhältnis (siehe Abb.7). Dennoch erteilt Voltaire damit jeder Bemühung um eine korrekte Raumdarstellung mit Hilfe der geometrischen Optik eine Absage, denn der beschriebene Effekt ist in einem visuellen Medium kaum zu realisieren und zeigt die Grenzen der Darstellbarkeit unserer Raumwahrnehmung auf. Die vergleichsweise junge Wahrnehmungspsychologie fndet bis heute sehr viele derartige Beispiele, die zeigen wie rudimentär eine Abbildung ist, die ausschließlich auf der Grundlage einer Projektion hergestellt wird. Das beschriebene Phänomen wird mittlerweile als Wahrnehmungskonstanz bezeichnet. Diese Wahrnehmungskonstanz funktioniert allerdings auch im umgekehrten Sinne, was eine in diesem Zusammenhang sehr oft präsentierte Darstellung verdeutlicht. 6 Abb.1a Abb.1b Die Abbildung 1a setzt ein Objekt bekannter Größe in Beziehung zu einer räumlichen Anordnung, welche die Größenwahrnehmung der schwarzen Männer dominiert. Es hilft nicht, die Größen in der Abbildung zu messen, um diesen wahrnehmungspsychologischen Effekt zu überwinden. Auch mit dem Wissen darum, dass die schwarzen Männer gleich groß sind, wird man sie in dem vorgegebenen illusionistischen Raumzusammenhang als unterschiedlich groß wahrnehmen. Das gleiche Phänomen wirkt in der Ponzo-Täuschung3 (Abb.1b) und im Ames-Raum (siehe 2.Teil). Bezüglich der Wahrnehmungskonstanz handelt es sich um die andere Seite der gleichen Medaille. Aber irgendwo muss man anfangen, wenn man sich ein Bild machen will. Der kleinste gemeinsame Nenner im Verhältnis von Raum- und Bildbetrachtung ist unsere Fähigkeit zur visuellen Illusion anhand weniger visueller Informationen. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich diese Informationen auf einer Abbildung präsentieren, oder im Raum selbst enthalten sind, denn beides kulminiert letztlich auf der Oberfäche der Retina. Auf der Ebene der visuellen Projektion ist alles fächenhaft und erst unsere Refexion konstruiert aus diesen Informationen einen Raumeindruck. Das binokulare Sehen, das Sehen mit zwei Augen, ändert nichts an dieser Grundkonstellation, denn mit zwei Augen empfangen wir zwei Projektionen mit minimal unterschiedlicher Parallaxe. Beide Projektionen sind zweidimensional. Weiterhin wirkt das binokulare Sehen nur im Nahbereich vor den Augen. Ab einer Entfernung von ca. 7 Metern ist die Parallaxe der binokularen Projektionen so gering, dass das binokulare Sehen, also das vermeintlich räumliche Sehen, für die Beurteilung des Raumes keine Rolle mehr spielt.4 Im Zusammenhang mit der Beurteilung der Lage und Entfernung eines Objektes im Raum, der weit entfernt liegt, fndet Herman von Helmholtz die Defnition der „fächenartigen Anordnung der Objekte im Gesichtsfeld“5. Helmholtz merkt ausdrücklich an, dass weit entfernten Punkte, wie etwa die Sterne am Himmelsgewölbe, für uns „wie an einer Fläche“ erscheinen und nicht etwa „an oder auf einer Fläche“. Als Maler fasse ich diese Unterscheidung als Hinweis auf den Bildträger auf. Solange der Bildträger als Objekt präsent ist, sind die Dinge im „Bildraum“ niemals wie an einer Fläche, sondern immer auf einer Fläche. Die Beurteilung der räumlichen Tiefe und die Entfernung des Betrachters zu den Dingen im Raum geschieht aufgrund von Erfahrungswerten, die während der Raumbetrachtung meist unbewusst wirksam sind. Diese Erfahrungswerte werden auch in der Malerei eingesetzt, um Tiefenwirkung zu erzeugen: 7 1. Wenn die tatsächliche Größe der Dinge im Raum bekannt ist, fällt es leicht aufgrund ihrer „Erscheinungsgröße“ die Entfernung zu diesen Dingen abzuschätzen. Daher mag es banal klingen, wenn festgestellt wird, dass diese bekannten Dinge von nahem größer erscheinen, als von ferne betrachtet. Jedoch ist gerade diese einfache Wahrheit die Quelle unzähliger Irrtümer bei der Beurteilung der räumlichen Lage der Dinge, denn die Schätzung der Entfernung aufgrund zuvor gemachter Erfahrungen ist variabel und unpräzise. 2. Dinge, von nahem betrachtet, erscheinen uns detailreicher. Bei größerer Entfernung verliert das Bild an Prägnanz, was auf das Aufösungsvermögen des Auges zurück zu führen ist. 3. Auch erscheinen die Farben vorne kräftiger und klarer als in zunehmender Entfernung. Dieser Effekt entsteht durch die Dispersion des Lichts, das bei zunehmender Entfernung in der Atmosphäre stärker gestreut wird. 4. Die Farbpsychologie des Sehens ergänzt diese atmosphärische Perspektive indem kalte Farbtöne große Entfernungen suggerieren, während Farbtöne des warmen Spektrums näher am Betrachter zu sein scheinen. 5. Kompakte Dinge, die nicht transparent sind, verdecken Dinge, die sich dahinter befnden. Vom Standpunkt des sehenden Menschen breitet sich das Licht, das von den Dingen refektiert wird, gradlinig aus. Das verschachtelte Bild der Dinge informiert uns darüber, was vorne und was hinten ist. 6. Unsere Augen fxieren in schneller Abfolge Punkte im Raum. Dabei verändern die Kristalllinsen stetig ihre Form. Während sie bei der Fernsicht bikonvex sind, erhalten sie bei der Betrachtung eines Punktes im Nahbereich eine Gradiantenform. Hinzu kommt die Drehung der Augäpfel. Die Veränderung der Linsenform (das Akkomodieren) und die Fixierung eines Punktes mit beiden Augen bewirken, dass nur jeweils der anvisierte Bereich im Raum scharf und bewusst gesehen wird. Unschärfe im Gesichtsfeld wird aber nur dann wahrgenommen, wenn man besonders darauf achtet. Wenn man etwa einen entfernten Punkt anvisiert und dabei an seinem ausgestreckten Zeigefnger vorbei schaut, wird man den Finger unscharf sehen. Dies aber nur dann, wenn der Zeigefnger einigermaßen in der Blickrichtung liegt. Gewöhnlich haben wir beim Sehen nicht die Wahrnehmung von Unschärfe, da sich unser Raumeindruck aus sehr vielen nacheinander gewonnenen Eindrücken zusammen setzt. In jeder Abhandlung über den Gesichtssinn des Menschen wird darauf hingewiesen, dass wir das Bild auf unserer Retina nicht sehen. Interessanter Weise ändert sich daran selbst dann nichts, wenn wir Störungen in unserem Gesichtsfeld wahrnehmen, von denen wir wissen, dass sie in unserem Auge entstanden sein müssen. Wenn wir in eine Lichtquelle oder auch nur auf eine sehr helle Fläche schauen, entsteht ein Nachbild (Sukzessivkontrast), das den starken Lichtreiz genau abbildet. Jedoch befndet sich das so entstandene Bild unserer Wahrnehmung nach offenbar nicht in unserem Auge, sondern im Raum davor. Daran ändert sich auch nichts, wenn wir diese Wahrnehmung analytisch betrachten und dessen Ursache kennen. Weiterhin befndet sich das Nachbild an der Stelle im Gesichtsfeld, an der der starke Lichtreiz diese Gegenreaktion ausgelöst hat und nicht etwa an der invertierten Stelle, d.h. an der tatsächlichen projizierten Position auf der Retina.6 M.H. Pirenne folgert daraus, und aus anderen Phänomenen, einen Zusatz zu der üblichen Formel über die Unsichtbarkeit des Netzhautbildes: „We do not see our retina, nor our brain process“7 (Wir sehen weder unsere Retina, noch unser Denken) 8 Pirenne führt in diesem Zusammenhang weitere „interne Gesichtseffekte“ an, wie etwa Störungen im Glaskörper des Auges, die wir als „tanzende Mücken“ wahrnehmen und Lichtwahrnehmungen, die durch eine Migräne ausgelöst werden können. Die unvollständige Aufzählung genügt um eine grundsätzliche Feststellung zu machen: „What we see always appears to be external to our eyes“8 (Was wir sehen erscheint immer außerhalb unserer Augen) Was wir jedoch nicht sehen, obwohl es physiologische Tatsachen sind, wie etwa das invertierte Bild auf der Retina, der blinde Fleck und die spezifsche Anordnung der Rezeptoren im Auge, belegt letztendlich ebenfalls den massiven Anteil der Refexion an dem was vor unseren Augen erscheint. In diesen Fällen jedoch durch Umkehrung und Kompensation. All diese Erkenntnisse mögen zu der Auffassung geführt haben, dass aufgrund des fehlenden Bewusstseins von unserem Retinabild, dieses auch keinen Einfuss auf das Sehen hat. So wird von Helmholtz auch angezweifelt, ob die Form der Netzhaut irgendeinen Effekt auf das Sehen hat: „Die wirkliche Netzhaut hat eine ellipsoidische Form, und das Netzhautbild der äusseren Gegenstände auf ihr ist jedenfalls durch die Asymmetrien des brechenden Apparats mannigfaltig verzogen. Auch halte ich für mein Theil für wahrscheinlich, dass es ganz gleichgiltig für das Sehen ist, welche Gestalt, Form und Lage die wirkliche Netzhaut hat, welche Verzerrungen das Bild auf ihr erleidet, wenn es nur überall scharf ausgeprägt ist, und weder die Form der Netzhaut noch die des Bildes im Laufe der Zeit sich merklich verändert. Im natürlichen Bewusstsein des Sehenden existiert die Netzhaut gar nicht. Weder durch die Hilfsmittel der gewöhnlichen Empfndung, noch selbst durch wissenschaftliche Versuche sind wir im Stande, von den Dimensionen und der Lage und Form der Netzhaut des lebenden Auges irgend etwas anderes zu erfahren, ausser was wir an ihrem optischen Bilde, welches die Augenmedien nach aussen werfen, ermitteln können.“9 Die Aussage bezieht sich lediglich auf die Projektion des Lichts im Auge. Die Netzhaut hat ihre spezifsche Form aufgrund der runden Form des Augapfels, wodurch anatomisch die Möglichkeit gegeben ist, dass sich der Augapfel frei in der Augenhöhle bewegen kann. Helmholtz selbst beschreibt an anderer Stelle10, welche Folgen die Augenbewegungen für die Raumwahrnehmung haben. Zunächst halte ich jedoch fest, dass auch Helmholtz der Meinung ist, dass die Augen das Bild „nach außen werfen“ und sie erhalten sogar begriffich die Qualität eines Mediums! Ferner ist offenbar das Sehen ein Vorgang, in dem reichlich unbewusste Vorgänge enthalten sind, und dies bereits auf der Ebene der physiologischen Optik. Die Augen lediglich als Sensoren zu beschreiben, die Lichtsignale aufnehmen und in irgendwelche Signale umwandeln, sollte bereits bis hier hin als zu simpel erscheinen. Es wird sich zeigen, dass die funktionale Auffassung von dem Sinnesorgan Auge letztlich zu den geometrischen Defnitionen für den Sehvorgang geführt hat und ferner, dass das „optische Bild, welches die Augenmedien nach außen werfen“, die Grundlage für die Optik der Antike ist. Doch zunächst zurück zur visuellen Illusion. Wenn wir davon ausgehen können, dass der Gesichtssinn und das damit verbundene Refexionsvermögen bereits bei den Menschen des Paläolithikums in gleicher Weise vorhanden war, so war die Erfndung der Malerei in der Steinzeit gleich bedeutend mit der Entdeckung der visuellen Illusion. 9 Während die Steinzeitmenschen noch vor wenigen Jahrzehnten landläufg als Keule schwingende Grobiane dargestellt wurden, hat sich heute dass entgegen gesetzte Extrem etabliert. Mittlerweile gelten die Höhlenbewohner als Genies, die mit minimalen Mitteln in einer feindseligen Umgebung überlebten und dabei noch komplizierte astronomische Berechnung anstellen konnten. Ich glaube, sie haben schon vor 20.000 Jahren das gleiche getan, wie wir heute. Sie haben die Natur beobachtet und sich einen Reim darauf gemacht. In Bezug auf die Erfndung der Malerei der Steinzeit, über deren Bedeutung nur noch spekuliert werden kann, gibt es jedoch unter den wenigen erhaltenen und dokumentierten Artefakten einige konkrete Hinweise über deren Entwicklung. Marie E.P. König beschreibt in ihrem erhellenden Buch über den Anfang der Kultur eine Skulptur in der „Kopfhöhle“ im französischen Felsmassiv der Dame Jouanne: „Aus einer Wand heraus ragt frei schwebend ein gewaltiger Kopf, der etwa 2 Meter lang ist. Er besteht aus milchigem Quarz und ist deshalb heller als die Wände und besonders hart. Innen ist er hohl. Zwischen wulstigen „Lippen“ öffnet sich ein tiefer „Schlund“, man kann bis in den „Hals“ hineinsehen. Das Ganze ist ein Spiel der Natur, aber den Mensch erkannte die Ähnlichkeit mit einem Kopf und schlug ein entsprechendes Auge ein.“11 Das Beispiel zeigt besonders anschaulich, wie sich bereits im Paläolithikum ein Stein in der Vorstellung des Betrachters in etwas anderes verwandeln konnte. Davon ausgehend war es nur noch ein kleiner Schritt zur illusionistischen Wandmalerei. Auch ein besonderer Fleck an einer Felswand konnte sich dank der Fähigkeit, etwas anderes darin sehen zu können, in ein Tier verwandeln, wenn man z.B. nur ein paar Hörner dazu setzte. Dabei ist bemerkenswert, dass die Steinzeitmenschen offenbar nur Körper assoziierten, die in ihrer Welt eine höhere Bedeutung hatten. Ein Umstand den Gombrich als gelenkte Projektion bezeichnet12. Eine kulturell bedingte Erwartungshaltung erzeugt die Illusion. Wir kennen das Spiel. Wenn wir bei einem Strandspaziergang einen besonders geformten Stein aufheben, dann vielleicht weil er uns verblüffender Weise an ein Smartphone erinnert? Der fnale Akt bestand wohl darin, auf die Assoziationsquelle zu verzichten, diese quasi nicht mehr nötig zu haben und die Illusion selbsttätig aus der Erinnerung heraus durch Malerei und Zeichnung zu erzeugen. Auch wenn es vielleicht doch nicht so abgelaufen ist, so steht mit der Entwicklung der naturalistischen Höhlenmalerei erstmals ein zweidimensionales illusionistisches Abbild dem sehenden Menschen mit seinem vorstellenden Bewusstsein gegenüber. Die Projektion in diesem Vorgang verläuft, wie bei jedem Sehvorgang, in zwei entgegen gesetzten Richtungen. Zunächst als optisches Ereignis, dass von den Dingen im Raum ausgeht und als Lichtstrahlen durch das Auge empfangen wird. Weiterhin als geistige Projektion, die auf die Dinge im Raum gerichtet ist. Dabei können wir in der Regel gar nicht anders, als durch ein zweidimensionales Abbild hindurch zu sehen und einen Raum dahinter zu erblicken. Die Defnition zu diesem Thema nach der gestaltpsychlogischen Untersuchung von Rudolf Arnheim lautet: „ Ein Muster erscheint dreidimensional, wenn es als Projektion einer dreidimensionalen Situation gesehen werden kann, die strukturell einfacher ist als die zweidimensionale“13 Dazu möchte ich ergänzen, dass es eine Priorität in dem Verhältnis zwischen dem Dreidimensionalen und den Zweidimensionalen gibt. Der Gesichtssinn ist darauf konditioniert den Raum, bzw. räumlich ausgedehnte Dinge zu sehen. Erst wenn die elementaren Aspekte des Sehens gegen den Raum sprechen, sehen wir das Zweidimensionale. Dabei muss allerdings klar sein, dass es das Zweidimensionale in der physikalischen Welt gar nicht gibt. Wie oben festgestellt existiert die 10 Fläche nur als abstrakte Idee, dient aber kurioser Weise dazu, den Raum zu erkennen. Ich sehe in diesem elementaren Widerspruch die Grundbedingung für die Bildillusion. Die gestaltpsychologische Untersuchung von Arnheim stammt aus einer kunstgeschichtlichen Phase, in der ein Großangriff auf die Illusion im Bildmedium stattfand. Motiviert durch den Jahrtausende langen Missbrauch der Bilder für religiöse und politische Propaganda, wurde es zur Aufgabe alles aus dem Bild zu entfernen, was über dessen Grundelemente Form und Farbe hinaus ging. Es wurden Mittel und Wege gesucht, welche die imaginäre Verwandlung von Form und Farbe in Raum und Licht verhindern. Nach Arnheims Meinung ist dieser Versuch vergeblich. Sein Beleg dafür ist die späte Malerei Piet Mondrians, der alles aus seinen Bildern eliminiert hatte, was irgendwie auf die dingliche Welt hinweisen konnte. „Trotzdem blieb ein Rest der sichtbaren Welt, den er nicht überwinden konnte: die Unterscheidung zwischen den Objekten und dem sie umgebenden leeren Raum“.14 Es handelt sich dabei um das Figur-Grund Phänomen. Alle künstlerischen Positionen, die auf die Materialität der Bilder hinweisen, wie z.B. die geschlitzten Leinwände von Fontana, oder die Tropfbilder von Pollock, zerstören nicht die Bildillusion, sondern sie produzieren Gegenstände, die auch als solche gesehen werden. Elemente auf einer Fläche, die nicht zuerst als Gegenstände im leeren Raum gesehen werden, sind Zeichen, insbesondere Schriftzeichen. Sehen Sie Objekte im Raum während Sie diese Zeilen lesen? Im Übergang von der Altsteinzeit zur Jungsteinzeit fand eine Zäsur statt, die nicht nur die Sozialstruktur der Gesellschaft und die Art der Nahrungsbeschaffung betraf, sondern auch die Formensprache der künstlerischen Kommunikation. Über die Ursachen dieser Neolithischen Revolution des Bildes lässt sich genauso vergeblich spekulieren, wie über den Sinn der Höhlenbilder. Möglicherweise wurden zunehmend Überlegungen angestellt, die in einem naturalistischen Bild nicht transportiert werden konnten. Vielleicht war man auch der Ansicht, dass der vermeintliche Jagdzauber der Höhlenbilder versagt hatte und suchte deshalb nach einer neuen Magie. Wir wissen es nicht. Tatsache ist jedoch, dass die Symbole und Zeichen des Neolithikums nicht mehr nur durch direkte Anschauung mittels Illusion gelesen werden konnten, denn sie waren nicht naturalistisch. Sie forderten vom Betrachter eine Übersetzung, die zuvor erlernt werden musste. Diese Zeichen sind primär auf der Fläche und nicht im Illusionsraum. Es war allerdings nicht so, dass es zunächst nur die Wandmalerei der Altsteinzeit gab und dann nur noch die Symbolik der Jungsteinzeit. Auch in den bemalten Höhlen der Jäger und Sammler fnden sich Symbole und Zeichen. Wahrscheinlich müssen wir uns die Entwicklung hin zu Ackerbau und Viehzucht als fießenden Übergang vorstellen, der sich über Jahrtausende hinzog und nicht als Revolution. Eine detaillierte Darstellung dieses Prozesses würde mich allerdings zu weit von dem Thema dieser Arbeit weg führen. Ich begnüge mich daher mit der Feststellung, dass die Entwicklung der Perspektive kein kontinuierlicher Vorgang war. Im Verlauf der Kunstgeschichte gab es immer wieder Richtungsänderungen durch die bereits erreichte Fortschritte vergessen wurden und in der Folge neu erfunden werden mussten. So waren in den Höhlenbildern bereits Ansätze zur perspektivischen Darstellung enthalten, etwa durch Drehung von einzelnen Körperteilen oder durch Positionierung der Beine der dargestellten Tiere. Diese Tendenz zur Darstellung bewegter Wesen im Raum mit Aspekten von vorn und dahinter ging zunächst verloren. Ich kehre im Geiste zurück an das Zeichenbrett meiner Jugend an dem ich mir vornehme einen Tisch aus dem Gedächtnis zu zeichnen. Bei dem Vorhaben, immer noch ohne die Kenntnis der Perspektivlehre, ist das Ergebnis prompt verdächtig. Es ist dabei zwar eindeutig die Darstellung eines Tisches entstanden, denn die Zeichnung enthält ein Viereck mit vier Beinen an jeder Ecke, 11 was ohne weiteres die Assoziation eines Tisches ergibt, die Ansicht ist aber sehr aufsichtig, als wäre die Platte nach oben gekippt wie bei einem Schreibpult, und die Tischbeine hängen irgendwie schief im Raum. Die übertriebene Aufsicht entspringt möglicher Weise dem Umstand, dass ich einen Tisch meist von schräg oben sehe. Die Zeichnung bildet eher das ab, was ich über einen Tisch denke, als die geometrische Projektion des Objektes. Ohne den Filter eines Darstellungssystems wird die Diskrepanz zwischen der Vorstellung und dem optischen Abbild deutlich. Ein Tisch ist in meiner Vorstellung ein defniertes Objekt, das wesentlich aus einer rechteckigen Tischplatte besteht, die von vier Beinen in der Luft gehalten wird. Die Tischplatte nicht annähernd rechtwinklig zu zeichnen, sondern als Trapez, dass auf einen Fluchtpunkt ausgerichtet ist kommt mir nicht in den Sinn solange ich den Tisch aus meinem Gedächtnis abrufe und ihn nicht in einer konkreten Situation betrachte. „ Die Vorstellung eines räumlich ausgedehnten Körpers z.B. eines Tisches schließt ein eine Masse von einzelnen Beobachtungen. Es liegt darin einbegriffen eine ganze Reihe von Bildern, welche dieser Tisch mir gewähren würde, wenn ich ihn von verschiedenen Seiten und aus verschiedenen Entfernungen her betrachten würde, ferner die ganze Reihe von Tasteindrücken, welche ich erhalten würde, wenn ich meine Hände nach einander an die verschiedenen Stellen seiner Oberfäche legen würde.“15 Hermann von Helmholtz zeigt mit dieser Aussage, dass die gesammelten Erfahrungen zu einer bestimmten Sache dem Bild des „inneren Auges“ zugeordnet sind und nicht nur eine einzelne Projektion. Dieses Bild beinhaltet nicht nur die Raumanschauung ergänzt durch Wahrnehmungen der anderen Modalitäten. Es schließt ausdrücklich auch eine Zeitebene mit ein. Helmholtz schreibt weiter: „ Eine solche Vorstellung von einem einzelnen individuellen Körper ist also in der That schon ein Begriff, welcher eine unendliche Anzahl von einzelnen in der Zeit auf einander folgenden Anschauungen unter sich begreift, die alle aus ihm abgeleitet werden können, ebenso wie der Gattungsbegriff „Tisch“ wiederum alle einzelnen Tische in sich begreift, und deren gemeinsamen Eigenthümlichkeiten ausspricht.“16 Auch Gombrich verwendet unser Bild von einem Tisch als Beispiel, um die vielen Facetten von Anschauung und Vorstellung zu verdeutlichen17. Zunächst wird angemerkt, dass die Erkenntnisse der Wahrnehmungspsychologie zur Abkehr von der traditionellen Auffassung vor dem 20sten Jahrhundert geführt hat, nach der das Bild von den Dingen im Raum durch die Wahrnehmung farbiger Flecken, deren räumliche Dimension und Eigenschaften jedoch durch den Tastsinn vermittelt werden. Das Begreifen der Welt wurde wohl wortwörtlich genommen. Er weist dabei auf James J. Gibson18 hin, der diese Lehrmeinung radikal angezweifelt hat. Gibson sieht die Eigenbewegung des Sehenden und die damit sich ergebenden Veränderungen in der Raumanschauung als entscheidend für die Vorstellung vom Raum an, während ihm das Einzelbild, der Schnappschuss aus einer fxierten Position, eher als Kuriosum der Kultur gilt. Das der Einfuss der Eigenbewegung des Sehenden auf die Raumwahrnehmung schon im 19ten Jahrhundert erfasst worden ist, zeigt das Zitat von Helmholtz. Gibson will jedoch sagen, dass nicht nur unsere Vorstellung vom Raum im Allgemeinen durch die Eigenbewegung defniert ist, sondern dieses „Erfahrungsbild“ bestimmt auch die konkrete Anschauung, die wiederum durch Eigenbewegung bestätigt wird. Doch kommen wir wieder zu Tisch. Gombrich schreibt: 12 „Das gleiche (Begreifen eines Raumes durch Eigenbewegung) gilt für eine Tischplatte, die schon bei der geringsten Änderung unseres Standortes eine andere Form projiziert. Gibson hat gezeigt, dass diese Wandlungen die sich anhand der darstellenden Geometrie erklären lassen, dem Bewusstsein unweigerlich gestatten, seine echte oder, wie er es nennt, „invariante“ Form zu erschließen.“19 Gibsons invariante Form von einem Tisch ist womöglich das komische Ding, welches ich, der Perspektivlehre noch unkundig, zu Papier gebracht habe: ein Viereck mit vier Beinen dran. Diese Vorstellung wäre demnach unveränderlich (invariant). Die optische Projektion des Objektes ist es jedoch nicht. So gesehen kann man die Abkehr vom altsteinzeitlichen Naturalismus als Fortschritt auffassen. Indem Symbole zum Bildprogramm wurden, wurde quasi die Vorstellung auf den Begriff gebracht. Es wurde ein Zeichen dafür gefunden. Dieses Zeichen ist nicht willkürlich gewählt, sondern es ist aus der Wahrnehmung hervorgegangen. Es handelt sich dabei aber noch lange nicht um ein Schriftzeichen. Vielleicht eher um die Vorstufe zu einer Bilderschrift. Am Ende der jungsteinzeitlichen Phase, im Übergang zum Metallzeitalter, nahm das Bildprogramm wiederum eine neue Richtung. Wenn ich die beiden Darstellungen eines Wagens (Abb. 2 und 3) vergleiche, stelle ich wieder die Bemühung zur perspektivisch räumlichen Darstellung fest. Während in der Darstellung 2 die Räder des Wagens auf der Seite neben dem Wagen zu liegen scheinen und die Zugtiere ebenfalls, enthält 3 schon eine räumliche Anordnung. Die Deichsel des Wagens in 3 liegt über den Beinen des oberen Zugtieres. Die Räder scheinen nicht mehr neben dem Wagen zu liegen, sondern übereinander gesetzt, was eine Interpretation ist, die sich unwillkürlich aus dem Zusammenhang mit den anderen Teilen der Zeichnung ergibt. Abb.3 sieht nach dem Versuch aus, den Wagen von der Seite darzustellen, was natürlich nicht ganz gelungen ist. Trotzdem repräsentiert die Zeichnung die ersten Ansätze bei dem Versuch eine Staffelung der Dinge im Raum durch Überlagerung zu realisieren. Kompakte Dinge, die räumlich näher am Betrachter sind, überdecken die Dinge dahinter. Zwei weitere Beispiele (Abb.4 u. 5) zeigen den allmählichen Fortschritt in der Darstellung des gleichen Motivs. Ich erlaube mir hier, Darstellungen aus der Bronzezeit in Schweden und der archaischen Epoche in Griechenland zu vergleichen. Der Handel und der kulturelle Austausch in ganz Europa gelten für die Zeit mittlerweile als erwiesen. Demgegenüber berichtet Plinius die Auffassung, dass die Griechen die Malerei von den Ägyptern übernommen haben. Jedenfalls ergab sich zunächst nur im östlichen Mittelmeerraum jene Verfeinerung, die zur berühmten griechischen Hochkultur der klassischen Epoche führte. Ich sehe in der Bildfolge Abb. 2-6 den Beginn einer Entwicklung, die im Verlauf von mehreren tausend Jahren zu einem neuen Naturalismus führte. Ich möchte allerdings nicht behaupten, dass diese Entwicklung kontinuierlich in der Zeit voran ging. Insbesondere die ägyptische Kunst und die in Fragmenten erhaltene Wandmalerei der minoischen Kultur passen nicht in diese Zeitleiste. Die Malereien dieser Kulturkreise scheinen der griechischen Entwicklung zunächst voraus gewesen zu sein. Allerdings verschwand das Minoische Reich plötzlich und die ägyptische Kunst neigte zu einem Formalismus, der nur selten durchbrochen wurde, wie etwa während der Armana-Periode. 13 Abb. 2 und 3 Abb. 4 und 5 Abb. 6 14 Im Griechenland des vierten Jahrhunderts v. Chr. wird die illusionistische Nachahmung des Gesichtssinns zum Qualitätsmerkmal. Sehr bedauerlich, dass von den Tafelbildern der griechischen Antike nicht eines erhalten ist. Für deren Beurteilung bleiben uns nur noch die Rezeption der Römer, die diese Bilder noch gesehen und erbeutet haben, und die erhaltene Keramikmalerei der Griechen. Das Verhältnis zwischen der Tafelmalerei und der Keramikmalerei war wohl das der hohen Schule und der nach geordneten Gebrauchsgrafk20. Die Vasenmaler griffen neue Ideen und Methoden auf, die von den Tafelmalern zuvor erfunden wurden. Wenn das zutrifft, können wir heute auf den Vasen und Schalen der Keramikmaler eine Art visuelles Echo der damaligen Tafelmalerei sehen. Das 35ste Buch der Naturkunde des Plinius21 ist eine reichhaltige Quelle für die Malerei der Antike. So ist darin nicht nur die historische Entwicklung der griechischen Tafelmalerei anhand von Einzeldarstellungen bedeutender Maler enthalten, sondern auch deren Wirkung auf die römische Kultur. Für Plinius ist klar, dass die perfekte Illusion das höchste Ziel in der Malerei ist. Die Wertschätzung der Maler unterliegt jedenfalls primär diesem Kriterium. Um die Erfolge auf diesem Gebiet zu illustrieren enthält das Buch eine Reihe von Anekdoten, in denen Mensch und Tier auf die Bildillusion hereinfallen. Ein Wettstreit zwischen Parrhasios und Zeuxis sollte zeigen wer von beiden der bessere Maler sei. Zeuxis malte Trauben, worauf Vögel herbei fogen, weil sie die Früchte für echt hielten. Parrhasios stellte ein Bild mit einem Vorhang auf. Zeuxis, der sich schon für den Sieger hielt, verlangte dass der Vorhang weg geschoben werden sollte, damit er das Bild dahinter betrachten könne. Als ihm klar wurde, dass der Vorhang gemalt war, erklärte er seinen Kontrahenten zum Sieger. Zeuxis soll später einen Knaben mit Trauben gemalt haben, was wieder die Vögel auf den Plan rief. Plinius zitiert ihn dazu in wörtlicher Rede: „Die Trauben habe ich besser gemalt als den Knaben, denn hätte ich auch mit ihm Vollkommenes geschaffen, hätten sich die Vögel fürchten müssen.“22 Eine ähnliche Geschichte handelt von dem Maler Protogenes, der einen Satyr mit einem Rebhuhn auf einer Säule gemalt hatte, worauf sich zahme Rebhühner dazugesellten. Das als Andachtsbild für einen Tempel vorgesehene Bild galt dem Maler daraufhin als misslungen, da die Hauptsache zur Nebensache geworden war. Er bat darum, das besonders gut gelungene Rebhuhn aus dem Bild tilgen zu dürfen.23 Aus römischer Zeit stammt die Geschichte eines gewissen Lepidus, der in einer Herberge übernachtete und dort keinen Schlaf fand, weil die Vögel in der Nacht so laut sangen. Als er sich am nächsten Tag darüber beschwerte wurde ein langes Stück Pergament ausgelegt, auf das eine Schlange gemalt war. Darauf verstummten die Vögel aus Angst vor der Schlange.24 Die Beteiligung der Vögel scheint ein fester Bestandteil für Geschichten dieses Genres zu sein, mit denen der perfekte Realismus der Malereien gepriesen wurde. Wie viel davon erdichtet ist, soll jeder für sich entscheiden. Nach Plinius erfand der Maler Kimon aus Kleonai die Verkürzung (Katágrapha), die Schrägansicht insbesondere von Gesichtern, die rückwärts, aufwärts oder nach unten blicken.25 Womit offenbar nicht das Halbprofl eines Gesichtes gemeint ist. Apollodoros aus Athen malte als erster die „schöne Gestalt“, was als Hinweis auf die erste Licht- und Schattenmalerei gewertet wird.26 Zu Timanthes fndet sich die Aussage, dass man immer mehr zu erkennen glaubte, als gemalt worden ist.27 Womöglich ist das eine frühe Beschreibung für den Wahrnehmungseffekt, der mittlerweile durch die Gestaltpsychologie als „Gesetz der guten Fortsetzung“ defniert ist. In Bezug auf ein Abbild ergänzt der Betrachter in seiner Vorstellung Bildinhalte, die zwar durch das Vorhandene etabliert, aber im Bild nicht enthalten sind. Besonders die grafschen Künste proftieren von dieser Eigenschaft der Wahrnehmung. 15 Doch die Kunst der Griechen sollte auch noch über die Augentäuschung hinausgehen. Im Zusammenhang mit der Beschreibung der Arbeiten des Malers Protogenes denkt Plinius über die „Wahrheit“ in der Illusion nach.28 Protogenes mühte sich vergeblich ab, um den Schaum am Maul eines Hundes zu malen. Nach vielen Fehlversuchen gab er frustriert auf und tupfte die Farbe mit einem Schwamm ab. Das Ergebnis dieses Eingriffs war dann aber besonders überzeugend. Plinius folgert aus der Episode, dass in der Malerei „ ... das Wahre, nicht aber das der Wahrheit Ähnliche enthalten sein sollte.“ Soweit hatten es die Maler also schon gebracht. Die Täuschung des Auges allein genügte nicht mehr. Es sollte auch das Wahre darin enthalten sein. Aus heutiger Sicht müssen wir uns aber fragen wie illusionistisch, oder auch wahr, die Bilder hätten sein können. Plinius stellt klar, dass den Malern der klassischen Zeit nur vier Farben zur Verfügung standen: Weiß, Schwarz, Ocker und Rot. Jedenfalls nutzten sie nur diese vier. Ferner muss die Ansicht eines Bildes vor 2300 Jahren ein seltener Anblick gewesen sein und alles andere als alltäglich, wie etwa in unserer Zeit. Ein guter Teil der Begeisterung muss wohl mit dem unerwarteten Illusionseffekt zu tun gehabt haben. Die Überraschung scheint aber bereits in römischer Zeit verbraucht gewesen zu sein, was ein Kommentar von Quintilianus, einem Zeitgenossen von Plinius belegt: „ ... ihre schlichte Farbgebung fndet heute noch so ergebene Verehrer, dass sie die noch etwas primitiven Schöpfungen, gleichsam die Wurzeln der künftigen Kunstentwicklung, den größten späteren Meistern mit einer meines Erachtens ihnen allein vorbehaltenen Parteinahme vorzogen.“29 Die „noch etwas primitiven Schöpfungen“ der Griechen wurden von den Römern entscheidend weiter entwickelt. So fnden sich in den Ruinen vom Pompeji und Herkulaneum perspektivische Malereien, bei denen die Figuren in einem Raumzusammenhang dargestellt worden sind, bis hin zu gemalten Scheinarchitekturen. Die oft geäußerte Vermutung, dass einzelne Bilder genaue Kopien griechischer Originale waren, ist nicht mehr überprüfbar. Zur vermeintlichen Beherrschung der Perspektive in der griechischen Malerei schreibt Wilhelm Kraiker: „ Die perspektivische Verkürzung einzelner Glieder oder Körperteile ist auf den attischen Gefäßbildern schon seit dem Beginn des 5. Jahrhunderts zu beobachten. (...) Das führte in der Malerei zur Anwendung perspektivisch verkürzender Linien, zunächst nur an einzelnen Gliedmaßen oder in der Drehung des Rumpfes in seinen Gelenken. Die Anwendung perspektivischer Verkürzung an der Gestalt ist jedoch nichts anderes als ein neuer Ausdruck der für sich bestehenden Gegenstände in der Bildwelt, die als eine objektive Gestaltenwelt unabhängig vom Betrachter besteht und in dieser Kunst immer noch als solche gesehen wird. Der Betrachter kommt nur insofern in diese Bildwelt hinein, als die Körper nun nicht mehr dem Gesetz der Bildfäche unterworfen werden, sondern den Erfahrungen der Wahrnehmung.“30 Die große Innovation der klassischen Zeit in Griechenland war die Überwindung der grafschen Strenge der archaischen Zeit. Die Darstellungen wurden durch Verkürzungen, Drehungen und scheinbar eingefrorene Bewegungen der Körper lebendiger. Aber sie standen immer noch vor einer undefnierten leeren Fläche. Den Blick in den tiefen Raum gab es wahrscheinlich in der Malerei der Griechen noch nicht, jedenfalls soweit man es anhand der Gefäßmalerei sagen kann. Dennoch genügte die Neuerung, um für allgemeine Begeisterung und hohe Wertschätzung zu sorgen. 16 Es war aber wohl nicht jeder begeistert von der neuen Kunst. Das zeigt eine oft zitierte Textstelle bei Platon: „ Folgendes: eine und dieselbe Größe, in der Nähe und in Ferne durch das Gesicht wahrgenommen, erscheint uns wohl nicht gleich?“ „ Nein“ „ So erscheinen uns dieselben körperlichen Gegenstände krumm und gerade, je nachdem wir sie in oder außer dem Wasser schauen, ferner dieselben gezeichneten Gegenstände bekanntlich hohl und erhaben gleichfalls infolge einer bei den Farben statthabenden Täuschung des Gesichtssinnes, und so hat überhaupt eine jede sinnliche Verblendung der Art offenbar ihren Grund in unserer Seele: dieser schwache Teil unserer Natur ist es nun, auf den die Zeichen- und Malkunst, die Gauklerkunst und die vielen übrigen Taschenspielereien ähnlicher Art es anlegen und kein Blendmittel unversucht lassen.“ „ Ja, richtig“ „ Erscheinen nun nicht das Messen, Rechnen und Wägen gegen jene Sinnestäuschung als die geeignetsten Hilfsmittel (...) ?“ (...) „ Das war es also, was ich vorhin als Behauptung feststellte und durch Erörterung mit dir zur evidenten Wahrheit bringen wollte, dass nämlich die Malerei und überhaupt die mit Nachahmung sich abgebende Kunst nicht nur weit von der Wahrheit entfernt ihr Wesen treibt, sondern auch nur mit einem gleichfalls von höherer Geistestätigkeit entfernten Vermögen in uns Verkehr hat, mit ihm buhlt und liebelt zu einem Endzwecke, der durchaus kein solider, kein wahrer ist.“31 Als naturalistischer Maler habe ich für so eine Meinung selbstverständlich gar nichts übrig. Aber sei es drum: Ich verzichte auf eine Widerlegung, da die Aussage offenbar kein seriöser Beitrag zur Optik und Wahrnehmungstheorie ist, sondern in erster Linie einen moralischen Hintergrund hat. Es bleibt festzuhalten, dass Platon „das Messen, Rechnen und Wägen“ als Quelle der Erkenntnis favorisierte und der sinnlichen Wahrnehmung misstraute, sie sogar als niedere und schwache Geistestätigkeit ansah. Für Platon war das rein Geistige die Wahrheit, die von jeder durch die Körperlichkeit bedingte Reaktion frei gemacht werden musste. Die Wahrheit ist jedoch nur durch naturwissenschaftliche Analyse zu erfassen. Platon hatte wohl übersehen, dass auch diese Analyse durch die sinnliche Wahrnehmung hindurch muss und deren Konditionierung unterliegt. Wie dem auch sei. Der Wettbewerb der Maler im antiken Griechenland legte den Grundstein für die theoretische Auseinandersetzung mit dem Sehen. Plinius berichtet an mehreren Stellen von Texten zur Malerei, die von den Malern selbst stammen. So soll es ein Lehrbuch über Perspektive von Apollodoros aus Athen gegeben haben, das aber leider verloren gegangen ist. Pamphilos wird vorgestellt als der erste „Maler von umfassender Bildung in der Arithmetik und Geometrie, ohne die, wie er behauptete, die Kunst nicht zur Vollendung gebracht werden könne.“32 Besonders die Geometrie war das Allzweckmittel der alten Griechen, wenn es darum ging die Welt zu erklären. 17 2. Entwicklung der linearen Perspektive aus der euklidischen Optik Mit dem besonderen Interesse der griechischen Maler für das Abbild der Natur und der Verbindung der Kunst mit Arithmetik und Geometrie war der Boden bereitet für die Optik des Euklid.33 Diese mit Abstand nachhaltigste Theorie des Altertums über den Gesichtssinn ist aufgeteilt in 8 Erfahrungssätze und 61 Theoreme. Daran anschließend folgt die Katoptik, die sich mit der Refexion von Lichtstrahlen auseinander setzt, aufgeteilt in 7 Erfahrungssätze und 31 Theoreme. Der erste Erfahrungssatz lautet: Die aus den Augen kommenden Strahlen gehen in geraden Linien fort und haben eine gewisse Entfernung voneinander. Die Auffassung von diesen „Sehstrahlen“ war vermutlich zu Euklids Zeiten selbstverständlich. Ich nehme an, dass die Quelle dieser Vorstellung in der oben beschriebenen Eigenschaft des Sehens liegt, nach der alles was der Gesichtssinn wahrnimmt vor unseren Augen steht. Das Sehen wird erklärt als eine Art Ortungssystem mit dem die Augen die Welt mit Hilfe eines eigenständigen Mediums quasi „abtasten“. Die Augen senden etwas aus und empfangen das Echo dieser Sendung, was als Zentrifugaltheorie bezeichnet wird. Aristoteles stellt es allerdings anders dar: „ Eine Schwierigkeit liegt in der Frage, warum es keine Empfndung der Sinne selbst gibt und warum diese ohne die Außenwelt keine Empfndung bewirken, ... „ (und an späterer Stelle über den Gesichtssinn) „ Gegenstand des Gesichtssinns ist das Sichtbare. Sichtbar ist nun einmal die Farbe (...) jede Farbe eines Dings sieht man nur bei Licht.“34 In dem Text über die sinnliche Wahrnehmung kommen die Sehstrahlen nicht vor. Dafür trifft Aristoteles den Kern der Sache. Er erklärt, Sehen bedeutet, dass wir Licht wahrnehmen. Es ist die Grundlegung der Zentripetaltheorie, die unsere Sinne als Empfänger defniert. So einfach ist es jedoch nicht, denn wie oben beschrieben, fndet beim Sehen in der Tat eine Projektion statt. Es ist aber keine materielle Projektion mit Hilfe irgendwelcher Strahlen. Sehen ist eine geistige Projektion, resultierend aus Gegebenheiten der Lichtempfndung, sowie der Erfahrung und Refexion. Aristoteles behandelt jedes Phänomen zunächst empirisch. Die bekannte Schwäche dieser Methode liegt in der Unmöglichkeit, daraus das abstrakte Denken zu erklären. Aristoteles defniert lediglich die aktuelle Empfndung, dessen Inhalt das Besondere ist und die denkende Betrachtung deren Inhalt das Allgemeine ist, was eine Trennung zwischen Geist und Sinnlichkeit bedingt. Jedoch besteht für Aristoteles diese Trennung nur in Bezug auf die Grundeigenschaft der Inhalte, während Platon an dieser Stelle eine moralische Wertung vornimmt. Euklids zweiter Erfahrungssatz lautet: Die von den Strahlen eingeschlossene Figur ist ein Kegel, der seinen Scheitel im Auge, und seine Grundfäche auf der Grenze der sichtbaren Gegenstände hat. Zunächst verbinde ich die Erfahrungssätze 1 und 2 und stelle mir vor, dass wir nach Euklid die Welt wie mit einer Taschenlampe ableuchten. Darauf baut der dritte Erfahrungssatz auf, der erklärt, dass nur diejenigen Dinge sichtbar sind, zu denen die Strahlen des Auges gelangen. Eine Konsequenz daraus ist das Theorem 1: Kein sichtbarer Gegenstand wird zugleich ganz gesehen. Die Nachhaltigkeit der euklidischen Optik beruht wesentlich darauf, dass die Sehstrahlen gradlinig sind, genau wie Lichtstrahlen. Dinge die unsichtbar sind, weil die geradlinigen Sehstrahlen nicht zu ihnen gelangen, sind ebenfalls unsichtbar, wenn die Lichtstrahlen, die von diesen Gegenständen refektiert werden, nicht zum Auge gelangen können, weil sich irgendetwas dazwischen befndet. Wir können nicht um die Ecke sehen, weil sich Lichtstrahlen gradlinig ausbreiten35. Das Prinzip ist also umkehrbar. Als Grundlage der geometrischen Optik sind jedoch die beiden ersten 18 Erfahrungssätze der Katoptik zu sehen. Der erste Satz lautet: Der Lichtstrahl ist eine gerade Linie, deren Endpunkte alle dazwischen liegenden Punkte decken. Und der zweite Satz: Jeder sichtbare Gegenstand wird in gerader Richtung gesehen. Die Defnition des Lichtstrahls gleich zu Euklids Defnition einer geraden Linie im ersten Buch der Elemente. Alle weiteren Erfahrungssätze der Katoptik befassen sich mit der Refexion von Lichtstrahlen an spiegelnden Oberfächen. Der vierte Erfahrungssatz bildet das berühmt berüchtigte Winkelaxiom: Diejenigen Gegenstände, die unter einem großen Winkel gesehen werden, erscheinen größer; die aber unter einem kleineren Winkel gesehen werden, kleiner. Und Nr.5: Gegenstände, die unter gleichen Winkeln gesehen werden erscheinen gleich groß. Diese Defnitionen stehen in direkter Verbindung zum Theorem 8, das besagt: Gleiche Größen, die ungleich vom Auge entfernt sind, werden nicht ihren Entfernungen proportional gesehen. Ich erinnere an die eingangs gegebenen Erklärungen zur Wahrnehmungskonstanz. Die Größe und Lage der Objekte im Raum einzig durch den Sehwinkel zu defnieren entsprach dem naturwissenschaftlichen Denken der Antike. Die Natur musste unbedingt auf eine einfache überprüfbare Formel gebracht werden. Wenn diese mathematische Darstellung dann doch keine Konstante in der Natur offenbarte, konnte das offenbar den Glauben der Griechen an die mathematische Strukturiertheit der Welt nicht erschüttern. Emil Wilde erklärt zu Theorem 8: „ Euklides zeigt, ohne die Hilfe der Trigonometrie zu kennen, in einem weitläufgen geometrischen Beweise, dass das Verhältnis der größeren und kleineren Entfernungen ein anderes sei, als das Verhältnis der größeren und kleineren Sehwinkel.“36 Auf der Grundlage der Trigonometrie gibt es selbstverständlich eine defnierte Beziehungen zwischen den Winkeln und den Seiten eines Dreiecks (die bekannten Winkelfunktionen Sinus, Kosinus, Tangens und Kotangens) Vergrößern oder verkleinern sich die Winkel und Seiten in einem Dreieck, bleiben deren Beziehungen zueinander immer gleich. Es kann nur nicht in zwei unterschiedlichen Dreiecken von den Größen des einen, auf die Größen des anderen geschlossen werden. Dies ist nur möglich, wenn die beiden Dreiecke proportional ähnlich sind37. Erwin Panofsky, der sich knapp hundert Jahre nach Wilde der Sache angenommen hatte38, konstruierte daraus jedoch einen Gegensatz zwischen planperspektivischer und winkelperspektivischer Auffassung. Demnach verhalten sich die „Sehgrößen“ in der planperspektivischen Konstruktion umgekehrt proportional zu den Entfernungen (d.h. große Entfernung= kleine Sehgröße), bei der winkelperspektivischen Auffassung verhalten sich diese Sehgrößen nicht umgekehrt proportional zu den Entfernungen (d.h. kleiner Sehwinkel= kleine Sehgröße). 19 Abb.7 (Winkel1&2 sind die beiden Sehwinkel, AB und CD sind gleich groß, CD ist halb so weit vom Augenpunkt O entfernt wie AB, Winkel1 ist nicht halb so groß wie Winkel2. Wenn die Entfernung größer wird, wird der Sehwinkel kleiner und damit auch die „Sehgröße“. Eine Verdopplung der Entfernung ergibt keine Halbierung des Winkels, wie bereits Euklid festgestellt hat (s.o.). Aber eine Verdopplung der Entfernung ergibt eine Halbierung der „Sehgröße“, d.h. die Projektion von AB halbiert CD.) Panofsky führt das Theorem 8 als einen Beleg für seine Kernthese von der sphärischen Gesichtswahrnehmung der antiken Welt an. Er behauptet, dass die Menschen der Antike den Raum anders wahrgenommen haben, als in der Zeit nach dem 15ten Jh., was er auf die Erfndung der linearen Perspektive und die veränderte Vorstellung vom Raum an sich zurückführt. Eine These, die sich bis heute offensichtlich nicht durchgesetzt hat, in der Kunstwissenschaft aber nach wie vor kontrovers diskutiert wird. Sein Beweis bezüglich Theorem 8 drückt lediglich eine mathematische Verhältnismäßigkeit aus, die weder in der Raumwahrnehmung, noch in der Bildbetrachtung eine Rolle spielt, denn ein Sehwinkel ist uns genauso wenig bewusst, wie das Abbild auf unserer Retina. Wenn wir die Sehwinkel in eine geometrische Perspektive umsetzen würden, indem der Punkt O den Augenpunkt (Origo: griech., der Ursprung) bildet, würden wir von der Linie OA und OB nur jeweils einen Punkt sehen. Diese beiden Punkte verraten uns nichts über die Größe des Sehwinkels. In der Trigonometrie bildet die Verbindung der beiden Punkte die Gegenkathete. Um die Größe des Winkels 1 bestimmen zu können, muss zumindest eine der beiden anderen Seiten des Dreiecks bekannt sein. Panofsky behauptet, dass das Winkelaxiom in der Konstruktion der Zentralperspektive nicht berücksichtigt wurde. Er sieht in dieser Auslassung einen weiteren Beleg für seinen behaupteten Wandel vom antiken Raumbild zur modernen und in seinem Sinne abstrakten Auffassung vom Raum. Genau genommen ist das nicht korrekt. Alberti erwähnt ausdrücklich, dass man beim Sehen „ein Dreieck“ bildet. Dies fndet Verwendung in der Setzung des Distanzpunktes in der zentralperspektivischen Konstruktion (siehe Abb10.), der allerdings nicht die Sehgröße der Dinge im Raum defniert, sondern die Entfernung des Betrachters zum Bild, um damit die im Bild enthaltene perspektivische Verkürzung zu realisieren. Es ist jedoch eher die subjektiv geschätzte Entfernung zu den Dingen im Raum, welche die Wahrnehmung von deren Größe beeinfusst, ergänzt durch weitere Seherfahrungen (s.o.). Der Umstand der nicht vorhandenen Proportionalität der Sehwinkel, wie auch die umgekehrte Propor- 20 tionalität zwischen Sehgrößen und Entfernungen kann also dabei auch keinen Unterscheid machen. Es hat mit dem Sehen schlicht und ergreifend nichts zu tun, sondern nur mit den abstrakten Projektionsgesetzen und den Winkelfunktionen im Dreieck. Ich kann Panofskys Sehwinkeltheorie als Beleg für das sphäroidische Gesichtsfeld nicht akzeptieren. Ich bin lediglich einverstanden, wenn Panofsky die lineare Perspektive (von ihm Planperspektive genannt) als grundsätzlich abstrahierend vom „psychologischen Raum“ beschreibt. Das hat für mich allerdings nichts mit dem Winkelaxiom zu tun. Für mich ist die erstaunlichste Leistung dieser abstrakten linearen Perspektive in der Tatsache zu sehen, dass sie in Teilen der visuellen Wahrnehmung entspricht, obwohl sie eine rein geometrische Konstruktion ist. Theorem 6 und dessen Weiterführung in Theorem 10-14 ist wesendlich fruchtbarer für Panofskys These. Nr.6 lautet: Parallele Linien aus der Ferne betrachtet scheinen nicht dieselbe Entfernung von einander zu behalten. Aus dem geometrischen „Beweis“ geht hervor, dass es bei dieser Aussage nicht um die Konvergenz von parallelen Linien geht, die vom Betrachter aus auf den Horizont zu laufen, also nicht um „Fluchtlinien“. Euklid betrachtet parallele Linien horizontal, auf Augenhöhe und auch darüber und darunter. Theorem 6 beschreibt die Kurvatur des Gesichtsfeldes. Diese Wahrnehmung wurde in der antiken Architektur umgesetzt, wie sich heute noch an den griechischen Tempelbauten nachweisen lässt. Während die Kurvatur die Krümmung gerader Linien in der Horizontalen beschreibt, bezieht sich die so genannte Entasis auf die Vertikale. Die vertikale Krümmung wurde an den Säulen des griechischen Tempels umgesetzt. Für mich ist jedoch fraglich, warum für Euklid diese Wahrnehmung nur aus der Ferne betrachtet gilt. Sie gilt ganz besonders auch für den Nahbereich. Die lineare Perspektive lässt diese Umstände jedoch grundsätzlich außer acht und legt fest, dass alle geraden Linien in der Natur auch auf dem fachen Bildträger gerade wieder gegeben werden. Dies ist tatsächlich eine Abstraktion vom „psychologischen Raum“. Die Konstante in den euklidischen Theoremen zur Optik ist der Versuch, für die Gesichtswahrnehmung und die Lichtausbreitung mathematisch überprüfbare Beweise zu defnieren. Dieser Ansatz führte zu den in der klassischen Physik gebräuchlichen Begriffen von der geometrischen Optik und dem euklidischen Raum, die heute aber eher der Mathematik zugeordnet werden. Diese Themenfelder bilden jedoch nicht vollkommen getrennte, oder gar gegensätzlichen Gebiete zur physiologischen Optik und zum nichteuklidischen Raum. Beide Themenfelder haben eine relativ große Schnittmenge. Beiden gemeinsam ist jedoch, dass sie weltanschauliche Fragen nicht behandeln. Es sind Naturwissenschaften, deren Sätze überprüfbar und allgemeingültig sein müssen. Wenn die Optik jedoch auf die Herstellung von Abbildern oder auch nicht abbildenden Bildern bezogen wird, ist darin fast zwangsläufg irgendein Aspekt der Weltanschauung des Bildautors enthalten. Dabei ist es nicht entscheidend, ob dies eine bewusst eingesetzte Haltung ist, oder ob von den Künstlern nur der allgemeine Konsens, der Zeitgeist oder die Mode der jeweiligen Epoche umgesetzt wird. Es ist leicht nachvollziehbar, dass ein verändertes Denken über Raum und Zeit nachhaltigen Einfuss auf deren Darstellung hat. Ob dabei auch die Wahrnehmung des Raumes verändert wird, wie Panofsky behauptet, wird in den Kunstwissenschaften kritisch gesehen. Besonders Gombrich erinnert uns daran, dass die Betrachtung einer Abbildung nicht mit dem Bild von der Wirklichkeit vergleichbar ist: „Wir dürfen nie vergessen, dass es hier um zwei Fragen geht: um die Frage, wie wir die Welt sehen, aber auch um die Frage, wie wir ein Bild wahrnehmen. Gerade die Nichtbeachtung der zweiten Frage führte zu der Konfusion in Bezug auf die Krümmung und die Notwendigkeit den gleichen Blickpunkt zu wahren. Wir dürfen sie auch nicht außer acht las- 21 sen, wenn wir von der scheinbaren Größe von Dingen auf einem perspektivischen Bild sprechen.“39 Das wird besonders deutlich, wenn wir Abbildungssysteme betrachten, die sich ausdrücklich gegen eine naturalistische Darstellung wenden. Zwischen der Optik der Antike und der Erfndung der linearen Perspektive liegen 1700 Jahre Kulturgeschichte. In dieser Zeit hat es nicht nur sehr unterschiedliche Lösungen für die Raumdarstellung gegeben, sondern auch radikale Angriffe auf grundsätzlich jede bildliche Darstellung. Wie bei Platon lagen diesen Extremen moralische Überzeugungen zu Grunde, die nun aber den Auslegungen der monotheistischen Religionen entnommen wurden. Die Erklärung des Christentums zur Staatsreligion markiert den Untergang des Römischen Reiches und damit auch das Ende der römischen Kunst, die unter anderem die griechische Malerei weiter entwickelt hatte indem die Raumtiefe durch konvergierende Fluchtlinien dem Abbild hinzugefügt wurde. Die darauf folgenden dunklen Jahrhunderte waren nicht nur politisch, sondern auch künstlerisch grob und fächenhaft. Nur langsam und allmählich wurde in der europäischen Malerei der Faden wieder aufgenommen. Die einzelnen Schritte auf diesem Weg werden allerdings in der Rezeption meist unter der Prämisse eines Unvermögens und mangelnden Wissens über die noch nicht formulierten Regeln der Perspektivlehre betrachtet. So werden die Ergebnisse der mittelalterlichen Malerei eingeordnet unter der Frage, ob sie einen Entwicklungsschritt hin zur linearen Perspektive beinhalten, oder nicht. Es werden Raumdarstellungen des Mittelalters als Parallelperspektive bezeichnet, was aufgrund der heutigen Zuordnung missverständlich ist. Unter Parallelperspektive, auch Isometrie genannt, verstehen wir heute eine technische Zeichnung, welche die räumliche Ausdehnung eines Werkstücks auf dem Papier nachmessbar verdeutlicht, dass z.B. in einer Metall- oder Holzwerkstatt hergestellt werden soll.40 Ein weiterer Kunstgriff ist die Bedeutungsperspektive, bei der nicht die realistische Größe der Körper im Raum entscheidend für deren Abbildung war, sondern deren religiöse Bedeutung oder politische Macht. Dieses Darstellungssystem resultierte auf jeden Fall nicht aus dem ungenügenden Wissen über die Lage und Größe der Dinge im Raum. Das Bild wird als freie Fläche und als Zeichenträger aufgefasst. Besonders in den Ländern nördlich der Alpen entwickelte sich eine Methode, die bereits konvergierende Konstruktionen enthielt, die aber nicht konsequent auf einen Fluchtpunkt ausgerichtet waren. Die Ausrichtung erfolgte auf Bildachsen, von denen es meist mehrere in einem Bild gab. Panofsky bezeichnet die Methode als Aggregatraum, den er dem Systemraum der linearen Perspektive gegenüber stellt. Ein viertes Prinzip ist die so genannte divergente Perspektive. Linien, die in den tiefen Raum weisen und in der linearen Perspektive in einem Fluchtpunkt konvergieren würden, laufen in der divergenten Perspektive auseinander. Körperteile und Flächen, die von einem fxierten Blickpunkt aus nicht sichtbar sind, werden trotzdem abgebildet. Pawel Florenski widerspricht ausdrücklich der Auffassung, diesem System läge eine ungenügende Beherrschung des euklidischen Raums zugrunde: „Die genannten Verfahren werden allgemein als umgekehrte oder verkehrte Perspektive bezeichnet, gelegentlich auch als verdrehte oder falsche Perspektive. Die umgekehrte Perspektive erschöpft sich jedoch weder in den vielfältigen Besonderheiten der Zeichnung noch im Helldunkel der Ikonen. Als direkte Auswirkung der Verfahren der umgekehrten Perspektive ist die Heterozentrik in der Darstellung hervorzuheben: Die Zeichnung ist so 22 konstruiert, als würde das Auge seinen Ort wechseln, wenn es ihre verschiedenen Teile betrachtet. Da werden beispielsweise bestimmte Teile von Gebäuden mehr oder weniger entsprechend den Erfordernissen der gewöhnlichen Linearperspektive gezeichnet, doch jeweils aus einem besonderen Blickwinkel, d.h. mit einem jeweils eigenen Perspektivzentrum; gelegentlich sogar mit einem eigenen Horizont, während andere Teile darüber hinaus unter Anwendung der umgekehrten Perspektive dargestellt werden. (...)41 Florenski, der sich explizit auf die Ikonenmalerei des christlich orthodoxen Kulturkreises bezieht, erklärt damit die vermeintlich divergente Perspektive zu einem System der mehrfachen Blickund Zeitpunkte. Die Darstellung beinhaltet eine Zeitspanne, die durch den Positionswechsel des Betrachters defniert ist. Mit Hilfe der divergenten Perspektive ist es plötzlich doch möglich um die Ecke zu schauen! Das lässt mich unwillkürlich an den Kubismus des 20sten Jh. denken. Diese Stilrichtung hat mit der divergenten Perspektive gemeinsam, dass ihr Name von deren oberfächlichen Erscheinung abgeleitet ist, was bei deren Beurteilung zu Irrtümern führt.42 Allerdings würde man den Vertretern des Kubismus nicht vorwerfen, dass Sie die perspektivischen Regeln nicht beherrschen. Es wird ihnen als Verdienst zugeschrieben, diese überwunden zu haben, indem sie das monofokale Prinzip der Linearperspektive aus ihren Bildern verbannten. Nach Florenskis Meinung bestand das Qualitätsmerkmal einer Ikonenmalerei darin, wie eindeutig der Maler sich über die Regeln der monofokalen Ansicht, und damit über die euklidische Optik, hinweggesetzt hatte. Wenn das Ergebnis nach einer Annäherung an den euklidischen Raum aussah, galt es als nicht gelungen. Mit Florenski halte ich es für unglaubwürdig, dass die Ikonenmaler die Diskrepanz zwischen ihren Bildräumen und ihrem Gesichtssinn nicht gesehen haben. Wie bei den Kubisten sollten wir von einem absichtsvoll gesetzten Kunstgriff ausgehen. Doch was dem einen sein Credo ist dem anderen ein Übel. Vasari nennt den Maler Giotto als einen der ersten, der „die unbeholfene griechische Manier“ ganz überwand.43 Mit der unbeholfenen griechischen Manier ist der oben beschriebene byzantinische Ikonenstil gemeint, der die Malerei des europäischen Mittelalters dominierte. Dem gegenüber stand für Vasari die „richtige, gute Malkunst“, die Giotto wieder zum Leben erweckte. Auch im Zusammenhang mit Masaccio wiederholt er die Schmähung gegen die „rohe und plumpe Manier“44. Das Zeichnen nach der Natur wurde wieder geübt und die erklärte Aufgabenstellung war wieder, die Welt so darzustellen, wie das Auge sie sieht. Dieser Bruch markiert den Beginn der italienischen Renaissance. Der allgemeine Wandel der damit eingeleitet wurde, betraf die ganze Gesellschaftsordnung. Die Wirkung blieb nicht auf Italien beschränkt, sondern weitete sich auf ganz Europa aus, und durch das spätere Zeitalter der Entdeckungen letztlich weltweit. Zeitlich bestimmt die italienische Renaissance das kulturelle Leben bis heute. Dem Thema folgend werde ich mich hier auf die Neuerung im Bereich der Raumdarstellung und deren Ungereimtheiten beschränken müssen. Auch wenn dies nur ein kleiner Ausschnitt der Entwicklung ist, so ist darin doch der ganze Umfang des Paradigmenwechsels enthalten. Ich bin der Auffassung, dass die philosophische Grundbedingung für die Erfndung einer Zentralperspektive, die aus einem defnierten Blickpunkt heraus konstruiert wird, ein emanzipiertes Individuum ist. Ein Mensch, der sich in jedem Fall als nicht selbstbestimmt begreift, sondern als ein Wesen in Gottes Hand, konnte wahrscheinlich keinen souveränen Standpunkt zur Welt entwickeln. Individualität oder gar Selbstverwirklichung hätte für die Menschen des Mittelalters gar keinen Sinn ergeben, denn ihr Denken und Handeln war auf die Unsterblichkeit der Seele gerichtet. Dem prüfenden Auge des Herrn konnten sie sich unter keinen Umständen entziehen. Es bedurfte Jahrhun- 23 derte des Missbrauchs durch die weltliche Macht und den Klerus, um diese im wahrsten Sinne blinde Ergebenheit und die geistige Grundhaltung der Menschen zu erschüttern. Abb. 8 (oben) Trinitätsikone von Andrej Rubljow, als Beispiel für die divergente Perspektive. Abb. 9 (rechts) Dreifaltigkeitsfresko von Masaccio. Vermeintlich erste zentralperspektivische Konstruktion. Die vorherrschende Geisteshaltung des Mittelalters bestand in der Lehre von den Universalien, die besagt, dass nur die Ideen real sind und nicht die konkreten Sachen von denen sie handeln. Nicht die Kathedrale ist real, sondern die allgemeine Idee vom Haus des Herrn. Egon Friedell beschreibt die Menschen des Mittelalters in ihrer geistigen Verfassung als begabte Kinder. Sie waren zwar analytische Denker, aber auch gutgläubig und naiv.45 Das einschneidende Ereignis, das diese durch Platons Idealismus inspirierte Negation der Natur erstmals ins Wanken brachte, war nach Friedell nicht der Universalienstreit, sondern das Jahr 1348, das den schwarzen Tod brachte. Der Universalienstreit handelte lediglich von der präzisen Defnition der Universalienlehre, stellte aber deren Grundsatz nicht in Frage. „ ... das Reale sind die Universalien. Wirklich ist nicht das Individuum, sondern der Stand, dem er angehört. Wirklich ist nicht der einzelne Priester, sondern die katholische Kirche, deren Gnadengaben er spendet: wer er ist, bleibt ganz gleichgültig, er kann ein Prasser, ein 24 Lügner, ein Wüstling sein, das beeinträchtigt nicht die Heiligkeit seines Amtes, denn er ist ja nicht wirklich.“46 Erste Widersprüche zu dieser Auffassung wurden nicht konsequent zu Ende gedacht. So stellt Wilhelm von Ockham47 zunächst klar, dass das Allgemeine nicht in den Dingen, sondern nur im menschlichen Geist existiert. Aus der Erkenntnis mit Hilfe allgemeiner Begriffe folgt jedoch nicht, dass das Allgemeine real ist. Das hätte die Grundlage für eine neue Naturwissenschaft werden können, doch Ockham ersetzt die allgemeinen Begriffe von den Naturdingen und deren Vorstellungen nur durch Zeichen.48 Es handelt sich aber bereits um eine Annäherung an den Satz von Aristoteles über das Allgemeine und das Besondere. Nach der „unendlichen Flut von Unheil“ (Vasari) erhob sich das Individuum gegen die alte Weltordnung. Das heißt zwar nicht, dass die Menschen der Renaissance gottlos geworden waren, es bedeutet, dass es den Menschen möglich wurde grundsätzliche Gegebenheiten nicht nur anzuzweifeln, sondern auch nach Alternativen zu suchen. Es ergab sich eine Rückbesinnung auf die Naturwissenschaften und die Menschen entwickelten ein souveränes Selbstbewusstsein. Die Initiation der linearen Perspektive wird auf die optischen Experimente des Architekten Filippo Brunelleschi zurückgeführt. Diese sind allerdings nicht dokumentiert worden. Es ist lediglich ein Augenzeugenbericht von Antonio di Tucci Manetti erhalten, der aber zu ungenau ist, um sagen zu können, wie er es tatsächlich gemacht hat. Versehen mit einer Bildtafel und einem Spiegel positionierte sich Brunelleschi im Eingangsportal des Doms von Florenz. Auf der Bildtafel befand sich eine perspektivische Abbildung des Baptisteriums, jenes Gebäudes, das man vom Portal des Doms aus noch heute sehen kann. In die Bildtafel war ein Loch gebohrt, durch das Brunelleschi das Baptisterium anvisierte; die Abbildung des Baptisteriums befand sich auf der dem Gebäude zugewandten Seite. Brunelleschi hielt nun den Spiegel vor das Bild. Während er einen Teil des Baptisteriums durch das Loch in der Bildtafel direkt sehen konnte, sah er gleichzeitig den anderen Teil des Gebäudes in Gestalt des perspektivischen Abbildes auf der Spiegeloberfäche. Er konnte somit die Korrektheit der Perspektive auf der Bildtafel überprüfen, indem er sie mit der direkten Ansicht des Baptisteriums verglich. Ein vermutlich ähnliches, oder gleiches Experiment machte Brunelleschi auf der Piazza della Signori in Florenz. Die Bildtafeln beider Experimente gibt es leider nicht mehr und selbst deren Datum ist nicht mehr bekannt. Es muss irgendwann in den ersten beiden Dekaden des 15. Jh. gewesen sein. Wie dem auch sei, es lassen sich trotz der fehlenden Maße und Winkel entscheidende Rückschlüsse für die Entwicklung der perspektivischen Darstellung ziehen. Brunelleschi hat mit seinem etwas umständlich anmutenden Versuchsaufbau eine Abbildung überprüft. Daher ist es eigentlich viel interessanter, wie die vermeintlich korrekte perspektivische Abbildung auf seine Bildtafel gekommen ist. Unglücklicher Weise gibt es darüber noch weniger Informationen und so wird darüber bis zum heutigen Tage gerätselt. Martin Kemp identifziert gleich mehrere mögliche Methoden.49 Brunelleschi könnte mit Messstäben die Winkel zwischen seinem Standpunkt und markanten Punkten an dem Gebäude ermittelt und die Ergebnisse auf seine Tafel übertragen haben. Gelegentlich machen es die Maler und Zeichner heute noch so, wenn sie vor der Natur arbeiten. Am ausgestreckten Arm wird der Stift oder Pinsel vor das Motiv gehalten und mit dem Daumen wird Maß genommen, indem man die gesehene Größe eines Objektes im Raum mit der Pinselspitze und dem Daumen fxiert. Der so ermittelte Längenwert kann dann direkt auf den Bildträger übertragen werden. Es ist die denkbar simpelste Methode der trigonometrischen Messung in der Natur. Die zu Brunelleschis Zeiten geläufge Messung mit einem Astrolab war natürlich viel genauer. Vielleicht, so meint Kemp, hat er auch eine Projektionstechnik von Ptolemäus ange- 25 wendet, die in der späten Antike benutzt wurde um Landkarten zu erstellen. Diese Methode funktioniert mit Hilfe eines Koordinatensystems, einer frühen Form der heutigen Einteilung der Erdkugel in Längen- und Breitengrade. Oder er hat eventuell einfach das Spiegelbild des Baptisteriums direkt auf der Spiegelfäche nachgezeichnet. Eine ganz neue Idee bringt der Maler David Hockney ins Spiel. Hockney stellt die These auf, dass ab dem 15. Jh. eine Spiegellinse in der Malerei reichlichen Gebrauch fand, mit der man das Motiv in der Natur direkt auf den Bildträger projizieren kann. Hockney ist nach Florenz gereist um die Wirkung der Spiegellinse vor dem Baptisterium zu überprüfen.50 Eine Spiegellinse ist nichts anderes als ein konkav gewölbter Spiegel, der gegenüber einem Planspiegel oder einem Konvexspiegel das Licht in einem Brennpunkt bündelt. Es werden also die Eigenschaften eines Planspiegels mit denen einer Sammellinse kombiniert. Man kann damit eine einigermaßen scharfe Projektion auf einen Schirm werfen und das Bild dann nachzeichnen. Spiegel dieser Art sind heute noch als Rasier- und Schminkspiegel im Gebrauch. Hockney erinnert daran, dass Brunelleschi zunächst bei einem Goldschmied in die Lehre gegangen war. Da Spiegel zu seiner Zeit in diesen Werkstätten hergestellt wurden, musste Brunelleschi also damit vertraut gewesen sein. Gewölbte Spiegel waren im 15. Jh. verbreiteter als Planspiegel. Möglicher Weise hat Manetti nicht gesehen, dass Brunelleschi bei der Überprüfung seiner Bildtafel auch einen Konkavspiegel benutzt hat. Wenn die Brennweite des Spiegels sehr lang ist, kann man ihn leicht mit einem Planspiegel verwechseln. Die optische Theorie über gewölbte Spiegel fndet sich bereits in der euklidischen Katoptik, die Brunelleschi wohl auch kannte. Vielleicht kam bei der Gegenprobe aber auch ein Planspiegel zum Einsatz, was sicher komfortabler wäre. Das Ergebnis, welches Hockney in der Originalsituation in Florenz mit seiner Spiegellinse erzielt hat, scheint jedenfalls seine These zu bestätigen. Es könnte aber genauso gut sein, dass Brunelleschi ein Velum51 benutzt hat. Einen einfachen Holzrahmen, über den ein Raster aus Fäden gespannt ist. Wenn auf dem Bildträger das gleiche Raster angelegt ist, kann man Punkte, die im Fadenraster von einem fxierten Blickpunkt aus identifziert werden, leicht auf die entsprechende Position des Bildträgers übertragen. Die Methode wird erst etliche Jahre später von Alberti beschrieben, was nicht heißen muss, dass Brunelleschi sie nicht bereits kannte. Wie Brunelleschi es gemacht hat bleibt jedoch Spekulation. Sicher ist dass er sein Ergebnis direkt vor dem Objekt erzielt hat, er hat bei der Natur nachgemessen und sich nicht auf seinen subjektiven Sinneseindruck verlassen. Seine Abbildungsmethode setzt die fxierte Position eines Auges voraus. Wie korrekt das Bild war, lässt sich vielleicht noch anhand des Trinitätsfreskos von Masaccio (Abb.9) nachvollziehen. Das Wandbild in der Santa Maria Novella in Florenz, gemalt ca.1427, gilt als das erste Gemälde, das konsequent auf einen einzigen Fluchtpunkt hin konstruiert wurde, noch bevor Alberti nach Florenz kam und sein Buch über die Malkunst verfasste. Weiterhin berücksichtigt die Perspektive den Standpunkt des Betrachters im Kirchenraum, dessen Augenhöhe etwas unterhalb der Ebene liegt, auf der die beiden Stifter abgebildet sind. Der Teil des Bildes über diesem gegebenen Augenhorizont realisiert eine linearperspektivisch korrekte Untersicht. Die Predella unter dem Augenhorizont ist dagegen in der linearperspektivischen Aufsicht wieder gegeben. So entsteht mit Hilfe einer Scheinarchitektur ein stimmiger Illusionsraum, der für das frühe 15. Jh. eine absolute Neuerung war. Es wird vermutet, dass Brunelleschi daran mitgewirkt hat. Bereits Vasari dokumentiert die enge Verbindung zwischen den beiden Künstlern. Zumindest in der Baukunst und in der Perspektive war Masaccio Brunelleschis Schüler. 26 Das wenige, was über Brunelleschis Beschäftigung mit der Perspektive bekannt ist, verweist auf Projektionstechniken, oder Peilungen. Das Fresko von Masaccio muss jedoch konstruiert worden sein. Die wesentliche Neuerung, die Alberti in die Entwicklung eingebracht hat, ist zunächst das Schema der zentralperspektivischen Konstruktion.52 Jedenfalls lässt sich nicht mehr feststellen, ob dieses System Albertis ureigene Erfndung ist, oder ob er es ganz oder teilweise von Brunelleschi übernommen hat. Dem Prolog von Della Pittura ist zu entnehmen, dass Alberti sich auf Brunelleschi beruft und ihm sein Werk zur kritischen Lektüre übergibt. Albertis Schema ist inzwischen durch die kunstwissenschaftliche Forschung ausführlich dargestellt worden. Da dessen Einfuss allumfassend und nachhaltig ist, wird es Sinn machen, die für diese Untersuchung entscheidenden Punkte nochmals durch zu arbeiten. Die Malkunst von Alberti umfasst vier verschiedene Methoden, um eine perspektivische Ansicht eines Raumes oder Gegenstandes auf einer Planfäche zu realisieren. Alberti geht in seinen Lehrstücken zunächst von den Elementen des Euklid53 aus, wobei er die geometrischen Größen Punkt, Linie und Fläche für die Malerei umdeutet, indem er diese abstrakten Größen zu Bildelementen erklärt. In der Weiterführung beschreibt er die geometrischen Eigenschaften eines Kreises und bezeichnet dessen Durchmesser als Zentrallinie. Alberti beschreibt weiter Winkel und geometrische Körper, wie die Kugel, um dann zu erklären, dass sich die Ansicht von Körpern verändert, wenn sich der Standpunkt und das Licht verändert. Endlich erklärt er die antike Sehstrahlentheorie ( ohne Euklid zu erwähnen) und zieht einen Vergleich zwischen der Zentrallinie (dem genannten Durchmesser) und dem „Zentralstrahl“ (Lehrstücke 3-5). In einer etwas umständlichen Überleitung (Lehrstück 6) kommt Alberti zu der Aussage, dass man beim Sehen ein Dreieck bildet, welches die Dimension eines gesehenen Körpers defniert. Ein Winkel dieses Dreiecks liegt im Auge. Die Größe dieses Winkels defniert die optische Größe des gesehenen Gegenstandes. Dabei handelt es sich eindeutig um das euklidische Winkelaxiom. Danach beschreibt er die Nah- und Fernansicht einer Kugel, von der man um so weniger sieht, je näher man ihr ist. Ein optische Regel, die ebenfalls bei Euklid entnommen ist. Das Lehrstück 7 fasst nun alle vorherigen Beschreibungen und „Lehrstücke“ zusammen und kommt ad hoc zu dem Ergebnis, dass alle Sehstrahlen zusammen eine Form bilden, die Alberti als „Sehpyramide“ bezeichnet. Nicht nur dass Alberti hier erstmals von Euklid abweicht, der diese Form als „Sehkegel“ beschrieben hat (siehe oben), die Schlussfolgerung ergibt sich für mich beim besten Willen nicht aus der Herleitung. Aber sei es drum; spätestens seit dieser Entscheidung hat ein Bild in der kollektiven Vorstellung der westlichen Welt vier Ecken. Vielleicht war das aber bereits zu Albertis Zeiten so, denn es scheint für ihn eine selbstverständliche Vorgabe gewesen zu sein, die erfüllt werden musste. Hätte Alberti seinen ursprünglich Vergleich zwischen dem Durchmesser eines Kreises und dem zentralen Sehstrahl weiter entwickelt, statt zu der Grundform des Sehdreiecks über zu gehen, wäre er zu einer ganz anderen Form gekommen, nämlich dem sphärischen Gesichtsfeld! Die Zentralperspektive bedarf jedoch unbedingt der Form der Sehpyramide und der rechtwinkligen Grundfäche des Bildes, da sie sonst als Konstruktionsmethode nicht mehr funktioniert. Die Konstruktion braucht insbesondere eine gerade Grundlinie. Ich denke darin liegt der Grund für Albertis „Winkelzug“. Nachdem Alberti über Licht, Farbe und Proportionalität von Dreiecken gesprochen hat, entwickelt er schrittweise seine Idee von der Sehpyramide weiter und beschreibt im Lehrstück 12 ein Bild als Schnitt durch die Sehpyramide. 27 „Wenn sie denn die Fläche mit ihren Linien umschreiben und mit Farben die umschriebenen Flächen ausfüllen, sollen sie lernen, dass nichts anderes gesucht wird, als wie die Formen der gesehenen Gegenstände auf dieser Fläche darzustellen sind, nämlich genau so, als ob die Fläche aus durchsichtigem Glas wäre, sodass die Sehpyramide sie durchdringen könnte, und ein bestimmter Abstand, eine bestimmte Beleuchtung und eine bestimmte Stellung des Zentralstrahls in der Luft und an irgend welchen anderen Orten angenommen werden. Dass dies sich so verhält, beweist jeder Maler, wenn er, von der Natur geleitet, sich von dem entfernt, was er malt, wie wenn er die spitze und den Winkel der Pyramide dort suchen wollte, von wo sich nach seiner Einsicht die gemalten Dinge besser prüfen lassen. (...) Daher wird ein Gemälde nichts anderes sein als die Schnittfäche durch die Sehpyramide, (...)“54 Damit ist aber fortan klar, dass ein naturalistisches Bild nach dieser Methode auf einer Planfäche wieder gegeben werden muss. Ferner defniert Alberti den richtigen Standpunkt, von dem aus ein Maler oder allgemein der Betrachter ein Bild sehen sollte. Der Winkel, der sich diesem Standpunkt, oder besser gesagt Blickpunkt aus ergibt, korrespondiert mit dem Winkel, den der Illusionsraum des Bildes abbildet. Wenn der Betrachter den richtigen Blickpunkt einnimmt, sind der Betrachtungswinkel und der Abbildungswinkel gleich groß. Die Notwendigkeit, diesen „richtigen“ Standpunkt zum Bild einzunehmen ist in unserer Zeit offenbar nicht mehr gegeben. Wir betrachten weitwinklige Fotos, deren Abbildungswinkel einen großen Anteil unseres Gesichtsfeldes ausfüllen würden als kleinformatige Abzüge, ohne dass uns der Bruch in der Illusionsebene Probleme bereitet. Wir sitzen in einem Kino vor einer monumentalen Leinwand, die durch die Raumsituation im Saal eigentlich immer nur Weitwinkelaufnahmen enthalten sollte und betrachten die ständig wechselnden Perspektiven durch die in der flmischen Aufösung üblichen Wechsel der Brennweiten, ohne dass uns diese Brüche Schwierigkeiten bereiten. Selbst wenn wir uns im Kino nicht in der optimalen Blickachse befnden, sondern dezentral sitzen, kompensieren wir die daraus resultierende Verzerrung des Bildes. Dass dies nicht immer so war, dokumentiert unter anderem der Streit über die richtige Perspektivmethode in einem Theater, in dem der perspektivische korrekte Blick auf die Bühnenmalereien- und Bauten nur von der Fürstenloge aus möglich war. Ab Lehrstück 19 geht Alberti daran, die Konstruktion eines Bildes zu erklären. „ Als Erstes zeichne ich auf der zu bemalenden Fläche ein rechtwinkliges Viereck von beliebiger Größe; von diesem nehme ich an, es sei ein offen stehendes Fenster, durch das ich betrachte, was hier gemalt werden soll; ...“55 Diese berühmt gewordene Fenstermetapher nimmt eine weitere Ergänzung vor. Der Schnitt durch die Sehpyramide ist jetzt nicht mehr aus durchsichtigem Glas, ist sozusagen entmaterialisiert worden, dafür hat die so gebildete Illusionsfäche einen begrenzenden Rahmen erhalten. Dies wird in der nachfolgenden Kunstgeschichte von Bedeutung sein. Bis ins 19te Jahrhundert wurde ein Gemälde als eine in sich geschlossene Komposition gedacht, die durch den Rahmen von der realen Welt abgegrenzt war. Erst der französische Impressionismus hat diesen konzeptionellen Bildrahmen wieder aufgelöst. Albertis offen stehendes Fenster wird nun auf der Grundlage der menschlichen Maßverhältnisse unterteilt. In das Feld wird ein Zentralpunkt gesetzt, der nicht notwendiger Weise in der Mitte des Formates sitzen muss. Alberti verwendet die Formulierung: „ ... wo es mir richtig erscheint“ und 28 gibt als einzige Orientierung die Körpergröße des Menschen an. Im Manierismus und Barock wurde der Zentralpunkt absichtsvoll auf eine dezentrale Position weit jenseits der Bildmitte gesetzt, was die linearperspektivische Konstruktion nicht beeinträchtigt. Er heißt Zentralpunkt, weil er die Stelle festlegt, an welcher der Zentralstrahl lotrecht auf den Schnitt durch die Sehpyramide trifft. Der Zentralpunkt liegt auf der Augenhöhe des Menschen, die Alberti als Zentrallinie bezeichnet, weil sie durch den Zentralpunkt verläuft. Das System von Alberti wird gerade in diesem Punkt oft missverstanden. Heute nennen wir die beiden Größen Fluchtpunkt und Augenhorizont. Die nächsten Schritte sind die Verbindungen des Fluchtpunktes mit der in gleichen Abständen unterteilten Grundlinie des Formates, was die Fluchtlinien ergibt und die Festlegung eines Distanzpunktes außerhalb des Formates. Die Verbindungen zwischen dem Distanzpunkt und den Unterteilungen auf der Grundlinie ergeben die Tiefenstaffelung der Perspektive. Alberti widerspricht damit dem zuvor üblichen Verfahren, nach dem die Tiefenstaffelung durch eine Reduzierung von jeweils einem Drittel der Abstände gebildet wurde und dadurch zu einem unnatürlichen Ergebnis führte. Dies ist Albertis erste Methode, die den Fußboden in ein Raster mit Tiefenstaffelung unterteilt und quasi nebenbei festlegt, dass alle horizontalen Linien parallel zum geraden Bildrand verlaufen. Damit befnden wir uns eindeutig im euklidischen Raum, denn dieser ist das einzige Raumkonzept in dem das Parallelenpostulat56 angewendet werden kann. Auch bei einem großen Abbildungswinkel lässt die Methode keine Kurvatur zu, mit fatalen Folgen, wie ich zeigen werde. Abb.10: Schema der ersten Methode, Z= Zentralpunkt / Fluchtpunkt, D= Distanzpunkt defniert die Entfernung zwischen Auge und Bildfäche und damit den Abbildungs-und Betrachtungswinkel. Die Zentrallinie / Augenhorizont liegt in Höhe 3 Braccia (soll der durchschnittlichen Größe eines Menschen entsprechen), Die Grundlinie wird nach dem gleichen Maß unterteilt. 29 Die zweite Methode (Lehrstück 30 und 31) ist die Verwendung eines Velums, primär zur Abbildung der menschlichen Gestalt. Alberti beschreibt sein Velum als ein auf einen Rahmen gespanntes loses Gewebe, durch das man hindurch schauen kann. Von einem fxierten Blickpunkt aus schaut der Maler so durch die Schnittfäche der Sehpyramide und ist in der Lage die Umrisse der zu zeichnenden Figur anhand der Aufteilung präzise zu identifzieren und zu übertragen. Leonardo da Vinci schlägt Jahrzehnte später vor, eine Glasscheibe zu verwenden, die durch ein Linienraster unterteilt ist, und direkt auf der Glasscheibe zu zeichnen.57 Von Albrecht Dürer stammen weiter Beschreibungen für die Verwendung eines Velums.58 Dabei kommt auch ein aufwändiges Set zum Einsatz, dessen Neuerung darin besteht, die Ungenauigkeiten auszuschießen, die sich durch minimale Veränderungen des Blickpunktes ergeben, indem ein an einem bestimmten Punkt befestigter und gespannter Faden die Funktion der „Sehstrahlen“ übernimmt (Abb.17). Allen Systemen ist jedoch gemeinsam, dass eine Raumansicht von einem festen Punkt aus, auf eine Planfäche projiziert wird. Albertis zweite Methode unterscheidet sich wesentlich von der ersten, denn es ist keine Konstruktion, sondern eine Projektion. Die beiden Verfahren lassen sich nicht in jedem Fall miteinander in Deckung bringen, auch wenn sie beide den gleichen Schnitt durch Albertis Sehpyramide realisieren. Was aus deren Kombination entstehen kann lässt sich sehr gut an der „Geißelung Christi“ (1455, Tafelbild, 59x81 cm) von Piero della Francesca nachvollziehen. Die drei Figuren am rechten Bildrand passen nicht in den linearperspektivischen Bildraum. Sie wirken wie nachträglich aufgeklebt und fügen sich nicht homogen ein. Ich glaube, dass Piero della Francesca hier die beiden Methoden von Alberti kombiniert hat und damit gescheitet ist. Abb.11 Die Geißelung Christi, von Piero della Francesca Methode drei beschreibt die Einzeichnung einer Mauer direkt in das Schema. Diese Mauer folgt bei Alberti den Fluchtlinien und der Tiefenstaffelung. Läge der Verlauf der Mauer nicht auf den Fluchtlinien, sondern in irgend einer anderen Ausrichtung, würde das bedeuten, dass ein weiter Fluchtpunkt auf den Horizont gesetzt werden muss, um die Mauer perspektivisch korrekt zu konstruieren. Soweit geht Alberti jedoch nicht. 30 Abb.12: Übertragungen von Kreisen auf das Perspektivschema, ausgehend von einem Grundriss Die vierte Methode bringt eine Neuerung ins Spiel. Die Aufgabe, einen Kreis perspektivisch in das Schema zu zeichnen, wird durch die Übertragung von einem Grundriss auf das perspektivische Schema realisiert. Ein Kreis wird mit einem Zirkel gezeichnet und dann mit der gleichen Anzahl von Unterteilungen versehen, wie sie in dem Schema enthalten sind. Der Umfang des Kreisbogens wird dann in das Perspektivraster „mit Talent“ (freihändig) übertragen. Besonders diese vierte Methode ist entlarvend für die Schwächen der linearperspektivischen Konstruktion. Eine korrekte Ellipse ergibt sich nur, wenn die Mitte des Kreisbogens auf der Mittelachse (dem Zentralstrahl) des Perspektivraums liegt. Liegt der Kreisbogen jenseits davon, wird der Kreisbogen zum Bildrand hin immer eiförmiger. Der Kreisbogen am rechten Rand der Konstruktion (Abb.12) ist eindeutig aus der Achse gekippt und die Fläche, die von ihm abgedeckt wird, ist verglichen mit dem Kreis in der Mitte größer, obwohl die Vorlagen für beide gleich groß sind. Diese Eigenschaft der linearen Perspektive ist bereits im 15. Jh. erkannt worden und führte zu einem Diskurs über den optimalen Abbildungswinkel auf einer Planfäche. Wenn Alberti im Lehrstück 19 sagt: „Sei dir dazu bewusst, dass kein gemalter Gegenstand je wie der echte aussehen wird, wenn nicht ein bestimmter Abstand beim Betrachten eingehalten wird.“, so bedeutet das für 31 die Maler, dass Sie diesen Abstand festlegen müssen. Mit diesem Abstand legen sie gleichzeitig auch den Abbildungs- und Betrachtungswinkel fest. Piero della Francesca analysiert in seinem Buch über die Perspektive der Malerei, dass der Abbildungswinkel 90 Winkelgrade nicht überschreiten sollte. Wenn der Blick weiter wird, erscheint ein Quadrat (z.B. die Platte eines Fußbodens) in der zentralperspektivischen Konstruktion tiefer als breit.59 Della Francesca, der sich ausführlich mit darstellender Mathematik befasst hat, liefert dafür auch den geometrischen Beweis, der nach Martin Kemps Rezeption auf der euklidischen Optik beruht. Ausgerechnet das Werk, das Alberti zur Grundlage seiner Perspektivkonstruktion gewählt hat, ist auch die Quelle für dessen eingeschränkte Gültigkeit. Die Anwendung des Winkelaxioms (zur Defnition der Sehgrößen) in Albertis Perspektive liefert Della Francesca nach, indem er die Proportionalität zwischen den Entfernungen zu einem gesehenen Objekt und dem Schnitt durch die Sehpyramide einerseits, und die Proportionalität zwischen der tatsächlichen Größe eines Objektes im Raum und dessen Abbildungsgröße auf dem Schnitt durch die Sehpyramide andererseits, zu einer Gleichung zusammenfasst. Allerdings kommt die Gleichung ohne den Sehwinkel aus, denn da die Dreiecke nach der Regel der Winkelgleichheit ähnlich sind, sind auch deren Seitenlängen zueinander proportional. Abb.13: Übertragen auf das Model zu Euklids Theorem 8 lauten die von Piero della Francesca gefundenen Beziehungen BO : D´O = AB : A´´D´, (sowie weitere Beziehungen der in der Grafk enthaltenen ähnlichen Dreiecke). Dies ist mittlerweile als Elementarsatz der Proportionalgeometrie bekannt und auch nichts anderes als die bereits durch Euklid defnierte Verhältnismäßigkeit zwischen der Entfernung zu den Objekten und deren Sehgrößen. Die Gleichung geht jedoch einen Schritt weiter, indem das Doppelverhältnis nicht nur für die Halbierung der Entfernung defniert wird, sondern für jede Teilung in diesem Aufbau. Die eigentliche Ursache für das von Della Francesca gefundene Problem des Abbildungswinkels ist jedoch die Projektion der Raumansicht auf eine Planfäche und nicht die Größe des Abbildungs-/ Betrachtungswinkels. Leonardo da Vinci war sich offenbar dieses Problems bewusst. In Panofskys Aufsatz über der Perspektive ist eine Grafk enthalten, die auf Leonardos Beschäftigung mit der Frage des Abbildungswinkels zurückgeht.60 Die Abbildung zeigt, wie sich durch die Projektion auf einer Planfäche eine Randverzerrung zwangsläufg ergibt. Gleich große Körper werden zum Rand der Abbildung hin breiter, obwohl sie weiter vom Auge entfernt sind und da- 32 her kleiner erscheinen müssten. Wenn jedoch um den Augenpunkt O ein Kreisbogen geschlagen wird, auf dem die projizierten Größen abgebildet werden, ist das Verhältnis der Abbildungsgrößen stimmiger. Martin Kemp ist der Ansicht, dass Leonardo damit nicht auf die kurvenlineare Perspektive hinaus wollte, und auch nicht einen Nachweis für die Fehlerhaftigkeit jeder linearperspektivischen Konstruktion erbringen wollte. Nach Kemp geht es Leonardo nur darum, die Bedeutung des richtigen Blickpunktes zu unterstreichen.61 Abb.14 : Grundriss einer Säulenreihe und deren Projektion auf den Schnitt durch die Sehpyramide (Bildoberfäche); O ist der Augenpunkt. In seinem Traktat über die Malerei geht Leonardo ebenfalls auf das Verhältnis von Entfernungen und Abbildungsgrößen ein und erklärt u.a. dass die Verdoppelung der Entfernung zu einem Objekt eine Halbierung der Abbildungsgröße ergibt. Auch er hat seinen Euklid gelesen. Er schließt die kurze Darstellung mit einer Formatregel. Der Maler soll gemessen an der Größe des Bildes doppelt so weit davon entfernt sein. Wenn man entsprechend der Bildgröße nur die einfache Entfernung einnehmen würde, würde das nach Leonardos Meinung einen großen Unterschied machen. Er behauptet, der Unterschied ergibt sich in der proportionalen Abbildungsgröße der Bildobjekte. Die Begründung lässt sich nach den Regeln der Geometrie nicht nachvollziehen. Möglicherweise möchte Leonardo den „Weitwinkeleffekt“ vermeiden, bei dem die Bildobjekte im Raum subjektiv weiter entfernt erscheinen, als sie wirklich sind. Jedenfalls ergibt Leonardos Formatregel einen Betrachtungswinkel von gerade einmal 28 Winkelgraden.62 Bei so einem spitzen Winkel fallen Randverzerrungen kaum ins Gewicht. Weiterhin bekräftigt Leonardo die Regel, dass ein Bild immer nur von einem Punkt aus betrachtet werden soll.63 Als Beweis dafür gibt er das Beispiel einer Kugel an, die sich sehr weit oben auf der Bildfäche befndet und eiförmig gemalt werden muss. Von dem richtigen Blickpunkt aus wird dieses Ei dann als Kugel erscheinen. Dass er als geometrischen Beweis gerade eine Kugel wählt, zeigt dass runde Bildelemente eine besondere Schwierigkeit für die Linearperspektive mit sich bringen, wie bereits die Abb.12 zur Illustration von Albertis vierter Methode demonstriert. Während wir es gewohnt sind, jede der sichtbaren Seiten eines Würfels immer in perspektivischer Verkürzung zu sehen und uns daher dessen Verzerrung in der Zentralperspektive nicht sofort auffällt, ist das bei einer Kugel nicht der Fall. Schon Euklid wusste dass eine Kugel von allen Seiten und aus jeder Entfernung immer absolut rund aussieht, sonst würden wir das Ding auch nicht als Kugel bezeichnen. Diese visuelle 33 Eigenschaft der Kugel nagelt den Betrachter einer korrekten linearperspektivischen Konstruktion mit einer „eiförmigen Kugel“ an einem defnierten Punkt fest. Leonardo war sich der Randverzerrung in der linearen Perspektive vollkommen bewusst und sah es als notwendig an, die Randverzerrung durch Regeln zu kompensieren. Auf Leonardo geht auch die Unterscheidung der „perspectiva naturalis“ von der „perspectiva artifcialis“ zurück. Demnach beschreibt die euklidische Optik die natürliche Perspektive des Menschen, das Bild jedoch enthält eine künstliche Perspektive.64 Diese Unterscheidung für das Bild zu treffen, wird dem Renaissance-Künstler vermutlich nicht leicht gefallen sein, denn es widerspricht letztendlich seinem Vorsatz, von der Natur zu lernen. Leonardo musste erkennen, dass es wohl nur mit Einschränkungen möglich war, die Welt so wiederzugeben, wie das Auge sie sieht. James E. Cutting nimmt Leonardos Überlegungen jedoch zum Anlass, ein Gegenbild zu Albertis fachem Fenster zu setzten, das er „Leonardos Window“ nennt.65 Dabei handelt es sich um eine sphärisch gekrümmte Bildoberfäche. M.H. Pirenne verweist im Zusammenhang mit runden Körpern im Bild auf das Wandgemälde „Die Schule von Athen“ von Raphael Santi, in dem am rechten Bildrand die Darstellungen eines Globus und einer Kugel als Sternenkarte zu sehen sind.66 Die beiden Kugeln sind nicht eiförmig gemalt, wie es nach den Regeln der linearen Perspektive richtig wäre, sondern vollkommen rund. Raphael ist offenbar davon ausgegangen, dass sich der Betrachter selbstverständlich vor diesem sehr großen Wandbild bewegen wird. Damit ist es nicht mehr möglich, das Bild nur von einem Punkt aus zu konstruieren. Raphael konstruierte nur die Architekturelemente nach der linearen Perspektive und fügte dann die Figuren und geometrischen Details in diesen Raum ein, was ihm besser gelungen ist als Piero della Francesca. Was für die beiden Kugeln gilt, gilt in besonderem Maß auch für die Figuren, die nach der Regel zum Rand hin immer breiter werden müssten. Raphael nahm eine Korrektur der Perspektivregeln vor, um die Randverzerrungen zu vermeiden. Abb.15 Demonstration eines Körpers „im perspektiv“ in Andrea Pozzos Perspektivlehrbuch67 34 Andrea Pozzo, ein entschiedener Vertreter der Konstruktion eines Bildes mit nur einem Fluchtpunkt, von nur einem Standpunkt aus, inklusive aller daraus bedingten Verzerrungen, kam auch nicht an dem Problem mit der Kugel vorbei. Während der Sockel und die runde Scheibe in Abb.15 korrekt nach der linearen Perspektive konstruiert worden ist, und damit auch nur von einem Punkt aus richtig gesehen werden kann, ist die Kugel darauf kugelrund dargestellt. Hat der Kupferstecher einen Fehler gemacht, oder wollte es Pozzo genau so haben? Wenn Pozzo die Konstruktion von Säulenfüßen und Kapitellen nach der Perspektivkunst demonstriert, kommen solche Kompromisse nicht vor. Besonders die Architekturmaler waren gezwungen, mit dem Prinzip der Bildbetrachtung von nur einem Punkt umzugehen. Für Deckengemälde, deren Perspektive monofokal konstruiert sind, wurde oft auf dem Fußboden eine Markierung gesetzt, die den für das Bild richtigen Standpunkt für den Betrachter anzeigt. Wer sich jenseits der Markierung befndet, sieht das Deckengemälde in einer verzogenen Perspektive. Auch der Abbildungs-/Betrachtungswinkel war durch die Architektur vorgegeben und konnte nicht frei variiert werden, wie etwa auf einem Tafelbild. Pozzo, dessen Lehrbuch primär von der Architektur- und Theatermalerei handelt, gibt dennoch eine weitere Formatregel für große Tafelbilder an68. Bei Hochformaten soll der Augenabstand der Höhe entsprechen, bei Querformaten der Breite. Das ergibt ein gleichschenkliges Dreieck auf der Vertikalen, bzw. Horizontalen, das einen Betrachtungswinkel von 53 Winkelgraden festlegt. In der Bilddiagonale ergibt die Regel naturgemäß einen weiteren Winkel. Weitere Empfehlungen aus dem 16. und 17. JH schwanken zwischen 45 und 60 Winkelgraden. Das alles ändert allerdings nichts an dem einmal durch die lineare Perspektive etablierten Problem. Auch neue Konstruktionsmethoden, die zusätzlich zum Grundriss eines Körpers auch dessen Aufriss (Proflansicht) einbezogen, kamen zu dem gleichen Ergebnis. Das führte zu ersten Ideen, nach denen man in der Malerei von dem einen Zentralpunkt abrücken sollte und je nach Größe des Abbildungswinkels, insbesondere bei großen Wand- und Deckenbildern und besonders auch bei gemalten und gebauten Theaterkulissen, mehrere Zentralpunkte verwenden sollte. Diese polyfokalen Perspektiven sollten auf einem Rahmen im Bild, oder auf der Horizontlinie verteilt werden. Lösungen dieser Art wurden heftig kritisiert, da sie auf Kosten der Tiefenwirkung der Bildillusion gingen. Letztlich handelte es sich dabei um einen Rückgriff auf den „Aggregatraum“ (Panofsky) des Mittelalters. Da besonders Architekturdarstellungen und regelmäßige geometrische Körper die Perspektive überprüfbar machen und damit auch deren Schwächen offenbaren, bestand nach Meinung von Pirenne eine weitere Lösung für die Deckenmalerei des Barock darin, möglichst auf gemalte Architekturelemente zu verzichten und Problemzonen durch gemalte Wolken zu verdecken. Es ist nur konsequent, dass die Erfndung der anamorphotischen Bilder, deren Betrachtungswinkel die Randverzerrung der linearen Perspektive auf die Spitze treibt, in dem gleichen Zeitraum stattfanden, in dem der Diskurs über den Abbildungs-/Betrachtungswinkel geführt wurde. Bereits Leonardo da Vinci hatte solche Zeichnungen gemacht. Jenseits des Zentralpunktes ist jede linearperspektivische Konstruktion anamorph! Vielleicht ist es das, was uns Hans Holbein d.J. in seinem Doppelportrait der Botschafter (1533) sagen wollte. Das Bild enthält jedenfalls genug Hinweise auf die Optik und dazu den berühmten anamorphotischen Schädel. Im Verlauf der Kunstgeschichte wurde die lineare Perspektive durch die Einführung der 2-Punkt und 3-Punkt Perspektive erweitert. Dabei ging es darum, nicht jeden Körper auf den Zentralpunkt ausrichten zu müssen und zusätzlich lineare Verkürzungen in der Vertikalen zu konstruieren. 35 Die Theorie von Alberti war zwar ein entscheidender Fortschritt, konnte aber je nach Aufgabenstellung nicht orthodox umgesetzt werden. Es wurde nach Mitteln und Wegen gesucht um deren Schwächen zu kompensieren. Abb. 16 Perspektivische Konstruktion eines kubischen Körpers:1 (links) Albertis Zentralperspektive mit einem Fluchtpunkt, 2 (Mitte) 2-Punkt-Perspektive, 3 (rechts) 3-Punktperspektive. Aber wir haben ja durch Alberti weitere Methoden zur Verfügung; insbesondere die Projektion auf der Grundlage des Velums. Wie sieht es nun damit aus? „Willst du durchzeichnen, was vor dir stehet, so rüste dazu ein geschicktes Zeug.“69 36 Abb.17 Dürers analytische Zeichenmaschine, genannt „Zeichner der Laute“,1525. In den folgenden Jahrhunderten taucht das Motiv der Laute sehr oft in Bildern auf, die sich mehr oder weniger konkret mit der Perspektive beschäftigen, vermutlich jeweils ein Dürer-Zitat. Von Albrecht Dürer stammen vier Beschreibungen für die Verwendung von Zeichengeräten, die nach dem Prinzip des Velums funktionieren. In der ersten Aufage (1525) seiner Unterweisung der Messung wird ein Gerät beschrieben, mit dem man ein „Konterfei“ direkt auf eine Glasscheibe malen kann, durch die man den zu Portraitierenden sieht. Ob dies durch Leonardo da Vinci inspiriert ist, ist fraglich, denn Leonardos Traktat über die Malerei ist erstmals 1651 gedruckt worden. Vielleicht hat Dürer aber auch auf seiner Italienreise (1505) von der Methode erfahren. Weiter beschreibt Dürer eine Anordnung, mit der die Position eines Punktes auf dem Bildträger durch drei Fäden präzise ermittelt werden kann und ganz ohne das menschliche Auge im Blickpunkt. Einer der Fäden repräsentiert den Sehstrahl und ist an einem bestimmen Punkt an der Wand fxiert, der dem Blickpunkt der Abbildung entspricht (Abb.17). Genau genommen ist es nicht möglich das Auge an einem Punkt und mit einer festen Ausrichtung zu fxieren, jedenfalls nicht ohne Gewalt anzuwenden. Unsere Augen sind immer in Bewegung, auch bei der Bildbetrachtung. Dürer ist es gelungen, dies auszuschließen, indem er die Raumanschauung der Augen ganz aus dem Spiel genommen hat. Es handelt sich also um eine Kombination aus linearperspektivischer Konstruktion und Projektion. In der zweiten Aufage folgen noch zwei weitere Techniken. Eine davon ist die für die spätere Zeit allgemein verwendetet Methode. Ein Gitternetz aus Fäden wird über einen Rahmen gespannt und eine Vorrichtung fxiert das Auge vor diesem Netz. Der durch das Gitternetz angepeilte Raum kann so auf ein Blatt übertragen werden, welches das gleiche Gitternetz enthält. Alle Techniken dieser Art zielen darauf ab, die physiologischen und refexiven Eigenschaften des Sehens auszuschließen und den Raum analytisch zu betrachten, um ihn dann nach dem System der linearen Perspektive auf dem Schnitt durch die Sehpyramide abzubilden. Daher ergeben diese Methoden auch die gleichen Ergebnisse wie Alberts Konstruktion, mit den gleichen Anamorphosen. Doch schon bald gab es etwas ganz Neues. In dem gleichen Zeitraum, in dem intensiv über die Perspektive nachgedacht wurde, wurden die ersten Linsen geschliffen. David Hockney weist die Verwendung von „optical devices“ in den Bildern von Hans Memling, Hans Holbein d.J. und Lorenzo Lotto nach.70 Die Perspektive der Bilder enthalten Artefakte, die üblicherweise durch das Nachfokussieren an einer Kameraoptik entstehen. Eine Camera Obscura, wie auch eine moderne Kamera, kann nicht die ganze Tiefe des Bildes scharf zeichnen. Wenn ein Maler mit einer Camera Obscura arbeitete, musste er offenbar je nach dem zu beobachtenden Bereich die Schärfe nachführen. Dadurch veränderte sich die Brennweite der Optik minimal und damit auch die Perspektive. Durch dieses Nachfokussieren hatte sich heimlich der Ansatz einer Kurvatur der Fluchtlinien in die Bilder eingeschlichen. Hockney fndet in der Folge weitere Artefakte optischer Instrumente in Gemälden ab der Mitte des 15. Jahrhunderts; unter anderem auch solche, die aus der Bewegung, dem Schwenken, dieser Instrumente resultieren müssen. Trotz des vermeintlich sehr technischen Entstehungsprozesses enthalten die Bilder offenbar Aspekte der physiologischen Optik, wie das Akkomodieren der Kristalllinse und die Bewegung der Augen. 37 Machen wir einen großen Zeitsprung zur Erfndung der Fotographie im 19. Jahrhundert. Nachdem die Maler im Lauf von 400 Jahren gelernt haben mit der linearen Perspektive umzugehen und dabei jedes zur Verfügung stehende optische Instrument eingesetzt haben, bedeutete die Fotografe zunächst einen Schritt zurück. Der Zentralpunkt saß nun unweigerlich in der Mitte des Formates. Die neue Technik wurde damit der landläufgen Fehlinterpretation der Zentralperspektive gerecht. Fotographie ist Zentralperspektive im wörtlichen Sinn. Alle Interpretationen zugunsten einer Perspektive, die dem tatsächlichen Sinneseindruck näher kommt, oder zumindest störende Effekte der linearen Perspektive kompensiert, wurden in der frühen Fotographie nicht mehr berücksichtigt. In seinen umfangreichen Experimenten zu dem Thema verwendet M.H. Pirenne eine Lochkamera, um den verfälschenden Einfuss einer Kameraoptik aus verschiedenen Linsen auszuschließen. Eine Lochkamera projiziert das Licht gradlinig auf eine Planfäche und ist damit die denkbar reinste Übersetzung von Albertis Konstruktion in ein technisches Medium. Die Kugel auf Pirennes Aufnahme ist eindeutig verzogen. Ohne die runden Elemente im Bild würde uns vermutlich kaum auffallen, dass es ein sehr weitwinkliges Foto ist. Es handelt sich um das Ei, das Leonardo von den Malern in treuer Umsetzung der Lehre gefordert hatte. Doch da Fotoabzüge in der Regel viel kleiner sind als Wandgemälde und wir gar nicht die Chance haben die Aufnahme aus dem richtigen Winkel, d.h. mit dem richtigen Abstand zu betrachten, sehen wir sofort die unnatürliche Randverzerrung. Zur Annäherung an einen natürlichen Eindruck der Szene bedarf es einer sphärischen Gegenkorrektur. Abb.18, Lochkameraaufnahme von M.H.Pirenne, 1970, links im Original und rechts mit dessen sphärischer Korrektur. So wie die Maler ab dem 15. Jh. sich der Sache angenommen hatten, befassten sich Not gedrungen auch die Kameraingenieure mit den Problemen der linearen Perspektive. Die kissen- oder tonnenförmige Verzeichnung in Weitwinkelfotographien werden mittlerweile durch kombinierte Linsensysteme korrigiert. Tilt-Shift-Optiken verhindern bei der Aufnahme hoher Gebäude stürzende Linien. Senkrechte Linien werden damit wieder parallel zum Bildrand abgebildet. Aus der linearen Projektion und der Planlage des Bildträgers ergibt sich zusätzlich das Problem der Randvignettierung. Dabei sind die Ecken einer Aufnahme dunkler als die Bildmitte, weil zum Rand 38 der Planfäche des Fotonegativs der Lichtweg länger ist. Auch dieser Effekt musste künstlich nachkorrigiert werden. Spätestens mit der digitalen Fotographie sind asphärische Linsen allgemein üblich und in Bildbearbeitungsprogrammen sind vorgefertigte Filter enthalten, mit denen man eine Korrektur der linearen Perspektive und der Abbildungsfehler des Linsensystems vornehmen kann. Die Entwicklungsgeschichte der modernen Fotographie ist beinahe eine Wiederholung der Historie von Albertis Konstruktionssystem und dessen Verfeinerung in den nachfolgenden Jahrhunderten. Mit der Erfndung des flmischen Apparates wurde zusätzlich die Eigenschaft des sukzessiven Sehens in das System eingeführt. Der Rundblick, der abtastende Blick und der Positionswechsel wurden möglich. Jedoch handelt es sich auch bei den bis heute entwickelten Film- und Digitalkameras um Instrumente, die einen Raum auf eine Planfäche projizieren. Das ist besonders auffällig, wenn mit einer sphärischen Linse ein Kameraschwenk gemacht wird. In der Leinwandprojektion oder auf einem Monitor habe ich in diesem speziellen Fall immer den Eindruck, dass ein faches Brett vor meinen Augen bewegt wird, von dem das Bild an der Seite herunter läuft, als wäre es füssig. Das wirkt auf mich sehr unnatürlich und irritierend, da sich durch diesen Effekt das Bild als Oberfäche entlarvt und seine Tiefenwirkung verliert. Die Bilderfut, die für uns mittlerweile selbstverständlich ist, und das Training an der Kulturtechnik des Abbildes, hat in unserer Gegenwart sicher einen Gewöhnungseffekt. Die Artefakte der linearen Perspektive werden im Allgemeinen nicht als Problem empfunden. Wenn sie überhaupt noch wahrgenommen werden, werden sie wahrscheinlich als Stilmittel akzeptiert. Hinzu kommt, dass wir den Unterschied zwischen dem Raum und dessen Abbildung auf einer Planfäche sehr genau kennen. Wir sind uns immer im Klaren darüber, dass wir eine Abbildung sehen, selbst wenn uns die Handlung eines Films zum Lachen reizt, oder zu Tränen rührt. Wie bereits erwähnt, stellt es kein Hindernis für die Bildbetrachtung dar, wenn wir uns nicht in der richtigen Entfernung zum Abbild befnden. Wir können auch eine dezentrale Betrachtungsposition kompensieren. All das ist wahr. Aber das bedeutet nicht, dass wir den Unterschied nicht mehr sehen können. Wir betrachten den Raum und das Abbild des Raumes auf einer Planfäche mit den gleichen Augen, aber der physiologische Raum, der sich aus den Gegebenheiten unserer Wahrnehmung ergibt, ist grundsätzlich anders strukturiert als der Bildraum der linearen Perspektive. 39 3. Das Weltbild und die physiologische Optik Ich erinnere mich an eine Attraktion auf dem Jahrmarkt meiner Heimatstadt. Lange bevor ich begonnen hatte mich mit Bildern zu beschäftigen, stand ich in einem Kuppelzelt und war umgeben von einer runden Leinwand. Das Spiel hieß Cinema 2000 und wurde mit den für einen Rummelplatz üblichen Versprechungen für den besonderen „Kick“ als Action-Kino angepriesen. Das war keine Übertreibung, denn ich erhielt meine erste Lektion im Fach Wahrnehmungspsychologie. Da es in diesem eigenartigen Kino keine Sitzplätze gab, mussten alle Besucher stehen. Es wurden kurze Sequenzen vorgeführt, deren Gemeinsamkeit die rasante Bewegung der Kamera war, wie etwa der Blick aus einem Flugzeug, das knapp über einen Berggrad hinweg fiegt, oder eine Achterbahnfahrt aus dem Blickwinkel der ersten Reihe, ein Autorennen von der Stoßstange aus gesehen und dergleichen. Es war zwar keine stereoskopische Projektion, aber der Eindruck war trotzdem so stark, dass die Zuschauer die Raumwirkung als real annahmen. Das konnte ich selbst und auch alle anderen Besucher daran merken, dass wir wie besoffen hin und her torkelten, da wir versuchten die im Bild suggerierten Fliehkräfte auszugleichen, indem wir uns schräg in die Kurve legten, um dann gleich zu merken, dass gar keine Fliehkräfte am Werk waren und die Schwerkraft ja auch noch da war. Aber wenn der Rennwagen dann über eine Kuppe fuhr, hatte ich wirklich das Gefühl, oder vielleicht besser gesagt: die Vorstellung, abzuheben. Ich stellte mich auf die Zehenspitzen, bereit zum Abfug und gleichzeitig enttäuscht, weil nichts dergleichen mit mir geschah. Doch gleich danach stand eine harte Landung bevor und mein erdgebundenes Bewusstsein verlangte von meinem Körper Gegenmaßnahmen. Ich ging in die Knie. In einem „normalen“ Kino mit einer fachen Leinwand habe ich so etwas noch nie erlebt. Körperliche Reaktionen, wie etwa Gänsehaut oder Gähnen, haben dort immer mit der erzählerischen Ebene zu tun. Was mir im Action-Kino passiert ist, ist ein Wahrnehmungskonfikt der darin besteht, dass die unterschiedlichen Sinnes- Modalitäten widersprüchliche Informationen aufnehmen. Ein Zustand der für das vorstellende Bewusstsein offenbar nicht akzeptabel ist. Nur eine der wahrgenommenen Realitäten kann richtig sein, was das Bewusstsein dazu treibt, sich auf der Grundlage der bereits gemachten Erfahrungen für eine Variante zu entscheiden. Wenn sich diese Entscheidung als falsch herausstellt, ist es im Cinema 2000 ein toller Spaß, auf See ist der gleiche Effekt meist zum kotzen. Bei der Seekrankheit liegt der umgekehrte Fall vor. Während der Gleichgewichtssinn die ganze Zeit Alarm schlägt, weil sich alles in Bewegung befndet, hält der Gesichtssinn dagegen, denn die Wände in der Kajüte bewegen sich defnitiv nicht. Alles ist senkrecht, im rechten Winkel und fest, wie es sein soll. Dabei hilft es nicht, sich klar zu machen, dass die Bewegung durch den Seegang verursacht wird. Der Wahrnehmungskonfikt lässt sich nur aufösen, wenn man sich auf das Oberdeck des Schiffes begibt und den Horizont fxiert. Aber nicht immer klärt das die Widersprüche auf. Wer wahrnehmungspsychologisch betrachtet fest auf seinen Beinen steht, kann möglicherweise weiterhin nicht akzeptieren, dass zwei sich widersprechende Realitäten nebeneinander existieren können. Zumindest steht man dann schon mal an der Reling. Anwendungen, die diese Konditionierung des wahrnehmenden und vorstellenden Bewusstseins ausnutzen, begegnen uns im Lauf der jüngeren Kulturgeschichte immer wieder in unterschiedlichem Gewand wie etwa in der Cyberspace-Technologie, der Full-Dome-Projektion im Planetarium und in bestimmten Varianten des Erlebniskinos. Aber im Prinzip ist der konditionierte Wahrnehmungsapparat in jedem Bildmedium wirksam, denn ein Bildmedium erzeugt in nahezu jedem Fall eine Illusion. Bereits im 19ten Jahrhundert71 ist darauf hingewiesen worden, dass bei den so genannten optischen Täuschungen im wörtlichen Sinne gar keine Täuschung vorliegt. Unsere Sinne täuschen sich nicht, sondern wir erhalten widersprüchliche Informationen, die aufgelöst werden müssen. Unser vorstellendes Bewusstsein entscheidet den Wahrnehmungskonfikt immer auf der Grund- 40 lage der gewöhnlichen Erfahrung, was bei Abbildungen leicht zu Fehlinterpretationen führt. Wenn die Täuschung in der Realität inszeniert werden soll, wie etwa in dem berühmten AmesRaum72, ist es interessanter Weise notwendig die Position der Augen zu fxieren. Sobald man im Ames-Raum den Blick schweifen lassen kann und durch die Drehung der Augen und des Kopfes vergleichende Eindrücke aufnimmt, entlarvt sich das Wahrnehmungsproblem sehr schnell als Gauklertrick. Wir kennen den Raum in dem wir leben und die physikalischen Gesetze, die darin herrschen sehr genau. Dieses implizierte Wissen ist immer präsent und unsere Sinnesorgane täuschen sich nicht. In Zweifelsfällen wird lediglich derjenigen Variante der Vorzug gegeben, die am ehesten dem Erfahrungshintergrund entspricht. Wenn man also das wahrnehmende und vorstellende Bewusstsein überlisten will, vielleicht um eine möglichst perfekte Illusion zu erzeugen, sollte man von den Regeln dieses Bewusstseins ausgehen, wie es beispielsweise im Cinema 2000 gelungen ist. Dabei ist nicht einmal die rasante Bewegung im Bild entscheidend, denn die gibt es auch in einem gewöhnlichen Kino. Ich gehe davon aus, dass die sphärische Projektionsfäche und die Möglichkeit darauf den Blick schweifen zu lassen, ohne auf den Bildrand (der Grenzlinie der Bildillusion) zu stoßen, die Grundbedingungen für die Illusion im Cinema 2000 sind. Wenn wir uns umschauen, haben wir zwangsläufg den Eindruck, dass wir von der Welt umgeben sind und die Welt ist nicht in uns, sondern da draußen. Ein dualistisches Weltbild in dem es ein Innen und ein Außen gibt, gehört zu unseren natürlichen Erfahrungen. Deshalb ist es auch so schwer zu akzeptieren, dass alles was wir wahrnehmen und erinnern letztendlich eine Vorstellung ist, die wir selbst erzeugen und die nach bestimmten Regeln konditioniert ist. Ein Umstand, der in der Geschichte der Geisteswissenschaften für jede Menge Konfiktstoff gesorgt hat. Es ging so weit, dass sogar daran gezweifelt wurde, dass die Welt da draußen in der wahrgenommen Form überhaupt existiert. Die Neurowissenschaftler unserer Tage gehen noch weiter indem sie behaupten, all das was uns so viel bedeutet, die ganzen Freuden und der ganze Zorn, unsere großen Ambitionen und täglichen Mühen sind nichts weiter als elektrochemische Impulse an den Synapsen unserer Neuronen73. Es wundert mich nicht, dass so eine materialistische Profanisierung des Lebens Widerspruch auslöst. Mit diesem Streit will ich mich an dieser Stelle aber nicht weiter befassen. Ich spreche diesen Umstand nur an, weil ich von der Welterfahrung auf der Grundlage der Wahrnehmung ausgehen muss, wohl wissend, dass Wahrnehmung eine komplexe Angelegenheit ist, die nicht nur auf Sinnesreizen basiert, sondern gleichzeitig auf allen Aspekten der Refexion. Dies muss im Folgenden immer „im Blick“ behalten werden. Der Blick unserer Augen ist zwangsläufg egozentrisch. Wir betrachten die Welt von einem defnierten Punkt aus, dem Selbstbewusstsein. Wenn es gelingt diesen Punkt zu verlassen, um einen anderen Blickwinkel einnehmen zu können, hat dies nicht nur einen möglichen Erkenntnisgewinn zur Folge, sondern auch den Verlust einer klaren Beziehung zu der Welt da draußen. Das Verhältnis bekommt eine abstrakte Ebene, die aber niemals ganz von dem natürlichen Blick des Selbstbewusstseins entkoppelt ist. Ein Anteil an Individualität ist wohl in jeder noch so artifziellen Perspektive enthalten. Jedenfalls gilt dies nach meiner Meinung für das vermutlich älteste „Weltbild“. Das als Ringkreuz bekannte Zeichen fndet sich über ganz Europa verteilt in den unterschiedlichsten kulturellen Zusammenhängen. Zeitlich taucht es bereits in Paläolithikum auf und wird im Allgemeinen als Sonnensymbol gelesen. Erwartungsgemäß besteht es aus einem Kreis, doch was bedeutet das Kreuz? 41 Das keltische Sonnensymbol besteht ebenfalls aus einer Scheibe (oder ein Ring, ein Kreis) allerdings mit einem Punkt in der Mitte. Das Zeichen dient in der westlichen Kultur heute noch dazu, unsere Sonne auf einer Sternenkarte zu positionieren. Das bekannte keltische Scheiben-Kreuz wäre formal ähnlicher zu dem steinzeitlichen Ringkreuz, ist aber eine Assimilation aus der viel späteren christlichen Epoche. Das altägyptische Sonnensymbol besteht aus zwei konzentrischen Kreisen und bildet die Hieroglyphe „Re“. Auch das Ringkreuz fand Verwendung als Schriftzeichen in der kretischen Linear A Schrift, die möglicherweise aus dem Zeichencode der erst kürzlich identifzierten Donaukultur abgeleitet wurde, und in der mykenischen Linear B Schrift, die dem Urgriechischen Alphabet voraus ging. Es bildet die 77. Silbe „ka“. Abb.19 Das Ringkreuz Abb. 21 Sphäroidisches Weltbild Abb. 20 Nummulites perforatus Abb.22 Ringkreuz in einer „Schale“ Abb.23 Schalenstein von Bunsoh Das keltische und das altägyptische Beispiel zeigen, dass Alternativen im Rahmen des Zeichenhaften zur Benennung der Sonne leicht möglich sind, doch geht das ältere Sonnensymbol weit über eine rein begriffiche Defnition hinaus. Es vermittelt die elementare Beziehung zwischen unserem Fixstern und dem Leben auf der Erde besonders sinnfällig: Zunächst ist das Runde ein Unendlichkeitsbegriff. Immer wieder geht die Sonne auf und zieht ihre Kreisbahn am gewölbten Himmel. Übertragen in unsere Gegenwart dient z.B. ein Ehering als Versprechen für die Ewigkeit. Die Zahl Pi ist genauso irrational wie die Ewigkeit und defniert das unveränderliche Verhältnis zwischen dem Durchmesser eines Kreises und dessen Umfang. Pi ist eine unendliche Zahl! 42 Der Symbolgehalt der runden Form sagt uns heute noch sehr viel. Zusammen mit dem Kreuz kann das Zeichen aber auch als Rad aufgefasst werden. Tatsächlich bewegt sich die Sonne in der Vorstellungswelt des Altertums auf einem Wagen über den Himmel. Der Mond dagegen, reist meistens per Schiff. Jedoch machen die Ägypter auch hier eine Ausnahme, denn Re fährt auf der Sonnenbarke. Das Sonnensymbol hat also Speichen bekommen und es sind vier Speichen, die eine Kreuz bilden und dabei vier gleich weit entfernte Punkte auf dem Umfang festlegen. Auch das ist nicht willkürlich. Stellt man sich den „Lauf der Welt“ als ewige Bewegung vor, als Kreislauf, so sind in dieser unendlichen Bewegung fxe, stetig wiederkehrende Punkte enthalten, die wir in unserem aktuellen Kalender immer noch fnden: die Wintersonnenwende, die Frühlings-Tagnachtgleiche, die Sommersonnenwende und die Herbst-Tagnachtgleiche. Wie elementar die Kenntnis des Kalenders für eine bäuerliche Gesellschaft sein muss, leuchtet sicher unmittelbar ein. Nach Marie E.P. König hatte die kulturell vorgestellte Welt des Paläolithikums die geistige Ordnung eines Sphäroids. Die ältesten Funde, die eindeutig keinen Werkzeugcharakter haben, sind zusammen gebackene Löskugeln und einigermaßen rund geschliffene Steine. Hinzu kommen die rituelle Verwendung der menschlichen Schädelkalotte und die in glatte Felsen eingeschlagenen Schalen, die oft in Verbindung mit einem eingravierten Ringkreuz stehen. Die sphäroidische Form erhielt im Lauf der frühen Kulturgeschichte eine Teilung in zwei Halbkugeln, die von König als Abbild für die überirdische Welt und die Unterwelt interpretiert werden. Im Symbol des Ringkreuzes ist dieses Bild mit weiteren universellen Begriffen angereichert: „ ... die Welt erhielt einen Mittelpunkt. Es war der Schnittpunkt der beiden Weltachsen. Von ihm gingen die vier Himmelsrichtungen aus, die in den vier Kardinalpunkten endeten und am Scheitelpunkt vier rechte Winkel bildeten; ganz allgemein gesagt ergab sich das Strukturbild der Vier. Sie entwickelte sich nicht aus dem organischen Wachstum, sondern entsprach dem begriffichen Denken.“74 Das Strukturbild führt zur Form des Vierecks. König sieht darin einen „Umlaufgedanken“ in Anlehnung an den Lauf der Gestirne mit einer Ost-West Ausrichtung. Der Kreis bildet den Rundhorizont. Möglicherweise gibt das Bild des Ringkreuzes auch die Hauptrichtungen der Raumvorstellung als zweidimensionale Übertragung wieder, die mit weiterführenden Qualitäten aufgeladen waren. Es gibt für den egozentrisch betrachteten Raum immer ein oben und ein unten. Die waagerechte Linie kann auch als Horizont gelesen werden, oder als die irdische Ebene zwischen der überirdischen Hemisphäre und der unterirdischen Hemisphäre, die alle samt von einem Element des Göttlichen durchdrungen sind: einem Sonnenstrahl, repräsentiert durch eine senkrechte Linie. Rein formal betrachtet scheint ein Vergleich mit dem cartesianischen Koordinatensystem verlockend. Allerdings behandelt das cartesianische Koordinatensystem den geometrischen Raum analytisch. Das System dient dazu Funktionen abzubilden. Jedoch hat auch dieses System einen Ursprung (Origo) am Schnittpunkt der beiden Achsen, von dem aus die analytischen Funktionen des Raums gedacht werden. Könnte eventuell der Erfnder dieses Raummodells seine kulturelle Prägung, die zur Formulierung einer X- und einer Y-Achse führte, aus der Altsteinzeit erhalten haben? Vielleicht sind auch die Konstruktionsregeln der platonischen und archimedischen Körper auf die ältere Vorstellungswelt zurück zu führen und eben keine reine Mathematik? Alle regelmäßigen geometrischen Körper haben zwei gemeinsame Regeln: Ihre Eckpunkte müssen eine sie umfassende Kugel berühren und ihre innere Form muss sich durch eine Kugel begrenzen lassen. 43 Warum die Kugel? Genau genommen ist die Sphäre der erste platonische Körper, wenn wir sagen, dass es sich um einen regelmäßigen Polyeder mit der Kantenlänge 0 handelt. Abb.24, Die fünf regelmäßigen platonischen Körper. Von links: Tetraeder, Hexaeder, Oktaeder, Dodekaeder, Ikosaeder. Die Fähigkeit, sich die Welt von außen vorstellen zu können, wie einen geometrischen Körper, war nach Marie E. P. Königs Thesen bereits den Menschen der Altsteinzeit gegeben. Er konnte ebenfalls seinen Standpunkt in der Welt defnieren, im Schnittpunkt der gekreuzten Linien. Unsere Welt ist unverändert, in Bezug auf seine kosmischen Verhältnisse und auch unser wahrnehmendes Bewusstsein ist gleich geblieben. Die Variablen in der Beziehung sind letztlich kulturell bedingte Interpretationen. Eine klare Trennung zwischen Natur und Kultur kann in diesem Zusammenhang nicht vollzogen werden, da offenbar selbst die vermeintlich reinsten Kulturformen aus der Beobachtung der Natur hervor gegangen sind. Die Vorstellung, dass die Welt eine Scheibe ist, über der sich der Himmel in Gestalt einer Halbkugel spannt, auf der die Gestirne ihre Kreise ziehen, entspricht der visuellen Wahrnehmung. Wenn wir heute den Sternenhimmel visualisieren wollen, begeben wir uns in ein Planetarium und genießen eine Full-Dome-Projektion. Das ist letztendlich das gleiche Spiel. Es funktioniert für uns, weil diese Abbildungsmethode den Bedingungen unseres Gesichtssinns entspricht. Wir sind uns darüber im Klaren, dass es sich bei der Kuppel des Planetariums um eine Projektionsfäche handelt. Der unvorstellbar weite Raum dahinter wird in der Situation trotzdem mühelos vorgestellt. Wir wissen mittlerweile dass die Welt am Himmelsgewölbe nicht zu Ende ist und sehen quasi durch die Projektionsfäche hindurch. Nichts anderes bedeutet Perspektive: Die Projektionsfäche wird durch die Illusion von dem weiten Raum dahinter entmaterialisiert. Wie mag es wohl für die Menschen des frühen Mittelalters gewesen sein? War ihre Projektionsfäche eine undurchdringliche Wand, so wie der Bildstil der Romanik, der fächenhaft und grafsch war? Die Darstellungen, die das Weltbild der damaligen Zeit visualisieren sollen, legen das nahe (Abb.26). Demnach befndet sich hinter der Projektionsfäche nicht der unendlichen Raum, sondern ein Mechanismus, der die Gestirne in Bewegung hält.75 Abb.25 Die Himmelssphäre Abb.26 Die fache Erde 44 Nach neueren Studien über die Geschichte der Forschungen ist die Behauptung, die Menschen des europäischen Mittelalters hätten geglaubt, die Welt sei eine Scheibe, ein Mythos. Jeffrey Burten Russell verweist auf die im Mittelalter bekannten Schriften der Antike seit Pythagoras, die unsere Erde als Kugel beschreiben. Demgegenüber fndet Russell keine schriftlichen Belege für das Weltbild der Erdscheibe vor 1830!76 Das diese Idee aber gar nicht vor dem 19.Jh vorhanden war, kann nicht sein. Woher kommt beispielsweise die Darstellung der Welt auf dem Bild „Der Garten der Lüste“ von Hieronymus Bosch (um 1500, zugeklappter Zustand)? Auch die authentischen Radkarten des Mittelalters, wie etwa die Weltkarte von Epstorf (13.Jahrhundert), bildet eine runde Scheibe ab, deren Mittelpunkt von der Stadt Jerusalem besetzt wird. Nichts weist auf eine mögliche Übertragung der Weltkugel auf die Fläche hin. Abb.27 Hieronymus Bosch, Der Garten der Lüste, um 1500 Nun gut, wir wissen inzwischen sicher, dass die Erde so nicht aussieht, aber es ist nach wie vor so, dass unser Blick auf das Himmelsgewölbe sphärisch ist. In dem Zusammenhang ist auch wieder unsere Sprache sehr aufschlussreich, denn sie funktioniert nicht nur als kollektives kulturelles Gedächtnis, sondern auch als Indikator für das, was gewohnheitsmäßig ist. So sagen wir nicht, 45 dass die Sterne irgendwo im Weltraum positioniert sind, sondern wir sagen die Sterne sind am Himmel. Bei den meist tragisch verlaufenen Streitigkeiten zwischen den Astronomen des späten Mittelalters und der katholischen Kirche ging es bekanntlich auch nicht um die Frage, ob die Erde eine Scheibe ist, oder eine Kugel. Es ging darum, ob die Erde das Zentrum des Universums ist, oder ob sie um die Sonne kreist. Die Kirche beharrte auf dem geozentrischen Weltbild, das nun mal falsch ist. Der Grund für die vehemente Verteidigung des geozentrischen Weltbildes durch die katholische Kirche wird indes eher ideologisch als wissenschaftlich gewesen sein. Nicht mehr die Mitte der „göttlichen Schöpfung“ zu sein, wurde wohl als ein inakzeptabler Verlust an Bedeutung aufgefasst, der einen Machtverlust für den heiligen Stuhl bedeutet hätte. Aus Sicht des Papstes war dies eine begründete Befürchtung, denn das Aufkommen des heliozentrischen Weltbildes geht zeitlich einher mit der Reformation. Abb.28 Schema für eine Sternenkarte Abb.29 Das geozentrische Weltbild Dennoch, wie im Ames-Raum, oder bei der Reisekrankheit, verhindert besseres Wissen nicht die Wahrnehmung der Welt als eine fache Scheibe unter einem Himmelsgewölbe, was unter Umständen deutlich wird, wenn man sich auf dem Globus an einem Ort befndet, von dem aus man „den Rand der Welt“ sehen kann. Wenn man an einem klaren Tag auf See den Horizont als deutliche Grenzlinie zwischen Himmel und Erde erkennt, ist uns heute bewusst, dass man nicht weiter sehen kann, weil die runde Form der Erde dies verhindert. Wenn jedoch ein Schiff in Sicht kommt, von dem nur die Masten und Antennen gerade noch über den Horizont ragen und der Rumpf unsichtbar bleibt, sieht es durch das Fernglas so aus, als fahre das Schiff zur Hälfte unter Wasser. Das Bild wird nicht verhindert, wenn man sich vergegenwärtigt, dass das Schiff hinter der Erdkrümmung fährt. Auf Meeresniveau (Niveau ist französisch für: ebene Fläche auf einer bestimmten Höhe) sieht man die Erdkrümmung nicht, man kann sie nur denken. Was man sieht, ist ein runder Horizont, von dem man umgeben ist. Um die Erdkrümmung sehen zu können, muss man sich sehr weit nach oben begeben. Auch wenn dies dem Menschen des Altertums nicht möglich war, zeigte Aristoteles in seinem Buch „Über den Himmel“, dass es genügend andere Mittel gab, um die runde Form der Erde nachzuweisen. Aristoteles beschrieb die unterschiedliche Länge der Schatten an unterschiedlichen Orten auf dem Planeten und beobachtete den runden Schatten der Erde bei einer Mondfnsternis. Für Aristoteles bestand kein Zweifel an der runden Form der Erde und damit war für ihn auch klar, warum ein Schiff hinter dem Horizont verschwindet. Das Himmelsgewölbe wurde von ihm jedoch weiterhin geozentrisch und sphärisch beschrieben. Seine Sphären waren keine ge- 46 dachten Projektionsfächen, sondern reale Schichten, welche die runde Erde umschließen, wie die Schichten einer Zwiebel ihren Keim umschließen. In diesem Aufbau der Welt sollte sich die perfekte, gleichsam göttliche Ordnung abbilden und es wurde Jahrhunderte lang versucht dieses Bild der Sphärenharmonie mit den Gesetzen der Natur und der Mathematik in Einklang zu bringen.77 Auch wenn diese Versuche alle gescheitet sind, hält sich hartnäckig das visuelle Feld in Gestalt einer Sphäre, besonders dann, wenn es darum geht die Position eines Objektes im Raum zu defnieren, wie beispielsweise bei dem Schema einer Sternenkarte (Abb.25 u. 28). Wie auch immer man sich die Welt als Ganzes vorgestellt hatte, die kugelige Form der Erde war gesichertes Wissen78. Eine Karte dieser Welt zu erstellen, um nicht immer einen Globus mit sich herum tragen zu müssen, brachte allerdings einige praktische Schwierigkeiten mit sich, die aus der Tatsache resultieren, dass man die Oberfäche einer Kugel nicht auf einer Planfäche ausbreiten kann. Die geometrischen Eigenschaften einer Kugel lassen dies nicht zu. Es ist lediglich möglich die Oberfäche einer Kugel zu berechnen und den Wert dann auf eine beliebige Planfäche zu übertragen. Wenn aber defnierte Punkte von einer Kugeloberfäche auf eine Planfäche projiziert werden sollen, enthält das Ergebnis je nach verwendeter Methode zwangsläufg eine mehr oder weniger große Abweichung von den Verhältnissen auf der Kugeloberfäche. Die erste Herausforderung in diesem Zusammenhang bestand darin möglichst genaue Land- und Seekarten herzustellen. Die frühen Entwürfe für eine Weltkarte verwendeten Projektionen auf die Innenseite eines Zylinders, in dessen Inneren die Weltkugel steckte (Eratosthenes, 3.Jh.v.Chr.). Oder ein Kegel wurde wie ein Hut auf die damals bekannte Nordhalbkugel gesetzt (Marinos von Tyros, Ptolemaios, 2.Jh.n.Chr.). Die so gewonnen Übertragungen von der Kugeloberfäche auf die innere Oberfäche eines anderen geometrischen Körpers konnte nun auf einer Planfäche ausgelegt werden. Die Karten enthielten bereits ein Koordinatensystem (Kartennetz), das den Kartenleser über die sphärische Abweichung unterrichtete, die sich aus der Projektionsmethode ergab. Im 20. Jh. führte die politisch ideologische Interpretation der Verzeichnungen, die sich ja nur aus einem geometrischen Problem ergeben hatte, zur Kritik an den bis dahin verwendeten Lösungen und zu dem Vorschlag einer Alternative mit einem gesellschaftspolitischen Fokus (Gall-Peters-Projektion). Diese Lösung rückt die Südhalbkugel, mit den damals als Entwicklungsstaaten oder dritte Welt bezeichneten Ländern, stärker in das Zentrum, was aber dann eine Verzerrung der anderen Weltregionen bedingt. Der Klassenkampf und die Kritik am wirtschaftlichen Imperialismus der Industriestaaten führen dabei zu einer verzerrten Projektion, die an die propagandistische Bedeutungsperspektive des Mittelalters erinnert. Länder und Weltregionen, die im Verhältnis größer und im Bildzentrum dargestellt wurden, sollten damit auch eine größere Bedeutung erhalten. Eine Steigerung erhält diese Haltung in jüngerer Zeit durch das so genannte „worldmapper-project“, das auf geographische Genauigkeit keinerlei Rücksicht nimmt, um die Weltkarte für sozialpolitische Agitation zu missbrauchen. Die Aufadung der Weltkarte mit politischen Einzelaspekten sorgt so nicht nur für eine groteske geometrische, sondern auch für eine inhaltliche Verzerrung der Darstellung. Um nicht ungerecht zu sein muss allerdings auch gesagt werden, dass die Vermessung und Darstellung der Welt in nahezu jedem Fall eine machtpolitische Ebene hat. Dies jedoch nicht unbedingt in Gestalt von oberfächlicher Agitation. Die neutralste und in Bezug auf das Projektionsproblem der Erdkugel beste Lösung unserer Zeit bildet für mich die Internet-Tools Google-Earth oder auch Google-Maps. Hier ist der User frei in der Wahl seines Standpunktes. Er kann die Welt aus der Distanz betrachten, oder nah heran zoomen. Seine Position ist in den Erdorbit verlegt, dem Ort der antiken Sphärenharmonie. Der Perspektivwechsel ist durch den variablen Blickwinkel immer gegeben. Die Projektion auf die Planfäche des Computermonitors ist durch die Bewegungsfreiheit in alle Richtungen selbst erklärend 47 und entzieht sich dem missionarischen Eifer auf der Erdoberfäche. Damit handelt es sich nicht nur einen Sieg des Individuums über die Propaganda, gleich welcher Art und Absicht, sondern auch um die Lösung eines uralten Darstellungsproblems für die Weltkarte. Auch wenn es heute unzählige Methoden gibt, aus denen man je nach Aufgabenstellung der Abbildung auswählen kann, ist das Grundprinzip der sphärischen Projektion gleich geblieben, da nun einmal die geometrischen Gegebenheiten der Kugel unverändert sind. Abb. 30 Links: Kegelprojektion, Mitte: Azimutalprojektion, rechts: Zylinderprojektion (Grafk von Sabine Baum) Die Kompensation des Problems wird neben den genannten Kegel- und Zylinderprojektionen grundsätzlich von drei azimutalen Projektionen realisiert, die orthographische-, die stereographische- und die gnomonische Projektion. Der Verweis auf den Azimut stammt aus der Vermessung des Sternenhimmels. Dabei wird die Position eines astronomischen Ereignisses mit den Abständen von der gedachten Linie des Himmelshorizontes und einem darauf liegenden Fixpunkt defniert. Die Anwendung in der Kartographie und in der Differenzialgeometrie zeigt die Übertragbarkeit von Lösungen, solange das Problem mathematisch defnierbar ist. Zu den drei Grundtypen kommen im Verlauf der Wissenschaftsgeschichte zahlreiche Variationen und Erweiterungen, die jeweils durch ihre spezifschen Abbildungseigenschaften von einander unterschieden werden. Je nach Aufgabenstellung können längentreue, winkeltreue oder fächentreue Projektionsverfahren angewendet werden. Es liegt jedoch in der Natur der Sache, dass keine der möglichen Metho- 48 den eine perfekte Abbildung der Kugeloberfäche auf der Planfäche realisiert. Es müssen jeweils mehr oder weniger große Kompromisse akzeptiert werden. Abb.31 a) bis e) Zweidimensionale Darstellung der drei azimutalen Projektionen und zwei Variationen. (Grafken von Lars H. Rohwedder auf wikipedia.org) Die orthographische Projektion überträgt jeden Punkt auf der Oberfäche einer Halbkugel auf die Tangentialebene (die Projektionsfäche), indem die Projektionen parallel und lotrecht auf die Fläche treffen. Damit wird die Krümmung der Sphäre graphisch dargestellt. Das Ergebnis ist in etwa vergleichbar mit der Abbildung einer Fischaugenoptik. Die orthographische Projektion kann nur eine Halbkugel (Hemisphäre) abbilden. Die stereographische Projektion realisiert die Übertragung durch ein Projektionszentrum auf dem Umfang der Sphäre. Sie entspricht nach ihrem grundsätzlichen Prinzip der Projektion im menschlichen Auge, bei der die Linse das Projektionszentrum bildet. Die spezifsche Eigenschaft der stereographischen Projektion ist ihre Konformität, durch die beispielsweise ein Kreis der sich auf der zu übertragenen sphärischen Oberfäche befndet, auch als Kreis auf der Tangentialebene abgebildet wird. Die Abstände der Längen- und Breitengrade des Kartennetzes auf dem Globus werden in gleichen Abständen auf der Planfäche wieder gegeben. Die gnomonische Projektion (Zentralprojektion), deren Projektionszentrum der Mittelpunkt der Sphäre ist, ist identisch mit der Projektion der Zentralperspektive (siehe dazu entsprechend Abb.14). Das System ist von der einfachsten Sonnenuhr (griechisch: Gnomon) abgeleitet, bei der lediglich ein Stab senkrecht in den Boden gesteckt werden muss. Großkreise (z.B. die Längengrade des Globus) werden durch die gnomonische Projektion als gerade Linie auf die Planfäche übertragen. Die gnomonische Projektion ist weder winkeltreu, noch fächentreu. Ihr Abbildungswinkel ist kleiner als 180 Grad. Es ist die vermeintlich älteste Übertragungsmethode, die bereits um 600 v. Chr. von Thales von Milet beschrieben wurde. 49 Soll die ganze Sphäre auf eine Planfäche übertragen werden, ist das mit einer gradlinigen Projektion nicht möglich. Abb. 31 d) und e) zeigen zwei Beispiele für die Lösung des Problems in der azimutalen Projektion, die zwei ganz verschiedene Bilder ergeben. Andere Kartennetzentwürfe breiten die Erdkugel auf einer Ellipse aus, wie etwas die Mollweide-Projektion. Auch wenn die sphärischen Projektionen nicht in erster Linie für die Kunst entwickelt wurden, wie etwa die lineare Perspektive, sondern in der Kartographie, der Kristallographie oder ganz allgemein in der Mathematik Anwendung fnden, handelt es sich um Bild gebende Verfahren die zum Teil Gegebenheiten der physiologischen Optik und damit die Raumwahrnehmung des Menschen illustrieren. So weist Hermann von Helmholtz in seinem Handbuch der physiologischen Optik auf die Riemannsche Projektion (also die stereographische Projektion) hin, um das Sehen zu beschreiben. „ Ich sage: Das Auge sieht die Objecte im Sehfelde scheinbar so verteilt, wie es sie nach geometrisch richtiger Projection sehen würde, wenn es die Bilder auf der Kugeloberfäche vom Occipitalpunkte desselben aus ansähe. Oder auch: Das Auge sieht die Gegenstände des Gesichtsfeldes wie in einer vom Occipitalpunkte aus entworfenen stereographischen Projection, wie sie bei geographischen Karten für Erdhalbkugeln angewendet wird.“79 Dies ist für den sonst sehr umsichtig und differenziert argumentierenden Universalgelehrten Helmholtz eine auffällig entschiedene Aussage. Ich muss dazu einwenden, dass der Zweck der stereographischen Projektion die Abbildung der Kugeloberfäche auf einer Planfäche ist. Diese Abbildung hat trotz ihrer Eigenschaft Kreise auch als vollkommene Kreise wieder zu geben, was einen grundsätzlichen Unterschied zur linearen Perspektive ausmacht, eine verzerrte Zeichnung gegenüber dem Bild auf der Sphäre. Dies scheint zunächst widersprüchlich in Bezug auf die Raumwahrnehmung. Helmholtz´ Vergleich wird aber nachvollziehbar, wenn wir seine Untersuchungen über die Augenbewegungen, das monokulare Gesichtsfeld und die Wahrnehmung der Tiefendimensionen genauer betrachten. Das monumentale Handbuch der physiologischen Optik von Hermann von Helmholtz bildet einen bedeutenden Eckpunkt in der Historie der Forschung zu diesem Themengebiet. Das in Abschnitten bis 1867 veröffentlichte Werk klärt die Irrtümer der vorangegangenen Jahrhunderte auf und bildet nach wie vor eine bedeutende Grundlage für die Beantwortung der Frage, wie wir den Raum sehen. Helmholtz teilt die physiologische Optik in drei Schwerpunkte ein: 1) Die Lehre von den Wegen des Lichts im Auge, 2) die Lehre von den Empfndungen des Sehnervenapparates, 3) die Lehre von dem Verständnis der Gesichtsempfndungen.80 Was zunächst vielleicht nach einer strikten Eingrenzung des Themas aussieht, stellt sich jedoch schnell als eine sehr komplexe Thematik heraus, die sich über etliche Fachbiete erstreckt, wie etwa Augenheilkunde und Anatomie bei Menschen und Tieren, Geometrie, Physik, Wahrnehmungs- und Erkenntnistheorie in der Philosophie und in der Psychologie, sowie die Wissenschaftsgeschichte für jedes dieser Fachgebiete. Entscheidend für diese Untersuchung ist besonders der dritte Abschnitt des Buches, der sich mit der Lehre von den Gesichtswahrnehmungen befasst.81 Dazu gehört zunächst auch das große Feld der Erkenntnistheorie mit der schon behandelten Einschätzung über den Begriff der Sinnestäuschung, der Frage nach der Übereinstimmung zwischen den Anschauungen, bzw. Vorstellungen und deren Objekten im Raum und grundsätzlich der Konfikt zwischen den Empirikern und den Nativisten. Eine befriedigende Darstellung dieses Themenfeldes würde den Rahmen dieses Textes bei weitem sprengen. Ich kann jedoch nicht ganz darauf verzichten, werde mich aber, Helm- 50 holtz folgend, auf den Bereich konzentrieren, den er „die praktischen Vorstellungen“ nennt. Helmholtz bezweifelt, dass es irgend einen Sinn haben kann, als von einer anderen Wahrheit unserer Vorstellung zu sprechen, als von einer praktischen.82 „Zu fragen, ob die Vorstellung, welche ich von einem Tische, seiner Gestalt, Festigkeit, Farbe, Schwere u.s.w. habe, an und für sich, abgesehen von dem praktischen Gebrauche, den ich von dieser Vorstellung machen kann, wahr sei und mit dem wirklichen Dinge übereinstimme, oder ob sie falsch sei und auf einer Täuschung beruhe, hat gerade soviel Sinn, als zu fragen, ob ein gewisser Ton roth, gelb oder blau sei. Vorstellungen und Vorgestelltes sind offenbar zwei ganz verschiedenen Welten angehörig, welche ebenso wenig eine Vergleichung unter einander zulassen als Farben und Töne, oder als die Buchstaben eines Buches mit dem Klang des Wortes, welches sie bezeichnen.“83 Zu bezweifeln ob der Zinnober wirklich rot ist, ist sinnlos, da die Vorstellung von der Farbe Rot von dem Objekt genauso abhängt, wie von der Art und Beschaffenheit des Organs mit dem die Wechselwirkung zwischen Objekt und Vorstellung hergestellt wird (eigentlich ebenso von dem Licht, das die Vorstellung des Roten bedingt). Ohne das Organ, das die Fähigkeit hat den Eindruck des Roten zu erzeugen, ergibt die Frage nach dem Roten keinen Sinn, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn jemand auch nur farbenblind für das rote Spektrum ist, ist für diesen die Vorstellung des Roten ganz und gar unverständlich. Um das Labyrinth der Widersprüche in der Erkenntnistheorie zu verlassen schlägt Helmholtz vor, einerseits von dem Kausalgesetz auszugehen, nach dem jeder Wirkung eine Ursache vorausgeht und den gewöhnlichen Gebrauch der Sinnesorgane und die daraus folgenden Vorstellungen (also Wirkungen) als gegeben zu akzeptieren. Das klingt nun nach einer eindeutigen Parteinahme für die englischen Empiriker (Berkely/ Locke/ Hume)84. Dies ist aber für Helmholtz nicht anzunehmen, denn der deutsche Nativismus85 und der kantsche Begriff des a priori dient ihm ebenfalls zur Klärung des Sachverhalts, in der Weise, dass wir in unserer sinnlichen Wahrnehmung gar nicht anders können als aufgrund der Vorbedingungen, welche durch die Sinnesorgane und die Tätigkeit unseres Geistes festgelegt sind, Wirkungen zu erzeugen. Keine der beiden widerstreitenden Lehrmeinungen wird von Helmholtz kritiklos anerkannt. „ Ebenso wie es die eigenthümliche Thätigkeit unseres Auges ist, Lichtempfndungen zu haben (...) , so ist es die eigenthümliche Thätigkeit unseres Verstandes, allgemeine Begriffe zu bilden, d.h. Ursachen zu suchen (...) Neben unserem Verstande steht wenigstens für die Auffassung der Außenwelt kein anderes gleich geordnetes Vermögen da. Was wir also nicht begreifen können, das können wir uns auch nicht als existirend vorstellen.“86 Aus diesen Darlegungen setzt Helmholtz seinen Begriff von den praktischen Vorstellungen zusammen. Diese sind immer konkret, aber subjektiv, d.h. durch eine zweite Person nicht reproduzierbar. Sie sind bewusste Vorstellung, wenn die Tätigkeit des Geistes auf einen konkreten „Gegenstand“ fokussiert, also ein aktiver Prozess. Sie können ebenso unbewusst sein, wenn sich die Tätigkeit des Geistes gerade mit anderen „Gegenständen“ befasst. Eine unbewusste Vorstellung in das Bewusstsein zu versetzen, bedarf immer einer bewussten Anstrengung des Geistes. Zu dem dynamischen und komplexen Verhältnis der Vorstellungen zu ihren Objekten gehören nun auch die physiologischen Gegebenheiten der Sinnesorgane. So beruht unser Bild vom Raum letztlich auch auf den Augenbewegungen, die durch Kontraktion der Augenmuskeln realisiert wird. Hinzu kommt die Bewegung des Kopfes und des ganzen Körpers. 51 Nach einer aufwendigen Analyse der Augenbewegungen auf der Grundlage seiner Vorgänger und eigener Messungen legt Helmholtz den Drehpunkt des normalsichtigen Auges annähernd im Mittelpunkt des Augapfels fest.87 Durch die anatomischen Unterschiede jedes einzelnen Menschen ergeben zwar unterschiedliche messbare Dimensionen, jedoch bleibt der Drehpunkt des Auges angepasst an die jeweiligen anatomischen Gegebenheiten tendenziell in der Mitte. Bei Fehlsichtigkeit durch Deformation des Augapfels kann eine verschobene Position des Drehpunkts jenseits der Mitte Wirkung auf die Verträglichkeit einer Sehhilfe haben, die den jeweiligen Bedingungen angepasst sein muss. Auf der Grundlage des fxierten Drehpunktes der Augen entwickelt Helmholtz ein mit festen Koordinaten versehenes Strukturmodel für das binokulare Sehen, das die Augenbewegungen einbezieht. Abb.32 Die Grafk, basierend auf der Beschreibung von Helmholtz, zeigt die Konvergenzstellung (also die Nahsicht) des Augenpaares in der Primärposition. Demgegenüber wären die Blicklinien in der Parallelstellung(Fernsicht) des Augenpaares parallel. Beide Augen fxieren immer nur einen Blickpunkt in der Weise, dass dieser Blickpunkt auf dem gelben Fleck (Makula lutea) abgebildet wird. Im Zentrum des gelben Flecks liegt die Fovea centralis, die Stelle des schärfsten Sehens. Allerdings liegt dieser Punkt um 5 Grad versetzt zur Blicklinie. Damit ist selbst in der Parallelstellung eine Konvergenz des Blicks durch die Anatomie der Netzhaut gegeben. Die Blicklinien verlaufen immer durch die Drehpunkte der beiden Augen. Die Bewegung der Augen nach links und rechts, nach oben und unten, sowie diagonal, bilden das Blickfeld. Die Medianlinie bezeichnet die Position der Medianebene, die Kopf und Körper in eine linke und eine rechte Hälfte teilt. Die Medianlinie bleibt im Verhältnis zum Augenpaar immer in der gleichen Position, während die Blickebene ihre Position verändert, quasi mit wandert wenn die Augen sich in die Sekundär- oder Tertiärposition drehen ( und dann nicht mehr senkrecht auf der Medianebene steht). 52 Das Strukturmodel, übertragen ins Dreidimensionale, ergibt ein Blickfeld, das die Innenseite einer Halbkugel bildet. „Wir denken uns das Blickfeld als Theil einer Kugel, deren Mittelpunkt im Drehpunkt liegt.“88 An dieser Stelle wird es notwendig einige Begriffe zu klären, die Helmholtz zur Beschreibung der Augenbewegungen verwendet. Die Primärposition der Augen bezeichnet anders ausgedrückt deren Null- oder Grundstellung, in der wir geradeaus blicken ohne die Augen zu drehen. Die Sekundärstellung bezeichnet die Bewegung der Augen auf der vertikalen oder horizontalen Achse. Die Augen sind in der Tertiärstellung, wenn die Augen diagonal jenseits der vertikalen und horizontalen Achse blicken. Helmholtz macht einen Unterschied zwischen dem Sehfeld, dem Gesichtsfeld und dem Blickfeld. Das Sehfeld ist die nach außen projizierte Netzhaut. Das Gesichtsfeld beschreibt das gesamte von den Augen wahrnehmbare Bild der Außenwelt aus der Primärposition der Augen. Das Blickfeld wird durch die Augenbewegungen gebildet und ist weder mit dem Sehfeld noch mit dem Gesichtsfeld identisch. Alle drei Felder haben eine sphärische Form, jedoch verschiebt sich das Blickfeld gegenüber dem Sehfeld, durch die Augenbewegung, etwa so als würde man zwei Halbkugelschalen, die ineinander liegen gegeneinander verdrehen.89 Die drei durch Begriffe getrennten visuellen Sphären haben jedoch den gleichen Mittelpunkt und sind damit konzentrisch. Auf der Grundlage seiner Festlegungen geht Helmholtz daran das Gesetz der Raddrehung der Augen nach der Defnition von Listing90 zu überprüfen und zu erklären. Abb. 33 zeigt die Listingsche Ebene mit den drei Drehachsen des Auges, die sich alle drei um den Drehpunkt bewegen. Bei jeder Drehung einer oder mehrerer Achsen bewegt sich die Listingsche Ebene im Sinne der jeweiligen Achsendrehung mit. Das Gesetz der Raddrehung besagt, dass die Augen eine minimale Drehung (Torsion) um die YAchse (nach Helmholtz die Blicklinie) vollziehen, wenn sie nach schräg oben oder schräg unten blicken, wenn sie sich also in der Tertiärposition befnden. In der Konvergenzstellung der Augen (Nahsicht) ist die Drehung eine andere als in der Parallelstellung (Fernsicht). 53 Helmholtz beschreibt einen Selbstversuch zur Klärung der Raddrehung der Augen um die Blicklinie (Y-Achse), bei dem er vertikale und horizontale Linien auf einer Wand in Bezug zu deren Nachbildern91 in der Tertiärsposition der Augen analysiert. Seine Beobachtungen der Nachbilder ergeben ein Hyperbelraster.92 Abb.34 Hyperbelraster93 nach Helmholtz´ Untersuchung über die Raddrehung der Augen. A_B bezeichnet den Augenabstand zur Wand, a ist der Blickpunkt in der Primärstellung. Dieses Abbildungsmuster hat mir sehr zu schaffen gemacht, da ich immer davon ausgegangen bin, dass ich Linien, die in der Natur gerade sind auch als solche wahrnehme, auch wenn mir klar ist, dass deren Projektion auf einer sphärischen Oberfäche stattfndet94. Ich habe den Selbstversuch von Helmholtz wiederholt und komme der Tendenz der gebogenen Linien nach zu dem gleichen Ergebnis. Allerdings sehe ich dabei keine Nachbilder gebogenen Linien, sondern Nachbilder gerader Linien, die durch die Torsion meiner Augen diagonal verlaufen. Das Hyperbelraster wäre demnach also eine Addition der verschiedenen Nachbilder diagonaler Linien, die zu gekrümmten Linien zusammengefasst sind. Das gleiche Muster taucht an späterer Stelle wieder auf, wenn es bei Helmholtz um das monokulare Gesichtsfeld und die Eigenschaften des indirekten Sehens geht. „Wir können das Blickfeld zum Zweck seiner geometrischen Ausmessung als eine Kugelfäche von unendlich grossem Radius betrachten, ähnlich dem Himmelsgewölbe, deren Mittelpunkt im Drehpunkt des Auges ist. Der Ort eines gesehenen Punktes im Blickfelde wird gefunden, wenn man durch ihn und den Drehpunkt des Auges eine gerade Linie legt und diese bis zur imaginären Fläche des Blickfeldes verlängert denkt. Wo sie die Fläche des Blickfeldes schneidet, ist der geometrische Ort des gesehenen Punktes im Blickfelde, den wir in vielen Fällen zu unterscheiden haben werden von dem scheinbaren Ort im Blickfel- 54 de, an welchen wir das gesehene Object nach der Schätzung vermittels des Augenmaßes verlegen.“95 Helmholtz muss diese Aufweichung der geometrisch exakten Regeln der Kugelfäche machen, um der folgenden Untersuchung gerecht werden zu können, die sich mit der Wahrnehmung gerader und gebogener Linien befasst. Seine Beobachtungen widersprechen der Geometrie der Sphäre und deren Projektionsgesetzen. Auch die stereographische Projektion, die Helmholtz als Erklärungsmodel für die visuelle Wahrnehmung vorschlägt, ist damit nur zum Teil in Deckung zu bringen. Er erklärt dies zunächst dadurch, dass das Sehfeld, das er vom Blickfeld unterscheidet, auch wenn beide den gleichen Drehpunkt haben, einen fxierten Punkt aufgrund der Augenbewegungen und dem indirekten Sehen an minimal anderer Position abbildet. Dies wird allerdings nur bei sehr nahen Objekten deutlich. Wenn eine gerade Linie auf die Oberfäche einer Kugel projiziert wird (=Orthodrome: die kürzeste Verbindung zweier Punkte auf einer sphärisch gekrümmten Oberfäche), so wird diese Linie vom Mittelpunkt der Kugel aus auch als gerade Linie erscheinen. Gleiches gilt für Großkreise auf der Sphäre (Also Linien, die dem Umfang einer Kugel entsprechen wie z.B. der Äquator und die Meridiane auf dem Globus). In der visuellen Wahrnehmung des Menschen ist dies nach Helmholtz aber nur unter „gewissen Bedingungen“ der Fall. Wir halten uns ein Lineal waagerecht und sehr nah vor die Augen und schauen geradeaus auf dessen Kante. Die Kante erscheint gerade. Wenn wir das Lineal nach oben oberhalb des Augenhorizontes halten und weiterhin grade aus schauen, das Lineal also „indirekt“ sehen, erscheint es konkav nach unten gekrümmt. Halten wir es unten, unterhalb des Augenhorizontes so erscheint es konkav nach oben gekrümmt.96 Bei einem Lineal habe ich selbst Mühe diese Krümmung zu sehen. Das Phänomen wird für mich erst deutlich, wenn ich gerade und parallele Kanten betrachte, die sich weiter in Richtung des peripheren Gesichtsfeldes ausdehnen, wie etwa die Böden eines langen Bücherregals, an das ich sehr nah herantrete. Dass diese Krümmung im peripheren Blickfeld erscheint, macht für Helmholtz den entscheidenden Unterschied zwischen dem Sehfeld und dem Blickfeld aus. Die Augenbewegungen, insbesondere die Torsion der Augen, die Eintritt, wenn man die Augen einem Punkt im peripheren Blickfeld zuwendet, kompensieren diese Unterschiede zwischen Sehfeld und Blickfeld. Zu meiner Verwunderung bezeichnet Helmholtz die Krümmungen im peripheren Blickfeld allerdings als Täuschungen. An anderer Stelle hat er uns erklärt, dass sich die Sinnesorgane nicht täuschen. Ein anderes einfaches Experiment ist für mich leichter nachzuvollziehen97. Ein Papierstreifen von drei bis fünf Zoll Breite wird zu einem Halbzylinder gebogen und vor die Augen gehalten, so dass die Mitte des Papierstreifens im Augenhorizont liegt. Fixiert man die Mitte, wölben sich die Ecken des Papierstreifes nach oben. Er scheint an den Enden breiter zu sein, als in der Mitte. Das sehe ich auch so. Wenn ich den Blick nach oben, oder nach unten zur Kante des Papierstreifens wandern lasse, verstärkt sich die Krümmung. Das macht Sinn, denn im Raum vor den Augen befndet sich eine gebogene Linie, die auch als solche gesehen wird. Bemerkenswert ist aber wieder die Veränderung dieser Linie zwischen der direkten und der indirekten Ansicht. Die beobachteten Krümmungen im Blickfeld werden von Helmholtz wiederum als Raster auf eine Planfäche übertragen. 55 Abb.35 Darstellung der Krümmungen des indirekten Sehens im Blickfeld, nach Helmholtz. A bezeichnet den Augenabstand, den man zum Mittelpunkt einnehmen muss, um das Bild im Sinne von Helmholtz´ Untersuchung richtig sehen zu können (es muss also vergrößert werden). Die Ähnlichkeit zur Abb.32 fällt sicher sofort auf und tatsächlich handelt es sich um das gleiche Muster mit den gleichen Hyperbelkrümmungen. Auch der vorgegebene Augenabstand ist gleich groß. Der Augenabstand im Verhältnis zum Durchmesser entspricht einem Winkel von 90 Grad. Bei Fixierung des Mittelpunktes, mit dem vorgegebenen Augenabstand im richtigen Verhältnis zur Grafk, erscheinen die gebogenen Linien gerade „...oder wenigstens als Linien, die nicht in der Fläche des Sehfeldes gekrümmt sind.“98 Das Bild erscheint als faches Schachbrettmuster. Sobald man jedoch den Blick zum Rand wendet, erkennt man die Krümmung. Dabei soll man nach Helmholtz´ Beschreibung die fache Zeichnung selbst gewölbt sehen, so als wäre sie eine Schüssel. Durch diese Erscheinung wird der Widerspruch zwischen dem direkten und dem indirekten Sehen einigermaßen aufgehoben. Helmholtz folgert, dass das Gesichtsfeld selbst gekrümmt erscheint. Am äußersten Rand des Gesichtsfeldes kippt das Muster um, was vermutlich mit der Begrenzung für die Torsion der Augen zusammen hängt. Wenn die Augen sehr weit zum Rand gedreht werden, spürt man bald die dafür notwendige starke Kontraktion der Augenmuskeln. Wenn ein Objekt im sehr weit dezentralen Gesichtsfeld unsere Aufmerksamkeit erregt, werden wir daher nicht nur die Augen dorthin wenden, sondern auch den Kopf drehen. Die Kombination zwischen Augenbewegungen und Kopfbewegungen erfolgt nach dem Prinzip des geringsten Energieaufwandes. Eine extreme Torsion in der entsprechend extremen Tertiärposition ist daher im Bewegungsapparat der Augäpfel nicht vorgesehen. 56 „Eine farbige kreisförmige Pappscheibe vor einem contrastierenden Grund gehalten, erscheint daher am oberen und unteren Rande des Sehfeldes als eine elliptische Scheibe mit längerem horizontalem Durchmesser. Weniger deutlich zeigt sie sich am rechten oder linken Rand des Sehfeldes als Ellipse mit längerem verticalem Durchmesser.“99 Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die von Leonardo da Vinci gegebene Empfehlung zur Darstellung von kreisförmigen Objekten am oberen Bildrand. Die Randverzerrung der linearen Perspektive sollte bei Kreisen kompensiert werden, indem sie nicht rund, sondern eiförmig gemalt werden. Dies aber im entgegen gesetztem Sinne zur obigen Beschreibung und auf der Grundlage der gradlinigen Projektion auf Albertis Schnitt durch die Sehpyramide (die eine gnomonische Projektion ist). In der linearen Perspektive gibt es keine Unterscheidung zwischen direktem und indirektem Sehen. Tatsächlich kommt Helmholtz zu dem oben zitierten Schluss für diese Untersuchung, nach dem das Auge die Gegenstände im Sehfeld verteilt sieht, wie bei einer stereographischen Projektion. Helmholtz selbst erklärt, dass er das geometrische Bild der stereographischen Projektion auch nur als solches betrachtet wissen möchte, da es nicht alle Hauptzüge der Verteilung im Sehfeld beinhaltet. Hinzu kommt, dass diese geometrische Abbildung nur für das Sehfeld (die nach außen projizierte Netzhaut) gilt. Für das Blickfeld würde das System schon nicht mehr funktionieren. Die stereographische Projektion realisiert ein Bild auf einer Planfäche und hat ein unbewegliches Projektionszentrum (von Helmholtz als Occipitalpunkt bezeichnet). Sobald sich das Projektionszentrum bewegt, kann dies im Blickfeld nur kompensiert werden, wenn die Projektionsfäche die Bewegung des Projektionszentrums mitmacht, so dass die Fläche immer senkrecht zur Mittelache der Projektion steht, wie etwa die Listingsche Ebene im Verhältnis zur Y-Achse oder die von Helmholtz in das System eingeführte Blickebene. Übertragen auf ein faches Bild, das an der Wand hängt, würde das bedeuten, dass sich das Bild um den Betrachter herum bewegen müsste, wenn er vor dem Bild die Augen bewegt. Dies immer so, dass die Bildfäche lotrecht zur Blickrichtung steht. Wer das für eine alberne Idee hält, dem sei empfohlen einen Fotoapparat zur Hand zu nehmen, durch den Sucher zu schauen und mit dem Apparat den Raum abzuschwenken. Auf der Mattscheibe, bzw. dem digitalen Display der Kamera erscheint dabei eine linearperspektivische Projektion, die synchron zur Schwenkbewegung um den Betrachter herum wandert. Mit dem Druck auf den Auslöser wird die Bewegung in einem bestimmten Moment fxiert, d.h. es wird ein Schnitt durch Albertis Sehpyramide gemacht. Mit einer Film- oder Videokamera ließe sich die Bewegung aufnehmen, aber mit der Kinoprojektion, oder der Monitordarstellung befnden wir uns am Ende doch wieder in der Welt der linearen Perspektive. Ich bin nicht von der stereographischen Projektion als Prinzip der physiologischen Optik überzeugt. Besonders nicht in Bezug auf die eigentümlichen Wahrnehmungen durch die Augenbewegungen. Die mit Wechsel zwischen der Parallelstellung (Fernsicht) und der Konvergenzstellung (Nachsicht) einhergehende Akkomodation100 der Linsen ist in diesem Zusammenhang noch gar nicht behandelt worden. Die stereographische Projektion, wie Helmholtz sie anwendet, realisiert die Übertragung der sphärischen Netzhaut auf eine Planfäche. Dabei sollte doch nach Helmholtz´ Meinung die Form der Retina für das Sehen keine Rolle spielen. Nach allem was bis hierhin über die physiologische Optik angeführt worden ist, sind die Erscheinungen des Gesichtsfeldes, bzw. des Blickfeldes, für mich nur dann auf einer Planfäche reproduzierbar, wenn sich die Augen nicht bewegen. Dies ist aber bereits eine der grundsätzlichen 57 Schwächen der linearen Perspektive. Unsere Augen bewegen sich unentwegt, mit weit reichenden Folgen für die Wahrnehmung der Objekte im Raum und auf einer Abbildung. Zu Beginn des 20sten Jahrhunderts geht Ernst Mach die Frage nach den Raumempfndungen des Auges und allgemeiner der Vorstellung vom Raum eher von der erkenntnistheoretischen Seite an. In den antimetaphysischen Vorbemerkungen zu seiner Analyse der Empfndungen101 wendet sich Mach ab, von dem bis dahin vorherrschenden Konfikt zwischen den Empirikern, die in ihren Untersuchungen vom Gegenstand ausgehen, und den Nativisten, die vom erkennenden Subjekt ausgehen. Mach schlägt als dritte Methode den Monismus vor. Um weder als Realist noch als Idealist aufgefasst zu werden, betrachtet er die Phänomene von einem neutralen Standpunkt aus. Dieser Standpunkt liegt aber nicht jenseits der Physik und der Psychologie, sondern verbindet beide. So widerspricht Mach dem Dualismus von Körper und Geist. Die Trennung von Leib und Seele ergibt Scheinproblem, die sich nur aus der getrennten Betrachtung des Physikalischen und Metaphysischen ergeben. Das Grundprinzip von Machs Analyse der Empfndungen ist: das Physische und das Psychische bilden eine Einheit. In dem Buch „Erkenntnis und Irrtum“ stellt Mach eine kausale Beziehung zwischen dem euklidischen Raum (Geometrie) und dem damit unvereinbaren physiologischen Raum her.102 Der geometrische Raum ist leer, homogen und unendlich. Er enthält nur idealisierte mathematische Körper und drei rein quantitative Dimensionen. Länge, Breite und Höhe werden durch ein Koordinatensystem gebildet, deren Achsen sich im Nullpunkt kreuzen. Der geometrische Raum hat scheinbar keine Beziehungen zu dem Subjekt, das sich diesen Raum vorstellt. Die Objekte im geometrischen Raum haben nur Beziehungen untereinander. Der physiologische Raum ist dagegen inhomogen und begrenzt. Er ist immer bezogen auf das wahrnehmende Subjekt und seine Dimensionierung enthält Qualitäten, die mit Bedeutungen aufgeladen sind. Die Raumkoordinaten des physiologischen Raums lauten: oben und unten, rechts und links, nah und fern (eigentlich auch vorn und hinten). Die Unvereinbarkeit dieser beiden Raumkonzepte, wie auch die Verwirrung die in dem Diskurs über den Raumbegriff enthalten ist, entspringt meiner Meinung nach dem Umstand, dass wir den Raum an sich gar nicht wahrnehmen. Die Crux ist, dass wir den Raum nur identifzieren anhand von Dingen, die eine räumliche Ausdehnung haben. Der Raum an sich ist für uns nicht greifbar. Dennoch haben wir einen Begriff vom Raum. Die Defnition dieses Begriffs vom „unsichtbaren“ Raum hat offenbar zu einer Idealisierung geführt, die der subjektiven sinnlichen Wahrnehmung zu widersprechen scheint, die aber trotzdem nicht aus der Luft gegriffen ist. Nach Mach ist der geometrische Raum und dessen abstrakte Regeln aus der Erfahrung schrittweise durch Reduzierung und Vereinheitlichung entwickelt worden. „ So wie es ohne Wärmeempfndung keine Wärmelehre gäbe, so auch keine Geometrie ohne Raumempfndung.“103 Die ersten Maße waren, wie die Koordinaten des physiologischen Raums, auf den Körper bezogen. Eine Handbreit, eine Spanne, eine Elle, ein Fuß, ein Schritt usw. bildeten die Längeneinheiten. Hohlmaße wurden durch Schüttungen vereinheitlicht, wie etwa eine Hand voll, ein Scheffel, ein Krug, ein Fass. Zeiteinheiten waren nicht nur mit dem Körper, sondern auch mit dem Raum verbunden. So wurde ein Augenblick, eine Zeitspanne und eine Tagesreise ein Ausdruck für einen Ablauf mit einem Anfang und einem Ende, der im Raum stattfand. Dies als Ergänzung und Verfeinerung zu den kosmischen Zeiteinheiten die durch den Lauf der Sonne, des Mondes, der Gezeiten, der Jahreszeiten usw. als natürliche Erfahrung gegeben sind. Aus dem Blickwinkel des 58 Subjekts bilden Raum und Zeit eine untrennbare Einheit. Diese Einheit entsteht aus der konkreten Erfahrung der räumlichen Ausdehnung und dem zeitlichen Ablauf eines Vorgangs. Die Gemeinsamkeit der alten körperlichen Maße ist die Vereinheitlichung in kleine Einheiten, zur Herstellung der Allgemeingültigkeit einer subjektiven Erfahrung, um die Möglichkeit zu schaffen, etwas aus- oder abzuzählen und dann zu kommunizieren. Im Verlauf der Kulturgeschichte wurde aus der Schrittlänge eines Bauern, der sein Feld abschreitet um dessen Größe zu bestimmen, ein Yard (=3 Fuß, oder 0,9114 Meter). Die Multiplikation der Schrittfolge in eine bestimmte Richtung mit der Schrittfolge in eine andere Richtung ergibt bereits die geometrische Form einer Fläche. Die gleiche Vereinheitlich lässt sich bezüglich der Raumkoordinaten annehmen. Was zuvor als oben und unten bezeichnet und als Richtungsangabe von einem Subjekt aus gedacht worden war, erhielt im geometrischen Raum einen positiven oder negativen Wert auf der Z-Achse. Ich erinnere in dem Zusammenhang an die Listingsche Ebene (siehe Abb.33), die das Koordinatensystem des geometrischen Raums benutzt um eine physiologische Eigenschaft zu beschreiben. Die Systeme zeigen hier ihre Verwandtschaft durch die Möglichkeit einer (Rück-) Übertragung. Es ist lediglich nötig den Nullpunkt der analytischen Geometrie durch den Drehpunkt des Auges zu ersetzen. Die Übereinstimmung in der Grundstruktur defniert Mach mit der Aussage: „Beide Räume sind dreifache Mannigfaltigkeit“104 Den Standpunkt des erkennenden Subjekts nun nach irgendwo in den leeren homogenen Raum zu versetzten scheint indes keine Kleinigkeit und weniger nahe liegend zu sein. Mach stellt die These auf, dass alle Raumempfndungen die Funktion haben, unsere Bewegungen im Raum (Lokomotion) zu leiten. Gerade unsere Bewegungen und die daraus entnommenen Erfahrungen motivieren die Vorstellung von einem in alle Richtungen homogenen Raum. „Die beliebige Lokomotion des Leibes als Ganzes, und die Möglichkeit beliebiger Orientierung desselben, fördern die Einsicht, dass wir überall und nach allen Richtungen dieselben Bewegungen ausführen können, dass der Raum überall und nach allen Richtungen gleich beschaffen ist und dass derselbe als unbegrenzt und unendlich vorgestellt werden kann. Der Geometer sagt, von jedem Punkt des Raumes aus, und in jeder Orientierung, seien dieselben Konstruktionen ausführbar. Bei gleichmäßig fortschreitender Lokomotion wiederholen sich immer dieselben Änderungen der Raumwerte.“105 Die Abstraktion der Raumerfahrung ist jedoch mit der komplexen Wahrnehmung des Subjekts immer nur in der Grundstruktur in Deckung zu bringen. So wird die Defnition eines Punktes um Raum durch einen metrischen Wert für mich immer einen geringeren Gehalt haben, als die Feststellung, dass sich ein Objekt in der Entfernung einer Armlänge vor meinem Gesicht befndet. Die Raumempfndungen des Auges analysiert Mach wesentlich anhand der physiologischen Raumdimensionen.106 Dabei können zwei nebeneinander stehende Gestalten geometrisch kongruent, physiologisch aber ganz verschieden sein. Wenn etwa ein Quadrat neben einem Karo gleicher Größe steht (), so ist die Erkenntnis der Ähnlichkeit der beiden Figuren nach Machs Meinung das Ergebnis einer intellektuellen Operation. Es muss analysiert werden, was die Gemeinsamkeit der beiden Figuren ist, bezüglich der Länge der Seiten und der Größe der Winkel, um letztlich zu dem Ergebnis kommen zu können, dass beide gleich sind und sich nur durch ihre Lage im Raum unterscheiden. Es gibt demnach einen Unterschied zwischen der geometrischen und der optischen Ähnlichkeit räumlicher Anordnungen. Optisch ähnlich werden zwei gleiche Fi- 59 guren erst, wenn sie auch richtig liegen. Machs Lösung hierfür ist die Symmetrie, die er auf die körperlichen Gegebenheiten des Menschen zurückführt. Die Medianebene des Kopfes, wie auch des ganzen Körpers, als auch der motorische Apparat der beiden Augen sind achsensymmetrisch. Die physiologischen Raumkoordinaten links und rechts bezeichnen demnach die beiden Hälften eines symmetrischen Raumbildes. Die sich daraus ergebene Symmetrie ist jedoch unvollkommen, z.B. durch die Herausbildung einer bevorzugten „Schreibhand“ und die sich daraus entwickelnde unterschiedliche Entwicklung der beiden Gehirnhälften. Diese Entwicklung scheint sich auch auf das Sehzentrum auszuwirken. Im Zusammenhang mit Landschaftsaufnahmen, die ich aus der Hand gemacht habe ist mir aufgefallen, dass die Bilder immer leicht nach rechts gekippt sind, obwohl ich anhand des Sucherbildes der Meinung war, der Apparat sei genau waagerecht gehalten. In der späteren Nachbearbeitung musste ich jedoch ein Abkippen um jeweils einen Winkelgrad nach rechts feststellen. Da ich Rechtshänder bin und auch immer mit dem rechten Auge durch den Sucher schaue, liegt die Lösung für diese Beobachtung möglicherweise in dem Umstand einer unterschiedlichen Ausprägung von links und rechts in meinem Sehzentrum. Eine weitere Symmetrieachse verläuft in der Physiologie horizontal. Die Koordinaten oben und unten sind jedoch von vorn herein unterschiedlich. Mach führt das auf die Asymmetrie des motorischen Apparates der Augen in Bezug auf die horizontale Ebene zurück. Wichtiger in dem Zusammenhang ist jedoch die Wirkung der Gravitation, die in unserem Unterbewusstsein ständig präsent ist und die Koordinaten oben und unten qualitativ unterscheidet. Unsere körperliche Konditionierung lässt uns auf symmetrische Muster regieren. Abweichungen von deren Raumordnung werden sofort auffällig und werden als störend, manchmal auch als komisch, empfunden. Besonders die Kunstrichtung der Ornamentik fußt wesentlich auf dieser Gegebenheit des physiologischen Raums. Mach folgert, dass die Regeln der Geometrie im euklidischen Raum u.a. aus der Symmetrie abgeleitet sind. Machs kurze Abhandlung fndet Bestätigung in dem sehr umfangreichen Buch „Kunst und Sehen“ von Rudolf Arnheim. In dessen ersten Kapitel fndet sich bezüglich des psychologischen und physikalischen Gleichgewichts die programmatische These: „Sieht man einmal von den vollkommen regelmäßigen Formen ab, kennen wir keine rationale Rechenmethode, die unserem Auge mit seinem intuitiven Gefühl für Ausgewogenheit gewachsen wäre.“107 Arnheim gründet seine Untersuchung auf den Ergebnissen der Gestaltpsychologie, die eine Kehrtwendung in der Wahrnehmungstheorie verlangten. Die neuen Erkenntnisse, die in Ansätzen bereits bei Ernst Mach enthalten sind, widerlegen die bis zum Ende des 19ten Jahrhunderts vorherrschende Auffassung, nach der die Wahrnehmung als ein Prozess vorgestellt wird, der vom Besonderen ausgeht und daraus allgemeine Begriffe bildet. Das Allgemeine ist jedoch bereits von Anfang an in der Konditionierung der Wahrnehmung, also dem „Gestalten sehen“ enthalten.108 Dies, und die Erkenntnis, dass die Vorstellung des Raumes wesentlich von den Augenbewegungen, den Kopfbewegungen und besonders der Eigenbewegung des Körpers abhängt, sind die Grundlage von James J. Gibsons Raumtheorie. In seiner Untersuchung über die Wahrnehmung der Form109 trennt Gibson zunächst begriffich drei Gruppen von Formen; Gegenstände, Abbildungen und geometrische Formen. Gegenstände 60 und Abbilder unterscheiden sich in der Wahrnehmung nur durch die Möglichkeit der Ertastbarkeit von Gegenständen und die Möglichkeit, sie von verschiedenen Seiten zu betrachten. Wird eine naturalistische Abbildung durch ein Guckloch betrachtet, wodurch man das Bild nur mit einem unbewegten Auge sieht und der Rand des Bildes nicht mehr sichtbar ist, ergibt sich in der visuellen Wahrnehmung ein Equivalent zur Wahrnehmung der Gegenstände im Raum. Die Vorstellung von Gegenständen (d.h. Objekten im Raum), die sich bereits anhand der Abbildung eingestellt hat, erreicht durch das Guckloch eine „illusion of reality“. Wenn wir Umrisszeichnungen betrachten und aufgefordert werden, zu sagen was wir sehen, enthalten diese Beschreibungen in der Regel Begriffe, die auf einen bekannten Gegenstand verweisen. Niemand wird sagen, er sieht eine bestimmte Anordnung von Linien auf einem Blatt Papier. Es wird auch kaum jemand sagen, er sehe die graphische Darstellung eines Gegenstandes. Eine Umrisszeichnung wird automatisch in eine Form übersetzt, die sich in einem Raum befndet, der aus dem weißen Papier jenseits der Form gebildet wird. Der Effekt ist als das Figur-HintergrundPhänomen bekannt. Dem gegenüber sind geometrische Formen weder Gegenstände noch Bilder (solange sie nicht als solche realisiert werden und dadurch nach Gibsons Terminologie keine geometrischen Formen mehr sind). Für Gibson existieren geometrische Formen nur als Abstraktionen, als idealisierte Stellvertreter. Geometrische Körper sind „ghosts of objects“, geometrische Flächen sind „ghosts of surfaces, Linien sind „ghosts of edges“ und Punkte sind „ghosts of particles“. Gibsons Zusammenfassung der Studie über die Wahrnehmung der Form lautet: „A picture is something to be looked at. The retinal image could only be a picture if there existed a perceiver behind the eye to look at it. The retinal image is none of the kinds of form defned; it is in fact not a form at all. (...) We do not see our retinal image; we see an object, and the process is mediated by the image.“110 (Eine Abbildung ist etwas, das man ansehen kann. Die Abbildung auf der Netzhaut kann nur dann eine Abbildung sein, wenn es einen Betrachter hinter dem Auge gibt, der sie anschaut. Die Netzhautabbildung ist keine der beschriebenen Formen; es ist tatsächlich gar keine Form. Wir sehen unser Netzhautbild nicht; wir sehen ein Objekt, und der Vorgang ist vermittelt durch das Bild.) Diese Defnition widerspricht der scharfen Trennung, die Gombrich in der Betrachtung des Raumes und der Bilder vom Raum angemahnt hat. Wir sehen die Form zweidimensional, auch wenn die Form ein Gegenstand mit einer räumlichen Ausdehnung ist. Aber wir haben zusätzlich die Möglichkeit uns durch Betasten der Gegenstände von der Existenz des Raumes zu überzeugen und wir bewegen uns im Raum, bzw. um die Dinge im Raum herum. Das visuelle Feld gerät in Bewegung, wenn wir uns bewegen. Die Selbstwahrnehmung der Eigenbewegung und das bewegte visuelle Feld unterrichten uns paradoxer Weise von der Unbewegtheit der Welt. „Die Flussrichtung in der visuellen Bewegungsperspektive“111 verändert sich im dynamischen Verhältnis zwischen der Richtung der Eigenbewegung und der dabei eingenommenen Blickrichtung. Bewegen wir uns nach vorn und blicken dabei gerade aus, fießt das visuelle Feld unterhalb des Augenhorizonts abwärts und oberhalb aufwärts. Wenden wir in der Vorwärtsbewegung den Blick z.B. nach links, fießt auch das visuelle Feld nach links. Wenn wir uns rückwärts bewegen, kehren sich auch die Flussrichtungen im visuellen Feld um. Das visuelle Feld enthält Expansions- und Kontraktionsbrennpunkte, die in Richtung der Fortbewegung positioniert sind. Die verschiedenen Bilder aus der Flussrichtung der Eigenbewegung und den dabei 61 eingenommenen Blickrichtungen verbinden sich übergangslos zu einer visuellen Sphäre, die in ständiger Bewegung ist. Selbst wenn wir uns körperlich nicht bewegen und nur mittels Augenbewegungen den Blick wandern lassen, verschieben sich dabei die Objekte der Wahrnehmung auf der visuelle Sphäre, wie bereits Helmholtz festgestellt hat. Er verwendet dabei das oben beschriebene Konzept von zwei ineinander liegenden Halbschalen (Sehfeld und Blickfeld), die sich durch die Augenbewegungen gegeneinander verschieben. Wenn man die sich dabei verschiebenden Punkte durch Vektoren verbinden würde, welche die Bewegungsrichtung der Augen anzeigen, würde man automatisch Gibsons Beschreibungskonzept der visuellen Bewegungsperspektive erhalten. Gibson kommentiert sein Konzept folgendermaßen: „ Es ist interessant sich vorzustellen, dass wir dann, wenn wir alle diese zweidimensionalen Projektionen einer dreidimensionalen Welt zu einer einzigen Szene vereinigten, im geometrischen Sinne einen zweidimensionalen Raum erhalten würden, der nicht euklidisch ist. Er hätte die Charakteristika des theoretischen Raumes, der durch den Mantel einer als zweidimensionale Oberfäche betrachteten Kugel defniert ist.“112 Abb.36 Die Verformungsrichtung im visuellen Feld bei Vorwärtsbewegung, in der Projektion auf eine Kugeloberfäche rund um den Kopf (nach Gibson). In der Grafk ist der Blickpunkt mit dem Expansionsbrennpunkt der Vorwärtsbewegung identisch. Es ist der Punkt von dem aus die Vektoren um den Kopf herum laufen. Wenn sich der Mensch rückwärts bewegen würde, würden sich die Vektoren umkehren und der Expansionsbrennpunkt würde sich in den Kontraktionsbrennpunkt verwandeln, auf den alles zu läuft. Besonders deutlich kommt uns dies zu Bewusstsein, wenn wir z.B. auf der Plattform des letzen Wagons eines vorwärts fahrenden Zuges stehen und nach hinten blicken. Wir können dann zusehen, wie die Landschaft um uns herum fießt, auf einen Punkt am Horizont zu. In der Regel fällt es uns leicht, einen Unterschied zu machen zwischen der fest gefügten Welt und deren dynamischen Bild, das durch unsere Eigenbewegung entsteht und andererseits Objekten im Raum, die sich ebenfalls in Bewegung befnden. Gelegentlich scheint uns aber unsere Gewöhnung an die visuelle Bewegungsperspektive einen Streich zu spielen. Wenn wir etwa auf einer Flussbrücke stehen und eine Weile stur auf das Wasser hinunter schauen, stellt sich bald das ku- 62 riose Gefühl ein, dass die Brücke sich entgegen der Fliessrichtung des Wassers bewegt. (Der Effekt ist bereits von Helmholtz beschrieben worden). Vielen ist auch der seltsame Eindruck bekannt, bei dem in einem Bahnhof plötzlich der Bahnsteig abzufahren scheint. Wenn wir in einem Zug sitzen und auf den Bahnsteig hinaus schauen, wenn wir sicher sind, uns selbst nicht zu bewegen, aber in der Peripherie unseres Gesichtsfeldes eine horizontale Bewegung bemerken (nämlich den Zug auf der gegenüber liegenden Bahnsteigseite, der gerade losfährt), kann unser Bewusstsein für einen Moment den Widerspruch nur aufösen, indem es vermeldet, dass der Bahnsteig sich bewegt. Sobald wir erkennen, was die Bewegungswahrnehmung verursacht hat, verschwindet die sehr dominante Illusion sofort. 63 4. Die kurvenlineare Perspektive Die wissenschaftlichen Untersuchungen über den Gesichtssinn des Menschen kommen letztlich zu dem Ergebnis, dass das Gesichtsfeld sphärisch gekrümmt ist. Die Krümmung objektiv gerader Linien im Gesichtsfeld, wie sie beispielsweise Helmholtz beschreibt, ist uns nicht bewusst. Dies besonders, da die Krümmung des Gesichtsfeldes erst an dessen Peripherie deutlich wird. Unser Fokus liegt aber immer in dessen Zentrum, das wir durch die Bewegung der Augen, des Kopfes und des Körpers auf den Blickpunkt unseres Interesses ausrichten. Die Peripherie des Gesichtsfeldes ist nicht zuletzt durch seine anatomische Struktur eher geeignet Bewegungen um Raum wahrzunehmen. Abb.37 Miniatur von Jean Fouquet in „Grandes Chroniques de France“, ca. 1460 Wie beschrieben, lesen wir den Raum auch nicht anhand von dessen Projektionen (auf welcher Oberfäche auch immer). Eine naturalistische Abbildung des Raumes (oder genauer: der Dinge im Raum) ist jedoch ohne Projektion nicht möglich. Wenn nun entgegen der ausdrücklichen Warnung von Piero della Francesca die Abbildung einen größeren Winkel als 90 Grad umfassen soll, steht der Maler, bzw. der Kameraingenieur, vor dem gleichen Problem, wie einst die Kartographen. Auch das sphärische Gesichtsfeld kann nicht auf einer Planfäche ausgebreitet werden. Die Projektionsverfahren, die dieses Problem für eine Abbildung aufösen sollen, werden zusammenfassend als kurvenlineare Perspektive bezeichnet. Wie bei der sphärischen Projektion gibt es hierbei verschiedene Lösungsvorschläge. Die frühesten Beispiele fnden sich bereits im Werk des Buchmalers Jean Fouquet (ca.14201480). Fouquet muss außerordentlich experimentierfreudig gewesen sein, wenn es um die Raumdarstellung ging. Er hat nicht nur in der Zeit des großen Umbruchs gelebt, sondern auch dessen künstlerischen Diskurs in seinem Oeuvre nachvollzogen. Seine Buchmalereien umfassen den mittelalterlichen Aggregatraum, die Zentralperspektive und dessen Variationen, wie etwas die Zwei- 64 Punkt-Perspektive, und auch einige Beispiele für die kurvenlineare Perspektive. Besonders berühmt ist „Der Einzug Karls IV in Saint Denis“ in der Handschrift „Grandes Chroniques de France“; entstanden ca. 1460. Die Anwendung der Kurvatur horizontaler Linien ist durch die quadratischen Steinplatten im Vordergrund deutlich ablesbar. Das goldene Zeitalter der niederländischen Malerei war neben vielen anderen Neuerungen auch ein großes Versuchslabor für die Möglichkeiten des Bildes und dessen Herstellungsverfahren. In diesem Umfeld malte Carel Fabritius (1622-1654) ein kleines Panoramabild, das eine Ansicht der großen Kirche in Delft zeigt und einen Blickwinkel von ca. 180 Grad umfasst. Aufgrund des kleinen Formates wird angenommen, dass dieses 1652 entstandene Bild Teil eines Perspektivkastens war.113 Von Fabritius selbst und auch von seinen Zeitgenossen sind solche Schaukästen erhalten, mit denen eine Trompe l´oeil Malerei durch eine Lochblende oder ein anderes Okular betrachtet werden konnte. Das Panoramabild von Delft realisiert eine Kurvatur lediglich auf der horizontalen Ebene. Vermutlich wurde es auf der Grundlage der Zylinderprojektion erstellt. Durch das Okular des Schaukastens wird sich dessen Kurvatur vermutlich aufheben und man wird den Eindruck eines Rundblicks erhalten, der dem natürlichen Sehen nahe kommt. Abb.38 Kurvenlineare Perspektive nach Guido Hauck Das gleiche Darstellungssystem schlägt der Mathematiker Guido Hauck (1845-1905) vor114. Er beruft sich dabei ausdrücklich auf den Architekturmaler Carl Graeb (1816-1884). Eine Kurvatur nur für horizontal verlaufende Linien vorzunehmen, und die Vertikalen senkrecht wieder zu gegeben, kommt zwar der horizontalen Ausrichtung unseres Gesichtsinns entgegen, ist aber in Bezug auf die Projektion der Sphäre auf eine Planfäche inkonsequent. Eine wesentliche Neuerung wird von dem Maler William Gawin Herdman ins Spiel gebracht, der sein Traktat über die kurvenlineare Perspektive115 auf die wissenschaftliche Vorarbeit116 von Thomas Malton (1726-1801) gründet. Herdmans Lösung ist die rektilineare Perspektive. Horizontale und gerade Linien, die nach der sphärischen Projektion auf einer Planfäche gekrümmt erscheinen, erhalten durch das System eine Gegenkorrektur, so dass sie auf der Abbildung wieder zu geraden Linien werden. Vertikale Linien bleiben aber gerade. Durch den Eingriff entsteht ein grundsätzlich anderer Raumeindruck als in der linearen Perspektive, auch wenn bei beiden Systemen Linien, die in der Natur gerade sind, auch auf der Bildoberfäche gerade abgebildet werden. Herdman widerspricht seinem Vorgänger Malton in Bezug zu dessen Aussage: „...It is not in the power of Art or Science to represent on a Plane, any single object, as it appears.“117 65 (Es liegt nicht in der Macht der Kunst oder Wissenschaft ein einziges Objekt auf einer Planfäche so wieder zu geben, wie es erscheint). Herdman glaubt, das dies mit Hilfe der rektilinearen Perspektive möglich ist, auch wenn er selbst in seiner Analyse des Gesichtssinns das visuelle Feld (feld of vision ) als sphärisch darstellt (circular sphere of action).118 Abb. 39 Rektilineare Perspektive (links) im Vergleich zur stereographischen Projektion (rechts) des gleichen Motivs (Mittelschiff von Big Ben, London; Quelle: Panotools.org) Die rektilineare Perspektive fndet heute Anwendung in der Fotographie, speziell beim Design von Ultra-Wide-Linsen zur Vermeidung sphärischer Verzerrungen und in der Programmierung von Bildbearbeitungssoftware für die Erstellung von Panoramabildern. Einen wesentlich freieren Umgang mit der Perspektive wurde von dem niederländischen Grafker Maurits Cornelis Escher (1898-1972) gepfegt. Es war nie seine primäre Aufgabenstellung ein Abbild zu schaffen, dass dem Raumeindruck des menschlichen Auges, also der „natürlichen Perspektive“ entspricht. Sein umfangreiches Werk umfasst genauso Erfndungen, die auf der darstellenden Mathematik basieren, wie auch ornamentale Aspekte und surreale Bildwelten. Als Meister der Perspektive hat er die kurvenlineare Perspektive konsequent auf die Horizontale und die Vertikale angewendet. Ein anderer Vertreter dieser Lösung ist Albert Flocon (1909-1994), dem wir auch eine theoretische Abhandlung über die kurvenlineare Perspektive (zusammen mit André Barre) verdanken.119 Während Escher wertfrei zwischen den Systemen wechselte, war es Flocons Anliegen, eine Lanze für die kurvenlineare Perspektive zu brechen. Nachdem er die Unzulänglichkeiten der linearen Perspektive (vom ihm klassische Perspektive genannt) analysiert hat, entwirft er die Theorie für eine neue Perspektive, deren Grundlage das sphärische Gesichtsfeld ist. Mit Hilfe der neuen Theorie soll es möglich werden, den nicht-euklidischen Raum auf der Planfäche abzubilden, und den dabei unvermeidlichen Ähnlichkeitsmangel gering zu halten. 66 „Die Zeichnung auf der durchsichtigen oder undurchsichtigen Kugeloberfäche ist von bemerkenswerter, ja absoluter Kohärenz und steht in keiner Weise im Widerspruch zur direkten Beobachtung: Sie ist völlig realistisch. Alle Widersprüche der Raumgestaltung sind deswegen aufgehoben, weil der wirkliche Raum mit seinen drei Dimensionen auf eine Oberfäche übertragen wurde, die ebenfalls im dreidimensionalen Raum gründet und allerorts gleich weit vom Beobachtungspunkt entfernt ist. Der Beobachter ist gewissermaßen mit einem sphärischen Raum verschmolzen, der als eine Art homothetischer Ausweitung seines Blickpunkts angesehen werden könnte.“120 Abb.40 Der sphärische Raum nach Flocon/Barré Allerdings spricht sich Flocon gegen die sphärische Oberfäche als Bildträger aus. Neben dem, seiner Meinung nach erheblichem Aufwand, den so ein Bildträger verursachen würde, ist sein Hauptargument die Fixierung des Betrachters im Mittelpunkt der Sphäre. Dieser Umstand ist bereits eins von Flocons Hauptargumenten gegen die lineare Perspektive und soll daher unbedingt vermieden werden. Allerdings geht Flocon auch von der Abbildung eines 180 Grad Winkels aus, was für einen sphärischen Bildträger natürlich bedeuten würde, dass der Betrachter sich immer sehr nah vor einer Halbkugel und in deren Mittelpunkt befnden müsste. Nach Flocon muss eine Übertragung auf die Planfäche gefunden werden. 67 Abb.41 Postel-Projektion im Vergleich zur stereographischen und gnomonischen Projektion. Der Zirkelschlag um PM mit dem Radius r (Strecke PM bis P) ergibt den projizierten Punkt p´. Für seine Lösung sucht Flocon ebenfalls Hilfe bei den Kartographen. Der Projektion auf der Halbkugel würde die gnomonische Projektion entsprechen. Die ist aber für die Planfäche inakzeptabel, denn es ist nichts anderes als die lineare Perspektive. Für einen 180 Grad Winkel müsste die Projektionsfäche unendlich groß sein, was natürlich für ein Blatt Papier nicht realisierbar ist. Die stereographische Projektion, die bereits Helmholtz vorgeschlagen hat, wäre eine weitere Möglichkeit. Doch Flocon entscheidet sich für die so genannte Postel-Projektion. Guillaume Postel (1510-1581) überträgt die Projektionspunkte auf der Sphäre durch einen Zirkelschlag vom Projektionsmittelpunkt aus auf die Planfäche (Tangentialebene). Die Methode ist vergleichbar mit der fächentreuen Azimutalprojektion nach Johan Heinrich Lambert (1728-1777), die allerdings die ganze Sphäre abbilden soll (Abb.31 e). Für Flocon liegen die Vorteile der Postel-Projektion in deren geringen Ähnlichkeitsmangel im Vergleich zu den anderen Projektionsarten. Die Abweichungen gleicher Abstände auf der Kugeloberfäche sind im Verhältnis zu den Abständen der entsprechend übertragenden Punkte auf der Planfäche selbst bei sehr weitem Blickwinkel einigermaßen gering. Orthodrome und Großkreise auf der Sphäre werden wie bei der stereographischen Projektion als gebogenen Linien wiedergegeben (abgesehen von der Horizontalen und Vertikalen, die durch die Projektionsmitte verlaufen und in jeder Projektion gerade Linien sind). Weiterhin lässt sich die Postel-Projektion leicht auf einem Blatt konstruieren. Die Konstruktionsmethode von Flocon ergibt bei Abbildung der vollständigen Hemisphäre zwangsläufg ein Tondo. Da ich gerade Linien in meinem Gesichtsfeld auch als gerade wahrnehme, scheinen mir alle Projektionen, die gerade Linien gekrümmt wiedergeben, noch weiter von meinem physiologischen Raum zu abstrahieren, als die lineare Perspektive oder die rektilineare Perspektive. Ferner ist es mir ein Rätsel warum Flocon meinte, die Postel-Projektion würde nicht unbedingt vom Betrachter verlangen, sich in das Projektionszentrum zu begeben, um die Darstellung „richtig“ sehen zu können. Natürlich wird der Betrachter einen dezentralen Standpunkt bis zu einem Grad kompensieren, aber das ist ihm auch in einer linearen Projektion möglich, wie oben beschrieben. 68 Abb. 42 Zeichnung in kurvenlinearer Perspektive mittel Postel-Projektion und Konstruktionsmethode von Flocon/ Barré. Der Abbildungswinkel beträgt 180 Grad. Die Analyse der sphärischen Projektionen unterrichtet uns darüber, dass die Übertragung des physiologischen Raums auf eine Planfäche nur mit Einschränkungen möglich ist, besonders wenn der Abbildungswinkel sehr groß ist. Wenn Flocon dennoch darauf bestand, hatte dies möglicherweise damit zu tun, dass er Grafker war. Das Spielfeld der Grafker ist das Blatt Papier und nicht etwa die Kuppel eines Doms oder die Panoramarotunde. Diese seit Jahrhunderten verwendeten Bildträger waren ihm aber sicher bekannt. Die Kirchenmaler seit der Renaissance waren gezwungen, mit einer bereits vorgegebenen Architektur umzugehen. Daher entsprechen deren Projektionen in der Regel nicht den Bedingungen des physiologischen Raums. Wenn deren Deckengemälde dennoch eine verblüffende räumliche Wirkung haben, liegt das möglicherweise an ihren Dimensionen, die einen großen Sektor des Gesichtsfeldes ausfüllen. Auch die Entfernung der Bildoberfäche spielt dabei eine Rolle. Jenseits der magischen sieben Meter Betrachtungsabstand zum Objekt im Raum sind die Augen in der Parallelstellung und das binokulare Sehen spielt für die Raumwahrnehmung keine Rolle mehr. Unter diesen Bedingungen scheint sich der Bildträger zu entmaterialisieren und wir sehen die Dinge im Raum in ihrer fächenhaften Erscheinung und dennoch dreidimensional. Sobald wir jedoch den vorgegebenen Betrachtungspunkt verlassen, erscheint das Bild zunehmend verzerrt und kippt um ins Zweidimensionale.121 Ein oft besprochenes Beispiel für diesen Effekt ist die Deckenmalerei in der römischen Kirche St. Ignazio von Andrea Pozzo. Die hierbei umgesetzte Projektionsmethode ist von Pozzo selbst in seinem Perspektivbuch beschrieben worden122. Die Projektionsfäche ist ein Tonnengewölbe (hemizylindrisch), dessen Mitte sich 30 Meter über dem Boden befndet. Der Betrachtungspunkt O (Origo) liegt weit außerhalb jedes denkbaren sphärischen Projektionszentrums. Es kann sich also auch nicht um eine Zylinder-Projektion der visuellen Sphäre handeln. 69 Abb.43 Andrea Pozzos Demonstration seiner Methode zur Übertragung eines Bildes in linearer Perspektive (die Fläche M) auf das Tonnengewölbe von St. Ignazio in Rom. Ganz anders verhält es sich in der Panoramarotunde. Das Gebäude ist explizit für das Panoramagemälde gebaut worden. Der Betrachter befndet sich auf einer Plattform in dessen Mitte und ist von dem Rundbild umgeben. Er befndet sich auf der Plattform zwar nicht in jedem Fall im Projektionszentrum, aber seine möglichen Bewegungen liegen im dem Toleranzbereich der kompensiert werden kann. Das Panorama war das Massen-Bildmedium des 19. Jahrhunderts, vor dem Aufkommen der Kinematographie. In letzter Zeit feiert das Spektakel ein grandioses Comeback in Dresden, Leipzig und Berlin (Das Panometer von Yadegar Asisi)123. Die Faszination des Rundblicks sollte aber auch im Kino mit bewegten Bildern realisiert werden, wofür das Cinerama-Verfahren entwickelt wurde. Cinerama wird mit drei synchron laufenden Projektoren auf eine um 146 Grad gebogene Leinwand projiziert. Die gebogene Leinwand bildet dabei den (Teil-) Umfang eines Kreises, dessen Radius der Distanz zu den Projektoren entspricht. Das Prinzip wird auch in einem Flugsimulator (auch als Schiffssimulator) angewandt, um vom Cockpit aus einen möglichst realistischen Eindruck vom virtuellen tiefen Raum und der Eigenbewegung darin zu bekommen. In diesen Fällen handelt es sich um eine echte Zylinderprojektion, die allerdings nicht auf die Planfäche zurück gebogen wird, sondern in ihrer ursprünglichen Form vom Mittelpunkt der Sphäre aus betrachtet wird. 70 Abb.44 Schnitt durch die Panoramarotunde Abb.45 Aufbau des IMAX-Ride Theaters Noch konsequenter sind aber Anwendungen, die nicht nur eine Raumkrümmung in der Horizontalen vornehmen, sondern auch in der Vertikalen wiedergeben. Dabei ergibt sich zwangsläufg die Projektionsfäche einer Halbkugel-Schale. Diese Bedingung ist in dem schon beschriebenen Cinema 2000 gegeben, wie auch in der FullDome-Projektion des Planetariums (auch im Omnimax-Kino und im IMAX-Magic Carpet). Die Steigerung sind Kinoraume, die sich synchron zur Bewegung auf der Leinwand bewegen, wie das IMAX-Ride-Kino. Das Cyberspace-System addiert zu dem Rundblick, der in eine spezielle Brille übertragen wird, die Möglichkeit interaktiv in die virtuelle Vision einzugreifen. Weniger spektakulär, aber gleichfalls mit den Bedingungen des sphärischen Gesichtsfelds verbunden sind sphärische Messmethoden und Visualisierungen des Gesichtsfeldes. Die Ringsonnenuhr, der Sextant der Seeleute und der Theodolit der Landvermesser nehmen Winkelmessungen vor, indem der Drehpunkt des zu messenden Winkels im Mittelpunkt der gedachten Sphäre festgelegt wird. Die Gesichtsfeldmessung der Augenärzte wird mittels einer Halbkugel-Schale vorgenommen, in die der Patient hinein schaut. Während die Mitte der Halbschale fxiert werden soll, werden Lichtreize in die Peripherie der Halbschale gegeben, um die Größe des Gesichtsfeldes zu ermitteln. Nachdem die Raumsonden, welche die Oberfäche des Planeten Mars erkunden sollten, Bilder eines Rundblicks zur Erde gesendet hatten, musste die NASA eine Methode fnden um dieses Mosaik von Einzelaufnahmen visualisieren zu können. Die nahe liegende Lösung war, eine Halbschale zu verwenden, auf deren innere Oberfäche die Fotos entsprechend ihres Blickwinkels aufgeklebt wurden. Erst kürzlich haben die beiden amerikanischen Künstler Trevor und Ryan Oakes eine Zeichenmaschine entwickelt, mit deren Hilfe der sphärische Rundblick direkt auf eine Halbschale gebracht werden kann. Wie bei der Gesichtsfeldmessung werden die Augen in der Mitte der Hemisphäre fxiert. Dann wird die Fläche nach und nach mit Papierstreifen geschlossen, die Streifen für Streifen mit dem Raumbild dahinter bedeckt werden. Die Künstler machen sich dabei zu nutze, dass die Gesichtsfelder der beiden Augen sich teilweise überdecken. Während etwa das linke Auge den gerade zu bearbeitenden Rand des Bildträgers betrachtet, sieht das rechte Auge in den tiefen Raum. Die „Erscheinung“ auf dem Bildträger kann direkt auf das Papier übertragen werden (in etwa wie bei einer camera lucida). Die Erkenntnis, von unserem sphärischen Gesichtsfeld generiert offensichtlich immer wieder neue Ideen für dessen Übertragung in ein Bildmedium, auch wenn dies seltene Ausnahmen sind. 71 Unsere Bilderwelt wird durch die lineare Perspektive dominiert, nicht zuletzt durch die moderne Fotographie und ihre exzessive Anwendung. Aber in den dabei verwendete Linsensystemen wird genauso die kurvenlineare Perspektive in irgendeiner Form umgesetzt. Nach den Erkenntnissen der physiologischen Optik müsste eigentlich jede Abbildung auf eine sphärische Oberfäche übertragen werden. Aber das wäre zugegebener Maßen genauso unpraktisch, wie immer einen Globus mit sich herum zu tragen, wenn man eine Weltreise macht. 72 Zusammenfassung 1. Alles was wir sehen befndet sich außerhalb unseres Körpers, vor unseren Augen. 2. Mit unseren Augen sehen wir eine fächenhafte Anordnung. Was wir jedoch wahrnehmen sind Dinge in ihrer geschlossenen Form und Bedeutung. Unsere visuelle Wahrnehmung hat eine zweidimensionale Räumlichkeit. 3. Wir nehmen die Dinge in einer räumlichen und zeitlichen Ausdehnung wahr, wodurch wir einen Begriff vom Raum erhalten, der mit dem Begriff der Zeit eine Einheit bildet. 4. Unsere visuelle Wahrnehmung ist darauf konditioniert Dinge im Raum zu sehen. Dabei macht es keinen Unterschied, ob sich diese Dinge tatsächlich im Raum, oder als Abbild auf einem Spiegel oder Bildträger befnden. 5. Die Dinge im Raum und unsere visuelle Wahrnehmung sind durch Bewegungen zeitlich in einer fortdauernden Richtung vektorisiert. 6. Durch unsere Eigenbewegung von Augen, Kopf und Körper erhält die visuelle Wahrnehmung die Form einer Sphäre. Deren innere Oberfäche bildet die Projektionsfäche. 7. Wir bilden jeweils das Zentrum unserer eigenen visuellen Sphäre. Die fächenhafte Anordnung unserer eigenen visuellen Sphäre ist konkret, deren Wahrnehmung ist jedoch subjektiv und durch eine zweite Person nicht reproduzierbar. 8. Unsere Eigenbewegung unterrichtet uns davon, dass die Welt, die uns umgibt, sich nicht bewegt. Die Bewegung der Erde wird nicht als solche wahrgenommen. Sie kann nur analytisch betrachtet und vorgestellt werden und ist daher nicht Teil der visuellen Sphäre. 9. Bewegungswahrnehmungen auf der visuellen Sphäre, die nicht aus der Eigenbewegung resultieren, werden als Bewegungen der Dinge im Raum erkannt. 10. Die fächenhafte Anordnung der visuellen Sphäre kann auf einer Planfäche nicht ohne Verzerrungen abgebildet werden. 11. Die Abbildung der visuellen Sphäre auf einer sphärischen Oberfäche kann die fächenhafte Anordnung unverzerrt abbilden, jedoch nicht die konditionierte Wahrnehmung der Dinge im Raum. 12. Die konditionierte Wahrnehmung der Dinge im Raum oder auf einer Abbildung ist subjektiv und kann nur durch einen Betrachter individuell impliziert werden. 13. Der geometrische Raum ist eine reine Abstraktion, die aus der visuellen Sphäre abgeleitet ist aber in keinem Bildmedium abgebildet werden kann. 73 Anhang 1 Zitiert nach Ernst H. Gombrich: Das forschende Auge- Kunstbetrachtung und Naturwahrnehmung, Campus Verlag Ffm/NY, 1994. Quelle: Collection complète des oeuvre de M. Voltaire, 1769, Bd. VIII, S.89 2 Die Geschichte des Vergleichs zwischen dem menschlichen Auge und der Kamera beginnt mit den Notizen von Leonardo da Vinci über die Camera Obscura. Bis heute wird dieser Vergleich verwendet, um die Projektion im Auge zu erklären. Quasi beiläufg befördert dies den Dualismus von Körper und Geist, da das Auge auf seine Funktionalität reduziert wird. 3 Ponzo Täuschung, auch Railway Lines Illusion. Benannt nach dem ital. Psychologen Mario Ponzo (18851960) 4 Die räumliche Wahrnehmung in größeren Entfernungen kann mit Hilfe eines Scherenfernrohrs erreicht werden. Die Bauweise des Scherenfernrohrs vergrößert den Abstand zwischen dem linken und dem rechten Auge und erhöht so die Paralaxe. 5 Hermann von Helmholtz: Handbuch der physiologischen Optik, III, Das monokulare Gesichtsfeld, S.529 ff., Leipzig, 1867 6 Die Projektion auf der Netzhaut (Retina) ist invertiert: Seiten verkehrt und auf dem Kopf stehend; zuerst beschrieben von Kepler (1604) 7 M.H.Pirenne: Optics Painting & Photography, Cambridge, University Press 1970, Introduction S.8 8 Ebd. S.10 9 Hermann von Helmholtz: Handbuch der physiologischen Optik, III, Das monokulare Gesichtsfeld, S.540 Leipzig, 1867 10 11 Ebd. §27, S.457 ff. Marie E.P. König: Am Anfang der Kultur- Die Zeichensprache des frühen Menschen, S.91, Ullstein Ffm/Berlin/Wien, 1981 12 E.H. Gombrich: Kunst und Illusion- Zur Psychologie der bildlichen Darstellung, Phaidon/ Berlin 2002. (engl. Original von 1960), Vorraussetzungen der Illusion, S.170 ff. 13 Rudolf Arnheim: Kunst und Sehen- Eine Psychologie des schöpferischen Auges, S. 242, deGryter, Berlin, 2000 (Original von 1954 und 1974) 14 Ebd. S.216 15 Hermann von Helmholtz: Handbuch der physiologischen Optik, III, S.446, Leipzig, 1867 16 Ebd.S.446 17 Ernst H. Gombrich: Das forschende Auge- Kunstbetrachtung und Naturwahrnehmung, Campus Verlag Ffm/NY, 1994, Die Raumwahrnehmung in der abendländischen Kunst, S.88 18 James J. Gibson, amerikanischer Psychologe, 1904-1979 19 Ernst H. Gombrich: Das forschende Auge- Kunstbetrachtung und Naturwahrnehmung, Campus Verlag Ffm/NY, 1994, Die Raumwahrnehmung in der abendländischen Kunst, S.89 20 nach Wilhelm Kraiker: Die Malerei der Griechen, W. Kohlkammer Verlag, Stuttgart, 1958, S.71 21 C. Plinius Secundus der Ältere, (23-79 n.Chr.): Naturalis Historiae Liber XXXV; unter Verwendung der Ausgabe vom Patmosverlag, Artemis & Winkler, Düsseldorf, 2007 (3. Auf.) 22 Ebd. Absatz 65 und 66 23 Ursprüngliche Quelle: Strabon, Geographica, XIV 2,5 24 C. Plinius Secundus der Ältere, (23-79 n.Chr.): Naturalis Historiae Liber XXXV, Absatz 121 25 Ebd. Absatz 56, Kimon aus Kleonai, Frühklassik, ca. 500 v.Chr. 26 Ebd. Absatz 60, Apollodoros aus Athen ( auch Schattenmaler gen.), um 400 v. Chr. 27 Ebd. Absatz 74, Timanthes aus Kythnos, 4. Jh. v. Chr. 28 Ebd. Absatz 102 ff., Protogenes aus Kaunos in Karien, 3. Jh. v. Chr. 29 Das Zitat von M. Fabius Quintilianus ist enthalten in der Ausgabe vom Patmosverlag, Artemis & Winkler, Düsseldorf, 2007 (3. Auf.), (siehe Anm.20), Seite 151 30 Wilhelm Kraiker: Die Malerei der Griechen, W. Kohlkammer Verlag, Stuttgart, 1958, S.72 31 Platon: Der Staat, 10. Buch 32 C. Plinius Secundus der Ältere, (23-79 n.Chr.): Naturalis Historiae Liber XXXV, Absatz 76 33 Die Autorenschaft von Eukid ist strittig. Dennoch ist der Text die Grundlage für die Auseinandersetzung mit der Optik in den folgenden 2000 Jahren. Ob wirklich Euklid diese Optik verfasst hat ist zwar nicht bedeutungslos, ist aber für die Beschäftigung mit dessen Inhalt nicht entscheidend, solange der Text selbst im Laufe der Zeit authentisch bewahrt wurde, was aber wohl auch nicht sicher ist. Ich beziehe mich auf einen deutschen Text von Emil Wilde: Eine Abhandlung über die Optik der Griechen, Berlin, 1832. Emil Wilde wiederum übernimmt für seine Untersuchung die englische Ausgabe der sämtlichen Werke des Euklides, von David Gregory, Oxford, 1703. Der Urtext stammt aus dem ptolemäischen Alexandria um 300 v. Chr., wanderte von da aus in den arabisch/persischen Raum und dann ins frühmittelalterliche Europa, wo er ins Lateinische übersetzt wurde. Viele Stellen erscheinen unlogisch oder ganz unverständlich, was vermutlich zu einem gewichtigen Teil mit der Überlieferung zu tun hat. 34 Aristoteles: Psychologie, 3 Die sinnliche Wahrnehmung oder Empfndung. Entnommen aus „Aristoteles-Hauptwerke“, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 8. Auf. 1977 35 Lichtstrahlen, die an Kanten gebeugt werden und dabei Interferenzmuster bilden, wie auch die Sichtbarkeit von Sternen, die in kosmologischen Größenordnungen durch Lichtbeugung an Hindernissen im Raum reali- siert wird, müssen hier außer acht gelassen werden. 36 Emil Wilde: Eine Abhandlung über die Optik der Griechen, Berlin, 1832, S. 11 37 Das Fundamentalgesetz der Proportionalgeometrie lautet: Zwei Dreiecke sind ähnlich, wenn ihre drei Winkel gleich groß sind. 38 Erwin Panofsky: Die Perspektive als symbolische Form, 1927, in: Aufsätze zu Grundfragen der Kunstwissenschaft, Hg. Hariolf Oberer und Egon Verheyen, Verlag Volker Spiess, Berlin 1980 39 Ernst H. Gombrich: Das forschende Auge- Kunstbetrachtung und Naturwahrnehmung, Campus Verlag Ffm/NY, 1994, Die Raumwahrnehmung in der abendländischen Kunst, S.87 40 Für die Parallelperspektive der Ingenieure und Architekten gibt es genaue Regeln, die nicht der illusionistischen Ansicht dienen, sondern die nachmessbare Form auf dem Papier abbilden. So bleiben Linien auf der Zeichnung parallel, wenn sie an dem Werkstück parallel sind. Es gibt in einer parallelperspektivischen Zeichnung keine Verkürzung, sondern nur eine Schrägansicht deren Winkel bezüglich der Horizontalen für alle Linien, die Tiefe darstellen sollen, immer gleich ist und für die jeweils angewandte Methode nach DIN festgesetzt ist. 41 Pawel Florenski: Raum und Zeit, Die umgekehrte Perspektive, 1920, S.18 f. , (deutsche Übersetzung: editionKONTEXT, Hg. Olga Radetzkaja und Ulrich Werner, Berlin 1997) 42 Der Begriff „Kubismus“ stammt vermeintlich von dem Dichter Apollinaire 43 Giorgio Vasari: Lebensläufe der berühmtesten Maler, Bildhauer und Architekten (1550), Ausgabe: Manesse Verlag Zürich, 2005, S.42 44 Ebd. S.181 45 Egon Friedell: Kulturgeschichte der Neuzeit, Verlag H.C.Beck, München 1927-1931, S. 88 ff. 46 Ebd. S.101 47 Wilhelm von Ockham (auch Occam) 1288-1347/49, Franziskaner und Philosoph 48 Egon Friedell: Kulturgeschichte der Neuzeit, Verlag H.C.Beck, München 1927-1931, S.102 f. 49 Martin Kemp: The Science Of Art- Optical themes in western art from Brunelleschi to Seurat, Yale University Press, New Haven and London, 1990, S.12 ff. 50 David Hockney: Secret Knowledge – Rediscovering the lost techniques of the Old Masters, Thames & Huson, London 2006 (2. Aufage), S.212 51 Velum (in Albertis ital. Text: Velo) darf nicht mit dem Vellum verwechselt werden, das ein dünnes Blatt aus Tierhaut bezeichnet (Pergament) 52 Leon Battista Alberti: Della Pittura – Über die Malkunst, 1435/36; unter Verwendung der Ausgabe der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft Darmstadt, Hrg. Oskar Bätschmann und Sandra Gianfreda, 3. Auf. 2010 53 Euklid: Die Elemente, Buch 1, Defnitionen, verwendete Ausgabe: Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften Bd. 235, Reprint/ Harri Deutsch, Frankfurt a.M., 4. Aufage 2010 54 Leon Battista Alberti: Della Pittura – Über die Malkunst. Unter Verwendung der Ausgabe der: Wissenschaftlichen Buchgesellschaft Darmstadt, Hrg. Oskar Bätschmann und Sandra Gianfreda, 3. Auf. 2010, S.83, 85 55 Ebd, S.93 56 Euklid: Die Elememte, Buch 1, Postulate. Das 5. Postulat (auch als 11. Axiom bezeichnet) hat in der Geschichte der Mathematik zu großen Kontroversen geführt. Heute wird der nichteuklidische Raum defniert, indem dieses 5. Postulat darin keine Gültigkeit hat. 57 Leonardo da Vinci: Traktat über die Malerei, 1480-1516, Linearperspektive - Absatz 126 58 Albrecht Dürer; Unterweisung der Messung mit Zirkel und Richtscheid, 1525 (1.Aufage), und weiteren Beschreibungen in der 2. Aufage, wenige Jahre später. 59 Piero della Francesca: De Prospectiva pingendi, 1474, in der Rezeption von Martin Kemp: The Science of Art. 60 Erwin Panofsky: Die Perspektive als symbolische Form, 1927, in: Aufsätze zu Grundfragen der Kunstwissenschaft, Hg. Hariolf Oberer und Egon Verheyen, Verlag Volker Spiess, Berlin 1980, S.128 (Anmerkung 8, zu dem Phänomen der „Randverzerrungen“) 61 Martin Kemp: The Science of Art- Optical themes in western art from Brunelleschi to Seurat, Yale University Press, New Haven and London, 1990, S.49 62 Leonardo da Vinci: Traktat über die Malerei, 1480-1516, Linearperspektive - Absatz 115 63 Ebd. Absatz 119 64 Panofsky nach Jean Paul Richter: The Notebooks of Leonardo da Vinci (1881) 65 James E. Cutting: Perception with an Eye for Motion, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 1986, S.23 66 M.H.Pirenne: Optics Painting & Photography, ,Cambridge, University Press 1970, S.121 67 Andrea Pozzo: Perspectivae pictorum atque architectorum, 1693, deutsche Übersetzung Augsburg 1709, 2.Buch, Figur 19 68 Ebd., 1.Buch, Figur 1 69 Albrecht Dürer; Unterweisung der Messung mit Zirkel und Richtscheid, 1525 (1.Aufage), viertes Büchlein, S.179 ff., nach der Ausgabe: Süddeutsche Monatshefte, München 1908, Hg. Alfred Pelzer 70 David Hockney: Secret Knowledge – Rediscovering the lost techniques of the Old Masters, Thames & Huson, London 2006 (2. Aufage), S.60-65 71 Herrmann von Helmholtz: Das Sehen des Menschen –Ein populärwissenschaftlicher Vortrag, gehalten in Königsberg am 27. Feb.1855, Druck Leipzig 1855. 72 Adelbert Ames baute 1946 einen Raum, der von einer festgelegten Position aus wie eingewöhnliches Zimmer mit rechtwinkligen geraden Wänden, Fußboden und Decke aussieht. Tatsächlich sind darin aber alle Flächen trapezförmig und Personen, die sich in dem Raum aufhalten, erscheinen dem Betrachter je nach Standort übermäßig groß oder zu klein. Dieser Eindruck stellt sich auch dann ein, wenn man über den Trick unterrichtet ist. 73 nach Eric Kandel, Neurowissenschaftler 74 Marie E. P. König: Am Anfang der Kultur- Die Zeichensprache des frühen Menschen, S.43, Ullstein Ffm/Berlin/Wien, 1981 75 Die Abbildung 26 ist kein authentisches Bild aus dem frühen Mittelalter. Es stammt von Camille Flammarion und wurde zuerst veröffentlicht im dem Buch: L´Atmosphere: Météorologie Populaire, Paris 1888. Der verbreitete Irrtum, es handele sich um ein authentisches Zeugnis für das Weltbild des mittelalterlichen Menschen, ist wohl dem allgemeinen Schulunterricht anzulasten, der über Jahrzehnte hinweg die wahre Herkunft und dessen Zeitzusammenhang nicht klarstellte. Ein besonders schlagendes Beispiel dafür, wie eine vorgegebene Lehrmeinung ein manipuliertes Geschichtsbild erzeugt. 76 Jeffrey Burton Russell: Inventing the Flat Earth- Columbus and Modern Historians, 1997 77 Die Sphärenharmonie bestand aus sieben Schichten, die den sieben Wandelsternen (Sonne, Mond, Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn) zugeordnet waren. Die Teilung einer Seite in sieben Abschnitte (Sectio canonis nach Euklid) sollte diese Harmonie geometrisch und akustisch abbilden. 1781 entdeckte Friederich Wilhelm Herschel den Planeten Uranus, der mit bloßem Auge nicht zu sehen ist und deshalb in der Antike nicht bekannt war. Dieser achte Wandelstern brachte die auf der Zahl sieben basierende Sphärenharmonie endgültig zu Fall. In der Harmonielehre der Musik hat sie sich jedoch bis heute erhalten. 78 Die heutige Darstellung, nach der die Erde ein Rotations-Sphäroid ist, widerlegt diese Erkenntnis meiner Meinung nach nicht. 79 Hermann von Helmholtz: Handbuch der physiologischen Optik, III, S.555, Leipzig, 1867 80 Ebd. S.30 81 Ebd. ab S.427 (§26) 82 Ebd. S.443 83 Ebd. S.443 84 Die Kernthese des Empirismus lautet, dass keine Vorstellung existieren kann, die nicht aus einer Wahrnehmung heraus erzeugt worden ist. Demnach sind Leistungen des Gedächtnisses lediglich Erinnerungen an frühere Wahrnehmungen. Die Gegenthese dazu lautet, dass wir über abstrakte Begriffe verfügen, die nicht aus Wahrnehmungen hervorgegangen sein können. 85 Der Nativismus geht davon aus, dass in unserer geistigen Tätigkeit bereits Vorformulierungen enthalten sind, die nicht erlernt worden sind. So stellt Kant den Raum als „reine Anschauung a priori“ dar. Diese Raumanschauung a priori hat eine abstrakte geometrische Struktur (in: Kritik der reinen Vernunft). 86 H.v.Helmholtz: Handbuch der physiologischen Optik, S.455 87 Ebd. S.457 ff. (§27) 88 Ebd. S.461 89 Ebd. S.538 90 Johann Benedict Listing, Naturwissenschaftler (1808-1882). Das Phänomen wird bis heute als Listingsche Regel bezeichnet. 91 Nachbilder, auch als Sukzessivkontrast bezeichnet, entstehen auf der Netzhaut als Reaktion auf einen starken Lichtreiz. So wird z.B. die Flamme einer Kerze, die man direkt angeschaut hat, einen Fleck in der Form der Flamme im Gesichtsfeld erzeugen. Die Farbigkeit und Intensität des Flecks verändert sich allmählich, bis er ganz verschwindet. 92 H.v.Helmholtz: Handbuch der physiologischen Optik, S.465 93 Hyperbel= Schnitt durch einen Kegel parallel zur Mittelachse des Kegels. 94 Dies allerdings immer unter Ausschluss der Wahrnehmung „scheinbar“ gekrümmter Linien in den zu diesem Zweck entworfenen „optischen Täuschungen“, wie z.B. bei den Hering-Linien 95 H.v.Helmholtz, Handbuch der physiologischen Optik, S.527 96 Ebd. S. 545 97 Ebd. S. 552 98 Ebd. S. 553 99 Ebd. S. 555 100 Akkomodation: Wenn die Augen einen Blickpunkt im Nachbereich fxieren verändert sich die Form der Linse im Auge von einer bikonvexen Form (für die Fernsicht) in eine Gradiantenform. Die Wirkung dieser Gradiantenform ist in etwa mit einer Weitwinkeloptik vergleichbar. 101 Ernst Mach, Analyse der Empfndungen und das Verhältnis des Physischen zum Psychischen, Verlag Gustav Fischer, Jena, 1911 (Nachdruck XENOMOI 2008) 102 Ernst Mach: Erkenntnis und Irrtum – Skizzen zur Psychologie der Forschung, Verlag Johann Ambrosius Barth, Leipzig, 1906 (Nachdruck XENOMOI 2011), Der physiologische Raum im Gegensatz zum metrischen, S. 347 103 Ebd., Zur Psychologie und natürlichen Entwicklung der Geometrie, S. 363 104 Ebd., Der physiologische Raum im Gegensatz zum metrischen, S. 353 105 Ebd., S. 357 106 Ernst Mach: Analyse der Empfndungen und das Verhältnis des Physischen zum Psychischen, Verlag Gustav Fischer, Jena, 1911 (Nachdruck XENOMOI 2008), VI. Die Raumempfndungen des Auges, S.105 107 Rudolf Arnheim: Kunst und Sehen- Eine Psychologie des schöpferischen Auges, S. 22, deGryter, Berlin, 2000 (Original von 1954 und 1974) 108 Ebd., S.48 109 James J. Gibson: What is Form?, 1954. Der Text ist Teil einer Studie die von der USAF School of Aviation Medicine an die Cornell University in Auftrag gegeben wurde. Es ging dabei um die besonderen wahrnehmungspsychologischen Anforderungen an einen Piloten, der sein Flugzeug auf einem Flugzeugträger landen soll. 110 Ebd., S.408 111 James J. Gibson: The Perception of the Visual Word, 1950, dt. Übersetzung aus dem Amerikanischen von Vera Schumann.Weinheim/Basel: Beltz, 1973, S. 185 ff.; enthalten in: Texte zur Theorie des Raums, Hrg. Stephan Günzel, Reclam Stuttgart 2013 112 Ebd. (Reclam S. 355) 113 Ausstellungskatalog „Sehsucht- Das Panorama als Massenunterhaltung des 19. Jahrghunderts“, Kunst und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Stromberg/Roter Stern 1993, S. 108 114 Guido Hauck: Die subjektive Perspektive und die horizontale Curvatur des dorischen Styls, 1879, in: Wochenblatt für Architekten und Ingeniere“ IV, 1882 115 William Gawin Herdman: A Treatise On The Curvilinear Perspective Of Nature: And Its Applicability To Art, Weale, London/ Deighton & Laughton/ Liverpool, 1854 116 Thomas Malton: A Compleat Treatise on Perspective (Theory and Practice on the True Principles of Dr Brook Taylor), 1775 117 William Gawin Herdman: A Treatise On The Curvilinear Perspective Of Nature: And Its Applicability To Art, Weale, London/ Deighton & Laughton, Liverpool, 1854, Malton zitiert durch Herdman, Seite 2 118 Ebd. S. 50 u. 51 119 Albert Flocon und André Barre: Die Kurvenlineare Perspektive – vom gesehenen Raum zum konstruierten Bild. Medusa Verlag Berlin – Wien 1983 (franz. Original: La perspective curviligne, 1964) 120 Ebd. S.90- Die Abwicklung der Kugel 121 M.H.Pirenne geht ausführlich auf die verblüffende Wirkung von Andrea Pozzos Deckengemälde ein in: Optics Painting & Photography, Cambridge, University Press 1970, S.79-94 122 Andrea Pozzo: Perspectivae pictorum atque architectorum, 1693, deutsche Übersetzung Augsburg 1709, 1.Buch, Figur 100 123 siehe: www.asisi.de Literatur Platon Aristoteles Aristoteles Euklid Euklid Strabon Titus Lucretius Carus (Lukrez) C. Plinius Secundus d. Ä. M. Fabius Quintilianus Leon Babtista Alberti Piero della Francesca Leonardo da Vinci Albrecht Dürer Georgio Vasari Joachim von Sandart Andrea Pozzo Berkeley John Locke David Hume Imanuel Kant Emil Wilde William Gawin Herdman Herrmann von Helmholtz Herrmann von Helmholtz Guido Hauck Christian von Ehrenfels Ernst Mach Ernst Mach Pawel Florenski Max Wertheimer Erwin Panovsky Egon Friedell Egmont Colerius James J. Gibson James J. Gibson Wilhelm Kraiker Ernst H.Gombrich Rudolf Arnheim M.H. Pirenne Jochen Jung, Hrg. Wolfgang Köhler Richard Seaford Robin Kerrod Marie E.P. König Der Staat, 10. Buch Über den Himmel / De Cielo Psychologie Die Elemente Optik Geographica Über die Natur der Dinge 4. Jh. v. Chr. 3. Jh. v. Chr. 3. Jh. v. Chr. 3. Jh. v. Chr. 3. Jh. v. Chr. 1. Jh. v. Chr. 1. Jh. v. Chr. Naturgeschichte, Bd.35, Farben-Malerei-Plastik Ausbildung des Redners Über die Malerei / Della Pittura De Prospectiva Pingendi Trattato della Pittura, im Codex Urbinas Unterweisung der Messung mit Zirkel und Richtscheit Lebensläufe der berühmtesten Maler, Bildhauer und Architekten Teutsche Academie – Perspektivkunst Perspéctiva pietorium et architectorum Towards a New Theorie of Vision An Essay Concerning Human Understanding Traktat über die menschliche Natur, 1. Der Verstand Kritik der reinen Vernunft Eine Abhandlung über die Optik der Griechen A Treatise on the Curvilinear Perspektive of Natur: And Its Applicability to Art Das Sehen des Menschen Handbuch der physiologischen Optik Die subjektive Perspektive und die horizontalen Curvaturen des Dorischen Tempels Über Gestaltqualitäten Erkenntnis und Irrtum – Skizzen zur Psychologie der Forschung Analyse der Empfindungen und Verhältnis des Physischen zum Psychischen Raum und Zeit Untersuchungen zur Lehre der Gestalt Die Perspektive als symbolische Form Kulturgeschichte der Neuzeit Vom Punkt zur vierten Dimension The Perception of the Visual World What Is Form? Die Malerei der Griechen Kunst und Illusion. Zur Psychologie der bildlichen Darstellung Kunst und Sehen. Eine Psychologie des schöpferischen Auges Optics, Painting and Photographie Die Welten des M.C.Escher Die Aufgabe der Gestaltpsychologie Pompeji Sterne und Planeten Am Anfang der Kultur- Die Zeichensprache des frühen Menschen 1. Jh n. Chr. 1. Jh n. Chr. 1436 1474 1480-1516 1525 (1. Ausg.) 1550 1675 1693- 1700 1709 1689 1748 1781 1832 1854 1855 1867 1879 1890 1906 1911 1920 1923 1927 1927-31 1935 1950 1954 1958 1960 1967 1970 1971 1971 1978 1979 1981 Albert Flacon/ André Barré, Torsten Capelle Bruno Ernst James E. Cutting Martin Kemp Bundeskunsthalle Bonn, Hrg. Ernst H. Gombrich David Hockney Die kurvenlineare Perspektive Geschlagen in Stein – Skandinavische Felsbilder der Bronzezeit Der Zauberspiegel des M.C.Escher Perception with an Eye for Motion The Science of Art -Optical Themes in western art from Brunelleschi to Seurat Sehsucht – Panoramamalerei des 19. JH, Ausstellungskatalog Das forschende Auge Secred Knowledge – Rediscovering the Lost Techniques of the Old Masters 1983 1985 1986 1986 1990 1993 1994 2002 Abbildungen 1a 1b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 a-e 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Optische Täuschung Ponzo-Täuschung Petroglyphen in Südschweden, in Thorsten Capelle „Geschlagen in Stein“ Petroglyphen in Südschweden, in Thorsten Capelle „Geschlagen in Stein“ Griechische Vasenmalerei, in Kraiker „Die Malerei der Griechen“ Griechische Vasenmalerei, in Kraiker „Die Malerei der Griechen“ Griechische Vasenmalerei, in Kraiker „Die Malerei der Griechen“ Das Winkelaxiom von Euklid, eigene Grafik Trinitätsikone von Andrej Rubljow Dreifaltigkeitsfresko von Masaccio Schema der Zentralperspektive, eigene Grafik nach Alberti Die Geißelung Christi von Piero della Francesca Übertragung von Kreisen in das Schema der Zentralperspektive, eigene Grafik nach Alberti Das Winkelaxiom mit Piero della Francescas Formel, eigene Grafik nach Kemp Grundriss der Säulenreihe, eigene Grafik nach Panofsky/ Richter/ Leonardo Figura 19, in Andreas Pozzos Perspektivlehre Ein-Punkt-, Zwei-Punkt- und Drei-Punkt-Perspektive, eigene Grafik Zeichner der Laute, in Albrecht Dürer „Unterweisung der Messung“ Lochkamerafoto von Pirenne im Original und mit sphärischer Korrektur Das Ringkreuz, eigene Grafik Versteinerte Muschel mit Gravur (Nummulites Perforatus), in König „Am Anfang der Kultur“ Sphäroidisches Weltbild, eigene Grafik Höhlenskulptur einer Schale mit Kreuz, in König „Am Anfang der Kultur“ Schalenstein von Bunsoh mit Ringkreuz, in König „Am Anfang der Kultur“ Die fünf regelmäßigen platonischen Körper Die Himmelssphäre, in „Sterne und Planeten“ Grafik von Ron Jobson Das Weltbild des Mittelalters, in „L´Atmosphere: Météorologie Populaire“ Der Garten der Lüste von Hieronymus Bosch Schema für eine Sternenkarte, in „Sterne und Planeten“ Grafik von Ron Jobson Das geozentrische Weltbild, eigene Grafik Demonstration der sphärischen Projektionen, Grafik von Sabine Baum Zweidimensionale Darstellung der azimutalen Projektionen, Grafik von Lars. H. Rohwedder Strukturmodell des Blickfeldes nach H. v. Helmholtz, eigene Grafik Die Listingsche Ebene, eigene Grafik Hyperbelraster nach der Raddrehung der Augen, in Helmholtz „Die physiologische Optik“ Hyperbelraster des indirekten Sehens, in Helmholtz „Die physiologische Optik“ Flussrichtung der Bewegungsperspektive, in Gibson „The Perception of the Visual World“ Einzug Karl IV in St. Denis von Jean Fouquet Pfeilerhalle in kurvenlinearer Perspektive, in Hauck „Die subjektive Perspektive“ Rektilineare Perspektive und stereographische Projektion, auf Panotools.org Der sphärische Raum, in Flocon/ Barré „Kurvenlineare Perspektive“ Postel-Projektion, eigene Grafik Zeichnung in kurvenlinearer Perspektive von Albert Flocon Figura 100, in Andrea Pozzos Perspektivlehre Schnitt durch die Panoramarotunde, in Ausstellungskatalog „Sehsucht“ IMAX-Ride Theater, in „Zeitmagazin“ 11/1995