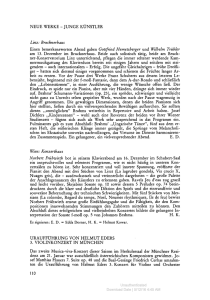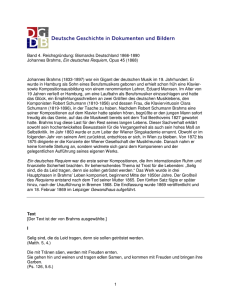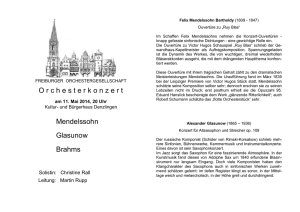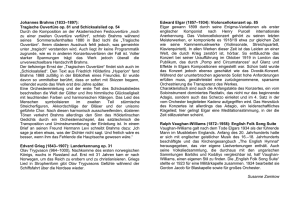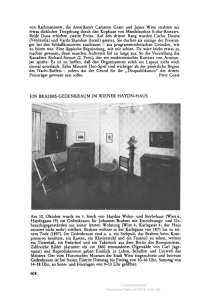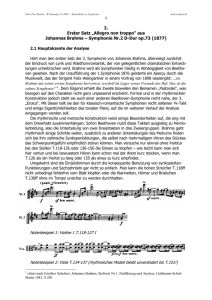Semyon Bychkov - Münchner Philharmoniker
Werbung

Semyon Bychkov Jean-Yves Thibaudet Samstag, 20. Juni 2015, 13:30 Uhr Sonntag, 21. Juni 2015, 11 Uhr Montag, 22. Juni 2015, 20 Uhr Dienstag, 23. Juni 2015, 20 Uhr SOEBEN BEI JUWELIER FRIDRICH FRISCH EINGETROFFEN: TRAUMHAFTE JUWELEN DER MEERE AUS DEN ZUCHTPERLFARMEN ASIENS. Edle Zuchtperlen direkt importiert von unseren Partnern in Japan, China und der Südsee ...zu verführerischen Preisen! TRAURINGHAUS · SCHMUCK · JUWELEN · UHREN · MEISTERWERKSTÄTTEN J. B. FRIDRICH GMBH & CO. KG · SENDLINGER STRASSE 15 · 80331 MÜNCHEN TELEFON: 089 260 80 38 · WWW.FRIDRICH.DE Johannes Brahms Symphonie Nr. 3 F-Dur op. 90 1. Allegro con brio | 2. Andante 3. Poco allegretto | 4. Allegro Maurice Ravel Konzer t für Klavier und Orchester G-Dur 1. Allegramente | 2. Adagio assai | 3. Presto Claude Debussy „La Mer“ Trois esquisses symphoniques 1. „De l’aube à midi sur la mer“ (Von der Morgendämmerung bis zum Mittag auf dem Meer) 2. „Jeux de vagues“ (Wellenspiele) 3. „Dialogue du vent et de la mer“ (Wechselspiel zwischen Wind und Meer) Semyon Bychkov, Dirigent Jean-Yves Thibaudet, Klavier Samstag, 20. Juni 2015, 13:30 Uhr 6. Öf fentliche Generalprobe Sonntag, 21. Juni 2015, 11 Uhr 8. Abonnementkonzer t m Montag, 22. Juni 2015, 20 Uhr 8. Abonnementkonzer t f Dienstag, 23. Juni 2015, 20 Uhr Uni-Konzer t Spielzeit 2014/2015 117. Spielzeit seit der Gründung 1893 Valery Gergiev, Chefdirigent (ab 2015/2016) Paul Müller, Intendant Johannes Brahms: Brahms: 3. 3. Symphonie Symphonie F-Dur F-Dur Johannes 212 „Heroisches ohne ohne kriegerischen „Heroisches kriegerischen Beigeschmack“ Beigeschmack“ Thomas Leibnitz Leibnitz Thomas Johannes Brahms Traditionslast der Vergangenheit (1833–1897) Uraufführung Sie waren Antipoden und empfanden einander auch als solche: Johannes Brahms und Anton Bruckner repräsentierten gegen Ende des 19. Jahrhunderts zwei verschiedene Entwicklungswege der deutschen Symphonik; beide gründen sich auf das symphonische Werk Beethovens. Während der „fortschrittsorientierte“ Strang Schubert – Bruckner – Mahler bis ins 20. Jahrhundert hinein wirkungsmächtig blieb, endete die „konservative“ Linie Mendelssohn – Schumann – Brahms bei Brahms selbst. Der aus Hamburg stammende Wahlwiener wurde geradezu zur Symbolfigur des musikalischen Konservativismus; er selbst war sich der retrospektiven, historistischen Ausrichtung seines Schaffens durchaus bewusst. Während Komponisten früherer Zeiten, unbelastet von musikalischer Vergangenheit, ihre eigene Sprache suchten und fanden, bedeutete für Brahms die im Konzertleben des 19. Jahrhunderts lebendig gebliebene Musikgeschichte eine ständige Herausforderung, ja Belastung. „Ich werde nie eine Symphonie komponieren ! Du hast keinen Begriff davon, wie es unsereinem zu Mute ist, wenn er immer so einen Riesen hinter sich marschieren hört“, äußerte sich Brahms zu Beginn der 70er Jahre dem Dirigenten Hermann Levi gegenüber. Am 2. Dezember 1883 in Wien im Großen Musikvereinssaal (Wiener Philharmoniker unter Leitung von Hans Richter). Keine Frage, dass mit dem „Riesen“ Beethoven gemeint war. Nach Beethoven als Symphoniker auf- Symphonie Nr. 3 F-Dur op. 90 1. Allegro con brio 2. Andante 3. Poco allegretto 4. Allegro Lebensdaten des Komponisten Geboren am 7. Mai 1833 in Hamburg; gestorben am 3. April 1897 in Wien. Entstehung Nach der Vollendung seiner D-Dur-Symphonie op. 73 legte Brahms eine Pause von immerhin sechs Jahren ein, ehe er sich um 1883 seiner „Dritten“ zuwandte, die während eines sommerlichen Erholungsaufenthalts im Rheingau in erster Linie in Wiesbaden und Umgebung entstand. Der Orchesterfassung ließ Brahms eine Bearbeitung für zwei Klaviere zu vier Händen folgen. Johannes Johannes Brahms: Brahms: 3. 3. Symphonie Symphonie F-Dur F-Dur zutreten, erschien Brahms als Herausforderung, die nur nach äußerst selbstkritischer und gewissenhafter Vorbereitung angenommen werden durfte. Bis 1876 komponierte er eine Reihe von Orchesterwerken, so die beiden Serenaden op. 11 und op. 16, das 1. Klavierkonzert op. 15 und die „Variationen über ein Thema von Joseph Haydn“ op. 56a; doch keines trug den Titel „Symphonie“. Erst nach Beendigung der durchaus bereits symphonisch konzipierten, meisterhaften „Haydn-Variationen“ glaubte er sich im Besitz des kompositorischen „Rüstzeugs“, das zur Bewältigung der geschichtlich befrachteten und ehrfurchtgebietenden Gattung der Symphonie nötig erschien. 1876 wurde die 1. Symphonie op. 68 beendet, von Hans von Bülow prompt als „Beethovens ‚Zehnte‘“ bezeichnet; ihr folgte bereits ein Jahr später die pastoralbeschauliche „Zweite“. Nach einer mehrjährigen Pause, in der u. a. das Violinkonzert op. 77 (1878), die „Akademische Festouvertüre“ op. 80 und die „Tragische Ouvertüre“ op. 81 (beide 1880) entstanden, schrieb Brahms 1883 endlich seine „Dritte“. Werkidee im Dunkeln Kaum ein anderer Komponist des 19. Jahrhunderts äußerte sich über Entstehung und Inhalt seiner Werke so wenig wie Johannes Brahms. So existiert als gesichertes Wissen über die Genese der 3. Symphonie nur die nüchterne Tatsache, dass das Werk im Sommer 1883 in Wiesbaden vollendet wurde, wo Brahms seinen Urlaub verbrachte. Zwar nimmt das Werk im Briefwechsel mit Verleger Fritz Simrock eine prominente Rolle ein; doch geht es hier nicht um musikalische Inhalte, sondern um etwas sehr Profanes: das Honorar. Brahms zählte seinerzeit zu den Komponisten mit hohem, ja höchstem „Marktwert“. Musste etwa Bruckner 133 die Verleger anflehen, seine Werke – selbstverständlich unentgeltlich – zu publizieren, konnte Brahms zwischen oft mehreren Angeboten wählen; meist fiel die Wahl auf Simrock – jedoch erst dann, wenn Brahms durch geschickte Hinweise auf lukrative Konkurrenzangebote das Honorar auf die gewünschte Höhe gesteigert hatte. Im Fall der 3. Symphonie gab er sich mit einem Honorar von 5000 Talern (= ca. 7.500 Euro) zufrieden, obwohl ihm der Wiener Verleger Albert J. Gutmann nach der erfolgreichen Uraufführung die stolze Summe von 10.000 Gulden (= ca. 10.000 Euro) geboten hatte. Brahms konnte es sich leisten, Simrock gegenüber in Honorarfragen einen selbstbewusstkoketten Ton anzuschlagen: „Und was wollen Sie mir denn für die Symphonie schuldig sein ? Das Gewöhnliche ? Die Hälfte ? Das Doppelte ?“ Da nun von Brahms selbst über Entstehung und Inhalt des Werks wenig oder gar nichts zu erfahren war, bemühte sich Biograph Max Kalbeck, die Lücke erfindungsreich zu füllen. In seiner mehrbändigen Brahms-Biographie entwickelte er die Hypothese, der 1. Satz habe in anderer Form schon „in früher Zeit“ existiert. Als Anhaltspunkt diente ihm ein aus dem Jahr 1883 stammender Brief des Komponisten an Simrock, in dem dieser dem Verleger mitteilt: „... und wenn ich etwa noch einmal Notenblätter aus meiner Jugendzeit finde, so will ich sie Ihnen auch schicken.“ Freilich deutet nichts auf einen Konnex mit der eben vollendeten 3. Symphonie hin, und auch stilistisch finden sich keine Verbindungslinien zum Frühwerk. Weiters nahm Kalbeck an, „dass die Mittelsätze, die als ein mit dem Übrigen nur lose verknüpftes Ganzes für sich zu betrachten sind, der Beschäftigung mit Goethes ‚Faust‘ ihr Dasein verdanken.“ Tatsächlich hatte Franz Dingelstedt, Wiener Burg- und Operndirektor, 414 Johannes Brahms: Brahms: 3. 3. Symphonie Symphonie F-Dur F-Dur Johannes Brahms 1880 zur Komposition einer „Faust“-Musik angeregt; doch mehr als Vermutungen können auch hier nicht angestellt werden. Vor allem sind die musikalischen Bezüge der Mittelsätze zu den Ecksätzen keineswegs so „lose“, wie Kalbeck behauptet. Äußerst fragwürdig und an den Haaren herbeigezogen schließlich erscheint der Versuch des Biographen, den letzten Satz der Symphonie als musikalisches Abbild der „Germania“ zu interpretieren, des Niederwald-Denkmals von Johann Schilling, das im Sommer des Jahres 1883 fertiggestellt und vom deutschen Kaiser mit großem Pomp eingeweiht wurde. Zwar ist nicht zu leugnen, dass auch Brahms vom zeittypischen Nationalismus beseelt war, dass er das Denkmal von Wiesbaden aus besuchte und die von ihm repräsentierte antifranzösische Gesinnung der „Wacht am Rhein“ durchaus teilte. Doch fehlen alle Belege für Kalbecks Behauptung, in Brahms’ „Visionen“ habe sich „das Vaterland zum All, das Deutsche Reich zum Weltreich“ ausgedehnt, woran sich die Interpretation an schließt: „Davon singt das Finale der F-Dur-Symphonie in mächtigen Tönen...“ Gerade der verhaltene, zurückgenommene Schluss dieses Satzes fügt sich in keiner Weise in das Bild eines kriegerischen „Hurra“Patriotismus. Zweimal zwei Sätze Die „Dritte“ ist nicht nur Brahms’ kürzeste Symphonie, sie unterscheidet sich von ihren Schwestern auch durch ein Charakteristikum der Konzeption: Zwei monumentale Ecksätze umrahmen zwei intermezzohafte Mittelsätze. In gewisser Weise greift der Komponist sogar auf den Typus der Symphonie vor Beethoven zurück, wenn er im 3. Satz die traditionelle Form des Menuetts verwendet – obgleich die romantische Färbung kaum Gedanken an die Tanzsätze der Haydn- und Mozart-Symphonien aufkommen lässt. Ein „Motto“ steht am Beginn des Kopfsatzes, eine spannungsvolle Folge von drei Bläserakkorden, die harmonisch das für Brahms typische Schwanken zwischen Dur und Moll und melodisch die Tonfolge f-as-f exponieren. Mit dem Motiv f-a-f („frei, aber froh“) hatte der junge Brahms immer wieder auf seine ganz persönliche Situation angespielt, auf die Lichtund Schattenseiten seiner Bindungslosigkeit. Hier, in der mittleren Schaffensphase, zitiert er das Motiv abermals, jedoch mit charakteristischer Eintrübung nach Moll. Dem Motto folgt unmittelbar das in weiträumigen Intervallschritten herabstürzende Hauptthema, das sogleich thematisch weiterentwickelt wird. Als explizit „kämpferisch“ wurde dieses Thema empfunden; vielleicht bezog sich Hans Richter, der Dirigent der Uraufführung, auf diese Eigenschaft, als er in einem Trinkspruch Brahms’ „Dritte“ als seine „Eroica“ bezeichnete. Als melodischer Gegenpol erweist sich das Seitenthema in der Klarinette, eine tänzerisch ausschwingende Melodie über wiegender Begleitung. Die Durchführung, dem klassischen Schema gemäß der Ort dramatischer thematischer Auseinandersetzungen, ist kurz: motivische und harmonische „Durchführung“ findet im Grunde von Beginn an statt. Immer wieder meldet sich das „Motto“ in wechselnder instrumentaler Gestalt zu Wort und verleiht dem Satz stringente thematische Einheit. 5 Johannes Brahms (um 1885) 6 Johannes Brahms: Brahms: 3. 3. Symphonie Symphonie F-Dur F-Dur Johannes Ruhe vor dem Sturm Gegenüber der Dramatik des 1. Satzes vermittelt das nun folgende Andante die Empfindung schwerelosen melodischen Strömens. Brahms beschränkt sich im wesentlichen darauf, das schlichte, liedartige Hauptthema immer wieder neu zu färben und einfallsreich zu umspielen. Einen fragenden, eher zurückhaltenden Charakter hat das von den Holzbläsern intonierte Seitenthema, dessen auftaktiger Rhythmus sich zu einem melodischen Charakteristikum entwickelt. Formal umschließen in diesem 2. Satz zwei Rahmenteile einen unruhigeren Mittelteil mit Durchführungscharakter; dass Brahms in der Reprise das Seitenthema nicht mehr auftreten lässt, zeugt für seinen freien Umgang mit tradierten Formen. Auch im 3. Satz, von Beethovens dämonisch-dramatischen Scherzosätzen meilenweit entfernt, trifft man auf die Grundform A-B-A und damit auf die Wiederkehr des Rahmenteils nach kontrastierendem Mittelteil. Ganz im Charakter einer „Valse sentimentale“ schwingt sich das melancholische Hauptmotiv aus und kehrt in stets neuen Abwandlungen wieder; das Trio zeigt ebenfalls zart tänzerischen Charakter, wobei Bläser- und Streichersatz rhythmisch raffiniert miteinander verschachtelt sind. Symphonische Dramatik ist erst wieder im Schlusssatz angesagt. Das in Sekundschritten geführte, im Unisono der Streicher und des Fagotts vorgetragene Hauptthema vermittelt den Eindruck von Gewitterschwüle; ihm folgt nach einem choralartigen Gedanken, der sich als fast tongetreue Wiederkehr des Seitenthemas des Andante erweist, der „Gewitterausbruch“: scharf punktierte, dann wieder kurz abgerissene Figuren, die das thematische Geschehen gleich zuckenden Blitzen durchziehen. 15 Auch in diesem Satz ist bereits die Exposition von so dichter thematischer Arbeit durchzogen, dass man sie von der eigentlichen Durchführung, die die Konflikte nur noch steigert, kaum unterscheiden kann. Charakteristisch für Brahms ist jedoch der Ausklang, der weder in Triumph noch Tragik mündet, sondern in stille, friedliche Ergebenheit. Wie leichtes Windesrauschen erklingen die Figurationen der Streicher, fast flüsternd zitieren sie zum Abschluss nochmals das Hauptthema des Kopfsatzes. Breites Deutungsspektrum Der mit Brahms befreundete Kritiker Eduard Hanslick hatte in seiner musikästhetischen Schrift „Vom Musikalisch-Schönen“ definiert: „Der Inhalt der Musik sind tönend bewegte Formen“. Getreu dieser Grundhaltung schrieb er nach der umjubelten Uraufführung der neuen Brahms-Symphonie, die am 2. Dezember 1883 im Wiener Musikverein stattgefunden hatte: „Ein wahres Fest – mehr noch für den entzückten Menschen und Musiker in uns als für den Kritiker, der hinterher beschreiben soll, wie die neue Symphonie von Brahms aussieht, und vor allem was alles schön daran ist. Nun gehört es weder zu den seltenen, noch zu den unerklärlichen Mißgeschicken, dass die Beredtsamkeit des Kritikers um so tiefer sinkt, je höher die des Komponisten sich emporgeschwungen. Die Wortsprache ist nicht sowohl eine ärmere, als vielmehr gar keine Sprache der Musik gegenüber, da sie die letztere nicht zu übersetzen vermag.“ In seiner dennoch ausführlichen Besprechung des Werks ging er auf Hans Richters Charakterisierung der Symphonie als neue „Eroica“ ein und versuchte eine Art Standortbestimmung für sie innerhalb von Brahms’ Schaffen: „Brahms’ dritte Symphonie ist tatsäch- 7 „Ministrant Hanslick beweihräuchert die Statue des heiligen Johannes“ (aus der satirischen Zeitschrift „Figaro“, um 1885) 816 Johannes Brahms: Brahms: 3. 3. Symphonie Symphonie F-Dur F-Dur Johannes lich wieder eine neue. Sie wiederholt weder das schmerzliche Schicksalslied der ‚Ersten‘, noch die heitere Idylle der ‚Zweiten‘; ihr Grundton ist selbstbewußte, tatenfrohe Kraft. Das Hero ische darin hat keinen kriegerischen Beigeschmack, führt auch zu keinerlei tragischem Akte, wie der Trauermarsch in der ‚Eroica‘ einer ist...“ Zu romantisch-literarischen Impressionen inspirierte das Werk Clara Schumann, die die Symphonie ausführlich am Klavier studiert hatte und Brahms am 11. Februar 1884 schrieb: „Ich habe so glückliche Stunden in Deiner wunderbaren Schöpfung gefeiert (sie viele Male mit Elise gespielt), dass ich dies wenigstens gesagt haben möchte: Welch ein Werk, welche Poesie, die harmonischste Stimmung durch das Ganze, alle Sätze wie aus einem Gusse, ein Herzschlag, jeder Satz ein Juwel ! – Wie ist man von Anfang bis zu Ende umfangen von dem geheimnisvollen Zauber des Waldlebens ! Ich könnte nicht sagen, welcher Satz mir der liebste ? Im ersten entzückt mich schon gleich der Glanz des erwachten Tages, wie die Sonnenstrahlen durch die Bäume glitzern, alles lebendig wird, alles Heiterkeit atmet !“ Wie weit in der Aufnahme durch die Zeitgenossen subjektive Eindrücke auseinanderklafften, zeigt die Meinung Joseph Joachims – des mit Brahms befreundeten großen Geigers – über den Schlusssatz der Symphonie. Max Kalbeck hatte darin, wie gesagt, eine Apotheose des neuen „Deutschen Reichs“ erblickt; Joachims Assoziationen waren gänzlich andere: „Und sonderbar, so wenig ich das Deuteln auf Poesie in der Musik in der Regel liebe, werde ich doch bei dem Stück (und nur bei wenigen anderen in dem ganzen Musikbereich geht es mir ebenso) ein bestimmtes poe t isches Bild nicht los: Hero und Leander ! Ungewollt kommt mir, beim Gedanken an das 2te Thema in C dur, der kühne, brave Schwimmer, gehoben die Brust von den Wellen und der mächtigen Leidenschaft, vors Auge – rüstig, heldenhaft ausholend zum Ziel, zum Ziel trotz der Elemente, die immer wieder anstürmen !“ Mythos der Originalität Die hier zitierten Stimmen stammen ausschließlich von Freunden und Verehrern des Komponisten. Ihnen standen – gewissermaßen im Sinne einer „Fundamentalopposition“ – die Wortmeldungen aus dem Lager der sog. „Neudeutschen“ und Wagnerianer gegenüber, die Brahms’ Schaffen prinzipiell als rückschrittlich und antiquiert bezeichneten. Eine besonders scharfe Feder führte Hugo Wolf; bei ihm verband sich der musikästhetische Standort mit persönlicher Animosität, denn Brahms hatte ihn – wie auch so manchen anderen – durch schroff-abfällige Bemerkungen über seine Kompositionen schwer gekränkt. Im Wiener „Salonblatt“ schlug nun Wolf in seiner Rezension der 3. Symphonie zurück: „Als Symphonie des Dr. Johannes Brahms ist sie zum Teile ein tüchtiges, verdienstliches Werk; als solche eines Beethoven Nr. 2 ist sie ganz und gar mißraten, weil man von einem Beethoven Nr. 2 alles das verlangen muss, was einem Dr. Johannes Brahms gänzlich fehlt: Originalität.“ Es spricht übrigens für Brahms’ Humor, dass er die Kritiken Hugo Wolfs sammelte und sie gelegentlich im Freundeskreis zur allgemeinen Erheiterung vorlas. Essay Brahms, der Unheroische 9 17 Resignieren statt statt jubilieren: Resignieren jubilieren: Brahms, der der Unheroische Brahms, Unheroische Hans Köhler Stephan Kohler Komponieren nach Beethoven Welche musikgeschichtliche Zukunft war der Gattung „Symphonie“ vorgezeichnet, als Beethoven sie zu revolutionieren begann ? Oder anders gefragt: Welchen Weg hätte sie genommen, wenn nicht Beethovens 9 Symphonien sie so nachhaltig geprägt hätten ? Es bleibt ein müßiges und fruchtloses Denkmanöver, darüber nachzusinnen, welche Gestalt wohl Schubert, Schumann, Brahms und Mahler ihren Symphonien gegeben hätten, wäre da nicht Beethovens von vielen als belastend, ja geradezu erdrückend empfundenes Vorbild gewesen. Über Beethoven hinaus, hinter ihn zurück oder geschickt um ihn herum ? Scheitern und Gelingen wurde nicht nur von den Zeitgenossen, sondern vor allem von den Komponisten selbst am Umgang mit Beethovens symphonischem Erbe abgelesen, das nicht einfach nur naiv kopiert oder fortgeschrieben werden durfte, aber auch nicht kaltblütig zu ignorieren war. Dabei schienen es weniger musikinterne Momente, wie etwa Harmonik, Melodik, Rhythmik oder Instrumentation zu sein, die einschüch ternd auf die nächste Komponistengeneration wirkten, und auch nicht Beethovens „architektonische“ Maßnahmen zur Umwälzung des symphonischen Formen-Repertoires; niederschmetternd und gleichzeitig traditionsstiftend wirkte vielmehr die Aura des „Heroischen“, die seine Werke verbreiteten und die wiederum untrennbar mit der persönlichen Leidensgeschichte ihres Autors verknüpft schien. Das Heroische als grundsätzliche innere Verfasstheit von Symphonik war von Beethoven in die Gattung eingeführt worden und blieb bis ins 20. Jahrhundert einer der Hauptcharaktere symphonischen Schaffens, von vielen als „zwingend“ vorgegebene Aufgabe, ja sogar Verpflichtung aufgefasst, deren gelungene Einlösung die Inanspruchnahme der Gattung fürs eigene Komponieren überhaupt erst rechtfertigte. „Durch Nacht zum Licht“ Was bei manchem Spät(er)geborenen zur zwanghaften Pose ausartete – bei Beethoven selbst schien „heroische“ Haltung mit privater Lebensführung noch vereinbar, wenn nicht deckungsgleich. Doch unabhängig von allen biographistischen Lesarten bieten die Werke selbst, insbesondere die 9., 5. und 3. Symphonie, genügend Anhaltspunkte, um sie als jeweils individuelle Wege aus einer anfänglich „tragischen“, quasi schicksalsumwitterten Situation ins gleißende Licht musikalischer Selbstbefreiung zu deuten. Romantiker wie E.T.A. Hoffmann haben das „innere Programm“ einer kämpferischen Bewältigung des Fatalen, Dunklen, eines musikalischen „Siegs“ von Dur über Moll, schon früh als musikmetaphorischen Akt der Selbstbehauptung begriffen, als 10 18 Essay Brahms, der Unheroische Überwindungsstrategie im Kampf gegen die Macht finsterer Gegenwelten, aber auch gegen die „OhnMacht“ des menschlichen Individuums. Beethovens c-Moll-Symphonie, die „Fünfte“, war es vor allem, die man als großangelegte Auseinandersetzung zwischen Nacht und Licht interpretierte, als Ausgang des Menschen aus einem von Schicksalsschlägen unterjochten Dasein und Eintritt in einen Zustand vitaler Selbstbefreiung und intellektueller Emanzipation. Den Weg durch Nacht zum Licht („per aspera ad astra“) haben Generationen von Musikgelehrten, Interpreten und Konzertbesuchern der „Fünften“ nicht nur als wohlfeiles Etikett angeheftet, sondern damit auch Wesentliches über die inhaltliche Komponente von Beethovens Komponieren gesagt: über die Symphonie als Formgefäß für heroisches Ethos und gelebte Humanität. Schuberts 4. Symphonie, die er selbst seine „Tragische“ nannte, folgt Beethovens c-Moll-Symphonie nicht nur in der Wahl der Tonart; und auch Schumanns d-Moll-Symphonie knüpft offenkundig an den von Beethoven geprägten Typus des „affirmativen“ Finales an. Bis hin zur 1. Symphonie des Schumann-Freundes Johannes Brahms, auch sie wieder von der Grundtonart c-Moll ausgehend, blieb die gängige Verlaufsform der Symphonie die des „per aspera ad astra“, und noch bei Bruckner münden alle Werke dieser Gattung – mit Ausnahme der unvollendet gebliebenden „Neunten“, der das Finale fehlt – in eine strahlende und gleichzeitig applaustreibende Dur-Apotheose. Kurskorrektur „Trauermarsch“ Beethovens „Eroica“, die heldenhaftes Ethos schon im Untertitel zum symphonischen „Programm“ erhebt, bildet das Schema „Durch Nacht zum Licht“ mit einer signifikanten „Kurskorrektur“ ab, die bis zu Gustav Mahler Bedeutung und Gewicht behalten sollte, also nicht minder traditionsstiftend wirkte. Mag der als „Marcia funebre“ integrierte Trauermarsch zunächst nur Ausdruck von Klage über heldenhaftes Scheitern sein – gerade dadurch wurde er zum musikgeschichtlichen Vorreiter zahlreicher „Trauermusiken“, die den Heroismus im Diesseits mit dem Erlösungsgedanken im Jenseits kausal verknüpften, wie es noch am Ende des Jahrhunderts in Mahlers „Totenfeier“ und Strauss’ „Tod und Verklärung“ der Fall war. Dennoch: Auch wenn in Beethovens „Eroica“ die metaphorische „Grablegung“ großer Hoffnungen zum Zentrum einer „heroischen“ Symphonie aufstieg – die Botschaft von Trauer und Schmerz wurde im weiteren Verlauf immer noch überwölbt vom Verklärungsglanz einer Schlusskonzeption, die Triumph, Sieg oder zumindest Ausweg aus Selbstverneinung und Frustration verhieß. Die Finalität und Zielgerichtetheit dieser Konzeption wird durch den neu eingeführten Trauermarsch jedoch „gestört“, weil er nicht – wie später bei Gustav Mahler – Ausgangspunkt und damit Fundament des gesamten symphonischen Gebäudes ist, sondern dieses nach einem heroisch gestimmten und deshalb verheißungsvollen 1. Satz quasi gegenläufig „unterwandert“. Es blieb Richard Wagner vorbehalten, dieses Netzwerk aus Dur und Moll, also die gegenseitige Durchdringung von Trauer, Schmerz und heroischem „Sich aufraffen“, als neutrale Mitte zwischen Sieg und Niederlage zu definieren: „Wir wollen nicht erliegen, sondern ertragen !“ Nur wenige Werke der symphonischen Literatur, etwa Mozarts g-Moll-Symphonie KV 550, harren in der anfänglichen Moll-Tonart bis zum sprichwörtlich „bitteren Ende“ aus; bei Mahler ist 11 Johannes Brahms auf Sommerfrische im Salzkammergut (um 1890) 12 20 Essay Brahms, der Unheroische es einzig die „Sechste“, die in Analogie zu Schuberts „Vierter“ denn auch prompt als „Tragische“ in sein Werkverzeichnis Eingang fand. Der konservative Revolutionär Zwischen diesen Extremen – dem Festhalten an der „per aspera ad astra“-Kurve und dem Negativitätssog fatalistischer Provenienz – schien es lange Zeit keine vermittelnde Instanz zu geben. Es gab sie dennoch und gerade dort, wo man sie vielleicht am allerwenigsten vermutete: im Lager der sog. „Konservativen“, denen man zu Unrecht – vor allem aber zu unüberlegt – den Hamburger Wahl-Wiener Johannes Brahms zurechnete. Kaum ein Komponist vor oder nach ihm hatte wohl mehr Scheu gehabt, sich angesichts der Vorgaben Beethovens mit der Gattung „Symphonie“ überhaupt noch einzulassen. Erst 1876, als er immerhin schon seine Lebensmitte überschritten hatte, wagte er es, eine erste Symphonie, bezeichnenderweise in c-Moll, vorzulegen, zu der die ersten Pläne nicht weniger als 16 Jahre in die Vergangenheit zurückreichten. Überwindung der Tradition, Abweichung vom Vorgegebenen, war Brahms’ Sache weder hier noch in der folgenden 2. Symphonie, weshalb Hans von Bülow beide Werke als „Zehnte“ und „Elfte“ bezeichnete, um ihre Abhängigkeit vom Beethoven’schen Vorbild ironisch, aber durchaus wohlwollend zu markieren. Triumph des Unheroischen Mit Brahms’ „Dritter“, die in Wagners Todesjahr 1883 entstand, verhält es sich freilich anders; sie unter Gattungstraditionen der Ersten Wiener Schule zu subsumieren, ihr den Stempel der klassischen Konformität, des heroischen Traditionskults aufzudrücken, hieße sie unzulässigerweise in eine Werkästhetik zu vereinnahmen, aus der sie hörbar ausschert. Brahms’ 3. Symphonie geht schon in der Wahl der Grundtonart in Opposition zu des „Titanen“ Beethoven „Eroica“: F-Dur ist des heroischen Tonfalls denkbar unverdächtig und steht seit der „Pastorale“ weit mehr für liebliche Bukolik und Idylle als für den „Griff in den Rachen des Schicksals“. Doch nimmt das so heiter und optimistisch angelegte Werk im Finale eine Wendung, die erneut als gegenläufig zu Beethovens „Dritter“ angesehen werden kann: Statt die Tonart F-Dur des eröffnenden „Allegro con brio“ aufzugreifen, bedient sich Brahms im letzten Satz der spannungsreichen Moll-Variante, macht das Finale zum Schauplatz „eines gewaltigen Ringens elementarer Kräfte“ und löst sich überraschend erst in den letzten 40 Takten vom f-Moll des Beginns, um zuletzt alle tragischen Zerwürfnisse und Konfliktballungen einer denkbar unheroischen, mehr verdämmernden als verklärenden Schlusslösung zuzuführen. Deutet dieser rätselhafte Schluss auf eine Verweigerungshaltung des Komponisten, sich unters Joch der „heroischen“ Gattungstradition zu begeben ? Läutet Brahms hier die Abdankung dessen ein, was seit Beethovens „Eroica“ als ethische Verfasstheit symphonischen Selbstverständnisses gegolten hat ? Schon Brahms’ Zeitgenossen versuchten, dem überraschend „unheroischen“ Schluss der „Dritten“ mit außermusikalischen Poetisierungen beizukommen. Dass sich, wie Martin Geck bemerkte, „symphonischer Schlussjubel im traditionellen Sinn“ nicht einstellt, ließ etwa Peter Benary zu der Erkenntnis kommen, Brahms stelle in seiner Anti-„Eroica“ die klassische Werkästhe- Essay Brahms, der Unheroische tik insgesamt in Frage und steuere ein nicht gesichertes, sozusagen „offenes“ Ende an: „Eine interpretatorische Konsequenz läge darin, nicht mehr auf eine formale Abrundung des Finalsatzes, nicht mehr auf die Integrierung der Finalcoda ins Finale als Ganzes abzuzielen, sondern entweder durch ein nur geringfügig langsameres Tempo die Coda in einem Licht erscheinen zu lassen, das weniger Verklärung als Verdämmern, weniger Entrückung als Resignation zum Ausdruck brächte – oder aber eine Brüchigkeit der Form zu offenbaren, wie sie dann in Gustav Mahlers Symphonik unverhüllt zutage tritt.“ Unterliegen statt siegen Mahler wird hier nicht umsonst als geistiger Erbe weniger von Bruckner als von Johannes Brahms genannt. Wenn Brahms dem üblichen Auftrumpfen heroischer Schlussgesten eine mehr als deutliche Absage erteilt, dann stellt sich als Reminiszenz an Gustav Mahler wiederum das Wort von den „Balladen des Unterliegens“ ein, das sein Exeget Theodor W. Adorno auf Mahlers Symphonien prägte. Nicht um die masochistische Selbstfeier von „Niederlagen“ gehe es hier, sondern um die rechtzeitig erteilte Absage ans heroische „Durchhalten“, ans „Siegen müssen“ um jeden Preis. Adorno hätte auch an das nicht minder zeittypische „Requiem“ von Rainer Maria Rilke erinnern können, in dem lakonisch bemerkt wird: „Wer spricht von Siegen ? Überstehn ist alles.“ Hier schließt sich der Kreis zu Wagners „Ertragen statt erliegen !“ und zu der Brahms mit Mahler verbindenden, höchst subversiven Energie einer zwischen Tradition und Moderne vermittelnden Haltung der Resignation. 13 21 Wenn Beethovens „Heroismus“ nur noch ironischbrüchig als Zitat aufscheint, dann heißt das aber noch nicht, dass musikgeschichtliche „Abdankung“ ausschließlich vergangenheitsorientiert sein muss. „Resignare“ kann auch bedeuten, neue Zeichen zu setzen, und in diesem Sinne hat Arnold Schönberg Brahms als den „fortschrittlichen“ unter seinen Zeitgenossen gefeiert, als Vorboten Gustav Mahlers und Alban Bergs, der wie diese bereits voll des Wissens war, „dass keine Hoffnung sei, als die des ‚Lass fahren dahin... !‘ “ 14 Maurice Ravel: Klavierkonzert G-Dur Musik, „nichts als Musik“ Stephan Kohler Maurice Ravel Entstehung (1875–1937) Während sich Ravel gegen Ende 1928 mit Plänen für ein Klavierkonzert trug, das er für sich selbst als Konzertpianist zu schreiben gedachte, erreichte ihn der unerwartete Auftrag des einarmigen Wiener Pianisten Paul Wittgenstein für ein Klavierkonzert nur für die linke Hand. In der Folge entstanden vom Sommer 1929 an beide Klavierkonzerte parallel, wobei das einhändige Konzert für Paul Wittgenstein nach nur 9-monatiger Arbeitszeit fertiggestellt war, während das zweihändige Konzert aufgrund von wiederholten Erkrankungen des Komponisten erst im November 1931 beendet werden konnte. Konzert für Klavier und Orchester G-Dur 1. Allegramente 2. Adagio assai 3. Presto Widmung Ravel widmete das Werk seiner ersten Interpretin: der französischen Pianistin Marguerite Long (1874–1966); er selbst sah sich aus gesundheitlichen Gründen nicht (mehr) in der Lage, wie ursprünglich geplant den Klavierpart selbst zu übernehmen. Uraufführung Lebensdaten des Komponisten Geboren am 7. März 1875 in Ciboure gegenüber dem Hafen von Saint-Jean-de-Luz im französischen Baskenland (Département PyrénéesAtlantiques); gestorben am 28. Dezember 1937 in Paris. Am 14. Januar 1932 in Paris in der Salle Pleyel im Rahmen eines Ravel-Festivals (Orchester der „Concerts Lamoureux“ unter Leitung von Maurice Ravel; Solistin: Marguerite Long); drei Monate später, im April 1932, nahm Ravel das Konzert mit Marguerite Long in einem Pariser Schallplattenstudio auf. 15 Maurice Ravel (um 1930) 16 Maurice Ravel: Klavierkonzert G-Dur Rätselhafter Einzelgänger Der Vater der „Groupe des Six“ Wer war Maurice Ravel ? So einfach die Beantwortung dieser Frage zu sein scheint, so diffizil wird sie bei näherem Umgang mit Biographie und Musik des in aller Welt und manchmal bis zum Überdruss als Schöpfer des „Boléro“ bekannten Komponisten. Unbeirrbares Unabhängigkeitsstreben, verbunden mit einem stark ausgeprägten Hang zur Selbstkritik, formte Ravel zum Gegentyp eines selbstgefälligen Komponiervirtuosen, als den ihn die Öffentlichkeit aufgrund der äußerlichen Brillanz eines Werks wie des späten G-Dur-Klavierkonzerts nur zu gern einstufte: Die stupende Beherrschung der Ausdrucksmittel, der Einfallsreichtum von Ravels Instrumentationskunst, die scheinbare Mühe­ losigkeit seines Produzierens und nicht zuletzt der viele Zeitgenossen peinigende Erfolgskurs seiner Werke bildeten Irritationsmomente, denen nicht nur die deutsche, sondern zeitweise auch die französische Musikkritik mit Unverstand und Ignoranz begegnete. Man hat in der Vergangenheit den Komponisten des „Pelléas“ jedoch immer wieder mit dem des „Daphnis“ in einem Atemzug genannt, als handle es sich bei Debussy und Ravel um ein ähnliches Dioskurenpaar wie bei Bach und Händel, Schumann und Mendelssohn oder Pfitzner und Strauss. Mitnichten ist dies der Fall: Zahlreiche Stileigentümlichkeiten von Ravels G-DurKonzert verweisen weniger auf Mitläuferschaft in der wohlfeilen Woge des „debussysme“ als auf Vorläuferschaft zum Neoklasizismus der sogenannten „Groupe des Six“, der nächsten Komponistengeneration, die sich um Jean Cocteau als Chefideologen geschart hatte. Auch das formal Unantastbare, der Feinschliff und die Konturenfülle von Ravels G-Dur-Konzert wurden als bloße Äußerlichkeit abgetan, obwohl es sich gerade in der architekturalen Kühle seiner Formbildungen, in der reißbrettartigen Schärfe seiner Verlaufsstrategien am deutlichsten vom „impressionistischen“ Tonfall Debussys unterscheidet, mit dem es höchstens ein schmales Repertoire an Klangidiomen verbindet: Über einzelne atmosphärische Analogien, hervorgerufen durch die zeitgebundene Verwurzelung beider Komponisten im Pariser Fin-de-Siècle, geht die oft gedankenlos kolportierte „Abhängigkeit“ Maurice Ravels von Claude Debussy nicht hinaus. Beriefen sich die französischen Neoklassizisten auf eine bewusst anti-romantische Musizierhaltung, scheuten sie vor klanglichen Härten und bruitistischen Akzenten nicht zurück, und erhoben sie Einfachheit und Klarheit zu ihren bevorzugten Stilpostulaten, so verdankten sie viele dieser Forderungen den beiden zwischen Sommer 1929 und November 1931 fast gleichzeitig entstandenen Klavierkonzerten Ravels, von denen das für zwei Hände geschriebene G-Dur-Konzert den Spätstil des Komponisten fast noch paradigmatischer repräsentiert als das originelle, nur für die linke Hand komponierte Auftragswerk für den einarmigen Pianisten Paul Wittgenstein. „Komplex, nicht kompliziert“ Klangliche Transparenz, Tendenz zur Einfachheit von Form, Melodie und harmonischem Grundmuster, sowie eine bis dahin nicht gekannte Vorrang- 17 Ravels Flügel, an dem er das Klavierkonzert komponierte – darüber das Portrait der geliebten Mutter, gemalt von seinem Onkel Édouard Ravel 18 Maurice Ravel: Klavierkonzert G-Dur stellung rhythmischer Parameter zeichnen diesen Spätstil aus, dessen Mittlerrolle zwischen Impressionismus und Neoklassizismus, zwischen Fin-desiècle und Moderne, auch heute noch keineswegs voll erkannt ist. Unter der Vorgabe, „komplex, aber nicht kompliziert“ zu schreiben, wird in vielen dieser letzten Werke Maurice Ravels eine „Musik der Fülle und Aufrichtigkeit des Ausdrucks“ angestrebt, die nie aufhören sollte, Musik, „nichts als Musik“, zu sein. In den sparsamen Äußerungen zu seinem G-DurKlavierkonzert, die von Ravel überliefert sind, verwies er immer wieder auf Mozart, der ihm zeitlebens das größte Vorbild blieb und in dessen Werk er die eigenen Ansprüche an Luzidität, handwerkliche Meisterschaft, klassische Symmetrie und spielerische Eleganz aufs Vollkommenste verwirklicht sah. „Meine Musik ist ab­ solut einfach“, bekannte er einmal, „nichts als Mozart.“ Oder an anderer Stelle: „Ich bin kein moderner Komponist im strengsten Sinn des Wortes, weil meine Musik keine Revolution, sondern eher eine Evolution ist. Obwohl ich neuen Ideen in der Musik immer zugänglich war, habe ich niemals versucht, die Gesetze der Harmonie und Komposition über den Haufen zu werfen. Im Gegenteil, ich habe immer großzügig meine Inspiration aus den großen Meistern geschöpft, habe niemals aufgehört, Mozart zu studieren, und meine Musik ist folglich zum größten Teil auf den Traditionen der Vergangenheit aufgebaut.“ Zwischen Jazz und baskischer Folklore Ravels Wunsch, neben dem für die linke Hand des kriegsverletzten Paul Wittgenstein geschrie- benen „Spezialwerk“ ein gattungskonformes, sozusagen „regelrechtes“ Klavierkonzert zu komponieren, rief bei den Zeitgenossen zwangsläufig den Eindruck einer gewollten Synthese hervor – des Zusammenklangs von monochromer und polychromer Schreibweise und der Versöhnung klangästhetischer Gegensätze, die Ravel bis dahin eher als Alternativen gehandhabt hatte. Er selbst nannte das Konzert „ein interessantes Experiment“ im Hinblick auf seine eigenwillige stilistische Position zwischen Prokofjew und Mozart, zwischen Jazz und baskischer Folkore, zwischen Drive und Divertissement. Wie so oft bei Ravel, stellt sich auch im G-DurKonzert das „Sujet“ der Musik erst auf dem Rücken ihrer virtuosen Bewältigung her: Technik bildet zwar nach wie vor die „conditio sine qua non“ des Klavierspiels, bleibt für sich genommen aber ohne wirklich tiefere Bedeutung. Um diese unterhalb der Tastenoberfläche zu entdecken, genüge es, den Klavierpart Note für Note lediglich zu „spielen“ – die richtige Art, ihn zu „interpretieren“, ergebe sich dann wie von selbst... Verklausulierungen wie diese rühren an Ravels Vorliebe für die perfekte artistische Illusion, die als reines Phantasieprodukt das übliche Vexierspiel zwischen Sein und Schein in nichts auflöst. „Kunst sollte die Nachahmung dessen sein, was nicht existiert“, hatte schon Paul Valéry gefordert und damit eine oft verdrängte Dimension von Ravels Musik umschrieben: ihren Hang zu Mystik und Transzendenz, mit dem sie die Klangsinnlichkeit zu einer Art Metaphysik der Diesseitigkeit überhöht. Claude Debussy: „La Mer“ 19 Im Ozean des Lebens Stephan Kohler Claude Debussy (1862–1918) „La Mer“ Trois esquisses symphoniques 1. „ De l’aube à midi sur la mer“ (Von der Morgendämmerung bis zum Mittag auf dem Meer) 2. „ Jeux de vagues“ (Wellenspiele) 3. „ Dialogue du vent et de la mer“ (Wechselspiel zwischen Wind und Meer) Lebensdaten des Komponisten Geboren am 22. August 1862 in Saint-Germainen-Laye (Département Yvelines / Region Paris); gestorben am 25. März 1918 in Paris. Entstehung Debussy begann das von Anfang an dreiteilig geplante Werk im Sommer 1903, als er bei den Eltern seiner ersten Frau Rosalie („Lilly“) Texier (1873-1932) in Bichain / Burgund wohnte. Der 1. Satz trug anfangs noch den Titel „Mer belle aux Îles Sanguinaires“ (Ruhige See vor den Îles Sanguinaires, einer kleinen Inselgruppe bei Korsika), der 3. Satz „Le vent fait danser la mer“ (Der Wind lässt das Meer tanzen); nach einer Umarbeitung des Schlusses von Satz 2 wurde die Partiturreinschrift am 5. März 1905 in Paris beendet. Der revidierte Druck von 1909 unterscheidet sich von der 1905 erschienenen Erstausgabe durch rund 80 Änderungen der Instrumentation, Phrasierung und Dynamik. Widmung „Pour la p. m. [= petite mienne] dont les yeux rient dans l’ombre“ (Für meine Kleine, deren Augen sogar im Schatten lachen); die sehr private, bewusst verklausulierte Widmung bezog sich auf Debussys Geliebte und spätere (zweite) Frau Emma Moyse-Bardac (1862–1934), wurde in der handschriftlichen Partitur im Nachhinein getilgt und erschien auch nicht in der gedruckten Partitur, die der Komponist seinem Verleger Jacques Durand (1865–1928) widmete. Uraufführung Am 15.Oktober 1905 in Paris (Orchester der „Concerts Lamoureux“ unter Leitung von Camille Chevillard); Erstaufführung der von Debussy durchgeführten Revision der Partitur: Am 19. Januar 1908 in Paris (Orchester der „Concerts Colonne“ unter Leitung von Claude Debussy). 20 Claude Debussy: „La Mer“ „Musicien français“ Debussy war weder timider Einzelgänger wie Ravel, noch lebte er wie dieser zurückgezogen und fernab der Großstadt, sich jeder Vereinnahmung durch die Öffentlichkeit verweigernd. Im Gegenteil: Er liebte es, der Mitwelt ideologisch verbrämte oder gar nationalistisch überhöhte Funktionsbestimmungen von Musik aufzuzwingen und benutzte seine Doppelrolle als umstrittener „Neutöner“ und gefürchteter Rezensent auch immer ein wenig zur Absicherung des eigenen Nachruhms. Anders als der völlig uneitle und uneigennützige Ravel sah Debussy seine Rolle nicht als altruistisch gesinnter Förderer jüngerer Kollegen, sondern wollte als „musicien français“ der französischen Musik – und nicht zuletzt seiner eigenen – die Vorrangstellung in der europäischen Moderne sichern. Da ihn seine Lebenszeit sowohl zum Zeitgenossen der deutschen Spätromantiker als auch der Wiener Schule um Arnold Schönberg machte, musste Debussys Position, die unbestreitbar eine Gegenposition zu diesen beiden sehr deutschen Musikströmungen darstellte, in doppelter Hinsicht befremden: als Inkarnation einer in spezifisch französischen Traditionen verharrenden, sensualistischen Sinngebung von Musik, die ohne die Materialschwere des „teutonischen Kontrapunkts“, erst recht ohne die Hybris von Wagners und Schönbergs Musikphilosophien auskam; und nicht minder als Ausdruck der unterschwelligen Subversion, mit der Debussy die Autorität der traditionellen Tonalität untergrub und ihre Regeln geschickt zu überspielen verstand. Auf der Suche nach mediterraner „Clarté“ Worin besteht nun das viel zitierte „Französische“ in Debussys Musik ? Er selbst, der sich vehement gegen eine Internationalisierung der Musik unter dem Diktat des aus Deutschland importieren „wagnérisme“ wandte, empfahl seinen Landsleuten als identitätsstiftendes „Gegengift“ gegen die aus Bayreuth eingewanderten tristanisierenden Viren die radikale geschichtliche Kehrtwende, den Gang „ad fontes“ (= zu den Quellen). Sein Purifikationswille ließ ihn bis ins 17. und 18. Jahrhundert hinabsteigen, wo er vom Ausland noch unbeeinflusste französische Komponisten vorzufinden gedachte, die seinem Stilideal einer mediterranen „clarté“ entsprachen: „Französische Musik, das heißt Klarheit, Eleganz, einfache und natürliche Deklamation. Französische Musik will vor allem Freude bereiten [‚faire plaisir‘]; Couperin, Rameau, das sind wahre Franzosen !“ Hier hilft ein flüchtiger Blick auf Debussys eige­ nes Œuvre einem vorschnellen, typisch deutschen Missverständnis vorzubeugen: „Faire plaisir“ bedeutet in der Tat „Freude bereiten“, aber gemeint ist die „Freude des Geistes [‚es­ prit‘] “, nicht platte Unterhaltung oder dümm­ liches „Entertainment“, und mit dem Rekurs auf die Komponisten des barocken „Grand Siècle“ wird keineswegs einer bloß historisierenden Altertümelei das Wort geredet. Ohnehin legte Debussy mit einem Werk wie den „Drei symphonischen Skizzen“, die er unter dem Titel „La Mer“ zusammenfasste, ein authentischeres Glaubensbekenntnis zu seinen Kompositionsprinzipien ab als mit manchen seiner tages­ 21 33 Ivan Thièle: Claude Debussy (um 1905) (1905) 22 Claude Debussy: „La Mer“ politisch motivierten Glossen in den Pariser Gazetten des Fin-de-siècle. Das Meer als Abbild der mensch­ lichen Seele „Leider, leider hören nicht alle Ohren gleich !“ Mit diesem Stoßseufzer Debussys, geäußert in einem Brief an den ihm prinzipiell gewogenen Musikkritiker Pierre Lalo ist bereits die latent prekäre Rezeptionsvielfalt benannt, die sich aus dem akustischen Assoziationsspektrum eines Hörers von „La Mer“ ergeben kann. Sind es biographisch-lebensweltliche, pittoreskbeschreibende, abstrakt-mathematische oder gar mystisch-verrätselte Aspekte, die hier unter dem Synonym eines der vier Elemente musikalisch zusammengefasst sind ? Mit der Begriffsbildung „L’homme océan“ hatte ja schon Victor Hugo in Anlehnung an Shakespeares Charakterportraits die Seelenlandschaft des Menschen als vielschichtiges Abbild des Meeres zu deuten versucht, und noch Debussys Freund Ernest Chausson widmete mit seinem „Poème de l‘Amour et de la Mer“ der Ineinssetzung von Seelen- und Meereslandschaft eine hochbedeutsame Komposition. Auch in Claude Debussys Biographie schlugen während der Entstehung von „La Mer“ die Wellen hoch und sollten sich nicht so bald wieder glätten: die stürmische Auflösung seiner Ehe mit Rosalie Texier provozierte nicht nur einen Selbstmordversuch der verlassenen Gattin und entfremdete ihn seinem gesamten Freundeskreis, sondern zog auch eine unangenehme und für Debussy äußerst schädliche Pressekampag­ ne nach sich. Es wäre denkbar, dass „La Mer“ diese dramatischen Vorgänge wenn nicht spiegelt, so doch zumindest teilweise verarbeitet, denn immerhin schrieb Debussy über sein Manuskript die später getilgten Widmungsworte: „Pour la petite mienne dont les yeux rient dans l’ombre“ (Für meine Kleine, deren Augen sogar im Schatten lachen); gemeint war Emma Bardac, die Mutter eines Schülers, für die er im Herbst 1903 seine Frau Lilly verlassen hatte. Doch ebenso gut ließen sich die apotheotische Klimax des ersten Satzes, die krisenhafte Nervosität des zweiten und die aggressiven Klangballungen des Finales als Metaphern für das Spiel von Wasser, Wind und Licht deuten. „Tönend bewegte Mathematik“ Doch gerade dieses bezweifelte Pierre Lalo in seiner Uraufführungskritik, die er auf die bündige Formal brachte, in „La Mer“ sei das Meer weder zu hören, noch zu sehen und noch nicht einmal zu spüren: Das Publikum der Jahrhundertwende hatte sich an die deskriptivistischen Exzesse der zeitgenössischen Programmmusik so sehr gewöhnt, dass es, wo Debussy ein imaginiertes Bild aus Klängen vorschwebte, ein realistisches, klingendes Abbild erwartete. Die Hoffnung auf sinnliche „Augenmusik“ wird zwar von den einzelnen Satzüberschriften genährt, die in der Tat dem musikalischen Verlauf des Triptychons in sehr konkreter Weise entsprechen; dennoch ist die Partitur von „La Mer“ nichts weniger als bloßer Spiegel des Äußeren oder die Übertragung impressionistischer Maltechniken auf die Musik. Alternative Satztitel aus der Entstehungszeit, etwa „Le vent fait danser la mer“ (Der Wind bringt das Meer zum Tanzen), huldigen einer eher symbolistisch, 23 35 Titelillustration für „La Mer“ unter Verwendung von Katsushika Hokusais Farbholzschnitt „Die große Welle vor große Kanagawa“ Farbholzschnitt „Die Welle (1905) vor Kanagawa“ (1905) 24 Claude Debussy: „La Mer“ irreal unterwanderten Phantasie und machen nachvollziehbar, warum Debussy die Formel „impressionistisch“ nicht mal als bloße Worthülse oder Verständigungschiffre für „La Mer“ zulassen wollte. Das irreale Moment der inhaltlichen unterliegt auf der rein formalen Ebene der Bändigung durch exakte, mathematisch genaue Konstruktionsverhältnisse, die auf den Partiturverlauf geometrisch organisierte Proportionen wie Symmetrie oder Goldener Schnitt projizieren. Wäre „La Mer“ demnach – in Anlehnung an Eduard Hanslicks berühmte Wortprägung – eine Art von „tönend bewegter Mathematik“ ? Dagegen hätte der Komponist vermutlich nichts einzuwenden gehabt; denn noch im Entstehungsjahr 1903 – die zeitliche Parallelität kann kein Zufall sein – konstatierte Debussy in einem in Paris publizierten Aufsatz: „Musik ist eine geheimnisvolle Art von Mathematik, deren Elemente universale Gültigkeit besitzen. Mit Musik lässt sich der Lauf des Wassers beschreiben; mit Musik wird erklärbar, wie die Wolken am Himmel ziehen; und letztlich gibt es für Musik kein besseres Sujet als einen Sonnenuntergang am Meer !” Synthese-Versuch auf mehreren Ebenen Mit seinem auf äußerste Dichte, Komplexität und Kontrastreichtum angelegten Orchester wagte Debussy einen Synthese-Versuch auf mehreren Ebenen: Tradierte Formmodelle der überlieferten Symphonik werden mit freien Formgestaltungen verschmolzen, wie es um 1900 für die Gattung der „Symphonischen Dichtung“ typisch war; gleichzeitig spiegeln die zyklisch aufeinander bezogenen Sätze entfernt das formale Grundmuster einer 3-sätzigen Symphonie. Auf der Ebene des musikalischen Materials sucht Debussy die Synthese zwischen differenziertesten Gebilden freier und polymodaler Chromatik, emanzipierten Klang- und Geräuschfeldern sowie rhythmisch komplexen, melodisch aber eher einfachen Formeln. Es verwundert nicht, dass die Errungenschaften von Debussys „La Mer“ sogar noch die Komponisten der nächsten Generation beeindruckten, ja form- und stilbildend auf sie wirkten. Der junge Béla Bartók etwa, wie er bereitwillig zugab, verdankte die Leuchtkraft seines sinnlichen Klangdenkens – neben dem von ihm hochverehrten Richard Strauss – vor allem der musikalischen Sprache Claude Debussys: Als der Geiger André Gertler Bartók noch in den späten 30er Jahren auf das naturhaft Fließende, Strömende seiner „Musik für Saiteninstrumente“ ansprach, auf die schier unendlichen Verzweigungen der Themen in immer wieder neue Richtungen, erhielt er folgerichtig zur Antwort: „Merken Sie es wohl ? Es ist ‚La Mer‘ !“ 22 Die Künstler 25 Semyon Bychkov Dirigent Der in Leningrad (St. Petersburg) geborene Semyon Bychkov gewann als Zwanzigjähriger den Rachmaninow-Dirigierwettbewerb. Dass ihm der Preis, die Leningrader Philharmonie zu dirigieren, vorenthalten wurde, trug zu seiner Entscheidung bei, zwei Jahre später die ehemalige Sowjetunion zu verlassen. In seiner Heimatstadt St. Petersburg besuchte Zu Semyon dem Zeitpunkt, Bychkov das als staatliche Bychkov 1989 Musikkonserals Erster Gastdirigent vatorium, wodes er Philharmonischen in die Dirigierklasse Orchesters Ilya Musins nach St. aufgenommen Petersburg zurückkehrte, wurde; 1975 wurde emigrierte er in er deninUSA die bereits als Music Rapids SymUSA. Dort war er Director von 1980des bisGrand 1985 Musikdirekphony und Symphony des Buffalo Philharmonic Ortor desOrchestra Grand Rapids Orchestra und von chestra 1985 bisgefeiert 1989 desund Buffalo hattePhilharmonic sich in Europa Orchesdurch Konzerte tra. Anschließend mit Orchestern übersiedelte wie u.a.Semyon den Berliner Bychkov Philharmonikern nach Europa, und wo er dem Chefdirigent Concertgebouw des renommierOrchester Amsterdam ten Orchestre etabliert. de ParisErwurde, wurde das Chefdirigent er bis 1998 des Orchestre leitete; daneben de Parisübernahm (1989), Chefdirigent er die Position deseines WDR Sinfonieorchesters Köln (1997) und Chefdirigent der Sächsischen Staatsoper Dresden (1998). ersten Bychkovs Gastdirigenten Opernrepertoire beiistden so vielseitig St. Petersburger wie sein Philharmonikern symphonisches. Es(1990–1994) reicht von Mozart sowie bis beim SchosOrtakowitsch, über Schubert, Mussorgsky, Tschaichester des Maggio Musicale Fiorentino (1993– 2000). kowsky und Janáček bis hin zu Puccini. Besonders anerkannt ist er für seine Interpretationen der Wer1998 ke vonwurde Strauss, Semyon WagnerBychkov und Verdi. Chefdirigent Er ist regelmäder ßig mit den Wiener Philharmonikern, MünchSächsischen Staatsoper Dresden, woden er bis 2003 ner Philharmonikern und Concertgebouw OrNeuinszenierungen von dem Wagners „Rheingold“ und chester „Walküre“, auf Tournee Strauss’ und ebenso „Rosenkavalier“ regelmäßig und zu Schostakowitschs Gast bei den Berliner „Lady Philharmonikern, Macbeth von Mzensk“ dem Gedirigierte. wandhausorchester Zu Bychkovs Leipzig, Repertoire dem BBC zählen unddarüdem ber hinaus zahlreiche weitereder Opern von Verdi, London Symphony Orchestra, Accademia NaWagner, Mussorgskij Schostakozionale diStrauss, Santa Cecilia, dem RAIund Torino, dem Orwitsch; chestre National im Rahmen de France, der Salzburger dem Chicago Festspiele und dem dirigierte San Francisco er 2004 Symphony Strauss’Orchestra, „Rosenkavalier“ sowie dem mit den Los Angeles Wiener Philharmonikern. und dem New York Philharmonic. Zuletzt In 1986 war begann Semyon Bychkov Bychkov seine Chefdirigent Zusammenarbeit des WDR-Sinfonieorchesters mit Philips, wodurch in derKöln Folge (1997–2010), Aufnahmen mit mit dem den Berliner er zahlreiche Philharmonikern, Tourneen durch dem NordSymphonie­ und Südamerika, orchester Russland, des Bayerischen JapanRundfunks, und Europadem unternomConcertmen gebouw hat.Orchester, Regelmäßig dem leitet Philharmonia Semyon Bychkov Orchestra, die dem London Philharmonic Orchestra und dem Orgroßen Orchester der USA; in Europa gastierte er u. a. bei den Berliner undsind. Wiener chestre de Paris entstanden Aus Philharmoseiner langnikern, jährigenbeim Zusammenarbeit Symphonieorchester mit dem des WDRBayeriSinfoschen nieorchester Rundfunks gingen und bahnbrechende beim Orchester Aufnahmen der Mailänder Scala. der Brahms Sinfonien und der Werke von Strauss, Mahler, Schostakowitsch, Rachmaninow, Verdi, Glanert und Höller hervor. 2010 wurde Bychkovs Aufnahme des »Lohengrin« vom BBC Music Magazine als »Record of the Year« ausgezeichnet. Goya Alle Radierzyklen 17.7.–13.9.2015 Münchner Künstlerhaus Lenbachplatz 8, www.goya-muenchen.de Die Künstler 27 Jean-Yves Thibaudet Klavier Tilson Thomas und Leonard Slatkin. Regelmäßige Auftritte bei großen Musikfestivals führten ihn u. a. nach Tanglewood und zum SchleswigHolstein Musikfestival. Daneben hat sich JeanYves Thibaudet auch als vielseitiger Kammer­ musiker einen Namen gemacht; als Liedbegleiter trat er gemeinsam mit Renée Fleming, Olga Borodina und Cecilia Bartoli auf. Der von deutsch-französischen Eltern abstammende Pianist wurde in Lyon geboren; er erhielt mit fünf Jahren seinen ersten Klavierunterricht und trat im Alter von sieben Jahren erstmals öffentlich auf. Thibaudets wichtigste Lehrer waren Lucette Descaves, eine Freundin und Mitarbeiterin von Maurice Ravel, und Aldo Ciccolini, bei dem er als 12-Jähriger am Pariser Conservatoire zu studieren begann. Im Alter von 15 Jahren gewann er dort den „Premier Prix du Conservatoire“ und drei Jahre später die Young Concert Artists Auditions in New York. Jean-Yves Thibaudet tritt weltweit als Solist mit bedeutenden Orchestern auf und spielt unter Dirigenten wie Vladimir Ashkenazy, Riccardo Chailly, Charles Dutoit, Valery Gergiev, Michael Der Pianist macht auch erfolgreiche Ausflüge in den Jazz, so z. B. mit seinen Programmen „Reflections on Duke Ellington“ und „Conversations with Bill Evans“ (ECHO-Preis 1998). 2002 erhielt er den „Premio Pegasus“ des Spoleto Festivals für seine künstlerischen Leistungen und sein langjähriges Engagement in Spoleto. Im Juni 2010 ehrte die Hollywood Bowl Thibaudet für seine musikalischen Erfolge durch die Aufnahme in ihre Hall of Fame. Außerdem verlieh das Französische Kultusministerium ihm im Jahr 2012 den Titel „Officier des Ordre des Arts et des Lettres“, nachdem er bereits 2001 zum „Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres“ ernannt worden war. Seine Konzertkleidung entwirft die gefeierte Londoner Designerin Vivienne Westwood. Ph ilh a Bl rm ät on te is r ch e 28 24 Auftakt „Tiefer Trost und Rechtfertigung“ Die Kolumne von Elke Heidenreich Neulich habe ich Hermann Hesses „Steppenwolf“ noch mal gelesen – sollte man in meinem Alter nicht tun, da gehen ein paar schöne Erinnerungen und Eindrücke verloren, die mit siebzehn, achtzehn, wenn man das Buch zum ersten Mal liest, lesen sollte, stark waren. Die Welt ist uns, wenn wir älter werden, nicht mehr ganz so zerrissen, wir haben unseren Platz darin gefunden und suchen nicht mehr so wie Harry Haller alias Hermann Hesse. Aber was mich wieder fasziniert hat, war das Kapitel, in dem Harry Haller im Drogenrausch in seinem imaginären Theater eine Musik hört, schön und schrecklich, die Musik, die in Mozarts „Don Giovanni“ das Auftreten des Steinernen Gastes begleitet. Und plötzlich erklingt „ein helles und eiskaltes Gelächter, aus einem den Menschen unerhörten Jenseits von Gelittenhaben, von Götterhumor geboren.“ Haller wendet sich um und sieht Mozart, lachend, und Mozart zeigt hinunter in die Tiefe des Zaubertheaters, wo sich eine wüstenähnliche Ebene ausdehnt. „In dieser Ebene sahen wir einen ehrwürdig aussehenden alten Herrn mit langem Barte, der mit wehmütigem Gesicht einen gewaltigen Zug von einigen zehntausend schwarzgekleideten Männern anführte. Es sah betrübt und hoffnungslos aus, und Mozart sagte: ‚Sehen Sie, das ist Brahms. Er strebt nach Erlösung, aber damit hat es noch eine gute Weile.‘ Ich erfuhr, dass die schwarzen Tausende alle die Spieler jener Stimmen und Noten waren, welche nach göttlichem Urteil in seinen Partituren überflüssig gewesen wären.“ Der arme Brahms bleibt nicht allein verspottet, auch Wagner taucht noch auf und schleppt seine überflüssigen Noten hinter sich her, sehr, sehr viele. Als ich jung war, bedeutete mir der Steppenwolf viel, Brahms und Wagner wenig. Jetzt ist es umgekehrt, aber alles gehört zusammen: dass man sich ändert, dass man sich entwickelt, dass man Musik anders hört und versteht als früher, da man jung war. Jeder hört anders, jeder, der im Konzert direkt neben mir sitzt. Manche sehen Bilder beim Hören, manche erinnern sich an frühere Konzerte mit den Stücken, die gerade gespielt werden – das meiste kennt man ja und will es doch wieder und wieder hören, weil es immer anders ist – je nachdem, wer spielt, wer dirigiert, wie mir an dem Abend zumute ist. Aber eines ist immer gewiss, und das wusste auch Hermann Hesse, dem die Musik zeitlebens sehr viel bedeutete: „So begierig ich auf manchen anderen Wegen nach Erlösung, nach Vergessen und Befreiung suchte, so sehr ich nach Gott, nach Erkenntnis und Frieden dürstete, gefunden habe ich das alles immer nur in der Musik. Es brauchte nicht Beethoven oder Bach zu sein: – dass überhaupt Musik in der Welt ist, dass ein Mensch zuzeiten bis ins Herz von Takten bewegt und von Harmonien durchblutet werden kann, das hat für mich immer wieder einen tiefen Trost und eine Rechtfertigung alles Lebens bedeutet.“* *Aus dem Musikerroman „Gertrud“, 1909 e ch is on m er a r ä tt ilh B l Ph Nachruf Notizen Philharmonische 29 25 In tiefer Trauer Arnold Riedhammer Am 2. Juni 2015 ist Thomas Walsh ganz unerwartet verstorben. Tom war langjähriger Tubist der Münchner Philharmoniker, Hauptdozent an der Hochschule für Musik und Theater München und Gründungsmitglied der Gruppe „Blechschaden“. Tom hat sich als Dozent für Tuba weltweit einen großen Namen gemacht und zahlreichen Studenten den Weg in die besten Orchester geebnet. Seine Solos und sein Humor werden bei „Blechschaden“ unvergesslich bleiben. Für alle, die ihn kannten – ein großer Verlust als Mensch, Freund, Musiker und Kollege! Lieber Tom, Du bist viel zu früh von uns gegangen. R.I.P. Arnold Riedhammer Ehemaliger 1. Schlagzeuger der Münchner Philharmoniker Ph ilh a Bl rm ät on te is r ch e 30 26 Im Instrumentenlager belauscht Philharmonische Notizen Herzlich Willkommen Wir bekommen eine neue stellvertretende Konzertmeisterin und ein neuen Solo-Hornisten: Lucja Madziar (Violine) und Matias Piñeira (Horn) treten ab September ihren Dienst und damit ihr Probejahr an. Abschied Karel Eberle verabschiedet sich ab Juni in den wohlverdienten Ruhestand. Er war seit 1972 Mitglied der 1. Geigen und stellvertretender Konzertmeister. Orchesterakademie Unsere Fagott-Akademistin Ryo Yoshimura hat die Stelle als 2. Fagottistin bei den Wiener Symphonikern gewonnen. Als Akademistin bleibt sie uns aber noch bis zum Sommer erhalten. Wir gratulieren und wünschen alles Gute! MPhil vor Ort bei „Klassik & Klub“ im „Harry Klein“ und Holleschek+Schlick in den Postgaragen Am 13. Mai ging „Klassik & Klub“ in die nächste Runde im „Harry Klein“. Kai Rapsch (Oboe und Englischhorn), Clément Courtin (Violine), Beate Springorum (Viola) und David Hausdorf (Violoncello) spielten Mozarts Oboen-Quartett und Jean Françaix Quartett für Englischhorn, Violine, Viola und Violoncello. Johannes Öllinger (Gitarre) war ebenso zu Gast. Seit magischen sieben Jahren feiern Holleschek+Schlick in den Postgaragen. Jetzt werden sie abgerissen. Grund genug, jemanden zu holen, der davon was versteht: Martin Grubinger und die Schlagzeuger der Münchner Philharmoniker! Ein „letztes Konzert + Abrissfest“ fand statt am Samstag, 25. April (siehe übernächste Seite). e ch is on m er a r ä tt ilh B l Ph Ort mit Fest MPhil vor Mphil Ort – vor Konzert 31 27 Konzert mit Fest Simone Siwek Am 25. April 2015 waren die Schlagzeuger der Münchner Philharmoniker mit Martin Grubinger in einem reinen Percussionkonzert in den Postgaragen zu erleben. Ein MPhil vor Ort-“Spezial“ zu einem besonderen Anlass: das letzte Fest von holleschek&schlick an diesem Ort, denn die Postgaragen werden abgerissen. Martin Grubinger war Ende April als Solist zu Gast bei den Münchner Philharmonikern. Als die Anfrage kam, ein weiteres Konzert mit unseren Schlagzeugern zu geben, sagte er schnell zu und reiste extra mehrere Tage früher an, um das ehrgeizige Programm parallel zu seinem Auftritt als Solist einzustudieren. Für ihn wie für unsere Schlagzeuger hieß das: intensive Vorbereitung und in vier Tagen über 30 Stunden extra Proben inklusive Nebenwirkungen (siehe unten). Aber es hat sich gelohnt: Standing Ovations! „Die Zusammenarbeit mit Martin war wahnsinnig intensiv. Sie hat mich bereichert und inspiriert. Klar kosteten die Proben zusätzlich zum Konzertprogramm in der Philharmonie viel Kraft, setzten aber ungleich viel mehr positive Energie frei!“ (Jörg Hannabach, Schlagzeuger) Ph ilh a Bl rm ät on te is r ch e 32 28 MPhil vorMphil Ort – vor Konzert Ort mit Fest „Anfangs war ich ein wenig skeptisch, als Simone Siwek mir vorgeschlagen hat, ein klassisches Schlagzeugkonzert für ein junges Publikum aufzuführen. ‚Anstrengend‘ war die erste Assoziation. Was Grubinger und die Münchner Philharmoniker dann in den Postgaragen aufgeführt haben, hat nicht nur das Publikum aus den Stühlen gerissen. Ich bin bekehrt. Und das nächste Schlagzeugkonzert ist schon ausgemacht – stehend dann.“ (Otger Holleschek, Kooperationspartner) „Wir kennen Martin als Solist mit dem Orchester. Nun durften wir ihn auch als Teamplayer kennen lernen, der sich ganz selbstverständlich in unsere Gruppe integrierte. In den Proben legte er großen Wert auf die Meinung aller Spieler und erwartete von jedem, dass er sich einbrachte.“ (Sebastian Förschl, 1. Schlagzeuger) „Martin spielt gerade ein Stück wie Pléiades sonst mit seinem festen Ensemble. Dass er ein komplettes Programm mit uns zusagte ist eine große Ehre für jeden von uns! Dieses Projekt hat mich begeistert und persönlich stark motiviert. Ich denke ich kann für alle Schlagzeug-Kollegen sprechen, wenn ich sage, dass uns diese Woche auch als Gruppe nachhaltig zusammengeschweißt hat.“ (Stefan Gagelmann, SoloPauker) „Martin Grubinger forderte von allen vollen Einsatz. Das bedeutet: immer 100% – und der Schritt von 99% zu 100% kann groß sein! Er perfektioniert rhythmische Genauigkeit, Lautstärke, Klang und Dynamik und verliert dabei nie die Freude am Spielen. Das ist unheimlich ansteckend und fordert einen mental und körperlich. In meinem Fall bedeutet das: Muskelkater, zwei blutige Finger und nach diesem Projekt eine gute Kondition: ich merke, dass ich mich weniger Einspielen muss.“ (Guido Rückel, SoloPauker) e ch is on m er a r ä tt ilh B l Ph MPhil vorMphil Ort – vor Konzert Ort mit Fest 33 29 „Wir hatten nahezu unser komplettes Schlagwerk im Einsatz. Mit über 60 Instrumenten war der Aufund Umbau sehr komplex und musste auf jeden Musiker abgestimmt sein. Martin war sehr engagiert und verlangte Musikern und Instrumenten einiges ab. Erste ‚Opfer‘ waren mehrere Bongos, deren Felle binnen kürzester Zeit durchschlagen waren. Zur Sicherheit wurden Ersatzinstrumente angemietet. Nach dem Konzert mussten 6 Paukenfelle und 18 TomTom-Felle ausgetauscht werden. Also: bei Werken wie dem Xenakis ist es durchaus ratsam nicht mit Naturfellpauken zu spielen.“ (Kilian Geppert, stellvertretender Orchesterinspizient) Das Programm: Sollima: Millennium Bug, Miki: Marimba Spiritual, Xenakis: Pléiades (daraus den Fellsatz), Jobim: Chega de Saudade, Engel: Ragtime und Grubinger: Planet Rudiment Es spielten: Sebastian Förschl, Stefan Gagelmann, Jörg Hannabach, Michael Leopold, Guido Rückel, Walter Schwarz, Linda-Philomène Tsoungui Ph ilh a Bl rm ät on te is r ch e 34 30 Orchestergeschichte Die Tonhalle, Heimstatt der Münchner Philharmoniker von 1895 bis 1944 Gabriele E. Meyer Bis zur Eröffnung des Kaim-Saales (der späteren Tonhalle) im Jahre 1895 gab es in München – sieht man von den akustisch unbefriedigenden CentralSälen in der Neuturmstraße ab – als einzigen großen Konzertsaal nur das Kgl. Odeon. Allerdings wurde dieser repräsentative Raum dem 1893 von Franz Kaim gegründeten Vorgänger der Münchner Philharmoniker nur widerwillig zur Verfügung gestellt; für den vorausschauenden Unternehmer Grund genug, ein weiteres Großprojekt in Angriff zu nehmen. Nach mehreren vergeblichen, weil nicht finanzierbaren Anläufen, entschloss sich Kaim schweren Herzens, seinen Saal selbst zu erbauen, und zwar auf dem Eckgrundstück Türkenstraße 5 zur inzwischen neu angelegten Prinz-Ludwig-Straße. Die Bauleitung hatte er Martin Dülfer anvertraut. Die Fassaden gestaltete der renommierte Architekt im LouisSeize-Stil, wegen der typischen Lorbeer- oder Fruchtgirlanden auch „Zopfstil“ genannt. Schon ein halbes Jahr nach der Grundsteinlegung im April 1895 wurde der „Kaim-Saal“ mit einem dreitägigen Musikfest „unter dem Protektorat des Prinzen Ludwig Ferdinand von Bayern“ eingeweiht (19.–21. Oktober). Die Orchestergründung trat in Anlehnung an den Konzertort nun unter dem Namen „Kaim-Orchester“ auf. Die ursprünglich veranschlagte Kostenpauschale von 500.000 Mark überschritt Dülfer allerdings „um die horrende Summe von 380.000 Mark“. Kaim gelang es nur mit Hilfe „mäcenatischer Gönner, zu denen maßgeblich Frau Marie Barlow gehörte“, den finanziellen Ruin abzuwenden. Ab Oktober 1905 gingen die Konzertbesucher in die „Tonhalle“; eine Begründung für diesen Namenswechsel gab es merkwürdigerweise nicht. – Im Laufe der Jahre waren an dem Saal immer wieder bauliche und akustische Veränderungen vorgenommen worden, um den Ansprüchen von Musikern und Zuhörern zu genügen. Viele historisch und künstlerisch bedeutsame Konzertereignisse verzeichnen die Annalen – bis hin zu jener Nacht des 24./25. April 1944, als ein vor allem für die Innenstadt verheerender Bombenangriff auch die philharmonische Heimstatt und den Odeonssaal in Schutt und Asche legte. Der schmerzliche Nachruf in den „Münchner Neuesten Nachrichten“ nur zwei Tage später erinnerte nochmals an das, was da vernichtet worden war. „Diese Räume waren Individualitäten, jeder hatte seinen besonderen Charakter, dem man als Konzertierender gerecht werden mußte. Jeder hatte auch seine spezifische Atmosphäre, die den Hörer mit ihrer ganz eigenartigen Stimmung empfing und die sich gewissermaßen aus dem langjährigen künstlerischen Geschehen ergab.“ Noch aber ging der Konzertbetrieb weiter. Eilends suchte die Stadt nach Ausweichquartieren und fand sie im Prinzregententheater, im Löwenbräukeller, im Deutschen Museum, in der Aula der Universität. Nach Kriegsende befanden sich die Philharmoniker weiterhin auf Wanderschaft. Zwar probierte Hans Rosbaud, GMD von 1945 bis 1948, zunächst noch in den notdürftig hergerichteten Kellerräumen an der Türkenstraße, die Konzerte aber fanden an anderen Orten statt. Zu einem durchaus möglichen Wiederaufbau des Saales, in dem einst Thomas Mann Katja Pringsheim, seine spätere Frau, entdeckte, konnte man sich nicht durchringen. Erst 1985 erhielten die Münchner Philharmoniker mit der Philharmonie im Gasteig wieder ein eigenes Zuhause. e ch is on m er a r ä tt ilh B l Ph Das Festival mphil 360° 35 31 „Mein Ziel ist es, dass jeder Münchner die Chance hat, die Münchner Philharmoniker live zu erleben.“ Dieses ehrgeizige Ziel hat Valery Gergiev zur Antrittspressekonferenz am 31. Januar 2013 formuliert. Zum Saisonstart 2015/16 rufen die Münchner Philharmoniker und ihr zukünftiger Chefdirigent Valery Gergiev ein neues Festival in München ins Leben: mphil 360°. Es wird vom 13. bis 15. November in allen fünf Sälen des Münchner Gasteigs stattfinden. Freitag, 13.11.2015, 20 Uhr Schönberg: »Begleitmusik zu einer Lichtspielszene« | Skrjabin: »Promethée. Le Poème du feu.« | Wagner: »Die Walküre« 1. Aufzug Valery Gergiev, Denis Matsuev, Anja Kampe, Johan Botha, René Pape, Philharmonischer Chor München Samstag, 14.11.2015, 12 Uhr – 24 Uhr Musikfest für alle – Eintritt frei Till Brönner, Hauschka, Andreas Martin Hofmeir, Miloš Karadaglić, Gewinner des Tschaikowsky-Wettbewerbs, Valery Gergiev, Tin Men and the Telephone, Mariinsky Strawinsky Ensemble, Deutsch-Russisches Ensemble, Odeon Jugendorchester, Kammerorchester der Münchner Philharmoniker, Community Music Sonntag, 15.11.2015 Kern der Programme am Sonntag sind die fünf Klavierkonzerte Prokofjews. Jedes Klavierkonzert wird kombiniert mit Werken aus der deutschen bzw. Münchner Musikgeschichte. Die Münchner Philharmoniker werden dabei zwei Konzerte, das Mariinsky-Orchester drei Konzerte bestreiten. 11 Uhr Prokofjew: »Symphonie classique« & Klavierkonzert Nr. 1 (Solist: Herbert Schuch) | Haydn: Symphonie Nr. 82 »Der Bär« 13 Uhr von Weber: Ouvertüre zu »Der Freischütz« | Prokofjew: Klavierkonzert Nr. 2 (Solist: Denis Matsuev) | von Weber: »Aufforderung zum Tanz« 15 Uhr Reger: Vier Tondichtungen nach Arnold Böcklin | Prokofjew: Klavierkonzert Nr. 3 (Solist: Behzod Abduraimov) 17 Uhr Hartmann: Suite aus »Simplicius Simplicissimus« | Prokofjew: Klavierkonzert Nr. 4 (Solist: Alexei Volodin) 19 Uhr Widmann: »Con brio« | Mozart: Klarinettenkonzert A-Dur (Solist: Jörg Widmann) | Prokofjew: Klavierkonzert Nr. 5 (Solist: Olli Mustonen) Karteninformationen Karten zu allen Veranstaltungen des Festivals gibt es ab 11.08.2015 im Webshop der Münchner Philharmoniker unter mphil.de und bei München Ticket (089/54 81 81 400). Der Eintritt zu allen Veranstaltungen am Samstag, 14.11.2015, ist frei, jedoch nicht ohne Eintrittskarte möglich. 36 Vorschau Do. 02.07.2015, 20:00 Uhr 8. Abo b Fr. 03.07.2015, 20:00 Uhr 8. Abo c So. 12.07.2015, 20:00 Uhr Klassik am Odeonsplatz Richard Wagner Vorspiel zu „Parsifal“ Edvard Grieg „Peer Gynt“-Suite Nr. 1 op. 46 Igor Strawinsky „Psalmensymphonie“ Pjotr Iljitsch Tschaikowsky Fantasie-Ouvertüre „Romeo und Julia“ Anton Bruckner Messe Nr. 3 f-Moll für Soli, Chor und Orchester Carl Orff „Carmina Burana“ Kent Nagano, Dirigent Anne Schwanewilms, Sopran Mihoko Fujimura, Mezzosopran Michael Schade, Tenor René Pape, Bass Philharmonischer Chor München, Einstudierung: Andreas Herrmann Krzysztof Urbański, Dirigent Daniela Fally, Sopran Benjamin Bruns, Tenor Jochen Kupfer, Bariton Philharmonischer Chor München, Einstudierung: Andreas Herrmann Kinderchor des Staatstheaters am Gärtnerplatz, Einstudierung: Verena Sarré Impressum Herausgeber Direktion der Münchner Philharmoniker Paul Müller, Intendant Kellerstraße 4, 81667 München Lektorat: Stephan Kohler Corporate Design: Textnachweise Thomas Leibnitz, Elke Heidenreich, Arnold Riedhammer, Monika Laxgang, Simone Siwek und Gabriele E. Meyer schrieben ihre Texte als Originalbeiträge für die Programmhefte der Münchner Phil­h armoniker. Stephan Kohler stellte seine Texte (Brahms, Ravel, Debussy) den Münchner Philharmonikern zum Abdruck in diesem Programmheft zur Verfügung; er verfasste auch die lexikalischen Werkangaben und Kurzkommentare zu den aufgeführten Werken. Künstler­biographien (Bychkov, Thibaudet): Nach Agenturvorlagen. Alle Rechte bei den Autorinnen und Autoren; jeder Nachdruck ist seitens der Urheber genehmigungsund kostenpflichtig. Graphik: dm druckmedien gmbh, München Druck: Color Offset GmbH, Geretsrieder Str. 10, 81379 München Gedruckt auf holzfreiem und FSC-Mix zertifiziertem Papier der Sorte LuxoArt Samt. Bildnachweise Abbildungen zu Johannes Brahms: Christian Martin Schmidt, Johannes Brahms und seine Zeit, Laaber 1998; Christiane Jacobsen (Hrsg.), Johannes Brahms – Leben und Werk, Wiesbaden / Hamburg 1983; Franz Grasberger, Johannes Brahms – Variationen um sein Wesen, Wien 1952. Abbildungen zu Maurice Ravel: Roger Nichols, Maurice Ravel im Spiegel seiner Zeit – Portraitiert von Zeitgenossen, Zürich – St. Gallen 1990; Theo Hirsbrunner, Maurice Ravel – Sein Leben, sein Werk, Laaber 1989. Abbildungen zu Claude Debussy: Michael Raeburn / Alan Kendall (Hrsg.), Heritage of Music, Volume IV, Oxford 1989; François Lesure, Claude Debussy (Iconographie musicale IV), Genève 1975. Künstlerphotographien: Sheila Rock (Bychkov); Decca Kasskara (Thibaudet); Leonie von Kleist (Heidenreich); Archiv der Münchner Philharmo­n iker (Thomas Walsh), Denise Vernillo und Guido Rückel (MPhil vor Ort). DAS ORCHESTER DER STADT FR 13_11 SA 14_11 SO 15_11 — GASTEIG In freundschaftlicher Zusammenarbeit mit WEITER HÖREN 3 M FÜ U TA R SI GE AL K LE 117. Spielzeit seit der Gründung 1893 Valery Gergiev, Chefdirigent (ab 2015/2016) Paul Müller, Intendant