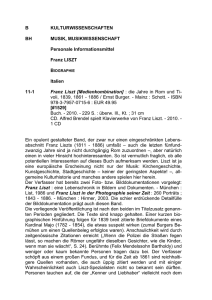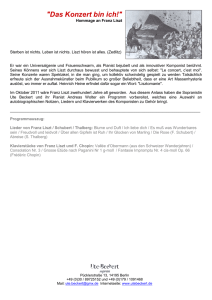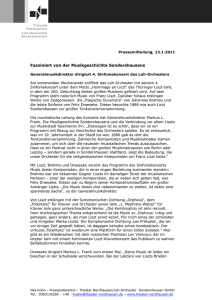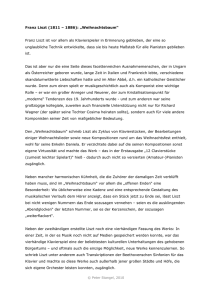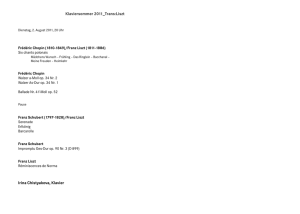Die „Soirees de Vienne“
Werbung

Landesmuseum für Burgenland, Austria, download unter www.biologiezentrum.at Die „Soirees de© Vienne“: Gibt es ein ‘Österreichisches’ in Franz Liszts Schubert-Bearbeitungen? Gerhard J. WINKLER, Eisenstadt I. Die Soirees de Vienne1bilden in Liszts CEuvre einen merkwürdigen Nachzügler: Entworfen zwar wohl schon 18462 in Wien, erschienen sie erst während der Weimarer Zeit, 1852/53, in Druck3, und sie fallen als letzte der SchubertBearbeitungen in eine Phase, in der der Höhepunkt von Liszts kompositorischer Auseinandersetzung mit Schubert bereits überschritten war. Der Titel läßt sogar offene Assoziationen an Liszts Virtuosenzeit anklingen, an die Pendants der Soirees musicales nach Rossini und der Soirees italiennes nach Mercadante4. Die Formulierung „Soirees de Vienne“ entwirft eine imaginäre Szenerie, die eines Salons, und weist sie einem genius loci zu („Wiener Abendgesellschaften“); der Name Schubert rückt in den Untertitel, der wiederum mit der Genrebezeichnung, die er enthält, die Salon-Atmosphäre noch unterstreicht: Valses-Caprices d ’apres Schubert. Aber nicht nur damit sind die Soirees de Vienne ganz auf den Wiener Dunstkreis bezogen: Die Erstausgabe, die im traditionsreichen Wiener Verlag Spina erschien, trägt die Widmung an Simon Löwy, einem Wiener Bankier im Umkreis von Liszts „oncle-cousin“ Eduard. Liszt kannte Löwy schon seit 1838; er stand mit ihm 1851 in näherem brieflichen Kontakt, weil Löwy biographisches Material für einen geplanten Schubert-Artikel Liszts liefern sollte5 Nach mehreren Auflagen ließ Liszt die Soirees de Vienne noch 1883 bei August Cranz in Leipzig in einer als „Nouvelle Edition augmentee par l ’Auteur“ bezeichneten, tatsächlich aber nur wenig veränderten Neufassung6erscheinen, deren Widmungsträgerin keine gerin­ gere als die Fürstin Metternich ist, jene Pauline Metternich, die als Gattin des Österreichischen Botschafters maßgeblich bei der Lancierung des Pariser Tannhäuser von 1861 beteiligt gewesen war. Die Widmung trägt der Tatsache Rechnung, daß Liszt die Soirees de Vienne in den Pariser und Wiener Salons der Fürstin oft gespielt hatte, wo er sie, wie man aus einem Brief aus dem Jahre 1875 erfährt, mit dem Beinamen „Wiener Backhändeln“ belegte - was Liszt in dem Brief übrigens mit dem Wortspiel „sans Bach ni Händel“ begleitet7 Wien, Schubert, Walzer: Diese Kombination fordert dazu heraus, am Beispiel der Soirees de Vienne einmal versuchsweise über das ‘Österreichische’ in der Musik Liszts nachzudenken. Da man bei Liszt nicht weit etwa mit dem kommt, was in der heutigen Musikwissenschaft unter dem Begriff des „Österreichischen in der M usik“, namentlich der Musik Schuberts und Bruckners, kursiert8, gilt es zunächst, bei ihm selbst einen festen Punkt zu gewinnen, von dem man sich abstoßen kann. 74 II. © Landesmuseum für Burgenland, Austria, download unter www.biologiezentrum.at Dieser scheint im Reisebrief an Lambert Massart gegeben, der, datiert mit Venedig, April und Mai 1838, im September desselben Jahres in der Pariser Revue et Gazette musicale erschien9, und der jenes so berühmte wie oft zitierte Postskrip­ tum („P.S.“) enthält, worin Liszt den Bericht von seinen Wiener und Pester Benefizkonzerten zugunsten der Donauüberschwemmungsopfer mit dem Be­ kenntnis zum ungarischen Vaterland verbindet. Zuvor, im Haupttext, berichtet Liszt von einer Abendveranstaltung im M ailän­ der Palais der russischen Gräfin Samoyloff („comtesse Samoiloff“) 10, bei der sich die feine Gesellschaft Mailands zusammengefunden habe, um den Auftritten verschiedener Gesangszelebritäten beizuwohnen, die Liszt kenntnisreich kom­ mentiert. Dem Hauskonzert habe sich ein Ball angeschlossen. Liszt, plötzlich angeekelt von dem Treiben, habe sich entfernt und allein in einem sehr phanta­ stisch eingerichteten Boudoir wiedergefunden. Dort sei er in einen tranceartigen Schlummer gefallen, wo ihn - der russische Tee sei wohl etwas stark gewesen eine Traumvision überfallen habe. Darin sei er einer unheimlichen Figur begeg­ net, einem bleichen, melancholisch-stummen Wandersmann, den er durch imagi­ näre Bilderfluchten und phantasmagorische Landschaften verfolgt und schließ­ lich mit dramatischer Geste zur Rede stellt, um ihm eine Antwort auf die Frage nach Zweck und Ziel seines Unterwegsseins abzutrotzen. Er erhält den Bescheid, er möge nicht zu erfahren verlangen, was ihm selbst - dem Fremdling, der schon Äonen unterwegs sei -, nicht gelungen sei: das Geheimnis der Wanderschaft zu ergründen. Alle Aspirationen, etwas zu wissen, zu vermögen oder zu genießen, seien vergeblich. Des Fragers Los seien Unwissenheit, Ohnmacht und Versagung: „‘Adieu.- Ne cherche point ä savoir, ton lot est l ’ignorance. Ne cherche pas ä p ou voir, ton lot est l ’impuissance. N e cherche pas ä jo u ir, ton lot est l ’abstinence.’“11 Wieder aufgewacht, habe sich Liszt zu Hause ans Klavier gesetzt, wo in ihm der traurige und poetische Gesang von Schuberts Wanderer aufgestiegen sei, der entfernte Ähnlichkeit mit den geheimnisvollen Harmonien gehabt hätte, die die Traumerscheinung begleiteten. Liszts Hinweis auf den Wanderer ist ein deutlicher Fingerzeig, denn die Traumsequenz stellt in ihren wesentlichsten Punkten eine freie Paraphrase des Wanderer-Textes12dar (Textmarken: „[...] ich bin ein Fremdling überall [...] Dort, wo du nicht bist, da ist das Glück.“), wobei die Figur des Wandersmanns vom mythischen Archetyp, Ahasver selbst, überblendet ist und massive Anleihen an den Motiven der zeitgenössischen literarischen sog. „Schwarzen Romantik“ nimmt: Ennui, Opiumrausch (!), Chiffren des Weltschmerzes und nicht zuletzt dem Doppelgängermotiv. Die etwas mystifikatorisch eingesetzte Symbolik legt nämlich die Deutung nahe, daß es sich bei diesem Wanderer-Ahasver um ein Ebenbild des Künstlers handelt (ein Spiegelsymbol spielt hier eine diskrete, aber wichtige Rolle)13, um sein ‘wahres Selbst’ oder eine Art überhöhte Imago, von dem Liszts Traum-Ich im Dialogtext Gewißheit über die eigene Bestimmung empfängt: der Künstler als ein Wanderer, ein voyageur, der unablässig unterwegs 75 © Landesmuseum für Burgenland, Austria, download unter www.biologiezentrum.at ist nach einer erahnten, aber unerreichbaren Heimat. Das ganze Mailänder Bühnen­ inventar dieses Reisebriefes wird also mit einem Mal zur Staffage und Kulisse für das ewige Drama des Künstlers. Die Traumsequenz stellt eine schwarze Variante dessen dar, was man aus anderen Äußerungen als die Künstlermetaphysik des frühen Liszt kennt14. Zwischendurch blitzt mit der Bezeichnung „pelerin“ das ‘weiße’ Gegenbild des Voyageurs auf: der Pilger, der im Gegensatz zu diesem Hoffnung hat, dereinst ein Ziel zu erreichen15. Dies klingt an so manche andere Formulierung Liszts an, wo es heißt, der Künstler habe seine innerste Bestimmung eben darin, daß er kompromißlos und unablässig nach dem Höchsten strebe. Aber auch in dieser Version ist der Weg selbst das Ziel; der Hauptakzent scheint auf der Unablässigkeit eines Strebens zu liegen, das einzig darin Gewißheit hat, daß ein Ideal, das erreichbar ist, kein Ideal mehr sein kann. Der Text enthält somit eine bedeutende Mitteilung über Liszts Selbstverständ­ nis als Künstler, dargeboten im literarischen Genre des Reisebriefs, der bei fiktiver intimer Mitteilung öffentliche Selbstinszenierung erlaubt und dabei noch die Funktion eines Korrespondentenberichts erfüllt. Liszts Künstlerimago tritt hier nicht nur verschlüsselt in der Figur des Wanderer-Voyageurs auf, sondern auch wie auf einer imaginären Bühne: Denn das Opiumtraum-Motiv führt eine deutliche und beinahe räumliche Spaltung in zwei Handlungsebenen herbei: hier die der Öffentlichkeit und des Salons, die der Künstler flieht, dort der Schauplatz seiner inneren Subjektivität, seines ‘eigentlichen’ Selbst. Die Traumsequenz setzt zwar einen deutlichen Kontrapunkt zum ersten Teil des Briefes, wo Liszt von seinen Mailänder Konzerten und weiteren Salonereignissen berichtet. Die beiden Handlungsebenen schließen einander jedoch nicht aus, sondern sind ineinander verschachtelt: Es ist, als ob die Traumerzählung nicht nur Antithese, sondern auch W iderspiegelung des Schicksals eines reisenden Virtuosen sei, dessen groteske Unbilden Liszt zu Beginn mit unverhohlenem Sarkasmus schildert. Der Text ist von einem reisenden Musiker an einen seßhaften gerichtet16; das VoyageurSyndrom, wie man es nennen könnte, betrifft die gesamte Konstellation in ihren ‘äußeren’ und ‘inneren’ Handlungsebenen. Sehr charakteristisch ist hier die (auch an vielen Parallelstellen ablesbare) Distanzierung Liszts von dem, was seine künstlerische Arena und Haupteinnah­ mequelle ist und noch ein Jahrzehnt bleiben wird: die des Virtuosen und Salonlö­ wen. Es handelt sich dabei um mehr als um eine bloße literarische Attitüde: Hier wird zweifellos ein psychodynamisches Spannungsfeld markiert, das für Liszt von zentraler Bedeutung ist. (Es ist ja kaum Zufall, daß es sich bei den Begriffen des „voyageur“ und des „pelerin“ geradezu um die Titelvarianten von Liszts Haupt­ werk aus dieser Periode, dem Album d ’un voyageur bzw. den Annees de pelerinage, handelt.) Meistens ergreift Liszt gegen den Virtuosen, der sich und seine Kunst öffentlich prostituieren muß, die Option ‘Beethoven’, also das Ideal des ‘seriösen’ Künstlers, wie er einer Zentralsonne gleich in Liszts psychischer Landschaft steht. In diesem Fall aber wird eine andere Perspektive eröffnet, für die Schuberts Wanderer abermals als Wegmarke fungiert. Das Postskriptum nämlich, das neben dem patriotischen Bekenntnis zu Ungarn auch einen Bericht über Wiener Ereig­ nisse (Schuberts Lieder und Clara Wieck) enthält, scheint nämlich eine indirekte 76 © Landesmuseum für Burgenland, Austria, downloadIn unter www.biologiezentrum.at Antwort auf das ‘Voyageur-Syndrom’ zu sein. der Traumsequenz ist Schuberts W anderer sozusagen zu gleichen Teilen auf die ‘weiße’ und ‘schwarze’ Symbolik aufgeteilt: Die Schubertsche Musik steht für den fernen Abglanz jener Heimat, die für den Wanderer laut Text unerreichbar ist. Das Bekenntnis zur ungarischen Nation aber eröffnet gleichsam eine neue Option, die das Dilemma, von dem im Haupttext die Rede ist, zwar nicht ‘löst’, aber entschärft: Der ewigen W ander­ schaft des Künstlers wird eine Heimat in Reichweite gegenübergestellt, im Medium eines nationalen Kollektivs, das sowohl die uneigentliche Existenz des Künstlers wie auch dessen subjektive Privathölle aufhebt. Es sind also drei Ebenen, die gleichsam das Hauptszenario dieses Textes bilden: die des Virtuosen, die des Wanderer-Voyageurs und die des patriotischen Be­ kenntnisses. Alle drei sind durch das Voyageur-Syndrom miteinander verschränkt und zentral mit dem Schubertschen Wanderer verschlüsselt. In gegenseitiger Verweisung illustrieren sie sozusagen die psychodramatische ‘Urszene’ des Künstlers Liszt, das verborgene Zentrum, das auf sein Verhalten als Künstler ausstrahlt und daher auch allen weiteren Überlegungen vorausgestellt werden muß. III. In das Hauptszenario des Textes ist eine versteckte Nebenhandlung einge­ schrieben: Auf dem Mailänder Hausball der schönen Comtesse Samoyloff wird nach Walzern von Johann Strauß getanzt: „Les diamants, les fleurs, les gazes, les satins flottaient, papillonaient, tourbillonaient au son d ’une entrainante valse de Strauss.“17 Der bloße Nachname genügt offensichtlich: Dem französischen Lesepublikum, das der primäre Adressat des Lisztschen Reisebriefs ist, muß „Strauss“ bereits ein Begriff sein. Johann Strauß („Vater“, 1804-1848) hatte gerade zur Jahreswende 1837/38 mit seinem Orchester in Paris wahre Triumphe gefeiert. Der StraußWalzer ist in Liszts Text prominent plaziert. Er hat seine Stelle unmittelbar vor der Traumsequenz und fungiert geradezu als deren Initialmoment. Er verstärkt einer­ seits den Opium-Effekt: Liszt versieht ihn mit dem Beiwort „entrainante“ („une valse entrainante“) „hinreißend“, „mit sich fortreißend“ wodurch er sehr treffend das elektrisierende Moment wiedergibt, das als Charakteristikum des Wiener Walzers gilt18 und gleichzeitig eine bedrohlich-intoxikative Komponente einfließen läßt. Andererseits ist der Strauß-Walzer M itauslöser des Einsamkeits­ syndroms: Musik, so Liszt, habe als solche die Wirkung, ihn von der Welt abzusondern; d.h. der Walzer ruft zunächst den Zustand des Auf-sich-selbstZurückgeworfenseins hervor, aus dem sich erst die Traumvision freisetzt. Trotz dieser Vertracktheiten ist der Strauß-Walzer in diesem Text natürlich ganz auf der ‘oberen’ Handlungsebene, der der Öffentlichkeit und des Salons, angesiedelt, woraus sich parallel zu den Schwerelinien dieses Textes eine interessante Konstel­ lation ergibt, in der sich gleichsam die europäische Großmächtepolitik vor 1848 spiegelt: Vor dem Wanderer-Traum der Wiener Walzer, nach ihm, im Postskrip­ tum, das patriotische Bekenntnis zu Ungarn. 77 Landesmuseum für Burgenland, Austria, download unter www.biologiezentrum.at Johann Strauß ©der Ältere ist wie später sein Sohn Repräsentant nicht nur eines musikalischen Genres, das des typischen Wiener Walzers, der seine europäische Geburtsstunde beim Wiener Kongreß hat, sondern auch des kaiserlichen Wien selbst, als dessen Exportartikel der Walzer zweifellos schon zu dieser Zeit gilt. Strauß hat sich gerade in den Dreißigerjahren durch Konzerttourneen bereits international bekannt gemacht. Für den Schauplatz des Textes ist jedoch ein anderer Punkt entscheidend: Der Mailänder Salon befindet sich 1838, politisch gesehen, ja nicht abstrakt in Italien, sondern in einer österreichischen Provinz. Die Lombardei und Venezien, von wo der Reisebrief und sein Postskriptum datiert sind, haben mit dem Königreich Ungarn gemeinsam, daß sie Staatsteile des Österreichischen Kaiserreiches sind (die Lombardei bis 1859, Venezien bis 1866). Mit dem Strauß-Walzer ist gleichsam die Besatzungsmacht präsent. Dies mag in der abgehobenen Sphäre des Hausballs, wie sie Liszt beschreibt, überhaupt nicht ins Gewicht fallen - die feine Mailänder Gesellschaft hat sich mit den politischen Gegebenheiten arrangiert -, gibt aber vor allem aus dem Lichte des Späteren ein latentes Bedrohungsbild wieder: Zehn Jahre später wird der österreichische Feldmarschall Radetzky vom Palazzo der Sforza aus die Stadt bombardieren derselbe Radetzky, dem Strauß der Ältere im selben Jahr 1848 jenes Musikstück widmen wird, den Radetzky-Marsch op. 228, der heute als Inbegriff österreichi­ scher Musik gilt und beim traditionellen Neujahrskonzert der Wiener Philharmo­ niker als obligate letzte Zugabe in alle Welt übertragen wird. Im selben Jahr 1848 wird auch das Unabhängigkeitsproblem Ungarns innerhalb der HabsburgerMonarchie zum ersten Mal zur vollen politischen Brisanz gelangen. IV Der Reisebrief scheint also ein latentes politisches Szenario zu enthalten, in dessen Mitte Österreich steht. Wenn man vom „Österreichischen“ spricht, so muß man stets evident halten, daß dieser Begriff im 19. Jahrhundert nicht ‘national’ besetzt ist. Er bezeichnet jenes Staatsgebilde des Österreichischen Kaiserreiches, das als Konglomerat der Habsburgischen Erb- und Kronländer 1804/06 aus dem Zusammenbruch des Heiligen Römischen Reiches hervorgegangen ist. Als Staats­ idee ist Österreich, die „Domus Austria“, der universalistische Deckbegriff für die Völker und Nationen, die er unter sich faßt. Diese gemeinsame dynastische Klammer erwies sich als identitätsstiftendes Moment jedoch zunehmend als brüchig gegenüber den einzelstaatlichen Selbständigkeitsbestrebungen, die sich im 19. Jahrhundert unter der Flagge des ‘Nationalen’ artikulierten, und sich zentrifugal, auf Kosten des Gesamtgebildes, auswirkten. So kommt es eben, daß es um die Mitte des 19. Jahrhunderts zwar eine deutsche, eine italienische, eine ungarische, aber keine österreichische National-Bewegung gab, und daß - inso­ fern das ‘nationale Paradigma’, wie man es nennen könnte, nicht nur eine fundamentale politische Triebfeder darstellte, sondern auch im geistig-kulturellen Bereich mächtige Synchronisierungseffekte hervorrief das ‘Österreichische’ auch auf der musikgeschichtlichen Landkarte des 19. Jahrhunderts einen weißen Fleck markiert, sozusagen die Leerstelle zwischen der „Idee der deutschen M usik“ und den verschiedenen „Nationalen Schulen“ M ittel-Osteuropas19 78 Landesmuseum für Burgenland, zu Austria, download unter www.biologiezentrum.at Wie nimmt sich© Liszts Bekenntnis Ungarn in diesem Kontext aus? Hat Liszts Postskriptum die politische Qualität antiösterreichischer Parteinahme? Der Text selbst ist hierin nicht sehr deutlich. Er ist einerseits durch das Voyageur-Syndrom geprägt und durch andere literarische Topoi vermittelt und als Mitteilung natürlich auf das französische Publikum berechnet, dem gegenüber sich Liszt da als Angehöriger eines undomestizierten, aber stolzen Volkes präsen­ tiert („O ma sauvage et lontaine patrie !“)20, ein „edler W ilder“ in der Tradition von Chateaubriands Rene. Versucht man, das, was Liszt aus seiner ‘französischen’ Geisteslage in diesen Text einbrachte, von jenem zu isolieren, was tatsächlich auf das ungarische Erlebnis von 1838 zurückzuführen ist, so scheint der Text sehr wohl eine neue Option zu eröffnen. Liszt scheint sich zunächst bewußt zu sein, daß sein Bekenntnis auch eine latente politische Dimension hat. Im Sprachgestus schwingt ähnlich wie im Falle des Lyoner Arbeiterelends21 ein Jahr zuvor ein wenig der parti pris für die Erniedrigten und Entrechteten mit; und wenn er seinen ungarischen Landsleuten eine ruhmreiche Zukunft prophezeiht, dann bewegt er sich hart an der Grenze dessen, was etwa ein Jahrzehnt später vielleicht auch einen Metternichschen Polizeibeamten interessiert haben würde. Dazu zwei Beobachtungen, die das Problem zwar nicht lösen, aber doch plastischer hervortreten lassen: 1. Liszts Bekenntnis von 1838 setzt eine Zäsur, die noch nicht vorhanden war, als Liszt fünfzehn Jahre zuvor aus Wien abreiste: Seiner Herkunft nach ist Liszt „Ungar“ strenggenommen lediglich in geographischem Sinn. Das Königreich Ungarn erhielt - wie die gesamte Habsburger-Monarchie - eine flächendeckende Verwaltungsstruktur (Einführung von Bezirkshauptmannschaften usw.) erst mit den Reformen der Fünfzigerjahre. Die erste für den jungen Liszt im west­ ungarischen Raiding relevante politische Struktur war die Esterhäzysche Zentral­ verwaltung in Eisenstadt gewesen, deren Beamtenschaft sein Vater angehörte. Die Amtssprache dieser Verwaltung - sowie Liszts Muttersprache wie auch die seiner Vorfahren väterlicherseits - war Deutsch und nicht Ungarisch, die Sprache der Landbevölkerung. Der Fürst selber hielt sich in Wien am Kaiserhof auf; der ungarische König, dessen Untertan Liszt mittelbar war, war mit dem österreichi­ schen Kaiser identisch und residierte in Wien. Als Liszt 1823 in Wien an Diabellis Variationen-Ausschreibung teilnahm, wurde er selbstverständlich als „(Knabe von 11 Jahren) geboren in Ungarn“ in den so benannten „Vaterländischen Künstler­ verein“22 miteinbezogen. Liszt hätte 1838 also, wenn er „ma patrie“ sagt, in diesem Quiproquo verschie­ dene ‘Vaterländer’ auswählen können. Daß er eine bestimmte Wahl traf, zeigt, daß er sich mit einer politisch-nationalen Geisteslage in Ungarn synchronisierte wenn nicht solidarisierte, die zur Zeit seiner Kindheit noch nicht virulent war und nun, repräsentiert durch verschiedene Gruppierungen, letztlich auf eine Los-vonHabsburg-Bewegung hinauslief. 2. Wenn dieser Solidarisierungseffekt allerdings je wirksam wurde, dann nicht in politischer Aktion oder in der Weise, daß Liszt daraufhin geradewegs ‘sein Leben verändert’ hätte. Liszt hat nicht nur nicht öffentlich Partei genommen für die politische Sache Ungarns (das hat ihm Heine 1849 bekanntlich sehr zum 79 © Landesmuseum Burgenland, Austria, download unter www.biologiezentrum.at Vorwurf gemacht23); er hatfürsich nach Beendigung seiner Virtuosenreisen auch zunächst keineswegs in Ungarn, sondern in Weimar niedergelassen. Wenn sich also sein Ungarn-Erlebnis, so überwältigend es für ihn gewesen sein mag, in seiner Biographie zunächst niederschlägt, dann einerseits ‘äußerlich’ in der Tourneen­ planung des Virtuosen (den beiden Ungarntourneen 1839/40 und 1846) und andererseits in seinen ungarischen Kompositionen, die später in das Projekt der Ungarischen Rhapsodien münden. Ungarn, wie Liszt es im Postskriptum seines Reisebriefs als eine Imago von „Heimat“ anvisiert, bleibt noch auf Jahre hinaus eine topographische Chiffre für eine künstlerische Option, die dem Schlüsseler­ lebnis von 1838 wohl sogar bereits vorausgegangen sein mag, sich aber mit ihm erst vollends eröffnet hat, ein emotional-heroisches Ferment seines künstlerischen Wirkens. Mit anderen Worten: Obwohl im Postskriptum von ungarischer oder Zigeuner­ musik usw. noch keine Rede ist, ist es eine eigentlich durch und durch künstleri­ sche Konsequenz, die Liszts nationales Bekenntnis zunächst (die Rede ist vom Zeitraum bis zum Ende der Virtuosenjahre) zeitigte. Doch ebenso wie die natio­ nale H inw endung zu U ngarn auf der sozusagen ‘p o litis c h e n ’ Ebene unausgesprochenermaßen das Urteil über Österreich enthält, so ist auch in Liszts künstlerischem Verhalten die Frage des ‘Österreichischen’ in der Entscheidung für Ungarn verborgen. Man hat also, um zum Kern des Themas „Liszt und das Österreichische“ vorzustoßen, Liszts Werk selbst zu befragen. Dies soll im folgenden in Form eines Gedankenexperiments versucht werden. V Liszt hat bis zum Ende seiner Virtuosenzeit eine ganze Reihe von Kompositio­ nen verfaßt, die in Titel oder Sujet usw. einen Bezug zu Orten, Landschaften, Staaten oder Nationen aufweisen. Diese wären zunächst in einer chronologisch angeordneten Liste zu erfassen. Der Katalog müßte weit genug sein, um auch jene Werke aufzunehmen, in denen der Bezug literarisch vermittelt ist, wie im Falle von Vallee d ’Obermann, oder sekundär über ein bearbeitetes Original gegeben ist, wie im Falle der Ouvertüre zu Guillaume Teil beide Stücke wären z.B. der Schweiz zuzuordnen. Zweifellos müßte in einer ganzen Reihe von Streitfällen erst entschieden werden, ob sie überhaupt in die Auswahl gehören oder nicht. Auch müßte bei dieser Zuordnung unentschieden bleiben, ob „Schweiz“ oder „Italien“ geographische Begriffe im eigentlichen Sinn sind oder ihrerseits literarisch oder sonstwie kulturell geprägte Topoi usw. Das Resultat des Verfahrens wäre jeden­ falls ein Katalog derjenigen Kompositionen Liszts vor 1848, die eine ‘nationale’ Beziehung im weitesten Sinne des Wortes aufweisen. Der zweite Schritt beträfe die innere Strukturierung dieses Materials: Man müßte für jede Komposition die Unterscheidung treffen, ob die ‘nationale’ Zuordnung ‘äußerlich’ ist bzw. sich in völlig konventionellem Rahmen bewegt und eigentlich keine individuelle Aussagekraft hat, oder ob damit eine dezidierte ‘nationale’ Hinwendung des Komponisten verbunden ist. Dieser Analyseschritt würde vermutlich die Versuchsanordnung vor unüberwindbare Probleme stellen, 80 © Landesmuseum für Burgenland, Austria, download unter www.biologiezentrum.at denn es müßte zweifellos für jede Komposition ein eigenes ästhetisches Kategorien­ system entwickelt werden, innerhalb dessen der Stellenwert des ‘nationalen’ Faktors zu ermitteln wäre. Um trotzdem einigermaßen pragmatisch vorzugehen, ohne in allzugroße Abstraktionen zu fallen, könnte man vorschlagen, den Reise­ brief von 1838 für das Gedankenexperiment fruchtbar zu machen. Wenn dieser Text ein zentrales psychodynamisches Spannungsfeld des Künstlers und Virtuo­ sen Liszt markiert, dann müßte er auch die inneren Ordnungskriterien für Liszts Werke dieser Periode liefern können. Es sind die drei Handlungsebenen des Textes, nämlich die des reisenden Virtuosen, die des Wanderer-Voyageurs und die des patriotischen Bekenntnisses, die im W erkkatalog Liszts abgebildet und in die analogen Werkkategorien übersetzt werden könnten: das ‘Reiserepertoire’ des Virtuosen, die Projekte mit ‘seriösem Anspruch’ und die ‘nationalen Projekte’ selbst. Dazu folgende Erläuterungen: 1. Das ‘Reiserepertoire’ Diese Kategorie betrifft die konventionelle Ebene: Nicht nur in Liszts Werk­ liste, sondern auch in denen Czernys, M oscheies’, Kalkbrenners oder Thalbergs24 findet sich eine große Anzahl von Kompositionen ‘nationaler’ Charakteristik oder mit Bezug zu Orten und Landschaften. Es gehörte offenbar zum Brauch des reisenden Musikers, durch Stücke dieser Art dem Publikum der Stadt, in der man das Konzert gibt, eine Hommage darzubringen oder durch die musikalische Kunde von anderen Ländern und Menschen umgekehrt das Flair der Internationalität, die den Virtuosen auszeichnet, zu unterstreichen. Das (Euvre seiner Kollegen blieb auch in den Vierzigerjahren von den politisch-nationalen Strömungen, dem ‘Erwachen der Nationen’, nicht unberührt25. Dazu kommt, daß das ‘Nationale’ seit dem 18. Jahrhundert auch durch verschiedene europäische Tanztypen (wie bei­ spielsweise die Polonaise oder die Ecossaise usw.) besetzt war. Das ganze Repertoire reicht hier vom „Souvenir de “ in Form eines Albumblatts bis zur Fantasie über ‘offizielle’ Hymnen zu verschiedensten Anlässen. Auch Thalberg hat mehrere Arten von ‘National’-Melodien benutzt; seine musikalische Huldigung an die Königin Victoria zu ihrem Regierungsantritt, die Grande Fantaisie sur les Airs nationaux Anglais: God save the Queen etR ule Britannia op. 27, mit der er 1837 gegen Liszt angetreten ist, gehört letztlich auch in dieses Genre. Liszt hat dazu sogar ein Pendant aufzu weisen, seine Bearbeitung God save the Queen von 184126. 2. Die Ebene des ‘W anderer-Voyageurs’ Die erste Ebene ist, was sie allein betrifft, bei Liszt unterhöhlt und getragen durch eine von allem Anfang an engagierte, sozusagen ‘Herdersche’ Intention, nach substanzielleren musikalischen Charakteren der Regionen, Städte oder Länder zu suchen, die in seine Wahrnehmung fielen. In diese Kategorie wäre z.B. Liszts konsequentes und systematisches Sammeln von Nationalmelodien aller Arten einzuordnen, aus denen dann die einschlägigen Kompositionen wie die ungarischen Magyar Dallok oder andererseits etwa auch die 1845 anläßlich der Spanientournee entstandene Große Konzertfantasie über spanische Weisen27 erwuchsen. (Auch das eben' erwähnte God save the Queen von 1841 z.B. war 81 Landesmuseum Burgenland, Austria, unter www.biologiezentrum.at offensichtlich als©Teil einer fürFantasie überdownload engliche Nationalmelodien gedacht.)28 Es handelt sich also hier bei Liszt um ein regelrechtes künstlerisches Konzept, das der „Nationalmelodien“, das man in dem Gedankenexperiment wohl der Ebene des Wanderer-Voyageurs zuordnen muß. Denn es findet nicht nur direkten kompositorischen Niederschlag in den Bearbeitungen von und Fantasien über Nationalmelodien, sondern führt auch zur höchst eigenwilligen Konzeption des Album d ’un voyageur, das in dieser Zusammenstellung neben der Erstfassung von Vallee d ’Obermann, worin die Schweiz nur noch als poetischer Ort eines Psychodramas fungiert, eben auch die Sammlung der Fleurs melodiques des Alpes enthält (und laut Vorwort in einem späteren Stadium Nationalmelodien verschiedener Völker, darunter auch ungarische, enthalten sollte)29 Wenn man vom „W eltbürger“ Liszt spricht, sollte man nicht verschweigen, daß es die Chiffren der eigenen Heimatlosigkeit sind, die der Künstler Liszt im Album d ’un voyageur in Gestalt der Schweizer Melodien und Impressionen um sich versam­ melt. Erst von diesem Komplex setzt sich die Ebene der dezidiert ‘nationalen Projekte’ ab: 3. Die ‘nationalen Projekte’ Franz Liszt hat einerseits während seiner Deutschland-Tourneen einige Kom­ positionen für Männerchor verfaßt, die als Dokumente eines patriotischen Enga­ gements in der deutschen Nationalbewegung des Vormärz verstanden werden können30 - ein Anliegen Liszts, das, ästhetisch transformiert, im späteren Weima­ rer Schaffen Liszts zweifellos seine Fortsetzung findet. Das Konzept der „National­ melodien“ andererseits setzt sich jedoch gleichsam auf Ungarn fest, wo es sich mit einer gewissen Verzögerung - über die Zwischenstufe der Magyar Rhapsodiäk von 1846 schließlich in den Ungarischen Rhapsodien mit ihrem ideologischen Überbau („Ungarisches Nationalepos in Tönen“) des Zigeunerbuches31 materiali­ siert - ganz zu schweigen von dem Sog, der vom musikalischen Prinzip „Ungarn“ auf Liszts spätere Werke ausgehen sollte. Man sieht also: Zwischen den drei Kategorien sind eigentlich keine scharfen Trennlinien zu ziehen; sie sind weniger als Schubladen zu verstehen, in die man Liszts Werke hineinzuzwängen hätte, sondern bezeichnen eher Spannungsfelder, zu denen jede einzelne Komposition jeweils unterschiedlichen Abstand einneh­ men kann. Trotzdem könnte man nun in einem dritten Schritt versuchen, die bisherigen Kategorisierungsergebnisse graphisch zu veranschaulichen: Man könnte auf einer europäischen Landkarte jedes Werk mit geographischem oder ‘nationalem’ Bezug mit einem Punkt oder durch Schraffur eintragen; geplante Werke sowie verschie­ dene Fassungen eines Werkes müßten separat berücksichtigt werden. Die drei Werkebenen könnten durch verschiedene Farbtönung, oder noch besser, in drei­ dimensionaler Versuchsanordnung durch Eintragung auf übereinandergelagerten Folien wiedergegeben werden. Das Resultat wäre sozusagen ein europäischer Atlas für Liszts Schaffen bis 1848, der das Thema „Liszt und die Nationalitäten“ 82 © Landesmuseum für Burgenland, Austria, download unter www.biologiezentrum.at könnte nicht nur für diesen Zeitraum statistisch abbildet. Dieses Kartendiagramm für den gesamten Zeitraum, sondern auch etwa für Jahresschnitte erstellt werden, sodaß man anhand von deren Abfolge die ‘nationale’ Entwicklung des Komponi­ sten Liszt in seinen Werken ablesen könnte. Wie immer das Ergebnis eines solchen statistischen Versuchs ausfallen und welche Aussagekraft man ihm letztlich beizumessen geneigt wäre - für die Frage nach Liszts Verhältnis zum ‘Österreichischen’ kann man jedenfalls die Antwort vorausnehmen. Das Ergebnis des Gedankenexperiments wäre eindeutig: Während man über dem ungarischen Territorium eine intensive Färbung bzw. hohe vertika­ le Streuungsdichte der Eintragungen erwarten darf - sozusagen vom ‘Virtuosen­ stück’ Pester Karneval über die Magyar Dallok und Rhapsodiäk bis zum tatsäch­ lich zensurnotorischen32 Räköczi-Marsch -, ergäbe sich hingegen auf dem Gebiet des heutigen Österreich eine geradewegs weiße Fläche: Liszt hat sich, wenn man von der Grande fantaisie sur la Tyrolienne de Vopera La Fiancee d ’Auber (1829/ 1839)33 und einem 1843 komponierten Ländler34, einer merkwürdigen Stilübung, absieht, kompositorisch niemals etwa um ‘österreichische Nationalmelodien’ bemüht; er hat nicht - wie Clara Wieck bei ihrem Wiener Aufenthalt von 1838 die österreichische „Volkshymne“ mit der Melodie Joseph Haydns, das Gott erhalte, bearbeitet35 (bei dem übrigens Eduard Hanslick 1848 klarsichtig bemerk­ te, es sei eben kein Nationallied, sondern eine Kaiserhymne)36, noch einen StraußWalzer oder gar den Radetzky-Marsch', das ‘Alpenländische’ ist bei ihm nicht durch das ‘Steirische’ oder ‘Tirolische’, sondern durch die Schweiz besetzt, dem klassischen europäischen Land romantischer Natur- und Ursprungssehnsucht. Auf diese Weise redupliziert Liszt durch eine Leerstelle in seinem sonst so flächendeckend europäischen (Euvre den weißen Fleck auf der Landkarte der ‘musikalischen Nationalitäten’, den Österreich zu dieser Zeit darstellt. Vielmehr beginnt die ungarische Karte für Liszt bereits in Wien. Wien ist sozusagen in dieser Zeit Liszts ungarischer Brückenkopf: Von Wien aus werden die ungarischen Tourneen unternommen, in Wien ist der Sitz des Verlagshauses Haslinger, das auch die Magyar Dallok druckt. Dies alles spricht eine beredtere Sprache als es ein flammendes patriotisches Bekenntnis je könnte. Auch Schubert, mit dessen Liedern sich Liszt zwar schon weit vor 1838 zu beschäftigen begonnen hat, die er aber ab diesem Jahr in größerer Anzahl überträgt, ist nicht eigentlich ‘wienerisch’ besetzt, sondern ein Faktor eigener Größe, der in Liszts ideologi­ schem System, wie die „Wanderer“-Episode illustriert, tief sitzt. Man könnte sogar umgekehrt behaupten: Nicht Schubert ist für ihn ‘wienerisch’, sondern Wien durch Schubert besetzt. Vielmehr muß man sogar eine Schubert-Bearbeitung Liszts eben aus dem Jahr 1838 in die Vorgeschichte der Ungarischen National­ melodien rechnen, die Melodies hongroises d ’apres Schubert37 nach dessen vierhändigem Divertissement ä l ’hongroise op. 54 [D 818] - und das vor allem, weil sich in den virtuosen Passagen schon ein Vorgeschmack auf die adaptierten Zigeunerspielweisen finden läßt. Dies zeigt nebenbei, daß Liszt den „ungarischen Nationalstil“ keineswegs ‘erfunden’ hat, sondern sich seinerseits bereits in einer „All’Ongarese“-Tradition befindet, die über Schubert selbst bis in die Werke Joseph Haydns zurückreicht38. Schubert erfüllt hier für Liszt beinahe eine ähnliche 83 Landesmuseum für Burgenland, Austria,E.Th. download A. unterHoffmann, www.biologiezentrum.at Funktion wie die ©deutschen Romantiker Heine und Tieck für Richard Wagner, die diesem die mittelalterlichen Stoffe zunächst literarisch vermittelten, bevor er sich den Quellen selbst zuwandte. In diesem Licht betrachtet ist Liszts Reisebrief an Lambert Massart ein bedeu­ tendes musikhistorisches Dokument des 19. Jahrhunderts: Er belegt eindrucks­ voll, daß für einen Künstler wie Liszt, der ‘seine’ Sache mit einem nationalen Aufbruch zu verbinden geneigt war, das ‘Österreichische’ unattraktiv sein mußte. Das ‘Österreichische’ als ‘Ton’ oder musikalischer ‘Nationalcharakter’ mag in der Musik des 19. Jahrhunderts - Schubert, Bruckner - zwar nachträglich festge­ macht werden können, hatte aber - im Sinne eines ‘nationalen’ Gesamtentwurfs kein Korrelat im zeitgenössischen künstlerischen Bewußtsein. V Umso mehr überrascht und freut einen daher die Existenz der Soirees de Vienne, die diese Lücke bei Liszt füllen. Der ideelle Hintergrund hat sich natürlich bis 1852 gewandelt: Liszt ist in Weimar seßhaft und hat in der klassischen Weimarer Tradition eine künstlerische Heimat gefunden: 1851 sind die Ungarischen Rhap­ sodien erschienen; Schubert ist für Liszt in Weimar auch nach Abschluß der wesentlichen Bearbeitungen noch aktuell. So würde er 1854 im Weimarer Hof­ theater Schuberts Alfonso und Estrella herausbringen; auch plante Liszt mit der Fürstin Wittgenstein 1851 eine literarische Studie über Schubert, zu der - wie anfangs erwähnt Simon Löwy, der Widmungsträger der Soirees de Vienne, biographisches Material liefern sollte. Hier sah Liszt vermutlich die Gelegenheit, ein wegen anderer Okkupationen zurückgestelltes Projekt nachzuholen. Die Soirees de Vienne bestehen aus neun Folgen, in denen Liszt Schubertsche Tänze zu Klavierstücken von der Ausdehnung der Chopinschen Walzer zusam­ menstellt. Schuberts Originale sind „Ländler“, „Deutsche“ und „Walzer“, die Schubert selbst ab 1821 in mehreren Ausgaben veröffentlichen ließ. Liszt konnte sich bei seiner Bearbeitung konkret auf folgende Drucke stützen, die das in den Soirees de Vienne verwendete Material enthalten39: 36 Originaltänze fü r Klavier op. 9 [= D 365], komponiert zwischen März 1818 und Juli 1821, erschienen 1821 in zwei Heften, Wien, Cappi & Diabelli, Verl.Nr. 873/874; 12 Walzer, 17 Ländler und 9 Ecossaisen fü r Klavier op. 18 [=D 145], einzelne Tänze datierbar zwischen 1815 und 1821, erschienen 1823 in zwei Heften, Wien, Cappi & Diabelli, Verl.-Nr. 1216/17; 16 Deutsche und 2 Ecossaisen fü r Klavier op. 33 [= D 783], zum Teil komponiert zwischen Januar 1823 und Juli 1824, erschienen 1825, Wien, Cappi & Diabelli, Verl.-Nr. 45; 34 Valses sentimentales fü r Klavier op. 50 [= D 779], komponiert ca. 1823, erschienen in zwei Heften 1825, Wien, A. Diabelli & Co., Verl.-Nr. 2073/2074; 16 Ländler und 2 Ecossaisen („Hommage aux belles Viennoises. Wiener 84 © Landesmuseum für Burgenland, www.biologiezentrum.at Damen-Ländler“) fü r Klavier op.Austria, 67 download [= D unter 734], erschienen 1826, Wien, A. Diabelli & Co., Verl.-Nr. 2442; 12 Walzer fü r Klavier („Valses nobles“) op. 77 [= D 969], erschienen 1827, Wien, Tobias Haslinger, Verl.-Nr. 4920; Schuberts Tänze sind in der Regel sehr kurze Musikstücke, meist bestehend aus zwei achttaktigen Notenzeilen mit Wiederholungszeichen, sodaß sich, wenn man den Notentext der Ausgaben Nummer für Nummer spielt, die endlose Folge aa bb cc dd usw. ergibt. Erst die späteren Drucke weisen Tänze in der dreiteiligen Disposition mit Trios auf. Die „Ländler“, „Deutschen“ und „Walzer“ entsprechen einem Tanztypus, der seit der Mitte des 18. Jahrhunderts in Wien modern zu werden begann und der musikalisches Resultat eines sozialen Emanzipationsprozesses ist, denn er mar­ kiert die Ablösung von den höfischen Tanzformen wie dem Menuett. Auch diese Entwicklung vollzog sich bereits im Medium des ‘Nationalen’, wobei allerdings die deutschen Bezeichnungen wie überhaupt der Titel „Deutsche“ mehr Synonym für den gesellschaftlichen Trägerwechsel oder den sozialen Standort („Ländler“) sind als im Sinne des späteren 19. Jahrhunderts ‘national’ inspiriert. Ethnogra­ phisch gesehen sind „Ländler“, „Deutsche“ und „W alzer“ Mitglieder oder Ab­ kömmlinge ein und derselben Tanzfamilie; „Ländler“ gilt als Sammelname für die im süddeutschen Raum verbreiteten Volkstänze im langsamen Dreivierteltakt. Die Terminologie ist keineswegs eindeutig und eine scharfe Unterscheidung zwischen den Typen schwierig zu treffen, da musikalische und choreographische Sachverhalte, sozial- und sprachgeschichtliche Kriterien ineinandergreifen. Der Begriff „Deutscher Tanz“ konnte um 1800 gleichzeitig für verschiedene Tanz­ formen angewandt werden: für den „Ländler“ als dessen städtisches Gegenstück, für die Schlußfigur des Ländlers, für „das W alzen“ usw. Als gesichert gilt, daß sich der „Walzer“ als ein nicht an ein choreographisches Muster gebundener Rundtanz aus dem „Deutschen“ entwickelt hat40. Schuberts Tänze sind Gebrauchsmusik, geschrieben nicht für den großen Rahmen, sondern für Hausbälle oder andere gesellige Zusammenkünfte, z.B. auch die sog. „Schubertiaden“ Als solche sind sie im Umgangston sozusagen ganz biedermeierliches Wien und weisen den für Schubert tiefstmöglichen individuel­ len Bearbeitungsgrad auf. (Trotzdem kann Schubert es natürlich nicht verhindern, daß überall sein ‘Ton’, eben das unverwechselbare Idiom, durchdringt.) Auch bei Schubert ist es schwierig, exakte musikalische Kriterien für die Unterscheidung zwischen den Typen angeben zu können: Die Titel der „Deutschen“, „Ländler“ und „W alzer“ - der letztere Begriff taucht bei Schubert im Autograph nur einmal auf - sind größtenteils vertauschbar und auch von Schubert selbst als Synonyma gebraucht41. Mit ihnen greift Liszt jedenfalls auf die Vorformen des Walzers zurück, wie er sie während seiner frühen Wiener Zeit wohl kennengelernt haben mag: Sie halten sozusagen den ideellen Punkt in der Entwicklung des Walzers fest, bevor sich aus der spezifisch Wiener Linie, die in den Walzertyp Lanners und Strauß’ mündet, der Walzer als allgemeiner Tanztyp ohne nationale Prägung 85 © Landesmuseum für Burgenland, unter www.biologiezentrum.at abspaltet. (Der Wiener Kongreß von Austria, 1815download repräsentiert diese historische Schnitt­ stelle.42) Die folgende Tabelle gibt die von Liszt in den Soirees de Vienne (I-IX) verwen­ deten Schubert-Tänze in der Reihenfolge ihres Auftretens wieder: I Op. 9, Nr. 22 (= H. 2, Nr. 4) Op. 67, „Ländler“ Nr. 14 Op. 33, „Deutscher“ Nr. 15 II Op. Op. Op. Op. Op. Op. 9, Nr. 1 18, „Ländler“ Nr. 3 (= H. 2, Nr. 3) 9, Nr. 6 [1. Achttakter] 18, „Ländler“ Nr. 4 (= H. 2, Nr. 4) [1. Achttakter] 18, „Ländler“ Nr. 5 (= H. 2, Nr. 5) [1. Achttakter] 9, Nr. 32 (= H. 2, Nr. 14) III Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. 18, „W alzer“ Nr. 1 33, „Deutscher“ Nr. 4 9, Nr. 19 (= H. 2, Nr. 1) 9, Nr. 20 (= H. 2, Nr. 2) 9, Nr. 25 (= H. 2, Nr. 7) 18, „W alzer“ Nr. 6 18, „W alzer“ Nr. 9 IV Op. 9, Nr. 29 (= H. 2, Nr. 11) Op. 9, Nr. 33 (= H. 2, Nr. 15) V Op. 9, Nr. 14 Op. 77, Nr. 3 VI Op. 77, Nr. 9 Op. 77, Nr. 10 Op. 50, Nr. 13 86 © Landesmuseum für Burgenland, Austria, download unter www.biologiezentrum.at VII Op. 33, „Deutscher“ Nr. 1 Op. 33, „Deutscher“ Nr. 7 Op. 33, „Deutscher“ Nr. 10 VIII Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. 33, 77, 77, 33, 33, 33, 33, „Deutscher“ Nr. Nr. 11 Nr. 2 „Deutscher“ Nr. „Deutscher“ Nr. „Deutscher“ Nr. „Deutscher“ Nr. 9 5 14 13 2 IX Op. 9, Nr. 2 Was ist das Bauprinzip der Soirees de Vienne? Um bei den musikalischen Bausteinen zu beginnen: Schuberts Tänze weisen trotz ihres knappen Zuschnitts und des engen Rahmens, in dem sie sich bewegen, eine erstaunliche Spannweite an verschiedenen Charakteren auf: Das Spektrum reicht hier von den ‘ländlerisch’-derben, ganz in der Dreiklangsmelodik und den Schwerpunkten des Dreivierteltakts verhafteten wie Op. 9/19 (III. Soiree) über harmonisch verfeinerte bis zu rhythmisch komplexen Typen wie etwa der hemiolisch gegen den Dreivierteltakt geschriebenen Nr. 13 aus den Valses senti­ mentales op. 50, die Liszt für das große Mittelstück seiner brillanten VI. Soiree verwendet. Liszt - dies bereits eines der Bauprinzipien der Soirees - läßt Schuberts Tänze syntaktisch unangetastet und gibt sie in der Regel vollständig wieder. Das Hauptaugenmerk der Bearbeitung betrifft die pianistische Faktur. Hier ist Liszt sehr erfinderisch und behutsam zugleich. Manche Tänze rührt er beinahe überhaupt nicht an; sei erscheinen in den Soirees sozusagen als Schubertsches ‘Original’. Bei manchen anderen variiert Liszt lediglich die Ober­ stimme (vgl. z.B. die Hinzufügung des ‘Echos’ bei Op. 33/14 in Soiree VIII); manche aber ertönen bei Liszt gleich vorneweg in einer von der Originalgestalt abweichenden Variante, ihres umgangsmusikalischen Gehäuses mit seiner beina­ he omnipräsenten ‘Hm-ta-ta’-Begleitung völlig entkleidet und auf den pianistischen Stand eines lyrischen Klavierstücks von Chopin gehoben: Aus Op. 9/1 wird am Beginn der II. Soiree ein wunderbar schwebendes Gebilde mit MittelstimmenBinnenmelodik der ineinandergreifenden Hände; der „Deutsche“ Nr. 10 aus Op. 33 wird in der VII. Soiree zu einer regelrechten kleinen Valse melancolique: (Notenbeispiel 1, siehe S. 88). 87 © Landesmuseum für Burgenland, Austria, download unter www.biologiezentrum.at Schu.beri/ 0/9, s/A Schllbcri, Op.&l'io A h U „___ -___ ^ ~Jf flllff J T ^ ~ ' ^LV W i tt' ftß i. ~ j — J3 g t » * Notenbeispiel 1 & * a © Landesmuseum für Burgenland, Austria, download www.biologiezentrum.at Auch in der Materialkombination sind dieunterSoirees sehr variabel und von unterschiedlicher Dichte: Während die mittleren Soirees IV und V nur auf jeweils zwei Schubert-Tänzen fußen, werden in Nr. III und Nr. VIII nicht weniger als sieben verarbeitet. Trotzdem bleibt das Baumuster für alle Soirees dasselbe, nämlich das der einfachen architektonischen Zusammenstellung. (Die IX. Soiree bildet insofern eine Ausnahme, als es sich um eine einfache Variationenfolge über einen einzigen Schubertschen Tanz, den sog. „Sehnsuchts-“ oder „Trauerwalzer“, handelt.) Liszt kombiniert die Schubertschen Tänze zu größeren Einheiten in der Art der Walzer Johann Strauß’, Walzerfolgen mit wiederkehrenden Abschnitten, die mit einem Großbuchstaben-Formschema in der Art der musikalischen For­ menlehre leicht wiedergegeben werden können: A, B, A ’ usw. Überleitende oder andere ‘freie’ Partien - sieht man von den Schlußcoden ab - sind knapp, ‘entwikkelnde’ oder gar ‘durchführende’ Passagen rar. Einleitungen werden meist aus dem Material der Tänze selbst gestaltet. Das einzige kompositorische Mittel, das in großem Maßstab zum Tragen kommt, ist das der Variation bzw. Varianten­ bildung, sei es in Form der primären bearbeitenden Zurichtung des Original­ materials, sei es in Form der Travestie wiederkehrender Formabschnitte (A \ A ” usw.). Liszts ‘eigener’ Anteil verschwindet also nahezu völlig hinter den Schubertschen Originalen, die sozusagen ganz ‘als sie selber’ präsentiert werden. Liszt betätigt sich hier als pianistischer Dramaturg, der nach einem perfekten Szenenplan die einzelnen Tanznummern nacheinander auftreten läßt. Die M etho­ den dieser Dramaturgie sind mannigfaltig: Liszt entreißt die Tänze, die er aus­ wählt, den schier endlosen Ketten, in denen sie in den Schubertschen Drucken aufscheinen, und gruppiert sie zu plastischen Formabläufen, indem er einerseits durch Gruppierung Gewichte verteilt und andererseits die charakterliche Abschat­ tierung dadurch unterstützt, daß er das in den Tänzen schlummernde musikalische Potential herausarbeitet. Als ein sehr instruktives Beispiel für die Machart der Soirees kann die Nr. IV gelten. Sie fußt auf nur zwei Schubertschen Tänzen; daher ist hier dem einzelnen Tanz größere Aufmerksamkeit gewidmet, das Niveau der Variantenbildung höher als in anderen Soirees. Ihr Dispositionsschema ist einfach: Einl. - A - B - A ’ - B ’ - A. Hier werden nicht Schubert-Tänze zu größeren Formteilen zusammengefaßt wie etwa in Soiree Nr. II, sondern die bearbeiteten Tänze markieren auch die Formzäsuren. Soiree IV beginnt mit einer kurzen ‘freien’ Einleitung, in der Liszt zunächst augenzwinkernd auf eine bekannte Beethoven-Sonate (Op. 31/3) anspielt. Das charakteristische Motiv (siehe Notenbeispiel 2a, S. 91) bereitet den Zuhörer aber auf die beherrschende rhythmische Figur des ersten verwendeten SchubertWalzers, Op. 9/29, vor. Abschnitt A: Schuberts Op. 9/29 stellt formal eine regelrechte a-b-a-Form von dreimal je acht Takten dar, durch Wiederholungszeichen geteilt zu je 8 und 16 Takten. Sein Rahmenteil ist nicht nur melodisch, sondern auch harmonisch ‘auftaktig’: Er beginnt mit einem verminderten Septakkord als Vorhaltsharmonie zum Quartsextakkord derTonika; erst auf T. 4 kommt die Tonika (im Schubertschen Original D-Dur) zum Liegen. T. 5-8 ist eine Wiederholung von T. 1-4 in Lagen- 89 © Landesmuseum für Burgenland, Austria, download unter www.biologiezentrum.at Wechsel. Der Mittelteil ist ganz von der Dominantharmonie der Mollparallele dominiert; hier bekommt das punktierte Motiv - nun eine verminderte Septime gais im Dominantnonenakkord von h-moll - einen heroisch-schmerzlichen Akzent. Nahtlos schließt an den Mittelteil die Wiederholung des Rahmenteils an: Der verminderte Septakkord des Beginns erhält nun die Funktion einer verbindenen Rückleitung zur Tonika. In der IV. Soiree ist dieser Tanz nach Des-Dur versetzt. Liszt läßt den musika­ lischen Organismus, den er darstellt, melodisch vollkommen intakt. Neben dem Ausschreiben der Wiederholungen und dem Auffüllen des Klaviersatzes im zweiten Teil ist es ein sehr unscheinbares, aber umso wirksameres Detail, worin seine Bearbeitung wirksam wird: Er bricht die kontinuierliche Dreiviertelbegleitung der linken Hand auf, im vorderen Rahmenteil dadurch, daß er den Baß ton erst auf den zweiten Schlag folgen und den Taktschwerpunkt durch Pause ausspart; im schließenden Rahmenteil faßt er die nachschlagenden Viertelakkorde zu einer Halben zusammen (NB 2b-c). Durch diesen einfachen Kunstgriff wird das Gebil­ de noch nervöser und fragiler, der Leidenschaftsausbruch im Mittelteil noch unvorhergesehener und wuchtiger. Nach kurzem Einhalt schließt ohne Überlei­ tung Abschnitt B an. Abschnitt B ist jener Schubert-Walzer op. 9/33, den Liszt bereits in der dritten der Apparitions von 183443bearbeitet hat. Das, was nun in der IV. Soiree in A-Dur in größtem Kontrast zum Vorangehenden anhebt, scheint mit dem Schubertschen Original (NB 2d) zunächst gar nichts zu tun zu haben: Der Schubertsche Walzer hat sich in eine ruhige, ausgedehnte Akkordfolge transformiert, bei der die Hauptmelodie des Schubertschen Tanzes durch den Daumen der rechten Hand beinahe nur eben angedeutet ist (NB 2e). Schuberts Op. 9/33, im Original in F-Dur, besteht aus zweimal 16 Takten ohne Wiederholungszeichen. In seiner Mittelpartie wendet sich der Walzer in die Mediante As-Dur, um erst ganz zum Schluß nach FDur zurückzukehren. Liszt kappt den Verlauf des Originals um die letzte, die Tonika befestigende Schlußwendung und läßt sein Gebilde in konsequentem Pianissimo zweimal durchlaufen, im zweiten Durchlauf zu einer auch pianistisch weitgespannten Klangfläche geöffnet (NB 2f), einer Variante, die sich wieder deutlicher an das Schubertsche Original hält (Oberstimmenmelodie, ‘W alzer­ begleitung’). Der Abschnitt B müßte damit eigentlich korrekt als b-b’ wiederge­ geben werden. Die Rückkehr zu Abschnitt A ’ erfolgt nicht unmittelbar, obwohl die Vorzeich­ nung Des-Dur sofort eintritt. Es wird zunächst eine chromatische AchtelnotenDurchgangsfigur exponiert, zu der die linke Hand gleichsam versuchsweise, jeweils durch einen Pausentakt getrennt, die vier Taktmotive von Op. 9/29 (Abschnitt A) intoniert. Hier handelt es sich sozusagen um einen im Notentext festgehaltenen improvisatorischen Vorgang, der der Komposition selbst voraus­ geht und ‘eigentlich’ nicht in den Notentext gehört, nämlich wie der Komponist Liszt am Klavier eine neue Variante ausprobiert. Der chromatische Gang paßt offenbar hervorragend zur ohnehin nervösen Grundstimmung von Abschnitt A: Er ist nun auf mannigfache Weise ständiger Begleiter des Durchlaufs von A ’, der am Schluß durch Wiederholung erweitert und bis ins Fortissimo („Agitato assai con 90 © Landesmuseum für Burgenland, Austria, download unter www.biologiezentrum.at Allegretto con lntlmo sentlmento. -m~ 7\ _ r )r p — - | ' ? r col Ped. sempre Notenbeispiel 2 91 Austria, download unter www.biologiezentrum.at somma passione“)© Landesmuseum gesteigertfür Burgenland, wird. An dieser Stelle hat der musikalische Verlauf der IV Soiree seine Spannungsperipetie. Die neuerliche W iederkehr des Abschnitts B, der als b-b” wiedergegeben werden müßte, ist eigentlich schon als Coda zu werten: Liszt beginnt nochmals mit b, das sich dann jedoch unversehens von A-Dur nach Des-Dur, der Grundtonart der Soiree zurückwendet, wo der Schubertsche Walzer nun sozusagen auch seine Maske fallen läßt und nach und nach in Schubertscher Originalfaktur erklingt (b” ). Auch das ist unter Liszts souveränem Zugriff möglich: daß eine ‘Bearbei­ tung’ sich schrittweise zum ‘O riginal’ zurückentwickelt! (Die „Allegretto malinconico“-Einleitung der I. Soiree z.B. wird im Mittelteil dieses Stücks wieder aufgegriffen und entpuppt sich dort als Variante des Walzers op. 33/15, der erst danach in ‘Originalgestalt’ - Melodie in der Oberstimme - erklingt.) Der Schluß der IV. Soiree ist außerordentlich knapp und ganz aus dem ‘Geist des Schubertschen Originals’ geboren, gleichsam ohne Fremdmittel bewerkstelligt: Liszt bricht b ” am Ende der Mediantenpartie (Fes-Dur, als E-Dur notiert) ab und schließt noch einmal die ersten vier Takte von Op. 9/29 (A) an (der verminderte Septakkord des Beginns erweist sich einmal mehr als Brückenharmonie zum Vorangegangenen), die zögernd und unter taktweisen Fermatenpunkten im allerletzten Takt die Tonika Des-Dur herbeiführen. Es ist kaum möglich, auf die delikaten Details gesondert einzugehen, die man in Liszt Soirees de Vienne antrifft. Es sind nur wenige bearbeitende Kunstgriffe, die aus der Zusammenstellung zweier Walzer einen perfekten musikalischen Organismus mit konsequenter Dramaturgie entstehen lassen. Gerade am Beispiel von Schuberts Op. 9/33 tritt Liszts Bearbeitungsart in den Soirees deutlich zutage: Auch in der 3. Apparition erklingt Schuberts Walzer zunächst vollständig (in einer Variante übrigens, die b ’ der IV Soiree ähnelt); umgekehrt tritt auch in der IV Soiree der Schubert-Walzer in äußerlich sehr veränderter Gestalt auf. Doch während er in der 3. Apparition, fragmentiert in seine Einzelteile, von einer grüblerischen Phantasie unter wechselnde Beleuchtung genommen wird, um schließlich selbst ein Teil der zerklüfteten musikalischen Landschaft des jungen Liszt zu werden, stellt die bearbeitende Zurichtung, die ihm in der IV Soiree widerfährt, nur eine musikalische Travestie dar, die den ‘Körper’ des Originals zwar umkleidet, aber sonst nicht antastet. Um nun schließlich zum Kern der Fragestellung zu kommen: Wie steht Liszt zum ‘Österreichischen’ in Schuberts Tänzen? Es ist aus dem Bisherigen hervorgegangen, daß der ästhetische Reiz der Soirees zu einem nicht geringen Ausmaß mit dem Mittel der kontrastierenden Abschattie­ rung zwischen den zusammengestellten Schubert-Tänzen erzielt wird, ein Kon­ trast, der nicht nur auf den Charakterunterschieden der Tänze selbst beruht, sondern durch die verschiedenen Niveaus der Bearbeitung verstärkt wird. Eine sehr eigenartige Wirkung aber ist dann gegeben, wenn einer der Tänze vom alpenländisch-bodenständigen ‘Ländler’-Typus mitten im hochartifiziellen Klavier­ satz ganz unbehauen dasteht wie etwa Schuberts Op. 9/19 in der III. Soiree. Zweifellos liegt in diesem, in manchen Passagen der Soirees mit Absicht provo­ 92 © Landesmuseum fürzwischen Burgenland, Austria, download unter www.biologiezentrum.at zierten Spannungsverhältnis den Niveaus ein Schlüssel zur Beantwor­ tung der Frage nach dem ‘Österreichischen’ Franz Liszt hat diese ästhetische Distanz an einer Stelle der VIII. Soiree sogar offen, wie auf einer Bühne, inszeniert (siehe NB 3). Schuberts Op. 77/2 wird dort in lapidarem Klaviersatz gleichsam als eine imaginäre Musikkapelle („quasi tromba“) eingeführt, die zuerst direkt unter dem Fenster bläst (ff) und sich dann im Verlauf des Stücks allmählich vom Zuhörer entfernt („2da volta dim.“) Erst danach, mit einer abrupten Rückung in die Mediante B-Dur und im Piano, erfolgt ein kompletter zweiter Durchlauf des Tanzes in konventioneller Klavierfaktur (die jeweiligen ausgeschriebenen Wiederholungen haben sogar weitgehend Schu­ berts Originalgestalt). Die Bruchstelle zwischen den beiden Verlaufs Varianten zeigt einen kompletten Wechsel der musikalischen Bedeutungsebenen an - als ob der Mann am Klavier nun über das reflektiert, was er gerade von der Straße her gehört hat. Wenn man will, kann man in den wenigen Takten das Verhältnis Liszts zur ‘österreichischen Volksmusik’ festgehalten sehen inszeniert im Medium eines Schubertschen Tanzes, der ja selbst eine erste Bearbeitung von ‘Volksmusik’ darstellt. VI. Es ist ein Hauptmerkmal der Soirees de Vienne, daß Liszt beinahe während des gesamten Verlaufs ohne die große, ostentative Virtuosität auskommt - die kleinen Notenwerte, ein Charakteristikum, das einem im Vergleich etwa zu den Melodies hongroises d ’apres Schubert sofort in die Augen springt. (Eine Ausnahme bildet hier die bewußt als Kontrapunkt gesetzte VI. Soiree, deren Kadenzen in der zweiten Fassung noch erweitert wurden.) Liszt setzt zwar die subtilsten pianistischen 93 © Landesmuseum für Burgenland, Austria, download unterTänze www.biologiezentrum.at Techniken ein, um den poetischen Gehalt dieser gleichsam zu sich selber zu bringen, aber er läßt Schubert sozusagen bei sich zu Hause und hält sich innerhalb der Grenzen des Genres; das gilt auch für die „Sehnsuchtswalzer“Variationen der XI. Soiree. Damit wahrt er gleichzeitig den Schauplatz seines Sujets: die Abendgesellschaft in einem Wiener Bürgerhaus mit all ihrer biedermeierlichen Behäbigkeit. Man hat über Liszts Transkriptionen von Schubert-Liedern gesagt, Liszt kom­ poniere da auch seinen eigenen Abstand zum Original hinein44. Das gilt noch viel mehr für die Soirees de Vienne, wo diese Distanz bewußt inszeniert ist und genaugenommen die ästhetische Pointe des Ganzen ausmacht. Durch die Lichtund Schatten Wirkung seiner Bearbeitungstechnik inszeniert Liszt nicht nur das an Schubert, was er schon im Brief an Lambert Massart dessen Naivität und Ur­ sprünglichkeit genannt hatte (man möchte hinzufügen: Unverwechselbarkeit), sondern er gibt vom Salon aus auch den Blick auf die Ländler frei - alles natürlich durch das Medium Schubert hindurch, der hier als Unschärferelation nicht weg­ gerechnet werden kann. Wenn irgendetwas, so könnte man die so sorgsam in ihrer Unbehauenheit hervorgehobenen Ländler aus heutiger naiver Perspektive als‘Österreichische Nationalmelodien’ ansehen, und man könnte sich vorstellen, wie eine entsprechende Komposition Liszts über solche ausgesehen haben mag. Doch gerade in diesem Punkt springt der entscheidende Unterschied ins Auge: In der 3. Apparition mag der Schubert-Walzer, vier Jahre vor dem Reisebrief an Lambert Massart, als musikalische Chiffre von Ursprungssehnsucht fungiert haben, und man hat diese Komposition zweifellos dem geistigen Milieu des „W anderer-Voyageurs“ zuzuordnen; bei den Soirees de Vienne jedoch geht es nicht um musikalische Verwurzelungstaktiken und -rituale, noch um den großen nationalen Aufbruch, als dessen Medium jede Art ‘Volksgut’ stets gedient hat. In den Soirees hält Liszt den Schubertschen Originalstücken gegenüber denselben ästhetischen Abstand wie der gebrauchsmusikalischen Sphäre, der sie ihrerseits entstammen. Die Soirees de Vienne sind ganz Abkömmlinge der Salon-Sphäre, für die sie auch geschrieben sind. Wenn in Ihnen die ästhetische Distanz zum ‘Originalmaterial’ zum Tragen kommt, dann in Form subtiler kompositorischer Ironie. Und es mag sein, daß dieser sozusagen ‘M ahlersche’ Zug ein unverfälschteres Abbild des ‘Österreichischen’ ist, als es ein patriotisches Be­ kenntnis je sein könnte. Anmerkungen: 1 R 252/ S 427 (V gl. Peter Raabe, Verzeichnis a ller Werke L iszts nach Gruppen geordnet, in: Peter Raabe, Franz Liszt, Bd. 2, L iszts Schaffen, 2. erg. A uflage, hrsg. von Felix Raabe, Tutzing 1968, S. 241-364, hier: S. 285 f.; Humphrey Searle, Franz Liszt, in: The New Grove. The C om poser B iography Series, E arly Rom antic M asters I, London 1985, Werk­ verzeichnis S. 322-368). 2 Vgl. Lina Ramann, Franz Liszt. Als K ünstler und Mensch, Bd. 2, 2. Abt., Leipzig 1894, S. 506. 3 Soirees de Vienne. V alses-C aprices d ’apres F. Schubert en neuf livraisons. Vienne: C.A. Spina, Verl.-Nrn. C.S. 9300-9308. 94 © Landesmuseum Austria, download unter bzw. www.biologiezentrum.at 4 R 236/ S 424 bzw. R 220/ für S Burgenland, 411, erschienen 1838 1839; auch Liszts DonizettiLiedbearbeitungen aus den N uits d ’ete ä P au silippe (R 153/ S 399, erschienen 1839) sind im Untertitel gleichsam in Fortsetzung der sechs Mercadante-Übertragungen als Soirees italiennes No. 7-9 bezeichnet. 5 Vgl. B rief Liszts an Carolyne von Sayn-W ittgenstein vom 3. Mai 1851, in: Franz Liszts Briefe, hrsg. von La Mara, Bd. 4, Leipzig 1900, S. 105. 6 Verl.-Nr. C 22720; die Neufassung betrifft - neben kleineren Details - vor allem die VI. Soiree, die Liszt an mehreren Stellen u.a. durch Hinzufügungen von Kadenzen erweiterte. D iese wiederum fußen auf Varianten, die Liszt 1869 für seine Schülerin Sophie Menter anfertigte (Manuskript in der Library o f Congress, Sign. M L96.L58, siehe The M usic M anuscripts, F irst Editions, and C orrespondence o f Franz L iszt in the C ollections o f the M usic D ivision, Library o f Congress, W ashington 1991, S. 17); D ie Soirees de Vienne sind (mit separatem Abdruck der zw ei Fassungen der VI. S oiree) im Neudruck in Liszt. K lavierw erke, hrsg. v. Emil Sauer, Band X, Bearbeitungen (Edition Peters Nr. 3602b), im Neudruck zugänglich. 7 B rief Liszts an Pauline Metternich vom 12. Dezember 1875; in: Franz L iszts Briefe, Bd. 8, Leipzig 1905, S. 303. 8 Hier sei exemplarisch auf die grundlegende Studie Harald Kaufmanns verwiesen: Versuch über das Ö sterreichische in der Musik, in: ders., Fingerübungen. M usikgesellschaft und W ertungsforschung, W ien 1970, S. 24-43. 9 L ettre d ’un bachelier es musique. A.M. Lam bert M assart [Revue et G azette m usicale de P aris, 2. September 1838, S. 345-352], im folgenden zitiert nach: Franz Liszt. P ages rom antiques, hrsg. v. Jean Chantavoine, Paris 1912 (Reprint hrsg. v. Serge Gut, Plan de la Tour 1985), S. 207-240; deutsch in: G esam m elte Schriften von Franz L iszt, hrsg. v. Lina Ramann, Bd. 2, Leipzig 1881, S. 202-228. 10 P ages rom antiques (siehe Anm. 9), S. 219 ff. Liszt bezieht sich hier offensichtlich auf eine große Soiree, die am 21. Februar 1838 im Mailänder Palais (via Borgonuovo Nr. 20) der Gräfin zu Ehren der italienischen Sängerin Giuditta Pasta veranstaltet wurde (C orriere delle dam eN r. 11 v. 2 5 .2 .1 8 3 8; für die Information sei Herrn Luciano Chiappari gedankt.) Julia Pahlen-Sam oyloff (1803-1875) ist Widmungsträgerin der Ricordi-Ausgabe von Liszts Soirees m usicales. 11 Ebd., S. 228. 12 Franz Schubert, D er W anderer („Ich komme vom Gebirge her“), Text von Georg Philipp Schmidt („von Lübeck“), D 489, komponiert 1816, 3. Fassung veröffentlicht 1821. Liszts Klaviertranskription von Schuberts W anderer (Nr. 11 der 12 Lieder, 1835-1837, R 243/ S 558) erschien im selben Jahr 1838. 13 „[...] j ’aper9us dans sa main un instrument d’une forme bizarre, dont le metal poli brillait comme une miroir ardent aux derniers rayons du soleil. Le vent [...] m ’apporta les accents de la lyre m ysterieuse [...]“; P ages rom antiques, S. 226. 14 Vgl. z.B. Liszts Charakterisierung des Künstlers am Beginn seiner Artikelserie De la Situation des artistes et de leur condition dans la societe in der G azette m usicale 1835, P ages rom antiques, S. 4 f. 15 „[...] es-tu le pelerin plein d’espoir qui marche avec ardeur vers un sejour de paix et de benediction?“, ebd., S. 225. 16 Lambert Massart (1811-1892) war Violinprofessor am Pariser Conservatoire. 17 Liszt, ebd., S. 222. 95 Landesmuseum für Burgenland, Austria, download unter www.biologiezentrum.at 18 V gl. Reingard W©itzmann, Wiener W alzer und W iener Ballkultur. Von d er Tanzextase zum W alzertraum, in: Bürgersinn und Auft>egehren. B iederm eier und Vormärz in Wien 18151848, A usstellungskatalog des Historischen M useums der Stadt W ien, W ien 1987, S. 130 ff. 19 Vgl. dazu Carl Dahlhaus, Die M usikgeschichte Ö sterreichs und die Idee der deutschen Musik, in: D eutschland und Ö sterreich. Ein bilaterales G eschichtsbuch, hrsg. v. Robert A. Kann und Friedrich E. Prinz, W ien - München 1980, S. 322-349. Es ist bezeichnend, daß die Idee des „Österreichischen“ als kulturgeschichtlicher Mythos erst rückblickend mit dem Zusammenbruch des Habsburgerreiches ‘entdeckt’ wurde. Ebenso setzt in der österreichischen Musikliteratur und -publizistik die Entdeckung des „Österreichischen in der M usik“ bzw. der „österreichischen M usik“ als Teil einer kulturel­ len Identitätssuche der Ersten Republik erst 1918 ein; vgl. Rudolf Flotzinger, Musik als Medium und Argument, in: Aufbruch und Untergang. Ö sterreichische K ultur zwischen 1918 und 1938, hrsg. v. Franz Kadrnoska, W ien u.a. 1981, S. 380 f.; vgl. zu diesem Kom plex auch die A ufsätze des M illenium sheftes der Ö sterreichischen M usikzeitschrift, H. 2-3/1996. 20 Pages rom antiques (siehe Anm. 9), S. 234. 21 Vgl. Liszts R eisebrief A A dolphe P ictet [Revue et G azette m usicale, 11. Februar 1838], ebd., S. 140 f. 22 Anton D iabellis V aterländischer Künstlerverein. Zweite Abteilung (1824), hrsg. v. Günter Brosche (= Denkm äler d er Tonkunst in Ö sterreich 136), Graz 1983, S. 21; in der V oranzeige ist von jenen Tonkünstlern die Rede, „die gegenwärtig auf Österreichs classischem Boden blühen“, ebd., S. VII. 23 „[...] Auch Liszt taucht wieder auf, der Franz, / Er lebt, er liegt nicht blutgerötet / A uf einem Schlachtfeld Ungarlands; / Kein Russe, noch Kroat hat ihn getötet. // Es fiel der Freiheit letzte Schanz’; / Und Ungarn blutet sich zu Tode - / Doch unversehrt blieb Ritter Franz, / Sein Säbel auch - er liegt in der Kom m ode.“, Heinrich Heine, Im O ktober 1849, in: ders., Säm tliche Schriften, hrsg. v. Klaus Briegleb, München 1976, Bd. 6/1, S. 116-118. 24 Vgl. dazu den Beitrag von Bettina B erlinghoff in diesem Band, S. 46. 25 Exemplarisch Kalkbrenners Opus 185 aus dem Jahr 1848: Les n ationalites musicales. Six Esquisses, Leipzig: B reitkop f & Härtel, Verl.-Nr.: 7902 („L’Ecosse, laR ussie, l ’Angleterre, l ’A llem agne et l ’Irlande“); vgl. dazu Hans Nautsch, Friedrich Kalkbrenner. Wirkung und W erk(= H am burger B eiträge zur M usikw issenschaft 25), Hamburg 1983, W erkverzeichnis S. 211-241. 26 R 98/ S 235. 27 R 89/ S 253. D ie G roße K onzertfantasie über spanische Weisen enthält allerdings neben einer Bezugnahme auf die M elodie des Fandango, den bereits Mozart in Le N ozze die F igaro benutzte, auch die M elodie der Cachucha, mit der die österreichische Tänzerin Fanny Elssler im Ballett Le D iable boiteux, Paris 1837, Begeisterungsstürme hervorrief. 28 Vgl. Peter Raabe (siehe Anm. 1), Bd. 2, S. 260. 29 Vgl. den Beitrag von Bettina B erlinghoff in diesem Band, S. 54 f. 30 Vgl. den Beitrag von Michael Saffle in diesem Band, S. 120 f. 31 Vgl. dazu D etlef Altenburg, L iszts Idee eines ungarischen N ationalepos in Tönen, in: Studia M usicologica 28 (1986), S. 213-223. 32 Vgl. Maria Parkai-Eckhardt, D ie H andschriften des R äköczi-M arsches von Franz L iszt in d er Szechenyi Nationalbibliothek, B udapest, in: Studia M usicologica 17 (1975), S. 350 ff. 33 R 116/ S 385 bzw. 385a. 96 34 R 3 4 / S 2 1 1 . © Landesmuseum für Burgenland, Austria, download unter www.biologiezentrum.at 35 Souvenir de Vienne. Im promptu p o u r le Piano-F orte p a r Clara Wieck, Oeuvre 9, Wien: D iabelli, Verl.-Nr. 6530. Ihr Verlobter Robert Schumann hat bekanntlich in seinen Faschings schwank aus Wien op. 26 das M arseillaise-Thema, eingebaut. Clara W ieck ist im Postskriptum desselben Reisebriefs an Lambert Massart Gegenstand der Würdigung Liszts, der sie 1838 in Wien kennengelernt hat (siehe Pages rom antiques, siehe Anm. 9, S. 237 f. 36 „Österreich hat w ie Rußland kein eigentliches Nationallied, sondern bloß einen kaiserli­ chen Hym nus.“, Eduard Hanslick, W iener Freiheitsm usik [in: Beilage zur Wiener Zeitung v. 3.9.1848], in: Sämtliche Schriften. H istorisch kritische A usgabe, hrsg. v. Dietmar Strauß, Band 1/1, Wien u.a. 1993, S. 178. 37 R 2 5 0 / S 425. 38 Vgl. Jonathan Beilmann, The „ Style H o n g ro is“ in the M usic o f W estern Europe, Boston 1993. 39 Nach Otto Erich Deutsch, Franz Schubert. Thematisches Verzeichnis sein er Werke in chronologischer Folge, Neuausgabe im Rahmen der Neuen Schubert-Ausgabe, Kassel u.a. 1978. 40 Vgl. dazu Sabine Schutte, D er Ländler. Untersuchungen zur m usikalischen Struktur ungeradtaktiger österreich isch er Volkstänze (= C ollection d ’etudes m usicologiques 52), Strasbourg Baden-Baden 1970, S. 27 f., S. 104 ff., sow ie Reingard Witzmann, D er Ländler in Wien. Ein B eitrag zur E ntwicklungsgeschichte des W iener W alzers bis in die Z eit des W iener K ongresses (= Veröffentlichungen d er Kom m ission fü r den Volkskunde­ atlas in Ö sterreich 4), Wien 1976; Eva Campaniu, D ie Tänze d er H aydn-Zeit, in: Joseph Haydn. B ericht über den Internationalen Joseph Haydn K ongress 1982, hrsg. v. Eva Badura-Skoda, München 1986, S. 470-475. 41 Vgl. Walburga Litschauer, Tänze fü r K lavier zu zw ei Händen, in: R eclam s Musikführer Franz Schubert, hrsg. v. Walther Dürr und Arnold Feil, Stuttgart 1991, S. 328-330; sow ie dies., Franz Schuberts Tänze zwischen Im provisation und Werk, in: M usiktheorie 10 (1995), H. l , S. 3-9. 42 Vgl. Reingard Witzmann (siehe Anm. 18) 43 (R 11/ S 155); F antaisie sur une valse de Frangois Schubert. 44 Peter Gülke in einem Festvortrag zum Thema Glanz und Elend d er virtuosen Aneignung: L iszt und Schubert anläßlich der 11. Weimarer Liszt-Tage am 21. Oktober 1993. 45 P ages rom antiques (siehe Anm. 9), S. 239. 97