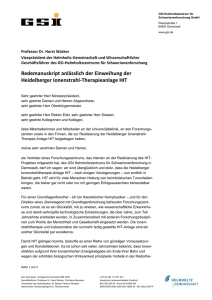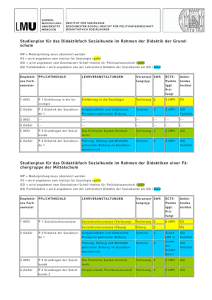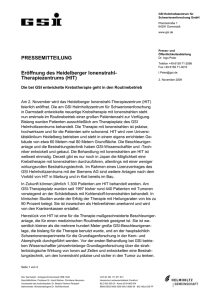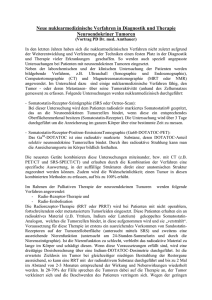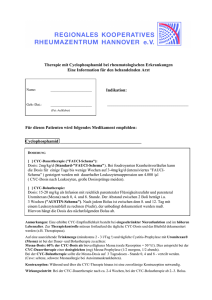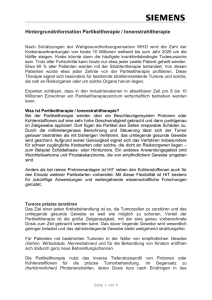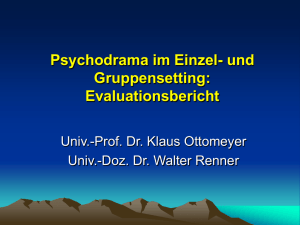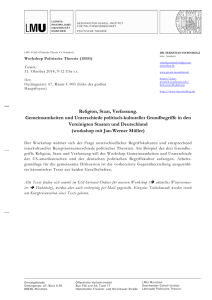G. Kraft, Schwere Geschütze gegen Krebs, Physik - Pro
Werbung

ÜBERBLICK BIOPHYSIK Schwere Geschütze gegen Krebs Der Weg der Schwerionentherapie von den physikalischen Einsichten zur klinischen Anwendung Gerhard Kraft Krebs ist nach Kreislauferkrankungen die häufigste Todesursache. Grund genug, neue Erfolg versprechende Therapien zu entwickeln. Dazu zählt die Schwerionentherapie, insbesondere mit Kohlenstoffionen. Jahrzehntelange Grundlagenforschung, erfolgreiche klinische Tests und das Interesse der Industrie haben nun endlich den Weg dafür geebnet, die Krebstherapie mit schweren Ionen im Klinikalltag zu etablieren. F ast jeder dritte Mensch erkrankt im Laufe seines Lebens an Krebs. Mehr als die Hälfte der jährlich 350 000 neuen Fälle in Deutschland lässt sich leider nicht heilen. Dies betrifft meist Erkrankungen im fortgeschrittenen Stadium, bei denen sich Tochtergeschwülste (Metastasen) gebildet haben [1]. Doch auch ein erheblicher Teil anfangs nicht metastasierter Tumoren − das betrifft ca. 70 000 Patienten pro Jahr − ist nicht erfolgreich zu behandeln. Oft liegt der Tumor zu nahe an lebenswichtigen Organen. Eine radikale chirurgische Entfernung wäre damit zu risikoreich, und eine Hochdosisbestrahlung würde wegen zu großer Nebenwirkungen am gesunden Gewebe scheitern. Mit der Identifizierung von Krebsgenen vor dreißig Jahren glaubten viele Mediziner an eine molekularbiologische Lösung des Krebsproblems. Trotz vieler Fortschritte auf diesem Gebiet haben sich viele der hochgesteckten Hoffnungen leider nicht erfüllt und noch konnte kein Patient auf diese Weise behandelt werden. Derzeit sucht man daher nicht mehr generelle, sondern tumorspezifische Lösungen. Eine vielversprechende Fortsetzung der konventionellen Therapien ist die gezielte Bestrahlung von Tumoren mit geladenen Teilchen, wie Protonen und vor allem den schwereren Kohlenstoffionen. Mit ihnen lassen sich Tumore mit größerer biologischer Effektivität und mit einer Präzision bekämpfen, die auf andere Weise nicht zu erreichen wäre. Der erste medizinische Einsatz der Ionentherapie liegt bereits fünf Jahrzehnte zurück und fand 1954 in Berkeley statt. Weltweit wurden seitdem mehr als 40000 Patienten mit Protonenstrahlen behandelt und 3000 Patienten mit Kohlenstoffionen, die meisten am japanischen National Institute of Radiological Sciences (NIRS) in Chiba. Bei der Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) in Darmstadt gelang es, die physikalischen und strahlenbiologischen Strahleigenschaften mit moder- Für eine hochpräzise Schwerionentherapie von Hirntumoren muss der Kopf des Patienten fixiert werden. Links ist das Ende des Strahlrohrs mit den Monitoreinheiten zu sehen. ner Beschleuniger- und Strahlführungstechnik effektiv zu kombinieren, was bis jetzt mehr als 300 Patienten zugute kam. Während die ersten Ionentherapien noch an alten kernphysikalischen Beschleunigern stattfinden mussten, kommen nun mehr und mehr auf die Therapie zugeschnittene Einheiten in Kliniken zum Einsatz. Von den ersten Vorschlägen, geladene Teilchen zur Tumorbehandlung anzuwenden, bis zur erfolgreichen Therapie war es jedoch ein langer Weg. Erst der amerikanische Physiker Robert Rathbun Wilson erkannte im Jahre 1946 die medizinische Bedeutung der invertierten Tiefendosisverteilung von Ionenstrahlen [2], nachdem er Ionisationsmessungen von Protonen und Kohlenstoffstrahlen am Zyklotron in Berkeley durchgeführt K O M PA K T ■ ■ ■ In der Tumor-Strahlentherapie haben schwere Ionen gegenüber Photonen den Vorteil, dass sie erst am Ende der Teilchenbahn die größte Energiedosis an das Körpergewebe abgeben. Deshalb lassen sich mit schweren Ionen bestimmte Krebsarten präziser bekämpfen, ohne das umgebende gesunde Gewebe zu stark zu schädigen. Langjährige strahlenbiologische und technische Vorarbeiten und ein erfolgreiches Testprojekt mit mehr als 300 Patienten an der GSI in Darmstadt haben die Voraussetzungen geschaffen für erste klinische Schwerionen-Therapieanlagen, wie sie in Heidelberg und Marburg gebaut werden. © 2007 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim 1617-9437/07/0202-29 Physik Journal 6 (2007) Nr. 2 29 Prof. Dr. Gerhard Kraft, TU Darmstadt und Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI), Bereich Biophysik, Planckstraße 1, 64291 Darmstadt ÜBERBLICK hatte. Zu dieser Zeit war es dank der Untersuchungen des Ionisationsverlaufs von Alphateilchen durch William Henry Bragg (1905) längst bekannt, dass die Ionisationsintensität am Ende der Teilchenbahn ein scharfes Maximum, den so genannten Bragg-Peak, besitzt. Wenn Ionenstrahlen einer bestimmten Energie in Körpergewebe eindringen, werden sie vorwiegend durch inelastische Stöße mit den Elektronen der Atomhüllen des „Stoppermaterials“ abgebremst. Dabei geben die Ionen zunächst wenig Energie an das Gewebe ab. Je langsamer sie werden, umso größer wird jedoch die abgegebene Energiedosis, die schließlich am Ende des Weges ein Maximum erreicht. Im Gegensatz dazu fällt die Energie-Deposition für Photonen (Röntgen-, Kobalt-Gamma- oder Elektronen-Bremsstrahlung) nach einem kurzen Anstieg exponentiell ab. Für Photonen ist deshalb bei einer einseitigen Bestrahlung die Dosis vor einem tiefliegenden Tumor höher als im Tumor selbst. Eine höhere letale Tumordosis ist nur mit einer „Vielfeldertechnik“ zu erreichen, bei der die Eingangsdosis über mehrere Felder verteilt wird. Dagegen lässt sich mit Teilchenstrahlen auch bei tiefliegenden Tumoren und einer einzigen Einstrahlrichtung eine höhere Dosis im Zielvolumen deponieren als im davor liegenden Gewebe (Abb. 1). Eine Reaktion der Ärzteschaft auf Wilsons Erkenntnisse blieb damals jedoch aus. Schließlich trieben Cornelius A. Tobias und John Lawrence, der Bruder des Leiters des Lawrence Berkeley National Laboratory (LBL) Ernest Lawrence, die Ionentherapie mit strahlenbiologischen und technischen Experimenten weiter voran. Bis zur ersten Patientenbestrahlung mit Protonen in Berkeley und kurz darauf in Harvard vergin- 5 12C-Ionen 250 MeV/u 4 300 MeV/u relative Dosis 3 2 18-MeVPhotonen 1 60Co-Gamma 120-keVRöntgen 0 0 5 10 Tiefe in Wasser in cm 15 20 Abb. 1 Für Photonen fällt die deponierte Energie-Dosis exponentiell mit der Tiefe im Gewebe ab. Bei Teilchenstrahlen liegt das Dosismaximum dagegen am Ende der Reichweite. Eine hohe Dosis kombiniert mit hoher Wirksamkeit führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Zerstörung der Tumorzellen, während die Schäden im Eingangskanal meist zu reparieren sind. 30 Physik Journal 6 (2007) Nr. 2 gen allerdings fast zehn Jahre. Der Versuch, die erhöhte biologische Wirksamkeit schwerer Ionen auszunutzen, begann noch einmal 15 Jahre später [3]. Bei der GSI habe ich die Tumortherapie mit schwereren Ionen zum ersten Mal 1975 als mögliches Arbeitsgebiet für das damals in Planung befindliche Schwerionen-Synchrotron SIS vorgeschlagen. Vom ersten Projektvorschlag bis zum Abschluss der ersten erfolgreichen klinischen Testreihe galt es, umfangreiche strahlenbiologische und technische Vorarbeiten zu leisten. Hier lag deshalb von 1982 bis 1992 auch der Schwerpunkt der Arbeitsgruppe Biophysik an der GSI, nicht zuletzt, weil bis zur Inbetriebnahme von SIS 1988 kein Beschleuniger mit klinisch relevanten Energien zur Verfügung stand. Daneben gab es aber auch Vorbehalte und Widerstände zu überwinden, denn das Thema Krebs wurde von einigen im Bereich der physikalischen Grundlagenforschung als belastend empfunden. Treffsicher bestrahlen Ziel einer Tumortherapie ist es, alle Tumorzellen zu entfernen. Wenn ein chirurgischer Eingriff nicht möglich ist, dann muss man den Tumor durch Strahlung so schädigen, dass er nicht mehr weiter wächst und sich auflöst. Die Kunst der Kohlenstofftherapie besteht also zunächst darin, das besonders wirksame Ende der Teilchenspur strikt auf das Zielvolumen zu beschränken und gesundes Gewebe auszusparen. In der Anfangszeit der Ionentherapie wurde der Strahl in enger Analogie zur konventionellen Photonentherapie mit passiven Elementen wie Streufolien, Kollimatoren, Absorbern und Reichweitenmodulatoren an den Tumor angepasst [4]. Mit diesen Hilfsmitteln lassen sich zylinderförmige Hochdosisbereiche erzeugen und durch gezielte Absorption so verbiegen, dass kritische Strukturen hinter dem Zielvolumen ausgespart bleiben. Dies geschieht jedoch auf Kosten des gesunden Gewebes vor dem Zielvolumen. Da Tumore meist unregelmäßig und nicht etwa zylinderförmig geformt sind, liegt bei der passiven Strahlformungsmethode etwa ein Drittel des Hochdosisbereichs im Normalgewebe und sorgt dort für Nebeneffekte, welche die maximal mögliche Tumordosis begrenzen. Die an der GSI entwickelte Strahlformung ist dagegen eine aktive Methode: Das Zielvolumen wird in Schichten gleicher Teilchenreichweite zerlegt und jede Schicht mit einem Netz von Rasterpunkten (Pixel) überzogen. Für jedes Pixel lässt sich die Teilchenbelegung berechnen. Anschließend werden die Pixel nacheinander ohne Unterbrechung mit einem feinen „Bleistift“-Strahl bestrahlt, von Pixel zu Pixel von einem schnellen magnetischen Ablenksystem geführt. Dieses Rasterverfahren gestattet es, jede Tiefenschicht in ihren Konturen frei vorzugeben und damit das Zielvolumen insgesamt an das Tumorvolumen anzupassen (Abb. 2). Wie alle konformen Bestrahlungsmethoden ist die Rastermethode empfindlich gegen Bewegungen des Zielvolumens. Die Bestrahlung lässt sich aber mit © 2007 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim ÜBERBLICK Tumor Polschuhe der Dipolmagneten vertikale horizontale Ablenkung Abb. 2 Beim Rasterscan-Verfahren führen zwei schnelle Magneten den feinen „Nadelstrahl“ von einigen Millimetern Durchmesser senkrecht und waagrecht über jede Schicht des Tumors. Durch Variation der Teilchenenergie lassen sich einzelne Schichten zu einem ausgedehnten Zielvolumen hintereinander setzen [7]. letzte Schicht, niedrigste Energie erste Schicht, höchste Energie dem Atemzyklus synchronisieren, sodass z. B. nur in der Phase nach dem Ausatmen bestrahlt wird. Mit dieser „Gating“-Anpassung ist eine hohe Konformität möglich, aber die Bestrahlungszeit verlängert sich erheblich. Eine alternative, ebenfalls an der GSI entwickelte Methode erlaubt es aber, den Strahl zeitgleich der Bewegung nachzuführen. Dabei wird der Strahl mit dem Rastersystem lateral und mit einer schnellen, passiven Energievariation in der Tiefe der Atembewegung angepasst. Diese schnelle Korrektur erlaubt eine hohe Präzision bei der Bestrahlung, sie wurde bis jetzt aber nur an Phantomen durchgeführt. In einigen Jahren sollte sie jedoch klinisch einsatzfähig sein und dann eine präzise Bestrahlung für alle Tumore, auch im Brust- und Bauchraum, ermöglichen. biologisches Optimum (Abb. 3) [6]. Das Dosismaximum liegt im Bereich der höchsten relativen biologischen Wirksamkeit. Die RBW ist das Ergebnis eines Wechselspiels von lokaler Dosis im Mikrometerbereich und biologischer Reparaturkapazität. Die lokale Dosis in den einzelnen Teilchenspuren hängt von der Ordnungszahl des Projektils und dessen Energie ab. Entscheidend ist die biologische Reparaturkapazität des Gewebes: Langsam wachsende Gewebe haben viel Zeit zur Reparatur und sind deshalb besonders strahlenresistent; schnell wachsende Gewebe sind dagegen meist strahlenempfindlicher. Reparaturfähigkeit und Strahlenresistenz als Grundlage der RBW lassen sich bis heute nicht durch molekulare Theorien vorhersagen. Aber es ist mög- Gewünschte Strahlenschäden 6 3 Dosis in Gy 4 2 2 1 Abb. 3 Ein tumorähnliches Volumen wurde mit verschiedenen Dosen (a) so bestrahlt, dass sich eine homogene Zellabtötung im Tumorbereich (ab 6 cm Tiefe) erzielen lässt (b). Aus dem gemessenen Zellüberleben wurde die relative biologische Wirksamkeit (RBW) bestimmt (c). Die Ergebnisse zeigen, dass die RBW, also die biologische Wirksamkeit im Vergleich zu Röntgenstrahlung gleicher Dosis, generell mit der Tiefe ansteigt und für kleine Kohlenstoffdosen am größten ist. Wahrscheinlichkeit für Zellüberleben 0 1 1 b 2 3 0,1 4 0,01 3 1 c 2 3 RBW Da in jeder individuellen Teilchenspur die lokale Ionisationsdichte zum Ende hin ansteigt, nimmt auch die so genannte relative biologische Wirksamkeit (RBW, siehe Infokasten „Strahlenqualität …“) zu: Bei dünn ionisierenden Strahlen wie Photonen- oder hochenergetischen Protonen entstehen meist vereinzelte Ionisationen in dem wichtigsten Molekül der Zelle, der DNA. Diese Schäden manifestieren sich in Einzelstrangbrüchen oder bei zunehmender Dosis in wenigen komplexen Doppelstrangbrüchen. Die komplexen Schäden sind für die Zelle häufig irreparabel. Dicht ionisierende Strahlung deponiert die Dosis in einer begrenzten Teilchenspur. Kohlenstoffionen können am Ende ihrer Teilchenspur ein DNA-Molekül mehrfach lokal ionisieren, sodass auch bei niedrigen makroskopischen Dosen gehäufte DNA-Schäden entstehen, welche die Reparaturfähigkeit der Zelle übersteigen und diese deshalb inaktivieren [5]. Dies zeichnet Kohlenstoffionen vor anderen Ionen aus: Bei Protonen liegt das Maximum der biologischen Wirksamkeit auf dem abfallenden Ende des Bragg-Maximums, und eine Steigerung der RBW spielt klinisch kaum eine Rolle. Bei Ionen, die schwerer als Kohlenstoff sind, wie z. B. Neon, liegt die größte biologische Wirksamkeit vor dem Dosismaximum. Das bewirkt zu viele irreparable Schäden im gesunden Gewebe vor dem Tumor, während im Tumor Sättigungseffekte (Overkill) die Wirkung reduzieren. Der Kohlenstoffstrahl bietet in der Tiefen-Verteilung der biologischen Wirksamkeit ein strahlen- 4 a 4 2 1 0 2 4 6 Tiefe in Wasser in cm © 2007 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim 8 10 Physik Journal 6 (2007) Nr. 2 31 ÜBERBLICK lich, auf Grund der mit Röntgenstrahlen gemessenen Reparaturkapazität die Wirkung von Ionenstrahlen zu berechnen. Vor dem Beginn der Therapie war von der Abteilung Biophysik an der GSI in vielen Experimentserien die Abhängigkeit der biologischen Wirksamkeit von physikalischen und biologischen Parametern über einen extremen Energie- und Teilchenbereich untersucht und anschließend modelliert worden: Im „Local-Effect Model“ (LEM) lässt sich die Wirkung von Ionenstrahlen berechnen, indem man das biologische Ziel, den Zellkern, der inhomogenen Dosisverteilung von Teilchenspuren aussetzt. Aus den gemessenen Dosiseffektkurven dünn-ionisierender Strahlung für das Zellüberleben ergibt sich die Wirkung für die unterschiedlichen Dosisanteile in den Teilchenspuren zunächst stückweise und lässt sich dann aus den Teilergebnissen zusammensetzen [8]. Basisdaten für die Rechnung sind auf der biologischen Seite die Größe der Zellkerne und die Reparaturkapazität gegenüber Röntgenstrahlen, wie sie sich in der Krümmung der Dosiseffektkurven ausdrückt. Auf der physikalischen Seite bestimmt die radiale Dosisverteilung in der Spur die biologische Effizienz. Sie hängt von den Teilchenenergie und der Ordnungszahl ab. Dem LEM-Formalismus, wie er von Michael Scholz entwickelt wurde, liegt die Faltung einer nichtlinearen Ansprechfunktion über eine inhomogene Dosisverteilung zugrunde. Dieser Formalismus gilt allgemein und kann auch erfolgreich die Bestrahlung nichtbiologischer Systeme wie Röntgenfilme und andere Festkörperdetektoren beschreiben. In der Bestrahlungsplanung der GSI wird die biologische Wirksamkeit RBW punktweise mit LEM auf der Basis S T R A H L E N Q UA L I TÄT U N D R E L AT I V E B I O L O G I S C H E W I R K S A M K E I T Strahlen können bei gleicher Dosis je nach Qualität unterschiedliche biologische Wirkung zeigen. Man unterscheidet zwischen dünn ionisierender Strahlung wie Elektronen, Gammaund Röntgenstrahlen und dicht ionisierender Strahlung wie Neutronen, Alphateilchen und niederenergetischen schweren Ionen. Die gleiche Dosis von verschiedenen dünn ionisierenden Strahlen produziert den gleichen biologischen Effekt. Für schwere Ionen gilt diese Regel nicht. Hier können bei gleicher Dosis – abhängig von Energie und Ordnungszahl der Ionen – verschiedene biologische Effekte auftreten. Ionen produzieren längs ihrer Bahn eine Spur von Elektronen und Ionisation von sehr hoher lokaler Energiedosis bis zu einigen Tausend Gray (Gy, 1 Gray entspricht 1 Joule pro Kilogramm). Der Schaden in einer solchen Spur ist dann kaum noch reparabel und die biologische Wirkung korreliert nicht mehr mit der makroskopischen Dosis, sondern hängt auch 32 von der „Qualität“ der Strahlung ab. Um diese Unterschiede zu berücksichtigen, wurde die Relative Biologische Wirksamkeit (RBW) eingeführt. Die RBW ist zunächst ein empirischer Faktor und berechnet sich aus gemessenen Daten als das Verhältnis aus Röntgendosis und Ionendosis, die jeweils nötig sind, um denselben biologischen Effekt zu produzieren. Die Biologisch Effektive Dosis (BED) wird von den Schwerionenzentren in Gray equivalent (Gye) angegeben, obwohl dafür noch keine DIN-Norm existiert. BED = RBW × Dosis Für die Therapie wurde bei der GSI eine semi-empirische Methode entwickelt, um die RBW auf Grund der Strahlenempfindlichkeit gegenüber Photonen zu berechnen: Im LocalEffect-Model (LEM) wird die inhomogene Dosisverteilung mit der meist nichtlinearen Dosiseffekt-Kurve gefaltet, um den Teilcheneffekt und damit die RBW zu berechnen [8]. Physik Journal 6 (2007) Nr. 2 der Wirkungsdaten derselben Tumorart in der konventionellen Photonentherapie berechnet. Die Qualität dieser Berechung bestätigt sich in dem Ausbleiben von Gewebevergiftungen (Nekrosen) bei möglichen Überdosierungen und von wieder aufwachsenden Tumoren (Rezidiven) bei Unterdosierungen. Das Pilotprojekt der GSI Von der Heidelberger Radiologie gab es seit Mitte der 80er-Jahre großes Interesse, am Schwerionen-Synchrotron SIS von Anfang an eine Tumortherapie aufzubauen. Ein hierzu 1987 eingereichter Vorschlag wurde 1988 vom BMBF nicht akzeptiert unter Verweis auf den European Light Ion Medical Accelerator (EULIMA). Diese europäische Initiative hatte sich zum Ziel gesetzt, ein supraleitendes Zyklotron zu entwickeln, das auf kleiner Fläche einen Kohlenstoff- und einen ProtonenStrahl für die Therapie produzieren sollte. Projektierter EULIMA-Standort war das Zentrum Lacasagne in Nizza. Das Projekt scheiterte aus lokalpolitischen Gründen. Die Gerüchte, dass das Projekt von einer lokalen Mafia als Geldwaschanlage benutzt worden war, konnten nie restlos ausgeräumt werden. Deshalb hinterließ EULIMA in Brüssel ein sehr schlechtes Image, das ähnliche Anträge für die nächsten zehn Jahre blockierte. Für unsere Gruppe aber brachte EULIMA das erste Geld für einen Doktoranden und einen Ingenieur, mit denen der Rastercan-Prototyp in Betrieb genommen werden konnte. Erst im Mai 1993 fiel der Beschluss, eine experimentelle Therapieeinheit an der GSI zu bauen. Am 31. Dezember 1997 konnten die ersten Patienten bestrahlt werden. Grundlegende Voraussetzung dafür, die neue Strahlentherapie zu konzipieren, war die wissenschaftliche und technische Expertise an der GSI in den unterschiedlichsten Bereichen: Strahlenbiologie, Kern- und Atomphysik, Elektronik und natürlich Detektor- und Beschleunigertechnik. Damit gelang es, die nötigen Einrichtungen am Beschleuniger und den Bestrahlungsraum zu bauen und eine biologischbasierte Planung zu entwickeln. Dies entspricht dem klassischen Weg des Wissenstransfers aus der Forschung zur Anwendung. Es gab aber auch die umgekehrte Richtung: Von der Anwendungsseite aus ergaben sich präzise Fragen an die Grundlagenforschung. Fast alle für die Therapie wichtigen kern- und atomphysikalischen Wirkungsquerschnitte waren nicht mit der nötigen Präzision von ca. 1 % bekannt. Es war ein außerordentlicher Glücksfall, dass es an der GSI Experimentiergruppen gab – z. B. am Fragment-Separator oder in der Atomphysik –, die bereit waren, diese Probleme in Zusammenarbeit mit der Biophysik befriedigend zu lösen. Dagegen sind hier Monte-Carlo-Programme, die „alles mit äußerster Präzision berechnen können“, wenig hilfreich. Diese Rechenprogramme sind meist sehr aufwändig und kaum experimentell im Prozentbereich validiert. Für die Therapie sollten die verwendeten Programme und © 2007 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim ÜBERBLICK Daten eine Präzision und einen Realitätsbezug haben, die den Physiker auch dann noch ruhig lassen, wenn seine eigenen Kinder betroffen wären. Die Planung sollte auch eine CPU-Zeit benötigen, die mit Krankenkassenbudgets verträglich ist. Für die Therapieplanung ist bis jetzt die Interpolation von gemessenen Daten der einzig praktikable Weg, präzise physikalische Grundlagen in vertretbarer Zeit zu erhalten. Außerdem ist es wichtig, die physikalischen Parameter der Bestrahlungsplanung experimentell im Submillimeterbereich zu validieren, z. B. durch dosimetrische Präzisionsmessungen in „Wasserphantomen“ und mit anderen Detektoren. Extrem wichtig für einen schnellen Start und die Anwendung unkonventioneller Methoden war die in Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum Rossendorf durchgeführte Qualitätskontrolle mit Hilfe der Positronen-Emissions-Tomographie (PET), mit der sich der Teilchenstrahl während der Behandlung im Patienten verfolgen lässt: Hochenergetische Kohlenstoffionen erzeugen in der Wechselwirkung mit dem Gewebe des Patienten Positronenemitter (z. B. C) mit fast gleicher Reichweite wie der primäre C-Strahl [9]. Der C-Zerfall lässt sich über die Vernichtungsquanten der Positronen mit einer PET-Kamera nachweisen, woraus sich die Reichweitenverteilung des Kohlenstoffstrahls im Patienten ergibt. Die PET-Aufnahmen belasten den Patienten nicht zusätzlich, ermöglichen aber, die Strahlreichweiten im Patienten mit einer Genauigkeit von ca. 2 mm zu messen. PET-Messungen sind daher zunächst eine hervorragende Kontrolle der Dosisapplikation. Darüber hinaus lassen sich damit auch Gewebeveränderungen während der Therapie erkennen und in die Planung miteinbeziehen. Das 1997 gestartete GSI-Pilotprojekt hatte ganz klare Zielsetzungen und Rahmenbedingungen: Mit den modernsten technischen Methoden der Beschleunigertechnik, der Strahlapplikation und -kontrolle sowie einer biologisch basierten Bestrahlungsplanung sollte eine Schwerionentherapie aufgebaut und fünf Jahre betrieben werden. In dieser Zeit stellte die GSI 20 % ihrer Strahlzeit für die Therapie zur Verfügung. Sollten die Ergebnisse zu einem klinischen Anschlussprojekt führen, würde das Pilotprojekt bis zum Patientenbetrieb der neuen Anlage fortgeführt. Wären die Ergebnisse zu schlecht für ein Nachfolgeprojekt gewesen, dann hätte die GSI das Pilotprojekt nach fünf Jahren beendet. ist zurzeit noch nicht möglich. Hierfür muss erst die Bewegungskorrektur verwirklicht sein. Für die ersten Bestrahlungen mit Kohlenstoff kamen vor allem strahlenresistente, langsam wachsende Tumore wie Chordome oder Chondrosarkome in Frage [10]. Diese Tumoren sind meist gut abgegrenzt gegenüber dem Normalgewebe und außerdem recht selten, sodass es möglich war, alle in Deutschland auftretenden schwierigen Fälle trotz der geringen Kapazität bei der GSI zu behandeln. Da die GSI für die Tumortherapie nur dreimal pro Jahr für ca. 15 Patienten einen Strahl zur Verfügung stellt, müssen die Patienten allerdings häufig warten. Dies ist bei einem langsam wachsenden Tumor jedoch weniger problematisch. Weiter ist für diese Tumoren der Zuwachs an klinischer Effektivität auf Grund der hohen RBWWerte des Kohlenstoffs besonders günstig. In der konventionellen Standardtherapie werden die Patienten in 6 Wochen an 30 Tagen mit jeweils 2 Gy – also insgesamt 60 Gy – bestrahlt. Schwerionenbestrahlung erlaubt eine verkürzte Bestrahlungszeit. Bei der GSI werden Patienten mit jeweils 3 Gye an 20 Tagen in 3 Wochen ausschließlich mit Kohlenstoffionen bestrahlt. Daneben gibt es gemischte Bestrahlungen (sog. Boost-Bestrahlungen), bei denen sechs Fraktionen Kohlenstoffionen mit je 3 Gye den eigentlichen Tumor treffen [10].1) Die übrige Dosis mit Photonen wird in einem breiten Saum auch auf das Nachbargewebe appliziert, um dort verstreute Tumorzellen zu erreichen. Diese Bestrahlungsstrategie wurde z. B. bei bösartigen Speicheldrüsenkarzinomen angewendet. Nach fünf Jahren Beobachtungszeit sind die Tumorkontrollraten 50 % höher und zeigen den Erfolg der Boost-Strategie für diese Tumorart (Abb. 5). Die lokale Tumorkontrollrate beinhaltet, dass ein Tumor erfolgreich am weiteren Wachstum gehindert werden konnte. Das schließt jedoch nicht aus, dass an anderen Stellen im Körper neue Tumore entstehen oder beim Patienten andere medizinische Probleme auftreten. 1) Zu den Einheiten vgl. Infokasten „Strahlenqualität und Relative Biologische Wirksamkeit“. Hoffnungsvolle klinische Ergebnisse Zunächst wurden an der GSI nur Patienten mit Tumoren im Kopf (Abb. 4) bestrahlt, weil mit einer äußeren Fixierung des Kopfes der Tumor und das NormalGewebe ebenfalls örtlich fixiert sind. Später wurden die Bestrahlungen auf Tumoren längs der Wirbelsäule ausgedehnt, 2006 auch auf Prostata-Karzinome. Der Beckenbereich lässt sich ebenfalls durch äußere Masken hinreichend fixieren. Eine Präzisionsbestrahlung von bewegten Tumoren im Brust- und Bauchbereich Abb. 4 Dreidimensionale Bestrahlungsplanung eines Tumors im Kopf. Mit Kohlenstoffstrahlen kann die Dosis exakt auf © 2007 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim den Tumor konzentriert werden. Das gesunde Gewebe bleibt weitgehend ausgespart. Physik Journal 6 (2007) Nr. 2 33 ÜBERBLICK Tumorkontrollraten im Vergleich Behandlungsergebnisse mit Indikation Kriterium Photonen Ionen (NIRS) (fortgeschrittene) NasopharynxKarzinome 5y-S 45 − 50 % 63 % Chordome LCR 30 − 50 % 65 % 74 % Chondrosarcome LCR 33 % 88 % 87 % Glioblastome AST 12 Monate 16 Monate AderhautMelanome 5y-S 95 % 96 %, Erhalt des Augenlichts Nasennebenhöhlentumoren LCR 21 % 63 % Bauchspeicheldrüsen-Karzinome AST 6,5 Monate 7,8 Monate Lebertumoren 5y-S 23 % 100 % Speicheldrüsentumo ren LCR 24 − 28 % 61 % WeichteilKarzinome 5y-S 31 − 75 % 52 − 83 % AST: Mittlere Überlebenszeit der Patienten 34 Ionen (GSI) 67 % 5y-S: 5-Jahres-Überleben des Patienten LCR: Lokale Tumorkontrollrate Physik Journal 6 (2007) Nr. 2 100 90 80 Wahrscheinlichkeit in % Auch für die reinen Kohlenstoffbestrahlungen finden sich sehr gute Tumorkontrollraten. Sie sind zusammen mit Ergebnissen aus dem japanischen NIRS in der Tabelle zusammengestellt und mit den Resultaten der Photonentherapie verglichen. Sowohl GSI als auch NIRS verwenden akzelerierte Bestrahlungsschemata, in Japan zum Teil mit noch kürzeren Fraktionierungen. Am NIRS wurden Lungenkarzinome in ein oder drei Fraktionen mit großem Erfolg behandelt. GSI und NIRS unterscheiden sich durch die aktive und passive Strahlformungsmethode. Mit beiden Strahlformungssystemen lässt sich bei gleicher Dosis die gleiche Tumorkontrollrate erzielen. Dies zeigt auch die Übereinstimmung der NIRS- und GSI-Ergebnisse. Die bessere Strahlkonformität beim aktiven System der GSI führt aber zu deutlich weniger Nebenwirkungen. Ein wichtiges Kriterium, um die Qualität einer Strahlentherapie zu beurteilen, sind die Nebenwirkungen in Normalgewebe. Auch die Neutronentherapie früherer Jahre zeigte hervorragende Tumorkontrollraten, allerdings bei nicht tolerablen Nebenwirkungen. Die Kohlenstofftherapie der GSI ergibt eine viel geringe Dosisbelastung des Normalgewebes. In vielen Fällen wurden keine oder nur geringe Nebenwirkungen beobachtet wie Hautrötungen oder Haarausfall, die meist nicht behandelt werden mussten. Nur in den Fällen, in denen auch Schleimhaut im Hochdosisbereich lag, gab es stärkere Nebenwirkungen. Zudem hängen Spätfolgen, wie z. B. die Induktion von sekundären Tumoren, weniger von der Dosis als vom Volumen des bestrahlten Normalgewebes ab. Die Schwerionentherapie hat von allen Tumortherapien die höchste Konformität und damit den kleinsten Dosis-Anteil im Normalgewebe. Generell zeigt die bisherige Erfahrung, dass neben der gesteigerten Heilungsrate vor allem die verringerten Nebenwirkungen und Spätfolgen ein wichtiger Erfolg sind. Eine bessere Lebensqualität bei gleicher Heilungsrate ist ein weiterer deutlicher Vorteil für eine Kohlenstoff- 70 60 50 40 30 20 10 0 0 12 24 36 48 60 Zeit in Monaten 72 84 96 108 Abb. 5 Lokale Tumorkontrollrate von Patienten mit einem fortgeschrittenen bösartigen Speicheldrüsenkarzinom. Die obere Kurve zeigt das Ergebnis von 29 Patienten, die mit Photonen und mit Kohlenstoffionen bestrahlt wurden. Die untere Kurve zeigt die Resultate von 34 Patienten, die nur mit IMRT – Intensitätsmodulierter Radiotherapie, der besten konventionellen Therapie mit hoch energetischen Photonen – bestrahlt wurden. Therapie gegenüber einer konventionellen Therapie. Von Anfang an plante und verwirklichte die GSI die Tumortherapie in Abstimmung mit der Strahlentherapie der Heidelberger Universitätsklinik. Die Heidelberger Uniklinik hat mit ca. 3000 Patienten pro Jahr große Erfahrung in konventioneller Therapie und entwickelt mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) auch andere innovative Therapieformen. Auf Grund ihrer experimentellen Erfahrung ist sie jetzt der Standort für die erste Ionentherapie in Europa. Eine ganz hervorragende Zusammenarbeit entwickelte sich auch mit dem Forschungszentrum Rossendorf, zunächst über die schwierige innerdeutsche Grenze hinweg. Von der Grundlagenforschung zum Produkt Für eine allgemeine Verbreitung neuer medizinischer Großtechnik über die experimentelle Phase hinaus ist es entscheidend, einen Industriepartner zu gewinnen, der die Serienproduktion und die Vermarktung übernimmt. Für eine weltweite Vermarktung kommen bei einem Projekt mit einem Finanzvolumen zwischen 100 und 200 Millionen Euro nur Firmen in Frage, die ein internationales Vertriebsnetz besitzen und den Übergang zum Industrieprodukt finanzieren konnten, wie z. B. General Electric (USA), Mitsubishi (Japan) oder Siemens in Deutschland. Versuche, die Firma Siemens direkt zu gewinnen, scheiterten, nachdem sie den Geschäftszweig Beschleuniger verlassen hatte. Eine Wende ergab sich durch das Interesse der Rhön-Klinikum-AG (RKA). Eine industrielle Machbarkeitsstudie der RKA, zusammen mit Siemens durch die Firma ACCEL2), zeigte 2001/2002, dass sich die Kosten bei der industriellen Fertigung von mehreren Therapieeinheiten deutlich senken lassen sollten. Das RKA entschloss sich daraufhin 2003, eine solche Anlage zu bauen, und Siemens Medical Solutions nahm die Partikeltherapie in ihr Portfolio auf und bot eine Kom- © 2007 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim ÜBERBLICK Internationale Situation und Zukunft Im europäischen Ausland bewirkte die 1995 ins Leben gerufene Initiative PIMMS (Proton Ion Medical Machine Study) des CERN, mit Projektgruppen aus Italien, Schweiz, Frankreich, Österreich und Beiträgen aus der GSI, ein breites Interesse an der Teilchentherapie. Der 1999 vorgelegte Entwurf enthält ein komplettes Baukastensystem vieler verschiedener Komponenten vom Beschleuniger bis zu einer beweglichen Strahlführung. Das PIMMS-Design ist derzeitig die technische Grundlage von Projekten in Italien (TERA), Österreich (Med-Austron) und Frankreich (Etoile). Zusammen mit Heidelberg und Marburg ist damit der Bau und Betrieb von fünf Schwerionen-Therapieanlagen in Europa in den nächsten Jahren gesichert. Weitere Projekte sind an vielen Orten in Europa wie Stockholm, Kopenhagen, Kiel, Berlin usw. im Gespräch, haben aber noch keine finanzielle Grundlage oder klinischen Konsens. Ähnliches gilt für die USA, wo an vielen führenden Kliniken die Vorteile von Schwerionen-Protonen-Therapien diskutiert und intensive Verhandlungen mit Firmen geführt werden. In Japan, dem Land, das durch die Kohlenstofftherapie in Chiba die größte Schwerionenerfahrung besitzt, wurde 2002 in Hyogo eine zweite Anlage für die Therapie mit Protonen- und Kohlenstoffionen in klinischen Betrieb genommen. In Gumna ist seit Anfang 2007 eine weitere Anlage im Aufbau. Die Schwerionentherapie erlebt weltweit eine Renaissance. Dies ist sicher zum Teil auf die guten klinischen Erfolge der Kohlenstofftherapie zurückzuführen, die wir in Darmstadt mit dem gemeinsamen Projekt mit Heidelberg und Dresden erzielt haben. Wie viele Ionentherapieanlagen letztendlich gebaut werden, ist nicht absehbar. Verschiedene Schätzungen in Österreich, Deutschland, Italien und Frankreich zeigen, dass für 10 Millionen Einwohner eine Schwerionenanlage vernünftig wäre, um Patienten mit strahlenresistenten Tumoren erfolgreich behandeln zu können. Darüber hinaus zeigt die Schwerionenbehandlung meist weniger Nebenwirkungen und wird deshalb dann vorgezogen werden, wenn sie finanziell tragbar ist. Gelingt es in einer Serienfertigung, die Investitionskosten zu senken, z. B. durch den Bau eines kompakten, lasergetriebenen Beschleunigers, dann wird sich die Ionentherapie auf eine Weise ausbreiten, wie es auch bei der Computertomographie oder der bildgebenden Kernspinresonanz der Fall war. * Diesen Artikel zu schreiben fiel mir schwer, da er nicht nur fachspezifiche Informationen enthalten sollte, sondern auch über das Werden der Therapie bei der GSI mit allen Schwierigkeiten und Umwegen berichten sollte. Deshalb möchte ich mich bei allen, die mich beim Schreiben unterstützten, bedanken, insbesondere bei Daniela Schulz-Ernter (Radiologie, Heidelberg), Hermann Requardt (Siemens), Johannes Nardi und der Partikeltherapie Siemens Erlangen sowie Stephan Kraft (Universität Freiburg) und Sebastian Kraft (Van der Waals-Zeeman-Institut, Amsterdam) 2) ACCEL wurde mittlerweile vom amerikanischen Marktführer in der Strahlentherapie Verian gekauft 3) Der aktuelle Zustand ist unter www.arge-sit.de abrufbar. Literatur [1] V. T. De Vita, S. Hellmann., S. A. Rosenberg, Cancer: Principles and Practice of Oncology, Lippincott-Raven, Philadelphia (1997) [2] R. R. Wilson, Radiology 47, 487 (1946) [3] J. Sisterson, Particle Newsletter 36 (2006) [4] W. T. Chu, B. A. Ludewigt und T. R. Renner, Rev. Sci. Instr. 64, 2055 (1993) [5] J. Heilmann et al., Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 34, 599 (1996) [6] W. K. Weyrather und G. Kraft, Radiother. Oncol. 73 (2), 161 (2004) [7] G. Kraft, Progr. Part. Nucl. Phys. 45, 473 (2000) [8] M. Scholz und G. Kraft, Cancer/Radiother. 83 (1), 50 (1996) [9] W. Enghardt, Physikalische Blätter, September 1996, S. 874 [10] D. Schulz-Ertner et al., Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 58 (2), 631 (2004) DER AUTOR Gerhard Kraft studierte von 1962 bis 1971 Physik in Heidelberg (Diplom) und Köln (Promotion) mit dem Schwerpunkt Kernphysik. Seit 1973 ist er bei der GSI Darmstadt tätig, zunächst in der Atomphysik. Aufenthalte am LBL Berkeley (Biomed Division) lenkten sein Interesse dann auf die Anwendung von Ionenstrahlen in Biologie und Medizin, ein Wechsel, den seine Frau Wilma K. Weyrather bereits vorher vollzogen hatte. Gemeinsam arbeiteten sie seit 1981 an strahlenbiologischen Problemen und der Vorbereitung der Therapie. Dazu bauten sie den Bereich Biophysik bei der GSI auf, der die Therapie und die zugehörigen Forschungsarbeiten trägt. © 2007 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim Physik Journal 6 (2007) Nr. 2 35 Katrin Binner plettlösung an, die neben dem Beschleuniger auch die medizinischen Geräte und die Bestrahlungsplanung enthält. Parallel zu dieser Entwicklung begann der Bau der Heidelberger Ionen-Therapieanlage (HIT) für die Therapie mit Protonen und Kohlenstoffionen. Die Kosten dieser Anlage waren anfangs auf 72 Millionen Euro veranschlagt und liegen jetzt knapp unter 100 Millionen Euro. Der Beschleuniger der HIT wird von der GSI errichtet. Die Strahlapplikation, d. h. den Rasterscan, ebenso wie die gesamte medizinische Ausrüstung liefert die Partikeltherapie von Siemens Medical Solutions. Anfang 2008 sollen bei HIT die ersten Patienten behandelt werden.3) Ein weiteres deutsches Projekt entsteht in Marburg: Beim Kauf des Universitätsklinikums Gießen/Marburg im Dezember 2005 umfasste das Angebot der RKA auch den Bau einer Schwerionen-Therapieanlage. In dieser Einheit sollen ca. 2000 Patienten jährlich behandelt werden bei Kosten von weniger als 20 000 Euro pro Patient. Dies ist mit den Kosten der Chemotherapie oder einer normalen Operation vergleichbar. Die Bestrahlung von Patienten soll hier 2010 beginnen.