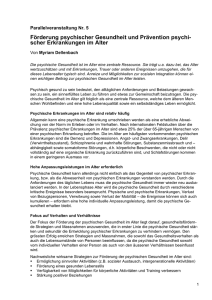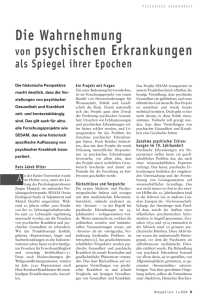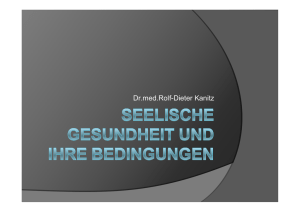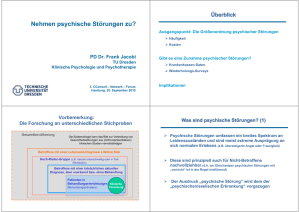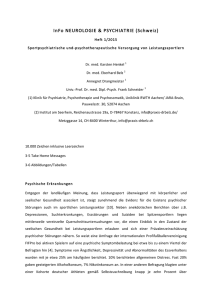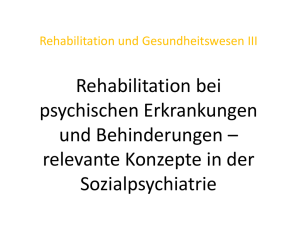Psychische Störungen bei chronischen
Werbung

Rehabilitationswissenschaftlicher Forschungsverbund Freiburg / Bad Säckingen Gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Deutsche Rentenversicherung Epidemiologie psychischer Störungen in der medizinischen Rehabilitation Abschlussbericht Martin Härter und Jürgen Bengel November 2001 RFV Vorwort Der vorliegende Band bildet den Abschlussbericht des Forschungsprojektes „Epidemiologie psychischer Störungen in der medizinischen Rehabilitation“ im Rehabilitationswissenschaftlichen Forschungsverbund Freiburg / Bad Säckingen. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und der Deutschen Rentenversicherung gefördert. Ergänzt werden konnte dieses Projekt durch zusätzliche Mittel aus der Studie „Psychische Störungen und Lebensqualität bei Tumorpatienten“ (Projektleiter M. Härter), die von den Firmen Aventis und Hoffmann La Roche zur Verfügung gestellt wurden. Der Hauptteil dieses Berichts beruht auf der Habilitationsschrift von M. Härter, die im Sommersemester 2001 an der Philosophischen Fakultät I der Universität Freiburg angenommen wurde. Wir möchten den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen folgender Kliniken und Praxen, ohne deren Unterstützung die Studie nicht durchführbar gewesen wäre, ganz herzlich danken: Breisgau-Klinik, Bad Krozingen – Dr. Kleinn Herz-Kreislauf-Klinik Waldkirch - Prof. Dr. Rauch Klinik Baden, Bad Krozingen - Prof. Dr. Bönner Klinik Lazariterhof, Bad Krozingen - Prof. Dr. Bönner Klinik für Tumorbiologie, Freiburg – Prof. Dr. Bartsch, Prof. Dr. Unger, Prof. Dr. Weis Rehabilitationsklinik Sinnighofen, Bad Krozingen - Dr. Reichelt Rheintal-Klinik, Bad Krozingen - Dr. Sagebiel Portens Privatklinik St. Georg, Höchenschwand – Dr. Kornotzki Schwarzwaldklinik, Bad Krozingen – Dr. Peters Theresienklinik, Bad Krozingen – Dr. Best, PD Dr. Jost Ziegelfeldklinik, St. Blasien – Dr. Weise Wir danken ferner den onkologischen Praxis Dr. Feyen, Friedrichshafen, Dr. Haen, Tübingen, Dr. Herbrik-Zipp, Weingarten, Dr. Höning, Stuttgart, Dr. Marschner, Freiburg, Dr. Oliver, Reutlingen, Dr. Reiber, Freiburg, Dr. Springer, Karlsruhe und der Abteilung Frauenheilkunde und Geburtshilfe I, Dr. Hasenburg, Prof. Dr. Kieback, Universitätsfrauenklinik Freiburg. Wir bedanken uns insbesondere auch bei den Patienten und Patientinnen für das Ausfüllen der umfangreichen Fragebogen und für die gewährten klinischen Interviews. Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, insbesondere Katrin Reuter und Alexandra Wunsch, Bettina Weißer, Manfred Rundel, Beate Schretzmann und Astrid Aschenbrenner danken wir für die Unterstützung bei der aufwändigen Datenerhebung und statistischen Aufbereitung der Daten sowie den Diplomandinnen und Diplomanden für ihre Mitarbeit. Dem Methodenzentrum des Rehabilitationswissenschaftlichen Forschungsverbundes Freiburg / Bad Säckingen, namentlich Dr. Christoph Löschmann und Carsten Maurischat, sei für die statistische und forschungsmethodische Unterstützung gedankt. Freiburg, im November 2001 Martin Härter Jürgen Bengel 1 Ziele und Kontext Viele Kliniker bestätigen, dass eine enge Beziehung zwischen psychischen und körperlichen Erkrankungen besteht. Diese somato-psychische Assoziation wird durch zahlreiche Studien an Patienten mit körperlichen Erkrankungen und mit Patienten, die wegen einer psychischen Störung behandelt werden, gestützt. Es wird geschätzt, dass 35-40% aller Krankenhauspatienten zusätzlich zu ihrer somatischen Erkrankung psychische Beeinträchtigungen aufweisen, welche die Kriterien einer psychischen Störung erfüllen. Das richtige und rechtzeitige Erkennen hat weitreichende Konsequenzen für die Diagnostik, die Behandlung und den Verlauf der körperlichen wie psychischen Störungen. Komorbide psychische Störungen erhöhen die somatische Morbidität und Mortalität, führen zu höheren Inanspruchnahme und erhöhten Kosten im medizinischen Versorgungssystem. Ungünstigerweise gibt es aber einen erheblichen Anteil psychisch beeinträchtigter Patienten, bei denen diese Störungen weder erkannt noch behandelt werden. Eine erweiterte Diagnostik, z.B. durch Einsatz von Screeninginstrumenten und diagnostischen Interviews zur Erfassung psychischer Störungen sowie eine adäquate Behandlung psychisch und somatisch kranker Patienten, z.B. durch Kombination psychotherapeutischer und psychopharmakologischer Maßnahmen, dienten einerseits der Verminderung von individuellen Beeinträchtigungen. Andererseits führten sie zu einer Qualitätsverbesserung der Diagnostik und Behandlung und potenziell auch zur Kostensenkung, z.B. durch Verhinderung chronifizierter Verläufe. Diese Maßnahmen gilt es, in primär somatisch ausgerichteten Institutionen der Gesundheitsversorgung zu integrieren. Psychologische Dienste haben dabei die Aufgabe, sich mit psychologischen und psychiatrischen Problemen von körperlich kranken Patienten intensiv zu befassen und andere medizinische Disziplinen hinsichtlich notwendiger diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen zu unterstützen und zu schulen. Obwohl die Früherkennung und Behandlung komorbider psychischer Störungen sowie die Vermeidung von Chronifizierungsprozessen im Rahmen der stationären und rehabilitationsmedizinischen Versorgung übereinstimmend gefordert wird, gibt es in Deutschland und auch international keine methodisch adäquaten epidemiologischen Studien zur Prävalenz psychischer Beeinträchtigungen und Störungen bei chronisch körperlich Kranken. Hingegen liegen verlässliche epidemiologische Zahlen zur Prävalenz psychischer Störungen in der Allgemeinbevölkerung vor. Das Hauptziel der im Rahmen des Förderschwerpunkts Rehabilitationswissenschaften 2 durchgeführten epidemiologischen Studie war es, die psychische Komorbidität bei Patienten mit den in der stationären medizinischen Rehabilitation häufigsten Indikationsgruppen wie HerzKreislauf-Erkrankungen und muskulo-skelettalen Erkrankungen zu analysieren. Die Studie wurde als gemeinschaftliches Projekt der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsklinik Freiburg (M. Härter) und der Abteilung für Rehabilitationspsychologie (J. Bengel) durchgeführt. Aufgrund einer Förderung durch die Firmen Aventis und Hoffmann LaRoche (Psychische Störungen und Lebensqualität bei Patienten mit Tumorerkrankungen, M. Härter) konnten auch ambulant und stationär behandelte Patienten mit unterschiedlichen Tumorerkrankungen zusätzlich untersucht werden. In einem parallel laufenden Dissertationsvorhaben werden ferner Daten von Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen in der ambulanten kardiologischen Rehabilitation analysiert (A. Wunsch). Eine weitere Dissertation beschäftigt sich mit der Differenzialdiagnostik von Fatigue und depressiven Störungen bei Tumorerkrankungen (K. Reuter). Dieser Abschlussbericht fasst alle Ergebnisse des Vorhabens zusammen und formuliert Schlussfolgerungen für Forschung und Praxis. Parallel zu diesem Abschlussbericht wurden die Ergebnisse in wissenschaftlichen Journals, Jahrbüchern und anderen Bänden publiziert bzw. zur Veröffentlichung eingereicht sowie auf zahlreichen Kongressen vorgetragen (Abschn. 8). Darüber hinaus wurden die Ergebnisse in den kooperierenden Kliniken vorgestellt und eine erste Fortbildung für Ärzte, Psychologen und andere Berufsgruppen durchgeführt (Abschn. 7). Zwischenzeitlich wurden zwei Anschlussvorhaben begonnen: Das Vorhaben „Epidemiologie psychischer Störungen bei Atemwegserkrankungen und Stoffwechselerkrankungen in der medizinischen Rehabilitation“, gefördert vom BMBF und der Deutschen Rentenversicherung, erweitert die Datenbasis um weitere wichtige Indikationsgruppen in der Rehabilitation (M. Härter, J. Bengel). Ein weiteres Projektziel ist die Entwicklung und Erprobung eines Fortbildungsprogramms zur Diagnostik und Behandlung komorbider somatischer und psychischer Erkrankungen. Damit soll die Prozess- und Ergebnisqualität in der Rehabilitation und der Versorgung chronisch kranker Patienten insgesamt erhöht und die Kompetenz der in der Rehabilitation tätigen Berufsgruppen verbessert werden. Das Vorhaben „Effektivität und Effizienz einer leitorientierten Behandlung von Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen und komorbiden depressiven Störungen“ untersucht basierend auf den vorgelegten Prävalenzdaten eine gezielten Intervention für Herz-Kreislauf-Patienten. Auch dieses Vorhaben wird vom BMBF und der Deutschen Rentenversicherung (LVA Baden Württemberg) gefördert (J. Barth, M. Härter, J. Bengel). 3 Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen epidemiologischer Studien ...................................................... 5 2 Diagnostik psychischer Störungen.................................................................12 2.1 Interviewverfahren......................................................................................... 13 2.2 Screeningverfahren......................................................................................... 16 2.3 Prävalenz psychischer Störungen .................................................................. 18 3 Psychische Störungen bei körperlichen Erkrankungen............................. 24 3.1 Komorbidität ................................................................................................. 24 3.2 Prävalenz psychischer Störungen bei körperlichen Erkrankungen............... 25 3.3 Diagnostik psychischer Störungen bei körperlichen Erkrankungen.............. 38 3.4 Fazit................................................................................................................ 42 4 Fragestellungen und Methodik......................................................................45 4.1 Kontext und Begründung................................................................................45 4.2 Ziele und Fragestellungen...............................................................................47 4.3 Design und Methodik......................................................................................49 4.4 Datenanalyse...................................................................................................52 4.5 Stichproben und Patientencharakteristika.......................................................53 4 5 Ergebnisse....................................................................................................... 57 5.1 Psychische Störungen bei Patienten mit Herz-Kreislauf Erkrankungen........ 57 5.2 Psychische Störungen bei Patienten mit muskulo-skelettalen Erkrankungen 59 5.3 Psychische Störungen bei Patienten mit Tumorerkrankungen....................... 61 5.4 Screening psychischer Störungen bei körperlichen Erkrankungen................ 66 5.5 Zusammenfassung.......................................................................................... 68 6 Konsequenzen für die Forschung................................................................. 76 7 Transfer und klinische Implikationen ........................................................ 82 8 Publikationen der Arbeitsgruppe ................................................................ 92 9 Literaturverzeichnis ..................................................................................... 95 5 1 Grundlagen epidemiologischer Studien Epidemiologische Forschungsansätze untersuchen die Verteilung, Determinanten und Risikofaktoren gesundheitsbezogener Zustände und Ereignisse in Bevölkerungsgruppen und wenden dieses Wissen, z.B. für die Bewältigung von Gesundheitsproblemen oder die Planung von Gesundheitsdienstleistungen an (Henderson, 1999; Last, 1995). Das spezielle Forschungsfeld der Epidemiologie psychischer Erkrankungen wird als die Untersuchung der räumlichen und zeitlichen Verteilung psychischer Störungen in unterschiedlichen Populationen definiert (Tsuang, Tohen & Zahner, 1995). Ziele Epidemiologische Studien analysieren u.a. die Bedingungen des Auftretens und des Verlaufs psychischer Störungen mit dem Ziel, das Wissen über Ursachen, Risiko- und Auslösefaktoren von psychischen Krankheitsepisoden und -folgen zu vertiefen (Weyerer, 1996). Morris (1964) beschrieb sieben Anwendungsbereiche, die den großen gesundheitspolitischen und wissenschaftlichen Nutzen epidemiologischer Untersuchungsansätze belegen (mod. nach Henderson, 1999; Härter, 2001). Epidemiologie in der klinischen Psychologie und Psychiatrie dient: a) Zur Verlaufsuntersuchung der Gesundheit bzw. der Häufung und Verminderung von psychischen Störungen in Bevölkerungsgruppen. Beispiele sind Untersuchungen zur Häufigkeit schizophrener Störungen in verschiedenen Kulturen oder zur Frage, in welchem Ausmaß depressive Störungen bei jüngeren Menschen in den letzten Jahren zunehmen (Wittchen, 2000a). b) Zur Untersuchung der Morbidität der Allgemeinbevölkerung. Jüngere Beispiele sind die Ergebnisse des National Comorbidity Survey in den USA (Kessler et al., 1994), des Survey of Psychiatric Morbidity in Großbritannien (Jenkins et al., 1997) und des Bundesgesundheits-Survey´98 (Wittchen et al., 1999b; Wittchen, 2000b). c) Zur Untersuchung der Arbeitsweise von Gesundheitsdiensten. Beispiele sind die Erforschung des Bedarfs und der Inanspruchnahme sowie die Evaluation ambulanter psychiatrischer Dienste durch verschiedene Bevölkerungsgruppen (Burke, 1995). 6 d) Zur Abschätzung des individuellen Risikos. Eine psychische Störung in einem bestimmten Lebensalter zu entwickeln, zu gesunden oder wieder zu erkranken. Z.B. kann das individuelle Risiko, an einer Schizophrenie zu erkranken, abgeschätzt werden, wenn die jährliche altersbezogene Inzidenzrate für Psychosen bekannt ist (Bromet, Dew & Eaton, 1995). e) Klinisches Verständnis verschiedener Manifestationen von psychischen Störungen. Mit epidemiologischen Studiendesigns können z.B. Formen bzw. Stadien psychischer Erkrankungen erfasst werden, um die Entwicklung subklinischer Syndrome zu voll entwickelten Störungsbildern zu verstehen (Angst & Merikangas, 1997; Angst, Sellaro & Merikangas, 2000). f) Zur Identifikation, Abgrenzung und Differenzierung von Syndromen. Epidemiologische Untersuchungen in verschiedenen Bevölkerungsgruppen geben Hinweise auf Stabilität und Varianten bzw. neu abzugrenzende psychiatrische Syndrome (Krueger, 1999; Wittchen, Höfler & Merikangas, 1999). Vorschläge für Differenzierungen sind z.B. die Forschungskriterien für kurzdauernde rezidivierende depressive Störungen (American Psychiatric Association, 1994). g) Zur Erforschung der Ursachen von seelischer Gesundheit und Krankheit. Hierzu gehört z.B. die Entdeckung von Personengruppen mit hohem und niedrigem Erkrankungsrisiko und die Untersuchung der Unterschiede in Abhängigkeit von unterschiedlichen Lebensstilen (Kessler et al., 1994; Kessler, 1995). Obwohl im Zentrum epidemiologischer Untersuchungsansätze meist Vergleiche von Erkrankungsraten zwischen zwei oder mehreren Gruppen stehen, wurde in der Praxis eine große Bandbreite verschiedener Forschungsdesigns umgesetzt, die durch verschiedene Charakteristika voneinander differenziert werden. Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale betreffen die Datensammlung hinsichtlich der gewählten Messzeitpunkte in Bezug auf relevante Risikofaktoren und das Auftreten von Erkrankungen, die Trennung zwischen Risikofaktoren und Erkrankungen über die Zeit und die Methoden zur Gewinnung von Stichproben. Zudem variieren Studien hinsichtlich der Kosten, ihrer Umsetzbarkeit und der Qualität der gesammelten Informationen (zu Designs vgl. Zahner, Hsieh & Fleming, 1995, S. 28ff; Beaglehole, Bonita & Kjellström, 1997, S. 53ff). Die in der psychiatrischen Epidemiologie am häufigsten verwendeten Studiendesigns sind Querschnittstudien, Kohortenstudien und Fall-Kontroll-Studien sowie im Rahmen der Erforschung genetischer Ursachen für psychische Störungen familienepidemiologische Designs (Henderson, 1999; Faraone & Tsuang, 1995; vgl. Härter, 2001). 7 Falldefinition und Klassifikationssysteme In der klinischen Psychologie bzw. Psychiatrie und Psychotherapie geht es zunächst und vor allem um die Diagnose und Behandlung individueller Probleme. Dieser idiographische Ansatz wird durch den epidemiologischen, nomothetischen Ansatz ergänzt, der nach wiederkehrenden und vorhersagbaren interindividuellen „Mustern” oder Symptomkomplexen in Personen- und Bevölkerungsgruppen sucht. In epidemiologischen Studien werden Symptome oder Diagnosen spezifiziert, die die Basis der quantitiativen Abschätzung gesundheitsbezogener Zustände sind (Beaglehole et al., 1997). Die Erarbeitung von Kriterien, anhand derer festgestellt werden kann, ob eine Störung vorliegt, setzt eine Abgrenzung von Gesundheit und Krankheit voraus. Um „Krankheitsfälle“ (cases) zu definieren, sind diagnostische Merkmale zu erheben, die in der Re- gel auf Krankheitssymptomen, Krankheitszeichen und Testergebnissen basieren. Analog den Begriffen aus der Diagnostik psychischer Störungen gelten die Begriffe Symptom - Syndrom Störung - Krankheit auch als Grundlage für epidemiologische Studien (Stieglitz, 2000). Die elementarste Ebene stellt das Symptom dar. Interindividuell überzufällig häufig gemeinsam auftretende Symptome oder Symptomkomplexe werden in der Regel als Syndrome bezeichnet. Syndrome werden zu Störungen zusammengefasst, wenn es Belege dafür gibt, dass die Konstellation von Symptomen als unabhängig voneinander anzusehen ist. Von Krankheit spricht man dann, wenn für Störungen eine bestimmte und spezifische Ätiologie sowie ein einheitliches Ansprechen auf die angewandte Therapie angenommen werden kann. Die meisten psychischen Erkrankungen können heute - im Gegensatz zu vielen somatischen Erkrankungen - (noch) nicht auf diesem Abstraktionsniveau definiert werden, sie sind auf Syndrom- oder Störungsebene anzusiedeln (Stieglitz, 2000). Durch die Einführung international anerkannter diagnostischer Kriterien ist die Klassifikation psychischer Symptome und Syndrome zu Störungsbildern heute präzise definiert und operationalisiert. Von der WHO wurde zur Einteilung psychischer Störungen die International Classification of Diseases in der 10ten Revision (ICD-10) mit der darin enthaltenen Klassifikation von psychischen und Verhaltensstörungen entwickelt (WHO, 1992a). Im amerikanischen Raum dominiert das von seinen Grundzügen her sehr ähnliche Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders in seiner vierten Edition (DSM-IV), welches von der American Psychiatric Association (1994) herausgegeben wird. Durch intensive Zusammenarbeit zwischen den beiden Arbeitsgruppen ist es gelungen, eine gemeinsame Sprache zwischen den in der Epidemiologie, 8 Diagnostik und Behandlung tätigen Berufsgruppen zu schaffen. Tatsächlich ist es für Untersuchungen überaus wünschenswert, beide Systeme simultan zu benutzen, da dies Vorteile sowohl für epidemiologische Analysen erbringt als auch unser Wissen über die Leistungsfähigkeit der ICD-10 und des DSM-IV als diagnostische Systeme vermehrt (Henderson, 1999). Prävalenz und Inzidenz Die quantitative Verteilung psychischer Störungen wird mit Hilfe deskriptiver Studienansätze zur Erfassung der Prävalenz und der Inzidenz festgestellt. Die Prävalenz einer Erkrankung ist die Anzahl der Krankheitsfälle in einer definierten Population zu einem bestimmten Zeitpunkt (Punktprävalenz) oder während einer Zeitperiode (Periodenprävalenz) (Weyerer, 1996). Die Lebenszeitprävalenz umfasst den Anteil der an einem Stichtag lebenden Bevölkerung, die irgendwann in ihrem Leben eine bestimmte Erkrankung hatte. Periodenprävalenzen sind wichtige Maßzahlen in der Epidemiologie psychischer Erkrankungen, da viele Störungen einen komplexen und episodischen Verlauf nehmen, wobei häufig 12 Monate als diagnostisches Zeitfenster gewählt werden. Hierdurch werden einerseits Patienten mit chronischen Störungen in Prävalenzschätzungen einbezogen, die aktuell remittiert sind, andererseits erfordern manche Störungsbilder die Erfüllung von diagnostischen Kriterien über längere Zeiträume (z. B. Dysthymie). Unter Inzidenz versteht man die Zahl der Neuerkrankungen in einem bestimmten Zeitraum und einer definierten Population, unabhängig davon, ob die Erkrankung zum Ende der Zeitperiode noch besteht oder nicht (Weyerer, 1996). Das einfachste Maß stellt hier die kumulative Inzidenzrate dar, welche aus der Relation von Personen besteht, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums erkranken und der Anzahl der Mitglieder der Risikopopulation, welche die Erkrankung zu Beginn des Zeitraums nicht haben (weiterführend: Beaglehole et al., 1997; Zahner et al., 1995). Schwierigkeiten bei der Berechnung von Inzidenzraten treten dann auf, wenn der Krankheitsbeginn, wie bei vielen psychischen Störungen (z. B. Depressionen, Psychosen, Suchterkrankungen), schleichend ist. Prävalenz- und Inzidenzraten sind voneinander abhängige epidemiologische Maßzahlen. Prävalenzen hängen einerseits von der Inzidenzrate und andererseits von der Krankheitsdauer ab. Wenn die Prävalenzrate niedrig ist und keine signifikanten zeitlichen Schwankungen aufweist, kann sie näherungsweise als das Produkt aus Inzidenzrate und durchschnittlicher Krankheitsdau- 9 er berechnet werden (Beaglehole et al., 1997). Die Dauer einer Erkrankung hängt in erster Linie von deren Verlauf und der spontan oder aufgrund von therapeutischen Maßnahmen erfolgten Remissionsrate ab (Weyerer, 1996). Psychische Störungen mit relativ hoher Inzidenz können deshalb relativ niedrige Prävalenzen aufweisen, wenn sie von kurzer Dauer sind (z. B. Panikstörungen). Umgekehrt kann bei chronischen Erkrankungen die Inzidenz niedrig, die Prävalenz aber hoch sein. Die Analyse von Krankheitshäufigkeiten und Neuerkrankungsraten ist eine Aufgabe epidemiologischer Studien. Genauso wichtig ist der Vergleich der Prävalenzraten in zwei oder mehr Gruppen, die in unterschiedlichem Ausmaß von verschiedenen Expositionsfaktoren betroffen sind und die Untersuchung von Assoziationen zwischen bestimmten Risikofaktoren und Krankheitshäufigkeiten (Beaglehole et al., 1997, Zahner et al., 1995). Gibt es z.B. einen Zusammenhang zwischen einem Studienfaktor (z.B. soziale Umgebungsfaktoren, genetische Bedingungen, traits) und einer psychischen Störung, wird die Prävalenz einer Störung Unterschiede in Gruppen aufweisen, die sich bzgl. der Exposition gegenüber dem Studienfaktor unterscheiden („vorhanden“ oder „nicht vorhanden“). Gruppenvergleiche können in diesem Zusammenhang als Differenzen oder als Verhältnis von Häufigkeiten (rate ratio) ausgedrückt werden. Die Größe der Differenz oder des Quotienten ist dann ein Indikator für die Stärke des Zusammenhanges zwischen dem untersuchten Studienfaktor und der psychischen Störung. Dieses Verhältnis zwischen zwei Raten wird als relatives Risiko bezeichnet (Beaglehole et al., 1997). Odds Ratios werden typischerweise als Schätzwerte für das relative Risiko berechnet (weiterführend: Zahner et al., 1995, Hillis & Woolson, 1995). Screening Im Rahmen epidemiologischer Studien werden häufig Screeningverfahren eingesetzt. Screening bezeichnet den Prozess, durch den bisher nicht bekannte Erkrankungen schnell und in großem Umfang als Indikator für notwendige Sekundär- oder Tertiärprävention erkannt werden. Tests zur Durchführung von Screeninguntersuchungen unterscheiden zwischen wahrscheinlich gesunden und möglicherweise erkrankten Personen. In der Regel können durch Screeningverfahren keine Diagnosen gestellt werden, sondern es müssen entsprechende Nach- oder Zusatzuntersuchungen angeschlossen werden. Ein Screening-Test sollte kostengünstig, leicht anwendbar, zu- 10 verlässig und valide sein. Zuverlässig (reliabel) heißt, dass er konsistente Ergebnisse liefert. Validität des Screeningverfahrens bedeutet, dass es die untersuchten Personen richtig in Gruppen erkrankter und nicht erkrankter Personen einteilt (Tab. 1). Die Sensitivität (Empfindlichkeit) gibt den Anteil der kranken Personen in der gescreenten Population an, die durch den Test als „krank“ erkannt werden (= Wahrscheinlichkeit eines positiven Tests bei Erkrankten, A / A + C). Die Spezifität (Genauigkeit) ist der Anteil gesunder Personen, die der Screening-Test korrekt identifiziert (= Wahrscheinlichkeit eines negativen Tests bei nicht Erkrankten, D / B + D). Tabelle 1: Validität von Screeningtests (Beaglehole et al., 1997; Goldstein & Simpson, 1995) Screening Störung vorhanden Nicht vorhanden Summe Positiv A B A+B Negativ C D C+D Summe A+C B+D A+B+C+D A = Anzahl richtig positiver, B = falsch positiver, C = falsch negativer, D = richtig negativer Fälle Ideal wären Screeningverfahren, die sowohl sehr sensitiv als auch gleichzeitig sehr spezifisch sind und gute Reliabilitäts- und Validitätsparameter aufweisen. In der Praxis muss jedoch ein Kompromiss zwischen diesen Kennwerten gefunden werden, da die Grenze, insbesondere bei psychischen Störungen, zwischen „gesund“ und „krank“ in der Regel nicht definitiv festzulegen ist. Wenn es im Interesse liegt, die Empfindlichkeit des Verfahrens zu erhöhen, und alle richtig Positiven erfasst werden sollen, steigt auch die Zahl der falsch positiven Werte, die Spezifität des Verfahrens sinkt. Eine Lockerung der Kriterien bzw. Absenkung von Schwellenwerten in Screeningverfahren erhöht daher die Sensitivität. Eine Verschärfung der Kriterien erhöht entsprechend die Spezifität, senkt aber die Wahrscheinlichkeit, alle wirklich erkrankten Personen zu entdecken. Welche Kriterien für ein Screeningverfahren geeignet sind, hängt insbesondere davon ab, welche Folgen (z. B. Kosten, Mortalität, Lebensqualität) die Identifizierung falsch negativer und falsch positiver Fälle hat. 11 Um den praktischen Wert eines Screeningtests bestimmen zu können, müssen - neben der Reliabilität und Validität - noch weitere Merkmale bekannt sein. Besonders wichtig sind in diesem Zusammenhang der positive und der negative prädiktive Wert. Der positive prädiktive Wert bezeichnet die Wahrscheinlichkeit eines Patienten mit einem positiven (erhöhten / abnormen) Testergebnis, die Störung tatsächlich zu haben (= Wahrscheinlichkeit der Erkrankung bei positivem Testbefund, A / A + B), während der negative prädiktive Wert die Wahrscheinlichkeit angibt, dass ein Patient mit negativem Ergebnis die Störung nicht hat (= Wahrscheinlichkeit der Gesundheit bei negativem Testbefund, D / C + D). Der prädiktive Wert hängt von der Spezifität und Sensitivität, vor allem von der Prävalenz der Störung in der untersuchten Population ab. Mit der Einführung der sog. ROC-Analyse (receiver operating characteristic) steht zusätzlich eine innovative Methode zur Verfügung, die eine graphische Beschreibung der Beziehungen von Sensitivität und Spezifität und ihre Abhängigkeit von der Wahl unterschiedlicher Cut-off-Werte ermöglicht, mithin ein Maß für die Diskriminationsfähigkeit bzw. Power des Screeningverfahrens darstellt (Metz, Wang & Kronman, 1993; Reuter & Härter, 2001; Härter, Reuter, GroßHardt & Bengel, 2001a). 12 2 Diagnostik psychischer Störungen Epidemiologische Studien basieren auf unterschiedlichen methodischen Ansätzen, je nachdem, ob für die Untersuchung der psychiatrischen Morbidität Fragebogenverfahren (Selbst- oder Fremdbeurteilungsinstrumente), klinische Interviewtechniken bzw. standardisierte klinische Interview-verfahren oder eine Kombination von Fragebogen- und Interviewverfahren eingesetzt werden. Diese Unterschiede tragen in erheblichem Ausmaß zur Schwankungsbreite von Prävalenzschätzungen psychischer Störungen und Beeinträchtigungen bei. Unabdingbar für die Festlegung des diagnostischen Verfahrens ist die Entscheidung, welche Kriterien herangezogen werden, um „Fälle“ bzw. Individuen mit psychischen Störungen zu identifizieren. Das Hauptproblem hierbei ist die zugrundeliegende Hypothese, dass der Fallbegriff eine kategoriale Struktur im Hinblick auf die psychische Morbidität impliziert („vorhanden“ vs. „nicht vorhanden“). Hingegen können psychische Störungen auch als dimensionale Einheiten konzeptualisiert werden (Rose, 1993): Die Häufigkeitsverteilung von Symptomen wie Ängstlichkeit, Depressivität oder kognitiven Beeinträchtigungen, die zu Syndromen zusammengefasst werden, zeigt, dass die meisten Individuen keine oder wenige Symptome aufweisen, wenige hingegen viele Symptome aufweisen. Per Konsensus wurden daher bei der Ausformulierung der diagnostischen Kriterien, z. B. der ICD-10 oder dem DSM-System, Cut-offs bestimmt, um Fälle eindeutig festzulegen. Eine auf diese Weise ermittelte Diagnose bedeutet jedoch nicht auch klinische Signifikanz. Daher wird zunehmend eine Erweiterung der kategorialen Diagnostik durch differenzierte Daten, z.B. zu Dauer der Symptomatik und Beeinträchtigung der Lebensqualität, gefordert (Regier et al., 1998). Aus statistischen Erwägungen kann es aber in epidemiologischen Studien sinnvoll sein, Individuen mit wenigen depressiven, angstbezogenen oder suchtspezifischen Symptomen zu identifizieren (z.B. über Fragebogenverfahren). Es können dann diese verschiedenen Beeinträchtigungen, die noch nicht die Schwellenwerte für Störungen überschritten haben, als Scores zusammengefasst werden und in einer Analyse möglicher Risikofaktoren als kontinuierliche Variable genutzt werden (Henderson, 1999). Aus diesem Ansatz lassen sich drei Konsequenzen ableiten: a) die Studienpopulation kann mit Hilfe kontinuierlicher Variablen (z.B. Fragebogenscores) als Ganzes charakterisiert werden (Mittelwerte und Standardabweichung etc.); 13 b) diese Populationskennwerte können z.B. große Unterschiede zwischen Männern und Frauen, geographischen Regionen, sozialen Schichten etc. aufweisen; c) die Unterschiede in der Prävalenz wahrscheinlicher Störungen (Score über dem Schwellenwert) stehen in Bezug zu verschiedenen Mittelwerten in diesen Gruppen. Ein weiterer Vorteil ergibt sich, wenn Erkrankungshäufigkeiten als ein Kontinuum in einer Population betrachtet werden: Morbidität bezieht sich üblicherweise auf Symptome und Störungen, zunächst ohne den Aspekt der Behinderung (disablement) zu beachten. Dieser Begriff beinhaltet verschiedene Aspekte im täglichen Leben von Patienten, die durch eine psychische Störung beeinträchtigt werden können. Unter impairment wird der eigentliche Gesundheitsschaden verstanden (z.B. die Minderung der Konzentration durch eine Depression) mit der Folge der Beeinträchtigung (disability) z.B. am Arbeitsplatz. Diese Beeinträchtigung kann so stark sein, dass der Betroffene seinen Arbeitsplatz verliert (handicap). Es ist evident, dass schwere psychische Störungen wie Psychosen, affektive und demenzielle Erkrankungen mit substanziellen Behinderungen auf verschiedenen Ebenen verbunden sind. Jedoch können auch subklinische Syndrome mit bestimmten Behinderungsgraden und Einschränkungen der Lebensqualität verbunden sein. Die Berücksichtigung dieser verschiedenen Behinderungs-Dimensionen wurde kürzlich im Modell der ICIDH-2, der „International Classification of Impairments, Activities, and Participation“ (WHO, 2000) noch um die Ebene der umweltbezogenen und persönlichen Kontextfaktoren erweitert (Gerdes & Weis, 2000). 2.1 Interviewverfahren Als Verfahren der Wahl für die Diagnostik psychischer Störungen in epidemiologischen Studien werden strukturierte Interviewverfahren empfohlen, die eine standardisierte und international vergleichbare Erfassung der einzelnen Störungen nach den gängigen diagnostischen Kriterien der ICD-10 und des DSM-IV ermöglichen. Es wurden in den letzten 30 Jahren psychiatrischer Forschung mehrere Interviewsysteme entwickelt. Diese Interviewtechniken unterscheiden sich hinsichtlich des Ausmaßes ihrer Strukturiertheit bzw. Standardisierung und im Hinblick auf zentrale inhaltliche Merkmale, die bei der Auswahl für ein Interviewverfahren von Bedeutung sind (Robins, 1995). In der epidemiologischen Forschung werden diejenigen Verfahren bevorzugt, die sich durch ein hohes Maß an Reliabilität auszeichnen. Der diagnostische Entscheidungspro- 14 zess soll bei der Diagnosenstellung soweit operationalisiert sein, dass der subjektive Einfluss auf das Urteil weitestgehend kontrollierbar ist (Wittchen, Unland & Knäuper, 1994). Die Verfahren unterscheiden sich z.B. durch (Härter, 2001): a) die Bandbreite der erfassbaren Diagnosen bzw. von Achse-I- und Achse-II-Störungen, b) die untersuchbaren Zeitfenster (aktuelle, 6-Monats-, Lebenszeitprävalenz etc.), c) die zugrundeliegenden diagnostischen Kriterien (DSM-III-R oder -IV, ICD-9, ICD-10), d) die internen Algorithmen zur Diagnosenstellung, e) die Möglichkeit einer Informationssammlung über Krankheitsverläufe, f) die Möglichkeit Kohortenstudien, der Verlaufsmessung (Messwiederholung) im Rahmen von g) die Notwendigkeit des Einsatzes von klinisch erfahrenen vs. Laieninterviewern, h) die Übertragbarkeit für Studien mit ethnisch und kulturell unterschiedlichen Stichproben, i) die Verfügbarkeit von standardisierten Computerversionen/Telefoninterviewversionen j) und die Reliabilität und Validität. Die heute verfügbaren und am häufigsten eingesetzten Instrumente für Achse-I-Störungen sind das Structured Clinical Interview for DSM-III-R (SCID, Spitzer, Williams, Gibbons & First, 1992) bzw. DSM-IV und die Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry (SCAN, WHO, 1992b) für die primär klinische Anwendung sowie das Diagnostic Interview Schedule (DIS, Robins, Helzer, Croughan & Ratcliff, 1981) bzw. v.a. das Composite International Diagnostic Interview (CIDI, Wittchen et al., 1991) für trainierte Laieninterviewer. Die verschiedenen Interviewverfahren beruhen auf unterschiedlichen Forschungstraditionen, wobei die heute eingesetzten Verfahren Weiterentwicklungen von früheren Systemen darstellen (weiterführend Murphy, 1995; Stieglitz, Baumann & Freyberger, 2001). Das DIS wurde 1980 entwickelt (Robins et al., 1981) und in der großen ECA-Study als epidemiologisches Erhebungsinstrument erprobt sowie in den folgenden Jahren in zahlreichen Untersuchungen international eingesetzt (Robins & Regier, 1991). 15 Tabelle 2: Diagnostische Instrumente zur Erfassung von Achse-I-Störungen für Erwachsene (nach Robins, 1995; Wittchen et al., 1994; aus Härter, 2001) Interview SADS / SADS-L Fragen- Prävalenzzeiträume struktur (+) Auswertung Diagnostische terien Aktuell, Lebenszeit Interviewer RDC Computer ICD-8 Kri- PSE-9 + Letzter Monat DIS-IIIR ++ Aktuell, letztes Jahr, Lebenszeit Computer DSM-III-R SCID + Aktuell, Lebenszeit Strukturiert DSM-IV SCAN + Aktuell, Lebenszeit Strukturiert DSM-III-R/ICD-10 CIDI / DIA-X ++ Aktuell, letztes Jahr, Lebenszeit Computer DSM-IV/ICD-10 SADS Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia (Endicott & Spitzer, 1978) PSE Present State Examination (Wing, Cooper & Sartorius, 1974) SCID Structured Clinical Interview (Spitzer et al., 1992) DIS Diagnostic Interview Schedule (Robins et al., 1981) SCAN Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry (WHO, 1992) CIDI Composite International Diagnostic Interview (Wittchen, Weigel & Pfister, 1996) Fragen (+) teilstrukturiert; + strukturiert; ++ standardisiert Das CIDI wurde unter der Förderung der World Health Organization 1988 aus dem DIS und der in Großbritannien in den 60er Jahren entwickelten Present State Examination (PSE) vorbereitet. Die Zusammenführung dieser beiden Traditionen führten zu einer technischen Verbesserung und transkulturellen Anwendbarkeit des Verfahrens. Das CIDI wird heute in vielen epidemiologischen Studien als diagnostisches Instrument eingesetzt. Während der langen Entwicklungszeit ist das CIDI-Vorgehen intensiv von verschiedenen Arbeitsgruppen untersucht worden. Es weist eine hohe Interrater-Reliabilität, befriedigende Test-Retest-Reliabilität und Validität auf (Wittchen et al., 1991). Eine erheblich überarbeitete und erweiterte Version steht seit mehreren Jahren als DIA-X (Diagnostisches Expertensystem) in Deutschland zur Verfügung (Wittchen et al., 1996). 16 Zur Erfassung von Persönlichkeitsstörungen (Achse-II-Störungen) wurden einerseits zur Ergänzung des SCID das Structured Clinical Interview für Persönlichkeitsstörungen (SCID-II) und die International Personality Disorder Examination (IPDE) entwickelt (weiterführend: Lyons, 1995; Stieglitz et al., 2001). 2.2 Screeningverfahren Aus forschungsökonomischen Gründen werden in epidemiologischen Studien sowohl im klinischen Bereich wie auf der Ebene der Allgemeinbevölkerung möglichst kurze Skalen eingesetzt, die eine hohe Sensitivität und hohe Spezifität (je nach Fragstellung) aufweisen. Bei bevölkerungsepidemiologischen Untersuchungen wird die Screeningerhebung, bei der sehr viele Personen schnell untersucht werden können, typischerweise durch eine Nachuntersuchung per Interview ergänzt, zu der die Probanden aufgrund der Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Teilstichproben (je nach Score im Screeningbogen) ausgewählt werden (z.B. Dohrenwend, 1995; Üstün & Sartorius, 1995; Wittchen et al., 1999b). Die folgende Übersicht berücksichtigt wichtige Screeninginstrumente, die aufgrund ihrer ökonomischen Anwendbarkeit und der empirischen Absicherung häufig in epidemiologischen Studien eingesetzt werden (weiterführend: Härter, 2001), u.a. auch in eigenen Studien unserer Arbeitsgruppe (Kap. 5). Sie ist unterteilt in die Bereiche zum Screening für psychische Störungen allgemein und spezifische Störungen, z.B. für Depression bzw. Depressivität und Angststörungen. Für weitere Selbstbeurteilungsverfahren, z.B. für Alkoholerkrankungen und somatoforme Störungen sowie demenzielle Syndrome, wird auf Spezialliteratur verwiesen (Stieglitz et al., 2001). General Health Questionnaire (GHQ) Der General Health Questionnaire ist ein Screeningtest zur Entdeckung psychischer Störungen primär in der Allgemeinbevölkerung und nicht-psychiatrischen klinischen Settings (primary care). Hierzu wurde eine Fülle von nationalen und internationalen Studien durchgeführt (Goldberg & Williams, 1988; Üstün & Sartorius, 1995). Er wurde ursprünglich in einer 60-Item-Version entwickelt, später zu einer 30- und 12-Item-Version sowie einer skalierten 28-Item-Version weiterentwickelt. Der GHQ kann einerseits im Sinne eines kategorialen Ansatzes zur Fallidentifikation, andererseits im dimensionalen Ansatz als Parameter der psychischen Beeinträchtigung genutzt werden. Die internen Konsistenzen bzw. Reliabilitäten sind für die drei Versionen (60, 30 und 12 Items) gut (0.85 - 0.93 bzw. 0.73 - 0.95). Am meisten verbreitet hat sich der GHQ-12 im 17 Rahmen zweistufiger epidemiologischer Ansätze. Vorteile des Verfahrens sind einerseits seine Zeitökonomie, die vielen störungsspezifischen Vergleichsmöglichkeiten durch die umfangreiche Literatur und die guten Sensitivitätswerte (je nach cut-off) zur Entdeckung psychischer Störungen. Nachteil des Verfahrens ist seine geringere Spezifität. Stamm-Screening-Questionnaire (SSQ / CID-S) Der Stamm-Screening Questionnaire enthält die sog. Stammfragen des CIDI (DIA-X- Interview). Der Bogen orientiert sich im Vergleich zu anderen Verfahren an der Lebenszeitdiagnostik, er kann aber ggf. auch auf andere Zeiträume bezogen werden. Im Rahmen des US National Comorbidity Survey und des Bundesgesundheitssurveys ´98 wurde der Bogen systematisch überprüft, wobei die Sensitivität als hinreichend gut, die Spezifität nur für drei Störungsbereiche als weniger gut zu beurteilen ist. Er gilt als sehr zeitökonomisches, kategorial orientiertes Screeninginstrument für die wichtigsten psychischen Störungen (Wittchen et al., 1999a). Primary Care Evaluation of Mental Disorders (Prime-MD) Die Primary Care Evaluation of Mental Disorders ist ein System, welches die schnelle und genaue Feststellung und Diagnose psychischer Störungen erleichtert, die bei Patienten in der allgemeinärztlichen Praxis am häufigsten auftreten (Spitzer et al., 1995). Die originale Validierungsstudie erbrachte gute Übereinstimmungskoeffizienten zwischen den Diagnosen der Allgemeinärzte durch Prime-MD und deren Validierung durch psychiatrische Fachdiagnosen (Kappa = 0.71). Inzwischen gibt es eine weiter verkürzte Version, die nur vom Patienten auszufüllen ist (Patient Health Questionnaire - PHQ bzw. Brief PHQ) und ebenfalls gute Sensitivitäts- und Spezifitätsscores erbringt (Spitzer et al., 1999). Vorteil des Verfahrens ist neben der Möglichkeit, sowohl dimensionale als auch kategoriale Klassifikationen vorzunehmen und die hohe Zeitökonomie. Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) Die Hospital Anxiety and Depression Scale ist ein kurzer Selbstbeurteilungsfragebogen zur Erfassung von Angst und Depressivität. Das Instrument wurde zum gezielten Einsatz bei Patienten in somatisch-medizinischen Einrichtungen entwickelt und auch in Deutschland validiert (Herrmann, Buss & Snaith, 1995). Explizit wurde in der Entwicklung dem Problem der Kriterienkonfundierung von depressiven Symptomen und körperlichen Beschwerden bei primär somatisch kranken Patienten Rechnung getragen. Die Skala besteht aus zwei Subskalen zu je sieben Depressivitäts- und Ängstlichkeitsitems. Validität und faktorielle Strukur wurden in zahlreichen Studien untersucht, die interne Konsistenz beträgt 0.8 (Angstskala) bzw. 0.81 (Depressionsskala), die Retest-Reliabilität 0.81-0.89, klinisch relevante Cut-off-Werte mit zufriedenstellenden Sensitivitäts- und Spezifitätswerden werden berichtet. Unklar bleibt allerdings, ob die zweifakorielle Struktur eher durch die Komorbidität von Ängstlichkeit und Depressivität oder eine Diskriminationsschwäche der Subskalen bedingt ist (vgl. Reuter & Härter, 2001). Weitere gebräuchliche Skalen wie die Allgemeine Depressionsskala (CES-D / ADS), der Depressions-Screening Questionnaire (DSQ), das Beck Depression Inventory for Primary Care 18 (BDI-PC), und der Fragebogen zur Depressionsdiagnostik nach DSM-IV (FDD-DSM-IV) sowie der Anxiety-Screening Questionnaire (ASQ) sind in der Übersichtsarbeit unserer Arbeitsgruppe dargestellt (Härter, 2001). 2.3 Prävalenz psychischer Störungen Epidemiologische Untersuchungen zur Erforschung psychischer Störungen können auf den Ebenen a) der Allgemeinbevölkerung (community, general population), b) der primärärztlichen bzw. klinisch-somatischen Versorgung (primary care) und c) der Ebene der psychiatrischen Versorgung (mental health services) durchgeführt werden, wobei mit den jeweiligen Zugangsweisen bestimmte Vor- und Nachteile verbunden sind. Studien zu ätiologischen Fragestellungen können eher auf der Ebene der Allgemeinbevölkerung als bei behandelten Personen durchgeführt werden. Es liegen weniger Selektionsmechanismen zugrunde, speziell bzgl. der Wahrscheinlichkeit einer Exposition gegenüber möglichen Risikofaktoren. Außerdem kann eine Verzerrung der Ergebnisse durch verschiedene Variablen (sog. Berkson´s Bias) vermieden werden, die zwar ätiologisch nicht in Beziehung zur Erkrankung stehen, aber die Wahrscheinlichkeit beeinflussen, dass eine Person Gesundheitsdienste in Anspruch nimmt. Zur Frage der Häufigkeit psychischer Störungen in der Allgemeinbevölkerung wurden seit den 60er Jahren international umfangreiche Studien durchgeführt (z.B. Dohrenwend et al., 1980; Leighton et al., 1963; Srole et al., 1962). In Deutschland erlangte die psychiatrische Epidemiologie in den 80er und 90er Jahren angemessenen wissenschaftlichen Stellenwert (Arolt, Driessen & Dilling, 1997; Dilling, Weyerer & Castell, 1984; Linden et al., 1996; Schepank, 1987; Wittchen et al., 1999b). Epidemiologische Studien verzeichneten insbesondere im letzten Jahrzehnt große Erfolge: Auf der einen Seite konnten wissenschaftlich anspruchsvolle analytisch-epidemiologische Untersuchungen bedeutende Beiträge zum Zusammenhang bestimmter Risikofaktoren (z.B. Geburten im späten Winter, mütterliche Grippeerkrankung im zweiten Trimenon) und der Häufung schizophrener Erkrankungen im jungen Erwachsenenalter leisten (Henderson, 1999). Auf der anderen Seite zeigten große deskriptive Bevölkerungsstudien, dass psychische Störungen nicht nur ein häufiges Problem in verschiedenen institutionellen Versorgungsbereichen (z.B. hausärztliche Praxis, Akutkrankenhaus) darstellen, sondern zu einem substanziellen Teil auch in der Allgemeinbevölkerung auftreten. 19 Tabelle 3: Ein-Jahres- und Lebenszeit-Prävalenzen psychischer Störungen (in %) im National Comorbidity Survey (Kessler et al., 1994) im Vergleich zum Bundesgesundheitssurvey ´98 (Wittchen, 2000b) Störungen 12-Monats-Prävalenz 12-Monats-Prävalenz Lebenszeit-Prävalenz (NCS) (Survey ´98) (NCS) Affektive Störungen Major Depression Manische Episode Dysthymie 11,3 10,3 1,3 2,5 (11,5) 19,3 17,1 1,6 6,4 Angststörungen Panikstörung Agoraphobie mit Panikstörung Soziale Phobie Einfache Phobie GAD 17,2 2,3 2,8 7,9 8,8 3,1 (14,5) 24,9 3,5 5,3 13,3 11,3 5,1 Suchterkrankungen Alkoholmissbrauch Alkoholabhängigkeit Drogenmissbrauch Drogenabhängigkeit 11,3 2,5 7,2 0,8 2,8 (6,8) 26,6 9,4 14,1 4,4 7,5 Psychosen Antisoziale Persönlichkeit 0,5 - (2,6) 0,7 3,5 Irgendeine Störung 29,5 (32,1) 48,0 - (48,0) 56,0 Komorbide Störungen Die Ergebnisse der großen US-amerikanischen Studien, der Epidemiological Catchment Area Study (ECA, Robins & Regier, 1991) und des späteren National Comorbidity Survey (NCS, Kessler et al., 1994), führten dazu, dass verschiedene Länder die Infrastruktur ihrer Gesundheitseinrichtungen auf kommunaler Ebene als verbesserungswürdig realisierten. Auch wenn diese Studien teilweise unterschiedliche Messinstrumente zur Erfassung der Prävalenz psychischer Störungen verwendeten, was einen erheblichen Einfluss auf die Prävalenzen haben kann, sind die Ergebnisse doch sehr ähnlich: Die Ein-Jahres-Prävalenz psychischer Störungen (insgesamt) beträgt nach diesen Studien in repräsentativen Stichproben aus der Allge- 20 meinbevölkerung 28,6% (ECA-Study, Diagnosen nach DSM-III, Robins & Regier, 1991) bzw. 29,5% im National Comorbidity Survey (Diagnosen nach DSM-III-R, Kessler et al., 1994) sowie 32,1% im Bundesgesundheitssurvey `98 (Diagnosen nach DSM-IV, Wittchen, 2000b). Der National Comorbidity Survey und der Bundesgesundheitssurvey ´98 fanden darüber hinaus, dass fast die Hälfte der Studienteilnehmer mindestens eine psychische Störung in ihrem Leben aufwiesen (Lebenszeitprävalenz). Die häufigsten Störungsbilder waren depressive und Angststörungen mit 12-Monats-Prävalenzen von 17% und 11% (Tab. 3). Ein ebenfalls bedeutsames Ergebnis war die Häufigkeit komorbider psychischer Störungen, d.h. das gleichzeitige Vorliegen mehrerer psychischer Beeinträchtigungen (Kessler et al., 1994; Kessler, 1995; Wittchen, 2000b; Wittchen et al., 1999b). Eine weitere wichtige internationale epidemiologische Untersuchung der letzten Jahre, die Studie zu Mental Illness in General Health Care zeigte, dass ca. 24% der in der primärärztlichen Versorgung befindlichen Patienten aktuell über psychische Symptome berichten (6-MonatsPrävalenz), die die Kriterien einer psychischen Störung erfüllen (Diagnosen nach ICD-10, Üstün & Sartorius, 1995). Von großer Bedeutung bei dieser Studie war zusätzlich, dass fast jeder zehnte Patient über psychische Beeinträchtigungen berichtete, die nur knapp die Kriterienschwelle für psychische Störungen verfehlten (unterschwellige Störungen) und fast ein Drittel Symptome psychischer Störungen aufwies (Abb. 1). Vier Störungsbereiche, die affektiven, Angst- und Suchterkrankungen sowie die somatoformen Störungen waren auch in dieser Studie am häufigsten bei den Patienten in den Allgemeinarztpraxen als Problembereiche benannt worden. Die psychischen Störungen hatten starke körperliche und soziale Einschränkungen (impairment) zur Folge, die Beeinträchtigung wurde von den Patienten mit psychischen Störungen höher eingeschätzt als von Patienten mit chronischen körperlichen Erkrankungen (z.B. mit Hypertonie, Diabetes, Arthritis). Die meisten Patienten (fast 80%) erfuhren eine Behandlung ihrer psychischen Probleme, meist mittels Beratungsansätzen, sedierender oder antidepressiver Medikation, allerdings ohne adäquate Berücksichtigung der zugrunde liegenden Diagnosen. Als Konsequenzen der Studie wurde einerseits eine verbesserte Entdeckung psychischer Störungen und ihrer adäquaten Behandlung gefordert. Andererseits wurde auf die Bedeutung von Studien zur strukturellen Verbesserung der Gesundheitsdienste (Erkennen – Management – Ergebnis) und der Entwicklung bzw. Übertragung von Behandlungsansätzen bei psychischen Störungen in die primärärztliche Versorgung abgehoben. Schließlich wurden zukünftige Untersuchungsansätze vorge- 21 schlagen, die die Behinderung durch psychische Störungen, die Kosten durch diese Erkrankungen, z.B. in der Allgemeinarztpraxis, und die Effektivität von Behandlungsansätzen untersuchen (Üstün et al., 1995). Abbildung 1: Psychische Störungen in der hausärztlichen Versorgung (N=5438, WHO-Studie, Üstün & Sartorius, 1995) unterschw ellig 9,0% aktuell 24,0% symptomatisch 31,0% gesund 36,0% In den letzten Jahren sind aufgrund der Weiterentwicklung der klassifikatorischen Ansätze der heute gültigen ICD-10 und des DSM-IV zahlreiche diagnostische Verfahren, sowohl Interviews als auch Fremd- und Selbstbeurteilungs- bzw. Screeninginstrumente, für die relevanten psychischen Störungen neu entwickelt bzw. adaptiert worden. V.a. das ältere DIS und das CIDI sowie frühere Verfahren (z.B. SADS, PSE) sind in großen epidemiologischen Studien, die auf repräsentative Stichproben der Allgemeinbevölkerung zielten, eingesetzt und bzgl. ihrer Gütekriterien zur Entdeckung von Fällen bzw. zur Diagnosenstellung systematisch überprüft worden. In den „Milestone-Studies“ der letzten Jahre wurden das DIS (ECA-Study, Robins & Regier, 1991) und das CIDI (NC-Survey, Kessler et al., 1994; BGS ´98, Wittchen, 2000b) benutzt, wo sie sich als reliable und valide sowie effiziente Instrumente bewährt haben. Darüber hinaus erlauben sie durch 22 den (möglichen) Einsatz trainierter Laieninterviewer die Gewinnung großer Stichproben in relativ kurzer Zeit. In epidemiologisch orientierten Untersuchungen in klinischen Settings hat sich hingegen v.a. das SKID (Versionen für Achse-I- und Achse-II-Störungen) bewährt, das aber klinisch erfahrene Interviewer erfordert. Hinsichtlich der eingesetzten Screeningverfahren geht der Trend in nicht-klinischen Stichproben hin zu kurzen und möglichst sensitiven Verfahren mit guten Spezifitätswerten. Psychische Beeinträchtigungen zur Fallidentifikation können im Sinne des dimensionalen Ansatzes störungsübergreifend (z.B. mit Hilfe des GHQ-12) oder störungsspezifisch (z.B. mit spezifischen Depressionsskalen) erhoben werden. Für die kategoriale Diagnostik liegen ebenfalls sowohl störungsübergreifende (z.B. SSQ) als auch störungsspezifische Skalen (z.B. ASQ) vor. Für die Entdeckung komorbider depressiver und angstbezogener Störungen in der Organmedizin liegen ebenfalls kurze, dimensional konzipierte Skalen vor (z.B. HADS). Neue Ansätze versuchen, auf der Selbstbeurteilungsebene den kategorialen und dimensionalen Ansatz in der Diagnostik zu verbinden (z.B. FDD-DSM-IV, Kühner, 1997). Für das Screening in der primärärztlichen Versorgung wird seit kurzem das Prime-MD-System und der zugehörige Fragebogen (PHQ) favorisiert, da es ein sensitives Screening auf Patientenebene und eine valide Diagnostik durch den Hausarzt ermöglicht. Große Fortschritte in der Epidemiologie psychischer Störungen bei Personen aus der Allgemeinbevölkerung wurden durch mehrere Studien in den letzten Jahren erzielt, die sowohl für die USA (ECA-Study; NC-Survey), für Deutschland (Bundesgesundheitssurvey ´98) als auch für europäische und nicht-europäische Länder (z.B. WHO-Studie) verlässliche und homogene Prävalenzraten von psychischen Störungen ermittelten. Auch wenn es zentrale Unterschiede im methodologischen Vorgehen der Studien gab (z.B. unterschiedliche Interview-Versionen des CIDI bzw. DIS, Einschluss verschiedener Störungsbereiche, unterschiedliche Kulturen, vgl. Regier et al., 1998), ist es dennoch bemerkenswert, dass die Schätzungen der Prävalenz psychischer Störungen sehr ähnlich sind. Man kann nach diesen Studien davon ausgehen, dass ca. 30% aller Personen aus der Allgemeinbevölkerung die Kriterien einer psychischen Störung – bezogen auf den Zeitraum der letzten 12 Monate – erfüllen (Kessler et al., 1994; Robins & Regier, 1991; Wittchen, 2000b; Regier et al., 1998). Hingegen gibt es zahlreiche relevante Unterschiede in der Häufigkeit einzelner Syndrome bzw. Syndromklassen (z.B. Raten von Sucherkrankungen im NCS > ECA; Raten von Angsterkrankungen, speziell Phobien ECA > NCS, vgl. Regier et al., 23 1998), die eine Abschätzung dieser Syndromhäufigkeiten in der Bevölkerung erschweren. Die größten Defizite liegen bei all den genannten Studien aber in der bisher mangelnden Differenzierung von „Diagnose“ und „Behandlungsbedarf“. Es wird bisher davon ausgegangen, dass die aufgenommenen Störungsbereiche (psychotische Störungen, Angst- und Suchterkrankungen, affektive Störungen und neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen sowie Essstörungen) – quasi aufgrund der Diagnosenstellung - auch behandlungsbedürftig sind (Andrews & Henderson, 2000). Als behandlungsbedürftig werden Störungen angesehen, die einerseits klar (diagnostisch) definiert sind und assoziierte Behinderungen bzw. Einschränkungen zur Folge haben und für die andererseits effektive und akzeptierte Behandlungsmaßnahmen zur Verfügung stehen. Schließlich gibt es für diese Störungsbereiche hinreichend differenzierte ätiologische und pathogenetische Erkenntnisse sowie Spontanverlaufsbeobachtungen (Wittchen, 2000c). Zur valideren Abklärung des (individuellen) Behandlungsbedarfs sollten daher statt der alleinigen Erhebung der Häufigkeiten psychischer Störungen in epidemiologischen Studien ihr jeweiliger Schweregrad, die daraus resultierende Behinderung, die Beeinträchtigung der Lebensqualität und die Periodendauer psychischer Beeinträchtigungen sowie die tatsächliche Inanspruchnahme von therapeutischen Angeboten ergänzend erhoben werden (Regier et al., 1998; Frances, 1998; Wittchen, 2000d). Dieses Vorgehen wird die Operationalisierung einer behandlungsbedürftigen Störung in zukünftigen Studien besser ermöglichen (Spitzer, 1998). Zukünftige Forschungsvorhaben sollten – neben der Beachtung des Einsatzes vergleichbarer Methodologien zur Erfassung psychischer Störungen – auch berücksichtigen, dass die bisher eingesetzten Messverfahren möglicherweise eher zu einer „Überdiagnostik“ milderer Störungsbilder (z.B. leichte Tier-Phobien, leichte depressive Verstimmungen) führen können, der Fokus jedoch eher auf den schweren psychiatrischen Erkrankungsbildern liegen sollte (z.B. Schizophrenie, Suchterkrankungen, schwere rezidivierende Depressionen), die auch von hoher gesundheitspolitischer Bedeutung sind (Regier et al., 1998). Schließlich wird es in zukünftigen epidemiologischen Studien von Bedeutung sein, die mittels Laieninterview gewonnenen diagnostischen Aussagen durch klinische Interviews zu validieren, insbesondere bei denjenigen Störungen, die am ehesten falsch positive Resultate erbringen (Frances, 1998). 24 3 Psychische Störungen bei körperlichen Erkrankungen Vielen Klinikern ist aus der täglichen Arbeit mit Patienten bekannt, dass eine enge Beziehung zwischen psychischen und körperlichen Erkrankungen besteht. Diese empirisch fundierte Assoziation stammt sowohl aus zahlreichen klinischen Studien von Patienten mit körperlichen Erkrankungen als auch von Patienten, die sich wegen einer psychischen Störung in Behandlung befinden (Stevens, Merikangas & Merikangas, 1995). Unabhängig von der Erkrankung, aufgrund derer die Patienten eine Behandlung aufgesucht haben, ist die präzise Erfassung komorbider Störungen außerordentlich wichtig, da diese weitreichende Konsequenzen für die Diagnostik, die Behandlung und den Verlauf der körperlichen wie psychischen Störungen haben können (Stevens et al., 1995). 1970 wurde Komorbidität definiert als „... any distinct additional clinical entity that has existed or that may occur during the clinical course of a patient who has the index disease under study... " (Feinstein, 1970). 3.1 Komorbidität In der Vergangenheit wurden mehrere Ansätze verfolgt, das gleichzeitige Vorliegen somatischer und psychischer Störungen, speziell einer komorbiden depressiven Störung, besser zu klassifizieren. Von Woodruff, Murphy und Herjanic (1967) wurde die Unterscheidung in primäre und sekundäre Depressionen auf der Grundlage des Beginns der jeweiligen Störung vorgeschlagen. Eine primäre Depression tritt in der Abwesenheit oder vor dem Beginn einer somatischen Erkrankung, eine sekundäre Depression nach dem Beginn einer körperlichen Störung auf. Trotz seiner klinischen Nützlichkeit konnte sich dieses Konzept aber wegen der mangelnden Validität der Unterscheidung nicht durchsetzen, v.a. weil die Reliabilität der retrospektiven Erfassung des Erkrankungsbeginns gering ist. Auch die bis in die frühen 90er Jahre gültigen Klassifikationssysteme für Erkrankungen, das DSM-III-R und die ICD-9, wiesen keine diagnostische Entitäten für psychische Beeinträchtigungen bei körperlichen Erkrankungen auf. In der 4. Revision des DSM wurden separate Kategorien für psychische Störungen aufgrund einer somatischen Erkrankung aufgenommen (American Psychiatric Association, 1994). Liegen eine psychische Störung und eine somatische Erkrankung gleichzeitig vor, gibt es mehrere Erklärungsmöglichkeiten für die Komorbidität (Creed, 1997; Depression Guideline Panel, 1993; Härter, 2000a; Kapfhammer, 2000; Mayou, 1997): 25 1. Die somatische Erkrankung (oder die zu ihrer Behandlung eingesetzten Medikamente) verursachen biologisch die psychische Störung, z.B. führt eine Schilddrüsenunterfunktion zu depressiven Symptomen wie Anergie etc. 2. Die somatische Erkrankung geht der Entwicklung einer psychischen Störung bei genetisch vulnerablen Personen zeitlich voraus, z.B. kann ein Morbus Cushing einer Episode einer Major Depression vorangehen. 3. Die psychische Störung entwickelt sich als Reaktion auf eine somatische Erkrankung und ihre Behandlung, z.B. entwickelt ein Patient eine Anpassungsstörung mit ängstlichen und depressiven Anteilen als Reaktion auf eine Tumorerkrankung. 4. Die psychische Störung geht dem Beginn körperlicher Symptome voraus und kann aktuell für sie verantwortlich sein (Somatisierung), z.B. kann eine depressive Episode für den Übergang von akuten in chronische Rückenschmerzen mit verursachend sein. 5. Die psychische Störung verursacht/beeinflusst die Auslösung einer körperlichen Erkrankung, z.B. haben Patienten mit depressiven Syndromen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, eine koronare Herzerkrankung zu entwickeln. 6. Die somatische und depressive Störung sind nicht kausal miteinander verbunden (rein zeitliche Koinzidenz). Bezogen auf die Entscheidung, welche therapeutischen Strategien bei Vorliegen einer komorbiden psychischen Störung sinnvoll sind, ist es sehr wichtig, wenn möglich, zwischen diesen Optionen zu unterscheiden: Trifft z.B. eine der ersten beiden Bedingungen zu, geht es zunächst darum, die zugrundeliegende somatische Störung zu behandeln. Bei Vorliegen der anderen Bedingungen werden effektive Behandlungsansätze sinnvollerweise parallel eingesetzt, während die somatische Störung behandelt wird. Bedacht werden sollte darüber hinaus, ob biologische (z.B. Medikamente wie Antihypertensiva, Hormonpräparate, Antihistaminika) oder soziale Bedingungsfaktoren (z.B. krankheitsbedingter Verlust sozialer Rollen und Aktivitäten) die psychischen Symptome ausgelöst haben könnten (weiterführend: Kapfhammer, 2000; Stoudemire, Fogel, Gulley & Moran, 1993). 3.2 Prävalenz psychischer Störungen bei körperlichen Erkrankungen Über eine enge Beziehung zwischen somatischen und psychischen, insbesondere depressiven Beschwerden und Störungen, ist konsistent in vielen Studien berichtet worden (Stevens et al., 1995; Katon & Sullivan, 1990). Frühe Reviews berichten z.B. über Schätzungen der Prävalenz depressiver Störungen bei somatisch erkrankten Patienten von 20% bis 83% (Editorial, 1979 in Stevens et al., 1995). Eine Übersichtsarbeit über die Häufigkeit depressiver Störungen bei Pati- 26 enten mit somatischen Erkrankungen berichtet in einer Zusammenfassung der 1960 bis 1990 durchgeführten Studien, alle auf der Basis klinischer semi-strukturierter oder standardisierter psychiatrischer Interviews, über eine Häufigkeit von 0% bis 54% depressiver Störungen, für eine Major Depression von 2,2% bis 14,6% (Cohen-Cole, Brown & McDaniel, 1993). Der letztere Befund steht in Einklang mit einer Zusammenfassung epidemiologischer Ergebnisse zur Diagnostik und Behandlung depressiver Störungen in der hausärztlichen Versorgung, bei der angegeben wird, dass ca. 12% - 36% aller Patienten mit somatischen Erkrankungen über klinisch signifikante depressive Symptome berichten (Depression Guideline Panel, 1993). Größere psychiatrisch-epidemiologische Studien im Bereich der ambulanten Versorgung aus den 80er Jahren, die standardisierte diagnostische Interviewverfahren einsetzten, berichten Prävalenzraten von 4,8% bis 9,2% für eine Major Depression und von 9% bis 20% für depressive Störungen bei ambulant behandelten Patienten (Depression Guideline Panel, 1993; Katon & Sullivan, 1990; Üstün & Sartorius, 1995). Bei stationär behandelten Patienten erhöhen sich diese Prävalenzen auf 8% für eine Major Depression und 15% bis 36% für alle depressiven Störungen (Katon & Sullivan, 1990; McDaniel, Musselman, Porter, Reed & Nemeroff, 1995). Diese Schätzungen überschreiten zum Teil die Prävalenzraten für depressive Störungen, die in den vergangenen Jahren durch große bevölkerungsepidemiologische Studien beschrieben wurden (vgl. Kap. 5, Robins & Regier, 1991; Kessler et al., 1994; Wittchen, 2000b). Auch hier sind die Ergebnisse nicht konsistent und erfordern eine differenzierte Analyse und Interpretation der unterschiedlichen Befunde (Regier et al., 1998). Prävalenz- und Komorbiditätsraten schwanken, z.T. nicht unerheblich, je nach der untersuchten Population, der Stichprobengröße, der untersuchten Art und Schwere der somatischen Störung und der eingesetzten Untersuchungsmethodik (vgl. Tab. 4). Hier zeigen sich z.B. bedeutsame Unterschiede aufgrund der Entwicklung und des Einsatzes verschiedener standardisierter klinischer Interviews, außerdem hängen die Ergebnisse davon ab, wie reliabel und valide die körperliche Störung selbst erfasst werden konnte (Regier et al., 1998; Härter, 2000a, 2000b). Werden Studien betrachtet, die für die Schätzung von Prävalenzraten Selbstbeurteilungsund Screeningverfahren eingesetzt haben, schwanken die Prävalenzraten für depressive Symptome noch stärker (2% bis 70%, Cohen-Cole et al., 1993). Hier gilt es zu bedenken, dass die Ergebnisse sowohl aus methodischen Gründen (Instrument, Stichprobenart und -größe etc.) als auch aufgrund der Nutzung unterschiedlicher „Cut-off“-Werte schwanken können (siehe Kap. 2). 27 Tabelle 4: Faktoren der Variabilität von Prävalenzen in epidemiologischen Studien • Untersuchungsfeld, z.B. Art und Schwerpunkt der Behandlungseinrichtung (Praxis, Klinik) • Reliabilität und Validität der Erfassung somatischer und psychischer Erkrankungen • Schweregrad der Erkrankung, z.B. Assoziation zwischen somatischem Schweregrad und Ausprägung der psychischen Symptomatik • Klassifikationssystem (ICD- bzw. DSM-Version und Beurteilungsebenen Achse I und II) • Wahl des Erhebungszeitpunktes, Patienten mit längerer Aufenthaltsdauer werden mit größerer Wahrscheinlichkeit untersucht, die Prävalenzen erhöhen sich • Auswahl des Untersuchungsansatzes, Vor- und Nachteile von Selbst- oder Fremdbeurteilungsbögen, Einsatz standardisierter Interviews oder Kombinationen der Verfahren • Auswahl der Messinstrumente, insbesondere die „Passung“ für den Anwendungsbereich • Prävalenzzeitraum, z.B. schwanken Prävalenzangaben je nachdem, ob aktuelle 4-Wochen-, 6-Monats- oder 12-Monatszeiträume betrachtet werden Auch muss beachtet werden, ob die Schätzungen der Häufigkeit psychischer Störungen aufgrund unterschiedlicher Untersuchungszeiträume verglichen werden können, da häufig eingesetzte Selbstbeurteilungsinstrumente (BDI, HADS, GHQ etc.) für eine Prävalenzschätzung psychischer Symptome in der Regel 1- bis 4-Wochenzeiträume (aktuelle Punktprävalenz) betrachten. Hingegen beziehen sich die Fragen in standardisierten klinischen Interviews oft auf die Schätzung von 6-Monats-, 12-Monats- und/oder Lebenszeitprävalenzen. Psychische Störungen bei Tumorerkrankungen Eine Tumorerkrankung stellt für die erkrankten Patienten einen tiefen Einschnitt in ihr bisheriges Leben dar. Die meisten Patienten sind in der Zeit nach Diagnosenstellung in der Lage, alleine oder mit Hilfe von Behandlern, Familie und Freunden die Krankheit und ihre Folgen zu verarbeiten und mit der veränderten Lebenssituation umzugehen. Ein signifikanter Anteil der Krebspatienten entwickelt jedoch nach Diagnosenstellung bzw. während der Therapie psychische Störungen, die eine klinisch relevante Ausprägung erreichen und einer speziellen Behandlung bedürfen. Bei einem weiteren Anteil der Patienten liegen bereits prämorbid (vor der Krebserkrankung) psychische Störungen vor, die z.B. unter erhöhter Belastung durch die Erkrankung und Therapie 28 erneut auftreten (z.B. rezidivierende depressive Erkrankungen) oder schon jahrelang chronisch bestehen (z.B. generalisierte Angststörung, Dysthymie). In den letzten Jahren wurden hauptsächlich im angloamerikanischen Sprachraum zahlreiche Studien zur Prävalenz psychischer Erkrankungen bei Tumorpatienten durchgeführt (Übersicht: Katon & Sullivan, 1990; McDaniel et al., 1995; Stevens et al., 1995). Schwerpunkt der verschiedenen Studien war die Untersuchung depressiver Störungen, die besonders häufig mit Krebserkrankungen assoziiert sind. DeFlorio und Massie (1995) beschreiben in ihrem Review 49 Studien, van`t Spijker und Kollegen (1997) in ihrer Metaanalyse 58 zwischen 1980 und 1994 durchgeführte Studien, die diese Assoziation untersuchten. Noyes und Kollegen (1998) berichten über 23 Studien zur Prävalenz von Angststörungen bei Tumorpatienten innerhalb der letzten 25 Jahre. Inzwischen sind die Ergebnisse dieser Studien und ihre klinischen Implikationen darüber hinaus in einer Reihe von Übersichtsarbeiten berücksichtigt worden (Breitbart, 1995; McDaniel et al., 1995; Sellick & Crooks, 1999). Die Prävalenzraten für allgemeine psychische Belastungen bzw. psychische Störungen bei Krebspatienten werden zwischen 5% und 50% angegeben, die Häufigkeit depressiver Störungen liegt dabei zwischen 0% und 46% und für Angststörungen zwischen 0,9% und 49% (Noyes et al., 1998; van`t Spijker et al., 1997). Für depressive Syndrome oder generalisierte Angststörungen berichten Katon und Sullivan (1990) in ihrer Zusammenfassung von Studien, die strukturierte oder semi-strukturierte psychiatrische Interviews einsetzen, Prävalenzraten von 20% bis 45%. Eine sorgfältig durchgeführte und häufig zitierte Studie von Derogatis et al. (1983) an einer Zufallsstichprobe stationärer Patienten fand, dass 53% der Patienten gut mit der Erkrankung umgehen konnten. Von den verbleibenden 47% wiesen 68% Kriterien einer Anpassungsstörung, 13% für eine Major Depression, Dysthymie oder bipolare affektive Störung auf. Weitere 8% hatten eine organische psychische Beeinträchtigung (Delirium), 7% eine Persönlichkeitsstörung und 4% eine Angststörung. In der zweiten Studie setzten Bukberg und Kollegen (1984) ein standardisiertes diagnostisches Interview nach den DSM-III-Kriterien ein. Sie zeigten, dass 77% der stationär behandelten, fortgeschritten erkrankten Patienten depressive Störungen aufwiesen, hingegen nur 23% der weniger beeinträchtigten ambulanten Patienten. Ergebnisse aus eigenen Studien zu Prävalenzraten psychischer Störungen bei Tumorpatienten werden in Kapitel 5 vorgestellt (Härter et al., 2000a; Härter et al. 2001a). 29 Bis heute ist es aufgrund der empirischen Datenlage nicht möglich, die Prävalenz psychischer Störungen bei verschiedenen Tumorformen zu differenzieren (Ausnahme: Pankreaskarzinome mit hoher Prävalenz depressiver Syndrome). Entgegen früheren Mythen, dass „alle Patienten mit einer Krebserkrankung psychiatrischer/psychologischer Betreuung bedürfen“ oder „Patienten kommen gut damit zurecht und benötigen wenig Unterstützung“, zeigt sich, dass die Prävalenzen hinsichtlich psychischer Störungen bei Tumorpatienten denen bei anderen körperlichen Erkrankungen weitgehend entsprechen (Härter, 2000a; Härter et al., 2001a). Liegen psychische Störungen vor, schränken diese die betroffenen Tumorpatienten allerdings massiv in ihrer persönlichen und sozialen Funktionsfähigkeit ein, können die Compliance senken und gefährden eine optimale medizinische Behandlung (Wells, Golding & Burnam, 1988; Härter et al., in press). Aus diesen Gründen ist die Identifikation derjenigen sozialen, personen- und krankheitsbezogenen Faktoren, die das Auftreten von depressiven und Angststörungen begünstigen, sinnvoll und notwendig (Harrison & Maguire, 1994). Darüber hinaus ist es bei Kenntnis relevanter Risikofaktoren für die Entwicklung psychischer Störungen im Sinne primärer Prävention möglich, den besonders gefährdeten Patienten adäquate Unterstützung anzubieten, bevor sich psychische Störungen manifestieren. In der Vergangenheit wurden zahlreiche potenzielle Risikofaktoren für psychische Störungen bei Tumorpatienten empirisch untersucht (Goldberg & Cullen, 1985). Breitbart (1995) schlug zum Beispiel als Einteilung die Kategorien „krankheitsbezogen“, „behandlungsbezogen“, „psychiatrische Vorgeschichte“ und „soziale Faktoren“ vor. Aus methodischer Sicht ist problematisch, dass in vielen Primärstudien lediglich Korrelationen auf bivariater Ebene berechnet wurden, die aufgrund von Konfundierungen keine Aussage über den unabhängigen Einfluss einzelner Faktoren zulassen (vgl. Aschenbrenner et al., in Druck). Zur Analyse von Risikofaktoren für psychische Störungen bei Krebspatienten haben wir in eigenen Arbeiten unserer Arbeitsgruppe relevante Studien mittels einer Literaturrecherche für die Jahre 1980 bis 2000 identifiziert (Aschenbrenner, 1999; Aschenbrenner et al., in Druck). Es wurden 31 Studien ausgewählt, die Prädiktoren auf multivariater Ebene in Form einer logistischen oder linearen Regressionsanalyse analysiert haben. Als Kriterium oder abhängige Variable wurde die Erfassung psychischer Belastungen durch Fragebogenskalen zu Depressivität, Ängstlichkeit oder allgemeiner psychischer Belastung oder die Diagnose psychischer Störungen (nach DSM/ICD) durch klinische Interviews gesetzt. Nur wenige der untersuchten krankheitsbezoge- 30 nen, soziodemographischen und psychosozialen Variablen zeigten auf multivariater Ebene einen Einfluss auf die psychische Belastung von Tumorpatienten. Betrachtet man die Auswirkungen der Tumorerkrankung und ihrer Behandlung, scheinen am ehesten Patienten in fortgeschrittenem Krankheitsstadium, mit geringer körperlicher Funktionsfähigkeit und Schmerzen sowohl von allgemeiner psychischer Belastung als auch von Depressivität und Ängstlichkeit betroffen zu sein. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit früheren Reviews zu dieser Fragestellung (Bukberg et al., 1984; Lesko, Massie & Holland, 1993; McDaniel et al., 1995). Jüngere Patienten leiden häufiger unter Ängstlichkeit, während Frauen ein höheres Risiko für allgemeine psychische Belastung und Depressivität aufweisen. Im Gegensatz zu einer depressiven Vorerkrankung erwies sich das Vorhandensein irgendeiner psychischen Störung in der Vorgeschichte als besserer Prädiktor für Depressivität. Schließlich scheint ein bestehendes Netz an sozialer Unterstützung Tumorpatienten vor depressiven Episoden zu schützen. Diese Ergebnisse müssen allerdings vor dem Hintergrund vielfältiger methodischer Einschränkungen interpretiert werden, die im wesentlichen in der Heterogenität der untersuchten Studien begründet ist. Psychische Störungen bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen Die Bedeutung psychischer Faktoren für die Entwicklung und den Verlauf einer kardiologischen Erkrankung wurde in Einzelfallbeobachtungen schon sehr früh erkannt. In einzelnen Studien wurde ein Zusammenhang von Angst und Depression mit der Überlebenswahrscheinlichkeit nach einem Herzinfarkt beschrieben (Lebovits, Shekelle, Ostfeld & Oglesby, 1967). Auch fand sich ein erhöhtes Risiko für einen plötzlichen Herztod bei Vorliegen von depressiven Symptomen nach Myokardinfarkt (Bruhn, Paredes, Adsett & Wolf, 1974) und die erleichterte Auslösbarkeit von ventrikulären Tachykardien und Kammerflimmern bei komorbiden depressiven Syndromen (Reich, DeSilva, Lown & Murawski, 1981). Seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde die Interaktion von psychischen Symptomen bzw. Störungen mit kardialen Beschwerden wie unspezifischen Brustschmerzen, Rhythmusstörungen (Tachykardien) und manifesten kardiovaskulären Erkrankungen (z.B. Myokardinfarkt, Hypertonie) systematisch untersucht (Bruhn et al., 1974; Costa et al., 1985; Ferketich, Schwartzbaum, Frid & Moeschberger, 2000; Ford et al., 1998; Hemingway & Marmot, 1999; Katon et al., 1988; Kubzansky & Kawachi, 2000; Musselman, Evans & Nemeroff, 1998). 31 Ängstliche und depressive Symptome stehen darüber hinaus häufig in Verbindung mit Brustschmerzen und Tachykardien bei Personen ohne Evidenz für eine kardiale Erkrankung und können zu kostenintensiven und invasiven Maßnahmen führen (Katon, Sullivan & Clark, 1995). Unter Patienten mit thorakalen und kardialen Beschwerden, aber ausgeschlossener koronarer Herzerkrankung, wurde immer wieder eine relativ hohe Prävalenz psychischer Auffälligkeiten beschrieben. Z.B. wurde bei erstmals angiographierten Patienten mit thorakalen Beschwerden eine Häufung verschiedener Formen angstbetonter psychischer Störungen bei unauffälligem Koronarbefund beobachtet (Chignon, Lepine & Ades, 1993; Costa et al., 1985; Katon et al. 1988; Katon et al., 1995). Beitmann et al. (1989) fanden bei 25-33% dieser Patienten ein Paniksyndrom als Ursache der Beschwerden. Herrmann, Scholz und Kreuzer (1991) fanden bei einer unausgelesenen Stichprobe von kardiologischen Patienten, die zum Belastungs-EKG vorgestellt wurden, 20% mit Angststörungen oder depressiven Störungen (Fragebogenscreening mit der HADS). Chignon et al. (1993) entdeckten bei einem ähnlichen Untersuchungsansatz 16% Patienten mit einer Panikstörung. Bei Durchführung strukturierter psychiatrischer Interviews können bei Vergleich von Personen mit normalen und abnormalen Befunden (in der Koronarangiographie) 40 50% der Patienten mit Brustschmerzen und einem angiographischen Normalbefund als Patienten mit einer Panikstörung identifiziert werden (Katon et al., 1995). Auch die Assoziation zwischen einer spezifischen Herzklappenerkrankung (Prolaps der Mitralklappe) und Angst-, speziell Panikstörungen gilt als gesichert. Schätzungsweise 15% aller Patienten mit Panikstörungen erfüllen zusätzlich die Kriterien für ein Vorliegen dieser Herzklappenstörung, für weitere 27% gilt dies mit hoher Wahrscheinlichkeit. Demgegenüber finden sich bei Kontrollpersonen nur 1% mit gesicherter und 12% mit wahrscheinlichem Mitralklappenprolaps (Katon et al., 1995). In der Studie des „Epidemiological Catchment Area Programs“ fanden Wells, Goldman und Burnam (1988) bezogen auf eine Bevölkerungsstichprobe insgesamt Punktprävalenzen für psychische Störungen bei herzkranken Patienten von 22-35% und Lebenszeitprävalenzen bis 54% (Wells et al., 1988; vgl. Stevens et al., 1995). In der Übersichtsarbeit von Musselman, Evans und Nemeroff (1998) werden Prävalenzraten für aktuell bestehende depressive Störungen (Major Depression) von 16% bis 23% bei Patienten mit koronarer Herzerkrankung und/oder Myokardinfarkt berichtet, die aus Studien mit standardisierten klinischen Interviews und großer Fallzahl stammen und valide Anhaltszahlen für die somato-psychische Komorbidität bei kardiovaskulä- 32 ren Erkrankungen erbringen (Carney, Rich, Freedland & Saini, 1988; Frasure-Smith, Lespérance & Talajic, 1993; Gonzalez et al., 1996; Schleifer et al., 1989). Werden auch weniger schwere depressive Störungen (Minor Depression) mit einbezogen, erhöhen sich die Punktprävalenzen auf bis zu 45% depressiver Patienten nach Myokardinfarkt (Depression Guideline Panel, 1993; Schleifer et al., 1989; Stevens et al., 1995). Selbst drei bis vier Monate nach dem Infarkt erfüllen immer noch 33% der Patienten Kriterien für eine minore oder majore depressive Störung (15% für eine Major Depression), wobei die minore Form am ehesten als zeitlich begrenzte Anpassungsreaktion auf die Erkrankung zu deuten ist (Depression Guideline Panel, 1993; Schleifer et al., 1989; Katon & Sullivan, 1990). Sehr viel Aufmerksamkeit wurde in den letzten Jahren Studien gewidmet, die die Assoziation zwischen einer depressiven Störung und dem Risiko einer nachfolgenden koronaren Herzerkrankung bzw. einem Myokardinfarkt und seiner Überlebenswahrscheinlichkeit untersucht haben. Dieser Zusammenhang wurde früher „intuitiv“ durch die Hypothese erklärt, dass psychisch erkrankte Personen zusätzlich andere Risikofaktoren für die Entwicklung einer koronaren Herzerkrankung aufweisen. Es konnte erstens gezeigt werden, dass sich das relative Risiko für zunächst gesunde Personen, eine kardiovaskuläre Erkrankung zu erleiden, erhöht, wenn die Patienten bei der Baseline-Messung erhöhte Depressionsscores aufweisen (z.B. Carney et al., 1988; Davidson, Jonas, Dixon & Markowitz, 2000; Ferketich et al., 2000; Ford et al., 1998; Glassman & Shapiro, 1998). Das relative Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen beim Vorliegen depressiver Syndrome liegt in den verschiedenen Studien zwischen 1,14 (Ferketich et al., 2000) und 4,16 (Pratt et al., 1996; vgl. Kubzansky & Kawachi, 2000). Darüber hinaus wurde mangelnde soziale Unterstützung als Risikofaktor für das Auftreten und frühe Versterben nach einem Myokardinfarkt beschrieben (Gala et al., 1997). Der Zusammenhang zwischen depressivem Befinden und einer erhöhten Morbidität ist bei einem Teil der Studien für Frauen stärker, es liegen aber auch gegenteilige Befunde vor (Härtel, 2000). Fasst man zweitens die Ergebnisse der Studien zusammen, die prospektiv, mit standardisierten klinischen Interviews oder Fragebogen, relevante Risikofaktoren (Bluthochdruck, Cholesterin, Rauchen etc.) unter Kontrolle demographischer Variablen (Alter, Geschlecht etc.) erfasst haben, zeigt sich, dass depressive Symptome und Störungen als unabhängiger Risikofaktor im pathophysiologischen Prozess einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu bewerten sind. Sie können nicht nur als sekundäre emotionale Reaktion auf die Erkrankung verstanden werden. Die Studien 33 zeigen, dass Patienten mit einer manifesten kardiovaskulären Erkrankung (Myokardinfarkt) und erhöhter Depressivität bzw. einer depressiven Störung eine statistisch abgesicherte erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, in den folgenden Monaten nach dem Infarkt zu versterben als Patienten ohne eine depressive Erkrankung (Gala, Galetti & Invernizzi, 1997; Glassman & Shapiro, 1998; Herrmann et al., 1998; Ladwig et al., 1992; Musselman et al., 1998). Frasure-Smith und Kollegen (1993) errechneten ein 3 1/2-fach erhöhtes Risiko für depressive Patienten. In den Studien von Frasure-Smith et al. (1993; 1997; 2000b) war das Vorliegen einer Depression mit einem gleich hohen Risiko eines früheren Versterbens assoziiert wie relevante medizinische prognostische Faktoren (z.B. linksventrikuläre Ejektionsfraktion, maligne ventrikuläre Arrhythmien). Inzwischen liegen auch entsprechende Daten für eine 5-Jahres-Katamnese vor, die diese Studienergebnisse weiter absichern (Herrmann, Brand-Driehorst, Buss & Rüger, 2000). Darüber hinaus bestätigt sich die Assoziation von komorbiden psychischen Störungen und einer erhöhten kardiovaskulären Mortalität auch bei Patienten mit Angina pectoris (Lespérance, Frasure-Smith, Juneau & Théroux, 2000). Eine depressive Störung ist also unzweifelhaft mit einem erhöhten Risiko für die Entwicklung einer ischämischen Herzerkrankung und dem früheren Versterben von Patienten in der Post-Myokardinfarkt-Phase verbunden. Diese statistisch abgesicherte Assoziation kann aber noch keine Aussage darüber erlauben, welche kausalen Mechanismen ihr zugrunde liegen. Vermutet wird, dass möglicherweise atherosklerotische Prozesse für beide Störungsbilder verantwortlich sein können, v.a. bei Depressionsbeginn im höheren Alter. Weiterhin können unterschiedlich autonom-nervöse Prozesse und Veränderungen in Blutgerinnungsparametern sowie unterschiedliches Gesundheitsverhalten dafür verantwortlich sein (weiterführend: Heßlinger et al., im Druck; Glassman & Shapiro 1998; Musselman et al., 1998). Bezogen auf Verhalten kann dies bedeuten, dass depressive Patienten u.U. eine niedrige Medikamentencompliance aufweisen. Darüber hinaus können die somatischen Symptome (Energieverminderung, Gewichtsverlust) die psychische Verfassung der Patienten ungünstig beeinflussen. Schließlich können die psychischen Beeinträchtigungen (depressive Stimmungslage, Selbstwertprobleme, suizidale Gedanken) die Bereitschaft zu präventiven und rehabilitativen Maßnahmen (Verminderung von Risikofaktoren, sportliche Betätigung, Diät etc.) reduzieren (Gala et al., 1997; Hayward, 1995). Inwieweit psychische Belastungen darüber hinaus mit anderen, persönlichkeitsbezogenen Variablen assoziiert sind, steht noch zur Diskussion (Glassman & Shapiro, 1998). Über drei 34 Jahrzehnte wurde z.B. der Frage nachgegangen, inwieweit ein bei Patienten mit Herz-KreislaufErkrankungen häufig beschriebenes Persönlichkeits- bzw. Verhaltensmuster (Typ-A-Verhalten) einen Einfluss auf Beginn und Verlauf einer koronaren Herzerkrankung nimmt (Friedman et al., 1986; Roskies, Kearney & Spevack, 1979). Myrtek (2000) kommt aufgrund einer Metaanalyse mit 25 prospektiven Studien zu dem Schluss, dass das Typ-A-Verhalten keinen eigenständigen Risikofaktor für die koronare Herzerkrankung darstellt. Es bestehen aber korrelative Beziehungen zwischen ängstlichen und depressiven Symptomen und der Feindseligkeit (hostility) als einer der zentralen Dimensionen dieses Konzeptes (Katon et al., 1995). Hier besteht weiterer Forschungsbedarf, ebenso gibt es kaum Studien, die der Frage nachgehen, ob und welche psychopharmakologischen und/oder psychotherapeutischen Behandlungsansätze bei depressiven Störungen die Risiken für kardiovaskuläre Erkrankungen und ihre Folgen senken können (Barth, Härter & Bengel, 2001; Katon et al., 1995; Shapiro et al., 1996). Psychische Störungen bei muskulo-skelettalen Erkrankungen Zu den muskulo-skelettalen Erkrankungen gehören Störungsbilder, deren gemeinsame Symptomatik in Schmerzen und/oder Bewegungseinschränkungen bzw. Form- und Funktionsverlust im Bereich des Bewegungsapparates (Gelenke, Sehnen, Muskeln, Bindegewebe, z. T. am Knochen) besteht. Rheumatische Beschwerden und Erkrankungen am Stütz- und Bewegungsapparat zählen zu den häufigsten Krankheitsgruppen in der medizinischen Primärversorgung überhaupt (Finkbeiner, 1996; Härter, 1993). Fast jeder Mensch ist im Laufe seines Lebens ein- oder mehrmals von Schmerzen am Bewegungsapparat, v.a. von Rücken- und Nackenschmerzen, betroffen. Die körperlichen und psychosozialen Beeinträchtigungen gehen häufig auch mit komorbiden psychischen Belastungen einher, die Störungswert haben und einen zusätzlichen Behandlungsbedarf begründen. Vor allem länger andauernde Schmerzzustände (chronische Schmerzen) erhöhen die Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung psychischer Beeinträchtigungen, wie Gefühlen der Hilflosigkeit, Irritabilität und depressive Verstimmungen (Flor, 1991; Härter, 1994). Die Literatur über die Prävalenz psychischer Störungen und Folgeerscheinungen bei diesen Erkrankungen ist widersprüchlich. Dies hängt einerseits, wie bereits beschrieben (s.o.) mit unterschiedlichen Studiendesigns und Kriterien für die Definition psychischer Störungen zusammen. 35 Andererseits sind Faktoren wie unterschiedliche demographische Charakteristika der Patienten, die Heterogenität der Erkrankungen, ihr Schweregrad und ihre Dauer sowie die Präsenz weiterer komorbider Störungen somatischer Art für die große Variabilität verantwortlich (Parker & Wright, 1997). Bisher liegen nur sehr wenige epidemiologische Studien vor, die Aussagen zur Prävalenz psychischer Störungen bei muskulo-skelettalen Erkrankungen insgesamt bzw. größerer Obergruppen, wie Dorso- bzw. Arthropathien, treffen. Im „Epidemiological Catchment Area Program“ fanden Wells et al. (1988) bezogen auf eine repräsentative Bevölkerungsstichprobe mit verschiedenen Schmerzsyndromen (Arthritiden) aktuelle Prävalenzen (Punktprävalenzen) von 25,3% (vs. 17,5% ohne Erkrankung) und Lebenszeitprävalenzen von 50,1% (vs. 33% ohne Erkrankung) für irgendeine psychische Störung. Magni et al. (1993) fanden in einer großen epidemiologischen Studie bei 18% der mit Schmerz belasteten Befragten depressive Störungen gegenüber nur 8% in der Normalbevölkerung. Eigene epidemiologische Studien unserer Arbeitsgruppe, die die Häufigkeit psychischer Störungen bei Patienten mit muskulo-skelettalen Erkrankungen in der stationären Rehabilitation untersuchten, werden in Kapitel 5 dargestellt (Härter et al., 2000b; Härter et al., in press). Präzisere Angaben zu psychischen Komorbiditäten liegen bezogen auf einzelne Störungsbilder des Haltungs- und Bewegungsapparates vor: Bei Patienten mit einer rheumatoiden Arthritis werden im Review von Stevens et al. (1995) Prävalenzraten für depressive Symptome von 17% bis 74% berichtet (Zusammenfassung von 20 Studien). Die einzige Studie aus dieser Übersicht, die ein standardisiertes klinisches Interviewverfahren einsetzte, fand 17% depressiver Patienten zum Zeitpunkt der Befragung (Major Depression), allerdings weitere 40% mit einer dysthymen Störung (Frank et al., 1988). Zu ähnlichen Ergebnissen kommen Creed und Ash (1992) in ihrer Übersicht, die Prävalenzen für eine Major Depression werden dort in einem Schwankungsbereich von 17% bis 27% angegeben (in Parker & Wright, 1997). Bei anderen Störungsbildern aus dem rheumatischen Formenkreis (z.B. Systemischer Lupus Erythematodes oder Osteoarthritiden) ist die Datenlage noch so dünn, dass bislang keine verlässlichen Schätzungen vorliegen (Stevens et al., 1995). Zur psychosomatischen Komorbidität bei Fibromyalgie liegen wesentlich mehr Studien vor, die eine deutliche Erhöhung depressiver Syndrome im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung zeigen (Parker & Wright, 1997). Es wurden einerseits erhöhte Raten depressiver Symptome und erhöhte Prävalenzraten psychischer Störungen bei Fibromyalgiepatienten gefunden (Stevens et al., 1995). Andererseits zeigten Studien von Erstgrad-Angehörigen ebenfalls erhöhte Raten depressiver Stö- 36 rungen in Familien von Fibromyalgiepatienten, welche eine überzufällige Assoziation von depressiven Störungen und dieser Erkrankung belegen (Arnold, Keck & Welge, 2000; Hudson et al., 1985). Die Prävalenz depressiver Störungen wird, je nach eingesetztem Verfahren und Patientenstichprobe, mit 22% bzw. 34% (mit strukturiertem klinischen Interview), 29% (Fragebogen – BDI) bis 55% (MMPI) angegeben und als höher im Vergleich zu Patienten mit einer rheumatoiden Arthritis geschätzt (Ahles et al., 1991; Burckhardt et al., 1994; Van Houdenhove & Onghena, 1997). Rückenschmerzen können aufgrund einer Reihe von pathophysiologischen Bedingungen entstehen bzw. auf definierte Ursachen somatischer Art zurückgeführt werden, allerdings können die wenigsten Rückenschmerzsyndrome eindeutig einer Ursache zugeschrieben werden. Sie bleiben in der Mehrzahl „unspezifisch“ oder werden als „idiopathische” Rückenschmerzen deklariert. Die Ursachen der Entstehung und Aufrechterhaltung von Rückenschmerzen werden auch in psychophysiologischen und psychosozialen Faktoren gesehen, wobei von einer Interaktion von physischen, psychologischen und sozialen Faktoren ausgegangen wird. Verhaltensmedizinische Erklärungsansätze fokussieren dabei weniger auf die Erklärung der Entstehung von Rückenschmerzen (im ätiologischen Sinne), vielmehr bieten sie Erklärungsansätze für den Übergang zwischen akuten und chronischen Schmerzen und für die Aufrechterhaltung von Rückenschmerzen (Flor & Turk, 1984; Linton, 2000). In einer Übersichtsarbeit zur Assoziation von Rückenschmerz und depressiven Störungen kommen Sullivan und Kollegen (1992) zum Ergebnis, dass 62% der chronischen Rückenschmerzpatienten in klinischen Settings signifikante depressive Symptome aufweisen. Die Prävalenzrate für eine Major Depression wird allerdings wesentlich niedriger geschätzt (21%), auch wenn sie 2- bis 4-fach höher ist als entsprechende Raten aus bevölkerungsepidemiologischen Studien (Sullivan, Reesor, Mikail & Fisher, 1992). Eine Studie an 200 Rehabilitationspatienten mit chronischen Rückenschmerzsyndromen (hoch selektierte, klinische Population) zeigt hingegen deutlich höhere Raten (Polatin et al., 1993): Die aktuelle Prävalenz psychischer Störungen, erfasst mit dem SKID nach DSM-III-R beträgt hier 95% (!), wobei 45% der Patienten zum Untersuchungszeitpunkt eine Major Depression aufweisen, 19% Substanzabusus betreiben und 17% eine Angststörung haben. Die Lebenszeitprävalenzen für die drei Störungen sind sogar noch höher (64% / 36% / 19%). Jeweils die Hälfte der Patienten berichteten vor (57%) bzw. nach Beginn der chronischen Rückenbeschwerden (43%) über psychische Störungen, wobei Angst- und Suchterkrankungen eher prämorbid vor, depressive Störungen je zur Hälfte prämorbid und nach 37 der Rückenerkrankung auftraten. Darüber hinaus war die Rate von aktuell bestehenden Achse-IIStörungen (Persönlichkeitsstörungen) im Vergleich zu Studien aus der Allgemeinbevölkerung mit 51% mehrfach erhöht (Polatin et al., 1993). In einem Beitrag unserer Arbeitsgruppe ging es schließlich um die Frage, ob es krankheitsbezogene oder –unabhängige evidente Risikofaktoren gibt, die die Assoziation somatischer und psychischer Morbidität bei muskulo-skelettalen Erkrankungen (z.B. Rückenschmerz und Depression) begünstigen (Weißer, 2000; Weißer, Härter, Reuter & Bengel, im Druck). Nach einer allgemeinen Literaturrecherche wurden Studien analysiert, die die Prävalenz psychischer Störungen bei verschiedenen muskulo-skelettalen Erkrankungen untersucht haben. Es wurden Studien ausgewählt, die Einflussfaktoren (unabhängige Variablen) auf psychische Belastungen oder Störungen, insbesondere Angst und Depression (abhängige Variablen), bei muskulo-skelettalen Erkrankungen untersuchten. Als methodische Voraussetzung zur Ermittlung von Einflussfaktoren wurden zunächst nur Studien ausgewählt, die mittels multivariater Regressionsanalysen die Assoziation von unabhängigen Variablen mit der Häufigkeit psychischer Beeinträchtigungen und Störungen untersuchten. Aufgrund der sehr geringen Zahl an Studien mit Regressionsanalysen wurden in einem zweiten Schritt auch Studien berücksichtigt, die bivariate Korrelationsberechnungen durchgeführt hatten. Weibliches Geschlecht stellt einen Risikofaktor hinsichtlich einer depressiven und ängstlichen Symptomatik dar. Ebenso scheint eine niedrige soziale Schicht, geringe Schulbildung verbunden mit Arbeitslosigkeit, das Auftreten von Ängstlichkeit und Depressivität zu begünstigen. Bei den krankheitsbezogenen Variablen ist chronischer Schmerz der stärkste Prädiktor für eine Depression. Was jedoch die Untersuchung der einzelnen Schmerzparameter (z. B. Intensität, Häufigkeit, Dauer) betrifft, sind die Ergebnisse sehr inkonsistent und bedürfen weiterer Analysen. Ein weiterer signifikanter Risikofaktor stellt eine verminderte körperliche Funktionsfähigkeit dar, wobei insbesondere die Abnahme subjektiv als wertvoll erlebter Aktivitäten vermehrt zu depressiver Symptomatik führt. 38 3.3 Diagnostik psychischer Störungen bei körperlichen Erkrankungen Die Erkennung und Behandlung psychischer Störungen bei körperlich kranken Patienten ist besonders bedeutsam, da sich diese Störungen negativ auf die Überlebenszeit, die Länge des Krankenhausaufenthalts und die Therapiecompliance sowie die Lebensqualität auswirken können (Tab. 5). Am überzeugendsten konnte die klinische Bedeutung komorbider psychischer Störungen in den letzten Jahren bei kardiologischen Erkrankungen nachgewiesen werden (vgl. Heßlinger et al., im Druck). Tabelle 5: Bedeutung komorbider psychischer Störungen bei körperlichen Erkrankungen Komorbide psychische Störungen bei somatischen Erkrankungen können: - die Krankenhausliegedauer verlängern 1 - die somatische Morbidität erhöhen, z.B. bei Patienten mit prämorbid bestehenden Depressionen erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer kardiologischen Erkrankung 4,5 - zur Chronifizierung somatischer Erkrankungen beitragen, z.B. beim Übergang von akuten in chronische Rückenschmerzen 5 - die Mortalität erhöhen, z.B. haben Patienten mit einem Herzinfarkt und einer depressiven Erkrankung eine mehrfach erhöhte Post-Infarkt-Sterblichkeit 1,2,4,6 - die Compliance und Lebensqualität ungünstig beeinflussen, z.B. leiden Patienten mit Tumoren und psychischen Erkrankungen an beträchtlichen Einbußen der Lebensqualität durch die körperliche und psychische Störung 3,4,5, 7 - zu erhöhten Kosten im Versorgungssystem beitragen, z.B. führen nicht erkannte psychische Störungen zu häufigeren Arztbesuchen betroffener Patienten 3,5 1 Ehlert 1998; 2 Cavanaugh et al. 2001, 3 Härter et al., 2001a; 4 McDaniel et al. 1995; 5 Linton 2000; 6 Saupe & Diefenbacher 1999; 7 DiMatteo et al., 2000 Es wurden zahlreiche prospektive Studien durchgeführt, die mit epidemiologischen Untersuchungsansätzen einerseits die Assoziation zwischen Depressivität und dem späteren Risiko einer koronaren Herzerkrankung (Æ Depressivität als Risikofaktor für die Entwicklung einer KHK), andererseits die Assoziation zwischen einer komorbiden Depression und einem Myokardinfarkt 39 bzw. seiner Überlebenswahrscheinlichkeit (Æ Depression als Risikofaktor für eine ungünstige Prognose) untersucht haben (vgl. Kapitel 3.2). Ungünstigerweise wird aber ein hoher Anteil psychisch beeinträchtigter Patienten in der medizinischen Versorgung nicht erkannt und behandelt. Verschiedene Studien konnten z.B. zeigen, dass in der stationären und hausärztlichen Versorgung depressive Störungen nur bei einem Viertel bis der Hälfte depressiver Patienten überhaupt erkannt werden (Cohen-Cole et al., 1993; Goldberg, Jenkins, Millar & Faragher, 1993; Ormel, Koeter, Van den Brink & Van de Willige, 1991; Paykel et al., 1997; Spiegel, 1996). Diese ungünstigen Entdeckungs- und Behandlungsraten psychischer Störungen bestätigen sich auch für die medizinische Rehabilitation (Reuter, Härter, Woll, Wunsch & Bengel, 2001). Die Diagnosenstellung einer komorbiden psychischen Störung, speziell der häufigen depressiven Erkrankungen, bei Vorliegen einer körperlichen Erkrankung ist häufig schwierig: Einerseits können somatische Symptome Teil eines depressiven Syndroms sein, andererseits können körperliche Erkrankungen Symptome, die auf eine depressive Störung hinweisen, verursachen oder „maskieren“, z.B. Gewichtsreduktion, Schlafstörungen, Energieverlust (Härter, 2000a; Reuter & Härter, 2000). Hierzu gehören Störungen wie z.B. Diabetes mellitus und andere endokrinologische Störungen, Krebserkrankungen, neurologische Krankheiten, Autoimmunerkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Um die Probleme einer Überlappung körperlich bzw. psychisch begründeter depressiver Symptome zu minimieren und die diagnostische Spezifität zu erhöhen, wurden vier verschiedene Untersuchungsansätze (inclusive, exclusive, etiologic und substitutive approach) vorgeschlagen (Bukberg, Penman & Holland, 1984; Cavenaugh, Clark & Gibbons, 1983; Endicott, 1984; Rifkin et al., 1985; Spitzer, Endicott & Robins, 1978; vgl. Raugust, 2001). Aufgrund der Vor- und Nachteile der jeweiligen Verfahren wird für die klinische Praxis am ehesten der „einschließende Ansatz“ (inclusive approach) empfohlen, der dem beschreibenden Ansatz der Klassifikationssysteme der ICD-10 bzw. DSM-IV entspricht und alle Kriterien einbezieht. Bei diesem Vorgehen werden Beschwerden von Patienten danach beurteilt, ob sie die bestehenden Kriterien für eine depressive Störung erfüllen, ohne dass ätiologische Überlegungen einbezogen werden. Die Chance einer Entdeckung einer tatsächlich vorliegenden depressiven Störung ist somit erhöht (hohe Sensitivität). Studien konnten zeigen, dass das Risiko einer zu häufigen Diagnosenstellung 40 bei Verwendung dieses Verfahrens insgesamt relativ gering ist (zwischen 1,5% bis 8%, Kathol et al., 1990; Härter, 2000a). In einer eigenen Arbeit unserer Gruppe zeigt sich hingegen beim Vergleich der Prävalenzraten nach Anwendung des inklusiven und des exklusiven Ansatzes, dass die Prävalenzraten depressiver Störungen bei Tumorpatienten nach dem inklusiven Ansatzes doppelt so hoch waren wie die nach dem exklusiven Ansatz, sowohl bezogen auf die Vier-Wochen-Prävalenz (9% vs. 4.5%) wie auch in Bezug auf die Lebenszeitprävalenz psychischer Störungen (10% vs. 20%). Allerdings fehlte bei über der Hälfte der Patienten, die nach dem exklusiven Ansatz keine Diagnose einer psychischen Störung mehr bekamen, nur ein weiteres Symptom zur Diagnosenstellung (Raugust, 2001). Häufig weisen einige der Patienten ohne Diagnose einer Major Depression nach dem exklusiven Ansatz auch mildere depressive Störungsbilder (z.B. minor depression) auf, die eine Beobachtung oder Mitbehandlung erforderlich machen (Härter et al., 2001b). Bei in erster Linie forschungsbezogenen Fragestellungen, die die Prävalenz depressiver Störungsbilder bei körperlichen Erkrankungen fokussieren, kann es daher sinnvoll sein, ein stärker symptomreduzierendes Verfahren (exclusive approach) zu wählen (Cohen-Cole et al., 1993; McDaniel et al., 1995; Raugust, 2001). Eine weitere wichtige differenzialdiagnostische Abgrenzung betrifft die Trennung von depressiven Reaktionen bzw. Störungen einerseits und neuen Konstrukten bei körperlichen Erkrankungen andererseits, die häufige Symptome bei chronisch körperlich Kranken als eigenständiges Syndrom begreifen (z.B. Weis & Bartsch, 2000). Anhaltende physische und psychische Erschöpfung (Fatigue) tritt als Symptom bei zahlreichen somatischen Erkrankungen (z.B. endokrinologischen Störungen, Tumorerkrankungen) und psychischen Störungen (z.B. affektiven Erkrankungen) auf und hat aufgrund der Häufigkeit und der beeinträchtigenden Wirkung auf die Lebensqualität der Patienten in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen (Smets et al., 1993). Da enge Zusammenhänge zwischen Fatigue und den somatischen Krankheitsprozessen der Tumorerkrankungen bzw. ihren Behandlungen bestehen (Greenberg, 1998; Smets et al.; 1993), ist einerseits die Abgrenzung psychischer Anteile an der Fatiguesymptomatik bzw. die Diagnose einer psychischen Störung schwierig. Studien zeigen andererseits, dass Fatigue und Depression häufig gleichzeitig bestehen (Akechi, 1998; Glaus, 1998): Es wird postuliert, dass Depressionen als Reaktion auf lang anhaltende Erschöpfungszustände entstehen können und damit Fatigue der Depression zeitlich vorausgeht. Zum anderen kann Fatigue im Rahmen einer 41 vorhandenen depressiven Symptomatik bestehen bzw. durch sie verstärkt werden (Glaus, 1998; Smets et al., 1993; Visser & Smets, 1998). Aufgrund der ähnlichen Phänomenologie der Konzepte bleibt die Differenzierung bislang häufig schwierig, erscheint aber dringend notwendig. Depressive Störungen sind durch die aktuellen Klassifikationssysteme der ICD-10 und des DSM-IV in ihrer Symptomatik klar umschriebene, auf empirisch abgesicherten Kriterien basierende psychische Krankheitsbilder. Bei der Diagnostik komorbider Depressionen sind die Überschneidungen der Symptome der Tumorerkrankung mit den somatischen Depressionssymptomen zu berücksichtigen. In einer eigenen Studie unserer Arbeitsgruppe wurden die Konstrukte „Fatigue“ und „depressive Störungen“ bei Tumorpatienten vertiefend untersucht (Raugust, 2001; Reuter & Härter, 2000; Reuter & Härter, in press). Es konnte erstens bestätigt werden, dass Tumorpatienten mit komorbider depressiver Störung unter deutlich stärker ausgeprägter Fatiguesymptomatik leiden als Patienten mit anderen psychischen Störungen und Patienten ohne die Diagnose einer psychischen Störung. Zweitens konnten wir zeigen, dass Fatigue als multidimensionales Konstrukt mit physischen, kognitiven und emotionalen Faktoren eine starke Überlappung mit Depressionssymptomen aufweist. Fatigue kann daher am ehesten als Untergruppe depressiver Syndrome betrachtet werden. Einzig die psychologischen Symptome (mit kognitivem, emotionalem und interpersonellem Charakter), die über die typische Fatiguesymptomatik hinausgehen, ermöglichen eine Trennung von Fatigue und Depression. Aus diesem Grund sind für eine genauere Trennung von Fatigue und Depression (Differenzialdiagnose) Forschungsansätze notwendig, die kriterienorientiert die diskriminierenden Merkmale und Symptome zwischen diesen Syndromen untersuchen. Dies kann in Anlehnung an Vorgehensweisen in der Chronic Fatigue Syndrome- und Neurasthenie-Forschung geschehen, in der die Differenzierung von chronischer Fatigue und psychischen Störungen verfolgt wird. Voraussetzung hierfür ist eine Psychodiagnostik, welche die Symptomatik der Fatigue und der Depression zuverlässig erfasst. Dazu sind Instrumente wie z.B. strukturierte oder standardisierte klinische Interviews empfehlenswert, die entsprechend den aktuellen diagnostischen Kriterien aufgebaut sind und die Diagnosenstellung psychischer Störungen nach ICD-10 oder DSM-IV ermöglichen. 42 3.4 Fazit Eine chronische körperliche Erkrankung führt zu emotionalen, kognitiven und verhaltensbezogenen Reaktionen des betroffenen Menschen. Diese Antworten sind als integraler Bestandteil im individuellen Adaptationsprozess an die chronische Erkrankung zu verstehen. Obwohl viele Patienten die jeweiligen Einschränkungen und Behinderungen durch eine Erkrankung erfolgreich bewältigen, sind andere Patienten von psychischen Beeinträchtigungen und Störungen betroffen, da sie die emotionale Belastung durch die Erkrankung weniger gut verarbeiten können. Bei manchen Patienten können prämorbid bestehende psychische Beeinträchtigungen den Ausbruch einer körperlichen Erkrankung durch noch wenig erklärte pathophysiologische Mechanismen anstoßen oder beschleunigen. Sicher ist hingegen, dass komorbide psychische Störungen den Verlauf und die Gesundungschancen sowie die Compliance und Lebensqualität körperlich kranker Patienten ungünstig beeinflussen können. Die Übersicht zeigte, dass die Häufigkeit psychischer Störungen bei Patienten mit verschiedenen chronischen körperlichen Erkrankungen, z.B. mit Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie muskulo-skelettalen Schmerzsyndromen, im Vergleich zur Häufigkeit psychischer Störungen bei Personen aus der Allgemeinbevölkerung, speziell bezogen auf depressive Störungen, Angstsyndrome und somatoforme Störungen, erhöht ist. Auch bei vielen anderen körperlichen Erkrankungen wie neurologischen Erkrankungen, z.B. Schlaganfällen, Epilepsien, Parkinsonscher Erkrankung und Migräne (Katon & Sullivan, 1990; Robertson, 1997; Merikangas & Stevens, 1997; Stevens et al., 1995), Erkrankungen des respiratorischen Systems (Collis, 1997; Smoller et al., 1996; Thompson & Thompson, 1993), chronischen Nierenerkrankungen (Levy, 1993; Sensky, 1997) und hormonellen Störungen (Härter & Berger, 2000; Härter & Bengel, im Druck) sowie AIDS sind signifikant erhöhte Prävalenzraten für komorbide psychische, hauptsächlich depressive Störungen, berichtet worden. Die Ergebnisse der zahlreichen, bisher durchgeführten Studien sind aber – im Vergleich zu Ergebnissen aus epidemiologischen Studien psychischer Störungen in der Allgemeinbevölkerung (vgl. Kap. 2) - wenig konsistent und erfordern eine differenzierte Analyse und Interpretation der unterschiedlichen Befunde. Die Prävalenz- und Komorbiditätsraten schwanken je nach der untersuchten Population, dem Setting und Zugang, der Stichprobengröße, der untersuchten Art und Schwere der somatischen Störung sowie dem Studiendesign und der eingesetzten Untersuchungsmethodik erheblich. Hier zeigten sich in der Vergangenheit auch bedeutsame Unterschie- 43 de aufgrund verschiedener Klassifikationssysteme (unterschiedliche ICD- und DSM-Versionen) und des Einsatzes darauf bezogener standardisierter klinischer Interviews. Schließlich hängen die Ergebnisse davon ab, wie reliabel und valide die körperlichen Störungen selbst erfasst werden. Die bisher publizierten Studienergebnisse eignen sich viel weniger als die Prävalenzraten aus Studien der Allgemeinbevölkerung zur Abschätzung des therapeutischen Bedarfs, d.h. wie viele Patienten mit chronischen körperlichen Erkrankungen tatsächlich behandlungsbedürftige psychische Beeinträchtigungen aufweisen. Hingegen konnten viele Studien der letzten Jahre eindrucksvoll zeigen, dass die psychische Komorbidität gravierende Konsequenzen hinsichtlich der somatischen Morbidität und Mortalität haben kann. Exemplarisch sind hier die exzellenten kanadischen, amerikanischen und europäischen Studien, die die ätiologische und klinische Bedeutung prämorbider depressiver Syndrome für eine erhöhte kardiologische Morbidität und die Bedeutung depressiver Störungen für die Überlebenswahrscheinlichkeit in der Post-MyokardinfarktPhase zeigen konnten. Es scheint auch, dass die Mortalitätsraten mit der Schwere der depressiven Syndrome assoziiert sind (Penninx et al., 2001; Pratt et al., 1996). Gründe für den schlechteren Verlauf kardiologischer Erkrankungen bei komorbider Depression liefern darüber hinaus Befunde, wonach Patienten mit einer Depression in geringerem Ausmaß Verhaltensempfehlungen (bzgl. Risikofaktoren) umsetzen (Ziegelstein et al., 2000) und eine geringere MedikamentenCompliance aufweisen (DiMatteo et al., 2000). Schließlich konnten Studien die neurobiologischen und pathophysiologischen Zusammenhänge zwischen depressiven Störungen und koronaren Herzerkrankungen (z.B. verminderte Pulsvariabilität, erhöhte Blutplättchenaktivierung) teilweise aufklären (Carney, Freedland & Jaffe, 2001). Es ist zu vermuten, dass ähnliche Mechanismen auch bei anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, z.B. bei Angina Pectoris, Hypertonie und Schlaganfällen, eine klinische Bedeutung hinsichtlich der Inzidenz und Prognose haben, hier sind die Studien aber noch nicht abgeschlossen (Davidson et al., 2000; Lespérance et al., 2000). Aufgrund der Überlappung häufiger somatischer Symptome wie Appetit- und Schlafstörungen, erhöhter Ermüdbarkeit etc. mit typischen depressiven Symptomen müssen bei der Diagnostik psychischer Störungen Besonderheiten beachtet werden, um eine „Überdiagnostik“ psychischer Beeinträchtigungen zu vermeiden. Hier wurden insbesondere in der Beforschung psychischer Störungen bei Tumorpatienten verschiedene diagnostische Ansätze entwickelt, die je nach Hauptfokus des Interesses sinnvoll eingesetzt werden können. Geht es z.B. im klinischen Kontext um die möglichst vollständige Erfassung komorbid depressiv erkrankter Patienten, wird 44 empfohlen, sich an die gängigen Kriterien der gültigen Klassifikationssysteme zu halten (inclusive approach). Bei stärker forschungsbezogenen Fragen kann es hingegen sinnvoll sein, eine Reduzierung der Kriterien einzuführen, um „falsch positive Befunde“ zu minimieren. Hier scheint aber weitere Forschung notwendig, insbesondere auch zu der Frage, inwieweit neue Syndrome, z.B. Fatigue bei chronischen körperlichen Erkrankungen, die bisher nur durch Selbstbeurteilungsinstrumente erfasst werden, mit Hilfe standardisierter Interviewverfahren, die präzise die körperlichen, affektiven und kognitiven Einzelsymptome erfassen, validiert werden können. 45 4 Fragestellungen und Methodik Im komplexen Behandlungs- und Rehabilitationsprozess bei chronischen körperlichen Erkrankungen ist eine spezifische Zieldefinition und die spätere Beurteilung des Grades der Zielerreichung ohne eine spezifische Diagnosenstellung bezogen sowohl auf die somatischen als auch psychischen und sozialen Problemlagen der Patienten nicht oder nur sehr ungenau möglich. Nur durch eine Erfassung der unterschiedlichen Beschwerdebereiche können - gemeinsam mit den Patienten - individualisierte Behandlungs- und Rehabilitationsziele erarbeitet werden. In der Praxis zeigt sich jedoch häufig eine mangelnde Differenziertheit der diagnostischen und therapeutischen Prozesse (Gerdes, Bengel & Jäckel, 2000). Die Behandler haben z.B. häufig die Tendenz, psychische Störungen bei Vorliegen dominanter körperlicher Symptome zu unterschätzen. Auch sind die klinischen wichtigsten Syndrome wie Angst- und depressive Störungen in der somatischen Medizin zwar bekannt, weniger aber die sie bestimmenden Symptome und diagnostischen Kriterien (Spiegel, 1996). Schließlich besteht häufig eine ungenaue Kenntnis über die Prognose und Behandelbarkeit psychischer Störungen. 4.1 Kontext und Begründung Das Vorhaben und die einzelnen Teilstudien wurden im Rahmen Leitthemas des rehabilitationswissenschaftlichen Forschungsverbundes Freiburg / Bad Säckingen „Zielorientierung in Diagnostik, Therapie und Ergebnismessung“ durchgeführt (Bengel & Jäckel, 2000). Derzeit steht in der Rehabilitation der hohen Komplexität der Problemlagen eines Patienten in einzelnen Bereichen eine mangelnden Differenziertheit der diagnostischen und therapeutischen Prozesse, die sich vorwiegend an den medizinisch definierten großen Diagnosegruppen orientieren, gegenüber. Es wird davon ausgegangen, dass zur Definition einer Untergruppe ein Merkmal (z.B. chronische Rückenschmerzen) ausreicht und eine standardisierte Behandlung rechtfertigt. Übersehen wird bei dieser Strategie allerdings leicht, dass die Unterschiede auf anderen Merkmalen innerhalb einer solchen Untergruppe viel größer sein können als die Gemeinsamkeit auf demjenigen Merkmal, das die Gruppenbildung bestimmt. So kann z.B. die unterschiedliche Ausprägung des Merkmals ”somatische vs. psychosoziale Beeinträchtigung” bei Rückenschmerzpatienten für die Therapie viel entscheidender sein als das gemeinsame Merkmal ”Rückenschmerzen” (Gerdes et al., 2000). Selbstverständlich kann und soll die Rehabilitation nicht gänzlich individualisiert werden. Wird jedoch in der medizinischen Rehabilitation die psychische Komorbidität der Pati- 46 enten nicht erkannt, diagnostiziert und behandelt, so wird dem Anspruch einer biopsychosozialen Versorgung nicht gerecht und er muss, wie in den vorangegangenen Kapiteln gezeigt wurde, mit geringerer Compliance und auch im somatischen Bereich mit ungünstigeren Therapieverläufen gerechnet werden. Das Leitthema und die Projekte des Verbundes wollen zu einer Verringerung der Segmentierung und Pauschalisierung in der Rehabilitation beitragen. Basis der Untersuchungen war die Hypothese, dass in der rehabilitationsmedizinischen Versorgung chronisch kranker Patienten mit Tumor-, Herz-Kreislauf- und muskulo-skelettalen Erkrankungen ein signifikanter Anteil von Patienten unter psychischen Beeinträchtigungen oder Störungen leidet, die eine verbesserte Differenzialdiagnostik und Anpassung der bisher vorgehaltenen rehabilitativen Maßnahmen erfordern. Bisher wurden in der medizinischen Rehabilitation keine systematischen Studien durchgeführt, die auf der Basis eines epidemiologischen Forschungsansatzes eine Verbesserung der differenzialdiagnostischen Prozesse zum Ziel hatten. Die theoretische Analyse bisher publizierter Arbeiten zeigt, dass komorbide psychische Störungen bei verschiedenen chronischen körperlichen Erkrankungen ein klinisch hoch relevantes Problem darstellen (Kapitel 3). Eine Übertragbarkeit der bisher vorliegenden Ergebnisse auf das Versorgungssystem in Deutschland, die stationäre Akutversorgung und insbesondere die medizinische Rehabilitation, wo viele der chronisch kranken Patienten behandelt werden, ist aber aus mehreren Gründen eingeschränkt: a) Es liegen zu verschiedenen Indikationen quantitativ und qualitativ sehr unterschiedliche Ergebnisse hinsichtlich der somato-psychischen Komorbidität vor, die fast ausschließlich aus anglo-amerikanischen Forschungsarbeiten stammen. In Deutschland wurde bislang nur eine epidemiologisch orientierte Untersuchung zur Prävalenz psychischer Störungen in der stationären Akutversorgung durchgeführt (Arolt, 1995; Arolt et al., 1995). b) Die Studien sind zum großen Teil relativ alt, außerdem untersuchten die meisten Studien kleinere, klinische Stichproben („convenience samples“). Es fehlen aktuelle Prävalenzstudien, die mit Hilfe moderner Diagnoseinstrumente (SKID oder CIDI) auf der Basis aktuell gültiger Klassifikationssysteme (ICD-10 oder DSM-IV) durchgeführt wurden. c) Nur sehr wenige Studien realisierten ein epidemiologisches Design; dabei waren Patienten mit chronischen Erkrankungen nicht die Hauptzielgruppen der Untersuchungen (z.B. ECAStudie, Wells et al., 1988). 47 d) Ein Transfer der Ergebnisse auf chronisch kranke Patienten in der medizinischen Rehabilitation ist nur sehr eingeschränkt möglich; keine Studie stammt aus der rehabilitationsmedizinischen Versorgung. e) Schließlich gibt es bisher bei chronischen Erkrankungen kaum Hinweise, inwieweit komorbide psychische Störungen, die sich ungünstig auf den Krankheitsverlauf und den Rehabilitationserfolg auswirken, von den Behandlern entdeckt und behandelt werden. 4.2 Ziele und Fragestellungen Die Analyse des gegenwärtigen Forschungsstandes zur Prävalenz psychischer Störungen ergibt, dass inzwischen zwar zahlreiche methodisch qualifizierte Studien in unterschiedlichen Anwendungsfeldern durchgeführt wurden. Allerdings stammt keine der erwähnten Studien aus dem Bereich rehabilitationsmedizinischer Settings, so dass bislang keine empirischen Aussagen über Komorbiditätsraten (Prävalenzraten) hinsichtlich psychischer Störungen bei Patienten gemacht werden können, die aufgrund einer somatischen Erkrankung eine stationäre Maßnahme im Rahmen medizinischer Leistungen zur Rehabilitation in Anspruch nehmen. Um generalisierbare Aussagen für die ökonomisch und klinisch bedeutsamsten Versorgungsbereiche der stationären Rehabilitation machen zu können, sollen Patienten mit den beiden in der medizinischen Rehabilitation häufigsten Krankheitsgruppen untersucht werden. Diese Erkrankungsbereiche verursachen aufgrund ihrer volkswirtschaftlichen und epidemiologischen Bedeutung die Hälfte bis zwei Drittel (bei Männern 65%, bei Frauen 53%) der in einem Jahr durchgeführten Rehabilitationsmaßnahmen (Verband Deutscher Rentenversicherungsträger, 1999). Diese Krankheitsgruppen sind: a) Krankheiten des Stütz- und Bewegungsapparates (insbesondere Dorsopathien) (ICD-10: M54; bei Männern ca. 48%, bei Frauen 47% aller stationären Reha-Maßnahmen); b) Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems (ICD-10: I00-I99; bei Männern 17%, bei Frauen 7% aller stationären Reha-Maßnahmen); Weitere bedeutsame Erkrankungsgruppen sind: c) Krankheiten des respiratorischen Systems (ICD-10: J00-J99, v.a. J42-45; bei Männern und Frauen 5% aller stationären Reha-Maßnahmen); 48 d) Neubildungen (im Rahmen der Pilotstudie zur Erprobung des Methodeninventars) (ICD-10: C00-D48; bei Männern 7%, bei Frauen 15% aller stationären Reha-Maßnahmen). Hauptziel der Untersuchung ist die Beantwortung der Frage, wie häufig welche Art von psychischer Störung bei Patienten zusätzlich zu einer somatischen Erkrankung vorliegt, die am Beginn einer stationären Rehabilitation sind. Die Studie dient daher der Verbesserung des rehabilitationswissenschaftlichen Forschungsstandes in diesem bisher nicht untersuchten Bereich und will darüber hinaus einen substantiellen inhaltlichen Beitrag zur Qualitätsverbesserung der Zieldefinition und der von ihr beeinflußten differentialtherapeutischen Entscheidungen im Rehabilitationsprozeß leisten. Es soll schließlich durch die Studie dazu beigetragen werden, die Zuweisungsentscheidungen für spezifische Rehabilitations-maßnahmen (differentielle Indikation) durch empirische Daten zur Comorbidität von Rehabilitationspatienten zu verbessern. Weiterhin sollen durch die verbesserte differentialdiagnostische Einschätzung Zuweisungsentscheidungen zu verschiedenen Behandlungsverfahren in der stationären Rehabilitation (z.B. psychologische Therapieverfahren, psychopharmakologische Interventionen) verbessert werden. Möglicherweise läßt sich aufgrund der Ergebnisse die Effektivität und Effizienz von stationären Rehabilitationsmaßnahmen insofern steigern, daß Fehlzuweisungen (z.B. aufgrund einer im Vordergrund stehenden psychischen Störung) in Zukunft eher vermieden werden können (gesundheitsökonomischer Studienaspekt). Zielsetzung ist die Fallidentifikation und Diagnosestellung bzgl. psychischer Störungen von Patienten in der medizinischen Rehabilitation mit der Möglichkeit zu nationalem und internationalem Vergleich auf der Basis einer Screening-Untersuchung mittels Fragebogen und deren Validierung auf der Basis computergestützter Diagnostik (M-CIDI-Interview in der DIA-XVersion) und klinische Interviews nach ICD-10 (klinische Leitlinien) und DSM-IV. Die geplante Studie hat im einzelnen folgende Untersuchungsziele: a) Wie hoch ist die aktuelle (4-Wochen). 6- bzw. 12-Monats- und Lebenszeitprävalenz komorbider Störungen bei orthopädischen, kardiologischen und onkologischen Erkrankungen und welche sind behandlungsbedürftig? b) Wie häufig kommen mehrere psychische Störungen vor (Komorbidität)? 49 c) Unterscheiden sich die Prävalenzraten komorbider psychischer Störungen zwischen verschiedenen Krankheitsgruppen? d) Unterscheiden sich die Prävalenzraten von komorbiden psychischen Störungen von Raten aus anderen epidemiologischen Studien (klinische Studien mit vergleichbarer Methodik, z.B. Bundesgesundheitssurvey ´98, Wittchen, 2000b)? e) Gibt es Zusammenhänge zwischen Risikofaktoren (z.B. Geschlecht, Alter, Schweregrad der somatischen Erkrankung) und der Art und Häufigkeit psychischer Störungen? f) Welche Screeningverfahren können für die Routineversorgung zur Entdeckung psychischer Störungen empfohlen werden? g) Wie hoch sind die Entdeckungsraten von psychischen Störungen durch die Behandler? h) Wie groß ist der Bedarf für psychologische, psychiatrische bzw. psychotherapeutische Betreuungsleistungen bei chronisch körperlich kranken Patienten? 4.3 Design und Methodik Der Untersuchungsplan sah eine schriftliche Befragung (Survey mittels Fragebogen) von Patienten der medizinischen Rehabilitation (Herz-Kreislauf-, muskulo-skelettale, Tumorerkrankungen) bzw. ambulanten Versorgung und in der stationären Akutversorgung (nur Tumorpatienten), in Kombination mit dem Einsatz eines standardisierten Interviewverfahrens vor. Nach Durchführung des Screenings wurden schwerpunktmäßig bei denjenigen Patienten standardisierte klinische Interviews durchgeführt, bei denen aufgrund der Ergebnisse der Screeninguntersuchung der Verdacht auf das Vorliegen einer psychischen Beeinträchtigung bestand. Dieses Design wurde in dieser Form bei der Untersuchung vom Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und muskulo-skelettalen Erkrankungen umgesetzt. In der Onkologie wurde ein leicht modifiziertes Procedere gewählt, welches zum Ziel hatte, je die Hälfte der per Fragebogen gescreenten Patienten zu interviewen. Analog der WHO-Studie zu „Mental Illness in General Health Care“ (Üstün & Sartorius, 1995) wurden die Patienten je nach Scoreausprägung auf dem Screening-Fragebogen „General Health Questionnaire“ (GHQ-12, Goldberg & Williams, 1988) interviewt, um die erhobenen Angaben zu validieren (zweistufiger, multimethodaler Untersuchungsansatz). 50 Abb. 2: Studiendesign Screening mit GHQ-12 (Tag 1-3) Stratifizierung 60% unterer 10% 20% mittlerer Zufalls- 30% 20 % oberer Score auswahl 50% Diagnostisches Interview (CIDI) Arztangaben Nach Ermittlung der GHQ-12-Scores im Rahmen einer Vorstudie, in der nur die Fragebogenverfahren eingesetzt und parallel die Akzeptanz der Befragungstechnik bei den Rehabilitanden überprüft wurde (vgl. Härter et al., 2000b), wurden die Patienten drei Gruppen mit unteren (60%), mittleren (20%) und oberen (20%) GHQ-12-Summenscores zugewiesen. Aus der Gruppe mit unteren Scores wurden nach Zufall ein Zehntel der Personen zum Interviewverfahren ausgewählt, aus der mittleren Score-Gruppe ein Drittel und aus der oberen Score-Gruppe die Hälfte der Patienten (Abb. 2). Dieses Samplingverfahren erhöhte die Wahrscheinlichkeit, in der klinischen Untersuchung schwerpunktmäßig diejenigen Patienten zu untersuchen, bei denen tatsächlich behandlungsbedürftige psychische Störungen vorliegen. Insgesamt war geplant, in den beiden Störungsbereichen Herz-Kreislauf- und muskulo-skelettale Erkrankungen je 800 Patienten zu untersuchen, wobei die Größe der Stichprobe nach Durchführung einer Poweranalyse aus der a priori (konservativ) geschätzten Prävalenz psychischer Störungen von 15% (erwarteter Populationsmittelwert) errechnet wurde. Als Referenzwerte galten einerseits die Ergebnisse der WHO-Studie aus dem allgemeinmedizinischen Versorgungsbereich (Üstün & Sartorius, 1995), andererseits die Statistik der Rentenversicherungsträger bzgl. der Häufigkeit von Zweit- und Drittdiagnosen (aus dem Bereich der psychischen Erkrankungen) bei Herz-Kreislauf- und muskulo-skelettalen Erkrankungen. 51 Die zweistufige Untersuchung bestand aus dem Screeningverfahren (GHQ-12, HADS), einem breiteren Fragebogenset (s.u.) kombiniert mit klinischen Interviews und ergänzt durch ärztliche Angaben zu den untersuchten Patienten. Für die Studie wurden international bewährte Selbstbeurteilungsinstrumente und Interviewverfahren angewandt, die insbesondere die Diagnosebereiche affektive Störungen, neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen sowie Störungen durch Substanzmissbrauch reliabel und valide mit guten psychometrischen Kennwerten (Sensitivität und Spezifität) erfassen (vgl. Kapitel 2). Folgende Assessment-Verfahren wurden eingesetzt: Selbstbeurteilungsverfahren • General Health Questionnaire (GHQ-12, Goldberg & Williams, 1988; Kap. 2.2) • Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS, Herrmann et al., 1995; Kap. 2.2) • Stamm-Screening-Questionnaire (SSQ / CID-S, Wittchen et al., 1999a; Kap. 2.2) • Lübecker Alkoholabhängigkeits- und missbrauchs-Screening-Test (LAST, Rumpf, Hapke & John, 2001); dieses 7-Item-Verfahren beruht auf einem kombinierten Einsatz der international gebräuchlichen Fragebogenverfahren CAGE und dem Michigan Alkoholismus Screening Test sowie seinen Kurzformen, wobei diese Skala eine höhere Sensitivität gegenüber den Einzelverfahren aufweist. • SF-36 Health Survey (Bullinger, 1996); diese Skala erfasst acht Dimensionen der Lebensqualität, die sich konzeptionell in die Bereiche „körperliche Gesundheit“ und „psychische Gesundheit“ einordnen lassen. Er eignet sich insbesondere als Screening-Instrument des allgemeinen Gesundheitszustandes und dessen Veränderung. • Krankheitsvorgeschichte und somatische Erkrankungen aus Fragebogen zum Bundesgesundheitssurvey ´98 (vgl. Wittchen et al., 1999b); es wurden die Skalen zur Erfassung körperlicher Erkrankungen und zu muskulo-skelettalen Schmerzsymptomen übernommen, um Vergleiche zwischen der Stichprobe der Rehabilitationspatienten und der Allgemeinbevölkerung vornehmen zu können. 52 Fremdbeurteilungsverfahren • Composite International Diagnostic Interview (M-CIDI) in der DIA-X-Version (Wittchen, Weigel & Pfister, 1996; Kap. 2.1). • Medizinisches Datenblatt (Eigenentwicklung); bei allen interviewten Patienten erfolgte eine Fremdbeurteilung der körperlichen, psychischen und sozialen Belastung durch den Arzt. Ferner wurden die vorliegenden somatischen Diagnosen, der Schweregrad der Erkrankung und die Art der eingeleiteten Maßnahmen erhoben. • Entlassberichte; hier wurden insbesondere die Angaben ausgewertet, die Hinweise auf psychische Beeinträchtigungen oder Störungen enthielten (genannte Diagnosen, sozialmedizinische Beurteilung, therapeutische Vorschläge für die poststationäre Phase). Interviewertraining Die Interviewer der Studie waren alle Diplom-Psychologen, Psychologiestudierende im letzten Ausbildungsabschnitt oder Ärzte, die in klinischer Ausbildung standen oder über vertiefte klinische Erfahrungen verfügten. Sie wurden vor Studienbeginn für den Einsatz des CIDI-Interviews in einem standardisierten zweitägigen Training geschult. Zuvor hatte unsere Arbeitsgruppe ein Interviewer-Seminar beim Autor der deutschen CIDI-Version in München (H.-U. Wittchen) absolviert. 4.4 Datenanalyse Die Analyse der Daten beinhaltete deskriptive Statistikverfahren, Chi2-Tests für Kontingenztafeln bei kategorialen Variablen und Varianzanalysen bei intervallskalierten Werten (ANOVA, Scheffé-test) sowie Berechnungen des relativen Risikos (Odds Ratios) assoziierter Risikofaktoren. Zur Berechnung der Prävalenz mit Bezug auf die Gesamtgruppe der Rehabilitanden (nur orthopädische und kardiologische Patienten) wurden die Patienten aufgrund des Samplingverfahrens (Selektion interviewter Patienten anhand des GHQ-Scores) in den drei Sub-Stichproben (untere, mittlere und hohe GHQ-Scores) bezüglich der individuellen Wahrscheinlichkeit der 53 Auswahl für das klinische Interview (10, 30 und 50%) gewichtet (vgl. Üstün & Sartorius, 1995). Das gruppenbezogene Gewicht wurde durch die Division der Anzahl gescreenter Patienten (mit einem der drei GHQ-Scores) durch die jeweilige Anzahl interviewter Patienten in diesem Stratum (mit demselben GHQ-Score) berechnet: z.B. wurden 503 Patienten mit Herz-KreislaufErkrankungen mit niedrigem GHQ-Score gescreent und 55 von diesen schlossen das Interview ab, das Stichprobengewicht in dieser „unteren“ GHQ-Gruppe beträgt 9,1 (503/55). Um die gewichtete Anzahl der Interviewpatienten pro Stratum auf die Anzahl der gesamten Interviewstichprobe beziehen zu können, wurden die drei Stichprobengewichte schließlich mit dem Ergebnis der Division der Gesamtanzahl interviewter Patienten durch die Anzahl insgesamt gescreenter Patienten multipliziert (z.B. 164 Interviews / 787 Screeningbögen = 0.2, bei Herz-KreislaufPatienten). Die Stichprobengewichte betragen entsprechend dieser Berechnungen bei der Indikationsgruppe Herz-Kreislauf-Erkrankungen 1,90 für die untere, 0,62 für die mittlere und 0,48 für die hohe GHQ-Score-Gruppe1. Diese Gewichtung erlaubt eine von der Auswahl der Patienten (gezieltes Oversampling von positiv gescreenten Patienten) unabhängige Schätzung der Populationsparameter 4-Wochen-, 12-Monats- und Lebenszeitprävalenz psychischer Störungen. 4.5 Stichproben und Patientencharakteristika In 23 Institutionen - 10 Rehabilitationskliniken aus den Indikationsbereichen Orthopädie und Kardiologie, vier onkologischen Kliniken und neun onkologischen Fachpraxen – konnten insgesamt 2266 Patienten mit den Screeninginstrumenten (GHQ-12, HADS und SSQ) untersucht werden (Tab. 6). Das epidemiologische Design konnte in den Bereichen Orthopädie und Kardiologie wie geplant umgesetzt werden; für jeden Indikationsbereich wurden die angestrebten Fallzahlen (je 800 Patienten in der Orthopädie und Kardiologie) erreicht. Ein guter Rücklauf konnte auch hinsichtlich der ausführlicheren Fragebogen zur Beeinträchtigung der Gesundheit und Funktionsfähigkeit (SF-36), zur Krankheitsvorgeschichte und zu somatischen Erkrankungen erzielt werden (Gesamtrücklauf: 87%). 1 Für die Gewichtsberechnung der drei GHQ-Gruppen bei den orthopädischen Patienten wird auf die entsprechende Publikation verwiesen (Härter et al., in press). 54 Tabelle 6: Messinstrumente und Stichproben aus den drei Indikationsbereichen Orthopädie Kardiologie Onkologie Gesamt 4 6 131 23 Screening 910 839 517 2266 Fragebogen (Rücklauf in %) 672 (74) 804 (96) 495 (96) 1971 (87) Interviews 205 170 200 575 Medizinische Datenblätter (Rate in %) 733 (81) 769 (92) 491 (95) 1993 (88) Einrichtungen (Reha-Kliniken) 1 zwei Rehabilitationskliniken, zwei Akutkliniken, neun onkologische Fachpraxen In der Onkologie konnten etwas mehr Patienten untersucht werden, als es im ursprünglichen Antrag im Rahmen der Pilotstudie bzw. durch den Zusatzantrag vorgesehen war (N=450). Dies lag an den sehr motivierten, an der Studie beteiligten Fachpraxen und Akutkliniken sowie zusätzlichen Diplomanden bzw. Doktoranden, die sich an der Untersuchung beteiligten. Sehr erfreulich war auch, dass die beteiligten ärztlichen Behandler sehr engagiert die Datenerhebung unterstützten und zu fast 90% der gescreenten Patienten medizinische Daten vorliegen. Tabelle 7 zeigt relevante soziodemographische Charakteristika der gewonnenen Stichproben. Da u.a. eine Fragestellung der Untersuchungen war, möglichst generalisierbare Aussagen hinsichtlich der Prävalenz psychischer Störungen bei chronischen körperlichen Erkrankungen, speziell bei Patienten in der medizinischen Rehabilitation, zu machen (Härter & Bengel, 1998), sind in der Tabelle Bezugszahlen zu den Indikationsbereichen Orthopädie und Kardiologie aus der 55 Statistik des Verbandes Deutscher Rentenversicherungsträger (vgl. VDR, 1999; 2000) aufgeführt. Tabelle 7: Soziodemographische Charakteristika der drei Stichproben Orthopädie (N = 672) VDR 19981 Kardiologie (N = 793) VDR 19992 Onkologie (N = 495) 53 45 23 24 75 51 (19-83) 49 61 (27-90) 52 55 (17-84) Nationalität (dt., %) 95 94 98 94 - Kostenträger (%) LVA BfA Andere 55 36 9 59 40 1 31 56 13 54 43 3 - Erwerbstätig (%) 70 69 42 70 62 Anteil Frauen (%) Alter MW (Range) 1 Mittelwerte aller Patienten mit muskulo-skelettalen Erkrankungen, Jahr 1998 (VDR, 1999) 2 Mittelwerte aller Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Jahr 1999 (VDR, 2000) Diese Zahlen (Mittelwerte) basieren auf Auswertungen aller Patienten, die im jeweiligen Bezugsjahr eine Rehabilitationsmaßnahme in Anspruch nahmen. Sie ermöglichen eine Abschätzung, inwieweit die gewonnenen Stichproben unserer Untersuchung mit den Patienten aus der Rehabilitation insgesamt vergleichbar sind (Bezugsjahr für die Stichprobe aus der Orthopädie: 1998; für die Kardiologie: 1999). Es zeigt sich, dass der Anteil von Frauen und Männern in beiden Stichproben sehr ähnlich den Bezugszahlen ist, tendenziell wurden in der Orthopädie etwas mehr Frauen untersucht als es ihrem Anteil in der Gesamtpopulation entspricht. Der Altersdurchschnitt, die Nationalität, der 56 Versicherungsstatus und der Anteil Erwerbstätiger ist in der Gruppe der Patienten mit muskuloskelettalen Erkrankungen hingegen sehr ähnlich der Vergleichspopulation. Bei der kardiologischen Stichprobe zeigen sich bei diesen Variablen deutlichere Unterschiede zur gewählten Bezugsgruppe. Die untersuchten Patienten sind im Durchschnitt älter (+9 Jahre) als die Rehabilitationspopulation, entsprechend zu einem geringerem Anteil noch erwerbstätig. Diese Unterschiede können folgendermaßen erklärt werden: Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, insbesondere mit Myokardinfarkten, sind im Durchschnitt ältere Patienten, deren Rehabilitationsmaßnahme häufig nicht durch die Rentenversicherung, sondern im Rahmen einer Anschlussheilbehandlung durch die Krankenkasse finanziert wird. Zudem gelang es weniger gut, ausreichend Patienten aus der Teilgruppe der Arbeiterrentenversicherung (LVA) zu untersuchen, der Anteil der Angestellten (BfA) ist deutlich höher. Der Vergleich der kardiologischen Stichprobe mit den VDR-Daten ist daher nur bedingt sinnvoll, da viele der in der Rehabilitation befindlichen Patienten nicht in der VDR-Statistik erfasst werden. Es scheint eher, dass die von uns untersuchte Stichprobe der kardiologischen Patienten einen Querschnitt von Patienten mit diesen Erkrankungen darstellen, die in Rehabilitationskliniken behandelt werden. Hinsichtlich der Patienten aus dem onkologischen Indikationsbereich liegen keine vergleichbaren Werte vor, die meisten Patienten stammen aus onkologischen Fachpraxen und sind daher nicht direkt mit dem Klientel der Rehabilitanden zu vergleichen. Man kann aber davon ausgehen, dass der höhere Anteil von Frauen in etwa auch der Relation in onkologischen Rehabilitationskliniken entspricht, da wesentlich häufiger Frauen mit Tumorerkrankungen eine Rehabilitationsmaßnahme in Anspruch nehmen als Männer. Der Alterdurchschnitt der Patienten in der Onkologie liegt je nach Indikation zwischen 55 und 60 Jahren (VDR, 1999). 57 5 Ergebnisse Nachfolgend werden die wichtigsten Ergebnisse der einzelnen Teilstudien bzw. Teilauswertungen zusammengefasst referiert. Die Darstellung orientiert sich an thematisch abgrenzbaren Einheiten, die bereits publiziert sind oder zur Publikation eingereicht wurden. Zunächst werden die die Ergebnisse von Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Abschnitt 5.1), dann die von Patienten mit muskulo-skelettalen Erkrankungen (Abschnitt 5.2) und schließlich die aus der Studie mit Tumorpatienten (Abschnitt 5.3) berichtet. Es folgen die Befunde zur Screeninggüte der eingesetzten und überprüften Selbstbeurteilungsinstrumente (Abschnitt 5.4). Abgeschlossen wird die Darstellung mit einer Zusammenfassung der Befunde (Abschnitt 5.5). 5.1 Psychische Störungen bei Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen Diese Teilauswertung beinhaltete einerseits, in welchem Ausmaß sich Patienten mit HerzKreislauf-Erkrankungen in der medizinischen Rehabilitation in ihrem aktuellen psychischen Befinden beeinträchtigt erleben (Selbstbeurteilung). Andererseits wurde erfasst, wie hoch die 4Wochen-, 12-Monats- und Lebenszeitprävalenz psychischer Störungen bei diesen Patienten ist und welche Einschränkungen Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und komorbiden psychischen Erkrankungen in ihrer Rollenfunktion und Lebensqualität erleben. Zur Ermittlung der GHQ-Scores der drei Score-Gruppen für die Durchführung des Samplingverfahren wurden zunächst in einer Vorstudie insgesamt 57 Patienten untersucht (Härter et al., 2000b). In der Hauptstudie konnten insgesamt 839 Patienten gescreent (GHQ-12) und 804 Patienten mit dem ausführlicheren Patientenfragebogen (HADS, LAST, SF-36 etc.) sowie 170 Patienten mit dem Interview untersucht werden (vgl. Tab. 6). Im Screening mit dem Fragebogen zum allgemeinen Wohlbefinden (GHQ-12) zeigt sich, dass ein erheblicher Anteil der Rehabilitanden aus dieser Indikationsgruppe (36%) mittlere bis starke psychische Befindlichkeitsstörungen berichtet. Über den empfohlenen Cut-off-Scores (≥11) der Skalen Ängstlichkeit und Depressivität liegen 12 bzw. 10% der Patienten. Im Screening für Alkoholerkrankungen (LAST) weisen 18% der Patienten erhöhte Testwerte auf. Keine signifikanten Unterschiede bestehen in den GHQ-Scores zwischen Patienten, die nur mit Fragebogen bzw. mit Fragebogen und Interview untersucht wurden. 58 Über die Hälfte der interviewten Patienten (55,2 %) erfüllt – bezogen auf die gesamte bisherige Lebensspanne - die Kriterien für eine psychische Störung. Bezogen auf die letzten 12 Monate weisen ein Drittel der untersuchten Patienten (34,1%) irgendeine psychische Störung auf. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt (aktuelle 4-Wochen-Prävalenz) weist jeder 5. kardiologische Rehabilitationspatient psychische Symptome mit Störungswert auf (19,5%). Die 12-Monats-Prävalenzen entsprechen weitgehend den Raten psychischer Störungen aus dem Bundesgesundheitssurvey 1998 (Wittchen et al., 1999b; Wittchen, 2000b; siehe Tab. 2), wobei tendenziell häufiger affektive und Suchterkrankungen von den kardiologischen Patienten berichtet werden. Jeder vierte Patient mit einer aktuellen psychischen Störung berichtete über zwei oder mehr simultan bestehende Störungen, bezogen auf die Einjahres- und Lebenszeitprävalenz sind ca. ein Drittel der Patienten von zwei oder mehr psychischen Störungen gleichzeitig betroffen. Eine vertiefte Subgruppenanalyse der Raten bezogen auf unterschiedliche Altersgruppen identifiziert höhere Prävalenzraten für aktuell bestehende psychische Störungen (4-WochenPrävalenz) bei Patienten aus der Altersgruppe 40-49 Jahre (Rate: 37%) und der Altersgruppe 5059 Jahre (25%). In der Population der über 59 Jahre alten Patienten sinkt die aktuelle Prävalenzrate auf 13% psychischer Störungen. Auch eine Berechnung des relativen Risikos mit dem Faktor Geschlecht als unabhängiger Variable zeigt, dass affektive Erkrankungen und psychische Störungen insgesamt (12Monatsprävalenz) signifikant häufiger von Frauen berichtet werden, die Odds Ratio beträgt bei den affektiven Erkrankungen 2,2 und den Störungen insgesamt 2,2. Suchterkrankungen treten tendenziell häufiger bei Männern auf (OR: 1.8), erreichen aber keinen signifikanten Unterschied (geringer Frauenanteil in dieser Erkrankungsgruppe), ebenso Angst- und somatoforme Störungen, letztere insbesondere aufgrund der geringen Fallzahl von Patienten insgesamt in dieser Kategorie. Bezüglich der aktuellen Prävalenz behandlungsbedürftiger psychischer Störungen werden am häufigsten Angststörungen (insbes. spezifische und soziale Phobien sowie Agoraphobien mit und ohne Panikstörung) mit insgesamt 8,7% und affektive Störungen (Major Depression bzw. affektive Erkrankung aufgrund eines medizinischen Krankheitsfaktors und anhaltende depressive Verstimmungen) mit 8,5% sowie Suchterkrankungen mit 5,5% (v.a. Nikotinabhängigkeit) berichtet. Andere psychischen Störungen sind in ihrer Häufigkeit unbedeutend, dies betrifft sowohl somatoforme Störungen (1,6%), Essstörungen und psychotische Störungen. Die Belastungssco- 59 res der jüngeren Patienten und die relativ höhere Rate psychischer Syndrome bei Frauen unterstreichen die Notwendigkeit von 1) effektiven und verbesserten diagnostischen Strategien zur Entdeckung psychischer Störungen in der medizinischen Rehabilitation und 2) von effektiven psychosozialen Konzepten und Interventionen für komorbid belastete Rehabilitanden. 5.2 Psychische Störungen bei Patienten mit muskulo-skelettalen Erkrankungen In dieser Teilauswertung wurde einerseits die aktuelle (4-Wochen-), 12-Monats- und Lebenszeitprävalenz psychischer Störungen in der Gruppe der Patienten mit muskulo-skelettalen Erkrankungen analysiert. Anderseits wurde untersucht, inwieweit Patienten mit komorbiden psychischen Störungen zusätzlich hinsichtlich der erlebten Schmerzintensität, der Einschränkungen der Lebensqualität und sozialer Konsequenzen (AU-Zeiten, Inanspruchnahme medizinischer Dienste) beeinträchtigt sind (vgl. Kapitel 4.2). Insgesamt gingen 910 gescreente Patienten und 205 interviewte Patienten in die Auswertung ein, wobei die Auswahl der Interviewten entsprechend der Stratifizierungs- und Samplingprozedur durchgeführt wurde (vgl. Abb. 2). 20% der Patienten berichten im GHQ-12 eine mittlere (Score: 5-7), 23% eine schwere psychische Belastung in den vergangenen Wochen (Score: 8-12). Auf der Depressionsskala der HADS geben 16% der Patienten Scores über dem empfohlenen Cut-off von 11 (4% mit hohem Score von 15-21), 24% aller Patienten einen Wert gleich oder höher dem Cut-off von 11 auf der Ängstlichkeitsskala an (4% mit hohem Score von 15-21). Der Alkoholismus-Screener (LAST) identifiziert 15% aller Patienten mit dem Risiko einer Alkoholerkrankung (Missbrauch oder Abhängigkeit). Die gewichteten Prävalenzraten psychischer Störungen nach DSM-IV betragen 31,1% in den letzten vier Wochen, 47,1% im letzten Jahr und 64,6% bezogen auf die Lebenszeit. Wie bei den anderen Indikationen sind auch in dieser Indikationsgruppe die häufigsten Erkrankungen Angststörungen (aktuell: 15,0%) und affektive Störungen (aktuell: 10,7%), die ca. zwei Drittel aller psychischen Störungen umfassen. Auch hier zeigt sich – bezogen auf alle drei Zeitfenster – dass spezifische Phobien und dysthyme Störungen sowie Episoden einer Major Depression die klinisch häufigsten einzelnen Syndrome darstellen. Im Vergleich zu den beiden anderen Indikationen sind auch Suchterkrankungen (aktuell: 9,2%), speziell die Nikotinabhängigkeit, und somato- 60 forme Schmerzsyndrome (aktuell: 8,3%) bedeutsam. 39,1% aller Patienten mit einer psychischen Störung hatten eine oder mehrere psychische Störung in der 4-Wochen-Periode. Die Komorbiditätsraten aller Patienten mit mindestens einer Störung für das Jahresintervall betragen 44,3% und 62,4% bezogen auf die Lebenszeit. Die häufigsten kombinierten Störungen sind mehrere Angststörungen oder Angststörungen mit depressiven bzw. Suchterkrankungen sowie somatoformen Störungen. Im Vergleich zu den Daten des Bundesgesundheitssurvey ´98 (Wittchen, 2000b) sind die aktuellen wie Ein-Jahres-Prävalenzen psychischer Störungen in dieser Indikationsgruppe am deutlichsten erhöht (31,1% vs. 17,3% bzw. 47,1% vs. 32,1%). Diese Unterschiede begründen sich v.a. durch die höheren Raten von affektiven, Angst- und Suchterkrankungen in unserer Stichprobe, alleine die Rate somatoformer Störungen (10,2%) ist ähnlich der Prävalenz in der WittchenStudie (11%). Wir fanden jedoch sehr viel niedrigere Raten als die bisher einzige Untersuchung aus dem Rehabilitationssetting (Polatin et al., 1983), die chronische Rückenschmerzpatienten untersuchten. Diese Studie berichtete über Lebenszeitprävalenzen von 98%, 97% dieser Studiengruppe erhielten die Diagnose einer somatoformen Schmerzstörung. Auch wenn diese klinisch schwierig zu stellende Diagnose ausgenommen wurde, erfüllten immer noch 77% die diagnostischen Kriterien einer Achse-I-Störung. Die Unterschiede können teilweise durch unterschiedliche methodische Ansätze (SKID statt CIDI in der amerikanischen Untersuchung) und die Auswahl der Patienten (nur chronische Rückenschmerzpatienten bei Polatin et al., 1993) erklärt werden. Bei der Analyse der Einschränkungen der Lebensqualität zeigt sich, dass Rehabilitanden mit einer oder mehreren komorbiden psychischen Störungen signifikant häufiger im letzten Jahr krank geschrieben sind als Patienten ohne psychische Störungen. Aktuell komorbid psychisch erkrankte Patienten berichten darüber hinaus über eine höhere aktuelle Schmerzintensität und auch eine höhere Schmerzintensität bezogen auf die Lebensspanne. Besonders stark sind die von den Patienten berichteten Einschränkungen der Lebensqualität, die sich - bis auf die körperliche Funktionsfähigkeit – auf allen sieben Einzelskalen ergeben (u.a. allgemeine Gesundheitswahrnehmung, Vitalität, soziale Rollenfunktion), die durch den SF-36 erfasst werden. Diese Beeinträchtigung der Lebensqualität ist besonders bei denjenigen Patienten ausgeprägt, die mehr als 61 eine komorbide psychische Störung aufweisen (Risikogruppe). Diese mehrfache Beeinträchtigung sollte in der Behandlung Berücksichtigung finden, da sie die Maßnahmen ungünstig beeinflussen kann, v.a. wenn komorbide psychische Störungen nicht entdeckt werden. 5.3 Psychische Störungen bei Patienten mit Tumorerkrankungen Die Teilstudie zu psychischen Störungen bei Krebspatienten in der stationären Akutbehandlung und medizinischen Rehabilitation umfasste die Analyse der 4-Wochen-, 6-Monats- und Lebenszeit-Prävalenzen psychischer Störungen bei Krebspatienten im stationären Setting. Insgesamt gingen in die Auswertung 256 Patienten aus zwei Akutkliniken und zwei Rehabilitationskliniken in die Studie ein. Das Ziel, jeden zweiten von ihnen anschließend im Rahmen des klinischstandardisierten Interview psychodiagnostisch zu untersuchen (N=120 Patienten), konnte mit insgesamt 47% interviewter Patienten bei dieser Teilstichprobe sehr gut erreicht werden. Im GHQ-12 geben fast die Hälfte beider Patientengruppen (44% und 49%) starke psychische Belastungen an (Cut-off > 4). Auf den Skalen Depressivität und Ängstlichkeit (HADS) liegen jeweils über 20% der Patienten über dem Cut-off > 10. Die vergleichbar hohen Belastungsscores der interviewten Patienten und der nur per Fragebogen untersuchten Patienten belegen, dass die Stichprobe der interviewten Patienten keiner ungünstigen Selektion (z.B. Auswahl psychisch stärker belasteter Patienten) unterliegt. Die psychische Belastung der Patienten, gemessen mit der HADS, ist mit 20% auf der Subskala Depression (bei einem Cut-off > 10) höher als in vergleichbaren Untersuchungen mit großen Stichproben (Literaturverweise s. Publikation im Anhang), ähnlich hoch ist die Belastung durch angstbezogene Symptome (Subskala Ängstlichkeit). Die Hälfte der Patienten in der Akutversorgung (48,7%) und über drei Viertel der Patienten in der Rehabilitation (78,9%) erfüllen die Kriterien für eine oder mehrere psychische Störungen im Verlaufe ihres Lebens (Lebenszeitprävalenz). Bezogen auf die vergangenen sechs Monate (6Monats-Prävalenz) werden bei 37,8% der in der Akutklinik behandelten Patienten und bei 44,7% der in der Rehabilitation befindlichen Patienten psychische Störungen diagnostiziert. Wird untersucht, wie viele Patienten aktuell, d.h. zuletzt innerhalb der 4 Wochen vor Untersuchung (4Wochen-Prävalenz) Symptome psychischer Störungen aufweisen, die die Diagnosekriterien einer oder mehrerer psychischer Störungen erfüllen, so ergeben sich Prävalenzraten von 24% (Akutversorgung) bzw. 34% (Rehabilitation). In beiden Patientengruppen sind Angststörungen und 62 affektive Störungen die häufigsten Diagnosen aktuell vorhandener psychischer Störungen (17% und 11% bzw. 16,8% und 13,2%). Unter den Angststörungen sind es insbesondere die Panikstörungen mit und ohne Agoraphobie, die klinisch bedeutsam sind. Die häufigsten Diagnosen bei Angststörungen werden jedoch durch spezifische und soziale Phobien verursacht, die allerdings nur in 40% der Fälle einen behandlungsbedürftigen Schweregrad erreichen. Bei den affektiven Störungen sind es die einzelnen oder rezidivierenden depressiven Episoden (Major Depression) und die länger anhaltenden Dysthymien, die den größten Anteil der Diagnosen ausmachen. Die deutlich selteneren somatoformen Schmerzstörungen sind von der Tumorerkrankung unabhängige Schmerzsymptomatiken, bei denen vom Patienten psychische Faktoren als mit verursachend oder verschlimmernd angegeben werden. Bei den Suchterkrankungen liegen entweder eine Nikotin- und/oder eine Alkoholabhängigkeit vor. Der Vergleich mit den Prävalenzraten aus dem Bundesgesundheitssurvey ´98 (Wittchen, 2000b) zeigt, dass im 4-Wochen-Intervall die stationär behandelten Tumorpatienten eine um ein Drittel höhere (Akutklinik) bzw. doppelt so hohe (Rehabilitation) Prävalenz psychischer Störungen aufweisen (24% und 34% versus 17,3% im Gesundheitssurvey). Die Unterschiede in den Prävalenzraten zwischen beiden klinischen Stichproben und der Allgemeinbevölkerungsstichprobe sind alleine auf die erhöhten Prävalenzen von affektiven und Angststörungen in der Stichprobe der Krebspatienten zurückzuführen. Allerdings muss bei dieser Bewertung der Raten beachtet werden, dass die Prävalenzraten für psychische Störungen in unserer Untersuchung auch deswegen höher sein können, da Frauen doppelt so häufig wie Männer psychische Störungen aufweisen und an der Studie v.a. Frauen teilgenommen haben. Die Ergebnisse hinsichtlich der Häufigkeit depressiver Störungen stehen in Einklang mit anglo-amerikanischen Studien, die mit ähnlicher Methodik ebenfalls erhöhte Prävalenzraten depressiver Erkrankungen von Krebspatienten im Vergleich zu Personen aus der Allgemeinbevölkerung berichten (Verweise s. Härter et al., 2000a). Allerdings sind die Raten aktuell bestehender psychischer Störungen in beiden Stichproben insgesamt geringer als die erhöhten Raten für psychische Störungen, die in früheren anglo-amerikanischen Studien berichtet wurden. Eine Erklärung für die niedrigere Prävalenz aktueller psychischer Störungen in unserer Studie im Vergleich zu früheren Untersuchungen ist, dass durch das eingesetzte Interviewverfahren (CIDI) die Diagnose von Anpassungsstörungen mit ängstlichen und depressiven Symptomen bisher nicht mög- 63 lich ist. Diese Störungen sind aber z.B. in der Untersuchung von Derogatis et al. (1983) für allein 32% aller aktuellen psychiatrischen Diagnosen verantwortlich. Hingegen ist die Prävalenz von aktuell bestehenden Angststörungen, speziell von Phobien, in unserer Untersuchung höher als in anderen Studien aus der Psychoonkologie (Lit. s. Härter et al., 2000a). Diese Differenz könnte sich dadurch ergeben, dass durch das voll standardisierte Interview (CIDI) alle Angststörungen (speziell die einfachen Phobien) im Detail abgefragt werden. In einem offenen klinisch-psychiatrischen Interview, wie z.B. in der klassischen Studie von Derogatis und Kollegen, wurde stärker auch auf die klinische Relevanz von aktuell bestehenden Störungen Wert gelegt. Werden nur die tatsächlich behandlungsbedürftigen Störungen betrachtet, reduziert sich auch in unserer Untersuchung die Häufigkeit von Angsterkrankungen (einfache und soziale Phobien) um 40%. Schwierig zu interpretieren ist der Unterschied in der Höhe der Lebenszeitprävalenzen in beiden Stichproben. Dies kann einerseits daran liegen, dass sich die Patienten im Rahmen der Rehabilitationsbehandlung verstärkt Fragen der Krankheitsverarbeitung und Auswirkungen der Krebserkrankung auf ihr psychisches Wohlbefinden zuwenden (können) und daher eher auch psychische Beeinträchtigungen in der Vergangenheit erinnern („recall bias“). Hingegen sind Patienten in der Akutversorgung primär mit Fragen und Belastungen im Hinblick auf die anstehende bzw. laufende Akutbehandlung (Chemotherapie, Bestrahlung, Operation) beschäftigt, die länger zurückliegende psychische Beeinträchtigungen in ihrer Bedeutung in den Hintergrund treten lassen. Andererseits könnte der Unterschied dadurch zustande kommen, dass die Auswahl der Kliniken und die relativ kleine Zahl untersuchter Patienten in den Rehabilitationskliniken die unterschiedlichen Prävalenzraten bedingte. Die Teilstudie psychische Störungen und assoziierte Faktoren bei Patienten in der stationären Akutversorgung, Rehabilitation und ambulanten Behandlung analysierte zusätzlich zu den onkologischen Patienten in der stationären Akutbehandlung und Rehabilitation Patienten aus der ambulanten Versorgung. Außerdem wurde die Häufigkeit komorbider psychischer Störungen und die Frage nach assoziierten Risikofaktoren für psychische Störungen (Geschlecht, Schweregrad der Krebserkrankung, körperliche Funktionsfähigkeit und Versorgungssetting) untersucht. Insgesamt gingen in die Auswertung 517 Patienten (vgl. Tab. 6) ein. Die häufigsten psychischen Störungen sind auch hier Angst- und depressive Erkrankungen, die zusammen 58% aller Störungen ausmachen (Tab. 8). Darüber hinaus sind Suchterkrankungen von zahlenmäßiger Relevanz. 64 5,5% aller Patienten berichten aktuell (4 Wochen) über mehr als eine psychische Störung, im 12Monats-Zeitraum sind es 12,0 % und bezogen auf die gesamte Lebensspanne 29% aller Patienten (psychische Komorbidität). Tabelle 8: Prävalenzraten psychischer Störungen in der Onkologie (N = 200 Krebspatienten) 4-Wochen-Prävalenz 12-Monats-Prävalenz Lebenszeit-Prävalenz % % % Gesamt 23,5 40,0 56,5 Affektive Störungen 9,5 17,5 26,0 13,0 (7,6) 20,5 (11,7) 30,5 (19,5) Somatoforme Schmerzstörungen 2,5 7,5 16,0 Substanzmissbrauch / abhängigkeit 4,0 6,0 18,0 Essstörungen 1,0 1,5 2,5 0 1,0 4,0 Störungen Angststörungen (behandlungsbedürftig) Schizophrenie und andere psychotische Störungen Die häufigsten Angststörungen sind spezifische Phobien und Panikstörungen mit oder ohne Agoraphobie. Eine spezifische Analyse der Interviewdaten zeigt, dass nur 2/3 dieser Angsterkrankungen auch klinisch behandlungsbedürftig sind. Als behandlungsbedürftig werden Angststörungen dann gewertet, wenn die Patienten sich in ihrem Leben und ihren täglichen Aktivitäten beeinträchtigt erleben. Die Prävalenzraten der Angststörungen reduzieren sich entsprechend in den drei Zeitfenstern von 13,0% auf 7,6% (4 Wochen), von 20,5% auf 11,7% (12 Monate) und von 30,5% auf 19,5% (Lebenszeit). 65 Die Analyse der Prävalenzen in Bezug auf die untersuchten Risikofaktoren zeigt einerseits eine Assoziation der Prävalenzraten psychischer Störungen mit dem Faktor Geschlecht: Frauen berichten bezogen auf die Lebenszeit signifikant häufiger psychische Störungen (OR = 2,2). In den beiden anderen Prävalenzperioden zeigt sich die gleiche Tendenz, wenn auch nicht signifikant (OR = 1,5). Besonders die Raten aktuell bestehender depressiver Störungen sind bei Frauen mehrfach erhöht (OR = 7,5). Angsterkrankungen sind ebenfalls häufiger bei Frauen, sowohl in der 12-Monats- (OR = 2,0) wie der Lebenszeit-Periode (OR = 2,0). Patienten in der stationären Versorgung (Akut- und Rehabilitationskliniken) haben tendenziell im Vergleich zu Patienten in der ambulanten Versorgung höhere psychische Komorbiditäten, allerdings sind die Raten nur für Angststörungen im 4-Wochen-Zeitraum signifikant (OR = 2,5). Obwohl Patienten mit Metastasen eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, Angst- und affektive Störungen zu berichten, sind die berechneten Odds Ratios nicht signifikant. Es gibt aber signifikante Assoziationen zwischen der körperlichen Funktionsfähigkeit und den Raten psychischer Störungen (psychische Störungen insgesamt, Angst- und depressive Störungen) im 4Wochen-Zeitfenster (OR zwischen 2,3 bis 2,8). Vergleicht man die Prävalenzraten der in verschiedenen Settings behandelten Krebspatienten mit den Bezugszahlen aus dem Bundesgesundheitssurvey ´98 in Deutschland, ergeben sich nur leicht erhöhte Raten psychischer Störungen bei Krebspatienten, die einerseits durch die höhere Prävalenz affektiver und Angsterkrankungen und andererseits durch das Übergewicht weiblicher Patienten mit höheren psychischen Komorbiditäten erklärt werden können. Die Verteilung von Frauen und Männer zugunsten der Frauen in unserer Stichprobe kann entsprechend auch niedrigere Raten von Suchterkrankungen bei den von uns untersuchten Krebspatienten erklären, da Frauen ein etwa halb so großes Risiko für diese Störungen haben wie Männer (Wittchen, 2000b). Bedeutsam an unseren Studienergebnissen ist, dass wir die früher berichteten stärker erhöhten Prävalenzraten psychischer Störungen in der Onkologie nicht replizieren konnten (z.B. Derogatis et al.,1983; Bukberg et al., 1984). Wir konnten eher die Hypothese bestätigen, dass psychische Störungen bei Krebspatienten, mit Ausnahme leicht erhöhter Raten von Angst- und depressiven Störungen, gleich häufig wie in der Allgemeinbevölkerung sind. Unsere Befunde bestätigen daher die Ergebnisse einer umfangreichen Meta-Analyse von Prävalenzstudien in der Onkologie (vgl. van`t Spijker et al., 1997), wenn Daten von ambulant und stationär behandelten Patienten zusammen ausgewertet werden. 66 Diese These muss insoweit allerdings eingeschränkt werden, da durch die Diagnostik psychischer Störungen mittels CIDI die früher häufig beschriebenen Anpassungsstörungen nicht erfasst werden können. Eine sorgfältige, vertiefende Analyse von unterschwelligen Syndromen zeigte schließlich, dass ein erheblicher Anteil (31%) der von uns untersuchten Patienten über aktuell bestehende Symptome berichteten, die die DSM-IV-Forschungskriterien einer minoren depressiven Störung erfüllen (mindestens zwei, weniger als fünf affektive Symptome). Die Analyse der assoziierten Risikofaktoren zeigt - ähnlich unserer Meta-Analyse publizierter Studien (vgl. Aschenbrenner et al., under review) – eine höhere Wahrscheinlichkeit psychischer Störungen bei Frauen, bei Patienten mit eingeschränkter körperlicher Funktionsfähigkeit und bei Patienten mit schwerer ausgeprägter Erkrankung (Metastasen), wobei die subjektiv berichtete Einschränkung ein besserer Prädiktor als der objektive Schweregrad ist. 5.4 Screening psychischer Störungen bei körperlichen Erkrankungen Die Ziele waren einerseits der Vergleich der in unseren Studien eingesetzten Screeningverfahren HADS und GHQ-12 hinsichtlich der psychometrischen Güte (Sensitivität und Spezifität) zur Entdeckung psychischer Störungen bei Patienten mit körperlichen Erkrankungen. Andererseits sollte im einzelnen geprüft, wie gut die beiden Instrumente a) depressive Störungen, b) Angsterkrankungen c) somatoforme bzw. komorbide psychische Störungen entdecken. In die Auswertung gingen aus der onkologischen Stichprobe 188 interviewte Patienten, aus der orthopädischen Stichprobe 206 interviewte Patienten ein, bei denen vollständige Screeningbögen vorlagen. Die Receiver-Operating-Characteristics- (ROC-) Methode wurde eingesetzt, um die diagnostische Sicherheit der beiden Screeningverfahren zur Entdeckung von Patienten in den vier Diagnosegruppen zu testen (Murphy et al. 1987; Zweig & Campbell, 1993). Als Zielkriterium galten die diagnostischen Ergebnisse der CIDI-Interviews (4-Wochen-Prävalenz). Die errechnete ROCKurve drückt dabei die jeweiligen Sensitivitäts- und Spezifitätskoeffizienten aus und repräsentiert einen Index der Gesamtgüte für die Instrumente, zwischen Fällen und Nichtfällen zu unterscheiden (Zweig & Campbell, 1993). Die Schätzung der Fläche unter der errechneten Kurve quantifiziert diese Genauigkeit, wobei die Werte zwischen 0.5 (keine Diskriminanzfähigkeit) und 1.0 (perfekte Diskriminationsfähigkeit) liegen können. 67 Tabelle 9: Zusammenfassende Darstellung der Güte von HADS und GHQ-12 in der Orthopädie (N=205) und Onkologie (N=188) zur Entdeckung psychischer Störungen (optimale Cut-offs, Sensitivitäts- und Spezifitätskennwerte) HADS Cut-off Sensitivität (in %) GHQ-12 Spezifität (in %) Cut-off Sensitivität (in %) Spezifität (in %) Irgendeine Störung Orthopädie 15 65 69 9 32 86 Onkologie 16 60 79 5 55 73 Orthopädie 16 78 71 5 75 52 Onkologie 17 79 76 2 93 49 Orthopädie 17 75 72 5 80 52 Onkologie 13 88 57 6 67 76 17 59 71 1 95 21 16 87 67 3 75 55 Depressive Störung Angststörung Somatoforme Störung Nur Orthopädie Komorbide Störungen Nur Onkologie Bezogen auf die Güte der beiden Screener GHQ-12 und HADS besteht insgesamt kein signifikanter Unterschied, auch wenn der HADS in fast allen Analysen die besseren Gütewerte zeigt. Die Güte der Entdeckung (AUC) liegt in der Stichprobe der onkologischen wie orthopädischen Patienten für die HADS (AUC zwischen 0.68 und 0.80) und den GHQ-12 (AUC zwischen 0.56 und 0.77) in einem mittleren Bereich. Sowohl bezüglich der Sensitivitäts- und Spezifitätskoeffizienten, der optimalen Cut-offs als auch der Ausgewogenheit der Parameter zeigt die HADS jedoch insgesamt die bessere Performanz. Die optimalen GHQ-Scores nach der ROC-Analyse 68 schwanken hingegen sehr stark (zwischen 1 und 9 bei einem Score-Range von 0-12) und sind auch im Vergleich der beiden Analysestichproben recht heterogen (Tab. 9; siehe auch Rundel, 2001). Für die untersuchten Diagnosegruppen liegen die Cut-offs der HADS zwischen 15 und 17 (mit Ausnahme der Angststörungen in der onkologischen Stichprobe), die die ausgewogenste Balance zwischen Sensitivität und Spezifität erbringen. Die Empfindlichkeit und Genauigkeit der HADS ist auch – erwartungsgemäß der Zielrichtung der Skala, Depressivität und Ängstlichkeit zu messen – hinsichtlich der statistischen Kennwerte zur Entdeckung depressiver und Angsterkrankungen am besten. Im Vergleich zu früheren Studien, die die Screeningperformanz der HADS testeten, zeigen unsere Analysen der Messverfahren etwas niedrigere Gütekennwerte. Möglicherweise wurde die Leistungsfähigkeit der HADS in den letzten Jahren eher überschätzt, zumal wenige Studien die Skala gegenüber dem relativ strengen Kriterium eines standardisierten klinischen Interviews (CIDI) getestet haben. Auf der anderen Seite ist auch möglich, dass die Kennwerte deswegen eher im unteren Bereich der bisher hierzu publizierten Wert liegen, da wir in die Analysen keine unterschwelligen Syndrome mit aufgenommen haben, die Prävalenz der untersuchten Störungen folglich insgesamt relativ gering ist. In anderen Studien konnte gezeigt werden, dass der Einschluss weniger schwerer Syndrome einen positiven Einfluss auf die Screeninggüte hatte. Schließlich muss bei der Interpretation der Ergebnisse bedacht werden, dass die unterschiedliche methodische Herangehensweise - Screener als Selbstbeurteilungsinstrument mit dimensionalem Messansatz vs. Interview als Fremdbeurteilungsverfahren mit kategorialem Messansatz (vgl. Kapitel 2.2) – die Gütekriterien in der Höhe beschränken kann. 5.5 Zusammenfassung Das Studienziel, hinreichend große Stichproben aus den drei Indikationsbereichen Tumor-, HerzKreislauf- und muskulo-skelettale Erkrankungen zu untersuchen, um möglichst generalisierbare Aussagen zur psychischen Beeinträchtigung und zur Prävalenz psychischer Störungen bei chronisch körperlich kranken Patienten zu machen, konnte realisiert werden. Wir konnten in 23 Institutionen insgesamt 2266 Patienten mit den gewählten Screeningverfahren untersuchen. Das epidemiologische Design und die damit verbundene Stratifizierungs- und Samplingprozedur konnte 69 in den Bereichen Orthopädie und Kardiologie wie geplant umgesetzt werden und die notwendigen Interviewzahlen (N = 375) zur Bestimmung der Prävalenzraten psychischer Störungen erreicht werden. In der Onkologie konnten weitere 200 Interviews in den drei Settingbedingungen ambulante und stationäre Versorgung sowie Rehabilitation durchgeführt werden. Sehr gute Rücklaufquoten ergaben sich auch für die von den Patienten ausgefüllten Fragebogen zur Lebensqualität und zu soziodemographischen Variablen etc. (87%) sowie den medizinischen Datenblättern der behandelnden Ärzten (88%). Hinsichtlich der psychischen Belastung der Patienten zeigt sich (Fragestellung a), dass 36% (kardiologische Reha-Patienten) bis 43% (orthopädische Reha-Patienten) der untersuchten Patienten erhebliche bis starke Befindlichkeitsstörungen (Cut-off > 4) im General Health Questionnaire (GHQ-12) angeben (unveröffentlichte Gesamtergebnisse, Abb. 3). Abbildung 3: Screeningergebnisse GHQ-12, HADS-A, HADS-D und LAST (in %, N=2266) 100 80 60 40 43 36 38 20 0 Orthopädie Kardiologie Onkologie 24 20 12 GHQ-12>4 15 17 10 HADS-A>10 HADS-D>10 15 18 12 LAST + Am häufigsten berichten Patienten mit muskulo-skelelettalen Erkrankungen über erhöhte Ängstlichkeit (24%), am wenigsten Patienten aus der kardiologischen Rehabilitation (12%, Cut-off > 10). Patienten mit Tumorerkrankungen liegen mit 20% zwischen diesen beiden Werten. Hingegen berichten onkologische Patienten am häufigsten depressive Syndrome (17%), auch hier sind die Herz-Kreislauf-Patienten am wenigsten belastet (10%). Im Screening für Probleme mit Alkohol sind die Unterschiede zwischen den Gruppen geringer, hier erreichen die kardiologischen Rehabilitationspatienten den höchsten Wert (18%). 70 Wir konnten zeigen, dass die eingesetzten Screeninginstrumente, speziell die HADS, zufriedenstellende bis gute Sensitivitäts- und Spezifitätskoeffizienten aufweisen, um in effizienter Weise Risikopatienten mit komorbiden psychischen Störungen zu entdecken (Fragestellung f). Für die untersuchten Diagnosegruppen der Patienten mit muskulo-skelettalen und Tumorerkrankungen liegen die Cut-off-Scores der HADS-Gesamtskala zwischen 15-17, die die ausgewogenste Balance zwischen Sensitivität und Spezifität erbringen (vgl. Kapitel 2.2). Ist es hingegen aus diagnostischen Überlegungen wünschenswert, möglichst viele komorbide Risikopatienten zu entdecken und differenzialdiagnostisch vertiefend zu untersuchen, empfiehlt es sich, den Cut-off abzusenken. Wird der HADS-Summenscore z.B. auf einen Wertebereich von 6-8 abgesenkt, steigt die Sensitivität auf 86-92% (die Spezifität sinkt hingegen auf 21-32%). Die gewichteten Prävalenzraten psychischer Störungen insgesamt unterscheiden sich in allen drei Beobachtungsperioden (aktuelle 4-Wochen-, 12-Monats- und Lebenszeit-Prävalenz), v.a. zwischen den Stichproben der muskulo-skelettalen und Herz-Kreislauf-Patienten (Fragestellung c). Erstere haben in allen Perioden höhere Raten, v.a. die Unterschiede in der 4-Wochen- und Einjahres-Prävalenz sind beträchtlich (Tab. 10). Die Patienten mit Tumorerkrankungen sind hinsichtlich des Settings (nicht nur Rehabilitation) und der anders gewählten Samplingprozedur nur mit gewissen Einschränkungen für einen Vergleich mit den anderen beiden Indikationen nutzbar. Es zeigt sich jedoch, dass die Prävalenzraten in den drei Perioden bei dieser Patientengruppe recht ähnlich den Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind. Auch bezogen auf aktuell bestehende spezifische psychische Störungen (4-WochenPrävalenz), die quantitativ von Bedeutung sind (affektive, Angst-, Sucht- und somatoforme Störungen), sind die Patienten mit muskulo-skelettalen Erkrankungen durchweg am stärksten belastet (Tab. 11). Hinsichtlich der Prävalenzraten affektiver und Angststörungen berichten die Patienten aus der orthopädischen Rehabilitation und der onkologischen Versorgung ähnlich hohe Belastungen. Die Rate von Angststörungen ist in der Gruppe der Herz-Kreislauf-Patienten hingegen deutlich niedriger. Auffällig ist auch, dass die orthopädischen Patienten stärker mit Suchtund somatoformen Erkrankungen belastet sind. 71 Tabelle 10: Prävalenzraten psychischer Störungen insgesamt (CIDI-Interviews, Chi2-Test zum Vergleich der orthopädischen und kardiologischen Patienten) Gewichtete Präva- Orthopädie Kardiologie Signifikanz (Onkologie) N=204 N=156 (2-seitig) (N=200) Lebenszeit 64,6 55,2 .03 (56,0) 12 Monate 47,1 34,1 .01 (40,0) 4 Wochen 31,1 19,5 .01 (23,5) lenzen (in %) Diese Ergebnisse müssen allerdings - insbesondere in Bezug auf den jetzt gezogenen Vergleich zwischen den drei Indikationsgruppen - mit gewissen methodischen Einschränkungen interpretiert werden (Fragestellung e): Erstens können die Unterschiede in den Prävalenzraten auch durch andere Faktoren als die „Haupterkrankung“, die zur Gruppeneinteilung diente, bedingt sein. Z.B. sind die Unterschiede in der Verteilung von Männern und Frauen in den drei Stichproben beträchtlich (vgl. Tab. 7). Da aus vielen epidemiologischen Studien bekannt ist, dass Frauen häufiger über psychische Störungen (v.a. Angst- und affektive Störungen) berichten als Männer (z.B. Kessler et al., 1994, Wittchen, 2000b), trägt der Unterschied in der Verteilung von Männern und Frauen in den drei Gruppen auch zu den unterschiedlichen Prävalenzraten bei. Wir konnten in unseren eigenen Analysen Prävalenzunterschiede zwischen Frauen und Männern in der Gruppe der Patienten mit muskulo-skelettalen und Tumorerkrankungen zeigen (Härter et al., in press). Darüber hinaus kann die Variabilität der Prävalenzraten psychischer Störungen mit der unterschiedlichen Altersverteilung in den drei Stichproben assoziiert sein. Es ist ebenfalls aus epidemiologischen Studien bekannt, dass Prävalenzraten in unterschiedlichen Altersgruppen differieren (Kessler et al., 1994; Wittchen et al., 1999b). Eigene Analysen zeigen bei den beiden Stichproben von Patienten aus der orthopädischen und kardiologischen Rehabilitation eine Assoziation von Lebensalter mit der Prävalenz psychischer Störungen (Abb. 4, unveröffentlichte Ergebnisse). 72 Tabelle 11: 4-Wochen-Prävalenzen spezifischer psychischer Störungen (CIDI-Interviews) Gewichtete Prävalenzen Orthopädie Kardiologie Onkologie N = 205 N = 164 N = 200 Affektive Störungen 10,7 8,5 9,5 Angststörungen 15,0 8,6 13,0 Suchterkrankungen 10,2 5,5 4,0 Somatoforme Störungen 8,3 1,8 2,5 (in %´) Jüngere Patienten (< 50 Jahre) weisen in beiden Stichproben deutlich höhere Prävalenzraten für aktuelle psychische Störungen (4-Wochen-Periode) auf als Patienten, die 50 Jahre und älter sind. Besonders niedrig ist die Prävalenzrate psychischer Störungen bei älteren Patienten (60 Jahre und älter), die einen großen Anteil kardiologischer Rehabilitationspatienten ausmachen. Zusammengefasst bedeutet dies, dass die Prävalenzraten psychischer Störungen in der Gruppe der Herz-Kreislauf-Patienten v.a. auch deswegen niedriger sein können, da diese Patientengruppe im Durchschnitt deutlich älter als die beiden anderen Stichproben und zum überwiegenden Teil männlich ist (vgl. Tab. 7, S. 55). Die Vergleiche der von uns ermittelten 12-Monats-Prävalenzen mit den Untersuchungsergebnissen des Bundesgesundheitssurvey ´98 (Wittchen, 2000b) zeigen, dass v.a. die Rehabilitationspatienten mit muskulo-skelettalen Erkrankungen in drei häufigen Störungsbereichen (affektive Störungen, Angst- und Suchterkrankungen) höhere Prävalenzraten als Personen der Allgemeinbevölkerung aufweisen (Fragestellung d). Dieser Vergleich wird durch die sehr ähnliche Verteilung von Männern und Frauen in unserer orthopädischen Stichprobe (47% zu 53% vs. BGS ´98: 45,8% zu 54,2%) gestärkt. Im Bereich der somatoformen Störungen sind die Prävalenzraten 73 gleich hoch. Auch die Komorbiditätsrate ist ähnlich hoch (Fragestellung b), 44% aller orthopädischen Rehabilitationspatienten mit einer psychischen Störungen weisen eine oder mehrere psychische Störungen auf (Tab. 12). Abbildung 4: Prävalenzraten aktueller psychischer Störungen insgesamt, nach Altersgruppen in % (CIDI, 4-Wochen-Prävalenzen, in %) 70 60 50 40 30 20 10 0 43 36 37 24 25 28 13 bis 39 40-49 Orthopädie (N=203) 50-59 >59 Kardiologie (N=156) Die beiden anderen Stichproben von Patienten mit Tumor- und Herz-KreislaufErkrankungen sind aufgrund der unterschiedlichen Verteilung von Männern und Frauen (s. o.) weniger gut mit den BGS-Daten in Beziehung zu setzen. Zur Klärung der Frage unterschiedlich hoher Prävalenzraten bei kardiologischen und onkologischen Patienten wird es notwendig sein, eine entsprechend parallelisierte Stichprobe aus den BGS-Daten zu ziehen und mit unseren Daten zu vergleichen. Dieser Vergleich wird im Rahmen einer geplanten gemeinsamen Auswertung von BGS-Daten und unseren Daten möglich sein. Die vertiefte Analyse der Frage nach behandlungsbedürftigen Störungen zeigt einerseits, dass viele Angsterkrankungen (v.a. die leichten spezifischen Phobien) von den Patienten als wenig beeinträchtigend erlebt werden (Fragestellung a), sodass sich die Prävalenzraten der Angsterkrankungen um ca. 40% reduzieren. Allerdings muss bei der Benutzung dieser relativ „strengen“ Kriterien andererseits bedacht werden, dass es viele Patienten gibt, die unterschwellige Störungen (z.B. minore Depressionen) aufweisen (Härter et al., 2001b). Diese können die Patienten 74 aufgrund der Symptomatik so stark beeinträchtigen, dass sie behandlungsbedürftig sind (z.B. bei ausgeprägten Schlafstörungen, starker Ermüdbarkeit). Tabelle 12: 12-Monats-Prävalenzen der häufigsten psychischen Störungen aus drei Indikationsbereichen im Vergleich zum Bundesgesundheitssurvey ´98 Gewichtete 12-MonatsPrävalenzen (in %) Orthopädie Kardiologie Onkologie BGS ´98 N=204 N=156 N=200 N=4181 Affektive Störungen 19,4 14,6 17,5 11,5 Angststörungen 25,2 16,0 20,5 14,5 Suchterkrankungen 16,1 11,6 5,0 6,8 Somatoforme Störungen 10,2 4,3 7,5 11,0 Komorbidität 44,3 34,8 30,0 48,0 Analysen zur Erkennens- und Behandlungsrate psychischer Störungen in der Teilstichprobe der orthopädischen Rehabilitationspatienten anhand der medizinischen Datenblätter und Entlassberichte zeigen (Reuter et al., under review), dass nur ca. 50% der durch das CIDI diagnostizierten psychischen Störungen von den behandelnden Ärzten erkannt werden (Fragestellung g). Diese Raten entdeckter Störungen entsprechen ziemlich genau den Entdeckungsraten, wie sie aus der hausärztlichen Versorgung bekannt sind (vgl. Üstün & Sartorius, 1995; vgl. Kapitel 3.3). Noch ungünstiger ist die psychodiagnostische Genauigkeit der Ärzte in den Entlassberichten, da nur 25% der Diagnosen psychischer Störungen korrekt benannt sind. In den Entlassdiagnosen wird ein hoher Anteil unspezifischer Diagnosen (z.B. „psychophysisches Erschöpfungssyndrom“) genannt, außerdem erfolgt keine Diagnostik komorbider psychischer Störungen, die bei vielen Patienten mit einer psychischen Störung vorliegen (Tab. 12). Der Anteil von durchgeführten psychosozialen bzw. psychotherapeutischen Maßnahmen bei erkannten psychischen Störungen ist ebenfalls relativ gering. Nur 50% der Patienten, bei denen von den Ärzten die Diagnose 75 einer psychischen Störung gestellt wurde, erhielt in der Rehabilitationsklinik eine psychosoziale Behandlungsmaßnahme. Sie entspricht damit ähnlichen Behandlungsquoten, wie sie auch aus dem Bundesgesundheitssurvey 1998 und den daraus abgeleiteten Konsequenzen für eine bedarfsgerechte Versorgung psychischer Störungen bekannt sind (Wittchen, 2000c). 76 6 Konsequenzen für die Forschung Die vorgestellten Ergebnisse stammen aus den ersten epidemiologischen Untersuchungen in Deutschland, die an hinreichend großen Stichproben chronisch körperlich kranker Patienten die Prävalenz komorbider psychischer Störungen mit dem standardisierten CIDI analog zu bevölkerungsepidemiologischen Studien erfasst haben. Das Interviewverfahren erlaubte die reliable Erfassung psychischer Störungen nach DSM-IV und hat sich - trotz der hohen Standardisierung und geringen Flexibilität in der Befragungssituation für Patienten und Interviewer – als praktikabel für die Untersuchung von Patienten mit chronischen körperlichen Erkrankungen erwiesen. Die Patienten zeigten eine hohe Bereitschaft zur Teilnahme am Interview, nur sehr selten mussten begonnene Interviews (ca. 3%) abgebrochen werden. Darüber hinaus hatten die Patienten und die beteiligten Klinken ein hohes Interesse an der Fragestellung. Durch dieses diagnostische Vorgehen war eine gleichzeitige Erfassung der Häufigkeit psychischer Störungen in verschiedenen, explizit definierten und klinisch relevanten Prävalenzzeiträumen (4 Wochen, 6 Monate, Lebenszeit) möglich. Nachteile früherer Untersuchungen mit weniger präzise definierten Prävalenzzeiträumen wurden dadurch vermieden. Dennoch zeigten sich auch Schwächen hinsichtlich des gewählten Vorgehens: 1) Die Diagnose von Anpassungsstörungen mit ängstlichen und depressiven Anteilen, die in früheren, insbesondere psychoonkologischen Untersuchungen und klinischen Erfahrungsberichten als zentrale Problembereiche bei chronischen körperlichen Erkrankungen benannt wurden, ist durch das CIDI nicht möglich gewesen. Weiterführende Untersuchungen mit Hilfe stärker klinisch orientierter Verfahren (z.B. SKID) oder auch klinische Interviews sollten diese Lücke schließen. Ein weitere Möglichkeit wäre die Adaption bzw. Erweiterung des CIDI-Verfahrens, um diese diagnostische Kategorie zu erfassen. 2) Die Diagnose von unterschwelligen depressiven Syndromen (z.B. minore Depressionen) in unseren Untersuchungen, anhand der quantitativen Auswertung einzelner Symptome, könnte ein Hinweis auf die Bedeutung der genannten Anpassungsstörungen sein. Diese häufigen Syndrome unterstreichen zusätzlich die genauere Differenzialdiagnostik milderer affektiver Störungen. Zusätzlich wäre ein CIDI-Modul sinnvoll, was als programmierter Algorithmus die Diagnose affektiver Störungen nach symptomreduzierenden oder – modifizierenden Kriterienlisten ermöglicht (inclusive vs. exclusive approach). 77 3) Auch die Diagnose affektiver oder Angststörungen aufgrund eines medizinischen Krankheitsfaktors ist durch die CIDI-Technologie noch nicht valide genug möglich. Voraussetzung für diese Diagnose ist alleine die Auskunft des Patienten, ob die psychischen Syndrome in Bezug zu einer somatischen Erkrankung (Diagnose eines Arztes) stehen. Da die pathophysiologischen Wechselwirkungen von somatischen und psychischen Störungen äußerst komplex sind, führt dieses Vorgehen ohne Abgleich dieser Information durch einen erfahrenen Kliniker zu einer Überschätzung dieser Krankheitskategorie. 4) Besonders schwierig sind die somatoformen Störungen mit dem CIDI zu erfassen, hier zeigen sich auch in den internationalen Studien Validitätsprobleme. Da davon auszugehen ist, dass insbesondere Patienten mit muskulo-skelettalen Erkrankungen erhöhte Prävalenzraten somatoformer Schmerzsyndrome aufweisen, erscheint hier eine Validierung der von uns ermittelten Raten mittels speziellerer Verfahren (SKID) oder die Differenzialdiagnostik durch erfahrene Kliniker notwendig. 5) Inwieweit die Häufigkeit und Schwere alkoholbezogener Erkrankungen valide durch das CIDI erfasst werden kann, ist nicht abschließend zu beurteilen. Zu vermuten ist aber, dass Patienten in der speziellen Untersuchungssituation (Interview durch externe Personen) und weil sie eine Rehabilitationsmaßnahme in Anspruch nehmen (Angst vor Sanktionen), alkoholbezogene Probleme möglicherweise eher verneinen oder minimieren. Diese „Abwehrmechanismen“ spielen im übrigen auch bei den Studien eine Rolle, die das CIDI und vergleichbare Verfahren in der Allgemeinbevölkerung eingesetzt haben. Wahrscheinlich lässt sich dieser Störungsbereich nur dann epidemiologisch valide erfassen, wenn zusätzliche Parameter (Laborparameter, Erfassung körperlicher Folgeerkrankungen) erhoben werden können. Screeningverfahren zur Entdeckung wahrscheinlich psychisch erkrankter Patienten sind eine sinnvolle Strategie, um effizient Hinweise auf besonders gefährdete Personen zu erhalten. Die Auswahl sollte sich anhand relevanter Kriterien, z.B. Akzeptanz und Eignung für die Zielgruppe, krankheitsübergreifende vs. -spezifische Verfahren, Vorliegen von Normen für Indikationsgruppen und Test-Gütekriterien, orientieren. Die Screeningprozedur durch die für unsere Studien ausgewählten Verfahren erwies sich als sehr gut umsetzbar. 99% der GHQ-12-Screener und 98% der HADS-Fragebogen wurden vollständig ausgefüllt und konnten ausgewertet werden. Nach Abschluss der Datenerhebung wurden die eingesetzten Screeningverfahren bezüglich ihrer je- 78 weiligen Sensitivitäts- und Spezifitätskoeffizienten in Bezug auf die korrekte Identifizierung psychischer Störungen (CIDI-Diagnosen) miteinander verglichen und die HADS im Vergleich zum GHQ-12 als das günstigere Verfahren ermittelt. Aufgrund der gefundenen zufriedenstellenden bis gut zu bewertenden Gütekriterien sollten für zukünftige Auswertungen und Studien folgende Aspekte weitere Beachtung finden: a) Die Sensitivitäts- und Spezifitätsparameter sind möglicherweise in unseren Untersuchungen deswegen niedriger als in bereits publizierten Arbeiten (vgl. Reuter & Härter, 2001), da das Diagnoseverfahren CIDI (der „Goldstandard“) auf dem kategorialen, nicht dem dimensionalen Ansatz zur Diagnose psychischer Störungen (wie die Screener) beruht. In neuen eigenen Studien soll daher an Patienten mit chronischen körperlichen Erkrankungen untersucht werden, ob kategorial orientierte Screeningverfahren (z.B. PHQ, Spitzer et al., 1999) eine (noch) bessere Screeningperformanz aufweisen als die bereits getesteten Verfahren (BMBF-Folgeantrag, Härter & Bengel, 2001). Danach wird entschieden werden können, welches Screeningverfahren am ehesten für Patienten mit körperlichen Erkrankungen empfohlen werden kann, oder ob eine Kombination dieser Verfahren die besten Ergebnisse liefert. b) Aufgrund der Häufigkeit psychischer Beeinträchtigungen bei Patienten, die nicht die Kriterien für psychische Störungen erreichen (z.B. minore depressive Störungen), kann es sinnvoll sein, diese für die Analyse der Screeningperformanz zur Entdeckung depressiver Syndrome einzubeziehen, d.h. die Störungsschwelle abzusenken. Damit wird die Prävalenz psychischer Störungen erhöht und die klinisch relevanten Parameter der positiven und negativen prädiktiven Validität aufgrund höherer Power statistisch valider abschätzbar (vgl. Kapitel 2). c) Die vergleichende Analyse der Sensitivitäts- und Spezifitätskoeffizienten sowie der positiven und negativen prädiktiven Werte in Abhängigkeit von der Art der somatischen Grunderkrankung sollte weitergeführt werden. Hierzu werden wir einerseits eine spezifische Auswertung der Screeningperformanz in der Stichprobe der Herz-KreislaufPatienten (erweitert um Patienten aus der ambulanten kardiologischen Rehabilitation) durchführen (Rundel, 2001). Diese Prüfung wird auch Aussagen darüber erlauben, ob in verschiedenen Indikationsbereichen u.U. unterschiedliche Messverfahren zu empfehlen sind. 79 Die ermittelten Prävalenzraten sind aufgrund von untersuchungsbedingten Faktoren (v.a. unterschiedliche Geschlechts- und Altersverteilung in den drei Stichproben) zwischen den Indikationsgruppen (noch) nicht valide genug vergleichbar. Daher ist geplant, analog einer retrospektiven Fall-Kontroll-Studie (in Absprache mit dem Projektleiter des Zusatzmoduls psychische Störungen des Bundesgesundheitssurvey ´98, H.-U. Wittchen) parallelisierte Stichproben der Allgemeinbevölkerung für die drei untersuchten Indikationsgruppen zu ziehen, die mit den chronisch kranken Patienten hinsichtlich der Art, Häufigkeit und Schwere psychischer Störungen verglichen werden können. Dadurch wird die These einer stärkeren psychischen Belastung bei den chronisch somatisch erkrankten Patienten weiter abgesichert werden können. Darüber hinaus sollen in weiterführenden Analysen der vorliegenden Datensätze u.a. folgende Fragen untersucht werden: a) Lassen sich Risikofaktoren psychischer Störungen empirisch absichern, die in den eigenen theoretischen Arbeiten (Aschenbrenner et al., im Druck; Weißer et al., im Druck) identifiziert werden konnten? b) Unterscheiden sich Patienten aus einer Indikationsgruppe hinsichtlich psychischer Beeinträchtigungen und Störungen aufgrund unterschiedlicher spezifischer somatischer Hauptdiagnosen (z.B. Patienten mit unspezifischen Rückenschmerzen vs. Patienten mit Arthrosen, Patienten in der Post-Myokardinfarkt-Phase vs. Patienten mit koronarer Herzerkrankung ohne Myokardinfarkt)? c) Wie ist der Verlauf der somatischen und komorbiden psychischen Störungen (Beginn der jeweiligen Störung) zu beschreiben? Zwei weiterführende Studien werden zur Zeit begonnen: Eine weitere epidemiologische Untersuchung wird es uns ermöglichen, Patienten mit Atemwegserkrankungen und hormonellen Störungen (Diabetes mellitus) hinsichtlich der psychischen Komorbidität zu untersuchen. Dieses Projekt ist ein Anschlussprojekt, das in der zweiten Förderphase (2001-2004) des Rehabilitationswissenschaftlichen Forschungsverbundes Freiburg / Bad Säckingen gefördert wird (Härter & Bengel, 2001). Parallel zu den empirischen Arbeiten zur Epidemiologie psychischer Störungen bei diesen beiden Indikationen werden Ziele, Inhalte und Didaktik eines Fortbildungsprogrammes zur somato-psychischen Komorbidität in der medizinischen Rehabilitation entwickelt. Die Evaluation dieses regional wie überregional orientierten Fortbildungsprogramm zur Diagnostik 80 und Behandlung komorbider somatischer und psychischer Erkrankungen soll die Prozess- und Ergebnisqualität in der Rehabilitation sowie die Kompetenz der in der Rehabilitation tätigen Berufsgruppen erhöhen. Ein zweites Vorhaben, das ab Januar 2002 ebenfalls im Rehabilitationswissenschaftlichen Forschungsverbund Freiburg / Bad Säckingen gefördert wird, untersucht die Effektivität und Effizienz einer leitlinienorientierten Diagnostik und Behandlung psychischer Störungen bei Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen, die stationär in einer Rehabilitationseinrichtung behandelt werden (Barth, Härter & Bengel, 2001). Diese Studie stellt eine Konsequenz aus unseren epidemiologischen Studien und den Studien zur Bedeutung der psychischen Komorbidität bei Herz-Kreislauf-Patienten dar und soll zudem die Voraussetzungen für eine Langzeitstudie zur prognostischen Bedeutung psychischer Komorbidität bei Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen schaffen. Die eigenen Ergebnisse aus den vorgestellten epidemiologischen Untersuchungen und die jetzt begonnene Anschlussstudie zur Prävalenz psychischer Störungen bei weiteren chronischen Erkrankungen (Härter & Bengel, 2001) basieren auf einem deskriptiv-epidemiologischen Ansatz und einer Querschnittuntersuchung. Mit diesem Studiendesign können erstens wichtige Anhaltszahlen für die Planung von Gesundheitsdienstleistungen gewonnen werden und zweitens Analysen des relativen Risikos für psychische Störungen aufgrund assoziierter Risikofaktoren (Alter, Geschlecht, Setting, somatische Grunderkrankung etc.) berechnet werden. Eines der Hauptziele von Untersuchungen zur Komorbidität ist es, die überzufällige Assoziation zwischen verschiedenen Störungen und ihre Kausalität aufzuklären. Die Dokumentation der Assoziation zwischen körperlichen und psychischen Störungen ist hier nur der erste Schritt im Erklärungsprozess. Die beiden wichtigsten Theorien zur Erklärung von Zusammenhängen zwischen verschiedenen Störungsbildern sind einerseits Ansätze, die davon ausgehen, dass eine (somatische) Indexerkrankung der Manifestation einer komorbiden (psychischen) Störung vorausgeht oder sie verursacht (causal model). Demgegenüber stehen Modelle, die Risikofaktoren annehmen, die für beide Erkrankungen auslösend bzw. mit verursachend sind und die somatischen bzw. psychischen Störungen bedingen (shared underlying etiology model, Merikangas & Stevens, 1997). Um zwischen diesen alternativen Modellen unterscheiden zu können, eignen sich sowohl familiengenetische als auch longitudinale Studiendesigns: In familienepidemiologischen Studien lässt sich die Evidenz für gemeinsame pathophysiologische Mechanismen z.B. durch eine Erhöhung der Prävalenzraten für die komorbide psychische Störung bei Verwandten 81 der Patienten mit der somatischen Indexerkrankung im Vergleich zu Kontrollpersonen stützen. In ähnlicher Richtung stärken in Zwillingsuntersuchungen erhöhte Raten für komorbide Störungen bei Zwillingen die Annahme, dass gemeinsame pathophysiologische Mechanismen zugrunde liegen. Wenn die komorbide psychische Störung hingegen unter den Verwandten der Patienten mit der (somatischen) Indexerkrankung häufiger auftritt, allerdings nur in Verbindung mit der Indexerkrankung, sind kausale Modelle für die Erklärung der Assoziation eher wahrscheinlich. Für die Durchführung dieser Untersuchungen müssen sowohl gesunde Kontrollpersonen (ohne die Indexerkrankung) als auch Verwandte ersten Grades einbezogen werden, die mit standardisierten Interviewverfahren befragt werden (Merikangas & Stevens, 1997; Stevens et al., 1995). Längsschnittuntersuchungen können dazu dienen, die Bedeutung komorbider Störungen für den Verlauf und die Gesundung bzw. Chronifizierung von Patienten mit einer spezifischen Erkrankung weiter aufzuklären. Darüber hinaus ist die Erforschung der Assoziation psychischer und somatischer Erkrankungen wichtig, um verschiedene Subtypen einer somatischen Indexerkrankung zu bestimmen. So kann das Vorliegen einer komorbiden depressiven Störung ggf. zu einer valideren Unterscheidung einer bestimmten Form der Indexerkrankung beitragen. Dieser epidemiologische Forschungsbereich wird in Zukunft für die Erforschung der Assoziation von somatischen und psychischen Erkrankungen verstärkte Beachtung verdienen. Darüber hinaus scheinen neurobiologische und psychophysiologische Ansätze zukunftsweisend, die die pathophysiologischen Zusammenhänge psychischer und somatischer Erkrankungen aufdecken wollen. Richtungsweisend sind hier z.B. Arbeiten zum Einfluss depressiver Syndrome und ihrer biologischen Veränderungen auf somatische Parameter bei kardiologischen Erkrankungen. 82 7 Transfer und klinische Implikationen Die Studien unserer Arbeitsgruppe konnten zeigen, dass ein substanzieller Anteil chronisch körperlich kranker Patienten in der stationären medizinischen Rehabilitation aber auch in anderen Versorgungsbereichen, unter behandlungsbedürftigen psychischen Störungen leidet. Am häufigsten sind verschiedene Angststörungen und affektive Störungen, aber auch somatoforme Störungen und Suchterkrankungen sind von klinischer Relevanz. Die Prävalenzraten komorbider psychischer Störungen sind höher als in Studien aus der Allgemeinbevölkerung, insbesondere bei der Indikationsgruppe von Patienten mit muskulo-skelettalen Erkrankungen und werden von den Behandlern bislang unzureichend erfasst. Klinisch bedeutsam ist auch der hohe Anteil von Personen, die komorbide psychische Störungen aufweisen. Hier sind die Entdeckungs- und Behandlungsraten noch ungünstiger. Darüber hinaus haben Frauen und jüngere Patienten ein höheres Risiko für komorbide Störungen. Schließlich sind die assoziierten Konsequenzen einer oder mehrerer psychischer Störungen auf die Lebensqualität, aber auch die Inanspruchnahme weiterer stationärer Maßnahmen im Vorfeld einer rehabilitativen Maßnahme von erheblicher Bedeutung für die Patienten und das Versorgungssystem. Diese sowohl aus den durchgeführten Studien ermittelten Ergebnisse als auch die unzureichende Entdeckung und Behandlung psychischer Störungen begründen u.E. eine Verbesserung der Diagnostik und eine Anpassung der Behandlungsmaßnahmen. Eine Verbesserung der Diagnose und Behandlung, v.a. der differenzialdiagnostischen Prozesse im Hinblick auf die unterschiedlichen psychischen Störungen, beinhaltet die folgenden Teilschritte: 1) Patienten mit psychischen Störungen sollten in Einrichtungen, die chronisch kranke Patienten behandeln, frühzeitig erkannt und diagnostiziert werden. Effiziente Screeningverfahren (z.B. die HADS) können zu Beginn einer Behandlungsmaßnahme (Tage 1-3) – ähnlich einem Labortest - eingesetzt werden, um Patienten mit einer psychischen Störungen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu entdecken. 2) Die Schwellenwerte der Screeningverfahren sollten so gewählt werden, dass möglichst viele komorbid erkrankte Patienten entdeckt werden. Dies bedeutet, die Sensitivität dieser Verfahren durch Absenken des optimalen Cut-offs zu erhöhen, auch wenn dadurch 83 die Wahrscheinlichkeit steigt, Patienten „fälschlicherweise“ zu entdecken, die keine psychische Störung aufweisen (verminderte Spezifität). 3) Positiv gescreente Patienten sollten von psychologischen Mitarbeitern oder den behandelnden Ärzten, die speziell geschult wurden, im Hinblick auf die Diagnose und Differenzialdiagnostik psychischer Störungen vertiefend untersucht werden. Voraussetzung für diese diagnostischen Entscheidungen ist die Kenntnis der wichtigsten psychischen Störungsbereiche und v.a. das Wissen und die Erfahrung, anhand welcher Kriterien spezifische psychische Störungen diagnostiziert werden. Hilfreich können hier Verfahren sein, die nach Durchführung spezieller Schulungen auch von den behandelnden Ärzten angewandt werden können (z.B. das PRIME-MD-System, Spitzer et al., 1999; oder die ICD-10-Checklisten, Hiller, Zaudig & Mombour, 1995). Meist wird es hingegen sinnvoll sein, die Differenzialdiagnostik im multiprofessionellen Team durch psychologische Mitarbeiter sicherzustellen, die aufgrund ihrer psychodiagnostischen Ausbildung oder spezifischer Weiterbildungen diese diagnostischen Fertigkeiten aufweisen. 4) Werden komorbide psychische Störungen diagnostiziert, ist es notwendig, je nach Störung zu entscheiden, ob eine und welche Indikation für eine Behandlung der spezifischen psychischen Störung besteht. Akut behandlungsbedürftige psychische Störungen umfassen z.B. das Spektrum der unipolaren oder rezidivierenden depressiven Störungen oder der eher seltenen psychotischen Störungen, bei denen sich v.a. auch die Frage der notwendigen psychopharmakologischen Intervention und der konsiliarpsychiatrischen Mitbehandlung stellt. Bei vielen psychischen Störungsbildern (z.B. Angsterkrankungen, anhaltenden depressiven Verstimmungen) wird sich mehr die Frage stellen, ob die Behandlung in der Klinik (bei Patienten in der Akutbehandlung bzw. in der medizinischen Rehabilitation) begonnen wird oder ob eher die Motivation für eine weiterführende poststationäre psychotherapeutische Behandlung gezielt gefördert wird. 5) Werden manifeste komorbide psychische Störungen bei chronisch körperlich kranken Patienten diagnostiziert, bedeutet dies nicht, dass Patienten auch bereit sind, eine psychotherapeutische oder psychopharmakologische Behandlung in Anspruch zu nehmen. Daher sollten neben der spezifischen Differenzialdiagnostik ebenfalls die Behandlungsmotivation und Inanspruchnahmebereitschaft der Patienten erfasst werden. Hier können standardisierte Befragungsinstrumente eingesetzt werden, die diese Motivation und die 84 Veränderungsbereitschaft von Patienten erfassen (z.B. Hafen, Bengel, Jastrebow & Nübling, 2001; Maurischat, Auclair, Bengel & Härter, im Druck). 6) Da viele psychische Störungen (z.B. Dysthymie, Panikstörungen) eine psychotherapeutische Behandlungsfrequenz benötigen, die nicht im Rahmen eines stationären Aufenthaltes in einer Akut- oder einer Rehabilitationsklinik erbracht werden können, scheinen eher psychoedukative Ansätze und Gruppenangebote zur Gesundheitsinformation sowie Patientenratgeber zur Vermittlung eines adäquaten Störungs- und Behandlungswissens für die stationär behandelten Patienten sinnvoll. Für die meisten psychischen Störungen liegen hierzu hervorragend ausgearbeitete verhaltenstherapeutisch orientierte Konzepte und Materialien vor, die auch in Patientengruppen angewandt werden können (vgl. Angenendt & Stieglitz, 1999). 7) Bei Patienten mit behandlungsbedürftigen psychischen Störungen, bei denen eine Gefährdung der akut- oder rehabiltiationsmedizinischen Behandlung (z.B. Compliance, schwerwiegende psychosoziale Probleme, Prognose) besteht, sind psychotherapeutische Einzelbehandlungen notwendig und sinnvoll. Dieser einzeltherapeutische Ansatz umfasst auch Angebote an Patienten, die selbst eine psychosoziale bzw. psychotherapeutische Maßnahme in Anspruch nehmen wollen. 8) Die in der klinischen Institution diagnostizierten komorbiden psychischen Störungen sollten – spezifiziert neben den somatischen Diagnosen – im Entlassbericht genannt werden. Ebenso sollten in der Klinik eingeleitete Maßnahmen zur Motivationsförderung oder Patientenedukation etc. im Bericht genannt werden. Die Sicherstellung dieser Informationsweitergabe diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen und Ergebnisse durch einen verbesserten Entlassbericht kann die anschließende Weiterbehandlung in der ambulanten Versorgung optimieren, insbesondere dann, wenn komplementäre psychotherapeutische Maßnahmen indiziert sind und z. B. in gemeinsamer Initiative von behandelndem Hausarzt und Patient initiiert werden sollen. Für die sozialmedizinische Beurteilung der Patienten (Multimorbidität, Behinderung etc.) und die ambulante Weiterbehandlung werden darüber hinaus entscheidende Informationen gewonnen, die mittel- bis langfristig eine Verbesserung der Rehabilitationsergebnisse bei multimorbid erkrankten Patienten erwarten lassen. 85 Die Umsetzung der skizzierten Teilschritte ist zunächst v.a. in Institutionen möglich, die über ein multiprofessionelles Behandlungsteam verfügen. Daher haben die vorgeschlagenen Optimierungsmöglichkeiten ihren Platz insbesondere in klinischen Einrichtungen der stationären, aber auch ambulanten Rehabilitation, wo viele der chronisch kranken Patienten behandelt werden. Die Umsetzung der Vorschläge beinhaltet eine stärkere Verpflichtung der primär somatisch orientierten Einrichtungen auf den umfassenden Ansatz der Rehabilitation, der den somatischen, psychischen und sozialen Bedingungsfaktoren gleichberechtigt Rechnung tragen will. Dies bedeutet im Rahmen der Rehabilitation a) eine differenzierte Diagnostik der individuellen Problemlagen im medizinischen, funktionalen und psychosozialen Bereich, soweit dies nicht im Vorfeld der Rehabilitation bereits geschehen ist (Æ Komorbiditätsdiagnostik); b) eine ausführliche und verständliche Information, die ein krankheitsgerechtes Verhalten ermöglicht (Æ Patientenedukation); und c) Hilfen zur Krankheitsbewältigung und zur Stärkung von Behandlungsmotivation sowie Selbstverantwortung etc. anzubieten (Æ Behandlungs- und Inanspruchnahmemotivation), wie sie als spezifische Aufgaben in Theoriemodellen für die Rehabilitation postuliert werden (Gerdes & Weis, 2000). In der bisherigen Rehabilitationspraxis zeigt sich jedoch häufig eine geringere Differenziertheit der diagnostischen und therapeutischen Prozesse, da die Rehabilitationsinstitutionen und die in ihnen tätigen Behandler trotz der komplexen individuellen Problemlagen im somatischen, psychischen und sozialen Bereich „handlungsfähig“ bleiben müssen. Als problematisch könnte sich in diesem Zusammenhang auch die Zuweisung von Patienten in die medizinischen Rehabilitationskliniken erweisen. Dort werden primär Patientengruppen für die Behandlung (mit Standardprogrammen) gebildet, die zunächst in einem Merkmal (z.B. Rückenschmerzen, Tumorerkrankungen) übereinstimmen. Übersehen wird bei dieser Strategie allerdings leicht, dass die Unterschiede zwischen anderen Merkmalen innerhalb einer solchen Untergruppe (z.B. Rückenschmerzpatienten mit oder ohne somatoforme Schmerzstörung) viel größer sein können als die „vermeintliche“ Gemeinsamkeit auf dem bestimmenden Gruppenmerkmal. Können die vorgeschlagenen Optimierungsschritte nicht insgesamt in den Kliniken etabliert werden, wird sich stärker die Frage stellen, ob Patienten bereits vor der Inanspruchnahme einer medizinischen Rehabilitationsmaßnahme umfassend differenzialdiagnostisch untersucht werden müssen und ggf. in spezielle Einrichtungen überwiesen werden sollten, die einen stärker psychosomatisch orientierten Diagnose- und Therapieansatz haben. Diese Möglichkeit erscheint aber 86 wegen der völlig ungeklärten Frage, wer in der ambulanten Versorgung eine auch psychische Störungen umfassende Differenzialdiagnostik leisten kann, weniger umsetzbar. Vielmehr erscheint es uns sinnvoll und notwendig, das psychodiagnostische und psychosoziale Profil der bestehenden Einrichtungen zu schärfen, um den Patienten mit ihren psychosozialen Problemlagen und psychischen Störungen, die wir in unseren Untersuchungen ermittelten, zukünftig besser gerecht zu werden. Diese Umsetzung ist auch deswegen begründet, da Untersuchungen sowohl im Bereich der kardiologischen wie muskulo-skelettalen Erkrankungen die prominente Bedeutung psychosozialer Faktoren und psychischer Störungen für die Morbiditäts- und Mortalitätsraten bei diesen Erkrankungen aufgezeigt haben (Carney et al., 2001; Linton, 2000; Penninx et al., 2001; vgl. Kapitel 3). Ob behandlungsbedürftige Patienten tatsächlich psychosoziale Dienstleistungen in den Kliniken in Anspruch nehmen werden, ist noch nicht abschließend geklärt. Schätzungen von Experten zum Bedarf (z.B. Koch, Weis, Matthey & Mehnert, 1998), begründet u.a. durch Ergebnisse epidemiologischer Studien, und der Inanspruchnahme weisen eine große Schwankungsbreite auf. Die Inanspruchnahmebereitschaft und tatsächliche Nutzung hängen sowohl von Merkmalen des Patienten (Art und Schwere der Erkrankung, Einstellung zur Erkrankung und ihrer Behandlung), von Einflüssen des sozialen Umfelds (Familie, Freunde und Arbeitskollegen) als auch vom "Anregungsverhalten" der professionellen Helfer ab (Weis & Koch, 1998). Dabei kommt dem behandelnden medizinischen Personal, insbesondere den Ärzten, eine besondere Rolle zu. Fachspezialisten aus den Bereichen der Psychologie und Psychotherapie können die medizinischen Behandler durch Erarbeitung verbesserter diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen bei komorbiden psychischen Störungen unterstützen. Erst dann können psychotherapeutische und psychopharmakologische sowie gesundheitsfördernde Strategien bzw. kombinierte Methoden in Abhängigkeit der vorliegenden Störungen wirkungsvoll eingesetzt werden. Die Arbeitsgruppe hat sich auch den Wissenstransfer – die unmittelbare und zeitnahe Diskussion der Ergebnisse und der Möglichkeiten ihrer Umsetzung - in die Verbundregion zum Ziel gesetzt (siehe Bengel & Jäckel, 2000, Löschmann & Bengel, 2000, Härter, 2000b; Härter & Koch, 2000). Die Ergebnisse des Projektes und der einzelnen Teilstudien wurden und werden den Diplom-Psychologen und Ärzten der beteiligten Rehabilitationseinrichtungen sowie allen interessierten Fachkräften in der medizinischen Rehabilitation in Form von Fortbildungen präsentiert. Hinsichtlich der didaktischen Vorgehensweise wurden sowohl klinikinterne Fortbil- 87 dungsveranstaltungen (z.B. für eine beteiligte Rehabilitationsklinik, interdisziplinär) als auch klinikübergreifende Workshops (z.B. zielgruppenorientiert für Rehabilitationspsychologen) im Rahmen des Fortbildungsprogramms des Forschungsverbundes Freiburg / Bad Säckingen durchgeführt (Wissenstransfer und curriculare Entwicklungen, siehe Bengel & Jäckel, 2000). Im letzten Drittel der Projektlaufzeit wurden Überlegungen zu Zielen, Inhalten und zur Didaktik eines Fortbildungsprogrammes formuliert und im März 2001 ein Pilotseminar angeboten, dessen Programm und Ablauf sowie Bewertung nachfolgend in Kurzform wiedergegeben wird. Psychische Störungen in der medizinischen Rehabilitation Epidemiologie und Diagnostik Verbundinterne und klinikübergreifende Fortbildung Schwerpunkt Kardiologie, Orthopädie und Onkologie Zielsetzung Die Behandler sollen die Relevanz, die Häufigkeit und Art psychischer Störungen sowie die diagnostischen Möglichkeiten zur Entdeckung psychischer Störungen bei den verschiedenen Indikationen kennenlernen. Sie sollen Informationen zu Behandlungsbedürftigkeit und zu differenziellen Behandlungsmöglichkeiten vermittelt bekommen. Zielgruppe Diplom-Psychologen und Ärzte in den Rehabilitationseinrichtungen des Verbundes. Eingeladen wurden alle mit dem Rehabilitationswissenschaftlichen Forschungsverbund Freiburg / Bad Säckingen kooperierenden Einrichtungen der Verbundregion. Organisation Der Workshop wurde von den Mitarbeitern des Forschungsprojektes „Epidemiologie psychischer Störungen in der medizinischen Rehabilitation“ mit Unterstützung durch die Geschäftsstelle des Verbundes am 23. März 2001 an der Universität Freiburg zwischen 9 - 18 Uhr durchgeführt. Jeder Teilnehmer erhielt ein Handout mit Materialien zu allen Beiträgen der Veranstaltung. 88 Programm 09.00 - 09.45 Uhr Begrüßung, Vorstellung und Erwartungen der Teilnehmer 09.45 - 10.30 Uhr Theoretische Basis: Epidemiologie und psychische Komorbidität 10.30 - 11.00 Uhr Kaffeepause 11.00 - 12.15 Uhr Ergebnisse der Studie „Epidemiologie psychischer Störungen in der medizinischen Rehabilitation“ 12.15 - 13.30 Uhr Mittagspause 13.30 - 15.15 Uhr Diagnostik psychischer Komorbidität bei körperlichen Erkrankungen 15.15 - 15.45 Uhr Kaffeepause 15.45 - 18.00 Uhr Umsetzung in die Rehabilitationspraxis Theoretische Basis: Epidemiologie und psychische Komorbidität Zuerst wurde eine Definition des Begriffs der Komorbidität gegeben. Verschiedene Krankheitsmodelle zur Entstehung von Komorbidität, ein Modell für die Entwicklung psychischer Erkrankungen sowie ein somato-psychisches Krankheitsmodell wurden vorgestellt. Die Relevanz des Erkennens und Behandelns psychischer Störungen bei somatischen Erkrankungen wurde am Beispiel des Risikofaktors „Depression“ bei kardiovaskulären Erkrankungen unter Bezugnahme auf die dabei wirksamen bio-psycho-sozialen Mechanismen erläutert. Nach einem Überblick über Möglichkeiten der Diagnostik psychischer Störungen wurden grundlegende Begriffe epidemiologischer Forschung (z.B. Inzidenz, Prävalenz) dargestellt sowie Zahlen zur Häufigkeit psychischer Störungen in der Allgemeinbevölkerung bzw. in der Primärversorgung referiert. Abschließend folgte eine Erläuterung der Einflussfaktoren auf Untersuchungsergebnisse in epidemiologischen Studien. Ergebnisse der Studie Epidemiologie psychischer Störungen in der med. Rehabilitation Hier wurde den Teilnehmern ein Überblick über die Ziele und Fragestellungen der Forschungsstudie vermittelt, das verwendete Design, die Untersuchungsmethodik und das Vorgehen bei der Ziehung der Stichproben wurden ausgeführt. Nach der Darstellung der Stichprobengrößen in den verschiedenen Indikationsgruppen und bezogen auf die einzelnen Untersuchungsinstrumente wurden wesentliche soziodemografische Charakteristika der Probanden erläutert. Diesem folgte die Vorstellung der Ergebnisse hinsichtlich der psychischen Belastungen und Störungen bei den untersuchten Patienten. Abschließend wurden anhand zweier Fallvignetten individuelle körperliche und psychische Krankheitsverläufe, und hier insbesondere die Interaktion zwischen somatischen und psychischen Symptomen, veranschaulicht. 89 Diagnostik psychischer Komorbidität bei körperlichen Erkrankungen Zunächst wurde eine Einteilung gebräuchlicher Erhebungsinstrumente in der medizinischen Rehabilitation vorgenommen. Neben übergreifenden Instrumenten, die eine globale Messung verschiedener Ebenen des Gesundheitszustandes einer Person ermöglichen und unabhängig von deren Krankheit oder Störung eingesetzt werden können, wurden spezifische Verfahren vorgestellt, die sich auf bestimmte Krankheiten, Störungen oder Populationen beziehen. Ein weiterer Klassifikationsgesichtspunkt lag in der Unterscheidung von Fragebogen- und Interviewverfahren. Folgende Fragebogenverfahren zur Erhebung psychischer Beeinträchtigungen wurden ausführlicher behandelt: IRES-2, SF-36, GHQ-12, SCL-90-R / BSI, HADS-D, DIA-X SSQ und Brief PHQ-D. Dabei wurde jeweils auf die Haupt- und Unterdimensionen des Instruments, die Itemzahl, Bearbeitungs- und Auswertungszeit, psychometrische Kriterien, Referenzwerte und etwaige spezifische Besonderheiten eingegangen. An Interviewverfahren zur Diagnostik psychischer Störungen wurden das Composite International Diagnostic Interview (CIDI DIA-X) und das Strukturierte Klinische Interview für DSM-IV (SKID-IV) präsentiert. Für beide Instrumente wurden jeweils Messziel, Durchführungsmodalitäten, Inhalt, Bezugszeitraum sowie ebenfalls Bearbeitungs- und Auswertungszeit und psychometrische bzw. Referenzwerte erörtert. Abschließend erfolgte unter Rekurs auf die in der vorliegenden Forschungsstudie eingesetzten Instrumente ein Überblick zur Akzeptanz der einzelnen Verfahren bei den untersuchten Patienten sowie die Ableitung eines Fazits zur Diagnostik psychischer Störungen bei körperlich kranken Personen. Im Anschluss an diesen Vortrag bearbeiteten die Teilnehmer in Kleingruppen die Thematik „Auswahl von Assessmentverfahren“. Dabei wurden folgende Stichworte vorgegeben: Akzeptanz / Eignung für die Zielgruppe übergreifende vs. spezifische Verfahren inhaltliche Dimensionen Normen für Indikationsgruppen Test-Gütekriterien Ökonomie und Zeitaufwand Eignung als Screening-Instrument: Sensitivität und Spezifität. Die Ergebnisse aus den Kleingruppen wurden im Plenum vorgestellt und diskutiert. Umsetzung in die Rehabilitationspraxis Zu dieser Thematik wurde anhand folgender Stichworte im Plenum diskutiert: Praxis in der eigenen Einrichtung Bewertung und Auswahl von Screeningstrategien Möglichkeiten der Diagnostik und Differentialdiagnostik Möglichkeiten der Intervention Kommunikation im Reha-Team und Bedeutung für das Behandlungskonzept Integration in Klinikalltag und Praxis Stellenwert im Entlassbericht und Therapieempfehlung. 90 Evaluation des Workshops Die 20 Teilnehmer äußerten sich dabei sowohl mündlich als auch mittels eines schriftlichen Evaluationsbogens sehr positiv zu den Inhalten, der Organisation und dem Verlauf des Workshops. Diese erste vorläufige Bewertung des Konzeptes soll durch weitere für das Jahr 2002 geplante Fortbildungsveranstaltungen vertieft und ergänzt werden. Auswertung der Feedbackbogen 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Relevanz Mittel SD 1,30 0,47 Inhalt 1,78 0,67 Neuigkeitsw. Didaktik/Präs. Disk.Mögl. 2,39 0,72 1,52 0,67 1,74 0,86 Umsetzbarkeit 3,22 1,04 Organisation 1,57 0,59 Gesamt 1,94 0,66 1. Säule Psychologen, 2. Säule Ärzte, Gesamt-N= 23 Die hier in der Endphase begonnene Entwicklung eines Fortbildungsprogrammes soll im Rahmen des Anschlussvorhaben „Prävalenz und Behandlungsbedürftigkeit komorbider psychischer Störungen bei Patienten mit Erkrankungen der Atmungsorgane und des Stoffwechsels in der 91 medizinischen Rehabilitation“ fortgesetzt werden. Die Behandler sollen die Relevanz, die Häufigkeit und Art psychischer Störungen sowie die diagnostischen Möglichkeiten zur Entdeckung psychischer Störungen bei den verschiedenen Indikationen kennenlernen. Ziel ist die Entwicklung und Evaluation eines standardisierten Fortbildungsprogrammes. 92 8 Publikationen der Arbeitsgruppe Originalia 1. Bengel, J., Wunsch, A. & Härter, M. (2001). Depression nach Herzerkrankung. In B. Rauch & K. Held (Hrsg.), Der schwerkranke und multimorbide Patient – eine Herausforderung für die kardiologische Rehabilitation (S. 154-160). Darmstadt: Steinkopff. 2. Härter, M. & Bengel, J. (im Druck). Psychische Beeinträchtigungen und Störungen bei Patienten mit Herz-Kreislauf- Erkrankungen – Epidemiologie und Implikationen für die medizinische Rehabilitation und Nachsorge. In B. Strauß (Hrsg.), Psychotherapie in der Medizin. Jahrbuch der Medizinischen Psychologie. Göttingen: Hogrefe. 3. Härter, M., Reuter, K., Aschenbrenner, A., Schretzmann, B., Marschner, N., Hasenburg, A. & Weis, J. (2001a). Psychiatric disorders and associated factors in cancer: Results of an interview study with patients in inpatient, rehabilitation and outpatient treatment. European Journal of Cancer, 37 (11), 1385-1393. 4. Härter, M., Reuter, K., Groß-Hardt, K. & Bengel, J. (2001b). Screening for anxiety, depressive and somatoform disorders in rehabilitation – Validity of HADS and GHQ-12 in patients with musculoskeletal diseases. Disability and Rehabilitation, 23, 737-744. 5. Härter, M., Reuter, K., Schretzmann, B., Hasenburg, A., Aschenbrenner, A. & Weis, J. (2000a). Komorbide psychische Störungen bei Krebspatienten in der stationären Akutbehandlung und medizinischen Rehabilitation. Die Rehabilitation, 39, 1-7. 6. Härter, M., Reuter, K., Weißer, B., Schretzmann, B., Aschenbrenner, A. & Bengel, J. (in press). A descriptive study of psychiatric disorders and psycho-social burden in rehabilitation patients with musculoskeletal diseases. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 7. Härter, M., Wunsch, A., Reuter, K. & Bengel, J. (2000b). Epidemiologie psychischer Störungen bei Patienten mit muskulo-skelettalen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. In J. Bengel & W.H. Jäckel (Hrsg.), Zielorientierung in der Rehabilitation - Rehabilitationswissenschaftlicher Forschungsverbund Freiburg / Bad Säckingen (S. 69-83). Regensburg: Roderer. 8. Reuter, K & Härter, M. (2000). Differentialdiagnose von Fatigue und depressiven Störungen bei Tumorerkrankungen. In J. Weis & H.H. Bartsch (Hrsg.), Fatigue bei Tumorpatienten - eine neue Herausforderung für Therapie und Rehabilitation (S. 36-51). BaselFreiburg: Karger. 9. Reuter, K., Härter, M. (2001). Screening for mental disorders in cancer patients – discriminant validity of HADS and GHQ-12 assessed by standardized clinical interview. International Journal of Methods in Psychiatric Research, 10 (2), 86-96. 10. Reuter, K., Woll, S., Stadelmann, S., Bengel, J. & Härter, M. (submitted). Erkennen und Behandeln psychischer Belastungen und Störungen in der orthopädischen Rehabilitation. Zeitschrift für Klinische Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie. 93 Reviews 11. Angenendt, J. & Härter, M. (in press). Somatoform disorders. In N.J. Smelsner & P.B. Baltes (eds.), International Enyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Oxford: Elsevier. 12. Aschenbrenner, A., Härter, M., Reuter, K. & Bengel, J. (im Druck). Prädiktoren für psychische Beeinträchtigungen und Störungen bei Patienten mit Tumorerkrankungen – Ein systematisches Review empirischer Studien. Zeitschrift für Medizinische Psychologie. 13. Härter, M. (2000a). Psychische Störungen bei körperlichen Erkrankungen. Psychotherapie, Psychosomatik, medizinische Psychologie, 50, 274-286. 14. Härter, M. (2000b). Psychische Störungen bei körperlichen Erkrankungen und ihre Bedeutung für psychosoziale Dienstleistungen im Krankenhaus. In M. Härter & U. Koch (Hrsg.), Psychosoziale Dienste im Krankenhaus (S. 7-28). Göttingen: Verlag für angewandte Psychologie. 15. Härter, M. (2001). Diagnostik in epidemiologischen Studien. In R.-D. Stieglitz, U. Baumann & H.-J. Freyberger (Hrsg.), Psychodiagnostik in Klinischer Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie (S. 339-350). 2. Auflage. Stuttgart: Thieme. 16. Härter, M. & Berger, M. (2000). Psychiatrische und psychosomatische Komorbidität bei Diabetes mellitus. In: M. Berger (Hrsg.), Diabetes mellitus (S. 754-762). München u.a.O. Urban & Schwarzenberg. 17. Heßlinger, B., Härter, M., Barth, J., Klecha, D., Bode, C., Walden, J., Bengel, J. & Berger, M. (im Druck). Komorbidität von depressiven Störungen und Herzerkrankungen – Implikationen für Diagnostik, Pharmako- und Psychotherapie. Der Nervenarzt. 18. Reuter, K. & Härter, M. (in press). The concepts of fatigue and depression in cancer. Annals of Oncology. 19. Weißer, B., Härter, M., Reuter, K. & Bengel, J. (im Druck). Prävalenz und Risikofaktoren psychischer Belastungen und psychische Störungen bei Patienten mit muskulo-skelettalen Erkrankungen – ein Review empirischer Studien. Der Schmerz. Abstracts 1. Aschenbrenner, A., Härter, M., Reuter, K. (2001). Risikofaktoren für komorbide psychische Störungen bei Patienten mit Tumorerkrankungen. DRV-Schriften, Bd.26, 357-359. 2. Härter, M., Kenk, A., Reuter, K., Wark, S., Weis, J. & Marschner, N. (1998). Comorbidity of cancer and mental disorders. Psycho-Oncology, 7, (4, suppl.), 47. 3. Härter, M., Reuter, K., Weis, J. & Marschner, N. Screening for mental disorders in cancer patients. Psycho-Oncology, 9 (5 suppl.), 206. 4. Reuter, K. & Härter, M. (1999). Fatigue and Depression. Onkologie, 22, 4, 353-354. 94 5. Reuter, K., Härter, M., Aschenbrenner, A., Weis, J. & Marschner, N. (2000) Differential diagnostic of depressive disorders. Psycho-Oncology, 9 (5 suppl.), 91. 6. Reuter, K., Raugust, S., Härter, M. (2001). Fatigue and/or depression. Onkologie, Sonderausg. 2. 7. Reuter, K., Härter, M., Wark, S., Marschner, N. (1999). Komorbidität psychischer Störungen bei Patienten mit Tumorerkrankungen. DRV-Schriften, Bd.12, 311-312. 8. Reuter, K., Härter, M., Bengel, J., Wunsch, A. (2000). Psychische Störungen in der orthopädischen Rehabilitation. DRV-Schriften, Bd.20, 266-267. 9. Reuter, K., Härter, M., Woll, S., Wunsch, A., Bengel, J. (2001). Erkennen und Behandeln psychischer Störungen in der orthopädischen Rehabilitation. DRV-Schriften, Bd.26, 265266. 10. Wunsch, A., Bengel, J., Härter, M., Reuter, K. (2000). Epidemiologie psychischer Störungen bei Herz-Kreislauf-Patienten in der medizinischen Rehabilitation. DRV-Schriften, Bd.20, 488 - 489. 11. Wunsch, A., Härter, M., Reuter, K., Bengel, J. (2001). Psychische Belastungen und psychische Störungen in der stationären kardiologischen Rehabilitation. DRV-Schriften, Bd.26, 334-336. Weitere Publikationen der Projektleiter siehe Homepage: http://www.uniklinik-freiburg.de/k/psy/appt/de/pub/ http://www.psychologie.uni-freiburg.de/einrichtungen/Reha/index.htm 95 9 Literaturverzeichnis Ahles, T.A., Khan, S.A., Yunus, M.B, Spiegel, D.A. & Masi, A.T. (1991). Psychiatric status of patients with primary fibromyalgia, patients with rehumatoid arthritis, and subjects without pain: A blind comparison of DSM-III diagnoses. American Journal of Psychiatry, 148, 17211726. Akechi, T., Kugaya, A., Okamura, H., Yamawaki, S. & Uchitomi, Y. (1999). Fatigue and its associated factors in ambulatory cancer patients: A preliminary study. Journal of Pain & Symptom Management, 17, 42-48. American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders. 4th edition. Washington DC: American Psychiatric Press. Andrews, G. & Henderson, S. (eds.) (2000). Unmet Need in Psychiatry. Cambridge: Cambridge University Press. Angenendt, J. & Stieglitz, R.-D. (1999). Psychoedukation, Patientenratgeber und Selbsthilfemanuale. In: M. Berger (Hrsg.), Psychiatrie und Psychotherapie (S. 239-255). Unter Mitarbeit von R.-D. Stieglitz. München: Urban & Schwarzenberg. Angst, J. & Merikangas, K.R. (1997). The depressive spectrum: diagnostic classification and course. Journal of Affective Disorders, 45, 31-39. Angst, J., Sellaro, R. & Merikangas, K.R. (2000). Depressive spectrum diagnoses. Comprehensive Psychiatry, 41(2 Suppl. 1), 39-47. Arnold, L.M., Keck, P.E. & Welge, J.A. (2000). Antidepressant treatment of fibromyalgia. A meta-analysis and review. Psychosomatics, 41, 104-113. Arolt, V. (1997). Psychische Störungen bei Krankenhauspatienten. Eine epidemiologische Studie zu Diagnostik, Prävalenz und Behandlungsbedarf psychiatrischer Morbidität bei internistischen und chirurgischen Patienten. In H. Hippius, W. Janzarik & C. Müller (Hrsg.), Monographien aus dem Gesamtgebiete der Psychiatrie, Bd. 84. Berlin: Springer-Verlag. Arolt, V., Driessen, M. & Dilling, H. (1997). Psychische Störungen bei Patienten im Allgemeinkrankenhaus. Deutsches Ärzteblatt, 94, A1354-1358. Aschenbrenner, A. (1999). Psychische Störungen und Belastungen bei Patienten mit Tumorerkrankungen in der stationären Rehabilitation. Unveröffentlichte Diplomarbeit. Psychologisches Institut der Universität Freiburg. Aschenbrenner, A., Härter, M., Reuter, K. & Bengel, J. (im Druck). Risikofaktoren für komorbide psychische Störungen bei Patienten mit Tumorerkrankungen – Ein Review empirischer Studien. Zeitschrift für Medizinische Psychologie. Barth, J., Härter, M. & Bengel, J. (2001). Effektivität und Effizienz einer leitlinienorientierten Behandlung von Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen und komorbiden psychischen Störungen. Rehabilitationswissenschaftlicher Forschungsverbund Freiburg / Bad Säckingen. Unveröffentlicher Forschungsantrag. Bonn: Bundesministerium für Bildung und Forschung. Beaglehole, R., Bonita, R. & Kjellström. T. (1997). Einführung in die Epidemiologie. Bern: Huber. 96 Beitman, B.D., Muskerji, V., Lamberti, J.W., Schmid, L., DeRosear, L., Kushner, M., Flaker, G. & Basha, J. (1989). Panic disorders in patients with chest pain and angiographically normal coronary arteries. American Journal of Cardiology, 63, 1399-1403. Bengel, J. & Jäckel, W.H. (Hrsg.). Zielorientierung in der Rehabilitation - Rehabilitationswissenschaftlicher Forschungsverbund Freiburg / Bad Säckingen. Regensburg: Roderer. Bengel, J. & Koch, U. (Hrsg.) (2000). Grundlagen der Rehabilitationswissenschaften. Themen, Stratgien und Methoden der Rehabilitationsforschung. Berlin: Springer. Breitbart, W. (1995). Identifying patients at risk for, and treatment of major psychatric complications of cancer. Supportive Care in Cancer, 3, 45-60. Bromet, E.J., Dew, M.A. & Eaton, W. (1995). Epidemiology of psychosis with special reference to schizophrenia. In M.T. Tsuang, M. Tohen, M. & G.E.P. Zahner (eds.), Textbook in Psychiatric Epidemiology (pp. 283-300). New York: Wiley-Liss. Bruhn, J.G., Paredes, A., Adsett, C.A. & Wolf, S. (1974). Psychological predictors of sudden death in myocardial infarction. Journal of Psychosomatic Research, 18, 187-191. Bukberg, J., Penman, D. & Holland, J.C. (1984). Depression in hospitalized cancer patients. Psychosomatic Medicine, 45, 199-212. Bullinger, M. (1996). Erfassung der gesundheitlichen Lebensqualität mit dem SF-36 Health Survey. Rehabilitation, 35, XVII-XXX. Burke, J. (1995). Mental Health Services Research. In M.T. Tsuang, M. Tohen, M. & G.E.P. Zahner (eds.), Textbook in Psychiatric Epidemiology (pp. 199-209). New York: Wiley-Liss. Burkhardt, C.S., O`Reilly, C.A., Wiens, A.N., Clark, S.R., Campbell, S.M. & Bennett, R.M. (1994). Assessing depression in fibromyalgie patients. Arthritis Care Research, 7, 35-39. Carney, R.D., Freedland, K.E. & Jaffe, A.S. (2001). Depression as a risk factor for coronary heart disease mortality. Commentary. Archives of General Psychiatry, 58, 229-230. Carney, R.M., Rich, M.W., Freedland, K.E. & Saini, J. (1988). Major depressive disorder predicts cardiac events in patients with coronary artery disease. Psychosomatic Medicine, 50, 627-633. Cavenaugh, S., Clark, D. & Gibbons, R. (1983). Diagnosing depression in the hospitalized medically ill. Psychosomatics, 24, 809-815. Chignon, J.M., Lepine, J.P. & Ades, J. (1993). Panic disorder in cardiac outpatients. American Journal of Psychiatry, 150, 780-785. Cohen-Cole, S.A., Brown, F.W. & McDaniel, J.S. (1993). Assessment of depression and grief reactions in the medically ill. In A. Stoudemire & B.S. Fogel (eds.), Psychiatric Care of the Medical Patient (pp. 53-69). New York: Oxford University Press. Collis, I. (1997). Depression and respiratory disorders. In M.M. Robertson & C.L.E. Katona (eds.), Depression and Physical Illness (pp. 391-405). Chichester: John Wiley & Sons. Costa, P.T., Zonderman, A.B., Engel, B.T., Baile, W.F., Brimlow, D.L. & Brinker, J. (1985). The relation of chest pain symptoms to angiographic findings of coronary artery stenosis and neuroticism. Psychosomatic Medicine, 47, 285-293. 97 Creed, F. & Ash, G. (1992). Depression in rheumatoid arthritis. Aetiology and treatment. International Reviews in Psychiatry, 4, 23-34. Creed, F. (1997). Assessing depression in the context of physical illness. In M.M. Robertson & C.L.E. Katona (eds.), Depression and Physical Illness (pp. 3-19). Chichester: John Wiley & Sons. Davidson, K., Jonas, B.S., Dixon, K.E. & Markowitz, J. (2000). Do depression symptoms predict early hypertension incidence in young adults in the CARDIA study? Archives of Internal Medicine, 160, 1495-1500. DeFlorio, M. & Massie, M.J. (1995). Review of depression in cancer: gender differences. Depression, 3, 66-80. Depression Guideline Panel (1993). Depression in Primary Care: Volume 1, Detection and Diagnosis. Clinical Practice Guideline, Number 5. Rockville: U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Agency for Health Care Policy and Research. Derogatis, L. R., Morrow, G. R., Fetting, J., Penman, D., Piasetsky, S., Schmale, A. M., Henrichs, M. & Carnicke, Ch. L. M. (1983). The prevalence of psychiatric disorders among cancer patients. JAMA, 249, 751-757. Dilling, H., Weyerer, S. & Castell, R. (Hrsg.) (1984). Psychische Erkrankungen in der Bevölkerung. Stuttgart: Enke. DiMatteo, M.R., Lepper, H.S. & Croghan, T.W. (2000). Depression is a risk factor for noncompliance with medical treatment. Meta-analysis of the effects of anxiety and depression on patient adherence. Archives of Internal Medicine, 160, 2101-2107. Dohrenwend, B.P. (1995). „The problem of validity in field studies of psychological disorders“ revisited. In M.T. Tsuang, M. Tohen, M. & G.E.P. Zahner (eds.), Textbook in Psychiatric Epidemiology (pp. 3- 20). New York: Wiley-Liss. Dohrenwend, B.P., Dohrenwend, B.S., Schwartz Gould, M., Link, B., Neugebauer, R. & Wunsch-Hitzig, R. (eds.) (1980), Mental Illness in the United States. Epidemiological Estimates. New York: Praeger. Ehlert, U. (1998). Psychologie im Krankenhaus. Bern: Huber. Endicott, J. (1984). Measurement of depression in patients with cancer. Cancer, 53 (suppl.), 2243-49. Endicott, J. & Spitzer, R.L. (1978). A diagnostic interview: The Schedule of Affective Disorders and Schizophrenia. Archives of General Psychiatry, 35, 837-844. Faraone, S.V. & Tsuang, M.T. (1995). Methods in psychiatric genetics. In M.T. Tsuang, M. Tohen, M. & G.E.P. Zahner (eds.), Textbook in Psychiatric Epidemiology (pp. 81-134). New York: Wiley-Liss. Feinstein, A. (1970). The pre-therapeutic classification of comorbidity in chronic disease. Journal of Chronic Diseases, 23, 455-468. Ferketich, A.K., Schwartzbaum, J.A., Frid, D.J. & Moeschberger, M.L. (2000). Depression as an antecedent to heart disease among women and men in the NHANES I study. Archives of Internal Medicine, 160, 1261-1268. 98 Finkbeiner, G.F. (1996). Rehabilitation bei Krankheiten der Haltungs- und Bewegungsorgane. In H. Delbrück & E. Haupt (Hrsg.), Rehabilitationsmedizin: Therapie- und Betreuungskonzepte bei chronischen Krankheiten (S. 355-401). München: Urban & Schwarzenberg. Flor, H. (1991). Psychobiologie des Schmerzes. Bern: Hans Huber. Flor, H. & Turk, D.C. (1984). Etiological theories and treatments for chronic back pain: I. Somatic models and interventions. Pain, 19, 105-121. Ford, D.E., Mead, L.A., Chang, P.P., Cooper-Patrick, L., Wang, N.-Y. & Klag, M.J. (1998). Depression is a risk factor for coronary artery disease in men. Archives of Internal Medicine, 158, 1422-1426. Frances, A. (1998). Problems in defining clinical significance in epidemiological studies. Archives of General Psychiatry, 55, 119. Frank, R.G., Beck, N.C., Parker, J.C., Kashani, J.H., Elliot, T.R., Haut, A.E., Smith, E., Atwood, C., Brownlee-Duffect, M. & Kay. D.R. (1988). Depression in rheumatoid arthritis. Journal of Rheumatology, 15, 920-925. Frasure-Smith, N., Lespérance, F. & Talajic, M. (1993). Depression following myocardial infarction: impact on 6-month survival. JAMA, 270, 1819-1861. Frasure-Smith, N., Lespérance, F., Gravel, G., Masson, A., Juneau, M. et al. (2000a). Depression and health-care costs during the first year following myocardial infarction. Journal of Psychosomatic Research, 48, 471-478. Frasure-Smith, N., Lespérance, F., Gravel, G., Masson, A., Juneau, M. et al. (2000b). Social support, depression, and mortality during the first year after myocardial infarction. Circulation, 101, 1919-1924. Frasure-Smith, N., Lespérance, F., Prince, R.H., Verrier, P., Garber, R., Juneau, M., Wolfson, C. & Bourassa, M.G. (1997). Randomised trial of home-based psychosocial nursing interventions for patients recovering from myocardial infarction. Lancet, 350, 473-479. Friedman, M., Thoresen, C.E., Gill, J.J., Ulmer, D., Powell, L.H., Price, V.A., Brown, B., Thompson, L., Rabin, D.D., Breall, W.S., Bourg, E., Levy, R. & Dixon, T. (1986). Alteration of type A behavior and its effects on cardiac recurrences in post myocardial infarction patients: summary results of the Recurrent Coronary Prevention Project. American Heart Journal, 112, 653-665. Gala, C., Galletti, F. & Invernizzi, G. (1997). Depression and cardiovascular disease. In M.M. Robertson & C.L.E. Katona (eds.), Depression and Physical Illness (pp. 210-223). Chichester: John Wiley & Sons. Gerdes, N., Bengel, J. & Jäckel, W. H. (2000). Zielorientierung in Diagnostik, Therapie und Ergebnismessung. In J. Bengel & W. H. Jäckel (Hrsg.), Zielorientierung in der Rehabilitation - Rehabilitationswissenschaftlicher Forschungsverbund Freiburg / Bad Säckingen (S. 3-12). Regensburg: Roderer. Gerdes, N. & Weis, J. (2000). Zur Theorie der Rehabilitation. In: J. Bengel & U. Koch (Hrsg.), Grundlagen der Rehabilitationswissenschaften. Themen, Strategien und Methoden der Rehabilitationsforschung (S. 41-68). Berlin: Springer. Glassman, A.H. & Shapiro, P.A. (1998). Depression and the course of coronary artery disease. American Journal of Psychiatry, 155 (1), 4-11. 99 Glaus, A (1998). Fatigue in Patients with Cancer. Analysis and Assessment. Berlin: Springer. Goldberg, D. & Williams P. (1988). A User`s Guide to the General Health Questionnaire. Windsor: NFER-Nelson. Goldberg, D., Jenkins, L., Millar, T. & Faragher, E.B. (1993). The ability of trainee general practitioners to identify psychological distress among their patients. Psychological Medicine, 23, 185-193. Goldberg, R.J. & Cullen, O. (1985). Factors important to psychosocial adjustment to cancer: a review of the evidence. Social Science & Medicine, 20, 803-807. Goldstein, J.M. & Simpson, J.C. (1995). Validity: definitions and applications to psychiatric research. In M.T. Tsuang, M. Tohen, M. & G.E.P. Zahner (eds.), Textbook in Psychiatric Epidemiology (pp. 229-242). New York: Wiley-Liss. Gonzalez, M.B., Snyderman, T.B., Colket, J.T., Arias, R.M., Jiang, J.W., O´Connor, C.M. & Krishman, K.R. (1996). Depression in patients with coronary artery disease. Depression, 4, 5762. Greenberg, D. (1998). Fatigue. In J.C. Holland (ed.), Psycho-oncology (pp. 485-493). New York: Oxford University Press. Hafen, K., Bengel, J., Jastrebow, J. & Nübling, R. (2000). Konzept und Dimensionen der Reha-Motivation. Prävention und Rehabilitation, 12, 1-10. Harrison, J. & Maguire, P. (1994). Predictors of psychiatric morbidity in cancer patients. British Journal of Psychiatry, 165, 593-598. Härtel, U. (2000). Geschlechtsspezifische Aspekte in der Rehabilitation: Das Beispiel koronare Herzkrankheit. In J. Bengel, & U. Koch (Hrsg.), Grundlagen der Rehabilitationswissenschaften. Themen, Strategien und Methoden der Rehabilitationsforschung (S. 215-238). Berlin: Springer. Härter, M. (1993). Psychosomatische Aspekte bei rheumatischen Erkrankungen. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 43, 100-109. Härter, M. (1994). Graduierung von Schmerzen und Funktionseinschränkungen bei Erkrankungen am Stütz- und Bewegungsapparat. Ergebnisse einer epidemiologischen Untersuchung von Gesunden und Patienten mit Rückenschmerzen. Frankfurt: Peter Lang. Härter, M. (2000a). Psychische Störungen bei körperlichen Erkrankungen. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 50, 274-286. Härter, M. (2000b). Psychische Störungen bei körperlichen Erkrankungen und ihre Bedeutung für psychosoziale Dienstleistungen im Krankenhaus. In M. Härter & U. Koch, U. (Hrsg.), Psychosoziale Dienste im Krankenhaus (S. 7-28). Göttingen: Verlag für angewandte Psychologie. Härter, M. (2001). Diagnostik in epidemiologischen Studien. In R.-D. Stieglitz, U. Baumann & H.-J. Freyberger (Hrsg.), Psychodiagnostik in Klinischer Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie. 2. Auflage (S. 339-350). Stuttgart: Thieme. 100 Härter, M. & Bengel, J. (1998). Epidemiologie psychischer Störungen in der medizinischen Rehabilitation. Rehabilitationswissenschaftlicher Forschungsverbund Freiburg / Bad Säckingen. Univeröffentlichter Forschungsantrag. Bonn: Bundesministerium für Bildung und Forschung. Härter, M. & Bengel, J. (2001). Prävalenz und Behandlungsbedürftigkeit komorbider psychischer Störungen bei Patienten mit Erkrankungen der Atmungsorgane und des Stoffwechsels in der medizinischen Rehabilitation. Rehabilitationswissenschaftlicher Forschungsverbund Freiburg / Bad Säckingen. Unveröffentlichter Forschungsantrag. Bonn: Bundesministerium für Bildung und Forschung. Härter, M. & Bengel, J. (im Druck). Psychische Beeinträchtigungen und Störungen bei Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen – Epidemiologie und Implikationen für die medizinische Rehabilitation und Nachsorge. In B. Strauß (Hrsg.), Psychotherapie in der Medizin. Jahrbuch der Medizinischen Psychologie. Göttingen: Hogrefe. Härter, M. & Berger, M. (2000). Psychiatrische und psychosomatische Komorbidität bei Diabetes mellitus. In M. Berger (Hrsg.), Diabetes mellitus (S. 754-762). München: Urban & Schwarzenberg. Härter, M., Reuter, K., Groß-Hardt, K. & Bengel, J. (2001a). Screening for anxiety, depressive and somatoform disorders in rehabilitation – Validity of HADS and GHQ-12 in patients with musculoskeletal diseases. Disability and Rehabilitation, 23, 737-744. Härter, M., Reuter, K., Aschenbrenner, A., Schretzmann, B., Marschner, N., Hasenburg, A. & Weis, J. (2001b). Psychiatric disorders and associated factors in cancer: Results of an interview study with patients in inpatient, rehabilitation and outpatient treatment. European Journal of Cancer, 37 (11), 1385-1393. Härter, M., Reuter, K., Schretzmann, B., Hasenburg, A., Aschenbrenner, A. & Weis, J. (2000a). Komorbide psychische Störungen bei Krebspatienten in der stationären Akutbehandlung und medizinischen Rehabilitation. Die Rehabilitation, 39, 317-323. Härter, M., Reuter, K., Weißer, B., Schretzmann, B., Aschenbrenner, A. & Bengel, J. (in press). A descriptive study of psychiatric disorders and psycho-social burden in rehabilitation patients with musculoskeletal diseases. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. Härter, M., Wunsch, A., Reuter, K. & Bengel, J. (2000b). Epidemiologie psychischer Störungen bei Patienten mit muskulo-skelettalen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. In J. Bengel & W.H. Jäckel (Hrsg.), Zielorientierung in der Rehabilitation - Rehabilitationswissenschaftlicher Forschungsverbund Freiburg / Bad Säckingen (S. 69-83). Regensburg: Roderer. Hayward, C. (1995). Psychiatric illness and cardiovascular disease risk. Epidemiological Reviews, 17, 129-138. Hemingway, H. & Marmot, M. (1999). Psychosocial factor in the etiology and prognosis of coronary heart disease: systematic review of prospective cohort studies. British Medical Journal, 318, 1460-1467. Henderson, A.S. (1999). Prinzipien psychiatrischer Epidemiologie. In H. Helmchen, F. Henn, H. Lauter & N. Sartorius (Hrsg.), Psychiatrie der Gegenwart. Grundlagen der Psychiatrie. 4. Aufl. (S. 45-78). Berlin: Springer. 101 Herrmann, Ch., Brand-Driehorst, S., Buss, U. & Rüger, U. (2000). Effects of anxiety and depression on 5-year mortality in 5057 patients referred for exercise testing. Journal of Psychosomatic Research, 48, 455-462. Herrmann, Ch., Brand-Driehorst, S., Kaminsky, B., Leibing, E., Staats, H. & Rüger, U. (1998). Diagnostic groups and depressed mood as predictors of 22-month mortality in medical inpatients. Psychosomatic Medicine, 60, 570-577. Herrmann, Ch., Buss, U. & Snaith, R.P. (1995). Hospital Anxiety and Depression Scale – Deutsche Version (HADS-D). Bern: Huber. Herrmann, Ch., Scholz, K.H. & Kreuzer, H. (1991). Psychologisches Screening von Patienten einer kardiologischen Akutklinik mit einer deutschen Fassung der "Hospital Anxiety and Depression" (HAD)-Skala. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 41, 8392. Heßlinger, B., Härter, M., Barth, J., Klecha, D., Bode, C., Walden, J. & Berger, M. (im Druck). Komorbidität von depressiven Störungen und Herzerkrankungen – Implikationen für Diagnostik, Pharmako- und Psychotherapie. Der Nervenarzt. Hiller, W., Zaudig, W. & Mombour, W. (1995). ICD-10 Checklisten. Bern: Huber. Hillis, S.L. & Woolson, R.F. (1995). Analysis of categorized data: use of the odds ratio as a measure of association. In M.T. Tsuang, M. Tohen, M. & G.E.P. Zahner (eds.), Textbook in Psychiatric Epidemiology (pp. 55-80). New York: Wiley-Liss. Hudson, J.I., Hudson, M.S., Pliner, L.F. et al. (1985). Fibromyalgia and major affective disorder: a controlled phenomenology and family history study. American Journal of Psychiatry, 142, 441-446. Jenkins, R., Bebbington, P., Brugha, T., Farrell, M., Gill, B., Lewis, T., Meltzer, H. & Pettigrew, M. (1997). The National Psychiatric Morbidity Survey of Great Britain - initial findings from the household survey. Psychological Medicine, 27, 775-789. Kapfhammer, H.-P. (2000). Depressiv-ängstliche Störungen bei somatischen Krankheiten. In H.-J. Möller, G. Laux & H.-P. Kapfhammer (Hrsg.), Psychiatrie und Psychotherapie (S. 14875120). Berlin: Springer. Kathol, R.G., Mutgi, A., Williams, J., Clamon, G. & Noyes, R. (1990). Diagnosis of major depression in cancer patients to four sets of criteria. American Journal of Psychiatry, 147, 10211024. Katon, W. & Sullivan, M. D. (1990). Depression and chronic medical illness. Journal of Clinical Psychiatry, 51 (suppl.), 3-11. Katon, W., Hall, M.L., Russo, J., Cormier, L., Hollifield, M., Vitaliano, P.P. & Beitman, B.D. (1988). Chest pain: relationship of psychiatric illness to coronay arteriographic results. American Journal of Medicine, 84, 1-9. Katon, W., Sullivan, M. & Clark, M. (1995). Cardiovascular disorders. In H.I. Kaplan & B.J. Saddock (1995). Comprehensive Textbook of Psychiatry. 6th edition (pp. 1491-1501). Baltimore: Williams & Wilkins. Kessler, R.C. (1995). Epidemiology of psychiatric comorbidity. In M.T. Tsuang, M. Tohen, M. & G.E.P. Zahner (eds.), Textbook in Psychiatric Epidemiology (pp. 179-197). New York: Wiley-Liss. 102 Kessler, R.C., McGonagle, K.A., Zhao, S., Nelson, C.B., Hughes, M., Eshleman, S., Wittchen, H.-U. & Kendler, K.S. (1994). Lifetime and 12-month prevalence of DSM-III-R psychiatric disorders in the United States. Archives of General Psychiatry, 51, 8-19. Koch, U., Weis, J., Matthey, K. & Mehnert, A. (1998). Bedarf an psychoonkologischer Betreuung aus Sicht der Experten - Ergebnisse einer Delphi-Befragung. In U. Koch & J. Weis (Hrsg.), Krankheitsbewältigung bei Krebs und Möglichkeiten der Unterstützung. Der Förderschwerpunkt "Rehabilitation von Krebskranken" (S. 245-252). Stuttgart: Schattauer. Krueger, R.F. (1999). The structure of common mental disorders. Archives of General Psychiatry, 56, 921-926. Kubzansky, L. & Kawachi, I. (2000). Going to the heart of the matter: do negative emotions cause coronary heart disease? Journal of Psychosomatic Research, 48, 323-337. Kühner, C. (1997). Fragebogen zur Depressionsdiagnostik nach DSM-IV (FDD-DSM-IV). Göttingen: Hogrefe. Ladwig, K.H., Lehmacher, W., Roth, R., Breithardt, G., Budde, Th. & Borggrefe, M. (1992). Factors which provoke post-infarction depression: results from the post-infarction late potential study (PILP). Journal of Psychosomatic Research, 36, 723-729. Last, J.M. (ed.) (1995). A Dictionary of Epidemiology. Edited for the International Association of Epidemiology. 3rd Edition. New York: Oxford University Press. Lebovits, B.Z., Shekelle, R.B., Ostfeld, A.M. & Oglesby, P. (1967). Prospective and retrospective psychological studies in coronary heart disease. Psychosomatic Medicine, 29, 265272.Leighton, D.C., Harding, J.C., Macklin, D.B., McMillan, A.M. & Leighton, A.H. (1963). The Character of Danger. The Stirling County Study of Psychiatric Disorder and Sociocultural Environment, Vol. III, New York, London: Basic Books. Lesko, L.M., Massie, M.J. & Holland, J. (1993). Oncology. In A. Stoudemire & B.S. Fogel (eds.), Psychiatric Care of the Medical Patient (pp. 565-590). New York: Oxford University Press. Lespérance, F., Frasure-Smith, N., Juneau, M. & Théroux, P. (2000). Depression and 1-year prognosis in unstable angina. Archives of Internal Medicine, 160, 1354-1360. Levy, N.B. (1993). Chronic renal failure and its treatment: dialysis and transplantation. In A. Stoudemire & B.S. Fogel (eds.), Psychiatric Care of the Medical Patient (pp. 627-635). New York: Oxford University Press. Linden, M., Maier, W., Achberger, M., Herr, R., Helmchen, H. & Benkert, O. (1996). Psychische Erkrankungen und ihre Behandlung in Allgemeinpraxen in Deutschland. Der Nervenarzt, 67, 205-215. Linton, S.J. (2000). A review of psychological risk factors in back and neck Pain. Spine, 25 (9), 1148-1156. Löschmann, C. & Bengel, J. (2000). Implementierung und Umsetzung von Ergebnissen in der Rehabilitationsforschung. In J. Bengel & U. Koch (Hrsg.), Grundlagen der Rehabilitationswissenschaften (S. 525-535). Berlin: Springer. 103 Lyons, M.J. (1995). Epidemiology of personality disorders. In M.T. Tsuang, M. Tohen, M. & G.E.P. Zahner (eds.), Textbook in Psychiatric Epidemiology (pp. 407-436). New York: WileyLiss. Magni, G., Marchetti, M., Moreschi, C., Merskey, H. & Lucchini, S.R. (1993). Chronic musculoskeletal pain and depressive symptoms in the national health and nutrition examination. I. Epidemiologic follow-up study. Pain, 53, 163-168. Maurischat, C., Auclair, P., Bengel, J. & Härter, M. (im Druck). Erfassung der Bereitschaft zur Änderung des Bewältigungsverhaltens bei chronischen Schmerzpatienten – eine Studie zum Transtheoretischen Modell. Der Schmerz. Mayou, R.A. (1997). Depression and types of physical disorders and treatment In M.M. Robertson & C.L.E. Katona (eds.), Depression and Physical Illness (pp. 20-38). Chichester: John Wiley & Sons. McDaniel, J.S., Musselman, D.L., Porter, M.R., Reed, D.A. & Nemeroff, C.B. (1995). Depression in patients with cancer. Archives of General Psychiatry, 52, 89-99. Merikangas, K.R. & Stevens, D. (1997). Comorbidity of migraine and psychiatric disorders. Advances in Headache, 15, 115-123. Metz, C.E., Wang, P.L. & Kronman, H.B. (1993). ROCFIT. Department of Radiology and the Franklin McLean Memorial Research Institute. University of Chicago. Morris, J.N. (1964). Uses of Epidemiology. Baltimore: Williams and Wilkins. Murphy, J.M. (1995). Diagnostic Schedules and Rating Scales in Adult Psychiatry. In M.T. Tsuang, M. Tohen, M. & G.E.P. Zahner (eds.), Textbook in Psychiatric Epidemiology (pp. 253271). New York: Wiley-Liss. Musselman, D.L., Evans, D.L. & Nemeroff, C.B. (1998). The relationship of depression to cardiovascular disease. Archives of General Psychiatry, 55, 580-592. Myrtek, M. (2000). Das Typ-A-Verhaltensmuster und Hostility als eigenständige Risikofaktoren der koronaren Herzkrankheit. Frankfurt: VAS. Noyes, J.R., Holt, C.S. & Massie, J.M. (1998). Anxiety disorders. In J.C. Holland (ed.), Psycho-oncology (pp. 548-563). New York: University Press. Ormel, J., Koeter, M.W.J., Van den Brink, W. & Van de Willige, G. (1991). Recognition, management, and course of anxiety and depression in general practice. Archives of General Psychiatry, 48, 700-706. Parker, J.C. & Wright, G.E. (1997). Depression in arthritis and muskuloskeletal disorders. In M.M. Robertson & C.L.E. Katona (eds.), Depression and Physical Illness (pp. 377-390). Chichester u.a.O.: John Wiley & Sons. Paykel, E.S., Tylee, A., Wright, A., Priest, R.G., Rix, S. & Hart, D. (1997). The Defeat Depression Campaign: psychiatry in the public area. American Journal of Psychiatry, 154 (6) (suppl.), 59-65. Penninx, B.W.J.H., Beekman, A.T.F., Honig, A., Deeg, D.J.H., Schoevers, R.A., van Eijk, J.T.E. & van Tilburg, W. (2001). Depression and cardiac mortality. Results from a communitybased longitudinal study. Archives of General Psychiatry, 58, 221-227. 104 Polatin, P. B., Kinney, R. K., Gatchel, R. J., Lillo, E. & Mayer, T. G. (1993). Psychiatric iIlness and chronic low-back pain. The mind and the spine - which goes first? Spine, 18, 66-71. Pratt, L.A., Ford, D.E., Crum, R.M., Armenian, H.K., Gallo, J. & Eaton, W.W. (1996). Depression, psychotropic medication, and risk of myocardial infarction. Circulation, 94, 31233129. Raugust, S. (2001) Symptomatik affektiver Störungen bei Patienten mit Tumorerkrankungen. Unveröffentlichte Diplomarbeit. Psychologisches Institut der Universität Freiburg. Regier, D.A., Kaelber, C.T., Rae, D.S., Farmer, M.E., Knauper, Barbel, Kessler, R.C. & Norquist, G.S. (1998). Limitations of diagnostic criteria and assessment instruments for mental disorders. Implications for research and policy. Archives of General Psychiatry, 55, 109-115. Reich, P., DeSilva, R.A., Lown, B. & Murawski, B.J. (1981). Acute psychological disturbances preceding life-threatening ventricular arrhythmias. JAMA, 246, 233-235. Reuter, K. & Härter, M. (2000). Differentialdiagnose von Fatigue und depressiven Störungen bei Tumorerkrankungen. In J. Weis & H.H. Bartsch (Hrsg.), Fatigue bei Tumorpatienten - eine neue Herausforderung für Therapie und Rehabilitation (S. 36-51). Basel-Freiburg: Karger. Reuter, K. & Härter, M. (2001). Screening for mental disorders in cancer patients – discriminant validity of HADS and GHQ-12 assessed by standardized clinical interview. International Journal of Methods in Psychiatric Research, 10, (2), 86-96. Reuter, K & Härter, M. (in press). The concepts of fatigue and depression in cancer. Annals of Oncology. Reuter, K., Härter, M., Woll, S., Wunsch, A. & Bengel, J. (2001). Erkennen und Behandeln psychischer Störungen in der orthopädischen Rehabilitation. DRV-Schriften, Bd. 26, 265-266. Rifkin, A., Reardon, G., Siris, S. et al. (1985). Trimipramine in physical illness with depression. Journal of Clinical Psychiatry, 46, 4-8. Robertson, M.M. (1997). Depression in neurological disorders. In M.M. Robertson & C.L.E. Katona (eds.), Depression and Physical Illness (pp. 305-340). Chichester: John Wiley & Sons. Robins, L.N. & Regier, D.A. (1991). Psychiatric Disorders in America. The Epidemiological Catchment Area Study. New York: Free Press. Robins, L.N. (1995). How to choose among the riches: selecting a diagnostic instrument. In M.T. Tsuang, M. Tohen, M. & G.E.P. Zahner (eds.), Textbook in Psychiatric Epidemiology (pp. 243-252). New York: Wiley-Liss. Robins, L.N., Helzer, J.E., Croughan, J. & Ratcliff, K. (1981). National Institute of Mental Health Diagnostic Interview Schedule: its history, characteristics, and validity. Archives of General Psychiatry, 38, 381-389. Rose, G. (1993). Mental disorders and the strategies of prevention. Psychological Medicine, 23, 553-555. Roskies, E., Kearny, H. & Spevack, M. (1979). Generalizability and durability of the treatment effects in an intervention program for coronary-prone (type A) managers. Journal of Behavioral Medicine, 2, 195-207. 105 Rundel. M. (2001). Sensitivität und Spezifität der Screeninginstrumente HADS, GHQ-12 und DIAX-SSQ zur Entdeckung psychischer Störungen in der kardiologischen Rehabilitation. Unveröffentlichte Diplomarbeit. Psychologisches Institut der Universität Freiburg. Rumpf, H.-J., Hapke, U. & John, U. (2001). Lübecker Alkoholabhängigkeits- und Missbrauchs-Screening-Test (LAST). Göttingen: Hogrefe. Saupe, R. & Diefenbacher, A. (1999). Konsiliarpsychiatrie und -psychotherapie. In M. Berger (Hrsg.), Psychiatrie und Psychotherapie (S. 941-956). München: Urban & Schwarzenberg. Schepank, H. (1987). Psychogene Erkrankungen in der Stadtbevölkerung. Eine tiefenpsychologisch-epidemiologische Feldstudie in Mannheim. Berlin: Springer. Schleifer, S.J., Macari-Hinson, M.M., Coyle, D.A., Slater, W.A., Kahn, M., Gorlin, R. & Zucker, H.D. (1989). The nature and course of depression following myocardial infarction. Archives of Internal Medicine, 149, 1785-1789. Sellick, S.M. & Crooks, D.L. (1999). Depression and cancer: An appraisal ot the literature for prevalence, detection, and practice guideline development for psychological interventions. Psycho-Oncology, 8, 315-333. Sensky, T. (1997). Depression in renal failure and in its treatment. In M.M. Robertson & C.L.E. Katona (eds.), Depression and Physical Illness (pp. 359-375). Chichester: John Wiley & Sons. Shapiro, P.A., Glassman, A.H., Lespérance, F., O´Connor, C.M., Baker, B., Lidagoster, L., Jiang, W. & Dorian, P. (1996). Treatment of major depression after acute myocardial infarction with sertraline: a preliminary study. In Annual Meeting (APA), New Research Program and Abstracts (pp. 249-250). Washington DC: American Psychiatric Association. Smets, E.M.A., Garssen, B., Schuster-Uitterhoeve, A.L.J. & de Haes, J.C.J.M. (1993). Fatigue in cancer patients. British Journal of Cancer, 68, 220-224. Smoller, J. W., Pollack, M.H., Otto, M.W., Rosenbaum, J.F. & Kradin, R.L. (1996). Panic anxiety, dyspnoe, and respiratory disease. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 154, 6-17. Spiegel, D. (1996): Cancer and Depression. British Journal of Psychiatry, 168 (suppl. 30), 109-116. Spitzer, R.L. (1998). Diagnosis and need for treatment are not the same. Archives of General Psychiatry, 55, 120. Spitzer, R.L., Endicott, J. & Robins, E. (1978). Research diagnostic criteria. Archives of General Psychiatry, 35, 527-533. Spitzer, R.L., Kroenke, K., Linzer, M., Hahn, S.R., Williams, J.B.W., Verloin deGruy Ill, F., Brody, D. & Davies, M. (1995). Health-related quality of life in primary care patients with mental disorders. JAMA, 274 (19), 1511-1517. Spitzer, R.L., Kroenke, K., Williams, J.B.W. & the Patient Health Questionnaire Primary Care Study Group (1999). Validation and utility of a self-report version of Prime-MD. JAMA, 282 (18), 1737-1744. 106 Spitzer, R.L., Williams, J, Gibbons, M. & First, M.B. (1992). The Structured Clinical Interview for DSM-III-R (SCID): History, rationale, and description. Archives of General Psychiatry, 49, 624-629. Srole, L., Langner, T.S., Michael, S.T., Opler, M.K. & Rennie, T.A.C. (1962). Mental health in the metropolis: The Midtown Manhattan Study. New York: McGraw Hill. Stevens, D., Merikangas, K.R. & Merikangas, J.R. (1995). Comorbidity of depression and other medical conditions. In E. Beckham & W. Leber (eds.), Handbook of Depression (pp. 147199). New York: Guildford Press. Stieglitz, R.-D. (2000). Diagnostik und Klassifikation psychischer Störungen. Göttingen: Hogrefe. Stieglitz, R.-D., Baumann, U. & Freyberger, H.-J. (Hrsg.) (2001). Psychodiagnostik in Klinischer Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie. 2. Auflage. Stuttgart: Thieme. Stoudemire, A., Fogel, B.S., Gulley, L.R. & Moran, M.G. (1993). Psychopharmacology in the medical patient. In A. Stoudemire & B.S. Fogel (eds.), Psychiatric Care of the Medical Patient (pp. 155-206). New York: Oxford University Press. Sullivan, M.J.L., Reesor, K., Mikail, S. & Fisher, R. (1992). The treatment of depression in chronic low back pain: Review and recommendations. Pain, 50, 5-13 Thompson, W.L. & Thompson, T.L. (1993). Pulmonary disease. In A. Stoudemire & B.S. Fogel (eds.), Psychiatric Care of the Medical Patient (pp. 591-610). New York: Oxford University Press. Tsuang, M.T., Tohen, M. & Zahner, G.E.P. (1995). Textbook in Psychiatric Epidemiology. New York: Wiley-Liss. Üstün, T.B. & Sartorius, N. (eds.) (1995). Mental Illness in General Health Care. An International Study. Chichester: John Wiley & Sons. Üstün, T.B., Sartorius, N., Costa e Silva, J.A., Goldberg, D.A., Lecrubier, Y., Ormel, J., von Korff, M. & Wittchen, H.-U. (1995). Conclusions. In T.B. Üstün & N. Sartorius (eds.), Mental Illness in General Health Care. An International Study (pp. 371-375). Chichester: John Wiley & Sons. Van Houdenhove, B. & Onghena, P. (1997). Pain and Depression. In: M.M. Robertson & C.L.E. Katona (eds.), Depression and Physical Illness (pp. 465-497). Chichester: John Wiley & Sons. Van´t Spijker, A., Trusburg, R.W. & Duivenvoorden, H.J. (1997). Psychological sequelae of cancer diagnosis: A meta-analytical review of 58 studies after 1980. Psychosomatic Medicine, 59, 280-293. Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (Hrsg.) (1999). VDR Statistik Rehabilitation. Leistungen zur Rehabilitation und zusätzliche Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung im Jahre 1998. Frankfurt: Verband Deutscher Rentenversicherungsträger. Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (Hrsg.) (2000). VDR Statistik Rehabilitation. Leistungen zur Rehabilitation und zusätzliche Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung im Jahre 1999. Frankfurt: Verband Deutscher Rentenversicherungsträger. 107 Visser, M.R.M. & Smets, E.M.A. (1998). Fatigue, depression and quality of life in cancer patients: how are they related? Supportive Care in Cancer, 6, 101-108. Weis, J. & Bartsch, H. (Hrsg.) (2000). Fatigue bei Tumorpatienten. Eine neue Herausforderung für Therapie und Rehabilitation. Basel: Karger. Weis, J. & Koch, U. (1998). Betreuungsbedarf, Versorgungsstrukturen und Inanspruchnahmeprozesse - eine theoretische Einführung. In U. Koch & J. Weis (Hrsg.), Krankheitsbewältigung bei Krebs und Möglichkeiten der Unterstützung. Der Förderschwerpunkt "Rehabilitation von Krebskranken" (S. 175-182). Stuttgart, New York: Schattauer. Weißer, B. (2000). Psychische, soziale und körperliche Belastungen bei Patienten mit Erkrankungen des Haltungs-, Stütz- und Bewegungsapparates in der medizinischen Rehabilitation. Unveröffentlichte Diplomarbeit. Psychologisches Institut der Universität Freiburg. Weißer, B., Härter, M., Reuter, K. & Bengel, J. (im Druck). Risikofaktoren für komorbide psychische Störungen bei Patienten mit muskulo-skelettalen Erkrankungen – ein Review. Der Schmerz. Wells, K.B., Golding, J.M. & Burnam, M.A. (1988). Psychiatric disorder in a sample of the general population with and without chronic medical conditions, American Journal of Psychiatry, 145, 976-981. Weyerer, S. (1996). Psychiatrische Epidemiologie. In H. J. Freyberger & R. D. Stieglitz (Hrsg.), Kompendium der Psychiatrie und Psychotherapie. Begr. Von Th. Spoerri, 10. Auflage (S. 46-56). Basel: Karger. Wing, J., Cooper, J.E. & Sartorius, N. (1974). The Measurement and Classification of Psychiatric Symptoms. Cambridge: Cambridge University Press. Winokur, G. (1990). The concept of secondary depression and its relationship to comorbidity. Psychiatric Clinics of North America, 13, 567-583. Wittchen, H.-U. (2000a). Die Studie “Depression 2000”. Eine bundesweite DepressionsScreening-Studie in Allgemeinarztpraxen. Fortschritte der Medizin, 118 (suppl. I), 1-3. Wittchen H.-U. (2000b). Schlussbericht Zusatzsurvey „Psychische Störungen“ (Bundesgesundheitssurvey ´98): Häufigkeit, psychosoziale Beeinträchtigungen und Zusammenhänge mit körperlichen Erkrankungen. Bonn: Bundesministerium für Bildung und Forschung. Wittchen, H.-U. (2000c). Epidemiological research in mental disorders: lessons for the next decade of research - the NAPE Lecture 1999. Acta Psychiatrica Scandinavica, 101, 2-10. Wittchen, H.-U. (2000d). Bedarfsgerechte Versorgung psychischer Störungen. Abschätzungen aufgrund epidemiologischer, bevölkerungsbezogener Daten. Stellungnahme im Zusammenhang mit der Befragung von Fachgesellschaften durch den Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen. Unveröffentlichtes Manuskript. München: Max-PlanckInstitut für Psychiatrie. Wittchen, H.-U., Höfler, M. & Merikangas, K.R. (1999). Toward the identification of core psychopathological processes. Archives of General Psychiatry, 56, 929-931. Wittchen, H.-U., Höfler, M., Gander, F., Pfister, H., Storz, S., Üstün, B., Müller, N. & Kessler, R. (1999a). Screening for mental disorders: performance of the Composite International Diagnostic Screener (CID-S). International Journal of Methods in Psychiatric Research, 8, 59-70. 108 Wittchen, H.-U., Müller, N., Pfister, H., Winter, S. & Schmidtkunz, B. (1999b). Affektive, somatoforme und Angststörungen in Deutschland. Erste Ergebnisse des bundesweiten Zusatzsurveys "Psychische Störungen". Das Gesundheitswesen, 61, Sonderheft 2, S216-S222. Wittchen, H.-U., Robins, L.N., Cottler, L.B., Sartorius, N., Burke, J.D., Regier, D. and participants of the WHO/ADAMHA field trials (1991). Cross-cultural feasibility, reliability and sources of variance of the Composite International Diagnostic Interview (CIDI) - Results of the multicenter WHO/ADAMHA field trials (Wave I). British Journal of Psychiatry, 159, 645-653. Wittchen, H.-U., Unland, H. & Knäuper, B. (1994). Interview. In R.-D. Stieglitz & U. Baumann (Hrsg.), Psychodiagnostik psychischer Störungen (S. 107-125). Stuttgart: Enke. Wittchen, H.-U., Weigel, A. & Pfister, H. (1996a). DIA-X - Diagnostisches Expertensystem. Frankfurt: Swets Test Services. Wittchen, H.-U. & Perkonigg, A. (1996b). DIA-X - Diagnostisches Expertensystem, Teil II: DIA-X Fragebögen. Frankfurt: Swets Test Services. Woodruff, R.A., Murphy, G.E. & Herjanic, M. (1967). The natural history of affective disorders: 1. Symptoms of 72 patients at the time of index hospital admission. Journal of Psychiatric Research, 5, 255-263. World Health Organization (1992a). International classification of diseases (10th revision). Genf: World Health Organization. World Health Organization (1992b). Schedule for Clinical Assessment in Neuropsychiatry (SCAN). Genf: World Health Organization. World Health Organization (2000). ICIDH-2. International Classification of Functioning, Disability, and Health. Final Draft. Genf: World Health Organization. http://www.who.int/icidh. Zahner, G.E.P., Hsieh, C.-C. & Fleming, J.A. (1995). Introduction to epidemiologic research methods. In M.T. Tsuang, M. Tohen, M. & G.E.P. Zahner (eds.), Textbook in Psychiatric Epidemiology (pp. 23-53). New York: Wiley-Liss. Ziegelstein, R.C., Fauerbach, J.A., Stevens, S.S., Romanelli, J., Richter, D.P. & Bush, D.E. (2000). Patients with depression are less likely to follow recommendations to reduce cardiac risk during recovery from a myocardial infarction. Archives of Internal Medicine, 160, 1818-1823. Anschriften der Autoren und Projektmitarbeiter Priv.-Doz. Dr. med. Dr. phil. Martin Härter (Projektleitung) Dipl. Psych. Katrin Reuter (Projektkoordination) Dipl. Psych. Astrid Aschenbrenner Dipl. Psych. Beate Schretzmann Dipl. Psych. Bettina Weißer Dipl. Psych. Stephanie Stadelmann Universitätsklinikum für Psychiatrie und Psychosomatik Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie Hauptstr. 5, D-79104 Freiburg [email protected] Prof. Dr. med. Dr. phil. Jürgen Bengel (Projektleitung) Dipl. Psych. Alexandra Wunsch (Projektkoordination) Dipl. Psych. Manfred Rundel Institut für Psychologie Universität Freiburg Abteilung Rehabilitationspsychologie D-79106 Freiburg [email protected]