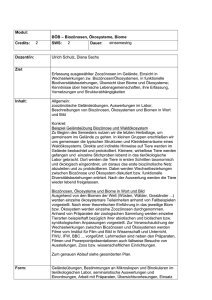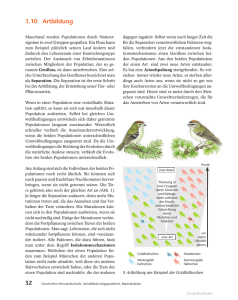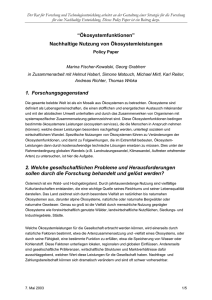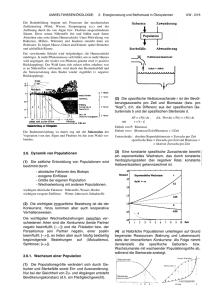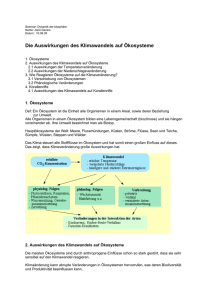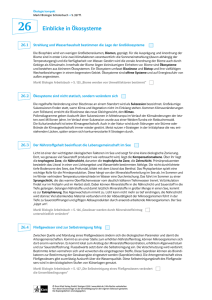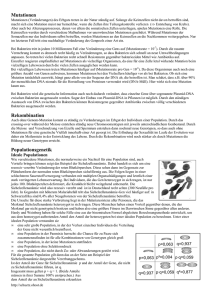Ökologie und Verhalten
Werbung
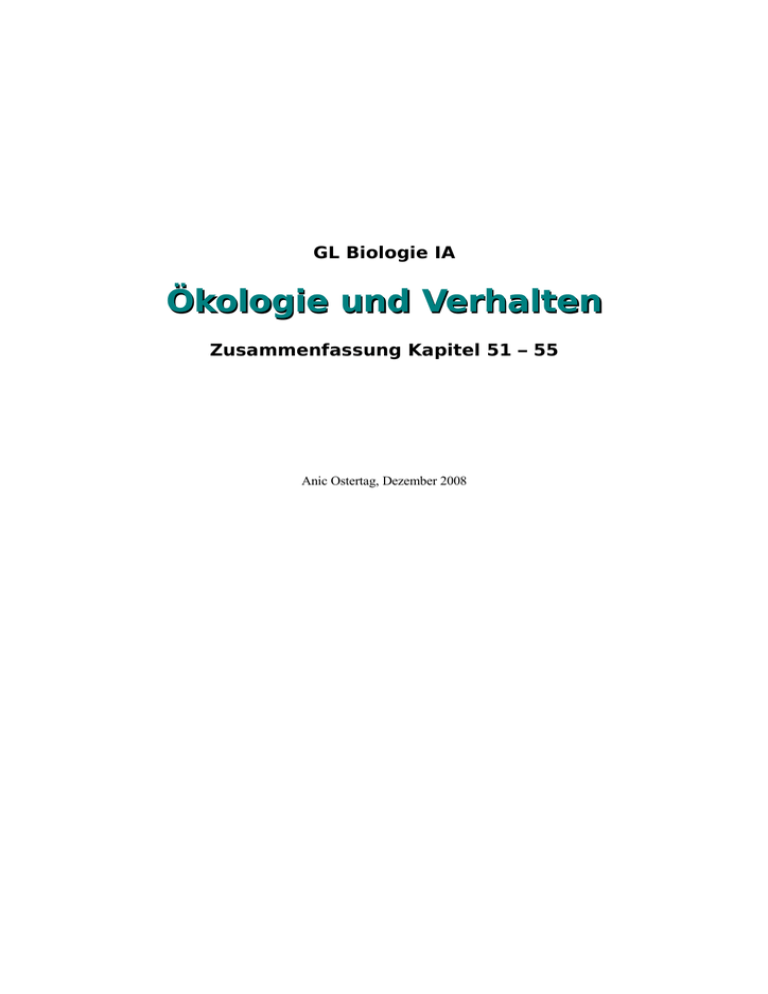
GL Biologie IA Ökologie und Verhalten Zusammenfassung Kapitel 51 – 55 Anic Ostertag, Dezember 2008 Inhaltsverzeichnis Kapitel 51 – Verhaltensbiologie....................................................4 Einführung in das Verhalten und die Verhaltensökologie..............................................................4 Verhalten ist, was ein Tier tut und wie es dies tut.................................................................................................................4 Jede Verhaltensweise hat sowohl ultimate (indirekte, mittelbare) als auch proximate (direkte, unmittelbare) Ursachen.....4 Verhalten resultiert aus genetischen und Umweltfaktoren...................................................................................................4 Angeborenes Verhalten ist durch die Entwicklung fixiert......................................................................................................4 Die klassische Ethologie deutete bereits eine evolutionsbiologische Komponente der Verhaltensbiologie an.....................4 In der Verhaltensökologie stehen evolutionsbiologische Hypothesen im Vordergrund.........................................................4 Steuerung des Verhaltens....................................................................................................................................................5 Lernen..................................................................................................................................................5 Lernen ist auf Erfahrung basierende Modifikation von Verhalten.........................................................................................5 Als Prägung (imprinting) bezeichnet man auf eine sensible Phase begrenztes Lernen.......................................................5 Der Vogelgesang kann als Modellsystem für die Entwicklung von Verhalten dienen...........................................................5 Viele Tiere können lernen, einen Reiz mit einem anderen zu assoziieren...........................................................................6 Das Sammeln praktischer Erfahrungen und Training könnten die ultimative Ursachen von Spielverhalten sein.................6 Kognitive Fähigkeiten von Tieren......................................................................................................6 Das Studium der Kognition verbindet die Funktionsweise des Nervensystems mit dem Verhalten......................................6 Zur Fortbewegung im Raum bedienen sich Tiere verschiedener kognitiver Mechanismen..................................................6 Die Erforschung des Bewusstseins stellt für Wissenschaftler eine immense Herausforderung dar.....................................7 Sozialverhalten und Soziobiologie....................................................................................................7 Die Soziobiologie untersucht Sozialverhalten im evolutionsbiologischen Kontext................................................................7 Beim konkurrierenden Sozialverhalten geht es oft um die Verteilung von Ressourcen........................................................7 Die natürliche Selektion begünstigt ein Paarungsverhalten, das die Zahl oder die Qualität der Geschlechtspartner maximiert.............................................................................................................................................................................8 Bei sozialen Interaktionen werden unterschiedliche Kommunikationsweisen eingesetzt.....................................................8 Die meisten altruistischen Verhaltensweisen lassen sich durch den Begriff der Gesamtfitness erklären.............................8 Die Soziobiologie verbindet die Evolutionstheorie mit der menschlichen Kultur...................................................................9 Kapitel 52 – Populationsökologie................................................10 Was Populationen kennzeichnet.....................................................................................................10 Zwei wichtige Merkmale jeder Population sind ihre Dichte (Abundanz) und die räumliche Verteilung (Dispersion) ihrer Mitglieder...........................................................................................................................................................................10 Demographie ist die Untersuchung der Faktoren, die Zu- und Abnahme der Populationsdichte beeinflussen..................10 Lebenszyklen.....................................................................................................................................11 Lebenszyklen sind äusserst divers, zeigen aber Muster in ihrer Variabilität.......................................................................11 Begrenzte Ressourcen erfordern Kompromisse zwischen Reproduktionsaufwand und Überleben...................................12 Populationswachstum......................................................................................................................12 Das exponentielle Wachstumsmodell beschreibt eine idealisierte Population in einem unbegrenzten Lebensraum..........12 Das logistische Modell des Populationswachstums berücksichtigt das Konzept der Umweltkapazität..............................13 Beschränkung des Populationswachstums...................................................................................14 Negative Rückkoppelung verhindert ein unbeschränktes Populationswachstum...............................................................14 Die Dynamik von Populationen spiegelt die komplexe Wechselwirkungen zwischen biotischen und abiotischen Einflüssen wider..................................................................................................................................................................................14 Einige Populationen zeigen regelmässige Boom-and-Burst-Zyklen...................................................................................14 Das menschliche Bevölkerungswachstum....................................................................................15 Auch das 300jährige fast exponentielle Wachstum der Menschheit hat seine Grenzen....................................................15 Es ist schwierig, die Umweltkapazität unserer Erde abzuschätzen....................................................................................15 Kapitel 53 – Ökologie der Biozönosen.........................................17 Was ist eine Biozönose?..................................................................................................................17 Die individualistische und die interaktive Hypothese betrachten Biozönosen aus gegensätzlichen Blickwinkeln (Phytozönosen, 1920-30er Jahre)......................................................................................................................................17 Die kontroverse Debatte wird durch das Nieten-Modell und das Redundanz-Modell fortgesetzt.......................................17 Einzelne Populationen können durch Konkurrenz, Prädation, Symbiose und Karpose miteinander verknüpft sein...........18 Die trophische Struktur ist ein Schlüsselfaktor für die Dynamik von Biozönosen...............................................................20 Dominante Arten und Schlüsselarten kontrollieren massgeblich die Struktur von Biozönosen..........................................21 2/41 Biozönotische Strukturen können durch Nährstoffe bottom-up oder durch Räuber top-down kontrolliert sein...................21 Störungen und die Struktur von Lebensgemeinschaften.............................................................21 Die meisten Biozönosen sind aufgrund von Störungen im Ungleichgewicht......................................................................21 Menschen sind die häufigsten Störfaktoren.......................................................................................................................22 Ökologische Sukzession ist die Abfolge biozönotischer Veränderungen nach einer Störung............................................22 Der Einfluss biogeographischer Faktoren auf die Diversität von Lebensgemeinschaften......23 Biodiversität umfasst nicht nur die Anzahl der Arten in einer Gemeinschaft, sonder auch deren relative Abundanzen......23 Der Artenreichtum nimmt prinzipiell vom Äquator zu den Polen ab....................................................................................23 Der Artenreichtum korreliert mit der geographischen Ausdehnung der Lebensgemeinschaft............................................23 Artenreichtum auf Inseln hängt von ihrer Grösse und von der Entfernung zum Festland ab.............................................24 Kapitel 54 – Ökosysteme...........................................................26 Das Ökosystem-Konzept in der Ökologie......................................................................................26 Der Weg des Energieflusses und die Art der Stoffkreisläufe in einem Ökosystem hängen von dessen Trophiestruktur ab ...........................................................................................................................................................................................26 Das Destruentensystem verbindet alle trophischen Ebenen..............................................................................................27 Ökosysteme gehorchen den thermodynamischen Grundgesetzen....................................................................................27 Die Primärproduktion in Ökosystemen..........................................................................................27 Der Energiehaushalt eines Ökosystems ist von der Primärproduktion abhängig...............................................................27 In aquatischen Ökosystemen wird die Primärproduktion durch Licht und Nährstoffe limitiert.............................................28 Für die Primärproduktion in terrestrischen Ökosystemen sind Temperatur, Feuchtigkeit und Nährstoffe die limitierenden Faktoren.............................................................................................................................................................................28 Die Sekundärproduktion in Ökosystemen.....................................................................................28 Die Effizienz des Energietransfers von einer Trophiestufe zur nächsten liegt in der Regel unter 20%...............................28 Herbivoren konsumieren nur einen geringen Teil der Primärproduktion: Die „Grüne-Welt-Hypothese“..............................30 Der Kreislauf chemischer Elemente in Ökosystemen...................................................................30 Biologische und geologische Prozesse verschieben die Nährstoffe zwischen organischen und anorganischen Reservoiren........................................................................................................................................................................31 Die Geschwindigkeit von Nährstoffkreisläufen wird vor allem durch die Zersetzungsrate bestimmt..................................36 Nährstoffkreisläufe werden stark durch die Vegetation beeinflusst....................................................................................36 Anthropogene Beeinflussung von Ökosystemen und der Biosphäre........................................36 Der Mensch greift in der gesamten Biosphäre in Stoffkreisläufe ein..................................................................................36 Die Verbrennung fossiler Energieträger ist die Hauptursache des sauren Regens............................................................37 Giftstoffe reichern sich in aufeinander folgenden Trophiestufen der Nahrungsnetze an....................................................37 Der anthropogen verursachte Anstieg der atmosphärischen CO2-Konzentration kann zu globalen Klimaveränderungen führen.................................................................................................................................................................................38 Die Zerstörung der Ozonschicht durch den Menschen hat weit reichende Konsequenzen................................................38 Kapitel 55 – Naturschutzbiologie................................................40 Die Biodiversitätskrise.....................................................................................................................40 Die drei Ebenen der Biodiversität bilden die genetische Variabilität, der Artenreichtum und die Ökosystemvielfalt...........40 Auf allen drei Ebenen ist Biodiversität wichtig für das Wohlergehen des Menschen..........................................................40 Die vier grössten Bedrohungen für die Biodiversität sind die Zerstörung von Lebensräumen, eingeführte Arten, die Übernutzung und die Unterbrechung von Nahrungsketten................................................................................................40 Naturschutz auf Populations- und Artenebene..............................................................................41 Schutzstrategie für kleine Populationen: Geringe Grösse kann eine Population in einen Aussterbestrudel ziehen...........41 Schutzstrategien für zurückgehende Populationen: den Rückgang von Populationen feststellen, die Ursachen dafür herausfinden und ihn aufhalten..........................................................................................................................................42 Beim Artenschutz sind widersprüchliche Bedürfnisse gegeneinander abzuwägen............................................................42 Naturschutz auf der Ebene von Lebensgemeinschaften, Ökosystemen und Landschaften....43 Saumbiotope und Biotopkorridore können sich enorm auf die biologische Vielfalt einer Landschaft auswirken................43 Naturschutzbiologen müssen bei der Einrichtung von Schutzgebieten viele Probleme lösen............................................43 Naturreservate müssen funktionelle Bestandteile von Landschaften sein..........................................................................44 Die Restauration geschädigter Gebiete wird im Naturschutz zu einer immer wichtigeren Aufgabe....................................44 Das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung ist eine Neuorientierung ökologischer Forschung und eine Herausforderung an uns alle, unsere Wertvorstellungen zu überdenken...........................................................................................................45 Die Zukunft der Biosphäre könnte von unserer Biophilie abhängen, der Liebe zur Natur..................................................45 Quellen....................................................................................45 3/41 Kapitel 51 – Verhaltensbiologie Kapitel 51 – Verhaltensbiologie Einführung in das Verhalten und die Verhaltensökologie Verhalten ist, was ein Tier tut und wie es dies tut Jede Verhaltensweise hat sowohl ultimate (indirekte, mittelbare) als auch proximate (direkte, unmittelbare) Ursachen • proximative Fragen betreffen Aussenreize, die ein bestimmtes Verhalten auslösen • ultimative Ursachen beziehen sich auf die evolutionäre Bedeutung eines Verhaltens Verhalten resultiert aus genetischen und Umweltfaktoren Der Phänotyp hängt somit sowohl von den Genen als auch von der Umwelt ab Bsp. Erdbeerköpfchen und Tragen des Nistmaterials. Art 1 (E): lange Streifen, kein Einstecken Art 2 (R): kurze Streifen, Einstecken E x R Kreuzung = Hybrid mittlere Streifen erfolgloses Einstecken in 1. Saison E x R Kreuzung = Hybrid später: kein Einsteck-Versuch mehr, nur noch Wenden des Kopfes Angeborenes Verhalten ist durch die Entwicklung fixiert Als entscheidendes Merkmal angeborenen Verhaltens (innate behavior) scheint sich dieses von Individuum zu Individuum nicht zu ändern, trotz des Spektrums an Umweltunterschieden. Die klassische Ethologie deutete bereits eine evolutionsbiologische Komponente der Verhaltensbiologie an In der Verhaltensökologie stehen evolutionsbiologische Hypothesen im Vordergrund 4/41 Kapitel 51 – Verhaltensbiologie Das Gesangsrepetoire von Singvögeln: Bsp. Rohrammern: grosse Repertoires ermöglichen frühere Gelege. Frühere Gelege sind erfolgreicher. Kosten-Nutzen-Analysen des Ernährungsverhalten: Der Hypothese des optimalen Nahrungserwerbs (optimal foraging) zufolge ist das mit dem Nahrungserwerb in Zusammenhang stehende Verhalten ein Kompromiss zwischen den Kosten und dem Nutzen der Ernährung.) Steuerung des Verhaltens Schlüsselreiz AAM (= angeborener auslösender Mechanismus) Verhalten ( selektiver Vorteil = Konsequenz für Überleben und Reproduktion AAM) Bsp. Stichling: Territorialverhalten; Graugänse: Einrollen eines Eis bzw. allem was ähnlich ist z.B. Tennisball; Brutparasiten (Kuckucke) nutzen Schlüsselreize aus Lernen Lernen ist auf Erfahrung basierende Modifikation von Verhalten • Lernen: Modifikationen des Verhaltens, die sich aufgrund bestimmter Erfahrungen ergeben. Bsp für „Plastizität“, d.h. gleicher Genotyp ändert Expression. • Reifung: Verhaltensweisen, die sich aufgrund entwicklungsbedingter Veränderungen in neuromuskulären Systemen vervollkommnen Lernen. Passiert unabhängig von „Erfahrung“. • Habituation: das Abgewöhnen angeborener Reaktionen auf Reize (sehr einfache Form des Lernens) Als Prägung (imprinting) bezeichnet man auf eine sensible Phase begrenztes Lernen • eine Form des Lernens, die auf einen bestimmten Zeitabschnitt im Leben des Tieres begrenzt und in der Regel irreversibel ist • nicht nur auf junge Tiere begrenzt • Konrad Lorenz: Graugänse 5/41 Kapitel 51 – Verhaltensbiologie Der Vogelgesang kann als Modellsystem für die Entwicklung von Verhalten dienen Viele Tiere können lernen, einen Reiz mit einem anderen zu assoziieren • Assoziatives Lernen: die Fähigkeit vieler Tiere zu lernen, einen bestimmten Reiz mit einem anderen zu assoziieren • Klassische Konditionierung (Pawlow, 1900, Hunde): Tiere lernen, einen willkürlichen Reiz mit einer Belohnung oder Bestrafung in Verbindung zu bringen • Operante Konditionierung („Skinner-Box“, 1930er): „Lernen durch Versuch und Irrtum“. Dabei lernt ein Tier, eine seiner Verhaltensweisen mit einer Belohnung oder einer Strafe zu assoziieren, und neigt dann dazu, dieses Verhalten zu wiederholen bzw. zu vermeiden. Das Sammeln praktischer Erfahrungen und Training könnten die ultimative Ursachen von Spielverhalten sein Spielen (Exploratives Lernen), hat keinen erkennbaren äusseren Zweck, beinhaltet aber Bewegungen, die eng mit zweckmässigem Verhalten assoziiert sind. Kognitive Fähigkeiten von Tieren Das Studium der Kognition verbindet die Funktionsweise des Nervensystems mit dem Verhalten • Kognition (im engeren Sinn) = Bewusstsein / Bewusstheit • Kognition (im weiteren Sinn) = Fähigkeit des NS eines Tieres, von sensorischen Rezeptoren gesammelte Informationen wahrzunehmen, zu speichern, zu verarbeiten und zu nutzen Bewusstsein: Erkennen (cognition) Bewusstsein (awarness, consciousness) Fähigkeit des Nervensystems: •Infos aufzunehmen •Infos zu verarbeiten •Infos zu verwenden •Benötigt eine interne Repräsentation der Umwelt •„sich-selbst Bewusstsein“ (das Ich) 6/41 Kapitel 51 – Verhaltensbiologie Zur Fortbewegung im Raum bedienen sich Tiere verschiedener kognitiver Mechanismen Kinese: einfache Änderung der Aktivitäts- oder Umsatzrate als Reaktion auf einen Reiz Taxis: eine mehr oder weniger automatisch ablaufende Bewegung auf einen Reiz zu (positive Taxis) oder von ihm weg (negative Taxis) Orientierung an Landmarken in vertrauter Umgebung: komplexerer kognitiver Mechanismus (z.B. Grabwespe, Honigbiene) Kognitive Karten: innerer Atlas; innere Repräsentation oder Verschlüsselung der räumlichen Beziehungen zwischen Objekten in der Umgebung eines Tieres Migrationsverhalten: Zugverhalten; regelmässige Wanderungen von Tieren über relativ weite Entfernungen. Charakteristisch: jedes Jahr hin und her ziehen zwischen zwei Gebieten. z.B. Vögel, Wale, einige Schmetterlingsarten, bestimmte Fische • Pilotieren: ein Tier wandert von einer vertrauten Landmarke zur nächsten, bis es sein Ziel erreicht. Hauptsächlich für kurze Entfernungen verwendet. • Kompassorientierung: ein Tier kann Himmelsrichtungen wahrnehmen und bewegt sich über eine bestimmte Entfernung, oder bis es sein Ziel erreicht, geradlinig in einer bestimmten Richtung • Navigation: ein Tier bestimmt zusätzlich zur Wahrnehmung der Himmelsrichtung den eigenen Standort relativ zu anderen Orten Die Erforschung des Bewusstseins stellt für Wissenschaftler eine immense Herausforderung dar Evolution des Bewusstseins Ökologische Hypothese: • Repräsentation von Nahrungsquellen • in kompetitiver Umwelt ein Vorteil • führt zu Repräsentation des Ichs in der Umwelt Soziale Hypothese: • Stellung innerhalb sozialer Gruppe • Kennen der Strategien der Anderen • Repräsentation des Ichs im strategischen Umfeld (Spieltheorie) Sozialverhalten und Soziobiologie Die Soziobiologie untersucht Sozialverhalten im evolutionsbiologischen Kontext Sozialverhalten (im weitesten Sinn): jede Art von Interaktion zwischen zwei oder mehr – in der Regel artgleichen – Tieren. Aggression, Balzverhalten, Kooperation, Täuschung... Soziobiologie: die Evolutionstheorie dient als Grundlage für die Erforschung und Interpretation von Sozialverhalten. Beim konkurrierenden Sozialverhalten geht es oft um die Verteilung von Ressourcen Agonistisches Verhalten: „kämpferisch“; ein Wettstreit, bei dem sowohl Droh- als auch Demutverhalten eine Rolle spielt, entscheidet, welches von zwei konkurrierenden (kompetitiven) Individuen Zugang zu einer Ressource erhält. Ein Grossteil dieses Verhaltens ist ritualisiert, d.h. es besteht aus symbolischen Handlungen, sodass die Gegner keine ernsthaften Verletzungen davontragen. Bei Tieren, die in recht dauerhaften So- 7/41 Kapitel 51 – Verhaltensbiologie zialgruppen leben, kommt es häufig zu Konflikten, bei denen es keine eindeutigen Gewinner und Verlierer gibt. In diesem Fall erfolgt i.d.R. nach dem Konflikt eine Art Schlichtungsverhalten oder Beschwichtigung zwischen den Kontrahenten. Territorialität: Ein Territorium oder Revier ist ein Gebiet, das von einem Individuum verteidigt wird, und zwar i.d.R. nur gegen Artgenossen. Normalerweise sind sie ortsfest. Viele Arten, die nur während der Fortpflanzungszeit territorial sind, bilden ausserhalb dieses Zeitraums soziale Gruppen. Territorien werden durch agonistisches Verhalten besetzt und verteidigt. Rangordnungen und Territorialität wirken stabilisierend auf die Populationsdichte. Hierarchie im Sozialverhalten: Solitär lebende Organismen – Aggregation/Schwarm – Einfache Sozialität – Eusozialität – Physisch verschmolzen Die natürliche Selektion begünstigt ein Paarungsverhalten, das die Zahl oder die Qualität der Geschlechtspartner maximiert Balzverhalten: setzt sich aus einer Reihe von Verhaltensmustern zusammen, die letztendlich zur Kopulation führen (oder bei Arten mit äusserer Befruchtung zur Freisetzung von Keimzellen) • Elternaufwand: die Zeit und die Ressourcen, die ein Individuum aufbringen muss, um Nachkommen zu produzieren und aufzuziehen. • Der Fortpflanzungserfolg eines Männchens ist oft proportional zur Anzahl seiner Partnerinnen. → Konkurrenz • Der Fortpflanzungserfolg von Weibchen dagegen hängt oft mehr von der Lebensfähigkeit der begrenzten Zahl von Nachkommen ab, die es produzieren kann. • Mit dieser auf dem Elternaufwand basierenden Unterscheidung zwischen der Konkurrenz unter den Männchen und der Partnerwahl der Weibchen lassen sich viele der Unterschiede morphologischer Art oder im Balzverhalten zwischen Männchen und Weibchen erklären. • Balz ist ein Evolutionsprodukt der sexuellen Selektion. Paarungssysteme: promiskuitiv, monogam, polygam, polygyn (1 ♂, mehrere ♀), polyandrin (1 ♀, mehrere ♂). Die Bedürfnisse der Jungen sind ein wichtiger ultimater Faktor für die Evolution der Paarungssysteme. Ein weiterer Faktor ist die „Gewissheit“ über die Vaterschaft. Bei sozialen Interaktionen werden unterschiedliche Kommunikationsweisen eingesetzt Definition tierischer Signale und Kommunikationsweisen: • Signal: Verhalten, das bei einem anderen Tier eine Verhaltensänderung auslöst. • Kommunikation: Das Aussenden und Empfangen von Signalen und die Reaktion auf diese Signale. Pheromone: chemische Signale. Besonders unter Säugern und Insekten verbreiten und spielen oft im Zusammenhang mit der Fortpflanzung eine Rolle. Die Tanzsprache der Honigbienen (Rundtanz, Schwänzeltanz) Die meisten altruistischen Verhaltensweisen lassen sich durch den Begriff der Gesamtfitness erklären Egoistisches Verhalten: Die Selektion begünstigt Verhalten, das den individuellen Fortpflanzungserfolg maximiert, unabhängig davon, wie sehr dieses Verhalten anderen Artgenossen, einer Population oder sogar der ganzen Art schadet. Altruismus: Verhaltensweisen, die die individuelle Fitness senken und die Fitness des Nutzniessers dieses Verhaltens steigern 8/41 Kapitel 51 – Verhaltensbiologie Gesamtfitness: (inclusive fitness); Gesamteffekt, den ein Individuum auf die Vermehrung seiner Gene erzielt (eigene Nachkommen + Nachkommen von Verwandten) Hamilton-Regel: die natürliche Selektion begünstigt Altruismus, wenn rB > C B: benefit für den Begünstigten; Ø Anz. Zusätzlicher Nachkommen des Begünstigten C: cost für den Altruisten; Anz. Nachkommen, die der Altruist weniger produziert r: Verwandtschaftskoeffizient; Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Gen von einem gemeinsamen Elter oder Vorfahren auch an ein zweites Individuum vererbt worden ist. Wird mit erblicher Distanz schwächer. Geschwister: 0.5 (½), Tante und Nichte: 0.25 (¼), zw. Cousins 1. Grades: 0.125 (1/8). Honigbiene Säugetier Verwandtschaftsselektion = spezielle Form der natürlichen Selektion. Reziproker Altruismus: Altruismus, nicht auf Grund von Verwandtschaft, sonder wegen Hilfe auf Gegenseitigkeit. D.h. der Empfänger der Hilfe revanchiert sich später. Die Soziobiologie verbindet die Evolutionstheorie mit der menschlichen Kultur Wichtigste Annahme der Soziobiologie: dass bestimmte Verhaltensmerkmale existieren, weil sie der Ausdruck von Genen sind, die durch die natürliche Auslese erhalten blieben. 9/41 Kapitel 52 – Populationsökologie Kapitel 52 – Populationsökologie Was Populationen kennzeichnet Biologische Hierarchie: DNA – Gen – Zelle – Individuum – Population – Lebensgemeinschaft – Ökosystem - Biosphäre Population = Gruppe von Individuen einer Art, die einen gemeinsamen Lebensraum bewohnen Eigenschaften von Populationen: Dichte, Grösse, Verteilung, Altersstruktur, Geschlechtsverhältnis Zwei wichtige Merkmale jeder Population sind ihre Dichte (Abundanz) und die räumliche Verteilung (Dispersion) ihrer Mitglieder Populationsdichte: Individuenzahl pro Flächen- oder Raumeinheit Messen der Populationsdichte: alle Individuen zählen; zählen einiger repräsentativer Standorte und hoch rechnen; zählen der Nistplätze oder Baue; aufgrund Kotspuren oder Fährten Fang-und-Wiederfang-Methode: Anzahl der markierten Wiederfänge Anz.markierter Tiere 1. Fang = Gesamtzahl Tiere 2. Fang Gesamtpopulation N → N= Anzahl markierter Tiere1. Fang x Gesamtzahl der Tiere 2. Fang Anzahl der markiertenWiederfänge Verteilung: räumliches Mustern in dem die Individuen innerhalb ihres Verbreitungsgebietes vorkommen Verteilungsmuster: • kumulierte (aggregierte, geklumpte): Individuen häufen sich an bestimmten Stellen lokal an, z.B. Herden, Schwärme, Pilze auf einem Baumstumpf. Am häufigsten. zB. Schwarmbildung bei Schmetterlingsfischen • uniform (äqual, homogen): direkte Wechselbeziehungen zwischen einzelnen Populationsmitgliedern, z.B. Beschattung und Konkurrenz um Wasser und Nährstoffe bei Pflanzen zB. Pinguine beim Brüten • zufällig (inäqual): wenn zwischen den einzelnen Individuen einer Population weder starke positive noch negative Wechselbeziehungen herrschen: Die räumliche Position eines einzelnen Organismus ist somit unabhängig von anderen. In der Natur selten. zB. Bäume im Tropischen Regenwald Demographie ist die Untersuchung der Faktoren, die Zu- und Abnahme der Populationsdichte beeinflussen Demographie: Analyse von Bevölkerungsstatistiken und ihre Bedeutung für die Populationsgrösse Zunahme: Fertilität (Fruchtbarkeit), Immigration (Zuwanderung) Abnahme: Mortalität (Sterblichkeit), Emigration (Abwanderung) Lebenstafeln: eine nach Altersgruppen geordnete Aufstellung des Überlebensmusters einer Population. 10/41 Kapitel 52 – Populationsökologie Konstruktion: Indem man das Schicksal einer Kohorte (Gruppe gleichaltriger Individuen) von der Geburt bis zum Tod aller Mitglieder verfolgt und die Anzahl der Sterbefälle, die in einer bestimmten Altersstufe während eines definierten Zeitraums auftreten, tabellarisch auflistet. Überlebenskurven: graphische Darstellung der Organismenzahl, die in einem bestimmten Alter noch am Leben ist. Viele Arten liegen in ihrer Überlebenswahrscheinlichkeit irgendwo zwischen den drei grundsätzlichen Kurventypen oder zeigen komplexere Muster.: Konvexe Kurven = Typ I, z.B. Menschen; grosse Säugetiere mit guter Brutpflege Geraden = Typ II, z.B. annuelle Pflanzen, verschiedene Invertebraten (z.B. Hydra), einige Eidechsenarten und Nager Konkave Kurven = Typ III, z.B. marine Invertebraten; Organismen, die eine grosse Nachkommenschaft hervorbringen, aber keine oder nur geringe Brutpflege leisten Reproduktionsraten: i.d.R. konzentriert man sich nur auf die Weibchen, da nur sie den Nachwuchs hervorbringen. Reproduktionstafel (Fekunditätstabelle): gibt die Reproduktionsraten einer Population in Abhängigkeit des Alters wider und wird am besten dadurch erstellt, dass man den Fortpflanzungserfolg einer Kohorte von der Geburt bis zum Tod verfolgt. Reproduktionsleistung sexueller Arten: (Anteil sich fortpflanzender ♀ einer bestimmten Altersgruppe) x (Anz. ♀ Nachkommen) Lebenszyklen Die natürliche Selektion begünstigt Merkmale, welche die Überlebenswahrscheinlichkeit und die Reproduktionserfolg verbessern. Auch der Lebenszyklus ist ein Produkt der natürlichen Selektion. Lebenszyklen sind äusserst divers, zeigen aber Muster in ihrer Variabilität Durch den unterschiedlichen Druck der natürlichen Selektion gestalten sich Lebenszyklen sehr heterogen. Kritischer Faktor: Überlebensrate der Nachkommenschaft. Semelparitie, Big-Bang-Reproduktion: in einem einmaligen Reproduktionsereignis produzieren sie Tausende von winzigen Eiern, um danach zu sterben z.B. Lachs, Agave, einjährige Wüstenblumen Iteroparitie: mehrmalige Reproduktion Begrenzte Ressourcen erfordern Kompromisse zwischen Reproduktionsaufwand und Überleben Die Lebenszyklen, die wir in der Natur beobachten, stellen immer Kompromisslösungen dar. Ganz allgemein besteht immer ein Konflikt zwischen Fortpflanzung einerseits und Überleben andererseits. Viele Lebenszyklen sind dadurch geprägt, dass der Nutzen, der aus einer gegenwärtigen Investition in die Nachkommenschaft resultiert, gegen den Aufwand abgewogen wird, der für Überleben und zukünftige Reproduktionsaussichten getrieben werden muss. Grundlegende Entscheidungen: 11/41 Kapitel 52 – Populationsökologie • Was soll mit der Reproduktion begonnen werden? • Wie oft soll sich ein Organismus fortpflanzen? • Wie viele Nachkommen sollen pro Reproduktionsphase erzeugt werden? • Lebenszyklus-Merkmale sind Produkte der Evolution, die sich in Entwicklung, Physiologie und Verhalten eines Lebewesens manifestieren. Populationswachstum Generationszeit: die durchschnittliche Zeitdauer zwischen der Geburt eines Lebewesens und der Geburt seiner Nachkommen. Meist korreliert die Generationszeit mit der Körpergrösse. Das exponentielle Wachstumsmodell beschreibt eine idealisierte Population in einem unbegrenzten Lebensraum N = B− D (N = Bevölkerungszahl, B = Geburtenzahl abs., D = Todesfälle abs.) t B=bN (b = rel. Geburtenzahl d.h. Geburtenzahl pro Kopf) D =dN (d = rel. Sterberate) r=b−d (r = individuelle oder rel. Netto-Wachstumsrate; r > 0 zunehmende Abundanz, r < 0 abnehmende Abundanz, r = 0 Nullwachstum) N =bN −dN t → dN =rN dt Exponentielles Populationswachstum: = Veränderung der Populationsgrösse dN =r max N dt Ein J-förmiges exponentielles Wachstum ist charakteristisch für Populationen, die einen Lebensraum neu besiedeln oder sich nach einer drastischen Grössenabnahme, z.B. Katastrophenereignis, wieder erholen. Das logistische Modell des Populationswachstums berücksichtigt das Konzept der Umweltkapazität Umweltkapazität K („ökologisches Fassungsvermögen“): maximale Populationsgrösse, die ein gegebener Lebensraum zu einem bestimmten Zeitpunkt ohne Zerstörung des Habitats unterhalten kann. K ist nicht starr festgelegt, sonder variiert sowohl räumlich als auch zeitlich mit der Menge an verfügbaren Ressourcen. Logistische Wachstumsgleichung: dN K −N =r max N dt K (aktuelle Wachstumsrate wird mit zunehmendem N red., S-förmige Kurve) 12/41 Kapitel 52 – Populationsökologie K − N : wie viele weitere Individuen für die Umwelt noch tragbar sind K− N : welcher Anteil von K noch für das Populationswachstum zur Verfügung steht K • N > K: K− N klein → Wachstumsrate klein K • N < K: K− N hoch → Wachstumsrate nahe bei potenziellen (max.) Zuwachsrate K • N = K: Nullwachstum (Geburten = Todesfälle) Das logistische Modell sagt unterschiedliche Wachstumsraten für hohe und niedrige Abundanzen (Populationsdichten) in Abhängigkeit von der Kapazität des Lebensraums voraus. Die meisten Populationen zeigen Abweichungen vom glatten sigmoiden Kurvenverlauf; und obwohl das Wachstum vieler natürlichen Populationen annähernd dem logistischen Modell entspricht, wird ein stabiles Kapazitätsplateau nur selten beobachtet. Einige der Grundannahmen, auf die das logistische Modell aufgebaut ist, treffen eindeutig nicht auf alle Populationen zu. Zum Beispiel übt nach dem Modell auch bei niedriger Abundanz jedes weitere Individuum den gleichen negativen Effekt auf das Populationswachstum aus. Manche Populationen zeigen jedoch einen „Allee-Effekt“, demzufolge sich das Unterschreiten einer bestimmten Mindestgrösse negativ auf das Überlegen und die Reproduktion der Mitglieder auswirken kann. Es geht auch von den Voraussetzungen aus, dass sich Populationen sofort anpassen und sich dem Kapazitätsplateau gleichmässig nähern. In den meisten Fällen wirken sich jedoch die negativen Dichteeffekte erst mit einer zeitlichen Verzögerung aus. Insgesamt ist das logistische Modell jedoch eine wertvolle Basis für unser Verständnis vom Wachstum einer Population und auch für die Entwicklung komplexerer Vorstellungen. Die unterschiedlichen Bedingungen fördern unterschiedlich geartete Lebenszyklen. Und die von der Natur selektierten Lebenszykluseigenschaften variieren je nach Populationsdichte und Umweltbedingungen. K-Selektion: dichteabhängige Selektion; Selektion von Eigenschaften, die empfindlich auf die Dichte einer Population reagieren. Tendiert zu maximalen Populationsgrössen und trifft auf Populationen zu, deren Dichte sich der durch die verfügbaren Ressourcen festgelegten K nähert. r-Selektion: dichteunabhängige Selektion; Föderung von Merkmalen, die einen max. Reproduktionserfolg in einer nicht überfüllten Umgebung gewährleisten. Fördert eine maximale Zuwachsrate rmax und ist charakteristisch für eine variable Umwelt, in der die Populationsdichten weit unterhalb des Kapazitätsniveaus stark schwanken, oder für offene Habitate, wo Einzelorganismen nur wenig Konkurrenz erfahren. K-Strategen: geringe Vermehrungsraten, hohe Investition in die Nachkommen r-Strategen: hohe Vermehrungsraten, geringe Investition in die Nachkommen In Laborexperimenten konnte gezeigt werden, dass unterschiedliche Populationen ein- und derselben Art, je nach Bedingungen, voneinander abweichende Anteile an K- und r-selektierten Merkmalen aufweisen können. 13/41 Kapitel 52 – Populationsökologie Beschränkung des Populationswachstums Dichteabhängige Raten sind Beispiele für negative Rückkoppelung (negative Feedback) Negative Rückkoppelung verhindert ein unbeschränktes Populationswachstum Keine Population stellt ihr Wachstum ein ohne eine gewisse negative Rückkoppelung zwischen der Populationsdichte und den Geburten- bzw. Sterberaten. • Ressourcenknappheit kann in zu dichten Populationen das Wachstum durch Einschränkungen der Reproduktion begrenzen. z.B. Reduzierte Samenproduktion bei gedrängt stehenden Pflanzen; Territorialität bei Vögeln (Brutplätze) • Die Populationsdichte wirkt sich auch auf die Gesundheit und damit auf die Überlebensfähigkeit von Organismen aus. • Räuber (Prädatoren) können eine wichtige Ursache für eine dichteabhängige Mortalitätsrate darstellen. • Die Anhäufung von Schadstoffen kann die Populationsgrösse in einer dichteabhängige Weise regulieren. z.B. Vergiftung durch Stoffwechselprodukte (Bakterien) • Die Auswirkungen einer Krankheit können dichteabhängige sein, wenn ihre Übertragungshäufigkeit von einer kritischen Populationsgrösse abhängt. z.B. Tuberkulose • Bei einigen Tierarten scheinen eher endogene Faktoren die Populationsgrösse zu regulieren. z.B. Mäuse, Waldmurmeltier, andere Nagetiere (Stress durch zu hohe Dichten → hormonelle Veränderungen) Die Dynamik von Populationen spiegelt die komplexe Wechselwirkungen zwischen biotischen und abiotischen Einflüssen wider • Für jede Spezies gibt es gute und schlechte Habitate, und die Umweltkapazität kann von Ort zu Ort unterschiedlich sein. • Die Umweltkapazität kann auch zeitlich variieren. • Langfristig verändern sich die meisten Populationen. Am interessantesten sind die Veränderungen von Jahr zu Jahr oder von Ort zu Ort und ihre Gründe dafür. • Einige Populationen zeigen extreme (chaotische) Schwankungen in ihrer Dichte. z.B. Kalifornischer Taschenkrebs Einige Populationen zeigen regelmässige Boom-and-Burst-Zyklen Bei einigen Insekten-, Vogel-, und Säugerpopulationen fluktuiert dich Dichte mit einer erstaunlichen Regelmässigkeit, die sich durch Zufallsereignisse nicht erklären lässt. z.B. 10-Jahreszyklen von Schneeschuhhase und Luchs in den nördliche Wäldern Kanadas und Alaskas Überbevölkerung und der dadurch bedingte Stress könnten den Populationszyklen vieler Tierarten zugrunde liegen. Populationszyklen sind auch das Ergebnis einer verzögerten Reaktion der Räuber auf eine Veränderung in der Anzahl der Beutetiere. Räuber reproduzieren sich langsamer als ihre Opfer. Lotka-Volterra Modell: 14/41 Kapitel 52 – Populationsökologie Das menschliche Bevölkerungswachstum Auch das 300jährige fast exponentielle Wachstum der Menschheit hat seine Grenzen Die demographische Transition Nullwachstum = hohe Geburtenrate – hohe Sterberate oder Nullwachstum = niedrige Geburtenrate – niedrige Sterberate Wechsel vom 1. zum 2. Zustand = demographische Transition = Übergang Die Dynamik der menschlichen Population ist regional verschieden. Die Bevölkerung der Industriestaaten befindet sich mehr oder weniger im Gleichgewicht (jährliche Wachstumsrate ca. 0.1%). Die Bevölkerung dieser Länder wird unweigerlich zurückgehen, wenn sich die Geburtenraten nicht erhöhen oder keine Zuwanderungen stattfinden. Aber etwa 80% der Menschen leben zurzeit in unterentwickelten Ländern, und der Grossteil des Bevölkerungswachstums (1.7% jährlich) findet in diesen Nationen statt. Die Reduktion der Familiengrösse ist der Schlüssel zur demographischen Transition. Verzögerte Reproduktion (ältere Eltern) führt letztendlich zur Abnahme des Populationswachstums und ermöglicht uns ein Nullwachstum bei niedrigen Geburten- und Sterberaten. Die Altersstruktur Ein wesentlicher demographischer Faktor für gegenwärtige und zukünftige Wachstumstendenzen ist die unterschiedliche Altersstruktur der einzelnen Länder. Altersdiagramme spiegeln nicht nur die Wachstumstendenz einer Population wider, sie weisen uns auch auf zukünftige soziale Gegebenheiten hin. Es ist schwierig, die Umweltkapazität unserer Erde abzuschätzen Schätzungen über das ökologische Fassungsvermögen unserer Erde gehen weit auseinander (→ unterschiedliche Methoden werden benutzt) Ökologische Footprints Ein neues Konzept, das bei der Abschätzung unserer Umweltkapazität unsere vielfältigen Zwänge und Bedürfnisse mit einbezieht. Wir können die Summe aller Land- und Wasserflächen in den verschieden Ökosystemkategorien berechnen, die von einer bestimmten Nation zur Produktion aller notwendigen Ressourcen und zur Entsorgung des gesamten Abfalls verwendet wird. Alle Werte werden in ha pro Person umgerechnet. Insgesamt ergeben diese Analysen, dass die Weltbevölkerung die Umweltkapazität der Erde bereits erreicht oder sogar knapp überschritten hat. Letztendlich können wir nur darüber spekulieren, wo die tatsächlichen ökologische Grenzen unserer Erde liegen, oder was letztendlich unser Wachstum limitieren wird. Die verschieden Technologien haben ohne Zweifel die Umweltkapazität der Erde für uns Menschen erhöht, aber keine Population kann endlos weiter wachsen. 15/41 Kapitel 53 – Ökologie der Biozönosen Kapitel 53 – Ökologie der Biozönosen Was ist eine Biozönose? Biozönose: Lebensgemeinschaft; Eine Ansammlung von Spezies, die eng genug zusammenleben, um miteinander interagieren zu können Biozönosen unterscheiden sich stark in ihrem Artenreichtum, also in der Anzahl der beteiligten Spezies, aber auch in der relativen Abundanz der vorhandenen Arten. Diversitäts-Index: Die individualistische und die interaktive Hypothese betrachten Biozönosen aus gegensätzlichen Blickwinkeln (Phytozönosen, 1920-30er Jahre) Die individualistische Hypothese: H.A. Gleason; Einzelne Arten stehen im Mittelpunkt der Untersuchung. Nach dieser Hypothese sind Arten entlang eines Gradienten unabhängig voneinander verteilt, und eine Lebensgemeinschaft stellt lediglich eine Ansammlung von Organismen dar, die zufällig den gleichen Lebensraum bewohnen, weil sie ähnliche abiotische Bedürfnisse haben. Die interaktive Hypothese: F.E. Clements; Betrachtet die Gesamtheit aller beteiligten Arten als Funktionsund Untersuchungseinheit. Nach dieser Hypothese sind bestimmte Arten voneinander abhängig. Sie kommen daher fast immer gemeinsam vor und bilden diskrete, definierbare Einheiten. In den meisten realen Fällen scheint sich die Zusammensetzung pflanzlicher Biozönosen tatsächlich kontinuierlich zu verändern; die einzelnen Mitgliedsarten sind mehr oder weniger unabhängig voneinander verteilt. Dies trifft v.a. für grossflächige Gebiete mit graduell variierenden Umweltparametern zu. In Fällen jedoch, wo sich ein abiotisches Umweltmerkmal abrupt ändert, treten Zäsuren zwischen benachbarten Biozönosen auf. Die kontroverse Debatte wird durch das Nieten-Modell und das Redundanz-Modell fortgesetzt Für Phytozönosen wird die individualistische Hypothese heutzutage allgemein akzeptiert. Nieten-Modell: Es postuliert, dass die meisten Arten innerhalb einer Biozönose eng miteinander zu einem „Lebensnetz“ verknüpft sind, und dass sich Veränderungen in der Abundanz einer Spezies auf viele andere auswirkt. (1981 P. & A. Ehrlich) 16/41 Kapitel 53 – Ökologie der Biozönosen Redundanz-Modell: Es besagt, dass die Vernetzung in einer Biozönose nur sehr locker sei und die Arten nicht eng assoziiert wären. Demzufolge würden sich Zu- oder Abnahmen in der Dichte der Spezies kauf auf die anderen Populationen auswirken, da alle Arten unabhängig voneinander operieren würden. Nach dieser Vorstellung sind die Arten innerhalb einer Biozönose redundant. (1992 B. Walker) Diese beiden Modelle stellen Extreme dar. Die meisten realen Lebensgemeinschaften werden irgendwo dazwischen liegen. Interspezifische Wechselwirkungen: Beziehungen zwischen unterschiedlichen Arten innerhalb einer Lebensgemeinschaft Einzelne Populationen können durch Konkurrenz, Prädation, Symbiose und Karpose miteinander verknüpft sein Interspezifische Wechselwirkungen Interaktion Wirkung auf die Populationsdichte Konkurrenz (-/-) Prädation (+/-) Inkl. Parasitismus Symbiose (+/+) (Mutualismus) Karpose (+/0) Inkl. Kommensalismus Die Wechselwirkung ist für beide Arten von Nachteil. Die Wechselwirkung ist vorteilhaft für die eine Art Und schädigt die andere. Beide Arten profitieren von der Wechselwirkung. Eine Art profitiert von der Wechselwirkung, Die andere wird nicht beeinflusst. Konkurrenz • Interspezifische Konkurrenz: tritt bei Ressourcenknappheit auf. Kann im Prinzip zwischen allen Arten auftreten, die von denselben Ressourcen abhängen. Kommt es zum zwischenartlichen Wettstreit um Ressourcen, ist das Ergebnis die Reduktion der Populationsdichte der einen oder der anderen Art, oder beiden Arten, oder im Extremfall das lokale Aussterben einer der beiden Populationen. • Konkurrenzausschluss-Prinzip: Zwei Arten, die aufgrund enger Verwandtschaft um dieselben Ressourcen konkurrieren, können räumlich nicht miteinander koexistieren, solange sie sich nicht in wenigstens einem Aspekt ihrer ökologischen Nische signifikant unterscheiden. Ökologische Nischen: die Gesamtheit der Ansprüche eines Organismus an die biotischen und abiotischen Ressourcen seiner Umgebung. Die ökologische Nische einer Art ist ihre ökologische Rolle – wie sie sich in ein Ökosystem „eingliedert“. Ressourcenaufteilung: „Nischendifferenzierung“, die es ähnlichen Arten erlaubt zu koexistieren 17/41 Kapitel 53 – Ökologie der Biozönosen Merkmalsdivergenz: Die Tendenz, dass sich zwei Arten, deren Populationen sympatrisch1 leben, deutlicher unterscheiden als bei allopatrischer2 Verteilung. z.B. Galapagosfinken Prädation: Carnivorie, Herbivorie, Parasitismus Anpassung bei den Prädatoren: scharfe Sinne, chemische Sensoren, Anpassungen wie Krallen, Zähne, Stacheln oder Gift Pflanzliche Abwehr von Herbivoren: Produktion toxischer Substanzen z.B. Strychnin, Morphium, Nikotin, Mescalin, Tannine, Zimt, Nelken, Pfefferminze; Stoffe, die Insekten-Hormonen ähnlich sind und Entwicklungsstörungen hervorrufen; Stacheln, Dornen Tierische Abwehr von Carnivoren: Verstecken, Flucht, Verteidigung, Alarmsignale, Gifte Tarnung (Mimese): kryptische Färbung (Gestaltauflösung durch eine Tarnfärbung), aposematische Färbung (Warnfärbung) Mimikry3: Batessche Mimikry (Mimikry, bei der eine harmlose Spezies aussieht wie eine andere Art, die giftig oder aus anderen Gründen für Prädatoren unattraktiv ist.); Müllersche Mimikry (Mimikry, bei der zwei oder mehr ungeniessbare Arten einander stark ähneln.) Die gegenseitige Mimikry ist wahrscheinlich für beide Arten von Vorteil, da Räuber schneller lernen, jede so markierte Art zu meiden. Parasiten und Pathogene als Prädatoren: 1 2 3 • Parasitismus ist eine interspezifische Wechselwirkung, bei der ein Organismus, der Parasit (Ektoparasiten, Endoparasiten), seine Nahrung von einem anderen Organismus, seinem Wirt, bezieht und ihn dadurch schädigt. • Pathogene, Krankheitserreger (Bakterien, Viren, Protisten, Pilze, Prionen), haben eine ähnliche Wirkung auf den Wirt wie Parasiten. Viele haben letale Auswirkungen. • Symbiose (Mutualismus): interspezifische Wechselwirkungen, die für beide Arten positiv sind • Karpose: „einseitiges Nutzniessertum“; Wechselbeziehung zwischen zwei Arten, aus der nur ein Partner profitiert, der andere unbeeinflusst bleibt. • Kommensalismus: „Mitessertum“; der Kommensale profitiert von der Nahrung seines Wirtes, ohne diesen wie ein Parasit zu schädigen. z.B. Aasfresser Denselben Lebensraum bewohnend. In unterschiedlichen, sich nicht überschneidenden Lebensräumen lebend. Strategie des Nachahmens, bei der eine Spezies das Erscheinungsbild einer anderen imitiert. 18/41 Kapitel 53 – Ökologie der Biozönosen • Phoresie: aktive, vorübergehende Benutzung eines anderen Organismus für Transportzwecke; „blinde Passagiere“. z.B. Pollen an Tieren, Milben an Insekten • Parökie: „Beisiedelung“; Leben in Nachbarschaft, wobei einer der beiden Partner Schutz oder Nahrung erhält. z.B. folgen Vögel oft grösseren Tieren, die beim Weiden Insekten aufscheuchen, die den Vögeln als Nahrung dienen. In der Peripherie einer Ameisenkolonie leben häufig Larven des Rosenkäfers. • Synökie: Mitbenutzung der Wohnstätte eines anderen Organismus. z.B. Ameisennester durch allerlei Insekten und Spinnen • Entökie: Eine Art hält sich in nach aussen offenen Körperhöhlen einer anderen Art auf. z.B. Der Innenraum von Schwämmen ist von zahlreichen Organismen besiedelt. Interspezifische Wechselwirkungen und Koevolution: • Koevolution bezieht sich auf reziproke evolutionäre Anpassung zwischen zwei Arten. Ein Wechselspiel von Anpassung und Gegenanpassung erfordert gegenseitige genetische Veränderungen in den Populationen beider beteiligter Arten. z.B. Gen-für-Gen-Erkennung zwischen einer Pflanzenart und einem avirulenten Pathogenen. • Die Anpassung von Organismen an eine andere Art – also an biotische Faktoren ihrer Umwelt – ist ein grundlegendes Merkmal allen Lebens. Die trophische Struktur ist ein Schlüsselfaktor für die Dynamik von Biozönosen Trophische Struktur: Nahrungsbeziehungen zwischen ihren Mitgliedarten Nahrungskette: Den Weg, den die in der Nahrung gespeicherte Energie nimmt. Primärproduzenten (photosynthetisch aktive Organismen) – Primärkonsumenten (Herbivoren) – Sekundär-, Tertiär- und Quartiärkosumenten (Carnivoren) – Destruenten. Innerhalb einer Nahrungskette tendieren die Tiere mit zunehmender Trophiestufe dazu, grösser zu werden (ausser Parasiten). Es gibt obere und untere Grenzen für die Grösse eines Beutetieres, die sowohl von der Grösse des Räubers als auch von dessen Art der Nahrungsaufnahme bestimmt werden. Nahrungsnetze: Nahrungsketten treten nicht isoliert auf, sondern sind mit- und ineinander in Nahrungsnetzen verwoben. Sie entstehen zum einen dadurch, dass eine Art mehr als eine Trophiestufe besetzen kann. z.B. Omnivoren (Primär- und Sekundärkonsumenten) Was beschränkt die Länge der Nahrungskette? Die generell am weitesten akzeptierte Erklärung ist die Energiehypothese, die besagt, dass die Länge einer Nahrungskette durch den ineffizienten Energietransfer von einer Stufe zur anderen limitiert wird. Dominante Arten und Schlüsselarten kontrollieren massgeblich die Struktur von Biozönosen Dominante Arten: Die mit der höchsten Abundanz oder der höchsten Biomasse (das Gesamtgewicht aller Individuen einer Population). Sie üben einen starken Kontrolleffekt auf das Auftreten und die Verteilung anderer Spezies aus. Einige Arten werden dominant, weil sie am erfolgreichsten um beschränkte Ressourcen konkurrieren können oder weil sie Räubern erfolgreicher entgehen können als andere. Schlüsselarten: Arten, die eine zentrale Funktion haben. Die meisten sind nicht besonders stark vertreten; ihre kontrollierende Wirkung auf die Biozönose beruht auf ihrer ökologischen Rolle oder den Nischen, die sie besetzen. Der einfachste Weg, eine Schlüsselspezies zu erkennen, ist ihre Eliminierung. z.B. Der Seestern (Pisaster ochraceus) oder der Seeotter (Enhydra lutris) 19/41 Kapitel 53 – Ökologie der Biozönosen Biozönotische Strukturen können durch Nährstoffe bottom-up oder durch Räuber top-down kontrolliert sein bottom-up Modell: Postuliert eine Verknüpfung V→H, also eine Regulation, die von der unteren Trophieebene auf die nächst höhere erfolgt. In diesem Fall sind es die mineralischen Nährstoffe, welche die Organisation einer Biozönose bestimmen. N→V→H→P. Wollen wir die Struktur einer so regulierten Biozönose beeinflussen, müssen wir die Biomasse der unteren Trophiestufen verändern. top-down Modell: Postuliert, dass die Organisation einer Lebensgemeinschaft vorwiegend von oben nach unten kontrolliert wird. P→H→V→N. Auch „trophisches Kaskadenmodell“ bezeichnet. Jede Manipulation wird sich daher nach unten als eine Folge von (+/-)-Effekten auswirken. Es gibt noch viele andere Modelle, die zwischen diesen beiden Extremen liegen. z.B. Können die Interaktionen zwischen zwei benachbarten Trophieebenen auch reziprok (↔) sein. Störungen und die Struktur von Lebensgemeinschaften Die meisten Biozönosen sind aufgrund von Störungen im Ungleichgewicht Störungen: Sturm, Feuer, Überflutung, Trockenheit, Überweidung oder menschliche Aktivität Störungen eröffnen auch Möglichkeiten für die Besiedlung eines Habitats durch neue Arten. In vielen Fällen erhöhen kleinräumige natürliche Störungen die mosaikartige Flechtenstruktur der Umgebung, eine möglicherweise wichtige Voraussetzung für die Erhaltung der Artenvielfalt. Häufige Störereignisse kleineren Ausmasses können auch dramatische Veränderungen mit negativen Effekten verhindern. z.B. Braucht die Drehkiefer Feuer um ihre Samen frei zusetzen. Junge Bäume sind feuerresistent, alte nicht mehr. Es häufen sich Hinweise, dass Instabilität für fast alle Biozönosen die Norm ist. Menschen sind die häufigsten Störfaktoren Menschliche Aktivitäten wirken sich v.a. auf den Artenreichtum von Lebensgemeinschaften aus. Ökologische Sukzession ist die Abfolge biozönotischer Veränderungen nach einer Störung Am offensichtlichsten werden Veränderungen in der Zusammensetzung und Struktur von Lebensgemeinschaften nach einem Ereignis, das die vorhandene Vegetation zerstört. z.B. Brand, Vulkanausbruch. Verschiedene Arten können das gestörte Gebiet neu besiedeln und werden nach und nach durch andere ersetzt. Ökologische Sukzession: Verschiebung der Artenzusammensetzung in einem ökologischen Zeitrahmen Primärsukzession: wenn dieser Prozess in einer unbelebten Region, in der sich noch kein Erdreich gebildet hat beginnt; z.B. auf einer neu entstandenen Vulkaninsel, nach Rückzug eines Gletschers. • autotrophe Bakterien (zu Beginn häufig die einzigen Lebensformen) • Flechten und Moose (Sporen durch Wind verbreitet; die ersten makroskopisch erkennbaren photosynthetisch aktiven Organismen) • Gesteinsverwitterung und Anreicherung der organischen Zersetzungsprodukte der Erstbesiedler (Pionierarten) Bodenbildung Einwanderung anderer Pflanzen möglich • Gräser – Sträucher – Bäume (Samen durch Wind oder Tiere aus umliegenden Gebieten eingetragen) • Schliesslich werden sich einige Pflanzenarten durchsetzen und zur dominierenden Vegetationsform der Lebensgemeinschaft entwickeln. Der gesamte Prozess kann Hunderte oder sogar Tausende von Jahren dauern. Sekundärsukzession: wenn eine bestehende Gemeinschaft durch eine Störung, die den Boden intakt lässt, eliminiert wurde. Häufig entwickelt sich das gestörte Gebiet wieder in Richtung seines ursprünglichen Zustands zurück. z.B. entwickeln sich gerodete Waldgebiet für Viehwirtschaft wieder zu Wald zurück (krautige 20/41 Kapitel 53 – Ökologie der Biozönosen Vegetation – Büsche – Waldbäume) 3 Schlüsselprozesse: Frühe Arten können die Einwanderung nachfolgender Organismen fördern. Sie können die Ansiedelung späterer Arten hemmen. Die frühen Arten tolerieren die späteren Kolonisierer, ohne sie zu fördern oder zu hemmen. Die Pionierpflanzen verändern die Bodeneigenschaften (pH-Wert, Stickstoffgehalt) und erlauben dadurch das Wachstum neuer Arten, die ihrerseits wieder die Umweltbedingungen in verschiedenster Weise verändern und zur Sukzession beitragen. Der Einfluss biogeographischer Faktoren auf die Diversität von Lebensgemeinschaften Zwei wichtige Faktoren im Zusammenhang mit der Biodiversität (biologische Vielfalt) einer Biozönose sind ihre Grösse und ihr geographischer Standort. Die geographischen Muster der Biodiversität werden durch eine Reihe grundlegender Prinzipien bestimmt und sind nicht Zufallsereignisse der Evolution. Biodiversität umfasst nicht nur die Anzahl der Arten in einer Gemeinschaft, sonder auch deren relative Abundanzen Artenreichtum („Artenvielfalt“): Gesamtzahl der Mitgliedsarten relative Abundanz: Häufigkeit, Anzahl, Dichte, in der die jeweiligen Arten vorkommen Biodiversität: Heterogenität (Vielfalt), besteht aus beiden Komponenten, Artenreichtum und relativer Abundanz Der Artenreichtum nimmt prinzipiell vom Äquator zu den Polen ab Ursache: mit grosser Wahrscheinlichkeit spielen die evolutionäre Entwicklung und das Klima eine entscheidende Rolle. Im Verlaufe der Evolution kann die Diversität durch Speziazion zunehmen. Tropen sind generell älter. Der Altersunterschied resultiert zum Teil aus den längeren Vegetationsphasen in den Tropen (5x schneller). Dazu kommt, dass viele der polaren und gemässigten Lebensgemeinschaften durch Gletscherbildung und Vereisung gestört wurden und sich einige Male wieder von neuem entwickeln mussten. Die Evapotranspiration (Verdunstung und Transpiration → Klima) ist in heissen und feuchten Gebieten wesentlich höher als in kalten trockenen und korreliert mit dem Artenreichtum von Flora und Fauna. 21/41 Kapitel 53 – Ökologie der Biozönosen Der Artenreichtum korreliert mit der geographischen Ausdehnung der Lebensgemeinschaft Arten-Areal-Kurve (species-area curve): quantifiziert eine ganz offensichtliche Korrelation: Die Anzahl der Arten ist umso höher, je grösser das geographische Areal der untersuchten Biozönose ist. Die wahrscheinlichste Erklärung für diesen Zusammenhang ist, dass grössere Areale vielfältigere Habitate und Mikrohabitate bieten. Artenreichtum auf Inseln hängt von ihrer Grösse und von der Entfernung zum Festland ab Kleine Inseln werden i.A. eine geringere Immigrationsrate haben, da sie von potenziellen Kolonisten seltener gefunden werden. Kleinere Inseln haben auch eine höhere Extinktionsrate. Sie besitzen grundsätzlich weniger Ressourcen und bieten den Besiedlern nicht so viele unterschiedliche Habitate, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit des Konkurrenzausschlusses erhöht. Eine Insel, die näher am Festland liegt, wird eine höhere Immigrationsrate haben als eine gleich grosse, aber weiter entfernte Insel. Die Immigrations- und Extinktionsraten werden zu jedem gegebenen Zeitpunkt auch durch die Anzahl der bereits auf der Insel vorhandenen Arten beeinflusst. Mit zunehmender Anzahl wird die Immigration neuer Spezies abnehmen, da sich die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass der Einwanderer einer neuen Art angehört. Zur gleichen Zeit erhöhen sich mit zunehmendem Artenreichtum die Konkurrenz und damit die Extinktionsrate. Schliesslich stellt sich ein Gleichgewicht ein, nämlich dann, wenn die Einwanderungsrate mit der Aussterberate identisch ist. Der Artenreichtum in diesem Gleichgewichtszustand korreliert mit der Grösse der Insel und ihrer Entfernung zum Festland. Jedes ökologische Gleichgewicht ist natürlich dynamisch; es kommt weiterhin zum Einwandern und Verlöschen von Arten, und die aktuelle Artenzusammensetzung kann sich mit der Zeit ändern. Diese Inselbiogeographie-Hypothese wird zum Teil bestritten. Sie soll zu stark vereinfacht sein und auf zu wenige Fälle zutreffen. 22/41 Kapitel 53 – Ökologie der Biozönosen 23/41 Kapitel 54 – Ökosysteme Kapitel 54 – Ökosysteme Ein Ökosystem besteht aus allen Organismen einer Gemeinschaft sowie aus allen abiotischen Faktoren, mit denen sie in Wechselbeziehung stehen. Sie sind nicht scharf begrenzt. Innerhalb von Ökosystemen laufen zwei dynamische Prozesse ab, die sich auf tieferen Ebenen nicht vollständig darstellen lassen: der Energiefluss und die Stoffkreisläufe. (Energie, chemische Elemente (C, N)) Energie- und Materiefluss durch Ökosysteme hängen zusammen, da beide über den Stofftransfer durch Photosynthese und Nahrungsbeziehungen erfolgen. Energie fliesst durch Ökosysteme hindurch, während Nährstoffe immer wieder in einem internen Kreislauf recycelt werden. Das Ökosystem-Konzept in der Ökologie Der Weg des Energieflusses und die Art der Stoffkreisläufe in einem Ökosystem hängen von dessen Trophiestruktur ab Primärproduzenten: Autotrophe; meist Photosynthese treibenden Organismen (Pflanzen, Algen, bestimmte Prokaryoten). Von ihnen hängen letztlich alle anderen Trophiestufen ab. Heterotrophe: hängen direkt oder indirekt von der Leistung der Primärproduzenten ab Primärkonsumenten: Herbivoren, die sich direkt von den Primärproduzenten (Pflanzen, Algen) ernähren Sekundärkonsumenten: Carnivoren, die Herbivoren fressen. Sie können wiederum anderen Carnivoren – den Tertiärkonsumenten – als Nahrung dienen. Destruenten: Zersetzer, Detritivoren; Pilze, Bakterien, bestimmte Invertebraten und einige Vertebraten; gewinnen ihre Energie aus dem Abbau von Detritus. Spielen eine wichtige Rolle im Kreislauf der Nährstoffe. 24/41 Kapitel 54 – Ökosysteme Das Destruentensystem verbindet alle trophischen Ebenen Destruenten bauen das organische Material ab (sie zersetzen es) und wandeln die chemischen Bausteine in eine anorganische Form um, die dann mineralischer Bestandteil von Böden, Wasser und Luft wird. Diese anorganischen Verbindungen können anschliessend wieder von Pflanzen und anderen Primärproduzenten als Ausgangssubstanz für die Produktion ihrer Biomasse benutzt werden. Ökosysteme gehorchen den thermodynamischen Grundgesetzen 1. Hauptsatz der Thermodynamik: Energie kann nicht erzeugt oder zerstört werden, sondern nur übertragen und umgewandelt. 2. Hauptsatz der Thermodynamik: Energieumwandlungen erfolgen nicht vollkommen effizient – bei jeder Transformation geht ein Teil in Form von Wärme verloren. Die Primärproduktion in Ökosystemen Primärproduktion: die Gesamtmenge der chemischen Energie (in Form von organischen Verbindungen), die von den Autotrophen eines Ökosystems innerhalb eines bestimmten Zeitraums mithilfe von Lichtenergie erzeugt wird. Der Energiehaushalt eines Ökosystems ist von der Primärproduktion abhängig Entscheidend für den Energiehaushalt eines Ökosystems ist also die Photosyntheseleistung seiner Produzenten. Die Strahlungsmenge, die schliesslich die Erdoberfläche erreicht, ist letztendlich der begrenzende Faktor für die Photosyntheseleistung der Ökosysteme. Und nur ein kleiner Teil trifft tatsächlich auf Algen, photosynthetisch tätige Prokaryoten und Pflanzenblätter, und davon entfällt wiederum nur ein Teil auf den Spektralbereich, der in der Photosynthese nutzbar ist. Von dem sichtbaren Licht, das photoautotrophe Orga- 25/41 Kapitel 54 – Ökosysteme nismen erreicht, werden nur etwa 1 Prozent durch Photosynthese in chemische Energie umgesetzt. Bruttoprimärproduktion (BPP): die Gesamtprimärproduktion; diejenige Lichtmenge, die durch Photosynthese pro Zeiteinheit in chemische Energie umgewandelt wird. Nettoprimärproduktion (NPP): NPP = BPP – R (Respiration: Energiemenge, welche die Produzenten bei der Zellatmung verbrauchen.) Primärproduktion: Energie oder Zunahme der pflanzlichen Biomasse pro Zeiteinheit Primärproduktivität: Primärproduktion pro Flächeneinheit, also die chemisch gespeicherte Energie pro Flächen- oder Zeiteinheit [kJ/km2/y] oder die Zunahme der pflanzlichen Biomasse pro Flächen- und Zeiteinheit [t/km2/y] Zwischen verschiedenen Ökosystemen gibt es erhebliche Unterschiede sowohl in der Produktivität als auch in ihrem Beitrag zur globalen Bruttoprimärproduktion. Tropische Regenwälder gehören zu den produktivsten terrestrischen Ökosystemen, Ästuare und Korallenriffe zu den produktivsten aquatischen. Da ihre Verbreitung aber gering ist, fallen sie nicht so ins Gewicht. In aquatischen Ökosystemen wird die Primärproduktion durch Licht und Nährstoffe limitiert Marine Ökosysteme: limitierende Nährstoffe sind v.a. Stickstoff und Phosphor. Auch Eisen kann ein limitierender Nährstoff sein (Eisen →+ Cyanobakterien →+ Stickstofffixierung →+ Phytoplanktonproduktion). Die limitierung der Primärproduktion durch Nährstoffe trifft nicht auf solche ozeanischen Regionen zu, in denen Auftriebswasser Nährelemente aus der Tiefe an die Oberfläche transportiert. z.B. Antarktis Limnische Ökosysteme: Im Gegensatz zu marinen Systemen stellt Stickstoff selten den limitieren Faktor dar. Experimente sprechen für Phosphor als limitieren Faktor, da dessen Zugabe eine Blaualgenblüte förderte. (Eutrophierung: vorherrschen von Cyanobakterien anstatt Diatomeen und Grünalgen) Für die Primärproduktion in terrestrischen Ökosystemen sind Temperatur, Feuchtigkeit und Nährstoffe die limitierenden Faktoren Auch hier sind Stickstoff oder Phosphor der limitiere Nährstoff. Die Sekundärproduktion in Ökosystemen Sekundärproduktion: Rate, mit der die Primärkonsumenten eines Ökosystems (die Herbivoren) die chemische Energie ihrer Nahrung in eigene neue Biomasse umsetzen. Die Effizienz des Energietransfers von einer Trophiestufe zur nächsten liegt in der Regel unter 20% Produktionseffizienz = Nettosekundärproduktion assimilierte Primärproduktion Nettosekundärproduktion: Energiemenge, die in Form von Biomasse (eigenes Wachstum und Produktion von Nachkommen) gespeichert wird. Assimilierte Primärproduktion: Gesamtenergiemenge, die aufgenommen und für Wachstum, Reproduktion und Atmung verwendet wurde. Produktionseffizienz: derjenige Teil der mit der Nahrung aufgenommenen Energie, der nicht durch die Atmung wieder verloren geht. Von der Aufgenommenen Nahrung wird nur ein Teil der Nahrung für das Wachstum genutzt, ein Teil wird noch für die Zellatmung gebraucht und der Rest als Kot ausgeschieden. Dieser Teil ist nicht verloren, da er von den Zersetzern genutzt wird. 26/41 Kapitel 54 – Ökosysteme Energie fliesst durch die Sonnenstrahlung in ein Ökosystem hinein und verlässt es wieder als Wärmestrahlung (Energie für die Respiration). ⇨ Energiefluss durch Ökosysteme (nicht Energiekreislauf) Nur diejenige chemische Energie, welche die Herbivoren als eigene Biomasse (oder in der ihrer Nachkommen) speichern, steht den Sekundärkonsumenten als Nahrung zur Verfügung. Produktionseffizienz von Insekten Ø 40%, von Fischen ca. 10%, Endotherme (wie Vögel, Säugetiere) 1-3% (brauchen enorme Energie zur Aufrechterhaltung ihrer Körpertemperatur) Trophische Effizienz und Nahrungspyramiden Trophische Effizienz: ökologische Effizienz, Ökoeffizienz; denjenigen Prozentsatz an Energie, der von einer Trophiestufe an die nächste weitergegeben wird. oder Das Verhältnis der Nettoproduktivität einer Trophiestufe zur Nettoproduktivität der nächst tieferen Stufe. Stets tiefer als Produktionseffizienz, das sie nicht nur die Energieverluste durch Atmung und unverdaulichen Kot berücksichtigt, sonder auch den Anteil, der nicht konsumiert wurde. I.d.R. liegen die trophischen Effizienzen zwischen 5 und 20%, je nach Ökosystem; d.h., 80-95% der auf einer Trophiestufe verfügbaren Energie wird nicht zur nächsten Stufe weitergegeben. Diese Verluste multiplizieren sich über die Länge der Nahrungskette. Produktivitätspyramiden: Energiepyramide; graphische Darstellung des multiplikativen Energieverlustes innerhalb einer Nahrungskette. Die Trophiestufen werden als Blöcke übereinander gestapelt, wobei die Primärproduzenten die Basis bilden. Die Grösse der einzelnen Blöcke ist der Produktivität der jeweiligen Trophiestufe proportional. Biomassepyramiden: jede Stufe entspricht der standing crop (Gesamttrockengewicht aller Organismen) einer Trophieebene. I.d.R. verjüngen sich Biomassepyramiden von den Produzenten an der Basis bis zu den oben stehenden Spitzenräubern erheblich, weil der Energietransfer zwischen den Trophiestufen so ineffizient ist. Bei manchen aquatischen Ökosystemen ist aber das Gesamtgewicht der Primärkonsumenten grösser als das der Produzenten. Solche umgekehrten Biomassepyramiden entstehen, weil die Zooplankter das Phytoplankton so schnell konsumieren, dass die Produzenten nie grosse Populationen oder eine grosse standing crop aufbauen können. Phytoplankton hat eine rasche Turnover-Rate (Umsatzrate) Turnover-Rate = standing crop mg / m² Produktivität mg / m² /Tag Zahlenpyramiden: Die Grösse der einzelnen Blöcke ist der Anzahl der Einzelorganismen in der jeweiligen Trophiestufe proportional. Durch den multiplikativen Energieverlust in der Nahrungskette können Ökosysteme nur eine sehr kleine Gesamtbiomasse an Spitzenräubern ernähren. Nur etwa 1/1000 der durch Photosynthese fixierten chemischen Energie durchläuft den gesamten Weg durch ein Nahrungsnetz bis hin zu den Tertiärkonsumenten. Dies erklärt, warum Nahrungsnetze i.d.R. nur 3-5 Trophiestufen haben. Herbivoren konsumieren nur einen geringen Teil der Primärproduktion: Die „Grüne-WeltHypothese“ Die „Grüne-Welt-Hypothese“: Herbivoren konsumieren nur einen geringen Anteil der pflanzlichen Biomasse, da sie durch eine Vielzahl von Faktoren in Schach gehalten werden. • Pflanzen verteidigen sich gegen Herbivoren. • Herbivoren werden i.d.R. nicht durch die verfügbare Energie, sondern durch Nährstoffe limitiert, z.B. Proteine (org. Stickstoffverbindungen). • Abiotische Faktoren schränken Herbivoren ein. • Intraspezifische Konkurrenz = innerartliche Konkurrenz • Interspezifische Wechselbeziehungen: Gemäss der Grüne-Welt-Hypothese sind es hauptsächlich 27/41 Kapitel 54 – Ökosysteme Prädatoren, also Räuber, Parasiten und Krankheitserreger, welche das Wachstum der HerbivorenPopulation kontrollieren. Top-down-Modell. Der Kreislauf chemischer Elemente in Ökosystemen Da an Nährstoffkreisläufen sowohl biotische als auch abiotische Komponenten von Ökosystemen beteiligt sind, bezeichnet man sie auch als biogeochemische Stoffkreisläufe. Biologische und geologische Prozesse verschieben die Nährstoffe zwischen organischen und anorganischen Reservoiren Es lassen sich generell zwei Arten biogeochemischer Stoffkreisläufe unterscheiden. Die Atmosphäre enthält gasförmige Verbindungen von Kohlenstoff, Sauerstoff, Schwefel und Stickstoff, und diese Elemente zirkulieren prinzipiell in globalen Kreisläufen. Andere, in der Umwelt weniger mobile Elemente, wie Phosphor, Kalium, Calcium und die Spurenelemente, zirkulieren i.d.R. in räumlich begrenzten Kreisläufen, zumindest über kürzere Zeiträume betrachtet. Der Boden ist das wichtigste abiotische Reservoir dieser Elemente. Ein allgemeines Modell für chemische Kreisläufe: Ökosysteme sind nicht nur a.o. komplex, sondern tauschen i.d.R. zumindest einen Teil der in ihnen enthalte- 28/41 Kapitel 54 – Ökosysteme nen Substanzen auch untereinander aus. Wasserkreislauf: Obwohl Lebewesen vorwiegend aus Wasser bestehen, wird nur wenig des Wassers, das durch Ökosysteme zirkuliert, durch ihre biotischen oder abiotischen Komponenten chemisch verändert. Die wichtigsten Ausnahmen sind die Spaltung des Wassermoleküls in H und O2 durch den Prozess der Photosynthese sowie die Bildung von Wasser in der Atmungskette. Stickstoffkreislauf: Stickstoff-Fixierung: Nur bestimmte Prokaryoten können Stickstoff fixieren, d.h. N2 in Ammoniak (NH3) umwandeln, das zur Synthese stickstoffhaltiger organischer Verbindungen wieder Aminosäuren verwendet werden kann. Nitrifikation: Obwohl Pflanzen Ammonium direkt verwerten können, wird der grösste Teil des im Boden enthaltenen Ammoniums von bestimmten aeroben Bakterien als Energiequelle benutzt. Durch ihre Aktivität wird Ammoniak zu Nitrit (NO2-) und dann zu Nitrat (NO3-) oxidiert. Das von diesen Bakterien freigesetzte Nitrat kann ebenfalls, wie Ammonium, von Pflanzen assimiliert und in organische Formen wie AS und Proteine umgewandelt werden. Denitrifikation: Manche Bakterien sind in der Lage, den Sauerstoff, den sie für ihren Stoffwechsel benötigen, unter anaeroben Bedingungen aus Nitrat statt aus O2 zu gewinnen. Infolge dieser Denitrifikation wird 29/41 Kapitel 54 – Ökosysteme ein Teil des Nitrats wieder in N2 verwandelt, das in die Atmosphäre zurückkehrt. Ammonifikation: Durch Zersetzung der organischen Stickstoffverbindungen, die v.a. durch bakterielle und pilzliche Destruenten erfolgt, aber auch durch Nematoden, entsteht wieder Ammonium. Über diesen Remineralisierungsprozess gelangen grosse Mengen an anorganischem Stickstoff zurück in den Boden. Phosphorkreislauf: Phosphor kommt in nur einer einzigen biologisch wichtigen anorganischen Form vor, nämlich als Phosphat (PO43-), das von Pflanzen absorbiert und für die Synthese organischer Verbindungen verwendet wird. Der grösste Teil des Phosphats zirkuliert in ökologischen Zeiträumen lokal begrenzt im Boden, Pflanzen und Konsumenten, während ein parallel verlaufender Sedimentzyklus terrestrischer Phosphor über geologische Zeiträume festhält und wieder freigibt. Das gleiche Schema gilt im Prinzip für andere Nährstoffe, von denen es keine atmosphärischen Formen gibt. Kohlenstoffkreislauf: Zusammenfassendes Schema biogeochemischer Kreisläufe: ❢ Destruenten = Decomposers 30/41 Kapitel 54 – Ökosysteme 31/41 Kapitel 54 – Ökosysteme 32/41 Kapitel 54 – Ökosysteme Die Geschwindigkeit von Nährstoffkreisläufen wird vor allem durch die Zersetzungsrate bestimmt Das Tempo der Remineralisierung und damit auch die Geschwindigkeit der Nährstoffkreisläufe hängt von der Temperatur sowie der Verfügbarkeit von Wasser und Sauerstoff ab; weitere mögliche Einflussfaktoren sind die lokale Biochemie und die Häufigkeit von Bränden. Nährstoffkreisläufe werden stark durch die Vegetation beeinflusst In terrestrischen Ökosystemen wird der grösste Teil der mineralischen Nährstoffe in internen Kreisläufen festgehalten. Die Nährstoffmenge, die ein intaktes Ökosystem verlässt, wird von den Pflanzen selbst kontrolliert; wo es keine Pflanzen gibt, die sie zurückhalten, gehen sie aus dem System verloren. Diese Effekte treten fast sofort ein (innerhalb weniger Monate nach Rodung) und halten an, solange keine Pflanzen vorhanden sind. Anthropogene Beeinflussung von Ökosystemen und der Biosphäre Der Mensch greift in der gesamten Biosphäre in Stoffkreisläufe ein Der Mensch hat in solchem Masse in Nährstoffkreisläufe eingegriffen, dass kein Kreislauf mehr zu verstehen ist, ohne dass man menschliche Einflüsse berücksichtigt. Wir verfrachten nicht nur Nährstoffe von Ort zu Ort, sonder wir haben auch völlig neue Substanzen, darunter viele toxische, in Ökosysteme eingebracht. Auswirkungen der Landwirtschaft auf Nährstoffkreisläufe: Irgendwann ist der natürliche Nährstoffvorrat in jedem intensiv landwirtschaftlich genutzten Gebiet erschöpft, und es muss gedüngt werden. Die Landwirtschaft hat einen erheblichen Einfluss auf den Stickstoffkreislauf. Neuere Untersuchungen ergaben, dass durch den Menschen die Menge an gebundenem Stickstoff, der weltweit den Primärproduzenten zur Verfügung steht, verdoppelt wurde (industriell erzeugter Stickstoffdünger, verstärkte Kultivierung von Leguminosen (Symbiose mit stickstofffixierenden Bakterien), Landrodungen durch Verbrennen der Vegetation). Die Stickstoffanreicherung hat nicht nur lokale Auswirkungen auf die Chemie unserer Böden und Gewässer, sonder führt auch zu einer verstärkten Freisetzung von molekularem Stickstoff (N2) und Stickoxiden (Nox) durch den Prozess der Denitrifikation. Nox sind Mitverursacher der atmosphärischen Erwärmung, tragen zur Zerstörung der Ozonschicht bei, und in einigen Ökosystemen sind sie auch mitverantwortlich für saure Niederschläge. Die „kritische Menge“ in Nährstoffkreisläufen: Der überschüssige mineralische Stickstoff im Boden landet letztendlich – indirekt über die Auswaschung ins Grundwasser oder direkt durch Oberflächenabfluss – in limnische und marine Ökosystemen. In der gesamten nördlichen Hemisphäre lässt sich der Anstieg der Nitratkonzentration mit der Bevölkerungsdichte entlang eines Flusses korrelieren. Unter bestimmten Umständen kann die Zugabe von Stickstoff sich auch positiv auf ein Ökosystem auswirken, zumindest aus menschlicher Perspektive. Düngereintrag kann die Stickstofflimitierung der Primärproduktion in terrestrischen Systemen ausgleichen. Das Hauptproblem liegt in der kritischen Menge, also wie viel Stickstoff von den Pflanzen absorbiert werden kann, bevor sich ein gewisser „Sättigungsgrad“ einstellt. Es ist der über diesen kritischen Wert hinaus verfügbare Stickstoff, der in das Grundwasser gelangt und die aquatischen Ökosysteme belastet. Die zunehmende Eutrophierung von Seen: 33/41 Kapitel 54 – Ökosysteme Anthropogene Eutrophierung: Industrie- und Haushaltsabwässer, auf Felder und Weiden vorhandene oder ausgebrachte tierische Rückstände wie Dung und Gülle sowie der Dünger, der in der Landwirtschaft und in Erholungs- und Siedlungsgebieten eingesetzt wird, gelangen zum grossen Teil in Flüsse und Seen und belasten viele von ihnen übermässig mit anorganischen Nährstoffen. Dies führt häufig zu explosionsartiger Vermehrung der Photosynthese treibenden Organismen. ⇨ Algenblüte ⇨ Sauerstoffungleichgewicht Die Verbrennung fossiler Energieträger ist die Hauptursache des sauren Regens Die Verbrennung von Holz, Kohle und anderen fossilen Brennstoffen setzt Schwefel- und Stickstoffoxide frei, die in der Atmosphäre mit Wasser zu schwefliger und salpetriger Säure reagieren. Diese Verbindungen gelangen schliesslich in Form von sauren Niederschlägen (< pH 5.6) wieder auf die Erdoberfläche zurück. Sie wirken sich auf die Azidität aquatischer Ökosysteme aus und beeinflussen die chemische Zusammensetzung terrestrischer Böden. Es gibt sie seit der industriellen Revolution. Es ist ein überregionales, vielleicht sogar globales Problem. Durch Erhöhung der Schornsteine lässt sich die lokale Situation verbessern. Gleichzeitig werden die Schadstoffe – und damit die Probleme – auf andere Regionen verteilt. In terrestrischen Ökosystemen bewirkt die Versauerung des Böden die Auswaschung von Calcium und anderen Nährstoffen, wodurch Gesundheit und Wachstum der Pflanzen stark beeinträchtigt werden. Süsswasser-Ökosysteme reagieren besonders empfindlich auf saure Niederschläge, v.a. solche, deren Becken aus Granitgestein besetzt. Sie besitzen eine sehr geringe Pufferkapazität, da die Konzentration an Bicarbonat, einem wichtigen Pufferion, niedrig ist (das Wasser ist „weich“). Giftstoffe reichern sich in aufeinander folgenden Trophiestufen der Nahrungsnetze an Der Mensch produziert eine enorme Vielfalt an toxischen Chemikalien – darunter Tausende von Verbindungen, die in der Natur bisher nicht vorkamen – und entlässt sie in die Umwelt. Viele dieser Giftstoffe könne nicht von Mikroorganismen abgebaut werden und überdauern daher Jahre oder sogar Jahrzehnte in der Umwelt. Andere Verbindungen sind relativ harmlos, werden aber durch Reaktionen mit anderen Substanzen oder durch die Stoffwechselaktivität von Mikroorganismen in stärker toxische Produkte umgewandelt. z.B. Hg MeHg (CH3Hg) Organismen nehmen toxischen Substanzen aus der Umwelt mit der Nahrung und dem Wasser auf. Manche der Giftstoffe werden verstoffwechselt und ausgeschieden, doch andere reichern sich in bestimmten Geweben an, v.a. im Fettgewebe. z.B. Chlorierte Kohlenwasserstoffe wie DDT, PCB Biomagnifikation: Die Konzentration der Giftstoffe nimmt in den aufeinander folgenden Trophiestufen eines Nahrungsnetzes zu. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Gesamtbiomasse jeder Trophiestufe aus sehr viel mehr Biomasse der nächst tieferen Trophiestufe gebildet wird. z.B. DDT (seit 1970er verboten) hilft aber auch gegen Malariamücken Zweischneidigkeit von Giftstoffen Der anthropogen verursachte Anstieg der atmosphärischen CO2-Konzentration kann zu globalen Klimaveränderungen führen Anthropogene Belastungen können aufgrund des endlichen Volumens der irdischen Lufthülle grundlegende Veränderungen in ihrer Zusammensetzung sowie ihrer Wechselwirkung mit dem Rest der Biosphäre bewirken. Der Anstieg von CO2 in der Atmosphäre: Seit der industriellen Revolution stieg die CO2-Konzentration in der Atmosphäre, und zwar infolge der Verbrennung fossiler Energieträger sowie enormer Mengen von Holz aus Rodungen. 1850: 274 ppm, 1950: 316 ppm, heute: > 370 ppm Eine vorhersehbare Folge der steigenden CO2-Konzentration ist die Zunahme der pflanzlichen Produktivität. Da die Verfügbarkeit von CO2 für C3-Pflanzen stärker limitierend ist als für C4-Pflanzen, könnte ein globaler Effekt der ansteigenden CO2-Konzentration eine Ausbreitung von C3-Arten (z.B. Weizen, Sojabohnen) in Lebensräumen sein, in denen bis dahin C4-Pflanzen (z.B. Mais) begünstigt waren. 34/41 Kapitel 54 – Ökosysteme Der Treibhauseffekt: Ein Grossteil der auf die Erde fallenden Sonnenstrahlung wird ins All reflektiert. CO2 und Wasserdampf in der Atmosphäre sind zwar für sichtbares Licht durchlässig, absorbieren aber einen Grossteil der von der Erde abgegebenen Infrarotstrahlung und reflektieren sie zurück auf die Erde. Durch diesen Prozess wird ein Teil der einfallenden Sonnenenergie festgehalten (Treibhauseffekt). Globale Erwärmung: Wie sich aus der Analyse fossiler Pollen schliessen lässt, verändern sich Pflanzengemeinschaften bei Temperaturverschiebungen dramatisch. In der Vergangenheit liefen Klimaänderungen langsam ab, und Pflanzenund Tierpopulationen konnten in Gebiete abwandern, in denen die abiotischen Umweltbedingungen ihnen erlaubten zu überleben. Die vorausgesagte Geschwindigkeit der derzeitigen Klimaveränderung ist daher Anlass zu grosser Sorge. Viele Arten, v.a. Pflanzen, die grosse Entfernungen nur langsam als Samen oder Ableger überwinden können, werden vermutlich nicht überleben. Die Zerstörung der Ozonschicht durch den Menschen hat weit reichende Konsequenzen Ozonschicht: Eine Schicht aus Ozonmolekülen (O3) in der unteren Stratosphäre, 17-25 km über der Erdoberfläche. Sie schützt das Leben auf der Erde vor den schädlichen Auswirkungen der UV-Sonnenstrahlung. Ozon absorbiert UV-Licht. Seit 1975 nimmt diese Ozonschicht ab; sie wird ausgedünnt. Am deutlichsten ist dieser Effekt über der Antarktis. Die Zerstörung des Ozons in der Atmosphäre ist vermutlich hauptsächlich eine Folge der Anreicherung von FCKW (Clkat daraus reagiert mit O3 zu O2). Wenn heute alle FCKW verboten würden, beeinflussen die bereits in der Atmosphäre befindlichen Cl-Moleküle den O3-Gehalt der Stratosphäre noch mindestens 1 Jahrhundert lang. Auswirkungen: Zunahme von letalen und nicht-letalen Formen von Hautkrebs und grauem Star beim Menschen, ausserdem unvorhersehbare Auswirkungen auf Kulturpflanzen und natürliche Pflanzengesellschaften, v.a. auf das Phytoplankton. 35/41 Kapitel 55 – Naturschutzbiologie Kapitel 55 – Naturschutzbiologie Die Biodiversitätskrise Die drei Ebenen der Biodiversität bilden die genetische Variabilität, der Artenreichtum und die Ökosystemvielfalt Die Biodiversität (= biologische Diversität) lässt sich in 3 Hauptbereiche oder Ebenen unterteilen: • Der Verlust an genetischer Variabilität (1. Ebene): Durch das Aussterben einer lokalen Population verliert eine Art einen Teil ihrer genetischen Variabilität, die Anpassung ermöglicht. • Der Verlust an Artenvielfalt (2. Ebene) • Der Verlust an Ökosystemvielfalt (3. Ebene) Auf allen drei Ebenen ist Biodiversität wichtig für das Wohlergehen des Menschen Der Nutzen von Artenvielfalt und genetischer Variabilität • Nahrungspflanzen, Gewinnung von Fasern, pharmazeutische Zwecke z.B. Madagaskar-Immergrün (Catharanthus roseus) dessen Alkaloide Krebszellen hemmen. Nun gibt es bei den potenziell tödlich verlaufenden Krebserkrankungen Hodgkin-Lymphom und akute lymphocytische Leukämie deutliche Besserungen. • Verlust von Arten bedeutet auch einen Verlust an Genen. Ökologische Leistungen: Zusammenfassung all jener Prozesse, durch die natürliche Ökosysteme und die darin lebenden Arten dazu beitragen, dass der Mensch auf der Erde leben kann. Bsp. • Reinigung von Luft und Wasser • Abschwächung von schlimmen Dürren und Überflutungen • Schaffung und Erhaltung fruchtbarer Böden • Entgiftung und Abbau von Abfallstoffen • Bestäubung von Nutzpflanzen und der natürlichen Vegetation • Verbreitung von Samen • Nährstoffkreisläufe • Bekämpfung vieler Landwirtschaftsschädlinge durch natürliche Feinde • Schutz von Küstengebieten vor Erosion • Schutz vor UV-Strahlung • Abschwächung von Witterungsextremen • ästhetische Schönheit und Erholungswert • ... Wenn wir zulassen, dass weiterhin Arten aussterben und Lebensräume zerstört werden, dann riskieren wir das Überleben unserer eigenen Art. Die Menschheit würde ohne diese ökologischen Leistungen zu Grunde gehen. 36/41 Kapitel 55 – Naturschutzbiologie Die vier grössten Bedrohungen für die Biodiversität sind die Zerstörung von Lebensräumen, eingeführte Arten, die Übernutzung und die Unterbrechung von Nahrungsketten Die Zerstörung von Lebensräumen: Die Veränderung von Lebensräumen durch den Menschen ist die grösste Bedrohung für die biologische Vielfalt in der gesamten Biosphäre. Die Landwirtschaft, der Ausbau von Städten, die Forstwirtschaft, der Bergbau und die Verschmutzung der Umwelt haben zur massiven Zerstörung von Lebensräumen auf der ganzen Welt geführt. Zusätzlich zu der grossflächigen Zerstörung von Lebensräumen wurden viele Naturlandschaften fragmentiert, also in kleine Restflächen unterteilt. Die Fragmentierung von Lebensräumen führt fast immer zu Verlust von Arten. Eingeführte Arten: Sie wurden vom Menschen von ihren natürlichen Verbreitungsgebieten in andere geographische Regionen umgesiedelt oder verschleppt. In einigen Fällen erfolgte die Einführung gewollt. Bsp. Europäische Rotfüchse nach Australien als Jagdwild; Nilbarsch in den Victoriasee; Kudzu oder Rauhaarige Kopoubohne von Japan in den Süden der USA zum Schutz gegen die Erosion; europäische Stare (Shakespear). Eingeführte Arten, die in einem neuen Gebiet Fuss fassen, erweisen sich in der Regel als Störfaktor in ihrer neuen Lebensgemeinschaft, indem sie entweder einheimische Arten erbeuten oder mit diesen um Ressourcen konkurrieren. Durch die leichte Transportmöglichkeit mittels Schiffen und Flugzeugen hat sich die Ausbreitung der Arten beschleunigt; insbesondere wurden sie dadurch unabsichtlich verschleppt. Übernutzung: Wenn der Mensch Wildpflanzen und Wildtiere in solcher Geschwindigkeit nutzt, dass die Populationen dieser Arten sich nicht wieder erholen können. Besonders gefährdet durch Übernutzung sind grosse Arten mit von Natur aus geringer Fortpflanzungsrate wie Elefanten, Wale, Nashörner und andere Tiere, die für den Menschen irgendwie von Wert sind. Auf kleinen Inseln lebende Arten werden besonders leicht durch Übernutzung ausgerottet. Die Unterbrechung von Nahrungsketten: Weil die meisten Räuber nicht auf eine bestimmte Beuteart spezialisiert sind, ist die Unterbrechung der Nahrungskette als Aussterbeursache wahrscheinlich weniger bedeutend als Lebensraumzerstörung, eingeführte Arten oder Übernutzung. Naturschutz auf Populations- und Artenebene Schutzstrategie für kleine Populationen: Geringe Grösse kann eine Population in einen Aussterbestrudel ziehen Es ist die Kleinheit der Population selbst, die sie schliesslich an den Rand des Aussterbens bringt, nachdem Faktoren wie Lebensraumverlust die Populationsdichte entsprechend reduziert haben. Im Mittelpunkt dieses Konzepts steht der Aussterbestrudel (extinction vortex), eine abwärts verlaufende Spirale, die typisch für kleine Populationen ist. Eine kleine Population ist durch Inzucht und genetischer Drift anfällig für positive Rückkopplungsschleifen, durch welche die Population immer kleiner wird und ständig tiefer in den Aussterbestrudel gerät, bis schliesslich überhaupt keine Individuen mehr existieren. Der entscheidende Faktor bei einem Aussterbestrudel ist der Verlust an genetischer Variabilität, auf welche die Population angewiesen ist, um sich durch Evolution anpassen zu können. Aber nicht alle Populationen sind durch eine geringe genetische Variabilität zum Aussterben verurteilt. Eine Reihe von Pflanzenarten (Bsp. Läusekraut (Pedicularis)) und verschiedene Grasarten scheinen von Natur aus eine geringe genetische Variabilität aufzuweisen. Ausserdem bedeutet eine geringe genetische Vielfalt nicht unbedingt, dass Populationen auf Dauer klein bleiben müssen (Bsp. Nördlicher See-Elefant). Diese Fälle sind aber ungewöhnlich. Wann ist einen Population zu klein? Kleinste überlebensfähige Population (MVP, minimum viable population size): Die MVP für eine be- 37/41 Kapitel 55 – Naturschutzbiologie stimmte Art wird in der Regel mithilfe von Computermodellen berechnet, die viele Faktoren mit einbeziehen. Naturschutzbiologen bringen die MVP einer Art in die Berechnung der sog. Analyse der Überlebensfähigkeit einer Population (PVA, population viability analysis) ein. Ziel einer solchen Analyse ist es, eine vernünftige Vorhersage über die Überlebenschancen einer Population zu treffen, gewöhnlich ausgedrückt als die Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Zeitraum zu überleben. Die effektive Populationsgrösse (Ne): Um die kleinste lebensfähige Population sinnvoll abschätzen zu können, muss zuerst die effektive Populationsgrösse ermittelt werden, die auf dem Fortpflanzungspotenzial der Population beruht. 4 N f Nm f N m N e= N ; Nf, Nm Zahl der Weibchen bzw. Männchen, die sich erfolgreich fortpflanzen In tatsächlich untersuchten Populationen beläuft sich Ne stets nur auf einen Bruchteil der Gesamtpopulation. Zahlreiche Merkmale eines Lebenszyklus können sich auf Ne auswirken, und so gibt es alternative Formeln für Ne, die zusätzlich Familiengrösse, das Alter bei der Geschlechtsreife, den genetischen Verwandtschaftsgrad zwischen den Mitgliedern der Population, die Auswirkungen des Genflusses zwischen geographisch getrennten Populationen sowie Populationsschwankungen berücksichtigen. Das Ziel der Erhaltung einer Ne, die über der MVP liegt, entstand aus der Sorge, ob Populationen genügend genetische Variabilität aufweisen, um sich durch Evolution anpassen zu können. Schutzstrategien für zurückgehende Populationen: den Rückgang von Populationen feststellen, die Ursachen dafür herausfinden und ihn aufhalten Noch praxisorientierter ist die Schutzstrategie für zurückgehende Populationen, die sich auf gefährdete oder vom Aussterben bedrohte Populationen konzentriert. Diese Schutzstrategie stellt Umweltfaktoren heraus, die zunächst für den Rückgang einer Population verantwortlich waren. Jeder Rückgang einer Population muss von Fall zu Fall bewertet werden und die entsprechenden Ursachen eruieren, bevor korrigierende Massnahmen getroffen werden können. Schritte, mit denen sich der Rückgang einer Population diagnostizieren und aufhalten lässt: • Bestätigung, dass die Art derzeit im Rückgang ist oder früher weiter verbreitet oder häufiger war. • Erforschung der Biologie einer Art, um ihre Umweltansprüche herauszufinden. • Feststellen aller möglichen Ursachen für den Rückgang. • Auflistung der Vorhersagen der jeweiligen Hypothesen für den Rückgang. • Überprüfung der wahrscheinlichsten Hypothese als Erstes; Planung eines Experiments, mit dem sich feststellen lässt, ob dieser Faktor die Hauptursache für den Rückgang ist. • Anwendung der Ergebnisse dieser Diagnose in Form entsprechender Schutzmassnahmen für die bedrohte Art. Beim Artenschutz sind widersprüchliche Bedürfnisse gegeneinander abzuwägen Nicht immer stehen grosse, sehr markante Wirbeltiere im Mittelpunkt solcher Konflikte, aber fast immer ist die Nutzung des Lebensraumes das Problem. Neben Fragen hinsichtlich der Ansprüche des Menschen an einen Lebensraum ist als weiterer wichtiger Faktor die ökologische Rolle von Arten abzuwägen. Weil wir nicht in der Lage sein werden, jede gefährdete Art zu retten, müssen wir entscheiden, welche für die Erhaltung der Biodiversität im Gesamten am wichtigsten ist → Schlüsselarten. Naturschutz auf der Ebene von Lebensgemeinschaften, Ökosystemen und Landschaften In ökologischem Sinn ist eine Landschaft eine regionale Ansammlung von miteinander in Wechselwirkung 38/41 Kapitel 55 – Naturschutzbiologie stehenden Ökosystemen wie ein Wald oder Waldstücke, benachbarte Felder, Feuchtgebiete, Wasserläufe und Uferbiotope. In der Landschaftsökologie werden ökologische Prinzipien angewandt, um zu erforschen, auf welche Weise der Mensch das Land nutzt. Saumbiotope und Biotopkorridore können sich enorm auf die biologische Vielfalt einer Landschaft auswirken Die Grenzen oder Ränder zwischen Ökosystemen (z.B. zwischen einem See und dem umgebenden Wald oder zwischen Ackerland und Wohngebieten) und innerhalb von Ökosystemen (wie Strassenränder und Felsregionen) sind kennzeichnende Merkmale von Landschaften. Ein Saumbiotop oder Ökoton ist durch eigenständige physikalische Bedingungen wie Bodentyp, Topographie und Störfaktoren gekennzeichnet, die sich von den auf beiden Seiten herrschenden Bedingungen unterscheiden. Aufgrund ihrer spezifischen physikalischen Eigenschaften weisen Saumbiotope auch ihre eigenen Organismengemeinschaften auf. Manche Organismen gedeihen besonders gut in Saumbiotopen, weil sie Ressourcen aus beiden benachbarten Gebieten benötigen. Bsp. Kragenhuhn, Weisswedelhirsche. Die Vermehrung von Arten der Saumbiotope kann sich auf die Biodiversität einer Lebensgemeinschaft positiv oder negativ auswirken. Diese Gebiete könnten wichtige Orte der Artenbildung sein. Ein weiteres wichtiges Merkmal von Landschaften – insbesondere dort, wo Lebensräume stark fragmentiert wurden – sind Biotop- oder Wanderungskorridore, schmale Biotopstreifen oder -flecken, die ansonsten isolierte Flächen miteinander verbinden. Uferbiotope dienen oft als Korridore. In Gebieten mit starker Nutzung durch den Menschen werden bisweilen künstliche Korridore geschaffen. z.B. Unterführungen bei Autobahnen. Biotopkorridore können die Ausbreitung von Individuen fördern und dazu beitragen, dass in schwindenden Populationen die Inzucht reduziert wird. Besonders wichtig sind solche Korridore für Arten, die saisonal zwischen verschiedenen Lebensräumen wandern. Mögliche Nachteile von Korridoren: Ausbreitung von Krankheiten oder Parasiten Naturschutzbiologen müssen bei der Einrichtung von Schutzgebieten viele Probleme lösen Etwa 7% der Landfläche der Erde stehen unter staatlichem Schutz als Reservate. Nach welchen Kriterien erfolgt die Auswahl solcher geschützter Gebiete? Im Mittelpunkt stehen in erster Linie die sog. „Brennpunkte (hotspots) der biologischen Vielfalt“. Biodiversitäts-Hotspot: ein relativ kleines Gebiet, in dem besonders viele endemische Spezies sowie eine grosse Zahl von gefährdeten und vom Aussterben bedrohten Arten leben. Insgesamt gesehen umfassen die „heissesten“ der Biodiversität-Hotspots, darunter Regenwälder und Trockenbuschgebiete (Chaparral), weniger als 1.5% der Landfläche, sind aber die Heimat für 1/3 aller Pflanzen- und Wirbeltierarten. Nicht immer sind diese Hotspots aber ohne weiteres zu erkennen. Und selbst wenn es gelänge, alle Hotspots unter Schutz zu stellen, würden diese Massnahmen damit scheitern, die Biodiversität unseres gesamten Planeten zu erhalten. Erstens werden Wirbellose und Mikroorganismen oft nicht miteinbezogen und zweitens sind die Naturschutzreservate oft viel zu klein. Das bedeutet insbesondere, dass in Naturschutzmassnahmen einbezogen werden muss, wie das Umland für landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Zwecke genutzt wird. Naturreservate müssen funktionelle Bestandteile von Landschaften sein Solche geschützte „Inseln“ sind nicht von ihrer Umgebung isoliert und die Labilität der ökologischen Verhältnisse für Naturreservate gelten genauso wie für die Landschaft, in die sie eingebettet sind. Weil Störungen durch den Menschen und eine Zergliederung immer häufiger Merkmale von Landschaften darstellen, sind Dynamik von Biotopfragmenten, die Populationsdynamik, Saumbiotope und Biotopkorrido- 39/41 Kapitel 55 – Naturschutzbiologie re wichtige Faktoren für die Planung und das Management von Schutzgebieten. Ist es besser ein grosses Reservat oder eine Reihe kleinerer Reservate einzurichten? Für grossflächige Schutzgebiete spricht, dass Arten mit geringer Populationsdichte, die weit umherwandern, solche grossen Lebensräume benötigen. Zusätzlich weisen solche grossflächigen Gebiete weniger Peripheriebereiche auf als kleinere, so dass Randeffekte hier weniger zum tragen kommen. Dagegen spricht für kleinere, räumlich verteilte Reservate, dass sich hier nicht so schnell Krankheiten in einer Population ausbreiten. Meistens aber bleiben den Naturschützern jene Flächen überlassen, die für eine landwirtschaftliche oder forstwirtschaftliche Nutzung ungeeignet sind. Mehrere Länder haben daher ein System für das Landschaftsmanagement eingeführt, bei dem eine Zonierung der Reservate erfolgt. Ein zoniertes Schutzgebiet ist ein flächenmässig grosses Gebiet mit einem oder mehreren Teilgebieten ohne menschliche Eingriffe, umgeben von Flächen, die durch menschliche Aktivitäten verändert wurden und zur Erzielung wirtschaftlicher Gewinne genutzt werden (unter Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen). Die umgebenden Flächen dienen daher als Pufferzonen gegen weitere Störungen de ungestörten Kernzone. Die Restauration geschädigter Gebiete wird im Naturschutz zu einer immer wichtigeren Aufgabe Irgendwann werden durch Aktivitäten des Menschen veränderte Flächen zumeist aufgegeben. Die Fläche an geschädigten Lebensräumen und Ökosystemen nimmt ständig zu, weil die Sukzessionsprozesse der natürlichen Erholung langsamer verlaufen als die Zerstörung durch menschliche Aktivitäten. Ein neues Teilgebiet der Naturschutzbiologie, die Restaurationökologie, versucht, geschädigte Ökosysteme durch Anwendung ökologischer Prinzipien wieder in einen Zustand zurückzuführen, der ihrem natürlichen Zustand vor der Schädigung so nahe wie möglich kommt und den Rückgang von Populationen und Lebensgemeinschaften umkehren. Sie geht dabei von der grundlegenden Annahme aus, dass die meisten Schädigungen der Umwelt reversibel sind. Lebensgemeinschaften können aber vermutlich nicht mit unendlicher Elastizität auf Schädigungen reagieren. Eines der Ziele der Restaurationsökologie ist es zu erkennen, welche Prozesse die Erholung am stärksten verlangsamen, damit man auf diese Faktoren dahingehend einwirken kann, dass sich eine Lebensgemeinschaft schneller wieder von den Auswirkungen der Störungen erholt. Zwei grundlegende Strategien der Restaurationsökologie sind die Bioremediation und die Bioaugmentation von Ökosystemprozessen. Bioremediation oder biologische Sanierung: Entgiftung von verseuchten Ökosystemen mithilfe von lebenden Organismen, in der Regel Prokaryoten, Pilze oder Pflanzen. • Manche an Schwermetallböden angepasste Pflanzen vermögen hohe Konzentrationen potenziell toxischer Metalle wie Zink, Nickel, Blei und Cadmium anzureichern. Geschädigte Orte werden mit solchen Pflanzen begrünt, diese reichern die Metalle an und dann werden sie gerodet und damit die entsprechenden Metalle beseitigt. • Fähigkeit bestimmter Prokaryoten und Flechten Schwermetalle anzureichern: Flechtenart die auf Böden wachst die vom Uranabbau kontaminierten Böden wächst könnte als biologischer Indikator für Uran und möglicherweise zur Sanierung dienen, denn sie reichert das Uran in einem dunklen Pigment an, das dem Melanin der menschlichen Haut ähnelt. • Manche extremophilen Bakterien und Archaeen gedeihen in natürlichen Umgebungen, die von der Industrie verschmutzten Standorten ähneln. Einige Erfolge wurden mit dem Bakterium Pseudomonas erzielt. Zusammen mit wachstumsfördernden Mitteln wurde es eingesetzt, um die Folgen einer Ölpest an Stränden zu beseitigen. 40/41 Kapitel 55 – Naturschutzbiologie • Noch verbreiteter ist die Verwendung bestimmter Prokaryoten zum Abbau von Giften auf Müllhalden. • Zukünftig könne auch der Gentechnik eine immer grössere Bedeutung als Hilfsmittel zukommen, um den Einsatz bestimmter Arten zur biologischen Sanierung noch erfolgreicher zu gestalten. Bioaugmentation: man nutzt Organismen, um geschädigten Ökosystemen essenzielle Stoffe zuzuführen. Man muss feststellen, welche Faktoren, etwa chemische Nährstoffe, aus einem Gebiet eliminiert wurden und nun die Geschwindigkeit der Erholung mindern. Wenn man das Wachstum von Pflanzen fördert, die auf nährstoffarmen Böden gedeihen, lassen sich dadurch häufig sukzessionelle Veränderungen beschleunigen, die zur Erholung von geschädigter Standorte führen können. Das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung ist eine Neuorientierung ökologischer Forschung und eine Herausforderung an uns alle, unsere Wertvorstellungen zu überdenken Die Wissenschaft des Naturschutzes ist ein Schnittpunkt zahlreicher Facetten der Biologie wie Ökologie, Evolution, Physiologie, Molekularbiologie, Genetik und Verhalten. Unsere Bemühungen, Ökosystemprozesse aufrechtzuerhalten und dem Verlust der genetischen Variabilität Einhalt zu gebieten, verbinden die Naturwissenschaft auch mit den Sozialwissenschaften, der Ökonomie und den Geisteswissenschaften. Die Zukunft der Biosphäre könnte von unserer Biophilie abhängen, der Liebe zur Natur Nach Ansicht von Edward O. Wilson ist unsere Biophilie angeboren, ein entwicklungsgeschichtliches Produkt durch das Einwirken der natürlichen Selektion auf eine intelligente Art, deren Überleben davon abhing, dass sie eine enge Verbindung mit der Umwelt einging und Pflanzen und Tiere für sie greifbare Werte bedeuteten. Quellen Neil A. Campbell / Jane B. Reece, Biologie, 6. Auflage, Spektrum Verlag Vorlesungs-Folien Prof. Dr. Paul Schmid-Hempel, ETH Zürich 41/41