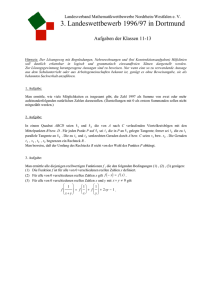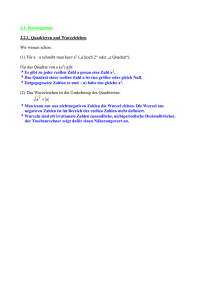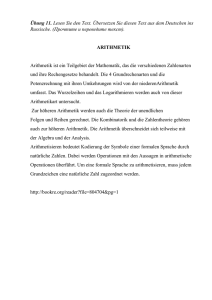nhpg-p 2713..2716 ++
Werbung

NHpG (48222) / p. 2621 /19.8.11 2611 Zahl Wagner, H. (1992), Die Würde des Menschen, Würzburg. Wolfgang H. Pleger Anmerkungen Vgl. Platon, Politeia 543 a–592 b. Cicero, De officiis I, 72 (zit. nach: Werke in drei Bänden. Bd. III, Berlin/Weimar 1989). 3 Ebd., 107. 4 Vgl. A. Grossmann, Art. ›Würde‹, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 12, Basel 2004, Sp. 1089. 5 Pico della Mirandola, Über die Würde des Menschen (1486), Zürich 1992, 9. 6 B. Pascal, Gedanken, übers. v. U. Kunzmann, Leipzig 1992, Nr. 200/347. 7 I. Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, in: Akademie-Ausgabe [= AA], Bd. IV, 385–463, 436. 8 I. Kant, Metaphysik der Sitten, AA VI, 434 f. 9 F. Schiller, Gesammelte Werke in fünf Bänden, Bd. 5, Gütersloh o. J., 149. 10 F. Lassalle, Das Arbeiterprogramm, in: Gesammelte Reden und Schriften, Bd. 2, hg. v. E. Bernstein, Berlin 1919, 147–202, 173. 11 F. Nietzsche, Werke in drei Bänden, Bd. 1, München 1954, 673. 1 2 M. Weber, Soziologie. Universalgeschichtliche Analysen. Politik, Stuttgart 1973, 173. 13 H. Plessner, Gesammelte Schriften, Bd. 5, Frankfurt a. M. 2003, 73. 14 J.-P. Sartre, Der Existentialismus ist ein Humanismus, Philosophische Schriften, Bd. I, Reinbek b. H. 1994, 133. 15 E. Bloch 1961 (Lit.), 14. 16 B. F. Skinner 1973 (Lit.), 220. 17 H. Jonas 1984 (Lit.), 246. 18 Platon, Kriton, 46 b; vgl. W. H. Pleger, Sokrates. Der Beginn des philosophischen Dialogs, Reinbek b. H. 1998. 19 W. Heidelmeyer 1997 (Lit.), 209. 20 T. Müller-Heidelberg u. a. (Hgg.), Grundrechtereport. Zur Lage der Bürger- und Menschenrechte in Deutschland, Reinbek b. H. 1997, 15. 21 K. Millett 1993 (Lit.), 9; vgl. Amnesty International, Bericht über die Folter, Frankfurt a. M. 1976, 34–39. 22 H. Ehmke, Flucht ins Grundsätzliche?, in: Der Spiegel, Hamburg 2001, H. 27, 40–42. 23 Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (Straßburg), 08/07/04 (Urteil der großen Kammer im Fall Vo gegen Frankreich); vgl. B. Wündisch, Süddeutsche Zeitung 10./11. 7. 2004; sowie V. Gerhardt, Ein Mensch wird geboren, München 2001. 12 Zahl 1. Bedeutung und Entstehung des Zahlbegriffs 2. Zahlen im allgemeinen Kontext 2.1 Die Zahlen des alltäglichen Rechnens 2.2 Zahlen und Handel 2.3 Rechenmaschinen und Computer 2.4 Zahlenmystik 3. Ontologie und Epistemologie der Zahlen 3.1 Synthetische Urteile a priori 3.2 Zahl, Einheit und Maß 3.3 Platonismus 3.4 Logizismus und Formalismus 3.5 Konstruktive und konstruktivistische Zugänge 3.6 Zahlbegriffe in der Analytischen Philosophie 3.7 Phänomenologische Grundlegungen 3.8 Zahlen im Empirismus 4. Zahlen in der Mathematik 4.1 Verschiedene Zahlbereiche 4.2 Kardinal- und Ordinalzahlen; das Unendliche 4.3 Mathematische Teildisziplinen 1. Die Geschichte der Zahlen ist weder die Geschichte des Zählens noch des Rechnens. Es gab und gibt Völker, die ohne abstrakten Zahlbegriff (also ohne Zahlen, die von konkreten Gegenständen losgelöst gedacht werden) auskommen und doch über Zählverfahren verfügen, die auf eindeutigen Zuordnungen zwischen den zu zählenden Objekten und besser handzuhabenden Objekten beruhen. Etwa Körperteile oder Steine werden verwendet, aber auch ausgeklügeltere Systeme, die verschiedene Stellungen der Hand nützen. In manchen Fällen werden mit Hilfe dieser Objekte sogar Additionen ausgeführt, das Zählen lässt sich jedoch nicht als sukzessive Addition von 1 begreifen, solange der Zählvorgang nicht isoliert von den Gegenständen betrachtet wird. 1 Grundsätzlich stellt sich die Frage, wann – bei Erfüllung welcher Bedingungen – man überhaupt vom Vorhandensein eines Zahlbegriffs sprechen möchte. Das intuitive Erkennen bzw. Unterscheiden von Anzahlen, wie es auch Kleinkinder 2 oder Tiere vermögen, bildet das eine Ende einer Skala, an deren anderem Ende das formale (axiomatische) Festlegen von Zahlen steht. Da das unmittelbare Erfassen von Anzahlen nur für sehr geringe Quantitäten (bis etwa 5) möglich ist, werden »technische« Hilfsmittel wie Knoten in NHpG (48222) / p. 2622 /19.8.11 Zahl Schnüren, Hölzer etc. sehr bald nötig; damit ist klar, dass die Entwicklung von Rechenmaschinen vom Fortschritt des Rechnens von allem Anfang an untrennbar ist. 3 Die Symbolisierung von (An-)Zahlen durch Zahlzeichen spiegelt die Intensität der Bindung von Zahlen an Gegenstände wider. So gibt es Sprachen, in denen jeweils verschiedene Ausdrücke für »zwei Bäume«, »zwei Schafe« etc. existieren. Vor allem bei den mündlichen Zahlzeichen gibt es noch eine andere – komplementäre – Art, wie sie an Gegenstände gebunden sind: Nicht Zeichen, die an die verschiedenen Gattungen von Objekten gebunden sind, sondern eine Sorte Objekt wird in den allgemeinen Zahlbegriff inkorporiert: das männliche Glied oder die Sonne z. B. stehen für 1, Brüste oder Augen für 2, etc. Ab dem Stadium, in dem Zahlen bereits durch schriftliche Zeichen dargestellt werden, wird die Geschichte der Zahlen üblicherweise vor allem als eine Geschichte der Zahlsysteme geschrieben. Neben dem Dezimalsystem, das auf den anatomischen »Zufall« der Beschaffenheit unserer Finger zurückzuführen ist, wurden noch andere Systeme verwendet: z. B. das Vigesimalsystem (Basis 20) u. a. von den Kelten, Mayas und Azteken, das Hexagesimalsystem (Basis 60) von den griechischen und arabischen Astronomen (seine Verwendung rührt von der Nützlichkeit beim Rechnen mit Winkeln her). Im Computerzeitalter als nützlich erwiesen hat sich das von G. W. Leibniz entwickelte und bei ihm theologisch begründete Binärsystem (Basis 2), das aber für das herkömmliche Rechnen wegen der vielen Stellen, die zu einer Darstellung einer großen Zahl nötig sind, unpraktisch ist. Als genuiner Ort der Zahlen kommen mindestens der Supermarkt, das Mathematikbuch und die ewige Wahrheit in Betracht. Paradigmatische Vertreter der entsprechenden philosophischen Versuche, den begründungstheoretischen Ursprung der Zahlen festzumachen, sind L. Wittgenstein, B. Russell und Platon oder auch – in ganz anderem Sinn – I. Kant. 2. Zahlen stellen zwar keine Schrift im Sinne der Sprachwissenschaft dar, sind aber doch »einer Schrift insoweit vergleichbar, als sie eine ähnliche Funktion erfüllen: Sie halten ein vergangenes Geschehen fest und sichern das Weiterbestehen vertraglicher Bindungen zwischen den Mitgliedern der Gesellschaft«. 4 Dabei sind die »vertraglichen Bindungen« durchaus in einem sehr weiten Sinn 2612 zu verstehen, sodass sie etwa auch kulturell-religiöse Praktiken umfassen. 2.1 Grundlegend für das heutige elementare Rechnen sind Ziffern und Stellenwertsystem, insbesondere die Dezimaldarstellung, in der die Ziffern verwendet werden, um Vielfache der Potenzen von 10 darzustellen. Besonders große bzw. kleine Zahlen werden bevorzugt in Gleitkommadarstellung angeschrieben, also in der Form a 10b bzw. a 10-b, wobei a eine Zahl zwischen 0 und 1 in Dezimaldarstellung und b eine natürliche Zahl ist. Zwischen den Zahlen des täglichen Umgangs und den Zahlen, die im Rahmen philosophischer und formaler Theoriebildung definiert werden, besteht ein Prioritätenstreit, den der späte Wittgenstein zugunsten der Zahlen im gewöhnlichen Gebrauch entscheidet: Ob eine Rechnung im Rahmen eines Kalküls (wie jenem B. Russells etwa) richtig ist – ja sogar ob der ganze Kalkül akzeptabel ist –, entscheiden wir aufgrund unserer Kenntnisse des gewöhnlichen Rechnens. 2.2 Ein Bedarf nach ausgefeilteren Rechentechniken entsteht mit der Einführung des Geldes in den Handel. Dabei ist zu beachten, dass nicht allein die Mühseligkeiten der Praxis des Tauschhandels, des Transports der Güter etwa, die Entwicklung des Handels mittels Geld gefördert haben, sondern auch das Problem der Genauigkeit des Umrechnens zwischen den Werten verschiedener Waren dazu beigetragen hat. (Eine Zwischenstufe bildet die Verwendung »normierter« Tauschobjekte, deren Wert als fest angesetzt wird, auf den dann der Wert aller anderen Objekte zu beziehen ist.) Zahlen fungieren hier also einerseits qua Abstraktheit (kein Transportproblem), andererseits als Maßstab. 2.3 Die Entwicklung der Rechenmaschinen geht Hand in Hand mit theoretischen Fortschritten. So bedeutet etwa die Tatsache, dass bei Abakus und Rechenbrett ein Stein unterschiedlich viel Wert hat, je nachdem, an welchen Platz er gesetzt ist, eine wichtige Station bei der Einführung des Stellenwertsystems. Die Rechenkompetenz bleibt dabei teilweise bei der Person, die die Rechnung ausführt. Den Versuch, die Mathematik gänzlich dem Rechner zu übertragen, kann man – je nach Auffassung – durch die Arbeiten von K. Gödel und A. Turing als gescheitert ansehen. Gödels erstes Unvollständigkeitstheorem 5 besagt, dass jedes widerspruchsfreie formale System, das die Arithmetik umfasst, unvollständig in dem Sinn ist, dass man einen in diesem System formulierbaren Satz angeben kann, der in dem System weder beweisbar noch widerleg- NHpG (48222) / p. 2623 /19.8.11 2613 bar (die Verneinung beweisbar) ist. Das kann man so interpretieren, dass die Zahlentheorie, wie sie der Intuition entspricht, prinzipiell nicht formalisierbar ist. Turing hat dieses Ergebnis in ein Resultat betreffend das sog. Halte-Problem übersetzt, bei dem es darum geht, einen Algorithmus anzugeben, mit dem man bei Computern, Programmen oder Automaten feststellen kann, ob sie nur für gewisse oder für alle Eingaben anhalten oder nicht. Für eine bestimmte Sorte von Computern bzw. Programmen, die sog. Turingmaschinen, ist das Halteproblem nicht entscheidbar. In der gegenwärtigen Praxis der Mathematik wird diskutiert, inwiefern Computer eingesetzt werden dürfen, wenn ein Beweis eines mathematischen Satzes ein Beweis in einem rigiden Sinn bleiben soll. Im Anschluss an I. Lakatos’ Theorie einer »quasi-empirischen Mathematik« wird argumentiert, 6 dass es ohnehin immer schon außermathematische Gegebenheiten auch sind, denen wir vertrauen müssen, wenn wir Mathematik betreiben, und der Computer in dieser Hinsicht keine Ausnahmestellung habe. 2.4 Zahlenmystische Betrachtungsweisen gehen davon aus, dass Zahlen über ihren Rechenwert hinaus eine Bedeutung haben, oft enthalten die Darstellungen Elemente der Zahlentheorie. In der Antike ist die Zahlenmystik vom wissenschaftlichen Umgang mit Zahlen kaum zu trennen, da etwa bei den Pythagoreern auch der Bau der Welt, die Harmonien in der Musik, … als Zahlengesetzmäßigkeiten unterworfen gedacht werden. Aber auch später treten aus einem Harmoniebedürfnis geborene Anschauungen auf, die zahlenmäßige Zusammenhänge als weltbestimmend ansehen. J. Kepler gibt eine Erklärung für die Form der Planetenbahnen, die ganz in dieser Tradition steht. Diese Überlegungen unterscheiden sich vom quantifizierenden Umgang der modernen Physik mit Naturphänomenen dadurch, dass es in der modernen Physik Funktionszusammenhänge sind, nicht feste Verbindungen zwischen einzelnen Zahlen, die zur Beschreibung der Gegebenheiten verwendet werden. Der Platz, an dem man Zahlenmystik am ehesten erwartet, ist die Religion. Obwohl dort Zahlenmystik eher als Schau Gottes verstanden wird, bedeutet das nicht notwendig ein Weniger an ratio. Verschiedene religiös-philosophische Strömungen wie die christliche Gnosis und die arabische Philosophie kennen Zahlenmystiken, die nicht allein auf einem kontemplativen Umgang mit Zahlen beruhen, son- Zahl dern auch theoretisch anspruchsvolle Konzeptionen aufweisen. In der jüdischen Philosophie ist die Kabbala u. a. von G. Scholem wissenschaftlich untersucht worden. Die Lehre von den Sefiroth, den zehn »Potenzen, in denen sich die wirkende Gottheit konstituiert« 7, bildet einen Kernbestandteil. Den Sefiroth wird eine lange Liste von Beschreibungen zugesprochen wie z. B. »zehn Throne, auf denen er [Gott] die Völker richtet, […] zehn Zwecke, nach denen alles Verlangen trägt, die aber nur die Gerechten erreichen, zehn Lichter, die alle Intelligenzen erleuchten« 8 und eben auch »zehn Zahlen, Maße und Gewichte, durch die alles gezählt, gewogen und gemessen wird«. Die Sefiroth, die auch die zehn Urzahlen heißen, werden zwar als metaphysische Weltprinzipien verstanden, dennoch verbindet sie mit der die Neuzeit prägenden Philosophie R. Descartes’ die nachgerade positivistische Idee einer auf Kombinatorik beruhenden Weltbeschreibung. Und auch ideengeschichtlich dürfte es Zusammenhänge geben: Bildliche Darstellungen der Sefiroth in Gestalt eines Baumes weisen starke Ähnlichkeiten mit jener der Kategorien bei R. Lullus auf. Descartes grenzt sich von Lullus zwar ab, und die von ihm zugrunde gelegten Größen sind ganz und gar nicht die innersprachlich wirkenden Kräfte oder mystisch-metaphysischen Gegebenheiten der Kabbala, aber auch er meint in seiner frühen Phase alle Sicherheit auf das Messen und Kombinieren von Grundgrößen zurückführen zu können, nützt also die Zahl als Fassung einer Quantität sowie zur Beschreibung von Kombinationen. 3. Die Diskussionen um die epistemischen und ontologischen Grundlagen der Mathematik lassen sich einteilen in solche, die eher von MathematikerInnen initiiert sind, und solche, die eher von PhilosophInnen angeregt wurden. Zu ersteren zählen vor allem die Positionen, die in der sog. Grundlagenkrise um 1900 entwickelt worden sind: Formalismus, Logizismus, Intuitionismus, … Zu letzteren gehören u. a. die einschlägigen Überlegungen in Transzendentalphilosophie, Empirismus und Phänomenologie. Die vielleicht grundlegendste Frage in der Beschäftigung mit der Epistemologie der Zahlen besteht in folgendem (vermeintlichen) Dilemma: Wenn den Objekten und Zusammenhängen der Mathematik eine Existenz und Gültigkeit unabhängig von der Empirie zukommt, wie können wir dann wissen, dass sie sich auf die Wirklichkeit an- NHpG (48222) / p. 2624 /19.8.11 Zahl wenden lassen? Wenn die mathematischen Sätze aber empirisch fundiert sind, wie können sie dann »ewige Wahrheiten« sein? Der Umgang mit diesem Problem hat Konsequenzen für die Bestimmung des Verhältnisses von reiner und angewandter Mathematik ebenso wie für die Frage, wie es neue Erkenntnis in der Mathematik geben kann. 3.1 Die letztgenannte Frage beantwortet I. Kant durch die Aussage, mathematische Sätze wären synthetische Sätze a priori. In der klassischen Philosophie wird die empirische Anwendbarkeit der Mathematik auf die Idealität der mathematischen Entitäten oder Vorstellungsweisen zurückgeführt. Platon denkt dieses Verhältnis als Teil-Ganzesoder Ähnlichkeitsbeziehung. Für Kant ist mathematische Erkenntnis rein apriorische Erkenntnis, allerdings bedarf sie im Unterschied zu einer nur begrifflichen der Anschauung. Mathematische Beweisführung erfolgt über die Konstruktion von Begriffen in der reinen Anschauung, daher sind mathematische Sätze synthetisch. Anschauung bedarf aber des Bezugs auf das reine Mannigfaltige von Raum und Zeit. Da nun aber die Formen der Sinnlichkeit die Grundbedingungen des Erscheinenkönnens von etwas darstellen, müssen sie – und mit ihnen die Mathematik – auch jederzeit »anwendbar« sein in dem Sinn, dass die empirischen Gegenstände den apriorischen Formen der endlichen Vernunft konform sein müssen. 9 Damit ist aber auch die Frage der Anwendbarkeit kein Grundproblem mehr für Kant. Innerhalb des so abgesteckten Rahmens erklärt Kant die Zahl als »die Synthesis des Mannigfaltigen einer gleichartigen Anschauung überhaupt, dadurch, dass ich die Zeit selbst in der Apprehension der Anschauung erzeuge« 10. 3.2 Damit sich die Frage nach der Anwendbarkeit der Mathematik, insbesondere der Arithmetik, überhaupt stellen kann, muss zuvor eine Entwicklung in die Gegenrichtung stattgefunden haben: Die Zahlen müssen sich in zweifacher Weise in der Geschichte erst von den Dingen loslösen. Ein Verständnis von Einheiten muss sich entwickeln, und die Zahlen müssen aus dem materiellen Zusammenhang abstrahiert werden. Zunächst sind für Thales Zahlen geometrische Bestimmungsstücke, für die Pythagoreer Harmonieprinzipien, mit denen sowohl kosmologische Phänomene und Naturphänomene als auch Vorkommnisse wie Gerechtigkeit erklärt werden können. Der Pythagoreer Philolaos formuliert: »Und in der Tat hat ja alles, was man erkennen kann, Zahl. Denn es ist nicht mög- 2614 lich, irgendetwas mit dem Gedanken zu erfassen oder zu erkennen ohne diese.« 11 Zahlen sind also allgegenwärtig, damit aber auch noch nicht von ihrem materiellen Kontext zu trennen. Den zweiten Bestandteil des Loslösungsprozesses, der zum heutigen Verständnis von Zahlen führt, bildet die Etablierung von Einheiten. Aristoteles schreibt dieses Verdienst Platon zu: »Ferner erklärt er [Platon], daß außer dem Sinnlichen und den Ideen die mathematischen Dinge existierten, als zwischen ihnen liegend, unterschieden vom Sinnlichen durch ihre Ewigkeit und Unbeweglichkeit, von den Ideen dadurch, dass es der mathematischen Dinge viel gleichartige gibt, während jede Idee nur eine, sie selbst, ist.« 12 Dass das Zählbare das Eine ist, hat zusammen mit der Auffassung, dass alles Zahl ist, die Konsequenz, dass das Seiende und das Eine dasselbe sein müssen. Von hier aus zieht sich ein Interesse an Einheiten durch die Geschichte, das sich in der scholastischen Metaphysik im »ens et unum convertuntur« niederschlägt, bei Leibniz in seiner Monadologie und in der Transzendentalphilosophie darin, dass der Verstand häufig überhaupt als das Vermögen Einheit zu stiften ausgelegt wird. In R. Descartes’ wissenschaftstheoretischer Phase, die man in den Regulae ad directionem ingenii niedergelegt findet, erhält das Tripel Zahl – Einheit – Maß bzw. Relation eine zentrale Bedeutung. Erkenntnis soll gestützt sein auf Proportionen zwischen messbaren Größen, die vielfach geometrische Größen sind. Descartes bindet die Zahl in einer homogeneren Weise als die Mathematiker vor ihm an die Geometrie: Zahlen und Variablen werden konsequent als Längen gedeutet, auch wenn es sich etwa um Quadratzahlen handelt – die vor Descartes häufig als Flächeninhalte aufgefasst werden. So ist eine systematische Übersetzbarkeit von Zusammenhängen zwischen Zahlen in solche zwischen geometrischen Größen und umgekehrt gewährleistet. Dabei spielt die Einheit eine wesentliche Rolle: »Nicht erkenne ich, welches Größenverhältnis zwischen zwei und drei besteht, wenn ich nicht etwas drittes berücksichtigt habe, nämlich die Einheit, die das gemeinsame Maß für beide ist.« 13 Descartes’ Arithmetisierung der Geometrie (und ihre Algebraisierung, die die Analytische Geometrie geboren hat) bildet eine unabdingbare Grundlage für die moderne Naturwissenschaft. 3.3 Jene Position in der Grundlagendiskussion der Mathematik, die »Platonismus« 14 genannt wird, ist nicht die Lehre Platons zum Thema Zahlen. Meist wird unter Platonismus im Zusammenhang mit der NHpG (48222) / p. 2625 /19.8.11 2615 Mathematik nur die Behauptung verstanden, mathematische Sätze wären dadurch a priori gültig, dass den mathematischen Entitäten ein für sich bestehendes ideales Sein zugewiesen wird. Worin dieses Sein bestehe und wie es zustande komme, wird selten erklärt, die Argumentation verläuft in die andere Richtung: Es muss ein solches Sein geben, sonst wären viele Erfahrungen mit der Mathematik nicht verständlich, z. B. der Eindruck von Mathematikern, dass sie etwas entdecken, nicht erfinden oder konstruieren. Eine zwischen Platonismus und konstruktiven Ansätzen vermittelnde Position formuliert L. Kronecker in seinem berühmten Zitat: »Die ganzen Zahlen […, -4, –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, 4 … ; Verf.] hat der liebe Gott gemacht, alles andere ist Menschenwerk.« 15 Als direkter Gegenspieler des Platonismus kann der Nominalismus angesehen werden, der bestreitet, dass den mathematischen Begriffen irgendeine Realität außerhalb der sprachlichen Ebene zukommt. 3.4 Das Anliegen, die Mathematik, insbesondere die Arithmetik, auf eine rein formale Basis zu stellen, wird von Logizismus und Formalismus geteilt. Allerdings soll diese Basis im Logizismus eine Axiomatik für die Logik, im Formalismus eine für die Mathematik selbst sein. Der Versuch, die Arithmetik auf die Logik zurückzuführen, geht auf G. Frege zurück, wird dann von B. Russell und A. N. Whitehead in den Principia Mathematica 16 weiter vorangetrieben. Nach Frege kommen Zahlen nicht Dingen zu, sondern Begriffen, sind aber nicht Eigenschaften von Begriffen, sondern selbständige Gegenstände. Er motiviert folgende Definition: »Die Anzahl, welche dem Begriffe F zukommt, ist der Umfang des Begriffs ›gleichzahlig dem Begriffe F‹.« 17 Russell und Whitehead erklären Zahlen mittels Äquivalenzklassen gleichgroßer Klassen. 2 etwa ist die Klasse aller zweielementigen Klassen. (Dabei ist zu beachten, dass in den Principia Mathematica Klassen nichts Anderes als Prädikate in einem gewissen Gebrauch sind.) Die Einführung von Typen, die durch die Antinomien im Rahmen einer naiven Vorstellung von Klassen notwendig wurde, hat die befremdliche Konsequenz, dass es (ohne Zusatzmaßnahmen) für jeden Typ eigene Zahlen gibt. Die spezielle Form der Theorie, die in den Principia Mathematica entwickelt wird – eine sog. verzweigte Typentheorie –, setzt sich aber aus anderen Gründen ohnehin nicht einheitlich durch, so dass sich die Bestrebungen hier in verschiedene Richtungen verlaufen bzw. diversifizieren. Einer Zahl der späteren Versuche findet sich im Werk von W. V. O. Quine. Hauptvertreter des Formalismus ist D. Hilbert, der die Axiomatisierung der Arithmetik in den allgemeineren Zusammenhang einer Formalisierung der gesamten Mathematik gestellt und eine Loslösung – in einem gewissen Sinn – vom semantischen Gehalt der Grundbegriffe gefordert hat. Was immer die entsprechenden Axiome erfüllt, sind nach seiner Auffassung die reellen Zahlen. Als einzige Bedingung, die Zahlen – oder allgemein: mathematische Objekte – erfüllen müssen, damit man sagt, sie existieren, gilt somit die Widerspruchsfreiheit des Axiomensystems. 3.5 Konstruktivismus in der Mathematik kann in weiterem (1) und engerem Sinn (2) verstanden werden. (1) Wenn an die Stelle der Teilhabebeziehung im Platonismus das menschliche Erkenntnisvermögen als gestaltende Kraft für die Mathematik tritt, dann ist eine der Eigenschaften eines konstruktiven Zugangs im allgemeinsten Sinn erfüllt. Schon Aristoteles formuliert die Auffassung, dass die mathematischen Objekte kein für sich bestehendes Sein haben, sondern von Menschen durch Idealisierung aus den vorliegenden Dingen gewonnen werden. Die Unendlichkeit etwa (die Punkte auf einer Geraden, die Länge einer Geraden, …) ist nur so zu verstehen, dass existiert, was durch die jeweils erforderlichen Operationen wirklich schon gewonnen ist. Dieses konstruktive Verständnis der mathematischen Gegenstände wird von Kant weiterentwickelt. (2) Mehrere moderne Positionen vertreten ein konstruktives Konzept in einem engeren Sinn. (Diese Positionen beziehen sich sämtlich auf die Mathematik allgemein, im Folgenden werden sie aber primär in Hinblick auf ihr Verständnis von Zahlen dargestellt.) Die Theorie, die dabei vielleicht am direktesten an Kant anknüpft, ist jene von P. Lorenzen. Den Leitgedanken seiner »operativen« Mathematikauffassung 18 findet man auch schon bei G. W. F. Hegel – der somit als Mittler zu Kant angesehen werden kann – ausgesprochen: »Die Arithmetik betrachtet die Zahl und ihre Figuren, oder vielmehr betrachtet sie nicht, sondern operiert mit denselben.« 19 Lorenzen teilt mit Kant die Ansicht, dass mathematische Zusammenhänge durch synthetisierendkonstruierende Akte entstehen, aber während es bei Kant Vorstellungsakte sind, handelt es sich bei Lorenzen um empirische Handlungen wie das An- NHpG (48222) / p. 2626 /19.8.11 Zahl einanderreihen von Strichen, das Eben-Schleifen von Platten etc. Logik und Mathematik versteht Lorenzen als Lehren vom Operieren nach bestimmten Regeln. Zahlen werden nicht axiomatisch festgelegt, sondern von uns hergestellt, sie sind Produkte von Zähloperationen, i. e. für die natürlichen Zahlen (er nennt sie »Grundzahlen«) das Aneinanderreihen von Strichen, für die reellen Zahlen bedarf es komplizierterer Regeln für Operationen. Der »radikale Konstruktivismus« geht in seinem Anspruch insofern weiter, als er jegliche Erkenntnis, nicht nur die mathematische konstruktivistisch fassen möchte. Das hat aber auch auf das Verständnis von Mathematik unmittelbare Auswirkungen, weil sich damit die Handlungen, die die Zahlen etc. konstituieren, ebenfalls in einem breiteren Kontext rechtfertigen müssen, etwa wird der Erinnerungsakt beim Zählen ein Thema. 20 Ein sehr spezifisches Verständnis von »konstruktiv« ist auch jener Position der Grundlagenkrise zuzuschreiben, die »Intuitionismus« (oft synonym mit »Konstruktivismus«) genannt wird. »Intuitionismus« meint dabei nicht, dass die Zahlen, die Mathematik schlichtweg »intuitiv« gegeben wären, lediglich die natürlichen Zahlen werden im Intuitionismus meist als undefinierbar vorausgesetzt. Dieser Umstand ist aber nicht das Wesentliche am Intuitionismus: Der Kerngedanke besteht darin, dass nur solche Beweise anerkannt werden, in denen das Gesuchte auch explizit angegeben wird, innerhalb des Formalismus »konstruiert« wird. Das tertium non datur wird somit nicht uneingeschränkt anerkannt. (Wenn man z. B. an der Existenz einer Zahl mit einer gewissen Eigenschaft interessiert ist, reicht es konstruktivistisch betrachtet nicht, zu zeigen, dass eine von zwei Zahlen diese Eigenschaft haben muss, solange man nicht angeben kann, welche.) Der Intuitionismus ist dem Formalismus nicht insofern entgegengesetzt, als er grundsätzlich weniger formalisiert wäre; die ursprünglichen Überlegungen von L. Brouwer und H. Weyl 21 wurden von A. Heyting zu einem Formalismus ausgearbeitet, der in einer Modifikation der Annahmen der »klassischen« Analysis besteht. Wird der Intuitionismus ernst genommen, so hat er von allen Grundlegungsbestrebungen die deutlichsten Auswirkungen auf die Praxis des Mathematikbetreibens, da wichtige Sätze der üblichen Analysis dann keine Gültigkeit haben. Mit einem ausgeprägter philosophischen Hintergrund als Weyl und Brouwer widmet sich später M. Dummett dem Intuitionismus. 2616 3.6 Als prägende Auffassung für die Analytische Philosophie muss zweifellos der Logizismus angesehen werden. Freges und Russells Arbeiten dienen als Referenzpunkte für die Arbeiten L. Wittgensteins, R. Carnaps, W. V. O. Quines, N. Goodmans, H. Putnams, u. v. a. Wittgenstein definiert im Tractatus logico-philosophicus 22 die Zahlen über das mehrmalige Hintereinanderausführen von Operationen. Er wendet sich damit insofern gegen Frege, als die so gewonnenen Zahlen keine oder eine andere Art der Eigenständigkeit haben, und insofern gegen Russell, als Zahlen nicht in einer Kontinuität mit dem Aufbau der sonstigen Theorie stehen wie bei Russell. Eben damit beweist er aber auch schon in seiner frühen Philosophie eine Ahnung von dem, was seine spätere Philosophie prägen wird: Die Rolle von mathematischen Sätzen ist eine wesentlich andere als jene von empirischen Sätzen, und Zahlen sind auch keine Begriffe. 23 Rechnungen sehen wir als normativ in dem Sinn an, dass wir im Fall, dass eine Beobachtung einer elementaren Rechnung widerspricht, nicht der Rechnung misstrauen, sondern die Ursache in etwas anderem suchen. (Würden wir allerdings zu oft Beobachtungen machen, die mathematischen Sätzen widersprechen, so würden wir schließlich die mathematischen Sätze für sinnlos erklären und nicht mehr verwenden.) Wittgenstein verlässt hier insofern den Boden der traditionellen Analytischen Philosophie, als er mathematische Sätze nicht als analytisch oder aus (formal-) logischen Gründen geltend ansieht. Viele Philosophen in der Analytischen Philosophie wie etwa Quine oder Putnam üben auf das heutige Verständnis vom Zahlbegriff großen Einfluss aus, aber nicht vorrangig, indem sie originäre Beiträge zum Thema »Zahl« liefern. Quine z. B. untersucht den Begriff »analytisch« und nimmt Differenzierungen vor, die die Zahlen relativ zu empirischen Begriffen, den positiven Wissenschaften etc. neu positionieren. Bei Carnap bekommen Zahlen dadurch einen innerhalb der Analytischen Philosophie eher singulären Stellenwert, dass er Koordinatensprachen in Betracht zieht, also (formale) Sprachen, in denen die Objekte, über die etwas ausgesagt werden soll, sämtlich durch Zahlen wie etwa ihre räumlichen Koordinaten bestimmt sind. Zahlen fungieren hier in der Rolle, die üblicherweise Namen zukommt, sie identifizieren die ontologisch bzw. epistemologisch grundlegenden Objekte. 3.7 Die phänomenologischen Grundlegungsver- NHpG (48222) / p. 2627 /19.8.11 2617 suche für die Zahlen unterscheiden sich von jenen der Analytischen Philosophie u. a. darin, dass jene nicht (mehr) das Verhältnis zwischen Zahl, Begriff, (Symbol) und Gegenstand allein als bestimmend ansehen, sondern weitere Komponenten der Konstitution mit einbeziehen. E. Husserl lässt selbst in seiner frühen, noch von F. Brentano geprägten psychologistischen Phase das tätige Subjekt bei der Konstitution der Zahlen wesentlich vorkommen, nämlich eben in Gestalt des psychischen Akts. In seiner Frühschrift Philosophie der Arithmetik gibt Husserl an, wie Zahlen gebildet werden: »Absehend von der besonderen Beschaffenheit der Einzelinhalte, betrachtet oder behält man einen jeden nur, insofern er ein Etwas oder Eins ist, und gewinnt so mit Rücksicht auf die kollektive Verbindung derselben, die zu der vorliegenden Vielheit gehörige allgemeine Vielheitsform: eins und eins, usw., und eins, mit welcher ein bestimmter Zahlenname assoziiert wird.« 24 Die Bestimmung des »Wieviel?« bzw. der Zählvorgang setzen Einheiten zu einer bestimmten Vielheitsform zusammen und wirken so konstitutiv für die Zahlen. (Wie schon bei Lorenzen lässt sich auch hier Hegel als Vorläufer zitieren: »Das erste Erzeugen der Zahl ist das Zusammenfassen von Vielen als solchen, d. i. deren jedes nur als Eins gesetzt ist, – das Numerieren.« 25) Der Arithmetiker rechnet aber nicht mit diesen so gewonnenen abstrakten Zahlbegriffen, denn dann würde, so Husserl, 5 und 5 wieder 5 ergeben wie Gold und Gold wieder Gold ergibt, sondern ein Satz der Arithmetik sagt etwas über beliebige Mengen aus, deren Anzahlen sich entsprechend dem arithmetischen Satz verhalten. Wird »Zahl« hier zunächst als Anzahl verstanden, so bleibt dies doch nicht der einzige Zahlbegriff, den Husserl berücksichtigt: neben den so gewonnenen »natürlichen Zahlen« kommen wir auch noch auf anderem Weg zu Zahlen; die Grundrechnungsarten verstehen wir nicht nur inhaltlich, sondern auch als formales Operieren mit Zahlen. Zusammen mit den Erfordernissen des Erweiterns der Zahlbereiche hat es Husserl dazu veranlasst, auch den Umgang mit »symbolischen Zahlen« zu erklären. Husserls Weg von der Mathematik in die Phänomenologie führt weite Strecken über die Logik. Während der Zeit seiner Beschäftigung mit der Logik kommt die Mathematik in seinen Ausführungen wenig vor. Erst viel später wendet er sich der Mathematik wieder zu, wobei ihn dann hauptsächlich die Analysis – somit das Konzept der reellen Zahl Zahl statt das der Anzahl bzw. der natürlichen Zahl – und das Zusammenspiel mit der Logik interessieren. M. Heideggers Beschäftigung mit der Mathematik erfolgt weniger frontal. In seiner 1924 gehaltenen Marburger Vorlesung über Platons Sophistes meint er zur Methode der Sophisten: »Rechnen meint hier nicht zählen, sondern rechnen auf etwas, berechnend sein; erst aus diesem ursprünglichen Sinn von Rechnen hat sich dann die Zahl ausgebildet.« 26 In der Kritik am Berechnen klingt schon an, was Heidegger die Mathematik später noch mehr verdächtig machen wird: ihre Nähe zur Technik. O. Becker unternimmt es, die Heideggerschen Überlegungen in eine der Mathematik wohlwollende Richtung zu wenden. 3.8 Den Umgang mit Zahlen im Empirismus zeichnet die Art und Weise aus, wie Zahlen nicht ausgezeichnet werden: Sätze der Mathematik haben keine apriorische Gültigkeit, sondern sind empirisch, in gewisser Hinsicht wie alle anderen Sätze auch. J. St. Mill formuliert: »All numbers must be numbers of something; there are no such things as numbers in the abstract. Ten must mean ten bodies, or ten sounds, or ten beatings of the pulse. But though numbers must be numbers of something, they may be numbers of anything. Propositions, therefore, concerning numbers have the remarkable peculiarity that they are propositions concerning all things whatever.« 27 Da alle Dinge Quantitäten sind, setzt Mill fort, gelten Zahlenaussagen für alle Dinge (Entsprechendes gilt nicht ebenso selbstverständlich für andere mathematische Objekte, wie z. B. geometrische). Für das Erkennen der Gültigkeit solcher Aussagen macht er, wie auch schon D. Hume, Induktionen (mit)verantwortlich. Es ist also die Universalität der Resultate, nicht der Erkenntnisprozess, der den Umgang mit Zahlen im Empirismus charakterisiert. 4. Während es wenig erstaunlich anmutet, dass historisch und alltagssprachlich nicht genau zu fassen ist, was unter einer Zahl zu verstehen ist, kann man wohl als bemerkenswert bezeichnen, dass das auch in der Mathematik nicht klar ist. Es gibt natürliche Zahlen, ganze Zahlen, rationale Zahlen etc., aber keine wie auch immer geartete Definition von »Zahl« schlechthin. Das liegt u. a. daran, dass nur bis ins 19. Jh. die Zahl als Grundlage der Mathematik gilt, dann aber die Mathematik sich vor allem unter dem Einfluss der Algebra und Mengentheorie zu einer Theorie allgemeinerer Struktu- NHpG (48222) / p. 2628 /19.8.11 Zahl ren wandelt, für die die Arithmetik nur eine Struktur unter anderen ist, und so die Hemmungen, auch den Zahlbegriff zu diversifizieren, geringer werden. Andere Gründe für Erweiterungen des Zahlbegriffs sind in den Erfordernissen moderner physikalischer Theorien zu finden. 4.1 Die erste Axiomatisierung der Arithmetik wird von G. Peano gegen Ende des 19. Jh. angegeben – also mehr als 2000 Jahre, nachdem Euklid einen Versuch unternommen hat, die Geometrie zu axiomatisieren. Peano erklärt die natürlichen Zahlen folgendermaßen: (1) 1 ist eine natürliche Zahl. (2) Jede natürliche Zahl hat einen eindeutig bestimmten Nachfolger in den natürlichen Zahlen. (3) 1 ist nicht Nachfolger einer natürlichen Zahl. (4) Zwei verschiedene natürliche Zahlen haben nie den gleichen Nachfolger. (5) Jede Eigenschaft, die 1 zukommt, und mit jeder natürlichen Zahl auch ihrem Nachfolger, kommt allen natürlichen Zahlen zu. Die Ausdrücke »1« und »Nachfolger« sind dabei undefinierte Ausdrücke. Für die so definierten natürlichen Zahlen (ob die natürlichen Zahlen mit 0 oder 1 beginnen, ist eine Konventionsfrage, die nicht einheitlich gelöst ist) kann man Addition und Multiplikation festlegen, die Subtraktion führt allerdings aus diesem Zahlbereich hinaus. Die ganzen Zahlen umfassen die natürlichen und die negativen Zahlen (und 0), für sie ist auch die Subtraktion unbeschränkt ausführbar, allerdings nicht die Division. Die rationalen Zahlen oder Bruchzahlen sind so beschaffen, dass alle vier Grundrechnungsarten angewendet auf zwei beliebige solcher Zahlen wieder eine solche Zahl liefern. Formal erhält man sie als Äquivalenzklasse von Zahlenpaaren, von denen die erste Zahl eine ganze Zahl, die zweite eine natürliche Zahl (nicht 0) ist. Dabei liegen zwei Zahlenpaare (k, l) und (m, n) genau dann in der gleichen Äquivalenzklasse – d. h. legen die gleiche Zahl fest –, wenn es eine natürliche Zahl p gibt, so dass p k = m und p l = n gilt (z. B.: [1,3] = [2,6] = [3,9] …). Man kann beweisen, dass die Lösung der Gleichung x2=2, d. h. die Länge der Diagonale eines Quadrats mit Seitenlänge 1, keine rationale Zahl ist. Aber selbst eine Erweiterung des Zahlbereichs, die das Lösen von algebraischen Gleichungen, i. e. Gleichungen mit ganzzahligen Koeffizienten, er- 2618 möglicht, gewährleistet noch nicht die sog. Vollständigkeit. Vollständigkeit einer Menge besagt, dass die Menge keine »Löcher« hat, m. a. W. dass jeder Approximationsprozess auf ein Ergebnis zustrebt, das ebenfalls in dieser Menge liegt. (Geometrisch betrachtet kann etwa der Umfang des Einheitskreises, π, durch die Längen von Streckenzügen mit rationalen Längen beliebig genau angenähert werden, aber π ist keine Lösung einer algebraischen Gleichung.) A.-L. Cauchy hat eben diese Charakterisierung von Vollständigkeit zur Grundlage seiner Definition der reellen Zahlen gemacht. Äquivalenzklassen von Folgen, deren Glieder sich mit wachsendem Index der Glieder immer mehr einander annähern, werden als Zahlen aufgefasst. R. Dedekind hat einen alternativen Vorgang vorgeschlagen, indem er die heute sog. »Dedekind’schen Schnitte« bildet. 28 Ein Schnitt ist eine Zerlegung der rationalen Zahlen in zwei Klassen mit der Eigenschaft, dass jedes Element der ersten Klasse kleiner ist als jedes (davon verschiedene) Element der zweiten Klasse. Bei manchen dieser Schnitte werden die beiden Klassen durch eine rationale Zahl »getrennt«. Wenn es aber keine solche rationale Zahl gibt, dann setzt man fest, dass diese Schnitte eine – reelle – Zahl definieren. Eine dritte Variante, die reellen Zahlen einzuführen, wurde von D. Hilbert im Rahmen eines umfassenderen Programms ausgearbeitet. Er gibt eine Axiomatik für die reellen Zahlen an, die vier Gruppen von Axiomen enthält (und die die natürlichen Zahlen nicht voraussetzt): (I) Die »Axiome der Verknüpfung« legen die unbeschränkte und eindeutige Durchführbarkeit von Addition und Multiplikation fest. (II) Die »Axiome der Rechnung« geben die üblichen Kommutativ-, Assoziativ und Distributivgesetze an. (III) Die »Axiome der Anordnung« bestimmen die Eigenschaften der Kleiner-Relation. (IV) Von den zwei »Axiomen der Stetigkeit« fordert das erste, dass jede nach unten beschränkte Menge ein kleinstes Element hat; das zweite fordert, dass das System der Zahlen bei Aufrechterhaltung sämtlicher Axiome keiner Erweiterung mehr fähig ist. Das erste Axiom garantiert die Vollständigkeit der reellen Zahlen. Die reellen Zahlen lassen sich einteilen in die algebraischen Zahlen und die transzendenten Zahlen, also diejenigen Zahlen, die Lösungen von algebraischen Gleichungen sind, und diejenigen, die das nicht sind. NHpG (48222) / p. 2629 /19.8.11 2619 Damit auch Gleichungen wie x2 + 1 = 0 lösbar sind, erweitert man den Bereich der reellen Zahlen zum Bereich der komplexen Zahlen. Jede komplexe Zahl z lässt sich durch geordnete Paare von reellen Zahlen (a, b) darstellen. Setzt man (0, b) = ib und (a, 0) = a und legt gewisse Rechengesetze fest, die mit jenen für die reellen Zahlen verträglich sind, so ergibt sich für eine komplexe Zahl z = (a, b) die übliche Darstellung z = a + ib. Die komplexen Zahlen sind lange Zeit umstritten, C. F. Gauß etabliert sie, indem er den sog. »Fundamentalsatz der Algebra« beweist, der besagt, dass jede algebraische Gleichung eine Lösung in den komplexen Zahlen besitzt. Zu den weiteren Verallgemeinerungen zählen die hyperkomplexen Zahlen, das sind die 2n-Tupel (n 2) von reellen Zahlen. Für n = 2 heißen sie Quaternionen, für n = 3 Biquaternionen oder Cayley-Zahlen, für n = 4 Clifford-Zahlen. Auch die Elemente anderer Körper wie etwa jener der Restklassen kann man als Zahlen ansehen. Im Zuge des Entstehungsprozesses von Differential- und Integralrechnung, in dem es Uneindeutigkeiten und Inkonsistenzen zu klären gilt, werden die ursprünglich von manchen Mathematikern – z. B. Leibniz – verwendeten unendlich kleinen Zahlen eliminiert (an ihre Stelle tritt die sog. Epsilontik, die Formalisierung von »beliebig nahe«). Mittlerweile sind aber die unendlich kleinen und unendlich großen Zahlen im Rahmen von NonStandard-Modellen der natürlichen und reellen Zahlen wieder zurückgekehrt. 4.2 Hat man einmal gewisse Zahlbereiche oder allgemeiner gewisse Mengen vor sich, so kann man sich fragen, »wie groß« diese Mengen jeweils sind, »wie viele« Elemente sie enthalten, und die Antwort darauf soll wieder eine Zahl sein. Die »Größe« einer Menge nennt man ihre Mächtigkeit oder Kardinalität oder auch Kardinalzahl. Zur Bestimmung der Mächtigkeit endlicher Mengen reichen offenbar die natürlichen Zahlen aus. Die natürlichen Zahlen werden einerseits zum Zählen, Ordnen etc. verwendet und haben dann den Charakter von Ordinalzahlen, können aber eben auch für Größenangaben verwendet werden, dann haben sie den Charakter von Kardinalzahlen. Die Begriffe »Kardinalzahl« und »Ordinalzahl« lassen sich präzisieren, und dann lässt sich einsehen, dass sie für endliche Zahlen identifizierbar sind. Die Größe von unendlichen Mengen wird dadurch bestimmt, dass die Mengen mit anderen Mengen verglichen werden und festgestellt wird, Zahl ob sie eineindeutig aufeinander abgebildet werden können. Die Mächtigkeit der natürlichen Zahlen nennt man 0, und jede Menge, die eineindeutig auf die natürlichen Zahlen abbildbar ist, z. B. die rationalen Zahlen, hat dann ebenfalls die Mächtigkeit 0. Man nennt solche Mengen und alle, die kleiner sind, abzählbar; die übrigen nennt man überabzählbar. Hier zeigt sich ein Unterschied zwischen endlichen und unendlichen Mengen: Nur bei letzteren ist es möglich, dass eine echte Teilmenge gleiche Mächtigkeit wie die Menge selbst hat. G. Cantor beweist, dass auch noch die Menge aller algebraischen Zahlen die Mächtigkeit 0 hat, dass aber die Menge der reellen Zahlen nicht gleichmächtig mit jener der natürlichen Zahlen ist, sondern echt größer. Die Kardinalität der Menge der reellen Zahlen (oder auch jede Menge, die dieselbe Mächtigkeit hat wie die reellen Zahlen) nennt man das Kontinuum. Cantor spricht im Anschluss an diese Untersuchungen die in der Grundlagenforschung bis heute vieldiskutierte Hypothese aus, dass zwischen der Mächtigkeit der natürlichen Zahlen und jener der reellen Zahlen keine weitere Kardinalzahl liegt. 4.3 Mehrere mathematische Teildisziplinen haben Zahlen explizit zum Untersuchungsgegenstand. Zahlentheorie, Maßtheorie, Analysis, mathematische Grundlagentheorie (mathematische Logik) fokussieren auf jeweils eigene Bereiche oder Aspekte von Zahlen. 29 Die Algebra verallgemeinert Zusammenhänge der Arithmetik oder Zahlentheorie (auch der Geometrie etc.), indem sie die Struktur dieser Zusammenhänge untersucht, unter Absehung von den für die jeweilige Einsicht irrelevanten spezifischen Eigenschaften der Zahlen. Die Zahlentheorie befasst sich mit natürlichen oder ganzen Zahlen (oder auch Zahlenmengen mit ähnlichen Eigenschaften) sowie gewissen Teilmengen davon, denen ein besonderes Interesse gilt, wie etwa den Primzahlen. Das sind jene natürlichen Zahlen, die nur 1 und sich selbst als Teiler haben. Typische Fragestellungen der Zahlentheorie lauten etwa: Wie sind die Primzahlen verteilt, d. h. wie viele gibt es, die kleiner als eine gegebene natürliche Zahl n sind, in Abhängigkeit von dieser Zahl n? Welche Funktion beschreibt dieses Verhalten gut, wenn n gegen unendlich geht? Ein anderes Beispiel für ein zahlentheoretisches Problem stellt die berühmte ca. 1637 aufgestellte, aber erst 1994 bewiesene Vermutung von P. Fermat dar, die besagt: Es gibt keine von 0 verschiedenen, ganzen Zahlen a, b, c, die der Gleichung an + bn = cn genügen, sobald der Exponent n größer als 2 ist. NHpG (48222) / p. 2630 /19.8.11 Zahl Die Maßtheorie beschäftigt sich mit Zahlen, insofern sie zum Messen verwendet werden. Messbaren Mengen (Volumina) – in einem zu spezifizierenden Sinn – werden reelle Zahlen zugeordnet. Die Maßtheorie stellt die Grundlagen für die Integrationsund für die Wahrscheinlichkeitstheorie bereit. Die Analysis beruht wesentlich auf der Beschaffenheit der reellen bzw. komplexen Zahlen. Für Stetigkeits- und Grenzwertüberlegungen, somit für die Differential- und Integralrechnung, stellt die Vollständigkeit der reellen Zahlen eine zentrale Voraussetzung dar. Man unterscheidet, je nach zugrunde gelegter Zahlenmenge, zwischen reeller und komplexer Analysis (auch, vor allem früher, Funktionentheorie genannt). Eine Diskussion der Zahlen als basale Objekte der Mathematik hat verstärkt in der Grundlagenkrise um 1900 stattgefunden. Die Grundlagengebiete der Mathematik – Logik und Mengentheorie – haben wesentliche Impulse dadurch empfangen, dass sie die Voraussetzungen für die Definitionen und axiomatischen Festlegungen der Zahlen schaffen sollten. Literatur Becker, O. (21964), Grundlagen der Mathematik in geschichtlicher Entwicklung, Freiburg/München. Benacerraf, P./Putnam, H. (Hgg.) (21983), Philosophy of Mathematics. Selected Readings, Cambridge. Black, M. (41958), The Nature of Mathematics, New York. Boolos, G. (1990), The Standard of Equality of Numbers, in: ders., (Hg.), Meaning and Method. Essays in Honor of H. Putnam, Cambridge, 261–277. Büttemeyer, W. (Hg.) (2003), Philosophie der Mathematik, Freiburg/München. Cantor, G. (1966), Abhandlungen mathematischen und philosophischen Inhalts, Hildesheim (Reprint von 1932). Dedekind, R. (10,71969), Was sind und was sollen die Zahlen? Stetigkeit und Irrationale Zahlen. Studienausgabe, Braunschweig. Frege, G. (1987), Grundlagen der Arithmetik, Stuttgart. Gadamer, H.-G./Schadewaldt, W. (Hgg.) (1968), Idee und Zahl. Studien zur Platonischen Philosophie, Heidelberg. Husserl, E. (1992), Philosophie der Arithmetik, Gesammelte Schriften 1 (= Husserliana XII), Hamburg. Ifrah, G. (1993), Universalgeschichte der Zahlen, Frankfurt a. M. Klein, F. (41933), Elementarmathematik vom höheren Standpunkte aus, Bd. I, Berlin. Lorenzen, P. (1955), Einführung in die operative Logik und Mathematik, Heidelberg. 2620 Meschkowski, H. (1979), Die Zahl als Archetypus, in: ders., Mathematik und Realität, Mannheim/Wien/ Zürich, 171–182. Mill, J. St. (2002), A System of Logic, Book II, Honolulu (Reprint von 1891). Russell, B./Whitehead, A. N. (1910–1913), Principia Mathematica, 3 Bde., Cambridge. Shapiro, S. (Hg.) (2005), The Oxford Handbook of Philosophy of Mathematics and Logic, New York. Tymoczko, T. (Hg.) (1998), New Directions in the Philosophy of Mathematics, Princeton. Van der Waerden, B. L. (21966), Erwachende Wissenschaft. Ägyptische, babylonische und griechische Mathematik, Basel/Stuttgart. Wittgenstein, L. (61999), Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik, Werkausgabe Bd. 6, Frankfurt a. M. Esther Ramharter Anmerkungen Siehe dazu G. Ifrah 1993 (Lit.). Siehe J. Piaget/A. Széminska, La genèse du nombre chez l’enfant, Neuchâtel 1941. 3 Siehe zu diesem Zusammenhang S. Krämer, Symbolische Maschinen. Die Idee der Formalisierung in geschichtlichem Abriß, Darmstadt 1988. 4 V. Alleton, L’écriture chinoise, Paris 21976, 71 (zit. n. G. Ifrah 1993 [Lit.], 128). 5 K. Gödel, Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme, in: Monatshefte für Mathematik und Physik 38 (1931), 173–198; wiederabgedruckt z. B. in: K. Berka/L. Kreiser (Hgg.), LogikTexte, Berlin 1983, 347–370. 6 Vgl. T. Tymoczko, The Four-Color Problem and Its Philosophical Significance, u. I. Lakatos, A Renaissance of Empiricism in the Recent Philosophy of Mathematics, in: T. Tymoczko 1998 (Lit.), 243–266, 29–48. 7 G. Scholem, Von der mystischen Gestalt der Gottheit. Studien zu Grundbegriffen der Kabbala, Frankfurt a. M. 41995, 32. 8 Ebd., 33. 9 Siehe dazu und zu einer weitergehenden Kant-Interpretation L. Schäfer, Art. ›Zahl‹, in: Handbuch philosophischer Grundbegriffe, München 1973 f., 1775–1787, insbes. 1785. 10 I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 182. 11 Philolaos, in: Diels/Kranz, Fragmente der Vorsokratiker, Fragm. 1B4. 12 Aristoteles, Metaphysik I, 6, 987b14–18. 13 R. Descartes, Regeln zur Ausrichtung der Erkenntniskraft, Hamburg 1972, 71. 14 Siehe dazu z. B. P. Bernays, On platonism in mathematics, in: P. Benacerraf/H. Putnam 1983 (Lit.), 258–271; auch A. R. Anderson, What do Symbols Symbolize? Platonism, in: B. Baumrin (Hg.), Philosophy of Science. The Delaware Seminar, Bd. I, New York/London 1963, 137–158. 15 Wiedergegeben in H. Weber, Leopold Kronecker. Jahresberichte der Deutschen Mathematiker-Vereinigung (DMV) 2 (1893), 5–31, Zitat 19. 1 2 NHpG (48222) / p. 2631 /19.8.11 2621 B. Russell/A. N. Whitehead 1910–1913 (Lit.). G. Frege 1987 (Lit.), 100. Die Idee dieser Definition übernimmt er auch in sein späteres, formaleres Werk, siehe ders., Grundgesetze der Arithmetik, Hildesheim 1962. 18 Siehe etwa P. Lorenzen 1955 (Lit.). 19 G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik I, Theorie Werkausgabe, Frankfurt 1970 ff., Bd. 5, 235. 20 E. v. Glasersfeld, Radikaler Konstruktivismus. Ideen, Ergebnisse, Probleme, Frankfurt a. M. 1997, 278. 21 H. Weyl, Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaften, München/Wien, 31966. 22 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Werkausgabe, Bd. 1, Frankfurt a. M. 41988. 23 Siehe etwa L. Wittgenstein 1999 (Lit.), I, § 81 f. 24 E. Husserl 1992 (Lit.), 82. 16 17 Zeichen G. W. F. Hegel (Anm. 19), 236. M. Heidegger, Platon: Sophistes (Gesamtausgabe, Bd. 19), Frankfurt a. M. 1992, 18. 27 J. St. Mill 2002 (Lit.), Book II, § 6, Sec. 2, 167. Übers. Verf.: »Alle Zahlen sind (An-)Zahlen von etwas; es gibt keine abstrakten Zahlen. Zehn muss zehn Körper bedeuten oder zehn Klänge oder zehn Pulsschläge. Aber obwohl Zahlen (An-)Zahl von etwas sein müssen, können sie Anzahl von etwas Beliebigem sein. Sätze, die von Zahlen handeln, haben daher die bemerkenswerte Eigenschaft, dass sie Sätze von überhaupt allen Dingen sind.« 28 R. Dedekind 1969 (Lit.). 29 Siehe z. B. E. Hlawka/J. Schoißengeier, Zahlentheorie. Eine Einführung, Wien 21990; H. Bauer, Maß- und Integrationstheorie, Berlin/New York 21992; H. Heuser, Lehrbuch der Analysis. Teil I, Stuttgart 61988. 25 26 Zeichen 1. Zeichenphilosophie und Sprachphilosophie 2. Sich zeigende Bedeutungen 3. Das unmittelbare Zeichenverstehen und die Definition der Begriffe 4. Der Zeichenbegriff als geschichtliche Dekonstruktion des Seinsbegriffs 4.1 Der grundlegende historische Anfang 4.2 Der Zeichenbegriff am Beginn der neueren Philosophie: Descartes und Leibniz 4.3 Lambert, Hamann, Kant, Hegel 4.4 Nietzsche 4.5 Der phänomenologische Zeichenbegriff Husserls 4.6 Wittgensteins Destruktion der Semantik 5 Philosophische Konsequenzen 5.1 Freges Restauration des ontologischen Bedeutungsbegriffs 5.2 Zeichen als menschliche Form 5.3 Zeichen und Freiheit 1. Das Wort ›Zeichen‹ wird auf vielfache Weise verwendet, und dementsprechend sind auch viele Antworten auf die Frage nach seiner Bedeutung möglich. Im Grunde kann alles, was gegeben ist, als Zeichen aufgefasst werden, z. B. der Rauch als Zeichen für Feuer oder gewisse Symptome als Zeichen einer Krankheit. Man unterscheidet »natürliche« Zeichen von »gesetzten« oder vereinbarten Zeichen. Der artikulierte Laut wird als Sprachzeichen verstanden, die Schriftzeichen als Zeichen für Lautzeichen und damit als »Zeichen für Zeichen«. I. d. R. ergibt sich aus dem Kontext, von welcher »Art« von Zeichen die Rede sein soll. – Etwas als Zeichen zu verstehen bedeutet jedoch, dass es als es selbst nicht zum Gegenstand wird. »Gegenstand« ist es erst im Sprechen über Zeichen. Sprachzeichen haben die besondere Bedeutung, dass in ihnen von »etwas als etwas« und damit auch von etwas als Zeichen bzw. als »Art« von Zeichen die Rede sein kann. Nur in der Sprache, genauer gesagt: nur in einer Sprache, wie sie in einer bestimmten Situation zur Verfügung steht, kann gefragt werden, was Zeichen ihrem »Wesen« nach seien, und die Antwort auf diese Frage kann als befriedigende Antwort gelten gelassen werden oder auch nicht. Auch die Philosophie gebraucht das Wort ›Zeichen‹ unter dem Aspekt ihrer jeweiligen Fragestellung und damit auf vielfache Weise. Die Frage nach dem allgemeinen »Wesen« der Zeichen, d. h. nach einem sich durchhaltenden allgemeinen Zeichenbegriff ist die Frage nach »etwas«, das seinem »Wesen« nach für etwas anderes steht und nicht für sich selbst. Sie weist damit über die »Grundbegriffe« der metaphysischen Wesensphilosophie hinaus. Die Begriffe des »Wesens« oder der »Substanz« stehen für etwas, insofern es nicht als Zeichen aufgefasst wird, sondern als etwas, das für sich selbst steht, so dass sich die Frage nach einer von den Zeichen verschiedenen Bedeutung nicht stellt. Der »linguistic turn« in der neueren Philosophie thematisiert die Bedeutung der Sprache für das Denken und das Erkennen. Dabei ist ein allgemeingültiger Sprachbegriff vorausgesetzt und damit