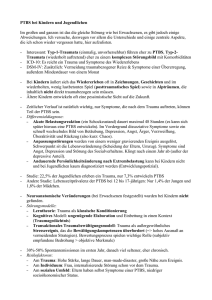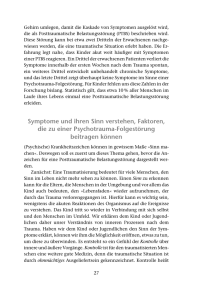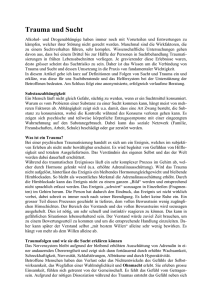Spuren in der Seele
Werbung

Tagung des Netzwerkes Frauen/Mädchen und Gesundheit Niedersachsen am 02.07.2003 in Hannover: Netzwerke gegen häusliche Gewalt – auch eine Auf- gabe für das Gesundheitswesen Dr. med. Marion Traub Fachärztin für Psychotherapeutische Medizin, Wicker-Kliniken Bad Wildungen Spuren in der Seele Was ist Gewalt gegen Frauen? – Man ist erstaunt, wie umfangreich die Palette der Gewalttaten ist und hätte vielleicht einzelne Punkte gar nicht dazu genommen oder sie unter häuslichen Konflikten subsumiert.1 Differenziert wird in körperliche Gewalt und sexualisierte Gewalt, soziale Gewalt sowie seelisch/psychische Gewalt. Was passiert, wenn Menschen im häuslichen Umfeld Gewalt erleben? Prinzipiell suchen wir uns – wenn möglich – Menschen für unser Zusammenleben aus, denen wir vertrauen und mit denen wir zusammen leben wollen. Dann sollte das Zuhause eigentlich die Bastion gegen das „feindliche Außen“ sein, im Sinne von „My home is my Castle“. So könnte man verkürzt sagen: In einer gesunden, stabilen, häuslichen Atmosphäre findet man als Grundgefühl Sicherheit, Stabilität, Geborgenheit u.s.w. In einer von Gewalt geprägten häuslichen Atmosphäre dominiert hingegen Stress, Vorsicht, Angst, Unsicherheit und ein Taktieren, um mögliche destruktive Stimmungen schon im Vorfeld zu bemerken. Andauernder Stress sorgt für eine erhöhte körperliche Grundspannung, einen erhöhten Cortisolspiegel, einen erhöhten Blutdruck, eine Herabsetzung unserer körpereigenen Abwehr und eine erhöhte Unfallneigung sowie eine gesteigerte Erkrankungsneigung. Vielen Betroffenen sind diese Folgen – gerade bei subtilen Formen der Gewalt – oft für lange Zeit nicht bewusst. In ärztlichen Praxen werden diese Frauen durch eine 1 Als Anlage ggf. die Folien mit der Definition von Mary Ann Dutton. 1 erhöhte Infektanfälligkeit, Schlafstörungen, unklaren Schwindel oder häufig wechselnde körperliche Beschwerden im Sinne von funktionellen Störungen oder Somatisierungsstörungen auffällig. Das heißt: Es lassen sich körperliche Symptome ohne pathologisches Korrelat feststellen. Die Identifizierung des dahinter stehenden Problembereichs ist davon abhängig, wie vertraut die Frau mit der Hausärztin bzw. dem Hausarzt ist und von deren/ dessen Gespür für seelische Zusammenhänge. Ab und an kommen solche Frauen dann auch in die psychotherapeutische REHA, in der sich solche belastenden familiären Strukturen ebenfalls zeigen und im Abstand zum häuslichen Umfeld auch eher thematisiert werden. Symptomträger sind häufig auch die Kinder, die mit Hilfe ihrer Erkrankungen auf häusliche und emotionale Defizite hinweisen. So weit der eher im Verborgenen liegende Bereich. Hier ist es folglich immer wieder sinnvoll und wichtig, bei Patientinnen mit vielen wechselnden somatischen Beschwerden das häusliche Umfeld zu hinterfragen. Gehen wir zu dem Themenbereich der körperlichen Gewalt: In der Geschichte befassten sich – ungefähr zeitgleich mit der Auseinandersetzung Amerikas mit den Folgen des Vietnamkrieges – Feministinnen mit den Folgen von innergesellschaftlicher Gewalt gegen Frauen. Ab 1975 gab es in den USA innerhalb des National Institut of Mental Health ein Forschungszentrum, in dem Frauen sich als Forscherinnen den Folgen von Gewalt widmeten. Dabei rückte das Problem der innerfamiliären Gewalt immer mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit. In den letzten Jahren ist die Forschung im Traumabereich deutlich intensiver geworden. Man weiß, dass Gewalt und Traumatisierung seelische Folgen hinterlässt, konzentriert allerdings das Interesse auf die schweren Borderline-Persönlichkeitsstörungen oder auch dissoziative Identitätsstörungen. Was passiert bei traumatisierender Gewalt? In existenziell bedrohlichen Situationen reagieren Menschen sowohl körperlich als auch seelisch nach dem so genannten „Fight and Flight-Prinzip“. Das heißt, der menschliche Organismus wird innerhalb von Sekunden in einen so genannten Ausnahmezustand gebracht, einen Zustand, in dem innerhalb weniger Augenblicke alles für Flucht oder Kampf bereitgestellt wird. Es werden Reserven mobilisiert, Adrenalin wird frei, Glucose wird dem Körper zur Verfügung gestellt, der Herzschlag wird be2 schleunigt, der Muskeltonus steigt an. Auslöser einer solchen Reaktion ist die Wahrnehmung einer kritischen Situation und der damit verbundenen Angst. Diese Reaktion passiert unwillkürlich. Diese physiologische Situation ist vielen Menschen aus eigener Erfahrung bekannt – beispielsweise von einem Autounfall. Kann ein Mensch diese Situation lösen, entweder durch Kämpfen oder Flüchten, bzw. kann die Situation in anderer Weise geklärt werden, so beruhigt er sich nach einigen Minuten, verspürt sein Herz noch bis zum Hals schlagend, zittert am ganzen Körper, erzählt das Erlebte möglicherweise noch emotional engagiert weiter, und kann dann darüber zunehmend ruhig werden. Als ein Trauma wird es dann verarbeitet, wenn ein Mensch in einer vitalen Extremsituation seine Abwehrmechanismen nicht leben kann. Fischer (Jahr, Quelle) definiert Trauma als vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einher geht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltbild bewirkt. Das heißt, der Mensch hat für diese Situation keine Möglichkeit, sich irgendwie zu helfen. Traumatisierend wirkt ein Ereignis dann, wenn es die aktuelle Reizverarbeitungsfähigkeit des menschlichen Ichs durch seine Heftigkeit oder Plötzlichkeit überfordert. Menschen, die traumatisierenden Erlebnissen ausgesetzt waren, erleben dieses seelisch als extrem belastend und qualvoll. Durch ein Trauma wird die körperliche und seelische Unversehrtheit und das Leben bedroht. Die Betroffenen erleben sich als Opfer schrecklicher, unfassbarer Ereignisse, denen sie hilflos ausgeliefert sind. Handeln hat keinen Sinn mehr, weder Widerstand noch Flucht sind in traumatischen Situationen möglich. Das Selbst wird überflutet von Reizen, Affektstürmen und Katastrophenerfahrungen. Das Selbstverteidigungssystem ist extrem überfordert, es kommt zum Zusammenbruch und zu temporärer oder dauerhafter Zerstörung des Selbstschutzsystems. Um die Folgen besser verstehen zu können, unter denen Menschen leiden, die traumatisierenden Ereignissen ausgesetzt waren, möchte ich einen kurzen Blick in die jüngeren Forschungsarbeiten der Psychobiologie werfen. Neurobiologisch hat 3 man herausgefunden, dass wir, vereinfacht gesagt, zwei unterschiedliche Gedächtnissysteme haben, nämlich das kognitiv, kühle Hippokampussystem, das als kognitive Weltkarte bezeichnet wird, und das hoch emotionale, heiße Amygdalasystem oder auch Mandelkernsystem. Das Hippokampussystem ist gewissermaßen das Archiv des Gedächtnisses. Es zeichnet auf unemotionale Weise autobiografische Ereignisse komplett in ihrem räumlichen und zeitlichen Kontext auf. Gedächtnisinhalte werden von gegenwärtigen Wahrnehmungen unterschieden, Erinnerungen sind als Wortrepräsentanzen kodiert und können erzählt werden. Der Hippokampus hat Verbindungen zur rechten und zur linken Hirnhälfte sowie zum Sprachzentrum. Im Gegensatz dazu reagiert das Amygdalasystem auf unintegrierte, fragmentarische, angsterzeugende Merkmale von Ereignissen, welche direkt mit Angstreaktionen verbunden werden. Der Mandelkern speichert direkt ohne Einschaltung der Hirnrinde fragmentarisch, reizabhängig, ungeordnet und unverschlüsselt. Die meist angstbesetzten Erinnerungsfetzen bringen das Gefühl aktuellen Wiederholens bzw. Wiedererlebens mit sich. Erinnerungen werden als Gefühlsrepräsentanz kodiert. Es besteht eine Blockade zur linken Hirnhälfte, aber auch zum Sprachzentrum, so dass die Gedächtnisinhalte des Amygdalasystems häufig kaum verbal reproduziert werden können. Bei niedrigem Stressniveau arbeiten beide Systeme parallel, so dass bei einer Situation sowohl die angsterzeugenden – also heiße –, als auch die kontextuellen und narrativen Merkmale – also kühle – gespeichert werden. Bei traumatischem Stressniveau wird das kühle Hippokampussystem dysfunktional, d.h. es schaltet ab, während das heiße Amygdalasystem überreagiert. Bei traumatischem Level konzentriert sich die Kodierung – also die Speicherung der Erinnerung – selektiv auf angsterzeugende Merkmale, die fragmentarisch und leicht triggerbar im Amygdalasystem abgelegt werden. Man hat bei Menschen die über lange Jahre traumatisiert wurden eine Atrophie (d.h. Verkleinerung) des Hippokampus festgestellt. Diese Entdeckung der Folgen von Gewalt ist ausgesprochen wichtig. Sie wurde vor einigen Jahren von Frau Professor Metcalff an der University of California gemacht. Diese Entdeckung kann die Diskussion über die Glaubwürdigkeit von Traumafolgen deutlich verkürzen. Sie erklärt beispielsweise, warum traumatisierte Menschen teil4 weise nicht über ihr Trauma reden können, dass Worte fehlen und zeitliche Abläufe teilweise nicht korrekt geschildert werden können. Es erklärt aber auch, warum sich Menschen, die Traumata erlebt haben, teilweise nicht mehr erinnern können und Erlebnisse und Ereignisse nur ungenau schildern können. Hier ist häufig der Ansatz, jemanden fälschlicherweise einer Lüge oder der Einbildung zu bezichtigen. In Gewaltsituationen hilft sich die Seele eines Menschen mit Dissoziation. Da man eine Situation nicht aushalten kann, wird sie abgespalten. Viele Patientinnen berichten z. B. in der Gewaltsituation ihren Körper nicht mehr gespürt zu haben, das Gefühl gehabt zu haben, sich aus dem Körper zu entfernen und Situationen von der Zimmerdecke aus oder wie durch Nebel zu sehen. Oder sie können sich nicht mehr erinnern. Alles dies sind Schutzmechanismen der Seele. Einige Symptome verselbstständigen sich und diese Menschen reagieren bei schwierigen Situationen automatisch mit solchen Spaltungsmechanismen. Bei den Folgen von Gewalt unterscheidet man zwischen Folgen akuter und einmaliger Traumata und sog. chronischen Persönlichkeitsveränderungen als Folge fortgesetzter Gewalt. Als Folge akuter Traumata können Menschen Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) entwickeln. Sie entsteht als eine verzögerte und protrahierte Reaktion auf ein belastendes Ereignis oder eine belastende Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigen Ausmaßes. Dieses muss einem Menschen nicht selbst passiert sein, sondern man kann eine solche PTBS auch entwickeln, wenn man Zuschauer einer traumatischen Situation gewesen ist. Man denke an Kinder, die die Gewalt innerhalb der Familie miterleben müssen. Letzte Woche habe ich eine Patientin entlassen, deren Partner sie brutal vergewaltigte, als sie ihm erklärte, dass sie sich trennen wolle. Diese Frau litt unter den klassischen Symptomen einer PTBS: Sie beschrieb diffuse Ängste, Panikattacken und Intrusionen, so genannte Flashbacks. Das heißt, sie wurde teilweise überschwemmt von Erinnerungen mit begleitenden Bildern, Worten, Affekten, Körpersensationen und Gerüchen, in denen sie die Vergewaltigung so erlebte, als sei sie gerade passiert. Weiterhin litt sie unter Schlafstörungen mit Albträumen und dem Gefühl immer in „Habachtstellung“ zu sein. 5 Manche Menschen haben allerdings auch keine Erinnerungen dazu, sie werden beispielsweise von Gerüchen überfallen und bekommen dann panische Ängste, ohne diese einordnen zu können. Häufig treten solche Phasen auch in Zeiten der Ruhe und der Reizarmut auf, vor allem vor dem Einschlafen. Weitere typische Symptome von diesen Menschen sind Ein- und Durchschlafstörungen, Reizbarkeit oder Wutausbrüche, Konzentrationsschwierigkeiten, übermäßige Wachsamkeit sowie übertriebene Schreckreaktionen. Erlebt man eine solche Situation häufiger, können sich chronische Persönlichkeitsveränderungen entwickeln. Hierzu gehören z.B. ausgeprägtes Vermeidungsverhalten, soziale Isolation, Angst und Depressionen. Auch Suizidgedanken sind nicht selten. Drogeneinnahme oder übermäßiger Alkoholkonsum können – ursprünglich entstanden, um diese traumatischen Lebensbedingungen besser aushalten zu können, – als komplizierende Faktoren hinzu kommen. Die Störung folgt dem Trauma in einer Latenz von einer Woche bis einigen Monaten, manchmal auch Jahren. Der Verlauf ist wechselhaft und die Stärke der beschriebenen Symptome variieren: Beeinflusst werden die Symptome durch die Schwere und Dauer sowie das Ausmaß des Kontrollverlustes, durch die Fähigkeiten des Individuums, durch das Alter und den Entwicklungsstand und bereits vorher entwickelte Bewältigungskompetenzen. Wichtig ist aber auch die Bewertung der sozialen Umwelt und das Ausmaß von Schutz und Verständnis, Unterstützung von Bezugspersonen oder durch die soziale Gemeinschaft sowie professionelle Hilfe. Die Wahrscheinlichkeit eines solchen posttraumatischen Belastungssyndroms ist höher, wenn - das Trauma auf Handlungen von Menschen zurückgeht - mit andauernder und hoher Lebensbedrohung verbunden ist, - moralische Konflikte eine Rolle spielen, - die soziale Umwelt die Traumatisierung ignoriert bzw. das Opfer ablehnt oder für die erlittenen Erfahrungen auch noch entwertet. Man hat herausgefunden, dass der Umgang mit Gewaltsituationen besser zu bewältigen ist, wenn die Menschen darüber reden können und ihnen eine verstehende Haltung entgegengebracht wird – etwas was Frauen mit Gewalterfahrun6 gen nicht immer erleben. Noch zu häufig gilt die Frau als die Mitschuldige. Noch allzu häufig gilt die Frau als die Verantwortliche für die Kontrolle männlicher Sexualität und männlicher Gewalt. Viele Frauen werden mit dieser Verantwortung groß. Erschwerend wirkt, wenn die Gewalt durch nahe stehende Menschen ausgeübt wird und sich im häuslichen Umfeld abspielt. Das häusliche Umfeld galt lange Zeit als „heilig“ und unantastbar – weil es ein Raum der Intimität und der familiären Sicherheit ist. Wir alle schätzen unser Zuhause als Raum in dem man nichts kontrollieren muss und sich entspannen kann. Dieses Gefühl der Sicherheit geht verloren. „Wenn man sich nicht einmal mehr in der eigenen Wohnung sicher fühlen kann, wo denn dann?“ fragen sich viele der betroffenen Frauen. Belastend wirkt zudem, dass eine Vielzahl der Frauen, die Gewalt in der Partnerschaft erleben, bereits in ihrer Kindheit massive körperliche und/ oder sexuelle Gewalt erleben mussten. Gewalt durch Menschen teilt diese in zwei Kategorien: In den Täter und das Opfer, in Mächtige und Ohnmächtige. Schon unsere Sprache zeigt, dass das Opfer seine geschlechtliche Identität verliert. Die klassische Definition Max Webers beschreibt Macht als jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung, den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel, worauf diese Chance beruht. Mit dem Erleben von Ohnmacht nimmt die Unsicherheit bezüglich der eigenen Person zu. Es geht die Fähigkeit verloren, die eigene Handlungsfähigkeit wahrzunehmen, verloren geht der Zugang zur Kraft, sich zu wehren, die Möglichkeit eigene Dinge zu initiieren und die Vorstellung davon, eigene Rechte zu haben. Das heißt, Frauen nach Gewalterfahrungen haben i.d.R. eine schwere Selbstwertproblematik, Schwierigkeiten, sich abzugrenzen und eigene Wünsche und Bedürfnisse wahrzunehmen und zu äußern. Eine besondere Position bekommt im intrapsychischen Erleben der Täter. Zu ihm entwickeln Patientinnen ein besonderes Verhältnis. So hat man z. B. herausgefunden, dass die Opfer von häuslicher Gewalt – ebenso wie die Opfer von Kidnapping – versuchen, ihre Täter zu mögen bzw. von ihnen gemocht zu werden, um wenigstens ein Minimum an Kontrolle über diesen übermächtigen Menschen, aber auch über die eigene Angst ausüben zu können. So versuchen z. B. Opfer häuslicher Gewalt, Dinge immer besser zu machen, mit der Vorstellung ”wenn ich nur gut genug bin, dann wird mich der andere auch nicht mehr schlagen, mich nicht 7 mehr vergewaltigen”, mit dem Ziel wenigstens ein Minimum an Handlungsfähigkeit erreichen zu können. Viele Frauen erkennen oder wissen nicht, dass man sich in Sicherheit bringen oder Hilfe holen könnte. Oft harren sie aus, um den Kindern nicht die „Familie“ wegzunehmen, aber auch weil sie sich die Schuld am Erlebten geben. Ein übrigens weit verbreitetes Phänomen, das verstärkt wird durch die soziale Situation von Frauen als die Verantwortliche für das Funktionieren von Beziehungen. Opfer beziehen die Schuld häufig auf sich. Auch hier geht es um den Erhalt von den Möglichkeiten, etwas verändern zu können, beispielsweise „wenn ich schuld bin, kann ich auch etwas ändern bzw. hätte etwas ändern können.“ Dies Gefühl der Schuld ist schambesetzt und schwer auszuhalten. Trotz allem ist es aber vielfach leichter auszuhalten, als das Bewusstsein Ohnmacht, Hilflosigkeit und Ausgeliefertsein in erheblichem Ausmaß erlebt zu haben. Oft fühlen sich die Opfer weit schuldiger als die Täter. Auch das Erlittene ist mit viel Scham besetzt und macht es schwierig, über das Erlebte zu reden. Die vermeintliche Schuld erschwert es, sich Hilfe zu holen. So erzählte die oben erwähnte Patientin, dass sie erst niemandem etwas erzählen wollte, da sie sich als die Schuldige ansah. Sie habe schließlich im Gespräch eine Tür öffnen können – ein langer Weg. Die Position der Schuldigen gibt das Gefühl der eigenen Handlungsfähigkeit und schützt vor der Wahrnehmung der erlittenen Ohnmacht. Viele Opfer können lange Zeit keine Wut auf die Täter empfinden. Die Handlungsunfähigkeit und die Ohnmacht (und das heißt: ohne Macht) bindet die Wut. Man kann es sich gut vorstellen: Es ist nicht angeraten, Wut gegen einen Menschen zu empfinden, der einen in Todesangst versetzt hat. Viel zu oft ist die Angst vor erneuter Gewalt auch berechtigt, der Schutz der Opfer insuffizient. Für viele Frauen ist es ein großer Schritt, sich Hilfe zu holen und in ein Frauenhaus zu flüchten oder sich an eine Beratungsstelle zu wenden. Ein noch größerer Schritt ist es, gegen die Täter Anzeige zu erstatten, das heißt, sich zu wehren, Unrecht öffentlich zu machen und sich die Hilfe des Staates zu holen. Denn dieses Öffentlichmachen und die daraus folgende Konfrontation mit dem Täter kann bei Frauen die schon beschriebenen Flashbacks auslösen, ein Gefühl der Lähmung und der Panik. Sie haben auch die, wie ich meine, nicht immer völlig unbegründete Angst, dass 8 ihnen nicht geglaubt wird. Und ein Strafprozess beinhaltet eine emotionale Belastung, die für viele Frauen nur schwer aushaltbar ist. Das Stichwort heißt hier ReTraumatisierung. In Anbetracht dieser komplexen und schwierigen Zusammenhänge ist es umso wichtiger und notwendiger kompetente Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen der unterschiedlichsten Berufsgruppen zu haben. Als Beispiele möchte ich u.a. nennen: Ärzteschaft, Beratungsstellen, Frauenhäuser, Lehrer, Kindergärtnerinnen, Polizei, Juristen, Psychologen, Politiker. Die heutige Veranstaltung und die Bildung von Netzwerken bilden hierbei einen wichtigen Schritt. 9