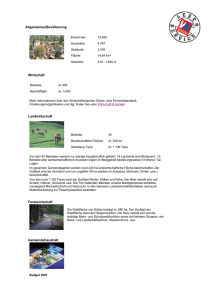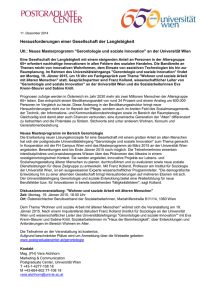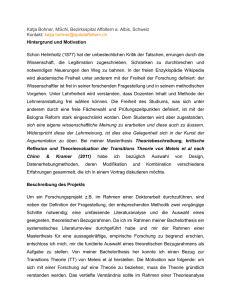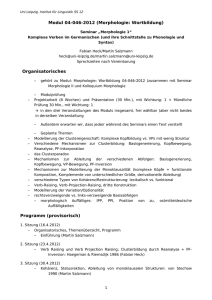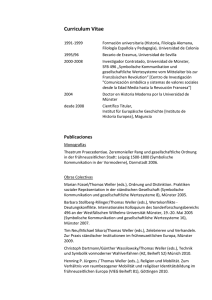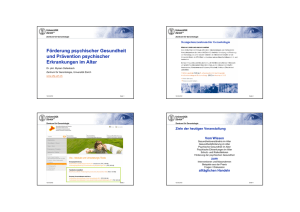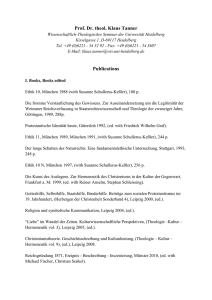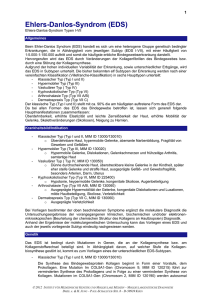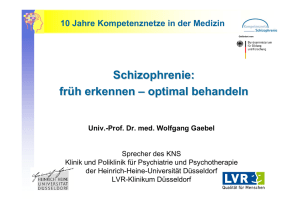Der Übergang ins Altenheim – ein Überblick
Werbung

AUSGEWÄHLTE GERONTOPSYCHOLOGISCHE MODELLE ZUM ÜBERGANG INS SENIORENHEIM Claudia Thiele Für die Gerontologie und insbesondere die Gerontopsychologie steht die Frage nach den Bedingungen des erfolgreichen Alterns im Vordergrund. Lebensqualität und psychische Gesundheit im Alter sind nur dann gewährleistet, wenn die Kontinuität der Lebensführung erhalten werden kann. Der zunehmende Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung und der daraus erwachsende Versorgungsbedarf bedingt, dass dieser meist nur in institutionalisierten Wohnformen (Seniorenheime) realisiert werden kann. Wohlbefinden und Gesundheit werden für den alten Menschen zur zentralen Adaptationsleistung beim Übergang ins Seniorenheim. Zahlreiche Studien belegen, dass eine ungeplante Übersiedlung im höheren Alter zu dramatischen Reaktionen der Betroffenen (Angst, Depression) und deren Angehörige führt. Darüber hinaus finden sich in einer Vielzahl von Untersuchungen Hinweise darauf, dass die Übersiedlung ins Seniorenheim von Menschen, die sich darauf vorbereitet haben, wesentlich positiver und stressfreier verläuft. Modelle des handlungsorientierten Ansatzes und Modelle der Bewältigungs- und Stressforschung werden dazu diskutiert. 1. Einleitung In den letzten Jahren haben sich Medizin, Psychologie und Soziologie intensiv mit der Erforschung von Alterungsprozessen befasst. Auf dem Gebiet der Erziehungswissenschaft befasst man sich zwar schon seit 1962 mit Fragen des Alterns, jedoch wird systematische empirische Forschung hauptsächlich an der Universität Giessen seit 1968 betrieben (Bollnow, 1962; Schulz, 1973). Für das Gesamt des Forschungsbereichs rund um den Prozess des Alterns wird der Terminus „Gerontologie“ benutzt. Gerontologie versteht sich als interdisziplinäre Wissenschaft, an der sowohl naturwissenschaftliche als auch sozialwissenschaftliche Disziplinen teilhaben. In neuerer Zeit wird eine Tendenz in der gerontologischen Forschung zunehmend bemerkbar, dass Alterungsprozesse nicht weitgehend endogen bedingtes Entwicklungsgeschehen darstellen, vielmehr wird den sozialen Bedingungen als exogene Faktoren erhöhte Bedeutung beigemessen und Altern wird als Prozess betrachtet, der bis zu einem gewissen Grad steuerbar ist (Weber, 1980). Da Altern ein sehr komplexer Vorgang ist, auf den biologische, psychologische und soziale Faktoren einwirken und sich wechselseitig beeinflussen, wurden je nach wissenschaftlicher Disziplin unterschiedliche Akzentuierungen in der Betrachtung des Alterns gesetzt. Es können dabei entweder primär physiologisch-biologische, psychologische oder soziologische Gesichtspunkte in den Vordergrund treten, Überschneidungen gibt es z.B. physiologisch-psychologisch im Bereich der Wahrnehmung und der Reaktionsfähigkeit. Für die Gerontopsychologie ist die Frage nach den Bedingungen des erfolgreichen Alterns von zunehmender Bedeutung. Lebensqualität und psychische Gesundheit im Alter sind vor allem dann gewährleistet, wenn eine Kontinuität der Lebensweise bis ins hohe Alter gegeben ist. Die steigende Lebenserwartung bringt jedoch mit sich, dass ältere Menschen ihren gewohnten Lebensraum verlassen und den letzten Lebensabschnitt im Seniorenheim verbringen müssen. Die Heimübersiedlung bedeutet ein „kritisches Lebensereignis“ (Filipp & Ferring, 1989), einen wichtigen Einschnitt im Lebenslauf (Saup, 1990) eines alten Menschen. Die eigene Wohnung gibt Selbständigkeit und Unabhängigkeit, sie verleiht Selbstwertgefühl und Würde (Oswald & Fleischmann, 1998). Es wird somit deutlich, dass die Übersiedlung in ein Seniorenheim selbst unter günstigen Voraussetzungen stets enorme Veränderungen bedingt: Verschlechterung des gesamten Gesundheitszustandes (Choi, 1996), eine Labilisierung des Selbstwertgefühls (Nay, 1995; Tews, 1996) und ein Absinken der Lebensqualität (Armer, 1993) sind nach dem Umzug meist die Folge. Obgleich sich der Einzug in ein Heim an einem bestimmten Tag vollzieht, stellt die Aufnahme in ein Senioren- oder Pflegeheim ein prozessurales Geschehen dar (Saup, 1990), in dem durch Beachtung bestimmter Faktoren der Übergang erleichtert, und die Weichen für eine erfolgreiche Anpassung und persönliche Weiterentwicklung im Seniorenheim gestellt werden können (Wahl & Kruse, 1999). 2. Modelle zur Bewältigung und Adaptation im hohen Lebensalter Zunächst werden ausgewählte gerontopsychologische Modelle der Bewältigung und Adaptation im höheren Lebensalter unter entwicklungspsychologischer Perspektive dargestellt (Baltes, 1993; Baltes, Staudinger & Lindenberger, 1999; Brandstädter, Rothermund & Schmitz, 1998; Carstensen, 1998; Gatz,1998; Kahana & Kahana, 1998; Lawton, 1999), als spezifisches Modell zum Prozess der Seniorenheimübersiedlung wird der handlungstheoretische Ansatz (Prochaska, DiClemente & Norcross, 1992; Saup, 1993) näher beleuchtet. 2.1 Modell der "Person-Umwelt-Passung" Als allgemeines Rahmenmodell zur Belastungsbewältigung dient das Konzept der PersonUmwelt-Passung (person-environment-fit; z.B. Lawton, 1999). Es ist nicht eine bestimmte Umwelt, die krank macht bzw. hohe Lebensqualität ermöglicht, es sind auch nicht Merkmale der Person allein, die dafür verantwortlich sind. Vielmehr ist es die spezifische Beziehung zwischen Person und Umwelt, die Kongruenz bzw. die Passung zwischen Zielen, Wünschen und Bedürfnissen der Person und den Gegebenheiten und Beschränkungen der Umwelt (Lazarus, 1999; Lazarus & Folkman, 1984). Als grundlegender theoretischer Zugang zum Prozess der Adaptation im Alter ist die Kongruenz zwischen Merkmalen der Person und Merkmalen der Umwelt immer wieder thematisiert worden (Kahana & Kahana, 1998; Lawton, 1999 für einen ausführlicheren Überblick; Parmelee & Lawton, 1990). Wesentliche Bestimmungsstücke dieses Modells sind: (a) Autonomie vs. Sicherheit: Parmelee und Lawton (1990) betrachten es zunächst als wesentliches Ziel der meisten Menschen, in einer Umwelt zu leben, die sowohl Bedürfnisse nach Unabhängigkeit als auch nach Abhängigkeit befriedigen kann. Hier verschiebt sich jedoch mit zunehmendem Alter häufig der Fokus. Die unmittelbare Wohnumgebung ist hier etwa der Ort, an dem das Ziel höchstmöglicher Autonomie erreicht werden kann. Gleichzeitig erfüllt sie Bedürfnisse nach Sicherheit. Beide Aspekte stehen in einem dialektischen Verhältnis, d.h. bei starker Betonung eines Aspekts tritt der andere Pol zunehmend in Erscheinung. Zu starke Betonung von Sicherheit und Abhängigkeit bringt den Wunsch nach Autonomie stärker hervor. Vor allem zunehmende körperliche Beeinträchtigung im Alter bringt umgekehrt die Beschwerlichkeiten des unabhängigen Lebens täglich ins Bewusstsein und macht Sicherheit zu einem hohen Gut. Dieses Verhältnis ist damit kein Gleichgewichtszustand, eine Homöostase, sondern ein dialektisches Verhältnis, das bei Betonung des einen Pols den jeweils anderen hervortreten lässt. (b) "environmental docility": Die "Dozilität" der Umwelt (Lawton & Simon, 1968) beschreibt, dass mit verstärkter Beeinträchtigung der personalen Kompetenz im Alter Verhalten und Wohlbefinden in größerem Ausmaß von Umweltfaktoren abhängig werden. Dazu ein Beispiel: Eine gehbehinderte Person, die bisher das Bad im ersten Stock ihrer Wohnung benutzen musste und es durch die Behinde- rung jetzt nicht mehr erreichen kann, wird wesentlich davon profitieren, wenn die Umwelt im Erdgeschoss entsprechend adaptiert wird bzw. Kompensationsmaßnahmen (z.B. Installation eines Lifts) ergriffen werden (vgl. Saup, 1990). (c) Umweltproaktivität: Diese Sichtweise kontrastiert die Dozilitäts-Hypothese, die den alten Menschen vor allem als passiven Rezipienten von Umwelteinflüssen charakterisiert, und stellt Anpassungsprozesse als aktive Leistungen der betroffenen Person dar. Demnach suchen ältere Menschen je nach Kompetenz aktiv Möglichkeiten in der Umwelt, ihre Bedürfnisse und Vorlieben zu befriedigen (Lawton, 1999). Je größer diese Kompetenz, desto größer wird auch das Umfeld sein, in der die Person nach Möglichkeiten zur Umsetzung der persönlichen Bedürfnisse suchen wird. (d) PersonUmwelt-Kongruenz: Die bereits erwähnte Person-Umwelt-Kongruenz (person-environmentfit; Kahana, 1982) als theoretische Sichtweise umfasst als allgemeinstes Modell alle bisher beschriebenen Zugänge. Dieses auf dem Stressmodell von Lazarus basierende Konzept, weist darauf hin, dass es weder die Person noch die Umwelt allein ist, die für die Vorhersage von Wohlbefinden oder Belastung verantwortlich sind. Vielmehr bringt die angemessene Befriedigung von persönlichen Interessen in einer spezifischen Umwelt Wohlbefinden und Lebensqualität, während andererseits Diskrepanzen zwischen den persönlichen Zielen einer Person und den Möglichkeiten der Umwelt negative Emotionen auslösen (z.B. Carver & Scheier, 1998; Lazarus, 1999). Faktoren bzw. Komponenten, die hier berücksichtigt werden müssen, sind nach Lawton und Nahemow (1973): das Maß individueller Kompetenz, Druck der Umwelt (environmental press; Umweltforderungen, die auf das Individuum einwirken), adaptives Verhalten (d.h. das beobachtbare Bewältigungsverhalten der Person in Reaktion auf Anforderungen der Umwelt), affektive Reaktionen und der Level der Adaptation (Bandbreite, innerhalb der sich eine Person mit den Anforderungen der Umwelt wohl fühlt, d.h. in etwa die Belastbarkeit einer Person). 2.2 Modell des erfolgreichen Alterns Ein aktuell dominierender Ansatz der Gerontopsychologie ist das Modell des erfolgreichen Alterns (Baltes & Baltes, 1990). Unter "Erfolg" in der Ontogenese einer Person lässt sich dabei ganz allgemein das Erreichen von Zielen verstehen, wobei hier sowohl die Realisierung von erwünschten als auch die Verhinderung von unerwünschten Ergebnissen verstanden werden kann. Von einer metatheoretischen Perspektive lassen sich zwei zentrale Ziele einer lebenslangen Entwicklung benennen (Marsiske et al., 1995): (1) Wachstum ("growth" und damit höheres Funktionsniveau) und (2) Aufrechterhaltung ("maintainance" und damit Vermeidung negativer Ergebnisse). Diese beiden zentralen Entwicklungsziele werden über drei Komponenten der Anpassung erreicht, deren Zusammenspiel den Umgang mit den Möglichkeiten und den Grenzen der persönlichen Ressourcen beschreiben: (a) Selektion, (b) Optimierung und (c) Kompensation (Baltes & Baltes, 1990). Das Modell erlaubt damit entsprechend auch die Erfassung ablaufender Prozesse, wenn sich das Verhältnis von Gewinnen und Verlusten im höheren Lebensalter verschlechtert (Baltes, Staudinger & Lindenberger, 1999). Selektion als erste Komponente des Modells beschreibt die bewusste oder unbewusste Auswahl von Bereichen bzw. Zielen, in denen Entwicklung und Aufrechterhaltung weiterhin angestrebt wird. Diese Selektion ist bei begrenzten, im Alter sinkenden Ressourcen eine notwendige Strategie, um Entwicklung in spezifischen Domänen aufrechtzuerhalten (Brandstädter & Wentura, 1995). Optimierung als zweite Komponente umfasst die internal und external regulierte Suche nach höheren Funktionsniveaus. Sie wird als fundamentale Komponente von Fortschritt und Aufrechterhaltung in der Entwicklung betrachtet. Kompensation als dritte Komponente ist schließlich besonders bei älteren Menschen relevant. Sie resultiert aus der internalen und externalen Limitierung oder dem Verlust von Ressourcen. Gehen internale oder externale Mittel zur Erreichung bestimmter Ziele verloren, wird die Kompensation zum wichtigsten adaptiven Prozess. 2.3 Diathese-Stress-Modell Eine Passung zwischen Person und Umwelt ist also eine in gewissem Rahmen bleibende Interaktion zwischen Zielen und Bedürfnissen einer (älteren) Person mit sich ändernden Umweltanforderungen. Inkongruenz zieht Belastung und affektive Reaktionen nach sich, die durch Bewältigungskompetenzen und Ressourcen moderiert und ausgeglichen werden können. Allerdings können ungünstige und überfordernde Bedingungen die Grenze der Belastbarkeit überschreiten. Aus einer Belastung wird Überlastung, aus psychischer Beein-trächtigung wird psychische Störung. Zentrale Annahme des ursprünglich von Zubin und Spring (1977) eingeführten Ansatzes ist die Interaktion einer Vulnerabilität mit belastenden Lebensereignissen. Geringe Vulnerabilität erfordert viele Belastungen, um eine psychische Störung auszulösen, während bei hoher Vulnerabilität bereits geringe Belastungen zur Überforderung führen. Während Diathese-Stress-Modelle in der Klinischen Psychologie weit verbreitet und weitgehend fundiert sind (vgl. z.B. Baumann & Perrez, 1998), gibt es in der Entwicklungs-psychologie (und hier v.a. im Bereich der älteren Menschen) wesentlich weniger Konzeptionen, die die Entwicklung von Stress und Störungen über die Lebensspanne betrachten (Elder, George & Shanahan, 1996; Gatz,1998; Gatz, Kasl-Godley & Karel, 1996; Kahana & Kahana, 1998; Pearlin & Skaff, 1996). Als zentrale Elemente in der Betrachtung von Belastung und Überlastung sind auch hier zunächst Vulnerabilitätsfaktoren auf der Negativ- und protektive Faktoren bzw. Ressourcen auf der Positivseite genannt, die auf belastende Umweltbedingungen treffen. Wesentlicher Zusatz in der Betrachtung von Stress über die Lebensspanne ist die Annahme, dass sowohl belastende Umwelteinflüsse als auch Person-Variablen Entwicklungsverläufen unterliegen und sich damit im Verlauf der Lebensspanne verändern. Diathesen, die im Verlauf der Entwicklung stärker hervortreten, sind etwa die körperlichen (z.B. Whitbourne, 1998) und kognitiven Veränderungen (z.B. Salthouse, 1999) im Alter. Als protektive Faktoren, die im Verlauf des Alters zunehmen, wurden "Ich-Integrität" oder "Weisheit" (Gatz, 1998; Staudinger, Marsiske & Baltes, 1995), reifere Bewältigungsstrategien (Aldwin, 1991) bzw. ein postformales Stadium des Denkens (Labouvie-Vief, 1997) vorgeschlagen (vgl. Herzog & Markus, 1999 für einen Überblick über mögliche protektive Elemente des Selbst im Alter). Schließlich ist das Altern mit einer Veränderung der Wahrscheinlichkeit im Auftreten von Stressoren verbunden (z.B. das Auftreten von Verlusterlebnissen). Gleichzeitig hängt auch die Bewertung von Belastungen wesentlich davon ab, ob das Ereignis zu erwarten war (z.B. Tod der alten Mutter) oder das Timing nicht den normativen Ereignissequenzen entspricht (z.B. Tod eines Kindes; vgl. Elder, George & Shanahan, 1996). Die Berücksichtigung dieses Timings bringt es häufig mit sich, dass Stressoren nicht nur als singuläre Einflussfaktoren, sondern kumulierend verstanden werden müssen (Kahana & Kahana, 1998; Pearlin & Skaff, 1996). Auch Strategien der Bewältigung scheinen Entwicklungsverläufen zu unterliegen. Einige Studien weisen darauf hin, dass ältere Menschen weniger Flucht/Vermeidung, jedoch etwa gleichbleibend problemorientierte Bewältigung einsetzen (Aldwin & Revenson, 1987, Costa, Zondermann & McCrae, 1991). Eine Ausnahme bildet die Studie von Folkman, Lazarus, Pimley und Novacek (1987), die das Ergebnis erbrachte, dass ältere Menschen weniger Problemlösen und mehr Flucht und Vermeidung als Bewältigungsstrategie zeigten. Weniger Problemlösestrategien und mehr emotionszentrierte Bewältigung fanden auch Chiriboga (1992) und Quayhagen und Quayhagen (1982). Der Übergang in ein Seniorenheim kann somit als "kritisches" Lebensereignis verschiedene Ebenen psychischen Leidens hervortreten lassen (Saup, 1984): Bereits länger bestehende Beeinträchtigungen (wie wiederkehrende depressive Episoden oder Angststörungen) verstärken etwa im Zuge der Übersiedlung die Belastung, erstmals im Alter auftretende kognitiven Beeinträchtigungen oder Pflegebedürftigkeit durch Depressionen und Angst machen die Übersiedlung notwendig, bzw. die Übersiedlung mit den daraus resultierenden Umweltanforderungen überfordert die Bewältigungskapazität der Person und löst psychische Beeinträchtigungen erst aus. Vor allem im letzten Punkt ist der Aspekt der "reserve capacity" bzw. der Reserven einer älteren Person angesprochen. Während Belastungen meist innerhalb der Limits einer Person liegen und stärkere Beeinträchtigungen daher vermieden werden können, sind starke Belastungen häufig der Auslöser für Störungen. Personen mit großen Reserven (z.B. soziale Unterstützung) werden Belastungen ausgleichen können, während die gleichen Belastungen bei Personen mit geringeren Reserven u.U. Störungen auslösen. Am Beispiel der Seniorenheimübersiedlung bedeutet dies: Führen alle Versuche der Belastungsbewältigung nicht zu einer Reduktion der erlebten Belastung bzw. versucht der alte Mensch erst gar nicht, die bestehende Belastung zu bewältigen, dann scheinen negative psychische Folgen der Seniorenheimübersiedlung wahrscheinlich. Abbildung 1 zeigt dazu die Bedingungskonstellation am Beispiel der Seniorenheimübersiedlung. Personale Faktoren z.B. soziale Unterstützung Umwelt- und Situationsbedingungen als objektivierte Belastungsfaktoren z.B. Autonomiereduktion durch Heimumwelt Subjektive Repräsentation der Umweltbedingungen als subjektive Belastungsfaktoren Bewältigungsversuche psychische Folgen der Heimübersiedlung z.B. Depression Abbildung 1: Bedingungskonstellation bei der Altenheimübersiedlung (Quelle: Saup, 1984) 2.4 Handlungstheoretisches Modell zum Übergang ins Seniorenheim Der handlungsorientierte Ansatz (Prochaska, DiClemente & Norcross, 1992; Saup, 1993) der Seniorenheimübersiedlung nimmt einen stufenförmigen Verlauf an, wobei fünf Phasen unterscheidbar sind: Phase des bestehenden oder antizipierten Unterstützungsbedarfs; Entscheidungs- und Wartephase; Umsiedlungsphase; Phase der anfänglichen Eingewöhnung; Phase der längerfristigen Adaptation. Die Situation vor dem Übergang ist gekennzeichnet durch potenzielle und reale Gründe, die zum Umzug ins Seniorenheim führen, sowie Faktoren, die den Umzug ins Altersheim wahrscheinlicher machen (Holden, McBride & Perozek, 1997). Im wesentlichen führen drei Faktoren zur Inanspruchnahme eines Seniorenheims (Anderson & Newman, 1973): „need factors“ (all jene Indikatoren, die darauf hinweisen, dass ein älterer Mensch nicht mehr allein und unabhängig leben kann z.B. schlechter Gesundheitszustand), „enabling factors“ (Verfügbarkeit und Erreichbarkeit von Hilfe, soziale und ökologische Rahmenbedingungen) und „predisposing factors“ (Risikofaktoren für einen Seniorenheimeintritt z.B. Alter, Geschlecht, Isolation und mangelnde soziale Einbettung, körperliche Erkrankungen) (vgl. dazu Bickel & Jäger, 1986; Lehmkuhl, Bosch & Steinhart, 1986; Maercker, 1998; Russel, Cutrona, De La Mora & Wallace, 1997; Wahl & Kruse, 1999). Meist zwingt jedoch erst das Zusammenwirken mehrerer Faktoren zur Aufgabe der eigenen Wohnung (Saup, 1990). Als potenzielle Gründe für eine Heimübersiedlung (Klein, Salaske, Schilling, Schneider & Wunder, 1997; Nay, 1995) werden von älteren Menschen überwiegend Versorgung und Betreuung bei schlechtem Gesundheitszustand, Nicht-zur-Last-Fallen und schlechte Wohnverhältnisse genannt. Abbildung 2 zeigt die Phasen und Konsequenzen des Übersiedlungsprozesses. Phase Situation bei Übergang Situation nach Übergang Verschlechterung des Gesundheitszustands, vermehrte Inanspruchnahme von Hilfe Beginn der gedanklichen Auseinandersetzung häufig Notfallreaktion Möglichkeit zur Information und Vorbereitung „Wartelisteneffekt“ strukturelle und organisatorische Maßnahmen des Heimumzugs Reorganisation des sozialen Umfelds Phase der kurzfristigen Adaptation first-month–syndrom erste Bewältigungsversuche Phase der längerfristigen Adaptation ab dem sechsten Monat nach Umzug gelungene bzw. misslungene Adaptation Phase des bestehenden bzw. antizipierten Unterstützungsbedarfs Situation vor Übergang Konsequenzen Entscheidungs- und Wartephase Umsiedlungsphase Abbildung 2: Prozessmodell des Übergangs ins Altenheim (Quelle: Saup, 1993) Die Phase des antizipierten bzw. bestehenden Unterstützungsbedarfs ist beschreibbar durch die beginnende Verschlechterung des Gesundheitszustands und die vermehrte Inanspruchnahme von familiärer oder/und professioneller Hilfe des Betroffenen. Hier sollte im Idealfall die Auseinandersetzung mit der Thematik „Seniorenheim“ beginnen, denn nur so könnten realistische Vorstellungen darüber entwickelt werden, welche Veränderungen zu erwarten sind (Dieck, 1990; Pinquart & Devrient, 1991). Damit stellt diese Phase die unerlässliche Voraussetzung für einen belastungsreduzierten Heimübergang dar (Friedrich, 1994; Gallagher & Walker, 1990; Gass, Gaustad & Oberst, 1992; Gatterer, 1996; Harkulich & Brugler, 1991; Saup & Schröppel, 1993; Nay, 1995; Wirsing, 1993). Die gedankliche Auseinandersetzung mit der Institutionalisierung setzt meist sehr spät ein, lediglich 2,8% der über 60-jährigen setzten sich mit der Thematik Seniorenheim auseinander (Lehr, 1996). Die generelle Bereitschaft einmal in ein Seniorenheim zu ziehen, ist in der Altersgruppe der 60- bis 70-Jährigen am geringsten, nimmt jedoch mit der zunehmenden Inanspruchnahme von institutioneller Hilfe zu, so dass eine gedankliche Auseinandersetzung und das Einholen von Information erst ab der Alterskategorie von 80 bis 90 Jahren einsetzt (Lehr, 1996). Meist durch interne (z.B. Verschlechterung des Gesundheitszustands) oder externe Auslöser (z.B. Überforderung der Angehörigen) (Lehr, 1996) rückt die Möglichkeit einer Senioren-heimübersiedlung in den Blickpunkt des Interesses von Betroffenen und Angehörigen. Häufig aus einer gesundheitlichen Notlage heraus, müssen der alte Mensch bzw. seine Angehörigen die Entscheidung zum Umzug ins Seniorenheim treffen. Ein Drittel der künftigen Seniorenheimbewohner wird direkt aus dem Krankenhaus übersiedelt (Streller-Holzner, 1991), die Entscheidung wird meist von Familienangehörigen getroffen. Ist der Entschluss in ein Heim zu übersiedeln gefallen, so kann die konkrete Auseinandersetzung mit dem „Ereignis“ beginnen. In der Zeit vor der Übersiedlung haben es vor allem die Betroffenen mit vielen Ängsten zu tun, wesentlich für deren Entstehung sind Befürchtungen und Erfahrungen, der Umwelt hilflos ausgeliefert zu sein und nicht mehr selbständig über sich bestimmen zu können. Häufig genannte Ängste bezüglich des Seniorenheims betreffen das Eingesperrt sein, Alleinsein, Langeweile und Bevormundung (Nay, 1995). Die Entscheidungs- und Wartephase bietet einerseits die Chance Informationen über die künftige Lebensumwelt einzuholen (Fisch, 1992) und alle organisatorischen Schritte des Umzugs zu planen. Je aktiver der alte Mensch in die Planung seiner neuen Lebensumwelt einbezogen wird, desto positiver wird diese angenommen (Fisch, 1992). Andererseits birgt diese Wartezeit die potenzielle Gefahr von Wartelisteneffekten (Fischer, 1976; Lehr, 1966; Lieberman, Prock, Tobin, 1968; Saup, 1990) wie etwa geringere Lebenszufriedenheit, negieren von Zukunftsperspektiven, Tendenz zu Abhängigkeitsorientierung und depressive Verstimmungen. Zu lange Wartephasen und nichtvorhandene bzw. unvollständige Informationen begünstigen das Auftreten diese Effekte (Lehr, 1982). Einige Autoren plädieren dafür die Wartephasen so kurz wie möglich zu halten, um die Spanne der Verunsicherung zu verkürzen (Fischer, 1976; Lehr, 1966; Lieberman, Prock, Tobin, 1968), andere Untersuchungen weisen eher darauf hin, dass kurze Wartephasen belastender erlebt werden (Pinquart & Devrient, 1991; Saup, 1990). Diese Wartelisteneffekte sind in der gerontologischen Forschung jedoch umstritten. Die nächste Phase im Übersiedlungsprozess stellt die eigentliche Umsiedlungsphase dar, sie beinhaltet alle strukturellen und organisatorischen Maßnahmen des Einzugs ins Seniorenheim (etwa Auflösung der eigenen Wohnung, Organisation des Umzugs, Bezug des Zimmers). Obwohl aus Untersuchungen (Ames, 1993; Aneshensel, Pearlin, Mullan, Zarit & Whitlach, 1995; Klein et al., 1997; York & Calsyn, 1977) hervorgeht, dass Angehörige großes Interesse am zukünftigen Wohnort ihres älteren Angehörigen haben, wird das Seniorenheim von einem Großteil der Angehörigen und Betroffenen vor Übersiedlung nicht besichtigt. Einerseits wird die Informationssuche pflegender Angehöriger stark durch deren Pflege- überlastung eingeschränkt (Bear, 1993), andererseits wollen sich Angehörige und Betroffene mit der Thematik oft nicht auseinandersetzen (Johnson & Werner, 1982; Lehr, 1996). Für den älteren Menschen selbst ist die Nähe familiärer Beziehungen (Voges, 1993) das wichtige Auswahlkriterium (Wahl & Kruse, 1999). Im Zuge der Wohnungsauflösung muss sich der ältere Mensch von vielen seiner, mit der Lebensgeschichte eng verknüpften Gegenstände bzw. Gewohnheiten trennen. Vielfach stellt der Verlust persönlicher Gegenstände eine größere Belastung dar, als die Trennung von Freunden und sozialen Aktivitäten (Nay, 1995; Oswald & Fleischmann, 1998). In diesem Zusammenhang wird betont (Groger, 1995; Mikhail, 1992; Nay, 1995; Pinquart, 1998; Saup, 1990; Streller-Holzner, 1991; Wahl & Kruse 1999), dass die Eingewöhnung im Seniorenheim durch Kontinuität von Lebensgewohnheiten und Mitnahme eigener Einrichtungsgegenstände erheblich erleichtert werden kann. Im Zuge der Übersiedlung haben auch Angehörige mit vielen Belastungen zu kämpfen, die von der geeigneten Heimauswahl bis zur Regelung finanzieller und organisatorischer Angelegenheiten reichen (Zarit & Whitlach,1992). Der Übersiedlungsprozess ist mit der Übersiedlung nicht abgeschlossen, zentral für die weitere Adaptation ist die Situation nach dem Übergang. Die Situation nach dem Übergang ins Seniorenheim gliedert sich in die Phase der anfänglichen Eingewöhnung und in die Phase der längerfristigen Adaptation. Der Umzug ins Seniorenheim bedingt für den älteren Menschen eine drastische Veränderung seiner gesamten physikalischen, behavioralen, emotionalen, kognitiven und sozialen Lebensumstände (Oswald & Fleischmann, 1998), und erfordert eine Umstellung in nahezu allen Aspekten der Lebensführung. Der Umzug stellt eine Labilisierung für das gesamte bio-psycho-soziale Gleichgewicht dar, wodurch das Risiko für Erkrankungen erhöht wird (Gast, Gaustad & Oberst, 1992). Eine Vielzahl von Autoren beschreiben den Umzug ins Seniorenheim als traumatische (Choi, 1996; Haisch, 1993), stressreiche (Pinquart & Devrient, 1991; Mikhail, 1992; Nay, 1995), von Verlusten geprägte, schmerzvolle Erfahrung (Frieling-Sonnenberg, 1996; Freter, 1998; Nay, 1995), als „Relocation Shock“ und „Transfer Trauma“ (Horgas et al., 1996; Houts et al., 1996; Netting & Wilson, 1991). Tobin (1989) bezeichnet die ersten vier Wochen als besonders kritisch dafür, ob eine Anpassung an das Leben im Heim für den Betroffenen gelingt. Ausgeprägte Hoffnungslosigkeit, geringe Lebenszufriedenheit und depressive Verstimmung kennzeichnen oft das erste Monat im Seniorenheim („first-month-syndrom“). Neuere Studien (z.B. Lehr, 1996; Pinquart & Devrient, 1991) weisen daraufhin, dass die Phase der kurzfristigen Eingewöhnung mindestens bis zum sechsten Monat nach Umzug anzunehmen ist. Danach werden Mechanismen der längerfristigen Adaptation wirksam. Die erfolgreiche Bewältigung der Phase der kurzfristigen Anpassung erweist sich wesentlich für die längerfristige Adaptation. Wie in den vorangegangenen Phasen bleibt es wichtig, die Übersiedlung und die neuen Umweltanforderungen konstruktiv zu bewältigen und ein adäquates Maß an Selbständigkeit und persönlicher Kontrolle zu finden (vgl. dazu weiter oben Diathese-Stress-Modell). Während in der ersten Zeit nach dem Übergang erst neue soziale Kontakte geknüpft werden müssen, ist im Rahmen der längerfristigen Anpassung das richtige Maß an sozialer und nicht-sozialer Aktivität zu entwickeln (Wahl & Reichert, 1994). Wenig thematisiert wurden bisher die Bedürfnisse und Belastungen der Angehörigen in dieser Phase (z.B. veränderte Rollensituation, Schuld- und Versagensgefühle). Dabei werden Angehörige selten adäquat auf diese Veränderungen vorbereitet oder unterstützt. 3. Ausblick Die verschiedensten Studien zeigen, dass die Lebenserwartung über Jahrzehnte bis in die neueste Zeit gestiegen ist, wobei Frauen eine höhere Lebenserwartung als Männer haben. Gleichzeitig steigt auch der Anteil der älteren Menschen an der Gesamtbevölkerung. Mit zu- nehmendem Alter nimmt der Bedarf an Unterstützung bei älteren Menschen zu, wobei diese Unterstützung vielfach ambulant durch unterschiedliche Dienste erbracht wird. Mit höherem Alter werden oft komplexe Unterstützungen benötigt, die nur durch institutionalisierte Wohnformen (Seniorenheime etc.) zu realisieren sind. Im Hinblick auf die Belastungsprävention erfordert ein einschneidendes Ereignis wie die Übersiedlung in ein Seniorenheim - basierend auf Überlegungen der Stresstheorie - eine gezielte Planung sowie konkrete Maßnahmen, die sich sowohl auf die Zeit vor und nach dem Einzug ins Heim beziehen sollten. Stresstheorien weisen darauf hin, dass Belastungen durch vorbereitendes Wissen reduziert werden können. Auch im hohen Alter sind Menschen daran interessiert, ihre Lebensumwelt und Lebensqualität zu steigern, zu gestalten und mitzubestimmen. Begleitende Maßnahmen sind sowohl für den betroffenen, alten Menschen als auch für Angehörige vor der Umsiedlung, aber auch in der Eingewöhnungsphase im Sinne der Belastungsprävention dringend nötig. Da die Phase unmittelbar vor der Übersiedlung relativ unberechenbar ist, Entscheidungen müssen oft sehr schnell getroffen werden, sollte eine Intervention zur tatsächlichen Vorbereitung der Übersiedlung prophylaktisch möglichst früh ansetzen. Praktische Maßnahmen besonders in der Situation vor Übersiedlung sollten sich auf eine realistische Auseinandersetzung mit der Thematik „Umzug ins Seniorenheim“ beziehen, mit besonderer Berücksichtigung von Personen, für die die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme eines Seniorenheims erhöht ist. Dabei wären Wege zu suchen, um eine realistische Gewinn/Verlust-Bilanz zu verdeutlichen und zu zeigen, dass auch im hohen Alter in Seniorenheimen belastungspuffernde Faktoren wie persönliche Kontrolle, Wahlfreiheit und Mitbestimmung zu realisieren sind. Diese Vorbereitung sollte dabei nicht nur die betroffenen Senioren, sondern auch deren Angehörige miteinschließen. Als wichtigste belastungsreduzierende Maßnahmen in der Übersiedlungsphase wäre die sorgfältige Planung des Umzugs ins Heim zu nennen; zentrale Aspekte sind dabei die Wohnungsauflösung, die Übersiedlung und die Reorganisation des sozialen Netzwerkes. Befunde zeigen, dass die unmittelbare Anpassung im Seniorenheim einen wesentlichen Indikator für die längerfristige Eingewöhnung im Heim darstellt. Begleitende Interventionsmaßnahmen sollten sich in der Situation nach Übersiedlung vor allem auf die Unterstützung der Orientierung und auf den Aufbau von ersten Kontakten und Aktivitäten im Heim konzentrieren, dabei erweisen sich vor allem Depressivität, soziale Unsicherheit (auch als Folge chronischer Krankheiten) und Passivität häufig als Hemmschwellen für die Bewohner. Unterstützung in diesen Bereichen zu geben, stellt sich als eine wichtige Aufgabe professionell tätiger Berufsgruppen im Seniorenheimen heraus. Abschließend ist festzuhalten, dass der Übergang ins Seniorenheim einen komplexen Prozess darstellt, der mit verschiedensten Belastungsgrößen versehen ist, wenn auch die Belastungen dieses Schritts meist im Vordergrund stehen, so ist jedoch auch zu betonen, dass der Übergang ins Seniorenheim durchaus Chancen und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung bietet. Literaturverzeichnis Aldwin, C. (1991). Does age affect the stress and coping process? Implications of the age differences in perceived control. Journal of Gerontology, 46, 174-180. Aldwin, C. & Revenson, T.A. (1987). Does coping help? A reexamination of the relationship between coping and mental health. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 337-348. Ames, D. (1993). Depressive disorders among elderly people in long-term institutional care. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 27, 379-391. Anderson, P.R., & Newman, B.M. (1973). Development through life. A psychosocial approach. Illinois: Homewood. Aneshensel, C.S., Pearlin, L.I., Mullan, J.T., Zarit, S.H. & Whitlach, C.J. (1995). Profiles in care-giving. London: Academic Press. Armer, J.M. (1993). Elderly relocation to a congregate setting: factors influencing adjustment. Issues in Mental health Nursing, 14, 157-172. Baltes, P.B. (1993). The aging mind: Potential and limits. The Gerontologist, 33, 580-594. Baltes, P.B. & Baltes, M.M. (1990). Successful aging: Perspectives from the behavioral sciences. New York: Cambridge University Press. Baltes, P.B., Staudinger, U. & Lindenberger, U. (1999). Life span psychology: Theory and application to intellectual functioning. Annual Review of Psychology, 50, 471-507. Baumann, U. & Perrez, M. (Hrsg.). (1998). Lehrbuch Klinische Psychologie - Psychotherapie. Bern: Huber. Bear, M. (1993). The differential roles of caregivers, caregiver networks, and health professionals in residentialcare-home entry. The Journal of Applied Gerontology, 12, 411-424. Bickel, H. & Jaeger, J. (1986). Die Inanspruchnahme von Heimen im Alter. Zeitschrift für Gerontologie, 19, 30-39. Blonski, H. (1995). Einführung. In H. Blonski (Ed.), Alte Menschen und ihre Ängste. (S. 13-32). München: Ernst Reinhardt Verlag. Bollnow, O. (1962). Das hohe Alter. Neue Sammlung, 2, 385-396. Brandstädter, J. & Wentura, D. (1995). Adjustment to shifting possibility frontiers in later life: Complementary adaptive modes. In R.A. Dixon & L. Bäckman (Eds.), Compensating for psychological deficits and declines. (pp. 83-106). Mahwah, NJ: Erlbaum. Brandstädter, J., Rothermund, K. & Schmitz, U. (1998). Maintaining self-integrity and efficacy through adulthood and later life: The adaptive functions of assimilative persistence and accomodative flexibility. In J. Heckhausen & C.S. Dweck (Eds.), Motivation and self-regulation across the life span. (pp. 365-388). New York: Cambridge. Carstensen, L.L. (1998). A Life-Span Approach to Social Motivation. In J. Heckhausen & C.S. Dweck (Eds.), Motivation and Self-Regulation Across the Life Span. (pp. 341-364). Cambridge: Cambridge University Press. Carver, C.S. & Scheier, M.F. (1998). On the self-regulation of behavior. Cambridge: Cambridge University Press. Chiriboga, D. (1992). Paradise lost: Stress in modern age. In M. Wykle, E. Kahana, & J. Kowal (Eds.), Stress and health in the elderly. (pp. 35-71). New York: Springer. Choi, N.G. (1996). Older persons who move: Reasons and health consequences. Journal of Applied Gerontology, 15, 325-344. Costa, P.T.Jr., Zonderman, A.B. & McCrae, R.R. (1991). Personality, defense, coping, and adaptation in adulthood. In E. Cumming, A.L. Greene, & K.H. Karraker (Eds.), Life-span developmental psychology: Perspectives on stress and coping. (pp. 277-293). Hillsdale: Erlbaum. Dieck, M. (1990). Zur Sozialamtspraxis: Wohnungsauflösung bei Heimunterbringung alter Menschen. Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit, 41, 352-354. Elder, G.H., George, L.K. & Shanahan, M.J. (1996). Psychosocial stress over the life course. In H.B. Kaplan (Ed.), Psychosocial stress. (pp. 247-292). San Diego: Academic Press. Filipp, S.H. & Ferring, D. (1989). Zur Alters- und Bereichsspezifität. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 21, 279-293. Fisch, H.P. (1992). Umgang mit Alterspatienten, ihren Angehörigen und Betreuern im Alters- und Pflegeheim. In N.I. Jovic & S. Uchtenhagen (Eds.), Ambulante Psychogeriatrie. (pp. 78-87). Heidelberg: Asanger. Folkman, S., Lazarus, R.S. Pimley, S., & Novacek, J. (1987). Age differences in stress and coping processes. Psychology and Aging, 2, 171-184. Freter, H.J. (1998). Nachtpflegeeinrichtungen für Demenzkranke: Bedarf, Konzeption, Begleitforschung. Zeitschrift für Gerontopsychologie und -psychiatrie, 11, 81-85. Friedrich, K. (1994). Wohnortwechsel im Alter. Zeitschrift für Gerontologie, 27, 410-418. Frieling-Sonnenberg, W. (1996). Was ist das Leben eines alten Menschen gesellschaftlich "wert"? Altenpflege, 7, 471-472. Gallagher, E.M., & Walker, G. (1990). Vulnerability of nursing home residents during relocations and renovations. Journal of Aging Studies, 4, 31-46. Gass, K.A., Gaustad, G., & Oberst, M.T. (1992). Relocation appraisal, functional independence, morale and health of nursing home residents. Issues in Mental health Nursing, 13, 239-253. Gatz, M. (1998). Toward a developmentally informed theory of mental disorder in older adults. In J. Lomranz (Ed.), Handbook of Aging and Mental Health. (pp. 101-120). New York: Plenum. Gatz, M., Kasl-Godley, J.E. & Karel, M.J. (1996). Aging and Mental Disorders. In J.E. Birren & K.W. Schaie (Eds.), Handbook of The Psychology of Aging. (pp. 365-382). San Diego: Academic Press. Groger, L. (1995). A nursing home can be a home. Journal of Aging Studies, 9, 137-153. Haisch, J. (1993). Die Vernachlässigung gesundheitspsychologischen Wissens im Altenheim. Praxis der Psychotherapie und Psychosomatik, 38, 297-302. Harkulich, J.T. & Brugler, Ch. (1991). Relocation and the resident. Activities, Adaptation and Aging, 15, 51-60. Herzog, A.R., & Markus, H.R. (1999). The Self-Concept in Life Span and Aging Research. In V.L. Bengtson & K.W. Schaie (Eds.), Handbook of Theories of Aging. (pp. 227-252). New York: Springer. Holden, K., McBride, T. & Perozek, M. (1997). Expectations of nursing home use in the health and retirement study: the role of gender, health, and family characteristics. Journals of Gerontology, Psychological Sciences and Social Sciences, 52, 240-251. Horgas, A.L., Wahl, H.-W. & Baltes, M.M. (1996). Dependency in Late Life. In L.L. Carstensen, B.A. Edelstein, & L. Dornbrand (Eds.), The Practical Handbook of Clinical Gerontology. (pp. 54-75). Thousand Oaks: Sage Publications. Houts, P.S., Nezu, A.M., Nezu, C.M. & Bucher, J.A. (1996). The pre-pared family caregiver: a problem-solving approach to family caregiver education. Patient Education and Counseling, 27, 63-73. Johnson, M.A. & Werner, C. (1982). "We had no choice". A study in familial guilt feelings. Journal of Gerontological Nursing , 8, 631-645. Kahana, B. & Kahana, E. (1998). Toward a Temporal-Spatial Model of Cumulative Life Stress: Placing LateLife Stress Effects in a Life-Course Perspective. In J. Lomranz (Ed.), Handbook of Aging and Mental Health. (pp. 153-178). New York: Plenum. Kahana, E.F., Kahana, B. & Young, R. (1987). Strategies of coping and postinstitutional outcomes. Research on Aging, 9, 182-199. Katz, I.M. & Parmelee, P.A. (1997). Overview. In R.L. Rubinstein & M.P. Lawton (Eds.), Depression in longterm and residential care. (pp. 1-25). New York: Springer. Klein, T., Salaske, I., Schilling, H., Schneider, S. & Wunder, E. (1997). Altenheimbewohner in Deutschland: Sozialstrukturelle Charakteristika und die Wahl des Heims. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, 30, 5467. Labouvie-Vief, G. (1997). Cognitive-Emotional Integration in Adulthood. In K.W. Schaie & M. Lawton (Eds.), Annual Review of Gerontology and Geriatrics. (pp. 206-237). New York: Springer. Lawton, M.P. (1999). Environmental design features and the well-being of older persons. In M. Duffy (Ed.), Handbook of counseling and psycho-therapy with older adults. (pp. 350-363). New York: Wiley. Lawton, M.P., & Nahemow, L. (1973). Ecology and the aging process. In C. Eisdorfer & M.P. Lawton (Eds.), Psychology of adult development and aging. (pp. 619-674). Washington, DC.: American Psychological Association. Lawton, M.P., & Simon, B. (1968). The ecology of social relationships in housing for the elderly. Gerontologist, 8, 108-115. Lazarus, R.S. (1999). Stress and Emotion: A new synthesis. New York: Springer. Lazarus, R.S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer. Lehmkuhl, D., Bosch, G. & Steinhart, I. (1986). Alte Menschen in Heimen. Zeitschrift für Gerontologie, 19, 5664. Lehr, U.M. (1966). Sozialpsychologische Aspekte der Heimübersiedlung älterer Mitbürger. Blätter der Wohlfahrtspflege, 12, 377-383. Lehr, U.M. (1968). Sozialpsychologische Aspekte der Heimübersiedlung älterer Mitbürger. In H. Thomae & U. Lehr (Eds.), Altern. Probleme und Tatsachen. (pp. 439-457). Frankfurt: Akademische Verlagsgesellschaft. Lehr, U.M. (1982). Depression und Lebensqualität im Alter - Korrelate negativer und positiver Gestimmtheit. Zeitschrift für Gerontologie, 15, 241-249. Lehr, U.M. (1996). Psychologie des Alterns (8. überarb. Auflage). Wiesbaden: Quelle und Meyer. Lieberman, M.A., Prock, V.N. & Tobin, S.S. (1968). Psychological effects of institutionalization. Journal of Gerontology, 23, 343-353. Maercker, A. (1998). Höheres Lebensalter, Bewertungsprozesse und Anpassungsstörungen. Zeitschrift für Klinische Psychologie, 27, 144-146. Marsiske, M., Lang, F.R., Baltes, P.B. & Baltes, M.M. (1995). Selective optimization with compensation: Lifespan perspectives on successful human development. In R.A. Dixon & L. Bäckman (Eds.), Compensating for psychological deficits and declines. (pp. 83-106). Mahwah, NJ.: Erlbaum. Mikhail, M.L. (1992). Psychological responses to relocation to a nursing home. Journal of Gerontological Nursing, 18, 35-39. Nay, R. (1995). Nursing home residents' perceptions of relocation. Journal of Clinical Nursing, 4, 319-325. Oswald, W.D., & Fleischmann, U.M. (1998). Gerontopsychologie. Stuttgart: Kohlhammer. Parmelee, P. & Lawton, M.P. (1990). The design of special environments for the aged. In J.E. Birren & K.W. Schaie (Eds.), Handbook of the psychology of aging. (pp. 464-487). New York: Academic Press. Pearlin, L.I., & Skaff, M.M. (1996). Stress and the life course: A paradigmatic alliance. The Gerontologist, 36, 239-247. Pinquart, M. (1998). Das Selbstkonzept im Seniorenalter. Weinheim: PVU. Pinquart, M., & Devrient, F. (1991). Einflußfaktoren auf die Eingewöhnung in ein Feierabend- und Pflegeheim. Ergebnisse einer Längsschnittstudie. Zeitschrift für Alternsforschung, 46, 119-122. Prochaska, J.O., DiClemente, C.C. & Norcross, J.C. (1992). In search of how people change. Applications to addictive behaviors. American Psychologist, 47, 1101-1114. Quayhagen, M.P., & Quayhagen, M. (1982). Coping with conflict: Measurement of age-related patterns. Research on Aging, 4, 364-377. Russel, D.W., Cutrona, C.E., de la Mora, A. & Wallace, R.B. (1997). Lone-liness and nursing home admission among rural older adults. Journal of Psychology and Aging, 12, 574-589. Salthouse, T.A. (1999). Theories of Cognition. In V.L. Bengtson & K.W. Schaie (Eds.), Handbook of Theories of Aging. (pp. 196-208). New York: Springer. Saup, W. (1984). Streß und Streßbewältigung bei der Heimübersiedlung älterer Menschen. Zeitschrift für Gerontologie, 17, 198-204. Saup, W. (1990). Formen der Lebensbewältigung im Alter. In P. Mayring & W. Saup (Eds.), Entwicklungsprozesse im Alter. (pp. 185-200). Stuttgart: Kohlhammer. Saup, W. (1993). Alter und Umwelt: Eine Einführung in die Ökologische Gerontologie. Stuttgart: Kohlhammer. Saup, W. & Schröppel, H. (1993). Wenn Altenheimbewohner selbst bestimmen können. Augsburg: Verlag für Gerontologie. Schulz, M. (1973). Spiel und Spielmittel für Menschen im Alter. In Konrad Adenauer Stiftung (Hrsg.), Anpassung oder Integration. (S. 101-120). Bonn: Konrad-Adenauer Verlag. Staudinger, U.M., Marsiske, M., & Baltes, P.B. (1995). Resilience and reserve capacity in later adulthood: Potentials and limits of development across the life span. In D. Cicchetti & D. Cohen (Eds.), Developmental psychopathology. (pp. 801-847). New York: Wiley. Streller-Holzner, A. (1991). Umzug ins Altenwohnheim? München: Reinhardt. Tews, H.P. (1977). Sozialökologische Einflußfaktoren auf das Verhalten alter Menschen. Zeitschrift für Gerontologie, 10, 322-342. Tobin, S.S. (1989). The effects of institutionalization. In K.S. Markides & C.I. Cooper (Eds.), Aging, stress and health. (S. 139-164). Chichester: Wiley. Ullrich, I. (1995). Mit Angst umgehen in der stationären Altenhilfe. In H. Blonski (Ed.), Alte Menschen und ihre Ängste. (pp. 167-177). München: Ernst Reinhardt Verlag. Voges, W. (1993). Aufgabe des Haushalts und Einzug in das Altenheim. Was wird aus dem bisherigen Lebensstil? Zeitschrift für Gerontologie, 26, 386-394. Wahl, H.W., & Kruse, A. (1999). Aufgaben, Belastungen und Grenzsituationen im Alter, Gesamtdiskussion. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, 32, 456-472. Wahl, H.W. & Reichert, M. (1994). Übersiedlung und Wohnen im Altenheim als Lebensaufgabe. In A. Kruse & H.W. Wahl (Eds.), Altern und Wohnen im Heim: Entstation oder Lebensort? (pp. 14-48). Bern: Huber. Weber, A. (1980). Erziehung und Bildung im Alter. Pädagogische Rundschau, 34, 649-665. Whitbourne, S.K. (1998). Physical changes in the aging individual: Clinical implications. In I.H. Nordhus, G.R. VandenBos, S. Berg, & P. Fromholt (Eds.), Clinical gerontopsychology. (pp. 79-108). Washington, DC.: American Psychological Association. Wirsing, K. (1993). Psychologisches Grundwissen für Altenpflegeberufe. Weinheim: PVU York, J.L. & Calsyn, R.J. (1977). Family involvement in nursing homes. The Gerontologist, 17, 500-505. Zarit, S.H. & Whitlatch, C.J. (1992). Institutional placement: phases of the transition. The Gerontologist, 32, 665-672. Zubin, J. & Spring, B. (1977). Vulnerability: A new view of schizophrenia. Journal of Abnormal Psychology, 86, 103-126.