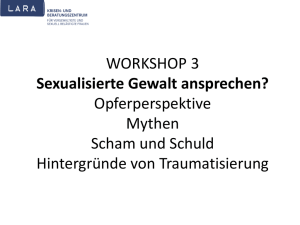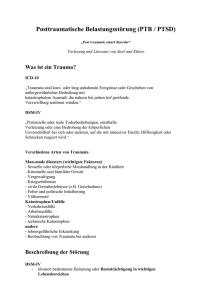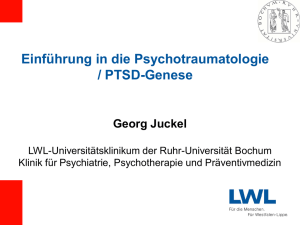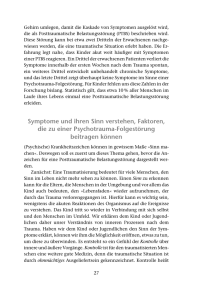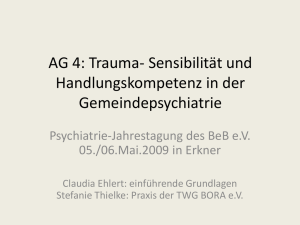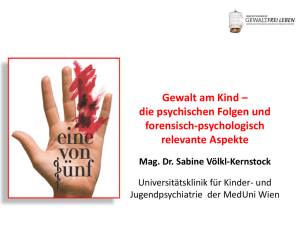Posttraumatische Belastungsstörung
Werbung

PTB, R. Steil, Version 1 Posttraumatische Belastungsstörung R. Steil 1. Problemstellung 1980 wurde die Diagnose der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTB) als eigenständiges Störungsbild, welches sich nach extrem belastenden Erfahrungen wie z.B. interpersoneller (sexueller oder nicht-sexueller) Gewalt, Unfällen, Naturkatastrophen, Kriegserlebnissen. Folter und Verfolgung ausbilden kann, in das DSM aufgenommen (American Psychiatric Association, 1980). Ausschlaggebend waren dabei die psychischen Folgen der Erfahrungen von Veteranen des Vietnamkrieges und der erstarkende Feminismus im Amerika der 70er Jahre, welche die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die Folgen interpersoneller Gewalt lenkten. Seither hat eine Fülle von Studien gezeigt, dass solche Ereignisse eine PTB auslösen können, bei welchen der oder die Betroffene mit großer Furcht und Entsetzen direkt oder indirekt eine Situation erlebt, die eine Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit ihrer selbst oder eines anderen Menschen beinhaltet. Als eine der wenigen Störungen, die das DSM beschreibt, beinhaltet sie eine ätiologische Annahme: die des traumatischen Stressors als Auslöser der Symptome. Grundlegende Dimensionen der PTB-Symptomatik sind - empirischen Untersuchungen zufolge – bei Erwachsenen wie bei Kindern und Jugendlichen drei Symptomgruppen: (1) belastendes Wiedererleben der traumatischen Ereignisse im Wachen (Intrusionen) oder im Schlaf und dessen aktive Vermeidung, (2) emotionale Taubheit und passive Vermeidung emotional negativer Aktivitäten sowie (3) Symptome einer autonomen Übererregung wie z.B. Schlaf- und Konzentrationsstörungen, Reizbarkeit oder erhöhte Schreckhaftigkeit (Anthony, Lonigan & Hecht, 1999). Die PTB führt zu erheblicher Beeinträchtigung in Sozialkontakten, Familie oder Beruf. Häufig folgen auch sekundäre und andauernde Stressoren (wie der Verlust von Angehörigen, schmerzhafte medizinische Behandlungen, körperliche Entstellung, Umzug und Verlust der vertrauten Umgebung). Häufig kommt es in der Folge einer PTB zur Entwicklung sekundärer psychischer Störungen wie Depression oder Substanzabhängigkeit, welche ihrerseits erhebliches Leiden verursachen. Die typischen 1 PTB, R. Steil, Version 1 Symptome der PTB sowie Symptome der Dissoziation können schon in den ersten Stunden und Tagen nach einem Trauma auftreten. DSMIV (American Psychiatric Association, 1994; deutsche Übersetzung von Saß, Wittchen & Zaudig, 1994) und ICD10 (World Health Organization, 1991, deutsche Übersetzung von Dilling, Mombour & Schmidt, 1993) sehen hierfür die Diagnose der akuten Belastungsstörung (AB) vor. Neben der Behandlung der Störung ist der Bereich der sekundären Prävention, d.h. der Verhinderung einer langfristigen psychischen Erkrankung traumatisierter Menschen, von besonderem psychotherapeutischen bzw. gesellschaftlichem Interesse. Fallbeispiel: Biographisches Frau A. ist 27 Jahre alt, sie studiert in einer großen Stadt Philosophie und lebt alleine. Finanziell unterstützt wird sie von ihrer Familie. Sie hat zwei Schwestern, die jünger sind als sie. Frau A. beschreibt ihre Kindheit und Jugend als negativ beeinflusst durch den ehelichen Zwist ihrer Eltern, der da gewesen sei solange sie sich erinnern könne. Sie habe sehr selbständig sein müssen und viele Pflichten im Haushalt schon früh übernehmen müssen. Sie habe schon mit 15 gewusst, dass sie sobald als möglich ausziehen und selbständig leben wolle. Die Beziehung zur Mutter sei im ganzen o.k., die zum Vater heute sehr konflikthaft. Mit den beiden Schwestern verstehe sie sich gut, sie seien jedoch noch zu jung, um echte Gesprächspartnerinnen zu sein. Frau A. hatte mehrere kurze intime Beziehungen zu Männern, eine längere Partnerschaft bisher noch nicht. Nach dem Abitur, das sie mit Bravour bestand, absolvierte sie ein Praktikum bei einem Fernsehsender, danach begann ihr Studium an einem Ort möglichst weit von den Eltern entfernt. Ihr Studium machte ihr immer großen Spaß, sie war sehr erfolgreich. Ihr Berufswunsch ist Journalistin. Ihre Freizeit verbrachte sie früher meist mit Freundinnen oder Freunden oder in einer Clique. Sie ging häufig aus, zu Partys und zum Tanzen, hatte vielfältige Interessen. Mit ihren Kommilitonen verstand sie sich prächtig. Beschreibung der Störung 2 PTB, R. Steil, Version 1 Frau A. wendet sich nach einem Zeitungsbericht über die Folgen sexueller Traumatisierung an die Psychotherapeutin. Sie berichtet von einem schrecklichen Erlebnis bei einem Auslandsaufenthalt in einem moslemischen Land. Sie hatte sich dort an einer Universität in einer großen Stadt um einen Studienplatz bemüht und ihn bekommen. Ein halbes Jahr lang wollte sie die Kultur, die sie sehr interessierte, kennen lernen und dort Philosophie studieren. Frau A. genoss die erste Zeit in M. sehr und fand sich schnell an der Universität zurecht. Im ersten Monat ihres Aufenthaltes lernte sie den Manager G., 7 Jahre älter als sie, kennen. Er wirkte auf sie sehr westlich orientiert, hatte in Europa studiert und gelebt. Sie verliebte sich und zog zu ihm. Nach einer sehr schönen Zeit zu Beginn habe er ihr mehr und mehr vorgeschrieben, was sie tun solle oder nicht, wann sie zu Hause sein solle etc. Er wurde immer eifersüchtiger, wenn sie sich mit Freunden traf, es sei dann immer häufiger zum Streit gekommen. Nach 3 Monaten, nach einem besonders schlimmen Streit, bei dem er ihr vorgeworfen habe, sie habe ihn betrogen, habe sie beschlossen, sich von ihm zu trennen. Sie habe ein Flugticket besorgt. Die wenigen Nächte bis zum Heimflug habe sie in einem Hotelzimmer verbringen wollen. In diesem Hotelzimmer hielt sie sich auf, als es plötzlich an ihre Tür klopfte. Obwohl sie ihm keine Adresse hinterlassen habe, habe er vor der Tür gestanden. Er schrie auf sie ein und beschimpfte sie als Hure, die Bestrafung verdient habe. Er schlug sie und trat auf sie ein. Sie blutete und hatte starke Schmerzen aufgrund mehrere Rippenbrüche. Er verbrannte alle ihre Kleidungsstücke und Besitztümer, einschließlich der, die sie trug, samt ihrem Flugticket. Er fügte ihr Verbrennungen an den Händen zu und drohte ihr, sie so lange zu quälen, bis sie ihre Untreue zugäbe. Er vergewaltigte sie. Nach mehreren solcher Stunden zwang er sie, mit ihm in seine Wohnung zurück zu kommen. Von dort gelang der Patientin eine Woche später die Flucht. Symptome auf der Verhaltensebene: Frau A. vermeidet Situationen und Dinge, die sie an das traumatische Erlebnis erinnern könnten. Sie hat alle Dinge, die mit ihrem Aufenthalt zu tun haben, verbannt. Sie spricht nicht mit anderen über das, was ihr geschehen ist. Sie vermeidet Kontakte zu Menschen, die sie nicht kennt, ganz besonders zu Männern. Während sie früher auch abends problemlos alleine das Haus verließ, tut sie dies nun nicht mehr. Mit einem Mann alleine in einem Zimmer zu sein ist für sie eine unerträgliche Vorstellung. Ins Ausland reiste sie nicht mehr. Wie könne sie verhindern, dass ihr das gleiche passiere? 3 PTB, R. Steil, Version 1 Symptome auf kognitiv-emotionaler Ebene: Bereits kurz nach dem Trauma hatte Frau A. belastende Erinnerungen und Gedanken an das Erlebte, die sich ihr gegen ihren Willen aufdrängten und bewirkten, dass sie sich elend fühlte. Sie hatte das Gefühl, dass sie eine solche Behandlung verdient hat. Sie hätte sich eben anders verhalten müssen, sie hat ihren Partner dazu gereizt. Sie ist fassungslos darüber und wirft sich vor, dass sie diesen Mann so falsch eingeschätzt hat. Sie hat das Gefühl, nie mehr jemandem trauen zu können, wenn sie einen solchen Fehler begangen habe. Sie hätte es doch vorhersehen müssen. Wenn ihr das mit diesem Mann passiert sei, könne es ihr mit jedem geschehen. Ihrer Einschätzung anderer Menschen, so sagt sie, könne sie einfach nicht mehr trauen. Sie hat das Gefühl ihre Würde verloren zu haben, weil sei so völlig außer Kontrolle geraten sei in der Situation. Sie habe alles gestanden was er wollte. Sie habe geschrieen und gewimmert, obwohl sie doch sonst ein so starker Mensch sei! Sie glaubt, dass sich eine anderen Frau besser verhalten habe. Frau A. berichtet über starke Konzentrationsprobleme, quält sich aber dennoch zur Zeit durch Prüfungen. Sie sagt, sie fühle sich wie ein Roboter, sie funktioniere zwar, aber ohne richtig zu leben. Sie grübelt darüber nach, wie sie das Trauma habe verhindern können, wie sie sich in der Situation anders habe verhalten können. Symptome auf körperlicher Ebene: Frau P. berichtet, dass sie bei der Konfrontation mit Reizen, die sie an das Trauma erinnern, und beim Auftreten von intrusiven Erinnerungen und Gedanken eine große körperliche Belastung verspürt. Verhalten der Freunde und Angehörigen: Frau A. spricht nicht mit anderen über das Trauma, und weder ihre Freundinnen noch ihre Familienmitglieder schneiden das Thema an. 4 PTB, R. Steil, Version 1 2. Klassifikation und Klinische Beschreibung (Symptomatologie) PTB und AB werden im DSMIV den Angststörungen zugerechnet, in der ICD10 bilden PTB und AB zusammen mit der Anpassungsstörung eine eigene Störungsgruppe. Eine weitere Diagnose nach Traumatisierung, die der andauernden Persönlichkeitsveränderung nach Extrembelastung (APE), sieht nur die ICD10 vor, diese wird der Gruppe der Persönlichkeitsund Verhaltensstörungen zugeordnet. Die Kriterien der PTB nach ICD10 werden von vielen Seiten kritisiert. Eine Orientierung an den im Vergleich eindeutiger operationalisierten Kriterien nach DSMIV wird empfohlen. Unterschiede bei der Diagnose von PTB und AB sowie Probleme werden im folgenden erläutert. Diagnosekriterien der PTB Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Symptomkriterien der beiden großen Diagnosesysteme. Traumakriterien: Laut ICD10 entsteht die PTB als eine verzögerte oder protrahierte Reaktion auf ein belastendes Ereignis oder eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigen Ausmaßes. Bedingung ist, dass das Ereignis bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde. Dieses Kriterium wird kritisiert, da die subjektiven Reaktionen auf eine vergleichbare Traumatisierung durchaus unterschiedlich sein können. Das DSMIV (American Psychiatric Association, 1994) beschreibt als Trauma ein Ereignis, das schwere körperliche Verletzung, tatsächlichen oder möglichen Tod oder eine Bedrohung der physischen Integrität der eigenen Person oder anderer Personen beinhaltet. Entscheidend ist dabei die subjektive Reaktion mit intensiver Furcht, Hilflosigkeit oder Entsetzen, bei Kindern auch aufgelöstes oder agitiertes Verhalten. Dies basiert auf Befunden, dass vor allem die subjektiv wahrgenommene Bedrohung die spätere posttraumatische Symptombelastung vorhersagt. Dem Entwicklungsstand unangemessene sexuelle Erfahrungen bei Kindern ohne angedrohte oder tatsächliche Gewalt oder Verletzung gelten laut DSMIV generell und auch unabhängig vom subjektivem Erleben des Kindes als Trauma. Symptomkriterien: Wiederholte, unausweichliche Erinnerungen oder Wiederinszenierung des Ereignisses in Gedächtnis, Tagträumen oder Träumen ist im Zusammenhang mit einem traumatischen Ereignis laut ICD10 hinreichend für die Diagnose einer PTB. Nach DSMIV dagegen wird das Vorliegen von Symptomen aus den drei Symptombereichen Intrusion, Vermeidung / emotionale Taubheit und autonome Übererregung verlangt sowie eine durch die 5 PTB, R. Steil, Version 1 Symptomatik bedingte klinisch bedeutsame Beeinträchtigung im sozialen, beruflichen oder in anderen wichtigen Lebensbereichen. Beginn und Dauer: Nach ICD10 soll eine PTB nur dann diagnostiziert werden, wenn sie innerhalb von 6 Monaten nach dem Trauma aufgetreten ist, danach wird eine wahrscheinliche Diagnose PTB vergeben. Diese Beschränkung steht im Kontrast zum DSMIV, welches gerade eine Form der PTB mit verzögertem Beginn (ab 6 Monate nach dem Trauma) spezifiziert. Die ICD10 spezifiziert kein Kriterium der Dauer der Symptomatik, laut DSMIV muss sie seit mindestens 4 Wochen bestehen. Das DSMIV unterscheidet zwischen einem akuten (weniger als 3 Monate andauernden) und einem chronischen (länger als 3 Monate andauernden) Verlauf der Störung. Diagnosekriterien der AB Bei der Diagnose der AB gelten laut DSMIV die entsprechenden Traumakriterien, laut ICD10 sind die auslösenden Ereignisse definiert als ein überwältigendes traumatisches Erlebnis mit einer ernsthaften Bedrohung für die Sicherheit oder körperliche Unversehrtheit des Betroffenen bzw. eine ungewöhnlich plötzliche und bedrohliche Änderung der sozialen Stellung und / oder des Beziehungsnetzes. Symptomkriterien: Ein Gefühl der Betäubung, Depression, Angst, Ärger, Verzweiflung, sowie Symptome wie Überaktivität, Rückzug oder Symptome der Dissoziation wechseln sich Stunden bis Tage nach der Traumatisierung in rascher Folge ab. Zwischen deren Auftreten und der Traumatisierung muss dabei ein klarer und unmittelbarer Zusammenhang gegeben sein. Abzugrenzen sind die Symptome einer AB laut ICD10 von der Verschlimmerung einer schon vor dem Trauma bestehenden psychischen Störung, laut DSMIV darüber hinaus von psychischen Symptomen, die auf die direkte Wirkung einer Droge oder eines Medikamentes bzw. eine Krankheit oder eine während des Traumas erlittene Verletzung zurückgehen. Ausschlusskriterium ist in beiden Diagnosesystemen, dass die Symptome besser durch eine andere psychische Störung erklärt werden können. Das DSMIV beschreibt die Symptombereiche der Dissoziation (Depersonalisation, Derealisation), der Intrusion, der Vermeidung und des erhöhten Erregungsniveaus, aus denen drei (Dissoziation) bzw. je ein Symptom vorliegen sollen. Zusätzlich wird zur Vergabe der Diagnose verlangt, dass die Symptome mit einer Beeinträchtigung in verschiedenen Lebensbereichen bzw. der Erfüllung wichtiger Aufgaben einhergehen. 6 PTB, R. Steil, Version 1 Beginn und Dauer: Dauert die posttraumatische Symptomatik kürzer als 2-3 Tage (laut ICD10) bzw. als vier Wochen (laut DSM-IV) an, so wird die Diagnose einer akuten Belastungsstörung vergeben. Das DSM verlangt eine Mindestdauer der Symptomatik von 2 Tagen und einen Beginn innerhalb der ersten vier Wochen nach der Traumatisierung, die ICD10 verlangt einen Beginn innerhalb weniger Minuten. Diagnosekriterien der APE Hierunter fasst die ICD10 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen, welche sich bei prätraumatisch in ihrer Persönlichkeit unauffälligen Personen nach extremer oder übermäßig anhaltender Belastung oder nach einer schweren Krankheit entwickelt haben. Eine Definition der Belastungsfaktoren erfolgt als tiefgreifende, existentiell extreme (meist - jedoch nicht notwendigerweise - traumatische) Erfahrungen. Bei der Person sollten Hinweise auf eine eindeutige und anhaltende Veränderung im Wahrnehmen, Denken und Verhalten bezüglich der Umwelt und der eigenen Person vorliegen sowie unflexibles und unangepasstes Verhalten, welches vor der belastenden Erfahrung nicht bestand. Ausgeschlossen wird die Diagnose, wenn das Verhalten durch eine andere psychische Störung erklärt werden kann. Klinische Beschreibung (Symptomatologie) Die Beschreibung der Symptomatologie erfolgt gegliedert nach deren empirisch gefundenen Dimensionen. Symptome des Wiedererlebens und Strategien zu deren aktiver Vermeidung: Der Betroffene erlebt im Wachen (oder im Schlaf als Alpträume) das Geschehene auf belastende Weise als Bilder, Filmszenen, Gerüche, Geräusche oder andere Sinnesempfindungen wieder. Bisweilen bestehen die Intrusionen aus nicht real erlebten, sondern z.B. gefürchteten Ereignissen (immer wieder kommt dem Patienten ein noch katastrophalerer Ausgang des Ereignisses in den Sinn). Die Intrusionen können an Intensität stark variieren bis hin zu dem subjektiven Eindruck, das Trauma aktuell wieder zu durchleben (Flashbacks). Die Konfrontation mit Dingen oder Situationen, die an das Trauma erinnern (externale Trigger wie z.B. Sirenen oder dem Trauma ähnliche Fernsehsendungen, internale Trigger wie z.B. ein Gefühl der Hilflosigkeit, das Auftreten von durch Verletzungsfolgen bedingtem Schmerz oder physiologische Erregungserhöhung durch Ärger etc.), wird als sehr belastend erlebt, der Betroffene reagiert mit körperlichen Symptomen der Erregung wie z.B. Zittern, Übelkeit, 7 PTB, R. Steil, Version 1 Herzrasen oder Atemnot, welche das Bild einer Panikattacke bieten können. Begleitet werden kann die Konfrontation mit Erinnerungen von einer Reihe weiterer körperlicher Beschwerden wie z.B. Kopfschmerzen. Um dieser Belastung zu entgehen, wendet der Betroffene Strategien zur Vermeidung oder Kontrolle der Intrusionen an: Auf der behavioralen Ebene vermeidet er mögliche Auslöser der Erinnerungen (Meiden des Ortes der Traumatisierung oder anderer Personen, die ebenfalls zugegen waren etc.), auf kognitiver Ebene wird das spontane Auftreten von Intrusionen mit Flucht beantwortet: der Patient lenkt sich ab durch eine andere Tätigkeit, er beginnt zu ruminieren, um den aufdringlichen Bildern und Sensationen zu entkommen, er versucht, Gedanken an das Trauma zu unterdrücken. Meist wird vermieden, mit anderen über das traumatische Geschehen zu sprechen. Die Betroffenen haben katastrophisierende Befürchtungen darüber, was bei einer ungehinderten Konfrontation mit den traumatischen Erinnerungen geschehen würde (im Sinne von “Ich werde verrückt werden.”, “Ich werde völlig die Kontrolle verlieren.”, “Ich werde anfangen zu weinen und nie mehr aufhören können.”). Besonders diese Befürchtungen wie die aktive Vermeidung traumabezogener Stimuli machen den Beginn einer Behandlung bzw. die Teilnahme an präventiver Intervention für die Betroffenen zu Beginn sehr schwer. Grundlage einer Berufsunfähigkeit bei PTB-Patienten sind häufig Symptome der Vermeidung (eine Bankangestellte kann nach einem bewaffneten Raubüberfall, bei dem sie Opfer wurde, nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten). Symptome der emotionalen Taubheit bzw. der passiven Vermeidung traumarelevanter Stimuli: Der Betroffene hat ein deutlich vermindertes Interesse an Dingen, die vor der Traumatisierung von Bedeutung waren (Hobbies, Freizeitaktivitäten etc.). Er fühlt sich außerhalb der Gemeinschaft der anderen Menschen und unfähig, starke Emotionen (Liebe, Hass) zu empfinden. Bisweilen verändert sich die Zukunftsplanung im Sinne einer Hoffnungslosigkeit (“Es hat keinen Sinn, mich beruflich etc. anzustrengen, das Böse kann jederzeit wieder über mich hereinbrechen.”). Symptome der autonomen Übererregung: Eine allgemeine Übererregtheit kann sich äußern in Konzentrations- und Gedächtnisproblemen, übermäßiger Wachsamkeit, großer Schreckhaftigkeit oder auch Aggressivität (unter der häufig auch die Familienmitglieder stark leiden und die bisweilen zu gewalttätigem Verhalten des Betroffenen führt). Meist treten Schwierigkeiten ein- oder durchzuschlafen auf. Vor dem Trauma schon vorhandene Leistungsstörungen können sich verstärken. 8 PTB, R. Steil, Version 1 3. Epidemiologie, Verlauf, Komorbidität Epidemiologie: Untersuchungen an großen Stichproben der amerikanischen Allgemeinbevölkerung zeigen, dass die PTB mit einer Lebenszeitprävalenz von ca. 1 bis 9% zu den häufigeren psychischen Störungen zählt (vgl. Kessler, Sonnega, Bromet, Hughes & Nelson, 1995; eine Übersicht bieten de Girolamo & McFarlane, 1997). Kessler und Kollegen (Kessler et al., 1995) untersuchten eine große repräsentative Gruppe (N = 5877) mit hoher Rücklaufquote (82%), die so ermittelte Lebenszeitprävalenz von ca. 8% kann als fundierteste Schätzung gelten. Zu den häufigsten Symptomen der PTB gehören das Wiedererleben des Traumas im Wachen oder Schlafen sowie eine erhöhte Schreckhaftigkeit (Kessler et al., 1995). Die häufigsten Formen der Traumatisierung waren bei Männern die Zeugenschaft bei einer Traumatisierung, Unfall oder Naturkatastrohphen (Kessler et al., 1995). Zur AB bzw. zur andauernden Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung liegen bislang keine Daten aus großen epidemiologischen Studien vor. Studien an Risikopersonen zeigen je nach Traumaart sehr unterschiedliche Prävalenzen. So entwickelten z.B. nach einem Amoklauf 33% der Zeugen eine AB, nach dem Erleben krimineller Gewalt 19%, nach einem Verkehrsunfall 13% und nach einer industriellen Katastrophe 6% (vgl. Brewin, Andrews, Rose & Kirk, 1999; Classen, Koopman, Hales & Spiegel, 1998; Creamer & Manning, 1999; Harvey & Bryant, 1998). Folgende Aspekte der Traumatisierung bzw. der Person zeigen einen Zusammenhang mit dem Erkrankungsrisiko: Art der Traumatisierung: Das Erleben sexueller Gewalt birgt generell ein gegenüber anderen Formen der Traumatisierung 6-7fach höheres Risiko, an PTB zu erkranken: 46% der Frauen und 65% der Männer erkrankten in der Studie von Kessler und Kollegen nach dem Erleben sexueller Gewalt an PTB (Kessler et al., 1995), ähnliche Befunde bzw. noch höhere Inzidenzraten fanden sich bei jungen Erwachsenen (Breslau, Davis, Andreski & Peterson, 1991; Giaconia et al., 1995). Traumata, die ebenfalls ein vergleichsweise hohes Erkrankungsrisiko bergen, sind Kampfeinsatz im Krieg, physischer Angriff oder Sehen wie jemand getötet oder verletzt wird. Naturkatastrophen, Unfälle oder Brände führen dagegen in weitaus geringerem Maße zur Entwicklung einer PTB (bei Kessler et al., 1995, in weniger als 10% der Fälle). Mit der Intensität der Traumatisierung steigt für Erwachsene wie Kinder das Risiko, an PTB zu erkranken. 9 PTB, R. Steil, Version 1 Lebensalter bei Traumatisierung: Das Risiko der Ausbildung einer PTB sinkt mit steigendem Lebensalter zum Zeitpunkt der Traumatisierung – dieser Befund wurde in vielen Studien repliziert (vgl. Essau, Conradt & Petermann, 1999; Kessler et al., 1995; Norris, 1992). Besonders vulnerabel sind demnach Kinder und Jugendliche (vgl. Steil & Straube, im Druck). Geschlecht: In den meisten epidemiologischen Studien fand man ein höheres Risiko für Frauen als für Männer, nach einer Traumatisierung eine PTB zu entwickeln (z.B. 20,4% vs. 8,2% bei Kessler et al., 1995; vgl. auch Breslau et al., 1991; Norris, 1992). Insgesamt lag bei Kessler und Kollegen die Lebenszeitprävalenz der PTB für Frauen mit 10,4% zweifach höher als für Männer mit 5,0%. Männer haben zwar im Laufe ihre Lebens ein deutlich höheres Risiko als Frauen, eine Traumatisierung zu erleben (vgl. Kessler et al., 1995: 61% vs. 51%; Stein, Walker, Hazen & Forde, 1997: 81% vs. 74%), Frauen scheinen jedoch allgemein vulnerabler zu sein für die Ausbildung einer PTB und haben zudem ein hohes Risiko, Traumata wie z.B. sexuelle Übergriffe zu erleben, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Ausbildung einer PTB führen. Ein vergleichbares Muster der Geschlechterunterschiede findet sich auch bei Kindern und Jugendlichen (Giaconia et al., 1995; Essau et al., 1999). Im frühen Lebensalter zeigt sich bei Traumatisierung der Geschlechterunterschied noch deutlicher als im Erwachsenenalter (vgl. Breslau, Davis, Andreski, Peterson & Schultz, 1997). Verlauf: In circa 40 bis 50 % der Fälle nimmt die PTB einen chronischen Verlauf (vgl. Kessler et al., 1995). Die initiale, akute Symptomatik (AB, darunter möglicherweise besonders Symptome der emotionalen Taubheit, der Intrusion und der Depersonalisation) prädizieren dabei den Grad späterer Symptombelastung (vgl. z.B. Brewin et al., 1999; Classen et al., 1998; Harvey & Bryant, 1998). Ohne Behandlung dauert die Symptomatik mitunter über Dekaden an. Folgt der Traumatisierung ein Aufenthalt im Krankenhaus oder einer Rehabilitationseinrichtung, so tritt bisweilen das volle Symptombild erst nach der Rückkehr in den Alltag zutage. In einigen Fällen beginnt die Störung länger als 6 Monate nach dem Trauma. Epidemiologische Befunde zur Häufigkeit des verzögerten Beginns fehlen bislang. Der Grund kann z.B. neue Information über die Gefährlichkeit der traumatischen Situation sein (Beispiel: ein Vergewaltigungsopfer erfährt, dass der Täter das nächste Opfer ermordet hat). Man vermutet, dass Kinder ab einem Alter von ca. 4 Jahren von der Störung betroffen sein können, wobei die Symptomatik sich in diesem frühen Lebensalter bzw. bei Kindern 10 PTB, R. Steil, Version 1 allgemein in einem etwas anderen Symptommuster äußert (vgl. Steil & Straube, im Druck). So stehen bei Kindern z.T. neu erworbene Ängste (Trennungsangst, Angst im Dunkeln), externalisierende Verhaltensprobleme oder der Verlust von schon erworbenen Fähigkeiten im Vordergrund. Besonderer Beachtung bedürfen bei der PTB sogenannte “recovered memories” – d.h. Ereignisse aus der Kindheit (z.B. ein unangemessener sexueller Kontakt), für die es – nach Angaben der Patienten - eine teilweise oder gänzliche Amnesie gab und welche nach Jahren oder Dekaden zum ersten Mal erinnert werden. Pillemer (1998) sieht sie als Ergebnis einer Reinterpretation früher emotionaler oder behavioraler Erinnerungen, welche das Kind während und kurz nach den Ereignissen nicht deuten und in exsistierende Schemata einordnen konnte. Der Prozess der Reinterpretation früher Erinnerungen ist jedoch weitaus anfälliger für Verzerrungen, Fehlinterpretationen oder gar Suggestion als der des Erinnerns lebensgeschichtlich späterer Erlebnisse (vgl. Schacter, 1995, Hyman & Loftus, 1998), daher sollte im Rahmen einer Behandlung diesbezüglich besondere diagnostische Vorsicht walten (vgl. auch Zola, 1998). Komorbidität: Bei ca. 88% aller Männer und 79% aller Frauen mit einer PTB findet sich in der Lebensgeschichte eine komorbide andere psychische Störungen (Kessler et al., 1995; vgl. auch Brady, 1997; Keane & Kaloupek, 1997). Am häufigsten geht sie mit affektiven Störungen, anderen Angststörungen, Substanzmissbrauch und Somatisierungsstörung einher. Zudem ist sie mit einem erhöhten Risiko körperlicher Erkrankungen, hier besonders mit Infektionen, aber auch musculo-skeletalen oder neurologischen Störungen, verbunden (Boscarino, 1997, Beckham et al., 1997, McFarlane, Atchison, Rafalowicz. & Papay, 1994). Bei Kindern und Jugendlichen tritt eine PTB häufig komorbide auf mit internalisierenden und externalisierenden Verhaltensproblemen, schlechterer schulischer Leistung, Suizidgedanken und Suizidversuchen, interpersonellen Schwierigkeiten und körperliche Beschwerden (Giaconia et al., 1995) oder auch Trennungsangst (vgl. Goenjian et al., 1995). Hinzuweisen ist darauf, dass die Symptome der PTB zum Teil mit denen affektiver Störungen und anderer Angsterkrankungen überlappen. Darauf könnte unter Umständen die hohe Komorbidität in diesen Fällen basieren. Wenige empirische Befunde gibt es bislang zu der Frage, welche psychische Störung der anderen vorausgeht, bzw. ob das prätraumatische Vorliegen einer psychischen Störung das 11 PTB, R. Steil, Version 1 Risiko der Erkrankung an einer PTB erhöht. Die Befunde hierzu sind widersprüchlich. Verschiedene Autorengruppen (Kessler et al., 1995; Breslau et al., 1997) fanden retrospektiv, dass affektive Störungen und Substanzmissbrauch meist einer PTB folgten. Zum Missbrauch von Alkohol oder Anxiolytika kommt es z.B. häufig als Folge einer anxiolytischen Selbstmedikation bzw. pharmakologischen Behandlung der Patienten. Einige Befunde implizieren jedoch, dass Drogenmissbrauch bei jungen Erwachsenen auch eine Risikovariable für Traumatisierung und Entwicklung einer PTB darstellt (Giaconia et al., 1995). Komorbide Angststörungen gingen in der Hälfte der Fälle der PTB voraus. In einer prospektiven Studie erhöhte eine PTB das Risiko von Schmerzen, Konversionssymptomen und Somatisierung (Andreski, Chilcoat & Breslau, 1998). Man fand jedoch auch, dass eine prätraumatisch bereits bestehende psychische Störung (insbesondere eine affektive Störung) das Risiko, nach Traumatisierung eine PTB zu entwickeln, steigerte (Breslau et al., 1991; Breslau et al., 1997; Smith, North, McCool & Shea, 1990). Breslau und Kollegen (1997) fanden darüber hinaus, dass eine bereits bestehende affektive Störung auch das Risiko einer Traumatisierung erhöhte. 4. Erklärungsmodelle Es konkurrieren eine Fülle von Erklärungsmodellen zur Entstehung und Aufrechterhaltung der PTB. Sie umfassen psychobiologische wie rein psychologische Theorien. Für alle diese Theorien existieren empirische Befunde, welche sich in ihrem Sinne deuten lassen. Die kognitiv-behaviorale Behandlung basiert vorwiegend auf psychologischen Konzepten der PTB, sie sollen hier vorgestellt werden. Einen guten Überblick über psychobiologische Modelle liefern Yehuda und McFarlane (1997). Lerntheoretische Modelle stellen eine Anwendung der Zwei-Faktoren-Theorie von Mowrer (1947) auf die psychischen Folgen einer Traumatisierung dar (Foa & Kozak, 1986; Keane, Zimering & Caddell, 1985). Sie erklären die PTB als konditionierte emotionale Reaktion, welche schwer löschbar ist, mit Hilfe der Prinzipien der klassischen Konditionierung (während des Traumas werden Merkmale der traumatischen Situation verknüpft mit den emotionalen und physiologischen Reaktionen, in der Folge lösen ähnliche Merkmale vergleichbare Reaktionen aus) und der operanten Konditionierung (eine Löschung wird durch die Vermeidung traumarelevanter Stimuli verhindert, letztere bleibt operant im Sinne einer negativen Verstärkung aufrechterhalten). Möglicherweise werden auch aggressives Verhalten, Rumination, das Empfinden von Wut und Ärger und Substanzmissbrauch durch negative 12 PTB, R. Steil, Version 1 Verstärkung aufrechterhalten, da sie ebenfalls die mit der Erinnerung verbundenen belastenden Emotionen beenden (Steil, Ehlers & Clark, 1997). In sogenannten Netzwerkmodellen wird die Symptomatik der PTB auf die Ausbildung eines spezifischen Traumagedächtnisnetzwerkes zurückgeführt, welches die Wahrnehmung und Verarbeitung von Reizen in selektiver Weise lenkt (Chemtob, Roitblat, Hamada, Carlson & Twentyman, 1988; Foa, Steketee & Rothbaum, 1989). Hierbei wird das Modell pathologischer Furchtstrukturen von Lang (1979) auf die Ätiologie der PTB angewandt. Die Gedächtnisrepräsentation traumatischer Geschehnisse, so die Annahme, ist umfassend und leicht aktivierbar, die Aktivierung zeigt sich in intrusivem Wiedererleben, Angst und Erregung, sowie in der chronischen Erwartung erneuter Bedrohung und der aktiven Suche nach Gefahrensignalen. Eine Veränderung des spezifischen Furchtnetzwerkes ist nur durch dessen direkte Aktivation (d.h. über Konfrontation mit traumatrelevanten Reizen) möglich. In Modellen kognitiver Schemata wird postuliert, dass eine Traumatisierung grundlegende Überzeugungen und Erwartungen (von persönlicher Sicherheit, von der Welt als bedeutungsvoll und sinnhaft und von sich selbst als kompetent und zur Kontrolle fähig) grundlegend erschüttert und dysfunktional verändert, bzw. dass sie prätraumatisch latent vorhandene dysfunktionale Schemata und Überzeugungen (z.B. von sich selbst als wertloser Person, die Bestrafung verdient hat) validiert (Beck, Rush, Shaw & Emery, 1986; Brewin, Dagleish & Joseph, 1996; Foa & Riggs, 1993; Horowitz, 1976, 1986; Janoff-Bulman, 1992). Schon während der Traumatisierung wird die Informationsverarbeitung durch präexistierende Schemata gelenkt (z.B.: Wer sich selbst für wertlos hält, beschuldigt sich danach in unangemessener Weise selbst). Die traumatische Information bleibt solange in einem aktiven Teil des Gedächtnisses, bis das Geschehen in das persönliche Weltbild integriert ist. Die Vermeidung traumarelevanter Stimuli verhindert generell eine Veränderung dysfunktionaler Einstellungen, z.B. durch neue, korrigierende Erfahrungen. In einer Synthese und Erweiterung der Netzwerkmodelle und Modelle kognitiver Schemata postulieren Brewin und seine Arbeitsgruppe (Brewin, 1989; Brewin, Dagleish & Joseph, 1996), dass während der Traumatisierung sensorischer Input sowohl mit als auch ohne Beteiligung kortikaler Strukturen verarbeitet wird. Sie nehmen hierbei Bezug auf Teasdale und Barnards (1993) Theorie interagierender kognitiver Systeme. Der Output dieser beiden Formen der Verarbeitung wird als verbal zugängliches Wissen und als (nicht willentlich 13 PTB, R. Steil, Version 1 abrufbares, sondern nur in der traumatischen Erfahrung ähnlichen Situationen verfügbares) situational zugängliches Wissen gespeichert. Während das verbal zugängliche Wissen Veränderungen durch Verarbeitungsprozesse unterworfen ist (Vergessen vs. Fokussierung auf bestimmte Aspekte des Traumas) und mit der Zeit weniger detailliert wird, bleibt das situational zugängliche Wissen im Detail erhalten. Verändert werden kann die situational zugängliche Form der Repräsentation des Traumas sowohl durch Habituation als auch durch Veränderung der Bedeutung des Traumas. Autoren neuerer kognitiver Modelle betonen die Rolle der idiosynkratischen Bedeutung der Traumatisierung und ihrer Folgen sowie der kognitiven Vermeidung bei der Aufrechterhaltung der Symptomatik (Ehlers & Clark, 2000; Steil, Ehlers & Clark, 1997; Steil & Ehlers, 2000). So ist von großer Bedeutung, ob eine Person ihre posttraumatischen Symptome als Teil eines normalen Genesungsprozesses wertet oder sie katastrophisierend interpretiert. Dysfunktionale Kognitionen, die mit den Intrusionen zusammen auftreten, wie ”Diese starken Erinnerungen bedeuten, ich werde verrückt”, ”Mir wird nie mehr etwas Schönes passieren können” oder ”Es ist passiert, weil ich so bin, wie ich bin” determinieren die subjektive Belastung, die mit dem Auftreten von Intrusionen einhergeht. Sie vermitteln Symptome eines erhöhten Erregungsniveaus. Sie motivieren Betroffene, Strategien zur Kontrolle der intrusiven Erinnerungen und Gedanken einzusetzen, die ihrerseits die Symptome entweder direkt verschlimmern (so z. B. führt Gedankenunterdrückung zum vermehrten Auftreten intrusiver Erinnerungen) oder eine adäquate Auseinandersetzung mit dem Trauma unterbinden (z. B. durch Rumination oder den Gebrauch von Anxiolytika). In prospektiven Studien wurde die aufrechterhaltende Rolle einer negativen Bedeutung des Traumas und seiner Folgen sowie der beschriebenen kognitiven Strategien bei Opfern von Verkehrsunfällen sowie Opfern sexueller und nichtsexueller Gewalt belegt (Dunmore, Clark & Ehlers, 1997; Ehlers, Mayou & Bryant, 1998). Überlegungen zur Entwicklung des episodischen bzw. des autobiographischen Gedächtnisses sind ebenfalls wichtiger Teil neuer kognitiver Theorien der PTB: so vermuten Ehlers und Clark (2000), dass eine persistierende PTB dann entsteht, wenn die traumatische Erinnerung nur ungenügend elaboriert und in einen autobiographischen Kontext eingeordnet wird. Damit können, so die Autoren, die besonderen Merkmale traumatischer Erinnerungen bei der PTB erklärt werden: die Schwierigkeit, traumatische Erinnerungen gewollt abzurufen, deren “hier und jetzt”-Qualität, mit der ein Gefühl akuter Bedrohung einhergeht, sowie die Tatsache, 14 PTB, R. Steil, Version 1 dass die traumatischen Erinnerungen sehr leicht durch Stimuli, die einem Merkmal der Traumatisierung ähneln, aktivierbar sind. Postuliert wird, dass eine daten-gesteuerte Enkodierung traumatischer Informationen (d.h. primär die Verarbeitung sensorischer Reize) im Gegensatz zu einer konzeptuell gesteuerten Enkodierung (d.h. eine Verarbeitung der Bedeutung der Situation und ihres Kontextes in einer geordneten und organisierten Weise) das Risiko der Ausbildung einer PTB erhöht, da sie die willentliche Abrufbarkeit der Erinnerung erschwert und zu einem starken Priming für traumarelevante Stimuli führt. Mit Hilfe dieser Annahmen liesse sich z.B. die negative Assoziation zwischen Alter und Risiko der Entwicklung einer PTB nach Traumatisierung erklären (Kinder neigen aufgrund ihrer eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten zu einer eher datengesteuerten Informationsverarbeitung bei Traumatisierung). In diesem Sinne deuten läßt sich z.B., dass das prätraumatische Intelligenzniveau das Risiko der Entwicklung einer PTB bei Vietnamsoldaten prädizierte (McNally & Shin 1995). Die Theorien zur erlernten Hilflosigkeit und zum Attributionsstil (Abramson, Metalsky & Alloy, 1989; Abramson, Seligman & Teasdale, 1978; Seligman, 1975) wurden ebenfalls auf die PTB übertragen. Empirische Belege dafür, dass Attributionsprozesse Bedeutung haben für die Entwicklung posttraumatischer Symptomatik, liegen vor (Flannery, 1987; Flannery & Harvey, 1991; Joseph, Yule & Williams, 1993; Peterson & Seligman, 1983). Auf diese Weise lassen sich vor allem die Symptome der PTB erklären, die denen der Depression ähneln (wie z. B. die emotionale Taubheit oder Passivität), wenig Erklärungswert besitzen die Theorien jedoch für die anderen Symptome der PTB wie das Wiedererleben. Joseph, Williams und Yule (1995) betonen die Notwendigkeit, zwischen der Attribution bezüglich dessen, warum das Trauma geschah, bezüglich des Geschehens während der Traumatisierung und bezüglich der nachfolgenden emotionalen Reaktionen zu unterscheiden. Wie diese Aspekte attribuiert werden, ergibt sich aus den Merkmalen des Traumas selbst und dem Attributionsstil des Betroffenen. Über Formen der unterschiedlichen Attribuierung lassen sich, so die Autoren, Gefühle wie Schuld, Scham, Wut und Ärger, die in der Folge des Traumas auftreten, erklären. In integrativen Modellen der PTB werden die unterschiedlichen Wirkmechanismen, die bei der Entstehung der Störung diskutiert werden, in umfassenden Rahmenkonzepten vereint. Green, Wilson & Lindy (1985), Peterson, Prout & Schwartz (1991), Maercker (1999) sowie Joseph, et al. (1995) führen übersichtlich gegliedert Einflußfaktoren aus unterschiedlichster Perspektive zusammen. 15 PTB, R. Steil, Version 1 Die verschiedenen psychologischen Modelle der PTB ähneln sich -- trotz unterschiedlichster theoretischer Basis-- in einigen Punkten in erstaunlicher Weise: 1) Meist werden Vermeidung, emotionale Taubheit und sozialer Rückzug als sekundäre Symptome der PTB bewertet, die als Reaktion des Individuums auf das Auftreten belastender Intrusionen und damit einhergehender Übererregung folgen (vgl. auch Everly, 1995). 2) Alle Autoren weisen der Vermeidung traumabezogener Stimuli eine Schlüsselrolle bei der Aufrechterhaltung der Störung zu: das aktive Bemühen, sich nicht zu erinnern, verhindert eine hilfreiche und adäquate Konfrontation mit den traumatischen Erlebnissen. 3) In den meisten Modellen wird die Bedeutung einer dysfunktionalen Bewertung des Traumas und seiner Folgen für die Pathogenese der PTB hervorgehoben. 4) Fast alle aus den Modellen abgeleiteten Interventionsvorschläge enthalten daher als Kernelemente a) die Konfrontation mit den traumabezogenen Reizen sowie b) die Identifikation und Veränderung negativer Kognitionen. Die oben dargestellten Modelle legen weiterhin nahe, dass Interventionen dann besonders erfolgversprechend sein sollten, wenn sie sowohl auf eine Konfrontation mit traumarelevanten Stimuli und eine Verringerung des Vermeidungsverhaltens als auch auf eine Umstrukturierung dysfunktionaler Kognitionen zu Trauma und Symptomatik abzielen. Befunde zur Wirksamkeit kognitiv-behavioraler Behandlung bestätigen dies (vgl. das entsprechende Unterkapitel). In den neueren kognitiven Modellen wird die dysfunktionale Rolle kognitiver Strategien zur Vermeidung oder Kontrolle der Intrusionen betont – dies schlägt sich therapeutisch nieder in dem Ziel der Verminderung von Gedankenunterdrückung und Rumination. Für in der Behandlung und Prävention der PTB tätige Psychotherapeutinnen und -therapeuten ist die Kenntnis der Modelle der PTB die Grundlage der Psychoedukation der Patienten. Psychologische Modelle werden herangezogen, um subjektive posttraumatische Reaktionen (Intrusionen, Vermeidung etc.) als Teil der normalen Anpassung nach Traumatisierung verständlich zu machen. Auch bei der Vermittlung der Therapierationale bei konfrontativer oder kognitiver Intervention sind Modelle der Ätiologie und Aufrechterhaltung der Störung von zentraler Bedeutung (vgl. Ehlers, 1999; Foa & Rothbaum, 1998; Resick & Schnicke, 1992, Steil et al., 1997). Sie werden genutzt, um zu erklären, wieso Konfrontation mit den 16 PTB, R. Steil, Version 1 belastenden Erinnerungen an das Trauma und die Bearbeitung kritischer Einstellungen und Überzeugungen zum Trauma und seinen Folgen notwendig und hilfreich ist. 5. Diagnostik und Erfolgskontrolle (Evaluation) Diagnostik Tabelle 2 zeigt eine Aufstellung Selbstbeurteilungsinstrumenten, welche von zur deutschsprachigen Diagnostik der Interviews PTB bzw. und zur Schweregradbestimmung posttraumatischer Symptomatik herangezogen werden können. Diagnosestellung: Zur Diagnosestellung wird die Anwendung eines strukturierten oder standardisierten klinischen Interviews empfohlen. Genutzt werden können das Diagnostische Interview bei psychischen Störungen (DIPS, Margraf, Schneider & Ehlers, 1994), für das eine Anpassung an die DSMIV-Kriterien jedoch erst in Vorbereitung ist, sowie das Strukturierte Klinische Interview bei psychischen Störungen (SKID, Wittchen, Zaudig & Fydrich, 1997), welches eine valide Diagnosestellung sowohl nach DSMIV wie nach ICD10 erlaubt. Besonders günstig erscheint hier, dass der Befragte zunächst nur anhand einer Liste das Vorliegen irgendeiner Form von Traumatisierung angeben muss, ohne diese schon zu benennen. Dies erlaubt eine vorsichtige Diagnosestellung zu einem Zeitpunkt, zu dem der Betroffene die näheren Umstände der Traumatisierung noch nicht preisgeben möchte. Für ein Screening zur PTB-Diagnose eignet sich die an den DSMIV-Kriterien der Störung orientierte Posttraumatische Diagnose Skala (PDS, Steil & Ehlers, in Vorbereitung). Sie erfasst alle Symptome und Kriterien der PTB laut DSMIV, einschließlich des Vorliegens einer Traumatisierung. Befunde zur Übereinstimmung der Diagnosestellung mit Hilfe der Skala und mit Hilfe eines klinischen Interviews sind in Vorbereitung, liegen jedoch noch nicht vor. Die amerikanische Originalversion zeigte hierfür eine gute Validität (Foa, Cashman, Jaycox & Perry, 1997). Da die Symptomatik bei Kindern und Jugendlichen von der Erwachsener abweichen kann, empfiehlt sich zur Diagnosestellung in diesem Lebensalter die Anwendung eines spezifisch zugeschnittenen Interviews. Angewendet werden können als Interview mit dem Kind die Clinician Administered PTSD Scale for Children and Adolescents (CAPS-CA, Nader, Blake & Kriegler, 1994, deutsche Übersetzung von Steil et al, in Vorbereitung), als Interview mit dem Kind und einem Elternteil das Diagnostische Interview bei psychischen Störungen für Kinder 17 PTB, R. Steil, Version 1 und Eltern (Kinder-DIPS, Unnewehr, Schneider & Margraf, 1995). Die CAPS-CA gilt im angelsächsischen Sprachraum als diagnostisches Instrument der Wahl (vgl. March, AmayaJackson & Pynoos, 1997). Eine sorgfältige psychometrische Untersuchung hinsichtlich der PTB-Diagnosestellung steht für beide deutschsprachigen Instrumente jedoch noch aus, die Reliabilität der CAPS-CA erwies sich als sehr gut (Steil et al., in Vorbereitung). Empfohlen wird soweit möglich ein Interview mit dem Kind selbst, da Eltern und Lehrer in empirischen Studien dazu neigten, die Belastung der Kinder im Vergleich zu deren eigenen Angaben grob zu unterschätzen (Korol, Green & Gleser, 1999; Martini, Ryan, Nakayama & Ramenofsky, 1990). Schweregradbestimmung der PTB-Symptomatik: Der Schweregrad der Symptomatik kann mit Hilfe von Selbstbeurteilungsinstrumenten geschehen. Für die beiden international gebräuchlichsten Fragebögen – die Impact of Event Scale – Revised (IES-R, Maercker & Schützwohl, 1998) sowie die PDS - liegen auf ihre Gütekriterien hin untersuchte deutschsprachige Übersetzungen vor. Sie erlauben jeweils die Bestimmung eines Gesamtschweregrades wie die von Werten für die Subskalen der Intrusion, Vermeidung und der Übererregung. Zur Schweregradbestimmung der PTB im Kindesalter liegt kein deutschsprachiges Selbstbeurteilungsinstrument vor – hier kann die CAPS-CA(Steil, Gundlach & Müller, in Vorbereitung) herangezogen werden, welche Werte sowohl zur Intensität wie zur Häufigkeit der Symptome liefert. Eine hohe Effizienz des Einsatzes von PDS und CAPS-CR ist darin begründet, dass neben der Schweregradbestimmung der Symptomatik auch eine Diagnosestellung möglich ist. Therapiebezogene weitere Diagnostik: Neben der Erfassung der Symptomatik ist eine therapiebezogene Diagnostik der Schwere und Art der Instrusionssymptomatik und kognitiver wie behavioraler Vermeidung sowie möglicher dysfunktionaler Kognitionen und Interpretationen zu empfehlen. Die Intrusionssymptomatik kann erfasst werden mit Hilfe eines Tagebuches (Steil et al., 1997), welches der Patient über jeweils 7 Tage hinweg führt, und in welchem das Auftreten von Intrusionen anhand folgender Aspekte erfasst wird: der Zeitpunkt des Auftretens der Erinnerung, deren Inhalt, mit der Intrusion verbundene Kognitionen, ein Rating des Ausmaßes der Belastung durch die Intrusion, mögliche Auslöser und die Reaktion des Patienten (evtl. Flucht aus der Situation, Gedankenunterdrückung, Rumination, Einsatz von Anxiolytika etc.). Anhand eines solchen Tagebuches können die Belastung durch Intrusionen, kritische Kognitionen und dysfunktionale Strategien zum 18 PTB, R. Steil, Version 1 Umgang mit Intrusionen im Alltag des Patienten erfasst werden, welche sonst im Behandlungssetting unberücksichtigt bleiben könnten. Zur Erfassung der Intensität möglicher dysfunktionaler Kognitionen zur Traumatisierung und ihrer Folgen kann im Deutschsprachigen der Fragebogen zu dysfunktionalen Kognitionen (Steil, 1997) herangezogen werden, welcher eine sehr gute Reliabilität und diskriminante Validität aufweist, oder der Fragebogen zu Gedanken nach traumatischen Erlebnissen (vgl. Ehlers, 1999). Zur Erfassung von Strategien zur Kontrolle oder Vermeidung von Intrusionen eignet sich der Fragebogen zum Umgang mit traumatischen Erlebnissen (vgl. Ehlers, 1999). Differentialdiagnose: Differentialdiagnostisch muss die PTB unterschieden werden von affektiven Störungen, von anderen Angststörungen oder psychotischen Störungen wie von der Borderline-Persönlichkeitsstörung, die ebenfalls in der Folge eines Traumas auftreten können, sowie von der Anpassungsstörung und den Folgen von Kopfverletzungen (hiernach lang anhaltende Symptome wie Irritabilität, Angst etc. sollten jedoch auf eine psychische Verursachung hin überprüft werden). 19 PTB, R. Steil, Version 1 Evaluation des Therapieerfolges Zur Evaluation des Therapieerfolges können die in Tabelle 2 dargestellten diagnostischen Interviews bzw. Fragebogenverfahren herangezogen werden. PDS und IES-R können mehrfach im Verlauf der Therapie eingesetzt werden. Beachtet werden sollte jedoch jeweils das Zeitfenster (die 7 vorausgegangenen Tage bei IES-R, die 4 vorausgegangenen Wochen bei PDS). Sehr gut eignet sich ebenfalls ein zu Beginn jeder Sitzung vom Patienten erhobenes Rating auf einer Skala von 0 bis 100 zu der Frage, als wie belastend der Patient in der vergangenen Woche Erinnerungen und Gedanken an das Trauma erlebt hat (vgl. Steil et al., 1997). Patient und Therapeut können hierzu gemeinsam eine graphische Darstellung vornehmen, die sehr anschaulich den Verlauf der Kernsymptomatik zeigen kann. Diagnostische Interviews sollten zu Beginn und zum Ende der Behandlung angewandt werden, um die klinische Signifikanz der Intervention zu erfassen. Ebenfalls sehr empfehlenswert ist der mehrfache Einsatz des oben beschriebenen Tagebuches (mehrmals über 7 Tage) und der der spezifischen Instrumente zur Erfassung dysfunktionaler Kognitionen und Strategien wie kognitiver Vermeidung. Zur Kontrolle der Therapieerfolges in Bezug auf komorbide Symptomatik wird darüber hinaus die mehrfache Anwendung von Selbstbeurteilungsinstrumenten bzw. Fremdratings zu den Bereichen Depression (z.B. Beck-Depressions-Inventar, Hautzinger, Bailer, Worall & Keller, 1995 etc.) und allgemeiner Ängstlichkeit (z.B. Beck Angst Inventar, Margraf & Ehlers, in Vorbereitung etc.) bzw. Instrumenten zur Erfassung der spezifischen komorbiden Störung empfohlen. 6. Indikation Evaluationsstudien zur kognitiven Verhaltenstherapie der PTB bei unterschiedlichsten Formen von Traumatisierung zeigen eine gute Wirksamkeit (vgl. Sherman, 1998). Folgende Punkte sind dabei jedoch zu beachten: Die Diagnose einer PTB sollte gesichert sein. Ist das Vorliegen einer Traumatisierung nicht verifizierbar (so z.B. vermutet eine Patientin, im Alter von 2 Jahren sexuell missbraucht worden zu sein, Indikatoren dafür finden sich nicht), so ist keine Behandlung einer PTB indiziert, vielmehr sollte ein gezielt auf die Beschwerden der Patientin zugeschnittenes Vorgehen gewählt werden. 20 PTB, R. Steil, Version 1 Die PTB sollte die primäre psychische Störung sein. Für diese Patientengruppe gilt die Wirksamkeit der kognitiven Verhaltenstherapie als gesichert. Falls schon prätraumatisch andere psychische Störungen vorlagen, so sollten diese unter Umständen zuerst Mittelpunkt therapeutischer Aufmerksamkeit sein. Liegt eine komorbide Störung vor, welche die Behandlung der PTB stark behindern könnte, so wird empfohlen, mit einem entsprechenden vorgeschalteten Behandlungsmodul zunächst eine Besserung dieser Symptomatik anzustreben (z.B. Bearbeitung der interpersonellen Probleme bei der Borderline- Persönlichkeitsstörung). Häufig setzen PTB-Patienten Alkohol oder andere Anxiolytika zur Selbstmedikation ein. Liegt ein komorbider Substanzabusus vor, so sollte diesem zunächst die therapeutische Aufmerksamkeit zukommen (Meisler, 1999; Triffleman, Carroll & Kellogg, 1999).Auch beim Vorliegen akuter Suizidalität und psychotischer Symptomatik sollte der therapeutische Fokus zunächst auf dieser Symptomatik liegen. Die kognitive Verhaltenstherapie der PTB ist geeignet zur Behandlung chronischer PTB, auch Jahrzehnte nach Ende der Traumatisierung. Zur Behandlung akuter Symptomatik bzw. Prävention einer chronischen PTB bei Patienten mit AB ist sie in den ersten Wochen nach dem Trauma ebenfalls geeignet. Der Patient sollte sich jedoch nicht mehr in akuter Gefahr befinden, gegebenenfalls muss zunächst die Situation akuter Bedrohung beendet werden. Bisweilen, so z.B. bei Folteropfern mit noch ungeklärtem Asylstatus, kann dies jedoch sehr lange dauern. Ein Beginn der Behandlung ist hier zwar möglich, die Behandlung gestaltet sich in der Regel jedoch sehr viel schwieriger. Eine Behandlung kann sowohl im Gruppensetting (bei vergleichbarer Traumatisierungsform) wie auch individuell durchgeführt werden. Für beide Formen liegen Wirksamkeitsnachweise vor (vgl. Sherman, 1998), Studien zum direkten Vergleich der Wirksamkeit der beiden Settings existieren jedoch noch nicht. Bei einer Behandlung in der Gruppe muss die Möglichkeit der individuellen Bearbeitung kritischer Kognitionen bzw. individueller Konfrontation gewährleistet sein. Falls der Patient zunächst zu große Bedenken gegen die gezielte Behandlung der posttraumatischen Symptomatik hat (er befürchtet vielleicht katastophisierende Konsequenzen, falls er über das Erlebte spricht), so sollte am Beginn das Angebot 21 PTB, R. Steil, Version 1 stehen, durch andere Formen der Intervention eine Verbesserung der Lebensqualität zu erreichen (z.B. Unterstützung bei Belastung durch juristische oder medizinische Komplikationen, Linderung der Schmerzsymptomatik etc.). Darüber kann das Vertrauen des Patienten meist auch für die gezieltere Behandlung der PTB gewonnen werden. Falls beim Patienten zunächst eine andere Symptomatik (z.B. eine Schmerzsymptomatik) im Vordergrund steht, so kann mit einer erfolgreichen Intervention zur Linderung des Leidens oder Verbesserung der Lebensqualität der Boden für eine gezieltere Behandlung der PTB bereitet werden. Gleiches gilt für Patienten, welche sich allein von juristischen oder medizinischen Maßnahmen Besserung versprechen und keine Erfolgsaussichten für eine psychologische Behandlung der PTB sehen. 7. Behandlung Beschrieben wird das Vorgehen bei einer Kombination von behavioraler und kognitiver Intervention. Behandlungsziel Ziel der Behandlung ist die Veränderung dysfunktionaler Einstellungen und Interpretationen zum Trauma und seinen Folgen hin zu einer realistischeren bzw. hilfreicheren Einstellung zu dem Erlebten sowie der Abbau der Vermeidung traumatrelevanter Stimuli bzw. von Strategien zur Vermeidung oder Kontrolle von Intrusionen. Therapeutisches Setting Die kognitiv-behaviorale Behandlung der PTB kann ambulant oder stationär durchgeführt werden. Eine stationäre Form ist vorzuziehen bei einem Schweregrad der PTB oder komorbider Störungen, der die Bewältigung des Alltages stark beeinträchtigt. Für die ambulante Intervention spricht, dass Hausaufgaben zur selbstgeleiteten Exposition mit traumarelevanten Stimuli sowie Verhaltensexperimente zur Überprüfung dysfunktonaler Annahmen meist einfacher zu organisieren sind und die Generalisierung des neu Erlernten auf den Alltag des Patienten erleichtert wird. Patienten mit einer PTB haben während der Traumatisierung einen maximalen Kontrollverlust erlebt - im Rahmen der Behandlung ist es daher günstig, ihnen ein großes Maß an Kontrolle über die Bedingungen der Behandlung (z.B. ihren Sitzplatz und ihre Sitzposition und die Lichtverhältnisse während der Sitzungen 22 PTB, R. Steil, Version 1 aber auch die Abfolge und den Beginn einzelner Interventionselemente etc.) zu geben. So z.B. war es für einen Patienten, der während erlittener Folterungen in einem dunklen Raum war und monatelang ohne Tageslicht leben musste, unmöglich, ein Erstgespräch an einem düsteren Wintertag in einem nur schwach erleuchteten Raum zu führen, ein Wechsel des Raumes hin zu einem mit mehr Tageslicht erleichterte dem Patienten das Gespräch erheblich. Um gerade zu Beginn der Behandlung genügend Zeit zu haben für die Komponenten der Exposition und der kognitiven Intervention haben sich Sitzungen von 90 Minuten Dauer sehr bewährt. Hausaufgaben sind obligatorisch und bieten Gelegenheit, z.B. Informationen aus dem Alltag einzuholen, Verhaltensexperimente und (gegen Therapieende) selbstgeleitete Konfrontationsübungen durchzuführen Am Ende jeder Sitzung sollte die Frage stehen nach den Aspekten, die heute für den Patienten von größter Bedeutung waren und die Frage, ob ihn etwas gestört hat, ob etwas an der Behandlung verändert werden sollte bzw. ob etwas ihn daran hindern könnte, wiederzukommen. Nach Ende einer Sitzung sollte für den Patienten Gelegenheit sein, in einem geschützten Raum so lange zu verweilen, bis er sich in der Lage fühlt, in den Alltag zurückzukehren. Tabelle 3 zeigt den Ablauf einer typischen Therapiesitzung. Sehr hilfreich ist der Einsatz einer Tafel oder eines Flipcharts während der Sitzungen. Therapeut und Patient können diese Hilfmittel nutzen, um z.B. therapiespezifische diagnostische Informationen zusammenzutragen, um z.B. ein idiosynkratisches Modell der Symptomatik zu entwerfen und graphisch darzustellen oder um im Rahmen kognitiver Interventionen das Für und Wider kritischer Interpretationen einander gegenüberzustellen. Jede Sitzung wird audiographiert, eine Version der Aufnahme erhält der Patient. Als obligatorische Hausaufgabe hört er sich jeweils jede Sitzung an und hat so die Gelegenheit, das Erarbeitete zu wiederholen oder Feedback zu geben, falls er z.B. etwas nicht verstanden hat oder sich falsch verstanden fühlte. Die Aufnahmen ermöglichen dem Patienten darüber hinaus, die Inhalte der Sitzungen zu sammeln und seine Einstellungen zu Beginn und im Verlauf der Behandlung zu vergleichen, um z.B. eigene Fortschritte würdigen zu können. Wird der Beginn einer Behandlung immer wieder hinausgeschoben, so sollten geduldig neue Termine angeboten werden – die Vermeidung ist nun einmal Bestandteil der Symptomatik. 23 PTB, R. Steil, Version 1 Therapeutische Beziehung Eine vertrauensvolle therapeutische Beziehung ist die Basis der Behandlung der PTB. Eine Standarddiagnostik mit Hilfe z.B. eines klinischen Interviews sollte daher nicht während des Erstgespräches geschehen, dieses sollte vorwiegend dem Beziehungsaufbau dienen. Folgende Verhaltensweisen der Therapeutin haben sich hierfür als hilfreich erwiesen: Durch detailliertes Nachfragen während des Berichtens des Patienten kann die Therapeutin signalisieren, dass sie belastbar ist und den Bericht über schreckliche Dinge (oft im Gegensatz zu Angehörigen und Bekannten) ertragen kann. Die Therapeutin sollte sich nicht scheuen, Teile des Berichtes zu wiederholen und kritische Begriffe (z.B. bei der Exploration sexueller Traumatisierung) selbst zu gebrauchen. Kritische Situationen auf Seiten des Patienten (wie Weinen, lange Pausen, körperliche Reaktionen, Zeichen von Misstrauen etc.) sollte die Therapeutin immer ansprechen. Sie kann damit dem Patienten signalisieren, dass sie seine Schwierigkeiten realisiert und er bei ihr gut aufgehoben ist. Das Verhalten der Therapeutin sollte durch Echtheit gekennzeichnet sein. Bisweilen ruft z.B. die Schilderung der Patienten sehr viel Mitgefühl oder Entsetzen auch bei der Therapeutin hervor, so dass ihr vielleicht Tränen in die Augen steigen. Eine mögliche Reaktion wäre, zu sagen „Ich merke, wie sehr mich Ihre Schilderung bewegt. Um wie viel schwerer muss es für Sie sein, die Sie all das erlebt haben.“. Manche Patienten „testen“ die Belastbarkeit der Therapeutin zunächst, bevor sie sich ganz anvertrauen. So z.B. brachte ein Patient Schrauben mit in die Sitzung, die während einer extrem schmerzhaften, auf einen Verkehrsunfall folgenden medizinischen Intervention immer wieder an seinem Schädelknochen fixiert worden waren, und beobachtete die Reaktion der Therapeutin genau. Wichtig war ihm, dass die Therapeutin sich nicht scheute, die Schrauben anzufassen, zu „begreifen“. 24 PTB, R. Steil, Version 1 Das Erstgespräch Neben dem Beziehungsaufbau beinhaltet das Erstgespräch eine Exploration zur Traumatisierung und die Psychoedukation über die üblichen Folgen einer Traumatisierung zur Entlastung des Patienten und zur Depathologisierung der Symptomatik („Die Symptome bedeuten nicht, dass Sie verrückt werden oder einen schwachen Charakter haben, xx% aller Menschen mit einem ähnlichen Erlebnis geht es wie Ihnen. Die üblichen psychischen Folgen solch eines Ereignisses sind....“). Es folgt eine störungsspezifische Diagnostik und daraus abgeleitet die Entwicklung eines individuellen Modells der Aufrechterhaltung der Störung. Hierzu werden die am meisten belastenden Intrusionen aktiviert, die mit ihnen verknüpften primären und sekundären Emotionen und Kognitionen wie die Reaktion auf ihr Auftreten wird erfragt und in ein graphisches Schema der Aufrechterhaltung integriert. Diese Teilintervention beinhaltet bereits eine erste, kurze Expositionsphase: Der Patient wird gebeten, die am meisten belastende Erinnerung kurz in der Gegenwarts- und Ich-Form zu schildern (vgl. auch den Abschnitt zu den Expositionselementen). Befürchtet der Patient starke negative Konsequenzen einer solchen kurzen Exposition, so wird an dieser Stelle zunächst mit Hilfe kognitiver Methoden über seine Befürchtungen debattiert (vgl. den entsprechenden Abschnitt bei den kognitiven Interventionen bzw. Tabelle 4). Abbildung 1 zeigt einen Leitfaden zur therapiespezifischen Diagnostik, Abbildung 2 ein Beispiel für solch eine graphische Darstellung. Bei diesem Interventionsschritt besteht schon die Möglichkeit, den Patienten immer wieder auf den Zusammenhang zwischen seinen Gefühlen, seinen Gedanken, seinen körperlichen Reaktionen und Reaktionen der Vermeidung aufmerksam zu machen (Was Sie denken, beeinflusst, wie Sie sich fühlen...“). Meist wirkt es sich sehr positiv auf die Compliance und die Therapiemotivation des Patienten auf, wenn schon in der ersten Sitzung durch die kurze Exposition zentrale Befürchtungen entkräftet werden können bzw. der Patient erlebt, dass er sich auf kontrollierte Weise an Elemente der Traumatisierung erinnern konnte. Falls die Zeit es erlaubt wird im Erstgespräch (ansonsten in der zweiten Sitzung) des Rational der Behandlung erarbeitet. Es ist von größter Wichtigkeit, dass der Patient den Sinn des Einsatzes der Exposition und des Überprüfens von Einstellungen versteht. Hierzu stehen der Therapeutin mehrere Möglichkeiten zur Verfügung: 25 PTB, R. Steil, Version 1 ein direktives, psychoedukatives Vorgehen („Leider hilft es bei sehr schlimmen Erlebnissen nicht, die Gedanken und Gefühle zu unterdrücken. Wir wollen Ihnen helfen, die Erfahrungen besser zu verarbeiten, indem Sie sich an das erinnern, was geschehen ist, und wir dann Ihre Gefühle und Gedanken genau besprechen.“, vgl. Foa & Rothbaum, 1998). das Zurückgreifen auf Erfahrungen, die der Patient bereits in anderen Lebensbereichen mit der Habituation an negative Emotionen oder der Veränderung von Einstellungen gemacht hat („Haben Sie schon einmal erlebt, dass etwas, was Ihnen zu Beginn sehr schwer gefallen ist, mit der Zeit für Sie leichter geworden ist?“). das Benutzen von Analogien und Bildern („Manchmal kann eine Wunde nur heilen, wenn man sie noch einmal öffnet und dann behandelt.“, vgl. Maercker, 1997; „Ihre Erinnerungen sind vergleichbar mit einem Mosaik, das in seine Teile zerfallen ist. Wir wollen alles wieder zu einem Ganzen zusammensetzen, dazu müssen wir uns jedoch jedes Teil genau anschauen.“, vgl. Ehlers, 1999). der Einsatz kognitiver Methoden, um die bisherigen Strategien zur Bewältigung der Symptomatik (behaviorale und kognitive Vermeidung) gemeinsam auf ihre Wirksamkeit zu prüfen und alternative Bewältigungsmöglicheiten zu sammeln („Wie sind Sie bislang mit den Erinnerungen umgegangen? Wie hilfreich war diese Strategie? Was waren die kurzfristigen, was die langfristigen Konsequenzen? Welche anderen Möglichkeiten haben wir noch?“). Hilfreich ist hier der Einsatz eines Experimentes zu den paradoxen Konsequenzen der Gedankenunterdrückung (vgl. den Abschnitt zu kognitiven Interventionen). Der Patient wird über eine mögliche initiale (aber nicht andauernde) Verschlechterung seiner Symptomatik durch die intensive Beschäftigung mit den Erinnerungen informiert. Gegen Ende der ersten Sitzung wird ein möglichst realistisches Therapieziel (z.B. „Ich möchte mich erinnern können, ohne so sehr leiden zu müssen.“) festgelegt. Den Abschluss der Sitzung bildet die Besprechung der Ressourcen des Patienten (unterstützende Personen, gesunde Bereiche des Lebens, Hobbys, Dinge, die der Patient genießen kann). Die Elemente der Exposition Wichtiger Bestandteil der Behandlung der PTB ist das imaginative Nacherleben der Traumatisierung (Exposition in sensu). Der Patient imaginiert (möglichst bei geschlossenen 26 PTB, R. Steil, Version 1 Augen) Teile des traumatischen Geschehens so als würden sie wieder stattfinden, und berichtet dabei über sein Erleben. Dabei soll er die auftretenden Kognitionen und Emotionen nicht bekämpfen. Zu Beginn jeder Sitzung wird der Patient gebeten, die jeweils am meisten belastenden Teile der Erinnerung an die Traumatisierung auf diese Weise nachzuerleben (so erfolgt die Exposition immer mit den Teilen der Erinnerung, die für den Patienten aktuell von größter Bedeutung sind). Im Rahmen eines kognitiv-behavioralen Vorgehens wird die Exposition als eine therapeutische Strategie unter anderen und vorwiegend zur Exploration des traumatischen Geschehens, zur Elaboration der traumatischen Erinnerungen und zur Identifizierung kritischer Kognitionen genutzt. Bei einem schwerpunktmäßig behavioralen Vorgehen stellt sie das zentrale Element dar und erfolgt zeitlich sehr viel ausgedehnter (bis zu 45 Minuten pro Sitzung z.B. bei Foa und Rothbaum, 1998, vs. 5 bis 10 Minuten beim hier beschriebenen Vorgehen). Exposition in sensu ist auch Teil der Hausaufgaben. Weitere Techniken sind das Schreiben über die Traumatisierung oder das Anhören eines eigenen Berichtes über die Traumatisierung (dies erfolgt als Hausaufgabe obligatorisch in Form des Anhörens des Mitschnittes der Sitzung). Bedeutsam ist, für die Durchführung dieser Hausaufgaben günstige Bedingungen (der Patient ist alleine und ungestört etc.) zu vereinbaren. Während der Exposition in sensu wie in vivo sollte die Therapeutin ein zugewandtes Verhalten zeigen, Hörersignale geben, Lob spenden (bei Exposition in sensu auf die Einhaltung des Präsens und der Ich-Form achten) und bei längeren Pausen etc. Fragen stellen („Was fühlen Sie jetzt? Was sehen Sie?“ etc.). Verliert der Patient den Kontakt zur Gegenwart indem er z.B. dissoziative Symptome zeigt, so fokussiert die Therapeutin auf sein gegenwärtiges körperliches Befinden („Sie fühlen, wie Sie im Sessel sitzen / sich bewegen...“, sogenanntes Grounding). Nach Beendigung der Exposition erfolgt eine Einschätzung des Patienten zur Belastung durch die Exposition wie eine Analyse der befürchteten im Vergleich zu den eingetretenen emotionalen, kognitiven und physischen (bzw. bei der Exposition in vivo möglicherweise auch sozialen) Konsequenzen. Die vorher geäußerten Befürchtungen werden so einer Realitätstestung unterzogen. Geschah das Wiedererleben ohne starke emotionale Beteiligung, so fehlen möglicherweise wichtige Faktoren (so z.B. berichtete ein Folteropfer vergleichsweise gelassen in englischer Sprache, 27 PTB, R. Steil, Version 1 der Wechsel zur Muttersprache erst führte zu starkem Angsterleben) oder der Patient setzt weiterhin Strategien der kognitiven Vermeidung ein. Der Patient muss zur Exposition angeleitet werden, es wird aber vereinbart, dass die Kontrolle über deren Durchführung (z.B. über Beginn, Ausstieg, Tempo etc.) beim Patienten bleibt. Bricht er ab, so kann dies als beispielhafte Situation zur weiteren Diagnostik besonders kritischer Emotionen und Kognitionen genutzt werden („Was hat es Ihnen eben so schwer gemacht, sich weiter zu erinnern? Was haben Sie gedacht, gefühlt? Was ging Ihnen durch den Kopf“). Die Exposition in vivo gewinnt im Verlauf der Behandlung an Bedeutung. Typische Inhalte sind das Aufsuchen des Ortes der Traumatisierung bzw. einer ähnlichen (natürlich immer objektiv ungefährlichen) Situation, Treffen mit Menschen, die ebenfalls während der Traumatisierung anwesend waren, das Anschauen von Bildern oder Filmszenen mit ähnlichem Inhalt etc.. Je nach dem Ausmaß der Belastung beim Patienten kann ein hierarchisches Vorgehen gewählt oder mit stark angstauslösenden Situationen begonnen werden. Zu Beginn begleitet die Therapeutin den Patienten, danach erfolgt die Konfrontation in vivo selbstgesteuert in Form von Hausaufgaben. Sie kann die Möglichkeiten der Überprüfung von katastrophisierenden Befürchtungen und der Beschaffung von Informationen sehr sinnvoll ergänzen. Hilfreich kann die Veränderung der traumatischen Erinnerungen in der Imagination hin zum Positiven oder weniger Bedrohlichen sein (vgl. Ehlers, 1999). Eingesetzt werden dabei z.B. Techniken, die das Trauma zu einem erträglicheren Ende führen (z.B. setzt ein Soldat imaginativ die durch eine Landmine zerstückelte Leiche seines Kameraden zu einem heilen aber toten Körper zusammen). Persistierende Alpträume können ebenfalls auf diese Weise gelindert und die Schlafqualität verbessert werden (Krakow, Kellner, Pathak & Lambert 1995, 1996). Kognitive Intervention Die Basis kognitiver Intervention ist der sokratische Dialog und das geleitete Entdecken. Am Anfang steht jeweils die Identifikation zentraler dysfunktionaler Kognitionen mit Hilfe der therapiespezifischen Diagnostik, welche über den gesamten Verlauf der Behandlung (jeweils zu Beginn der Sitzung) anhand des imaginativen Wiedererlebens der aktuell am meisten 28 PTB, R. Steil, Version 1 belastenden Intrusion durchgeführt wird. Im Mittelpunkt einer Sitzung stehen jeweils eine bis zwei bedeutsame maladaptive Kognitionen. Die subjektive Gültigkeit dieser Kognitionen wird zunächst mit Hilfe von Ratingskalen erfasst (z.B. „Wie sehr sind Sie davon überzeugt auf einer Skala von 0 = überhaupt nicht bis 100 = voll und ganz?“). Geduldig lässt die Therapeutin den Patienten mit ihrer Unterstützung prüfen, ob seine Einstellungen, Überzeugungen und Interpretationen zum Trauma und seinen Folgen angemessen und hilfreich oder wenig angemessen und dysfunktional sind. Welche Belege hat der Patient dafür, dass seine Auffassung zutreffend ist? Sind auch andere Auffassungen denkbar? Von zentraler Bedeutung ist es, den Patienten nicht zu überreden, sondern gemeinsam mit ihm Argumente für und wider seine Auffassung abzuwägen und den Patienten zu eigenen Schlußfolgerungen kommen zu lassen. Zum Ende der Debatte über die Kognition schätzt der Patient erneut deren Gültigkeit ein. In einem zweiten Schritt werden im Sinne der Spaltentechnik hilfreiche Kognitionen gesucht, mit denen der Patient die maladaptiven in kritischen Situationen ersetzten kann. In der Imagination kann die Implementierung der neuen, hilfreichen Kognition geübt werden. In Tabelle 4 findet sich eine Beschreibung zentraler kognitiver Techniken mit Beispielen. Zur Überprüfung bestimmter Annahmen oder Befürchtungen werden Verhaltensexperimente eingesetzt. So kann man z.B. mit Hilfe eines Experimentes zu den Folgen von Gedankenunterdrückung den Patienten erleben lassen, ob man tatsächlich seine Gedanken steuern kann oder nicht: Man bittet den Patienten, in der nächsten Minute an alles Mögliche zu denken, bloß nicht an weiße Bären (oder einen anderen festgelegten Reiz). Der Patient wird erleben, dass er nicht vermeiden kann, an den festgelegten Reiz zu denken. Die Rolle der Gedankenunterdrückung bei der Aufrechterhaltung seiner belastenden Erinnerungen an das Trauma kann dann besprochen werden. Der Patient erhält die Hausaufgabe, für einige Tage die belastenden Erinnerungen nicht zu bekämpfen und zu beobachten, ob sie dann häufiger oder weniger häufig auftreten bzw. ob sich am Grad der Belastung etwas verändert. In die Informationssammlung zur Überprüfung der Überzeugungen werden unter Umständen auch Angehörige oder Experten mit einbezogen (so z.B. erfährt ein Patient, Opfer einer Geiselnahme in einer Bank, der sich in der Situation völlig alleine gelassen fühlte, dass sehr viele Polizisten und Experten anwesend waren, die aber von den Tätern (und damit auch vom Opfer) nicht wahrgenommen werden sollten / eine Patientin, Opfer eines sexuellen Missbrauches, erfährt, dass ihre Schwester sich an seiner Stelle nicht anders verhalten hätte). 29 PTB, R. Steil, Version 1 Häufig schreiben sich PTB-Patienten in sehr unangemessener Weise selbst die Verantwortung für weite Teile des traumatischen Geschehens zu (so z.B. sind Opfer sexuellen Missbrauchs häufig der Ansicht, durch ihr Verhalten / ihre Persönlichkeit die sexuelle Gewalt verursacht zu haben). Am Beispiel kognitiver Umstrukturierung bezüglich Schuld und Scham lassen sich kognitive Techniken sehr gut illustrieren. Zunächst sollte das Ausmaß der eigenen Verantwortungszuschreibung erfasst werden. Hierzu sammeln Patient und Therapeut, wer bzw. welche Umstände Anteil an der Verantwortung für die Taumatisierung bzw. für bedeutende Elemente daraus tragen könnten. Hernach zeichnet der Therapeut einen "Verantwortungskuchen" (einen leeren Kreis), in dem der Patient den Anteil der Verantwortung für jede beteiligte Person / jeden Umstand markiert. Überschätzt der Patient den eigenen Anteil, so wird in der Folge debattiert, auf welche Weise er zu dem Geschehen beigetragen hat. Die folgenden kognitiven Fehler bzw. falschen Schlussfogerungen können dabei zutage treten (vgl. Kubany, 1998): Das Wissen über den Ausgang beeinflusst die Erinnerung daran, was man vor oder während der Traumatisierung wusste ("Ich hätte wissen müssen, dass ich mit einer Erkältung und bei Nebel als Autofahrer einen Unfall verursachen würde..."). Entscheidungen, welche unter Zeitdruck gefällt wurden, werden auf der Grundlage ausführlicher Kontemplation im Nachhinein bewertet. Der Patient glaubt, er hätte Lösungsmöglichkeiten nutzen müssen, die erst in der Retrospektive sichtbar wurden. Einflussfaktoren außerhalb der eigenen Person (wie z.B. der auch Einfluss eines Schocks) werden nicht bedacht. Positive Auswirkungen der tatsächlichen Handlungen („Mich nicht zu wehren hat mir möglicherweise das Leben gerettet.“) bzw. Geschehnisse, welche während der Traumatisierung wahrscheinlich erschienen (z.B. „Ich dachte, er bringt mich um, wenn ich mich stärker wehre.“, vs. „Ich hätte mich körperlich stärker wehren müssen.“), werden übersehen. Der Patient setzt die Möglichkeit, ein Ereignis verhindern zu können, mit dessen Verursachung gleich. Er misst sein Verhalten an dessen Konsequenzen, nicht an seiner Intention. Das Gefühl, das mit einer Überzeugung verbunden ist, wird zu deren Validierung herangezogen. 30 PTB, R. Steil, Version 1 Die Bearbeitung der dysfunktionalen Einstellungen zum Bereich Schuld erfolgt in mehreren Phasen: Zunächst analysieren Therapeut und Patient gemeinsam die Vorgänge und Handlungen während des traumatischen Geschehens wie auch die wahrscheinlichen Konsequenzen alternativer Verhaltensweisen. Möglicherweise ist es hilfreich, das Geschehen in einzelne Teile zu teilen und die Verantwortung dafür getrennt zu bearbeiten. Die Frage, warum der Patient sich in der Situation so und nicht anders verhalten hat, erlaubt ihm, noch einmal detailliert die Gründe für sein Handeln zusammenzutragen („Wie genau haben Sie ihren Vater als 8jährige dazu gebracht, Sie zu missbrauchen?“ oder „Warum haben Sie sich nicht gewehrt?“). Wichtig ist, dem Patienten die kognitiven Techniken zur Überprüfung von Annahmen und Überzeugungen so zu vermitteln, dass er lernt, sie mehr und mehr auch selbständig anzuwenden. Übungen hierzu werden in Form von Hausaufgaben gegen Ende der Behandlung durchgeführt. Neben der Veränderung dysfunktionaler Annahmen stellt die Verminderung der Strategien zur Kontrolle oder Beendigung des intrusiven Wiedererlebens bzw. des Einsatzes von Sicherheitsverhalten eine tragende Säule der kognitiven Interventionen dar. Die aufrechterhaltende Bedeutung der Gedankenunterdrückung, des Grübelns oder anderer Strategien wird mit dem Patienten erarbeitet, im Rahmen von Hausaufgaben wird die Reduktion dieses Verhaltens geübt. Ärger und Wut sind als sekundäre Emotionen häufig präsent bei PTB-Patienten. Möglicherweise werden sie über den Mechanismus der sekundären Verstärkung als subtile Strategie der Beendigung der mit Intrusionen aktivierten belastenderen primären Emotionen Angst und Furcht aufrechterhalten: der Patient verändert die Qualität der Emotion (vgl. Steil et al., 1997) und vermindert damit das Erleben von Angst. Damit konsistent ist der Befund, dass das Ausmaß an Wut in einem umgekehrten Zusammenhang zum Therapieerfolg bei einer Konfrontationsbehandlung der PTB stand (Foa, Riggs, Massier & Yarczower, 1995). Hat Ärger und Wut solch eine Bedeutung als Vermeidungsstrategie, so sollte dies mit dem Patienten erarbeitet und wirkungsvolle Strategien der Ärgerreduktion eingesetzt werden. Diese sind ebenfalls angezeigt, wenn Ärger und Wut zu Gewaltanwendung in der Familie oder zur Beeinträchtigung im Beruf oder Privatleben führen. Zur Ärgerreduktion hat sich bei hochärgerlichen und zu interpersoneller Gewalt neigenden PTB-Patienten ein kognitiv31 PTB, R. Steil, Version 1 behaviorales Programm als effektiv erwiesen, bei dem das Training angemessener Kommunikation, von Ärgerkontroll- und Problemlösetechniken im Mittelpunkt stehen (vgl. Chemtob, Novaco, Hamada & Gross, 1997; Novaco & Chemtob, 1998; vgl. auch Reilly et al., 1994). Einbeziehen der Angehörigen Angehörige können auf vielfältige Weise den Erfolg der Behandlung fördern (indem sie den Patienten bei der Konfrontation mit Erinnerungen und der Veränderung dysfunktionaler Einstellungen unterstützen) oder behindern (indem sie den Angehörigen weiterhin schützen wollen vor der Belastung durch das Erinnern und zur Aufrechterhaltung ungünstiger Einstellungen beitragen). Im letzten Fall kann es sehr nützlich sein, Angehörige in die Behandlung mit einzubinden, ihnen Informationen über das Störungsbild, die Behandlung, hilfreiches und nicht hilfreiches Verhalten zukommen zu lassen. Die kann geschehen, indem Angehörige zu einer gemeinsamen Sitzung eingeladen werden, oder über die Hausaufgabe an den Patienten, den Angehörigen über vereinbarte Inhalte der Sitzungen zu informieren (bisweilen auch mit Hilfe vom Patienten ausgewählter Passagen des Mitschnittes der Sitzung). Den exemplarischen Ablauf einer Behandlung der PTB mit der Abfolge der verschiedenen Elemente zeigt Tabelle 5. Zusätzlich können entsprechend der Symptomatik des Patienten Interventionsstrategien wie Kommunikationstraining, Interventionen zur Schlafhygiene, Elemente der Paartherapie etc. zum Einsatz kommen. Behandlung der AB / Prävention der PTB Auch zur Behandlung der AB bzw. zur Prävention der AB kurz nach einer Traumatisierung kann das oben beschriebene kognitiv-behaviorale Vorgehen eingesetzt werden (vgl. Bryant, Harvey, Dang, Sackville & Basten, 1998; Bryant, Sackville, Dang, Moulds & Guthrie, 1999). Hier wäre eine Zahl von 4-5 Sitzungen empfehlenswert. 8. Wirksamkeit Wirksamkeit der Behandlung mit behavioralem Schwerpunkt: Als wirksam erwiesen hat sich in kontrollierten Studien sowohl ein graduelles Vorgehen im Sinne der systematischen Desensibilisierung (z.B. Brom, Kleber & Defares, 1989), als auch ein massiertes Vorgehen (Keane, Fairbank, Caddell & Zimering, 1989; Foa, Rothbaum, Riggs & Murdock, 1991; Foa, 32 PTB, R. Steil, Version 1 Dancu, Hembree, Jaycox, Meadows & Street, 1999; Marks, Lovell, Noshirvani, Livanou & Thrasher, 1998, Tarrier, Pilgrim, Sommerfiled, Faragher, Reynolds, Graham & Barrowglough, 1999; Vaughan, Armstrong, Gold, O´Connor, Jenneke & Tarrier, 1994). Die Adaptation einer behavioralen Intervention zur Behandlung der AB bzw. zur Prävention der Entwicklung einer chronischen PTB zeigte bei Opfern von Verkehrs- und Arbeitsunfällen in einer randomisierten und kontrollierten Studie eine gute Wirksamkeit (Bryant et al., 1999). Dies steht im Kontrast zu den widersprüchlichen und teilweise negativen (d.h. in Bezug auf die posttraumatische Symptomatik schädigenden) Ergebnissen zur Wirksamkeit des bislang häufig angewandten Critical Incident Stress Debriefings (vgl. Rose & Bisson, 1998). Zur differentiellen Wirksamkeit liegen bereits Befunde vor: So fanden Foa und Kolleginnen (Foa et al., 1995) bei Patientinnen, die nach einer Vergewaltigung an einer PTB litten, dass diejenigen am besten von der Konfrontationsbehandlung profitierten, welche a) eine schwere Symptomatik zu Beginn der Behandlung zeigten, und welche zu Beginn der Konfrontation b) eine große subjektive Belastung angaben und c) einen starken mimischen Furchtausdruck zeigten (eingeschätzt von unabhängigen Ratern anhand eines Videobandes der Konfrontation). Zeigte sich im mimischen Ausdruck zu Beginn der Konfrontation starke Wut und Ärger, so profitierten die Patientinnen nur wenig von der Konfrontationsbehandlung. Die Befunde implizieren, dass die Aktivation der ursprünglich beim Trauma vorhandenen, primären Emotionen (im Gegensatz zur Aktivation eher sekundär sich einstellender Emotionen wie Wut) von zentraler Bedeutung für den Erfolg der Konfrontationsbehandlung ist. Tarrier, Sommerfield, Pilgrim & Faragher (2000) fanden für eine behaviorale oder kognitive Intervention (sie fassten für diese Analyse die zwei Behandlungsformen zusammen), dass eine unregelmäßige Teilnahme an der Behandlung der beste Prädiktor für einen Misserfolg der Behandlung war. Frauen profitierten besser als Männer: sie waren motivierter, hielten die Behandlung für glaubwürdiger und fehlten seltener. Suizidalität zu Beginn der Behandlung war mit einem schlechteren Therapieerfolg zum Ende der Behandlung verknüpft. Langfristig (in der 6-Monats-Katamnese) erwiesen sich eine komorbide generalisierte Angststörung zu Beginn der Behandlung und unregelmäßige Teilnahme als ungünstig, allein Lebende profitierten weniger als Patienten, die mit anderen zusammen lebten. Tarrier, Sommerfiled und Pilgrim (1999) fanden darüber hinaus im Rahmen der gleichen Evaluationsstudie, dass das Kommunikationsverhalten zwischen Patient und Angehörigen (im Sinne der Expressed 33 PTB, R. Steil, Version 1 Emotion) den Therapieerfolg prädizierte: Patienten mit Angehörigen, welche in hohem Maße ihnen gegenüber Kritik und Feindseligkeit äußerten, profitierten weniger. Wirksamkeit der Behandlung mit kognitivem Schwerpunkt: Auch die Wirksamkeit einer vorwiegend kognitiven Intervention bei PTB wurde in kontrollierten und randomisierten Studien belegt (Marks et al., 1998; Tarrier et al, 1999). Die Anzahl der Evaluationsstudien ist jedoch bislang geringer als die zur schwerpunktmäßig behavioralen Intervention. Wirksamkeit einer Kombination kognitiv-behavioraler Intervention: Die Kombination kognitiver und behavioraler Intervention erwies sich als ebenfalls als wirksam (Devilly & Spence, 1999; Fecteau & Nicki, 1999; Glynn et al., 1999; Marks et al., 1998; Resick & Schnicke, 1992). Im Vergleich mit nur einer der Behandlungskomponenten alleine ergaben sich in einer ersten Studie jedoch keine Effektivitätsvorteile (Marks et al., 1998). Auch bei der Behandlung der akuten Belastungsstörung bzw. Prävention der PTB hat sich ein kognitiv-behaviorales Vorgehen als effektiv erwiesen (vgl. Bryant et al., 1999). Vergleich der Wirksamkeit kognitiver und behavioraler Strategien: Der Vergleich einer schwerpunktmäßig behavioralen mit einer schwerpunktmäßig kognitiven Behandlung bz.w Prävention der PTB erbrachte keine Unterschiede in der Effektivität beider Strategien (Bryant et al., 1999; Marks et al., 1998; Tarrier et al., 1999). Allerdings ist unklar, ob die Evaluation neuerer kognitiver Behandlungsansätze (vgl. Steil et al., 1997; Ehlers, 1999), welche gerade im kognitiven Bereich detaillierter als die bislang überprüften Vorgehensweisen auf die Symptomatik der PTB zugeschnitten sind, nicht vielleicht einen Behandlungsvorteil für kognitive Intervention ergeben werden. Ergebnisse stehen hier bislang noch aus. Wirksamkeit zusätzlicher Behandlungselemente: Eine additive Wirksamkeit von verhaltenstherapeutisch ausgerichteter Paar- bzw. Familienintervention (Inhalte waren Komminikationstraining, Psychoedukation über die Störung, Ärgermanagement und Problemlösetraining) zusätzlich zur einer kognitiv-behavioralen Intervention konnte in einer ersten Studie nicht bestätigt werden (Glynn et al., 1999). Allerdings waren die Patienten hier Vietnamveteranen mit einer über Dekanden andauernden Chronizität der Störung (trotz mehrfacher vorausgehender Behandlungsversuche) und hoher Komorbidität. Die Überprüfung dieser zusätzlichen Komponente der Behandlung bei anderen Formen der 34 PTB, R. Steil, Version 1 Traumatisierung bzw. zu einem früheren Zeitpunkt nach der Traumatisierung steht aus. Gute Ergebnisse wurden erzielt mit dem zusätzlichen Einsatz kognitiv-behavioraler Methoden des Ärgermanagements bei hochärgerlichen Vietnam-Veteranen mit PTB (Chemtob et al., 1997; Novaco & Chemtob, 1998). In einer randomisierten und kontrollierten Studie erzielte die Kombination einer behavioralen Routinebehandlung und dieser Intervention Vorteile bezüglich der Ärgerintensität und –kontrolle, bezüglich allgemeiner Ängstlichkeit und intrusiver Symptomatik (Chemtob et al., 1998). Zur Wirksamkeit einer Kombination der Behandlung der PTB mit der eines Substanzabusus bei entsprechender Komorbidität liegen noch keine kontrollierten und randomisierten Studien vor. Wirksamkeit kognitiv-behavioraler Intervention bei Kindern und Jugendlichen: Es existieren Hinweise darauf, dass eine kognitiv-behaviorale Behandlung bei Kindern und Jugendlichen erfolgreich ist (Deblinger, McLeer & Henry, 1990; Farrell, Hains & Davies, 1998; March et al., 1998; Saigh, 1992; Saigh, Yule & Inamdar, 1996, Yule & Canterbury, 1994). March und Kollegen (March et al., 1998) behandelten 14 PTB-Patienten zwischen 10 und 15 Jahren mit einem kognitiv-behavioralen Gruppenprogramm (die Exposition wurde im Einzelsetting durchgeführt). Im Rahmen eines Multiple-Baseline-Designs zeigte sich, dass diese Form der Behandlung zu einer Besserung der Posttraumatischen Symptomatik führte, die auch ein halbes Jahr nach Ende der Behandlung weiter bestand. Allerdings waren in dieser Studie Kinder, die nach multipler Traumatisierung eine sehr schwere PTB entwickelt hatten, ausgeschlossen, die Ergebnisse sind daher nicht auf diese Gruppe von Kindern und Jugendlichen generalisierbar. Kontrollierte und randomisierte Evaluationsstudien zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit PTB stehen noch aus. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wirksamkeit behavioraler und kognitiver Intervention als sehr gut belegt und bislang als vergleichbar gelten kann (vgl. auch Sherman, 1998). Erste Studien zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen zeigen die Wirksamkeit auch in dieser Altersgruppe. Zur Behandlung der akuten Belastungsstörung ist ein kognitivbehaviorales Vorgehen ebenfalls zu empfehlen. 10. Literaturempfehlungen Ehlers, A. (1999). Posttraumtische Belastungsstörung. Göttingen: Hogrefe. Foa, E. B. & Rothbaum, B. (1998). Treating the trauma of rape. New York: Guilford Press. 35 PTB, R. Steil, Version 1 Folette, V. M., Ruzek, J. I. & Abueg, F. R. (1998). Cognitive-behavioral therapies for trauma. New York: Guilford Press. Maercker, A. (1997). Therapie der Posttraumatischen Belastungsstörungen. Heidelberg: Springer. 36 PTB, R. Steil, Version 1 Literatur Abramson, L. Y., Metalsky, G. I. & Alloy, L. B. (1989). Hopelessness depression: A theory-based subtype of depression. Psychological Review, 96, 358-372. Abramson, L. Y., Seligman, M. E. P. & Teasdale, J. D. (1978). Learned helplessness in humans: Critique and reformulation. Journal of Abnormal Psychology, 87, 49-74. American Psychiatric Association. (1980). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (3rd ed.). Washington, DC: Author. American Psychiatric Association.(1987). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Rev. 3rd ed.). Washington, DC: Author. American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed.). Washington, DC: Author. Andreski, P., Chilcoat, H., & Breslau, N. (1998). Post-traumatic stress disorder and somatization symptoms: A prospective study. Psychiatry Research, 79, 131-138. Anthony, J. L., Lonigan, C. J. & Hecht, S. A. (1999). Dimensionality of Posttraumatic Stress Disorder symptoms in children exposed to disaster: Results from confirmatory factor analyses. Journal of Abnormal Psychology, 108, 326-336. Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F. & Emery, G. (1986). Kognitive Therapie der Depression. München: Psychologie Verlags Union, Urban & Schwarzenberg. Beckham, J. C. et al., (1997). Chronic posttraumatic stress disorder and chronic pain in Vietnam combat veterans. Journal of Psychosomatic Research, 43, 379-389. Boscarino, J. A. (1997). Diseases among men 20 years after exposure to severe stress: Implications for clinical research and medical care. Psychosomatic Medicine, 59, 605-614. Brady, K. T. (1997). Posttraumatic stress disorder and Comorbidity: Recognizing the many faces of PTSD. Journal of Clinical Psychiatry, 58, 12-15. Breslau, N., Davis, G., Andreski, P., Federman, B. & Anthony, J. C. (1998). Epidemiological findings on posttraumatic stress disorder and co-morbid disorders in the general population. In B. P Dohrenwend (Ed.). Adversity, Stress, and Psychopathology. New York: Oxford University Press. Breslau, N., Davis, G. C., Andreski, P. & Peterson, E. (1991). Traumatic events and posttraumatic stress disorder in an urban population of young adults. Archives of General Psychiatry, 48, 216-222. Breslau, N., Davis, G. C., Andreski, P., Peterson, E. L. & Schultz, L. R. (1997). Sex differences in posttraumatic stress disorder. Archives of General Psychiatry, 54, 1044-1048. Brewin, C. R. (1989). Cognitive change processes in psychotherapy. Psychological Review, 96, 379394. Brewin, C. R., Andrews, B., Rose, S. & Kirk, M (1999). Acute stress disorder and posttraumtic stress disorder in victims of violent crime. American Journal of Psychiatry, 156, 360-366. Brewin, C. R., Dagleish, T. & Joseph, S. (1996). A dual representation theory of posttraumatic stress disorder. Psychological Review, 103, 670-686. 37 PTB, R. Steil, Version 1 Brom, D., Kleber, R. J. & Defares, P. B. (1989). Brief psychotherapy for posttraumatic stress disorders. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 57, 607-612. Bryant, R. A., Harvey, A. G., Dang, S. T., Sackville, T. & Basten, C. (1998). Treatment of Acute Stress Disorder: A comparison of cognitive-behavioral therapy and supportive counseling. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66 (5), 862-866. Bryant, R., Sackville, T., Dang, S. T., Moulds, M. & Guthrie, R. (1999). Treating acute stress disorder : An evaluation of cognitive behavior therapy and supportive counselling techniques. American Journal of Psychiatry, 156, 1780-1786. Chemtob, C. M., Novaco, R. W. Hamada, R. S. & Gross, D. M. (1997). Cognitive-behavioral treatment for severe anger in posttraumatic stress disorder. Journal of Consulting and Clinical-Psychology, 65, 184-189. Chemtob, C., Roitblat, H. L., Hamada, R. S., Carlson, J. G. & Twentyman, C. T. (1988). A cognitive action theory of post-traumatic stress disorder. Journal of Anxiety Disorders, 2, 253-275. Classen, C., Koopman, C., Hales, R. & Spiegel, D. (1998). Acute stress disorder as a predictor of posttraumatic stress symptoms. American Journal of Psychiatry, 155, 620-624. Creamer, M. & Manning, C. (1999). Acute stress disorder following an industrial accident. Australian Psychologist, 33, 125-129. Davidson, J. R., Hughes, D., Blazer, D. G. & George, L. K. (1991). Post-Traumatic Stress Disorder in the community: an epidemiological study. Psychological Medicine, 21, 713-721. Deblinger, E., McLeer, S.V. & Delmina, H. (1990). Cognitive behavioal treatment for sexually abused children suffering from post-traumatic stress: Preliminary findings. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 29, 747-752. De Girolamo, G. & McFarlane, A. (1997). The epidemiology of PTSD: a comprehensive review of the international literature. In A. Marsella, M. Friedman, E. Gerrity & R. Scurfield (Eds.): Ethnocultural aspects of posttraumatic stress disorder. Washington: APA. Devilly, G. J. & Spence, S. H. (1999). The relative efficacy and treatment distress of EMDR and a cognitive-behavior trauma treatment protocol in the amelioration of posttraumatic stress disorder. Journal of Anxiety Disorders, 13, 131-157. Dilling, H., Mombour, W. & Schmidt, M. H. (1991). Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD10 Kap. V (F). Bern: Huber. Dunmore, E., Clark, D.M. & Ehlers, A. (1997). Cognitive factors in persistent vs. recovered posttraumatic stress disorder: A pilot study. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 25, 147-159 Ehlers, A. (1999). Posttraumtische Belastungsstörung. Göttingen: Hogrefe. Ehlers, A. & Clark, D.M. (2000). A cognitive model of posttraumatic stress disorder. Behavior Research and Therapy, 38, 319-345. Ehlers, A., Mayou, R. & Bryant, B. (1998). Psychological Predictors of chronic posttraumatic stress disorder after motor vehicle accidents. Journal of Abnormal Psychology, 107, 508-519. 38 PTB, R. Steil, Version 1 Ehlers, A. & Steil, R. (1995). Maintenance of intrusive memories in Posttraumatic Stress Disorder: A cognitive approach. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 23, 217-250. Essau, C. A., Conradt, J. & Petermann, F. (1999). Häufigkeit der Posttraumatischen Belastungsstörung bei Jugendlichen: Ergebnisse der Bremer Jugendstudie. Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 27, 37-45. Farrell, S. P., Hains, A. A. & Davies, W. H. (1998). Cognitive behavioral interventions for sexually abused children exhibiting PTSD symptomatology. Behavior Therapy, 299, 241-255. Flannery, R. B. (1987). From victim to survivor: A stress management approach in the treatment of learned helplessness. In B. A. van der Kolk (Ed.), Psychological Trauma (pp 217-232). Washington DC: American Psychiatric Press. Fecteau, Gary. & Nicki, R. (1999). Cognitive behavioural treatment of post traumatic stress disorder after motor vehicle accident. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 27, 201-214. Flannery, R. B. & Harvey, M. R. (1991). Psychological trauma and learned helplessness: Seligman's paradigm reconsidered. Psychotherapy, 28, 374-378. Foa, E. B., Cashman, L., Jaycox, L. & Perry, K. (1997). The validation of a self-report measure of posttraumatic stress disorder: the Posttraumatic Diagnostic Scale. Psychological Assessment, 9, 445451. Foa, E. B., Dancu,-C. V., Hembree, E. A., Jaycox, L. H., Meadows, E. A. & Street, G. P. (1999). A comparison of exposure therapy, stress inoculation training, and their combination for reducing posttraumatic stress disorder in female assault victims. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67, 194-200. Foa, E. B., Davidson, J. R. T. & Frances, A. (1999). The expert consensus guideline series. Treatment of Posttraumatic Stress disorder. Journal of Clinical Psychiatry, 60, 4-76. Foa, E. B. & Kozak, M. J. (1986). Emotional processing of fear: Exposure to corrective information in rape victims. Psychological Bulletin, 99, 20-35. Foa, E. B. & Meadows, E. A. (1997). Psychosocial treatments for posttraumatic stress disorder: A critical review. Annual Review of Psychology, 48, 449-480. Foa, E. B. & Rothbaum, B. (1998). Treating the trauma of rape. New York: Guilford Press. Foa, E. B., Rothbaum, B. O., Riggs, D. S. & Murdock, T. (1991). Treatment of post-traumatic stress disorder in rape-victims: A comparison between cognitive-behavioral procedures and counseling. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59, 715-723. Foa, E. B. & Riggs, D.S. (1993). Posttraumatic stress disorder in rape victims. In J. Oldham, M.B. Riba & A. Tasman (Eds.), American Psychiatric Press review of psychiatry (Vol. 12, pp. 273-303). Washington, D.C: American Psychiatric Press. Foa, E. B., Riggs, D. S., Massie, E. D. & Yarczower, M. (1995). The impact of fear activation and anger on the efficiacy of exposure treatment for Posttraumatic Stress Disorder. Behavior Therapy, 25, 487-499. 39 PTB, R. Steil, Version 1 Foa, E. B., Steketee, G. & Rothbaum, B. (1989). Behavioral/cognitive conceptualizations of posttraumatic stess disorder. Behavior Therapy, 20, 155-176. Folette, V. M., Ruzek, J. I. & Abueg, F. R. (1998). Cognitive-behavioral therapies for trauma. New York: Guilford Press. Glynn, S. M., Eth, S., Randolph, E. T. et al. (1999). A test of behavioral family therapy to augment exposure for combat-related posttraumatic stress disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67, 243-251. Goenjian, A., Pynoos, R.S., Steinberg, A. M., Najarian, L. M., Asarnow, J. R., Karayan, I., Ghurabi, M. & Fairbanks, L. A. (1995). Psychiatric co-morbidity in children after the 1988 earthquake in Armenia. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34, 1174-1184. Giaconia, R. M., Reinherz, H. Z., Silverman, A. B., Pakiz, B., Frost, A. K. & Cohen, E. (1995). Traumas and Posttraumatic Stress Disorder in a community population of older adults. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34, 1369-1380. Goenjian, A., Pynoos, R.S., Steinberg, A. M., Najarian, L. M., Asarnow, J. R., Karayan, I., Ghurabi, M. & Fairbanks, L. A. (1995). Psychiatric co-morbidity in children after the 1988 earthquake in Armenia. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34, 1174-1184. Green, B. L., Wilson, J. P. & Lindy, J. D. (1985). Conceptualizing posttraumatic stress disorder: A psychosocial framework. In C. Figley (Ed.), Trauma and its awake (Bd. 1) (pp. 53-72). New York: Brunner/Mazel. Hautzinger, M., Bailer, M., Worall, H. & Keller, F. (1995). Beck Depressions Inventar (BDI). Bern: Verlag Hans Huber. Harvey, A. G. & Bryant, R. A: (1998). The relationship between acute stress disorder an posttraumatic stress disorder: A prospective evaluation of motor vehicle accident survivors. Journal of Clinical and Consulting Psychology, 66, 507-512. Horowitz, M. J. (1976). Stress response syndromes. New York: Aronson. Hyman, I. E. & Loftus, E. F. (1998). Errors in autobiographical memory. Clinical Psychology Review, 18, 933-947. Janoff-Bulman, R. (1992). Shattered assumptions: Towards a new psychology of trauma. New York: The Free Press. Joseph, S., Williams, R. & Yule, W. (1995). Psychosocial perspectives on post-traumatic stress. Clinical Psychology Review, 15, 515-544. Joseph, S., Yule, W. & Williams, R. (1993). Post-traumatic stress: Attributional aspects. Journal of Traumatic Stress, 6, 501-513. Keane, T. M., Fairbank, J. A., Caddell, J. M. & Zimering, R. T. (1989). Implosive (flooding) therapy reduces symptoms of PT.SD in Vietnam Combat Veterans. Behavior Therapy, 20, 245-260. 40 PTB, R. Steil, Version 1 Keane, T. M. & Kaloupek, D. G (1997). Comorbid psychiatric disorders in PTSD. In R. Yehuda & A. C. McFarlane (Eds.). Psychobiology of Posttraumatic Stress Disorder. New York: New York Academy of Sciences. Keane, T. M., Zimering, R. T. & Caddell, R. T. (1985). A behavioral formulation of PTSD in Vietnam Veterans. Behavior Therapist, 8, 9-12. Kessler, R. C., Sonnega, A., Bromet, E., Hughes, M. & Nelson, C. B. (1995). Posttraumatic stress disorder in the national comorbidity sample. Archives of General Psychiatry, 52, 1048-1060. Krakow, B., Kellner, R., Pathak, D. & Lambert, L. (1995). Imagery rehearsal treatment for chronic nightmares. Behaviour Research and Therapy, 33, 837-843. Krakow, B., Kellner, R., Pathak, D. & Lambert, L. (1996). Long term reduction of nightmares with imagery rehearsal treatment. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 24, 135-148. Kubany, ER. S. (1998). Cognitive Therapy for trauma-related guilt. In V. M. Folette, J. I. Ruzek & F. R. Abueg (Eds.). Cognitive-behavioral therapies for trauma. New York: Guilford Press. Lang, P. (1979). A bio-informational theory of emotional imagery. Psychophysiology, 16, 495-512. Maercker, A. (1997). Therapie der Posttraumatischen Belastungsstörungen. Heidelberg: Springer. Maercker, A. (1999). Posttraumatische Belastungsstörungen: Psychologie der Extrembelastungen bei Opfern politischer Gewalt. Lengerich: Pabst. Maercker, A. & Schützwohl, M. (1998). Erfassung von psychischen Belastungsfolgen: Die Impact of Event Skala-revidierte Version (IES-R). Diagnostica, 44(3), 130-141. March, J. S., Amaya-Jackson, L. & Pynoos, R. S. (1997). Pediatric Posttraumatic Stress Disorder. In J. M. Wiener (Ed.). Textbook of child & adolescent psychiatry. Washington: American Psychiatric Press. March, J. S., Amaya-Jackson, L., Murray, M. C. & Schulte, A. (1998). Cognitive-behavioral psychotherapy for children and adolescents with posttraumatic stress disorder after a single-incident stressor. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 37, 585-593. Margraf, J. & Ehlers, A. (in Vorbereitung). Beck Angst Inventar. Göttingen: Hogrefe. Margraf, J., Schneider, S. & Ehlers, A. (1991). Diagnostisches Interview bei psychischen Störungen (DIPS). Berlin: Springer. Marks, I., Lovell, K., Noshirvani, H., Livanou, M. & Thrasher, S. (1998). Treatment of Posttraumatic Stress Disorder by exposure and/or cognitive restructuring. Archives of General Psychiatry, 55, 317325. McFarlane, A.C., Atchison, M., Rafalowicz, E. & Papay, P. (1994). Physical symptoms in posttraumatic stress disorder. Journal of Psychosomatic Research, 38, 715-726. Meisler, A. W. (1999). Group treatment of PTSD and comorbid alcohol abuse. In B. Young & D. D. Blake (Eds.). Group treatments for posttraumatic stress disorder. Philadelphia: Brunner / Mazel. McNally, R. & Shin, L. M. (1995). Association of intelligence with severity of posttraumatic stress disorder symptoms in Vietnam combat veterans. American Journal of Psychiatry, 152, 936-630. 41 PTB, R. Steil, Version 1 Mowrer, O. H. (1947). On the dual nature of learning - a re-interpretation of "conditioning" and "problem-solving". Harvard Educational Review, 17, 102-148 Nader, K., Blake, D. & Kriegler, J. (1994). Clinician Administered PTSD Scale for Children (CAPSC). Current and lifetime Diagnosis Version, and Instruction Manual. Los Angeles, CA, UCLA. Neuropsychiatric Institute and National Center for PTSD. Norris, F. H. (1992). Epidemiology of trauma: Frequency and impact of different potentially traumatic events on different demographic groups. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 60, 409-418. Novaco, R. W. & V. M. Chemtob (1998). Anger and trauma: Conceptualization, assessment, and treatment. In V. M. Follette, J. I. Ruzek & F. R. Abueg (Eds). Cognitive-behavioral therapies for trauma.New York: Guilford. Peterson, C. & Seligman, M. E. P. (1983). Learned helplessness and victimization. Journal of Social Issues, 2, 103-116. Peterson, K. C., Prout, M. F. & Schwarz, R. A. (1991). Post-Traumatic Stress Disorder. A Clini- cian´s Guide. New York: Plenum Press. Pillemer, D. B. (1998). What is remembered about early childhood events? Clinical Psychology Review, 18, 895-913. Resick, P. A. & Schnicke, M. K. (1992). Cognitive processing therapy for sexual assault victims. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 60, 748-756. Rose, S. & Bisson, J. (1998). Brief early psychological interventions following trauma: A systematic review of the literature. Journal of Traumatic Stress, 11, 697-710. Saigh, P. A. (1992). The behavioral treatment of child and adolescent posttraumatic stress disorder. Advances in Beahvior Research and Therapy, 14, 247-275. Saigh, P. A., Yule, W. & Inamdar, S. C. (1996). Imaginal flooding of traumatized children and adolescents. Journal of School Psychology, 34, 163-183. Saß, H., Wittchen, H.U. & Zaudig, M. (1994). Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen DSMIV. Göttingen: Hogrefe. Schacter, D. L. (1995). Memory distortion: History and current status. In D. F. Schacter (Ed.). Memory distortion: How minds, brains, and societies reconstruct the past. Cambridge: Harvard University Press. Seligman, M. E. P. (1975). Helplessness. On depression, development and death. San Francisco: Freeman and Company. Sherman, J. J. (1998). Effects of psychotherapeutic treatments for PTSD: A meta-analysis of controlled clinical trials. Journal of Traumatic Stress, 11, 413-435. Smith, E. M., North, C. S., McCool, R. E. & Shea, J. M. (1990). Acute postdisaster psychiatric disorders: Identification of persons at risk. American Journal of Psychiatry, 147, 202-206. Steil, R. (1997). Posttraumatische Intrusionen nach Verkehrsunfällen - Faktoren der Aufrechterhaltung. Frankfurt: Lang. 42 PTB, R. Steil, Version 1 Steil, R. & Ehlers, A. (2000). Dysfunctional meaning of posstraumatic intrusions in chronic PTSD. Behaviour Research and Therapy, 38, 537-558. Steil, R. & Ehlers, A. (in Vorbereitung). Die Posttraumatische Diagnose Skala (PDS). Göttingen: Hogrefe. Steil, R. , Ehlers, A. & Clark, D. M. (1997). Kognitive Aspekte bei der Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung. In A. Maercker (Hrsg.). Therapie der posttraumatischen Belastungsstörungen. Berlin: Springer. Steil, R., Gundlach, P. & Müller, C. (unveröffentlichtes Manuskript). Die deutsche Übersetzung der CAPS-CA. Jena: Friedrich Schiller Universität. Steil, R., Gundlach, P. & Müller, C. (in Vorbereitung). Posttraumatic stress disorder in child and adolescent survivors of motor vehicle accidents – cognitive correlates of posttraumatic symptomatology in children /adolescents and their parents. Steil, R. & Straube, E. R. (im Druck). Posttraumatische Belastungsstörung bei Kindern und Jugendlichen – ein Überblick. Zeitschrift für Klinische Psychologie. Stein, M., Walker, J. R., Hazen, A. L. & Forde, D. R. (1997). Full and partial posttraumatic stress disorder: Findings from a community survey. American Journal of Psychiatry, 154, 1114-1119. Tarrier, N., Sommerfield, C. & Pilgrim, H. (1999). Relatives' expressed emotion (EE) and PTSD treatment outcome. Psychological Medicine, 29, 801-811. Tarrier, N., Sommerfield, C., Pilgrim, H. & Faragher, B. (2000). Factors associated with outcome of cognitive-behavioural treatment of chronic post-traumatic stress disorder. Behaviour Research Tarrier, N., Pilgrim, H., Sommerfield, C., Faragher, B., Reynolds, M., Graham, E. & Barrowclough, C. (1999). A randomized trial of cognitive therapy and imaginal exposure in the treatment of chronic posttraumatic stress disorder. Journal of Clinical and Consulting Psychology, 67, 13-18. Teasdale, J. D. & Barnard, P. J. (1993). Affect, cognition, and change: Re-modelling depressive thought. Hove, England: Erlbaum. Triffleman, E., Carroll, K. & Kellogg, S. (1999). Substance dependence posttrauamatic stress disorder therapy. Journal of Substance abuse treatment, 17, 3-14. Unnewehr, S., Schneider, S. & Margraf, J. (1995). Kinder-DIPS. Diagnostisches Interview bei psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter. Berlin: Springer. Vaughan, K., Armstrong, M. S., Gold,R., O'Connor, N. et-al (1994). A trial of eye movement desensitization compared to image habituation training and applied muscle relaxation in post-traumatic stress disorder. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 25, 283-291. Wittchen, H.-U., Zaudig, M. & Fydrich, T. (1997). SKID. Strukturiertes klinisches Interview für DSMIV Achse I und II. Göttingen: Beltz. World Health Organization, WHO (1991). Tenth Revision of the International Classification of Diseases, Chapter V (F): Mental and Behavioral Disorders. Genf: WHO. 43 PTB, R. Steil, Version 1 Yehuda, R. & McFarlane, A. (1997). Psychobiology of Posttraumatic Stress Disorder. New York: New York Academy of Sciences. Yule, W. & Canterbury, R. (1994). The treatment of post traumatic stress disorder in children and adolescents. International Review of Psychiatry, 6, 141-151. Zola, S. M. (1998). Memory, amnesia, and the issue of recovered memory: Neurobiological aspects. Clinical Psychology Review, 18, 915-932. 44 PTB, R. Steil, Version 1 Tabelle 3: Ablauf einer typischen Sitzung ___________________________________________________________________________ Besprechen der Hausaufgabe. Lob für Exposition bzw. Aufgabe von Vermeidung Einschätzung zur Belastung durch Intrusionen seit der letzten Sitzung (Eintrag des Wertes in eine Graphik) Wachrufen der aktuell am meisten belastenden Erinnerung plus Einschätzung zur Belastung durch diese Exposition in sensu Bearbeitung und Überprüfung mit der Erinnerung aktivierter dysfunktionaler Einstellungen und Überzeugungen mit Hilfe von Techniken der kognitiven Therapie Erarbeiten der neuen Hausaufgabe (Obligatorisch: Tonbandaufnahme der Sitzung zuhause anhören) Frage: Gibt es etwas an der heutigen Sitzung, was Ihnen unangenehm war, was wir ändern sollten bzw. was Sie daran hindern könnte, wiederzukommen? Frage: Was war für Sie an der heutigen Sitzung das Wichtigste? Zeit für die Patientin, in einem geschützten Raum so lange zu verweilen, bis sie wieder in den Alltag gehen möchte __________________________________________________ 45 PTB, R. Steil, Version 1 Tabelle 4: Kognitive Techniken in der Behandlung der PTB Demonstrationen zum Zusammenhang zwischen Gedanken und Gefühlen „Immer, wenn ich denke, dass ich es hätte verhindern können, fühle ich mich noch trauriger und schlechter.“ „Wenn ich in Situationen, die mich an den Unfall erinnern, solche starken körperlichen Symptome bekomme, dann denke ich, dass ich doch nicht normal bin, dass ich vielleicht verrückt werde. Diese Gedanken ängstigen mich dann sehr.“ die Betrachtung von Befürchtungen und Erwartungen als Hypothesen, die man testen kann sowie der Gebrauch von Wahrscheinlichkeitsschätzungen, Beweissammlung und Verhaltensexperimenten, um Überzeugungen und Erwartungen zu überprüfen „Sie nehmen an, dass Ihre Frau sich von Ihnen abwenden und Sie weniger lieben wird, wenn Sie Ihr erzählen, wie hilflos und ängstlich Sie sich während des Überfalles gefühlt haben. Woher kommt diese Erwartung? Haben Sie schon einmal erlebt, dass sie in einer ähnlichen Situation so auf Sie reagiert hat? Welche Dinge sprechen dafür, dass sie sich so verhalten wird, welche Dinge sprechen dagegen?“ „Sie befürchten, dass Sie nicht mehr aufhören können zu weinen, wenn Sie mir genau erzählen, was vorgefallen ist. Haben Sie schon einmal einen Menschen erlebt, der bei einer traurigen Erinnerung nie mehr aufhören konnte, zu weinen? Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie drei Stunden lang weinen werden?“ die logische Analyse von Gedanken und Überzeugungen „Wenn Sie sich an das Ereignis erinnern, dann denken Sie, Ihr Leben sei ruiniert. Was meinen Sie genau damit? Bedeutet das, dass in Ihrem Leben nie mehr etwas Positives wird passieren können? Welche Bereiche in Ihrem Leben sind Ihnen wichtig? Welche Dinge genießen Sie in Ihrem Leben? Auf welche Dinge in der Zukunft könnten Sie sich sogar freuen?“ Advocatus diaboli Technik „Sie werfen sich vor, dass Sie sich als Kind nicht gegen die sexuellen Übergriffe Ihres Vaters gewehrt haben. Ich würde gerne genau wissen, warum Sie sich nicht gewehrt haben. Wie kam es dazu?“. Dem Patienten helfen, sich mit den Augen des Menschen zu sehen und zu beurteilen, der er vor der Traumatisierung oder währenddessen war, bzw. sein Handeln auf der Grundlage der Informationen zu beurteilen, die ihm vor oder während des Traumas zur Verfügung standen „Sie grübeln darüber nach, warum Sie an diesem Tag trotz Nebel und ihrer Erkältung mit dem Auto gefahren sind. Sie haben, so sagen Sie, den Radfahrer, der vom Radweg abkam, einfach nicht gesehen, und Sie meinen, Sie hätten seinen Tod verhindern können, wenn Sie das Auto nicht benützt hätten. Was dachten Sie an jenem Morgen, bevor Sie losfuhren? Als wie groß schätzten Sie das Risiko an diesem Morgen, dass Sie eventuell den Tod eines anderen Menschen mit herbeiführen könnten, wenn Sie sich in das Auto setzen und losfahren?“ die Entwicklung alternativer und hilfreicher Gedanken und Erwartungen „Wenn ich anderen von den belastenden Erinnerungen erzähle, werde ich vielleicht recht traurig werden und weinen müssen, aber das wird vorüber gehen. Ich werde nicht die Kontrolle über mich verlieren, und die anderen werden wahrscheinlich gut verstehen können, warum ich so traurig bin. Ich werde mich vielleicht nicht mehr so isoliert fühlen, wenn ich über meine Erinnerungen sprechen kann.“ „Dass ich so starkes Herzklopfen und bekomme und dass mir übel wird, wenn ich an der Stelle vorübergehe, an der es passiert ist, ist ganz normal. Es ist kein Zeichen dafür, dass etwas mit mir nicht stimmt. Anderen geht es genauso.“ Tabelle 5: Exemplarischer Therapieplan für eine kognitiv-behaviorale Behandlung der PTB Dauer einer Sitzung: 90 Minuten, 1 bis 2 mal wöchentlich, individuelles Setting 46 PTB, R. Steil, Version 1 Sitzung 1: Erstgespräch Informationen gewinnen über Traumatisierung und Symptomatik Beziehungsaufbau!! Psychoedukation über Folgen einer Traumatisierung / Entlastung d. Patienten / Normalisierung der Symptome („Es wäre verwunderlich, wenn Sie nicht diese Symptome entwickelt hätten!) Störungsspezifische Diagnostik / individuelles Modell erarbeiten Rational erarbeiten, evtl. Experiment zur Gedankenunterdrückung, wenn möglich kurze Exposition Festlegen eines realistischen Therapiezieles Einstieg in kognitive Intervention Ressourcen und gesunde Bereiche des Lebens besprechen Hausaufgabe: Tagebuch zu Intrusionen führen (7 Tage lang), Selbstbeurteilungsinstrumente ausfüllen, Intrusionen für limitierte Zeiträume nicht bekämpfen / nicht als Reaktion ruminieren Sitzung 2: Diagnostik / Beginn kognitiver Intervention Diagnostik mit Hilfe eines klinischen Interviews Nacherleben des Traumas, weitere Exploration der Interpretationen / Bedeutungen Beginn der Umstrukturierung bei einem zentralen dysfunktionalen Gedanken, welcher sich aus dem Nacherleben ergab Aufrechterhaltende Verhaltensweisen aufgeben (Gedankenunterdrückung, Grübeln etc.) Hausaufgabe: Konfrontation in sensu, evtl. spezifische Hausaufgabe passend zur kognitiven Umstrukturierung (z.B. Verhaltensexperiment) Sitzung 3 und 4: Kognitive Intervention Nacherleben des Traumas, weitere Exploration der Interpretationen / Bedeutungen Fortsetzen der kognitiven Intervention bei gleichem bzw. anderen dysfunktionalen Gedanken Möglicherweise Angehörige mit einladen zu Psychoedukation und Planung der Unterstützung der Behandlung Hausaufgabe: Imaginatives Nacherleben, evtl. Verhaltensexperimente Sitzung 5: Kognitive Intervention, Rekonstruktion des Traumas Möglicherweise Konfrontation in vivo. Nie reale Gefahr!! Genaue Rekonstruktion des Geschehenen, Unterscheiden zwischen damals und heute, bewusst 47 PTB, R. Steil, Version 1 auf Unterschiede achten Überprüfen der Interpretationen / Befürchtungen / Erwartungen Hausaufgabe: Konfrontation in sensu, evtl. Verhaltensexperimente, evtl. selbstgesteuerte in vivoExposition, Übungen zur Implementierung neuer, hilfreicher Gedanken Sitzung 6-xx: Kognitive Intervention Fortsetzung kognitive Intervention Evtl. neue Sicht in das Nacherleben integrieren, evtl. mit Imaginationsteckniken Aufrechterhaltendes Verhalten weiter modifizieren Wenn nötig / hilfreich Angehörig mit einladen zu Informationssitzung und Planung Hausaufgabe: je nach Themen der Sitzungen Abschlusssitzung der Behandlung: Rückfallprophylaxe Zusammenfassen aller gelernten hilfreichen Techniken Wiederholen des idiosynkratischen Modells der Aufrechterhaltung der Symptomatik Plan für den zukünftigen Umgang mit Intrusionen, belastenden Gedanken, Vermeidung etc. Vorwegnahme möglicher kritischer Situationen in der Zukunft und deren Bearbeitung Kriterien für Beendigung der Behandlung: Belastung unter 30 bei Konfrontation mit den vorher belastendsten Erinnerungen, Intrusionen werden nicht mehr als belastend erlebt, kaum behaviorale bzw. kognitive Vermeidung mehr (Tagebuch abermals über 7 Tage einsetzen) Booster Sessions / Katamnesen Analyse kritischer Situationen, Auffrischung der Techniken zur Bewältigung 48 PTB, R. Steil, Version 1 Abbildung 1: Leitfaden zur therapiespezifischen Diagnostik (nach Steil et al., 1997) (Beispiele für Instruktionen etc. sind kursiv gedruckt.) a) Gefühle und Gedanken während und kurz nach dem Trauma Der Patient wird gebeten, eine der am meisten belastenden Intrusionen zu schildern, wenn möglich mit geschlossenen Augen und in der Gegenwart und Ich-Form.. „Damit wir zusammen daran arbeiten können, dass Sie in Zukunft weniger unter den Erinnerungen leiden, ist es zunächst notwendig, dass wir uns ein genaues Bild von ihren belastenden Erinnerungen und Gedanken machen. Dazu ist es wichtig, genau zu wissen, was während und nach dem Trauma passierte, welche Gefühle und Gedanken mit ihren Erinnerungen verknüpft sind und wie Sie dann üblicherweise auf diese Gefühle und Gedanken reagieren. Wir haben festgestellt, dass Menschen, die ein sehr belastendes Erlebnis hatten, bestimmte Gefühle und Gedanken, die durch die Erinnerungen daran ausgelöst werden, als besonders belastend empfinden. Deshalb versuchen sie, nicht mehr an das Erlebte zu denken und können sich den Erinnerungen nicht stellen. Wenn wir genau wissen, welche Gedanken und Gefühle bei Ihnen durch die Erinnerung ausgelöst werden, können wir daran gehen, sie genau zu betrachten und zu besprechen. Oft werden sie dadurch weniger belastend. Ich bitte Sie zunächst, mir kurz eine der belastenden Erinnerungen zu schildern. Das kann für Sie vielleicht sehr belastend sein. Ich werde Sie dabei unterstützen. Sind Sie bereit dazu? Haben Sie Bedenken oder Befürchtungen?“ b) Wachrufen der am meisten belastenden Erinnerung Der Patient wird gebeten, die am meisten belastenden Erinnerungen an das Trauma wachzurufen und zu verbalisieren. Er soll die am meisten belastenden Erinnerungen in der Ich-Form detailliert schildern, so, wie er die Erinnerung im Alltag auch erlebt. Der Therapeut instruiert hierzu den Patienten, die Augen zu schließen und in seiner Vorstellung zurückzugehen bis zu einem Zeitpunkt kurz vor dem traumatischen Geschehen. „Es ist völlig normal, wenn man belastende Erinnerungen oder Gedanken an ein solch schlimmes Ereignis hat. Das beschreiben alle Menschen, die einmal in einer ähnlichen Situation waren. Nun ist es hilfreich, wenn wir uns die Erinnerungen, die Sie als am meisten belastend empfinden, etwas genauer anschauen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ein guter Weg dazu ist, die Augen zu schließen und sich so lebhaft wie möglich zu erinnern. Ich bitte Sie, dass Sie die Augen schließen und in Gedanken zu dem Zeitpunkt zurückzugehen, an dem das passierte, was Sie heute noch am meisten quält. Bitte schildern Sie mir diese Ereignisse so, wie Sie sie im Alltag üblicherweise auch erleben.“ c) Mit den Intrusionen verbundene Kognitionen und Emotionen Kognitionen und Emotionen, die durch die traumatischen Erinnerungen hervorgerufen werden, werden exploriert. Die Frage lautet dabei jeweils, was der Patient denkt, wenn er Erinnerungen an das Trauma hat und wie er sich infolge dieser Gedanken fühlt. Dabei hat der Therapeut die Chance, Verbindungen zwischen bestimmten mit den Erinnerungen auftretenden Gedanken und Gefühlen genau herauszuarbeiten und graphisch zu verdeutlichen. „Wenn Sie diese Erinnerung haben, was denken Sie dann, was ist dann in Ihrem Kopf? In welcher Weise beeinflusst dieser Gedanke, wie sie sich dann fühlen? Bewirkt dieser Gedanke, dass es Ihnen dann besser oder schlechter geht? Denken Sie manchmal auch etwas anderes? Fühlen Sie sich dann auch anders? Was sind die schlimmsten Gedanken, was sind die, die bewirken, dass Sie sich sehr schlecht fühlen? 49 PTB, R. Steil, Version 1 Gibt es auch Gedanken, die bewirken, dass Sie sich ein wenig besser fühlen?“ Erfasst werden sollte, ob der Patient bestimmte Befürchtungen damit verbindet, sich den Erinnerungen an das Trauma auszusetzen. Häufig fürchten Patienten z.B., sie könnten völlig die Kontrolle über ihre Gefühle verlieren und nicht mehr aufhören können zu weinen oder so wütend werden, dass sie den Therapeuten oder andere Menschen gefährden würden. Diese Befürchtungen sind insofern von großer Wichtigkeit, als sie die notwendige Exposition an die traumatischen Erinnerungen behindern können. Sie sollten daher vorrangig Gegenstand der Diskussion sein, der Abwägung der Argumente dafür und dagegen, dass die Befürchtung sich bewahrheiten wird. Ebenfalls von Bedeutung sind Befürchtungen zu negativen und ablehnenden Reaktionen anderer Personen, wenn der Patient über seine Erlebnisse offen spräche (im Sinne von „Wenn ich offen berichte, was ich erlebt habe, werden die anderen mich als abstoßend empfinden, sich von mir zurückziehen.“). Solche negativen Erwartungen können auch im Zusammenhang mit einer katastrophisierenden oder selbstbeschuldigenden Interpretation der PTB-Symptome auftreten („Etwas stimmt ernsthaft nicht mit mir, was denken die anderen, wenn sie erfahren, dass ich immer noch so sehr leide?“). Sie beeinträchtigen die Bereitschaft des Betroffenen, mit anderen über seine traumatischen Erinnerungen zu sprechen. Daher sollten Kognitionen, die sich auf die Reaktionen anderer beziehen, sehr sorgfältig erhoben und bearbeitet werden. Der Partner oder Familienmitglieder können an solchen Punkten in die Behandlung mit einbezogen werden. d) Erfassung kognitiver Vermeidung Im nächsten Schritt werden alle Verhaltensweisen erhoben, die der Patient bisher zur Bewältigung belastender Situationen beim Auftreten von Intrusionen angewandt hat, wie z.B. Gedankenunterdrückung, Grübeln, Alkohol trinken etc. Möglicherweise empfindet der Patient es als beschämend, über bestimmte Bewältigungsversuche zu sprechen. Wenn dieser Eindruck im therapeutischen Gespräch entsteht, kann der Therapeut bestimmte, möglicherweise mit Scham verbundene Reaktionen vorgeben und versichern, dass diese sehr verständlich sind (im Sinne von „Wir hatten viele Patienten, die ...). Der Patient wird zu jeder Reaktion auf das Auftreten von Intrusionen dazu befragt, ob der betreffende Bewältigungsversuch in seinen Augen sich bisher als hilfreich oder weniger hilfreich erwiesen hat. Bei der Gedankenunterdrückung und dem Grübeln z.B. kann der Patient herausfinden, dass diese Reaktionen die Häufigkeit der Intrusionen weniger gesenkt als vielmehr erhöht haben. Eine solche Erkenntnis des Patienten läßt sich als rückkoppelnder Pfeil im in Abbildung 2 dargestellten Schema graphisch verdeutlichen und festhalten. „Normalerweise versuchen Menschen, etwas gegen Gedanken und Erinnerungen, die sie belasten, zu tun. Das ist völlig normal so. Mich interessiert, wie Sie persönlich bisher versucht haben, mit diesen Erinnerungen und Gedanken umzugehen. Wenn Sie diese Erinnerungen, Gedanken und Gefühle haben, über die wir eben gesprochen haben, was tun Sie dann üblicherweise? Tun Sie bestimmte Dinge, damit die Erinnerungen aufhören? (Falls der Patient es schwierig findet, diese Fragen zu beantworten, kann man genauer nachfragen: Tun Sie etwas, um sich abzulenken? Versuchen Sie, an etwas anderes zu denken? Tun Sie bestimmte Dinge, um die Gedanken aus Ihrem Kopf zu vertreiben? Grübeln Sie über bestimmte Dinge dann nach? Über was genau?). Was ist Ihr Ziel, wenn Sie dies tun? Haben Sie den Eindruck, dass dies Ihnen hilft, die Erinnerung oder den Gedanken loszuwerden? Bewirkt dies, dass Sie die Erinnerung als weniger belastend erleben? Hilft es, dass die Erinnerung seltener auftritt? Haben Sie den Eindruck, dass dies Ihnen auf Dauer hilft, besser mit den Erinnerungen zurechtzukommen? Was passiert, wenn Sie versuchen, sich abzulenken/wenn Sie dann über .... nachgrübeln?“ e) Erfassung der Vermeidung intrusionsauslösender Situationen und Verhaltensweisen 50 PTB, R. Steil, Version 1 Erhoben wird auch die Vermeidung von Auslösern von Intrusionen. Wenn der Patient es schwer findet, entsprechende Informationen zu geben, kann man fragen, welche Bereiche des Lebens sich seit dem Trauma verändert haben. Der Patient wird dazu befragt, ob er die Vermeidung dieser Situationen oder Dinge bisher als langfristig hilfreich oder weniger hilfreich erlebt hat. Bezogen auf das spezifische Trauma kann man dem Patienten auch Listen mit Situationen oder Verhaltensweisen vorgeben, die PTB-Patienten nach einem solchen Trauma üblicherweise vermeiden. Ein beispielhafter Fragebogen für Personen, die einen Verkehrsunfall erlebten, kann bei der Erstautorin angefordert werden. „Gibt es Dinge, die Sie vermeiden, weil sie Sie an das Trauma erinnern? Vermeiden Sie sie immer oder nur unter bestimmten Umständen? Warum glauben Sie, umgehen Sie diese Situationen? Ist Ihr Eindruck, dass das Vermeiden auf Dauer hilfreich ist oder weniger hilfreich? Hat die Anzahl der Dinge, die Sie umgehen oder vermeiden, mit der Zeit zu- oder abgenommen?“ f) Auslöser von Intrusionen Typische Auslöser von Erinnerungen und Gedanken an das Trauma werden gesammelt. „Was kann bei Ihnen Erinnerungen und Gedanken an das belastende Ereignis auslösen? Haben Sie schon einmal bemerkt, dass sie in bestimmten Situationen häufiger auftreten als in anderen? Welche Situationen sind das genau?“ 51 PTB, R. Steil, Version 1 Abbildung 2: Beispiel eines graphischen Schemas zur Darstellung des individuellen Modells der Symptomatik (am Beispiel einer Patientin mit PTB nach sexuellem Missbrauch in der Kindheit) Auslöser traumatischer Erinnerungen und Gedanken Ehemann drängt zu sexueller Interaktion Empfundener Druck, Sex mit dem Ehemann haben zu müssen Fernsehsendungen bzw. Artikel über das Thema sexueller Missbrauch sich selbst an der Scheide berühren (auch z.B. beim Duschen) Untersuchung durch Gynäkologen Traumatische Erinnerungen damit verbundene (primäre) Gefühle nackt mit dem Vater auf Bett liegen den erigierten Penis des Vaters berühren müssen Vater führt Finger in Scheide ein Hilflosigkeit, ich kann nichts tun Ekel, große Unsicherheit Aktivierte Kognitionen Angst, Furcht, Hilflosigkeit damit verbundene (sekundäre) Gefühle Ich bin schuld daran. Ich hätte es verhindern können. Mein Leben ist ruiniert. Ich muss meinen Vater dazu provoziert haben. Schuldgefühl, Verzweiflung Schuldgefühl, Verzweiflung Hoffnungslosigkeit, tiefe Traurigkeit Selbsthass Reaktion auf diese Gedanken mich ablenken, indem ich ganz fest an etwas anderes denke darüber nachdenken, wie ich den Mißbrauch hätte verhindern können Ärger und Wut auf den Vater Befürchtungen, was geschieht, wenn ich mich nicht vor den Erinnerungen schütze oder darüber berichte: Ich werde verrückt, ich verliere die Kontrolle über mich / andere werden mich ablehnen. 52 PTB, R. Steil, Version 1 53 PTB, R. Steil, Version 1 Tabelle 1: Diagnostische Kriterien der PTB nach DSMIV und ICD10 Kriterien zu Traumatisierung ICD10 (WHO, 1991) DSMIV (American Psychiatric Association, 1994) Ereignis, das schwere körperliche Verletzung, tatsächlichen oder möglichen Tod oder eine Bedrohung der physischen Integrität der eigenen Person oder anderer Personen beinhaltet Subj. Reaktion mit intensiver Furcht, Hilflosigkeit belastendes Ereignis oder eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigen Ausmaßes Bedingung ist, dass das Ereignis bei fast jedem eine tiefe Verstörung hervorrufen würde oder Entsetzen Hinreichenden Symptomen Beginn der Störung Dauer der Störung Beeinträchtigung durch Störung Vorliegen von Symptomen aus den Bereichen Intrusion (mind. 1) Vermeidung / emot. Taubheit (mind. 3) Autonome Übererregung (mind. 2) Keine Beschränkung Spezifikation des verzögerten Beginns, wenn die Symptomatik ab 6 Monate nach dem Trauma einsetzt mindestens 4 Wochen durch Symptomatik bedingte klinisch bedeutsame Beeinträchtigung in wichtigen Lebensbereichen Wiederholte, unausweichliche Erinnerungen oder Wiederinszenierung des Ereignisses in Gedächtnis, Tagträumen oder Träumen in Zusammenhang mit einem traumatischen Ereignis innerhalb von 6 Monaten nach dem Trauma keine Angaben keine Angaben 54 PTB, R. Steil, Version 1 Tabelle 3: Differentialdiagnostik der PTB Abzugrenzen sind die Symptome der PTB von Symptomen der Vermeidung, Empfindungslosigkeit und erhöhtem Arousal, die schon vor der Traumatisierung vorhanden waren der Verschlimmerung einer schon prätraumatisch bestehenden psychischen Störung psychotischer Symptomatik den psychischen Folgen einer Kopfverletzung oder anderer Verletzungen den Symptomen substanzinduzierter Störungen der Anpassungsstörung als Folge von psychosozialen Stressoren wie Scheidung der Eltern bzw. als Reaktion auf eine Traumatisierung, die nicht die Symptomkritierien einer PTB erfüllen anderen psychiatrischen Störungsbildern, die infolge einer Traumatisierung auftreten können, wie z.B. affektive Störungen oder andere Angststörungen 55