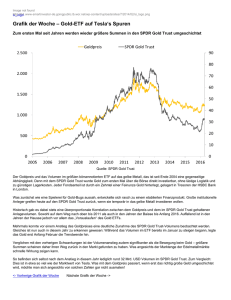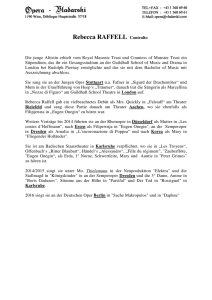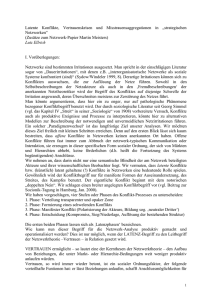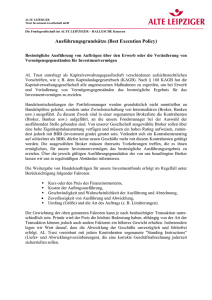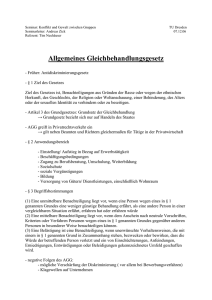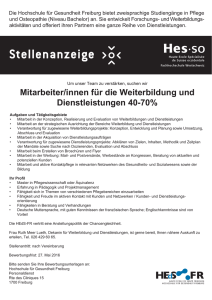200k word - Informatik 5
Werbung

Kultiviertes Misstrauen Bausteine zu einer Soziologie strategischer Netzwerke Lutz Ellrich, Christiane Funken, Martin Meister Z u s a m m e n f a s s u n g: Soziale Netzwerke sind eine eigenständige Form von sozialer Ordnungsbildung. Ihr basaler Koordinationsmechanismus heißt ‚Vertrauen’. Besonders „strategische“ – d.h. langfristig angelegte und ergebnisoffene – Netzwerke beruhen auf der Pflege von Vertrauen, stellen es aber auch permanent auf die Probe. Damit eröffnen sie Perspektiven, die dem Misstrauen einen gebührenden Platz einräumen. Für diese gleichsam strukturbildende Operation gibt es aber weder in den Selbstbeschreibungen der Netzakteure noch in den Fremdbeschreibungen der Netzwerksoziologie geeignete Kategorien. Das komplexe Zusammenspiel von Vertrauen und Misstrauen bleibt begrifflich unterbestimmt. Wir diskutieren daher zunächst die Konzeptualisierungen von Vertrauen in der allgemeinen Soziologie. Dabei stehen zwei Fragen im Vordergrund: 1. Ist Vertrauen ein bewusstes Kalkül oder eine inhärent „blinde“ Operation? 2. Wie weit führt die Unterscheidung von personenbezogenem Vertrauen und Netzwerkvertrauen? Sodann entwickeln wir die These, dass erst mit Blick auf das verborgene, latent bleibende Misstrauen die besondere Fragilität von Netzwerken erklärt werden kann, und skizzieren das typische Verlaufsmuster des Misstrauens. Abschließend greifen wir auf vielversprechende neuere organisationstheoretische Befunde zurück, in denen nicht nur die destruktive, sondern auch die produktive Rolle des Misstrauens zum Thema wird. Auf dieser Grundlage schlagen wir eine „Neubeschreibung“ von strategischen Netzwerken vor, die die produktiven Spannungen zwischen Vertrauen und Misstrauen ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt. 1. Soziale Netzwerke – strategische Koordination und Vertrauen Die Rede von ‚sozialen Netzwerken’ hat Konjunktur. Das zeigen sowohl die Selbstbeschreibungen der Protagonisten neuartiger, flexibler Organisationsweisen als auch die flink gefertigten Blaupausen soziologischer Beobachter, die sich sofort auf die Untersuchung der ungewöhnlichen Phänomene spezialisiert haben.1 Dass es einen erfolgreichen Diskurs über Netzwerke gibt, wird also niemand bestreiten, ob aber Netze eine realistische Antwort auf gesellschaftliche und ökonomische Probleme oder bloß die Erfindung der sich formierenden Netzwerksoziologie darstellen, scheint noch nicht sicher zu sein. In den Augen mancher Kommentatoren, die das Zusammenspiel investitionsbereiter Akteure und innovationssüchtiger Wissenschaftler skeptisch verfolgen, ist der Netzbegriff nur eine „Staubsaugermetapher“ oder eine „universelle Residualkategorie“ für Sachverhalte, die sich noch nicht genau identifizieren und unter präzise Kategorien subsumieren lassen (vgl. Köhler 2000: 280). Aber auch solche Verächter modischer Vokabeln können nicht darüber hinwegsehen, dass sich im Zuge der Globalisierung die Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Handeln erheblich geändert haben. Seit zehn Jahren experimentieren marktsensible Unternehmen mit Strategien, die zu den neuen Verhältnissen nicht nur passen, sondern auch die Möglichkeit zur Anhebung von Gewinnen oder wenigstens von Gewinnerwartungen eröffnen sollen. Die immer turbulenter werdenden Märkte erzeugen einen unübersehbaren Zwang zur Flexibilisierung. Firmen, die sich unter Bedingungen erhöhter Geschwindigkeit, globaler Reichweite, schwer abschätzbaren Innovationserfordernissen und gesteigerten Qualitätsanforderungen behaupten wollen, müssen ihre Effizienz steigern. Dieses Grobziel ist nur zu erreichen, wenn erstarrte Strukturen aufgelöst, eingeschliffene Routinen preisgegeben und andere Schwerpunkte bei Kapitalinvestition und Personalführung gesetzt werden. Dynamische Unternehmen reagieren auf die skizzierten Herausforderungen gegenwärtig mit zwei durchaus komplementären Konzepten: 1. legen sie die Unternehmensgrenzen neu fest („outsourcing“, „Konzentration aufs Kerngeschäft“ usw.), und 2. gehen sie Partnerschaften 1 Vgl. die beiden Übersichtsbände Weyer (2000) und Sydow/Windeler (2000). 1 mit anderen Unternehmungen ein, um eine gemeinsame Nutzung von Ressourcen und Informationen zu ermöglichen2. Solche Partnerschaften bezeichnet man schlicht und einfach als Netzwerke. Essentiell für das Gelingen der Vernetzung – und dies gilt auch für subtilere und ambitioniertere Formen – ist eine funktionierende „Doppelbindung der Akteure“ (Weyer 2000). Im genannten Fall ist sie besonders ausgeprägt: Alle Akteure müssen sich nicht nur an Erfolgs- und Loyalitätskriterien ihrer jeweiligen Heimatunternehmung, sondern auch an Gedeihen und Fortbestand des Gesamtnetzwerkes orientieren. Vernetzung bedeutet also, dass typische Kooperationselemente in die Sphäre des Marktes eingeführt werden. Der Effizienzvorteil von Netzen lässt sich allerdings nur dann sichern und auf Dauer stellen, wenn zu den marktfremden Kooperationselementen auch Formen der Handlungsabstimmung hinzutreten, die man gewöhnlich dem Markt zurechnet. Konkurrenzbeziehungen müssen also bewahrt und geradezu gepflegt werden, damit der erreichte Vorteil sich nicht nach wenigen gemeinsamen Transaktionen verflüchtigt. Für wirtschaftliche Beziehungssysteme, in denen die „Doppelbindung“, auf die sich die Beteiligten in Erwartungen hoher sozialer und ökonomischer Gewinne über den Tag hinaus einlassen, als operative Gelenkstelle fungiert, hat sich der Begriff „strategische Netzwerke“3 eingebürgert. Damit geht eine Abgrenzung von ephemeren „ein-Punkt-Netzwerken“ einher, in denen eher taktische Gesichtspunkten vorherrschen. (Als typische Beispiele hierfür gelten Projektnetzwerke und virtuelle Organisationen). Strategische Netzwerke werden von ihren Mitgliedern bewusst als langfristige Interorganisationsnetzwerke aufgebaut. Zumeist schließen sich hierbei rechtlich selbständige Unternehmungen aus freien Stücken4 zusammen, weil sie zu der Ansicht gekommen sind, dass nur so den bestehenden Flexibilitätserfordernissen Rechnung getragen werden kann. Der „strategische“ und damit langfristige Charakter dieser Vernetzung5 resultiert aus dem gemeinsamen Interesse, auf ungewöhnliche und schwierige Marktsituationen adäquat zu reagieren, d.h. Problemen gewachsen zu sein, die zum Zeitpunkt der Netzwerkgeburt noch nicht genau spezifiziert werden können. Strategische Netzwerke verdienen besondere Aufmerksamkeit, weil die Ansprüche, denen sie genügen wollen, enorm hoch sind. Die Mitglieder verschleiern ihre profanen Intentionen nicht und streben trotzdem Ergebnisse an, die sonst nur unter Einsatz elaborierter Ideologien erreicht werden. Was sie als Leitvorstellung propagieren ist eine Art inspirierter Nüchternheit. Die alltagssprachlich positive Konnotation von „Vernetzung“ (als „horizontaler“ und daher per se besonders demokratie- oder solidaritätsaffiner Koordinationsform) wird in den Hintergrund gedrängt. Konkurrenz und Kooperation sollen sich verbinden, ohne dass das eine zum Vehikel des anderen wird. Wer in „strategische Netzwerke“ eintritt, bekennt sich zu einer erstaunlichen Mentalität. Er nährt in sich selbst und allen anderen Netzmitgliedern die Hoffnung, immun gegen Illusionen zu sein. Die beiden Grundelemente Konkurrenz und Kooperation, die wohldosiert und ausgewogen sein müssen, damit die Netzwerkchemie stimmt, werden von den Akteuren zugleich als unverzichtbar und mangelhaft erkannt und anerkannt. Diese erhebende Einsicht kann übermütig machen und Meta-Illusionen über Stabilität und Resistenz 2 In der industriesoziologischen Forschung zu Netzwerken wird die Koppelung von unternehmensinterner und unternehmensexterner Restrukturierung herausgestellt; vgl. etwa Semlinger (1993) und Köhler (2000). 3 Damit geht eine Abgrenzung von ephemeren „ein-Punkt-Netzwerken“ einher, in denen eher taktische Gesichtspunkten vorherrschen. Als typische Beispiele hierfür gelten Projektnetzwerke und virtuelle Organisationen. 4 Das Kriterium der Freiwilligkeit lässt es problematisch erscheinen, ausgerechnet Franchising und Zulieferindustrien als typische Fälle von vernetztem Wirtschaften zu betrachten. Heidling (2000) trägt diesem Problem dadurch Rechnung, dass er auf eine vorgelagerte Fragestellung fokussiert, und zwar auf die Frage nach der Herstellung von Verhandlungsfähigkeit auf Seiten der machtunterlegenen Akteure. 5 Die bekannte Definition von Sydow (1992: 82) lautet: „Ein Unternehmensnetzwerk stellt eine auf die Realisierung von Wettbewerbsvorteilen zielende Organisationsform ökonomischer Aktivitäten dar, die sich durch komplex-reziproke, eher kooperative denn kompetitive und relativ stabile Beziehungen zwischen rechtlich selbständigen, jedoch zumeist wirtschaftlich abhängigen Unternehmen auszeichnet“. 2 der konstruierten Verbindung erzeugen. Eine Abgeklärtheit, die man sich wortlos wechselseitig bescheinigt, erregt Begeisterung. Der modische Kult um die Netzwerke ist mithin kein Zufall. Die Probleme sind durchschaut und wirken deshalb trivial. Und das einmal trivial Gewordene – selbst wenn es kurz zuvor noch als paradoxe Angelegenheit erschien – kann man leicht ignorieren. Doch unter allen möglichen Netzwerken sind und bleiben gerade die sog. strategischen die mit Abstand fragilsten Gebilde. Dass sie ausdrücklich auf Dauer angelegt sind und ihren Anhängern damit gleichsam ein ‚Struktur-Versprechen’ geben, ändert daran nichts. Es ist vielmehr die Ursache ihrer Krisenanfälligkeit. Wenn sie gelingen, bringen sie den Beteiligten höchste Gewinne, wenn sie Scheitern peinliche Verluste. ‚Strategische Netzwerke’ setzen durch ihre Ambitionen sich selber und ihre externen wissenschaftlichen Beobachter unter Druck. Ohnehin sind die Forscher, die sich den Netzwerken widmen, beständig mit der Frage nach dem grundlegenden sozialen Mechanismus befasst, der die Kopplung zweier so gegensätzlicher Phänomene wie Konkurrenz und Kooperation ermöglicht. „Strategische Netze“ spitzen diese Frage nur noch weiter zu; denn sie erheben den Anspruch, die ephemere Liaison, deren Reiz niemand in Abrede stellt, in eine ewige Orgie zu verwandeln. Welche theoretischen Modelle sind der Sache angemessen? Das Grundproblem ist klar und wird von den Netzwerktheoretikern bis zur Ermüdung repetiert. Auch wir wollen es uns noch mal vor Augen führen: Strategische Netzwerke halten sich nicht an die gängige idealtypische Trennung von Organisation und Markt. Sie überführen die antagonistischen Beziehungen der rationalen Marktegoisten in langfristige (also unvermeidlich ergebnisoffene) Beziehungen. Zugleich aber untergraben sie die Stabilität und Dauerhaftigkeit der klassischen (hierarchischen) Organisation durch kompetitive Zugaben. Diesem eigentümliche ‚Zwischencharakter’ wird in der Netzwerkforschung durch Wortschöpfungen wie „kooperative Wettbewerbsbeziehungen“ (Ortmann/Schnelle 2000) oder „antagonistische Kooperation“ (Heidling 2000) Kontur verliehen. Sein Status ist damit freilich nicht geklärt. Auf die Frage, worin die ‚Substanz’ von Netzwerken liegt, hat die Forschung eine Reihe von Antworten gegeben, unter denen drei den Diskurs besonders nachhaltig geprägt haben: Der ersten, am entschiedensten im Transaktionskostenansatz vertretenen Position zufolge handelt es sich bei sozialen Netzwerken um „Hybride“ zwischen Markt und Hierarchie, also – dem buchstäblichen Wortsinne nach – um Mischphänomene, die sich aus eigener Kraft nicht reproduzieren können (vgl. Williamson 1985). Der zweiten Position zufolge handelt es sich bei sozialen Netzwerken um ein eigenständiges 6 soziales Phänomen, das dann auch mit einer originären Begrifflichkeit und entsprechenden Untersuchungsmethoden zu erschließen ist. Dabei rückt die Vertrauensproblematik ins Zentrum. Vertrauensbasierte Interaktion wird als ein flexibler und durch die reziproke Bindung gleichwohl dauerhafter Koordinationsmechanismus eingeführt, der die sog. „Organisationslücke“ von Netzwerken überbrückt. Auch die dritte Position erklärt soziale Netzwerke zu einer Sozialform eigener Art, setzt allerdings einen anderen Schwerpunkt. Powells bekannte Formulierung „neither market nor hierarchy“ (Powell 1990) lenkt die Aufmerksamkeit auf den informellen Charakter und die kommunikative Dichte von Netzwerkstrukturen. Zahlreiche Aussagen, die im Rahmen dieser Position getroffen werden, führen allerdings dazu, dass das Forschungsobjekt ‚Netzwerk’ Die Frage „eigenständiges oder hybrides Phänomen?“ wird abgehandelt bei Krebs/Rock (1997) und Winkler (1999: 43-49). 6 3 seine analytische Prägnanz verliert7, überdies gerät es zur sozialen Grundform, die angeblich die Keime all dessen in sich trägt, was sich später von ihr scharf unterscheidet.8 Während die erste und die dritte Position das Ausgangsproblem der Netzwerke (durch Einengung und Überdehnung) zum Verschwinden bringen9, versucht die zweite den Mechanismus aufzuspüren, dem die Netzwerke ihre Sonderstellung verdanken. Dieser Ansatz hat in den letzen Jahren immer mehr Zustimmung gefunden und dominiert gegenwärtig die Szene.10 Der Leitbegriff „Vertrauen“, an dem sich der mainstream der Netzwerkforschung zur Zeit abarbeitet, visiert – wie wir glauben – in der Tat den neuralgischen Punkt der Netze an. Und dies gilt speziell für strategisch Netzwerke. Sie beruhen auf Vertrauen und stellen es zugleich permanent auf die Probe. Damit öffnen sie sich für Perspektiven, die dem Misstrauen einen gebührenden Platz einräumen. Für diese gleichsam strukturbildende Operation gibt es aber weder in den Selbstbeschreibungen der Netzakteure noch in den Fremdbeschreibungen der Netzforscher Kategorien, die das komplexe Zusammenspiel von Vertrauen und Misstrauen in Netzwerken erfassen. Der folgende Text möchte hier, wenn schon nicht auf einen Schlag Abhilfe schaffen, so doch wenigsten die Richtung angeben, in die man gehen müsste, um besseren Analysestrategien und schließlich auch Ideen für geeignete Unterstützungssysteme zu finden. Dabei ist in einem ersten Schritt die Arbeit an den Begriffen, die im herrschenden Diskurs in Umlauf sind, erforderlich. Wir wollen zunächst prüfen, was die allgemeine Soziologie über Vertrauen und Misstrauen zu sagen hat, sodann vielversprechende neuere organisationstheoretische Befunde hinzuziehen und schließlich ein eigenes Konzept vorschlagen. Das Ziel ist dabei nicht, die Vereinheitlichung der Netzwerk-Terminologie voranzubringen. Im Augenblick dürfte etwas mehr gehobener Streit der Sache dienlicher sein. Auch die brennende Frage, ob wir es beim Trend zur Vernetzung „mit einer konvergenten oder divergenten Entwicklungsdynamik zu tun haben“, oder ob sich gar ein neues „one best model“ herausbildet (Voskamp/Willke 1997: 216) wollen wir einstweilen auf sich beruhen lassen. 2. Soziologie des Vertrauens Die Kategorie Vertrauen zählt nicht zu den Kernbegriffen der Soziologie. Während die Literatur zu den prominenten Gegenständen des Fachs unüberschaubar geworden ist, lassen sich die gehaltvollen Beiträge zum Thema Vertrauen durchaus noch bewältigen. Die Zahl der 7 Die These ist, dass normalerweise Mehrfachvernetzungen vorliegen und dass die Grenzen von Netzwerken sich in einem ständigen Fluss befinden (White 1992). 8 Mit Blick auf den neoinstitutionalistischen Kern dieser Position kommen Hasse/Krücken (1999) zu dem Schluss, dass Netzwerke als Grundlage aller modernen Sozialformen anzusehen sind, da sich Marktbeziehungen und formale Organisationen aus primordialen sozialen Verflechtungen überhaupt erst herausbilden. 9 Die erste Position macht Netzwerke zu seltenen Gebilden, die nur eine kurze Lebensdauer haben, die zweite Position hingegen weitet die Eigenart von Netzen zur ‚Natur’ des Sozialen aus. 10 Die vorgenommene Einteilung in drei Grundpositionen ist eine gewisse Stilisierung, die allerdings durch die unübersichtliche Lage bei der Konzeptionalisierung von sozialen Netzwerken nachgerade erzwungen wird. So stehen die beiden wohl einflussreichsten Konzeptionen der deutschsprachigen Netzwerkforschung nochmals orthogonal zu diesen drei Grundpositionen: Die organisationstheoretische Definition von Sydow stellt Netzwerke zwar neben Märkte und Hierarchien, eine „grundsätzlich neue, zusätzliche Qualität dieses Koordinationsmechanismus“ (1992: 102) vermag er „jedoch nicht zu erkennen“. Dagegen hatte Semlinger Netzwerke durch „Kooperation“ –„einer eigenständigen Koordinationsform zwischen Markt und Hierarchie“ (1993: 312) – definiert, ohne allerdings das Wechselspiel von Kontrolle und Abhängigkeit auf Vertrauen zu beziehen. 4 Autoren, die sich geäußert haben, hält sich in Grenzen.11 Und es sind Stimmen darunter, die in der Disziplin Gewicht haben: Simmel, Parsons12, Blau, Garfinkel, Luhmann, Coleman, Giddens. Dennoch ist es nicht gelungen, eine einheitliche Konzeption zu entwickeln. Das wäre per se kein beklagenswerter Zustand. Theorien-Konkurrenz belebt das wissenschaftliche Geschäft. Aber die etablierten Differenzen trugen zur Entfaltung der Ansätze nichts Wesentliches bei, sondern paralysierten eher die Diskussion. Mit dem Aufkommen der Netzwerktheorie, die soziale Ordnungstypen mit besonders hohem Vertrauenspegel untersucht, bildete sich daher rasch die Erwartung, dass in diesem Punkt jetzt Abhilfe geschafft werden könne. Doch die begriffliche Konfusion nahm zu. Bisher hat weder die theoretisch-konzeptionelle noch die empirisch fundierte Literatur zu Netzwerken einen erheblichen Beitrag zur Engführung der Kontroversen geleistet, die die Vertrauenstheorien prägen. Die wichtigsten Impulse für neue und integrale Modelle kommen zur Zeit aus der Organisations- und Management-Literatur. Das ist erstaunlich, denn Netzwerke weisen eine Reihe von Eigentümlichkeiten auf, aus deren Beobachtung sich Kriterien ableiten ließen, die die festgefahrenen begrifflichen Fronten auflösen könnten. 2.1 Der Status von Kalkülen Zunächst einmal dürfte die Frage, ob (und – wenn ja – in welchem Sinne) Vertrauen als Kalkül gelten darf, einer Beantwortung näher rücken, sobald die Funktionsweise von Netzwerken genauer bestimmt wird. Denn Netzwerke lassen sich als Testarenen auffassen, in denen Vertrauensformen, die ordnungsbildende Kraft entfalten, von Vertrauensformen, die keine innovativen Potentiale besitzen, zu unterscheiden sind. Sollte es sich zeigen, dass ein kalkülfrei operierendes Vertrauen in Netzwerke keine relevante soziale Leistung erbringt, dann würden sich semantische Querelen um die angemessene Verwendung des Begriffs erübrigen. Ein kalkül-bezogener Vertrauensbegriff hätte seine Feuertaufe bestanden. Das Gleiche würde selbstverständlich auch im umgekehrten Fall gelten: Sollten kalkül-basierte Vertrauensinvestitionen genau das unterminieren, was durch Vertrauen angeblich ermöglicht wird, nämlich kooperatives und erfolgreiches Handeln mit Partnern, deren Aktionen und Reaktionen nicht zu kontrollieren oder beherrschen sind, dann wäre das Projekt der Begriffsklärung ebenfalls zu einem vernünftigen Ende gekommen. Zu prüfen bliebe nur noch, ob man tatsächlich bestimmte Akte der Vertrauensvergabe untersucht oder nur die Rhetorik des Vertrauens in Augenschein genommen hat, und weiterhin, ob ein solch altbackener Unterschied zwischen Fakten und Fiktionen im Hinblick auf die sozial-konstruktive Grundierung von Vertrauen gar keinen Sinn mehr ergibt.13 Welche Rolle Kalküle beim Aufbau von sozialen Gebilden spielen, die äußerst fragil, aber auch besonders effizient sind, lässt sich erst sagen, wenn hinreichend sicher ist, dass es solche Gebilde überhaupt gibt und wir es nicht etwa mit Vorgängen zu tun haben, deren ‚wirkliche’ Funktionsweise eine modische Ideologie bemäntelt, die sich früher oder später blamieren wird.14 Aber selbst dann, wenn aus der Warte externer Beobachter verschiedene Indizien in 11 Vgl. etwa die Sammelbände Gambetta (1988), Tyler/Kramer (1996), Sitkin/Rousseau/Burt/Camerer (1998), Lane/Bachmann(1998), die Monographien von Luhmann (1968, 1989³), Barber (1983), Waschkuhn (1984), Petermann (1985, 1996³), Sako (1992), Brown, (1994), Bianco (1994), Fukuyama (1995), Seligman, (1997), Ripperger (1998), Sztompka (1999), Shionoya, (2001) und den monographieartigen langen Essay von Zucker (1986). 12 Die zahlreichen impliziten Bezüge auf Vertrauen im Werk von Parsons hat Barber (1983) ausgearbeitet. 13 Vgl. hierzu die Überlegungen von Dasgupta (1988), der (im Rahmen seiner Vorschläge zur ‚Kalkülisierung’ des Vertrauens) strikt trennt zwischen dem Eindruck von Vertrauen und dem Vertrauen selbst. 14 So argumentieren z.B. Autoren, die Netzwerke für Phänomene halten, deren markt- oder organisationsförmiger Charakter durch eine verführerische Propaganda den Blicken entzogen worden ist, aber beim ersten besten Problem an den Tag kommt. 5 diese Richtung zeigen sollten, ist noch Vorsicht geboten. Denn die soziale Schwerkraft von Wunschbildern und Projektionen ist erheblich. Sie können im Laufe der Zeit eine Realität schaffen, die immun ist gegen eine Kritik, welche nur auf eine fragwürdige Genesis hinweisen kann, ohne die aktuelle Geltung in Rechnung zu stellen. Das Thomas-Theorem15 liefert eine gut begründete Warnung vor übereilten Aufklärungsaktionen, denen harte Strukturen alles, fluide Semantiken aber nichts bedeuten. Dass die Vertrauenssoziologie sich an der Kalkülfrage festgebissen hat, liegt nicht zuletzt an der Funktion, die die Kategorie ‚Vertrauen’ in konkreten Analysen eines soziologisch beachtlichen Problems hat. Ob man das mehr oder minder erstaunliche Vorkommen von Vertrauen erklären will oder unverständliche Verhaltensweisen auf etwas (eben Vertrauen) zurückführen will, dessen Evidenz schlagend ist, entscheidet darüber, wie die Bedeutung des Begriffs bestimmt wird. Während die einen mit Hilfe des Vertrauensbegriffs darlegen, dass das Unwahrscheinliche geschehen und sogar zur Routine werden kann (z.B. Luhmann), versuchen die anderen zu demonstrieren, wie die Verankerung im Wahrscheinlichen das Vertrauen überhaupt erst in Gang bringt (z.B. Coleman). Freilich liegen mit den frühen Studien von Morton Deutsch über Konflikt, Vertrauen und Verdacht 16 Analysen vor, die sich in dieses heute vorherrschende Schema nur bedingt einfügen lassen. Deutsch versucht nämlich, die eher unwahrscheinliche und erstaunliche Vertrauensgabe begreiflich zu machen, indem er die Figur der subjektiven Wahrscheinlichkeit ins Spiel bringt. Bevor diese raffinierte Konzeption diskutiert werden kann, müssen zunächst einige Grundelemente der allgemeinen Vertrauenstheorie eingeführt werden. Äußerst wichtig ist es, sich klar zu machen, dass Vertrauen ein Phänomen darstellt, bei dem Erleben und Handeln zusammenwirken. Wer vertraut, wählt nicht die Rolle des kontemplativen, passiven Weltbeobachters. Er fällt nicht allein ein Urteil über Personen oder Sachverhalte und deren zukünftige Verhaltensweisen oder Zustände, sondern er verstrickt sich aktiv in die aktuellen Verhältnisse und Konstellationen, deren weitere Entwicklung nicht übersehbar ist. 17 Und er tut dies, obschon er mit aller Deutlichkeit sieht, dass ihm „daraus auch Nachteile erwachsen können“ (Deutsch 1976: 136). Derartiges Handeln löst aber noch keine Verwunderung aus, denn es ist Teil des sozialen Alltags und einer common-sense-adäquaten Praxis, die für Irritationen wenig Raum lässt. Erstaunlich (ja vielleicht sogar unvernünftig) erscheint Vertrauen erst, wenn man in ihm ein Engagement oder eine Investition sieht, zu denen sich ein Subjekt bewegen lässt, obwohl der mögliche Nutzen oder Gewinn geringer ist als der mögliche Schaden oder Nachteil. Ein solcher Fall, über dessen empirische Häufigkeit natürlich gar kein Zweifel besteht, schafft Erklärungsbedarf. Warum aber wird der Vertrauensbegriff für diese spezifische Klasse riskanter Entscheidungen und Handlungen reserviert und nicht ein weiter Begriff benutzt, der die Möglichkeit eröffnet, Vertrauen auch als „schlichten und durchaus kaltherzigen Kalkül“18 zu sehen. Das Kernargument der Verfechter eines engen Begriffs lautet folgendermaßen: Warum sollte ein so merkwürdiger Anschubmechanismus wie Vertrauen aktiviert werden, wenn man durch rationale Abwägung möglicher Vorteile und Schäden zu dem Schluss gelangt, dass die Realisierung von Gewinnen wahrscheinlicher ist als das Eintreten von Verlusten? Mit der Zur Erinnerung: „If men define situations as real, they are real in their consequences.“ Das Buch The Resolution of Conflict (1973; dt. 1976) enthält Texte zum Vertrauen, die überwiegend zwischen 1958 und 1962 erschienen sind. 17 Es ist daher wenig sinnvoll, mit Ripperger „zwischen Vertrauen als subjektiver Erwartungshaltung und Vertrauen als sichtbarem kooperativem Verhalten“ zu unterscheiden (1999: 90). Eine Person, die Vertrauen in eine andere Person oder ein System hat, nimmt Investitionen vor, falls sie über Ressourcen verfügt. Gleichwohl ist die Unterscheidung analytisch von Nutzen. Sie lässt sich nämlich bei der Analyse des Misstrauens einsetzen. 18 So umschreibt Kay Junge (1998: 26) Colemans Konzept. 15 16 6 Vokabel ‚Vertrauen’ wird doch auf eine (zusätzliche) Motivationsinstanz verwiesen19, die nur nötig ist, wenn die Chancen gering sind und deshalb hohe Barrieren überwunden werden müssen. Vertrauen sorgt dafür, dass auch dann noch gehandelt wird, wenn (aus der Perspektive eines mögliche Gewinne und Verluste abwägenden Subjekts) fast alles dagegen spricht. Wie aber lässt sich im Rahmen dieser Beschreibung die Vergabe von Vertrauen erklären? Lassen sich dafür plausible Gründe anführen oder ist die Gewährung von Vertrauen ein spontanes, gänzlich unberechenbares Phänomen, das auf die Bedeutung des Unverfügbaren im Leben der Menschen verweist? Aus soziologischer Warte wäre es z.B. recht unbefriedigend, wenn sich die Ursachen für erwiesenes Vertrauen auf die ersten sieben „Umstände für Vertrauenseinstellungen“ reduzieren ließen, die Morton Deutsch aufgezählt und erläutert hat. Es gibt Vertrauen „aus Verzweiflung“ (1), „aus sozialer Anpassung“ (2), „aus Arglosigkeit“ (3), „aus Impulsivität“ (4), „aus Tugend“ (5), „aus Masochismus“ (6) und „aus Glauben“ (7). Ein Spezialfall ist für Deutsch dasjenige Vertrauen, welches im Zusammenhang von „Risikoverhalten oder Spiel“ (8) auftritt. Ein ‚echter’ Spieler wird, im Unterschied zu einem Vertrauensgeber, verlustreiche Investitionen eben nicht bedauern, sondern auch im Schadensfall den Reiz der Spielsituation auskosten.20 Die Differenz zwischen „gambler“ und „trustor“ scheint scharf zu sein, und doch kommt es hier leicht zu falschen Selbstdeutungen: Manche Akteure halten sich für Spieler, die ihre Chancen genau kalkulieren und Risiken bewusst eingehen, weil die Gewinne verlockend sind, aber in Wirklichkeit gründen sie ihr Vertrauen nur auf einen schlechten Rat: „Sometimes ... people misjudge their own evaluations of the significance to them of losing and act as though they are gambling when, in fact, they are trusting ill-advisedly“ (Deutsch 1973: 148). Die letzte und für Deutsch relevanteste Form des Vertrauens beruht auf Zuversicht (9): Jemand agiert vertrauensvoll, „because he has confidence that he will find what is desired rather than what is feared“ (Deutsch 1973: 148). Zuversicht/confidence wird von Deutsch also nicht nur als eine Einstellung betrachtet, die riskante Handlungen und Investitionen auch dann ermöglicht, wenn der Akteur sich darüber im Klaren ist, dass sein Tun „möglicherweise Konsequenzen hat, die die möglichen positiven Konsequenzen übertreffen“ (Deutsch 1976: 136)21, Zuversicht ist auch diejenige Einstellung, die für die Integration moderner Gesellschaften besonders wichtig ist. Sie verdient deshalb eine tiefergehende Analyse als die übrigen Einstellungen, welche ebenfalls die handlungshemmende Wirkung aufheben, die das Ungleichgewicht zwischen Nutzen und Schaden ausübt. Deutsch definiert Zuversicht als die subjektive Wahrscheinlichkeit („subjective probability“), dass aus den Handlungen, Investitionen oder Vorleistungen eines Akteurs eher Ereignisse mit positiv motivierender Bedeutung resultieren als Ereignisse mit negativ motivierender Bedeutung.22 Der Umstand, dass der mögliche Schaden den angestrebten Nutzen übertreffen kann, ist für Deutsch kein Grund, um Vertrauen nicht als eine Art Kalkül zu betrachten.23 19 Die Netzwerktheoretiker Loose/Sydow streichen diesen Punkt besonders heraus und weisen mit Blick auf Axelrod (1984) darauf hin, dass ein „Kooperationsmodell unter Unsicherheit ... sich möglicherweise auch gänzlich ohne die Hinzuziehung des Vertrauensbegriffs erfassen lässt“ (1997: 325). 20 Der mögliche Schaden, der sich aus einem Akt des Vertrauens ergeben kann, hat einen anderen Status als der Schaden, den ein Spieler einkalkuliert und zu tragen bereit ist: „Man darf nicht übersehen, dass der Schaden, der dem vertrauenden Individuum erwächst, wenn sein Vertrauen unerfüllt bleibt, kein gewöhnlicher Schaden ist im Verhältnis zum Nutzen, der aus dem Vertrauen bzw. aus dem erfüllten Vertrauen erwachsen kann“ (Deutsch 1976: 136). 21 Wie die anderen genannten Einstellungen hebt confidence die handlungshemmende Wirkung auf, die das Ungleichgewicht zwischen Nutzen und Schaden hervorruft. 22 Vgl. dazu „Definition 4“ von „Trust“ (Deutsch 1973: 149). 23 Dies ist auch in der Netzwerkliteratur bei der Rezeption gängiger Vertrauenstheorien hervorgehoben worden: „Vertrauen ist bei Deutsch ... das Ergebnis eines subjektiv-rationalen Kalkulationsprozesses“ (Loose/Sydow 7 Diese Position hat Luhmann (1968/1989³; 1988), der sich in vielen Punkten auf Deutsch bezieht, preisgegeben. Genau wie Deutsch geht er zwar davon aus, dass Vertrauen nur in einer Situation möglich ist „where the possible damage may be greater than the advantage you seek“. Aber er begründet diese semantische Festlegung mit einem Argument, das mit Deutschs Konzept nicht kompatibel ist: „Otherwise, it would simply be a question of rational calculation and you would choose your action anyway, because the risks remain within acceptable limits. Trust is only required if a bad outcome would make you regret your action“ (Luhmann 1988: 98). Man könnte versucht sein, diese auffällige Dissonanz, über die Luhmann übrigens kein Wort verliert, zu beseitigen, indem man auf den Unterschied zwischen einer Kalkulation, die psychologisches Wissen verwendet, und einem streng ökonomischen Kosten-Nutzen-Kalkül insistiert.24 Der subjektiv-rationale Kalkulationsprozess, den Deutsch konstruiert, beruht auf der These, dass „Menschen auf die eine oder andere Art psychologische Theoretiker (sind) und psychologische Annahmen über andere auf(stellen), die den [von Deutsch] vorgebrachten ähneln“. Darüber hinaus vermutet Deutsch, dass „die Menschen“ nicht nur in Übereinstimmung mit seiner (bloß rekonstruktiv verstandenen) Theorie „handeln“, sondern zudem „denken, ... dass es andere genau so tun“ (1976: 142). Aber auch diese Unterstellung erklärt keineswegs, warum Personen, soweit ihre Beweggründe nicht unter das angeführte Sieben-Punkte-Programm fallen, bereit sind, riskante Vorleistungen zu erbringen, deren Ergebnisse möglicherweise ein heftiges Bedauern auslösen werden. Soziologisch interessant und verwertbar wäre nur eine Erklärung, die nicht allein den gesamtgesellschaftlichen Nutzen der individuellen Vertrauenswahl herausstreicht, sondern zugleich deutlich macht, worin der subjektive Vorteil für einen Akteur liegt, der die Schieflage im Verhältnis von Schaden und Nutzen ignoriert. Luhmann schlägt vor, die „Reduktion sozialer Komplexität“, die die Vergabe von Vertrauen unweigerlich nach sich zieht, als entscheidende Funktion riskanter Vorleistungen zu betrachten. Dieser These ist aber nur dann plausibel, wenn es zutrifft, dass die Komplexität der Welt die Akteure in einem höheren Masse irritiert als die unbehagliche Aussicht, vorgenommene Investitionen bedauern zu müssen. Vertrauen ist also eine nicht allein makrosozial notwendige, sondern auch akteursbezogen sinnvolle Täuschung über die Komplexität der Welt. Damit hat Luhmann ein Vertrauenskonzept vermieden, dass „Vertrauen in die Nähe irrationalen Verhaltens“25 rückt. Vertrauensvolle Akteure verhalten sich vielmehr unter funktionalen Gesichtspunkten vernünftig, ohne rationale Kalküle bemühen zu müssen, die die Handlungsfähigkeit auch in schwierigen Situationen erhalten, oder sich einfach ihren Trieben zu überlassen, die Subjekte zur Vertrauensinvestition drängen, weil allein so eine rasche Befriedigung gewährleistet ist. Luhmanns Rückgriff auf eine funktionalistisch rekonstruierbare Form von Rationalität wirft freilich einige Probleme auf. Neben grundsätzlichen Bedenken gegenüber funktionalistischen Erklärungen 26 ergeben sich Nachfragen, die auf die Figur der „funktionalen Äquivalenz“ zielen. Dieses theoretische Konstrukt soll den Vergleich zwischen unterschiedlichen (mitunter gar kontrastierenden) Phänomenen mit einem ähnlichen Leistungsspektrum ermöglichen. Wird der soziale Sinn des Vertrauens funktionalistisch gedeutet, so öffnet sich unweigerlich der Blick auf andere Möglichkeiten. Wenn jedoch zum Vertrauen hinsichtlich der Reduktion sozialer Komplexität 1997: 167). Allerdings lässt Deutsch es dabei nicht bewenden. Er zeigt auf, dass „auch andere Faktoren als die subjektive Wahrscheinlichkeit einen Einfluss ausüben können“. So z.B. die „Zeitperspektive“: „Je mehr Zeit zwischen dem möglichen Auftreten“ positiv bewerteter Ereignisse und negativ bewerteter Ereignisse liegt, „um so wahrscheinlicher wird sich das Individuum für eine Vertrauenswahl entscheiden“ (Deutsch 1976: 143). 24 Scheidt weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass „insbesondere die Betonung des ‚Bedauerns’ bei Eintritt des unerwünschten Ereignisses“ den Vertrauensbegriff, den Deutsch und Luhmann verwenden, „von einem ökonomisch-rationalen ab(grenzt)“ (Scheidt 1995: 298). 25 So Scheidt (1995: 299) unter Bezug auf Jon Elsters Diskussion der Theorie von Deutsch. 26 Vgl. Giddens 1976. 8 ein funktionales Äquivalent existiert27, so lässt sich mit dem Hinweis auf die spezifische Funktion des Vertrauens die Wahl einer riskanten Vorleistung, die die Asymmetrie zwischen Nutzen und Schaden ignoriert, weder logisch begründen noch genealogisch herleiten. Das Vertrauen, welches ein einzelnes Individuum investiert, entbehrt (folgt man Luhmanns Analyse) jeglicher kakulierbarer Rationalität. Es „beruht auf Täuschung“ (Luhmann 1989³: 33) oder ist – wie Giddens aus einer anderen theoretischen Perspektive formuliert hat – „ in a certain sense blind“ (Giddens 1990: 33). Worin aber liegt der Wert dieser Täuschung? Angesichts der funktional äquivalenten Möglichkeiten, auf das fundamentale Problem der Unsicherheit sowie des Informations- und Zeitmangels zu reagieren, scheint es keinen vernünftigen Grund zu geben, der Individuen veranlassen könnte, gerade auf Vertrauen als Mechanismus zur Reduktion sozialer Komplexität zu setzen. Es erhebt sich zwangsläufig die Frage: „Why can we trust trust?“ (Gambetta 1988b). Der funktionalistische Ansatz erlaubt nur eine Antwort: Die Rationalität des Vertrauens liegt nicht primär in der Investitionsentscheidung des einzelnen Akteurs, der sein Handeln im Schadensfall bedauern wird. Sie liegt in den emergenten Effekten, die durch das vertrauensvolle Handeln vieler Akteure hervorgerufen werden. Kalkülfreies Vertrauen hat daher von vornherein einen makrosozialen Wert, der sich hinter dem Rücken der ich-bezogenen Individuen (aber insgesamt zu deren Vorteil) realisiert. Freilich kann diese Einsicht in emergente Makro-Effekte nicht nur ein externer (soziologischer) Beobachter gewinnen, sondern auch jedes beteiligte Individuum. Wer den engen Horizont der eigenen Interessen reflexiv durchbricht und sich selbst als ebenso soziales wie egoistisches Wesen interpretiert28, erkennt auch ohne Rekurs auf moralische Normen leicht, dass die Pflege von vertrauensbasierten Beziehungsnetzen sinnvoll ist und letztlich auch auf dem Konto des Individuums zu Buche schlägt. Die Makroperspektive macht also der Blindheit vertrauensvoll agierender Akteure ein Ende. Sie kann gerade deshalb aber auch zum Element eines subjektiven Kalküls werden, der die Mikroperspektive nicht preisgibt, sondern nur erweitert.29 Es ist eine empirische Frage, ob und in welchem Umfang derartige systemische Aspekte in die Überlegungen der konkreten Akteure eingehen. Handeln und Erleben in Netzwerken dürfte hier der geeignete Forschungsgegenstand sein. Man wird klären müssen, welche Ansichten über den Zusammenhang von Individuum und Gesellschaft Personen hegen, die heute riskant investieren. In Anbetracht der bereits vorliegenden Netzwerkuntersuchungen spricht viel dafür, dass die Beteiligten über ein mehr oder minder intuitives Wissen verfügen, dass Soziologen folgendermaßen in Worte fassen würden: Der Grad an individueller Rationalität, der unter Bedingungen des „Gefangenendilemmas“ (man könnte in einer anderen Theoriesprache auch sagen: unter Bedingungen statischer „doppelter Kontingenz“) erreicht werden kann, ist gesamtgesellschaftlich suboptimal. Riskante Vorleistungen einzelner Personen steigern deshalb Wohlstand und Wohlbefinden aller. Vorsicht ist jedoch bei Investitionen in Bereiche geboten, wo Bünde oder Kartelle die Austauschprozesse bereits kontrollieren oder sich nach der Etablierung eines präsumtiv vertrauensvollen Kooperationsgeflechts rasch ausbilden. 27 Wir kommen bei der Behandlung des Misstrauens (das die Rolle des funktionalen Äquivalentes übernimmt) auf diesen Punkt zurück. Die Lösung des funktionalistischen Erklärungsdilemmas liegt nämlich darin, beide Möglichkeiten zu wählen und sie dann mit- und gegeneinander zu steigern. 28 Angehörige von Netzwerken verfügen über eine solche Doppelperspektive. 29 Dieser Befund lässt sich zwanglos mit der von zahlreichen Forschern geteilten Annahme verbinden, „that trust may be a ‚meso’ concept, integrating microlevel psychological processes and group dynamics with macrolevel institutional arrangements“ (Rousseau et al. 1998: 393). 9 Als Fazit der bisherigen Darlegungen können wir festhalten, dass die speziell von Luhmann vorgetragenen Argumente für einen engen Vertrauensbegriff30 ebenso wenig überzeugend sind wie das Plädoyer für ein Begriffsdesign, das auf Kalküle31 und Formalismen verzichtet. Das einfachste, eleganteste und zugleich für Erweiterungen und Präzisierungen offenste Konzept, Vertrauen als Kalkül zu beschreiben, hat James Coleman (1990; dt. 1991) vorgelegt. Eine Vertrauensinvestition lässt sich mit Coleman als eine Art „Wette“ verstehen. Der Akteur handelt nicht primär unter Bedingungen von Unsicherheit32, sondern er kalkuliert sein Risiko, d.h. er operiert mit einem Wahrscheinlichkeitswert für die Vertrauenswürdigkeit des jeweiligen Vertrauensnehmers und setzt diesen subjektiven Schätzwert (p = probability) in ein Verhältnis zu dem antizipierten Gewinn (G = gain) und dem (im Falle des Vertrauensbruchs) erwartbaren Verlust (L = loss). Die inzwischen berühmt gewordene Maxime lautet: Erweise Vertrauen, wenn p G größer ist als (1-p) L und verzichte auf die Gewährung von Vertrauen, wenn p G kleiner ist als (1-p) L.33 Anders als Deutsch und Luhmann, die die besondere Bindungskraft34 des Vertrauens u.a. dadurch erklären, dass der Vertrauensgeber ein überproportional hohes Verlustrisiko eingeht, wählt Coleman also ein ‚ausgewogenes‘ Konzept.35 Ausführlich erläutert er die definitorische Verengung von Deutsch36 und präsentiert als Alternative ein neutrales Gewinn/VerlustModell. Auch Marsh, der einen ambitionierten Formalismus entwickelt, „which embodies the concept of truth“, folgt nicht dem Ansatz von Deutsch. Er wählt „a less extreme view“, weil er die Unterstellung, “that the harmful effects outweigh the positive ones” (Marsh 1994: 95) im Rahmen einer Modellierung von Vertrauen für unangemessen hält.37 30 Junge (1998) hingegen hat in seinem Vergleich zwischen dem rational choice Konzept von Vertrauen und dem systemtheoretischen Modell Luhmanns Argumentationslinie unterstützt. 31 Dass Luhmann seine Kritik an der ‚Kalkülisierung’ des Vertrauens nicht durchhalten kann und sich am Ende in Widersprüche verstrickt, zeigt Scheidt (1995: 344). Wir kommen bei unserer Diskussion der trust/confidenceUnterscheidung darauf zurück. 32 Dieser Fall ist spieltheoretisch zu erfassen (vgl. Preisendörfer 1995: 266) und ergibt zwei günstige Bedingungen für die Vertrauensvergabe: 1. Dauerhaftigkeit der Beziehung, „Gesetz des Wiedersehens“ (Luhmann 1989³: 39), 2. Reputation im sozialen Umfeld, Dichte der sozialen Nebenbeziehungen. 33 Siehe Coleman 1990, 100; dt. 1991, 126. 34 Reizvoll könnte der Versuch sein, die Gewährung von Vertrauen als eine Art Geschenk zu betrachten. Schenken ist ein ostentativer Akt, der die beteiligten Personen in unterschiedlicher Weise verwundbar macht und eine Logik der ‚Gabe’ (Mauss 1925/1950; Godelier 1996) in Gang setzen kann. Ein funktionierender Gabentausch setzt allerdings bestehende normative Strukturen bereits voraus, während riskante Vorleistungen (mit denen die Netzwerkgeschichte beginnt) oft den Zweck verfolgen, solche Strukturen in einer Welt voller Unsicherheiten erst zu schaffen. Im übrigen garantiert auch die Logik der Gabe – wie das Phänomen ‚Potlatch’ beweist – keine stabilen und wohltemperierten Verhältnisse. Dass Geschenke im Vorfeld der ‚eigentlichen’ Netzwerkkonstitution mitunter eine wichtige Rolle spielen können, wird selbstverständlich nicht bestritten. 35 Kay Junge hat gegen Colemans Kalkül eingewandt, dass er nicht dem „Alltagsverständnis von Vertrauen“ entspreche. Hier spiele die Unterstellung oder Einschätzung von Vertrauenswürdigkeit die entscheidende Rolle: Wenn wir Vertrauen erweisen, unterscheiden wir „sehr deutlich zwischen der Vertrauenswürdigkeit einerseits und dem zu erwartenden Gewinn bzw. Verlust andererseits und verrechnen diese Größen nicht miteinander. Der Vertrauenswürdigkeit eines Menschen [oder eines Systems] kommt beim Entschluss, Vertrauen zu schenken, im Alltag gewöhnlich eine höhere Bedeutung zu als Colemans Kalkül zu erklären vermag“ (Junge 1998: 51). 36 „Deutsch definiert vertrauensvolles Verhalten als Handlung, die die eigene Verwundbarkeit einer anderen Person gegenüber verstärken, deren Verhalten man in einer bestimmten Art von Situation nicht kontrolliert; diese Situation beinhaltet, dass der Verlust, den man erleidet, falls der andere (der Treuhänder) die Verwundbarkeit missbraucht, größer ist als der Gewinn, den man erzielt, wenn der andere die Verwundbarkeit nicht missbraucht“ (1991, 126). Dass die Erklärungskraft dieses Konzepts begrenzt ist, zeigt Coleman mit Hilfe seines instruktiven Hochstaplerbeispiels auf. 37 Weiter Vorschläge zur Formalisierung von Vertrauen finden sich bei Dasgupta 1988 (vgl. hierzu auch Scheidt 1995: 320ff.); Williamson 1993; Thimbleby (1994); Ripperger 1998; Matiaske 1999. Zur Diskussion informatischer Modellierungen von Vertrauen (z.B. bei Castelfranchi/Falcone 1999; Yu/Lin 2000 etc.) vgl. Gans et al. 2001. 10 Ripperger hat einige Vorschläge unterbreitet, um die existierenden Modellierungen des Vertrauens-Kalküls zu verbessern. Sie bemängelt an Colemans Modell38, dass hier nur das „Verhältnis zwischen potentiellem Schaden und Nutzen“, aber nicht die „absolute Höhe des potentiellen Schadens“ berücksichtig wird. Vertrauen „heißt Risiken eingehen und Risiken wachsen“ mit der Bedeutung, die die möglichen Nachteile für die Akteure haben (1998: 90). Eine Verfeinerung des Coleman-Kalküls – soviel ist gewiss – lässt sich auf mancherlei Wegen anstreben: Bachmann hat im Anschluss an Thimbleby (1994) einen (Rational-Choice-nahen) Katalog von Regeln zusammengestellt, denen ein strategisch operierender Agent folgen könnte, der mit der Unterscheidung Vertrauen/Misstrauen operiert und die Seite des Vertrauens als sinnvollere Konzeption wählt.39 Auch wenn man keinen Zweifel an der These hegt, dass Vertrauen einen rationalen Kern40 hat, der sich mit Hilfe eines Kalküls deuten und präzisieren lässt, so ist doch keineswegs sicher, ob Vertrauensakte sich vollständig durch Kalküle abbilden lassen. Zahlreiche empirische Studien haben Indizien dafür geliefert, dass Vertrauen nicht-instrumentelle Züge aufweist oder sogar einzig auf dem Boden nicht-instrumenteller Einstellungen gedeihen kann: Tyler/Kramer fassen die Ergebnisse neuerer Studien über „trust in organizations“ zusammen: „Evidence of the noninstrumental nature of people’s cooperation in social dilemmas is provided by the important role that identifications with the group plays in faciliating cooperation“ (1996: 5). Die beiden Autoren ziehen daraus den Schluss, dass „instrumental models are inadequate to explain people’s trust in others“ (1996: 6). Wie Colemans Kalkül jedoch zeigt, können Formalismen eine Größe enthalten, die die nicht-instrumentellen Aspekte des Vertrauens einbezieht.41 Die subjektive Einschätzung von Vertrauenswürdigkeit, die in Colemans Formel durch den Faktor p repräsentiert ist, darf als eine solche Größe 38 Dieser Vorwurf ist auch an Deutsch und Luhmann adressiert. „1. Gib stets eine Selbstbeschreibung deines Handelns, in der Du deine Motive offenlegst. 2. Formuliere positive Erwartungen in bezug auf das künftige Verhalten deines Gegenübers. 3. Formuliere Erwartungen über die Erwartungen, die dein Gegenüber in bezug auf dich selbst entwickelt. 4. Überprüfe die Häufigkeit deiner richtigen und deiner unrichtigen Erwartungen, indem du das Verhalten deines Interaktionspartners in gewissen zeitlichen Abständen auswertest. 5. Wenn sich eine Tendenz erkennen lässt, dass die Richtigkeit deiner gemachten Erwartungen zunimmt, dann indiziere dein Gegenüber mit einem Wert für X (= ‚Vertrauenswürdigkeit‘). Dieser Wert soll nach einer bestimmten Anzahl weiterer enttäuschungsfreier Interaktionen graduell erhöht werden. 6. Umgekehrt: Jede Interaktion, die mit einer Erwartungsenttäuschung endet, soll je nach der vorherrschenden Anzahl von enttäuschungsfreien Interaktionen mit dem jeweiligen Agenten mit einem Wert für Y (= ‚Vertrauensunwürdigkeit‘) belegt werden. 7. Verrechne den Vertrauenswürdigkeitswert mit dem Vertrauensunwürdigkeitswert des jeweiligen Agenten nach einem näher zu spezifizierenden Algorithmus, der nach einer besonders hohen Zahl von enttäuschungsfreien Interaktionen einen ‚no claim bonus‘ vergibt, also einen Enttäuschungsfall unbewertet lässt, und bei Enttäuschungen, die in kürzeren Zeitabständen erfolgt sind, den maximalen Vertrauensunwürdigkeitswert (bzw. minimalen Vertrauenswürdigkeitswert) einsetzt. 8. Kooperiere stets zuerst mit denjenigen unter den für deinen Zeck in Frage kommenden Mitagenten, denen du den höchsten Wert für ‚Vertrauenswürdigkeit (bzw. niedrigsten Wert für Vertrauensunwürdigkeit) zugerechnet hast. 9. Wäge das Risiko, betrogen zu werden, mit dem möglichen Nutzen ab, der für dich mit einer enttäuschungsfreien Interaktion verbunden sein kann, soweit du das im Voraus abschätzen kannst.“ (Bachmann 1998: 226f.) 40 Hardin (1993) spricht von dem im Vertrauen eingekapselten Interesse an einer rationalen Perspektive, die dazu dient, die Wahrscheinlichkeit abzuschätzen, mit der andere die eigenen Kooperationsofferten und Vorleistungen erwidern. 41 Diese Abschätzung kann folgende Elemente umfassen: „die Vorhersehbarkeit des Goodwills und der moralischen Integrität der Akteure“ (Loose/Sydow 1996: 188), die Reduktion sozialer Komplexität (Luhmann) oder ein allgemeines kulturelles Klima (wie z.B. die verbreitete Netzwerksemantik), welches Risikofreude und die damit verbundene Bereitschaft zu erheblichen Vorleistungen als besonders ‚chic’ und ‚innovativ’ bewertet. 39 11 betrachtet werden.42 Sie öffnet Spielräume der Interpretation, die je nach Situation von den Akteuren gefüllt werden können. Kalküle hemmen keineswegs per se die besonders für Netzwerke charakteristische Fähigkeit, „to move away from rational decision making to a more hermeneutic process“ (Piore 1995: 134). Sie bewahren vielmehr die freigesetzte hermeneutische Energie davor, die Realität zu vernachlässigen. Der hermeneutische Prozess führt nämlich nicht ohne weiteres zu vertrauensvollen Beziehungen, er kann ebenso gut Misstrauen aufkeimen lassen und paranoische Verschwörungsphantasien in die Welt setzen.43 Den Wert von Kalkülen innerhalb einer anspruchsvollen Vertrauenstheorie wird man erst beurteilen können, wenn man den Vertrauensbegriff differenziert (z.B. in trust und confidence bzw. in personen-orientiertes und system-orientiertes Vertrauen) und auf das Phänomen des Misstrauens bezieht. Überdies müssen sowohl die verschiedenen Vertrauensformen als auch das Misstrauen als dynamische Phänomene verstanden werden.44 Unter den Versuchen eine Dynamik des Vertrauens zu rekonstruieren, verdient wohl das Konzept von Lewicki/Bunker (1996) besondere Aufmerksamkeit: Mit Bezug auf eine Arbeit von Shapiro et al. (1992) schlagen sie ein Stufenmodell vor, das die Entwicklung von einfachen zu elaborierten Formen des Vertrauens beschreibt: „Trust evolves and changes. If relationship goes through its full development into maturation, the movement is from calculus-based45, to knowledge-based, to identification-based trust. However, not all relationships develop fully; as a result, trust may not develop past the first or second stage” (124). Selbst viele produktive Beziehungen kommen z.B. über die Stufe des wissens-basierten Vertrauens nicht hinaus, weil nicht genügend Zeit oder Energie in die Beziehung investiert wird. Generell lässt sich feststellen: Je entwickelter die Vertrauensbeziehung ist, desto größer ist auch die Fähigkeit der beteiligten Akteure, eine Verletzung des Vertrauens zu bearbeiten und das Vertrauen auf einer niedrigeren Entwicklungsstufe zu re-etablieren. Lewicki/Bunker vertreten zudem die These, dass beim Übergang von einer zur anderen Stufe ein Rahmenwechsel stattfindet. Im ersten Fall (dem Übergang vom kakül-basierten zu wissensbasiertem Vertrauen) wird die Orientierung an Kontrasten und Differenzen durch die Orientierung an Assimilationen und Ähnlichkeiten ersetzt. Im zweiten Fall (dem Übergang vom wissens-basiertem hin zum identifikations-basierten Vertrauen) „the shift is from simply Dies entgeht Junge gänzlich, denn er kommt zu dem Schluss: „Eigentlich benötigt Coleman den Begriff der Vertrauenswürdigkeit nicht wirklich“ (1998: 51, Anm. 62). Die Semantik des Colemanschen Vertrauenskonzepts erfüllt sich aber nicht darin, bloß positive und negative Effekte miteinander zu vergleichen, sondern auch folgenreiche Urteile über Interaktionspartner zu fällen. 43 Wie wichtig eine Arbeit an Konzepten ist, die sich den Sinn für Kalküle und Formalismen nicht nehmen lässt, zeigt der vage Begriff „swift trust“. Organisationskonzepte, die die ausgetretenen Theoriepfade verlassen, stoßen – wie man lesen kann – auf ungewöhnliche Formen des Vertrauens: „Organizations are moving away from formal hierarchical structures to move flexible and temporary grouping around particular projects. Such rapidly converging groups require methods for developing ‚swift trust’. Paradoxically, temporary groups often exhibit behavior that presupposes trust, without having any of the traditional sources of trust. This seeming paradox is resolved by the recognition of a new form of trust characteristic of such groups – swift trust.“ Die Probleme sind damit aber keineswegs verschwunden: Denn “such trust involves a series of hedges in which people behave in a trusting manner but also hedge to reduce the risks of betrayal” (Tyler/Kramer 1996: 8). Mit dem Begriff “swift trust” ist noch nicht gesagt, 1. um welche Art des Vertrauens es sich in diesen flexiblen und kurzfristigen Projektgruppen (innerhalb von Organisationen) handelt, 2. wie der Verdacht, betrogen zu werden, sich entwickelt und manifestiert und 3. welche Vorkehrung der Risiko-Eindämmung getroffen werden (müssen). 44 Vgl. hierzu auch das Plädoyer von Rousseau et al. 1998: 396. 45 Shapiro et al. hatten drei Typen des Vertrauens: „deterrence-based“, „knowledge-based“ und „identificationbased trust“ unterschieden. Lewicki/Bunker übernehmen dieses Schema in leicht modifizierter Form: sie bezeichnen jedoch den ersten Typ als „calculus-based-trust“ (1996: 119f.). Diese Gleichsetzung ist jedoch problematisch. Sitkin/Roth (1993) haben gute Gründe dafür angegeben, „that deterrence-based trust is not trust at all“ (vgl. Rousseau et al. 1998: 398). Die Figur des kalkül-basierten Vertrauens sollte für komplexere Zusammenhänge reserviert werden. Um dies vorzuführen, greifen Rousseau et al. Überlegungen auf, die Lewicki et al. in einer späteren Arbeit (1998) angestellt haben. Auf diesen wichtigen Punkt kommen wir bei der Thematisierung des Misstrauens zurück. 42 12 extending one’s knowledge about the other to a more personal identification with the other“ (125). Besonders interessant am Stufenmodell von Lewicki/Bunker ist die Vorstellung, dass „calculus-based trust“ gleichsam voraussetzungslos operieren kann. Es benötigt keinen normativen Rahmen oder sonstige kulturell codierte Bedingungen46, um Kooperationsmöglichkeiten zu schaffen. 2.2 ‚Trust’ und ‚Confidence’ Bei den Versuchen, verschiedenartige Typen von Vertrauen zu beschreiben und in ein entwicklungslogisches Konzepte einzufügen, wird immer wieder – teil implizit, teils explizit – zwischen einem eher kognitiv bestimmten und einem eher auf diffusen Hintergrunderwartungen beruhendem Vertrauen differenziert. Mit dieser Differenzierung ist oft die Vorstellung von einer fundamentalen Polarität zwischen konkreten und abstrakten, nahweltlichen und raum-zeitlich distanzierten Beziehungen verbunden. Wichtig sind die genannten Unterscheidungen und ihre Konnotationen, weil sie etwas über die Funktion der Vertrauenstheorie für die allgemeine Theorie der sozialen Integration aussagen. M.a.W.: sie gewinnen ihre Bedeutung erst im Zusammenhang mit den zeitdiagnostischen Befunden zur Lage der gegenwärtigen Gesellschaft und ihrer Entwicklungstendenzen. Je nach dem, ob Werte und Normen, kommunikativ gestiftete Formen der ‚verbindlichen Unverbindlichkeit’ oder normalistische Orientierungen47 als die entscheidenden und vorherrschenden Integrationsmechanismen gelten, werden die konkreten und abstrakten Aspekte von Vertrauensbeziehungen betont und gewichtet. Wenn es zutrifft, dass die spätmoderne Gesellschaft durch Prozesse des „disembedding“ (Giddens 1990: 17) gekennzeichnet ist, die zur Umstrukturierung menschlicher Beziehungsmuster führen und kompensatorische Anstöße zum „reembedding“ (1990: 79) geben48, dann ist es unumgänglich, eine basale Unterscheidung zwischen personenorientiertem Vertrauen und „trust in abstract systems“ (1990: 83) zu treffen. In diese Differenz muss dann ein angemessenes Konzept von Vertrauenswürdigkeit und Kalkulierbarkeit eingeschrieben werden. Giddens versucht den Ansprüchen, die seine Ausgangsdiagnose impliziert, zu genügen, indem er die Rolle von Experten und Expertensystemen herausstellt: „In conditions of modernity, the future is always open ... This counterfactual, future-oriented character of modernity is largely structured by trust vested in abstract systems49 – which by its very nature is filtered by the trustworthiness of established expertise”. Es geht heute nicht mehr wie in der Vormoderne um die Erzeugung eines „sense of security about an independently given universe of events. It is a matter of the calculation of benefit and risk in circumstances where expert knowledge does not provide that calculus but actually creates … a universe of events, as a result of the continual reflexive implementation of that very knowledge” (1990: 84). Giddens verwendet also den Begriff Kalkül, um die spezifische Form des Systemvertrauens zu explizieren. Damit Vertrauen als eine Art ‚Berechnung’ von Nutzen und Risiken funktioniert, muss zuvor das Wissen von bestimmten, in der Regel anonym bleibenden Personen als vertrauenswürdig eingeschätzt werden. Das für die Spätmoderne typische (und erforderliche) Vertrauen ist zweistufig gebaut: anders als in Colemans Theorie ist der Schätzwert für Vertrauenswürdigkeit nicht Teil des Kalküls, sondern bildet die notwendige (wenn auch nicht hinreichende) Voraussetzung, 46 Auf die Relevanz solcher Bedingungen hat speziell Preisendörfer (1995: 268ff.) hingewiesen. Zur Diskussion dieser drei Möglichkeiten vgl. Ellrich 2001a. 48 Vgl. dazu die Darlegung des Problems bei Kramer/Tyler: „American society is moving away from supporting long-term social connections”. Im Privatleben ebenso wie im Beruf „people increasingly cannot count on loyalty to others as a basis for reciprocity. (…) In a world without …reciprocal obligations, it is hardly surprising that people are interested in learning how to negotiate effectively to protect their self-interests“ (1996: 3). 49 Bereits Simmel war in seinen Bemerkungen zum Vertrauen (1908) von dieser Transformation ausgegangen. 47 13 die hergestellt sein muss, damit die Berechnung von Vor- und Nachteilen überhaupt zu praktikablen Ergebnissen führt. Colemans Formel kann – im Lichte von Giddens’ Strukturationstheorie – dieses Bedingungsgefüge nicht exakt abbilden, weil sie die Gleichrangigkeit und Gleichwertigkeit der im Kalkül verknüpften Faktoren suggeriert. Freilich ist Giddens wichtige Analyse nicht in erster Linie eine Auseinandersetzung mit dem RC-Ansatz, sondern eine Antwort auf Luhmanns Theorie des Vertrauens. Luhmann, der in seiner ersten Arbeit zum Thema Vertrauen (1968/1989³) die Unterscheidung von persönlichem Vertrauen und Systemvertrauen50 besonders deutlich gemacht hat, verfeinert in einem Aufsatz von 1988 sein frühes Konzept. Er unterscheidet zunächst zwischen „familiarity” und „trust”: „Familiarity is an unavoidable fact of life 51; trust is a solution for specific problems of risk“ (1988: 95). In einem zweiten Schritt wird dann „trust“ (Vertrauen) von „confidence“ (Zuversicht) geschieden.52 „Both concepts refer to expectations which may lapse into disappointment. The normal case is that of confidence (...).If you do not consider alternatives …, you are in a situation of confidence. (…) Trust, on the other hand, requires a previous engagement on your part. It presupposes a situation of risk” (1988: 97). „Confidence“ sorgt dafür, dass Enttäuschung der Umwelt oder anderen Personen zugerechnet werden und potentielle negative Ereignisse als drohende Gefahren erscheinen.53 „Trust“ passt zu einer Einstellung, die Enttäuschungen dem Akteur zurechnet und potentielle negative Ereignisse als Risiken verbucht.54 In Luhmanns Beschreibung, die das umstrittene Risiko/Gefahr-Schema55 verwendet, schleicht sich – vom Autor offenbar nicht bemerkt – die Vokabel „calculation“ ein. Allem Anschein nach sieht sich Luhmann durch die Risiko/Gefahr-Differenz gezwungen, die unterschiedlichen Zurechnungsweisen so zu erläutern, dass die eine Seite der Differenz als interne Form der Berechnung externer Bedingungen Kontur gewinnet. „Trust” wird definiert als “a purely internal calculation of external conditions which creates risk” (1988: 100). Damit verwässert Luhmann seine funktionalistische Theorie des Vertrauens, die die Rationalität der Vertrauensgewährung auf der makrosozialen Ebene ansiedelte (s.o.). Wesentlich bedeutsamer ist aber ein anderer Punkt: Luhmann verbindet „confidence“ mit Systemvertrauen und „trust“ mit interpersonalem Vertrauen. Ausdrücklich spricht er von „confidence in the system and trust in partners” (1988: 99). Diese Zuordnung ist freilich nicht als analytische Verklammerung zu verstehen. 56 Auch zu Systemen ist im Prinzip eine risikobewusste Haltung im Hinblick auf Vorleistungen möglich, und selbstverständlich können Personen (z.B. betrunkene Autofahrer) als Quellen 50 Preisendörfer (1995) bezweifelt den Wert der von Luhmann und Giddens benutzten Differenz zwischen interpersonellem Vertrauen und Systemvertrauen: Das analytische Potential der Vertrauenskategorie liege gerade darin, sowohl individuelle als auch korporative Akteure zu umfassen und Phänomene zu erschließen, die auf beide gleichermaßen zutreffen. So stoße man bei der konkreten Untersuchung auf „Regelhaftigkeiten und Mechanismen“ wie etwa „Aufbau von Vertrauen in kleinen Schritten, Kontrolle über Symbole, rascher Zusammenbruch von Vertrauen usw.“, die „unabhängig davon gelten (dürften), ob es sich um individuelle Akteure (meine Lebenspartnerin) oder um korporative Akteure (meine Bank) handelt“ (1995: 271). Diesen Ausführungen können wir natürlich nicht zustimmen. 51 Vgl. hierzu auch die Ausführungen über „Vertrautheit und Vertrauen“ (1989³: 17ff). Der ‚Vertrautheit’ entspricht in Giddens’ Theorie der Begriff „basic trust“ (Urvertrauen). 52 Die Bedeutung, die Deutsch (1973) dem Begriff gab (siehe oben), wird dabei ignoriert. Das ist nicht ohne Folgen für die Verwendung der Vokabel ‚confidence’ in der Netzwerkliteratur geblieben. Loose/Sydow (1996) werfen beide Bedeutungen in einen Topf und stiften damit einige Verwirrung. 53 Giddens referiert Luhmann folgendermaßen: “… an individual who does not consider alternatives is in a situation of confidence, whereas someone who does recognise those alternatives and tries to counter the risks thus acknowledged, engages in trust” (Giddens 1990: 31). 54 Das Risiko/Gefahr-Schema erweckt den falschen Eindruck, trust und confidence ließen sich gegeneinander aufrechnen. Luhmann betont daher explizit: „the relation between confidence and trust is not a simple zero-sum game in which the more confidence is given the less trust is required and vice versa“ (1988: 99). 55 Vgl. hierzu auch Luhmanns „Soziologie des Risikos“ (1991: 30ff.). 56 So allerding die Interpretation von Scheidt (1996: 299). 14 von Gefahren angesehen werden. Dennoch haben in Luhmanns Augen die funktional ausdifferenzierten Sozialsysteme in der Spätmoderne eine derart opake Gestalt angenommen, dass die Subjekte kaum eine andere Wahl haben, als diesen Gebilden gegenüber die Haltung des „Zutrauens“ (confidence) einzunehmen.57 Im Umgang mit konkreten Personen hingegen können die Subjekte in der Regel Vertrauensvorschüsse gewähren, weil sich deren Risiken noch ‚kalkulierend’ erwägen lassen. Nicht das (durch Expertenwissen medialisierte) Systemvertrauen – wie bei Giddens – sondern das interpersonale Vertrauen erscheint als ein kalkulierbares Phänomen. Es ist daher alles andere als überraschend, dass Giddens die konzeptionellen Vorschläge von Luhmann ablehnt. Zwar hält er die Unterscheidung von confidence und trust für ebenso sinnvoll wie die Unterscheidung von Risiko und Gefahr, plädiert aber gegen die von Luhmann durchgeführte Kombination beider Unterscheidungen: “it is unhelpful to connect the notion of trust to the specific circumstances in which individuals consciously contemplate alternative courses of action. Trust is usually much more of a continuous state than this implies. It is … a particular type of confidence rather than something distinct from it. (Giddens 1990: 32). Die Diskussion der teils ähnlich gelagerten, teils kontrastierenden Ansätze von Giddens und Luhmann zeigt, wie sinnvoll die Unterscheidung von interpersonalem Vertrauen und Systemvertrauen ist, macht aber auf der anderen Seite auch deutlich, dass noch weitere Arbeit in die Präzisierung der Begriffe investiert werden muss. Der Status von Kalkulationen, die ggf. die Form von mathematischen Kalkülen annehmen können, ist nach wie vor unklar. Zwar hat sich herausgestellt, dass auch Theorien, die das Vertrauen generell als „blind“ bezeichnen und harte Rational-choice-Konstrukte zurückweisen, auf den Begriff der Berechnung (calculation) nicht verzichten können58, doch lässt sich nicht zwingend entscheiden, ob eher die systemische oder die interpersonale Dimension des Vertrauens durch Kalküle expliziert werden kann. Auch die vorhandene Netzwerkliteratur hat zur Lösung dieser Probleme bislang nichts Entscheidendes beizutragen vermocht. Im Gegenteil. Loose/Sydow, die den reflektiertesten Aufsatz zur Rolle der Vertrauens-Semantik in Netzwerken geliefert haben, verheddern sich im Gestrüpp der Kategorien. Sie unterscheiden im Anschluss an Ring (1993) zwischen einem „There is neither the need nor even the occasion to decide about confidence in the system. One can feel unhappy and complain about this” (Luhmann 1988: 103). Die sozialen Bewegungen, die Luhmann an anderer Stelle kritisch analysiert (1991: 135ff.), sind ein gutes Beispiel für die Verweigerung von Systemvertrauen à la confidence. 58 Luhmann verwendet ja nicht allein den Begriff „calculation“, er entwickelt auch eine Argumentation, der „eine implizite Kosten-Nutzen-Abwägung zugrunde liegt“ (Scheidt 1996: 355). Wenn Luhmann „confidence“ als „one of the essential conditions of trust” (1988: 103) bezeichnet, so „unterstellt er, dass das Vertrauen durch die Verringerung der Gefahr des Betrugs, bzw. des damit verbundenen Verlustes, gefördert wird. Gleichzeitig besteht er aber darauf, dass Vertrauen nicht als das Ergebnis eines Kosten-Nutzen-Kalküls betrachtet werden kann, denn nur dann, wenn der drohende Verlust größer wäre als der Vorteil aus dem Vertrauen und der Vertrauende den Verlust bedauern würde, könne von einem vertrauensvollen Verhalten gesprochen werden. Dieses ‚Bedauern’ kann aber nicht durch eine Verringerung des möglichen Verlustes im Betrugsfall gefördert werden“ (Scheidt 1996: 344). Luhmann verstrickt sich – wie Scheidt meint – in einen eklatanten Widerspruch, der nur durch die implizite oder rhetorisch unauffällige Verwendung des Kalkulationsbegriffs entschärft werden kann. – Dieser Widerspruch lässt sich jedoch auflösen. Die strukturelle Minimierung des Risikos durch die Anhebung des bestehenden Confidence-Niveaus kann auf den des vertrauensbereiten Akteurs positive Auswirkungen haben, weil sie günstige Rahmenbedingungen für die Steigerung von Vertrauensinvestitionen schafft. Jede Art der Sicherung, die die Abwesenheit von Alternativen suggeriert, kann mithin als Startrampe für die Erzeugung neuer Unsicherheiten in anderen Bereichen dienen. Auf diese Weise kann zugleich der Pegelstand von confidence und trust ansteigen. Diese Spirale der Doppelevolution von trust und confidence kann aber auch umschlagen in einen „vicious circle of not risking trust, losing possibilities of rational [!] action, losing confidence in the system, and so on“ (Luhmann 1988: 105). Nach der Beseitigung des Widerspruchs, den Scheidt aufgedeckt zu haben glaubt, bleibt die Dialektik von ‚Doppelevolution’ und ‚vicious circle’ erhalten. Die Frage ist 1., ob der potentielle Umschlag eine Gefahr darstellt oder ein Risiko, ob also die Wende den Akteuren oder dem System zugerechnet werden muss, und 2., wer diese Zurechnung ggf. vornimmt. 57 15 fragilen und einem resilienten bzw. widerstandsfähigen Vertrauen. Das klingt äußerst plausibel, lenkt jedoch die Analyse von den relevanten Fragen ab. „Fragiles Vertrauen meint die Zuversicht (confidence) von Akteuren in ihre auf zukünftige Erwartungen gerichtete Vorhersagen und steht insofern in engem Zusammenhang mit dem Begriff des Risikos. Dieses eher kognitive, auf Kalkulation und Erfahrung basierende Vertrauen zerbricht, wenn diese Erwartungen nicht mehr erfüllt werden. Im Falle resilienten Vertrauens beruht demgegenüber die Zuversicht nicht nur auf der Vorhersagbarkeit bestimmter Ergebnisse, sondern auf der Vorhersagbarkeit des Goodwills und der moralischen Integrität der Akteure. Dieses stärker normativ verankerte Vertrauen basiert vor allem auf Eigenschaften oder Institutionen“ (Loose/Sydow 1997: 188). Beide Arten von Vertrauen, die hier beschrieben werden, beziehen sich auf interpersonale Kontexte. Der systemische Charakter von Netzen, der sich nicht auf Eigenschaften von Personen und institutionell verankerte Normen reduzieren lässt, bleibt unterbelichtet. Auch wird nicht bedacht, dass Annahmen über „Goodwill und moralische Integrität“ anderer Personen als Schätzwerte in Kalküle eingehen können. Und schließlich fehlen Überlegungen zur Steigerung der Resilienz von Netzwerkvertrauen durch die Verbindung von trust, confidence und distrust. Bevor diese netzwerk-theoretische Alternative skizziert werden kann, ist zunächst ein geeigneter Misstrauensbegriff zu entwickeln. 3. Konzepte des Misstrauens Soziologische Analysen des Misstrauens sind überaus rar und erregen nur wenig Aufmerksamkeit. Die allgemeine Soziologie hat in diesem Bereich kaum Grundlagenforschung betrieben und die gewonnenen Ergebnisse in ihre Modelle der verschiedenartigen Formen gesellschaftlicher Ordnungsbildung (z.B. Markt, Hierarchie, Netzwerk) eingefügt. Das Thema ist heikel (vielleicht ‚hobbesianisch’ verdunkelt) und konnte die Forschung nur selten zur Einnahme ‚inkongruenter Perspektiven’ veranlassen. Zumeist werden Common-sense-Annahmen reproduziert. Besondere Erwähnung verdienen jedoch folgende Arbeiten: 1. Die sozial-psychologischen Untersuchungen von Deutsch („Trust and Suspicion“ 1958; 1972)59, 2. Luhmanns äußerst produktiver soziologischer Versuch, Misstrauen als funktionales Äquivalent von Vertrauen zu beschreiben und die Selbstverstärkungs-Tendenz des Misstrauens, die auch als ‚Misstrauensspirale’ bezeichnet wird), zu erklären (1968/1989³), sowie 3. Gambettas Mafia-Studien, die den hohen sozialen Preis des Misstrauens thematisieren (1988b; 1994).60 Lassen wir die wichtigsten Thesen dieser Autoren noch einmal Revue passieren: (1) Morton Deutsch nimmt an, dass „distrust“ das Gegenteil von „trust“ ist. Er definiert – auf der Basis seiner oben diskutierten Entwürfe – zunächst: „a path that can lead to an event having positive motivational signifiance (Va+) or to one having negative motivational signifiance (Va-) is an ambiguous path“, und fährt dann fort: “the choice of an ambiguous path, when Va+ is less than Va-, is a trusting choice; the choice of avoiding such a path is a distrusting choice“ (1972: 149). Mit diesen Bestimmungen verbaut Deutsch jedoch einer heuristisch fruchtbaren Organisations- und Netzwerkanalyse den Weg; denn Misstrauen ist ein eigenständiges Phänomen, das sich nicht derart mit Vertrauen verrechnen lässt. Relevant sind hingegen Deutschs feinkörnige Thesen zu überzogenem Vertrauen und pathologischem Misstrauen. Sie dürften wohl bleibenden Wert haben. Zu den sozial-psychologischen Konzepten vgl. auch den Übersichtsartikel von Worchel (1979) zu „trust and distrust“. 60 In diesem Zusammenhang ist auch eine Arbeit über den politischen Skandal und seine Auswirkungen von Garment (1991) erwähnenswert. Thematisiert wird hier nämlich das Verhältnis eines ereignisbezogenen Misstrauens zu generellen Vorbehalten gegenüber einem bestimmten gesellschaftlichen Teilsystem. 59 16 (2) Niklas Luhmann weist darauf hin, dass Vertrauen nicht ohne Misstrauen existieren und anwachsen kann, weil die alleinige Steigerung von Vertrauen oder Misstrauen mehr Schaden als Nutzen stiftet.61 Zudem betont er die kreativen Aspekte des Misstrauens: „manche Systeme (brauchen) gerade in ihren internen Beziehungen starke Einschüsse von Misstrauen, um wach und neuerungsfähig zu bleiben, um nicht dem gewohnten Trott auf dem Sichaufeinander-Verlassen anheimzufallen (1989³: 102). Hierbei handelt es sich um bedeutsame Feststellungen (die allerdings nur von Kern und Lewicki et al. aufgegriffen und konkretisiert werden).62 Andererseits behauptet Luhmann aber auch, dass es sich beim Misstrauen um eine Einstellung handelt, die von Personen, die sie hegen, nicht verborgen werden kann. Misstrauen ist etwas, das sich als solches zeigt. „Das Mißtrauen wird im mißtrauischen Verhalten mitdargestellt. ... Der Mißtrauische (kann), ob er will oder nicht, kaum vermeiden, daß sein Mißtrauen ihm angesehen und zugerechnet wird. Feindselige Gefühle lassen sich schwer im Verborgenen bändigen, die Barrieren der Vorsicht, die nun nötig zu sein scheint, verraten die Absicht“ (1989³: 82). Dies ist ein Befund, der die Analyse latenter Konflikte eher behindert als fördert. Denn ertragreich ist eine Theorie, die die produktiven Aspekte von Konflikten auch und gerade in Netzwerken hervorheben möchte, nur dann, wenn ein Misstrauen, das sich unmittelbar als solches zeigt (und dementsprechend empirisch zu erfassen ist) mit einem getarnten Misstrauen, das nur aus verschiedenen Indikatoren erschlossen werden kann, in Beziehung gesetzt wird. (3) Diego Gambetta schließlich thematisiert einen pathologischen Grenzfall von netzwerkartigen Interaktionen: „a world of deep distrust“ (1988a: 168). Kauf und Verkauf von Vertrauen (protection) beherrschen hier die Szene, konservieren ein unter bestimmten historischen Sonderbedingungen entstandenes Klima des Misstrauens63 und zerstören so jenen spezifischen Mehrwert, den vertrauensvolle (Hyper-)Aktivitäten gerade in Geschäftsbeziehungen haben können. Erstickt wird die Chance, Wettbewerb oder Rivalität mit starken Anreizen zu riskanten Vorleistungen zu verbinden, deren Erwiderung durch Zug um Zug aufgestockte Gegenleistungen hochgradig wahrscheinlich ist. Stattdessen bilden sich Monopole aus. Durch die rücksichtslose (zumeist gewaltförmige) Suche nach Exklusivität wird jeder aufkeimende Wettbewerb entmutigt (1988a: 164). Konkurrenz kann sich auf der Marktebene nur Geltung verschaffen, wenn sie die Strategie der Mafia übernimmt. Es kommt dann zum Kampf um monopolisierbare Güter oder Gebiete. Am Beispiel der Mafia lässt sich eine Art von sozialer Schädlichkeit beschreiben und analysieren, die (trotz des gegenteiligen Erscheinungsbildes) äußerst subtil ist; denn es gibt nicht nur Erpressungsopfer, sondern auch freiwillige Kunden64 dieser „Industrie, die privaten Schutz schafft, fördert und verkauft“, indem sie dosiertes Misstrauen sät und „eine mögliche eigenständige Entwicklung von Vertrauen“ gezielt unterbindet (1994: 9, 11). Vertrauen und Misstrauen gehen in Sphären, die die Mafia beherrscht, eine ebenso sonderbare wie fatale Verbindung ein. Es entsteht ein turbulentes Gleichgewicht („a turbulent equilibrium“), das auf Makroebene suboptimale Ergebnisse zeitigt, ohne deswegen die wohlerwogenen Erwartungen 61 Vgl. auch Lewickis Rekurs auf diese These (Lewicki et al. 1998: 450). Wir kommen darauf zurück. 63 Die Nachfrage nach Protektion bzw. Schutz entsteht nur unter sozialen Bedingungen, die durch den Mangel an Vertrauen geprägt sind. Aber die spezifische Überwindung des Misstrauens durch mafiöse Protektion „bewirkt nichts anderes als das Fortleben und die Vermehrung eben dieses Misstrauens – es wird endogen“ (1994: 47). Die Mafia kontrolliert und fördert das Misstrauen, um den Bedarf für das Produkt Schutz (Vertrauen) zu steigern oder konstant hoch zu halten. Sie muss aber dafür sorgen, dass der Misstrauenspegel einen kritischen Punkt nicht übersteigt, sonst kämen die Geschäfte, an denen die Mafia verdient, gar nicht mehr zustande. Für Käufer und Verkäufer, der die Mafia vermittelt, sind die anfallenden Kosten „zwar höher als in einer Welt, in der mehr Vertrauen herrscht (und in der der Mafioso überflüssig wäre), doch die Profite sind immer noch höher, als wenn der Handel unterbliebe“ (1994: 37). 64 Zudem spannt sich „um die Mafiosi herum ... sich ein Netz freiwillig mitarbeitender Personen“ (Gambetta 1994: 37). 62 17 der beteiligten Subjekte immer enttäuschen zu müssen: „the solution of the problem of trust that mafioso behaviour offers will remain at once individually rational and collectively disastrous“(1988a: 165). Die drei referierten Konzepte sind in vieler Hinsicht aufschlussreich. Ihnen lassen sich unverzichtbare Gesichtpunkte für die Analyse des Entstehens und des Anwachsens von Misstrauen sowie des Umgangs mit Misstrauen in Netzwerken entnehmen. Bahnbrechend ist die Einsicht, dass das Misstrauen (sowohl in Organisationen als auch in Netzwerken) einer eigenen Logik folgt, also keinesfalls als bloß negatives Vertrauen aufgefasst werden darf. Wichtig sind ferner die Analysen turbulenter Gleichgewichtsverhältnisse und die Belege für die kreativen Effekte des Misstrauens. Keine der angeführten Theorien und Analysen lenkt jedoch die Aufmerksamkeit auf den Umstand, dass das Misstrauen zumeist verborgen wird und gerade in der Latenz seine größte – sei es förderliche, sei es destruktive – Wirkung entfaltet.65 Auch in der vorliegenden Netzwerkliteratur wird dieses Problem nicht diskutiert. Ohnehin erfährt das Thema „Misstrauen“ hier eine stiefmütterliche Behandlung. Nur wenige Autoren beziehen dezidiert Stellung. Zumeist wird Misstrauen als Gefahr, die unbedingt abgewehrt werden muss, behandelt, und nur gelegentlich auch als Chance aufgefasst, die ergriffen werden sollte, sobald bestehende Netzwerke zur Verkrustung neigen und auf diese Weise ein innovationsfeindliches Klima erzeugen. Als Beispiel für den ersten Fall können die Analysen von B. Scheidt gelten. Die Autorin erwähnt die „Verhaltensunsicherheit“, die durch „mögliches opportunistisches Verhalten bzw. Misstrauen genährt wird“ und führt als Weg zur Lösung des Problems die traditionelle Strategie der „Informationsbeschaffung und Informationsverteilung“ an (Scheidt 1995: 342). Den seltenen zweiten Fall repräsentiert der Industriesoziologe H. Kern. Er weist darauf hin, dass „tradierte Milieus“, die sich gerade in Netzwerken leicht bilden, beim Umgang mit „Basisinnovationen“66 eine „hemmende Wirkung“ besitzen, und schlägt daher vor „Unternehmensnetzwerke ... durch Injektion von Misstrauen“ aufzufrischen (Kern 1997: 278).67 Theoretische Durchbrüche, die auf der Linie von Kerns Konzept liegen, lassen sich wohl erst dann erreichen, wenn die interessantesten Befunde der Misstrauens-Soziologie aufgegriffen und mit aktuellen Ansätzen aus der Management-Theorie (Sitkin/Roth 1993; Burt/Knez 1996; Lewicki/McAllister/Bies 1998) angereichert werden. 65 Wir wollen deshalb mit unserem Konzept an diesem neuralgischen Punkt ansetzen, um schließlich mit Hilfe eines Phasenmodells der Misstrauensaggregation Aussagen über die Dynamik latenter Konflikte in Netzwerken zu machen. 66 „Basisinnovationen gelingen ceteris paribus umso besser, je leichter Wissen, welches bisher an verschiedenen Stellen – in separaten Fächern oder Firmen – lokalisiert war, miteinander verflochten werden kann“ (Kern 1997: 277). Um ungewöhnliche Erfolge zu verbuchen, ist die Kooperationen zwischen Fremden erforderlich (vgl. Saxenian 1994). Das hier gewährte Vertrauen ist mit Misstrauen gepaart, ohne dass diese Mischung zur Blockade von Handlungen führt. Kooperation mit Fremden beruht auf einem besonders hohen (positiv bewerteten) Risikobewusstsein und Risikobereitschaft. Zur positiven Bewertung solcher Schritte können günstige strukturelle bzw. systemische Voraussetzungen beitragen. „In einer Sozialordnung, deren Institutionen eine generelle Vertrauensvermutung herstellen, ist diese Gewißheit wie von selbst gegeben. Mit diesem Vertrauen im Hintergrund, können ihre Mitglieder das Wagnis der Exploration eingehen. Zur Exploration selbst stimuliert aber nicht der selbstverständliche Glaube an diese Ordnung, sondern der Sinn für ihre Beschränktheit oder Fehler – also ein gewisses Mißtrauen gegenüber ihren konkreten Leistungen“ (Kern 1997: 281). Einen ähnlichen Zusammenhang zwischen hochriskanten Vorleistungen, die immer auf einer „Täuschung“ (über die Komplexität der Welt) beruhen, und Absicherungen auf Systemebene konstruiert – wie oben erläutert – Luhmann. Stabile oder bewährte Strukturen sorgen also nicht für risikofreies Agieren (und schon gar nicht für Stagnation), sie dienen vielmehr als Ausgangspunkt für weitere und noch riskantere Operationen der Akteure. 67 Dass die gezielte Institutionalisierung von Misstrauen oft problematisch ist, zeigen die historisch angelegte Untersuchung von Zucker (1986: 89ff.) und die systematischen Überlegungen von Shapiro (1987: 635ff.). 18 Der Beitrag von Lewicki et al. ist besonders gehaltvoll. Die Autoren knüpfen mit ihren Überlegungen zunächst an Luhmann an und machen deutlich, „that trust and distrust are not opposite ends of one single trust-distrust continuum“. Die übliche Vorstellung, der (wie oben schon notiert) auch Deutsch noch angehangen hat, wird mit aller Entschiedenheit korrigiert: „the opposite of trust is not distrust“; denn: „trust and distrust are separable and distinct constructs“ (1998: 448), die in unterschiedlicher Dosierung miteinander ko-existieren können.68 Zur Illustration ihrer These entwerfen sie eine Kreuztabelle, die die wichtigsten Formen der Integration von „trust and distrust“ enthält. Vier definierte Grund-Zustände (low trust, high trust, low distrust, high distrust) werden miteinander kombiniert und unterschiedlichen Formen der sozialen Realität zugeordnet. „High trust“ wird charakterisiert durch: hope, faith, confidence, assurance, initiative; „low trust“ durch: no hope, no faith, no confidence, passivity, hesitance; „low distrust“ durch: no fear, absence of sceptcism, absence of cynism, low monitoring, no vigilance; „high distrust“ durch: fear, scepticism, cynism, wariness and watchfulness, vigilance. Die Kombination „low trust/low distrust“ findet sich z.B. bei „casual acquaintances“ und „bounded arms-length transactions“, die Kombination „high trust/low distrust“ z.B. bei „high-value congruence“ und „new initiatives“, die Kombination „low trust/high distrust“ z.B. bei „interdependence managed“ und „paranoia“, und die in unserem Forschungszusammenhang interessanteste Kombination „high trust/high distrust“ z.B. bei „relationships highly segmented and bounded“ und „opportunities pursued and down-side risks/vulnerability monitored“ (1998: 445). Die Aussage der Keuztabelle ist eindeutig: Kooperationen sind dann besonders effektiv, wenn der Pegelstand von Vertrauen und Misstrauen gleichermaßen hoch ist. Organisationen oder Netzwerke, denen die Kombination dieser vermeintlich gegensätzlichen Elemente gelingt, müssen aber nicht nur gepriesen werden, um die herrschende Ideologie zu einem Paradigmenwechsel zu veranlassen, sondern solche Gebilde müssen auch durch theoretisch ausgefeilte Warnsysteme vor Fehlentwicklungen geschützt werden. Gefahr droht den besonders effizienten Kooperationsformen von zwei Seiten. Vertrauen und Misstrauen sollen beide – wie gesagt – hoch sein, aber sie dürfen den Bezug zu konkreten Ereignissen und Problemen im work-flow oder Entscheidungsgang nicht einbüßen. Pauschalisierungen sind Gift für effiziente Systeme: „overgeneralized trust as a necessary precondition for the undermonitoring of employees“ ist nicht minder schädlich als die Übergeneralisierung von Misstrauen, die mit „paranoid cognitions“ (1998: 451)69 einhergeht. Während zu viel Vertrauen in ‚klientelistischer Versumpfung’ endet, führt das entfesselte Misstrauen zu Racheplänen und ggf. auch -akten oder zum totalen „monitoring“ der anderen. Vertrauen und Misstrauen müssen also – um optimale Ergebnisse zu bringen – zusammenspielen und in eine ausbalancierte Beziehung treten. Sie sind m.a.W. gehalten, ihre Selbstreproduktion mit der indirekten Förderung der anderen Seite koppeln.70 68 Um diese zunächst einmal plausibel zu machen, weisen sie darauf hin, dass sich Mikrosituationen des Handelns durch Ambivalenz und durch die Bandbreite („bandwidth“) möglicher Beziehungen auszeichnen. Erst in einem zweiten Schritt wird diese Einsicht dann in organisationssoziologische Terme übersetzt. 69 Wir möchten allerdings vorschlagen, dieses Übergeneralisierungsphänomen nicht als „Fehlattribution“ (Staber) des tatsächlichen Verhaltens („conduct“) der Partner zu begreifen. Es ist wohl sinnvoller, es auf einen eigenständigen (kognitiven) Aggregationspfad des Misstrauens zurückzuführen und Pauschalisierungen als Ergebnis von Pfad-Optionen zu deuten. 70 Dabei spielen Art und Dichte der Kommunikation eine entscheidende Rolle. Die Analyse muss hier sehr präzise verfahren. Dass allgemeine Statements nicht weiter helfen, kann man bei Luhmann studieren. Einerseits wird Vertrauenspflege mit Kommunikation verknüpft. Die Regel lautet: ‚Vertrauen muss kommuniziert werden’ oder: ‚Kommunikation erhöht das Vertrauen’. Dieser Schluss kann aus den Gefangenen-Dilemma-Experimenten gezogen werden (vgl. Luhmann 1989³: 46, Anm. 14; Loose/Sydow 1997: 184). Aber andererseits wird betont, dass zuviel Kommunikation Argwohn erzeugt: „Eine sehr genaue Artikulation von Gründen und Gesichtspunkten ist ... weder beim Vertrauenserweis noch beim Vertrauensentzug angemessen. Auch für den, der Vertrauen sucht, ist sie nicht erforderlich; sie kann sogar leicht zum Störfaktor werden, ja Misstrauen 19 Dies ist natürlich nicht als Plädoyer für die Entfaltung einer mephistophelischen Kraft, „die stets das Böse will und stets das Gute schafft“, zu verstehen; und schon gar nicht als Werbung für großangelegte vertrauensfördernde Maßnahmen, die gleichsam als Nebenfolge auch das Misstrauen steigern. Wäre dies die Lösung, so müsste man z.B. einfach nur Mechanismen ‚vertrauen’, „by which formal procedures, standards, and so on can lead to distrust“ (Sitkin/Stickel 1996: 197). Es geht vielmehr darum, Schritt für Schritt zu lernen, auf derartige Instrumente zur Entwicklung von Organisations- oder Netzwerkkulturen zu verzichten. Strategien, die auf dialektische Verkehrungen spekulieren, sind ungeeignet. Vertrauen soll ja nicht durch heilsame Rituale in Misstrauen umschlagen und genauso wenig Misstrauen sich plötzlich in Vertrauen verwandeln. Solche Metamorphosen verschlimmern bloß die Situation. Der Eigensinn von Vertrauen und Misstrauen muss gewahrt bleiben. Sie sollen im ‚Fahrstuhleffekt’ gleichzeitig und doch auf je spezifische Weise auf ein höheres Niveau befördert werden. Um hierfür geeignete Konzepte entwickeln zu können, muss man die Fallen kennen und wissen, dass ein unproduktives Misstrauen gerade durch Konzepte ausgelöst, wird, „that are typically offered as ‚remedies’ for trust problems“ (1996: 209). Die Art von Vertrauen, die hier in den Blick genommen wird, hat ebenso wie das endlich rehabilitierte Misstrauen eine eigene Logik, aber es ist deshalb noch lange kein eindimensionales Phänomen. Wir dürfen diesen Umstand nicht vernachlässigen. Gerade Theoretiker, die zwischen Vertrauen und Misstrauen substantiell differenzieren 71, gehen davon aus, „that trust has a bandwidth, where it can vary in scope as well as degree. Trust takes different forms in different relationships – from a calculated weighing of perceived gains and losses to an emotional response based on interpersonal attachment and identification“ (Rousseau et al. 1998: 398). In diesem Zusammenhang sind eine Reihe von Vorschlägen gemacht worden, die die basale Differenz zwischen trust und confidence, bzw. zwischen persönlichem Vertrauen und Systemvertrauen anreichern: Unter Bezug auf den bahnbrechenden Aufsatz von Lewicki/McAllister/Bies (1998) über die verschiedenen Arten des Zusammenspiels von Vertrauen und Misstrauen haben Rousseau et al. „deterrence-based trust“ und „calculus-based trust“ auseinandergezogen und die durch Hinzufügung von „relational trust“ und „institution-based trust“ gewonnenen vier Vertrauens-Typen in drei Kästchen der Kreuztabelle (trust/distrust – high/low) von Lewicki et al. eingetragen.72 Sie ordnen 1. deterrence-based trust (als uneigentliche Vertrauensweise) der Kombination von low distrust/low trust zu, 2. calculus-based trust der high trust/high distrust Kombination, die nach Lewicki/McAllister/Bies die effektivste Form einer zielorientierten Handlungskoordination in Organisationen darstellt, 3. „relational trust“ der high trust/low distrust Kombination und bezeichnen 4. „institution-based trust“ als einen Typus von Vertrauen, bei dem „calculus-based and relational based trust“ eine Einheit bilden. Rousseau et al. argumentieren dafür, dass ein kalkül-bezogenes Vertrauen bei der Erzeugung besonders günstiger Kooperationsweisen eine zentrale Rolle spielt. Denn es bietet – stärker als die übrigen Vertrauensarten – Anschlüsse für ein produktives Misstrauen. Die optimale Verbindung von „high trust“ und „high distrust“ ist ohne ein „calculus-based trust“ nicht denkbar. Ferner machen Rousseau et al. deutlich, dass das kalkül-bezogene Vertrauen durchaus mit anderen Vertauensarten (wie etwa dem relational-basierten) verknüpft werden kann und soll. Mit ihren Darlegungen korrigieren sie jenen falschen Eindruck, den das auslösen“ (Luhmann 1989³: 31f.). – Ohne sprechakt-theoretische Feinarbeit wird man diese Ambivalenz nicht auflösen können. Vgl. hierzu die Modellierungsansätze zur Netzwerkkommunikation bei Gans et al. 2001. 71 Vgl. Sitkin/Roth (1993), Kramer (1996), Lewicki et al. (1998), die von „asymmetries between trust and distrust“ (Kramer 1996: 236) sprechen oder beiden Phänomenen eigene Logiken zuweisen. 72 Die Kombination low trust/high distrust, die sich als eine Form der Paranoia identifizieren lässt, wird von Rousseau et al. bei ihrer Klassifikation übergangen. Sie markiert die Gefahr, der jede Organisation ausgesetzt ist, wenn sie zu starke Kontrollmechanismen installiert und auf jedes Zeichen der Krise mit einer Verstärkung formaler Prozeduren antwortet. In ihr endet „the road to hell“ (Sitkin/Stickel 1996). 20 Evolutionskonzept des Vertrauens von Lewicki/Bunker allzu leicht zu wecken vermag. Denn dort wird das „calculus-based trust“ als elementarste und niedrigste (also quasi primitivste) Stufe der Vertrauensbildung angesetzt. Der Essay über „new relationships and realities“, den Lewicki et al. drei Jahre nach der Skizze zur Vertrauensevolution publiziert haben, legt eher die Vermutung nahe, dass das „calculus-based trust“ eine äußerst voraussetzungsvolle Errungenschaft darstellt, die sich mit kreativem Misstrauen nur dann erfolgreich koppeln lässt, wenn in den Kalkül (z.B. als Maßzahl für Vertrauenswürdigkeit) hochentwickelte hermeneutische Potentiale einfließen. Lewicki et al. leisten einen wertvollen Beitrag zur „Neubeschreibung“ (Rorty) der Bedingungen, unter denen Netzwerke entstehen und sich dann als soziale Ordnungsformen reproduzieren, die die Erwartungen der beteiligten Akteure besser als andere Ordnungsformen erfüllen können. Wir vermuten, dass der ‚harmonistische bias’, der die Netzwerkphilosophie heute noch weitgehend beherrscht, kein funktions-notwendiger Schein ist. Aufwendig gepflegte Konsensfiktionen sind gar nicht erforderlich, sondern eher hinderlich. Das gewünschte Ergebniss ist auch auf anderen Wegen zu erlangen und sogar zu verbessern. Es wird den Netzwerken nicht zum Schaden gereichen, wenn sie in ihre Selbstthematisierung einen elaborierten Begriff von Misstrauen aufnehmen. Und überzeugende Theorien können zu dieser Erweiterung etwas beitragen. Die Welt der sich gründenden Netzwerke ist besonders empfänglich für Deutungen, die gleichzeitig Optimismus verbreiten und Irritationen auslösen. Semantiken haben vorübergehend mehr Gewicht als Strukturen. Deshalb sind die Wege von der akademischen Theorie zur Praxis hier weniger weit als in anderen Bereichen. Selten bietet sich eine derartige Chance für soziologische Reflexion. Netzwerke sind – um es noch einmal zu sagen – Systeme, die in viel stärkerem Maße als preisbezogene Märkte und hierarchisch aufgebaute Organisationen ihre Reproduktion durch Selbstbeschreibungen gewährleisten. Es ist kaum zu übersehen, dass in den gegenwärtig kursierenden Netzwerkphilosophien der Konflikt-Begriff kein sonderlich hohes Ansehen genießt. Konflikte gelten als problematische Ereignisse, deren Auftreten eine schwere Krise signalisiert. Diese Krise führt – wie immer wieder zu hören ist – entweder rasch zur Auflösung des Netzwerkes oder gibt den entscheidenden Anstoß für einen Prozess, in dessen Verlauf das Netzwerk in eine regelrechte Organisation oder eine marktförmige Allianz verwandelt wird. Die einschlägige Konflikttheorie hat hinreichend plausible Belege für die Annahme geliefert, dass Konflikte – bevor sie zur Überraschung der internen und (oft auch) externen Beobachter ausbrechen – fast immer Phasen durchlaufen, in denen sie kaum merklich Gestalt gewinnen und ansteigen. Man spricht in diesem Zusammenhang von schwelenden oder latenten Konflikten, die sich in unterschiedlichem Tempo aufheizen. Aber auch für dieses notorische Phänomen hält die Netzwerk-Philosophie keine adäquaten Begriffe bereit. Um latente Konflikte zu analysieren und den Beteiligten vor Augen zu führen, wird eine Operationalisierung benötigt, die einerseits diverse Formen der Unzufriedenheit von Netzwerkmitgliedern erfasst und andererseits die verschiedenartigen Aktivitäten, die durch Unzufriedenheit ausgelöst werden. Die Pflege des einmal aufgekommenen Misstrauens ist ein Mechanismus, der den offenen Konflikt umgeht, aber zugleich den Konfliktstoff-Pool so anreichert, dass die Krise an einem bestimmten Punkt der Netzwerkevolution dann besonders heftig hervortritt. Wir schlagen vor, den Begriff des Misstrauens als Konzept zur Operationalisierung latenter Konflikte in Netzwerken zu verwenden, und möchten überdies ein Modell präsentieren, das die ‚Misstrauenskurve’ nachzeichnet. Jeder Teilnehmer an einer Netzwerk-Kooperation hat bei Unzufriedenheit mit dieser Kooperation nicht nur die „exit“- oder „voice“-Option (Hirschmann 1970), sondern die dritte 21 Möglichkeit, seinen Argwohn heimlich zu kultivieren73. Ein derartiges im Verborgenen (in der Latenz) gepflegtes Misstrauen hält den Akteur im Netz und verhindert zunächst die entschiedene voice- oder exit-Option. Misstrauen verzögert also die Entscheidung. Stattdessen läuft ein Suchprogramm an, das die Aufmerksamkeit des Akteurs bindet und in eine bestimmte Richtung lenkt. Unter hohen Kosten (Zeit und Ressourcen) werden Informationen ermittelt, die den aufgekommenen Verdacht belegen oder widerlegen sollen. Allerdings ist das Suchprogramm nicht neutral. Die aufgespürten Indizien werden unterschiedlich gewichtet. Misstrauen besitzt (wie oben erläutert) eine inhärente Tendenz zur Selbstverstärkung. Dies ist u.a. auf die Wahrnehmungsasymmetrie bezüglich der sog. „doppelten Kontingenz“ (Parsons, Luhmann) zurückzuführen. Informationen, die den anfänglichen Verdacht bestätigen, werden offenbar leichter registriert und memoriert als entlastende Indizien; und Interpretationen, die den einmal aufgekeimten Verdacht erhärten, lassen sich den kognitiven Skripts besser integrieren als Deutungen, die den Verdacht auflösen.74 Die Analyse des heimlichen Misstrauens ist für eine Theorie der Netzwerke von besonderer Relevanz. Denn im Unterschied zu offen artikuliertem Misstrauen, das auch in Netzwerken bearbeitet werden kann75, entbindet das latent gehaltene Misstrauen Sprengkräfte, die den Bestand des Netzwerkes ernsthaft gefährden.76 Es ist ferner zu vermuten, dass diese Tendenz zur Selbstverstärkung – vom anfänglichen Argwohn bis hin zur offenen Artikulation des Verdachts – in verschiedenen Phasen verläuft. Diese Phasen lassen sich mit Hilfe eines Modells der Misstrauensaggregation illustrieren. Ein solches Modell ist freilich nur dann heuristisch wertvoll, wenn es auch die für Netzwerke charakteristische Phase der Dämpfung des Misstrauens gebührend berücksichtigt. Betrachtet man das Netz als Ganzes, so können Vermutungen über typische Verläufe, Pegelstände des Misstrauens und bestimmte Schwellenwerte77 bzw. Problempunkte, an denen die weitere Entwicklung zur Disposition der Akteure steht, angestellt werden [siehe Schaubild im Anhang]: Misstrauen ist in der Geschäftswelt ein ubiquitäres Phänomen. Es hat einen ähnlichen Stellenwert wie jene basale Vertrautheit (familiarity), die Luhmann ausführlich beschrieben 73 Es handelt sich dabei zumeist um den (mehr oder minder durch Anzeichen begründeten) Verdacht, dass andere Netzwerkteilnehmer verkappte Opportunisten sind. Solange dieser Verdacht aber eine bestimmte Schwelle nicht überschritten hat, wird die „exit“- oder „voice“-Option nicht ergriffen. Der Verdacht muss zuvor erhärtet werden, muss sich zur Gewissheit zuspitzen. Aber selbst dann bleibt noch die Möglichkeit bestehen, dass der Opportunismus der Anderen nur eine relative Schädigung des misstrauischen Akteur bewirkt. Eine disparitätische bzw. ungerechte Verteilung von Gewinnen hat nicht zwangsläufig exit oder voice dessen zufolge, der diese Schieflage bemerkt. Sie kann hingegen zur Entwicklung einer opportunistischen Einstellung führen. 74 „Mißtrauen hat eine inhärente Tendenz, sich im sozialen Verkehr zu bestätigen und zu verstärken. (...) Ein solcher Verstärkungseffekt ist durch vielfältige Beobachtungen, namentlich im Organisationsmilieu, belegt“ (Luhmann 1989³: 82f.). 75 Die allseitige Kenntnis der Risiken stellt ja schließlich ein Konstituens von Netzwerken dar. 76 Der schweigende misstrauische Akteur, der Opportunismus bei anderen wittert oder Anzeichen für die Bildung von Sonder-Netze im Netzwerk wahrnimmt, verwandelt sich selbst in einen potentiellen Opportunisten. Er sucht seine Chance, um unter günstigen Umständen aus dem Netz auszusteigen. Es steht zu vermuten, dass solche Netz-Mitglieder für das Netz letztlich destruktiver sind als Personen/Firmen, die von Anfang an opportunistisch gesonnen waren. 77 Für die zeitliche Verteilung von Vertrauen und Misstrauen ist der Schwellenbegriff äußerst wichtig. Mit seiner Hilfe werden eine Vielzahl von Erfahrungsmöglichkeiten zusammengefasst und vereinfacht. Nicht jede Kleinigkeit z. B gilt als Auslöser für die Zerstörung von Vertrauen. Es muss erst eine bestimmte Grenze passiert werden, damit die Neuorientierung (z.B. das Misstrauen) stattfindet. Die „Schwellen“ des einzelnen Akteurs oder Systems sind abhängig von strukturellen Randbedingungen und von der jeweiligen Personen- oder Systemgeschichte. (Zu Semantik und Funktion des Schwellenbegriffs vgl. Luhmann 1989³: 80ff.). 22 hat (1968/1989³,1988). Von besonderer Bedeutung für eine angemessene Netzwerktheorie ist der Umstand, dass Misstrauen im Vorfeld der Netzwerkbildung empirisch nachzuweisen ist. Untersuchungen über die Startphase von Netzwerken sind darauf gestoßen (Ortmann/Schelle 2000: 255ff.; Yoshino/Rangan 1995: 124), dass eine Art basales Misstrauen gegenüber Kooperationen mit unbekannten oder wenig bekannten Partnern besteht.78 Ähnliche Ausgangssituationen werden in spieltheoretischen Konzepten beschrieben (Axelrod 1984) Hier wird ein genereller diffuser Vorbehalt in den Blick genommen, ein Gespür für Gefahren79, die in jeder Kooperation liegen, die mit erheblichen Vorleistungen verbunden ist. Man wartet in dieser Lage ab oder macht tastende Versuche der Interaktion. Das basale Misstrauen weicht erst dann, wenn eine explizite Netzwerksemantik ins Spiel kommt, die den Gefahren-Instinkt in Risikobewusstsein transformiert. Mögliche Schäden und Verluste werden dann in kalkulierbare Begleiterscheinungen von erfolgversprechenden Investitionen übersetzt. Die Netzwerkemphase macht negative Effekte zu items, mit denen man rechnen kann, deren Wahrscheinlichkeit sich schätzen und mit Gewinnchancen vergleichen lässt. Das selbstverantwortliche Handeln tritt in den Vordergrund; fremdes Agieren erscheint als Größe, die durch eigene Schritte positiv beeinflusst werden kann. Die Philosophie des Vertrauens trägt jetzt das Handeln der Akteure. Es stiftet die Bereitschaft, Risiken einzugehen und verhilft so den Akteuren dazu, die Schwelle des diffusen Misstrauens zu überwinden. Nach der Etablierung des Netzwerks herrscht zunächst eine gewisse Euphorie.80 Die Semantik ist risiko-affin und konflikt-avers. (A – B). Diese Anfangseuphorie klingt ab, wenn sich Routinen herausbilden oder erste Anzeichen dafür beobachten lassen, dass das Netz die hochgespannten Erwartungen nicht (oder jedenfalls nicht für alle Beteiligten gleichermaßen) erfüllt. Bei einigen Mitgliedern entsteht der Eindruck, dass ihre Gewinnchancen (absolut oder relativ) schwinden. Es folgt eine zweite Phase (B – C), in der das Misstrauen zunächst ansteigt, aber von den Beteiligten als ein normales Phänomen behandelt werden kann. Die positive Grundhaltung, die nach der heiklen Implementationszeit durch allgemeine Diskursrituale erzeugt und bestärkt wird, reicht hin, um aufkeimenden Argwohn in Schach zu halten. In dieser Phase werden zwar Informationen (z.B. auch über mögliches opportunistisches Verhalten anderer) gesammelt und gespeichert, aber noch nicht eindeutig beurteilt. Alle Akteure arbeiten an der Konstruktion einer plausiblen Netzwerkgeschichte. Man bewegt sich unterhalb der Schwelle der Aufmerksamkeit für problematische Entwicklungen des Netzwerkes. Diese Schwelle wird erst dann überschritten, wenn ein signifikantes Ereignis geschieht, das bei hinreichend vielen Mitgliedern das Misstrauen anstößt (Punkt C). Nun können die alten Daten rückblickend als Indikatoren für eigene Nachteile (bzw. fremde Vorteile) gelesen werden. Die bisher geübte schlichte Strategie der Selbstberuhigung (explizite Kundgabe der NW-Ideologie: ‚Alle sind guten Willens und mobilisieren Fähigkeiten bzw. Ressourcen’) greift jetzt nicht mehr. Das Misstrauen steigt sprunghaft an und absorbiert bei denen, die von ihm erfasst werden, erhebliche Energie. Es wird ein Punkt (D) erreicht, an dem die Re-Interpretationen der Netzgeschichte eine Entscheidung über das künftige Verhalten erzwingen. Die betroffenen Akteure können zwischen mehreren Rollen wählen. Diesen Angeboten korrespondieren Kalküle, die die jeweils vorherrschenden Erwartungsstrukturen, die sich im Zuge der anfänglichen NWInteraktionen herausgebildet haben, betreffen. Es handelt sich um die Rolle des Misstrauens78 Es äußert sich als der generelle Verdacht, dass man Angebote für Kooperationen erhält, deren Akzeptierung mehr Schaden als Nutzen bringt. Es tritt als ein Wissen über möglichen oder wahrscheinlichen Opportunismus auf: man muss stets darauf gefasst sein, auf Betrüger, Trittbrettfahrer oder ‚free rider’ zu stoßen. 79 Gefahren werden als potentielle Schäden betrachtet, die von anderen verursacht werden. Demgegenüber handelt es sich bei Risiken um potentielle Nachteile, die dem eigenen Handeln zugerechnet und aufgrund der ebenfalls möglichen Gewinne in Kauf genommen werden. 80 Ähnliche Start-Einstellungen sind aus Studien über die Konsensfiktionen in Kleingruppen – z.B. junger Ehen – bekannt (vgl. Hahn 1983). 23 Maximierers (der nicht als solcher erkennbar ist), des Misstrauens-Minimierers bzw. Reflexions-Propagandisten, des quasi-neutralen Dritten, des Sektierers und des Netzaussteigers. Der Misstrauens-Maximierer entschließt sich zur ‚doppelten Buchführung’. Er flaggt weiterhin, ggf. sogar stärker als bisher, die Bereitschaft zu vertrauensvoller Kooperation aus und setzt ostentativ seine riskanten Investitionen ins Netz fort, zugleich aber späht er die anderen Netzmitglieder aus und registriert genau ihre Beiträge. Diejenigen, die die beiden nächsten Rollen wählen, greifen in unterschiedlicher Manier auf die emphatische Netzwerk-Rhetorik zurück. Auch der Misstrauens-Minimierer kaschiert seinen Argwohn. Doch er thematisiert das Problem des Misstrauens. Indem er auf das sich beständig verschlechternde Klima im Netz aufmerksam macht, unterschiebt er die eigene kritische Sicht den anderen Mitgliedern. Damit erringt er eine Position der Überlegenheit, aus der er nun die Forderung aufstellen kann, dass das Netz die eigene Struktur und Entwicklungsdynamik intensiver reflektieren und neue Konzepte für vertrauensbildende Maßnahmen entwickeln müsse. Der quasi-neutrale Dritte tarnt sein eigenes Misstrauen, indem er die Knoten des Netzes als potentielle Orte der Zwietracht darstellt. Er plädiert für eine offene Konflikt-Kommunikation (elaborierte Kultur des Misstrauens) und bietet sich selbst als Moderator an. 81 Attraktiv ist diese Rolle besonders für jene, die sich in der Reflexionsschraube negativer ErwartungsErwartungen verfangen haben. Sie unterstellen nämlich, dass die anderen sie fälschlich für besonders rücksichtslose und virtuose Opportunisten halten. Wir haben es hier mit der Extremform einer ‚Misstrauensprojektionsprojektion’ zu tun, die sich nur dann auflöst, wenn eine souveräne und joviale Rolle, wie die des „Moderators“, eingenommen wird. Der Sektierer reagiert auf seinen eigenen Argwohn und das im Netz flottierende Misstrauen mit der Suche nach Verbündeten. Er bildet mit ähnlich Gesinnten eine interne Gruppe oder schließt sich einer bereits bestehenden Gruppe an. Auf diese Weise wird seine subjektive Unsicherheit über die wirkliche Lage, in der Chancen und Gefahren, Freunde und Feinde sich kaum mehr unterscheiden lassen, durch klare Differenzen behoben. Sobald die misstrauischen Sektierer im Netz überhand nehmen, entstehen Verhältnisse wie sie aus Organisationen bekannt sind: „When distrust splits an organization into warily circling subcommunities, pressures for in-group conformity can escalate and seal off these subgroups from each other“. Der Vergleich mit Ereignissen in Netzen ist keinesfalls überzogen; denn eine derartige Institutionalisierung von „conformity pressures“ kann „formal and informal systems“ gleichermaßen erfassen, „thus solidifying opposing positions and forcing individuals to take sides“ (Sitkin/Stickel 1996: 211). Das wohlbekannte „groupthink“-Phänomen (1996: 212) wird dann dominant, verstärkt und verhärtet die eigene Sicht, so dass Mitglieder von „outgroups“ weitgehend stereotyp und negativ wahrgenommen werden. Der Ausbruch offener Konflikte ist nur noch einer Frage der Zeit. Der Aussteiger nimmt die viel beschworene Exit-Option (Hirschman 1970) wahr. Es kann sich dabei um eine späte opportunistische Aktion handeln, die nur deshalb ausgeführt wird, damit man anderen (vermeintlichen) Opportunisten zuvorkommt. Im Zuge der Misstrauensaggregation hat sich ein anfänglicher Netz-Fan in einen überzeugten Trittbrettfahrer verwandelt, der – wie er meint – unversehens unter Seinesgleichen geraten ist und (wie die übrigen auch) nur auf den günstigen Zeitpunkt zur Gewinnmitnahme wartet. Dieser Mutant, der vom Getreuen zum Verräter geworden ist, fühlt sich, obschon er Der echte ‚neutrale Dritte’ konstituiert sich normalerweise erst im Zuge des offenen Konflikts, der unter einem starken Polarisierungssog steht. Der ‚Dritte’ entzieht sich diesem Sog und bietet sich als potentieller Friedensstifter an bzw. hält sich allzeit als ein Schlichter bereit, der die streitenden Parteien zu Kompromissen führt, bei denen keiner der Beteiligten sein Gesicht verliert. 81 24 entschieden agiert, gar nicht als Täter, sondern vielmehr als Opfer des stummen Zwangs der Netzverhältnisse, die offenbar nicht halten, was sie versprechen. Anders liegt der Fall bei misstrauischen Akteuren, die dem Druck der prekären Situation nicht gewachsen sind. Hier schließt jemand eine unübersichtlich gewordene Bilanz, weil ihm die psychischen und materiellen Kosten – sei es der ‚doppelten Buchführung’, des unablässigen Monitoring oder auch der offenen Äußerung seines Verdachts (Voice-Option) – zu hoch erscheinen. Damit verzichtet er natürlich auf mögliche Gewinne. Aber die penetrante Erwartung relativer oder absoluter Einbußen musste um jeden Preis (auch den des realen, aber gering gehaltenen Verlustes) vor der drohenden Erfüllung bewahrt werden. 4. Ausblick – Die produktive Rolle des Misstrauens in Netzwerken All diese theoretischen Überlegungen (die sich wenigstens partiell auch empirisch absichern lassen) weisen darauf hin, dass Misstrauen ein irreduzibles, weder mit Vertrauen noch mit anderen Mechanismen der sozialen Ordnungsbildung zu verrechnendes Phänomen darstellt. Dieses Ergebnis hat besonders gravierende Folgen für die Konzeptualisierung von strategischen Netzwerken, die ja als die anspruchsvollste Form vertrauensbasierter Ordnung vorgestellt werden. Anspruchsvolle Netzwerke, die robust und kreativ sind, können nur geknüpft und am Leben erhalten werden, wenn die Akteure für die latente Dynamik des Misstrauens und die diversen Formen des Umgangs mit Unterstellungen, Vermutungen, Projektionen, negativen Erwartungs-Erwartungen etc. Sensibilität entwickeln.82 Ohne Wissen über latente Prozesse und raffinierte Arten von Opportunismus lassen sich die spezifischen Spielregeln, auf die Netzwerke angewiesen sind, nicht verfeinern. Um einerseits produktives Misstrauen zu wecken und andererseits die Übergeneralisierungen des Misstrauens sowie das Überschreiten der „exit“-Schwelle unwahrscheinlich zu machen, müssen die bislang existierenden Maximen-Kataloge verbessert werden. Ortmann/Schnelle haben die Essenz von Netzwerk-Spielregeln auf die knappe Formel gebracht: „Sei kooperativ, provozierbar und nicht nachtragend“ (2000: 228). Das ist viel, reicht aber noch nicht aus. Wir können das übersetzen in die erweiterte Formel: ‚Riskiere bewusst, halte dein Vertrauen wachsam und dein Misstrauen im Zaum’, oder noch schärfer: ‚Kultiviere dein Misstrauen, denn ein kultiviertes Misstrauen ist des beste Garant für die Effektivität des Netzwerkes’. Lewicki et al. (1998) haben in ihrer (oben diskutierten) Theorie des Misstrauens diesen Aspekt besonders hervorgehoben. Der von ihnen vollzogene Perspektivenwechsel beschränkt sich ja nicht auf die Einführung des Misstrauens als eigenständiges Phänomen, sondern nimmt die positiven Auswirkungen des Misstrauens in den Blick. Der Bruch mit dem impliziten Harmonismus des bisherigen Theoriedesigns wird zwar im Rahmen einer Organisationsanalyse vollzogen, trägt aber auch zur Präzisierung der bislang nur sehr allgemein formulierten These der Netzwerksoziologie bei, wonach Netze deshalb besonders effektiv sind, weil sie kooperative und kompetitive Handlungsweisen dauerhaft verschränken. 82 Hierzu können auch computertechnische Unterstützungssysteme eingesetzt werden. Mit solchen Systemen werden die für das Konfliktmanagement typische Schlichteraktivität zeitlich vorverlegt. Schlichter dienen nicht dazu, Konflikte zu dämpfen oder zu verdrängen, sondern haben die Aufgabe, Konflikte in kommunikative Auseinandersetzungen zu überführen, die im günstigsten Falle in einen Kompromiss einmünden. Die Autorität und Kompetenz derartiger Schlichter hängt maßgeblich von der Neutralität ihrer Position ab. Computertechnische Unterstützungssysteme besitzen von vornherein diese Aura der Neutralität und sind deswegen besonders geeignet, latente und heikle Szenarien der Interaktion manifest zu machen und die ans Licht geholten Probleme einer Lösung zuzuführen. Zu potentiellen Unterstützungssystemen vgl. Gans et al. (2001), zur Relevanz neutraler Dritter Ellrich (2001b). 25 Empirische Studien haben gezeigt, dass in Netzwerken intensive Rivalität und intensive Zusammenarbeit gleichzeitig vorliegen können83. Saxenian etwa führt die Erfolgsgeschichte des Silicon Valley auf eine paradox anmutende Konstellation zurück: „It was the juxtaposition of competitive rivalries and quasi-familial loyality that distinguished the aera“ (1994: 31). Der familiäre Charakter der Netzwerkkultur des Valley lässt sich dabei nicht als autoritative (und damit risikofreie) Einhegung konkurrenten Verhaltens begreifen – das berühmte Barbecue der Rivalen ist trotz aller Freundschaft und Solidarität auch ein Ort des wechselseitigen Aushorchens und Spekulierens. Saxenians Schilderungen laufen darauf hinaus, dass die Besonderheit dieses regionalen Netzwerkes nicht nur in der Bevorzugung des bewusst eingegangenen Risikos, und nicht nur in einer breiten Akzeptanz des Scheiterns als einer Gelegenheit zum Lernen liegt, sondern auch in einer gelebten Kultur84 des offenen und ‚freundschaftlich eingehegten Misstrauens’. Dieser Befund zwingt zu einer Veränderung des gängigen Konzepts von „network culture“. Bisher wurde der kulturelle Aspekt von Netzwerken zumeist mit Eigenschaften wie Gemeinschaftssinn oder Identitätsstiftung gleichgesetzt. Übersehen wurde dabei freilich jene problematischen Folgen, auf die die Ansätze zur „network governance“ (Jones/Hesterly/Borgatti 1997) mit Nachdruck hingewiesen haben: Die Pflege von „network culture“ macht opportunistisches Verhalten unwahrscheinlicher, führt aber auch zu einer Homogenisierung des Netzwerkes, die das Effektivitätsniveau senkt. Die Arbeit an der Netzwerkkultur sollte sich durch Theorien leiten lassen, die das Wechselspiel von Vertrauen (das als personen- und systembezogene Risikobereitschaft gefasst wird) und Misstrauen thematisieren und so die eindimensionale Gegenüberstellung von allzu beruhigender Homogenität und allzu gefährlicher Heterogenität aufbrechen. Denn allein ein hinreichendes Maß an Misstrauen macht die Netzwerkpartnerschaften wachsam, motiviert zur beständigen Suche nach alternativen Partnern und zur Nutzung von netzwerkexternen „weak ties“85. Es sind solche Aktivitäten, die die Grenzen des Netzwerk offen halten und die erforderliche Kompetenz, neuen Herausforderungen schwungvoll zu begegnen, gewährleisten. Aus der Vogelperspektive betrachtet, liegt die Besonderheit von Netzwerken – d.h. ihre Situierung zwischen Markt und Hierarchie – darin begründet, dass sie der inhärenten Paradoxie, die sie entfalten, eine produktive Wendung geben: Soziale Netzwerke sind durch die Selbstverstärkungsdynamiken des Misstrauens dauergefährdet, benötigen aber zugleich ein hinreichend hohes Maß an kultiviertem Misstrauen, um effektiv zu bleiben. Erst die vorgenommene Unterscheidung von zwei Arten des Vertrauens (trust und Netzwerkvertrauen) sowie die Berücksichtigung des Misstrauens erlaubt eine „Neubeschreibung“ von Vernetzung, die den schmalen Korridor der Aufrechterhaltung von zugleich robust-vertrauensbasierter wie kreativ-flexibler Interaktion identifizieren kann. Soziale Netzwerke sind demnach 83 Staber (2000) hat das Vorliegen von intensiven Rivalitäten (und von interorganisationaler Gleichgültigkeit) als einen der wichtigsten Gegenstände der zukünftigen Netzwerkforschung bezeichnet, da sich diese Phänomene weder mit einem (harmonistischen) Solidaritäts-Bias noch mit einer generalisierten Opportunismusannahme erklären lassen. 84 Interessanterweise basiert die Effizienz der Einbindung in ein regionales Netzwerk in diesem Fall auf einem Missverständnis: Die Protagonisten sahen (und sehen) sich selbst als technische Pioniere und nicht als Netzwerkgründer bzw. -mitglieder. 85 Lewicki et al. beziehen ihr Argument an diesem Punkt ausdrücklich auf die bekannte „strenght of weak ties“ (Granovetter 1973): „By the same token, those to whom we are weakly tied are more inclined to have values and preferences different from our own, providing a partial foundation for distrust within the relationship. ... Ultimately, a party’s effectiveness in organizing for concerted action depends on his or her ability to leverage the benefits of diversity while managing the inherent dynamics of trust and distrust within the relationship“ (1998: 453). 26 Sozialformen, in denen die Aufrechterhaltung von „produktiven Spannungen“ (Staber 2000) auf der Handlungsebene und die „Balancierung eines dynamischen Ungleichgewichtes“ (Lewicki et.al. 1998) auf der Systemebene notwendig ist. Die Umsetzung in ein empirisches Forschungsdesign sollte an dieser Figur gelingender (oder misslingender) Balancierung ansetzen. Soziale Netzwerke können auf Grund von vier unterschiedlichen Entwicklungen ihre Effizienzvorteile einbüßen oder gar scheitern: 1. durch ein Übermaß an Routinisierung von Reputationszuschreibungen, 2. durch ein Übermaß von “Netzwerkvertrauen”, 3. durch die Überschreitung eines Schwellenwertes des Misstrauens, und 4. durch die Implementierung allzu rigider Selbstregulationsmechanismen v.a. formaler Art. Auf die Frage, wo die jeweiligen Schwellenwerte liegen und wie die Balance gehalten werden kann, lässt sich erst eine informative Antwort geben, wenn die Analyse von Netzwerken die Kultivierung des Misstrauens ins Zentrum der Aufmerksamkeit stellt. Literatur Axelrod, R., 1984: The evolution of cooperation. New York: Basic Books. (dt. 1987: Die Evolution der Kooperation, München: Oldenbourg). Bachmann, R., 1998: Kooperation, Vertrauen und Macht in Systemen Verteilter Künstlicher Intelligenz. S. 197234 in Malsch, T. (Hrsg.): Sozionik. Berlin: sigma. Barber, B., 1983: The logic and limits of trust. New York: Rutgers University Press. Beckert, J., 1997: Grenzen des Marktes. Die sozialen Grundlagen wirtschaftlicher Effizienz. Frankfurt a.M./New York: Campus. Bianco, W. T., 1994: Trust: representatives and constituents. Ann Arbor: University of Michigan Press. Blau, P. M., 1964: Exchange and power in social life. New York: John Wiley. Brown, P. G., 1994: Restoring the public trust: A fresh vision for progressive government in America. Boston: Beacon Press. Burt, R. S./Knez, M., 1996: Trust and Third-Party Gossip. S. 68-89 in Kramer, R.M./Tyler, T.R. (Eds.): Trust in organizations. Thousand Oaks: Sage. Castelfranchi, C./Falcone, R., 1999: Social Trust: A Cognitive Approach. invited talk at International Workshop on Agent-Oriented Information Systems, CAiSE 1999, Heidelberg. Internet-Dokument unter http://www.aois.org/99/castelfranchi-Social-Trust-paper.doc. Coleman, J. S., 1990: Foundations of social theory. Cambridge, Ma.: Harvard University Press. (dt. 1991: Grundlagen der Sozialtheorie, Bd. 1. München, Oldenbourg). Dasgupta, P., 1988: Trust as a commodity. S. 49-72 in Gambetta, D. (Ed.): Trust. Making and Breaking Cooperative Relations. New York: Basil Blackwell. Deutsch, M., 1958: Trust and suspicion. Journal of Conflict Resolution 2: 265-279. Deutsch, M., 1973: The resolution of conflict. Constructive and destructive processes. New Haven: Yale University Press. (dt. 1976: Konfliktregelung: konstruktive und destruktive Prozesse. München/Basel: E. Reinhardt). Ellrich, L., 2001a: Medialer Normalismus und die Rolle der digitalen Elite. In Allmendinger, J. (Hrsg.): Die Gute Gesellschaft. Opladen: Leske und Budrich. Ellrich, L., 2001b: Unsichtbare Dritte. Elitenlatenz und neue Medien. In Hitzler, R. (Hrsg.): Elitenmacht. Opladen: Leske und Budrich. Fukuyama, F., 1995: Trust: the social virtues and the creation of prosperity. New York: Free Press. Gambetta, D., 1988a: Can we trust? S. 213-237 in Gambetta, D. (Ed.): Trust. Making and Breaking Cooperative Relations. New York: Basil Blackwell. Gambetta, D., 1988b: Mafia: The price of distrust. S. 158-175 in Gambetta, D. (Ed.): Trust. Making and Breaking Cooperative Relations. New York: Basil Blackwell. 27 Gambetta, D. (Ed.), 1988: Trust. Making and breaking cooperative relations. New York: Basil Blackwell. Gans, G./Jarke, M./Lakemeyer, G./Kethers, S./Ellrich, L./Funken, C./Meister, M., 2001: Requirements modelling for organization networks: A(dis)trust based approach. Requirements Engeneering (in Vorb.). Garfinkel, H., 1963: A conception of, and experiments with 'trust' as a condition of stable concerted actions. In Harvey, O.J. (Ed.): Motivation and Social Interaction. New York: Ronald Press. Garment, S., 1991: Scandal: The culture of mistrust in American politics. New York: Times Books. Giddens, A., 1976: Functionalism: Après la lutte. Social Research 43: 325-366. Giddens, A., 1990: The consequences of modernity. Oxford: Polity Press. Giddens, A., 1996: Risiko, Vertrauen und Reflexivität. S. 316-337 in Beck, U./Giddens, A./Lash, S. (Hrsg.): Reflexive Modernisierung. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Godelier, M., 1996: L'enigme du don. Paris: Librairie Arthème Fayard. Granovetter, M. S., 1973: The strength of weak ties. American Journal of Sociology 78: 1360-1380. Hahn, A., 1983: Konsensfiktionen in Kleingruppen. S. 210-232 in Neidhardt, F. (Hrsg.): Gruppensoziologie. Opladen: Westdeutscher Verlag. Hardin, R., 1983: The street-level epistemology of trust. Politics and Society 2: 137-141. Hasse, R./Krücken, G., 1999: Neo-Institutionalismus. Bielefeld: transcript. Heidling, E., 2000: Strategische Netzwerke. Koordination und Kooperation in asymmetrisch strukturierten Netzwerken. S. 63-86 in Weyer, J. (Hrsg.): Soziale Netzwerke. München: Oldenbourg. Hirschman, O. E., 1970: Exit, voice and loyality. Cambridge, Ma.: Harvard University Press. Jones, C./Hesterly, W./Borgatti, S., 1997: A general theory of network governance: Exchange conditions and social mechanisms. Academy of Management Review 22: 911-945. Junge, K., 1998: Vertrauen und die Grundlagen der Sozialtheorie - Ein Kommentar zu James S. Coleman. S. 2663 in Müller, H.P./Schmid, M. (Hrsg.): Norm, Herrschaft und Vertrauen. Opladen: Westdeutscher Verlag. Kern, H., 1997: Vertrauensverlust und blindes Vertrauen. S. 271-282 in Hradil, S. (Hrsg.): Differenz und Integration. Frankfurt a.M./New York: Campus. Kern, H., 1998: Lack of trust, surfeit of trust: Some causes of the innovation crises in german industry. S. 203213 in Lane, C./Bachmann, R. (Eds.): Trust within and between Organizations. Oxford: Oxford University Press. Köhler, H.-D., 2000: Netzwerksteuerung und/oder Konzernkontrolle? Die Automobilkonzerne im Internationalisierungsprozeß. S. 280-300 in Sydow, J./Windeler, A. (Hrsg.): Steuerung von Netzwerken. Opladen: Westdeutscher Verlag. Kramer, R. M., 1991: Intergroup relations and organizational dilemmas. In Staw, B.M./Cummings, L.L. (Eds.): Research in organizational behavior; Vol. 13. Greenwich (CT): JAI Press. Kramer, R. M., 1994: The sinister attribution error: Paranoid cognition and collective distrust in organizations. Motivation and Emotion 18: 199-230. Kramer, R. M./Tyler, T. M. (Eds.), 1996: Trust in organizations. Frontiers of theory and research. Thousand Oaks: Sage. Krebs, M./Rock, R., 1997: Unternehmensnetzwerke - eine intermediäre oder eigenständige Organisationsform? S. 322-345 in Sydow, J./Windeler, A. (Hrsg.): Management interorganisationaler Beziehungen. Vertrauen, Kontrolle und Informationstechnik. Opladen: Westdeutscher Verlag. Lane, C./Bachmann, R. (Eds.), 1998: Trust within and between organizations. Oxford: Oxford University Press. Lewicki, R. J./Bunker, B. B., 1996: Developing and maintaining trust in work relations. S. 114-139 in Kramer, R.M./Tyler, T.R. (Eds.): Trust in Organizations. Thousand Oaks: Sage. Lewicki, R. J./McAllister, D. J./Bies, R. J., 1998: Trust and Distrust: New Relationsships and Realities. Academy of Management Review 23(3): 438-458. Luhmann, N., 1968 (19893): Vertrauen. Stuttgart: Enke. Luhmann, N., 1988: Familiarity, confidence, trust: problems and alternatives. S. 94-107 in Gambetta, D. (Ed.): Trust. Making and Breaking Cooperative Relations. New York: Basil Blackwell. 28 March, S., 1994: Trust in Distributed Artificial Intelligence. S. 94-111 in Castelfranchi, C./Werner, E. (Eds.): Artificial Social Systems. Berlin/New York: Springer-Verlag. Matiaske, W., 1999: Soziales Kapital in Organisationen. Eine tauschtheoretische Studie. München: Rainer Hampp Verlag. Mauss, M., 1925 (1950): Essai sur le don (dt. 1999: Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften. Frankfurt a.M.: Suhrkamp). Paris: PUF. Ortmann, G./Schnelle, W., 2000: Medizinische Qualitätsnetzwerke - Steuerung und Selbststeuerung. S. 206-233 in Sydow, J./Windeler, A. (Hrsg.): Steuerung von Netzwerken. Opladen: Westdeutscher Verlag. Parsons, T./Smelser, N., 1956: Economy and Society. London: Routledge. Petermann, F., 1985 (19963): Psychologie des Vertrauens. Salzburg: Hogrefe-Verlag. Piore, M., 1995: Beyond Individualism. Cambridge, Ma./London: Harvard University Press. Powell, W., 1990: Neither market nor hirarchy: Network forms of organization. S. 295-336 in Staw, B./Cummings, L.L. (Eds.): Research in organizational behavior, Vol. 12. Greenwich: JAI Press. Preisendörfer, P., 1995: Vertrauen als soziologische Kategorie. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 24: 263-272. Ring, P. S., 1993: Processes faciliating reliance on trust in inter-organisational networks. S. 367-406 in Ebers, M. (Ed.): Inter-organizational networks: Structures and processes. Berlin. Ripperger, T., 1998: Ökonomik des Vertrauens. Analyse eines Organisationsproblems. Tübingen: Mohr. Rousseau, D. M./Sitkin, S. B./Burt, R. S./Camerer, C., 1998: Not so different after all: A cross-discipline view of trust. Academy of Management Review 23(3): 393-404. Sako, M., 1992: Prices, Quality and Trust. Inter-Firm Relations in Britain and Japan. Cambridge, Ma.: Cambridge University Press. Saxenian, A., 1994: Regional advantage: Culture and competition in Silicon Valley and Route 128. Cambridge, Ma.: Harvard University Press. Scheidt, B., 1995: Die Einbindung junger Technologieunternehmen in Unternehmens- und Politiknetzwerke: Eine theoretische, empirische und strukturpolitische Analyse. Berlin: Duncker und Humblot. Seligman, A., 1997: The problem of trust. Princeton: Princeton University Press. Sellerberg, A.-M., 1982: On Modern Confidence. Acta Sociologica 25: 39-48. Semlinger, K., 1993: Effizienz und Kontrolle in Zulieferungsnetzwerken. Zum strategischen Gehalt von Kooperationen. S. 309-354 in Staehle, H.W./Sydow, J. (Hrsg.): Managementforschung 3. Berlin/New York. Shapiro, S. P., 1987: The social control of impersonal trust. American Journal of Sociology 93: 365-377. Shapiro, D./Sheppard, B. H./Cheraskin, L., 1992: Business on a handshake. Negotiation Journal 8: 365-377. Shionoya, Y./Yagi, K. (Eds.), 2001: Competition, trust and cooperation. Berlin/Heidelberg: Springer. Simmel, G., 1908 (19685): Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung. Berlin: Duncker und Humblot. Sitkin, S. B./Roth, N. L., 1993: Explaining the limited effectiveness of legalistic 'remedies' for trust/distrust. Organization Science 4: 367-392. Sitkin, S. B./Stickel, D., 1996: The road to hell: The dynamics of distrust in an era of quality. S. 196-215 in Kramer, R.M./Tyler, T.R. (Eds.): Trust in Organizations. Thousand Oaks: Sage. Staber, U., 2000: Steuerung von Unternehmensnetzwerken: Organisationstheoretische Perspektiven und soziale Mechanismen. S. 58-87 in Sydow, J./Windeler, A. (Hrsg.): Steuerung von Netzwerken. Opladen: Westdeutscher Verlag. Sydow, J., 1992: Strategische Netzwerke. Evolution und Organisation. Wiesbaden: Gabler. Sydow, J./Windeler, A. (Hrsg.), 2000: Steuerung von Netzwerken. Konzepte und Praktiken. Opladen: Westdeutscher Verlag. Sztompka, A., 1995: Vertrauen: Die fehlende Ressource in der postkommunistischen Gesellschaft. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 35: 254-276. 29 Sztompka, A., 1999: Trust. A sociological theory. Cambridge,UK: Cambridge University Press. Thimbleby, H., 1994: Trust in CSCW. In Scrivener, S. (Ed.): Computer-Supported Cooperative Work: The multi-media and networking paradigm. Aldershot: Avebury Technical. Voskamp, U./Wittke, V., 1997: Vom "Silicon Valley" zur "virtuellen Integration" - Neue Formen der Organisation von Innovationsprozessen am Beispiel der Halbleiterindustrie. S. 212-243 in Sydow, J./Windeler, A. (Hrsg.): Management interorganisationaler Beziehungen. Vertrauen, Kontrolle und Informationstechnik. Opladen: Westdeutscher Verlag. Waschkuhn, A., 1984: Partizipation und Vertrauen. Opladen: Westdeutscher Verlag. Weyer, J., 2000: Einleitung: Zum Stand der Netzwerkforschung in den Sozialwissenschaften. S. 1-34 in Weyer, J. (Hrsg.): Soziale Netzwerke. Weyer, J. (Hrsg.), 2000: Soziale Netzwerke. Konzepte und Methoden der sozialwissenschaftlichen Netzwerkforschung. München: Oldenbourg. White, H. C., 1992: Identity and Control. A structural theory of social action. Princeton: Princeton University Press. Williamson, O. E., 1985: The economic institutions of capitalism. New York. Free Press Williamson, O. E., 1993: Calculativness, trust, and economic organization. Journal of Law and Economics 36: 453-486. Winkler, G., 1999: Koordination in strategischen Netzwerken. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag. Worchel, P., 1979: Trust and distrust. in Austin, W.G./Worchel, P. (Eds.): The social psychology of intergroup relations. Belmont, Ca.: Nelson-Hall. Yoshino, M. Y./Rangan, U. S., 1995: Strategic Alliances: An entrepreneurial approach to globalization. Boston: Harvard Business School. Yu, E./Liu, L., 2000: Modelling Trust in the i* Strategic Actors Framework. In Falcone, R./Singh, M./Tan, Y.H. (Eds.): Proceedings of the Autonomous Agents Workshop on Deception, Fraud and Trust in Agent Societies, Barcelona, Spain, June 2000. Zucker, L., 1986: Production of Trust: Institutional Sources of Economic Structure. Research in Organizational Behaviour 8: 53-111. 30