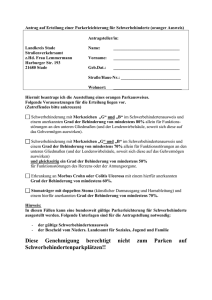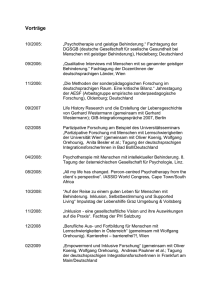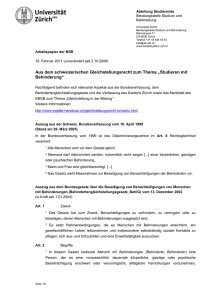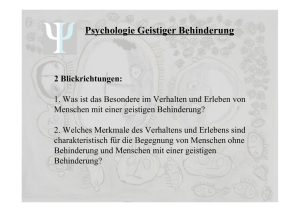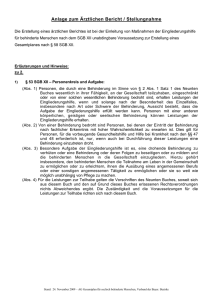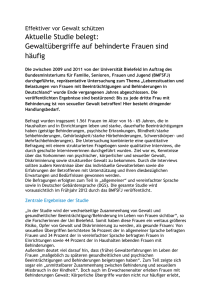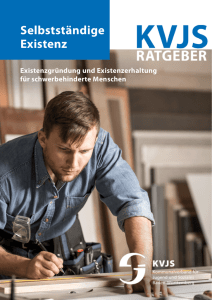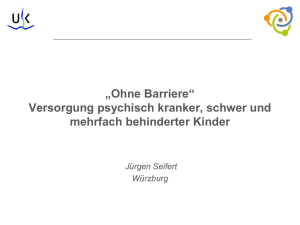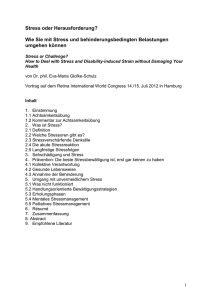Der Mensch mit Behinderung
Werbung

Was Du mir sagst, das vergesse ich. Was Du mir zeigst, daran erinnere ich mich. Was Du mich tun lässt, das verstehe ich. (aus dem Amerikanischen) 1 Vorwort Dieses Buch ist ein Ergebnis des Projektes „Bekämpfung von Diskriminierung in gemeindeintegrierten Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung: Toleranz oder Akzeptanz?“ Das Projekt wurde von der European Association of Service Providers for People with Disabilities, EASPD, (Europäische Vereinigung der Dienstleistungsanbieter für Menschen mit Behinderung) mit Förderung durch die Generaldirektion für Beschäftigung und Soziales der Europäischen Kommission durchgeführt; (das EU-geförderte Projekt wird als „Vorbereitende Maßnahme zur Bekämpfung und Vorbeugung sozialer Exklusion“ durchgeführt). In diesem Buch finden Sie die wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse, aber vor allem die Berichte aus 520 Interviews1 mit Menschen mit Behinderung und Personen aus zwölf verschiedenen europäischen Ländern, die mit und nahe bei ihnen leben. Das Buch beruht auf den Erfahrungen jener Menschen mit Behinderung, die in der Gemeinde leben, einer „inklusiven“ Gemeinschaft, die wir anstreben, indem neue politische Leitlinien2 wie die Antidiskriminierungsresolution der Europäischen Kommission umgesetzt werden, weil sie die Menschen mit Behinderung inkludiert und wertschätzt. Deinstitutionalisierung und Inklusion sind keine neue Erfindung der europäischen Länder, die an diesem Projekt mitgearbeitet haben. Als Konzepte unterscheiden sich diese Begriffe jedoch nicht nur unter den europäischen Staaten, sondern auch auf lokaler oder regionaler Ebene. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir noch sehr viel zu tun haben, wollen wir diese Konzepte in die Praxis umsetzen. Wir wollten einen Blick hinter die theoretischen Paradigmen - der vollen Bürgerrechte und - der Inklusion werfen und herausfinden, wie es den Menschen mit Behinderung in kleinen gemeindeintegrierten Wohneinrichtungen geht. Wir wollten wissen, ob sie mit ihren 1 Die in diesem Projekt eingesetzte Interviewmethode finden Sie im Anhang des Buches. Resolution des EU-Rates vom 20. Dezember 1996 hinsichtlich Chancengleichheit für Menschen mit Behinderung (OJ C 12, 13.1.1997, P.1) Direktive 2000/78/EC Einsetzung allgemein gültiger Rahmenbedingungen für Gleichbehandlung in Arbeit und Beruf 2 2 nicht behinderten Mitmenschen (mehr) Kontakt hatten und wie sich diese Beziehungen gestalteten. Wurden sie in die Gemeinschaft integriert oder fühlten sie sich als Außenseiter? Wir fragten die NachbarInnen, welche Auswirkungen solche Wohnformen auf sie hatten und wie diese ihre Vorstellung von Menschen mit Behinderung beeinflusste. Weiters finden Sie in diesem Buch die Meinung von Experten, deren Aufgabe es ist, die Menschen mit Behinderung beim Aufbau von Beziehungen mit ihren Mitmenschen zu unterstützen. Dieses Projekt war kein quantitatives Forschungsprojekt, sondern eine Suche nach Erzählungen und Geschichten, die wir zur Reflektion über Inklusion und Integration im Alltag der Menschen mit Behinderung verwenden. Uns fehlten Zeit und Mittel, um alle Daten zu verarbeiten und deshalb erachten wir dieses Werk als Anregung für Anschlussprojekte. Für dieses Projekt gibt es auch eine Webseite www.community-lives.org, auf der wir hauptsächlich gute Praxisbeispiele von gemeindeintegrierten Einrichtungen für Menschen mit Behinderung präsentieren. Wir hoffen, dass wir auf die durch die Interviews gewonnenen Erfahrungen aufbauen und sozialen Dienstleistungsanbietern, KlientInnen und deren Familien praktische Hinweise und Unterstützung bieten können. Diese Webseite soll ein interaktives Forum sein. Die Art und Weise, wie dieses Projekt und die Interviews durchgeführt wurden, gewährt uns eine Übersicht über alle gemeindeintegrierten Wohneinrichtungen in ganz Europa. Die Webseite wird eine Informationsquelle für interessierte Kreise sein, mit dem Hauptaugenmerk auf Zusatzinformationen für die alltägliche Unterstützung der Menschen mit Behinderung, damit sie ein Leben wie andere Menschen auch führen können. EASPD will die Webseite weiter ausbauen und die Datenbanken ständig aktualisieren, indem neue wichtige Informationen über Aktivitäten und antidiskriminierende Maßnahmen für Menschen mit Behinderung aufgezeigt werden. Wir freuen uns daher auf Ihre Beiträge und Kommentare. 3 Wir hoffen, dass die Berichte in diesem Buch eine Quelle der Inspiration für Sie sind. Dieses Buch soll Ihnen helfen, über Ihre ganz persönliche Haltung gegenüber Menschen mit Behinderung und Dienstleistungseinrichtungen für behinderte Menschen im Allgemeinen nachzudenken. Wir hoffen auch, dass dieses Buch und die Webseite eine breitere Diskussionsplattform über Inklusion ermöglicht und eine wertvolle Informationsquelle für Sie darstellt. Natacha Glautier EASPD Brüssel, 31. Juli 2003 4 Inhaltsverzeichnis Einleitung Hintergrundinformationen über die Methodologie des Projektes ABSCHNITT I: Kleinere gemeindeintegrierte Einrichtungen Wohnheime und verschiedene Wohnformen Wohnsitz der Menschen mit Behinderung, die an diesem Projekt beteiligt waren Einrichtungen: HeimLeiterInnen und andere Fachleute Einleitung Die Etablierung laut Personal oder LeiterInnen Erste Reaktionen der benachbarten Umgebung Grad der Interaktion und Partizipation Interaktion mit den NachbarInnen laut Mitarbeiterstab: Partizipation Maßnahmen zur Verbesserung der Interaktion und der Kontakte: Vorschläge für betreuendes Personal Information und Erhöhung des Bewusstseins TraIng der Schlüsselqualifikationen für KlientInnen Vorschläge für die Leitung der Serviceeinrichtung Netzwerk von Freiwilligen im Ort Präsenz im Ort Öffnung nach außen durch die Serviceeinrichtung Vorschläge für die Organisation Personal und Finanzen Versorgung mit Pflege- und Betreuungsdienstleistungen: Unterstützung hinsichtlich Empowerment Auswahlmöglichkeit und Autonomie Beratung der KlientInnen Lebensplanung für KlientInnen Förderung der Nutzung allgemein zugänglicher Einrichtungen Schlussfolgerungen – Standpunkt des Personal und anderer Experten 5 ABSCHNITT II: Die Nachbarumgebung und ihre BewohnerInnen Einleitung Etablierung der Serviceeinrichtung und die Beteiligung der NachbarInnen Reaktionen bezüglich der gemeindeintegrierten Einrichtungen Auswirkungen durch den Kontakt mit Menschen mit Behinderung Das Bewusstsein erhöhen? Verbesserung der kommunikativen Fähigkeiten Dienstleistungen und Einrichtungen in der Umgebung Unzugänglichkeit Vorstellung der Menschen mit Behinderung als KlientInnen Eine Person mit Behinderung beschäftigen Schlussfolgerungen – Standpunkt der NachbarInnen ABSCHNITT III: Der Mensch mit Behinderung Einleitung Auszug Negative Auswahlmöglichkeiten Evaluierung des Konzeptes Gemeindeintegrierte Wohnstätten für Wohngemeinschaften oder Empowerment Tägliche Aktivitäten Beschäftigung Warum sind unserer Meinung nach Beschäftigung und Arbeit so wichtig? Freizeit Zugänglichkeit Psycho-soziale Unzugänglichkeit Beförderungsmittel Bedarf an Unterstützung und Anleitung Soziale Netzwerke und Beteiligung an gesellschaftlichen Aktivitäten und sozialen Beziehungen Freundschaft Freizeitaktivitäten Familienleben Menschen mit Behinderung und ihr Selbstbild Interaktion mit nicht behinderten Mitmenschen Positive Diskriminierung 6 Paternalistische Wahrnehmung und das ‘Ewige-Kind’-Syndrom Vorurteile und Missverständnisse Problem Kommunikation – aber wessen Problem ist es eigentlich? Sich unbehaglich fühlen Diskriminierung Reaktionen und Meinungen bezüglich intolerantes Verhalten Die Nachbarschaft Positive Interaktionen mit den NachbarInnen Negative Erfahrungen mit NachbarInnen - Ärger mit Kindern und Jugendlichen, Lärmbelästigung und Streitereien Schlussfolgerungen – Standpunkt der Menschen mit Behinderung ALLGEMEINE SCHLUSSFOLGERUNGEN Was ist eine gemeindeintegrierte Wohneinrichtung? Beziehungen zu anderen Menschen/NachbarInnen Auswahlmöglichkeiten Die Möglichkeit, Fähigkeiten und Kompetenzen zu entwickeln Schlussausführung Checkliste für soziale Dienstleistungsanbieter Zukunftsforschung 7 Einleitung Menschen mit Behinderung wurden von der EU-Kommissarin Anna Diamantopoulou in ihrer Rede anlässlich der Eröffnung des Europäischen Jahres der Menschen mit Behinderung 2003 als ‘unsichtbare Bürger’ bezeichnet. Die Menschen mit Behinderung, die wir für die Interviews kontaktiert haben, sollten schon mehr in das Licht der Öffentlichkeit gerückt sein, weil sie bereits in gemeindeintegrierten Wohnstätten leben. Ihre Erzählungen und Erfahrungen werden zeigen, ob diese spezielle Wohnform die Wirkung zeitigte, die sich die Menschen mit Behinderung wünschen. In der Literatur wird das Wohnen in einer Gemeinschaft mit folgenden Inhalten assoziiert (LINDSAY, W. R., 2002): 1. Stärkeres Gefühl des Heimischseins und bessere äußere Lebensbedingungen 2. Bessere Anpassungsfähigkeit nach der Übersiedlung 3. Umfassendere Teilhabe an Alltagsaktivitäten 4. Verstärkte Mitwirkung bei örtlichen Aktivitäten. Zurzeit gibt es keine Standards, um diese neuen Serviceeinrichtungen in der Bevölkerung zu evaluieren und mit anderen Einrichtungen zu vergleichen. Unser besonderes Interesse gilt den beiden letzten Punkten bezüglich Teilhabe und Partizipation. In den Berichten, die wir aus ganz Europa erhielten, suchten wir gute Praxisbeispiele hinsichtlich dieser Grundsätze. In Teil I dieses Buches werfen wir einen Blick auf die Etablierung der Serviceeinrichtung und der verschiedenen Arten der gemeindeintegrierten Wohnformen für Menschen mit Behinderung. Mithilfe der Informationen des Personals und der LeiterInnen, werden wir sehen, wie die Dienstleistungen und Hilfestellungen für Menschen mit Behinderung organisiert werden. Im zweiten Teil des Buches werden wir uns die benachbarte Umgebung, in der die Menschen mit Behinderung leben, ansehen. Wir werden auch die Reaktionen und Meinungen der hiesigen Bevölkerung, in der diese Einrichtungen etabliert wurden, berücksichtigen. Durch diese Gliederung möchten wir auch gerne die Lebensumgebung, in der sich die Menschen mit Behinderung vor dem Umzug befanden, in groben Umrissen darstellen. Wir werden gerne eine ganze Reihe von Fragen stellen: 8 Wie die Serviceeinrichtung und die Umgebung das Leben der Menschen mit Behinderung beeinflusst, die entweder durch die Entscheidung anderer hierher kamen oder die selbst entschieden haben, hierher zu ziehen. Wie sich die äußeren Lebensbedingungen auf das Leben der Menschen mit Behinderung auswirken. Wie sich eine kleine, gemeindeintegrierte Einrichtung auf die Lebensqualitität und die Teilhabe der Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft auswirkt. Hintergrundinformation über die Methodologie des Projektes Wir haben in sieben europäischen Ländern Interviews durchgeführt. Wir ersuchten unsere Partnerorganisationen, Behinderteneinrichtungen ausfindig zu machen, die nach unseren Richtlinien geeignete oder von EASPD erwünschte Projektpartner sein könnten3. Zwölf Partner, soziale Dienstleistungsanbieter oder Dachorganisationen von Dienstleistungsanbietern führten die Interviews durch. Wir ersuchten alle zwölf Partner, jeweils 40 Interviews zu führen, Menschen mit verschiedenen Behinderungen mit einzubeziehen und drei verschiedene Themenschwerpunkte näher zu beleuchten. Die in Betracht gezogenen Perspektiven sind die Perspektiven der einzelnen Menschen mit Behinderung selbst, der NachbarInnen/der Umgebung und der Experten, die die Menschen mit Behinderung betreuen und unterstützen. Es war nicht beabsichtigt, das gesammelte Material quantitativ auszuwerten. Der Fokus lag auf dem Inhalt der Interviews, wobei eine qualitative Verarbeitung des Materials vorgesehen war. Dieser Prozess wurde durch das Softwarepaket „NUDIST“ erheblich erleichtert. Wir versuchten jedoch, einige statistische Daten zu inkludieren, um die stärksten Strömungen in einigen Antworten herausstreichen zu können. Die nachstehend angeführte Tabelle zeigt die Anzahl der durchgeführten Interviews in jedem Land und von jedem Themenschwerpunkt. Um einen Ländervergleich anzustellen, bräuchten wir eine ausgewogenere Selektion der Befragten. Für ein Anschlussprojekt wäre es jedoch von Nutzen, diese Vergleiche noch näher zu beleuchten, da wir durch dieses Projekt genügend Informationen erhalten haben, um daraus eine noch detailliertere Befragung für jedes einzelne Land zu erarbeiten. 3 Die von unseren Partnergruppen verwendete Definition finden Sie im Anhang. 9 Überblick über die Gesamtanzahl der Befragten pro Kategorie in jedem einzelnen Irland 24 24 24 90 276 NachbarInnen 50 33 9 12 10 12 53 179 Personal 10 3 9 4 5 4 38 73 Gesamt 113 79 36 40 39 40 181 528 Summe Finnland 18 nien Ungarn 43 nien Österreich Menschen mit Behinderung 53 Mazedo- Belgien Großbritan- Teilnehmerland. Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Antworten der befragten Menschen mit Behinderung unter Umständen durch den Interviewer beeinflusst worden sind. In einigen Fällen wurden die befragten Menschen mit Behinderung von ihren eigenen BetreuerInnenn befragt. Dadurch könnten ihre Antworten positiver als vorgesehen ausge-fallen sein. Andere Partner haben mit externen Interviewern gearbeitet. In den Interviews mit den NachbarInnen und Einrichtungen in der Umgebung müssen wir in Betracht ziehen, dass die Befragten sozial erwünschte Antworten auf die gestellten Fragen gegeben haben. Bevor wir uns die Auswirkungen der gemeindeintegrierten Wohnformen anschauen oder einen Blick auf Interaktionen in der benachbarten Umgebung werfen, müssen wir jedoch deutlich machen, was wir unter dem Konzept einer ‘gemeindeintegrierten Einrichtung für Menschen mit Behinderung’ verstehen. 10 ABSCHNITT I: Kleinere gemeindeintegrierte Einrichtungen für Menschen mit Behinderung Wohnheime und verschiedene Wohnformen Wo leben die Menschen mit Behinderung? Neben der von uns verwendeten Definition für die zu den Interviews ausgewählten Menschen mit Behinderung, wollten wir auch gerne wissen, welche unterschiedlichen Wohnmöglichkeiten es für die Menschen mit Behinderung in den verschiedenen Ländern abgesehen von den großen Behinderteneinrichtungen gibt. Dies führt zu einem besseren Verständnis bezüglich der Darstellung und des Kontexts der verschiedenen Einrichtungen in den verschiedenen Ländern. Österreich Österreich ist ein Bundesstaat mit neun Bundesländern. Jedes Bundesland hat eine eigene Gesetzgebung für Menschen mit Behinderung, was unterschiedliche Wohnund Lebensbedingungen und Dienstleistungsangebote für Menschen mit Behinderung nach sich zieht. In der Steiermark zum Beispiel gibt es für die Menschen mit Behinderung nicht sehr viele Möglichkeiten, ein unabhängiges Leben zu führen. Der Grund dafür ist ein noch immer fehlendes neues Behindertengesetz. Die derzeitige Gesetzgebung stammt aus dem Jahre 1964 und ist einer Etablierung von zeitgemäßen Wohnangeboten für Menschen mit Behinderung nicht gerade dienlich. Obwohl es natürlich bestimmte Einrichtungen und Dienstleistungen gibt, werden diese meistens durch spezielle Projekte und Programme gefördert, um die Menschen mit Behinderung auf ein Leben wie es andere auch führen, vorzubereiten. Diese Wohnungen nennt man ‘TraIngswohnungen’. In einer TraIngswohnung wohnen nicht mehr als fünf Personen mit Behinderung. Sie können aber nur begrenzte Zeit (sechs Monate bis zwei Jahre) bleiben. Sie lernen, den Haushalt zu führen und mit Geld umzugehen, damit sie später unabhängig leben können. Nach Ablauf der 11 TraIngszeit, wenn sie in der Lage sind, alleine zu leben, werden sie bei der Wohnungssuche unterstützt. Hin und wieder ist es jedoch auch notwendig, dass sie länger in der TraIngswohnung bleiben. Nach dem Aufenthalt in der TraIngswohnung werden die behinderten Menschen von der Behinderteneinrichtung durch verschiedene Aktivitäten außerhalb unterstützt. Sie leben nun allein und wenn sie Unterstützung brauchen, geschieht dies durch externe Betreuung. Menschen mit Behinderung brauchen oft Hilfe bei Mietfragen und Verträgen, Sozialhilfe, bei ihrer Verpflegung und bei ihren Finanzen. ... In Vorarlberg leben im Durchschnitt drei Menschen mit Behinderung in einer gemeindeintegrierten Wohnung. In der Steiermark gibt es dazu aufgrund des fehlenden Gesetzes noch keine Erfahrungen. Belgien In Belgien gibt es für Menschen mit Behinderung viele Alternativen zu großen Institutionen. Es gibt Wohnmöglichkeiten für Menschen mit einer körperlichen Behinderung, wo der/die KlientIn allein oder mit seiner/ihrer PartnerIn in einer kleinen Wohnung lebt. Diese Wohnungen sind in Blöcken angeordnet, eine Rund-um-die-Uhr Betreuung ist in Notfällen oder dringenden Fällen möglich, aber nur für alltägliche Aktivitäten. Für andere Dienstleistungen, wie zum Beispiel für die psychosoziale oder medizinische Versorgung müssen sie externe Einrichtungen aufsuchen. Unterstütztes Wohnen ist für Menschen mit Behinderung mit unterschiedlichsten Behinderungen möglich, wobei sie in einem Haus ihrer Wahl wohnen können. Zu einer vorher vereinbarten Zeit kommt ein/e BetreuerInnenIn zu ihnen. Er/sie unterstützt den/die KlientIn in allen Lebensbereichen, wie zum Beispiel Beschäftigung, Besuch von Ämtern und Behörden, Ausbildung. ... In Belgien gibt es auch ein System der mobilen Heimbetreuung. Hier besucht der/die BetreuerInnenIn die Familie, in der eine Person mit Behinderung lebt. Das Ausmaß der Betreuung hängt von den Bedürfnissen und Wünschen des/der KlientIn und seiner/ihrer Familie ab. Eine weitere Möglichkeit ist das System des geschützten Wohnens für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Diese Menschen leben in einem Haus, in dem sie einige Stunden am Tag direkte Hilfe sowie eine Rund-umdie-Uhr Betreuung zur Verfügung haben. Die Unterstützung ist sowohl für die 12 Gemeinschaft als auch für den Einzelnen ausgelegt. Durch die Rücksprache mit den verschiedenen Interessensgruppen, wie den KlientInnen (BewohnerInnen)und dem Personal wird das Haus mit seinen laufenden Anforderungen betrieben. Für die KlientInnen gibt es Unterstützung für alle Bereiche des täglichen Lebens. Eine Gruppe von acht Personen in einem Haus (selbst wenn es in einer Gemeinde integriert und getrennt von jeder anderen Einrichtung oder Wohnanlage ist) wird nicht als Wohneinrichtung für unabhängiges Wohnen anerkannt. „Unterstützte Wohnprojekte für Menschen mit Behinderung. Die meisten haben eine geistige Behinderung, einige wenige eine körperliche Beeinträchtigung. Zu Beginn wohnten sie zusammen mit anderen Menschen mit Behinderung in ihren eigenen Räumen unter einem Dach. Das Personal wohnte auch dort und unterstützte die BewohnerInnen. Dieses System wurde jedoch weiter entwickelt. Die meisten Menschen mit Behinderung leben nun in getrennten Häusern und die Assistenz ist nun ambulant. ... Sie werden auch in Geldangelegenheiten unterstützt, aber nur wenn sie es wünschen: Die KlientInnen können jederzeit über ihr Geld verfügen, aber gewöhnlich nehmen sie die Hilfe an.“ „Kleine Wohnung, in der ein Mann und eine Frau mit geistiger Behinderung wohnen. Die beiden werden jeden Tag betreut, aber nicht permanent überwacht.“ Finnland In Finnland gibt es für Menschen mit Behinderung folgende Alternativen zu großen Institutionen: Unterstütztes Wohnen; Wohngemeinschaften mit Unterstützung, je nach Bedarf der KlientInnen; Wohnanlage mit eigener Wohnung oder eigenem Zimmer; „Treppenhaus“-Modell (Treppenschacht): verschiedene Wohnungen auf derselben Stiege für Menschen mit geistiger Behinderung und eine Wohnung für das Personal inklusive Gemeinschaftsraum. 13 Die Durchschnittsgröße hängt von den Lebensverhältnissen der einzelnen BewohnerInnen ab. Ehepaare oder Paare können in einem eigenen Ein- oder Zweipersonen- Appartement wohnen. Gemeinschaftswohnungen bieten Platz für fünf bis acht Personen, können aber für bis zu 20 Personen ausgelegt werden, was viel zu viel ist, wie wir jetzt wissen. Sehr häufig werden die Menschen, die in solch großen Einrichtungen wohnen, auf zwei oder drei Häuser in der gleichen Anlage aufgeteilt und jede/r hat seine eigene Wohnung. Die Unterstützung variiert von zwei bis drei Stunden pro Tag bis zu einer Rund-um-die-Uhr Betreuung und ist von den BewohnerInnen und ihren Beeinträchtigungen abhängig. Die Unterstützung hängt von der Art der Behinderung ab. Die Gemeindeintegrierte Serviceeinrichtung hat jedoch immer Kontakt nach außen, wie groß die Abhängigkeit des KlientInnen auch sein mag. Auch Menschen mit schweren geistigen oder anderen Behinderungen nehmen am Gemeinschaftsleben (kulturelle Veranstaltungen, Restaurantbesuche, Sport, Festivals etc) meistens ohne große Probleme teil. KlientInnen, die außerhalb der großen Institutionen leben, wohnen in zeitgemäßen Einrichtungen, in wohnlichen Räumen und Appartements. Ihnen steht mehr Platz zur Verfügung als jenen Menschen mit Behinderung, die in großen Institutionen wohnen. Ungarn Neben großen Institutionen werden auch Wohngemeinschaften als eine Form der Dienstleistungseinrichtung anerkannt. Ein „Gruppenheim“ wird als eine Betreuungseinrichtung für acht bis zwölf Personen definiert – unter speziellen Bedingungen kann das obere Limit vierzehn Personen betragen. Unterstütztes, unabhängiges Wohnen mit den entsprechenden Dienstleistungsangeboten befinden sind noch in einem relativ frühen Entwicklungsstadium. Die Größe der Behinderteneinrichtungen schwankt innerhalb der gesetzlichen Vorgabe, nämlich zwischen acht bis zwölf Personen. Nichtsdestotrotz gibt es einige von Nichtregierungsorganisationen betriebene Einrichtungen mit weniger als acht Personen. Diese Einrichtungen stellen oft einen Übergang zwischen der staatlichen Pflege und dem unterstützten Wohnen in Gemeindeintegrierten Wohnmöglichkeiten dar. Es ist wichtig zu betonen, dass das Personal oft mit bürokratischen Hürden zu 14 kämpfen hat – zum Beispiel mit der Ausstellung der behördlichen Genehmigungen für finanzielle Beihilfen etc. Einige Beschreibungen von ungarischen Behinderteneinrichtungen: „Das Wohnhaus befindet sich in einem Haus mit eigenem Garten und ihre KlientInnen sind junge Menschen mit Behinderung, die aus staatlich geführten Heimen kommen. Es wird von einer kleinen religiösen Gruppe geführt, die oft als ‘Sekte’ abgestempelt wird, besonders auf dem Lande.“ „Die Einrichtung liegt in einer ganz besonderen Umgebung und wurde zwischen 1920 – 1930 für BeamtInnen des öffentlichen Dienstes gebaut. Die Straßen werden von langen Gebäuden mit mehreren Häusern mit kleinen Gärten an der Vorder- und Rückseite der Gebäude gesäumt. Alle Gebäude wurden im gleichen Stil errichtet. Die Umgebung scheint sehr friedvoll zu sein und viele der Häuser wurden ansprechend restauriert. Das Haus ist ganz in die Umgebung integriert. Ein außenstehender Beobachter könnte nicht erkennen, dass dies ein Haus für Menschen mit Behinderung ist, weil es sich von den angrenzenden Häusern weder in der Größe noch im Aussehen unterscheidet. Sie unterstützen Menschen mit geistiger Behinderung.“ Irland In Irland gibt es ein Kontinuum verschiedener Wohn- und Lebensarrangements, das hauptsächlich aus folgenden Möglichkeiten besteht: Menschen werden unterstützt, um unabhängig oder teilweise unabhängig in einem Haus oder einer eigenen Wohnung leben können (655), Menschen wohnen in einem kleinen, gemeindeintegrierten Wohnhaus (3267) Weitläufige Wohnheime (3461) Einrichtungen für intensive Arbeitsplatzsuche und -vermittlung (503), Verbleibende Einrichtungen in Krankenhäusern (515), Eine kleine Anzahl von individuellen Arrangements für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf wurde ausgearbeitet (103) und Pflegekinder (233)4 4 Alle Zahlen in dieser Übersicht sind statistische Daten aus dem Jahresbericht 2002 des National Intellectual Disability Database Committee. In diesem Bericht sind nicht alle Menschen mit einer leichten geistigen Behinderung berücksichtigt. 15 Die meisten neuen Entwicklungen findet man in den gemeindeintegrierten Wohnhäusern oder Wohngemeinschaften. Die durchschnittliche Größe eines solchen Hauses bietet fünf behinderten Personen Platz, wobei diese Anzahl ständig hinterfragt wird. Die Unterstützung dieser Wohngemeinschaften wird auf einer dezentralisierten Basis organisiert. Immer größerer Wert wird darauf gelegt, dass den HeimBewohnerInnen eine Art Besitzrecht auf Dienstleistungen zugestanden und eine starke Einbindung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht wird. Der Zugang zu den Dienstleistungen soll eher durch das Prioritätsprinzip als durch das Rechtsprinzip definiert werden. Der Großteil der Menschen -15.448- lebt zu Hause, wobei 7.407 von ihnen über 20 Jahre alt sind. Es gibt ein zunehmendes Bewusstsein für die Notwendigkeit, für eine alternde Bevölkerungsgruppe mit Behinderung rechtzeitig vorauszuplanen, um künftige Bedürfnisse abdecken zu können. Die letzte staatliche Überprüfung der Heimdienstleistungen als Teil der Einrichtungen für Menschen mit Behinderung fand 1990 statt. Im Bericht für Dienstleistungen für Menschen mit geistigen Behinderungen – Bedürfnisse und Fähigkeiten steht im Abschnitt 9.5: ‘Wenn eine Person mit einer geistigen Behinderung ihre Familie entweder vorübergehend oder für immer verlassen muss, sollte das Ersatzheim alle Merkmale eines guten Heimathauses aufweisen’. Ein neuer Prüfbericht wird in Kürze veröffentlicht. Die staatliche Behörde für Behindertenangelegenheiten ist dabei, nationale Standards für Pflegedienstleistungen inklusive Heimdienstleistungen zu entwickeln (zur Zeit im Pilotstadium), die sich auf interne Aktivitäten beziehen und in engem Zusammenhang mit personenzentrierten Serviceangeboten stehen. Diese sind auf der Webseite www.nda.ie verfügbar. Eine Beschreibung einer Wohneinrichtung: „Fünf KlientInnen mit einer leichten geistigen Behinderung in einem Haus. Es gibt Rund-um-die-Uhr Betreuung.“ Mazedonien In Mazedonien gibt es außer den großen Heimeinrichtungen keine Wohnmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung. Die Menschen mit Behinderung, die in der 16 Gemeinschaft integriert sind, wohnen entweder bei ihren Eltern oder in einer Familie. Es gibt Tagesheime, aber sie bieten keinen Rund-um-die-Uhr Service an. Großbritannien In Großbritannien gibt es ‘unterstützes Wohnen’ für Menschen mit Behinderung. Sie leben im Wesentlichen in einem eigenen Haus, allein oder mit einem MitBewohnerInnen oder zwei MitBewohnerInnenn und sie werden von geschultem Personal, aber auch von Freunden betreut. Überwacht wird die Einrichtung vom Vertragspartner und der staatlichen Kommission für Pflegestandards. Die Menschen mit Behinderung können auch auf sogenannten vermittelten Plätzen für Erwachsene leben – das bedeutet, dass sie in einer Familie leben, die vom hiesigen Sozialamt unterstützt wird. Menschen in Heimeinrichtungen leben mit sechs bis acht Personen zusammen. Dies gilt als repräsentativer Durchschnittswert. Die meisten kleinen Einrichtungen sind für eine, zwei oder drei Personen ausgelegt. Einige Darstellungen von Einrichtungen: „Wohnheim für sechs Personen mit Lernschwierigkeiten. Alle KlientInnen verfü-gen über ihr eigenes Schlafzimmer, teilen aber andere Räumlichkeiten.“ „Wohnblöcke für Menschen mit Lernschwierigkeiten in einem angenehmen, ruhigen Ambiente einer Kleinstadt. Es ist ein großes Gebäude, in dem in einem Stockwerk acht Wohnungen behindertengerecht umgebaut wurden, ein anderes Stockwerk wurde in eine Tagesstätte mit verschiedenen Dienstleistungsangeboten umgewandelt und im Erdgeschoss gibt es Büros und einen allgemeinen Aufenthaltsraum. In sieben Wohnungen sind Menschen mit Lernschwierigkeiten eingezogen und eine wird von einem BetreuerInnen, der im Haus wohnt, benützt.“ „Ein großes Haus für vier Männer mit Lernschwierigkeiten im städtischen Bereich. Es ist ein Doppelhaus, das in einem Stockwerk nun vier nebeneinanderliegende Schlafzimmer hat, mit einer Personalwohnung im obersten Stock und Küche, Aufenthaltsräume etc. im Erdgeschoß. Fünf BetreuerInnen 17 für Rund-um-die-Uhr Betreuung stehen zur Verfügung. Ein/e BetreuerInnenIn ist immer anwesend, auch in der Nacht.“ „Eine große Organisation hat für Menschen mit Lernschwierigkeiten einen behindertengerechten Wohnblock in einem städtischen Gebiet am Meer gebaut. Die BewohnerInnen leben hier ein Jahr lang und werden auf ein selbständiges Leben in einer eigenen Wohnung vorbereitet. ... Es stehen vier Wohnungen für je eine Person und zwei Wohnungen für je zwei Personen zur Verfügung.“ Wohnsitz der Menschen mit Behinderung, die an diesem Projekt teilgenommen haben. Durch die folgenden Grafiken erhält man einen Überblick über die verschiedenen Wohnmöglichkeiten für die von uns befragten Menschen mit Behinderung. Die Antworten sind unter den Titeln ‘Wo wohnen Sie?’ und ‘Wie viele MitBewohnerInnen haben Sie?’ zu ersehen. Von den Menschen mit Behinderung, die bei diesem Projekt mitmachten, wohnen 47% in einer Mehrpersonenwohnung oder in einer Wohngemeinschaft mit anderen Menschen mit Behinderung. Nur 18% der von uns befragten Personen leben allein. Die übrigen 35% leben bei ihren Familien und hier hauptsächlich bei ihren Eltern. Wo wohnen Sie? (n= 273) 35% Familie 47% allein in Gemeinschaft 18% 18 Wieviele Mitbewohner haben Sie? (n= 133) in Gemeinschaft (keine nähere Angabe) 22% 28% weniger als 3 11% zwischen 3 - 5 mehr als 5 39% Wenn Menschen mit Behinderung in einer Mehrpersonenwohnung mit anderen behinderten Menschen leben, bewegt sich die Anzahl zwischen drei und fünf Personen. 41% dieser Gruppe (wohnen mit mehr als fünf Personen in einem Haus) wohnt mit acht Personen in einem Haus. Mehr als fünf Personen in einem Haus 5% 3% 23% 10% mit 6 - 23% mit 7 - 10% mit 8 - 41% 8% mit 9 - 8% 10% mit 10 - 10% mit 11 - 3% 41% mit 13 - 5% Ungeachtet der Tatsache, dass wir für gemeindeintegrierte Wohnstätten für Menschen mit Behinderung acht Personen als Limit angesetzt haben, sind auch größere Wohneinrichtungen in dieses Projekt einbezogen worden, weil zum Beispiel in Mazedonien dieses Konzept noch sehr neu und die Gruppenanzahl größer als in anderen Ländern ist. 19 Einrichtungen für Menschen mit Behinderung: Befragung von HeimLeiterInnen und anderen ExpertInnen Einleitung Mithilfe der durchgeführten Interviews mit HeimLeiterInnen und anderen ExpertInnen, die in diesen Einrichtungen arbeiten, wollten wir herausfinden, wie Aufbau und Organisation der Behinderteneinrichtung vor sich gingen. Wir wollten zum Beispiel in Erfahrung bringen, ob sich die HeimLeiterInnen mit den NachbarInnen oder anderen Informationsquellen in Verbindung gesetzt haben und welche Erfahrungen sie dabei gemacht haben. Wir baten sie, uns eine Evaluierung der ihnen angebotenen Hilfe und Unterstützung zu übermitteln. Zu diesen Daten kamen wir, indem wir uns den derzeitigen Stand der Interaktion ihrer KlientInnen mit der örtlichen Bevölkerung ansahen und den Grad der Autonomie ihrer KlientInnen in Bezug auf die notwendige Organisation und Versorgung notwendiger Dienstleistungen analysierten. Wir ersuchten sie weiters, darüber nachzudenken, wie sie Inklusion und Empowerment ihrer KlientInnen verbessern könnten. Die Vorbereitung laut Personal oder HeimLeiterInnen Starker Widerstand gegen die Eröffnung einer Behinderteneinrichtung in der hiesigen Nachbarschaft oder ein herzliches Willkommen? Ein HeimLeiterInnen für eine Einrichtung für elf Menschen mit einer leichten geistigen Behinderung hat ziemlich starken Gegenwind gegen diese Einrichtung und ihre künftigen BewohnerInnen geortet. Von den NachbarInnen - zwar nur von einigen wenigen - waren heftige Reaktionen gekommen. Es ging sogar so weit, dass einige NachbarInnen mit Hilfe einer Lobby diese Einrichtung verhindern wollten. Im Laufe der Zeit haben sich die Reaktionen ohne offensichtlichen Grund geändert, offenbar nur deswegen, weil die Nachbarschaft die BewohnerInnen der Einrichtung ein wenig näher kennen gelernt haben. Widerstand in der Bevölkerung: 20 „Als die Renovierungsarbeiten am Gebäude abgeschlossen waren und wir zum Einzug bereit waren, machte sich in der Bevölkerung erheblicher Widerstand breit. Sie organisierten eine öffentliche Sitzung, um die Eröffnung der Einrichtung zu verhindern, wobei die unterschiedlichsten falschen Behauptungen über unsere BewohnerInnen aufgestellt wurden. Dies geschah meiner Meinung nach nur deshalb, weil die Bevölkerung unsere Leute nicht kannte - oder sie nicht gut genug kannte – unter den OpponentInnen gab es auch einige Angestellte der Behinderteneinrichtung – oder sie haben sich einfach geirrt und getäuscht. Darüber hinaus haben sie schon von Anfang an die Idee bekämpft, noch bevor sie wussten, wer einziehen würde. Sie haben sich auch heftig gegen die Möglichkeit zur Wehr gesetzt, weitere Behinderteneinrichtungen im Ort zu eröffnen. Sie machten sich zum Beispiel dafür stark, dass unsere BewohnerInnen hinter den Institutionsmauern bleiben sollten, da dies das Beste für sie wäre. Sie sollten nicht in einem ‘normalen’ Umfeld in Freiheit leben. Die NachbarInnen behaupteten auch, dass unsere BewohnerInnen in ihre Gärten und Höfe eindringen und Diebstähle begehen würden. Diese Behauptungen muteten seltsam an, weil unsere BewohnerInnen schon in der Institution freien Ausgang hatten, um ihre Einkäufe zu erledigen etc. und es gab niemals irgendwelche negativen Rückmeldungen oder Anzeigen oder Probleme und Konflikte irgendwelcher Art mit der heimischen Bevölkerung. In regelmäßigen Abständen besuchten wir verschiedenste Veranstaltungen im Ort und hielten unsere größten Veranstaltungen im Ortszentrum ab, wobei die einheimische Bevölkerung immer dazu eingeladen wurde. Während der Reibereien sind die Besucherzahlen jedoch stark gesunken. Der Widerstand wurde vorwiegend von einigen wenigen Personen organisiert. Sie haben Unterschriften gesammelt und riefen nach einer Befragung der heimischen Bevölkerung. Dieses Referendum wurde einen Tag vor unserem Auszug abgehalten und die Leute stimmten mit ‘nein’ für unsere neue Einrichtung. ... Eine Nachbarin hat uns von Anfang an unterstützt, sie hat wirklich eine sehr positive Haltung an den Tag gelegt. Andere zeigten erheblichen Widerstand, sie haben zum Beispiel vorgeschlagen, eine Betonmauer um das Haus zu errichten, sodass sie den Anblick unserer BewohnerInnen nicht ertragen müssten. Nichtsdestotrotz änderte sich ihre Haltung innerhalb von zwei bis drei Wochen. Wir haben immer großen Wert darauf gelegt, alle zu grüßen, höflich zu sein und eine positive Haltung an den Tag zu legen. Nachdem die NachbarInnen anfingen, mit unseren Leuten zu reden und sie etwas näher kennen zu lernen, wurde ihnen bewusst, dass eine Mauer nicht notwendig war. Ich glaube, dass unsere BewohnerInnen jetzt doch von den NachbarInnen akzeptiert werden. ... Im Fernsehen gab es einen Bericht über einen Mann, der damit drohte, das Haus in die Luft zu jagen, wenn Menschen mit Behinderung einziehen würden. Doch nach und nach gewöhnte er sich an diesen Gedanken und jetzt gibt es gute Kontakte, seine Frau bringt manchmal Kekse etc. ... NachbarInnen und Einheimische besuchten uns in der Anfangsphase. Wir luden sie zu uns ein, zum Beispiel zu Silvester. Es gab auch einen Tag der offenen Tür. Sehr viele Besucher sind gekommen, ich schätze, sie waren einfach neugierig. Nun ist es so, dass wir uns nicht gerade gegenseitig besuchen, aber wir reden miteinander, wenn wir uns auf der Straße oder im Garten begegnen. Darüber hinaus holen unsere BewohnerInnen Milch und Eier von den umliegenden Bauern und kennen daher den Ort und seine Menschen sehr gut – viel besser als ich selbst. 21 22 Die ersten Reaktionen der Nachbarschaft Die Argumente, mit denen HeimLeiterInnen konfrontiert sind, reichen von der Angst vor den HeimBewohnerInnen bis zur Befürchtung, einen Wertverlust des Grundstückes zu erleiden. Einige Menschen ändern ihre ursprünglichen Gedanken nicht. Aktivitäten, um die Außenkontakte für die drei Personen mit Down-Syndrom zu verbessern, konnten das Eis leider nicht brechen, wie das folgende Beispiel eines leitenden Angestellten zeigt. „Der Bungalow wurde von der Heimleitung für Menschen, die einen größeren Freiraum benötigen, eingerichtet. Die Wohnbaugenossenschaft, der das Grundstück gehörte, hat sich vor dem Einzug der behinderten Menschen mit den NachbarInnen in Verbindung gesetzt, aber bei einigen Leuten sind sie nur auf Feindseligkeit und Misstrauen gestoßen. ... Von ihrer Türnachbarin haben sie erfahren, dass sich die Stimmung in der Nachbarschaft negativ verändert hat und ihre Grundstücke durch den Einzug der Menschen mit Behinderung an Wert verloren hätten. Diese Leute haben ihre Meinung bis heute nicht geändert. Sie wurden eingeladen, die Menschen mit Behinderung in ihrem Haus zu besuchen, haben aber die Einladung nicht angenommen. Sie wollen nicht einmal mit ihnen reden, wenn sie einander treffen.“ (Leitender BetreuerInnen eines großen Bungalows für drei Personen mit Down-Syndrom) Renovierungsarbeiten und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten haben die Kontakte zwischen den sieben KlientInnen, ihren BetreuerInnen und den NachbarInnen erheblich belastet. Nicht die neuen BewohnerInnen, sondern der Baustellenlärm war das Objekt des Widerstandes und Protestes. Als die Arbeiten fertig gestellt waren, sind auch die Probleme verschwunden. „Nachdem wir uns entschlossen haben, diese Wohnung zu kaufen, gab es von den NachbarInnen während der Renovierungsarbeiten erheblichen Widerstand. Sie hatten auch mit den Bauarbeitern einige Schwierigkeiten. Als ich das erste Mal hierher kam, empfingen sie mich ziemlich unfreundlich und führten ins Treffen, dass nicht die Menschen mit Behinderung das Problem seien, sondern dass sie die Renovierungsarbeiten nicht mehr länger hinnehmen könnten. Es war sehr laut, obwohl wir nicht sehr viel umändern mussten: Zwei Appartements wurden zu einer Wohnung umgebaut, einige Wände wurden entfernt und die Stromkabel mussten neu verlegt werden. In 23 einem Wohnblock klingt das allerdings anders. Aber das war alles, ich meine, was den Widerstand und den Protest betrifft. ...“ „Ich lud die NachbarInnen ein, zeigte ihnen alles und erklärte ihnen, was wir machten und von da an änderte sich die Situation. Zu Beginn machten wir uns Sorgen darüber, wie die jungen Leute hier aufgenommen werden würden, aber es schaut ganz gut aus. Am Anfang beschwerten sich die NachbarInnen aus dem oberen Stockwerk bei anderen NachbarInnen einige Male, weil sich jemand nach 23:00 Uhr duschte und der Lärm störend war. Aber jetzt sagen sie nichts mehr, obwohl nach wie vor um diese Zeit geduscht wird. Als sie die jungen Leute kennen lernten, haben sich die Dinge geändert. Somit hat sich der anfängliche Konflikt gelöst und es gibt keine Probleme mehr. Sie haben sich vor unseren BewohnerInnenn auch irgendwie gefürchtet bis sie sie kennen gelernt haben. Diese Angst ist zu dem Zeitpunkt verschwunden als wir zur offiziellen Eröffnung auch die NachbarInnen eingeladen haben. Viele Menschen aus der Nachbarschaft sind der Einladung dankend gefolgt und drückten ihre Anerkennung für die Einrichtung und die dahinter stehende Idee aus.“ Die folgende Erzählung einer stellvertretenden LeiterInnenin einer Behinderteneinrichtung bestätigt, dass nicht nur Menschen mit Behinderung diskriminiert werden, sondern auch andere Gruppen davon betroffen sind. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Reaktionen von Menschen hinsichtlich Menschen, die nicht ‘der Norm’ entsprechen und der Umgebung, in der sie wohnen? Können wir daraus etwas über Menschen unterschiedlicher sozialer Schichten lernen? Ist dies ein Punkt, den soziale Dienstleistungsanbieter berücksichtigen müssen, um die passende Orts-auswahl für eine gemeindeintegrierte Behinderteneinrichtung zu treffen? Wir haben in unseren Interviews keine Berichte darüber gefunden, doch eine nähere Betrach-tung dieser Fragen würde sich auf jeden Fall lohnen. „Im Allgemeinen waren die Beziehungen zur örtlichen Bevölkerung gut, aber früher gab es einige Vorfälle. Kinder aus dem Wohnblock warfen Steine in den Garten und beschimpften die BewohnerInnen. ... Sie haben diese Art von Vorurteil als ein Resultat von Ignoranz empfunden, die bis zu einem gewissen 24 Grad auch das Personal betraf. Diese Umgebung war aber sicher nicht der Ort, wo man ‘Menschen einfach so aufnimmt’. Viele Probleme im Ort waren nicht nur auf die Menschen mit Behinderung beschränkt. Es hat viele rassistische Übergriffe und verbreitet Vandalenakte im Ort gegeben. Die stellvertretende LeiterInnenin war der Meinung, dass das Personal die örtliche Bevölkerung möglichst umfassend aufklären sollte. ... Wir haben über die veränderte Einstellung in der Nachbarschaft gesprochen, wobei das Personal hier eine wichtige Rolle gespielt hat, denn die NachbarInnen wurden zu Grillfesten und anderen Veranstaltungen eingeladen und zu Weihnachten wurden Weihnachtsgrüße verschickt. Es ist nicht leicht, die Menschen mit einzubeziehen, da die meisten tagsüber arbeiten und nicht ansprechbar sind.“ Der Grad der Interaktion und Partizipation Interaktion mit den NachbarInnen laut Angaben durch den Mitarbeiterstab Als sich die ersten Wogen der Erregung geglättet hatten, ersuchten wir die BetreuerInnen, den normalen Tagesablauf und die Interaktionen ihrer KlientInnen näher zu beleuchten. Haben sie freundschaftliche Beziehungen aufgebaut und pflegen sie den Umgang mit anderen ortsansässigen Personen? Wie wird dieser Prozess von den LeiterInnen und BetreuerInnen unterstützt? Es gibt große Unterschiede in der Kommunikation zwischen der Nachbarschaft und den Menschen mit Behinderung. Ein paar bleiben stehen, um zu plaudern, andere gehen einfach vorbei. Über einige Vorfälle wurde berichtet, aber das Personal hat oft den Eindruck, dass sich die Kontakte bei näherem Kennenlernen der Behinderteneinrichtung und ihrer BewohnerInnen verbessern. Wie berichtet, hat sich die Einstellung der Menschen geändert, nicht nur die von einigen MitarbeiterInnen, sondern auch die der NachbarInnen, die laut Bericht am Anfang gewisse Befürchtungen hegten, weil sie nicht wussten, was auf sie zukam. Über die Erfahrungen der NachbarInnen werden wir in Abschnitt II berichten. Die BetreuerInnen des Wohnheimes für Menschen mit Behinderung haben sowohl positive als auch negative Ergebnisse dieser Interaktionen berichtet. 25 Negative Evaluierungen beinhalten paternalistisches Verhalten und Infantilisierung und die Wahrnehmung des ‘ewigen Kindes’. Die Fachleute, mit denen wir sprachen, haben sich über das mangelnde Wissen der Bevölkerung über Behinderung an sich beklagt. Dieses fehlende Wissen führt zu einem unrealistischen Bild der Menschen mit Behinderung und zu Vorurteilen. Im folgenden Beispiel schlägt ein Koordinator einer Tagesheimstätte für Menschen mit geistiger Behinderung vor, Regierungskampagnen und -aktionen gemeinsam mit Außenaktivitäten der Behinderteneinrichtung dafür einzusetzen, das Image der Menschen mit Behinderung in der Öffentlichkeit zu verbessern. Weiters schlägt er, Arbeitsplatz fördernde Maßnahmen zu ergreifen, um die Menschen mit Behinderung besser in den Arbeitsprozess eingliedern zu können. „Die Menschen aus der benachbarten Umgebung kennen unsere KlientInnen nicht sehr gut, weil sie mit ihren Problemen nicht vertraut sind. Sie wissen gar nichts über sie. Sie bemitleiden sie nur. Es findet keine Interaktion zwischen unseren KlientInnen und den NachbarInnen statt, selbst wenn es ungewöhnlich klingt. Die NachbarInnen helfen unseren KlientInnen nicht, sie empfinden nur Mitleid mit ihnen. Wir organisieren kulturelle Veranstaltungen, aber auch Geburtstagsparties, zu denen Einheimische eingeladen werden, um die Einrichtung und ihre BewohnerInnen kennenzulernen. Wir veranstalten Ausflüge mit Picknick gemeinsam mit den Pfadfindern. Das sind gute Kontakte. Die Kampagne zur Förderung der Menschen mit Behinderung ist notwendig, damit die Bevölkerung erkennt, welche Fähigkeiten diese Menschen haben. Die Regierung muss durch entsprechende Gesetze die Beschäftigungsmöglichkeiten für die Menschen mit Behinderung sicherstellen.“ Die Ergebnisse der Interviews bestätigen die Annahme des betreuenden Personals, dass Menschen mit Behinderung hauptsächlich wieder mit behinderten Menschen befreundet sind und wenig andere soziale Kontakte haben. Ein Sozialarbeiter eines Projektes für unterstütztes Wohnen für Menschen mit vorwiegend geistiger Behinderung fasst die Frage der informellen Kontakte und den Aufbau von Freundschaften wie folgt zusammen: „Die Menschen mit Behinderung haben im Normalfall mit ihren direkten NachbarInnen Kontakt, mit der übrigen Nachbarschaft gibt es kaum 26 Berührungspunkte. Häufig sind ihre Freunde Menschen mit Behinderung aus der Tagesheimstätte.“ „Es ist uns bewusst, das unsere BewohnerInnen vor allem Langzeitbeziehungen mit Freunden oder und ihnen gut gesinnten Menschen und mit der einheimischen Bevölkerung brauchen.“ (stellvertretende Leiterin eines Gemeindeintegrierten Wohnheimes für vier Frauen und zwei Männer mit geistiger Behinderung) Einige soziale Dienstleistungsanbieter äußern sich positiv über die Interaktion ihrer KlientInnen mit restlichen Bevölkerung. Nach Aussagen einer Betreuerin einer großen Behinderteneinrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung sind die guten zwischenmenschlichen Beziehungen auf die Freiwilligenarbeit von einigen NachbarInnen zurückzuführen. Dadurch wurde die Interaktion erleichtert und die Einrichtung mit ihren behinderten Menschen in der Gemeinde verankert. Weiters schafft diese Freiwilligenarbeit die Basis für gute Verbindungen nach außen, um neue Bekanntschaften zu schließen und örtliche Angebote zu nutzen. „Die Betreuerin glaubt, dass die Menschen in der Umgebung die KlientInnen dieses Hauses sehr gut kennen. Sie ist auch der Meinung, dass die Interaktion zwischen ihren KlientInnen und den NachbarInnen gut ist; wahrscheinlich kommt das davon, dass dies eine lokale Wohlfahrtseinrichtung ist und viele Menschen in der einen oder anderen Art mit dieser Institution verbunden sind. Sie ermutigt ihre KlientInnen, die öffentlichen Einrichtungen und Angebote zu nutzen, was deren Akzeptanz und Interaktion mit der einheimischen Bevölkerung steigert.“ (Institution für Menschen mit Lernschwierigkeiten (6)) Die folgende Schilderung macht deutlich, dass das Leben in einer Gruppe oder in einer Wohngemeinschaft mit anderen Menschen mit Behinderung einer Kontaktaufnahme mit der Bevölkerung nicht gerade dienlich ist. Der Umstand, dass die Menschen mit Behinderung von BetreuerInnen begleitet werden und in Fahrzeugen der Behinderteneinrichtung unterwegs sind, wird oft als Stigma angesehen und verringert die Chancen der Menschen mit Behinderung, Kontakte zu anderen Menschen ohne mit Behinderung zu knüpfen. 27 „Wie gut kennen die NachbarInnen die KlientInnen, die in dieser Umgebung leben? Ich weiß es nicht, wir treffen sie nicht sehr oft. Öfters treffen wir im Schwimmbad aufeinander, aber es sind so viele BetreuerInnen dabei, dass andere Personen nicht sehr viel mit den behinderten Menschen sprechen können, aber im Schwimmbad brauchen sie Betreuung. ... Sie schließen mit anderen keine Kontakte, das ist das spezielle Problem bei der sozialen Interaktion.“ (persönlicher Assistent einer Person mit Autismus) „Eigentlich kennt abgesehen vom Friseur (auch ein Nachbar) keiner der NachbarInnen auch nur einen einzigen KlientInnen. Sie verweisen auf sie als ‘die von der Behinderteneinrichtung’ (nennen den Namen des Hauses)“. (Sozialarbeiter in einem Haus mit elf Personen mit unterschiedlichen Behinderungen) Die letzte Aussage zeigt, dass Menschen mit Behinderung oft nur in Bezug auf ihre Behinderung und ihre Wohngemeinschaft mit anderen Menschen mit Behinderung erwähnt werden. Sie haben nur eine Gruppenidentität: „Sie gehören zu der Gruppe von behinderten Menschen und wohnen da und dort“ ... „Es ist interessant, zu fragen, wie gut die NachbarInnen die BewohnerInnen kennen. Ich wohne nun schon einige Jahre in diesem Dorf und kenne meine NachbarInnen noch immer nicht und ich habe meine NachbarInnen dort, wo ich vorher gewohnt habe, auch nicht gekannt. Aber die Beziehungen (das heißt zu meinen jetzigen NachbarInnen) sind ganz gut. Wir bemühen uns, die Kontakte zwischen unseren KlientInnen und der Bevölkerung zu verbessern und auszubauen. Wir gehen mit unseren KlientInnen ins Freibad, fahren mit dem Bus, ich meine, wir benützen öffentliche Verkehrsmittel, sodass sie sich aneinander (Bevölkerung und KlientInnen) gewöhnen können. Wir gehen mit unseren KlientInnen in den Ort, organisieren verschiedene Aktivitäten und verstecken sie nicht in der Einrichtung. Aber natürlich gibt es noch sehr viel zu tun. Selbstverständlich machen wir auch negative Erfahrungen, im Freibad zum Beispiel starrten uns alle an. Doch glaube ich, dass nicht nur behinderte Menschen angestarrt werden, sondern auch Übergewichtige. Nun gut, wir könnten ins Treffen führen, dass Übergewicht auch eine Form der Behinderung ist, aber ich will jetzt nicht ins Detail gehen.“ 28 Wir sollten uns besser nach Aktivitäten umschauen, an denen die Menschen mit Behinderung getrennt und unabhängig von der Gruppe oder ihrer Wohneinrichtung teilnehmen können. Gruppenausflüge können stigmatisierend sein, ‘Sie sehen den Bus mit dem Namen der Behinderteneinrichtung und fangen zu lachen an’ und es ist schwerer, Kontakte zu schließen, wenn man einer größeren Gruppe angehört. Der Betreuer im obigen Beispiel vergleicht die Kontakte seines Klienten mit seinen eigenen in der Nachbarschaft. Wie schon öfters angemerkt, hat es den Anschein, dass die Menschen in dieser Hinsicht insgesamt zur Kontaktarmut neigen. Nach der anfänglichen Ablehnung haben sich die öffentliche Meinung und die Interaktion zwischen der Bevölkerung und den KlientInnen offenbar zum Besseren gewandt. Darüber wurde schon in vorhergehenden Kapiteln berichtet. Die gleiche Entwicklung im Verhalten der NachbarInnen wurde auch vom Personal beobachtet. „Die NachbarInnen kennen ihn sehr gut. Zu einem Paar hat er besonders gute Kontakte. Er hat zwei Schweine und viele Kaninchen, die er im Hof des Nachbarn untergebracht hat; früher waren sie in unserem Stall, aber irgendein Tier ist eingedrungen und hat alle seine Kaninchen getötet. Deshalb hat er sie zu seinem Nachbarn gebracht. Die NachbarInnen akzeptieren ihn voll und ganz, aber nicht nur ihn, sondern alle anderen Menschen mit Behinderung auch. Die anfängliche Ablehnung hat sich ganz gelegt. Nun, die NachbarInnen haben erkannt, dass die behinderten Menschen nicht viel anders sind als sie selbst; sie besuchen uns und ich bin der Überzeugung, dass wir voll und ganz in der Bevölkerung integriert sind. Die Menschen haben erkannt, dass behinderte Menschen sich nicht vom Durchschnitt anderer Menschen unterscheiden. Vorher waren sie völlig Fremde im Ort und wurden ‘abgestempelt’, aber heute ist das ganz anders.“ (Gruppenleiter in einem Haus für junge Menschen mit Behinderung) Partizipation Wie sieht die Teilhabe der Menschen mit Behinderung in der Bevölkerung aus und wie werden sie vom Personal unterstützt? 29 Ein persönlicher Assistent einer Person mit Autismus und psychischen Problemen äußert sich darüber ziemlich negativ. Die Aktivitäten, an denen sein Klient teilnimmt, sind eher symbolisch anzusehen, ohne jeden Effekt auf seine Integration. Irgendwie widerspiegelt dies die Forschungsergebnisse von Prof. Myers et al. (1998), der betonte, dass durch den Umzug der Menschen mit Behinderung in eine gemeindeintegrierte Wohneinrichtung eher eine ’Präsenz in der Bevölkerung‘ und mehr Gestaltungsmöglichkeiten erreicht werden als eine echte Teilhabe5. Die BetreuerInnen sollten bei der Planung für ihre KlientInnen sorgsam sein und sie nicht in irgendeine integrierte Einrichtung hineinzwingen, nur weil diese ihre Integration fördern könnte. Freizeitaktivitäten müssen einen personenzentrierten Ansatz haben und können nicht als die einzige Maßnahme zur Inklusion gesehen werden, sondern nur als ein Instrument von vielen, um die Lebensqualität der Menschen mit Behinderung zu verbessern. „Die von mir unterstützte Person bekommt die gleiche Ausbildung wie andere auch, aber sie ist nur körperlich anwesend, denn meiner Meinung nach ist sie sozial nicht integriert und hat keine sozialen Kontakte. Es ist nur eine symbolische Integration.“ Sowohl das Personal als auch die Menschen mit Behinderung selbst haben in den Interviews den Eindruck vermittelt, dass die Menschen mit Behinderung hauptsächlich wieder Umgang mit behinderten Menschen haben. Die folgende Aussage eines Betreuers scheint diesen Eindruck nur noch zu verstärken. Er gibt an, dass der Großteil der Aktivitäten meistens gemeinsam mit anderen Menschen mit Behinderung ausgeführt wird. Gleichermaßen werden diese Aktivitäten mit Angehörigen des Personals unternommen, die wiederum Kontakte zu gewissen Organisationen haben, die diese Aktivitäten organisieren. Es ist schwierig, den Menschen mit Behinderung die Teilhabe an allgemein zugänglichen Einrichtungen zu ermöglichen, weil nicht genug Personal zur Verfügung steht. 5 MYERS et al. (1998) in : AGER, A., MYERS, F., KERR, P., MYLES, S. und GREEN, A. (2001). Umzug: Soziale Integration für Erwachsene mit geistiger Behinderung. Wiedereingliederung in die Gemeinde. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 14, pp. 392 – 400. 30 „... BewohnerInnen mit Lernschwierigkeiten unternehmen vor allem mit ihren Mit-BewohnerInnen etwas, einige wenige gehen zur Kirche. Ein Betreuer hat eine Kunstklasse eingerichtet, die die KlientInnen besuchten. Manche gingen zum Kegeln in den britischen Legionärsklub in der Stadt. Der Betreuer war der Meinung, dass die KlientInnen gerne mehr soziale Aktivitäten hätten, aber durch das Personalproblem ist das Angebot beschränkt.“ (Betreuer in einem Haus für Menschen mit Lernschwierigkeiten) „Das Personal übernimmt das Einkaufen und das Kochen. Die KlientInnen kennen überhaupt niemand aus der Nachbarschaft. Sie sehen sie kaum, haben aber keine Probleme. ... Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Bedarf an einer verstärkten Interaktion gibt.“ Es ist erstaunlich, dass eine leitende Angestellte es nicht als Problem empfindet, wenn ihre KlientInnen außer mit ihren Mit-BewohnerInnen und dem Personal keine Kontakte pflegen. Das Leben in der Gemeinschaft wird die Lebensqualität und die Teilhabe an der Gesellschaft nicht verbessern, wenn nicht auch das betreuende Personal seine Einstellung ändert. Sie müssen ihre KlientInnen dahingehend unterstützen, Pflichten und Aufgaben zu übernehmen, um ganz in die Gesellschaft eingegliedert zu werden. Welche Maßnahmen könnten zur Verbesserung der Kontakte und Interaktionen beitragen? Vorschläge für BetreuerInnen und das Personal, die unmittelbaren Kontakt zu Menschen mit Behinderung haben Im folgenden Auszug eines Interviews werfen wir einen genaueren Blick auf die Maßnahmen, die von BetreuerInnen gesetzt werden können. Ein Mitarbeiter berichtet uns, wie er seine KlientInnen in der Bevölkerung bekannt gemacht hat. Er wohnt (als Betreuer) zusammen mit vier Männern mit Behinderung in einer Wohnung, die Teil eines Wohnblockes mit weiteren Wohnungen ist. „Als wir hierher zogen, dachte ich, dass wir ganz normale Kontakte zuerst einmal auf unserem Stockwerk haben würden. Ich versuchte, alle Möglich31 keiten auszunutzen, als wir zum Beispiel die Kellerschlüssel abholten, Konversation mit dem Hausverwalter machen etc. Ich erzählte den Leuten von den jungen Menschen, die hierher ziehen würden und versuchte die möglichen Reaktionen (der NachbarInnen) abzuschätzen. Ich glaube, dass die NachbarInnen sie mögen ... und sie sind auch sehr hilfsbereit. Geht einer unserer BewohnerInnen zu dem kleinen Gemüsegeschäft und gibt es dort Probleme, helfen sie uns immer, zum Beispiel beim Geld zählen etc. Dies ist Teil einer Entwicklung. Wir versuchten, die Nachbarschaft gemeinsam zu erforschen und entdeckten gemeinsam die Geschäfte. Ich erklärte dem Geschäftsinhaber, dass er so komische Laute von sich gibt, weil er hörbehindert ist und habe Zusammenfassung: MASSNAHMEN AUF DEM BETREUUNGSSEKTOR ZUR FÖRDERUNG VON KONTAKTEN UND DER INTERAKTION - Die KlientInnen mit den NachbarInnen bekannt machen, indem man informelle Begegnungen nutzt; - Den NachbarInnen Informationen zukommen lassen; - Die Nachbarschaft gemeinsam mit den KlientInnen erkunden; - Kontaktaufnahme erleichtern, wann immer es geht; - Individuelle Hilfe durch Dialog und gegenseitige Beratung; - Als Mediator fungieren; - Vermeiden, über die Person hinweg zu sprechen. ihm auch gesagt, wie er mit ihm kommunizieren soll und ihn um Verständnis gebeten. So habe ich ihn praktisch in der Gemeinde bekannt gemacht. Ich bin der Meinung, dass sich zwischen unseren BewohnerInnen und mir ein guter Dialog entwickelt hat. Normalerweise fragen sie mich um Rat, ich sage ihnen dann, was ich darüber denke und welche Möglichkeiten es meiner Ansicht nach gibt. Nachdem eine Entscheidung getroffen wurde, diskutieren wir auch über Probleme, die unter Umständen entstehen könnten. Sie haben mehrere Optionen und ich versuche, ihnen die Entscheidung zu überlassen und nur 32 dann ‘einzugreifen”, wenn wirklich ernsthafte Probleme auftauchen, aber dies passiert nicht sehr häufig. Ich kann behaupten, dass sie sehr selbständig sind und ich ihre Meinung immer berücksichtigen möchte. ... In unserem Block wohnen ungefähr 50 Personen, wobei ca. 15% unsere BewohnerInnen kennen. Ich rede mit jenen Menschen über unsere jungen Männer, die mir offen erscheinen, mit anderen nicht. Die NachbarInnen sprechen jedoch noch immer lieber mit mir, obwohl sie unsere BewohnerInnen zumindest grüßen. Mit 50% der unmittelbaren NachbarInnen haben wir sehr gute Kontakte und die übrigen sehen wir ohnedies kaum. Man kann sagen, dass die nachbarschaftlichen Beziehungen sehr gut sind, weil unsere NachbarInnen alle Informationen, die sie benötigen und wünschen, erhalten. Auf diesem Weg haben sie die Erkenntnis gewonnen, dass es hier Menschen mit einer Behinderung gibt, die so leben wollen wie sie auch, nur unter etwas anderen Bedingungen. Ich versuche auch unter den NachbarInnen und unseren BewohnerInnenn zu vermitteln. Zum Beispiel haben die NachbarInnen einmal unsere BewohnerInnen beschuldigt, den Müll draußen liegen zu lassen, aber wie sich herausstellte, war es einer der NachbarInnen. Natürlich musste ich unsere Jungs verteidigen. Ich glaube, dass wir den Leuten mehr Informationen zukommen lassen müssen, wie zum Beispiel Interviews mit Experten und mehr Öffentlichkeitsarbeit in Behindertenfragen.“ Informationen und Erhöhung des Bewusstseins Welche Maßnahmen werden von den Behinderteneinrichtungen bezüglich Kommunikation mit der Nachbarschaft ergriffen? Die Weitergabe richtiger Informationen wurde von einer Heimleiterin für sechs Menschen mit geistiger Behinderung als sehr wichtiges Instrument im Zusammenhang mit negativen Reaktionen gesehen. Offene Kommunikation und klare Informationen lösen viele Probleme. „Die Leiterin fand, dass ein guter Teil ihrer Arbeit darin bestand, die Leute zu beruhigen; die NachbarInnen zu treffen und ihnen zu erklären, wer nun hier einziehen würde und mit den Eltern der neuen BewohnerInnen zu reden, die auch nervös und besorgt waren, denn ‘immerhin sind es ja doch unsere 33 Kinder‘. Jeder wurde ermutigt, sie zu besuchen, ‘es war ein offenes Haus, jeder konnte einfach nur auf einen Sprung vorbeikommen‘. Aufklärung und Information, das Bewusstsein erweitern und das Wissen über die Fähigkeiten der Menschen mit Behinderung verstärkt weitergeben, ist, wie bereits von Angestellten berichtet, eine Maßnahme von vielen, um die Inklusion der Menschen mit Behinderung voranzutreiben. Den Menschen klar machen, die Person und nicht das ‘Etikett’ zu sehen. Es würde helfen, die Einstellung zu ändern, die zurzeit auf Angst, falschen Vorstellungen und Unkenntnis, wie man sich mit einer behinderten Person auf ein Gespräch einlässt, beruht. „Obwohl ich nicht wirklich akzeptieren kann, dass Menschen in extremen Situationen oder auf Ungewöhnliches in dieser Art und Weise reagieren. Ich glaube, es liegt an der Aufklärung, wir sollten die junge Generation dahingehend erziehen und ausbilden, Unterschiede zu akzeptieren und zu tolerieren.“ „Viele Menschen mit Lernschwierigkeiten besuchen jetzt eine Integrationsklasse in einer öffentlichen Schule und die Kinder lernen schon sehr früh den Umgang mit Menschen mit Lernschwierigkeiten. Sie werden darin bestärkt, ihre Mitschüler und Mitschülerinnen zu unterstützen und ihnen beizustehen. Ich denke, dass den Älteren diese Akzeptanz schwerer fällt. Als sie jünger waren, lebten diese Menschen hauptsächlich in Behindertenheimen. ... Die nicht behinderten Menschen sollten an die Menschen mit Lernschwierigkeiten glauben und nicht auf sie herabsehen, aber ich denke, es wird noch viel Zeit vergehen bis es so weit ist.“ Für diesen Heimleiter würde eine inklusive Erziehung und Ausbildung auch eine erhöhte Akzeptanz der Menschen mit Behinderung bedeuten, weil sie den Umgang und die Kommunikation mit Menschen, die anders sind, auf ganz natürliche Art und Weise in der Schule lernen würden. 34 TraIng der Schlüsselqualifikationen für KlientInnen Ein Betreuer einer integrierten Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung und psychischen Erkrankungen glaubt, dass die Information und Aufklärung der Nachbarschaft zu seinen Aufgaben gehört, um den Menschen mehr Sicherheit zu geben. Weiters fühlt er sich auch verpflichtet, seinen KlientInnen ein sozial verträgliches Verhalten zu vermitteln. „Die Rolle des Betreuers sehe ich darin, die Menschen auf behutsame Art aufzuklären und sie nicht in Unbehagen zu versetzen. Weiters soll auch den KlientInnen ein sozial akzeptiertes Verhalten mit auf den Weg gegeben werden, damit sie sich leichter in ihr neues Umfeld einfügen können.“ Im folgenden, konkreteren Beispiel wird aufgezeigt, in welchen Fällen es notwendig ist, Maßnahmen zu setzen und den Menschen mit Behinderung zu lehren, welches Verhalten akzeptiert werden kann und welches nicht. „Einer der KlientInnen betritt ohne Erlaubnis das Grundstück des Nachbarn. Er wurde aufgefordert, dies zu unterlassen und wir arbeiten mit ihm, um ihm bewusst zu machen, dass es bezüglich der Nachbarsbesuche Grenzen gibt.“ Vorschläge für die Leitung der Behinderteneinrichtung Einige positive Maßnahmen wurden bereits in den vorhergehenden Kapiteln angeführt. Experten wiesen auf das Engagement von Freiwilligen aus der Bevölkerung hin, empfehlen den KlientInnen, hiesige Geschäfte und Einrichtungen zu nutzen und raten dem Personal, eine offene Kommunikation mit den NachbarInnen hinsichtlich der neuen BewohnerInnen zu pflegen. Netzwerk der örtlichen Freiwilligenarbeit Um die Verbindungen zur Bevölkerung zu verbessern, wurde bereits das Engagement von Personen erwähnt, die auf unentgeltlicher Basis für die Menschen mit Behinderung zur Verfügung stehen. Freiwillige aus dem Ort kennen die Nachbarschaft und die BewohnerInnen und stellen ein wertvolles Bindeglied zu anderen Kontakten und/oder verschiedenen Einrichtungen dar. Gelegentlich wissen sie besser als das Personal, welche Einrichtungen zur Verfügung stehen. Ihr Wissen 35 kann die Kontakte zwischen den NachbarInnen und der Behinderteneinrichtung erleichtern. Das folgende Beispiel zeigt Vorteile der Freiwilligenarbeit und verweist darauf, wie das Personal das Wissen und die Energie der freiwillig tätigen Menschen in seiner Arbeit nutzen kann. „Gute Freiwillige sind häufig Menschen, die kürzlich in Pension gegangen sind und eine wichtige Rolle spielen: Sie haben oft Zeit, um für Menschen mit Behinderung da zu sein. Sie würden gerne ein System wie das ‘Buddy’ ‘Kumpel’ -System für AIDS Patienten installieren, die von ihren ‘Kumpels’ regelmäßig Besuch bekommen.“ „Es gibt kaum Probleme. Es gibt auch Personen, die diese Aktivitäten als Freiwillige beaufsichtigen/steuern. ... Was muss getan werden, um mehr Menschen aus der Nachbarschaft zu involvieren und für das persönliche Netzwerk eines Menschen mit Behinderung zu begeistern? Information, aber keine Überlastung ist das Stichwort und als Coach muss man mit den Freiwilligen in ständigem Kontakt stehen.“ Präsenz in der Bevölkerung Die Mitarbeiter der Behinderteneinrichtung haben in unseren Interviews betont, dass die Präsenz ihrer KlientInnen in der Bevölkerung wichtig ist. Diese Präsenz ist durch die Nutzung der unterschiedlichsten Einrichtungen und durch die Teilnahme am öffentlichen Leben sehr gut möglich. Der physische wie auch der soziale Zugang sind nach wie vor ein Hindernis, aber nichtsdestotrotz bemühen sich die sozialen Dienstleistungsanbieter sehr, ihre KlientInnen zu bestärken, regelmäßig hinaus zu gehen, einzukaufen, allgemeine Einrichtungen zu nutzen und örtliche Aktivitäten zu unterstützen. Die folgende Schilderung einer Wohnassistentin, die mit ihren KlientInnen zum Kegeln ging, zeigt, dass Toleranz nicht immer an der Tagesordnung ist. „Sie sagte, dass sie immer nach neuen Freizeitaktivitäten Ausschau hielten, die die Interaktion zwischen ihren KlientInnen und der Bevölkerung verbessern könnte. Sie haben die örtliche Bingohalle besucht, aber dort sind einige ältere Personen ausfällig geworden, deshalb sind sie nicht mehr hingegangen. ... Ein Tag der offenen Tür könnte mehr Leute in die Behinderteneinrichtung locken.“ 36 (Teilzeit - Wohnassistentin in einer Einrichtung für sieben Menschen mit geistiger Behinderung) In vielen Berichten über dieses Projekt kommt zum Ausdruck, dass Arbeit und Beschäftigung für den Aufbau sozialer Kontakte eine ungeheuer wichtige Rolle spielen. Auch die Arbeit in einer geschützten Werkstätte erweitert das soziale Netzwerk der Menschen mit Behinderung, doch in diesem Fall sind die Kontakte wieder auf Menschen mit Behinderung beschränkt. „Aus Erfahrung wissen wir sehr wohl, dass es für die Leute einfacher ist, eine Beziehung zu Menschen mit Behinderung aufzubauen, wenn eine behinderte Person eine Arbeit im Ort findet.“ (Heimleiter einer Behinderteneinrichtung für Menschen mit Lernschwierigkeiten) „Was muss getan werden, um mehr Menschen aus der Bevölkerung für das soziale Netzwerk eines Menschen mit Behinderung zu gewinnen? Er meint, dass dies eine sehr schwierige Aufgabe sei. ... Seine KlientInnen haben vor allem mit ihren KollegInnen von der geschützten Werkstätte Kontakt. Sie machen auch zusammen mit den im Projekt des unterstützten Wohnens untergebrachten KlientInnen Ausflüge, um die Kontakte untereinander auszubauen. Er meint, dass Freundschaften normalerweise wieder mit Menschen aus der gleichen sozialen und intellektuellen Schicht geschlossen werden.“ Dieser Sozialarbeiter, der in einem Projekt für unterstütztes Wohnen tätig ist, meint, dass die Menschen mit ihresgleichen Beziehungen aufnehmen, das heißt mit Menschen mit Behinderung. Er unterstützt diese Kontakte zwischen den KlientInnen dieses Projektes, indem er sie bei gemeinsamen Ausflügen zusammenbringt. Wir dürfen unsere vorhergehenden Aussagen über die Stigmatisierung von Ausflügen in größeren Gruppen und die Notwendigkeit, die KlientInnen in das öffentliche Leben einzubinden, nicht vergessen. Sollten Menschen mit Behinderung (aufgrund ihrer Behinderung) wieder nur mit anderen behinderten Personen Freundschaft schließen? 37 Öffnung nach außen durch Aktivitäten der Einrichtung Andere Aktivitäten, zu denen die NachbarInnen eingeladen werden, sind zum Beispiel Ausstellungen, Tage der offenen Tür, Grillfeste, Informationstage etc. Sowohl vor als auch nach der Eröffnung der Serviceeinrichtung können vom Mitarbeiterstab und von der Leitung der Einrichtung Aktivitäten gesetzt werden. Es sind oft nur kleine Schritte, aber trotzdem ist es wichtig, die Öffnung nach außen durch verschiedenste Aktivitäten weiter voranzutreiben, um so den Platz für Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft sicher zu stellen. Die Türen der Behinderteneinrichtungen für die einheimische Bevölkerung zu bestimmten Anlässen zu öffnen, ist ein Aspekt der Inklusion. Andere Behinderteneinrichtungen haben ein eigenes Geschäft oder ein für die allgemeine Öffentlichkeit zugängliches Schwimmbad. „Die Behinderteneinrichtung organisiert spezielle Feste und Veranstaltungen, um die Menschen mit Behinderung näher an die Bevölkerung heranzuführen. Bei den Fußball Weltpokalspielen zum Beispiel wurde im großen Aufenthaltsraum eine Großbildleinwand installiert und auf Plakaten wurde die Öffentlichkeit eingeladen, diese Einrichtung zu nutzen. Viele Menschen kommen auch in das Schwimmbad. Es kommen wirklich sehr viele.“ HeimLeiterInnen werden oft als Brückenbauer gesehen, die den Grundstein für die Kontakte zur Bevölkerung legen. Die folgende Aussage ist ein Beispiel dafür und kommt von einer Leiterin eines Hauses für sechs Personen mit geistiger Behinderung. „Als die Bauarbeiten noch im Gang waren, traf sich die Leiterin mit den NachbarInnen. Sie hat dies als wichtige Basisarbeit gesehen – ein langer, aber lohnenswerter Prozess. Neben den Bedenken über ihre zukünftigen NachbarInnen, mussten sich die HausBewohnerInnen auch ein ganzes Jahr lang mit dem Baustellenlärm abfinden und die Leiterin hat es als entscheidenden Schritt für das künftige Zusammenleben gesehen, sich mit den NachbarInnen zusammen zu setzen. Sie lud sie zum Nachmittagskaffee ein, zeigte ihnen das noch unbewohnte Haus und hat sie zu einem Grillfest mit den neuen BewohnerInnen eingeladen. Für sie war das ein schönes Stück Arbeit, aber es hat sich insofern gelohnt, als die neuen BewohnerInnen mit 38 Schokolade und Glückwunschkarten aus der Nachbarschaft begrüßt wurden.“ (Leiterin eines gemeindeintegrierten Wohnhauses für vier Frauen und zwei Männer mit geistiger Behinderung) Die Behinderteneinrichtungen können Tage der offenen Tür veranstalten, die NachbarInnen zu Veranstaltungen einladen, Informationsfolder verteilen, Freiwillige können wertvolle Dienste tun - alle diese Aktionen können helfen, die soziale Interaktion zu verbessern. Doch nicht immer zeitigen all diese Initiativen den Erfolg, den sich die LeiterInnen wünschen. Auf der anderen Seite beschweren sich die Leute darüber, dass die Kontakte ziemlich oberflächlich bleiben. „Die Leute zu motivieren und die Einrichtung durch Weihnachtsmärkte, Ausstellungen und Theatervorstellungen kennen zu lernen ...“ (BetreuerInnen für geistig behinderte Erwachsene und Erwachsene mit Mehrfachbehinderungen). (Dieses Zitat allein sagt noch gar nichts aus) „Im Ort gibt es verschiedene Veranstaltungen und wir gehen immer dort hin. Wenn wir eine Einladung bekommen, glaube ich, ist es sehr wichtig, diese auch anzunehmen.“ (Betreuer einer Wohnung für Menschen mit geistiger Behinderung, Autismus, Down-Syndrom und Epilepsie) Vorschläge für die Organisation Verschiedene Aspekte, wie die theoretischen Rahmenbedingungen, die Anzahl des notwendigen Personals und die finanziellen Gegebenheiten sind zu berücksichtigen, um die Lebensqualität und Inklusion der Menschen mit Behinderung zu steigern. Personal und Finanzen Finanzielle und personelle Überlegungen müssen in Betracht gezogen werden, wenn wir die Lebensqualität und die Teilhabe unserer KlientInnen in der Gesellschaft verbessern wollen. Schon früher wurde erwähnt, dass in einigen Einrichtungen so mancher Wunsch der KlientInnen aus Personalmangel nicht erfüllt werden kann. 39 „Der Betreuer berichtet, dass die KlientInnen überwiegend ihr eigener Herr und in der Lage sind, dem Prozedere der Einrichtung zu folgen. Den Wünschen und Bedürfnissen der KlientInnen wird – soweit wir in Erfahrung bringen konnten - große Beachtung geschenkt. Es gibt viele Beschränkungen, finanzieller und personeller Natur, die sich auf die Arbeit auswirken und Verschiedenes nicht zulassen. ... Der Umzug (aus ihrer früheren Unterkunft) wurde von dem ‘Ethos’ begleitet, dass die KlientInnen wachsen und sich entwickeln können, einige sind in der neuen Umgebung regelrecht aufgeblüht. Es hat den Anschein, als ob die KlientInnen ein kleineres Heim schätzen und es genießen, hier leben zu können und daher Verhaltensauffälligkeiten in den Hintergrund treten. Das Ziel der Tagesheimstätte in dieser Organisation ist, den BewohnerInnenn eine Vielzahl von Möglichkeiten anzubieten. Dies erfordert jedoch einen erheblichen Personalaufwand, weil die KlientInnen doch sehr von anderen Menschen abhängig sind.“ Ein Pflege- und Betreuungsmodell in der Bevölkerung installieren Maßnahmen auf organisatorischer Ebene würden auch das Personal dazu befähigen, den Menschen mit Behinderung den Weg in Richtung volle Bürgerrechte zu ebnen. Die theoretischen Rahmenbedingungen und Grundvoraussetzungen der Versorgung6 mit Pflege- und Betreuungsdienstleistungen muss durch ausreichende finanzielle Mittel gesichert sein, um die neuen Pflegestandards umsetzen zu können. „Durch das derzeitige Wohnheim kann man die Geschäfte bequem zu Fuß erreichen und das Personal hatte zwei BewohnerInnen ermuntert, alleine einkaufen zu gehen. ... Sie sprach darüber, bei allem, was man tut, das Risiko abzuschätzen, doch nicht die Perspektive aus den Augen zu verlieren. ‘Es ist von grundlegender Bedeutung, das Risiko abzuschätzen, doch ist es nur allzu leicht, dem zu große Bedeutung beizumessen’ – man muss die Situation im Auge behalten.“ (stellvertretende Leiterin eines Wohnhauses für vier Frauen und zwei Männer mit geistiger Behinderung) 6 Die Bereitstellung von Pflege- und Betreungsdienstleistungen soll den Menschen ein möglichst unabhängiges Leben in ihrem eigenen Heim oder in anderen Einrichtungen ermöglichen. Es handelt sich um einen personenzentrierten Betreuungsansatz mit besonderem Augenmerk auf die Klientenbeteiligung und ihre Teilhabe am öffentlichen Leben. 40 Die stellvertretende Leiterin hat einen sehr wichtigen Punkt bei der Unterstützung der Menschen mit Behinderung angeschnitten. Es ist ein schwieriges Unterfangen, die richtige Balance zwischen Beschützen und Loslassen zu finden. Den KlientInnen einerseits die Möglichkeit zu geben, selbst Dinge zu entdecken, Fehler zu machen und aus diesen zu lernen und andererseits ihnen den notwendigen Schutz zu geben. Es ist eine Gratwanderung und das Personal ist sehr gefordert, die Balance zu finden und zu halten. Diese neue Art der Unterstützung der Menschen mit Behinderung muss auch ein Umdenken hinsichtlich dessen, ‘was Pflege ist und wie diese ausschauen soll’, nach sich ziehen. Es müssen an der richtigen Stelle Prozesse eingeleitet werden, um den KlientInnen zu mehr Autonomie und Teilhabe zu befähigen, nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in ihrer Lebensplanung und bei allen Hilfestellungen. Der Betreuer dieser Menschen mit einer leichten geistigen Behinderung gibt an, dass der Umzug auch von ihm einen anderen Betreuungsansatz erfordert hat. „Früher habe ich in einer Wohngemeinschaft einer Einrichtung gearbeitet. 22 Jahre habe ich mit geistig behinderten Menschen gearbeitet. Seit ich in dieser integrierten Einrichtung tätig bin, habe ich meine Betreuungsstil geändert. Ich versuche, den KlientInnen so weit wie möglich freie Hand zu lassen und greife nur ein, wenn es notwendig ist, was wiederum von der einzelnen Person abhängt.“ In der Betreuung der Menschen mit Behinderung wurde der paternalistische Betreuungsansatz von der Methode des Empowerments abgelöst. „Mit der Zeit hat sich die Einstellung der Organisation geändert: Als sie vor drei Jahren das Projekt ins Leben riefen, gingen sie mit ihren KlientInnen noch etwas gönnerhafter um. Aber jetzt lassen sie ihnen mehr Freiheit, weil sie offenbar klug genug sind, großteils auf sich selbst auf zu passen. Die Unterstützung wird nun auch mehr auf die einzelne Person konzentriert.“ Nicht nur die öffentliche Meinung muss revidiert werden, sondern auch das Personal muss seinen Betreuungsstil dem geänderten Image der Person mit Behinderung 41 Rechnung tragen. Ein Image, in dem die Fähigkeiten des Einzelnen berücksichtigt und in der Tat ein zentraler Punkt eines personenzentrierten Planungsansatzes werden. Pflege- und Betreuungsdienstleistungen: Unterstützung in Richtung Empowerment Der Übergang zu kleineren Wohneinrichtungen zur Hebung der Lebensqualitität der Menschen mit Behinderung passiert nicht von allein. Dieser ‘Umzug’ muss von einer geänderten Einstellung bei der Betreuung und bei den Unterstützungsmaßnahmen begleitet werden. Einige Vorschläge haben wir früher schon erwähnt, aber wir möchten dieses Thema noch etwas näher beleuchten. In verschiedenen Interviews mit Menschen mit Behinderung haben wir beobachtet, dass die Entscheidung über Gemeindeintegrierte Wohneinrichtungen oft ohne die Beteiligung der Betroffenen gefällt wurde. In Teil III werden wir noch auf diese Thematik zurückkommen. Um zu verstehen, wie Hilfestellungen und Unterstützung in den für dieses Projekt ausgewählten Einrichtungen geleistet werden, haben wir das Personal über ihre Arbeitsweise befragt und überprüft, ob die KlientInnen ein Mitspracherecht haben. Die folgende Aussage ist ein Beispiel eines Auftrages einer Einrichtung für sechs Männer mit Lernschwierigkeiten und psychischen Erkrankungen: „Sechs Männer leben in einem Haus und alle leiden an psychischen Erkrankungen, die meisten von ihnen haben Depressionen und Angstzustände zusätzlich zu ihren Lernschwierigkeiten. Das Ziel ist, ihr Selbstbewusstsein zu stärken, damit sie in Zukunft unabhängiger leben können. Ethisch geht es vor allem darum, diese Menschen in ihrem eigenen Heim zu unterstützen und sie darin zu bestärken, öffentliche Ressourcen zu nutzen.“ 42 Wahl und Autonomie Wahlmöglichkeiten und Autonomie sind philosophische Ziele7, die aber durch eine offene Kommunikation und Qualitätsüberwachung durch das Personal sinnvoll unterstützt werden können. Andere Verbesserungsmöglichkeiten bestehen in der durchgängigen Berücksichtigung des Hilfebedarfs und in der Ermutigung der Menschen mit Behinderung, die öffentlich zugänglichen Einrichtungen für ihre Bedürfnisse zu nutzen. Wie stehen die sozialen Dienstleistungsanbieter dazu? Im folgenden Beispiel gibt der Sozialarbeiter an, dass die unterstützende Organisation in seinem Fall nur eine beratende Funktion für die Menschen mit geistiger Behinderung innehat. Diese Haltung hat auf ihre Arbeit insofern Konsequenzen, als ihre KlientInnen für ihr Tun verantwortlich gemacht werden, selbst wenn etwas schief geht. „Ihre KlientInnen sind alle voll und ganz für sich selbst verantwortlich. Beim unterstützten Wohnen werden die KlientInnen nur beraten, jeder Klient hat immer das Recht, auszusteigen. ... Letzten Endes ist immer die Meinung des KlientInnen ausschlaggebend und die BetreuerInnen können sie nicht daran hindern, ihren eigenen Willen durchzusetzen.“ Die Menschen mit Behinderung, die an diesem Projekt teilgenommen haben, hatten in Bezug auf ihr neues Heim offensichtlich keine Wahlmöglichkeit. Das einzig Wichtige war anscheinend der Umzug von einer großen in eine kleinere Einrichtung, andere Aspekte schienen für das Personal oder für die Leitung nicht relevant gewesen zu sein. Dies wird durch die Reaktionen einiger von uns befragten Menschen mit Behinderung noch offenkundiger, aber auch von Angehörigen des Mitarbeiterstabs kamen bemerkenswerte Kommentare: „Sie wollten alle hierher kommen, meinte ein Teamleiter einer Wohngemeinschaft für junge Menschen mit Behinderung. Später fügte er im Interview an: ... Genauer gesagt, hatten sie keine andere Wahl, weil hätten wir ihnen kein Dach über dem Kopf gegeben, wären sie obdachlos geworden. Aber sie sind alle sehr glücklich, nun hier wohnen zu können.“ 7 JOYCE, Theresa & SHUTTLEWORTH, Lorraine (2001). Von Engagement zur Partizipation: Wie kann man diese Kluft überbrücken? British Journal of Learning Disabilities, 29, 63-71. 43 Wieder ein anderer Leiter und BetreuerInnen teilten mit, dass die Entscheidung nicht zur Gänze von den Menschen mit Behinderung selbst getroffen wurde, sondern in Zusammenarbeit mit den Eltern und dem Vorstand der Einrichtung. „Ich glaube, dass nicht die KlientInnen entschieden haben, hierher zu kommen, sondern ihre Eltern, SachwalterInnen und Familienmitglieder. Natürlich wurden unsere BewohnerInnen gefragt, ob sie hier leben möchten.“ Zusammenfassung: EMPOWERMENT - Bestärkung der KlientInnen, sich an der Planung der Unterstützungsmaßnahmen zu beteiligen, aber wie sieht gute KlientInnenkonsultation aus? - Organisation regelmäßiger Treffen mit den verschiedenen Interessensgruppen (KlientInnen, Familienmitglieder und Freunde, Personal und Leitung der Einrichtung); - Erstellung eines persönlichen Zukunftsplanes mit klaren Zielsetzungen, in Verbindung und unter Berücksichtigung der Wünsche und Bedürfnisse des KlientInnen; - Bereitstellung der entsprechenden Informationen, um dem KlientInnen eine sachkundige Wahl oder eine Entscheidung unter mehreren sachlich und fachlich begründeten Möglichkeiten zu erlauben; - Die Kommunikation mit den KlientInnen erleichtern, falls nötig. Konsultation der KlientInnen Um die Menschen mit Behinderung in Richtung Empowerment besser unterstützen zu können, muss man die KlientInnen beraten. Ein möglicher Weg dafür ist die Bildung eines KlientInnenausschusses. In dem Doppelhaus für sechs Personen mit Autismus und zerebraler Lähmung haben sie keinen KlientInnenausschuss, um die KlientInnen in die Planung der Unterstützungsmaßnahmen einzubeziehen. Es ist nicht klar, wie sie ihre KlientInnen beraten. „KlientInnen werden schon im Vorfeld beraten, aber es gibt keinen KlientInnenausschuss. Die Leitung des Hauses ist für den täglichen Ablauf verantwortlich, aber alle wichtigen und finanziellen Entscheidungen werden von den dafür zuständigen Personen getroffen, normalerweise nach der Beratung.“ 44 Manchmal wird die Entscheidungskompetenz der KlientInnen durch die Einrichtung beschränkt, weil das Zusammenleben in einer Gruppe einer gewissen Struktur und Organisation bedarf. Daher sind sie in ihrer eigenen Tagesplanung und in der Organisation verschiedener Aktivitäten eingeschränkt. „Die KlientInnen sind die erste Instanz für alle ihre Wünsche und Bedürfnisse, aber was die allgemeinen Haushaltsbelange angeht, werden diese bei der wöchentlichen Sitzung besprochen. ... Einige Freizeitaktivitäten werden vom Personal organisiert und die KlientInnen können entscheiden, ob sie daran teilnehmen möchten oder nicht. Jede Woche wird ein Dienstplan für sie erstellt, in dem ihre Haushaltspflichten festgelegt sind.“ (Behinderteneinrichtung für sechs Personen mit Lernschwierigkeiten) Lebensplanung für KlientInnen Langfristige Planungen kommen in den Interviews mit den Angehörigen des Personals nicht sehr oft vor. Nur einige der Befragten erwähnen die in der Zukunftsplanung enthalten Perspektiven für die behinderte Person. Im folgenden Beispiel wird das Konzept des unterstützten Wohnens als Vorbereitung zu einem künftig noch unabhängigeren Leben gesehen. Zu diesem Zweck wurde ein individuelles Unterstützungspaket geschnürt. Kann man diese Maßnahmen als Planung betrachten oder gibt es da noch andere Möglichkeiten für soziale Dienstleistungsanbieter? „Die KlientInnen leben ein Jahr lang hier und bereiten sich darauf vor, nach diesem Jahr in eine eigene Wohnung zu ziehen. Während ihres Aufenthaltes wird für jeden Einzelnen ein individuelles Unterstützungspaket geschnürt, das ihren Wünschen und Bedürfnissen entspricht. Sie arbeiten mit den KlientInnen und bereiten maßgeschneiderte Unterstützungspläne vor.“ In der unten angeführten Einrichtung für Menschen mit einer körperlichen Behinderung hat der Klient mit seinem Dienstleistungsanbieter einen Vertrag als Teil eines persönlichen Entwicklungsplanes, in dem zukünftige Entwicklungsschritte festgelegt sind, abgeschlossen. „Diese Einrichtung ist nur eine vorübergehende Lösung, viele von ihnen würden gerne ein unabhängigeres Leben führen. Die Institution hat mit jedem 45 Bewohner einen Vertrag abgeschlossen, in dem die allgemeinen Bedingungen und die Dauer des Aufenthaltes niedergeschrieben sind. Die Aufenthaltsdauer kann je nach den persönlichen Umständen ein, zwei oder sogar mehrere Jahre betragen. Damit unterscheiden wir uns von anderen Organisationen. ... Individuelle Entwicklungspläne werden zusammen mit Fachleuten für jeden einzelnen BewohnerInnen erstellt.“ Ein Betreuer in einer Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung und psychischen Erkrankungen möchte gerne auf die notwendige Flexibilität des Personals und anderer Fachleute bei der Erstellung von Entwicklungsplänen für Menschen mit Behinderung hinweisen. Man sollte nicht vergessen, dass man es mit dem Leben anderer zu tun hat, was eine respektvolle Haltung gegenüber dem Anderen verlangt. „Das Wichtigste ist, dass wir – das Personal - nicht vergessen, dass dies hier das Zuhause der jungen Männer ist und wir nur Besucher sind. ... Alles muss um die BewohnerInnen herum organisiert und geplant werden, was manchmal bei all den unterschiedlichen Bedürfnissen schwierig ist. Das Personal muss flexibel sein.“ (BetreuerInnen einer Behinderteneinrichtung für sechs Männer mit Lernschwierigkeiten und psychischen Erkrankungen) Positive Wahlmöglichkeiten Interview mit der stellvertretenden Leiterin eines Hauses mit Menschen mit Behinderung. Der Interviewer berichtet: „Auch die Familien haben sich beim Umzug in das neue Heim sehr engagiert. Wir sprachen über Wahl- und Kontrollmöglichkeiten im Heim, wobei die Befragte meinte, dass dadurch alle möglichen Fragen aufgeworfen worden sind. Sie ist auch der Meinung, dass den Menschen mit Behinderung eine sachkundige Auswahl zu ermöglichen ist und sie in möglichst viele Entscheidungen über die Auswahl des künftigen Wohnsitzes mit einzubeziehen sind. ... Weiters sei es wichtig, Dinge durchzudenken, wenn man den BewohnerInnen verschiedene Aktivitäten anbietet – aber immer unter der notwendigen Voraussetzung, dass genug Personal zur Verfügung steht, die Bedürfnisse und Fähigkeiten vieler sehr unterschiedlicher Menschen berücksichtigt und ‘vernünftige” Wahlmöglichkeiten angeboten werden. Sie hält eine sach- und fachkundige Auswahl für die Menschen mit Behinderung für 46 sehr wichtig und spricht mit ihnen über die Auswirkungen der von ihnen getroffenen Wahl. ... Die meisten BewohnerInnen verständigen sich auf einer nonverbalen Ebene, sprechen nur sehr wenig oder ‘neigen dazu, nur ja zu sagen’ und antworten mit ‘ja’ oder ‘nein’; sie glaubt, dass dies ein besonderes Problem in der Berücksichtigung der Meinung der Menschen mit Behinderung darstellt. ... Sie deuten Töne und Laute, interpretieren die Körpersprache und das Auftreten, um ihre Vorlieben herauszufinden und setzen auch Fotos, zum Beispiel beim Speiseplan, ein. Regelmäßige Überprüfungen garantieren die notwendigen Unterstützungen und in den Hausversammlungen werden die erforderlichen Maßnahmen für das Haus geplant.“ (stellvertretende Leiterin einer Organisation für vier Frauen und zwei Männer mit geistiger Behinderung) Diese Schilderung zeigt, dass einige Einrichtungen noch sehr viel tun müssen, um ihre KlientInnen in den Aufbau und die Planung ihrer Einrichtung zu involvieren. Dies ist sogar bei jenen Menschen mit Behinderung möglich, die sich verbal nicht ausdrücken können. Die Benützung der allgemein zugänglichen Einrichtungen fördern Obwohl viele BetreuerInnen ins Treffen führen, ihre KlientInnen darin zu bestärken, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, werden noch immer viele Belange ihres Lebens für sie geregelt und viele Aktivitäten für sie organisiert. Dies lässt nicht genügend Spielraum, um die Teilhabe an allgemein zugänglichen Aktivitäten oder Einrichtungen zu gewährleisten. Ein Betreuer in einer Wohnung für sieben Menschen mit geistiger Behinderung erklärt: „Freizeitaktivitäten werden vom Personal für die KlientInnen organisiert, wie zum Beispiel Ausflüge, Restaurantbesuche, monatliche Abendaktivitäten, Urlaub etc.“ Eine Betreuerin eines Hauses für Menschen mit Autismus und zerebraler Lähmung erläutert, wie die Freizeitaktivitäten an ihrem Arbeitsplatz organisiert werden. Neben der Tatsache, dass sie öffentliche Verkehrsmittel benutzen, gibt es auch Anzeichen, dass die Nutzung anderer allgemein zugänglicher Einrichtungen gefördert wird, doch das Hauptaugenmerk wird auf Gruppenausflüge und interne Aktivitäten gelegt. 47 „Sie bespricht mit den KlientInnen, was sie gerne tun würden. Dann schaut sie sich im Ort um eine Arbeit oder einen Platz in einer Schule um. Einige Aktivitäten werden gemeinsam mit anderen HausBewohnerInnenn unternommen, zum Beispiel gehen sie ein Mal pro Woche wandern. Sie nehmen den hauseigenen Bus und fahren zu einem Ort ihres Interesses und gehen dann wandern. Sie unternehmen auch gemeinsame Einkaufstouren. Einige Aktivitäten finden in der Zentrale der Organisation statt, zum Beispiel Erholung.“ Durch die Benützung allgemein zugänglicher Einrichtungen werden den Menschen mit Behinderung Türen zu Netzwerken von Menschen geöffnet, die nichts mit ihrer Behinderung oder ihrer Einrichtung, in der sie betreut werden, zu tun haben. Ein Merkmal der neuen Pflege- und Betreuungsdienstleistungen ist die Suche nach Möglichkeiten, diese öffentlichen Einrichtungen zu nutzen. Wenn die sozialen Dienstleistungsanbieter weiterhin ein Monopol auf das Leben und Wohl und Weh ihrer KlientInnen haben wollen, werden die Kontakte zu anderen Menschen sehr limitiert bleiben und gewisse Fragen hinsichtlich Privatsphäre und Entscheidungsfreiheit der Menschen mit Behinderung aufwerfen. 48 Schlussfolgerungen – Standpunkt des Personals und anderer Fachleute In den frühen 1970er Jahren begann ein langsames Umdenken hinsichtlich großer Behinderteneinrichtungen in Richtung kleinerer, gemeindeintegrierter Wohnformen; dieser Prozess schlug sich auch in der Politik und in der Praxis quer durch Europa nieder und beeinflusste Größe und Art der Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.8 Die Mehrheit der Menschen mit Behinderung, die in dieses Projekt involviert waren, wohnten gemeinsam mit anderen Menschen mit Behinderung in einem Haus. In einigen Ländern, die an diesem Projekt teilnahmen, gab es überhaupt keine gemeindeintegrierten Wohneinrichtungen. In diesem Fall wurden Menschen, die eine eigene Wohnung hatten oder bei ihren Familien lebten, in das Projekt miteinbezogen. Mit welchen Reaktionen sahen sich die Experten, die während der Anfangsphase in diesen Einrichtungen arbeiteten, konfrontiert? Es gab Aussagen, aus denen hervorging, dass die NachbarInnen sich vor den BewohnerInnen fürchteten und besorgt über einen Wertverlust ihres Besitzes waren. Es gab auch mehrere Beschwerden über Baustellenlärm und andere Missstände. Diese Reaktionen oder Einwände gegen die BewohnerInnen schienen sich nach einer Weile zu verändern oder gar ganz zu verschwinden. Für dieses veränderte Verhalten hat es aber keine aussagekräftigen Begründungen gegeben. Angehörige des Personals bezogen diese Änderungen darauf, dass die Menschen mit Behinderung mit ihren NachbarInnen Bekanntschaft schlossen. Vielleicht wurden der Mensch und seine Behinderung durch diese Bande entmystifiziert, sprich ins rechte Licht gerückt? Wir werden diese Reaktionen der NachbarInnen überprüfen und in Teil II versuchen, die Gründe für diese Verhaltens- und Meinungsänderung herauszufinden. 8 KIM, S., LARSON, S.A. and LAKIN, C.K. (2001). Forschungsergebnisse im Verhalten der Menschen mit Behinderung durch Deinstitutionalisierung: Eine Rückschau auf US-Studien durchgeführt zwischen 1980 & 1999. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 26 (1), pp. 35-50. 49 Der Grad der Interaktion zwischen der Nachbarschaft und den KlientInnen der Dienstleistungseinrichtung war nach den Aussagen des betroffenen Personals ziemlich gering. Über paternalistisches Verhalten und die Auffassung des ‘ewigen Kindes’ wurde ziemlich oft berichtet. Nach Meinung der Fachleute könnte einer der Gründe das mangelnde Wissen der Allgemeinheit über Behinderung im Allgemeinen und über Menschen mit Behinderung im Besonderen sein. Offene Kommunikation und ein respektvoller Umgang miteinander werden als wertvolle Prinzipien in der Interaktion mit den NachbarInnen genannt. Diese Prinzipien könnten auch zur Vermeidung von Reaktionen beitragen, die durch Ignoranz, Zweifel und Bedenken entstehen. Durch den geringen Kontakt mit anderen NachbarInnen sind nach Meinung der BetreuerInnen die einzigen Freunde ihrer KlientInnen die MitbewohnerInnen oder andere Menschen mit Behinderung, die sie im Tagesheim oder am geschützten Arbeitsplatz treffen. Durch das ständige Zusammenleben in und mit einer Gruppe wird ein unbeschwertes Zusammentreffen mit anderen Menschen nicht gerade gefördert. Die befragten Fachleute waren sich der Tatsache bewusst, dass zum Beispiel Gruppenausflüge stigmatisierend sein können. Einige gaben zu, dass die NachbarInnen keinen ihrer KlientInnen als eigenständigen Menschen wahrnehmen, sondern sie nur als Gruppe kennen und sie mit der Einrichtung, in der sie wohnen, in Verbindung bringen: „Aha, die Behinderten, die in dem Haus am Ende der Straße wohnen.“ Die Teilnahme an allgemein zugänglichen Aktivitäten ist unter ihren KlientInnen auch nicht sehr verbreitet. Haben diese Beobachtungen das Personal dazu angespornt, Schritte zu unternehmen, um ihren KlientInnen die soziale Inklusion in der örtlichen Nachbarschaft zu erleichtern? Viele Einrichtungen, die von uns befragt wurden, organisieren spezielle Veranstaltungen, zu denen auch die NachbarInnen eingeladen werden. Während dieser Veranstaltungen haben die NachbarInnen die Möglichkeit, die Serviceeinrichtung von innen kennen zu lernen und mit BetreuerInnenn und KlientInnen zu reden. Damit soll eine Kontaktaufnahme erleichtert und den NachbarInnen die Befangenheit 50 genommen werden. Es ist jedoch nicht erwiesen, ob diese Initiativen auch den erwünschten Effekt erzielen. Hingegen können gewisse Einrichtungen, wie zum Beispiel Geschäfte, in denen handwerkliche Produkte und verschiedene andere Dinge zum Kauf angeboten werden, aber auch öffentlich zugängliche Schwimmbäder, sehr wohl auf regen Zuspruch verweisen. Ein gewisser Grad an öffentlicher Präsenz ist aber garantiert, da die BetreuerInnen ihre KlientInnen ermutigen, örtliche Geschäfte aufzusuchen. Gefördert werden nicht nur der Besuch von Geschäften für spezielle Bedürfnisse und medizinischen Bedarf, sondern auch die Teilhabe am öffentlichen Leben und die Inanspruchnahme externer Dienstleistungen. Eine weitere gute Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen, ist die Aufnahme einer Beschäftigung und die Vermittlung eines Arbeitsplatzes. Das gilt in Besonderem für die unterstützte Beschäftigung, da sie die Kontaktaufnahme mit Menschen ohne Behinderung bietet. Hingegen kann durch einen geschützten Werkstättenplatz nur mit Gleichgesinnten Kontakt aufgenommen werden. Beide Arten sollten jedoch forciert werden. Kontakte und Interaktion mit anderen erhöht die Wahrscheinlichkeit zur Entwicklung einer positiven Identität, einer eher den Menschen zugewandten Haltung und interpersoneller Kompetenzen, laut eines Forschungsberichtes von Crocket & Crouter (1995) et al.9. Wenn diese Kontakte über den geschützten Bereich hinausgehen und in die Bevölkerung hineinreichen, wird dadurch die soziale Inklusion der Menschen mit Behinderung gefördert. Einige BetreuerInnen weisen darauf hin, dass es nicht genug Personal gibt, um ihren KlientInnen die Teilnahme an verschiedenen allgemeinen Aktivitäten zu ermöglichen. Durch praktische und organisatorische Arbeiten können die BetreuerInnen ihren KlientInnen nicht mehr alle intern organisierten Freizeitaktivitäten anbieten. Freiwillige aus dem Ort können andere Kontakte fördern und erleichtern, die das soziale Netzwerk der Menschen mit Behinderung vergrößern würden, sodass ihre sozialen Kontakte nicht nur auf ihre Behinderung oder ihr Unterstützungsnetzwerk 9 CROCKETT & CROUTER, 1995; SILBERELSEN & TODT, 1994 in: PRETTY, G., RAPLEY, M. & BRAMSTON, P. (2002). Erfahrungen der Nachbarschaft und der Bevölkerung und die Lebensqualität von heranwachsenden Jugendlichen auf dem Land mit und ohne geistige Behinderung. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 24 (2), pp. 106 - 116 51 bezogen bleiben. Engagierte Freiwillige können somit – nach den Aussagen der Befragten - ein wichtiges Glied in der Kette in Richtung soziale Inklusion sein. Viele Befragte sind der Meinung, dass es auch notwendig ist, mit den KlientInnen an einer verbesserten Integration zu arbeiten. Ein Mangel an sozial verträglichem Verhalten wurde als Hemmschwelle für die Menschen mit Behinderung genannt, damit sie sich reibungslos in eine neue Umgebung eingliedern können. Siedeln sich Menschen mit Behinderung in einer neuen Umgebung an, zieht dies weder automatisch eine ‘Inklusion’ noch eine Verbesserung ihrer Lebensqualität 10 nach sich. „Es ist nicht ganz richtig, das Hauptaugenmerk nur auf Variable wie zum Beispiel Größe des Hauses, Personal, Bauart des Gebäudes und Ortsauswahl zu legen. Die BetreuerInnen und ihre Tätigkeit sind auch ein wichtiger Faktor, damit sich die Menschen mit Behinderung gut in ihre neue Umgebung eingewöhnen können“ 11. Das Personal muss seine Arbeits- und Handlungsweise an die geänderten Lebensbedingungen der Menschen mit Behinderung anpassen. Ein Unterstützungsmodell muss installiert werden, mit dem Ziel, den Menschen mit Behinderung einerseits mehr persönliche Kraft und Energie zu geben (BRUINCKS, MEYER, et al. (1981)) und andererseits muss diese Modell Strategien beinhalten, die die Entwicklung von neuen, sozialen Rollenmodellen für die BewohnerInnen unterstützen12. Das betreuende Personal bemerkt, dass es – was ihre KlientInnen betrifft – gelegentlich schwierig ist, eine Balance zwischen Verantwortung, Rechten und Risiko zu finden. Aber natürlich beeinflussen Veränderungen oder Übersiedlungen die Arbeits- und Handlungsweise des Personals. Haben Leitung und BetreuerInnen die Umkehr von einer eher beschützenden, ja manches Mal paternalistischen Haltung zum Empowerment geschafft, einer Haltung, in der die Menschen mit Behinderung 10 MC VILLY & RAWLINSON (1998) in: PRETTY, G., RAPLEY, M. & BRAMSTON, P. (2002). Erfahrungen der Nachbarschaft und der Bevölkerung und die Lebensqualität von heranwachsenden Jugendlichen auf dem Land mit und ohne geistige Behinderung. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 24 (2), pp. 106 - 116 11 MANSELL, J., BEADLE-BROWN, J., MACDONALD, S. & ASHMAN, B. (2003). Teilhabe an Aktivitäten in kleinen Gemeindeintegrierten Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 16, pp. 63-74. 12 O´BRIEN, P., THESING, A., TUCK, B. & CAPIE, A. (2001). Wahrnehmung von Veränderungen, Vorteile und Lebensqualität für Menschen mit Behinderung, die nach einem langen Heimaufenthalt in eine Gemeindeintegrierte Wohnung gezogen sind. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 26 (1), pp. 67-82. 52 dermaßen unterstützt und ermutigt werden, dass sie ihr eigenes Leben aktiv mitgestalten können? Ein Gradmesser dafür sollten die Autonomie und Wahlmöglichkeiten eines KlientInnen sein. Es gibt jedoch noch immer Berichte über einige Wohnbereiche, sogar über solche, die in der Bevölkerung integriert sind, in denen die Menschen mit Behinderung nicht auswählen können, wo und mit wem sie zusammenleben möchten. Dies führt dazu, dass sie vorwiegend mit ihresgleichen, also wiederum mit Menschen mit Behinderung, zusammen wohnen. Diese Beobachtung wurde bereits von Prof. Brown in den frühen 1990er Jahren gemacht13. Aus einigen von uns gesammelten Erzählungen geht hervor, dass der Förderung der individuellen Wahlmöglichkeit keine besondere Bedeutung zugemessen wird. Entscheidungen über alltägliche Dinge, wie zum Beispiel das Essen, werden noch immer in der Gruppe diskutiert und vom Personal mit entschieden. KlientInnenberatung und die Erstellung eines persönlichen Entwicklungsplanes müssen ein integrierter Teil des Unterstützungsangebotes der Serviceeinrichtung sein. Das Leben eines Menschen mit Behinderung verläuft nicht statisch, sondern ist für jede einzelne Person ein Wachstumsprozess, der realistischer Ziele und Perspektiven bedarf. 13 BROWN (1994) in CARNABY, S. (1998). Reflektionen über soziale Integration der Menschen mit Behinderung: Spielt die Unabhängigkeit eine Rolle? Journal of Intellectual & Developmental Disability, 23 (3), p. 219 – 229. 53 ABSCHNITT II Die Nachbarschaft und deren BewohnerInnen Einleitung Mit den Interviews der NachbarInnen und Geschäftsleute in der Umgebung wollten wir einen Einblick in ihr Denken und ihre Einstellung zu Menschen mit Behinderung gewinnen. Wir wollten Folgendes wissen: Was sie bei der Nachricht empfunden haben, dass Menschen mit Behinderung ihre zukünftigen NachbarInnen sind und warum sie so gefühlt haben? Ob es zwischen ihnen und den behinderten NachbarInnen irgendeinen Kontakt gegeben hat? Welche Art von Beziehungen zwischen ihnen geknüpft wurde? Wie die Behinderteneinrichtung ihrer Meinung nach ihr Leben und das ihrer Umgebung beeinflusst hat? Ob die nächsten NachbarInnen Informationen über die Einrichtung erhalten haben und ob durch diese Informationen die Übergangszeit für die Menschen mit Behinderung erleichtert wurde? Ob sie irgendwelche Probleme mit der Einrichtung und deren BewohnerInnenn hatten? Über die Reaktionen in der Nachbarschaft. Wir sprachen mit den hiesigen Geschäftsleuten und deren Angestellten, mit Angestellten der Bibliothek und mit Theaterleuten. Wir fragten sie, ob sie ihre Einrichtungen den Bedürfnissen der Menschen mit Behinderung angepasst hatten und wenn ja, wie sie dies bewerkstelligt haben. Ihre Meinung über die Anstellung von Menschen mit Behinderung. Wir geben im Folgenden einen Überblick über die wesentlichsten Themen, die in diesen Interviews aufgetaucht sind. Durch diese Übersicht wollten wir das vorherrschende Stimmungsbild in der Nachbarschaft über die Menschen mit Behinderung, die in eine gemeindeintegrierte Einrichtung zogen oder bei ihrer Familie wohnten, skizzieren. 54 Anfängliche Bedenken der NachbarInnen Dies ist die Abschrift eines Interviews mit einer 60-jährigen Frau, verheiratet und zwei Kinder. Nach den Angaben des Interviewers weiß sie weder über das Alltagsleben in diesem Haus für Menschen mit Behinderung noch über seine Einrichtungen und seine BewohnerInnen Bescheid. ... Es herrscht ein eher steifes Klima zwischen ihnen. Sie ist nett zu ihnen und toleriert sie. ... Dieses Interview spiegelt die Ansichten und Gedanken von einigen Befragten wider. Als sie das erste Mal von dieser Behinderteneinrichtung hörten, hatten sie Einwände, die mit der Zeit aber weniger wurden. Binnen kurzem hörte man keine negativen Bemerkungen mehr, doch der Kontakt blieb ziemlich oberflächlich. Ihre Meinung über Menschen mit Behinderung ist nach wie vor von einer allzu großen Vereinfachung und in bestimmten Punkten von Vorurteilen geprägt. „Sie haben uns nicht darüber informiert, dass nebenan eine Behinderteneinrichtung eröffnet wird, aber ich habe bemerkt, dass sie anfingen, im Garten zu arbeiten. Dann fragte ich, was hier vor sich gehe und bekam die Antwort, dass hier eine Gemeinschaftswohnung für Menschen mit Behinderung eingerichtet werden würde. ... Ich bin der Meinung, dass darüber wohl niemand sehr glücklich war. Vielleicht auch deshalb, weil wir nicht richtig informiert wurden, welche Menschen mit welchen Behinderungen hierher ziehen würden. Ich nehme an, dass sich die Leute vor der Lärmbelästigung fürchteten. Das allgemeine Bild von Menschen mit einer geistigen Behinderung ist, dass sie schreien und Ähnliches tun, daher haben wir uns alle gefürchtet, dass sie die Nachbarschaft zerstören. Aber ich glaube, dass wir letzten Endes alle positiv überrascht waren, dass diese Einrichtung doch sehr ruhig ist. Wir hören überhaupt keinen Lärm. Außerdem bin ich der Meinung, dass dieses Haus für uns sogar Vorteile hat, weil es in der Umgebung nun sicherer ist, da das Haus immer beleuchtet ist und sich Menschen in und um das Haus herum tummeln etc. Nun ja, ob Menschen mit Behinderung ihren Beitrag zur Gesellschaft leisten? Ich nehme an, es kommt auf ihre Fähigkeiten an. ... Einige haben ‘mehr Fähigkeiten’, obwohl sie behindert sind. Sie sind wirklich ruhig und friedlich, gelegentlich sehe ich sie ausgehen. Sie gehen auch in die Kirche und sitzen 55 dort und hören sich ruhig die Messe an. ... Der frühere Leiter grüßte uns immer und ab und zu schwatzten wir miteinander. Andererseits ist dies eine geschlossene Institution, ich weiß nicht, was da vor sich geht und das Personal kenne ich auch nicht. Darüber sprechen wir nie. Wenn behinderte Kinder in die gleiche Schule gingen wie gesunde (nicht behinderte) Kinder, würde das der Entwicklung der gesunden Kinder schaden. Obwohl ich sicher bin, dass es für die behinderten Kinder von Vorteil wäre, weil sie von den anderen lernen könnten. Es hängt von ihren geistigen Fähigkeiten ab. Aber vielleicht würden sie Minderwertigkeitskomplexe entwickeln, weil sie von den anderen nicht akzeptiert werden? Ich weiß es nicht. Vielleicht würden sie sich (die nicht behinderten Kinder) an die behinderten Kinder gewöhnen, wenn sie von Anfang an zusammen die Schulbank drückten und sie dann sogar lieb gewinnen und ihnen beistehen. Ich glaube, dass Kinder heutzutage dank dem Fernsehen klüger sind und sich nicht über sie lustig machen, so wie es zu unserer Zeit geschah.“ 56 Gründung einer neuen Behinderteneinrichtung und die Einbeziehung der Nachbarschaft Viel ist schon darüber diskutiert worden, ob Behinderteneinrichtungen die NachbarInnen informieren sollen oder nicht. Manche nehmen die Menschenrechtsperspektive als Ausgangspunkt und sehen sich nicht dazu verpflichtet, weil sie der Auffassung sind, dass ihre KlientInnen ohnehin das Recht haben, in einem Haus an einem Ort ihrer Wahl zu leben. Andere wiederum unternehmen einiges, um die Nachbarschaft auf ihre neuen NachbarInnen ‘einzustimmen’. Information über die Eröffnung einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung (n =43) 30 58% 25 20 42% 15 10 5 0 Ja Nein Die NachbarInnen wurden gefragt, ob sie vor der Eröffnung Informationen über die Behinderteneinrichtung erhalten hätten. 58% der Befragten sagten, dass sie vorher über die Eröffnung einer Behinderteneinrichtung in ihrer Nachbarschaft keine Mitteilung erhalten haben. Das folgende Interview wurde mit einer Familie geführt, die keine Vorabinformation erhalten hat. Laut Interviewer hat diese Familie am meisten gegen die Einrichtung in ihrer Nachbarschaft opponiert. Die Familie gab an, dass sie sich um die Sicherheit ihrer Kinder Sorgen machten, weil für sie der Anblick der Menschen mit Behinderung eine ‘traumatische Erfahrung’ sein würde. Aber die Familie hat ihre Meinung geändert. 57 „...Die Menschen machen sich wegen der neuen Einrichtung für Menschen mit Behinderung Sorgen: Einheimische waren nicht informiert, es gab Gerüchte, dass die Institution geschlossen werden würde und alle BewohnerInnen in kleinere Wohnungen in den Ort ziehen würden (was nicht stimmte). Auch der Doktor hat wieder mit seinen Sprüchen angefangen, dass ‘das (das heißt die Gründung einer neuen Einrichtung) nicht gut sei’. Zum ersten Mal hörten sie über die Einrichtung als die Institutionsleitung begann, sich nach anderen Häusern umzusehen. Die einheimische Bevölkerung sprach darüber, dass die Leitung die ‘Narren freilassen würde’. ... Sie waren positiv überrascht, als ihnen bewusst wurde, dass ihre behinderten NachbarInnen höflich und nett waren. Sie größten immer, fragten nach ihrem Wohlergehen und verschenkten oft Schokolade an Kinder etc. Darüber hinaus sind sie unter ständiger Aufsicht. Nun haben die Leute erkannt, dass es keinen Grund zur Sorge gibt.“ Die meisten Menschen haben vorher keine offizielle oder persönliche Benachrichtigung erhalten. Einige lasen in der Zeitung über die Einrichtung. Trotzdem hat ein Teil der Leute keine Einwände, denn für sie ist dieses Haus gleich wie jedes andere in der Nachbarschaft. Ein Vater von drei Kindern, der gerade in der Nähe der Einrichtung ein Haus gekauft hat, fragt sich, ob er absichtlich keine Benachrichtigung bekommen hat. Er gab an, dass er seine Kaufentscheidung ohnehin nicht geändert hätte, fragte sich aber, ob der frühere Hausbesitzer deswegen ausgezogen ist. „Er fand es schon interessant, dass ihm weder der Immobilienmakler noch der frühere Hauseigentümer mitteilten, dass nebenan eine Behinderteneinrichtung sei. Er war sich nicht sicher, ob dies absichtlich geschah, aber er vermutet es. Er fand es erst heraus, als die Besitzerin des Heimes bald nach seinem Einzug bei ihm vorbei kam und sich vorstellte. Er beteuerte wiederum, dass er sich nicht anders entschieden hätte, selbst wenn er von der Behinderteneinrichtung gewusst hätte. Trotzdem würde er gerne wissen, ob dies für den Vorbesitzer ein Problem war – keiner von seinen unmittelbaren NachbarInnen hat jedoch jemals über irgendwelche Konflikte oder Probleme mit der Institution oder seinen Einwohnern gesprochen.“ 58 Nicht informiert zu werden, beeinträchtigt den Geisteszustand mancher Leute. Sie wissen nicht, was sie erwartet. Ihre Ängste stammen oft von Gerüchten anderer NachbarInnen. Im Folgenden glaubt ein Mann, dass eine Einbeziehung positive Effekte hätte haben können. „Ich fand es schade, dass wir erst im allerletzten Moment darüber informiert worden sind, dass in Zukunft hier Menschen mit Behinderung leben werden. Es war am Anfang aufregend, weil man ja nie weiß, was das Neue bringt.“ (Mann, 49, verheiratet, zwei Kinder, mit einer behinderten Person bekannt) Die Gerüchteküche Die folgenden Beispiele, von denen eines von einer 72-jährigen Großmutter erzählt, zeigen, wie schnell Gerüchte ein Eigenleben entwickeln können. „Das Haus wurde vor sechs Jahren eröffnet, aber schon vorher kursierten die wildesten Gerüchte über die Einrichtung und die Einwohner wurden immer besorgter, wer denn da wohl einziehen würde. Wir haben nur die Worte ‘Schwierigkeiten’ und ’Probleme’ gehört und verfielen gleich in Panik. Wir wussten nicht, was dies alles bedeutete. Waren das Häftlinge, würden sie in sicherem Gewahrsam sein? Die Gerüchteküche brodelte immer heftiger, weil bis zur Fertigstellung des Heimes ein ganzes Jahr verging. Meine Tochter war wirklich um ihre Kinder besorgt. Alle Häuser hatten nach hinten hinaus ein erweitertes Flachdach und jeder konnte, wenn er wollte, an diesem Flachdach entlang laufen und in den Garten gelangen. Wir wussten einfach nicht, was uns erwartete. Sie war der Meinung, dass die Stadtpolitik viel mehr unternehmen hätte müssen, um den Menschen reinen Wein einzuschenken. Es war einfach dumm, sage ich Ihnen ... wir mussten nur abwarten. Die Einwohner waren überzeugt, dass die Politiker nur deswegen so heimlichtuerisch waren, weil sie Sexualstraftäter hierher bringen wollten.“ „Am Anfang wollten einige Leute den Einheimischen ‘das Fürchten lehren”, indem sie meinten, dass die neuen NachbarInnen laut und gefährlich seien; folglich waren sie über diese Einrichtung auch nicht sehr begeistert. Das war auch der Grund, warum die Nachbarschaft ziemlich kühl und distanziert war, aber in 1-2 Jahren wandelten sich diese Beziehungen in Freundschaften.“ 59 Informationen können auf unterschiedliche Art und Weise unter die Leute gebracht werden. Entweder vor oder nach der Eröffnung – mit einem Treffen, einem Besuch oder mit verschiedenen Aktivitäten der Einrichtung, wie zum Beispiel mit einem Tag der offenen Tür, einem Fest zum gegenseitigen Kennenlernen, mit anderen Festivitäten und Einladungen zum Essen. ... Einige HeimleiterInnen statten der Nachbarschaft Besuche ab, um die Menschen über die neuen NachbarInnen zu informieren. Aussagen der folgenden Befragten zeigen, dass die Menschen doch der Meinung sind, dass diese Aktivitäten für sie und ihre NachbarInnen von Bedeutung sind. Solche Maßnahmen erleichtern die Beziehungen zur neuen Einrichtung und ermutigen die Leute, das Haus und seine BewohnerInnen kennen zu lernen und Angst und Unsicherheit hintanzustellen. „Sie haben sich gegenüber der Nachbarschaft immer sehr informationsfreudig gezeigt: Bei geplanten Aktivitäten haben sie uns immer eine Mitteilung (oder eine Einladung) in den Postkasten gesteckt und sich für eventuelle Unannehmlichkeiten entschuldigt. ... Gelegentlich machen sie ein Fest oder ein Essen. Diese Aktivitäten wecken die Aufmerksamkeit der NachbarInnen, denn sie gehen oft dort hin und gewöhnlich treffen sie dort auch ihre nächsten Nachbarn.“ „Die Nachbarschaft war darüber informiert, dass die Absicht bestand, den Bungalow als Zuhause für Menschen mit Lernschwierigkeiten einzurichten. Es gab große Unruhe in der Umgebung und ein Treffen wurde mit dem Direktor der zuständigen Organisation vereinbart, bei dem er den NachbarInnen die meisten Ängste nehmen konnte.“ Reaktionen auf gemeindeintegrierte Einrichtungen für Menschen mit Behinderung Selbst wenn die Nachbarschaft informiert wird, geht es nicht immer gut aus. Negative Reaktionen können auftauchen, selbst wenn es Informationskampagnen für die angrenzenden BewohnerInnen gibt. 60 Das Netzwerk der Nachbarschaft Eine Witwe mit zwei erwachsenen Töchtern spricht über die Aktionen und Petitionen, die sie in Zusammenarbeit mit anderen NachbarInnen ins Leben rief, weil sie nicht wollte, dass die ‘dummen Kinder’ in ihrer Nachbarschaft leben. „Als die Umbauarbeiten begannen, wurde ich über die Einrichtung informiert. Sie wollten meine Unterschrift für irgendwelche Dokumente, die ich aber verweigerte. Ein ‘informeller Ausschuss’ von Einheimischen hat sich formiert, um über Maßnahmen zu diskutieren, die die Eröffnung dieses Hauses verhindern sollten. ... Mir wurde vom Ausschuss gesagt, dass ich die einzige Person sei, die das verhindern könne, weil ich die unmittelbare Nachbarin sei. Folglich starteten wir eine Unterschriftenkampagne und schrieben zuerst ein Gesuch an die Stadtgemeinde, das jedoch abschlägig behandelt wurde und später folgte ein Brief an die Bezirksverwaltungsbehörde, um die Eröffnung dieses Hauses zu verhindern.“ Auch der Leiter der Einrichtung, in deren unmittelbarer Nähe diese Frau wohnte, wurde befragt. Er war mit den Ängsten der NachbarInnen, was die Menschen mit Behinderung betrifft, konfrontiert, wobei die Ängste und Beschwerden jeder Grundlage entbehrten. Der Leiter antwortete folgendermaßen ... „Als die Stiftung das Haus erwarb und mit den Umbauarbeiten begann, schrieb ich einen kurzen Brief an alle NachbarInnen in dieser Straße und auch an jene aus der Parallelstraße, indem ich uns und unsere Ziele vorstellte. Als die Umbauarbeiten fertiggestellt waren, schrieb ich erneut einen kurze Mitteilung, in der ich sie im Namen unserer BewohnerInnen zur Eröffnungsfeier einlud. ... Wir versenden auch Weihnachts- und Ostergrüße. ... Ich verschickte Blumensamen mit einigen Grußworten an alle NachbarInnen in der Straße. Mit der anderen Nachbarin (siehe oben angeführte Schilderungen) wechseln wir hin und wieder einige Worte. Die NachbarInnen hatten ernstliche Bedenken und stellten uns während der Umbauarbeiten einige Bedingungen, (wie Privatsphäre) die wir alle erfüllten. Eines Tages behauptete die Witwe, dass an Wochenenden laute Parties im Haus gefeiert würden. Ich habe das wirklich bezweifelt, weil ich wusste, dass über das Wochenende niemand im Heim war. 61 Ein anderes Mal wiederum behauptete sie, dass wir Zigaretten und Abfall in ihren Garten werfen würden. Wieder war ich sehr überrascht, weil hier niemand raucht, aber es stellte sich heraus, dass es der fünfjährige Enkel des anderen Nachbarn war. ... Rund um die Eröffnung gab es auch etliche Probleme. Einerseits hatten wir mit einem der unmittelbaren Nachbarn eine Auseinandersetzung, andererseits gab es ein rechtliches Problem: Einer der früheren Hausbesitzer hatte schon vor langer Zeit bauliche Veränderungen am Gebäude vorgenommen, die von einem anderen Vorbesitzer hätten genehmigt und der Behörde zur Grundbucheintragung gemeldet werden sollen. Wir versuchten die Situation zu klären und das Einverständnis vom anderen Besitzer einzuholen, leider ohne Erfolg, was uns letztlich zur Aufgabe veranlasste. Soweit ich informiert bin, hat die Frau aus der Nachbarswohnung angefangen, Unterschriften zu sammeln, als sie hörte, dass hier eine Behinderteneinrichtung aufgemacht werden würde. Nun gut, ich sagte zu ihr, dass sie uns zwar behindern kann, indem sie die bürokratischen Verfahren verzögert, aber dass sie die Eröffnung dieser Einrichtung nicht letztlich verhindern kann, weil es unser gesetzliches Recht ist, hier zu wohnen. Natürlich bringt dieses Heim auch für sie keinerlei Nachteile. Sie glaubte mir damals nicht, aber jetzt nehme ich an, beginnt sie zu verstehen, dass ihre Bedenken unbegründet waren. Sie befürchtete, dass unsere BewohnerInnen in ihren Garten kommen, in der Nacht an ihre Tür und Fenster klopfen und immer schreien würden, sodass sie nicht mehr schlafen konnte. Sie hat mir klar und deutlich ihre Befürchtungen mitgeteilt und ich versuchte mein Bestes, um ihr klar zu machen, dass ihre Ängste jeder Grundlage entbehrten. Jedes Mal, wenn ich während der Umbauarbeiten jemand auf der Straße sah, ergriff ich darüber hinaus die Gelegenheit, mich persönlich vorzustellen, ihn/sie über unser Haus und unsere Ziele zu informieren und Frage und Antwort zu stehen. Aber gewöhnlich begegnete mir völliges Desinteresse oder Teilnahmslosigkeit. Hartnäckigen Gerüchten kann man mit Information allein oft nur schwer entgegen treten. Aus den verschiedenen Interviews kann man ersehen, dass der direkte Kontakt mit den Menschen mit Behinderung viel besser dafür geeignet ist, eine Haltungsänderung der Leute herbeizuführen. Durch den täglichen Umgang müssen 62 sich die Menschen eingestehen, dass ihr Bild von den Menschen mit Behinderung falsch war. Im folgenden Kapitel ‘Auswirkungen durch den Umgang mit Menschen mit Behinderung’ werden wir einige Änderungen näher beleuchten, nämlich die Auswirkungen, die der Kontakt mit behinderten Menschen auf die Einstellung und Denkweise der Öffentlichkeit hatte. Neben den Menschen, die keine Probleme mit der neuen Einrichtung hatten, haben wir die unterschiedlichsten Reaktionen der NachbarInnen zur Kenntnis genommen. Es gibt immer wieder viele Menschen, die sich anscheinend um nichts kümmern. Zu dieser Beobachtung werden wir später noch zurückkehren, wenn wir über das Leben in der Gemeinschaft im Allgemeinen sprechen. Die Gründe für einen Großteil der negativen Reaktionen scheinen Ignoranz und Unsicherheit zu sein. Die Leute verwechseln die Menschen mit Behinderung mit Personen mit psychischen Erkrankungen, die sie wiederum mit Häftlingen und Sexualstraftätern in Verbindung bringen. Natürlich wollen sie mit dieser ‘Art’ von Leuten nichts zu tun haben. Die meisten Leute wissen nicht, was sie erwartet. Einige beschreiben dies als ‘natürliche Angst vor dem Unbekannten’. Vielleicht ist diese Beschreibung gar nicht so schlecht, weil viele Menschen offenbar nicht wissen, was sie erwartet, wenn es heißt, dass Menschen mit Behinderung in ihre Nachbarschaft ziehen. Ein weiterer Grund für viele negative Reaktionen ist, dass der Tratsch blüht und sich die Menschen mit ungenauen oder falschen Informationen gegenseitig aufschaukeln. Die folgende Schilderung eines Mitarbeiters einer gemeindeintegrierten Wohneinrichtung zeigt, dass sich kurz nach der Eröffnung viele Missverständnisse aufklärten und Ängste von den NachbarInnen genommen wurden. „Als sie später herausfanden, was unterstütztes Wohnen eigentlich bedeutet, haben sie an diesem Projekt sogar Gefallen gefunden.“ Nur einige wenige haben beschlossen, Erkundigungen über ihre neuen NachbarInnen einzuholen. Gleichermaßen scheint die Bildung eines Ausschusses zur Verhinderung der Eröffnung der neuen Einrichtung eine extreme Reaktion zu sein. Worüber machen sich die NachbarInnen sonst noch Sorgen? Die Antworten fallen ziemlich vage aus, wahrscheinlich aufgrund des Nichtwissens der Leute. Die 63 NachbarInnen geben zu verstehen, dass sie sich um die Sicherheit ihrer Kinder Sorgen machen. Sie sorgen sich auch um die Sicherheit ihres Besitzes und um den Wertverlust ihrer Häuser rund um die Behinderteneinrichtung. Eine anderer Aspekt ist die Lärmbelästigung. Einige gaben an, dass sie darüber beunruhigt wären, dass die behinderten Menschen in diesem Haus nicht die richtige Betreuung bekämen. Dies lässt vielleicht auf das stereotype Bild schließen, das die Leute über die Abhängigkeit und Unterstützungsmöglichkeiten von behinderten Menschen haben, während sie ihre Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten nicht erkennen können. Die folgende Aussage einer 51-jährigen Witwe gewährt uns einen interessanten Überblick über die verschiedenen Gründe. Der letzte Satz weist wieder darauf hin, dass sich die Meinung der NachbarInnen nach einer Weile ändert. „Sie erklärte, dass die Hauptangst der einheimischen Bevölkerung die Lärmbelästigung war und dass als Folge die Wohnungen und Häuser in der Nähe der Behinderteneinrichtung an Wert verlieren würden. Auch der Ausdruck ‘geistig behindert’ löste Angst aus. ... Einheimische waren auch über die Stimmung in der Nachbarschaft besorgt. ... Sie hörten Negatives über die Menschen mit einer geistigen Behinderung. Für ihre Ängste gab es jedoch keine Anhaltspunkte und sie bedauert, was sie getan hat.“ VORURTEILEN ENTGEGENTRETEN Würden die erwähnten Ängste durch eine verbesserte Informationspolitik über Behinderung aus der Welt geschafft? Würde die Öffentlichkeit wirklich von einer korrekten Information über Menschen mit Behinderung und über das Konzept des integrierten Wohnens des Angebotes über Pflege- und Betreuungsdienstleistungen profitieren? Könnte eine umfassende Medienkampagne das Bild der Menschen in ein positiveres Licht rücken und die unbegründeten Ängste wegnehmen oder sind all diese Maßnahmen ohne Wirkung? In Bezug auf die Haltungsänderungen, die hier sehr oft erwähnt werden, kann man auch noch andere Schlüsse ziehen. Der zwischenmenschliche Umgang scheint die 64 Reaktionen und Ansichten der Menschen zu ändern. Viele Leute gaben an, dass sie nicht genug Kontakt mit ihren behinderten NachbarInnen hatten, um Bekanntschaften zu schließen, ihre Einstellung anzupassen und ihr Unbehagen abzuschütteln. Diese Aussagen lassen darauf schließen, dass es sich wirklich lohnt, Zeit und Energie in die gegenseitige Kommunikation zu investieren. Es zeigt auch, dass nur durch das gegenseitige Kennenlernen die Vorurteile mit der Zeit kleiner werden. Wir wissen nicht, wie die Informationsbereitstellung diese Fakten beeinflussen könnte. Information allein scheint nicht genug zu sein. Die Forschung hat gezeigt, dass das Zusammentreffen mit Menschen mit Behinderung eine viel größere Wirkung auf die Menschen hat. In diesem Zusammenhang möchte ich auf eine große Medienkampagne in den Niederlanden mit dem Titel ‘Die Herausforderung für die Niederländer’14 verweisen, in der die Menschen aufgefordert wurden, eine Person mit einer Behinderung auf der Basis gemeinsamer Interessen, wie zum Beispiel Musik oder Fußball, zu treffen. Durch diese Kampagne sollten Empfindungen wie Verlegenheit und Peinlichkeit beim aktiven Tun und Handeln bewältigt werden. Für Personen ohne Beeinträchtigungen gibt es bei der Kontaktaufnahme mit behinderten oder chronisch kranken Personen gewisse Hemmschwellen. Deshalb lautete die Devise dieser Kampagne: ‘Stell´ dir vor, wie es ist, finde heraus, was du tun kannst.’ Die ganze Kampagne zielte darauf ab, sich mit Menschen mit Behinderung oder chronisch kranken Personen zu identifizieren und sich danach bewusst zu machen, wie man selbst gerne behandelt werden möchte, wäre man behindert oder chronisch krank. Dadurch wollte man ein Ende der Barrieren im täglichen Umgang oder zumindest eine Möglichkeit, dieses Thema auf die Tagesordnung zu setzen, erreichen. Die Medienkampagne war insofern ein großer Erfolg, als eine bemerkenswerte Verbesserung in der Einstellung und des Images hinsichtlich der Menschen mit Behinderung erzielt wurde. Diejenigen, die sich bei dieser Kampagne exponiert hatten, waren wesentlich eher als andere geneigt, den Menschen mit Behinderung eine eigenständige Lebensgestaltung zuzugestehen. Die Kampagne kam am besten bei jüngeren Männern mit hohem Bildungsniveau an. Im folgenden Teil können wir ersehen, wie 14 Die Herausforderung für die Niederländer, eine niederländische Medienkampagne (2002) von Ronald Besemer, Jan Franssen & Aartjan Ter Haar, http://www.community- lives.org/com/eventsdetail.php?id=8 65 das Leben in der Nähe einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung die NachbarInnen und ihre Vorstellungen und Ansichten über Behinderung beeinflusste. Auswirkungen des Kontaktes mit Menschen mit Behinderung Einige Schilderungen zeigen - was Behinderung betrifft - eine gewisse Änderung in der Denkweise, aber sie zeigen auch ein noch immer grundlegend falsches Bild über Menschen mit Behinderung und deren Fähigkeiten, sowie darüber, wieviel Kontrolle sie benötigen und wie diese aussehen soll. Die Leute haben noch immer eine falsche Vorstellung von Behinderung und den möglichen Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen. Das Bewusstsein erhöhen? Der Umgang mit Menschen mit Behinderung erhöht das Bewusstsein über ihre Fähigkeiten. Er vertieft das Verständnis für die Menschen mit Behinderung. Die Leute hören auf, behinderte Menschen als pflegebedürftig einzustufen. Sie entdecken, dass es für sie möglich ist, in kleinen Gruppen ein ‘ziemlich’ unabhängiges Leben zu führen. Sie beginnen, ihnen mehr Vertrauen entgegenzubringen und erachten sie öfter als gleichberechtigte Personen mit den gleichen Bedürfnissen und Zielen, mit Begabungen und dem Recht, so behandelt zu werden, wie alle anderen auch. Diese verschiedenen Auswirkungen wurden von etlichen Interviewern berichtet, aber wir glauben, dass die Konfrontation mit Behinderung sicher Fragen aufwirft, aber keine echtes Bewusstsein schafft, weil die Menschen noch immer an falschen Vorstellungen festhalten. „Ich glaube, dass diese Person nicht in der Lage ist, im Markt mit Kunden umzugehen. Diese Person kann nur dort arbeiten, wo keine Kunden sind, wie zum Beispiel im Lager.“ „Behinderte Menschen sollten kein Geld in die Hände kriegen, weil es könnte ihnen gestohlen werden oder jemand könnte sie um ihr Geld betrügen.“ 66 Einige Personen berichteten über eine geänderte Einstellung, nachdem sie in der Nähe einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung gewohnt hatten. In der Nähe der Menschen mit Behinderung zu leben, wirft auch bestimmte strittige Punkte wie Zugänglichkeit oder Verfügbarkeit auf. „Es macht mich nachdenklich, wie die Gesellschaft im Allgemeinen mit diesen Menschen umgeht.“ Aber einige Reaktionen zeigen deutlich, dass die Öffentlichkeit noch immer in konservativen Stereotypen denkt, wenn es um Menschen mit Behinderung geht. Um welche Vorurteile geht es? - Vorurteil 1: Menschen mit Behinderung müssen vielen Dingen die Stirn bieten - Vorurteil 2: Menschen mit Behinderung sind in ihren Handlungen und Taten sehr eingeschränkt Beide Vorurteile können in einer ganzen Reihe von Bemerkungen, die wir von den NachbarInnen gesammelt haben, identifiziert und in drei verschiedene Kategorien einge-teilt werden: Bewunderung (für den Mut der Leute) Bewunderung für die behinderte Person selbst oder für die Eltern. Sie halten sie für tapfer, weil sie fähig sind, ein Leben mit derartigen Beeinträchtigungen zu führen. „Ich finde es ist sehr traurig, aber für mich sind die Eltern sehr tapfere Leute.“ Mitleid Oft ausgedrückt in Zusammenhang mit ihrer eigenen Situation. Die Konfrontation mit Behinderung macht den Leuten bewusst, in welch glücklicher Lage sie selber sind und dass sie ‘davon verschont geblieben sind’. „Es ist mir voll und ganz bewusst, dass wir Gott danken müssen, dass er uns gesunde Kinder geschenkt hat.“ „Deine eigenen Probleme werden relativiert.“ 67 Infantilisierung und Paternalismus Im Gegensatz zu der Tatsache, dass die Menschen mehr über Behinderungen wissen und somit behinderten Menschen auch mehr Verständnis entgegenbringen können, hängen viele Menschen, was Behinderung betrifft, noch immer tradierten, naiven und oft falschen Vorstellungen nach. Sie verklären das Leben behinderter Menschen und das, was den Menschen ausmacht oder stellen ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten in Abrede. Für manche sind Menschen mit Behinderung immer nett und freundlich, niemals zornig oder unzufrieden. Das Bild einer zornigen Person gehört nicht zum Image eines Menschen mit Behinderung. Auch die beiden folgenden Personen tragen dieses unvollständige Bild in sich. Hier finden sie ein Interview mit einer stellvertretenden Pfarrerin einer hiesigen Kirche. Es zeigt, wie diese Frau einer behinderten Person, die regelmäßig in die Kirche geht, gewisse positive Effekte zuschreibt. Trotz des Umstandes, dass sie die Kirchenbesuche dieser Person sehr positiv sieht, hat sie eine doch ziemlich verklärte Sicht der Dinge. „Sie findet, das die Menschen mit Behinderung, die in diese Kirche kommen, eine wertvolle Rolle als ‘Lehrer’ für Akzeptanz spielen und die ganze Kirchengemeinde ja soviel von ihnen gelernt habt – sie tun ja so viel Gutes. Eine Friseurin sagte über ihre behinderten KundInnen Folgendes: „Zu mir kommen an die sieben KundInnen mit Behinderung. Sie kommen regelmäßig und ich mag sie sehr. Sie sind wie die Sonne und immer fröhlich.“ Sind Fernsehen und Medien aufgerufen, ein besseres, realistischeres Bild der Menschen mit Behinderung zu kreieren und zu unterstützen? Ein Artikel von Peter Radtke zeigt, dass die Bevölkerung die Menschen mit Behinderung heutzutage als arme Menschen bezeichnet, denen man Sympathie entgegenbringen oder sie als Helden sehen und sie für ihre Stärke und Tapferkeit, mit der Last einer Behinderung zu leben, bewundern sollte. Andere Aspekte werden selten hervorgehoben. 68 Diese einseitige Bild führt in der Öffentlichkeit zu der falschen Vorstellung, dass Menschen mit Behinderung nur eine durch ihre Behinderung charakterisierte Gruppe sind.15 Eine Person mit einer körperlichen Behinderung beschreibt dies so: „Wir werden noch immer nicht als Varianten auf den Standard gesehen, dabei sind wir alle Varianten des Standards.“ Verbesserung der kommunikativen Fähigkeiten Viele Menschen fühlen sich in der Gegenwart von Menschen mit einer Behinderung nicht wohl. „Selten fange ich an zu reden, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll.“ Sie wissen nicht, was sie sagen oder wie sie mit ihnen reden sollen. Das ist sogar von behinderten Menschen, die selbst an diesem Projekt beteiligt waren, berichtet worden. Das ist bekannt als das ‘Nimmt-sie-Zucker-Syndrom’, das heißt, dass Personen mit Behinderung nicht direkt angesprochen werden, sondern über sie hinweg gesprochen wird, selbst wenn es um die behinderte Person geht. Wir werden dazu in Abschnitt III noch mehr ins Detail gehen. Eine Person mit einer Behinderung sagt aus: „Sie fragen meinen Ehemann, wie es meiner Familie geht, obwohl ich direkt neben ihm sitze.“ Die Leute geben an, dass sie sich im Umgang mit ihren ‘besonderen’ NachbarInnen nach einer gewissen Eingewöhnungszeit wohler fühlten. Es wurde berichtet, dass die Leute das überfreundliche und betuliche Verhalten abgelegt haben. Sie gaben auch ihre reservierte und distanzierte Haltung auf. Andere wurden geduldiger und verständnisvoller und kamen den Bedürfnissen der behinderten Personen mehr entgegen. „Es hilft nichts, sie zu bemitleiden oder ein Theater zu machen.“ 15 Peter Radtke, Zwischen Bettler und Batman: Das Bild der Menschen mit Behinderung in den Medien. EDF Bulletin: Sonderdossier über „Medien und Behinderung“ – April-Juni 2003, p. 11-13 69 „Ja, nach einer gewissen Zeit geht es leichter und schneller, mit ihnen Kontakt aufzunehmen.“ Mehrere Gründe sind für eine Meinungs- und Verhaltensänderung ausschlaggebend. Diese Gründe können in zwei Gruppen eingeteilt werden. Einerseits gewöhnt man sich an sie, an die Art und Weise, wie sie sprechen und ausschauen – dies ist der Effekt einer näheren Bekanntschaft. Andererseits sind die Informationen über die Menschen mit Behinderung und der Kontakt mit ihnen und ihrer Wohneinrichtung ausschlaggebend für eine Meinungsund Verhaltensänderung. „Das Leben als Nachbar hat meine Haltung gegenüber den behinderten Menschen insofern geändert, als ich sie als ‘Leute’ ansehe, mit denen ich in Kontakt stehe.“ „Ja, es ist anders, wenn man sie besser kennen lernt. Man ist mehr involviert.“ Einfluss der Freiwilligenarbeit Einige NachbarInnen haben sich in Behinderteneinrichtungen engagiert und helfen aus, wenn es notwendig ist. Dieser Mann, ein pensionierter Heeresangestellter, hat sogar beim Bau des Wohnkomplexes mitgeholfen. Er beschreibt die verschiedenen Entwicklungsstufen in der Beurteilung der Menschen mit Behinderung, das heißt, wie er und seine NachbarInnen graduell die Meinung über Menschen mit Behinderung geändert haben. „Die Leute in der benachbarten Umgebung wurden über das Projekt nicht offiziell informiert, aber er hat davon gewusst und trotzdem beim Bau geholfen. ... Die nächsten NachbarInnen haben bei der Installation geholfen (des Gebäudes, das früher eine kleine Schule war). Es hat viele freiwillige Helfer gegeben. ... Die vorherrschende Meinung beschreibt er folgendermaßen: Die meisten Menschen haben ihren Job und sind nicht wirklich an etwas anderem interessiert. So lange es in der Nachbarschaft ruhig ist, kümmert es sie nicht, ob hier Menschen mit Behinderung leben oder ob es nebenan eine Schule gibt. 70 Zu Beginn hat er sich in der Gegenwart der Menschen mit Behinderung nicht sehr wohl gefühlt, aber nach einer gewissen Zeit hat er entdeckt, dass sie sich nicht von den anderen unterscheiden. Während er vorher den Kontakt eher vermieden hat, hat er mittlerweile gelernt, mit ihnen auszukommen. ... Er meint, dass er ohne sein Vorwissen, das er durch seine Freiwilligentätigkeit gewonnen hat, sicher nicht erkannt hätte, dass diese Menschen versuchen, ein Leben wie alle anderen auch zu führen. Er ist auch der Meinung, dass er bei der Organisation des Tages der offenen Tür anlässlich der Eröffnung viel dazugelernt hat.“ Dienstleistungen, Geschäfte und andere öffentlich zugängliche Einrichtungen Unsere InterviewerInnen haben neben den Familien, die in der Nachbarschaft der Menschen mit Behinderung wohnen, auch Geschäfte und andere örtliche Einrichtungen, besucht. Wir fragten, ob es möglich ist, die Geschäfte und andere Einrichtungen den Bedürfnissen der Menschen mit Behinderung anzupassen und ob sie auch in Erwägung ziehen, einen behinderten Menschen anzustellen. Außerdem fragten wir, ob sie Menschen mit Behinderung gelegentlich auch als Kunden haben. Spezielle Vorkehrungen für Menschen mit Behinderung Was machen Geschäftsleute, um die Barrieren aus dem Weg zu räumen, um Menschen mit Behinderung als Kunden zu gewinnen oder die Nutzung ihres Geschäftslokales für diese Kundengruppe zu erleichtern? Diese Änderungen können auf verschiedenen Ebenen vor sich gehen. Es kann sich um die Entfernung von baulichen Barrieren handeln, es kann um adaptive Maßnahmen oder um zusätzliche Hilfsmaßnahmen gehen. Ob und wie die Geschäftsleitung diese Kundengruppe berücksichtigt, sagt oft etwas über ihre Einstellung zu den Menschen mit Behinderung aus. Kooperation zur Gleichbehandlung in einem kulturellen Umfeld Hier geht es um ein Theater im städtischen Bereich, das sich bereits seit vielen Jahren für Menschen mit geistiger Behinderung und psychischen Erkrankungen 71 einsetzt. Regelmäßig besuchen Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen das Theater. Sie arbeiten mit einer Organisation für Menschen mit Behinderung zusammen, um einige Stücke und Projekte für behinderte Menschen zu adaptieren. Sie sind der Meinung, dass ein Mitarbeiter mit Behinderung ihnen als Fachmann zur Seite stehen könnte, um die gegenwärtigen Maßnahmen für die Menschen mit Behinderung zu verbessern. Wir haben zum Großteil positive Erfahrungen gemacht. Durch die jahrelange Hauskrankenpflege und das psychiatrische Krankenhaus in der Stadt wurde die Bevölkerung, aber auch das Personal des Kulturzentrums mit ‘den Anderen’ zusammengeschweißt. Wir beobachten aber, dass Theater von geistig behinderten Menschen anders erlebt wird, denn sie haben mehr Ausdruckskraft. Für uns ist das kein Problem, aber für eine kleine Minderheit unseres Publikums kann es während einer Aufführung störend sein. Es gibt aber sehr wenig negative Reaktionen, weil unser Publikum sehr tolerant und viel gewöhnt ist, weil die Stadt schon seit vielen Jahren mit behinderten Menschen zu tun hat. Treffen Sie für ihre behinderten KundInnen irgendwelche Maßnahmen, um Ihr Dienstleistungsangebot zur verbessern? Für RollstuhlfahrerInnen gibt es bei jeder Vorstellung zehn Plätze. In jeder Spielsaison versuchen wir ein oder zwei Objekte für/über behinderte Menschen einzubauen, oft in Verbindung mit einer Organisation, die uns Informationen über Menschen mit Behinderung zur Verfügung stellt. In der nächsten Saison werden wir eine Broschüre in Zusammenarbeit mit dieser Organisation auflegen, die Informationen speziell über Menschen mit einer geistigen Behinderung bietet. Eine gewisse Anzahl der Aufführungen aus unserem Programm wird nach einer entsprechenden Überarbeitung folgen. Würden Sie eine Person mit einer Behinderung in ihrem Unternehmen aufnehmen? Wenn ja, warum? Wenn nicht, warum? Es ist sicher so, dass eine Behinderung keine Rolle spielt, wenn die richtige Qualifikation für eine bestimmte Position vorhanden ist. Ein Mensch mit Behinderung wird innerhalb einer Organisation als Experte eingesetzt. Die Vorschläge für derartige Initiativen für diese Zielgruppe können sofort von einem behinderten Mitarbeiter bearbeitet werden. Ein behinderter Mitarbeiter kann 72 auch im Hintergrund seiner eigenen Behinderung diese Initiative begutachten. So kann das ganze Unterfangen nur an Qualität gewinnen.“ Das Fremdenverkehrsbüro hat vor kurzem eine Person mit einer Behinderung angestellt. Es hat sein Angebot für andere Menschen mit Behinderung verbessert. Die Leitung des Fremdenverkehrsbüros ist wie das Theater ebenfalls der Meinung, dass eine behinderte Person das notwendige Wissen mitbringt, um die Angebote für diese Zielgruppe zu adaptieren. Die Konfrontation oder Kooperation mit einem behinderten Mitarbeiter hat auch die anderen KollegInnen verändert. Sie haben nun einen unbefangenen Umgang mit behinderten Menschen. Ein Teil der Informationen, die im Fremdenverkehrsbüro aufliegen, richtet sich an die Menschen mit Behinderung und ihre speziellen Bedürfnisse, wenn sie auf Reisen gehen. „Im Fremdenverkehrsbüro arbeitet auch eine Person mit Behinderung und meine KollegInnen haben sich an den Umgang mit ihr gewöhnt. Am Anfang haben sich die anderen Mitarbeiter ein wenig auf ihren neuen, geistig behinderten KollegInnen einstellen müssen, aber jetzt läuft alles reibungslos. Menschen mit Behinderung kommen mit den gleichen Fragen zu uns wie nicht behinderte Personen, nämlich mit Fragen über Angebote für Urlaub und Freizeit. Ist die Interaktion mit dieser Kundengruppe einfach und unkompliziert oder gibt es Probleme? Es gibt keine Probleme mit den Kunden. Vorher (bevor die behinderte Person hier gearbeitet hat) war es für viele Mitarbeiter viel schwieriger, aber nachdem sie mit behinderten Menschen Kontakt haben, haben sie sich darauf eingestellt (im positiven Sinne). Ich selbst habe einen behinderten Bruder und hatte ohnehin nie Probleme. Ich scheue mich nicht, eine Person mit Behinderung einzustellen. Ergreifen Sie irgendwelche Maßnahmen, um Ihre Angebote für Menschen mit Behinderung zu verbessern? In unserer Broschüre (Reiseempfehlungen) wird hervorgehoben, welche Aktivitäten und Gebäude für RollstuhlfahrerInnen zugänglich sind. Für Blinde und Sehschwache haben wir einen eigenen Veranstaltungskalender auf Band (aufgenommen). Darüber hinaus ist unser Gebäude auch für RollstuhlfahrerInnen zugänglich.“ 73 Ein Mitarbeiter der Bibliothek beantwortete unsere Fragen folgendermaßen. Menschen mit Behinderung sind in der Bibliothek sowohl als Leser als auch als MitarbeiterIn willkommen. ... „Wir versuchen immer, die Bedürfnisse von möglichst vielen unterschiedlichen Personengruppen abzudecken. ... Ergreifen Sie irgendwelche Maßnahmen, um Ihre Angebote für Menschen mit Behinderung zu verbessern? Wir sind rollstuhlgerecht eingerichtet, haben Kassetten, Bücher in Brailleschrift, Bücher mit großer Schrift, Videokassetten, behindertengerechte Toiletten. Würden Sie in ihrem Unternehmen eine Person mit einer Behinderung anstellen? Das haben wir bereits in der Vergangenheit getan und es hat sehr gut funktioniert. Wir würden niemanden aufgrund einer Behinderung diskriminieren:“ Wir haben sehr viele Supermärkte befragt. Dieser Supermarkt hat erst vor kurzem seine Infrastruktur für eine verbesserte Zugänglichkeit für Rollstuhlfahrer adaptiert. Mit der Einführung des Euro hat man auch für Menschen, die sich mit der Euroumstellung schwer getan haben, an den Kassen Unterstützung angeboten. Eine Person mit Behinderung hat versucht, in diesem Geschäft zu arbeiten, aber leider ohne Erfolg. „Ja, es kommen jeden Tag einige Menschen mit Behinderung zu uns. Hauptsächlich sind es RollstuhlfahrerInnen. Wir haben nicht viele Kunden mit Sinnesbeeinträchtigungen. Menschen mit geistiger Behinderung kommen vor allem in Gruppen und mit der entsprechenden Betreuung in das Geschäft. Personen mit einer leichten geistigen Behinderung fallen nicht auf, ausgenommen bei der Einführung des Euro, als es gelegentlich Probleme bei der Kassa gegeben hat. Diesen Leute sind wir natürlich immer behilflich. Vor kurzem haben wir unsere Zwischengänge erweitert, um den RollstuhlfahrerInnen genug Spielraum zum Wenden des Rollstuhles zu geben. Vor einigen Jahren haben wir den Eingangsbereich geändert. Früher stand da eine kleine Mühle, die für die Menschen mit Behinderung oft ein Problem war. 74 Wir haben auch eine Kasse mit einem extrabreiten Durchgang gemacht. Es wird versucht, diese Kassa möglichst oft offen zu halten, aber es ist halt nicht immer machbar. Wir haben einen behinderten Mitarbeiter gehabt, der einen schrecklichen Autounfall erlitten hatte: Er konnte seine Sprache und seine Bewegungen nicht mehr koordinieren. Er hat sechs Monate in diesem Geschäft gearbeitet, sein Bestes gegeben und alle haben ihn geschätzt. Er hatte jedoch Schwierigkeiten, mit den anderen Schritt zu halten und er tat sich sehr schwer. Es wurde betont, dass die Arbeit im Supermarkt an sich schon sehr hart und für eine behinderte Person eher ungeeignet sei. Bei der Anstellung kommt es natürlich auf die Art der Behinderung an. Vielleicht wäre ein Job an der Kasse besser für bestimmte Menschen mit Behinderung geeignet.“ Viele bauliche Veränderungen waren notwendig, um den Menschen mit Behinderung, vor allem den RollstuhlfahrerInnen, den Zugang zu ermöglichen: Adaptierte Eingangsbereiche, breite Korridore und Gänge, behindertengerechte Toiletten, spezielle Einkaufswägen, elektronische Stühle, ständig verfügbare Assistenz, weite und niedrige Checkout-Möglichkeiten, elektronische Türen und niedrige Kassen. Im Gegensatz zu diesen Anpassungen für körperlich behinderte Personen scheint es den Geschäftsinhabern viel schwerer zu fallen, Adaptierungen zur Verbesserung ihres Angebotes für geistig behinderte Kunden vorzunehmen. „In einem Supermarkt gibt es keine großen Entwicklungsmöglichkeiten, um die Zugänglichkeit für geistig behinderte Menschen zu verbessern.“ Dieses Kino hat auch nur vordergründige Adaptierungen im Sinn: „Nein, wir unternehmen keine besonderen Schritte zur Verbesserung unseres Angebotes für behinderte Menschen.“ Stellvertretender Leiter im Postamt: „Wir stehen immer zur Verfügung, wenn jemand Hilfe benötigt; wir haben für RollstuhlfahrerInnen einige niedrige Schalter und einen Schalter für gehörlose Personen. 75 Eine Person mit Behinderung meint, dass Menschen mit Behinderung mehr Energie dazu verwenden sollten, die GeschäftsinhaberInnen mit den Hürden zu konfrontieren, die ihnen den Zugang unmöglich machen. „Er kennt einige Geschäftslokale, die tatsächlich mehrere Adaptierungen vorgenommen haben, nachdem er mit seinem Rollstuhl wiederholt ins Geschäft gekommen war. Man kann sagen, dass es nicht nur an den Geschäftsleuten liegt, sondern auch an den Menschen mit Behinderung selbst. So lange niemand mit ihren Problemen konfrontiert wird, kann man auch keine Änderungen erwarten.“ Unzugänglichkeit Sehr oft kommt es vor, dass Menschen mit Behinderung beim Zugang zu einem Gebäude oder bei einer Aktivität auf unüberwindliche Hürden stoßen. Einige der befragten Einrichtungen realisierten die Notwendigkeit entsprechender Adaptierungsmaßnahmen, andere wiederum hielten sie für eine Zeit- und Geldverschwendung. Der Kinokomplex Für Menschen mit Behinderung gibt es natürlich besondere Vorkehrungen. Es gibt einen Lift, mit dem man ohne Probleme in jedes Stockwerk gelangen kann. Falls notwendig, werden behinderte Menschen zu ihrem Platz begleitet und auf jedem Stockwerk gibt es behindertengerechte Toiletten. Es gibt aber noch immer Probleme, wie zum Beispiel ein fehlendes Platzangebot für Rollstuhlfahrer. Sie müssen im Zwischengang oder vor der ersten Reihe sitzen (auf Wunsch werden behinderte Personen zu ihrem Platz getragen). Weitere Nachteile sind die Stufen bei fünf von den sieben Kinos. Wenn sie wissen, dass eine Gruppe von behinderten Menschen kommt, bemühen sie sich um eine Änderung des Programmes, sodass diese Personen eine für sie adaptierte Spielstätte vorfinden. Schwierigkeiten gibt es jedoch mit den feuerpolizeilichen Bestimmungen, weil alle Kinoausgänge Stufen haben, die aber aus baulichen Gründen unmöglich geändert werden können. Sie unternehmen für Menschen mit Behinderung nichts von sich aus, da sie auch nicht genau wissen, was und wie geändert werden soll. Eine Initiative aus 76 dieser Ecke wäre höchst willkommen, mit einer bestimmten Frage. Beide Seiten würden sicher davon profitieren, weil diese Personengruppe am Nachmittag kommen könnte (die meisten arbeiten nicht) und so die geschäftsarme Zeit beleben würden. Für Menschen mit Behinderung gibt es einen vergünstigten Tarif. Jedes Jahr wird ein Film für eine Organisation für geistig leicht behinderte Menschen angeboten, bei dem sie die Hälfte der Einnahmen lukrieren. Im Dezember findet ein Kongress eines Vereines von Menschen mit Behinderung statt, die übrigens die Zugänglichkeit dieses Komplexes überprüften und für gut befanden. Bis zum heutigen Tag hat sich keine behinderte Person jemals um eine Arbeit in diesem Kinokomplex bemüht. Es scheint dem Leiter des Modegeschäftes offensichtlich nicht in den Sinn zu kommen, dass die geringe Anzahl behinderter Kunden etwas mit der Unzugänglichkeit seines Geschäftes zu tun haben könnte. „Kommen oft Menschen mit Behinderung als Kunden in ihr Geschäft? Fast nie. Ich kann mich nur an einige wenige Kunden erinnern. ... Ich weiß, dass Rollstuhlfahrer unmöglich hereinfahren können. Es wäre nicht schlecht, dagegen etwas zu unternehmen.“ Auch andere Einrichtungen arbeiten mit diesen falschen Begründungen. Sie behaupten, dass die Menschen mit Behinderung für adaptive Maßnahmen eine zu kleine KundInnengruppe darstellten. Die umgekehrte Beweisführung, dass diese Unzugänglichkeit die Menschen mit Behinderung von einem Geschäftsbesuch abhält, lassen sie nicht gelten. Dieser Standpunkt wurde auch von einem Nachbar vertreten: „Vor einigen Jahren habe ich eine ‘Expertenmeinung’ gehört, in der behauptet wurde, dass ein Zugang zu den öffentlichen Verkehrsmitteln für Menschen mit Behinderung nicht notwendig sei, weil sie sie ohnehin nicht benutzten. Nun ja, das mag schon richtig sein. Ich bin aber der Überzeugung, wenn wir die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen, werden sie kommen und in den Bus, in die Straßenbahn oder in die Untergrundbahn einsteigen. Deshalb sollte ein Aktionsplan, basierend auf einem breiten sozialen Konsens mit einer geänderten Einstellung als entscheidendem Element, erstellt werden.“ 77 Das folgende Beispiel betrifft einen Sportklub: „Kommen oft Menschen mit Behinderung als Kunden in ihr Geschäft? Nein, fast nie. Hin und wieder kommen einige Rollstuhlfahrer. Ergreifen Sie irgendwelche Maßnahmen, um ihr Geschäft für Menschen mit Behinderung attraktiver zu gestalten? Nein, weil ich der Meinung bin, dass es sich für diese kleine Gruppe nicht auszahlt.“ Ein weitere Bemerkung bestätigt diese Begründungen insofern, als adaptierte Toiletten und Räume zwar existieren, aber meistens zweckentfremdend eingesetzt werden. „Obwohl viele Restaurants und Geschäfte behindertengerechte Toiletten oder Umkleidekabinen haben, werden sie meistens als Lagerräume benutzt. Das heißt, auf dem Papier gibt es spezielle Adaptierungen für Menschen mit Behinderung, aber die Praxis schaut ganz anders aus.“ Restaurants und Gasthäuser Vom Standpunkt der von uns befragten Menschen mit Behinderung ist ein Restaurantbesuch problematisch, nicht nur wegen der physischen Zugänglichkeit, sondern auch wegen vielerlei psychologischer Barrieren. „Ein Restaurantbesuch ist eine Katastrophe: Der Zugang ist normalerweise möglich, aber will man an einen Tisch gelangen, gibt es einen Wirbel, weil die Menschen aufstehen und Tische und Sessel zur Seite gerückt werden müssen. ... In manchen Lokalen ist es besser, aber es ist sehr schwer, eine behindertengerechte Toilette zu finden.“ „Wir gingen ins Lokal und waren erst einmal erschrocken, weil sich offenbar die anderen vor uns gefürchtet haben. Wir hatten jeden Grund zu dieser Annahme, (das heißt, dass sich andere Kunden ängstigten) weil sie uns so anstarrten. ...“ (Person mit einer körperlichen Behinderung) 78 Der unten zitierte Lokalbesitzer zieht die Kosten - Nutzenrechnung ins Kalkül und kommt zu dem Schluss, dass sich Adaptierungen für sein Lokal nicht rechnen. ... Hier der Bericht: „Er (der Lokalbesitzer) hat keine besonderen Maßnahmen für eine bessere Zugänglichkeit seines Lokals zum Beispiel für Rollstuhlfahrer ergriffen, weil sie noch immer eine kleine Gruppe von Gästen sind und er dann das ganze Lokal neu gestalten müsste, was ziemlich ins Geld gehen würde.“ Das befragte Fast Food Restaurant hält es nicht für seine Aufgabe, die Zugänglichkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus fühlt sich der Geschäftsführer im Umgang mit behinderten Kunden nicht sehr wohl. Eine Bemerkung ist wie auch schon in den vorhergehenden Interviews mit den NachbarInnen gefallen: „Ergreifen Sie irgendwelche Maßnahmen, um Ihr Angebot für Menschen mit Behinderung zu verbessern? Nein, das ist nicht möglich. Ich würde nicht einmal wissen, was ich ändern müsste. Für einen Lift gibt es keinen Platz.“ „Würden Sie in Ihrem Unternehmen eine behinderte Person aufnehmen? Nein, weil ich den Umgang mit ihnen nicht gewohnt bin. Ich glaube, dass es für mich ziemlich schwer wäre, mit ihnen zusammen zu arbeiten. In unserem Geschäft muss man schnell arbeiten und rechnen. Daher wäre eine Anstellung für eine behinderte Person nicht möglich.“ In einem der Interviews mit einer Person im Rollstuhl fanden wir ein paar Bemerkungen Rollstuhlfahrer über weist die auf Zugänglichkeit von häufig öffentlichen vorkommende Einrichtungen. Probleme hin. Von Der den vorhergehenden Aussagen der Geschäftsinhaber können wir erkennen, dass sie sich der Probleme der Menschen im Rollstuhl nicht bewusst sind: „Im Kino muss ich oft im Zwischengang oder sogar vor der ersten Reihe sitzen, was nicht sehr angenehm ist.“ Sehr oft fehlen in Gebäuden behindertengerechte Toiletten. „Es gibt nur wenige Bars, Restaurants oder Kinos, die für Menschen mit Behinderung eine entsprechende Toilette zur Verfügung stellen können. 79 Abteilung der Verwaltungsbehörde Diese Darstellung zeigt auf, wie die Unzugänglichkeit zu diskriminierenden Praktiken hinsichtlich der Verfügbarkeit von Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung führen kann. „Im Durchschnitt kommen fünf behinderte Personen pro Woche in das Amt. Die Interaktion mit ihnen ist ziemlich problematisch. Zunächst einmal muss man sagen, dass das Gebäude für Rollstuhlfahrer nicht zugänglich ist. Es gibt für sie keinen speziellen Eingang und würden sie hereinkommen, müssten sie durch eine sehr schwere Tür fahren, um ins Büro zu gelangen. Eine Person in einem Rollstuhl kann die Tür nicht aufmachen. Wenn jemand in einem Rollstuhl das Amt besucht, muss die Person an einer Glocke läuten, um mit einem Beamten sprechen zu können. Danach geht der Beamte mit dem Akt des Betroffenen nach draußen und bespricht die Angelegenheit im Freien. Diese Situation hat naturgemäß einige Nachteile, wobei in diesem Fall die Privatsphäre vollkommen fehlte. Einmal hat es einen Fall gegeben, in dem es um Geld ging. Ein Bekannter dieser Person hat dieses Gespräch mit angehört, was zu einer ‘verzwickten Situation’ geführt hat. Weiters hat man an Regentagen nur unter dem überdachten Fahrradstand Schutz vor schlechtem Wetter. Abschließend ist anzumerken, dass seit der Übersiedlung der Abteilung in das Stadtzentrum die Glocke schon sehr oft Zielscheibe für Vandalenakte war. Noch dazu gibt es im ganzen Gebäude keine einzige behindertengerechte Toilette.“ Ähnlich dazu wurde einem blinden Mann mit seinem Blindenhund der Zutritt zu einem Restaurant verweigert. Ein Interviewer erzählte uns: „Mit Restaurants hat er so seine Probleme: Es kommt vor, dass sie ihn wegen seines Hundes nicht hinein lassen. Er regt sich normalerweise nicht auf, sondern dreht sich einfach um und geht weg und kommt niemals wieder.“ Image der Menschen mit Behinderung als Kunden Supermarkt: „Menschen mit Behinderung kommen einkaufen und so lange sie ‘nichts ruinieren’ hat der Filialleiter auch nichts dagegen. ... Einmal hat es einen Zwischenfall mit einer spastisch gelähmten Person im Rollstuhl gegeben. 80 Diese Person hatte eine spastischen Anfall erlitten und konnte den Rollstuhl nicht mehr unter Kontrolle halten. Es wurde nichts zerbrochen, aber ‘die anderen Kunden waren sehr schockiert’.“ Eine hiesige Kinobesitzerin äußerte ihre Meinung über mögliche adaptive Maßnahmen für ihre behinderten Kunden: „Sie behauptet, dass an die 10% aller Kunden Menschen mit Behinderung sind. Sie hat der Behinderteneinrichtung für Gruppenbesuche einen vergünstigten Tarif angeboten. Außerdem versteht sie nicht ganz, warum die Menschen mit Behinderung nur in kleineren Gruppen oder einzeln kommen sollten. Sie fügt hinzu, dass es normalerweise keine Probleme mit ihnen gibt. Weiters sagt sie, dass sie manchmal ‘ein wenig ungestüm sind, doch dass die Begleitpersonen die Situation immer gut im Griff haben.’ Sie hat das Gefühl, dass durch den behindertengerechten Zugang und die vergünstigten Eintrittskarten ihre Möglichkeiten zur Verbesserung ihres Angebotes für Menschen mit Behinderung ausgeschöpft sind. Die Anstellung von behinderten Menschen ist für sie kein Thema, weil sie ein Familienbetrieb sind und überhaupt kein Personal beschäftigen.“ Verblüffende Einzeiler: Was denken Sie über Menschen mit Behinderung als Kunden? Sie sind leicht zufrieden zu stellen, freundlich oder sagen überhaupt nichts. Nur ab und zu sind sie irgendwie ekelhaft. (Friseur) „Rollstuhlfahrer brauchen keinen Eintritt zahlen, weil sie keinen Sitzplatz benötigen.“ (Kino) Eine Person mit Behinderung anstellen In den vorhergehenden Schilderungen haben wir bereits erfahren, dass Unternehmen mit ihren behinderten MitarbeiterInnen gute Erfahrungen gemacht haben. 81 Für andere Firmen war dieses Konzept jedoch noch ziemlich unbekannt. Aus einigen Interviews ist ersichtlich, dass nicht alle ArbeitgeberInnen über die Möglichkeit, Menschen mit Behinderung einzustellen, informiert sind. Jüngste Direktiven über die Anstellung der Menschen mit Behinderung auf europäischer Ebene inkludieren die Europäische Direktive über Gleichbehandlung am Arbeitsplatz und im Beruf (2000)16 und die neue Europäische Beschäftigungsstrategie (2003)17, basierend auf den drei Säulen der Lissaboner Strategie: - Vollbeschäftigung - Qualität und Produktivität am Arbeitsplatz - Kohäsion und Inklusion auf dem Arbeitsmarkt Die folgenden Zitate sind Beispiele von Unternehmern, denen diese Möglichkeit nicht bekannt ist. „Würden Sie eine Person mit einer Behinderung in Ihrem Unternehmen anstellen? Ich weiß es nicht. Ist es rechtlich überhaupt möglich?“ „Ich habe noch nicht darüber nachgedacht.“ NEIN Einige meinen, dass eine Anstellung einer behinderten Person für sie nicht in Frage kommt. Begründet wird dies damit, dass entweder besondere Qualifikationen notwendig sind oder dass es praktische bauliche Barrieren am Arbeitsplatz gibt. Andere Befragte wiederum sagen, dass sie sich Sorgen machen, dass etwas passiert oder befürchten, dass die behinderte Person, die jetzt im Geschäft steht, einen Einfluss auf die Anzahl jener KlientInnen haben könnte, die derzeit die Einrichtung nützen. Die Verkäuferin im Molkereigeschäft vermutet, dass die Arbeit zu beschwerlich sein könnte. „Ich hätte Angst, dass etwas passiert.“ 16 Direktive 2000/78/EC Einsetzung eines allgemein gültigen Systems zur Gleichbehandlung am Arbeitsplatz und im Beruf. 17 http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2003/apr/newees_en.html 82 „Meiner Meinung nach ist es praktisch nicht möglich. In unserem Geschäft kann man nicht mit einem Rollstuhl hinter dem Ladentisch stehen.“ „Ich glaube, dass es sehr schwierig wäre, eine behinderte Person in unserer hoch in den Bergen gelegenen Molkerei anzustellen. Ich bezweifle, dass dieses Arbeitsumfeld für eine behinderte Person gut ist.“ Auch diese Führungskraft kann nicht zwischen einer Person mit einer Behinderung und jemanden mit guter Gesundheit entscheiden. Er vermutet, dass eine behinderte Person automatisch auch krank ist. Menschen mit Behinderung mögen ja anfälliger für bestimmte Krankheiten sein, aber dies ist noch lange kein Grund, dies als gegeben anzunehmen. „Nein, die Arbeit in diesem Geschäft ist sehr hart und man muss dafür gesund und robust sein.“ Einige Leute haben den Eindruck, dass ein behinderter Mitarbeiter für den Betrieb und das übrige Personal eine Mehrbelastung sein könnte. Sie finden, dass ein behinderter Kollege kein guter Mitarbeiter sein kann, der seine Aufgaben ohne Unterstützung erfüllt. „Nein, für so etwas habe ich keine Zeit. Ich brauche jemand, der mich voll und ganz unterstützt.“ „Vielleicht, aber nicht, wenn wir viel zu tun haben, denn dann sind wir selbst voll ausgelastet.“ Die Mehrheit der befragten Personen gab an, dass die Fähigkeiten einer Person der entscheidende Faktor für eine Anstellung sei. Eine Inhaber eines Bioladens meint dazu: „Wenn diese Person die Anforderungen erfüllt, würde ich sie einstellen.“ Es wird natürlich unter den verschiedenen Arten von Behinderung unterschieden. In den zwei folgenden Beispielen werden den Personen mit einer körperlichen Behinderung eher die Fähigkeit zugesprochen, in ihrem jeweiligen Unternehmen ihren Mann stellen zu können. 83 „Eine körperlich behinderte Person könnte, wenn sie sich bewirbt und die Anforderungen erfüllt, schon geeignet sein.“ (Friseur) „Vielleicht eine körperlich behinderte Person im Büro. Für einen geistig behinderten Menschen wäre es zu anstrengend.“ (Leiter eines Möbelgeschäftes) Einige Leute sind der Ansicht, dass eine Person mit Behinderung für eine Bürostelle geeignet wäre. Sie sprechen aus Erfahrung, weil sie entweder bereits mit einer behinderten Person zusammengearbeitet haben oder ganz genau wissen, welche Art von Arbeit Menschen mit geistiger Behinderung verrichten können. Es gibt durchaus Jobs, bei denen es weder Hürden für den Rollstuhl noch andere physische/bauliche Barrieren gibt. Einzelne waren willens, dafür Veränderungen in Kauf zu nehmen. „Es ist möglich, wenn wir es nur wollen.“ „Ja, ich wäre dafür. Es ist egal, ob jemand behindert ist oder nicht. Die Arbeit muss ordentlich gemacht werden.“ Ein Gewinn für die Gemeinschaft Dies ist das Interview mit einem Schulwart, in dessen Team ein Mann mit Lernschwierigkeiten als Teilzeit-Volontär beschäftigt ist. Er ist bereits der Zweite, weil der Erste nun einer Vollzeitbeschäftigung nachgeht. „Er glaubt, dass er vom Personal generell als ‘einer von ihnen’ betrachtet wird, aber bei den Studenten muss man ein bisschen mehr aufpassen. Er nimmt am Geschehen in der Schule Teil, spielt auch in einem Theaterstück mit, aber man muss Acht geben, dass er nicht ausgenutzt wird. Er verrichtet vor allem Hilfsarbeiten, aber auch diese müssen getan werden und ihm machen diese Arbeiten offenbar Freude. Er kann auch die Maschinen benutzen und ist für die Leerung der Abfalleimer verantwortlich. Er hat freien Zugang zu allen verfügbaren Einrichtungen und zur Werkstatt. Niemand scheint ihm irgendwelche Schwierigkeiten zu machen und das beflügelt ihn. Mit den Studenten gibt es hin und wieder Probleme. Wenn Schwierigkeiten auftauchen, hat man ihm geraten, sich einfach umzudrehen 84 und zu gehen. So kommt er offenbar ganz gut zurecht, sollte wirklich einmal etwas Ernsthaftes passieren, kann er sich Rat und Hilfe holen. Es ist gut, ihn im Team zu haben, obwohl er Unterstützung braucht und einer Mehrbelastung nicht standhalten könnte. Wichtig ist aber die richtige Person, jemand mit Selbstvertrauen. Gelegentlich müssen wir ihn etwas einbremsen. Hätte ich ein eigenes Geschäft, würde ich jemand wie ihn anstellen, obwohl seine Zeiteinteilung besser sein könnte, aber ich hetze ihn nicht zu viel, weil er ja auch kein Geld bekommt. Er könnte sehr leicht ausgebeutet werden und er muss richtig eingesetzt werden. Alles in allem ist er ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft – wenn er in die richtigen Hände kommt.“ Ein Kulturzentrum hat Erfahrung mit Volontären als Aushilfskräfte. Die Mitarbeiter haben gute Erfahrungen mit behinderten Menschen gemacht, weisen aber darauf hin, dass sie bei der Arbeit mehr Unterstützung brauchen „Die Formel: Zwei KlientInnen arbeiten im Kulturzentrum sehr gut zusammen, vorausgesetzt, sie werden streng kontrolliert. Dafür braucht man zusätzliches Personal oder finanzielle Unterstützung.“ Dieser Manager wurde nie gefragt, ob er eine Person mit Behinderung einstellen würde. „Niemand hat mich je gefragt, aber warum eigentlich nicht?“ Einigen Schilderungen zufolge könnten behinderte Menschen in vielen Betrieben arbeiten, wie zum Beispiel in einem Gasthaus: „Bei uns arbeiten zwei Damen mit Behinderung. Sie machen ihre Arbeit sehr gut.“ (Gasthaus) Die Bank hat sogar eine gehörlose Frau aufgenommen. „Sie liest von den Lippen und eine Tafel neben ihrem Schalter ersucht die Kunden, sich beim Sprechen nicht abzuwenden und langsam zu sprechen.“ Verblüffende Einzeiler: Auf die Frage, ob sie eine Person mit einer Behinderung aufnehmen würden: Nein, sie haben ja ihre Werkstätte, in der sie viel besser aufgehoben sind. 85 Nein, so eine Person könnte die Kunden erschrecken. Schlussfolgerungen - Standpunkt der NachbarInnen Die Reaktionen aus den Interviews mit den NachbarInnen lassen erkennen, dass sie nur wenig über Menschen mit Behinderung, deren Lebensumstände und Fähigkeiten wissen. Diese Ignoranz könnte zum Teil für bestimmte Ängste im Umgang mit behinderten Menschen verantwortlich sein. Die fehlende Information über die Eröffnung einer Gemeindeintegrierten Einrichtung für Menschen mit Behinderung verstärkte in etlichen Fällen dieses Gefühl und führte, was dieses Wohnprojekt betrifft, zu starkem Widerstand in der Bevölkerung. Die häufigsten Einwände lauteten: Die Menschen fürchten um die Sicherheit ihrer Kinder, weil einige glauben, dass alle Menschen mit Behinderung Sexualstraftäter sind; Sie sind um ihre sichere Umgebung besorgt. Sie fürchten sich vor Einbrüchen und Diebstählen, weil sie der Meinung sind, dass die neuen NachbarInnen aus dem Gefängnis entlassene Kriminelle sind; Sie haben Angst, dass die behinderten Menschen viel Lärm machen, weil sie gehört haben, dass alle Menschen mit Behinderung ständig schreien und brüllen; Sie befürchten einen Wertverlust ihres Besitzes, weil sie in der Nähe eines Irrenhauses mit gefährlichen Narren wohnen. Anfängliche Einwände bezüglich der Behinderteneinrichtung und die Befangenheit in der Gegenwart eines behinderten Nachbars scheinen sich nach einer gewissen Zeit zu legen, aber einige Vorurteile bleiben doch bestehen. Viele Befragte haben noch immer ein stark vereinfachtes Bild von Menschen mit Behinderung und sehen sie als eine homogene Gruppe. Wie wir bereits in den Interviews mit den Menschen mit Behinderung selbst beobachtet haben, gibt es zwischen den einzelnen NachbarInnen keine echten nachbarschaftlichen Kontakte. Nachdem sie sich flüchtig kennen gelernt haben, verschwindet die Angst und die Einstellung ändert sich, aber, aus den Erkenntnissen 86 der Interviews haben wir gelernt, dass es keine wirkliche Interaktion zwischen den NachbarInnen gibt. Diese Interaktion könnte aber ein wichtiges Instrument sein, um das öffentliche Image der Menschen mit Behinderung zu korrigieren. Heutzutage werden sie noch immer als kleine Kinder oder als tapfere und mutige Menschen gesehen. Trotz der ersten ängstlichen Reaktionen haben letztlich die Wenigsten über wirkliche Probleme berichtet. Es gibt kleinere Reibereien, die in jeder Nachbarschaft vorkommen können, wie zum Beispiel Lärmbelästigung oder Streitereien über Renovierungs- und Grundstücksfragen. In einigen Aussagen haben wir die Beobachtung gemacht, dass die Leute zwischen Art und Ausmaß der Behinderung unterscheiden. Was Beschäftigung und Ausbildung betrifft (als Voraussetzung wirklicher Inklusion), neigen die Menschen zu dem Glauben, dass dies nur für Personen mit einer körperlichen oder leichten geistigen Behinderung möglich ist. Aus den Berichten der Betriebe und ihrer Sicht der Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung ist erwähnenswert, dass viele Arbeitgeber trotz günstiger Rechtslage (auf europäischer und nationaler Ebene) über die Möglichkeiten einer Anstellung einer behinderten Person nicht Bescheid wissen. Die Behörden sollten die Betriebe darüber besser informieren und diese Zielgruppe bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt unterstützen. Aus unseren Berichten geht auch hervor, dass die meisten Veränderungen durch die Beseitigung von baulichen Barrieren vonstatten gingen. Darüber hinaus wurden viele adaptive Maßnahmen in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen, vor allem für RollstuhlfahrerInnen, durchgeführt. Dieses Projekt lässt erkennen, dass es noch großen Spielraum für Kontakte zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen gibt, die unserer Meinung nach zur Bildung einer inklusiven Gesellschaft beitragen. 87 SECTION III: Der Mensch mit Behinderung Einleitung In den vorhergehenden Abschnitten skizzierten wir die benachbarte Umgebung mit den Reaktionen der NachbarInnen und der Betriebe und deren Organisation. In diesem Abschnitt legen wir unser Hauptaugenmerk auf die Erfahrungen der Menschen mit Behinderung, die in der örtlichen Gemeinschaft leben. Wir wollten durch die Befragung der Menschen mit Behinderung herausfinden, welche Art der Beziehung sie mit anderen Menschen in der Nachbarschaft haben. Weiters wollten wir wissen, ob sie sich als Teil der Nachbarschaft fühlten und ob es für sie Möglichkeiten zur Teilhabe gibt. Wir befragten sie über ihre Lebensumstände, wo und mit wem sie lebten und welchen Einfluss die ortsansässige Bevölkerung auf Ihr Leben hatte. Der Auszug „Die Nonnen sagten zu mir, dass ich ausgewählt wurde, um in der Gemeinde zu leben. Sie brachten mich in dieses Haus.“ Im vorhergehenden Abschnitt sprachen wir Faktor über die Annahme, dass ein Leben in der Gemeinschaft der entscheidendste dafür ist, den Menschen mit Behinderung die Teilhabe am öffentlichen Leben zu ermöglichen18. Wir haben gesehen, dass die Entscheidung, in einer bestimmten Umgebung zu leben, eine Änderung der Unterstützungsmethoden erforderlich macht. Ein Schlüsselaspekt in der Unterstützung der Menschen mit Behinderung, um in der Bevölkerung ein Leben wie andere auch führen zu können und somit eine verbesserte Lebensqualität zu erzielen, ist das Ausmaß der Unterstützung, die ihnen zuteil wird, um Entscheidungen für sich selbst treffen zu können – dieser Betreuungsansatz 18 MC VILLY & RAWLINSON (1998) in: PRETTY, G., RAPLEY, M. & BRAMSTON, P. (2002). Erfahrungen der Nachbarschaft und der Bevölkerung und die Lebensqualität von heranwachsenden Jugendlichen auf dem Land mit und ohne geistige Behinderung. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 24 (2), pp. 106 - 116 88 heißt Empowerment. Die Entscheidung, in eine gemeindeintegrierte Wohnung zu ziehen, muss Teil eines individuellen Unterstützungsplanes sein. Die betroffenen Personen müssen über die verschiedenen Wohnformen informiert werden und in der Lage sein, eine sachkundige Auswahl zu treffen. Können die meisten Menschen mit Behinderung selbst entscheiden, wo und mit wem sie gerne leben möchten? Offensichtlich nicht. Schaut man sich die verschiedenen Antworten an, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Entscheidungen von sozialen Dienstleistern und politischen EntscheidungsträgerInnen im Namen der Menschen mit Behinderung getroffen wurden. Diese Entscheidungen wurden in der Annahme getroffen, die Lebensqualität der Menschen mit Behinderung zu verbessern. Die folgenden Ausführungen illustrieren die Tatsache, dass einige von uns befragte Menschen mit Behinderung ziemliche eingeschränkte Entscheidungsmöglichkeiten hatten. Dies wird durch die Äußerungen reflektiert, dass sie über die Übersiedlung sehr glücklich waren, aber dennoch lieber selbst darüber entschieden hätten, mit wem sie in Zukunft zusammenleben möchten. Dieser Punkt kommt auch in einer Aussage in den Schlussfolgerungen in Abschnitt I vor und besagt, dass für Menschen mit Behinderung noch immer Wohn- und Lebensarrangements mit anderen behinderten Personen geplant werden. „Es war nicht seine Entscheidung, in diesem Haus zu wohnen und schon gar nicht mit diesen Leuten.“ „Ja, es war nicht meine Entscheidung, hier zu wohnen, auch die Wohnung und die NachbarInnen habe ich mir nicht selbst ausgesucht. Die Wohnung ist sehr klein und es gibt wenig Platz.“ Gleichermaßen werden Menschen mit Behinderung hin und wieder durch gewisse Bestimmungen und Verordnungen davon abgehalten, in kleiner dimensionierte Wohneinrichtungen zu ziehen. „Er war über den Auszug glücklich, aber er durfte seinen Hund nicht mitnehmen.“ 89 Negative Wahlmöglichkeiten Natürlich gibt es zu wenig Auswahlmöglichkeiten für die Menschen mit Behinderung. Sie sind zwar alle sehr gerne ausgezogen, aber es hat immer etwas gegeben, was nicht möglich oder nicht verfügbar zu sein schien. Wartelisten oder Platzmangel in verschiedenen Projekten oder Einrichtungen waren ausschlaggebend für die Menschen mit Behinderung, dass sie sich nicht selbst für die Wohnstätte ihrer Wahl entscheiden konnten. Sie müssen in bestimmten Gebieten leben und gewissen Bestimmungen Folge leisten. „Die erste Option war bei seiner Mutter zu wohnen, aber das hieß, abhängig zu sein und die zweite Option bestand darin, in ein Pflegeheim zu ziehen, was eine noch größere Abhängigkeit bedeutete. Im Grunde genommen gab es keine oder nur eine Möglichkeit. „Sie wollte nicht in dieser bestimmten Einrichtung wohnen, aber es gab nur diese eine in der Umgebung jenes Heimes, in dem sie früher lebte. Es war die einzige Einrichtung in ihrer gewohnten Umgebung.“ Die oben angeführten Zitate sind Beispiele einer negativen Auswahlmöglichkeit, einer Auswahl, weil es keine besseren Optionen gibt. Sowohl soziale Dienstleistungseinrichtungen als auch öffentliche Entscheidungsträger sollten sich darüber Gedanken machen, was Auswahlmöglichkeit für den einzelnen betroffenen Menschen mit Behinderung bedeutet. Eltern, betreuendes Personal und sogar lokale Politiker scheinen auf die Entscheidungskompetenz der Menschen mit Behinderung einen großen Einfluss auszuüben. Dazu gehören Informationen, Empfehlungen, Beratungen oder einfach die Kunst, jemanden zu überzeugen, an einem bestimmten Ort zu wohnen. Die KlientInnen, Kinder und PatientInnen bezeugen: „Das Rehabilitationsteam empfahl mir, hier zu wohnen“. „Die Politiker entschieden, dass ich hier wohnen sollte“. 90 Im Idealfall sollte eine gemeinsame Entscheidung getroffen werden, wie es offensichtlich in der folgenden Aussage zum Ausdruck kommt. „Es war eine gemeinsame Entscheidung zwischen mir und meinen Eltern.“ Es sollte nicht nur eine gemeinsame Entscheidung zwischen dem Klienten und den Eltern sein, sondern auch ein Zusammenspiel der verschiedenen Interessensgruppen, um zu einer angemessenen Lösung zu kommen. „Es war ihre Entscheidung, gemeinsam mit ihrem Freund in die Wohnung zu ziehen. Sie hatte eine Beziehung zu ihrem Freund aufgebaut, der zu dieser Zeit zu Hause bei seiner Mutter lebte. Sie äußerten den Wunsch, zusammenzuziehen und der Betreuer und die lokalen Sozialeinrichtungen nahmen Verbindung auf, um eine Wohnung für die beiden zu finden.“ „Es war meine Entscheidung, hierher zu ziehen. Ich bin sehr gern aus der Wohngemeinschaft ausgezogen. In meinem früheren Wohnheim gab es eine Krankenschwester, die mir beim Umzug half. Auch mein Sachwalter hat mir die Erlaubnis gegeben und somit war alles geregelt.“ „Man hat uns diese Möglichkeit angeboten. Wir haben davon gehört, dass die Residenz eine neue Wohnmöglichkeit für Menschen mit Körperbehinderung in der Gemeinde schafft und als sich der Direktor an uns wandte und uns fragte, ob wir umziehen möchten, antworteten wir natürlich mit „Ja“. Zuerst erkundigten wir uns über die finanziellen Bedingungen, aber als wir hörten, dass die Kosten niedriger waren als in unserem früheren Heim, entschlossen wir uns zu diesem Schritt.“ Die Mitarbeiter sind sich bewusst, dass die Entscheidungskompetenz nicht immer bei der behinderten Person selbst liegt. „Ich glaube, dass es nicht die Entscheidung unserer BewohnerInnen war, hierher zu ziehen, sondern in erster Linie die von den Eltern, SachwalterInnen und Familienmitgliedern. Natürlich wurden unsere BewohnerInnen zuerst gefragt, ob sie hier wohnen möchten.“ 91 Neben der Möglichkeit, sich mit anderen Personen über die gewünschte Wohnmöglichkeit zu beraten, gibt es bei der Wohnwahl auch noch andere Barrieren für Menschen mit Behinderung. In einigen Fällen sind es die gleichen Hindernisse, auf die auch nicht behinderte Menschen stoßen. Die Wohnwahl kann zum Beispiel durch finanzielle Einschränkungen oder administrative Hürden begrenzt werden: „Das ist die günstigste Wohnmöglichkeit.“ „Ich rief den Direktor der Wohneinrichtung und fragte ihn, wie ich zu einer Wohnung kommen könnte. Er riet mir, einen Lebenslauf und eine Absichtserklärung zu schicken, danach würde sich der Vorstand über meine Bewerbung beraten und mir mitteilen, ob sich mich haben wollen in dieser Einrichtung, in dieser Gemeinde, sozusagen als ‘Teil einer großen Familie’.“ Der Mangel an zugänglichen Wohnmöglichkeiten bedeutet, dass Menschen mit Behinderung in jenen Gebäuden und Infrastrukturen leben müssen, die für sie zur Verfügung stehen. Physische Barrieren beeinflussen natürlich auch ihre Wohnwahl: „Ich habe mich für dieses Haus entschieden, aber ich hatte nicht die große Auswahl. Wir mussten ein neues Haus bauen, das ganz meinen Bedürfnissen angepasst wurde.“ „Das Haus, in dem wir nun wohnen, war sozusagen eine Notlösung. Um eine Familie gründen zu können, brauchten wir eine Unterkunft, die größer als meine Wohnung war. Also begannen wir nach einem leicht zugänglichen Haus zu suchen und dieses Haus war das einzige, das wir nach sechsmonatiger Suche gefunden haben.“ Verschiedene Vorkommnisse in den Familien dürften auch einen Einfluss auf den Wohnsitz der Menschen mit Behinderung haben. Viele Menschen mit Behinderung verwiesen auf Krankheit oder Tod der Eltern, was ihre Entscheidung, in Zukunft woanders zu leben, beeinflusste. Dies wiederum zeigt, wie sehr sie von anderen Personen abhängig sind, um ihr Leben und ihre Zukunft aufzubauen. „Er wollte unabhängiger leben von den Personen, die ihn betreuten und entschloss sich, auszuziehen. Er wollte nicht mehr in diesem Haus leben, aber 92 als sein Vater starb, musste er rasch einen anderen Platz zum Wohnen finden. Da die Warteliste für das Haus in der Stadt, in die er ziehen wollte, zu lang war, beschloss er, sich diesem Projekt anzuschließen.“ „Ich werde in eine andere Wohnung ziehen müssen, wenn meine Eltern zu alt sind, um für mich Sorge zu tragen.“ Einige ziehen von einer Einrichtung in die andere, weil sie bestimmte unterstützende Maßnahmen benötigen, die an ihrem vorherigen Wohnsitz nicht angeboten wurden: „Er hat mentale Probleme, wodurch er mehr Hilfe benötigt, als er in dem Heim bekommen konnte.“ „Es wurde ihm geraten, auszuziehen, da er eine Essstörung hatte und beinahe 159 kg wog, was ernsthafte gesundheitliche Probleme mit sich brachte.“ In den folgenden Ausführungen wird ersichtlich, dass Menschen mit Behinderung sehr geringe Erwartungen an ihr Lebensumfeld haben. Sie sind erfreut über die ihnen angebotenen Möglichkeiten, selbst wenn diese nicht ganz ihren Wünschen oder Erwartungen entsprechen. Wissenschaftliche Forschungsergebnisse haben schon oft gezeigt, dass Menschen mit Behinderung in Bezug auf ihre Lebenssituation19 eine niedrige Erwartungshaltung und eine positive Einschätzung an den Tag legen. Die behinderten BewohnerInnen waren bezeichnenderweise mit den ihnen zur Verfügung stehenden Wahlmöglichkeiten wesentlich zufriedener, als die Ergebnisse von objektiven Messungen jemals hätten darauf schließen lassen. Es sieht so aus, als ob es der menschlichen Natur entspricht, das eigene Wohlergehen positiver darzustellen als es von anderen Menschen wahrgenommen wird. Im Folgenden finden Sie erstaunliche Beispiele, wie sehr die Menschen mit Behinderung mit den ihnen gemachten Angeboten zufrieden zu sein scheinen. 19 PERRY, J. & FELCE, D. (2003). Untersuchung der Lebensqualität von Menschen mit geistiger Behinderung, die in unterstützten Wohnprojekten leben: Eine geschichtete Stichprobe aus rechtlichen, unabhängigen und privaten Quellen. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 16, 11-28, p. 27 93 „Das Personal und die KlientInnen sind die einzigen, die mit ihm reden, aber er ist ganz glücklich damit.“ (Diese Aussage stammt von einer Person mit geistiger Behinderung, die in einer Wohngemeinschaft lebt). „Die Wohnung habe nicht ich ausgewählt. Ich erhielt sie von der Gemeinde. Ich kann mich sehr glücklich schätzen.“ Das könnte vielleicht eine Erklärung dafür sein, dass nur sehr wenige Menschen mit Behinderung angeben, Zukunftspläne oder Hoffnungen hinsichtlich einer Übersiedlung zu haben, um unabhängig zu werden oder eine Familie zu gründen. Es sieht so aus, als ob sie keine Ambitionen hätten, ihren Wohnort zu verlassen oder diese Hoffnung bereits begraben haben. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel „Soziales Netzwerk und Freunde“. „Damals war sie sehr froh, hierher ziehen zu können, aber sie würde gerne mit ihrem Freund in einem Bungalow wohnen.“ „Er hat nichts gegen seine NachbarInnen oder gegen das Haus, aber er würde gerne alleine wohnen.“ „Diese Frau möchte gerne mit ihrem Freund in einen Bungalow ziehen und trotzdem auf eine 24-Stunden-Betreuung zurückgreifen können. Sie hofft, dass die zuständige Organisation ihr diese Betreuung bereitstellen kann.“ Evaluierung des Konzeptes für Wohngemeinschaften oder gemeindeintegrierte Wohnformen Ob die Menschen mit Behinderung, die in einer gemeindeintegrierten Wohnung leben, glücklich oder eher unglücklich sind, hängt oft von dem Grad ihrer Entscheidungs- und Wahlmöglichkeiten ab. Mehr Freiheit und Entscheidungsmöglichkeiten sind nach den Aussagen der Befragten die positivsten Faktoren. Nachteilig wirkt sich bei einigen gemeindeintegrierten Wohnstätten für Menschen mit Behinderung nach wie vor der Umstand aus, dass viele Entscheidungen nicht von den Menschen selbst getroffen werden können. 94 „Ich wollte nicht in eines dieser betreuten Wohnprojekte einsteigen, die es in einigen Städten gibt, weil sie nicht auf Familien ausgerichtet sind. Man wird gezwungen, mit vielen anderen Personen mit Behinderung zusammen zu wohnen und man hat keine Möglichkeit, den Wohnort selbst zu bestimmen. Ich fürchte mich vor einer Ghettobildung.“ Betreutes Wohnen, wo der Einzelne eine eigene Wohnung hat, scheint den Wünschen der Menschen mit Behinderung hinsichtlich einer höheren Unabhängigkeit oder Interdependenz weit mehr entgegenzukommen. „Ich wollte die Wohnung nicht länger teilen und suchte mir daher ein richtiges Appartement. Nun bin ich mein eigener Herr und brauche nicht mehr an der wöchentlichen Supervision teilnehmen.“ Weitere wesentliche Punkte, die Menschen mit Behinderung in gemeindeintegrierten Wohnstätten anführten, waren Unstimmigkeiten mit MitbewohnerInnen. Viele Befragten erwähnten, wie schwierig es ist, in einer Gruppe zu leben. Ein Bewohner einer Gemeinschaftswohnung erzählt dem Interviewer: „Manchmal gibt es Streit in der Gruppe und das ist schlecht. Es gibt einen, der schimpft und schreit und isst alles, auch Zigaretten. Dann geht ein Betreuer zu ihm hin und beruhigt ihn.“ Als negative Aspekte im Zusammenleben mit anderen Menschen mit Behinderung werden Ärger mit den Gewohnheiten anderer und Störungen, nicht nur durch MitbewohnerInnen, sondern auch durch das Personal, genannt. Im Gegensatz dazu leben andere wiederum gerne in einer Gruppe und genießen diese Atmosphäre, wie es eine in einer Wohngemeinschaft lebende Person mit einer geistigen Behinderung, ausdrückt: „Ja, es ist toll, weil du mit so einer großen Gruppe viel unternehmen kannst. Aber das Zusammenleben ist nicht immer leicht. Zum Beispiel wenn es Probleme oder Streitigkeiten gibt.“ Ein weiterer Punkt ist die Privatsphäre, die in einem Wohnhaus, in dem man die Küche und andere Räumlichkeiten teilen muss, einfach zu kurz kommt. 95 „In diesem Haus muss sie diese Räume mit anderen teilen und sie hat eigentlich das Gefühl, dass sie auf diese Weise einen Teil ihrer Unabhängigkeit verloren hat. Sie würde lieber alleine leben. Irgendwo in der Nähe, wo sie dieselbe Unterstützung wie hier hat, aber wo sie die Unterkunft nicht mit anderen teilen muss. ... Einer der Wohnungsinsassen ist Autist und der erledigt nicht immer seinen Teil der Hausarbeit und sie ärgert sich, dass das Haus nicht immer sauber ist, wenn er zum Putzen dran ist.“ Zusammenfassung: WIE WIRD Andere wiederum betonen in DAS KONZEPT EINER den folgenden GEMEINDEINTEGRIERTEN WOHNUNG VON Interviewauszügen, dass sich DEN BEWOHNERINNENN SELSBT ihr Privatleben durch den BEURTEILT? Umzug Positive Beurteilung: gemeindeintegrierte in eine Wohnung - Sie haben mehr Auswahlmöglichkeiten; - Sie haben eine größere Unabhängigkeit - Sie haben mehr Privatsphäre, zum Beispiel ihr Verbesserung eigenes Zimmer; Lebensqualität im Vergleich zu - Sie haben mehr Entscheidungskompetenz; größeren - Sie erhalten mehr persönliche Unterstützung, die ihnen eine eigenständigere verbessert hat, weil dies eine Planung ihrer Tagesaktivitäten und Hobbies erlaubt; - ihrer Wohnkomplexen darstellt. Sie haben mehr Freiheit, um das zu tun, was sie Wenn die Einrichtung gut in der Gemeinde gerne tun möchten. integriert ist, ist es weniger stigmatisierend. „... Wir entscheiden selbst, was wir kochen. ... Ich habe mein Negative Bewertung: - eigenes In eine Lebenssituation mit anderen Menschen mit Behinderung ohne eigenes Zutun gedrängt zu Zimmer und einen eigenen Fernseher.“ (Person werden; mit einer geistigen - Streitigkeiten mit MitbewohnerInnen; Behinderung, - In einem Gemeinschaftskonzept müssen gewisse Wohngemeinschaft wohnt) die in einer Einrichtungen geteilt werden, wie zum Beispiel Küche und Wohnzimmer, was den Verlust an Privatsphäre nach sich zieht; - Ärger mit anderen KlientInnen oder dem Keine langfristigen Hier kann ich Leute einladen und ich kann einkaufen gehen.“ betreuenden Personal; - „Ich mag die Unabhängigkeit. Perspektiven bezüglich (Person mit einer zukünftiger Wohnungspläne; 96 Körperbehinderung, die alleine wohnt) „Hier kann sie ganz ungestört leben, kann alles dann tun, wann sie es will und kann ausgehen, wann immer und mit wem sie es möchte. ... Sie wohnt sehr gerne hier, insbesondere weil sie hier ihre Privatsphäre und Unabhängigkeit hat.“ (Person mit einer geistigen Behinderung, die alleine lebt) Manchmal haben gemeindeintegrierte Wohnungen, die wir besucht haben, eine günstige Lage. Die Menschen mit Behinderung haben mehr Möglichkeiten, selbständig etwas zu unternehmen, da die Wohnungen oft sehr zentrumsnahe oder im Stadtzentrum selbst liegen. Eine Person mit einer Körperbehinderung meinte: „Ich mag die ruhige Wohnumgebung, aber auch die Nähe zur Stadt, denn dadurch haben wir viele Einkaufsmöglichkeiten.“ Empowerment Mit dieser Unabhängigkeit und Freiheit öffnet sich für die Menschen mit Behinderung eine ganz neue Welt. Sie entdecken neue Möglichkeiten und sehen sich Herausforderungen gegenüber, aus denen sie viel lernen können. Einige berichten von einem neuen Selbstbewusstsein, das ihnen vorher oft fehlte. Ein Interviewer hielt die folgende Geschichte eines Mannes mit Körperbehinderung, der mit seiner Frau ein Haus bewohnt, fest. „Er beschreibt es als ‘einen wahr gewordenen Traum’. Früher wohnte er in einem Pflegeheim, hatte aber dort nicht den Freiraum, den er jetzt genießen kann. Nun hat er jederzeit rund-um-die-Uhr die nötige Unterstützung und ist nicht mehr auf das strenge und einengende System im Pflegeheim angewiesen. Jetzt kann er dreimal am Tag duschen oder ins Bett gehen, wann immer er will. Er kann nun selbst entscheiden, wann und was er essen und wann er aufstehen oder schlafen gehen möchte. Sein Umzug hat ihn – wie er es ausgedrückt hat –‘einfach befreit’. ... Er sagte auch, dass es eine Wohltat sei, die jetzige Wohnadresse nennen zu können, weil ihr nicht mehr das Stigma eines Pflegeheimes anhaftet. Er fühlt sich ernster genommen, wenn er sagen 97 kann, dass er unabhängig ist. Er hat auch gemerkt, dass seinen Freunden sein geändertes Selbstbewusstsein aufgefallen ist.“ Nicht nur die Wohnlage, aber auch die Art und Weise, wie das betreuende Personal und andere Experten mit ihnen umgehen, hat einen Einfluss auf die Möglichkeiten und Chancen der Menschen mit Behinderung, ein erfülltes Leben zu leben und durch eine personenbezogenere Unterstützung und mehr Autonomie am öffentlichen Leben teilzunehmen. Die Unterstützung wird nun in einem weit höherem Ausmaß ihren persönlichen Wünschen und Bedürfnissen angepasst. Der Interviewer, der einen Mann mit einer geistigen Behinderung und einer körperlichen Beeinträchtigung befragt hatte, kam mit der folgenden Geschichte zurück: „... das Wichtigste ist, dass die AssistentInnen keine Krankenschwestern sind. Sie haben in keiner Beziehung irgendeine Kontrolle über sein Leben oder die Art und Weise, wie er sein Leben gestalten will. Das ist die wahre Integration, meint er. Innerhalb des Gebäudes sind die fünfzehn Wohnungen auf verschiedenen Stockwerken aufgeteilt. Somit gibt es kein ‘Stockwerk für die Menschen mit Behinderung’. Sie wohnen zusammen mit den anderen Menschen ohne Behinderung und es gibt keine Unterschiede.“ Hier ein weiterer Beweis für die Türen, die sich durch einen personalisierten Betreuungsansatz geöffnet haben: „Durch den Umzug ist ihr Leben flexibler geworden und besser an ihre persönlichen Bedürfnisse und Hobbies angepasst worden. Durch dieses Wohnprojekt kann sie nun dem Verband der Rollstuhlfahrer beitreten, einen Lese- und Schreibkurs besuchen und an allgemeinen Aktivitäten teilnehmen.“ Es ist aber noch immer offensichtlich, das sich häufig weder Menschen mit Behinderung noch ihre MitbewohnerInnen ihren Wohnsitz selbst aussuchen können. ... Sie sind von ihrer Umgebung oder anderen externen Faktoren hinsichtlich ihrer Wünsche oder Sehnsüchte abhängig und für manche ist das ein beängstigendes Gefühl. 98 „Hin und wieder macht er sich Sorgen, dass er noch lange hier bleiben muss. Er meinte, dass das Beste an diesem Wohnort die Hoffnung auf einen Umzug sei und das Schlechteste, die Aussicht, für immer hier bleiben zu müssen.“ Alltägliche Aktivitäten In den Interviews scheinen auch einige Fragen über allgemeine Aktivitäten der Menschen mit Behinderung auf. Gehen sie zur Arbeit und wenn nicht, gehen sie anderen Betätigungen nach? Beschäftigung in einem Arbeitsverhältnis Dies ist Teil einer Abschrift eines Interviews mit einem körperbehinderten Mann, der im Rollstuhl sitzt. Er lebt allein und arbeitet im Schwimmbad des Wohnhauses. Er erklärt, wie wichtig diese Arbeit für ihn ist und was sie für sein Leben und seine sozialen Kontakte bedeutet. Peter´s Arbeit Ich arbeite am Eingang des Schwimmbades. ... Ursprünglich wurde das Schwimmbad für therapeutische Zwecke für die BewohnerInnen dieser Wohnanlage gebaut. Aber dann entschied sich das Management, das Schwimmbad für die Allgemeinheit zu öffnen, was sich als sehr gute Entscheidung herausstellte. Ich bin der Meinung, dass alles gut klappt und dass das Schwimmbad nun so etwas wie eine Schnittstelle für Kontakte mit der ortsansässigen Bevölkerung ist. ... Leider gibt es in einigen Ländern noch immer wenig Berührungspunkte zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. Hierzulande wird es langsam besser. Einheimische akzeptieren uns voll und ganz und wir sind sozusagen ein Teil der Dorfbevölkerung geworden. Dies hat sehr gute Beziehungen zwischen den behinderten und nicht behinderten Menschen zur Folge. Das ist keine geschlossene Gesellschaft, sondern es gibt die unterschiedlichsten Beziehungen. Ich habe meine Arbeit sehr gerne, weil ich Kontakt mit Menschen habe. Ich kann mit ihnen reden und mag es, neue Kontakte mit den Menschen zu knüpfen, für die der persönliche Umgang mit Menschen mit Behinderung noch immer schwierig ist. Gegenseitige Offenheit ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Die nicht behinderten Menschen sollen auch das Gefühl haben, dass die behinderten Menschen offen und an ihnen interessiert sind und dass man als behinderte Person ein Teil des Lebens ist und sein 99 will und nicht nur dahin vegetiert. Durch meine Arbeit im Schwimmbad habe ich die großartige Möglichkeit, in unserem Dorf neue Beziehungen zu knüpfen und auszubauen. 48% aller von uns befragten Personen haben eine Arbeit, wobei die Interpretation des Begriffes Arbeit besonders interessant war. Fast die Hälfte all derer, die eine Arbeit hatten, waren in einer geschützten Werkstätte tätig. Diverse Beschäftigungen 39% Geschützte Werkstätte 43% Unterstützte Beschäftigung 18% Geschützte Werkstätten Diese geschützten Werkstätten sind meistens an die Institution oder an Einrichtungen, in denen die Menschen mit Behinderung andere Dienstleistungen in Anspruch nehmen, gebunden. Die ihnen übertragenen Aufgaben sind zum Beispiel Abwaschen und Kartoffel schälen. Wenn sie in einer geschützten Gartenbauanlage arbeiten, sind sie meistens mit Anpflanzen, Umstechen und Gießen beschäftigt. Einige sind mit handwerklichen Tätigkeiten wie Holzarbeiten, Töpferei oder Papier schöpfen oder mit der Herstellung von Türmatten ausgefüllt. Wieder andere arbeiten auch im Verkaufsladen, wo sie ihre eigenen Produkte anbieten, wie zum Beispiel Gemüse und Fleisch, das am eigenen Bauernhof produziert wird. Leichte industrielle Tätigkeiten wie die Herstellung von Vorhangklipps oder Obst- und Gemüsekisten werden ausgeführt; manche Menschen mit Behinderung kommen sogar mit chemischen Produkten in Berührung oder verpacken Tabletten für eine pharmazeutische Firma. Verschiedene Verpackungsarbeiten für Servietten, Kugelschreiber und Bleistifte... 100 Diese unterschiedlichen Tätigkeiten werden von Firmen oft ausgelagert und von den Menschen mit Behinderung verrichtet. Unterstützte Beschäftigung 18% berichteten, dass sie einer unterstützten Beschäftigung nachgehen. Diese Tätigkeit sollte wie eine normale Arbeit bezahlt werden, nur mit dem Unterschied, dass der Klient an seinem Arbeitsplatz von einem Arbeitsassistenten unterstützt und begleitet. Die unterstützte Beschäftigung ist an die Fähigkeiten des Einzelnen angepasst, wobei ein Großteil der Menschen mit Behinderung bei einer unterstützten Beschäftigung nur teilzeitbeschäftigt sind. Einige Länder, wie zum Beispiel Irland, haben eigenes Personal für den Bereich Beschäftigung für Menschen mit Behinderung. Sie helfen ihren KlientInnen, einen für sie maßgeschneiderten Job mit voller Bezahlung zu finden. John hat uns erzählt, dass er in einem Projekt für unterstützte Beschäftigung arbeitet. „Ich arbeite im Fremdenverkehrsbüro unter Anleitung. Ich arbeite dort 4 Tage die Woche auf Teilzeitbasis, vier Stunden am Tag.“ Andere Beschäftigungsmöglichkeiten 39% sagten, dass sie eine Arbeit haben, aber sie konnten nicht sagen, um welche Tätigkeit es sich handelte. Einige von ihnen haben offensichtlich einen festen Arbeitsplatz, Vollzeit, mit voller Bezahlung. Manche von ihnen gaben an, dass sie einer regulären Arbeit in einem Integrationsprojekt nachgingen. Andere wussten nicht genau, ob es eine fixe Arbeit war.20 Folgende Beispiele wurden aus den Interviews exzerpiert: „Ich bin ein unabhängiger Richter.“ „Ich bin ein unabhängiger Berater für die Europäische Raumfahrtbehörde.“ „Ich habe einen Job: Ich bin Küchenhilfe in einer Krankenhausküche.“ 20 Wir sprechen dann von einem ‘festen Arbeitsplatz’, wenn der Angestellte ein Minimumgehalt bezieht, eine Arbeitsplatzbeschreibung und einen Arbeitsvertrag hat. 101 „Ich arbeite in einer Firma als Botenjunge.“ „Ich arbeite in einer Bank als Systemadministrator des einzigartigen Software Programmes. Ich habe ein Zertifikat von Microsoft.“ Die Mehrheit der Personen, die angibt, eine fixe Arbeit zu haben, sind Menschen mit einer körperlichen Behinderung oder einer Sinnnesbeeinträchtigung. Warum ist es so wichtig, eine Beschäftigung zu haben? In Interviews mit ExpertInnen, aber auch mit Menschen mit Behinderung selbst wird Beschäftigung oft als eine Quelle für Kontakte mit nicht behinderten Menschen und als Zugangsmöglichkeit zu allgemeinen Aktivitäten erachtet. Sehr oft werden ArbeitskollegInnen als Freunde angesehen. Für einige Menschen mit Behinderung sind ihre ArbeitskollegInnen die einzigen nicht behinderten Freunde. Andere Kontakte ergeben sich mit ihren behinderten MitbewohnerInnen und mit den Menschen, die sie im Tagesheim oder bei anderen Freizeitaktivitäten für behinderte Menschen treffen. Wir wollen nun einen Blick auf die Art und Weise, wie die Menschen mit Behinderung ihre Freizeit verbringen, werfen. Wie schaut ihr soziales Netzwerk aus und wer sind ihre Freunde? Freizeitgestaltung Gemäß den Forschungsergebnissen von Prof. BEART et. al.21, hebt eine aktive Freizeitgestaltung den Selbstwert der Menschen mit Behinderung, ist die Basis für soziale Interaktion und bietet die Möglichkeit, neue Fertigkeiten zu erlernen. Eine aktive Freizeitgestaltung erhöht die Chancen, die öffentliche Wahrnehmung in Bezug auf Menschen mit Behinderung zu verändern. 21 WERTHEIMER(1983), MC CONKEY & MC GINLEY (1990), MC EVOY et al.(1990) in: BEARTS, S., HAWKINS, D., KROESE, S.B., SMITHSON, P., & TOLOSA, I. (2001). Barrieren in der Gestaltung von Freizeitmöglichkeiten für Menschen mit Lernschwierigkeiten. British Journal of Learning Disabilities, 29 (4), p. 133 – 138. 102 Sprechen wir über ‘Freizeit’, müssen wir klar und deutlich zwischen der Freizeit, die jemand zu Hause verbringt und jener, die außer Haus, als aktive Freizeit verbracht wird, unterscheiden. Wenn Menschen mit Behinderung in ihrer Freizeit an einer kulturellen Veranstaltung teilnehmen möchten, bringt dies einige praktische Schwierigkeiten mit sich, zum Beispiel das Organisieren, mögliche physische und soziale Barrieren und die Auswahl der Menschen, mit denen man ausgehen möchte. All diese Faktoren müssen berücksichtigt werden. Viele Studien zeigen, dass Menschen mit Behinderung eher dazu neigen, ihre freie Zeit allein, zu Hause zu verbringen.22. „Ich arbeite am PC, allein.“ „Ich lese sehr viel.“ „Was machst du zu deinem Vergnügen?. Ich sitze vorm Fernseher.“ Wenn jemand seine Freizeit zu Hause verbringt, Fernsehen schaut, Musik hört oder ein Buch liest, ist der organisatorische Aufwand geringer und verursacht weniger Probleme. Deshalb legen wir unser Hauptaugenmerk hauptsächlich auf die aktivere Freizeitgestaltung der Menschen mit Behinderung, die sich vor allem auf die Teilnahme an „kulturellen Veranstaltungen“ (im weitesten Sinn des Wortes) in ihrem Wohnort bezieht. Zugänglichkeit Physische und soziale Zugänglichkeit sind zwei wichtige Bedingungen für die Menschen mit Behinderung, um überhaupt irgendwohin zu gelangen. Physische Unzugänglichkeit ist das größte Problem. Eine Person mit Behinderung meint, dass es solange keine Verbesserungen geben wird, solange nicht die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten und überwacht werden: „Es ist ein sehr großes Problem, die Bauordnung in die Praxis umzusetzen. Ich bin sehr enttäuscht und auch skeptisch and glaube, dass es erst dann einen Fortschritt geben wird, wenn die Behörden und Investoren gezwungen 22 Gleich wie 4. 103 werden, den Baubestimmungen Folge zu leisten. Häufig denken sie ganz einfach nicht an die Zugänglichkeit des neuen Gebäudes. Ein Großteil der Architekten ist sich über die Baubestimmungen nicht im Klaren.“ Der Zutritt zu einem Gebäude ist das Wichtigste, sei es mithilfe eines Seiteneinganges, den einige der Befragten durchaus akzeptierten, obwohl ihnen bewusst war, dass ihre Rechte verletzt wurden. BARRIEREN FÜR EINE INKLUSIVE FREIZEITGESTALTUNG - Unzugänglichkeit - Zu wenig Personal - Zu wenig Freunde, mit denen sie ihre Freizeit verbringen können - Transportprobleme - Ablehnende Haltung der Öffentlichkeit in Verbindung mit fehlendem Selbstvertrauen Ein Rollstuhlfahrer erklärt Folgendes: „Geht es um ein bestehendes Gebäude, ist die Zugänglichkeit der wichtigste Faktor. Für mich als Privatperson ist es jedoch absolut egal, ob ich den Haupteingang oder die Hintertür benützen kann, solange ich nur Bescheid weiß, wo ich hinein kann. Das Wichtigste ist, dass ich hineinkomme. Aber als Aktivist kämpfe ich für allgemein gültige Richtlinien und akzeptiere keinerlei Diskriminierung oder Nachteile; auf jeden Fall wäre es gut, den Haupteingang zugänglich zu machen.“ „Die nächste Einkaufsstadt ist wegen der Parkplätze und Stufen ein „Albtraum“. Geschäftsinhaber sagen, dass sie keine Versicherung haben und daher nicht in der Lage sind, den Rollstuhl die paar Stufen hinauf zu schieben; ‘sie muss endlos lange auf Hilfe warten’. Sie kann überhaupt nicht in das Dorfkaufhaus hinein und muss um Hilfe schreien. Sie sagen, das Haus steht unter Denkmalschutz und darf nicht verändert werden – sie gebrauchen Ausflüchte“. Psychosoziale Unzugänglichkeit 104 Mitunter fühlen sich Menschen mit Behinderung durch die Reaktionen ihrer Mitmenschen nicht gut angenommen. Hier finden Sie das Beispiel einer Person mit einer geistigen Behinderung, die zum Abendessen ausgehen wollte. „Als ich einmal ein Restaurant besuchte, sagten sie zu mir, ich hätte die falschen Schuhe an, aber hinterher dachte ich mir, dass das nicht der Hauptgrund war.“ Die negativen Reaktionen anderer Menschen und das Gefühl, nicht willkommen zu sein, haben in einigen Menschen mit Behinderung einen Mangel an Selbstbewusstsein bewirkt und in einigen Fällen einen Minderwertigkeitskomplex ausgelöst. Die beiden folgenden Aussagen bezeugen dies: „Ich gehe dort nicht hin, weil ich nicht weiß, wie ich von den anderen aufgenommen werde“. „Ich würde gerne ins Theater gehen, aber ich habe Angst, allein dort hin zu gehen. Ich glaube, dass die Menschen, die ins Theater gehen, gebildeter sind als ich und daher fühle ich mich minderwertig“. Der BetreuerInnen einer Person mit einer geistigen Behinderung sagte Folgendes: „Alle Schwierigkeiten hinsichtlich Restaurantbesuchen oder Zugang zu öffentlichen Einrichtungen entstehen durch mangelndes Selbstvertrauen oder aus Angst vor dem Unbekannten“. (Person mit geistiger Behinderung) Der Lernbetreuer merkt auch an, dass fehlendes Selbstvertrauen für Menschen mit Behinderung eine schwerwiegende Barriere hinsichtlich der Teilhabe am öffentlichen Leben darstellt. Sie haben sich noch nicht an den Gedanken gewöhnt, einfach eine Gelegenheit beim Schopf zu packen und ihr Glück zu versuchen. „Die meisten Menschen mit Behinderung sind sich der Dinge, die sie tun könnten, nicht bewusst – es wurde ihnen beigebracht, dass für sie halt vieles nicht möglich ist – sie können nicht einmal so einfache Dinge wie Kinogehen machen.“ Transportmittel 105 Auf die Frage, welche Transportmittel sie benützen, standen die ‘öffentlichen Verkehrsmittel’ an oberster Stelle. Dies scheint beinahe im Widerspruch zu den Beschwerden über die Zugänglichkeit der öffentlichen Verkehrsmittel zu stehen. Die Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel kann auch sehr mühevoll sein. Hier die Erfahrungen einer Person mit einer leichten geistigen und spastischen Behinderung: „Busse sind problematischer, weil sie stellenweise sehr hohe Plattformen haben und es aufgrund meiner Gleichgewichtsprobleme und spastischen Beeinträchtigung sehr schwer ist, in den Bus einzusteigen.“ Ist jemand in der Lage, selbst mit dem Auto zu fahren (was nur für sehr wenige Menschen mit Behinderung in Frage kommt) dann ist es oft schwierig, in der Stadt einen geeigneten Parkplatz zu finden. Obwohl sich natürlich auch viele nicht behinderte Personen über die Parkplatznot beschweren, ist es für Menschen mit einer eingeschränkten Mobilität doch ein sehr ernstes Problem. „Er geht nicht sehr oft ins Kino. Er geht regelmäßig ins Theater und besucht Konzerte. Das größte Problem ist ein Parkplatz, der nicht zu weit entfernt ist.“ (Person mit einer Körperbehinderung, Belgien) Unterstützung und Anleitung Wenn Menschen mit Behinderung etwas unternehmen möchten, müssen sie oft von den Eltern oder Assistenten begleitet werden. Dieser Bedarf an Hilfestellung beeinflusst sie auch seelisch. Es hält sie davon ab, gewisse Dinge zu unternehmen: „Ich muss öffentliche Verkehrsmittel benützen – aber ich nehme nur den Bus. Im Zug habe ich Angst, dass mir niemand hinaushilft.“ Die von den Menschen mit Behinderung in Anspruch genommenen Freizeitaktivitäten werden oft von der Serviceeinrichtung organisiert. Wie schon in Abschnitt I von Angehörigen der Belegschaft berichtet wurde, gibt es nicht genug Personal, um den Menschen mit Behinderung die Teilnahme an allgemein zugänglichen Freizeitangeboten in der Gemeinde zu ermöglichen. Es gibt zu wenig Personal, um die persönlichen Interessen des Einzelnen abzudecken. Deshalb werden Tagesbeschäfti106 gungen eher in den eigens dafür geschaffenen Einrichtungen angeboten. 23 Wie im Kapitel über Freundschaften berichtet wird, könnte dies ein wichtiger Punkt sein, der das soziale Netzwerk der Menschen mit Behinderung beeinflusst. (Re)aktionen Ab und zu gelingt es den Menschen mit Behinderung zurückzuschlagen und die Dinge in das richtige Licht zu rücken. „Nur wenige Gebäude in der Stadt sind rollstuhlgerecht. Deshalb habe ich meine eigene Planke mit, damit ich in ein Gebäude hineinfahren kann.“ „Was kann ich im Rollstuhl schon machen. Wegen der Stufen kann ich nicht ins Geschäft hineinfahren; aber ich habe dem Verkäufer gesagt: „Hallo, ich hätte gerne dies und jenes“ und er brachte mir alles, was ich wollte und verstaute die Sachen im Netz hinten am Rollstuhl.“ 23 REYNOLDS, F. (2002). Eine Sondierungserhebung der Möglichkeiten und Barrieren hinsichtlich kreativer Freizeitaktivitäten für Menschen mit Behinderung. British Journal of Learning Disability, 30 (2), pp. 63 – 67. 107 Soziale Netzwerke und Einbindung in soziale Aktivitäten und Beziehungen Freundschaften Obwohl Streitigkeiten unter den MitbewohnerInnen einer der negativen Punkte des Wohnkonzeptes war, gaben viele an diesem Forschungsprojekt beteiligte behinderte Menschen an, dass ihre ZimmerkameradInnen ihre einzigen Freunde seien. Haben Menschen mit Behinderung hinsichtlich sozialer Kontakte und Freundschaften niedrigere Erwartungen als die allgemeine Bevölkerung? Oder zeigt dies, wie schwer es für die Menschen mit Behinderung ist, ihr soziales Netzwerk auszudehnen? „Seine Freunde sind die Personen, die im gleichen Haus wohnen.“ „Seine einzigen Freunde sind seine MitbewohnerInnen.“ „Seine Freunde sind die anderen HausbewohnerInnen. Ihre Beziehungen haben sich allmählich verbessert und jetzt ist es ganz OK.“ Die Kontakte der einzelnen Menschen mit Behinderung, die wir befragt haben, sind offensichtlich sehr oft mit ihrer Behinderung verbunden. Ein Drittel der Befragten verwies auf andere Menschen mit Behinderung als ihre Freunde. Mehr als die Hälfte von ihnen erachten ihre MitbewohnerInnen, mit denen sie ein Haus oder eine Wohnung teilen, als ihre Freunde - trotz der früher erwähnten Streitigkeiten. 108 Prozentsatz Freunde Menschen mit Behinderung 35% Div. (Gasthaus, Sportverein, Kirche, Nachbarschaft) keine Behinderung 30% Arbeitskollegen 25% Nachbarn 20% Früherer Wohnort 15% Personal 10% Familie 5% keine Freunde 0% Schule Wer? Die Menschen mit Behinderung haben, selbst wenn sie in gemeindeintegrierten Wohneinrichtungen leben, nur in den seltensten Fällen ein aktives soziales Leben mit behinderten und nicht behinderten Freunden. 109 Freunde mit einer Behinderung 27% 18% Tagesheimstätte Mitbewohner 55% div.ohne nähere Angabe (Verein, Freizeitak. Ein Interviewer gab an: „Diese Frau gab mir eine lange Liste mit Namen von Freunden, aber alle angeführten Personen, kommen entweder von den ihr bekannten Behinderteneinrichtungen oder arbeiten dort“. Er sagte, dass er nach seinem Schlaganfall alle Freunde verloren hat – und jetzt besteht sein Freundeskreis aus den behinderten Menschen vom Tagesheim.“ 13% gaben ihre ArbeitskollegInnen als ‘Freunde’ an, aber da die meisten unserer Befragten in geschützten Werkstätten oder Tageszentren arbeiten, gibt es hier kein breiteres soziales Netzwerk, das über den Behindertenbereich hinausgeht. „Alle seine Freunde hat er in der geschützten Werkstätte kennen gelernt. Er hat nicht viele Freunde, er besucht kaum jemand von ihnen.“ „Es ist schwer, Freundschaften zu schließen. Außerhalb des Arbeitsplatzes habe ich keine Freunde.“ „Meine Freunde sind die Menschen, mit denen ich wohne und arbeite.“ 5% aller von uns befragten Menschen mit Behinderung gaben an, dass sie eigentlich keine Freunde hatten. 110 Freizeitgestaltung Auf die Frage, mit wem sie ihre Freizeit verbringen, ist die häufigste Antwort ‘mit Freunden’. Wie in den vorhergehenden Abschnitten angeführt, läuft es darauf hinaus, dass ‘Freunde’ - seien nun es ArbeitskollegInnen, MitbewohnerInnen oder andere Personen aus anderen gemeindeintegrierten Wohneinrichtungen - auch wieder Menschen mit Behinderung sind. In einigen Interviews ging es um den Freund oder die Freundin. Nur in sehr wenigen Fällen wird ausdrücklich auf einen Freund oder eine Freundin ohne Behinderung hingewiesen. Ein Mann mit einer körperlichen Beeinträchtigung gibt auf unsere Frage, mit wem und wie er seine freie Zeit verbringt, Folgendes an: „Ich fahre oft nach Budapest und gehe dort ins Kino, gehe essen und besuche meine Freunde. Ich komme immer zurecht. Ich rufe zum Beispiel einen meiner Freunde, der ein Auto hat, an und sage zu ihm, dass ich dort und dorthin fahren möchte und dann kommt er und bringt mich zum Bahnhof.“ „Sie geht mit ihrem Freund sehr gerne essen.“ „L´s Freunde kommen hauptsächlich aus der Werkstätte, sie besuchen sich gegenseitig und gelegentlich machen sie Ausflüge.“ Für weitere Freizeitaktivitäten ersuchen sie das Personal oder andere Fachleute, sie zu begleiten; dies geschieht aber nicht ganz aus freien Stücken, sondern weil es notwendig ist. „Ich sehe schlecht, also fahre ich mit dem Personal.“ Dann wiederum ist es nicht ganz klar, ob es notwendig ist, dass BetreuerInnen sie begleiten. Wir müssen bedenken, dass viele Menschen mit Behinderung, mit denen wir sprachen, die Serviceeinrichtung für organisierte Ausflüge frequentieren, wie in Abschnitt I erwähnt. 111 „Ich gehe gerne mit den BetreuerInnen ins Gasthaus.“ (Person mit einer geistigen Behinderung) „Sie geht gerne mit den BetreuerInnen und anderen KlientInnen in kleinen Gruppen ins Gasthaus, zum Schwimmen oder zum Kegeln.“ „Er geht sehr gerne mit den BetreuerInnen und anderen KlientInnen ins Kino, zum Kegeln oder macht Tagesausflüge mit ihnen.“ Die Menschen mit Behinderung verbringen viel Zeit mit ihrer Familie. Es scheint, als ob sie oft von ihnen abhängig sind, um mit ihnen verschiedene Aktivitäten zu unternehmen. Bis zu einem gewissen Grad hängt die Art und Weise, wie Menschen mit Behinderung ihre Freizeit verbringen, auch davon ab, wie viel Energie und Zeit ihre Angehörige in die Organisation verschiedener Freizeitaktivitäten investieren. „Ich schaue mit meinem Vater Tennis im Fernsehen an.“ „Ich fahre mit meinen Eltern in den Urlaub.“ „Sie besucht Konzerte und schwimmt gerne. Sie geht aber nie alleine. Sie wird immer von ihren Eltern begleitet.“ Spiegeln die angeführten Aktivitäten ihre eigenen Interessen oder jene ihrer Eltern oder AssistentInnen wider? In einem der angeführten Beispiele berichtete ein Interviewer Folgendes: „Der Besuch von Chorkonzerten mit der Mutter gehörte zu ihren Lieblingsbeschäftigungen.“ „Was unternimmst du zu deinem Vergnügen und mit wem? Schwimmen, Rad fahren, Karten spielen mit dem Großvater. Das macht Spaß. Er ist von seinen Eltern abhängig.“ Abschließend lassen die Rückantworten klar darauf schließen, dass die Mehrheit der Befragten ihre freie Zeit vorwiegend mit ihnen bekannten Menschen mit Behinderung 112 verbringen und entweder von Familienangehörigen oder bezahltem Personal unterstützt werden. Familienleben Eine Ehe einzugehen ist derzeit für Menschen mit Behinderung oft nicht möglich. Hin und wieder kommt dieser Wunsch, auch als Möglichkeit, sich von anderen Menschen zu unterscheiden, auf. „Er sprach mit seinen Freunden darüber und wünschte sich auch eine Freundin oder Frau.“ Es scheint, als ob eine Beziehung, eine Ehe und ein Sexualleben und Kinder für Menschen mit Behinderung von der Öffentlichkeit noch nicht akzeptiert werden. „Sie sagte, dass die Leute sie anstarrten: Wie kann eine Frau mit Behinderung nur ein Baby haben?“ Nur 21 Menschen mit Behinderung (7% der Befragten) haben über die Ehefrau oder den Ehemann oder über ihre Ehe gesprochen. Der überwiegende Teil dieser Gruppe hat eine körperliche Behinderung oder eine Sinnesbeeinträchtigung. „Er vergleicht sich mit anderen Menschen und sagt, dass er versagt hätte und nutzlos wäre, weil er bereits 25 Jahre alt ist und keine Freundin hat.“ (Person mit geistiger Behinderung) Ein Interviewer gab an, dass die Konversation sich immer wieder um die Mädchen drehte und darum, ein normales Leben zu führen, wozu auch Beziehungen zu Frauen gehören. „Als sie gebeten wurde, ihr Leben und ihre Aktivitäten mit denen ihrer NachbarInnen zu vergleichen, meinte sie, dass es leichter wäre, verheiratet zu sein und mit nur einer Person statt mit sieben anderen Personen zu leben.“ „Ich fühle, dass ich anders bin, ich spüre einen Unterschied zwischen mir und den Kindern, mit denen ich früher spielte. Sie sind jetzt erwachsen und haben eine Familie.“ 113 „Der einzige Unterschied ist, dass einige meiner NachbarInnen jetzt verheiratet sind.“ Es hat den Anschein, dass viele Menschen mit Behinderung ihr Anderssein im fehlenden Familienleben, in ihrer Ehelosigkeit oder in ihrem Alleinsein ohne Freundin oder Freund sehen. Wir wollten auch gerne wissen, in welchen anderen Aspekten sie sich anders fühlen. Menschen mit Behinderung und ihr Selbstbild Das Selbstbild der Menschen mit Behinderung spielt im Inklusionsprozess eine wichtige Rolle. Eine stabiles und positives Bild der Menschen mit Behinderung ist eine wesentliche Bedingung für ihre aktive Teilhabe in der Gesellschaft. Die Möglichkeit ihrer Teilhabe hängt davon ab, wie sie von anderen Menschen angesehen und beurteilt werden und wie sie sich selbst sehen24. Während des Interviews fragten wir die Menschen mit Behinderung, ob sie sich von anderen Menschen unterscheiden. Die meisten gaben an, dass sie einen Unterschied fühlten, nur die Begründungen waren unterschiedlich. Es war auch nicht immer ein Minderwertigkeitsgefühl ausschlaggebend. Natürlich hat die Behinderung sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf ihr Leben, aber glücklicherweise dominiert die Behinderung nicht immer ihr gesamtes Leben. „Meine Behinderung hat mich niemals davon abgehalten, Ziele zu erreichen, die ich wirklich erreichen wollte. Negative Erfahrungen, zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln haben mich nie abgehalten, meine Ziele zu verfolgen, ich habe immer Lösungen gefunden. ... Das heißt, wenn wir etwas erreichen wollen, arbeiten wir daran und werden es trotz unserer Behinderung bekommen. Natürlich immer mit einem Lächeln und im Rahmen unserer Möglichkeiten, aber man kann alles schaffen, wenn man wirklich will.“ 24 HEENE, 1993 in VAN HOVE, G., LENOIR, S. & VANPEPERSTRAETE, L. (2003) Beeldvorming over personen met een handicap. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Gelijke Kansen in Vlaanderen. Eindrapport. Ein unveröffentlichter Forschungsbericht der Universität von Gent, Belgien 114 „Ich bin anders“ Es ist augenscheinlich, dass sich Menschen mit Behinderung in manchen Beziehungen von anderen Menschen unterscheiden, weil sie bestimmte Bedürfnisse oder charakteristische Merkmale haben, die mit ihrer Behinderung in Verbindung stehen. Warum ich mich anders fühle „Ich brauche aufgrund meiner Behinderung eine Rund-um-die-Uhr Betreuung.“ „Ich sitze im Rollstuhl.“ „Ich muss von anderen Menschen Geld bekommen und sie schreiben Dinge auf einen Zettel. Ich kann nicht alles selbst erledigen.“ „Wir sind irgendwie anders, weil unser Hirn anders ist, nicht wahr?“ „Nun, wir leben natürlich auch anders und viele von uns leben zusammen. Zusammen sind wir wie eine Familie.“ „Ich bin gelähmt und brauche einen Rollstuhl.“ Einige der Befragten haben das Gefühl, dass ihre Behinderung oder die charakteristischen Merkmale, die mit ihrer Behinderung verbunden sind, sie davon abhalten, das zu tun, was sie gerne tun möchten. Aufgrund ihrer Behinderung stoßen sie in vielen Lebensbereichen auf Hürden, wie zum Beispiel bei der Arbeit und in der Freizeit, bei den Wohnmöglichkeiten, bei der Mobilität und bei den Ausbildungschancen. Eine Person mit einer Sinnesbeeinträchtigung, verheiratet und Kinder, beschreibt dies so: „Der größte Unterschied zu Menschen ohne Behinderung liegt darin, dass ein Mensch mit Behinderung für dasselbe Ziel erheblich mehr Zeit und Energie aufwenden muss!“ 115 In Alltagssituationen stoßen sie auf zahlreiche Hürden und in bestimmten Situationen werden sie mit ihren Einschränkungen konfrontiert. Hier beschreibt ein Mann mit einer körperlichen Einschränkung und Multipler Sklerose, dass er in bestimmten Situationen peinlich berührt ist und sich dabei anders als die anderen fühlt. „Ich bin behindert und im Restaurant müssen sie mir zum Beispiel das Fleisch schneiden, weil ich selbst dazu nicht in der Lage bin.“ Dieser Lehrer mit psychischen Problemen (Depressionen) weist auch auf einige Erfordernisse und Einschränkungen hin, die sein Leben von dem anderer Menschen unterscheidet. „Mit Stress kann ich nicht leben. Ich nehme Medikamente, damit ich ein ‘normales’ Leben führen kann. ... Die Leute gehen sehr behutsam und vorsichtig mit mir um.“ Die Tatsache, dass sie ein Gefühl des Anderssein haben, hält sie oft von verschiedenen Unternehmungen ab. Ein Interviewer berichtet von einer befragten Person: „Er sagt, dass er sich jetzt, nach seinem Schlaganfall, von anderen unterscheidet. Er sagt, dass er nicht mehr ausgeht und Neues ausprobiert, keinen Umgang mehr mit anderen Menschen pflegt und nicht ins Gasthaus oder ins Restaurant etc geht.“ Ein anderer Teil der Befragten beobachtet einen Unterschied durch die unterschiedliche Lebensweise. Im Gegensatz zu anderen Menschen leben sie oft in Gruppen und brauchen Unterstützung. Eine junge Frau mit einer geistigen Behinderung, die mit ihrem Freund zusammenlebt, führt aus: „Ich bin nicht der Meinung, dass sich unser Leben von dem anderer Menschen in diesem Wohnblock in irgendeiner Weise unterscheidet, abgesehen davon, dass wir einige BetreuerInnen haben. Ein Mann mit einer geistigen Behinderung erachtet auch die Abhängigkeit von anderen Menschen als den größten Unterschied zwischen ihm und seinen NachbarInnen. 116 „Mein Leben ist anders – wir haben BetreuerInnen um uns; die NachbarInnen haben niemand, der sie kontrolliert, oder? Meine Mama hat auch ein Auge auf mich.“ Andere Menschen mit Behinderung gaben an, dass sie sich aufgrund ihrer Mobilitätsprobleme und physischen Barrieren unterscheiden. Eine Person mit einer körperlichen Behinderung drückte sich so aus: „Ja, weil ich nicht gehen kann. Für vieles brauche ich einfach mehr Zeit. Ich kann mich nicht so gut bewegen wie andere.“ Manchmal haben sie das Gefühl, dass der Unterschied in Schule und Ausbildung liegt. Sie meinten, dass andere Menschen besser ausgebildet seien als sie, da sie nicht in eine reguläre Schule gehen konnten. „Ich fühle keinen Unterschied zu anderen Menschen, abgesehen von meiner Schulausbildung. Ich konnte nur die Volksschule abschließen. „Jeder ist anders“ Andere wiederum fühlen sich anders, aber in dem Sinne, dass jeder Mensch anders und einzigartig ist. Sie denken ziemlich positiv und rücken die Dinge und diese Frage ins richtige Verhältnis. „Jeder ist anders“, kommt oft als Antwort. „Ich fühle, ich bin anders, aber ich mag das.“ „Ein Mensch zu sein, bedeutet für mich das gleiche wie für alle anderen auch. Ich bin anders, weil ich eine andere Meinung und einen anderen Charakter habe. Ich mache genauso gern Spaß wie alle anderen. Aber ich bin immer von anderen abhängig. Ich bin viel langsamer und kann nicht sehr weit gehen und ich bin sehr oft krank.“ Ich bin anders, jeder unterscheidet sich vom anderen. Jeder ist wichtig. Ja, jeder ist besonders in seiner ganz eigenen Art.“ Ja, ich bin anders. Ich habe andere Interessen und Begabungen. 117 „Ich bin ein Mensch wieder jeder andere auch“ Eine weitere Gruppe der befragten Personen mit Behinderung ist der Ansicht, dass sie so sind wie alle anderen Menschen auch. Sie fühlen überhaupt gar keinen Unterschied. „Ich fühle das Gleiche. Die NachbarInnen haben Kinder und fahren mit dem Auto, aber viele Menschen haben keine Kinder und fahren nicht mit dem Auto und daher gibt es keinen Unterschied.“ „Ich sehe keinen Unterschied zwischen mir und den anderen. Ich glaube, dass wir von den anderen Menschen sehr gut angenommen werden.“ Ein Rollstuhlfahrer erklärt: „Niemals habe ich mich wegen meiner Behinderung peinlich berührt gefühlt. Ich habe mich immer als gleichwertig mit den nicht behinderten Menschen gesehen. Meiner Meinung nach sollten alle Menschen mit Behinderung hinsichtlich der Menschen, die auf ihren beiden Beinen stehen, so empfinden wie ich. Gut, der Unterschied besteht darin, dass sie auf ihren zwei Beinen stehen und gehen können. Es ist jedoch wichtig, dass wir nicht das Gefühl haben, etwas zu versäumen, weil wir haben die gleichen Rechte. Ich war niemals verlegen oder habe mich anders gefühlt, nur weil ich behindert bin und der andere nicht. Ich gehe mit den nicht behinderten Menschen ganz genauso um wie mit meinen behinderten Mitmenschen.“ Interaktion mit nicht behinderten Menschen Wie erleben sie die Interaktion mit ihren nicht behinderten Zeitgenossen? Wir fragten die Menschen mit Behinderung, ob sie der Meinung sind, dass sie anders behandelt werden als andere und ob sie diese andersartige Behandlung als positiv oder negativ empfinden. Es kamen verschiedene Antworten. Einige bemerkten gar keinen Unterschied und waren mit der Art und Weise, wie die Menschen auf sie zugingen und reagierten, sehr zufrieden. Andere hingegen hatten eine ganz andere Geschichte auf Lager. Positive Diskriminierung 118 Die folgenden Zitate kann man als eine Form der positiven Diskriminierung sehen. Offiziell bezieht sich dieser Terminus auf Maßnahmen, die eine bestimmte Kategorie von Personen besonders bevorzugt, um die ständige Unterrepräsentation in der Gesellschaft wettzumachen. Gewöhnlich wird der Ausdruck in Bezug auf Arbeit und Beschäftigung verwendet25. In dieser Broschüre verwenden wir diesen Begriff, um Aktionen oder Reaktionen von Menschen zu beschreiben, die den Menschen mit Behinderung eine bessere Behandlung angedeihen lassen, unter anderem KlientInnen und KonsumentInnen. Zum Beispiel die Bedienung in einem Geschäft, ohne sich anstellen zu müssen. Die nachfolgende Antwort kommt von jemanden, der mit dieser Behandlung nicht sehr glücklich ist, da er eine gleiche Behandlung mit dem gleichen Respekt bevorzugt. „Natürlich werde ich anders als andere behandelt; ich glaube, das ist unvermeidlich, obwohl es meiner Meinung nach nicht ganz korrekt ist. Ich möchte nicht bevorzugt bedient werden; ich möchte nur gleich gut bedient werden.“ Manchmal haben Menschen mit Behinderung auch das Gefühl, überfreundlich behandelt zu werden. Die Person mit einer Körperbehinderung empfindet dies im Folgenden als ziemlich ermüdend: „Einige haben mich nur angestarrt, andere wiederum haben mir hundert Mal ihre Hilfe angeboten, was ja wirklich sehr nett, aber auch ein bisschen nervenaufreibend war.“ Eine Person mit Multipler Sklerose merkte an: „Es kommt mir so vor, als ob alle netter zu mir sind, seit ich im Rollstuhl sitze ...“ Ein Mann mit einer körperlichen Beeinträchtigung denkt über die Tatsache nach, dass er anders behandelt worden ist, erachtet dies aber für notwendig und empfindet dies nicht als Diskriminierung. „Haben Sie jemals das Gefühl gehabt, anders als andere Personen behandelt worden zu sein? Ach, das ist schwer zu sagen. ... Ich hatte eine Sonder- 25 http://www.mic.org.mt/EUINFO Empfehlung des Rates vom 13. Dezember 1984 zur Förderung von positiven Aktionen für Frauen (84/635/EEC). 119 behandlung, weil ich sie brauchte. Es war kein Problem. Ich habe mich dadurch nicht diskriminiert gefühlt.“ Paternalistische Wahrnehmung und das „Ewige-Kind-Syndrom“ Weitere Bemerkungen verweisen auf die Gedanken im Abschnitt II, dass nicht behinderte Menschen dazu neigen, behinderte Menschen auf paternalistische Art und Weise zu behandeln, sie bemitleiden sie und sehen sie als sehr bedürftig an. Es scheint immer noch eine weitverbreitete Haltung zu sein, Menschen mit Behinderung als Kranke zu behandeln und sie zu bemitleiden. Eine Person mit einer geistigen Behinderung hat dies beobachtet: „Hin und wieder sind die Leute etwas angespannt und schauen etwas zu lange und ihre Freundlichkeit ist etwas herablassend.“ Einige unserer Befragten haben das Gefühl, dass sie wie Kinder behandelt werden. Hier einige Beispiele: „Ich darf nicht immer das tun, was ich möchte. Sie können nicht glauben, dass ich es selbst machen kann.“ „Sie sind immer sehr streng mit mir.“ „Die Menschen glauben, dass ich zu jung bin, um auf mich selbst aufzupassen.“ „Die Menschen glauben, dass ich nicht alles selbst machen kann.“ „Viele hören mir nicht zu.“ Vorurteile und Mißverständnisse Wie bereits berichtet, hat ein Teil der Öffentlichkeit kein realistisches Bild von den Menschen mit Behinderung und ihren Möglichkeiten. Dies könnte ein Grund für das Verhalten unserer befragten Menschen mit Behinderung sein. 120 Ein signifikanter Teil der befragten Personen mit Behinderung weist darauf hin, dass sie sich unterschätzt fühlen und ihnen nicht die gleichen Möglichkeiten eingeräumt werden wie ihren nicht behinderten Mitmenschen. Sie haben die Empfindung, dass ihnen Chancen und Möglichkeiten vorenthalten werden. „Ja, manchmal habe ich nicht die gleichen Chancen, obwohl ich das bewerkstelligen kann, zum Beispiel eine Arbeit.“ „Die Leute sind manchmal wirklich der Überzeugung, dass ich nicht so viel tun kann wie sie.“ Der folgende Auszug aus einem Interview ist ein verblüffendes Beispiel für die Reaktionen der Menschen, wenn sie sich behinderten Arbeitnehmern gegenübersehen. „Oft werde ich am Empfang, wo ich arbeite, gefragt, ob eine zuständige Person da ist.“ Zwei körperbehinderte Personen beschweren sich darüber, dass sie wie geistig behinderte Menschen behandelt werden, weil nicht behinderte Personen den Unterschied nicht kennen und falsche Verallgemeinerungen anstellen. Diese Bemerkungen zeigen auch, wie wichtig es ist, diese Unterscheidung zu machen. „Wegen meiner körperlichen Beeinträchtigung wurde ich wie ein geistig behinderter Mensch behandelt.“ „Viele Menschen behandeln mich wie eine Person mit Lernschwierigkeiten.“ Problem Kommunikation – aber wessen Problem ist es eigentlich? Menschen mit Behinderung beklagen sich manchmal darüber, dass sie nicht verstanden werden. „Sie hat ziemlich viele Probleme in Geschäften und im Kino gehabt, weil viele Leute nicht verstanden haben, was sie gesagt hat. Meistens sind sie verärgert und sagen ihr, ’dass sei dafür keine Zeit haben’. Deswegen geht sie jetzt nicht mehr ins Kino.“ 121 „Selbst bei Familienfeiern reden die Leute nicht mit ihm. Klassenkameraden und Verwandte, immer ist er ausgeschlossen und unfair behandelt worden, auch und vor allem von Ärzten und im Krankenhaus.“ Menschen mit Behinderung werden ziemlich oft mit dem ‘Nimmt-sie-Zucker’ Syndrom konfrontiert, wo Fremde andere Personen fragen, ob sie etwas tun können. Bei privaten Angelegenheiten werden sie nicht direkt angesprochen. Die Menschen neigen dazu, betreuende Personen zu fragen, selbst die Frage nach dem persönlichen Wohlergehen wird nicht direkt an die behinderte Person gerichtet. Untenstehend finden sie drei Beispiele dieses Syndroms: „Wenn ich mit einem meiner BetreuerInnen zur Bank gehe, wird sofort er angesprochen, selbst wenn ich mit dem Gespräch beginne. Ich bin darüber sehr verärgert und es macht traurig. Ich verstehe es einfach nicht, warum sich die Menschen nicht ein bisschen mehr Zeit für mich nehmen können. Das ist auch der Grund, dass ich mich in dieser Beziehung auf jeden Fall anders als andere Menschen fühle.“ „Wegen meines Hundes bekam ich einen Verweis, aber nicht ich persönlich, sondern der Hausherr, der mir dann die Nachricht überbrachte.“ „1994 war ich mit einem Freund im Büro der Sozialarbeiterin. Die Sozialarbeiterin stellte statt mir meinem Freund Fragen über mich. Sie beachtete mich überhaupt nicht, obwohl es um mich ging. Sich unbehaglich fühlen Viele Menschen fühlen sich in der Anwesenheit von Menschen mit Behinderung ziemlich unwohl. Sie wissen nicht, wie sie sie ansprechen sollen, wohin sie schauen oder was sie anschauen sollen oder wie lange sie irgendwohin blicken sollen und vermeiden deshalb jeden Kontakt mit ihnen. Dadurch entsteht eine ungute Atmosphäre, die wiederum verschiedene Reaktionen nach sich zieht. Zusammenfassung: 122 AUSDRUCK VON FREMDHEIT Welche verschiedenen Reaktionen kommen aus der Bevölkerung, die von den Menschen mit Behinderung beobachtet werden? - Vermeidung von (Augen)Kontakt oder unangemessenes Starren; - Vermeidung von Interaktion; - Das ‘Nimmt-sie-Zucker ’Syndrom, das heißt, über eine Person ‘hinweg’ sprechen, eine Person nicht direkt ansprechen; - Den „Gegenstand der Behinderung“ als ein Tabu vermeiden; - Menschen mit Behinderung lächerlich machen. „Sie fühlen sich in meiner Gegenwart nicht wohl.“ „Sie vermeiden den Kontakt mit mir.“ „Sie trauen sich nicht, mit mir zu reden, insbesondere wenn sie wissen, dass ich taub bin.“ Eltern ziehen ihre Kinder weg oder verbieten ihnen den Mund, wenn sie auf der Straße eine Frage an Menschen mit Behinderung stellen. Es hat den Anschein, als ob Ignoranz und Angst vor Andersartigem den Kontakt zwischen Menschen mit und ohne Behinderung dominiert26. „Im Allgemeinen ist er mit der Behandlung zufrieden, er ist aber darüber traurig, dass die Eltern ihre Kinder oft zum Stillsein ermahnen, wenn sie über diese ‘merkwürdige Person‘ Fragen stellen, anstatt ihnen zu sagen, ‘dass der Herr halt nicht gut sehen kann und vielleicht ein Augenleiden hat’. Dies beweist, dass es um die Menschen mit Behinderung noch immer eine Tabuzone gibt.“ 26 RADTKE, P. (2003) Zwischen Bettler und Batman: Das Bild der Menschen mit Behinderung in den Medien. EDF Bulletin: Sonderdossier über: „Medien und Behinderung“ – April-Juni 2003, p.11-13. 123 Ständiges Starren der Leute ist auch ein Symptom derselben Krankheit; mit gewissen Situationen nicht umgehen zu können, nicht daran gewöhnt zu sein oder einfach Angst zu haben. „Auf die Frage, wie die Leute im Allgemeinen auf ihn reagieren, meint er, dass sie üblicherweise überhaupt nicht auf ihn reagieren, aber dass sie ihm sehr wohl viele Blicke zuwerfen.“ „Wenn andere auf mich zeigen und sagen ‘er ist ein Krüppel‘ oder ‘er ist behindert‘ macht mir das überhaupt nichts mehr aus. Ab und zu starren mich die Leute auf der Straße an und reden über meinen Gang. Am Anfang war ich darüber sehr deprimiert und verletzt, aber nun macht mir das gar nichts mehr aus. Sie starren, nun gut, was soll´s. Auch Männer starren hübsche Frauen auf der Straße an. Das ist menschlich.“ „Die Menschen schauen ihn immer etwas seltsam an, aber er hat schon vor Jahren aufgehört, sich darüber Sorgen zu machen, was die Leute von ihm denken.“ „Er geht nicht gerne in ein Restaurant. Der Gang zur Toilette ist das größte Problem, aber er hat es auch nicht gern, ständig ‘Blicke zu spüren‘. Er isst lieber zu Hause in aller Ruhe.“ (Person mit einer körperlichen und einer geringfügigen geistigen Behinderung) Auch vom betreuenden Personal wurde dieses Anstarren beobachtet: „Natürlich machen wir auch negative Erfahrungen, im Freibad zum Beispiel haben uns alle intensiv gemustert.“ „Es sieht so aus, als ob manche Menschen nicht einmal ihren Anblick ertragen können. Vielleicht wird ihnen zu sehr der Spiegel vorgehalten.“ Eine Person mit einer Körperbehinderung erzählte uns: „Setzte ich mich in den Garten, ging mein Nachbar ins Haus; er kann nicht draußen sitzen, wenn ich draußen sitze, sehr sonderbar.“ 124 Es wird auch darüber berichtet, dass Menschen mit Behinderung auf der Straße ausgelacht werden. Sehr oft geschah dies früher in der Schule. Über das Verhalten von Kindern gibt es sehr viele Beschwerden. Viele Menschen mit Behinderung beschwerten sich darüber, dass sie als Kinder in der Schule oft schikaniert wurden. „Früher behandelten mich die Leute anders als die anderen (verspotteten mich und lachten mich aus), heute ist es besser.“ „In der Schule wurde ich anders behandelt als die anderen Kinder. In der Schule haben sie mich unfair behandelt.“ Das lässt darauf schließen, dass die Schule den Kindern frühzeitig den Umgang mit einer vielfältigen Gesellschaft lehren soll. Die Schule würde sich überhaupt sehr gut dafür eignen, Toleranz zu lehren und zu vermitteln, besonders dann, wenn die Schule die bunte Vielfalt der Menschheit als eine Einheit reflektiert, zu der auch Kinder mit Behinderung gehören. Eine Person mit einer körperlichen Behinderung erzählte dem Interviewer Folgendes: Seine Geschichte wurde von den BetreuerInnen bestätigt. „Auf der Straße lachen mich die Leute aus, weil sie glauben, dass ich ein Alkoholiker bin.“ Ein BetreuerInnen erzählt: „Von seinen NachbarInnen wurde er sehr oft beleidigt und gedemütigt. Er möchte sich gerne mit ihnen unterhalten und sie grüßen, aber sie vermeiden den Kontakt mit ihm.“ Menschen, die selbst eine Behinderung haben, können sich vielleicht denken, warum die Menschen so reagieren. Menschen mit Behinderung haben folgende Aussagen als Beispiele für das seltsame Verhalten ihrer NachbarInnen herausgefunden: „Viele Leuten können mit Menschen mit Behinderung nicht kommunizieren.“ 125 „Die Leute wissen einfach nicht, wie man reagiert, wenn man eine sehbehinderte Person trifft.“ „Erfahrungsgemäß scheuen die Leute irgendwie davor zurück, mit einer behinderten Person ins Gespräch zu kommen.“ Ein Fürsprecher von einigen Menschen mit Behinderung bemerkte zu diesem Thema: „...Leute zögern oft, mit ihm in Kontakt zu treten.“ „...Leute wissen nicht, wie sie mit ihm umgehen sollen.“ Die befragten Menschen mit Behinderung geben zu, dass sich das Verhalten im Lauf der Zeit geändert hat. Dies kann man auch in Abschnitt II ersehen, in dem NachbarInnen aussagen, dass sich die Kommunikation mit ihren behinderten Mitmenschen nach einer gewissen Zeit verbessert hat, wobei die befragten Menschen mit Behinderung diese Verhaltensänderung auf das gegenseitige Kennenlernen zurückführen. Die Menschen legen jedoch noch immer ein zu gönnerhaftes Verhalten an den Tag, was sicher auf frühere Vorurteile schließen lässt. Aber Menschen mit Behinderung konstatieren, dass sie kein Mitleid brauchen. „Wenn er zum ersten Mal mit Menschen spricht, reagieren sie geschockt oder verängstigt, aber dies ändert sich im Laufe eines Gespräches sehr rasch.“ (Person mit einer körperlichen Behinderung) Diskriminierung Die Tatsache, dass den Menschen mit Behinderung Fähigkeiten abgesprochen werden, führt von Zeit zu Zeit zu Ungleichbehandlungen, was wiederum in Diskriminierung der Menschen mit Behinderung in verschiedenen Bereichen resultiert. „Hin und wieder sind die Leute im Geschäft unhöflich.“ 126 Einige Leute glauben, dass ich wertlos bin und sie unterschätzen mich, aber ich mag mich nicht mit ihnen streiten.“ Anders behandelt zu werden ist nicht immer gleichzusetzen mit unfairer oder diskriminierender Behandlung. Manchmal ist ‘unterschiedliche Behandlung’ ganz einfach grobes und intolerantes Benehmen. Menschen mit Behinderung werden oft unterschätzt. Einige nachfolgend angeführte Beispiele zeigen sogar eine Verletzung ihrer Rechte. Eine Person mit einer geistigen Behinderung erzählte uns die folgende Geschichte eines Gasthausbesuches: „Haben Sie sich jemals unfair behandelt gefühlt? Ich ja, als ein Mann in einem Lokal zu mir sagte, ich könne nicht Billard spielen, als ich mein Geld hinlegte. Ich habe ihn ohnehin nicht beachtet.“ Ziemlich viele Aussagen, die mit unhöflichem und intolerantem Verhalten zu tun haben, werden mit Behörden in Verbindung gebracht. Hier finden Sie ein Beispiel einer Person mit einer körperlichen Behinderung: „Insbesonders wenn ich ein Amt besuche. Sie schicken mich von einer Abteilung in die nächste und hören mir einfach nicht zu.“ Ein Beispiel aus einer Bank: „Sie hat schon sehr viele Probleme in Geschäften und in der Bank gehabt, weil die Leute nicht verstehen können, was sie sagt. Meistens sind sie verärgert und wimmeln sie einfach ab.“ Über Aggressionen ohne offensichtlichen Grund wurde nur in Extremfällen berichtet. „Ab und zu versetzen mir Leute einen Schlag auf den Kopf, nur um zu sehen, wie weit sie gehen können.“ „Einmal wollte der Hausherr, dass ich die Wohnung verlasse und rief die Polizei. Acht Polizisten führten mich wie einen Schwerverbrecher ab.“ 127 Über Verletzungen der Menschenrechte wird in Bezug auf Beförderungsmittel und das Recht, Zugang zu Dienstleistungen zu erhalten, berichtet. „Einmal steckten sie mich im Zug in das Gepäckabteil.“ (Person mit Behinderung) „Ein Psychiater verweigerte ihm seine Hilfe, als seine Großmutter starb. Dadurch geriet er stark unter Stress und reagierte sehr aggressiv.“ „Einmal traf ich auf einen Taxifahrer, der behinderte Menschen nicht leiden konnte und mich nicht in sein Taxi einsteigen ließ. Ich war gezwungen, ein anderes Taxi zu rufen.“ (Person mit Behinderung) „Ständig muss D. den Geschäftsinhaber ersuchen, etwas wegzuräumen, damit sie hineinfahren kann, wobei sich die Freude des Besitzers über diese Mehrarbeit in Grenzen hält. (Manchmal fährt D. absichtlich in etwas hinein und ‘dann räumen sie es weg’) Im Grunde genommen sind Rollstuhlfahrer hier nicht gerne gesehen. Im Vergnügungspark wollen sie dich nicht fahren lassen – ‘Du bist eine Brandgefahr’. Für den Zutritt muss bezahlt werden, drinnen kann man aber keine Angebote nützen und niemand hilft den behinderten Menschen.“ (im Vergleich dazu Disney World, wo alle Einrichtungen offen standen und alle sehr hilfreich waren – Rollstuhlfahrer) Es gibt verschiedene Arten von Diskriminierung - beabsichtigte und unbeabsichtigte. Menschen mit Behinderung können in ihrem Leben zu verschiedenen Zeiten auf beide Arten stoßen. Dies trifft auch auf essentielle Lebensbereiche, wie zum Beispiel auf Arbeit und Beschäftigung, zu. Diskriminierung gefährdet auch die Jobchancen der Menschen mit Behinderung. Für viele der von uns befragten Menschen mit Behinderung war die Arbeitssuche, selbst mit einem Diplom, sehr schwer. Ein Interviewer berichtet: „Manchmal fühlt er sich ungleich behandelt, aber wegen Kleinigkeiten (zum Beispiel wenn jemand über ‘seinen Kopf hinweg’ spricht). Aber in einem Bereich fühlt er sich wirklich ungerecht behandelt, nämlich was die Arbeit betrifft. Er hat sehr lange einen Job gesucht und war ca. 60 Mal zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen (aufgrund seines Diploms). Aber nach 128 jedem Gespräch war der Arbeitsplatz plötzlich schon vergeben. Es kamen ihm auch Gerüchte zu Ohren, dass seine Behinderung mit der erfolglosen Arbeitssuche zu tun hätte. Zwei weitere von uns befragte Menschen mit Behinderung berichteten über eine ungerechte Behandlung an ihrem Arbeitsplatz: „Es stört mich, wenn die Leute Mitleid mit mir haben und ich mich am Arbeitsplatz ausgenutzt fühle.“ „Einmal wurde ich in dem Hotel, in dem ich arbeitete, schlecht behandelt. Ich fühlte mich ausgeschlossen, war oft krank. Ich wurde nicht angenommen – die Menschen hatten keine Geduld.“ Andere Fälle von Diskriminierung waren nicht zwischenmenschlicher Natur, sondern auf strukturelle und organisatorische Probleme hinsichtlich Beschäftigung für Menschen mit Behinderung zurückzuführen. Der Umstand, dass Politiker und vor allem Arbeitgeber Menschen mit Behinderung noch immer nicht für förderungswürdig halten, ist sowohl für die behinderten Menschen als auch für deren BetreuerInnen insofern ein großes Problem, als die behinderten Personen durch eine Arbeitsaufnahme oft den Verlust anderer lebensnotwendiger Sozialleistungen riskieren. Jüngste Bestrebungen auf europäischer Ebene im Rahmen des Europäischen Jahres der Menschen mit Behinderung 2003 und einiger Maßnahmen durch das Programm Leonardo da Vinci, mit Hauptaugenmerk auf Berufsausbildung und Berufseinstiegskurse, lassen auf eine positive Entwicklung für die Zukunft hoffen. „... Es ist auch schwierig, eine Arbeit zu finden. Potentielle Arbeitgeber werden immer wieder durch einen befürchteten Produktionsverlust abgeschreckt (obwohl sie eine staatliche Ausgleichszahlung bekommen). Das größte Problem ist jedoch die Tatsache, dass der gesamte Verdienst von den Beihilfen abgezogen wird. Dadurch ist es für Menschen mit Behinderung nicht möglich, einen Teilzeitjob anzunehmen: Sie würden die gesamten Zuschüsse verlieren. Dies stellt ein signifikantes Hindernis für die Integration dar.“ Ein Mann mit einer körperlichen Behinderung, verheiratet, lebt mit seiner Frau unter einem Dach, berichtet über folgende Nachteile des Beihilfensystems. 129 „Meiner Meinung nach ist es wirklich unfair, die Beihilfe einer körperbehinderten Person an das Einkommen des Partners anzugleichen, wenn sie zusammen leben.“ Reaktionen und Meinungen über intolerantes Verhalten Die Interviews zeigten unterschiedliche Reaktionen und Meinungen der Menschen mit Behinderung, wie sie auf intolerantes Verhalten ihrer Mitmenschen reagieren oder gerne reagieren möchten. Im Großen und Ganzen gab es drei verschiedene Strömungen. Isolation: Viele Menschen mit Behinderung beschrieben sich selbst als in Isolation lebende Menschen, die nur Umgang mit jenen Menschen haben, die sie kennen und akzeptieren. „Ich lebe sehr zurückgezogen und errege somit keine Aufmerksamkeit.“ „Üblicherweise hilft mir meine Mutter, weil ich die meiste Zeit bei ihr bin. Die anderen Leute haben kein Verständnis für mich.“ Der Mann mit einer körperlichen Behinderung sinnt über das ständige Anstarren von anderen Menschen nach: „Selbst wenn ihn das dumme Anstarren überhaupt nichts mehr ausmacht, möchte er sich und anderen diese Situation ersparen.“ „Am Anfang haben die Leute nicht sehr viel mit ihm oder seiner Frau geredet. Er hat damals nichts unternommen, um den Kontakt zu seinen NachbarInnen zu verbessern: ‘Wenn die Leute nicht mit mir reden wollen, dann will auch ich nicht mit ihnen reden’, meint er.“ Die Mitmenschen aufklären: Eine ganze Reihe der Befragten sagte uns, dass sie die Mitmenschen über ihre Behinderung informieren und aufklären möchten. Ihr vorrangiges Ziel ist, das Bild der Menschen mit Behinderung zu ändern. 130 „Er ist der Auffassung, dass er, indem er über seine Ängste spricht, die richtige Hilfe und Unterstützung vom stellvertretenden Pfarrer, von den Angestellten in der Imbissstube oder vom nächsten NachbarInnen bekommt.“ „Die Leute verstehen dich besser, wenn sie über deine Situation Bescheid wissen.“ Andere Reaktionen: Einige der befragten Personen sehen es auch als Aufgabe der Menschen mit Behinderung selbst, die Reaktionen ihrer Mitmenschen zu verändern. Eine Person fand, dass sie die Initiative ergreifen und den ersten Schritt zur Kontaktaufnahme tun sollten etc. „Es ist mir bewusst, dass es an uns – den behinderten Menschen – liegt, auf die Menschen ohne Behinderung zuzugehen. Seit sechs Monaten lebe ich nun hier und behaupte ständig, nicht anders als die anderen zu sein. Zuerst dachte ich, dass ich mich aufgrund meiner Behinderung von anderen unterscheide, aber dann ist mir klar geworden, dass jeder irgendwie behindert ist, wenn nicht körperlich, dann moralisch oder emotional. ...“ Diese Aussage lässt darauf schließen, dass Menschen mit Behinderung keine wirklichen Vorbilder haben. Dies könnte eine weitere Aufgabe für die Medien sein, das Ansehen der Menschen mit Behinderung zu ändern und zu heben. „Es ist sehr schwer, die Eltern zu überzeugen, ihre Kinder zu unseren Veranstaltungen zu bringen, weil sie eine Behinderung noch immer als Stigma betrachten. Es ist ein hartes Stück Arbeit, hier einen Durchbruch zu erzielen. Es wäre auch schön, wenn die Menschen mit Behinderung mehr unter die Leute gehen würden. Sie nehmen in den unterschiedlichsten Bereichen des alltäglichen Lebens wie zum Beispiel Sport, Ausbildung etc. keine aktive Rolle ein. Es gibt keine Vorbilder mit Behinderung, die sogar nicht behinderten Menschen zeigen könnten, dass wir die gleichen Leistungen, nur unter anderen Voraussetzungen, erbringen können.“ 131 „Darüber hinaus ist es nicht einfach, mich loszuwerden. Ich bin sehr hartnäckig, zum Beispiel wenn ich irgendwohin gehe und nicht allein hineinkomme, dann suche ich mir immer einige Leute aus und sage zu ihnen ‘Ich würde da gerne hineinkommen, aber allein schaffe ich das nicht, bitte helfen sie mir’.“ Die Nachbarschaft Wie haben die NachbarInnen auf die Gründung dieser Einrichtung für Menschen mit Behinderung reagiert? Mit welchen Reaktionen sind die behinderten BewohnerInnen konfrontiert worden? Wie wurden Sie aufgenommen und wie sind jetzt die Beziehungen zu ihren NachbarInnen? Eine Trilogie: Nachfolgend finden Sie drei Interviews, eines Paares und ihrer Nachbarin (40), die seit der Eröffnung der Gemeindeintegrierten Behinderteneinrichtung Tür an Tür wohnen. Wir haben die drei Erfahrungswerte, der geistig behinderten Ehefrau und ihres ebenfalls geistig behinderte Ehemannes und der Wohnungsnachbarin in Zusammenhang gestellt. Das Paar. SIE: „Ich habe nie schlechte Erfahrungen gemacht; dies kommt wahrscheinlich davon, weil wir ‘nicht komisch aussehen und uns kein Bein oder sonst was fehlt’. Abgesehen von einigen NachbarInnen, die uns hin und wieder ‘ein bisschen merkwürdig’ anschauen, hat es nie auch nur die geringsten Schwierigkeiten mit den NachbarInnen gegeben.“ ER: Alle NachbarInnen mag ich nicht. Mit einigen Leuten, die ich auf der Straße treffe, rede ich regelmäßig, aber es gibt auch einige wenige, die kein Wort mit mir sprechen, wenn wir uns begegnen oder mich anstarren und dann zu lachen anfangen. Im ersten Jahr passierte das häufiger, die Situation hat sich aber zum Besseren gewandt. Warum, kann ich auch nicht sagen, aber wahrscheinlich wird den Leuten bewusst, dass wir doch nicht so merkwürdig sind.“ Ihre Nachbarin lebt allein und hat keine Kinder: 132 Zu Beginn hat es einige Bedenken hinsichtlich dieses Projektes gegeben.... Als sie später herausfanden, was Unterstütztes Wohnen tatsächlich heißt, begannen sie diese Einrichtung zu schätzen. Da beide Personen, die in diesem Haus wohnen, sehr liebenswürdig sind und sie auf der Straße grüßen, hat sie sie ein wenig näher kennengelernt. ... „Ich habe über diese Art von Projekten nichts gewusst und habe mir auch immer gedacht, dass so etwas nicht wirklich funktionieren kann. ... Aber ich habe gelernt, dass die geistige Behinderung der beiden durch einen Coach oder einen Nachhilfelehrer leicht ‘ersetzt’ werden kann. Somit können diese beiden Menschen ohne weiteres in einem ganz normalen Umfeld wohnen. ... Die beiden kommen mich auch hin und wieder besuchen, obwohl ich zur Frau mehr Kontakt habe als zum Mann. Der Mann tut sich schwer, über sich selbst zu reden und ist ein ziemlich ruhiger Typ. Die Frau dagegen ist sehr lebhaft und ’sehr intelligent’. Hin und wieder besuche ich sie und manchmal helfe ich ihr im Garten, auf den die beiden sehr stolz sind. ... Meine Einstellung hat sich durch ihre Fähigkeit, sich gut in der Nachbarschaft einzuleben, geändert. Am Anfang war ich etwas besorgt über die Qualität dieses Projektes, aber ich habe sowohl meine Meinung über das behinderte Paar als auch meine Einstellung über deren Inklusion geändert. Solchermaßen bin ich der Meinung, dass diese Projekte der ‘ideale Weg sind, ihnen zu einem unabhängigeren Leben zu verhelfen’.“... Bevor dieses Paar hierher gezogen ist, habe ich keine behinderten Menschen gekannt. Wir fragten die BewohnerInnen der Einrichtung, wie die NachbarInnen auf ihre Gegenwart oder auf die Etablierung dieser Einrichtung reagierten. Die Menschen mit Behinderung sagten, dass sich die Menschen überrascht bis neugierig zeigten. Dieser Mann mit einer körperlichen Behinderung erzählt über seine Gefühle, als er hierher zog. Er lebt in einer Wohngemeinschaft mit sieben anderen behinderten Menschen: „Am Anfang hatte ich irgendwie Bedenken: In einigen Kreisen und bei manchen Menschen werden solche Leute (=wir) nicht gerne aufgenommen. Hier war es auch so und es hat einige Zeit gedauert, bis wir akzeptiert wurden. ... Zuerst war ich besorgt, das sie uns hier nicht tolerieren würden. ... 133 Wir hatten allen Grund zu dieser Annahme (zum Beispiel dass sich andere KlientInnen fürchteten) weil sie uns so anstarrten. Zu Beginn waren wir in der Gemeinschaft nicht willkommen. Wir müssen uns hier halt einleben, habe ich mir gedacht und kann nun sagen, dass wir jetzt integriert sind. Wenn wir ins Gasthaus oder in ein Geschäft gehen, plaudern wir mit den Leuten, aber am Anfang war es ziemlich schlimm.“ Die Reaktionen auf die Frage, wie sich die Interaktion mit ihren NachbarInnen gestaltet, waren recht unterschiedlich. Einige konnten nur von positiven, andere wiederum hauptsächlich von negativen Erfahrungen berichten. Einige meinten, dass dies von der Person abhängt, andere halten die Tagesverfassung für die Interaktion ausschlaggebend. Jedenfalls sind die Antworten auf die Frage, wie sich die Interaktion gestaltet oder welche Reaktionen sie erhalten, sehr unterschiedlich und variieren von Person zu Person. „Ich rede mit einem Teil der NachbarInnen und sie behandeln mich so wie alle anderen auch. Das gefällt mir. Aber es gibt auch andere Leute, die nicht mit mir sprechen und mich beleidigen und einmal sogar mein Fahrrad kaputt gemacht haben.“ (Person mit geistiger Behinderung) „Ein Teil der Nachbarschaft hat ihn akzeptiert. Er redet mit ihnen und sie beschenken ihn zu bestimmten Anlässen. Der andere Teil hat ihn nicht akzeptiert. Sie ignorieren ihn, beleidigen ihn oft und manchmal werden sie sogar handgreiflich.“ (Person mit schwerer geistiger Behinderung, lebt bei seiner Familie) „Einige Einheimische sind freundlicher als andere, die lieber auf die andere Straßenseite wechseln als zu grüßen, aber dies kommt wohl überall vor. (Person mit geistiger Behinderung und Sinnesbeeinträchtigung, lebt in einer Wohngemeinschaft) „Er sagte, dass einige in Ordnung seien und mit ihm meistens über Autos reden, andere jedoch machen sich nicht die Mühe, ein Gespräch mit ihm zu führen. ...In der Stadt kennt er mehr Menschen als in seiner engeren 134 Wohnumgebung. Er spricht mit Leuten, die er im Gasthaus trifft. (Person mit geistiger Behinderung, abgeschlossene Wohnung (8)) In der Forschung wurde schon oft nach Antworten auf die Frage, welche Faktoren für diese Reaktionen verantwortlich sind, gesucht. Die Art der Behinderung, Bildungsniveau der NachbarInnen. ... Nachstehend finden sie einige positive und einige negative Erfahrungswerte. Positive Interaktion mit den NachbarInnen Der Umstand, dass eine Person mit Behinderung bei den Eltern wohnt, scheint einen positiven Effekt auf die mögliche Inklusion zu haben. Die Eltern und ihre nachbarschaftlichen Kontakte erleichtern die Kontaktaufnahme zwischen ihrem Sohn oder ihrer Tochter und den anderen NachbarInnen. Dies zeigt ein Beispiel einer Person mit einer geistigen Behinderung, die bei den Eltern wohnt. „Wir haben einen freundschaftlichen Kontakt zu unseren NachbarInnen. Sie haben einen jungen Hund, der uns manchmal besuchen kommt.“ Diese Aussage wird von einem Betreuer bestätigt, der ebenso auf die positive Wirkung auf Menschen mit Behinderung hinweist, wenn sie in ihrem Heimatort leben können. „Hier kennen ihn fast alle Leute, weil er hier geboren und aufgewachsen ist – die Leute bleiben immer stehen, um mit ihm zu reden.“ „Sie mag die Umgebung und die Menschen, die hier leben. Die meisten Leute reden mit ihr und sie grüßt sie auf der Straße. Sie hat regen Kontakt mit ihren beiden NachbarInnen. Sie kommt ein paar Mal die Woche auf einen Kaffee vorbei oder die NachbarInnen kommen auf einen Plausch und ein Getränk zu ihr, zum Beispiel nachdem sie sich im Supermarkt getroffen haben. Es gibt jedoch noch immer Menschen, die nichts mit ihr zu tun haben wollen und wegschauen, wenn sie einander auf der Straße begegnen. (Person mit geistiger Behinderung, betreutes Wohnprojekt, verheiratet) 135 Dieser Mann mit einer körperlichen Behinderung, der mit seiner Frau in einem Haus wohnt, ist der Auffassung, dass die Art der Interaktion auch von der behinderten Person selbst abhängt. Offenheit und ein angemessenes Verhalten spielen bei einer geglückten Interaktion eine große Rolle. „Ich bin seit jeher gut mit meinen NachbarInnen ausgekommen. Das ist noch immer so, die zwischenmenschlichen Beziehungen sind sogar gewachsen und somit auch die nachbarschaftlichen Beziehungen. Es ist hauptsächlich ein Spiegel deiner Offenheit und die der NachbarInnen. ... Ich bin im Allgemeinen sehr zufrieden mit dem Verhalten meiner Mitmenschen und betrachte dies als wirkliche Interaktion: Kommst du deinen Mitmenschen freundlich entgegen, so werden diese auch dir freundlich begegnen.“ Dann und wann gibt es sogar Berichte über besondere Freundschaften und sehr enge Verbindungen zwischen den NachbarInnen. Die folgende Geschichte eines Rollstuhlfahrers, der allein in einer Wohnung lebt, widerspiegelt die Tiefe einer Beziehung, die Menschen mit Behinderung leben können: „Ich kenne meine NachbarInnen sehr gut und ich kann sagen, dass wir im Laufe dieser sechs Jahre eine sehr gute Beziehung aufgebaut haben. Meine NachbarInnen sind sehr tolerant. Ich liebe laute und gute Musik und sie tolerieren mein Hobby. Wir helfen einander; ich helfe ihnen so gut ich kann. Es ist nicht nur ein Nebeneinanderwohnen, ohne das der eine vom anderen etwas weiß. Natürlich gibt es gelegentlich Probleme, aber wir lösen sie gemeinsam. ... Ist das gesamte Haus betroffen, so besprechen wir das in der Hausversammlung. ... Kurz nachdem ich hierher übersiedelt bin, ist auch ein Paar eingezogen, mit dem ich mich sehr gut verstehe; wir sind wie eine große Familie. Die Beziehungen werden immer stärker, nachdem ich der Taufpate ihres Kindes geworden bin. Es ist wirklich eine sehr enge Freundschaft.“ Einige Leute haben sehr enge nachbarschaftliche Beziehungen, indem sie einander helfen, wenn es notwendig ist oder auf das Haus oder die Wohnung aufpassen, wenn die NachbarInnen auf Urlaub sind. Diese ausgewogenen Beziehungen wirken sich nicht nur sehr positiv auf den Selbstwert der Menschen mit Behinderung, sondern auch auf jenen der nicht behinderten NachbarInnen aus, und helfen, 136 eventuelle Zweifel und Vorurteile aus dem Weg zu räumen. Diese Beziehungen ermöglichen den Menschen, die jeweiligen Stärken des anderen kennenzulernen. „Die Einzigen, mit denen er ab und zu plaudert, ist ein älteres Paar. Der Kontakt ist lose, aber wenn etwas ansteht, können sie jederzeit aufeinander zählen.“ (Person mit einer körperlichen Behinderung) „Es gibt keine gegenseitige Besuche, ausgenommen, um auf das Haus des anderen aufzupassen.“ Eine ganze Reihe der von uns befragten Menschen mit Behinderung gaben an, dass sie keine Kontakte brauchen: Wollen sie wirklich lieber allein sein oder ist dies nur eine der Reaktionen, die wir früher besprochen haben? Absonderung als Selbstschutz, um unangenehme Reaktionen zu vermeiden? „Auf die Frage, ob ihn die Leute in seiner Umgebung kennen, sagte er nein und fügte hinzu, dass er lieber für sich allein lebt, weil er ein Einzelgänger ist.“ Andere behaupten, dass das Leben in der Stadt sehr anonym ist und laut ihren Aussagen es nicht viele Gelegenheiten gibt, mit anderen Leuten zu kommunizieren. „Er fühlt sich nicht wirklich als Teil der Nachbarschaft, aber nicht mehr und nicht weniger als alle anderen auch. Die Stadt ist einfach zu anonym.“ Eine Person mit einer körperlichen Behinderung, die in einem unterstützten Wohnprojekt wohnt, teilt diese Meinung: „Er fühlt sich nicht wirklich als Teil der Nachbarschaft, aber in einem Stadtzentrum sind die zwischenmenschlichen Kontakte nicht so ausgeprägt wie auf dem Lande.“ Obwohl ein Großteil überhaupt keine Kontakte hat, sprechen die wenigsten frank und frei aus, was sie denken. Auch die nicht behinderten NachbarInnen geben an, nicht allzu viele Kontakte in ihrer Umgebung zu pflegen, weder mit ihren behinderten noch mit ihren nicht behinderten NachbarInnen. Ist dies der Grund, warum es für Menschen mit Behinderung so schwer ist, stärker in die Gemeinschaft eingebunden zu werden? 137 „Es gibt sehr wenig Kontakte zu den Menschen in der Nachbarschaft. Einige reden mit den behinderten Menschen, andere haben keine Berührungspunkte. ... „Sie kennt niemand beim Namen und redet auch mit niemand.“ (Frau mit geistiger Behinderung, wohnt alleine in einer Wohnung mit Gemeinschaftsräumen) Negative Erfahrungen mit NachbarInnen – Ärger mit Kindern und Jugendlichen, Lärmbelästigung und Streitereien Wie bereits erwähnt, scheinen die Reaktionen von Kindern und Jugendlichen auf Menschen mit Behinderung oft sehr grob und intolerant zu sein. Die Kinder schikanieren und schüchtern die Menschen mit Behinderung ein und beschimpfen sie. Ein Direktor berichtet über Probleme mit Kindern: „Es hat einige kleinere Probleme mit Kindern aus dem Ort gegeben; sie sind auf das Grundstück gekommen und dadurch haben sich einige HausbewohnerInnen bedroht gefühlt.“ „Einige Kinder aus der Nachbarschaft haben sie geschlagen, weshalb wir nicht mehr mit ihnen reden.“ „Die Erwachsenen benehmen sich ordentlich, aber die Kinder beleidigen sie oft.“ Auch diese Person mit einer geistigen Behinderung, die alleine lebt, berichtet über Ärger mit Kindern und Jugendlichen in der Nachbarschaft. „Die Jungen von nebenan hänseln Sie? Ja, sie läuten an der Tür und laufen dann weg. Hat sich nicht irgendwer für Sie eingesetzt? Ja, doch, die HeimleiterInnen. Und was passierte dann? Die Polizei ist gekommen ...“ Auch Angehörige des Personals haben über zwischenmenschliche Probleme mit Kindern und Jugendlichen in der Umgebung berichtet. 138 „Im Großen und Ganzen ist die Interaktion zwischen den KlientInnen und den NachbarInnen gut. Aber es tauchen immer wieder Probleme auf, zum Beispiel mit Jugendgruppen im Stadtzentrum, die sich einen Spaß machen und sie beschimpfen“ (BetreuerInnen in einem Haus mit sechs Personen mit geistigen Behinderung). Sie weiß nicht, ob irgendein Nachbar auch nur einen einzigen Bewohner ihrer Einrichtung kennt. Soweit sie informiert ist, gibt es zwischen ihren KlientInnen und den NachbarInnen nur sehr wenig Kontakt. Sie haben kleinere Probleme mit den Kindern aus der Gegend, aber die Polizei schreitet bei Bedarf ein.“ (Wohnung für Menschen mit Lernschwierigkeiten (7)). Viele Probleme und Streitigkeiten, über die behinderte BewohnerInnen berichteten, unterscheiden sich nicht von den Problemen nicht behinderter NachbarInnen. Sie handeln von den ganz alltäglichen Reibereien im Zusammenleben mit anderen Menschen. „Wir streiten über die Randsteine auf unseren Äckern. Wenn wir Reibereien haben, handelt es sich um das Haus, um Reparaturen und diverse Anschaffungen.“ Ja, ab und zu diskutieren wir über Fußball. Ich mache gewöhnlich meine Scherze darüber, aber sie nehmen es ernst.“ Wie in Abschnitt II angemerkt, sind Lärmbelästigung, Umweltverschmutzung und Diskussionen während der Umbauarbeiten an der Tagesordnung. „Wenn wir streiten, ist es wegen des Hauses (Reparaturen und Renovierungen) (Person mit Behinderung, lebt in Wohngemeinschaft, (3)) „Mit unseren NachbarInnen auf der anderen Straßenseite haben wir allerdings kein gutes Verhältnis. Sie waren offensichtlich wegen des Baustellenlärms verärgert.“ Im folgenden Beispiel fanden die Menschen mit Behinderung nach einer Beschwerde 139 selbst eine Lösung: „Na ja, die ältere Dame im oberen Stockwerk beschwerte sich kürzlich, dass wir nach 23:00 Uhr duschten und sie deshalb nicht schlafen konnte. Wir dankten ihr für ihre offene Kritik und versprachen ihr, uns danach zu richten. Seither ist alles in Ordnung. Wir haben einen Wohnungsgenossen, der verrückte Musik liebt und sie kam einmal und bat uns, ein wenig leiser zu drehen. Er legte dann eine Platte mit einem alten ungarischen Sänger auf, den sie gerne mochte. Das ist aber auch alles.“ Nur einige wenige BewohnerInnen berichten über ernsthafte Probleme mit ihren NachbarInnen. Eine Aussage eines Mannes mit einer körperlichen Behinderung, der mit seiner Frau und seinen Kindern in einem Haus wohnt. „Von Zeit zu Zeit habe ich mit meinen NachbarInnen Streit. ... Mir gefällt die Art und Weise, wie die Leute mich behandeln, nicht. Gewöhnlich wird man nach dem Äußeren und nicht nach der Persönlichkeit beurteilt. Wenn mich jemand nach dem ersten Eindruck ablehnt, wird er/sie mich nach näherem Kennenlernen doch akzeptieren.“ Wir müssen berücksichtigen, dass gerade Menschen mit einer geistigen Behinderung bei sozialen Kontakten sehr verletzlich sind.27. Schwierigkeiten in der Interpretation von Zeichen oder gesprochenen Worten können ihnen schaden, wenn sie auf Menschen treffen, die sie ausnutzen möchten. Sie davor zu bewahren ist nicht leicht, weil eine Balance zwischen einem Handlungsspielraum und dem notwendigen Schutz für die Menschen mit Behinderung gefunden werden muss. Ein Angehöriger des Personals berichtet über eine Person mit einer geistigen Behinderung, die in einem geschützten Wohnprojekt lebt: „Sie plaudert regelmäßig mit den Leuten auf der Straße und geht oft in die hiesigen Lokale und schwatzt mit den Gästen. Diese Kontakte erweisen sich nicht immer als positiv, weil sie schon etliche Male beleidigt worden ist, 27 WILSON & BREWER (1992) in: LONG, K. & HOLMES, N. (2001). Unterstützung von Erwachsenen mit Lernschwierigkeiten, einen festen Platz in der Gemeinschaft einzunehmen: Bericht über eine Gruppenzusammensetzung, Entwicklung und Evaluierung. British Journal of Learning Disabilities, 29, p. 139 - 144 140 nachdem sie einige Leute, die sie im Gasthaus getroffen hat, zu Hause besuchte.“ Durch die Gruppeninterviews - befragt wurden Personen mit Behinderung, deren NachbarInnen und betreuendes Personal – erhielten wir eine gute Übersicht über die Probleme und deren Bewältigung. Die folgende Geschichte stellt anschaulich dar, wie durch Kommunikation und Schlichtung durch die BetreuerInnen Probleme gelöst werden können, obwohl es den BewohnerInnen lieber gewesen wäre, sie hätten diese Schwierigkeiten ohne die BetreuerInnen aus dem Weg räumen können. Personal! Eine Verbindung zur Gemeinschaft oder ein Hindernis? Klient: „Ein Nachbar hat sich ‘grundlos über den Lärm aufgeregt’ und sich einmal oder zweimal über die zu laute Musik beschwert.“ Klient: „Ich war peinlich berührt als dies geschah, obwohl ich die Musik wirklich zu laut aufgedreht hatte und die NachbarInnen mit dem Personal und nicht mit den BewohnerInnen selbst gesprochen haben. ... Die Beschwerde wurde bei der Hausversammlung im Heim besprochen und eine Lösung wurde gefunden. Nachbar: Der Nachbar sprach darüber, was kürzlich passierte und wie gut es war, zu erkennen, dass einer der BewohnerInnen eine ‘schlechte Zeit’ hatte und ständig seine Musik zu laut spielte. Eines Nachts war die Musik so laut, dass der Nachbar und viele Pensionsgäste aufwachten. Er diskutierte dies am nächsten Tag mit dem Hausbesitzer, dieser zeigte Verständnis für die Schwierigkeiten des Bewohners, sagte aber, dass er es sich nicht leisten könne, sein Geschäft zu verlieren, wenn die Leute über den Lärm verärgert wären. Er hatte den Eindruck, dass die Situation rasch geklärt wurde und dass auf beiden Seiten kein Groll zurückblieb, weil er den Besitzer gut kannte und mit ihm über die behinderten Menschen sprechen konnte.“ Personal: „Sie beschrieb die NachbarInnen als ‘verständnisvolle, anständige Leute”, die genug Gründe hätten, sich über den Lärm der BewohnerInnen zu beschweren, aber sie ließen sich die Beziehungen dadurch nicht zerstören. Die Angelegenheit wurde bei der Hausversammlung diskutiert und Lösungen wurden vereinbart, wie zum Beispiel die Benützung der Haupteingangstür in der Nacht. Das Personal hat mit den BewohnerInnen über die Notwendigkeit, gute Bürger und gute NachbarInnen zu sein, gesprochen und betont, dass der Respekt vor den anderen wichtig sei. Sie 141 findet, dass das Personal mit dieser Intervention eine sehr wichtige Rolle bezüglich der Verbindung zur Außenwelt gespielt hat. 142 Schlussfolgerung – Standpunkt der Menschen mit Behinderung In den Erzählungen der von uns befragten Menschen mit Behinderung wurde offensichtlich, dass sie sich ihren gewünschten Wohnort oder Wohnsitz nicht selbst aussuchen konnten, auch wenn sie mit ihrem Zuhause sehr zufrieden waren. Viele leben noch immer in einer bestimmten Einrichtung und haben keine Gelegenheit, sich eingehend über andere Möglichkeiten zu informieren. Für Menschen mit Behinderung, die in eine kleinere Einrichtung ziehen, kann es noch immer so sein, dass sie mit jemand leben müssen, mit dem sie eigentlich lieber nicht zusammen wohnen würden28. Faktum ist jedoch, dass ein gemeindeintegriertes Wohnprojekt alleine noch keine Verbesserung der Lebensumstände der Menschen mit Behinderung mit sich bringt, wenn nicht auch die Art der Unterstützung geändert wird. Haben die Menschen mit Behinderung viele Möglichkeiten, wenn es um die Wahl ihres Wohnsitzes geht? Eine ganze Reihe der von uns Befragten berichtete über eine negative Auswahl, eine Wahl, die getroffen wurde, weil es keine bessere Option gab. Viele Menschen mit Behinderung sind an die fehlenden Alternativen dermaßen gewöhnt, dass sie keine Träume mehr haben und keine Zukunftspläne schmieden. Nur einige wenige reden über ihre Wünsche für die Zukunft. Warten alle anderen nur darauf, was ihnen als nächstes offeriert wird? Trotz des Umstandes, dass die Entscheidung für den Umzug in ein kleineres Haus sehr oft für sie getroffen wird, genießen sie die dadurch gewonnene Freiheit, Entscheidungskompetenz und Privatsphäre. Als negative Aspekte eines gemeindeintegrierten Wohnkonzeptes werden noch immer Einmischung durch das Personal und die MitbewohnerInnen und andere Schwierigkeiten im Zusammenleben mit anderen genannt. Jede Evaluierung hinsichtlich einer verbesserten Privatsphäre kann auch von ihren früheren Lebensumständen abhängen. Je individueller die Hilfestellung zugeschnitten auf die Bedürfnisse des Einzelnen ist, desto besser wurde sie von den befragten Personen mit Behinderung aufgenommen, 28 CARNABY, S. (1998), Reflektionen über die Soziale Integration von Menschen mit einer geistigen Behinderung: Spielt die Interdependenz eine Rolle? Journal of Intellectual and Developmental Disability. 23 (3), p. 219-229. 143 denn dadurch wurde ihnen der Weg geebnet, Neues zu entdecken und auszuprobieren. Aber Menschen mit Behinderung stoßen immer noch auf Barrieren, wenn sie am öffentlichen Leben teilhaben wollen. Einige dieser hier beschriebenen Barrieren sind: Die Unzugänglichkeit der Gebäude Die negativen Haltungen der Mitmenschen Transportprobleme Aufgrund dieser Barrieren sind die Menschen mit Behinderung noch immer von anderen abhängig, um in ein Gebäude zu gelangen, an einen Ort ihrer Wahl zu fahren oder an gewissen Veranstaltungen teilzunehmen. Gelegentlich halten diese Barrieren die Menschen mit Behinderung davon ab, etwas Neues in Angriff zu nehmen und sie verbringen stattdessen ihre Zeit zu Hause mit dem Personal, der Familie oder anderen Menschen mit Behinderung. Trotz des gemeindeintegrierten Wohnsitzes erfuhren wir aus den Interviews, dass die KlientInnen noch immer sehr stark vom Tagesablauf in ihrer Einrichtung und vom Personal hinsichtlich ihrer Kontakte, Beziehungen und Aktivitäten abhängig sind 29. Aktivitäten, bei denen sie ihr soziales Netzwerk erweitern und auch mit nicht behinderten Personen in Kontakt treten können, fehlen oft. Obwohl viele Menschen mit Behinderung einer Beschäftigung nachgehen, spielen sich diese Tätigkeiten vor allem im geschützten Bereich ab, in dem auch die ArbeitskollegInnen und Freunde eine Behinderung haben. Es kam auch ans Tageslicht, dass viele der von uns befragten Menschen mit Behinderung noch immer ein einsames und isoliertes Leben führen, obwohl sie inmitten der Gemeinschaft wohnen und leben. Einige Menschen mit Behinderung, die wir befragten, fühlen sich anders als andere Menschen und dies aus verschiedenen Gründen. Sie machen die Beobachtung, 29 AGER, A., MYERS, F., KERR, P., MYLES, S. & GREEN, A. (2001). Umzug: Soziale Integration für Erwachsene mit einer geistigen Behinderung durch Integration in die Gemeinschaft. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 14, p. 392 – 400. 144 dass sich die Menschen in ihrer Gegenwart merkwürdig verhalten und befangen sind. Sie empfinden ihre starrenden Blicke als sehr aufdringlich. Gelegentlich wird über ungleiche Behandlung berichtet und die Menschen mit Behinderung wissen, dass sie nicht die gleichen Chancen haben wie andere. Ein großes Problem für die Menschen mit Behinderung ist auch die Tatsache, dass sie unterschätzt und nicht als Person geachtet, sondern nur aufgrund ihrer Behinderung beurteilt werden. Diese Studie hat auch für uns eine ganze Reihe von Fragen aufgeworfen. Der Fokus liegt auf folgenden Bereichen: Kann der Zugang der Menschen mit Behinderung zu allgemein zugänglichen Einrichtungen und zum ersten Arbeitsmarkt den Leuten die Angst vor dem Umgang mit Menschen mit Behinderung nehmen? Können die Leute durch regelmäßigen und informellen Kontakt mehr über Behinderungen und Fähigkeiten der Menschen mit Behinderung wissen? Über gewisse Verhaltensänderungen wurde berichtet, nicht nur bei den NachbarInnen, sondern auch bei den Menschen mit Behinderung selbst, die eine Verbesserung der nachbarschaftlichen Beziehungen beobachteten. Was die Diskriminierung betrifft, wurde auch ziemlich oft über ungleiche Behandlung durch PolizistInnen, in der öffentlichen Verwaltung und in Arbeitsfragen berichtet. Es gibt wenig Kontakt zu den NachbarInnen, obwohl sie nicht weit voneinander wohnen. Die Kontakte bleiben oberflächlich und unfreundlich. Es ist schwer zu sagen, ob wir wirklich von einer echten Akzeptanz und von ausgewogenen Beziehungen sprechen können. Neben den ersten Reaktionen der NachbarInnen auf die Eröffnung der Behinderteneinrichtung gab es nur wenige negative Rückmeldungen. Als negativ werden Beleidigungen und Schikanen durch Kinder angesehen. Andere Auseinandersetzungen unterscheiden sich nicht von den üblichen Nachbarschaftsstreitereien, wie zum Beispiel Beschwerden über Lärmbelästigung und Grundstückstreitereien. Wenn man in seiner Umgebung verwurzelt ist, steigen auch die Chancen der Menschen mit Behinderung, von ihrer Umgebung angenommen zu werden. Die 145 Familie und deren soziale Kontakte helfen der Person mit Behinderung, ein sozial inklusives Leben zu führen. Allgemeine Schlussfolgerungen Das Projekt „Toleranz oder Akzeptanz“ ermöglichte elf sozialen Dienstleistungsanbietern einen tieferen Einblick in den Integrations- und Inklusionsprozess ihrer KlientInnen, die in einer Vielzahl von unterschiedlichen gemeindeintegrierten Wohnformen bis hin zu großen Behinderteneinrichtungen leben. Durch Tiefeninterviews versuchten wir Verhinderungsmechanismen ein einer Verständnis vollen für die Integration Förderungs- und Akzeptanz oder der Menschen mit Behinderung in ihrer Nachbarschaft zu entwickeln. Wir hoffen, dass durch diese Studie, die einige dieser tief verwurzelten Konflikte und strittigen Punkte hinsichtlich des Lebens in der Gemeinde und einer vollen Integration und Inklusion scharf unter die Lupe genommen hat, die sozialen Dienstleistungsanbieter in der Lage sind, die notwendigen Schlüsselfaktoren und wesentlichen Merkmale für die Errichtung einer kleineren Gemeindeintegrierten Wohnanlage zu identifizieren. Es stimmt, dass diese Forschungsmethode mit den halboffenen Interviews mehr Fragen aufwerfen als sie Antworten zur Verfügung stellen kann. Mit diesem Projekt wollten wir die Ansichten, Meinungen und Erfahrungen der Menschen mit Behinderung in gemeindeintegrierten Wohnstätten, ihrer NachbarInnen und der Geschäftsleute und anderer Dienstleistungsanbieter untersuchen. In diesen allgemeinen Schlussfolgerungen werfen wir einen Blick auf einige Themen und Fragen, die im Zuge dieses Projektes zur Sprache gekommen sind. Was ist eine gemeindeintegrierte Wohnstätte? Es ist offensichtlich geworden, dass das Konzept einer ‘Gemeindeintegrierten Wohnstätte’ in allen in dieses Projekt involvierten Ländern eine andere Bedeutung hat. Ungeachtet dieser unterschiedlichen Auslegungen haben wir mit Erfolg eine ganze Reihe von Zielvorstellungen formuliert, die die sozialen Dienstleistungsanbieter bei der Schaffung kleinerer Wohnformen für ihre KlientInnen anstreben. Diese Zielvorstellungen wurden auch in anderen Forschungsprojekten 146 über Deinstitutionalisierung und gemeindeintegrierte Betreuung formuliert (i.e. Szivos, 1991). Szivos identifiziert sie folgendermaßen: - Ein höherer Grad an sozialer Integration oder sozialer Inklusion unserer KlientInnen in der örtlichen Bevölkerung. Dies wird definiert durch: - Beziehungen zu anderen Menschen Nutzung der örtlichen Einrichtungen Eine höhere Lebensqualität Diese wird definiert durch: einen individualisierten Unterstützungsansatz ausgedehntere Möglichkeiten zur Entwicklung von Kompetenzen Wir haben durch die Interviews jedoch beobachten können, dass die Präsenz in der Gemeinde keine Teilhabe am öffentlichen Leben garantieren kann. ‘Präsenz in der Gemeinde und mehr Chancen und Möglichkeiten können leichter erreicht werden als eine echte Teilhabe’ (Myers et al., 1998). Durch den Wechsel von großen Institutionen zu kleineren gemeindeintegrierten Wohnformen werden die sozialen Dienstleistungsanbieter auch andere relevante Faktoren identifizieren müssen, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Beziehungen mit anderen Menschen/mit den NachbarInnen Paternalistisches Verhalten und die Wahrnehmung der Menschen mit Behinderung als ewige Kinder war eines der Ergebnisse dieses Projektes. Was liegt diesem Verhalten zugrunde? Sind die herrschenden Missverständnisse über Behinderungen an sich der Grund für das paternalistische Verhalten der nicht behinderten Menschen im Umgang mit behinderten Menschen? Könnten Außenaktivitäten oder Austauschprojekte helfen, die öffentliche Wahrnehmung zu verändern? Könnten die Öffnung der Einrichtungen oder spezielle Angebote von behinderten Menschen für ihre nicht behinderten Mitmenschen helfen, den ’Schleier des Geheimnisses’ zu lüften und die Missverständnisse aus dem Weg zu räumen? Kann die Integration der Schüler und Schülerinnen zu einer toleranteren Gesellschaft führen, die unterschiedliche Menschen und Meinungen akzeptiert? 147 Welche Rolle könnten die Medien hier spielen? Wie sehr sind die Medien dafür verantwortlich zu machen, dass sich das Image der Menschen mit Behinderung nicht oder nur langsam zum Positiven ändert? Wie könnte eine positive Berichterstattung Behinderungen ins rechte Licht rücken? Wie können die europäischen, nationalen und regionalen Regierungen intervenieren, um das Bild der Menschen mit Behinderung in der Öffentlichkeit zu verbessern? Regierungen können eine Rolle spielen, indem sie spezielle Behindertengesetze verabschieden (das heißt anti-diskriminierende Gesetze), Kampagnen ins Leben rufen, die Integration durch öffentliche Verpflichtungen der behinderten Menschen vorantreiben und stereotype Darstellungen in allgemein zugänglichen Informationen und Kampagnen unterlassen. Aus den Interviews ist zu erkennen, dass es im Alltagsleben nicht ganz einfach ist, einen Menschen mit Behinderung kennenzulernen und nur in Ausnahmefällen werden aus NachbarInnen auch Freunde. Daher sind andere Treffpunkte viel wichtiger geworden, weil das Leben in der Gemeinschaft sich insofern geändert hat, als die meisten Menschen eher auf sich selbst bezogen sind und lieber die Privatsphäre in ihren eigenen vier Wänden genießen. Was können soziale Dienstleistungsanbieter tun, um die Außenwelt näher an ihre KlientInnen heranzuführen? Wären die Vorbehalte der Öffentlichkeit gegenüber einer Behinderteneinrichtung in ihrer Nachbarschaft durch eingehendere Informationen geringer gewesen? Wie können wir die Vorteile einer offenen Kommunikation mit dem Menschenrecht, das den Menschen die Wahl des Wohnortes zugesteht, in Einklang bringen? Wir erklären wir uns die Reaktionen der Nachbarschaft bezüglich der gemeindeintegrierten Wohneinrichtung im Allgemeinen und der behinderten Menschen im Besonderen? Ist das eine Kombination aus dem fehlenden Wissen über Behindertenanliegen und dem Mangel an Informationen über die Einrichtung und ihre BewohnerInnen? Wie können die sozialen Dienstleistungsanbieter diesen Problemen frühzeitig begegnen? 148 Müssen wir diese Probleme voraussehen? Aus vielen Berichten wissen wir, dass mehr Kontakte weniger Einwände bedeuten. Sollten die sozialen Dienstleistungsanbieter einfach nur einziehen und warten, bis sich die Umgebung an sie gewöhnt hat? Wie schwierig ist es überhaupt für alle neuen NachbarInnen in eine Gemeinde zu ziehen? Die lokalen Behörden sind für ein zugängliches Umfeld verantwortlich. Diese Zugänglichkeit ist für die Gemeindepräsenz der Menschen die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind und für Rollstuhlfahrer eine Voraussetzung. Die Politik muss die praktischen Auswirkungen der Anti-Diskriminierungsgesetze von einer Expertengruppe kontrollieren lassen. Dies erhöht das Bewusstsein für gesellschaftspolitische Behindertenfragen und erhöht die Zugänglichkeit zu allen politischen Gremien. Die Möglichkeit, eine Auswahl zu treffen Die Wahlmöglichkeit für Menschen mit Behinderung wird selten in Betracht gezogen. Oft werden Änderungen in einer gemeindeintegrierten Wohnstätte ohne Berücksichtigung der persönlichen Präferenzen der KlientInnen durchgeführt. Müssen die meisten sozialen Dienstleistungsanbieter die Vorlieben ihrer KlientInnen, was Gruppenzusammensetzungen oder diverse Einrichtungen betrifft, in Betracht ziehen? (Brown, 1994 in Carnaby, 1998) Das Personal in den großen Behinderteneineinrichtungen wird für den Übergang von der institutionalisierten Pflege hin zur individualisierten Unterstützung Umschulung und Unterstützung benötigen. Dies wird auch eine geänderte Einstellung und andere Betreuungsansätze erfordern. Die Führungskräfte könnten auf Widerstand stoßen, aber sie müssen in der Lage sein, dem Druck etwas entgegenzusetzen und unsichere Situationen durch realistische und machbare Lösungen zu ersetzen. Eine der wichtigsten Fragen für die sozialen Dienstleistungsanbieter wird die Frage auf mögliche Auswirkungen auf ihr Budget sein. Wie wirkt sich der Übergang auf kleinere gemeindeintegrierte Einrichtungen auf die Finanzen aus? Den Führungskräften ist sehr wohl bewusst, dass ein verstärkter individualisierter Betreuungsansatz aufgrund der fehlenden Finanzen und des Personalmangels derzeit nicht möglich ist. 149 Die Hauptverantwortung für die Verteilung der Geldmittel liegt bei den nationalen und regionalen Regierungen. Die Politik ist auch für ein Klima der Veränderung, sowohl durch eine positive Gesetzgebung, die die Menschen mit Behinderung als Teil der gesamten Bevölkerung wertschätzt, als auch durch die Bereitstellung der finanziellen Ressourcen für die notwendigen Adaptierungsmaßnahmen, verantwortlich. Die Möglichkeit, neue Fähigkeiten und Kompetenzen zu entwickeln Wie wichtig ist eine Beschäftigung, ist das Unternehmen und die Arbeitsplatzumgebung wichtig? Beschäftigung erhöht die Fähigkeiten und den Selbstwert der Menschen mit Behinderung. Beschäftigung erweitert auch ihre sozialen Kontakte. Je nach Arbeitsumgebung können diese Kontakte Menschen mit und ohne Behinderung einschließen. Trotz der Zentrumslage sind die Kontakte der Menschen mit Behinderung oft auf den Umgang mit dem Personal und auf ihre behinderten MitbewohnerInnen beschränkt und die Teilhabe an allgemeinen Aktivitäten ist eher die Ausnahme. Es sollten daher Aktivitäten abseits ihres gewohnten Umfeldes gefördert werden. Dies bezieht sich nicht nur auf Beschäftigungsmöglichkeiten, sondern auch auf andere Tages- und Freizeitaktivitäten. Eine Beschäftigung in der freien Wirtschaft würde das Bewusstsein in der Öffentlichkeit für die Menschen mit Behinderung steigern. Die Öffentlichkeit hätte ausreichend Gelegenheit, sich von der Leistungsfähigkeit der behinderten Menschen zu überzeugen. Schlussausführung Für die sozialen Dienstleistungsanbieter gibt es bezüglich der Errichtung und Leitung eines gemeindeintegrierten Wohnhauses keine vorgefertigten Antworten. Es gibt keine allgemein gültige Strategie oder Methode. Wir können jedoch die verschiedenen Themenstellungen beleuchten, nicht nur was die integrierten Wohnformen betrifft, sondern auch unser Tun und Handeln für Menschen mit Behinderung hinterfragen. 150 Checkliste für soziale Dienstleistungsanbieter Es gibt keinen Plan für die Einrichtung einer gemeindeintegrierten Wohnform, doch zum Abschluss erstellen wir eine kurze Checkliste für die sozialen Dienstleistungsanbieter und weisen auf wichtige Aspekte eines derartigen Transfers hin: Welche Faktoren können wir in verschiedenen Dienstleistungen identifizieren, die die soziale Inklusion steigern könnten? Planung des Informationsaustausches Eine Strategie vereinbaren, um sich mit den Reaktionen der NachbarInnen auseinander zu setzen. Klare Zielsetzung Die Strukturen und die Organisation den Bedürfnissen und Erfordernissen der KlientInnen anpassen Das Personal wird von den neuen Kernwerten, wie offene Kommunikation, Empowerment, Partizipation, positive Auswahlmöglichkeit, soziale Kraft und Inklusion profitieren. Unterstützung des Personals vonseiten der Einrichtung Soziale Einbettung der Einrichtung Die Wurzeln der KlientInnen berücksichtigen Verbindungen zur Öffentlichkeit durch die Nutzung der öffentlichen Einrichtungen und die Einbeziehung von lokalen Freiwilligen Unterstützung der KlientInnen bei sozialen Kontakten und neuen sozialen Rollen, um ihr soziales Netzwerk durch neue Kontakte abseits ihres Lebensumfeldes zu erweitern. Zusammenarbeit mit allgemeinen Einrichtungen und lokalen Ämtern und Behörden Etablierung einer freundlichen, zugänglicheren Umgebung als Bedingung für echte Teilhabe. Qualitätssicherung durch permanente Evaluierung der Einrichtungen 151 Evaluierungsbestrebungen oder –verpflichtungen, um die Bedürfnisse der KlientInnen abzudecken, würde ein erster Schritt in der Entwicklung eines Konzeptrahmens für soziale Dienstleistungsanbieter sein, die in Richtung Pflege- und Betreuungsdienstleistungen oder gemeindeintegrierte Wohnformen gehen möchten. Zukunftsforschung Dieses Forschungsprojekt basiert auf einer qualitativen, subjektiven Analyse der Lebensqualität von Menschen mit Behinderung in Bezug auf ihre individuelle Wohnsituation. Interessant würden Resultate aus einer objektiven, quantitativen Messung sein. Welche unterschiedlichen Informationen würden wir erhalten oder würden unsere Daten bestätigt werden? Eine nationenübergreifende Longitudinalstudie berücksichtigt die Anzahl der Jahre, die eine Person in einer integrierten Wohnstätte zubringt und würde uns aufschlussreiche Informationen über die Entwicklung der sozialen Kontakte und der Lebensqualität zur Verfügung stellen. Gleichermaßen würde eine Studie über das notwendige Kapital und die erforderlichen Einnahmen für soziale Dienstleister von Nutzen sein, um den Übergang von großen Institutionen zu kleinen integrierten Wohnstätten mit einem individualisierteren Betreuungsansatz zu schaffen. Abschließend ist zu erwähnen, dass dies eine transeuropäische Studie von sozialen Dienstleistungsanbietern war, die alle ganz unterschiedliche Meinungen vertreten. Einige Länder können schon auf die Schließung der meisten großen Institutionen zurück schauen und sind bereits aufgebrochen, neue Wege in der Entwicklung gemeindeintegrierter Wohnformen zu finden. Andere Länder stehen erst in den Startlöchern, haben wenig Erfahrung mit den neuen Entwicklungen und kämpfen noch mit Altlasten. Für sie ist die Einschätzung wichtig, wie viele Schritte sie gehen müssen, um den Herausforderungen einer echten integrierten Gesellschaft zu begegnen. Die Frage ist, ob sie ähnliche 152 Entwicklungen wie andere Länder und deren soziale Dienstleistungsanbieter durchmachen und zwangsläufig das Rad neu erfinden müssen! Wir hoffen, dass unser Projekt ‘Toleranz oder Akzeptanz’ diesen Ländern wertvolle Einblicke in den Entwicklungsverlauf einer Gemeindeintegrierten Wohnform geben wird. Wir hoffen ebenso, dass dieses Projekt ihre Ansicht bestärkt, dass Inklusion nicht einfach mithilfe einer gemeindeintegrierten Wohnform geschieht, sondern dass die Inklusion nur dann verbessert werden kann, wenn auch die sozialen Dienstleister wirklich und wahrhaftig die Strukturen ihrer Unterstützungsmethoden ändern und eine tragfähige Kommunikationsbasis zur Bevölkerung aufbauen. Wir hoffen, dass dieses Buch eine Inspiration für alle ist. 153