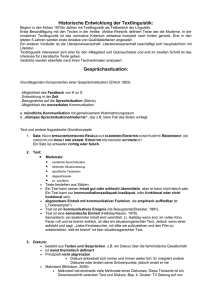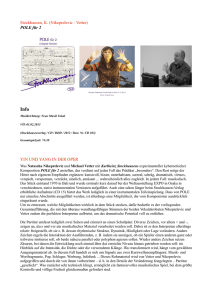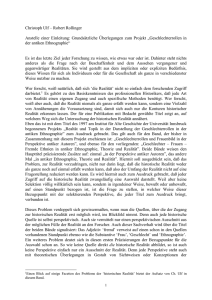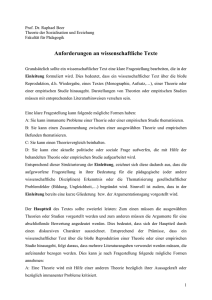Literarische Interpretationen und Interpretationstheorien
Werbung
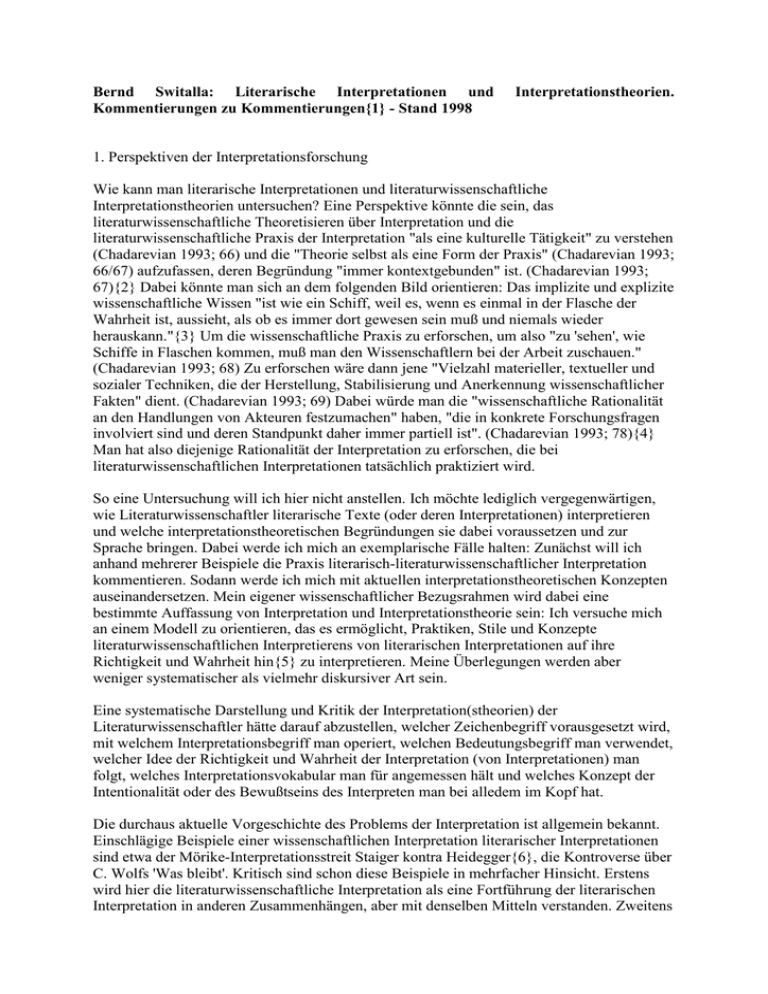
Bernd Switalla: Literarische Interpretationen und
Kommentierungen zu Kommentierungen{1} - Stand 1998
Interpretationstheorien.
1. Perspektiven der Interpretationsforschung
Wie kann man literarische Interpretationen und literaturwissenschaftliche
Interpretationstheorien untersuchen? Eine Perspektive könnte die sein, das
literaturwissenschaftliche Theoretisieren über Interpretation und die
literaturwissenschaftliche Praxis der Interpretation "als eine kulturelle Tätigkeit" zu verstehen
(Chadarevian 1993; 66) und die "Theorie selbst als eine Form der Praxis" (Chadarevian 1993;
66/67) aufzufassen, deren Begründung "immer kontextgebunden" ist. (Chadarevian 1993;
67){2} Dabei könnte man sich an dem folgenden Bild orientieren: Das implizite und explizite
wissenschaftliche Wissen "ist wie ein Schiff, weil es, wenn es einmal in der Flasche der
Wahrheit ist, aussieht, als ob es immer dort gewesen sein muß und niemals wieder
herauskann."{3} Um die wissenschaftliche Praxis zu erforschen, um also "zu 'sehen', wie
Schiffe in Flaschen kommen, muß man den Wissenschaftlern bei der Arbeit zuschauen."
(Chadarevian 1993; 68) Zu erforschen wäre dann jene "Vielzahl materieller, textueller und
sozialer Techniken, die der Herstellung, Stabilisierung und Anerkennung wissenschaftlicher
Fakten" dient. (Chadarevian 1993; 69) Dabei würde man die "wissenschaftliche Rationalität
an den Handlungen von Akteuren festzumachen" haben, "die in konkrete Forschungsfragen
involviert sind und deren Standpunkt daher immer partiell ist". (Chadarevian 1993; 78){4}
Man hat also diejenige Rationalität der Interpretation zu erforschen, die bei
literaturwissenschaftlichen Interpretationen tatsächlich praktiziert wird.
So eine Untersuchung will ich hier nicht anstellen. Ich möchte lediglich vergegenwärtigen,
wie Literaturwissenschaftler literarische Texte (oder deren Interpretationen) interpretieren
und welche interpretationstheoretischen Begründungen sie dabei voraussetzen und zur
Sprache bringen. Dabei werde ich mich an exemplarische Fälle halten: Zunächst will ich
anhand mehrerer Beispiele die Praxis literarisch-literaturwissenschaftlicher Interpretation
kommentieren. Sodann werde ich mich mit aktuellen interpretationstheoretischen Konzepten
auseinandersetzen. Mein eigener wissenschaftlicher Bezugsrahmen wird dabei eine
bestimmte Auffassung von Interpretation und Interpretationstheorie sein: Ich versuche mich
an einem Modell zu orientieren, das es ermöglicht, Praktiken, Stile und Konzepte
literaturwissenschaftlichen Interpretierens von literarischen Interpretationen auf ihre
Richtigkeit und Wahrheit hin{5} zu interpretieren. Meine Überlegungen werden aber
weniger systematischer als vielmehr diskursiver Art sein.
Eine systematische Darstellung und Kritik der Interpretation(stheorien) der
Literaturwissenschaftler hätte darauf abzustellen, welcher Zeichenbegriff vorausgesetzt wird,
mit welchem Interpretationsbegriff man operiert, welchen Bedeutungsbegriff man verwendet,
welcher Idee der Richtigkeit und Wahrheit der Interpretation (von Interpretationen) man
folgt, welches Interpretationsvokabular man für angemessen hält und welches Konzept der
Intentionalität oder des Bewußtseins des Interpreten man bei alledem im Kopf hat.
Die durchaus aktuelle Vorgeschichte des Problems der Interpretation ist allgemein bekannt.
Einschlägige Beispiele einer wissenschaftlichen Interpretation literarischer Interpretationen
sind etwa der Mörike-Interpretationsstreit Staiger kontra Heidegger{6}, die Kontroverse über
C. Wolfs 'Was bleibt'. Kritisch sind schon diese Beispiele in mehrfacher Hinsicht. Erstens
wird hier die literaturwissenschaftliche Interpretation als eine Fortführung der literarischen
Interpretation in anderen Zusammenhängen, aber mit denselben Mitteln verstanden. Zweitens
wird dabei auf textwissenschaftliches Können und Wissen kein Bezug genommen. Drittens
wird das eigene Interpretationsvokabular kaum reflektiert. Viertens wird die Perspektive, der
Standpunkt des Interpreten gegenüber dem Erzähler und den Figuren oder Personen der
Geschichten, in die er sich verstrickt findet, selten thematisiert. Fünftens wird eher en passant
auf literatur- und verstehenstheoretische Konzepte Bezug genommen, die die vorgeführte
Praxis der Interpretation in der Regel jnicht begründen, sondern rationalisieren.
Linguistische Interpretationen - man spricht dort lieber von Textanalysen - wären ebenfalls
ein einschlägiger Untersuchungsgegenstand, lassen sie doch im wesentlichen dieselben
Probleme erkennen. Auch hier ist allem Anschein nach unklar, was die Rolle des
wissenschaftlichen Interpreten ist, was alltagsweltliche Interpretationen von
wissenschaftlichen Interpretationen unterscheidet, was einen text- und
kognitionswissenschaftlich gleichermaßen plausiblen Begriff der Interpretation ausmacht{7},
in welcher Sprache (und in wessen Sprache) die Interpretation (der Spuren) sprachlicher
Äußerungen zu formulieren ist und wie die vielfach offensichtliche Diskrepanz zwischen der
deklarierten Sprachauffassung und der praktizierten Sprachauffassung zu überbrücken wäre.
Literaturwissenschaftler und Linguisten unternehmen im übrigen schon längst nicht mehr den
Versuch, auf ein gemeinsames interpretationsanalytisches Können und Wissen
zurückzugreifen - oder ein solches Können und Wissen zu erarbeiten. Vielmehr lesen
Literaturwissenschaftler - trotz aller literaturtheoretischen Innovationsbemühungen - ihre
Primärtexte nach wie vor wie Naive Hermeneuten. Und Linguisten verhalten sich, trotz aller
verstehenstheoretisch einschlägigen Erkenntnisse und Einsichten der Kognitiven
Wissenschaften, als ob der literaturtheoretische Streit über die Reichweite der Hermeneutik
für sie schlicht belanglos sei. Beide Seiten der Philologie Germanistik scheint ein Verständnis
für die Geschichte und Aktualität des Problems der Einheit der Disziplin hinsichtlich des
Verständnissen ihrer Aufgaben, Methoden und Ziele abhanden gekommen zu sein.{8}
Das gilt insbesondere für die Interpretation sprachlicher Äußerungen, sprachlicher
Ausdrücke, sprachlicher Texte. Literaturwissenschaftler rekurrieren gegenwärtig wie
selbstverständlich auf sprachtheoretisch vermeintlich durchdachte Interpretationskonzepte;
Sprachwissenschaftler ignorieren gegenwärtig eben so selbstverständlich literaturtheoretisch
motivierte Interpretationsmodelle. Sowohl die Germanistische Literaturwissenschaft als auch
die Germanistische Sprachwissenschaft haben überdies bislang durchweg wenig Interesse
daran entwickelt, ihre Praxis, ihre Methodik und ihren Begriff der Interpretation von Texten
auf dem Niveau derjenigen Interpretationstheorien zu durchdenken, das die (Sprach)Analytische Philosophie (vor allem die Tradition des Pragmatismus aktualisierend)
definiert.{9}
In beiden, inzwischen stark partialisierten und fragmentarisierten Teildisziplinen der
Germanistik besteht insbesondere eine erhebliche methodische Unsicherheit und theoretische
Unklarheit darüber, wie bei der Interpretation eine reflektierte Bezugnahme auf (literarische)
Texte herzustellen sei, was es heißen soll, einen Text wörtlich zu lesen und wann
Interpretationen treffend und richtig sind. Beide Teildisziplinen haben die Frage nach dem
Sinn und nach der Bedeutung von Interpretationen gewissermaßen eingeklammert: die
Literaturwissenschaftler, weil sie schon die Idee der Plausibiltät für anrüchig halten; die
Sprachwissenschaftler, weil sie damit nicht die geringsten Probleme haben.
Die folgenden Interpretationen literaturwissenschaftlicher Interpretationen sollen aber kein
Beitrag zur theoretischen Decouvrierung philologischer Interpretationskonzepte sein. Hier
sollen vielmehr exemplarisch ambitionierte Versuche der (literaturwissenschaftlichen) Praxis
der Interpretation literarischer Texte zum Gegenstand gemacht werden. Das Ziel soll es sein,
eingespielte Praktiken der Interpretation (von Interpretationen) literarischer Texte
verständlich zu machen. Den Gegenstand der Untersuchung bilden dabei neuere Kafka- und
Kleistinterpretationen. Vielleicht gelingt es dabei, interpretationsmethodische und theoretische Perspektiven zu entwickeln, die das offenkundig Allerselbstverständlichste des
Geschäfts der Interpretation in einem anderen Licht erscheinen lassen: die Art und Weise,
wie Literaturwissenschaftler als Interpreten - auch dann, wenn sie sich nicht nur als
literarische Interpreten betätigen - in diejenigen Geschichten verwickelt sind, zu denen sie per
Interpretation eine wie auch immer wahrgenommene reflexive Distanz zu gewinnen
versuchen. Mit eben diesem epistemischen Problem hätte jede Textwissenschaft
selbstkritisch umzugehen, wenn sie denn mehr im Sinn hat als eine intelligente,
bildungsbewußte Kommentierung derjenigen Kommentare, für die sie die literarischen Texte
selbst inzwischen durchweg zu halten scheint.
Fast gänzlich außer acht lasse ich bei meinen folgenden Erörterungen das Problem des
Wandels der Interpretationsfähigkeit und der Interpretationskunst unter den Bedingungen der
weiter fortschreitenden Technisierung der Interpretationsmedien selbst. Ich verhalte mich
also (fast) genau so, wie die Zunft der Philologen es derzeit allgemein tut. Sie scheint zu
übersehen, daß gerade auch die Informations-, Kommunikations- und Wissensmedien der
Geisteswissenschaften einer sich beschleunigenden Veränderung unterliegen, die mit
Sicherheit erhebliche Folgen für die Praxis und die Theorie der Interpretation haben
wird.{10}
2.Die Praxis der Interpretation: Exemplarische Fallstudien
2.1Erste Fallstudie: Kleist-Interpretationen
Die von D. von Wellbery{11} herausgegebenen Kleist-Interpretationen sind in
interpretationspraktischer und interpretationstheoretischer Hinsicht ein Musterbeispiel für
begriffliche, methodische und analytische Probleme. Sie sind exemplarisch für Diskrepanzen
zwischen den expliziten und den impliziten Interpretationskonzepten.
2.1.1 Altenhofers Hermeneutik{12}
Altenhofer behauptet, es gebe eine "spezifisch hermeneutische Bestimmung des
Verhältnisses von Gegenstand und interpretativem Verfahren". (Altenhofer 1995; 39)
Diejenige nämlich, nach der "die Verfahrensweise der Auslegung ihrem Gegenstand nicht wie es der klassische naturwissenschaftliche Methodenbegriff voraussetzt (sic!) - äußerlich
bleiben dürfe". (Altenhofer 1985; 39) Die historische "hermeneutische Bestimmung des
Verhältnisses" sieht er in der "Gleichzeitigkeit der Ausbildung hermeneutischer Theorie bei
Schleiermacher und postnarrativer Techniken bei Kleist" als einem "gemeinsamen
Problemhorizont". (Altenhofer 1985; 40) Damit ist für ihn der Bezugsrahmen der
Interpretation umrissen: Das Thema seiner Erörterung ist die "Frage nach den gemeinsamen
Voraussetzungen poetischer und hermeneutischer Praxis bei Kleist und Schleiermacher".
(Altenhofer 1985; 40)
Wie wie aktualisiert Altenhofer nun Schleiermacher? Schleiermacher, so Altenhofer, "hat die
Aufgabe der Hermeneutik als erkenntniskritisch kontrollierte und historisch reflektierte
Operationalisierung des Verstehens bestimmt" (Altenhofer 1985; 40): "Individuelle
Sprachhandlung und generische Bestimmtheit des Inhalts und der Form treten in ein
produktives Konfliktverhältnis, dessen Dynamik und Eigenart nur von Fall zu Fall bestimmt
werden (...) kann." (Altenhofer 1985; 41) "Schleiermachers Hermeneutik bezieht sich (...) auf
einen aus historischer Verschüttung, kollektiver Verzerrung und subjektiver Verdunkelung
durch spezielle sprachliche Rekonstruktion und interpretatorischen Entwurf erst zu
gewinnenden Sinn." (Altenhofer 1985; 43)
"Das spezifisch hermeneutische Interesse der Textinterpretation", meint Altenhofer, "läßt sich
mit Blick auf diesen Ausgangspunkt der modernen Hermeneutik genauer fassen": "Es findet
Nahrung in der Spannung zwischen Sprache als vorgegebenem System auf der einen, als
individuellem 'poetischem' Akt auf der anderen Seite". (Altenhofer 1985; 43).
"Schleiermachers hermeneutische Konzeption ist einer poetischen Praxis abgewonnen, die
den eigenen Umgang mit überlieferter Dichtungssprache, mit tradierten Formen, Motiven
und Gehalten nicht mehr im Sinne einer Annäherung an eine durch autoritative Muster als
verbindlich gesetzte Norm, sondern als souveräne Aneignung des Vorgegebenen auffaßt".
(Altenhofer 1985; 44) So gesehen paßt dann Schleiermachers "Kunst der Auslegung"
(Altenhofer 1985; 44) zum Altenhoferschen Gegenstand der Interpretation: Es "tritt der
hermeneutische Aspekt des poetischen Akts als implizite oder explizite kritischpoetologische Rückwendung des Textes auf sich selbst hervor". (Altenhofer 1985; 44). "Der
Text" ist also zu lesen "als ein kunstvolles Szenario von Frage und Sinnentwurf". (Altenhofer
1985; 45)
Wie aber liest Altenhofer nun Kleist? Programmatisch stellt er fest: "Kleists 'Erdbeben in
Chili' gehört zu diesen die Signatur der Epoche tragenden Texten. Es bietet sich auf den
ersten Blick als eine traditionell erzählte, an historisch kolorierten Handlungsdetails reiche
Geschichte dar, die mit ihrer lükenlosen Faktizität nichts 'offen' zu lassen scheint. Daß es mit
dieser gedrängten Faktizität eine eigene Bewandtnis hat, ist immer wieder bemerkt worden.
Die Schilderung der Ereignisse ist von relativierenden oder perspektivierenden Formeln wie
'es schien'oder 'es war, als ob' durchsetzt, die das Objektiv-Eindeutige der Vorgänge aus der
Sicht des Erzählers oder der handelnden Personen in Frage stellen." (Altenhofer 1985; 45)
Schon diese Feststellung enthält komplexe literarhistorische, literaturtheoretische,
erzähltheoretische und sprachanalytische Annahmen. So wird vorausgesetzt, daß
Ereignisschilderungen 'an sich' vielleicht auf 'Faktizität', auf 'das Objektiv-Eindeutige'
abstellen, daß hier allerdings eben diese 'Faktizität' reflexiv 'in Frage gestellt' sei. Es wird
vorausgesetzt, daß es Sinn mache, zwischen der "Ebene der dargestellten Fakten" und "der
ihrer narrativen Präsentation" zu unterscheiden. (Altenhofer 1985; 48) Es wird auf
selbstverständliches literarhistorisches Wissen über Erzählweisen und Erzählmuster
vergleichend und wertend Bezug genommen. Dabei wird überdies ein bestimmtes
Epochenverständnis ins Spiel gebracht: Die Kleistsche Geschichte trage die
Schleiermachersche 'Signatur der Epoche', der Text indiziere sie nachgerade.
In dieser Hinsicht soll insbesondere Kleists Gebrauch des Konjunktiv II aufschlußreich sein als ein 'relativierender', ein 'perspektivierender': "In der Bewertung der Ereignisse durch die
Personen schieben sich ambivalente Urteile oder Gefühlsreaktionen so sehr vor das Ereignis
selbst, daß dieses innerhalb der Konstruktion der Erzählung - also nicht nur in der Erfahrung
der fiktiven Gestalten, sondern auch in der Perspektive des Lesers Rätselcharakter
gewinnen." (Altenhofer 1985; 45) Aufschlußreich erscheint Altenhofer also die
Erzählperspektive des Erzählers selbst. Sie virtualisiere die Wahrnehmungsweisen der
Figuren gewissermaßen. Altenhofer stellt fest: "Ambivalenzen des Fühlens und der
Sinngebung, deren Zuordnung zu einem Subjekt durch die fließenden Übergänge zwischen
Erzählerkommentar und erlebter Rede oft zusätzlich erschwert wird, reichen bis ins szenische
und körpersprachliche Detail hinein". (Altenhofer 1985; 46) "Kleist verfolgt eine
Erzählstrategie, die gerade das faktisch gesichert oder traditionell verbürgt Scheinende ins
Zwielicht rückt". (Altenhofer 1985; 46) Der Text Kleists zeige, kurz gesagt, eben jene "stets
mit dem Vorbehalt des Scheinhaften, des 'Als ob' versehene Form 'gleitender' Sinngebung",
die Schleiermacher epochal auf den Begriff gebracht habe. Das 'Erdbeben in Chili' stehe für
den (nur) scheinbaren "Einsturz der alten Ordnung", der "Macht des Bestehenden", zum
Beispiel und vor allem "in der äußerlichen Form institutionalisierter Gewalt und
gesellschaftlicher Konvention" (Altenhofer 1985; 47); das Erdbeben symbolisiert eine
"Naturkatastrophe", die "revolutionäre Qualität" hat. "Alle Souveränität erzählerischer
Strategie wird aufgeboten, um zu demonstrieren, daß inmitten scheinbar gesicherten Wissens
und konventioneller Verständigung über das, 'was ist', das Rätsel beginnt." (Altenhofer 1985;
48) "Rätselhaft ist Kleists Erdbeben nicht als faktisches, sondern als hermeneutisches
Ereignis, nicht in seiner die sichtbaren Dinge verrückenden oder zerstörenden, sondern in
seiner die Zeichen verschiebenden oder verkehrenden Qualität." (Altenhofer 1985; 48) "Die
Kleistsche Erzählung folgt einem neuen Muster individualisierter und perspektivierter
Erfahrung, die nicht mehr nur eine Geschichte, sondern viele interferierende Geschichten zu
erzählen weiß." (Altenhofer 1985; 51) Der "Text" werde "zur Mimesis der Rätselhaftigkeit
des Lebens, der Undurchschaubarkeit der Welt" (usw.), weil die Welt "selbst die Form eines
unverständlichen Textes angenommen hat". (Altenhofer 1985; 52) "Der Text als Rätsel, das
Leben als unverständliches Buch, die Auslegung als unendliche Aufgabe: In diesem
Problembewußtsein treffen sich der Schriftsteller Kleist und der Hermeneut Schleiermacher."
(Altenhofer 1985; 53)
Die Plausibilität dieser die gesamte Interpretation tragenden Behauptung hängt
selbstverständlich von der Reichweite der hermeneutischen Historisierung ab. Denn das vom
Interpreten wahrgenommene sozial- und gesellschaftsgeschichtliche Panorama der Kleistund Schleiermacher-Epoche bildet den Interpretationshintergrund. Teilt man Altenhofers
geistesgeschichtliche Wahrnehmung, dann mag es naheliegen, Kleists Erzählung als
Exemplifizierung der Hermeneutik Schleiermachers hermeneutisch zu lesen. Was aber
spricht dafür, eine Aktualisierung der Hermeneutik Schleiermachers zum theoretischen
Bezugsrahmen der eigenen Interpretation zu machen?
Erst recht dann, wenn dabei ein elementares Problem der wissenschaftlichen Interpretation
literarischer Texte schlicht übersehen wird: das Problem der wörtlichen Bezugnahme auf den
Wortlaut des Textes. Wie versteht Altenhofer die sprachliche Bezugnahme auf den Text? Da
werden Textauszüge einerseits so zitiert, als ob der Interpret die Sprache des Erzählers
spräche und die Perspektive des Erzählers teilte. Es werden Sätze des Erzählers so gelesen
und interpretiert, als ob es sich um Exemplifizierungen von Berichtssätzen des Interpreten
handelte. Wenn man so verfährt, dann verschwimmen aber die Unterschiede zwischen der
Welt des Textes und der Welt des Interpreten. Andererseits wird bei der Erzählanalyse
nachgerade antihermeneutisch mit grammatischen Aspekten des Textes umgegangen.
Grammatische Sachverhalte werden nämlich dargestellt und gedeutet, als ob sie
interpretationsunabhängig beschrieben werden könnten. Zum Beispiel werden der Gebrauch
des Konj II, der Gebrauch der Temporalkonjunktion 'als' und die Verwendung des
wahrnehmungsperspektivierenden Ausdrucks 'es schien (so), als ob...' nicht kontextsensitiv,
sondern regelwissensfixiert beschrieben.
2.1.2 Kittlers Diskursanalyse{13}
Kittler grenzt seine 'Diskursanalyse' gegen die aus seiner Sicht übliche literarischliteraturwissenschaftliche Interpretationspraxis ab. Was tut die Literaturwissenschaft
üblicherweise? Sie versuche im allgemeinen, "den schweigenden Text dadurch zum Sprechen
zu bringen, daß sie ihm einen nie verlauteten, aber unaufhörlichen Diskurs des Autors
unterlegt, den sie selbst dann ausschreiben kann". "Diese Versuchung hat historische Gründe.
Im Zeitalter der Bildung ist die Funktion 'Autor' tatsächlich zum bestimmenden Jenseits von
Literatur geworden." (Kittler 1985; 25) Also will die gewöhnliche Literaturwissenschaft noch
immer der Bildungsintention des literarischen Autors noch immer auf die Spur kommen? Das
wäre nicht nur anachronistisch: "Niemand weiß, was der Schreiber beim Schreiben dachte
oder meinte; niemand weiß, was er bei der Drucklegung dachte oder meinte." (Kittler 1985;
26) Die gängige Literaturwissenschaft schreibt also nur die "grundlegenden
Vernetzungsregeln klassisch-romantischer Dichtung" (gerade im Falle Kleists ganz und gar
unangemessen) fort. (Kittler 1985; 27) Sie reproduziert weitere "Deutungsmuster von der
Beliebigkeit aller Hermeneutiken". (Kittler 1985; 31) Kurz - sie erliegt der Fiktion, "die
Referenz von Diskursen" sei eine "Sache der Sprechermeinungen oder Redebedeutungen".
(Kittler 1985; 32) Eben so werde sie aber Kleist nicht gerecht: "Statt ein gebildetes Publikum
dadurch zu bilden, daß Stimmen am Textrand selber alle beschriebenen Ereignisse mit
psychologischer oder philosophischer Bildung ausdeuten, gibt Kleist gerade umgekehrt
Rätsel auf." (Kittler 1985; 27)
Es ist also die Intentionalitätsunterstellung des Interpreten anscheinend nicht mehr
gerechtfertigt. Aber kann der Interpret tatsächlich darauf verzichten, dem Autor, dem
Erzähler oder dem Text eine Erzählintention zu unterstellen? Kittler spielt die Praxis auch des
diskursanalytisch verfahrenden Literaturwissenschaftlers herunter: Jeder Interpret spielt
notwendigerweise die Rolle einer Person, die zu wissen meint, was der Text sagt und was er
soll. Nur auf der Basis des eigenen Verständnisses des Textes lassen sich ja erst jene
diskursiven Vernetzungen dar- bzw. herstellen, an denen Kittler interessiert ist. Kann also der
Diskursanalytiker die elementaren hermeneutischen Operationen überspringen, die Kittler der
üblichen Literaturwissenschaft als gedankenloses Interpretieren unterstellt? Kann sich der
Literaturwissenschaftler zum Nicht-Leser stilisieren?
Kittler meint: "Diskursanalysen dagegen brauchen nicht zu deuten." "Über die Effekte von
Texten haben andere und synchrone Diskurse, die mit ihnen vernetzt gewesen sind, schon
längst entschieden." (Kittler 1985; 38) "Man braucht nur gegen den Strich zu lesen." (Kittler
1985; 36) Und dann "setzt" "der Novellentext" nurmehr eine pädagogische Utopie "in Szene"
(Kittler 1985; 31); denn er verdankt sich selbst "einem Dispositiv von Diskursen" (Kittler
1985; 37): "Ein entlassener preußischer Offizier (...) entwickelt unter Bedingungen und
Masken des Bildungssystems die Diskurspraxis des Partisanen." (Kittler 1985; 37) Der
Diskursanalytiker liest also verschiedene literarische Texte als Dokumente einer 'diskursiven'
gesellschaftlichen Praxis; im Falle von Kleists 'Erdbeben in Chili' eben als Fragmente aus
dem "Diskurs deutscher Bildung". (Kittler 1985; 29) Eben diese Lektüre erzeugt die
thematische Relevanz und inhaltliche Kohärenz der Texte, um die es geht. Aber so
ontologisiert und reifiziert der Diskursanalytiker jene 'Vernetzungen', die er als Interpret der
Interpretationen herstellt, indem er sie darstellt.
Kittlers eigene differenzierte Interpretationen widersprechen aber der programmatischen
Behauptung, "Diskursanalysen (...) brauchen nicht zu deuten". (Kittler 1985; 38) Sie sind der
Beweis dafür, in welchem Maße und auf welche Weise die Lektüre der Texte als Dokumente
diskursiver Dispositive vom kulturellen, historischen, textreflexiven und text- wie
sprachanalytischen Wissen des gebildeten Lesers abhängt. Das 'Dispositiv' des 'Diskurses',
die thematische 'Vernetzung' mit denjenigen "Daten, die am Rand oder jenseits des
Einzeltextes stehen" (Kittler 1985; 24), ist das Produkt einer Interpretation, die der Interpret
mit einer tiefenhermeneutischen Attitüde über die Texte legt, ohne die Textsorten und
Medien zu unterscheiden.
Mit einer Diskursanalyse im Stile Kittlers ignoriert man übrigens auch ästhetische Aspekte
der Interpretation literarischer Texte. An literarischen Geschichten interessiert, was sie im
weiteren Kontext kultureller Diskurse lesenswert macht. So läßt sich zum Beispiel die
thematische Nähe des 'deutschen Bildungsdiskurses' zum 'Pädagogischen Diskurs' "aus der
Feder einer Bremer Mädchenschullehrerin" (Kittler 1985; 30) konstruieren: "Kind - Mutter Gatte: so und nicht anders läuft in spieltheoretischer Exaktheit die Rangfolge der Prioritäten,
die den Diskurs deutscher Bildung regelt." (Kittler 1985; 29) Geht so eine Diskursanalyse,
die eine Alternative zur "Beliebigkeit aller Hermeneutiken" sein soll?
2.2 Zweite Fallstudie: Kafka-Interpretationen{14}
2.2.0 Die Lehrbarkeit literaturwissenschaftlicher Interpretationen
Die "Frage nach Lese- und Analysegewohnheiten von Germanisten und Lehrern" thematisiert
1994 anläßlich des Erscheinens von zwei weiteren Büchern über und mit KafkaInterpretationen der Literaturdidaktiker K.-H. Fingerhut.{15} Fingerhut kommentiert KafkaInterpretationen von Binder (1993{16}) und in Bogdal (1993{17}). Die Intention der
Interpretationen sei es, so stellt er fest, "an 'Vor dem Gesetz' die Regeln und Grenzen der
Interpretierbarkeit ausschreiten" zu wollen. (Fingerhut 1994; 50)
Fingerhut interpretiert also seinerseits Interpretationen. Die Art und Weise, auf die er es tut,
exemplifiziert aktuelle interpretationstheoretische Probleme der Literaturwissenschaft.
Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang sein kritisches Referat von Binder. Binder stoße
bei seiner Analyse und Kritik von Kafka-Interpretationen "immer wieder auf affirmative
Regelkreise": In die literarischen Erzählungen werde "ein in sich geschlossenes gedankliches
Konzept, eben die erschlossene 'Bedeutung'" 'hineingedeutet'. Dabei verführen die Interpreten
- so wird Binder referiert - "nach Maßgabe ihrer theoretischen Vorentscheidungen, nicht aber
nach Maßgabe der Textbefunde". Kurz (und mit Binder übereinstimmend): "In jedem Falle
aber sind die Deutungen eindeutiger, überschaubarer, geordneter als der Text. Dessen
Widersprüchlichkeiten sind überall zugunsten der Deutungen eingeebnet." (Fingerhut 1994;
51) Im Unterschied zur für ihn verstehens- und texttheoretisch aufgeklärteren
"Rezeptionstheorie" macht die "Hermeneutik" nurmehr den Versuch herauszufinden, "was
Kafka 'eigentlich sagen' wollte", orientiert an der Unterscheidung "zwischen dem richtigen
Auffassen umd dem Mißverstehen einer Textbotschaft". Dabei mißverstehe sie die "Aufgabe
der philologisch fundierten Wissenschaften" als "die Suche nach dem Sinn des Textes"
(Fingerhut 1994; 51). Das gelte auch für Binder: "Binder hält (...) an der Auslegbarkeit und
dem Postulat des analytisch gewonnenen, wissenschaftlich nachprüfbaren 'richtigen'
Verstehens fest" (Fingerhut 1994; 52), wenn er "eine formale Textanalyse" (Fingerhut 1994;
51) praktiziere, die eine "Methode", die "ein minutiöses Lesen", "eine genaue Überprüfung
der Text-Logik", "eine manchmal ins Detail gehende Diskussion einzelner begrifflicher
Doppeldeutigkeiten" und "eine Prüfung des Handschriftenbefunds" einschließt und auf die
"Form" (etwa die "Erzählperspektive") und die "Figuren" abstellt und ihre "Zielpunkte" in
der "Frage nach dem Sinn des Textes" und in der "Einbettung des Geschichte in den
biographischen Hintergrund" hat. (Fingerhut 1994; 52) Binder habe die "Entwicklung der
Sprachphilosophie" und die "Diskussion um Moderne und Postmoderne, um
Konstruktivismus und Dekonstruktivismus" nicht mitbekommen (Fingerhut 1994; 52). Jene
'Sprachphilosophie' nämlich, die die Autoren des von Bogdal herausgegebenen KafkaInterpretationen-Bandes nach Fingerhuts Eindruck durchaus akzeptiert zu haben scheinen:
"die Überzeugung, daß sprachliche Zeichen keine Referenzbezüge auf eine
texttranszendierende Realität haben, sondern durch das Netz der Textbezüge - textintern oder
intertextuell definiert - bestimmt werden", "daß 'Sinn' oder 'Bedeutungen' in den Texten nicht
abgelegt und wieder heraufgerufen werden können, sondern jeweils neu konstituiert werden
müssen". (Fingerhut 1994; 53) "Bedeutungskonstruktion" und "Referenz-Rekonstruktion"
(Fingerhut 1994; 54) seien eben Aktivitäten des Lesers.
Was qualifiziert für Fingerhut "Lektüren" eines literarischen Textes? Nichts anderes als deren
"Kreativitäts- und Innovationspotential", soweit es nicht bloß darum geht, "die eigene
Lektüre gegenüber anderen Lektüren zur Geltung zu bringen". (Fingerhut 1994; 54)
Innovativ und kreativ seien Interpretationen (so will Fingerhut wohl verstanden werden)
gerade dann, wenn "unter der Hand nicht nur die literaturtheoretischen Prämissen als
Schlüssel zu Kafka, sondern umgekehrt, auch Kafka als Schlüssel zu Derrida, Deleuze oder
Foucault genutzt wird" (Fingerhut 1994; 54).
Fingerhuts didaktische Quintessenz ist diese: Angesichts der "verwirrenden Gesamtsituation
der aktuellen wissenschaftlichen und schulischen Interpretationskultur" (Fingerhut 1994; 50)
bleibe dem Didaktiker nur "der intelligente und interessierte Eklektizismus", "der die
vorgestellten Methoden praktisch in Gebrauch nimmt, um etwas pädagogisch Sinnvolles (...)
damit anzustellen"; "z.B. die Aufklärung der Schüler über Machtverhältnisse". (Fingerhut
1994; 55)
Nun wird aber die Verwirrung durch eine interpretationskritische Bilanz eher gesteigert,
wenn unklare Begriffe im Spiel sind. Unklar ist zum Beispiel, worin die Bezugnahme auf
einen literarischen Text besteht: Was zum Beispiel macht Textbefunde aus? Unklar ist auch,
wie der Sinn und die Bedeutung eines literarischen Textes hergestellt wird: Worin besteht die
Sinn- und Bedeutungsherstellung durch den Leser? Unklar ist überdies, wie man sich
sprachliche Zeichen vorzustellen habt, die nichts weiter repräsentieren als ihre Verweisung
auf andere Zeichen: Wie soll dann über die Angemessenheit der Interpretationen entschieden
werden? Unklar ist insbesondere, inwieweit es eine kreative und innovative Theorie der
Interpretation ausmacht, den literarischen Text wie eine Exemplifizierung einer
Interpretationstheorie zu lesen: Was wäre die Rationalität einer solchen
Interpretationstheorie? Fingerhuts kritische Kommentierung aktueller Kafka-Interpretationen
pointiert eben jene Probleme, die zur Zeit die literaturwissenschaftliche Debatte über
Interpretation bestimmen.
2.2.1Bogdals Kafka-Interpretation; oder: Wie man Loriot als Variation über ein Thema von
Kafka lesen kann{18}
Bogdal geht bei seiner Kafka-Interpretation von der Einschätzung aus, daß der literarische
Text der Moderne kein "Teil einer homogenen Kultur" mehr sei, "die in ihrer Totalität als
sinnhafter Prozeß verläuft"; die "substantiierbare Sinnhaftigkeit und die Homogenität der
Kultur" sei eine Fiktion. (Bogdal 1993; 48) Eben dem habe die Interpretation zu entsprechen:
"Die postmoderne Vorgehensweise läßt eine Topographie entstehen, die man mit einem ihrer
strategischen Begriffe als 'Vernetzung' bezeichnen kann. Sie durchzieht den Text mit einer
Serie unterschiedlicher Linien, die Oppositionen, Brüche, Differenzen, Verkettungen,
Similaritäten, Dominanzen usw. sichtbar werden lassen." (Bogdal 1993; 49) "Eine historische
Diskursanalyse könnte einen Ausweg aus den Aporien der beiden Erkenntnismodelle
weisen." (Bogdal 1993; 49) Historische Diskursanalyse als Alternative zur hermeneutischen
Interpretation und zur postmodernen Kommentierung?
Zunächst die Programmatik: Es komme darauf an, "den Begriff der Interpretation von jenen
hermeneutischen Prämissen zu lösen, die zu einer Verdoppelung und Wiederholung der
Texte führen". (Bogdal 1993; 49) Zu konstatieren sei zunächst "die kontinuierliche Wirkung
eines intentionalen, referentiellen Bedeutungsbegriffs, der sowohl gesellschaftlichen bzw.
individuellen Sinnstiftungen und Repräsentationen 'im Werk' als auch Verstehensprozessen
zugrunde liegt", die "Erfahrung von Sinnhaftigkeit". (Bogdal 1993; 49) Doch: "Die Aufgaben
der Wissenschaft von der Literatur reichen jedoch über die Repräsentation kulturellen
Alltagswissens hinaus." (Bogdal 1993; 50) "Was sie leisten kann, ist die Analyse der
historischen Konstituierungsbedingungen von Sinn und Repräsentation." (Bogdal 1993; 50)
Wie hat sie zu verfahren? Sie werde "sich auf das Wechselspiel zwischen der Rekonstruktion
und dem Verstehen kulturell 'gelebten' Sinns und seiner Destruktion einstellen müssen." Das
heiße: "Jede Literaturwissenschaft" müsse "sich mit anderen Worten ästhetisch und
wissenschaftlich verhalten." (Bogdal 1993; 50) Die "ästhetische Verhaltensweise" sei im
Sinne von Adorno dabei die, "'mehr an den Dingen wahrzunehmen, als sie sind'".{19}
"Interpretation" sei also "das Zur-Sprache-Bringen dieser Wahrnehmung." (Bogdal 1993; 50)
"'Interpretation' jenseits hermeneutischer Illusionen": sie sei das Programm. (Bogdal 1993;
50)
Diese "Wissenschaft von der Literatur" bestehe dabei in zweierlei: Erstens sei sie
"symptomale Lektüre" (Bogdal 1993; 50), zweitens "historische Diskursanalyse". (Bogdal
1993; 51) Zum einen sei "Literatur im Blick auf ihre Sinneffekte und
Repräsentationsfunktionen für kollektive bzw. individuelle Subjekte im kulturellen Feld" zu
erschließen (Bogdal 1993; 50); mit dem "positiven Befund" "der bewußten und unbewußten,
intendierten und verschwiegenen, automatisierten und singulären usw. Bedeutungen der
Texte und dem Verhältnis der 'Subjekte' zu ihnen". (Bogdal 1993; 51) 'Symptomale Lektüre'
also als Art Tiefenhermeneutik vom Standpunkt des allwissenden oder wenigstens Vieles
wissenden intentionalen Subjekts aus?{20} Zum anderen sei wissenschaftliche
Literaturanalyse die "Aufdeckung jener (materiellen, struktuellen) Prozesse", "die
grundlegender sind als das Schreiben und die Herstellung von 'Bedeutung'". (Bogdal 1993;
51)
Entspricht Bogdals metaphernreich konnotierte literaturwissenschaftliche Praxis dem
selbstgesetzten Anspruch? Sie besteht dem Konzept nach "in einem historischen Vergleich
von Texten unterschiedlichen kulturellen Prestiges (...), die trotz eines differenten Dispositivs
eine analoge Grundsituation wie Kafkas Roman zur Sprache bringen". (Bogdal 1993; 51)
Eine 'historische Diskursanalyse' hat also die Aufgabe zu zeigen, wie unterschiedliche Texte
ein und dieselbe 'anthropologische' 'Grundsituation' exemplifizieren. Vor dem Hintergrund
des Foucaultschen Diskurses von Wissen und Macht, von Wahrheit und Gesetz kann sie
literarische Texte als paradigmatische historisch-anthropologische Situationen durchsichtig
zu machen versuchen. Und der eigene Umgang mit dem Text? Historische Diskursanalyse
vergegenwärtigt den "Prozeß der Selbstdisziplinierung der bürgerlichen Gesellschaft".
(Bogdal 1993; 54) Sie zeigt, zum Beispiel, wie ein zeitgenössischer Medientext "bei näherer
Betrachtung" als Darstellung einer "Szene kafkaesken Zuschnitts" wahrgenommen werden
kann, und weist damit nach, daß "das Gerät die Kommunikation der Individuen" "zerstört".
(Bogdal 1993; 55) Loriots pseudodialogische Texte kann man dabei wahrnehmen als ein
"satirisches Seitenstück zu Kafkas Parabel". Es sieht dann so aus, als führe Loriot vor, "daß
auch im familiären Alltag die 'Herrschaft des Signifikanten' angebrochen ist". (Bogdal 1993;
56) Die textvergleichende diskursive Lektüre läßt ein und dieselbe Grundkonstellation
erkennen. Vorausgesetzt, man versteht sich darauf, typologisch und historisch verschiedene
Texte so zu lesen, daß man sie in ihnen wiedererkennen kann.
Aber wie vollzieht sich das Wiedererkennen? Bogdals textanalytische Aussagen und Urteile
lesen sich zum Beispiel so: "Nicht nur, daß <Kafka> die referentiellen Beziehungen seiner
Aussagen in der beschriebenen Weise verwischt, auch die Positionen der Aussagenden
wechseln genau wie der Status ihrer Aussagen ständig." Sie enthalten aber nichts weiter als
grobe Kennzeichnungen der Erzählstruktur in Foucault immitierender spekulativer Absicht.
(Bogdal 1993; 58ff) Eine zentrale textanalytische Behauptung lautet: "Was Kafka 'Gesetz'
nennt, regiert demnach nicht nur den Text, sondern auch das Schreiben Kafkas selbst, der
sich seines Ortes im Realen, seiner Aussageposition und seines Status' nicht mehr gewiß ist."
(Bogdal 1993; 57): sie bedeutet aber nichts anderes als eine kühne Gleichsetzung des
unterstellten poetischen Gehalts der Erzählung mit der unterstellten Poetologie des Erzählers
Kafka. Kafka, so sollen wir lernen, sei der Autor, der "sich kulturell nicht positiv zu
repäsentieren" vermag, der "in einer dekonstruktiven, aber nicht destruktiven Bewegung
Literatur als 'gesetzlose' Gegenwelt und Rückzugsort zur Selbstverwirklichung angezweifelt"
hat. (Bogdal 1993; 57) Noch einsinniger kann man, entgegen dem eigenen
Interpretationsprogramm, wohl kaum auf eine zentrale 'dichterische Aussage' abstellen.
Der Versuch einer Kafka-Lektüre über Foucalts Verständnis vom sog. Wissen-MachtDiskurs als "umfassenderes Dispositiv der Moderne nach 1900" (Bogdal 1993; 60) soll am
Ende gezeigt haben: "Singularität und epochale Repräsentation, diese Grundbedingungen
moderner Autorschaft, sind vom Individuum nicht mehr zu realisieren." (Bogdal 1993;
60/61) Diese historische Diskursanalyse verkürzt aber Kafkas Erzähl-Kunst auf nachmoderne erzählte Erzähl-Reflexion. Sie reflektiert nicht die Art und Weise, die Form der
Bewegung der ästhetischen Wahrnehmung, die der Text Kafkas bei Interpreten auslöst. Sie
operiert vielmehr mit Versatzstücken literarisch-historischen Wissens, die sich in ein aus dem
Text herausgelesenes, ein in den Text hineingelesenes Bild moderner Befindlichkeit
einpassen lassen.
Sie ist aber nicht nur deswegen interpretationstheoretisch heikel: Es hat sich anscheinend
eingespielt, sich mit plakativen Vereinfachungen von denjenigen Interpretationskonzepten
abzusetzen, die nicht mehr zeitgemäß erscheinen. Der praktischen Hermeneutik Altenhofers
beispielsweise{21} entspricht das Bild, das Bogdal von der Hermeneutik zeichnet,
mitnichten. Programmatische Abgrenzung von der vermeintlichen uniformen Hermeneutik
ohne Reflexion der eigenen impliziten Hermeneutik scheint überhaupt die Maxime zu sein,
der die 'anderen' Interpretationsprojekte (nicht nur im Falle Kafka) folgen. Das gilt auch für
Wittes Kafka-Interpretation.
2.2.2Wittes Kafka-Interpretation; oder: der Kommentar zum literarischen Text als Alternative
zur hermeneutischen Auslegung des Textes?{22}
Witte interpretiert Kafkas Parabel 'Vor dem Gesetz' seinem eigenen Verständnis nach auf
zweierlei Weise: Zunächst spielt er in mehreren Schritten eine "hermeneutische Auslegung"
(Witte 1993; 105) des Textes durch; dann "eine andere Lektüreweise" (Witte 1993; 107),
nämlich "die des Kommentars" (Witte 1993; 108). "Hermeneutische Auslegung", so
resümiert Witte den ersten Teil seiner Kafka-Exegese, "individualisiert den Text, macht ihn
auf seine menschlichen Züge hin durchsichtig. Tendenziell verwandelt sie ihn selber in ein
Individuum mit einer gleichsam unverwechselbaren Physiognomie. Diese Eigentümlichkeit
hat ihren Ursprung in der Tatsache, daß hermeneutisches Interpretieren sich auf das
autonome Kunstwerk als seinen eigentlichen Gegenstand bezieht. Dessen kanonisches
Vorbild aber ist in der Ästhetik der Goethezeit die klassische griechische Statue." (Witte
1993; 105) Die "andere Lektüreweise" (Witte 1993; 107), eben "die des Kommentars" (Witte
1993; 108), geht dann so: "Während das hermeneutische Verfahren das autonome Kunstwerk
und das 'interesselose Wohlgefallen' des Rezipienten an ihm voraussetzt, den Text also
gleichsam als Naturprodukt begreift, macht der Kommentar sichtbar, daß jeder Text
interessegeleitet, also das Ergebnis von historischen Entscheidungen ist, denen der neue Text,
der Kommentar, weitere Entscheidungen hinzufügt. Er versteht den Text also als einen
Prozeß, in dem der gegenwärtige Schreiber sich mit historisch getroffenen Entscheidungen
auseinandersetzt und dadurch zu seiner eigenen, das heißt, einer neuen Sicht der Dinge
gelangt." (Witte 1993; 109) "Eine Totalität der Bedeutungen, wie sie die hermeneutische
Auslegung intendiert", könne der Kommentar "nur im Durchgang durch alle überhaupt
möglichen Kommentare erreichen. Das heißt, die Arbeit des Kommentierens ist virtuell
unabschließbar." (Witte 1993; 109)
Worin besteht, wenn man Witte folgt, die übliche hermeneutische Auslegung? Sie "bestimmt
die Bedeutung der einzelnen Worte aus dem Kontext, in dem sie stehen, und die des
Gesamttextes durch die einzelnen Worte, aus denen er gebildet ist. So zwischen dem Ganzen
und seinen Teilen hin- und hergehend, sucht sie einen Sinn zu etablieren, der durchaus einen
gewissen Eindeutigkeits- und Wahrheitsanspruch stellt." (Witte 1993; 94) Der Kommentar
hingegen nehme die "Widersprüche" der Interpretationen ausdrücklich an. Das nachgerade
"antihermeneutische Prinzip des Kommentars" sei es, was der Geistliche den
Interpretationsversuchen des Joseph K. in der Erzählung selbst entgegenhalte: "'Richtiges
Auffassen einer Sache und Mißverstehn der gleichen Sache schließen einander nicht
vollständig aus.' Im Kontinuum der aufeinanderfolgenden Kommentare ist jeder ein Teil der
richtigen Auffassung und zugleich ein Mißverständnis, das durch den nächsten Kommentar
aufgehoben werden muß." (Witte 1993; 110) Mit anderen Worten: Während die
hermeneutische Interpretation des Textes das bedeutungsvolle Ganze des Textes bereits
voraussetze, ziele der Kommentar demgegenüber darauf ab, dem Text, näherhin: der
Schriftgestalt des Textes (Witte 1993; 112), durch eine "jeweils individuelle
Kommentierung" (Witte 1993; 112) Bedeutung erst zuzusprechen. Das bedeute, "daß nach
Auffassung der Sprache als Schrift Wahrheit nicht durch hermeneutische Anstrengung aus
einem vorhandenen Text gelesen werden kann". "Wahrheit erweist sich vielmehr als
geschichtliche Entfaltung dessen, was im Ursprungstext gegeben, aber nicht vorhanden ist."
"Der Ort ihrer Entfaltung ist das Kontinuum der jeweils individuellen Kommentare." (Witte
1993; 113) Kurz: Die Bedeutung, der Sinn, die Wahrheit literarischer Texte sei das Ergebnis
ihrer kontinuierlichen Interpretation. Eben weil die 'kommentierende Lektüreweise' die
Bedeutung, den Sinn, die Wahrheit des literarischen Textes nicht voraussetze, sondern
herstelle, seien die von der Interpretation am literarischen Text aufgedeckten oder entdeckten
'Widersprüche', 'Ambiguitäten', 'Paradoxien' genau das, was den Prozeß des Interpretierens,
die Geschichte des Kommentierens weitertreibe. Wie gesagt: "Im Kontinuum der
aufeinanderfolgenden Kommentare ist jeder ein Teil der richtigen Auffassung und zugleich
ein Mißverständnis, das durch den nächsten Kommentar aufgehoben werden muß." (Witte
1993; 110)
Selbstverständlich besonders gerade dann, wenn, so Witte, "Bruch, Fragment, Widerspruch
als Möglichkeiten ästhetischer Praxis" (Witte 1993; 106) bereits im zu interpretierenden Text
angelegt und reflexiv artikuliert sind. Denn es sei ja "die Türhüterlegende auch eine Parabel
über den Vollzug des kommentierenden Schreibens" selbst. (Witte 1993; 110) Der
literarische Text selbst, so ist das wohl zu verstehen, exemplifiziere eben jene literatur- und
interpretationstheoretische Behauptung, die das Verfahren der kommentierenden Lektüre
begründe. (Witte 1993; 110ff)
Witte interpretiert seine eigene mehrschrittige 'hermeneutische Auslegung' der Parabel von
Kafka als Musterbeispiel für sein hermeneutikkritisches Verständnis literarischer
Interpretation: "Auch die hermeneutische Interpretation führt - das haben die
vorausgegangenen Auslegungsversuche erwiesen - zu einander widersprechenden
Ergebnissen. So war der Mann vom Lande nacheinander als Vaterfigur, als Repräsenant des
Schriftstellers oder als Am ha-Arez interpretiert worden, der Tod als Verheißung, als
Erfüllung oder als absurdes Ende. Die Legende ließ sich zwar als ein sich stimmiges Ganzes
interpretieren, aber nur so lange sich die Interpretation auf einen einzigen Kontext als
Bezugsrahmen beschränkte, und selbst dann wurden durch das 'gleitende Paradox' der
Kafkaschen Erzählweise am Ende die erreichten Ergebnisse wieder in Frage gestellt." (Witte
1993; 110)
Witte demonstriert aber mit seiner eigenen Auslegungspraxis nichts anderes als jene Einsicht,
die die Hermeneutik verstehenstheoretisch bis heute so attraktiv macht: die Erkenntnis
nämlich, daß Interpretationen von literarischen Texten an Interessen orientiert und intentional
strukturiert sind, daß sie sprachliches, literarisches, ästhetisches, kulturelles und historisches
Wissen voraussetzen (zum Beispiel und vor allem eine gewisse Vertrautheit mit den
Interpretationspraktiken und Interpretationskonzepten anderer), daß sie einer gewissen
analytischen Kunstfertigkeit bedürfen, daß sie in einer bestimmten, dem üblichen literarischliteraturwissenschaftlichen Diskurs gemäßen Sprache formuliert sein sollten und daß sie in
einem gewissen Sinne auch plausibel sein sollten, wenn sie denn überhaupt zu Einsichten
oder Widersprüchen führen können sollen.
Seine anschließende "andere Lektüreweise (Witte 1993; 107ff), seine "Kommentierung" des
Kafka-Textes, ist bei näherem Hinsehen nichts anderes als eine Fortsetzung eben dieser
Auslegungspraxis: Witte liest nämlich, dabei Bezug nehmend auf (auto-)biographische,
kulturelle und historische Kontexte, Kafkas Parabel als "eine Parabel über den Vollzug des
kommentierenden Schreibens" selbst. Er liest sie wie eine Geschichte, mit der ihr Autor eine
Erkenntnis ins Bild setzt, die auf den Text selbst angewendet werden kann: Die "Legende"
Kafkas wird eben erst so zu einer "Metapher für den Prozeß des Schreibens" und - das führt
Witte praktisch vor - für den Prozeß des Interpretierens.
Kein Zweifel, daß so der Interpretation der Parabel Kafkas neue Perspektiven abgewonnen
werden. Nur scheint mir das nicht die Überwindung gewisser hermeneutischer Lektüren,
sondern die Fortschreibung einer bestimmten prekären Vorstellung von
literaturwissenschaftlicher Interpretation zu sein. Einen literarischen Text zu interpretieren,
das soll wohl (nach wie vor) die Kunst sein zu zeigen, wie man mit der bei text-, kontext-,
situations- und geschichtskritischer Lektüre ermittelten poetischen (und sei es:
poetologischen) Botschaft eines Autors umgeht, indem man sie interpretationspraktisch und
interpretationstheoretisch wörtlich nimmt: der literarische Interpret führt gewissermaßen vor,
wie er die Botschaft des Textes auf seine eigene Interpretation anzuwenden versteht.
Literaturwissenschaftlich verfährt der Interpret dabei insoweit, als er seine eigene
Interpretation des literarischen Textes neben andere stellt, auf die er dann gelegentlich, von
Fall zu Fall, ablehnend oder zustimmend Bezug nimmt. Der Literaturwissenschaftler Witte ist
aber kein kritischer, kein reflexiver Interpret der Interpretationen; eine Auslegung der
Auslegungen, eine Kommentierung der Kommentierungen ist seine Sache offenbar nicht. Ihn
interessiert kaum, wie Interpretationen zustandekommen, wie Interpretationsgeschichten
entstehen und weitergegeben werden, wie Interpretationskonzepte wirken. Der Wittesche
Ausleger hat eine Stimme unter den vielen Kommentatoren der literarischen Texte, besitzt
aber allem Anschein so gut wie keine interpretationsanalytische Urteilskraft. Der Diskurs der
Literaturwissenschaftler hat, so scheint es, den Diskurs über die Literatur weiterzuführen.
Aber wie geht die literarische Interpretation literarischer Texte? Was sind die wesentlichen
Aspekte und Kriterien der literarischen Interpretation? Erstaunlicherweise thematisiert Witte
ästhetische Aspekte des Textes von Kafka überhaupt nicht. Die Art und Weise, wie die
Geschichte darstellt, was sie darstellt, wird nurmehr stillschweigend als gekonnt gewertet.
(Schließlich rechtfertigt ja die poetische Dichte der Erzählung den Aufwand an
Interpretation.) Dabei wäre aber gerade auch zu zeigen gewesen, wie die Darstellungsweise
Kafkas die Wahnehmungsweise und Wahrnehmungsperspektive des Lesers organisiert. Es
wäre etwa zu zeigen, wie es der Erzähler (im Erzähler) anstellt, den Zuhörer (im Leser) in
einander abwechselnde, auf den ersten Blick widersprüchliche Wahrnehmungen und
Wertungen der Situation zu verwickeln. Zu zeigen wäre, kurz gesagt, worin eben jener
(reflexive) poetische Schreibprozeß besteht, als dessen Spur sich der Text Kafkas auch
interpretieren läßt.
Auch wenn man das Geschäft des Literaturwissenschaftlers darin sieht, einen weiteren
Kommentar im "Kontinuum der jeweils individuellen Kommentare" anzufertigen, sollte man
überdies nicht darauf verzichten, das eigene Textverständnis - soweit es
interpretationsrelevant ist - explizit mitzuteilen. Ein elementares handlungslogisches
Verständnis des Textes wird ja schon immer dann vorausgesetzt, wenn sich auf die
Auslegung von Schlüsselstellen ('Schlüsselaussagen') des Textes verlegt. Mit anderen
Worten: Jede interpretatorische Bezugnahme auf Textelemente schließt ein Verständnis des
Textes im ganzen ein - und modifiziert es. Also hätte auch man die Handlungs- oder
Ereignisstruktur der Geschichte zu vergegenwärtigen, die man aus dem Text herausliest oder in ihn hineinliest. Dies durchdacht zu tun, würde selbstverständlich einschließen, daß
man den Inhalt der Geschichte als einen Ausdruck der Struktur ihrer Erzählung zu
beschreiben versucht. Eben dies unterbleibt bei Wittes Kafka-Lektüre.{23} Der Interpret gibt
das Nachdenken über seinen eigenen Wahrnehmungs- und Deutungsstandpunkt auf und
verliert sich gewissermaßen in die Geschichte.
Entgegen der programmtischen Absicht - die 'hermeneutische Auslegung' solle sich
gewissermaßen selbst als noch unreflektierte Praxis der 'Kommentierung' verständlich
machen lassen - wird dabei ein Interpretationsvokabular verwendet, daß gerade nicht die
verstehenstheoretischen Erkenntnisse der hermeneutischen Textwissenschaft voraussetzt,
sondern nach wie vor der Idee der wörtlichen Lektüre des wörtlich bedeutungsvollen Textes
folgt.{24} Hier wird nach eben derjenigen Interpretationslogik verfahren, die theoretisch als
unzureichende Hermeneutik kommentierungspraktisch überboten werden soll. Wie man die
Logik des naiv-alltagsweltlichen Verstehens der Handlungen und Äußerungen der
Erzählfiguren und des Erzählers selbst (als einer Figur innerhalb der Geschichte) interpretativ
zu reflektieren hätte, eben das wäre ein Thema für eine verstehenswissenschaftliche
Interpretation, die über identifikatorische Lektüre hinauskäme - und sie nicht mit der
Antithese von hermeneutischer Auslegung und historisch-kritischem Kommentar nurmehr
rhetorisch außer Kraft zu setzen versuchte.
Wittes literarische Interpretation ist wie gesagt durchaus ein Versuch der hermeneutischen
Lektüre der Parabel von Kafka in mehreren Schritten. Zunächst deutet er die erzählte
Geschichte selbst, dann bezieht die Publikationsumstände sowie die Biographie des Autors in
seine Deutung ein, danach deutet die "Funktion" der "Türhüterlegende" "als Binnenerzählung
im Proceßroman". (Witte 1993; 102) Die Interpretationsintention erweitert also schrittweise
den Bezugsrahmen der Interpretationspraxis. Die voraufgegangenen Deutungen erscheinen
dabei in einem anderen Licht, es sieht so aus, als widersprächen sie einander. Eben dies
scheint ein Beleg für die Angemessenheit der Interpretation im ganzen zu sein; exemplifiziert
sie doch die Kernaussage, die der Interpret - aktuellen Interpretationsgepflogenheiten folgend
(Witte 1993; 97) - in die Erzählung hineinliest: "In einer für Kafka höchst charakteristischen
paradoxalen Wendung erweist sich der Text, der auf Grund seiner Gattungsmerkmale
<gemeint ist die Novelle!> für den Leser eine Verheißung enthält, für den Zuhörer K. als
Verhängnis." (Witte 1993; 104) "Die für Kafkas Texte charakterstische Ambivalenz, die
Gerhard Neumann als 'gleitende Paradoxie des Erzählens' definiert hat, (Gerhard Neumann
1968){25} behält so auch in der Türhüterlegende das letzte Wort." (Witte 1993; 97) Die
mehrschrittige und mehrschichtige Deutung der Parabel Kafkas entspricht, so erscheint es
dem Interpreten, eben jener Interpretationstheorie, die jede 'hermeneutische Auslegung'
obsolet werden läßt und nurmehr literaturwissenschaftliche Kommentare über literarische
Kommentare, Texte über Texte, zuläßt. Sie stellt für ihn nichts anderes dar als eine
Instantiierung eben dieser Interpretationstheorie. Kafkas Parabel bringt so verstanden
anscheinend zur Anschauung, wovon die reflektierte Lektüre ausgeht: die Wahrheit der
Interpretation ist, daß jede Interpretation kontingent ist, wie eben die Parabel selbst lehrt.
(Vergl. Witte 1993; 113) Wenn "sich die Interpretation auf einen einzigen Kontext
beschränkte" (Witte 1993; 110), wäre das nicht so offfensichtlich; so aber zeigt der Wechsel
der Intentionen und Perspektiven der literarischen Kommentierungen, daß die Wahrheit der
Interpretation immer im Fluß ist. (Witte 1993; 110) Also ist der Idee der hermeneutischen
Interpretation grundsätzlich zu widersprechen?
Mir scheint, daß hier eher mehrere interpretationstheoretische Mißverständnisse vorliegen:
Zunächst einmal ist es trivial festzustellen, daß weiteres interpretationsrelevantes Wissen die
Intention und das Ergebnis der Interpretation verändern wird. (Das bedeutet ja nichts anderes
als die Abhängigkeit des Textverständnisses vom Vorverständnis.) Weniger trivial wäre
demgegenüber aber bereits die Feststellung, daß die Entscheidung darüber, was als
interpretationsrelevantes Wissen gelten kann und auf welche Art und Weise es
interpretationsrelevant gemacht werden kann, eine methodische Reflexion voraussetzte:
Wann und inwiefern denn zählt beispielsweise 'intertextuelles' Interpretenwissen? (Ist es der
literarhistorischen Intuition des literarischen Interpreten freigestellt, welche Texte er mit
welchen anderen Texten zusammenliest?) Was heißt es denn zum Beispiel, einen
literarischen Text als Spur einer literarischen Biographie zu lesen? (Kann man denn
autobiographische Äußerungen wie Selbstinterpretationen des literarischen Ausdrucks eines
Autors lesen?) Worin etwa bestünde eine plausible Bezugnahme auf die
Interpretationsgeschichte(n) des Textes? (Welche Interpretationen sind unter welchen
Aspekten und nach welchen Kriterien welchen anderen diskursiv überlegen?) Und worin
besteht vor allem eine Bezugnahme auf den Text selbst, die sich nicht in einer Auswahl von
symptomatischen Schlüsselstellen erschöpfte? (Muß man sich damit zufrieden geben, daß
literarische Texte noch immer wie Zitaten-Collagen für literarische Kommentierungen
gelesen werden?) In welcher Sprache und in wessen Sprache sollen denn die
Textwissenschaften ihre Textinterpretationen formulieren? (Gilt denn immer noch H. Meyers
ironisch gemeintes Diktum, daß es in der Literaturwissenschaft allem Anschein nach darauf
ankomme, über Hölderlin wie Hölderin zu reden? Soll man den Anspruch aufgeben, daß auch
die Literaturwissenschaft ein wissenschaftliches Interpretationsvokabular zu entwickeln
hätte?) Eine methodisch reflektiertere literarische Interpretationspraxis bedarf heute, so denke
ich, einer text- und wissenstheoretischen - und selbstverständlich erst recht auch: einer
ästhetiktheoretischen - Fundierung, wenn sie denn mehr sein soll als die Fortsetzung des
literarischen Feuilletons mit bildungssprachlichen Mitteln.
Die literaturwissenschaftliche Interpretation bedarf darüber hinaus auch eines entwickelteren
sprachtheoretischen Wissens und sprachanalytischen Könnens, als es zum Beispiel die
Kafka-Interpretation von Witte in Anspruch nimmt. Mit vielen anderen literarischliteraturwissenschaftlichen Interpreten teilt Witte ja die Einschätzung, daß Kafkas
Erzählweise eine "charakteristische Ambivalenz" aufweise, die als 'Paradoxie' auf den Begriff
zu bringen sei. (Witte 1993; 97) So interpretiert er die Geschichte vom Türhüter vor dem
Gesetz, die der Geistliche K. beim Eintritt in den Dom vergegenwärtigt{26}, wie folgt:
"Schon der einleitende Satz des kurzen Textes: 'Vor dem Gesetz steht ein Türhüter' weist auf
ein doppeltes Paradox hin, das aufzulösen es hermeneutischer Anstrengung bedarf:
Offensichtlich wird das Gesetz mit einem Haus oder einer Stadt verglichen, in das
einzutreten, Geborgenheit oder Erfüllung bedeuten würde, vor dessen Tor aber ein
Beuftragter darüber wacht, daß nicht jedermann Zugang erhält. Dem 'Mann vom Lande', der
um 'Eintritt in das Gesetz' bittet, wird dieser Zugang vom Türhüter für 'jetzt' verwehrt, für
'später' aber als möglich in Aussicht gestellt. Die aus dieser Ausgangssituation sich
entwickelnde Auseinandersetzung zwischen den beiden, die die ganze Lebenszeit des
Mannes andauert, dieses soziale Drama, macht den eigentlichen Erzählgegenstand / der
Legende aus. Das doppelte Paradox besteht nun darin, daß, obwohl der Türhüter dem Mann
den Eintritt verwehrt, 'das Tor zum Gesetz offensteht wie immer', und daß, obwohl das Tor
offensteht und 'der Türhüter beiseite tritt', wie ausdrücklich gesagt wird, der Mann nicht
hineingeht." (Witte 1993; 95/96)
Die Geschichte selbst, die 'Legende', von der Witte spricht, fängt bei Kafka innerhalb der
Erzählung des Gesprächs zwischen K. und dem Geistlichen bekanntlich so an:
"(...) 'Täusche dich nicht', sagte der Geistliche. 'Worin sollte ich mich denn täuschen?' fragte
K. 'In dem Gericht täuschst Du Dich', sagte der Geistliche, 'in den einleitenden Schriften zum
Gesetz heißt es von dieser Täuschung: Vor dem Gesetz steht ein Türhüter. Zu diesem
Türhüter kommt ein Mann vom Lande und bittet um Eintritt in das Gesetz. Aber der Türhüter
sagt, daß er ihm jetzt nicht den Eintritt gewähren könne. Der Mann überlegt und fragt dann,
ob er also später werde eintreten dürfen. Es ist möglich, sagt der Türhüter, jetzt aber nicht. Da
das Tor zum Gesetz offen steht wie immer und der Türhüter beiseite tritt, bückt sich der
Mann, um durch das Tor ins Innere zu sehn. Als der Türhüter das merkt, lacht er und sagt:
Wenn es Dich so lockt, versuche es doch trotz meines Verbotes hineinzugehen. Merke aber:
ich bin mächtig. Und ich bin nur der unterste Türhüter.' (...)"
Der literarische Interpret deutet die vom Geistlichen dargestellte Situation, indem er dessen
Darstellungsweise paraphrasiert. Er begibt sich gewissermaßen als hypothetischer Mitspieler
in die Szene hinein und deutet sie in dessen Perspektive intentional. Dabei versucht er das
intentionale Vokabular des Textes zu treffen. Den Kontext und die Perspektive der
Darstellung der vergegenwärtigten Situation läßt er dabei außer acht. Der Interpret bezieht
einen Standpunkt innerhalb der dargestellten Szene der Legende und sucht nach einem die
Handlungen der (anderen) Mitspieler motivierenden Verständnis.
Das führt ihn zur Wahrnehmung einer zweifachen handlungslogischen Widersprüchlichkeit
(in der Perspektive des Manns vom Lande): Erstens konfrontiert der Türhüter den Mann vom
Lande allem Anschein nach mit einem ihm unverständlichen, situationsunangemessenen
Verbot; zweitens widerspricht er anscheinend seinem eigenen Verbot, aber der Mann vom
Lande handelt gleichwohl nicht. Einer Person wird also eine Handlungsweise zugleich
untersagt und freigestellt, und sie selbst will handeln und zugleich nicht handeln. Eben diese
Widersprüchlichkeit könnte man durchaus als ein situatives Paradox deuten - wenn sie denn
eindeutig aus dem Text herauszulesen wäre.
Tatsächlich ist aber der Interpret als impliziter Mitspieler in eine Interpretationsfalle getappt,
die in der exemplarisch gemeinten Vergegenwärtigung der Türhütergeschichte durch den
Geistlichen in der Parabel 'Vor dem Gesetz' des Romanautors Kafka angelegt ist: in die Falle
der intentionalistischen Motivierung von Handlungsbeschreibungen. Der Interpret erst liest
nämlich in die Sätze des Geistlichen jene praktische Kausalität hinein, die der Geistliche
selbst gerade nicht artikuliert. Er selbst spielt gewissermaßen die Rolle der impliziten dritten
Person in der Türhüterlegende, die den beiden anderen Personen gewisse 'Um-zu'-Motive und
'Weil'-Motive unterstellt. Der Interpret deutet die Handlungen und Äußerungen des Mannes
vom Lande seinem eigenen Situationsverständnis folgend als den Ausdruck bestimmer
Absichten und Wünsche, Wahrnehmungen und Überzeugungen, die seinen Umgang mit dem
Türhüter orientieren. Er spielt den teilnehmenden Beobachter, der den intentionalen
Zusammenhang der Handlungen und Äußerungen der anderen Personen zu durchschauen
meint, weil er sich selbst in das Spiel involviert findet. Er fällt, so denke ich, auf genau jene
Logik der Wahrnehmung des Gerichts herein, die der Geistliche Joseph K. gegenüber in
Frage stellt: 'In dem, was das Gericht ausmacht, solltest Du Dich nicht täuschen.'
Der Interpret nimmt dabei den Wortlaut der Vergegenwärtigung der Geschichte vom
Türhüter - es ist wichtig zu sehen, daß es sich der sprachlichen Form nach gerade nicht um
eine Erzählung, sondern vielmehr um eine Anführung und Erläuterung einer Geschichte
handelt - auf die Weise wörtlich, daß er sie in eine ihm selbst vertraute Erfahrungsgeschichte
transformiert, die der literale Kontext plausibilisiert. Eben so macht er die 'Legende' für seine
Interpretation kohärent. Dabei verliert er den Blick für den Unterschied zwischen den Ebenen
und den Perspektiven des Handelns, seiner Wahrnehmung, seiner Darstellung und Wertung.
Der Interpret macht sich bei der Interpretation das Vokabular der Akteure zu eigen. Er spricht
- die Zitierungen zeigen das - über die Sprache der Figuren des Erzählers, wie der Erzähler es
selbst tut. Das "doppelte Paradox" der Geschichte vom Türhüter ist also ein
interpretatorisches Konstrukt.
Nun ist ganz gewiß jede literarische Interpretation ein kognitives Konstrukt: Jeder Interpret
liest in den Text hinein, was er herauslesen möchte und herauslesen kann. Entscheidend ist
aber das Wie der Interpretation. Sollte die wissenschaftliche Interpretation nichts anderes sein
als eine kommentierende Lektüre? Sollte der wissenschaftliche Interpret am Ende keine
andere Sprache sprechen als diejenige, in der der Erzähler spricht oder seine Figuren
sprechen läßt? Sollte die wissenschaftliche Perspektive der Interpretation in der Identifikation
mit der Diktion der literarischen Figuren aufgehen? Kann die wissenschaftliche Beschreibung
der Interpretation literarischer Texte text- und sprachanalytisch unkritisch verfahren? Der
literaturwissenschaftliche Interpretationsgestus Wittes (und anderer Kafka-Exegeten)
jedenfalls scheint alles andere zu exemplifizieren als eine hinsichtlich ihrer Mittel und
Methoden reflexiv verfahrende Interpretationspraxis.
2.2.3Hiebels "poststrukturalistische Lektüre der 'Legende' 'Vor dem Gesetz'"; oder: Die
Figuren der 'Paradoxie', der 'gleitenden Metapher' und des 'Zirkels von Innen und Außen' sprachanalytisch reinterpretiert{27}
Hiebel weist "auf jene drei Formen oder Figuren (Paradoxie, gleitende Metapher, Zirkel von
Innen und Außen)" hin, "mit deren Hilfe" er "das Werk Kafkas aufzuschließen versucht"
habe. (Hiebel 1993; 19) "Die drei Grundformen lassen sich folgendermaßen skizzieren": "Die
Qualität des Irritierend-Unauflöslichen, meist von der Form der Paradoxie, einer Paradoxie,
die sich oft weiter und weiter verzweigt, kennzeichnet das gesamte Werk Kafkas."
"Andererseits prägen der Schwebezustand zwischen Wörtlichkeit und Uneigentlichkeit sowie
die Vielbezüglichkeit bzw. Unstimmigkeit dieser Uneigentlichkeit oder Figürlichkeit Kafkas
Werk; vorherrschend ist daher die Metapher, die oft einen ganzen Teil determiniert (...), aber
eine prozessuale, changierende Metapher, die von einer Bedeutung zur anderen 'gleitet' (...)."
"Aus der Form der unbestimmten Uneigentlichkeit bzw. gleitenden Semiose läßt sich häufig
die Figur des Zirkels von Innen und Außen hervorheben, eine Doppeldeutigkeit, derzufolge
es (...) unentscheidbar scheint, ob von einer inneren Instanz (Anklage-, Kritik- und
Strafinstanz) oder einer äußeren, sozialen Struktur (Anklage-, Verfahrens-, Urteils-,
Strafinstanz) die Rede ist." (Hiebel 1993; 20)
Paradoxie wird Kafkas Parabel seit langem attestiert. Aber was ist das Paradoxe am Text 'Vor
dem Gesetz'? Als paradox erscheint auch dem Interpreten Hiebel "vor allem seine Fabel: Für
den Mann vom Lande existiert ein Eingang ins Gesetz, aber genau diesen Eingang darf oder
kann er nicht passieren; für ihn und nicht für ihn ist der Eingang bestimmt." Doch
unterschlägt diese Deutungsbehauptung die Perspektivik der Erzählung und der
Interpretation: Was genau ist daran das Paradoxe? In welcher Perspektive ist der dargestellte
Handlungszusammenhang denn für wen ein paradoxer? Worin besteht denn die Paradoxie für
die Fabelfigur(en)? Worin für den Interpreten als einen imaginativen Beobachter? Die
mehrfache perspektivische Brechung des Erzählens bewirkt doch die Widersprüchlichkeiten
der Wahrnehmung und des Urteils, die der Interpret auf die Erzählung in der Erzählung selbst
identifikatorisch projiziert. Wie das 'im Kopf' des Interpreten als Leser geschieht, eben das
hätte eine reflexive Strukturanalyse der Erzählung im ganzen zu zeigen.
Die 'Gleitende Metapher' wird ebenfalls immer wieder als Eigenart der Erzählweise Kafkas
herausgestellt. "Jedes Wort bei Kafka steht buchstäblich und darf doch niemals nur wörtlich
genommen werden: Urteil, Gesetz, Prozeß, Fürsprecher. Was also ist gemeint mit 'Gesetz'?
Ein Gebäude ('Justizpalast')? Das Gesetzeswerk als die Summe aller positiven Gesetze?
Extrajuridische Gesetze? Das moralische Gesetz? Die Richtschnur für das richtige Leben?
Der wahre Weg? Der wahre Weg, der für jedes Individuum anders definiert ist?" (Hiebel
1993; 20) Statt zu zeigen, was für einen Interpreten gemeint sein mag, stilisiert Hiebel das
Problem metaphorischen Sprachgebrauchs semiotisch: "Der Sinn des Signifikanten
verschiebt sich offenbar von Partie zu Partie, die Metapher gleitet: Zunächst wird der Leser
vielleicht 'das Gesetz' als die Summe der Gesetze interpretieren. Der 'Türhüter' und die
Vorstellung vom Eintritt in das Gesetz' indessen legen die Vorstellung eines Gebäudes nahe,
d.h. die Personifizierung oder Allegorisierung des Gesetzes oder schlicht den Ort, an dem
man vor Gericht zu erscheinen hat und 'im Namen des Gesetzes' verhört oder verurteilt wird."
(Hiebel 1993; 20/21){28} Damit bezieht er sich auf eine metaphern- wie sprachtheoretisch
wenig überzeugende Unterscheidung zwischen 'wörtlicher' und 'nicht-wörtlicher', zwischen
'eigentlicher' und 'uneigentlicher' Rede.{29} Die Behauptung: "Die Metapher gleitet, die
Semiose verschiebt die Bedeutungen" (Hiebel 1993; 21), ist nurmehr eine begrifflich wie
analytisch verschwommene (metaphorisierende) Kennzeichnung, ist der Ausdruck eines
interpretationskonformen Uneigentlichkeits-Pathos, das seiner sprachanalytischen Reflexion
entbehrt. Und die Hiebelsche Konstruktion einer dritten "Figur, in der sich die gleitende
Metapher oder unbestimmte Uneigentlichkeit zu einem Zirkel von Innen und Außen
verfestigt" (Hiebel 1993; 21), exemplifiziert nur eben diese naive Stellvertreter-Theorie des
metaphorischen Ausdrucks der Sprache Kafkas.
Im ganzen fehlt Hiebels Beschreibung der "Figuren der 'Paradoxie', der 'gleitenden Metapher'
und des 'Zirkels von Innen und Außen'" die sprachanalytische Basis. Hiebel zeigt gerade
nicht, wie Kafkas figurative Ausdrucksweise die Interpretationsweise strukturiert.
2.2.4Galle über Kafka-Rezeptionen und Rezeptionstheorie; oder: der Interpret als der
exemplarische Rezipient?{30}
Galle stellt sich die "Aufgabe, eine rezeptionstheoretische Annäherung an Kafka zu
versuchen", um damit "paradigmatisch das Interesse und das Anliegen der Rezeptionsästhetik
zu verdeutlichen". (Galle 1993; 115) Er unterscheidet "das Werk und die von diesem Werk
ausgehende Wirkung auf der einen und den Leser, das Publikum sowie die von ihnen
ausgehende Rezeption auf der anderen Seite". (Galle 1993; 115/116) "Diese Doppelstruktur
der Betrachtung ist grundlegend für die einzelnen Verfahrensschritte der Rezeptionsästhetik;
sie vermag auch als Schlüssel zu dienen für ihre zentralen theoretischen Begriffe und
Probleme." (Galle 1993; 116) Im Erwartungshorizont (des Lesers?) manifestiere sich ein
"Gegenspiel zweier Systeme oder auch Kodes oder eben Horizonte: des primär ästhetischen
Kodes, den das Werk selbst mitführt, aufruft und eventuell auch überbietet, und eines
sekundären Kodes, den der Rezipient sich als je geschichtliches Wesen aufgrund seiner
Lebenspraxis gebildet hat und der seine Aneignung des Werks wesentlich bestimmt". (Galle
1993; 116) Man könne auch sagen: "ein Hiat besteht zwischen Produzent und Rezipient,
Autor und Leser", der aber "darauf angelegt" sei, "im hermeneutischen Dialog zwischen
Gegenwart und Vergangenheit vermittelt zu werden". Die "konstitutiven Differenzen
zwischen Werk und Rezeption" transparent zu machen, "kann als eine der zentralen
Aufgaben und Leistungen der Rezeptionsästhetik betrachtet werden". (Galle 1993; 116) Das
"künstlerische Werk" sei nach dem "Konzept der 'Partitur'" zu lesen, "das die Möglichkeit
und auch die Notwendigkeit freigibt, das Kunstwerk als ein in jedem Rezeptionsvorgang
gleichsam neu zu erschaffendes Gebilde zu sehen". Zu thematisieren sei so gesehen "die
Aktivität des Rezipienten im kulturellen Dialog". (Galle 1993; 116) Von daher scheine "auch
eine ganz neue Konzeption literarischer Traditionsbildung auf": "eine kontinuierliche
Umschreibung und Neuaneignung", ein "Prozeß, in dem Appropriation und Abstoßung
unablässig ineinandergreifen, in dem jede Generation oder gar literarische Gruppe sich eine
ihr eigene literarische Tradition gleichsam erschafft". (Galle 1993; 117) Die
"Unhintergehbarkeit" der "Initiative" des Lesers sei "ein zentraler Bezugspunkt der
Rezeptionsästhetik". (Galle 1993; 117)
Ein Musterfall für eine so verstandene Rezeptionsforschung sei "der Fall Kafka", dessen
"Weltgeltung" "den Artikulationsmodus einer langhin abgedrängten Schattenseite der
Moderne" ausmache. (Galle 1993; 117) Es komme darauf an, "die in der zweiten Hälfte
unseres Jahrhunderts etablierte Rezeption seines Werkes kritisch zu befragen"; denn "der
Weltruhm Kafkas beruhe auf einer Universalierung, die durch ein Überspringen des
spezifisch historischen und ästhetischen Ortes, an dem dieses Werk anzusiedeln sei und dem
es seine sprachliche und problemgeschichtliche Konkretheit zu verdanken habe". (So Galle
1993; 117/118 mit Bezug auf Robert.{31}) Man habe sich mit der "Primär-Rezeption" zu
beschäftigen, um "die historische Einbettung von Produktion und Rezeption eines
Kunstwerks aufzuarbeiten und für die Bestimmung von dessen ästhetischem Wert nutzbar zu
machen". (Galle 1993; 118) Galle liest seinerseits diese Primärrezeption im Falle des 'Prozeß'
als eine dem Werk (der Intention des Autors) gerecht werdende "Abweisung der
Bedeutungsfrage". (Galle 1993; 118) Diese Deutung sei eine, der auch Tucholsky zunächst
noch zugestimmt habe, "wenn er im Entzug von Orientierungs- und Deutungskategorien den
Kern des Romans sieht". (Galle 1993; 119) In einer "zweiten Phase der Kafka-Rezeption, in
der sich eine Tendenz zur globalen Deutung Bahn bricht", werde dann die zentrale
Bedeutung der 'Türhüter'-"Parabel" immer weniger gesehen. Es gebe "eine enscheidende
Zweiteilung in der Bewertung zwischen der Parabel und dem exegetischen Annex" innerhalb
der Romanerzählung. (Galle 1993; 121) "Darüber hinaus aber hat es, vielleicht, des
Dekonstruktivismus bedurft, damit man der Dimension, die diese frühe Kritik mit sich führt,
in vollem Umfange einsichtig werden kann." (Galle 1993; 121) Denn schließlich habe der
Roman "genau die Struktur, die diesen Text im dekonstruktivistischen Sinne nobilitieren
muß". (Galle 1993; 122) Man sieht: Das eigene Werkverständnis bildet also für Galle den
Bezugsrahmen der Darstellung und Deutung der Rezeptionsgeschichte.
Galle zeigt dann, wie seine Rezeptionsästhetik auf eine dritte Phase der Rezeptionsgeschichte
des Werks Kafkas exemplarisch anzuwenden sei: auf "künstlerische Bearbeitungen des
Prozeß-Romans in je einer paradigmatischen Dramen-, Film- und Prosafassung". (Galle
1993; 123) Er vergleicht die "Kafka-Rezeption der Nachkriegszeit" durch Adorno (Galle
1993; 122f), die "Theaterfassung" von Gide und Barrault (Galle 1993; 122ff), die
"Filmversion von Orson Welles" (Galle 1993; 128ff) und Handkes Erzählung 'Der Prozeß'
(Galle 1993; 133ff). Damit versucht er dem Anspruch gerecht zu werden, "das Werk und die
von diesem Werk ausgehende / Wirkung auf der einen und den Leser, das Publikum sowie
die von ihnen ausgehende Rezeption auf der anderen Seite" (Galle 1993; 115/116)
miteinander in Beziehung zu setzen. Tatsächlich aber liest er die genannten 'künstlerischen
Bearbeitungen' so, daß er sein eigenes Verständnis der Parabel innerhalb des Romans von
Kafka mit seinem eigenen Verständnis der auf Kafkas Roman als Erzählvorlage Bezug
nehmenden ästhetischen Texte vergleicht. Das "rezeptionsästhetische" Verfahren Galles
besteht also darin, die aus den künstlerischen Bearbeitungen erschließbaren
Autorendeutungen des Romans von Kafka - und hier wiederum insbesondere der 'Türhüter'Parabel - mit der eigenen Deutung des 'Bezugstexts' von Kafka selbst zu konfrontieren.
Damit macht sich Galle gewissermaßen zum 'generalisierten Rezipienten' der KafkaRezeptionen und des Kafka-Textes selbst. Er führt vor, wie die Rezeptionen zu lesen sind,
wie das Original zu lesen ist und was beide hinsichtlich der authentischen poetischen
Intention Kafkas voneinander unterscheidet. Er gibt sich aus als der sozial und historisch
gesehen exemplarische Interpret von Werk und Wirkung Kafkas. Seine empirische
Rezeptionsforschung beschränkt sich dabei auf eine intentionale Text- und Intertextanalyse.
Dergleichen ist keineswegs zwecklos; hat doch jeder Rezeptionsanalytiker auch sein eigenes
Textverständnis als denjenigen Interpretationshorizont zu reflektieren, vor dem er andere
Rezeptionsweisen überhaupt wahrnehmen und unterscheiden kann. Das Problem ist nur, wie
"die Differenz zwischen Bezugstext und Bearbeitung aufzudecken" ist (Galle 1993; 123), wie
die Rezipiententexte und ihr Bezugstext zu lesen sind.
Die text- und sprachanalytisch gesehen entscheidende Frage ist dabei die, wie eine
methodische Analyse von Rezeptionstexten und von Bezugstexten auszusehen hat. Eben hier
hat die Untersuchung von Galle durchaus exemplarische Schwächen. Galle trägt eine Reihe
von Interpretationsbehauptungen über Kafkas Parabel vor, ohne sie im einzelnen zu
reflektieren und zu begründen.{32} Die "Türhüterparabel" wird interpretiert, als stelle sie
"eine gleichermaßen übergreifende und unzugängliche Wahrheit dar". (Galle 1993; 129){33}
Was Galle vorführt, ist aber nichts anderes als eine handlungslogisch motivierte Deutung
desjenigen Situations- und Personenverständnisses, das der Wortlaut der beiden Texte bei
ihm selbst hervorruft. Wie er aus den Sätzen der beiden Textauszüge, die er miteinander
vergleicht, herausliest, was er versteht, eben darüber macht er keine sprachanalytisch
begründeten Aussagen. Seine Bezugnahme auf den Wortlaut der Texte ist unreflektiert, seine
textanalytisch intendierte Kommentierung assoziativ.{34} Schon deswegen sind die
vergleichenden Interpretationen in methodischer Hinsicht fragwürdig. (Daß man bei
gleichartigen Kommentierungen der Texte auch zu durchaus anderen Deutungen kommen
kann, ist also nicht der Punkt.)
Die rezeptionsästhetischen Studien Galles sind darüber hinaus aber in einem viel
grundsätzlicheren Sinne problematisch: Der Interpret Galle beansprucht,
Rezeptionsgeschichten zu rekonstruieren. Tatsächlich vergleicht er nur seine eigenen
Interpretationen eines literarischen Werks mit seinen eigenen Interpretationen von
Verständnissen dieses literarischen Werks, ohne dabei die Interpretations- und die
Rezeptionsbedingungen zu reflektieren. Er nimmt damit den Standpunkt eines authentischen
Interpreten ein, der zu wissen beansprucht, wie der Text und die Texte über den Text wirklich
zu lesen sind. Mit anderen Worten: Er macht sich zum vermeintlich paradigmatischen
Rezipienten. So anregend dieses Untersuchungsverfahren ist - sollte das schon die richtige
Perspektive empirischer Rezeptionsforschung sein?
2.3Dritte Fallstudie: Das Interpretationsverfahren und die Interpretensprache im Funkkolleg
'Literatur der Moderne'{35}
Inzwischen liegt eine weitere neue Interpretation der Parabel im 'Dom-Kapitel' des 'ProceßRomans' von Kafka vor: die Interpretation von D. Kremer. Anhand dieses Beispiels läßt sich
noch deutlicher zeigen, daß die literaturwissenschaftliche Interpretation literarischer Texte
bis heute keine überzeugende Antwort auf die Frage gefunden hat, wie zwischen der Sprache
des Textes und der Sprache des Interpreten zu vermitteln sei. Der Kafka-Interpret des
Funkkollegs versteht nämlich die zu interpretierende Geschichte empathetisch; er identifiziert
sich mit den Perspektive der Erzählfiguren; er spricht die Sprache des Textes. Er verwendet,
anders gesagt, sprachliche Handlungsmuster wie das Zitieren, das Paraphrasen, das
Explizieren sprachanalytisch gesehen interpretationsunkritisch.
Wie gerät der literarische Interpret in die Geschichte der Parabel Kafkas hinein? Welche
Perspektive nimmt er dabei ein? Welche Sprache spricht er? Der literarischliteraturwissenschaftliche Kafka-Interpret des 'Funkkollegs Literatur der Moderne' versteht
Kafkas 'Proceß'-Roman (und Kafkas Werk im ganzen) als den Ausdruck einer
Lebensphilosophie im Medium des literarischen Schreibens. Eine exemplarische Passage der
Interpretation:
"Im neunten Kapitel des 'Proceß', im Dom-Kapitel, findet sich die berühmte Parabel 'Vor dem
Gesetz', die den gesamten Roman in zentralen Punkten bündig wiedergibt. Im Anschluß an
seinen Vortrag der Parabel holt der sogenannte Gefängsnisgeistliche zu einer längeren
Auslegung des Textes aus. Er setzt einen Akzent darauf, daß der Mann vom Lande eigentlich
nicht zu bedauern sei, nur weil man ihm den Eintritt in das Gesetz nicht gewährt, denn er
handelt aus eigenem Entschluß:
'Nun ist der Mann tatsächlich frei, er kann hingehn, wo er will, nur der Eingang in das Gesetz
ist ihm verboten und überdies nur von einem Einzelnen, vom Türhüter. Wenn er sich auf den
Schemel seitwärts vom Tor niedersetzt und dort sein Leben lang bleibt, so geschieht dies
freiwillig, die Geschichte erzählt von keinem Zwang.'
Tatsächlich zwingt niemand den Mann dazu, das Gesetz aufzusuchen, niemand zwingt ihn
vor allem, ein Leben lang vergeblich vor dem Gesetz auszuharren, niemand, so muß man
einschränken, niemand als sein eigenes Verlangen nach dem Gesetz, die Verlockung des
unbekannten Territoriums." (Kremer 1994; 16/9)
Bereits diese Passage macht deutlich, wie der Autor der Interpretation die Kommentierung
möglicher Auslegungen (denn um nichts anderes handelt es sich ja, jedenfalls nicht um eine
Auslegung des Textes der Parabel selbst!) durch die Erzählfigur des Geistlichen interpretiert:
Für ihn exemplifiziert die dargestellte Deutung durch den Geistlichen genau jene Deutung
der Parabel, auf die er selbst aus ist und die er ein paar Sätze vorher bereits angedeutet hat:
"Anhand des 'Proceß' läßt sich dieser (nämlich Kafkas eigener) Begriff des Lebens darüber
hinaus auf sein Zentrum einer problematischen Erotik hin präzisieren." (Kremer 1994; 16/9)
Also exemplifiziert die Roman-Darstellung des Joseph K. - genauer: die Kommentierung
denkbarer Deutungen der Situation des Mannes 'Vor dem Gesetz' durch den Geistlichen
Joseph K. gegenüber in der Perspektive des literarischen Interpreten des Funk-Kollegs - eben
jene biographisch-epochengeschichtlich gesehen verständlich zu machende
Lebensphilosophie des Autors Kafka selbst? Dann wäre eine kohärente Lektüre der KafkaParabel diejenige, die nachvollziehbar zeigen kann, wie denn der Text in den Kontext, in den
Erzählraum, in die literarische Biographie des Erzählers und seiner soziokulturellen Welt
paßt. Die Interpretation hätte plausibel zu machen, was der Text zu verstehen gibt, wenn man
ihn so liest, wie der Interpret es vor dem Hintergrund seiner eigenen literarischen und
literaturgeschichtlichen Kenntnisse tut.
Dann wäre der wissenschaftliche Interpret also das Modell des literarischen Interpreten? Ob
das das Ziel einer literatur-wissenschaftlichen Interpretation sein sollte, mag man bezweifeln.
Wichtiger erscheint es mir aber zu sehen, wie der Interpret in die Geschichte hineingerät und
welche Rolle er ihr gegenüber spielt. Vergegenwärtigt man sich nämlich die eben zitierte
Passage, dann zeigt sich, daß er keinen anderen Standpunkt einnimmt als den des an der
Geschichte, genauer: an der Auslegungserörterung und der von ihr zum Gegenstand
gemachten Parabel selbst, gedanklich teilhabenden Mitspielers. Dieser in die Geschichte und
ihre Kommentierungsgeschichte verwickelte Beobachter motiviert nämlich die
Deutungshypothesen des Geistlichen, indem er sie mit Bezug auf sein Verständnis der
Handlungen, Meinungen und Überzeugungen des Mannes 'vor dem Gesetz' plausibilisiert. Er
motiviert sie mit Bezug auf denjenigen interpretativen Bezugsrahmen, der ihm die
(Auslegungs-)Geschichte so zu sehen ermöglicht, wie es seinem Deutungsinteresse
entspricht.
Der literarisch-literaturwissenschaftliche Interpret interpretiert also die Parabel und deren
Kommentierungsgeschichte innerhalb des Romans durchaus intentional. Wie er das anstellt,
macht insbesondere seine eigene Sprache, macht sein Interpretationsvokabular deutlich. Er
paraphrasiert die Handlungs-, Person- und Situationensbeschreibungen und -zuschreibungen
des Geistlichen und des Erzählers und sagt scheinbar dasselbe mit nurmehr anderen Worten.
Tatsächlich transponiert er sie aber in die Perspektive eines zwar an der Geschichte
interessierten, gleichwohl aber darüberstehenden auktorialen Interpreten. Ein paar Beispiele:
Der Interpret identifiziert sich mit der Perspektive der Figur des Geistlichen, wenn er dem
Mann vor dem Gesetz unterstellt, er handle "aus eigenem Entschluß". Er liest diese vom
Geistlichen zwar angeführte, aber keineswegs geteilte Deutung des Verhaltens des Mannes
'vor dem Gesetz' einsinnig, indem er sie als durch "sein eigenes Verlangen", durch die auf ihn
wirkende "Verlockung des unbekannten Territoriums" motiviert deutet. (Kremer 1994; 16/9)
Oder: Der Interpret vergleicht die Einstellung von K. mit der einer anderen Figur innerhalb
der Rahmenerzählung - und macht sich auch damit zum übergeordneten 'Intentionalen
Interpreten', zum 'Central Meaner', der weiß, was die Leute denken, wenn sie sich so
verhalten, wie sie ein Erzähler sie sich verhalten läßt, indem er ihre Geschichte
vergegenwärtigt. Oder: Der Interpret gibt vor, die gedanklichen Projektionen des Joseph K.
zu referieren, die ihm vor dem Gesetz durch den Kopf gehen und die ihm den Eintritt
attraktiv erscheinen lassen - und deutet diese erfundenen Gedanken dann (übrigens auch mit
Blick auf den Erzähler Kafka selbst) tiefenpsychologisch:
"Was hält K. und die übrigen Angeklagten im Inneren des Gerichts? Ist es die Luft der
Kanzleien, die an 'Tagen großen Parteienverkehrs' kaum mehr zu atmen ist? Oder das
Verlangen herauszufinden, ob das Innere der Behörde ebenso 'widerlich ist wie die
Außenansicht? Vermutlich steht Josef K.s machtfixierter Eros in enger Beziehung zu jener
'Mischung von Kindlichkeit und Verworfenheit', mit der die Mädchen des Malers Titorelli
ihre ohnehin zu kurzen Röcke bei jeder Gelegenheit heben." (Kremer 1994; 16/10)
Indem er so verfährt, werden aus den darstellenden Sätzen der (Parabel innerhalb der)
Erzählung Sätze über Darstellungen. Die Zitierungen und Paraphrasierungen des Wortlauts
der Geschichte entpuppen sich als wertende Stellungnahmen zum Inhalt der Geschichte.
Heißt es im Text selbst (in der Kommentierungsperspektive des Türhüters) beispielsweise:
"Wenn er sich auf den Schemel seitwärts vom Tor niedersetzt und dort sein Leben lang
bleibt, so geschieht dies freiwillig, die Geschichte erzählt von keinem Zwang."
so liest der literarische Interpret heraus,
der Mann vor dem Gesetz handle "aus eigenem Entschluß". (Kremer 1994; 16/9)
Eben damit wertet der Interpret die Handlungsbeschreibung des Geistlichen als einen
Ausdruck von Handlungsfreiheit. Und genau dies ist in der Beschreibung selbst (wenn man
das sagen darf: kunstvoll) offen gehalten: Daß etwas freiwillig geschieht, bedeutet eben nicht
selbstverständlich dasselbe wie, daß etwa aus eigenem Entschluß getan werde. Kurz: die
Raffinesse der Darstellung des Problems der Intentionalität der Figur des Mannes vor dem
Gesetz durch Kafka (oder richtiger: durch den Geistlichen in der Erzählung Kafkas) wird
intentionalistisch verkürzt. Der literaturwissenschaftlich ambitionierte literarische Interpret
identifiziert sich mit einem erzählenden Beobachter der Erzählung innerhalb der Erzählung
eines literarischen Autors. Er ist 'in die Geschichten verstrickt'{36}, von denen er
kommentierend und interpretierend spricht. Interpretationsanalytisch und
interpretationstheoretisch ist das problematisch, kommt es doch darauf an, daß der Interpret
seine Interpretationen rational interpretiert. Identifikatorische Lektüre ist eine Sache,
reflexive Interpretation von Lektüren ist eine andere. Wie weit sollte sich der interpretierende
Literaturwissenschaftler mit dem literarischen Interpreten identifizieren? Sollte das
Interpretationsvokabular mit dem Geschichtenvokabular identisch sein?
Dieses Problem hängt mit einem zweiten Problem zusammen: Der literarischliteraturwissenschaftliche Kafka-Interpret des 'Funkkollegs Literatur der Moderne' versteht
Kafkas 'Proceß'-Roman (und Kafkas Werk im ganzen) als den Ausdruck einer
Lebensphilosophie im Medium des literarischen Schreibens. (Kremer 1994; 16/9) Der Roman
exemplifiziert so gesehen, was er zu zeigen scheint: Kafkas "Flucht in die Literatur" (Kremer
1994; 16/8), in die Reflexion der Reflexion des Schreibens und der Schrift im Medium des
künstlerischen Ausdrucks. Kafkas Erzählkunst selbst wird so aber psychologisiert. Der
Roman wird so gelesen, als stünde er für eine lebens-, kultur- und zeitgeschichtlich bedingte
literarische Existenz. Seine ästhetischen Qualitäten werden dabei ausgeblendet. Wie der
Autor Kafka das Verständnis des Lesers für den Hergang der Erzählung, für die Perspektive
des Erzählers, für die Art und Weise des Erzählens organisiert und strukturiert, gerät auch
hier vollkommen aus dem Blick. Damit unterbleibt, mit Seel gesprochen{37}, der "Test für
die Bedeutung von Kunstwerken": "ob es sich lohnt, die Welt in ihrem Stil wahrzunehmen".
Es entfällt "die eingehende Konfrontation mit den durch Kunst veröffentlichten Sichtweisen"
durch eine Bezugnahme "auf die genaue Konstruktion ihrer Werke". (Seel 1991; 239) Die
literarischen Kunstmittel der Konstruktion der anderen Wahrnehmungswelt und der anderen
Weltwahrnehmung werden nicht thematisiert. Gleichwohl haben sie aber Bedeutung für die
Praxis der Interpretation: Sie organisieren und strukturieren implizit jenes Verständnis des
Textes, auf das der Interpret stillschweigend Bezug nimmt, wenn er ihn expressivistisch
kontextualisiert liest. Nur reflektiert der Interpret eben nicht, wie aus dem Text auf dem
Papier der Text in seinem eigenen Kopf wird. Wie ästhetische Imagination erzeugt ist, sollte
den Literaturwissenschaftler als Interpreten aber durchaus interessieren. Richtiger: es sollte
ihn interessieren, wie Interpretation als ästhetische Imagination literaturwissenschaftlich
interpretiert werden kann.
2.4Vierte Fallstudie: Schirrmachers dekonstruktivistische Kafka-Interpretation; oder: einige
Probleme der Hermeneutik 'dekonstruktive' Interpretation
Schirrmachers Intention ist, ganz im Sinne H. Blooms{38}, diese: Er will exemplarisch
nachweisen, "'daß starke Dichter' die Tradition 'dekonstruktivistisch' lesen, ganz gleich, ob
sie sich dessen bewußt sind oder nicht". "Im Sinne Gumbrechts soll gezeigt werden, daß
Kafkas Literatur bereits jenes dekonstruktivistische 'reading' darstellt, dass 'an die Stelle von
Interpretation tritt'. Kafkas 'Prozeß', so die These, ist ein analytisches Buch, das seinen
kognitiven Anspruch unter einer Vielzahl von Lektüren der Tradition verbirgt."
(Schirrmacher 1987; 4) Kafka also als Dekonstruktivist literarischer Tradition, als einer der
Blomschen "'strong poets', die durch ihre Werke den Kanon der Literatur revidieren".
(Schirrmacher 1987; 5) Wie aber ist Kafkas dekonstruktivistische Lektüre der literarischen
Tradition dann zu lesen? Schirrmachers Antwort lautet: Es komme auf eine
"dekonstruktivistische Lektüre Kafkas" (Schirrmacher 1987; 5) als Verfahren der
literarischen Interpretation an. Nachzuweisen sei etwa, "daß beispielsweise Kafkas 'Prozeß'
eine verschlüsselte, in fast allen Details zu rekonstruierende Reflexionsgeschichte enthält."
(Schirrmacher 1987; 6) Denn "Kafkas Erfindung des 'Gerichts', so die These, entspreche
Blooms Begriff der 'Tradition'. Kafka liest die abendländische Überlieferung in jenem Sinn,
den Harold Blooms Kabbala-Kritik formuliert (...)." (Schirrmacher 1987; 6) Kafkas Roman
sei, wie sein Tagebuch vermerke, "ein 'Zwiegespräch' des Autors mit dieser geistigen
Tradition: er <der Roman: sic!> konfrontiert den schwerkranken Bürger K. in seinem letzten
Lebensjahr noch einmal mit den verschlüsselten Ansprüchen, Urteilen und Heilsangeboten
der metaphysischen Tradition." (Schirrmacher 1987; 7) Denn an "vielen Stellen des Romans
ist vom 'Gedankengang' die Rede (...). Die Rede vom Gedankengang signalisiert, daß im
'Prozeß' ein systematischer Reflexionsprozeß durchgeführt wird, der Josef K.s Verständnis
übersteigt." (Schirrmacher 1987; 8) Kurz: "Der 'Prozeß' ist (...) Kafkas Dokument für eine
'Dekonstruktion' der metaphysischen Tradition." (Schirrmacher 1987; 8) "Kafkas
'Lehrgespräch' mit der Tradition ist als 'misreading' angelegt." (Schirrmacher 1987; 11).
Soweit also das literaturanalytische Programm Schirrmachers: 'Starke Poeten' dekonstruieren
mit ihren literarischen Werken die literarische Tradition. Ihre Werke sind also so zu lesen,
daß ihre dekonstruktive, reflexive, analytische Intention der Kritik der metaphysikverdächtigen Tradition verständlich gemacht werden kann. Deswegen hat man als
literarischer Interpret am Text zu zeigen, wie diese Intention ihren Ausdruck findet. Der Text
selbst ist also so zu lesen, daß er im ganzen und in seinen relevanten Teilen als eine
exemplarische Exemplifizierung des kognitiven Anspruchs seines Autors gelesen werden
kann - auch dann, wenn dieser dem Autor nicht bewußt gewesen ist. Kurz: die Interpretation
hat zu zeigen, inwieweit der Text des Autors das literaturtheoretische Kriterium erfüllt, eine
andere Poetologie darzustellen. Eben darin soll das literaturwissenschaftliche Verfahren der
Dekonstruktion bestehen.
Wie aber dekonstruiert Schirrmacher den 'Prozeß'-Roman, sein 'Dom-Kapitel' und die darin
enthaltene 'Türhüterparabel'? Er deutet relevante Textauszüge mit Bezug auf
Tagebuchnotizen des Autors, auf seine (auch darin zum Ausdruck kommende) kulturelle
Biographie, auf die (eben dafür bedeutsame) besondere kulturelle Überlieferungsgeschichte.
Der im Roman dargestellte Prozeß, so findet der Interpret, "zitiert" "die Grundtexte der
metaphysischen Tradition" und "versteht sie zugleich mit Hilfe kabbalistischer
Grundeinsichten anders zu lesen." (Schirrmacher 1987; 28) Um dahinter zu kommen, muß
man den Text eben 'intertextuell' zu lesen verstehen.
Schirrmachers praktische Hermeneutik der Interpretation der Türhüterparabel unterscheidet
sich nun aber von diesem Anspruch einer dekonstruktiven Lektüre. Schirrmacher
paraphasiert und kommentiert nämlich interpretationsrelevante Passagen des Romans so, als
ob sein Verständnis des Textes das authentische sei. So versteht er zum Beispiel die Joseph
K. gegenüber geäußerten Gedanken des Geistlichen über die Schrift als einen unmittelbar
wörtlich zu nehmenden Ausdruck der (unterstelltermaßen dekonstruktiven) poetologischen
Reflexionen des Autors selbst - und verwischt damit alle Unterschiede zwischen den in der
Parabel angelegten Ausdrucks-, Darstellungs- und Reflexionsperspektiven. "Die Schrift", so
kommentiert er seinerseits die Äußerungen des Geistlichen, "ist der Ort, eine Totalität von
Meinungen, eine infinite Progression von Deutungen aufzunehmen, ohne je selbst verändert
zu werden". (Schirrmacher 1987; 37) Beim Gespräch mit dem Geistlichen, so urteilt er vom
Standpunkt des auktorialen Interpreten der poetologischen Intention Kafkas aus, begreife K.,
"daß die Schrift mehr ist als die realistische Lesart von Geschichte, von fabula und historia"
(Schirrmacher 1987; 39) - und stützt diese interpretative Behauptung mit seinem Verständnis
derselben Textstelle in einer früheren Entwurfsfassung der Parabel im Roman Kafkas: "Die
gestrichene Version dieser Stelle hätte noch deutlicher Schrift mit dem Leitmotiv des
unbekanten 'Gedankengangs' verbunden (...)." (Schirrmacher 1987; 39) Als relevanter
Bezugsrahmen dieser Lektüre der Parabel gilt für ihn dabei seine eigene Kenntnis der
"Semantik der Kabbala" (Schirrmacher 1987; 42ff){39} - eben weil er voraussetzt, daß der
Roman als Musterfall der Destruktion einer poetologischen Biographie gegenüber einer
literarischen Tradition zu lesen sei. Eben deswegen erscheint auch seine Feststellung
hinsichtlich der literarischen Intention plausibel: "Nicht, daß Metaphysik ästhetische
Einbildung ist, will der Roman erweisen. Im Gegenteil: Nur in der Ästhetik ihrer
'Erfindungen' wird Metaphysik zu einer erzählbaren und prüfbaren Geschichte."
(Schirrmacher 1987; 114)
Schirrmachers Interpretation exemplifiziert ein bestimmtes Verständnis der Interpretation
literarischer Texte: Man lese nur "Kafkas avanciertes Schriftparadigma, das er durch die
Entdeckung der Kabbala als hermeneutisches Motiv in seine Texte integrieren konnte", mit
Bezug auf "seine literaturtheoretische Tragweite", nämlich vor dem Hintergrund des
"amerikanischen Dekonstruktivismus", der "überhaupt erst eine konsequente
interpretatorische Entsprechung" zum "Diskurs der literarischen Moderne" darstelle, "den
Kafka am nachhaltigsten bestimmt hat" (Schirrmacher 1987; 152) - und schon ergibt sich die
richtige dekonstruktive Interpretation. Tatsächlich aber gerät man auf diese Weise nurmehr in
interpretatorische Zirkel hinein: Der literarische Text wird so verstanden, als ob er der
Musterfall der Darstellung einer poetologische Intention sei, die derjenigen Literaturtheorie
entsprecht, die der Text selbst zu artikulieren scheint. Ob dieses Verfahren
interpretationstheoretisch gesehen Sinn macht, ist aber die Frage. Auch das 'intertextuelle
Lesen' des literarischen Textes ist Interpretation.{40} Auch der interpretationspraktisch und
interpretationstheoretisch kenntnisreiche Leser kommt nicht umhin, "sich mit den
individuellen Interpretationsleistungen des einzelnen Lesers zu befassen" (Schirrmacher
1987; 155), der er selbst ist. Das gerade auch dann nicht, wenn man wie Schirrmacher mit
Bezug auf Bloom (Schirrmacher 1987; 155; 164f) darauf besteht, daß "Lektüre" "ein
intersubjektiver und intertextueller Vorgang zwischen bereits stattgefundenen
Interpretationen" (Schirrmacher 1987; 155) ist. Eben dann kann der literarische Interpret mit
literaturtheoretischen Ambitionen nicht davon absehen, die Interpretationsverfahren,
Interpretationssituationen und Interpretationsgeschichten zu reflektieren, in die er selbst sich
verwickelt, wenn er den Text mit der Attitüde des auktorialen Exegeten deutet. Nicht jede
beliebige Lektüre geht; manche Lektüren sind anregend; keine Lektüre ist aber schon per se
eine Antwort auf die Frage nach ihrer Geschichte und ihrer Geltung. Die
literaturwissenschaftlich Analyse sollte etwas mehr sein als eine Fortsetzung der Lektüre der
Literatur in der Haltung gebildeter Leser.
2.5Fünfte Fallstudie: Binders Versuch philologischer Interpretation; oder: sprachanalytische
Grenzen des Wörtlich-Nehmens literarischer Texte{41}
Binder versucht mit seiner neuen "Einführung in Kafkas Welt" am Beispiel der TürhüterParabel zu demonstrieren, wie literarische Interpretationen textanalytisch zu fundieren sind.
Dabei orientiert er sich allerdings an einem Begriff des Wörtlich-Nehmens des Wortlauts der
Texte, der sprachanalytisch gesehen keinen Sinn mehr macht: Eine Textanalyse, die die
Differenz zwischen der Sprache des Textes und der Sprache des Interpreten ignoriert, führt
zu nichts anderem als zu einer idiosynkratischen Lektüre. Es gibt kein Wörtlich-Nehmen
sprachlicher Ausdrücke, das nicht interpretativ wäre. Die philologische Exegese literarischer
Texte ist deswegen interpretationstheoretisch zu begründen.
Binder sieht sich einer "Zunft der Interpreten" gegenüber, "die es bei ihrer Arbeit an der
notwendigen Sorgfalt fehlen läßt und wichtige Grundsätze der Auslegungswissenschaft
mißachtet". "Kafkas Erzählung Vor dem Gesetz ist häufig gedeutet, aber kaum jemals richtig
verstanden worden." (Binder 1993; 3) "Eine literaturwissenschaftliche Deutung, die diesen
Namen verdient, (...) sollte Erklärungsmodelle verwenden, die möglichst viele, im Idealfall
sogar alle deutungsfähigen Bestandteile des Textes einbeziehen." (Binder 1993; 6) "Die
Interpreten lesen selektiv", ihre Interpretationen führen zu einer "Verstümmelung der
Erzählintention Kafkas", "die zur Sinnaussage des Texte gehörenden Antinomien" bleiben
"unerkannt". "Es wird gar nicht ernsthaft in Betracht gezogen, daß die Erzählung einen
Sachverhalt darstellen könnte, der sich nicht dem Grundsatz der Widerspruchsfreiheit fügt,
ein verhängnisvoller Irrtum". (Binder 1993; 6) "Auch die neuerdings an Boden gewinnende
Intertextualitätstheorie, die Interferenzen und Entlehnungen zwischen Werken verschiedener
Autoren über die Brücke eines allgemeinen kulturellen Repertoires verwirklicht sieht", könne
derartigen Mängeln "nicht abhelfen". (Binder 1993; 7) "In dieser Lage kann nur eine
gründliche Analyse der von den Interpreten verwendeten Argumentationsstrukturen und eine
schonungslose Überprüfung der bisher gewonnenen Ergebnisse am Text Klarheit schaffen."
(Binder 1993; 9)
Was versteht Binder unter einer textkritischen Argumentation? Wie geht Binder selbst vor?
Zunächst beschreibt er die 'Form' der Parabel{42}, später ihren 'Sinn'. Gerade dabei stützt er
sich aber auf ein Verständnis des Textverstehens, daß insbesondere sprachanalytisch und
sprachtheoretisch wenig plausibel ist. Er wählt ein Verfahren des Wörtlich-Nehmens des
Textes, das gerade nicht dazu geeignet ist, die Diskrepanz zwischen den üblichen
literaturwissenschaftlichen und sprachwissenschaftlichen Interpretationsweisen zu
überbrücken. Er verkennt, daß eine 'Überprüfung am Text' ihrerseits eine hochkomplexe
Interpretationsleistung ist.
So nimmt sich Binder zum Beispiel im ersten Kapitel seiner Exegese der Parabel 'Vor dem
Gesetz' eine "Beschreibung der diesen Text auszeichnenden Merkmale" (Binder 1993; 10)
vor. Er untersucht das Tempus, die Perspektive, die Gestaltung und das Muster der
Erzählung. So eine Beschreibung könne, behauptet Binder, "dazu beitragen, feste Pfade
durch den Dschungel einander widersprechender, ja sogar ausschließender
Auslegungsversuche zu bahnen". (Binder 1993; 10) Eine der formalen Auffälligkeiten sei
zum Beispiel der Tempus-Gebrauch Kafkas: "Vor dem Gesetz läßt sich gattungsmäßig
mithilfe von vier unterschiedlichen Formkategorien festlegen. Zunächst einmal verwendet
Kafka das Präsens als Darbietungstempus und nicht das übliche epische Präteritum (...)."
(Binder 1993; 11) "Das in Vor dem Gesetz begegnende Präsens läßt sich nicht als Präsens
historicum verstehen"; es sei "auch nicht zu verwechseln mit dem Gebrauch dieser Zeitstufe,
der in einzelnen Stücken des Landarzt-Bandes vorherrscht", wo Kafka "nämlich das in
wissenschaftlichen Untersuchungen gebräuchliche analytische oder beschreibende Präsens
zur Darstellung von Textverläufen benützt". (Binder 1993; 11) Auch handele es sich nicht um
"das Gnomische Präsens, das zur Feststellung immerwährend geltender Sachverhalte dient,
oder das Präsens der Reportage, das in der Erzählung Ein Landarzt die Gleichzeitigkeit
zwischen erlebendem und erzählendem Ich betont." (Binder 1993; 11/12) "Demgegenüber ist
Vor dem Gesetz durch ein episches Präsens gekennzeichnet, das in gleicher Weise wie das
epische Präteritum geeignet ist, einen eigenen Gesetzen folgenden Geschehnisrahmen zu
schaffen (...)." (Binder 1993; 12) Würde Kafkas Parabel "im Präteritum erzählt werden",
dann "ergäbe sich jedoch ein anderer Gesamtcharakter, jedenfalls dann, wenn man das Stück
im Kontext des Proceß-Romans liest: Es träte weniger deutlich hervor, daß die Erzählung als
eine Art Präambel zum Gesetz die Bedingungen darlegen will, denen sich ausgesetzt sieht,
wer mit diesem Bereich in Verbindung tritt." (Binder 1993; 13) Die Verwendung des
Präteritums "wäre den Absichten Kafkas gänzlich entgegengesetzt gewesen, wollte er doch
mithilfe dieser Beispielerzählung eine allgemeine Gesetzmäßigkeit zur Darstellung bringen."
(Binder 1993; 13) Kurz: eine differenziertere grammatische Betrachtung des gewählten
Tempus ergebe, das die Wahl motiviert sei, weil sie der Darstellungsintention des Textes
(und des Autors) entspreche, die die Wahl des Tempus erkennen lasse.
Diese interpretative Argumentation ist natürlich zirkulär: Das verwendete Tempus begründet
das Verständnis der literarischen Intention des Autors; das Verständnis der literarischen
Intention bildet den Bezugsrahmen für die Identifikation der Tempusformen. Das analytische
Urteil stützt sich auf einen Begriff der Grammatik einer Sprache, der sprachtheoretisch
gesehen problematisch ist: grammatische Formen entsprechen Mitteilungsabsichten,
Mitteilungsabsichten entsprechen sprachlichen Formen; die Grammatik des Textes erklärt die
Intention des Textes - und umgekehrt. Tatsächlich bringen aber grammatische
Unterscheidungen, zum Beispiel von Tempusformen, nurmehr Differenzierungen von
Gewohnheiten und Üblichkeiten des sprachlichen Ausdrucks auf den Begriff, die es
unabhängig von der Vertrautheit mit Texten, von der Sprachkenntnis und von der Verfügung
über Sprachbeschreibungen gar nicht gibt. Jede Grammatik einer Sprache stellt einen
Versuch dar, dasjenige Wissen in der Sprache und über die Sprache für bestimmte praktische
Zwecke (insbesondere für Lehr- und Lernzwecke) übersichtlich zu ordnen, das wir zum
besseren Verständnis der Äußerungen und Texte gelegentlich brauchen.{43} Eben deswegen
läßt sich über die (grammatische) Form eines Textes nicht unabhängig vom Verständnis des
Textes, von der Kenntnis ähnlicher Texte, von der Beherrschung von Textbeschreibungen,
also unabhängig von Interpretationskompetenz bestimmen. Kafkas Gebrauch des Präsens
entspricht nicht einfach einem Lehrbuchwissen über Tempusformen; er aktualisiert - und
modifiziert - dasjenige text-, situations- und kulturspezifische grammatische Wissen von
Autoren und Lesern, von dem sie bei ihren interpretationsrelevanten Beschreibungen
ausdrücklich Gebrauch machen. Wie Kafka in der Parabel das 'epische Präsenz' verwendet,
läßt sich also nicht interpretationsfrei feststellen. Die den "Text auszeichnenden Merkmale"
(Binder 1993; 10) gibt es nicht außerhalb ihrer Beschreibung. Also suggeriert Binders Rekurs
auf "die Struktur des Textes" (Binder 1993; 8) nurmehr größere Beweiskraft. Seine
"Auslegungswissenschaft" (Binder 1993; 3) bedürfte einer durchdachteren
sprachanalytischen Praxis und Reflexion.
In einem zweiten Schritt untersucht Binder die "Erzählerperspektive" Kafkas. Zutreffend sei,
so schreibt er, "daß die Vorgänge, die Vor dem Gesetz zur Sprache bringt, außerordentlich
stark gerafft und vorwiegend aus der übergreifenden Optik eines auktorialen Erzählers
dargeboten werden, der die Eigenarten der am Handlungsgang beteiligten Figuren benennt
und Einblick in deren Innenleben besitzt". (Binder 1993; 13) "Die Neigung des Textes zur
auktorialen Erzählhaltung betonen, heißt freilich zugleich lediglich die halbe Wahheit
feststellen. Denn Vor dem Gesetz kennt andererseits auch Formulierungen, in denen sich der
Erzähler hinter seinen Figuren verbirgt." (Binder 1993; 14) Die Parabel sei eben auch "als
prägnant gehaltenes Lehrstück angelegt". (Binder 1993; 15) Aufschlußreich ist, wie Binder
argumentiert, um seine Wahrnehmung der Erzählerperspektive zu begründen: Er identifiziert
sich als Interpret mit den Handlungsweisen und Handlungsperspektiven der dargestellten
Personen und motiviert so seine eigene Sicht der Darstellungsperspektive. Binder
plausiblisiert die sprachliche Darstellungsperspektive, die der Erzähler Kafka dem Erzähler in
der Parabel ermöglicht, indem er sich in die Geschichte hineinbegibt. Die abschließende
Feststellung ist deswegen zwar nachvollziehbar, sie ist aber gerade nicht perspektivenanalytisch begründet: "Die Analyse der Erzählerperspektive in Vor dem Gesetz zeitigt
demnach insofern ein ungewöhnliches Ergebnis, als eine Einheitlichkeit des Blickpunkts, die
eine besondere Formqualität des Kafkaschen Erzählens ausmachen soll, in diesem
besonderen Fall offensichtlich nicht gegeben ist und sogar nicht einmal gewollt ist." (Binder
1993; 17) Bei der Beschreibung des Tempus-Gebrauchs in Kafkas Parabel nimmt Binder auf
die vermeintlich harten Fakten der Grammatik des Deutschen Bezug; dabei bezieht er sich
aber auf nichts anderes als auf seine eigene alltagsweltliche Kasuistik. Dabei wäre gerade die
Parabel ein interessantes Beispiel dafür, wie ein Autor perspektivische Mehrschichtigkeit und
Mehrdeutigkeit mit seiner Erzählung zum Ausdruck bringt.
Binders 'Auslegungskunst' ist der exemplarische Fall jener philologischen Praxis, die auf eine
kohärente Lektüre des literarischen Textes abstellt, ohne die Bedingungen und
Voraussetzungen der interpretatorischen Herstellung von Kohärenz zu reflektieren. Eine
detailliertere Rekonstruktion seiner Argumentationen unter interpretationstheoretischen
Aspekten wäre eine wichtige interpretationsanalytische Aufgabe. Binder fordert die
sprachanalytische Urteilskraft der Interpreten heraus, orientiert sich aber selbst an einem
Ideal der Sprachbeschreibung, das textwissenschaftlich längst obsolet geworden ist: Was
Texte zu verstehen geben und was Autoren meinen (oder Erzähler meinen lassen), entsteht
gewissermaßen erst 'im Kopf' des Interpreten.{44} Binder verfestigt unbeabsichtigt die
Diskrepanz zwischen literaturwissenschaftlicher und sprachwissenschaftlicher Philologie.
Deren Problem ist noch immer, wie die Interpretation von Äußerungen und Texten zu
verstehen sei und wie sie gelingen kann.
2.6Eine Zwischenbilanz der exemplarischen Interpretation der Interpretationen; oder:
Stichworte zu einer Heuristik der Interpretation
Die exemplarisch vergegenwärtigten Praktiken der Interpretation literarischer Texte weisen
bestimmte interpretationslogische Fehler auf:
1. Allen expliziten interpretationstheoretischen Reflexionen zum Trotz nimmt man bei der
Interpretation durchweg Bezug auf das eigene implizite Textverständnis.{45}
2. Die Bedeutung des eigenen Textverständnisses für die weitere Interpretation (der
Interpretationen) wird in aller Regel weder genetisch noch logisch noch theoretisch
reflektiert.{46}
3. Entsprechend gilt die selektive Bezugnahme auf sogenannte Schlüsselstellen des Textes
meist als schlichtweg trivial.
4. Interpretatorische Zirkelschlüsse sind eher die Regel als die Ausnahme. Die Kohärenz der
Interpretationstätigkeit wird mit der Kohärenz des Interpretationsgegenstandes verwechselt.
5. Oft wird die eigene Perspektive der Wahrnehmung der im Text wiedererkannten Situation
oder Geschichte mit der Wahrnehmungsperspektive des Erzählers oder der Erzählfiguren in
der Geschichte gleichgesetzt.
6. Nicht selten identifiziert, motiviert, plausibilisiert und rationalisiert man Handlungen,
Äußerungen, Gedanken und Gefühle der Erzählfiguren mit der eigenen Alltagstheorie
intentionaler Zustände.
7. Deutungsbehauptungen werden durch intentionalistische Rekurse auf das vermeintliche
Ganze des Werkes, der Biographie, der Selbstverständnisses des Autors kontextualisiert.
8. Die Sprache der Interpretation wird mit der Sprache des Textes verwechselt. In der
Sprache des Textes wird über die Sprache des Textes gesprochen.
9. Die Bezugnahme auf Textelemente folgt oft einem unkritischen Konzept der
Sprachanalyse: Das Zitieren wird als wörtliche, das Paraphrasieren als sinnangemessene
Wiedergabe des intentionalen Gehalts des Textes aufgefaßt.
10. Bei der Analyse figurativer sprachlicher Formen wird vielfach auf ein nicht nur
metapherntheoretisch längst überholtes Konzept wörtlichen Ausdrucks und eigentlicher Rede
Bezug genommen.
11. Bei der Begründung von Interpretationen werden vielfach bedeutungstheoretische
Voraussetzungen gemacht, die auf ein elementares Mißverständnis des semiologischen
Pragmatismus insbesondere von Saussure zurückgehen.
12. Interpretationstheoretische Ausführungen haben oft keinen erkennbaren (reflexiven)
Bezug zur interpretatorischen Praxis. Vielfach besteht ein deutliches Mißverhältnis zwischen
dem Theoretisieren über Interpretation und der Praxis der Interpretation.
13. Literaturwissenschaftler scheinen dazu zu tendieren, die unendliche Reihe der
Interpretationen fortsetzen, nicht aber das Verständnis von Interpretationen klären zu wollen.
Sie scheinen ihre Aufgabe nicht selten darin zu sehen, Muster- oder Meisterexegesen
literarischer Werke vorzuführen (und fortzuschreiben).
14. Die wissenschaftliche Interpretation scheint durchweg das Interesse an den ästhetischen
Aspekten literarischer Texte verloren zu haben. Es besteht vielfach ein Mangel an
methodischer Reflexion darüber, wie die ästhetische Wahrnehmung in literarischen Texten
organisiert wird.
Käme es also auf eine kognitionswissenschaftliche Orientierung der literarischliteraturwissenschaftlichen Interpretationspraxis an? Dagegen sprechen - wie ich im
folgenden Teil zeigen möchte - meines Erachtens grundlegende interpretationstheoretische
Bedenken.
3. Die Theorie der Interpretation literarischer Texte
3.0Interpretationstheoretische Schlüsselfragen
Die Grundbegriffe der Praxis und der Theorie der Interpretation literarischer Texte sind in der
Germanistik gegenwärtig alles andere als klar. Weit auseinder gehen die Auffassungen
darüber, was ein Text sei, was die Rolle des Interpreten sei, worin Interpretation bestehe,
worin insbesondere die Bezugnahme auf den Text bestehe, was die Sprache der Interpretation
von der Sprache des Textes unterscheide, worin die Bedeutung von Interpretationen im
Unterschied zur Bedeutung des Textes bestehe und was der Sinn von Interpretation(en) sei.
Von einer überzeugenden Theorie der Interpretation kann ebenso wenig die Rede sein wie
von einer überzeugenden Theorie der Sprache. Noch weniger von einer überzeugenden
Theorie der Ästhetik literarischer Texte. Es dürfte wohl keine Übertreibung sein, wenn man
feststellt, daß die germanistische Literaturwissenschaft nach wie vor sowohl die
texttheoretischen Erkenntnisse der Kognitionsforschung als auch die
interpretationstheoretischen Erkenntnisse der Sprachanalytischen Philosophie weitgehend
ignoriert und nach wie vor die Idiosynkrasien ihrer eigenen Begriffsgeschichten
fortschreibt.{47}
3.1Hermeneutik: eine vage Verstehenstheorie?
Die Aktualisierungen der Tradition der Hermeneutik beispielsweise sind nichts weiter als
Fortschreibungen einer problematischen Unterscheidung zwischen dem Gebrauchstext und
dem literarischen Text. So konstatiert beispielsweise Kurz mit einer gewissen Emphase: "Der
Ausleger, schreibt Novalis, muß 'der Dichter des Dichters seyn und ihn also nach seiner und
des Dichters eigner Idee zugleichen reden lassen können'." (Kurz 1986;2{48}) Wie macht er
das? "Der Interpret eignet sich den Text an, indem er das, was er für dessen eigentlichen Sinn
hält, mittels seiner analytischen Sprache, genauer, mittels einer Kombination der Sprache des
Textes und seiner eigenen, neu formuliert (...)." (Kurz 1986;2) Aber was soll das heißen?
Welcher Interpret ist hier gemeint? Der literarische Interpret, oder der wissenschaftliche
Interpret der literarischen Interpretationen? Und wessen Sprache spricht (oder schreibt) der
Interpret? Soll er nach wie vor 'über Hölderlin wie Hölderin reden'? (H. Meyer)
Kurz denkt offensichtlich ähnlich wie Gadamer{49}: "Meine These ist, Auslegung ist
wesenhaft und untrennbar mit dem dichterischen Text selbst verbunden, gerade weil er nie
durch Umsetzung in Begriff auszuschöpfen ist." (Gadamer 1986; 6) "(...) Werke (...) müssen
'gelesen' werden, um 'da' zu sein." (Gadamer 1986; 7) "Der dialogische Charakter der
Sprache", schreibt Gadamer{50}, "läßt den Ausgangspunkt in der Subjektivität, gerade auch
den des Sprechers in seiner Intention auf Sinn, hinter sich. Was im Sprechen herauskommt,
ist nicht bloß eine Fixierung von intendiertem Sinn, sondern ein beständig sich wandelnder
Versuch oder besser, eine ständig sich wandelnde Versuchung, sich auf etwas einzulassen
und sich mit jemandem einzulassen." (Gadamer 1984; 29) "Interpretation ist es, was
zwischen Mensch und Welt die niemals vollendbare Vermittlung leistet, und insofern ist es
die einzig wirkliche Unmittelbarkeit und Gegebenheit, daß wir etwas als etwas verstehen."
Man könne der "hermeneutischen Konsequenz nicht ausweichen, daß das sogenannte
Gegebene von der Interpretation nicht ablösbar ist". (Gadamer 1984; 33) "Interpretation" sei
"die ursprüngliche Struktur des 'In-der-Welt-Seins'". (Gadamer 1984; 34) Und was macht den
Text der (literarischen) Interpretation aus? Für den "Begriff des Textes" (Gadamer 1984; 31)
sei "festzuhalten, daß erst vom Begriff der Interpretation aus der Begriff des Textes sich als
ein Zentralbegriff in der Struktur der Sprachlichkeit konstituiert; das kennzeichnet ja den
Begriff des Textes, daß er sich nur im Zusammenhang der Interpretation und von ihr aus als
das eigentlich Gegebene, zu Verstehende darstellt." (Gadamer 1984; 34) 'Text' sei "als ein
hermeneutischer Begriff" aufzufassen: "Das will sagen, daß er nicht von der Perspektive der
Grammatik und der Linguistik her, d. h. nicht als Endprodukt gesehen wird, auf das hin die
Analyse seiner Herstellung unternommen wird, in der Absicht, den Mechanismus
aufzuklären, kraft dessen Sprache als solche funktioniert, im Absehen von allen Inhalten, die
sie vermittelt. Vom hermeneutischen Standpunkt aus - der der Standpunkt jedes Lesers ist -
ist der Text ein bloßes Zwischenprodukt, eine Phase im Verständigungsgeschehen, die als
solche gewiß auch eine bestimmte Abstraktion einschließt, nämlich die Isolierung und
Fixierung eben dieser Phase. Aber diese Abstraktion geht ganz in die umgekehrte Richtung
als die dem Linguisten vertraute. Der Linguist will nicht in die Verständigung über die Sache
eintreten, die in dem Text zur Sprache kommt, sondern in das Funktionieren von Sprache als
solcher Licht bringen, was immer auch der Text sagen mag. Nicht, was da mitgeteilt wird,
macht er zum Thema, sondern wie es überhaupt möglich ist, etwas mitzuteilen, mit welchen
Mitteln der Zeichensetzung und Zeichengebung das vor sich geht." "Für die hermeneutische
Betrachtung dagegen ist das Verständnis des Gesagten das einzige, worauf es ankommt.
Dafür ist das Funktionieren von Sprache eine bloße Vorbedingung. So ist als erstes
vorausgesetzt, daß eine Äußerung akustisch verständlich ist oder daß eine schriftliche
Fixierung sich entziffern läßt, damit das Verständnis des Gesagten überhaupt möglich ist. Der
Text muß lesbar sein." (Gadamer 1984; 35) Gadamers Bestimmung des Verhältnisses von
literaturwissenschaftlicher und sprachwissenschaftlicher Interpretation schreibt nurmehr die
etablierte, die institutionalisierte Diskrepanz zwischen literaturwissenschaftlicher und
sprachwissenschaftlicher Interpretationspraxis und Interpretationstheorie fort: so ist die
Bedeutung der Sprachanalyse für die (literarische) Textinterpretation nicht angemessen zu
bestimmen. Gadamers eigene Exemplifizierung einer hermeneutischen Interpretationspraxis
(Gadamer 1984; 54f) besteht denn auch in nichts anderem als einem eher intuitionistischen
Rekurs auf 'das Ganze' der (unterstellten) poetischen Intention: "Das innere Ohr hört hier (...).
Der Interpret, der seine Gründe beibrachte, verschwindet, und der Text spricht." (Gadamer
1984; 55). Ist der Literaturwissenschaftler also nichts anderes als die andere Stimme des
literarischen Erzählers?
Bekanntlich kritisiert M. Frank die unterlassene Auseinandersetzung zwischen
"Neostrukturalismus und Hermeneutik"{51}, der "Hermeneutik" als "die Kunst, eine Rede
oder Schrift richtig zu verstehen". (Frank 1984; 183) "Man muß", so konstatiert er, "die
Illussion eines ursprünglichen, mit sich identischen Textsinns fahrenlassen und sehen, daß
Text und Interpretation nicht zwei Seiten einer teilbaren Arbeit - der Produktion und der
Rezeption - sind, sondern daß bereits die im Text selbst verwobenen Ausdrücke nur kraft
einer Interpretation bestehen, d. h. den Status von Zeichen erwerben." (Frank 1984; 202)
Interpretation, so ließe sich das vielleicht verstehen, konstituiert erst den Text. "Nicht die
Auslegung verfehlt also - wie die Theoretiker einer 'objektiven Interpretation' (Betti, Hirsch
u. a.) wollen - den ursprünglichen Sinn der Textäußerung; der Text selbst besitzt Sinn nur diá
hypóthesin, nur vermutungsweise. Darum ordnet Saussure die Sprachwissenschaft dem
Spektrum der interpretierenden Disziplinen zu: Die Sprache steht in einem beständigen Reinterpretationsprozeß, der darin gründet, daß die von einer Sprachgemeinschaft
vorgenommene Artikulation/Differenzierung in jedem Augenblick neu und anders
vorgenommen werden kann". (Frank 1984; 202) Damit deutet er, anders als Gadamer, eine
semiologische Sprachauffassung und eine semiologisch fundierte Sprachwissenschaft an.
Allerdings legt er dabei die Verwechselung des abduktiven Schlusses{52} mit einem
'hypothetischen' - das soll wohl heißen: einem nur bis auf Weiteres treffenden Bedeutungszuschreibungs-Urteil nahe: Der "prinzipiell hypothetische Charakter jeder
denkbaren symbolischen Ordnung" sei es, "welcher die Einfältigkeit der regelgesteuerten
Sinnzuschreibung vereitelt". (Frank 1984; 203) Und er resümiert: "Jede Realisation eines
Sinns ist das Resultat einer niemals verifizierbaren Hypothese und also divinatorisch." (Frank
1984; 211){53} Damit radikalisiert er aber den Wahrheitsanspruch von Interpretationen auf
problematische Weise: Die Idee der definitiven Geltung von Interpretationen zu
verabschieden, muß ja mitnichten die Konsequenz haben, jeden Wahrheitsanspruch
aufzugeben. Es kommt vielmehr darauf an, den Begriff der Verifikation selbst
interpretationstheoretisch zu fassen: Wahr sind jene Interpretationen, die uns problem-,
situations- und erfahrungsbezogen stimmig und überzeugend erscheinen.
3.2Diskurstheorie: ein Ende der Hermeneutik?
Fohrmann/Müller erörtern den Zusammenhang von Diskurstheorien und
Literaturwissenschaft.{54} Sie stellen, so schreiben sie in der Einleitung ihres Buches{55},
als Alternativen "zum idealistischen Modell" "Diskurstheorien" vor, "die in der Regel als
Post- oder Neostrukturalismus etikettiert werden". (Fohrmann/Müller 1988b; 14) Für jenes
stehe, so ihre Kritik, etwa die von Jauß exemplarisch markierte Position einer "Begriffstrias
Autor, Werk und Leser" (Fohrmann/Müller 1988b; 9): "Autoren schreiben Texte, Texte
werden gelesen, und Lektüre veranlaßt Autoren zu neuer Vertextung, diese zu neuer Lektüre
usw. Der Autor erscheint als 'Produzent', als Urheber von Werken, die ihm 'zugerechnet'
werden können. Texte verweisen auf ihre Hersteller, deren Intentionalität in ihnen präsent
bleibt (...)." (Fohrmann/Müller 1988b; 9) Die der Jaußschen "Rezeptionsästhetik"
(Fohrmann/Müller 1988b; 10) zugrunde liegende "Textvorstellung" (Fohrmann/Müller
1988b; 9) beruhe auf der prekären Annahme: "Poetisches 'Bildungsvermögen' schafft ein
Kapital, das seinerseits eines Lektürevermögens (also einer Hermeneutik) bedarf, um
angeeignet zu werden." (Fohrmann/Müller 1988b; 10) "Hermeneutik" sei, so gesehen, "als
die Theorie verstehender Teilnahme, als dialogisch geregelte Partizipation an beide Pole
<Autor und Rezipient> umfassenden Sinnverhältnissen" orientiert. (Fohrmann/Müller 1988b;
10/11) "Der Sinn von Texten" werde hermeneutisch "in einer noch zu entschlüsselnden
Tiefenstruktur verortet, die als Signifikat fungiert." (Fohrmann/Müller 1988b; 11) "Das
individuelle Allgemeine als gemeinsamer Nenner für Autor, Text und Leser"
(Fohrmann/Müller 1988b; 11) sei eben eine problematische Konstruktion. Dieses Urteil ist
nichts weiter als eine polemische, eine tendenziöse Wertung der tatsächlichen Praxis der
Hermeneutik - und der Frankschen Aktualisierung der Tradition der Hermeneutik. Zwar
treffen Fohrmann und Müller zum Teil die gängige Praxis und das gängige Verständnis von
Interpretation; aber an der reflektierteren literarischen Hermeneutik etwa von Altenhofer geht
die Kritik denn doch vorbei: Der "interpretative Kommentar", die "Signifikantenkette des
Kommentars gibt sich als verstehendes Rearrangement, als Rekonstruktion, deren Zielpunkt
in der 'Bedeutung' des Textes liegt." (Fohrmann/Müller 1988b; 11) Was ist die Alternative?
Die Kritik des Phantoms der Hermeneutik ist läßt mitnichten bereits eine angemessene
Beschreibung dessen erkennen, was Literatur- oder Textwissenschaftler tun, wenn sie
Verständnisse von Textverständnissen beschreiben und beurteilen. Und selbst wenn man mit
Fohrmann/Müller darin übereinstimmte, daß das methodologische Problem "der bis heute
anhaltenden Geltung dieses Hermeneutikmodells, wo 'dialogisches' Verstehen
'monologisches' Beobachten eindeutig in den Dienst nimmt", das der "'Identität' von Teilhabe
und Beobachtung" sei (Fohrmann/Müller 1988b; 12), würde man hinsichtlich der Logik der
Interpretation und der Perspektive des Interpreten nicht unbedingt klüger. Soll Interpretation
als ein nicht-intentionaler Prozeß aufgefaßt werden müssen? Anscheinend bestehen
Fohrmann und Müller darauf: "Die Zuordnungszusammenhänge, die die Bedingung der
Möglichkeit der Verortung von Texten ergeben sollen, bedürfen fast alle eines Modells
intenional gerichteter, personaler Interaktion, das die Autor-Text-Leser-Triade als
Handlungszusammenhang zu fassen versucht." (Fohrmann/Müller 1988b; 12) Also wäre
diskurstheoretisch die Intentionalität der Interpretation, ja, das intentionale
Interpretationsvokabulars zu kritisieren? Sind Interpretationen keine Handlungen? Mir
scheint, daß die beiden Diskurstheoretiker eher einem intentionalistischen Mißverständis des
Zusammenhangs von Handlung, Sprache und Interpretation aufsitzen: Wenn Fohrmann und
Müller die "subjekttheoretische Annahmen" hermeneutischer Praxis (Fohrmann/Müller
1988b; 13) zu kritisieren meinen, dann treffen sie doch bestenfalls einen für die
sprachanalytisch fundierte Handlungstheorie ohnehin fragwürdigen, naiv-alltagstheoretischen
Begriff der Intentionalität. Die "diskurstheoretische Analyse" setzt, so behaupten sie, "auf
Subjektdezentrierung". Diskurstheoretische Konzepte bezögen "ihre Gemeinsamkeit aus
einer Negativgeste gegenüber einem allerorten vermuteten Logozentrismus."
(Fohrmann/Müller 1988b; 14) Aber ihre Argumentation lebt von schlechten Abstraktionen:
'Subjektzentrierung', 'Logozentrismus', das sind doch nur vage Kennzeichungen jener
Interpretationshaltungen, die sie für obsolet halten. Sie dienen der programmatischen
Abgrenzung auf dem Terrain philologischer Interpretationen von Interpretationskonzepten.
Mit ihnen markiert man gewissermaßen denjenigen Bereich des philologischen Diskurses,
innerhalb dessen man sich nicht (mehr) aufzuhalten bereit ist. Nur deshalb erscheint es auch
als überzeugend, wenn man konstatiert: "Entscheidend für alle diskurstheoretischen
Überlegungen ist so, daß tradierte Sinneinheiten nicht den Fundierungspunkt der Analyse
bilden. Damit erscheinen <sic!> Subjekt und Text nicht mehr als Ausgangsvoraussetzung
(...). Die Idee des Autors als kreativ-bildendes Subjekt, sprachmächtig und sprachschöpfend
zugleich, weicht der einer vorgängigen symbolischen Ordnung und der Vorstellung vom
Einzelnen als Schnittpunkt differenter Diskurse jenseits aller
Selbstdurchsichtigkeitsphantasmen." (Fohrmann/Müller 1988b; 15) So hilft auch die
beiläufige Anspielung auf Foucault nichts: Diese Behauptung auf die eigene
interpretationstheoretische Praxis anzuwenden, würde das Urteil dem Sinn und der
Möglichkeit nach selbst in Frage stellen.
"Texte" sind für Fohrmann und Müller nichts anderes "als zusammengesetzte und künstlich
zum Abschluß gebrachte disperse Einheiten, die sich aus Differenzen ergeben".
(Fohrmann/Müller 1988b; 16) Die "Intertextualität" und "Interdiskursivität", kurz die
"Pluraliltät eines Textes" habe für 'Beobachter' den Ausgangspunkt zu bilden.
(Fohrmann/Müller 1988b; 16). Deswegen sei "eine neue Theorie des Lesens" vonnöten
(Fohrmann/Müller 1988b; 17), eine die zur Folge habe, daß Texte durch Interpretationen
gerade "nicht vereindeutigt" werden. (Fohrmann/Müller 1988b; 17). "Wenn der Ingenieur nur
ein vom Bastler erzeugter Mythos ist, hätten sich die Textwissenschaftler dem Basteln, der
bricolage, zu stellen". (Fohrmann/Müller 1988b; 17) Aber: "Wie sind Text, Diskurs, Intraund Interdiskurs methodisch zu verbinden?" (Fohrmann/Müller 1988b; 18) "Welche
Verfahrensänderungen werden für diskurstheoretische Arbeiten in den Textwissenschaften
notwenig? Gibt es eine Wiederkehr der Hermeneutik, und - vor allem - wie hat diese
auszusehen?" (Fohrmann/Müller 1988b; 18) Diese interpretationsmethodisch wichtigen
Fragen sollen in dem von ihnen herausgegebenen Buch beantwortet worden sein. Jedenfalls
werde hier "der Versuch gemacht, zu einer neuen Lektüre oder Plazierung literarischer
Werke zu gelangen". (Fohrmann/Müller 1988b; 19) Zeigen das die weiteren Beiträge?
H. Müller thematisiert Kleist-Exegesen{56}. Er spricht sich dabei gegen "Hermeneutik als
spekulativer Karfreitag" aus. (Müller 1988; 83). Aber eine andere Methodik und Theorie der
Interpretation ist seiner Polemik mitnichten zu entnehmen. Daß "in der ironisch-distanzierten
Sicht Paul de Mans ästhetische Lesarten des Textes" (Müller 1988; 83) in den Blick kommen,
wird nurmehr behauptet. Das Verfahren de Mans - die "dekonstruktive - rhetorische Textanalyse" (Müller 1988; 85) wird nicht exemplifiziert. Sprachtheoretisch wird - das ein
beinahe durchgängiger Topos aller 'nach-hermeneutischen' Diskurse über diskursive
Interpretationsweisen und Interpretationsansprüche - auf einen mißverstandenen
Saussure{57} Bezug genommen: "Es handelt sich bei der de Manschen Variante von
deconstruction um den Entwurf einer Literaturtheorie, um den Entwurf einer Poetik, die
allerdings auf Grund von sprachtheoretischen Voraussetzungen weiß, daß Poetik und
Hermeneutik - entgegen der von der Rezeptionsästhetik Jaußscher Provenienz gehegten
illusionären Hoffnung - nicht synthetisierbar sind". (Müller 1988; 85) Unterschieden wird
nämlich im Sinne de Mans zwischen einem "außerlinguistischen Wahrheitswert literarischer
Texte" einerseits und einer "formale(n) Analyse linguistischer Entitätem als solcher,
unabhängig von Signifikation". (Müller 1988; 85). Eben diese Unterscheidung ist nichts
anderes als die Reetablierung genau jenes zweistelligen Zeichenmodells, das gerade Saussure
aufgegeben hat.{58} Wer behauptet, 'deconstruction' ziehe "radikale Konsequenzen aus der
de Saussureschen Annahme", "daß die Beziehung zwischen Wort und Ding konventionell ist,
ebenso wie aus der Annahme, daß die Signifikantenkette prinzipiell nicht abschließbar ist"
(Müller 1988; 86), kehrt nurmehr die Abbildtheorie der Sprache um und zieht daraus den
kühnen Schluß, daß das Verhältnis zwischen den Zeichen und der Wirklichkeit nurmehr
kontingent sei und keine Interpretation ein wirkliches Bild der wirklichen Wirklichkeit
vermittle. Der mißverstandene Saussure hat so als der Ziehvater der Diskurstheorie, des
Poststrukturalismus, des Dekonstruktivismus herzuhalten. Daß Hermeneutiker demgegenüber
denken, "daß zwischen Signifikant und Signifikat eine ontologisch oder organisch fundierte
Beziehung besteht" (Müller 1988; 86), ist deswegen nichts mehr als eine semiologisch
unbegründete Unterstellung.{59} Sprachtheoretisch gesehen ist deswegen auch die folgende
Behauptung keineswegs begründet: "Mit der Annahme der Nichtabschließbarkeit der
Siginfikantenkette lockert sich die referentielle Beziehung von Sprache; es gibt nicht den
Referenten, aber Referenzen". (Müller 1988; 87) So wird eben doch naiv-ontologisch gedacht
- um Ontologismen abzuwehren.
Die kritische Intention der diskurstheoretischen Argumentation Müllers geht am Problem der
Intentionalität der Interpretation vorbei: "Um es noch einmal zu verdeutlichen: die Poetik des
Textes ist nicht auf Bewußtseinsakte eines Autors rückführbar. Der Autor ist kein Schöpfer,
kein Sprachsouverän im strengen Sinne des Wortes." (Müller 1988; 88) Wer würde das, im
Ernst, noch unterstellen wollen? Auf 'Bewußtseinsakte' eines abstrakten Subjekts würde
heute allen Ernstes doch niemand mehr die Prozesse und Strukturen des Lesens und
Schreibens literarischer Texte zurückführen wollen. Das Problem ist vielmehr, mit welchem
Begriff der Intentionalität der Interpretation sich sinnvoll arbeiten läßt. Wenn "deconstruction
in Aporien" führt, "die es kenntlich zu machen gilt", dann verdanken die sich eher sprachund interpretationstheoretischen Mißverständnissen. Der interpretatorische
"Wahrheitsanspruch, der zumindest im Augenblick des Behauptens nicht relativiert werden
kann", führt jedenfalls in keine Aporie. Die "Ehe von deconstruction und Skepsis mit Ironie
als Stil- und Erkenntnisform" hat "ihre paradoxen Grenzen" (Müller 1988; 88) an der
diskurstheoretischen Begriffswelt selbst.
Fohrmann sieht den (literaturwissenschaftlichen) "Kommentar als diskursive Einheit der
Wissenschaft":{60} Mit Foucault sei "nach der säkularen Herrschaft der (Tiefen)Hermeneutik" eine "Änderung der Blickrichtung" eingetreten. (Fohrmann 1988; 246). Den
"ursprünglichen Text zu suchen und damit an Wahrheit teilzuhaben: Daraus haben die
philologischen Disziplinen ihr wissenschaftliches Ethos entwickelt" - so urteilt er. (Fohrmann
1988; 244) Eben diese Hermeneutik-Tradition treffe Foucaults kritischer Begriff der Lektüre
literarischer Texte: "Allein durch die Bearbeitung der Oberfläche - und dies ist das Novum,
das den Siegeszug der Textwissenschaften erst begründet - kann der Tiefenstruktur, die stets
als das Eigentliche gilt, als Zentrum, als Ordnung, ihre Wahrheit abgerungen werden. Es ist
der Kommentar, der so Monumente zu Dokumenten macht, indem er den verstreuten
Überlieferungen mit heiligem Pathos einen bislang verborgenen Sinnzusammenhang
unterlegt." (Fohrmann 1988; 245) Und "den Kommentar zu umgehen", sei nicht möglich. Es
bedürfe nurmehr "einer Neusituierung, nicht aber einer Beerdigung des Kommentarbegriffs".
(Fohrmann 1988; 246) Was aber ist der Kommentar? "Die Einheit des jeweiligen
Kommentars ist eine diskursive Einheit." (Fohrmann 1988; 247) Es "schließt der Kommentar
an bestehende Kommentare des Diskurssystems an". (Fohrmann 1988; 247)
Systemtheoretisch begriffen: das "Feld der Kommentare" ist "selbstreferentiell aufgebaut",
Kommentare stehen "nicht hinter, sondern vor den literarischen Texten"; das bedeutet: "in der
Arbeit der Kommentare wird das zu bearbeitende Objekt zugleich erzeugt". "Nicht die
literarischen Texte, sondern die anderen Kommentare des Wissenschaftssystems und damit
eine wechselnde Matrix je eigentümlicher Verfahren organisieren die Produktion jedes neuen
Kommentars." Denn das "Angemessenheitskriterium selbst hat ja kein Fundamentum in re,
sondern ist lediglich ein Regularium, mit dem der Wissenschaftsdiskurs seine
Kommentarentscheidungen zu begründen versucht." (Fohrmann 1988; 248) "Textauslegung
hat dann kein lebensweltliches Dialogmodell zwischen Text und Leser zur Voraussetzung
sondern die diskursiven Möglichkeiten eines Systems." (Fohrmann 1988; 248/249) Mit
anderen Worten: Interpretationen sind Elemente von Diskursen über Texte; Interpretationen
sind wahr relativ zu relevanten Interpretationspraktiken, -geschichten, -standards und kriterien der Interpretationswissenschaft(en). In eben diesem Sinne können sie zum
Gegenstand interpretationstheoretischer und interpretationsanalytischer Untersuchungen
gemacht werden. "Weder die individuelle, noch die soziale Lebenswelt, sondern die
disziplinäre Gemeinschaft der Literaturwissenschaft bildet daher den Rahmen, der die
Bedingungen und Möglichkeiten des Kommentars über literarische Texte bestimmt."
(Fohrmann 1988; 249) Das heißt, "daß die disziplinäre Gemeinschaft für den
literaturwissenschaftlichen Kommentar als grundlegende Einheit zu betrachten ist".
"Literarische Texte erscheinen im Wissenschaftssystem daher erst in ihrer Bearbeitung durch
(vornehmlich) den Kommentar, und jede Neukommentierung ist eine Kommentierung im
Wissenschaftssystem." (Fohrmann 1988; 249) Dem wird man (vielleicht bis auf den
Systemtheorie-V-Effekt) sicher zustimmen können. Aber bezieht nicht auch Fohrmann
Position gegenüber Interpretationskonzepten, die niemand im Ernst vertritt, der seine eigene
wissenschaftliche Praxis reflexiv organisiert?
Die Reflexion über die diskursive Genese des literarisch-ästhetischen Wissens, die Reflexion
der literarischen und literaturwissenschaftlichen Sozialisation des Literaturwissenschaftlers
wäre ja ein zentrales Thema literaturwissenschaftlicher Forschung. Eben dabei wären
Relevanz- und Wahrheitsfragen (das, habe ich den Eindruck, sieht auch Fohrmann so)
keineswegs belanglos: Die wissenschaftliche Interpretation von Kommentaren als Elementen
von Interpretationsdiskursen hätte zu zeigen, inwieweit sie anschlußfähig sind. Andernfalls
wären beliebige Kommentierungsweisen und Kommentierungsgeschichten denkbar.
Aber was sind die Kriterien für die Anschließbarkeit der Kommentare, und was sind die
Kriterien der angemessenen Referenz auf die literarischen Texte? Fohrmann argumentiert auf
den ersten Blick semiologisch: "Allgemeiner läßt sich formulieren: der Kommentar errichtet
eine Signifikantenkette (den Kommentar) über eine andere Signifikantenkette (den Text), in
der Absicht, diese zweite Signifikantenkette so zu (re-)arrangieren, daß eine
Signifikatfunktion zugewiesen werden kann." (Fohrmann 1988; 250) Allerdings ist das
sprachtheoretisch und sprachanalytisch gesehen eine gänzlich unzureichende Antwort. Sie
besagt ja nichts weiter, als daß einem literarischen Text mit der Interpretation irgendwie eine
Bedeutung zugeschrieben werde. Worin das Kommentieren besteht, ist damit noch nicht
verständlich gemacht. Vielmehr bleibt es bei einem semiotisch stilisierten Meta-Kommentar:
"Die Arbeit des Kommentierens ist (...) ein formales Verfahren: Die Signifikantenkette des
Kommentars rückt die Signifikantenkette des Textes in jenes rechte Licht, das die 'wirkliche'
Bedeutung, das Signifikat, freigibt." (Fohrmann 1988; 251) Die 'wirkliche Bedeutung' ist also
eine Konstruktion des Interpreten - in Anführungszeichen gesetzt? "Je unterschiedlich
werden also Texte auf wechselnde Signifikate bezogen: klassifikatorisch oder temporal,
genetisch oder funktional." (Fohrmann 1988; 251) "Verfahren und Gegenstandsbezug heißen
die Kriterien, die über Angemessenheit entscheiden und die nicht eigen-systemische
Diskursivität erst in Umschreibungen passieren lassen." (Fohrmann 1988; 251/252)
Leider zeigt auch Fohrmann nicht exemplarisch, wie er sich die Praxis des Kommentierens
vorstellt - oder wie Praktiken des Kommentierens zu lesen und zu werten wären. Er beläßt es
bei einer programmatischen literaturtheoretischen Erklärung: "Der Kommentar als
identifizierbare Einheit übernimmt so eine Reihe von Funktionen: Er realisiert Bedeutung,
wenn er einen zweiten Text über einen ersten produziert. Er ist Ordnung und stellt zugleich
Ordnung her, wenn er klassifikatorisch (Gattungen...), temporal (Epochen...) oder personal
(Autor, Werk...) zuschreibt; er inszeniert Ordnung, wenn er alle Kunstfertigkeit aufwendet,
um den Eindruck von Stimmigkeit rhetorisch zu erzeugen. Und schließlich schließt der
Kommentar damit an schon bestehende Kommentare an und grenzt sich - als einzigartig
zugleich von diesen Kommentaren wieder ab." (Fohrmann 1988; 253/254) Wie
"Wissenschaftsforschung" dann die "Genealogie signifikativer Zuordnungen" zum
Gegenstand machen kann (Fohrmann 1988; 254), eben das bleibt der Phantasie des
literaturwissenschaftlichen Lesers überlassen. Man kann nur ahnen, um was es dabei gehen
wird: "Der Kommentar steht selbst zur Untersuchung an. Seine Organisation und das, was sie
bedingt, sind zu analysieren. Was die Kommentare formiert, muß der Zuweisung einer
Bedeutung zunächst vorgelagert sein. Damit also geht es um Wissenschaft und
'Wissenschaftsgeschichte'." (Fohrmann 1988; 254)
Was sonst als eine literaturwissenschaftlichen Hermeneutik der literarischen Hermeneutik
wäre das diskurstheoretisch stilisierte Projekt? Die auch von Fohrmann in der Verkleidung
der 'Rezeptionsästhetik' ausgemachte Hermeneutik wäre durch diese KommentarKommentierungs-Wissenschaft noch längst nicht in Frage gestellt. Eine "fröhliche
Fortschreibung der Tradition" (Fohrmann 1988; 255) wäre noch keineswegs ausgeschlossen.
Die "nicht abschließbare Zuschneidung literarischer Werke durch kommentierende Arbeit"
im "Wissen um Selbstbezüglichkeit" (Fohrmann 1988; 255) könnte, literaturtheoretisch
überhöht, beliebig weitergehen. Auch dann, wenn man die Interpretationsforschung zur
Wissenschaftsforschung erklärt.
3.3Systemtheorie und/oder Radikaler Konstruktivismus: Abschied von den Ontologismen?
Konjunktur haben gegenwärtig ja auch Erörterungen über das Verhältnis von
Literaturwissenschaft und Systemtheorie.{61} Schönert nimmt mit einem ironisch gefärbten
Siegener Vortrag über das Programm einer 'Empirischen Literaturwissenschaft' im Stile des
Radikalen Konstruktivismus{62} eine Abgrenzung "des konstruktivistischen Konzepts gegen
hermeneutische, dialektische, analytische und 'empirisierende' Ansätze" der
Literaturwissenschaft vor. Der "Gegenstandsbereich" einer empirischen
Literaturwissenschaft, so konstatiert er, sind "nicht Texte, sondern
Kommunikationshandlungen über Texte"; "Texte" gelten dabei als "Ansatzpunkt von
literarischen Kommunikationshandlungen und Sinnproduktionen". (Schönert 1985; 3) "Zu
untersuchen wären die jeweils geltenden Konventionen, die Normen und Regeln für
Produktion, Distribution, Rezeption und Verarbeitung von Literatur und die verschiedenen
Stufen der literarischen Sozialisation." (Schönert 1985; 4) Interpretationen (von
Interpretationen) bilden so gesehen den Gegenstand der Textwissenschaft. Konstitutiv sei
dabei die "Funktionsfrage, welche Rolle die literarischen Konstruktionen von Wirklichkeit in
den individuellen und gesellschaftlichen Entwürfen von Realität spielen". (Schönert 1985;4)
Eben deswegen bedürfe es des Bezugsrahmens einer "Theorie der literarischen
Kommunikation" (Schönert 1985; 5), die die "öffentliche, in bestimmten Rollen und
Handlungssituationen institutionalisierte Auslegung literarischer Texte", als eines "kulturell
verankerten Expertengesprächs über Literatur" - und damit eben auch "gegenwärtige
Rollenbilder des Philologen", von den "Textegeten und Homiletikern bis hin zum Literatur-
Animateur und Trainer für 'literarische Sensibilität'" - zum Gegenstand hat. (Schönert 1985;
7) So fundiert führe sie über das unverbindliche Spiel "derridadaistischer Lektüre, magischer
Einfälle und geistreicher Selbstbespiegelung der Interpreten" (Schönert 1985; 10) hinaus.
Schönert thematisiert aber nicht die interpretationstheoretischen und
interpretationsanalytischen Probleme einer systemtheoretisch orientierten
Literaturwissenschaft. Und das tun auch deren Programmatiker nicht.
Im Gegenteil. S. J. Schmidts Plädoyer für "Kommunikationskonzepte für eine
systemorientierte Literaturwissenschaft" auf der Basis (s)eines 'Radikalen
Konstruktivismus'{63} schreibt das intentionalistische Mißverständnis der hermeneutischen
Praxis und das abbildtheoretische Mißverständnis der hermeneutischen Theorie der
Interpretation literarischer Texte nurmehr fort. Aus der Einsicht, daß Interpretationen (medial
vermittelte) Konstruktionen sozialer Systeme sind, scheint für ihn zu folgen, daß die Rede
vom Subjekt der Interpretation keinen Sinn mehr macht. Die Erkenntnis, daß jede
Wahrnehmung und jede Erkenntnis (medial vermittelte) Interpretation ist, scheint den Schluß
zuzulassen, daß Abbildtheorien der sprachlichen Darstellung auf den Kopf zu stellen sind. So
jedenfalls lautet das Programm des Radikalen Konstruktivismus.
Tatsächlich läßt sich aber, gerade in den aktuellen literaturtheoretischen Studien von S. J.
Schmidt, eine Veränderung der systemtheoretischen Begriffspolitik erkennen. Zum einen
wird eine Distanzierung von Luhmanns Systemtheorie, zum anderen eine Annäherung an den
Pragmatismus versucht. So fragt sich Schmidt beispielsweise, "ob das theoretisch durchaus
begründbare Vorhaben, Kommunikation ohne Referenz auf Aktanten zu beschreiben (und
das heißt ja doch auch: zu beobachten!), überhaupt durchführbar ist" und ob es nicht gerade
darauf ankomme, "Luhmanns Kommunikationstheorie kritisch zu beobachten" (Schmidt
1993b; 241f); im Hinblick darauf nämlich, "ob eine systemtheoretische Literaturwissenschaft
Luhmannscher Prägung nicht ein handlungstheoretisches Defizit aufweist". (Schmidt 1993b;
242) Aber was wäre eine handlungstheoretische Reorientierung? Schmidts Eindruck ist: "In
den meisten der heute vertretenen Kommunikationstheorien gibt es einen stillschweigenden
Konsens, Kommunikation von den kommunizierenden Individuen (Kommunikatoren,
Kommunikanden) her zu modellieren". (Schmidt 1993b; 243). Aber der dürfte auf den
aktuellen sozialwissenschaftlichen{64} und semiologischen Pragmatismus{65} wohl kaum
zutreffen. Überdies löst die systemisch-konstruktivistisch gedachte, neurobiologisch
begründete Unterscheidung von Bewußtsein und Kommunikation{66} mitnichten die
Aporien von Luhmanns Differenzierung zwischen dem Individuellen und dem Sozialen
auf:{67} Schmidt meint konstatieren zu müssen, daß "Bewußtsein und Kommunikation
operativ anders arbeiten und getrennten Bereichen zugehören: Bewußtsein dem Bereich des
Individuums, Kommunikation dem Bereich des Sozialen". (Schmidt 1993b; 246) Da denkt er
wie Luhmann. Daneben regt er aber an, "Kommunikation in der Doppelperspektivierung auf
kognitive und soziale Systeme hin konkret zu bestimmen" (Schmidt 1993b; 251), und
plädiert für einen entsprechenden Wissensbegriff, der "die Entscheidung obsolet" mache,
"Wissen entweder der Kognition oder der Kommunikation zurechnen zu müssen". (Schmidt
1993b; 250) Denn "auch Wissen entsteht erst durch strukturelle Kopplung von Kognition und
Kommunikation über kollektives Wissen bzw. im allgemeinsten Sinne über Kultur".
(Schmidt 1993b; 251) Also "scheint kein gewichtiger Grund dagegen zu sprechen, auch
Individuen mit der Unterscheidung Kognition/Kommunikation zu beobachten" und "auf den
Handlungsaspekt und den Aktantenaspekt zu verzichten". (Schmidt 1993b; 253) Aber wie
ließen sich Systemtheorie und Handlungstheorie miteinander vermitteln?
Mit welchem Begriff (der Konstitution und der Geltung) intersubjektiven Wissens operiert
Schmidt praktisch? Wie kann der Wissenschaftler empirisches Wissen über Wissen bilden?
Schmidt stellt fest, "daß streng genommen nur der Bezug von Medienangeboten auf
Medienangebote beobachtbar ist" (Schmidt 1993b; 255), aber er deutet diese Aussage
kulturalistisch (wenn man so will: wissenssoziologisch{68}) um: Den Gegenstand der
empirischen Literaturwissenschaft bilden für ihn "symbolische Ordnungen in Form
kollektiven Wissens"; insbesondere "Diskurse", verstanden als "strukturierte und kohärente
Zusammenhänge spezifischer Wissensbestände und Themen, die mithilfe spezifischer Erzähl, Darstellungs- bzw. Argumentationsformen, mit spezifischen Metaphern und
Kollektivsymbolen (sensu J. Link) kommunikativ abgehandelt werden und deren Kohärenz
reflexiv überprüft wird (bzw. werden kann)". (Schmidt 1993b; 257) "Mein Versuch läuft
darauf hinaus, Bedingungen anzugeben, die zu einem Wandel der Produktion und Rezeption,
Vermittlung und Verarbeitung solcher Phänomene geführt haben, die die Zeitgenossen nach
ihren ästhetischen Kriterien für literarisch gehalten haben." (Schmidt 1993b; 263). Also wäre
die praktische Empirie der konstruktivistischen Literaturwissenschaft ein Diskurs über
Diskurse über literarische Diskurse? Wer aber würde dabei die interpretativen Standards
setzen? Inwieweit könnte die Analyse dabei von ästhetischen Kritierien und einer Theorie des
Ästhetischen absehen? Da Schmidt sein (modifiziertes) Konzept des literaturtheoretischen
Konstruktivusmus nicht exemplifiziert, bleibt es (wohl nicht nur dem Leser) unklar, welche
Rolle das literarisch-ästhetische Wissen des wissenschaftlichen Diskursanalytikers selbst
spielt.
Auch mit seinem neuen Versuch einer begrifflichen Grundlegung der Medienforschung{69}
überwindet S. J. Schmidt die interpretationstheoretischen Defizite seines Konstruktivismus
nicht. Der Beobachter der sozialen Systeme literarischer Kommunikationen wird hier
konstruiert als der künstliche Halbbruder des hermeneutischen Interpreten: "Die Einheit der
Unterscheidung, mit der beobachtet wird, gibt es nur im jeweils beobachtenden System.
Dementsprechend liefern Wahrnehmen und Erkennen keine getreuen Abbildungen der
Umwelt; sie sind Konstruktionen, die (...) auch anders ausfallen können." (Schmidt 1994; 7)
Gegenüber der Umwelt des Literatursystems verhält sich das System der
Literaturwissenschaft als ein Unterscheidungen hervorbringendes System: "Konstruktive
Unterscheidungen bewähren sich nicht im unmittelbaren Vergleich mit der Umwelt.
Vielmehr kontrolliert jedes beobachtende System seine Wirklichkeitsannahmen rekursiv (d.h.
durch Beobachtung seiner Beobachtungen oder durch die Beobachtung anderer Beobachter)
auf ihre Konsistenz, ihre Anschließbarkeit und ihren Erfolg hin (...)." (Schmidt 1994; 7) Der
Diskurs der Literaturwissenschaft erzeugt das Bild der literarischen Welt, das er beschreibt:
"Konstruktion von Wirklichkeit ist (...) ein selbstreferentieller, selbstorganisierender und sich
selbst legitimierender Prozeß, an dem Individuen in ganz unterschiedlichem Maße beteiligt
sind." (Schmidt 1994; 14)
Das Medium der Konstruktion ist die Sprache. Aber welche? Wie (er)findet der
Konstruktivist sein analytisches Vokabular? Schmidts sprachtheoretische Überlegungen
erschöpfen sich bei den bekannten systemtheoretischen Andeutungen im Stile
Luhmanns{70}: "Wahrnehmen und Erkennen" seien "systemabhängige Handhabungen von
Unterscheidungen und Benennungen". (Schmidt 1994; 8) "Beobachtung" sei "eine
empirische, ihrerseits beobachtbare Operation, die immer empirisch konditioniert ist." Zu den
"empirischen Konditionierungen" gehöre "aber auch in besonderem Maße Sprache, die in
einem langen Prozeß der (Selbst-)Sozialisation erworben wird." (Schmidt 1994; 13) Dabei sei
vorausgesetzt, "daß Sprache im konstruktivistischen Diskurs nicht nur als semiotisches
System, sondern als sozial sanktioniertes Instrument der Verhaltenskoordinierung gesehen
wird." Denn "Sprache reguliert Verhalten, indem sie Unterscheidungen benennt,
intersubjektiv vermittelt und damit sozial zu 'prozessieren' erlaubt." (Schmidt 1994; 13) Der
einzelne (wissenschaftliche) Interpret, jeder "individuelle Aktant" sei "gewissermaßen ein
Schnittpunkt von Constraints, kein autonomer oder gar willkürlicher Sinnproduzent."
(Schmidt 1994; 13) Doch wer hätte je behauptet, der Interpret verfahre bei seinen
Interpretationen autonom oder willkürlich? (Welche Subjektphilosophie wird hier karrikiert?)
Und wer nähme gegenwärtig noch eine Sprachauffassung ernst, nach der zwischen
Unterscheidungen und Benennungen von Unterscheidungen unterschieden werden können
soll? Wer würde heute noch mit einem verhaltenstheoretisch akzentuierten Konzept
symbolischer Interaktion operieren wollen?{71} Schmidts Konzept einer konstruktivistischen
Theorie der Interaktion sozialer Systeme entbehrt offensichtlich der sprachtheoretischen
Begriffsklärung und Begriffsbildung.
Schmidts Darstellung des "Konstruktivismus in der Medienforschung"{72} läßt die Konturen
der Gestalt des Beobachters keineswegs deutlicher werden. Sein Versuch, konstruktivistischsystemtheoretische Überlegungen und Begriffe pragmatistisch zu aktualisieren (oder sollte
man feststellen: den aktuellen philosophischen und sprachanalytischen Pragmatismus
konstruktivistisch zu reinterpretieren?), erscheint mir eher mißlungen. Seine Kritik der Kritik
am Konstruktivismus ist nicht überzeugend. Seine Argumentation ist diese: Zunächst
unternimmt er eine kultursoziologische Umdeutung des Konstruktivismus: "Wahrnehmen,
Denken, Fühlen, Handeln und Kommunizieren sind (...) geprägt von den Mustern und
Möglichkeiten, über die der Mensch als Gattungswesen, als Gesellschaftsmitglied, als
Sprecher einer Muttersprache und als Angehöriger einer bestimmten Kultur verfügt."
"Kollektives Wissen, das individuelles Handeln orientiert und reguliert, resultiert aus
sozialem Handeln der Individuen und orientiert wiederum deren soziales Handeln. Als
soziales Handeln kann kommunikativ gerichtetes Handeln gelten, das über
Erwartungserwartungen reflexiv auf die Ebene sozialen bzw. kollektiven Wissens gerichtet
ist und sich konventionalisierter Ausdrucksformen bedient." (Schmidt 1994; 594)
"Wirklichkeitskonstruktion wird hier näher bestimmt als ein empirisch hoch konditionierter
sozialer Prozeß, in dem sich Modelle für (nicht von) ökologisch validen
Erfahrungswirklichkeiten/Umwelten im sozialisierten Individuum als empirischem Ort der
Sinnproduktion herausbilden." (Schmidt 1994; 595)
Sodann versucht er den konstruktivistischen Sprachbegriff pragmatistisch zu präzisieren;
freilich ohne zwischen den unterschiedlichen Konzepten von Humboldt, Maturana, Morris,
Wittgenstein usw. hinreichend zu differenzieren: "In jüngster Zeit läßt sich eine deutliche
Annäherung zeichentheoretischer Sprachkonzeptionen an instrumentalistische und
pragmatistische Sprachtheorien beobachten": "Sprache wird hier theoretisch modelliert als
soziales Instrument bzw. als soziale Institution der Verhaltenskoordinierung." (Schmidt 1994;
596) "Die Unterscheidungen, die Sprachen benennen, stammen aus dem Sprechen und sind in
ihren Leistungen auf das Sprechen bezogen. Sprecher nutzen Unterscheidungen, um
Erfahrungen, Vorstellungen usw. zu artikulieren; und umgekehrt werden solche
Nutzungserfahrungen zum Bestandteil sprachlichen Wissens, und der Gebrauch von Sprache
orientiert sich an solchen Erfahrungen mit Sprache." (Schmidt 1994; 596) Mit derartigen
Aussagen meint er den Zusammenhang von Sprache und (kollektivem) Wissen plausibel
gemacht zu haben: "Common Sense ist sprachliches Wissen und sprachliches Wissen ist
Common Sense." (Schmidt 1994; 597) Tatsächlich gehen solche Differenzierungen aber an
den Einsichten der gegenwärtigen sprachanalytischen Philosophie und ihrer pragmatistischen
Tradition vorbei. Vielmehr läuft alles auf eine Soziologisierung des von der
Gründungsgeschichte des Konstruktivismus her naheliegenden sprach- und
wissenstheoretischen Naturalismus hinaus: Soziales Wissen ist kulturell verankert, "Kultur
ko-ordiniert Kognition wie Kommunikation über kollektives Wissen, das allerdings im
Individuum als empirischem Ort der Sinnproduktion immer wieder neu produziert werden
muß (...)." (Schmidt 1994; 600) "Dieses kulturelle Wissen wird beobachtbar und beschreibbar
in Form symbolischer Ordnungen (wie zum Beispiel Schemata, Grammatiken, Erzählmuster,
Diskurse, Stilistiken) (...)." (Schmidt 1994; 600).
Mit einem dritten Schritt versucht Schmidt die Funktion des (wissenschaftlichen)
Beobachters deutlicher zu bestimmen: "Sobald wir wahrnehmen und reden, agieren wir als
Beobachter (als Aktanten und Kommunikatoren) innerhalb einer Kultur (...)." (Schmidt 1994;
602) In "der Perspektive des Beobachters zweiter Ordnung" wird dann "jede Sinnproduktion
- von der Wahrnehmung bis zur Theoriebildung - (...) "zeitrelativ, das heißt sozial und
kulturell determiniert. (Schmidt 1994; 603) Aber diese Formulierung stellt nichts anderes als
eine abstrakte, konstruktivistische Paraphrase der pragmatistischen Beschreibung der
Reflexivität der Struktur der Interpretation (der Interpretationen) dar.
Schließlich skizziert er seine Antwort auf die interpretationstheoretisch zentrale Frage nach
dem Sinn von Interpretationen: "Haben Medienangebote Bedeutungen?" (Schmidt 1994; 615)
Er beantwortet sie nur scheinbar radikal: "Im Zentrum steht dabei die von Konstruktivisten
vertretene These, daß Medienangebote (Texte, Fernsehsendungen usw.) ihre Bedeutung nicht
in sich selbst enthalten, sondern daß ihnen Bedeutungen von Kommunikanden attribuiert
werden." "Ohne Produzenten und Distributoren keine Medienangebote, ohne Rezipienten
keine 'Lektüren' solcher Angebote: Information, Bedeutung oder Sinn 'gibt es' nach diesen
Prämissen nicht in Medienangeboten, sondern nur im kognitiven System, 'in den Köpfen' von
Menschen." (Schmidt 1994; 615) "Medienangebote" "transportieren" "keine Information,
sondern lediglich mustergeprägte Zeichenketten. Dadurch liefern sie konventionalisierte
Anlässe für individualisierte Sinnkonstruktionen, die in ihrem Verlauf, ihrer subjektiven
emotionalen Besetzung und hinsichtlich der Einschätzung ihrer lebenspraktischen Relevanz
nur vom einzelnen Individuum realisiert werden können und daher von Individuum zu
Individuum je nach Textsorte, Kontext und individueller Disposition unterschiedlich stark
variieren." (Schmidt 1994; 615/616) Die Konstruktivität des Mediengebrauchs sei die
wesentliche Entdeckung der gegenwärtigen Medienforschung: "Wie die Wirkungsforschung
inzwischen gelernt hat (...), machen die Menschen etwas mit den Medien, nicht umgekehrt,
obwohl (oder gerade weil) intersubjektiv geteiltes soziokulturelles Wissen die Produktion
und Rezeption von Medien intersubjektiv prägt." (Schmidt 1994; 616) "Denn die Wirkung
dieser Angebote aber wird bestimmt von den Nutzergewohnheiten und -erwartungen, von
Motivationen und emotionalem Engagement, von Rezeptionsstrategien (z.B.
involviert/distanzlos vs. kritisch/analysierend) usw." (Schmidt 1994; 616) Mit anderen
Worten: "Da kulturell geprägtes kollektives Wissen Kognition und Kommunikation orientiert
und bei der Produktion wie Rezeption von Medienangeboten unausweichlich benutzt wird,
bleibt jede Bedeutungsattribuierung an Medienangebote gebunden an kognitive Systeme und
ermöglicht dennoch - durch reflexiven Bezug aller Beteiligten auf kollektives Wissen erfolgreiche Kommunikation." (Schmidt 1994; 615) Bedeutung und Sinn sind also, kurz
gesagt, sozial konstituierte kognitive Konstruktionen; die "Konstruktivität als generelles
Prinzip aller beobachtenden Systeme" und "die kognitive Verfassung unserer Wirklichkeit"
(Schmidt 1994; 618) sind nicht hintergehbar.
Doch gegen diese argumentativen Konstruktionen läßt sich das eine oder andere einwenden:
Wie soll man den Text als Angebot, als Auslöser von Interpretationen verstehen? Und wie
entsteht die Bedeutung von Texten? Daß Texte keine Bedeutung 'an sich' haben ist eine an
sich schon unstrittige, weil schlichtweg unsinnige Behauptung, die - und das scheint mir die
entscheidende Implikation auch ihrer Umkehrung zu sein - nichts anderes als bedeutungsund sprachtheoretischen Nonsens darstellt: Bedeutung ist immer eine interpretative Leistung
des Interpreten; aber Bedeutung ist immer an das Verständnis des Textes gebunden. Die
Radikalisierung des Bedeutungsbegriffs verdankt sich wohl dem fatalen Umkehrschluß, daß
Bedeutung - wenn sie schon nicht im Text selbst enthalten sei - nur im Kopf des Lesers
entstehen könne. Als ob der Text nicht gerade das Entstehen seiner Bedeutung provozierte!
Ist Interpretation überdies nichts anderes als Rezeption? Wie würden dann die Rezeptionen
des Rezeptionsanalytikers verständlich und einsichtig zu machen sein? Kann sich der
Literaturwissenschaftler als Interpret der Interpretationen (derjenigen Interpretationen, die die
Texte selbst darstellten) zum externen Analytiker, oder sollte er sich zum weiteren
Rezipienten stilisieren? Schmidt blendet, so scheint mir, die meta-reflexive Rolle des
Beobachters (der Beobachtungen (der Beobachtungen)) einfach systematisch aus. Eine
'Rekursivität' der Interpretationen zu unterstellen (und diese mit deren Reflexivität zu
verwechseln), löst das Problem des Zusammenhangs zwischen der eigenen Rezeption und
den Rezeptionen anderer ja nicht. Daß man den "Einschluß des Beobachters in die
Beobachtungen" "als wichtiges Argument" akzeptiert, muß man epistemologisch gesehen
mitnichten antirealistisch begründen: Keineswegs folgt nämlich "daraus, daß sich
menschliches Wissen nicht auf 'die Realität' bezieht, sondern auf menschliches Wissen von
der Realität" (Schmidt 1994; 617) der radikale Kognitivismus. Ein "pragmatischer
Wahrheitsbegriff", das ahnt auch Schmidt selbst, ist anderes zu begründen: "Wissen resultiert
aus Handeln, leitet Handeln kognitiv an und konstituiert dessen Sozialität und
Kulturspezifik." (Schmidt 1994; 617) Kurz: Die "Einsicht in die Konstruktivität als
generelles Prinzip aller beobachtenden Systeme" zu behaupten, ist eine Sache, dabei "die
kognitive Verfassung unserer Wirklichkeit" zu unterstellen, sehr wohl eine andere. (Schmidt
1994; 618) Interpretationen haben Bedeutung, Interpretationen sind nur wahr relativ zu
unseren Interpretationsgewohnheiten und Interpretationsansprüchen; Interpretationen nehmen
aber immer Bezug auf eine (durch Interpretationsgeschichten) erschlossene Welt.
Wie kann eine empirische Literaturwissenschaft arbeiten? "Was aber kann 'emipirisch' für
Konstruktivisten noch bedeuten?" (Schmidt 1994; 621) Auffallend ist ja die kausalistische
Diktion der Bestimmung des Einflusses, der Wirkung von 'Medienangeboten': Deren
Rezeption werde 'geprägt' von etwas, ihre 'Bedeutung' werde ihnen 'attribuiert',
'mustergeprägte Zeichenketten' 'liefern Anlässe für etwas anderes', 'Sinnkonstruktionen'
können nur vom einzelnen Individuum 'realisiert' werden, die 'Wirkung der Medienangebote'
werde 'bestimmt' von soziokulturellen Gewohnheiten usw. Was für ein Wirkungsbegriff ist
hier im Spiel? Soll etwa die Wirkungsforschung re-etabliert werden? Wie es scheint, wohl
doch nicht: konstruktivistisch-systemtheoretische Literaturforschung soll offenbar
operationalistisch konzipiert werden: Das "zentrale Kriterium für Wirklichkeit" sei
"Stabilität". "'Denkresultate'", so Schmidt mit Kruse{73}, "'werden von uns unter anderem
immer dann als wirklichkeitsbezogen eingestuft, wenn sie gezielte Vorhersagen ermöglichen,
das heißt eine stabile Handlungsgrundlage bilden, wenn sie reproduzierbar, das heißt logisch
stabil, und vermittelbar, das heißt sozial stabil sind.'" (Schmidt 1994; 621) "'Empirisch
forschen' kann dementsprechend bestimmt werden als Herstellung logischer, pragmatischer
und sozialer Stabilitäten, mit denen Wissenschaftler wie mit unabhängigen Gegenständen
kommunikativ umgehen." (Schmidt 1994; 622) Daraus folgt: "Konsequenterweise muß also
'empirisch'von der traditionellen Referenz auf 'die Realität' und den Beobachter erster
Ordnung umgepolt werden auf Kognition und methodisch kontrollierte Beobachtung zweiter
Ordnung." Kurz: "Wissenschaftliches Denken ist (...) zu einem theoretischen Pluralismus
verpflichtet." (Schmidt 1994; 622) Also hat man einen theoretischen Perspektivismus der
literaturwissenschaftlichen Interpretation literarischer Interpretationen zum Programm zu
erheben? Wie hätte man sich die praktische Empirie systemtheoretisch-konstruktivistischer
Art dann vorzustellen?
Proben der Exemplifizierung des konstruktivistischen Paradigmas stellt Scheffer vor.{74} Er
thematisiert dabei interpretationsanalytische Probleme, die Schmidt nicht zu sehen scheint.
Im dritten Abschnitt des dritten Kapitels seiner 'konstruktivistischen Literaturtheorie'
skizziert er mit Bezug auf seine Arp-Lektüre exemplarisch sein Konzept des
Textverständnisses. "Die einzig adäquate Interpretation", so akzentuiert er ironisch, "ist das
Zitat." (Scheffer 1992; 267) Seine Überlegungen treffen meines Erachtens genau den Punkt,
an dem die gegenwärtigen "Überlegungen der Analytischen Philosophie zum
Interpretationsproblem" (Scheffer 1992; 52) relevant werden - wenngleich anders, als
Scheffer selbst anzunehmen scheint. "Alles, was Texte von sich aus zu sagen scheinen", so
pointiert er, "sind bereits Interpretationen." (Scheffer 1992; 270) "Das Dilemma des Redens
über Texte" sei eben dieses: "Einerseits kann man das, was der Text zu sagen scheint, nicht
anders sagen - andererseits muß man das, was der Text zu sagen scheint, anders sagen, um
überhaupt etwas verstehen zu können; kein Text kann für sich selber sprechen. Das, was da
steht, gibt es erst durch das Darüber-Reden (mit sich selbst, mit anderen)." (Scheffer 1992;
271) "Sprachgebrauch läßt sich immer nur in dem Ausmaß verstehen, in dem man den
vorgegebenen Text in diesem Verstehensprozeß verändert, paraphrasiert, assoziiert, mit
Folgesätzen umstellt, übersetzt etc." (Scheffer 1992; 271/272) "Wissenschaftliches Reden ist
lediglich eine Form des Darüber-Redens - die Vorzüge liegen keinesfalls in der
Textadäquatheit, sondern allenfalls in den verläßlicheren Regeln dieser Methode des
Darüber-Redens." (Scheffer 1992; 272) Deswegen seine (vielleicht nicht einmal) ironische
Anmerkung: "Jede Interpretation verkürzt, entschärft, domestiziert. Die einzig textadäquate
Interpretation ist das vollständige Zitat. Daher blamieren sich Interpreten grundsätzlich, mehr
oder weniger stark. Welche Interpretation liefert schon einen 'besseren' Text als der
Ausgangstext?" (Scheffer 1992; 271) Nur - den Text bei der Interpretation 'paraphrasieren',
'assoziieren', 'mit Folgesätzen umstellen', 'übersetzen', 'zitieren' 'etc.', um ihn zur Sprache zu
bringen: genau darin besteht die Praxis jeder alltagsweltlichen und wissenschaftlichen
Interpretation. Die Frage ist nur, wie man diese Praxis begreift und ausübt.
Die vollständige wörtliche Wiedergabe eines Textes kann in der Tat kein angemessener
Ausdruck einer Interpretation sein; sie würde ja (vorausgesetzt, sie gelänge überhaupt)
nurmehr - darin ist Goodman und Elgin trotz ihres impliziten symboltheoretischen
Syntaktizismus zuzustimmen{75} - die "Konfigurationen aus Buchstaben, Zwischenräumen
und Satzzeichen", die graphemische "Identität eines Textes" (Goodman/Elgin 1993; 82)
darstellen. Und davon abgesehen ist eine vollständige wörtliche Wiedergabe auch etwas
anderes als eine Zitierung. Einen Text oder ein Textelement zu zitieren, besteht ja darin, das
eigene Verständnis mit den Worten der zitierten Person wiederzugeben. Aber worin besteht
dabei der Zusammenhang zwischen der Sprache des Interpreten und der Sprache des Autors?
Die Paraphrase eines (literarischen) Textes ist nicht nur eine Reformulierung des Textes mit
den bekannten nurmehr vermeintlich 'anderen Worten'. Sie stellt vielmehr eine Übersetzung
aus der Sprache des Autors in die Sprache des Interpreten selbst dar. Aber worin besteht die
Übersetzung, und was sind denn Kriterien der Angemessenheit? Einen Text 'mit Folgesätzen
zu umstellen', ist nichts anderes als Implikationen aus ihm heraus- und Konsequenzen in ihn
hineinzulesen. Man stellt den Text, richtiger: das eigene Verständnis des Textes, als ein
Gefüge von Aussagen und Annahmen, von Stellungnahmen und Wertungen dar. Aber welche
Darstellungen sind möglich, welche sind plausibel? Welche sind methodisch begründet?
Scheffer plädiert (mir scheint, mit einem fast resignativen interpretationstheoretischen
Unterton) für eine empirische Literaturwissenschaft durch "Neu-Konzipierung der
Interpretation literarischer Texte als eine essayistische, indessen nicht mehr als eine
wissenschaftliche Tätigkeit" (Scheffer 1992; 314) und führt eben diese Literatur-Essayistik
exemplarisch vor. Seine "umfassende Skepsis am Wissenschaftsanspruch der Interpretation"
(Scheffer 1992; 315) verliert sich aber ins literarischen Interpretieren selbst. Wäre das die
angemessene Reaktion auf die Frage, wie sich der Radikale Konstruktivismus empirisch
wenden ließe? Welchen Expertenstatus könnte dann der Literaturwissenschaftler als
Interpretationswissenschaftler noch beanspruchen? "Niemand", so Scheffer, "der literarische
Texte interpretiert, sei es der Literaturkritiker oder der Literaturwissenschaftler, handelt
routinemäßig als 'stellvertretender Leser' für die anderen (auch nicht für andere 'Experten');
der Essayist kann und soll diesen Anspruch simulieren, aber irgendein Anspruch von
Wissenschaftlichkeit wäre damit selbstverständlich nicht (mehr) verbunden." (Scheffer 1992;
320) Sollte der Literaturwissenschaftler also am Ende den Part desjenigen gebildeten
Literaten spielen, der sich an der Tradierung der Interpretationsgeschichte(n) und an der
Kultivierung des Interpretationsbetriebs beteiligt?
Die Überlegungen Scheffers sind ein exemplarischer Ausdruck derjenigen interpretationsund sprachtheoetischen Mißverständnisse, die der literaturtheoretische Konstruktivismus mit
seiner vermeintlich radikalen Kritik an abbildtheoretischen Konzepten und Traditionen des
Verständnisses von Wahrnehmung, Beobachtung und Beschreibung nicht aufgelöst, sondern
fortgeschrieben hat. Scheffers Konstruktivismus eröffnet dort neue begriffliche,
methodologische und empirische Nebenkriegsschauplätze, wo längst keine
wissenschaftlichen Kämpfe mehr zu gewinnen sind: weit außerhalb der Tradition und der
Aktualität des (inzwischen sprachanalytisch weiterentwickelten) Pragmatismus. Die
Sprachtheorie des konstruktivistischen Literaturtheoretikers verdankt sich der Intention, den
Zusammenhang von Text und Interpretation, von Bedeutung und Wortlaut 'umgekehrt' zur
(alltagstheoretisch) üblichen abbildtheoretischen Auffassung vom Zusammenhang zwischen
Gegenstand und Interpretation zu denken. Aus dem Blick gerät dabei die wesentliche
Aufgabe der Interpretationswissenschaft: die Darstellung und Kritik der Praktiken, Stile,
Diskurse und Traditionen literarischer Interpretation samt ihren (impliziten) Konzepten.
3.4 Empirische Literaturwissenschaft: ein neues methodologisches Paradigma?
Für N. Groeben erfüllt das Projekt der (radikal-)konstruktivistischen 'Empirischen
Literaturwissenschaft' (EWL) noch nicht ganz die Kriterien (der Genese) eines neuen
wissenschaftlichen Paradigmas nach seinem Verständnis von T. Kuhn.{76} "Bei den
(metaphysischen) Kernannahmen stellt sicherlich die kognitive Konstruktivität des
Rezipienten bei der Verarbeitung von (literarischen) Texten einen zentralen Ausgangspunkt
dar. Die ELW hat hier Entwicklungen und Thesen der hermeneutischen Ästhetik, z.B. der
Rezeptionsästhetik der Konstanzer Schule (...) aufgenommen und mit den empirischen
Ergebnissen der Textwissenschaften (Linguistik, Psychologie, Informatik usw: Cognitive
Science (...) verbunden. Danach besteht die Rezeption von Texten prinzipiell in einer
Informationsverarbeitung, die die im Text enthaltene 'linguistische Information' so mit
Weltwissen usw. verbindet, daß dabei auch über die im Text enthaltenen manifesten
Bedeutungsinhalte hinaus Information 'geschaffen' wird (...); dies gilt für sogenannte
literarische Texte aufgrund von deren 'Leerstellenstruktur' (Konstanzer Rezeptionsästhetik)
und den bei der Produktion und Rezeptionen dieser Texte relevanten Konventionen (...) in
erhöhtem Maße. Daraus folgt für die ELW die Notwendigkeit, von einem als 'essentialistisch'
empfundenen Textbegriff der klassischen hermenetischen Literaturtheorie abzugehen, d.h.
auschließlich 'den Text in Funktion' als konzeptuelle Grundlage der Theoriebildung
anzusehen. Dieser funktionale Text-Begriff stellt die zentrale problemdefinierende
Kernannahme der ELW dar, deren Eliminierung die Basis aller weiteren theoretischen
(Zusatz-)Annahmen auflösen würde. Damit hat der funktionale Text-Begriff innerhalb der
ELW sicherlich jenen quasibegrifflichen Status der Unfalsifizierbarkeit inne, wie das für den
Strukturkern von Theorien nach Nicht-Aussagen-Konzeption unvermeidbar ist (...)."
(Groeben 1994; 23) Weil die EWL "gerade nicht von konkreten Charakteristika eines
inhaltlich ('essentialistisch') festgelegten Konzepts des 'literarischen Texts'" ausgehe, sei sie
zudem "in bezug auf die Gegenstandsdimension von einer vergleichsweise flexiblen Breite
gekennzeichnet" und beziehe "in ihrer Theoriebildung gerade auch die Vernetzung zu
anderen Medien und Mediennutzungen in der 'Informationsgesellschaft' (...) mit ein, und
zwar sowohl in bezug auf ästhetische als auch pragmatische Nutzungskontexte (...)." "Diese
Flexibilität in der Gegenstandsextension gründet sich in einer Haltung, die man im Kontrast
zur rückwärts gewandten Historizität der hermeneutischen Literaturwissenschaft als
'vorwärtsgewandte Historizität bezeichnen könnte (...)." (Groeben 1994; 24) Allerdings: "Ein
vergleichbar klares Profil kann nun allerdings für die paradigmainterne operativ-konstruktive
Dimension m. E. nicht behauptet werden." (Groeben 1994; 27) Die "berechtigte generelle
Zielidee, daß auch in der Epmirischen Literaturwissenschaft eine theoriegeleitete Forschung
anzustreben ist, wie es heute für die empirischen Sozialwissenschaften weitgehend als
akzeptiert gilt" (Groeben 1994; 27), sei in der praktischen Forschung noch keineswegs
realisiert. "Gesucht sind also Musterbeispiele für theoriegeleitete Forschung in der ELW
(...)." (Groeben 1994; 28) Es müsse darüber hinaus sogar "eine offene Frage bleiben, ob auf
die Dauer wirklich ein solcher operativ-konstruktiver Wechsel zur ELW als herrschendem
Paradigma in der Literaturwissenschaft eintritt oder nicht." (Groeben 1994; 34)
In der Tat fehlen die Musterbeispiele einer praktischen 'Empirischen Literaturwissenschaft'
im Sinne Groebens und S. J. Schmidts. Aber das liegt wohl weniger an der Unerfülltheit des
vermeintlich neuen, empirische Relevanz beanspruchenden Paradigmas. Es liegt vielmehr an
den begrifflichen Problemen der ELW selbst, die auch Groeben in seiner abstraktprogammatischen Würdigung keineswegs nur anführt, sondern durchaus auch vorführt. Wenn
man von den vermeintlich aussichtsreichen Höhen der "empirisch-analytischen
Wissenschaftstheorie" herabzusteigen versucht, hat man sich mit eben jenen
kognitionstheoretisch fundierenden und fundierten Unterscheidungen auseinanderzusetzen,
die Groeben wie selbstverständlich voraussetzt. Die 'Kernannahme' der 'kognitiven
Konstruktivität des Rezipienten bei der Verarbeitung von (literarischen) Texten' verdankt
sich nämlich einem kruden Kognitivismus{77}, der die Interpretation von Texten als
Informationsverarbeitung im Kopf der interpretierenden Person deutet. Dieser sprach- und
zeichentheoretisch unreflektierten Verstehenstheorie verdankt sich auch die Unterscheidung
zwischen einer 'im Text enthaltenen linguistischen Information' einerseits und dem
'Weltwissens'-Bezugsrahmen des Lesers als Interpreten andererseits, die sich weder
begrifflich noch analytisch durchhalten läßt. Denn empirisch kann mit ihr gerade nicht so
gearbeitet werden, daß der Nachweis geführt werden könnte, eine verstehende Person schaffe
über die im Text enthaltenen manifesten Bedeutungsinhalte hinaus Information und sei in
diesem Sinne kognitiv konstruktiv tätig. Der Nachweis kann einfach deswegen nicht geführt
werden, weil es unabhängig von Interpretation keine 'im Text enthaltene linguistische
Information', keine 'manifesten Bedeutungsgehalte' gibt. Im Text steht, was wir auf der Basis
unserer Sprach- und Weltkenntnis, unserer Interpretationskompetenz und unseres
Interpretationsinteresses herauslesen und mitteilen können. Eben deswegen kommt auch der
empirische Literaturwissenschaftler nicht um eine explizite Darstellung seines Verständnisses
des Textes herum, wenn er die Textverständnisse anderer Personen verständlich machen will.
Die funktionalistische Textbegriff verdinglicht den Text und psychologisiert das Verstehen.
Genau darüber war bekanntlich bereits Schleiermacher, ist heute die von Groeben kritisch
apostrophierte 'traditionelle hermeneutische Literaturwissenschaft' hinaus.{78} Einen
Zusammenhang herzustellen zwischen der 'im Text enthaltenen linguistischen Information'
und dem 'Weltwissens'-Bezugsrahmen des Interpreten, schließt notwendigerweise eine
Beschreibung der Form und der Struktur des Textes und eine Wertung der Qualität des
Textes ein, und das wiederum setzt die praktische Vertrautheit mit ähnlichen Texten und
Kontexten, ähnlichen Situationen und Geschichten der Interpretation ein. Es setzt überdies
auch voraus, daß der Analytiker die Sprache versteht (oder zu verstehen lernt), in der der
Text artikuliert ist. Die empirische Analyse 'funktioniert' überdies nur dann, wenn der
Analytiker ein Beschreibungs- und Wertungsvokabular verwendet, das kritisch-reflexiv auf
diejenigen Interpretationsvokabulare Bezug nimmt, die die Geschichte und Aktualität der
Interpretationen des Textes ausmachen. Von diesen Bedingungen und Voraussetzungen
empirischer Literaturforschung ist aber in Groebens konstruktivistischer Rezeptionsforschung
der Empirischen Literaturwissenschaft überhaupt nicht die Rede. Vielmehr wird hier das
Problem einer Beschreibung von Textverständnissen an die Rezipienten delegiert: Der
Analytiker hält sich versuchsweise aus den Interpretationen und Interpretationsgeschichten
heraus - und projiziert dabei stillschweigend seine eigenen Interpretationen, seine eigenen
ästhetische Wahrnehmungen und Wertungen in die Köpfe der Rezipienten.
Groebens Programm einer 'theoriegeleiteten' empirischen Literaturwissenschaft reicht auch
wissenschaftstheoretisch nicht allzu weit. Das Paradigma der der ELW zugeschriebenen
"empirisch-analytischen Wissenschaftstheorie" entspricht weder faktisch noch begrifflich
dem Standard der empirischen Sozialwissenschaften heute.{79} Es ist
kulturwissenschaftstheoretisch längst in Frage gestellt worden.{80} Überdies ist das hier zum
Paradigma-Indikator stilisierte Konzept des Verstehens als Informationsverarbeitung gerade
seiner naturalistischen Implikationen wegen auch kognitionstheoretisch inzwischen
problematisiert worden.{81} Und schließlich zeigt die gegenwärtige kulturtheoretisch
fundierte empirische Wissenschaftsforschung, daß eine noch so rationalisierte
Wissenschaftstheorie empirischer (Kultur-)Wissenschaften dem faktischen Verständnis und
den faktischen Gewohnheiten (kultur-)wissenschaftlicher Praxis hoffnungslos hinterherläuft
und bestenfalls ihre eigenen Selbstmißverständnisse kultiviert.{82} Die Ursache für das
Fehlen paradigmatischer Empirie dürfte letzten Endes wohl die sein, daß weiterhin intensiv
am konstruktivistischen Überbau gezimmert wird, anstatt zu versuchen, selbstreflexiv die
eigenen Ansätze zur empirischen Forschung zu erörtern. Erst dann würde man sich der
interpretationspraktischen, -analytischen und -theoretischen Probleme bewußt, die sich hinter
der Bühne des Theoretisierens längst eingestellt haben.
Pasternack kritisiert S. J. Schmidts und N. Groebens konstruktivistische Konzeption einer
empirischen Literaturwissenschaft hinsichtlich ihrer wissenschaftstheoretischen
Voraussetzungen radikal.{83} Auch wenn man seinem Ideal einer Wissenschaftstheorie nicht
folgt, kann man seinem Urteil gleichwohl in wesentlichen Punkten zustimmen: "Die
empirische Literaturwissenschaft" verstehe sich selbst als eine "Kritik der eingespielten
literaturwissenschaftlichen Praktiken, insbesondere der hermeneutischen
Interpretationsverfahren". (Pasternack 1994; 55) Aber ihre "Abgrenzung gegen die
traditionelle hermeneutische Literaturwissenschaft und die Textinterpretation" lasse deren
eigene "philosophischen, insbesondere epistemologischen und ontologischen Besonderheiten
nicht ins Blickfeld geraten". (Pasternack 1994; 56) "Mit umgekehrtem Vorzeichen wirken
sich für die Forschungspraxis der empirischen Literaturwissenschaft die Ausrichtung an
Objekttheorien und die Orientierung an den standardisierten Methodologien bereits
entwickelter empirischer Wissenschaften einschließlich ihrer impliziten realistischen
Voraussetzungen als Hindernisse für die metatheoretische Reflexion der eigenen
objekttheoretischen Konstruktionen und methodologischen Setzungen aus." (Pasternack
1994; 57) Bereits für die "Entstehung der empirischen Literaturwissenschaft bleibt das
wissenschaftsphilosophische Reflexionsdefizit kennzeichnend und folgenreich". (Pasternack
1994; 58) So gehe "die empirische Literaturwissenschaft in der einen Version theoretisch von
der Unterscheidung zwischen 'Text' und 'Kommunikat' aus, methodologisch aber von
'Sinnangeboten des Werkes', die das 'auslösen', was die Rezipienten an der Kommunikatbasis
als 'formale Texteigenschaften' realisieren, in der anderen Version geht sie von
Rezeptionsresultaten aus, die Rückschlüsse auf Werkstrukturen ermöglichen."
"Groeben orientiert sich in seinen methodologischen Festsetzungen an einem
epistemologisch modifizierten Realismus." (Pasternack 1994; 61) Er nutze "implizit die
'materiale Textstruktur' als einen ontologischen Bezugspunkt". (Pasternack 1994; 62)
"Schmidt geht in seiner Version der empirischen Literaturwissenschaft von der Interaktion
zwischen Text, Leser und Situation aus." (Pasternack 1994; 62) Er rücke insbesondere die
"Untersuchung der kognitiven Prozesse, die beim Verstehen, Rezipieren, Verarbeiten von
Texten ablaufen (...) in den Mittelpunkt des Interesses".(Pasternack 1994; 62) Das
entscheidende Problem sei dabei aber dieses: "Korrelierungen zwischen Leser, Situation und
Text ermöglichen zwar Erklärungen des Rezpientenverhaltens, erlauben aber keine
Rückschlüsse auf Werkstrukturen oder ästhetische Ordnungsbildungen, so daß weder für
Adäquanzentscheidungen noch für Prüfinstanzen Deskriptionen von Werkstrukturen
herangezogen werden können." (Pasternack 1994; 63) (Pasternack 1994; 59) "Die
konstruktivistische Epistemologie als konzeptueller Rahmen (...) hat die Funktion eines
nachträglich eingeführten Deutungsschemas". (Pasternack 1994; 64) "Die
wissenschaftstheoretische Position des methodologischen 'Als ob' bleibt im Radikalen
Konstruktivismus erkenntnistheoretisch und ontologisch aber ganz ungeklärt." (Pasternack
1994; 64) Überdies sei die Orientierung an der Methodologie des emprischen
Sozialwissenschaften eine nicht-theoriekonforme Anleihe: "Denn die ursprünglich auf dem
Wege des imitierenden Theoretisierens im wesentlichen von den Sozialwissenschaften
übernommene empirisch-wissenschaftliche Methodologie hat theoretische Vorgaben, die
nicht bruchlos vom Radikalen Konstruktivismus adaptiert werden können, ohne auf
metatheoretischer Ebene zu gravierenden Widersprüchen zu führen. Das betrifft insbesondere
die Interpretation des Empiriebegriffs." (Pasternack 1994; 65) Die Hermeneutik sei überdies
interpretationspraktisch keineswegs verabschiedet: "Das in den hermeneutischen
Wissenschaften viel diskutierte Problem der Zirkularität kehrt in veränderter Gestalt auch in
der empirischen Literaturwissenschaft wieder, da es nicht auf der Ebene der
methodologischen Festsetzungen zu entscheiden, sondern nur auf der Ebene der
wissenschaftsphilosophischen Voraussetzungen zu klären ist." (Pasternack 1994; 66/67)
'Wissenschaftsphilosophisch' werde aber die (neurobiologisch fundierte) Basistheorie der
Kognition nachgerade selbstwidersprüchlich vorausgesetzt. "Mit der nicht-reduktionistischen
Kognitionstheorie wird über die wissenschaftstheoretischen Kriterien hinaus eine
wissenschaftsphilosophische Rahmentheorie eingeführt, die die Polyinterpretabilität
wissenschaftlicher Entitäten erkenntnistheoretisch untermauert." (Pasternack 1994; 67) Und
auf eben diese Rahmentheorie werde zirkulär Bezug genommen: Man orientiere sich am
neurobiologischen Verständnis des Gehirns. "Dabei ist das reale Gehirn als Konstrukteur des
phänomenalen Gehirns, wie des kognitiven Subjekts in der kognitiven Welt selbst ein
Konstrukt dieser phänomenalen Welt." (Pasternack 1994; 68) "Der Konstruktivist kann auch
als Experimentator nicht ein 'objektiv vorhandenes Gehirn' untersuchen, sondern immer nur
ein von einem kognitiven System konstruiertes Gehirn und dessen Interaktionen mit einer
konstruierten Umwelt." Die methodologischen und begrifflichen Implikationen seien fatal: In
der Bezugnahme des Konstruktivismus auf "die biologisch, insbesondere neurophysiologisch
begründeten kognitiven Theorien, die zugleich Theorien der Wahrnehmung und
Kommunikation und philosophische Erkenntnistheorien sein wollen", liege "die Gefahr eines
vitiösen Zirkels in der Anwendung der Ergebnisse der empirischen Kognitionsforschung auf
die konstruktivistische Erkenntnistheorie" vor. (Pasternack 1994; 72/73) "In diesen
wissenschaftsphilosophischen Rahmen kann somit eine empiristische Methodologie nur nach
Umdeutung aller Grundbegriffe, wie des Empiriebegriffs, Beobachtungsbegriffs,
Theoriebegriffs, Wahrheitsbegriffs eingeführt werden." (Pasternack 1994; 68) Und deswegen
sei festzustellen: "Der Radikale Konstruktivismus hat somit für die empirische
Literaturwissenschaft nicht die Funktion einer wissenschaftsphilosophischen Metatheorie,
sondern ist zu einem bloß weltbildartigen Deutungsmuster herabgesetzt." (Pasternack 1994;
75)
Die gleichwohl systemische (mit einer eigenwilligen Hegel-Interpretation begründete)
Alternative einer empirischen Literaturwissenschaft Pasternacks hat eine gewisse Affinität
zum sprachanalytisch und sprachtheoretisch reflektierten Pragmatismus: "Methodischer
Ausgangspunkt für die Selbstexplikation des Systems ist daher auch nicht die Wahrnehmung
oder Beobachtung einer Außenwelt, sondern deren subjektabhängige Konstruktion und
Präsentation des Wissens (...)." (Pasternack 1994; 70/71) Für die "Sicherung des Wissens"
gebe es "keine Wahrnehmungsevidenzen" außerhalb "von den kognitiven, sprachlichen und
kommunikativen Bedingungen dieses Systems selbst". (Pasternack 1994; 71) "Jede Theorie
selbstreferentieller Systeme muß eine Methodologie der Selbstauslegung, der kategorialen
Selbstexplikation der systeminternen Bestimmungen entwickeln, die immer schon von den
kategorialen Einheiten, die Gegenstand der Explikation sind, Gebrauch machen muß, weil
keine unabhängige Deskriptionssprache zur Verfügung steht. Selbstexplikative Systeme des
Wissens müssen darüber hinaus eine spezifische Methodologie der Selbstkontrolle
entwickeln", die "von einem Wahrheitskonzept Gebrauch" mache, "das alle Korrespondenzen
durch epistemisch-pragmatische Kohärenzkriterien ersetzt". (Pasternack 1994; 72) So
gesehen hätten "selbstreferentielle und selbstexplikative Systeme" "auch eine größere Nähe
zu hermeneutischen als zu empiristischen Methodologien". (Pasternack 1994; 72)
Nur - was spricht denn überhaupt für eine systemtheoretische Konzeption der
Interpretationsforschung? Die Kontroverse von Systemtheorie und Handlungstheorie ist im
Bereich der Textwissenschaften ja noch lange nicht entschieden, ignorieren doch auch
Systemforscher vom Format N. Groebens und S. J. Schmidts nach wie vor die kultur- und
kognitionswissenschaftlich relevante Kritik in der Soziologie und Anthropologie.
3.5 Systemtheorie versus Handlungstheorie: Ein zweckmäßiger Exkurs?
Systemtheoretisch, konstruktivistisch, dekonstruktivistisch und diskurstheoretisch
argumentierende Literaturwissenschaftler zeichnen gerne ein Zerrbild der Intentionalität und
der Intersubjektivität der Interpretation - und übersehen dabei durchweg deren konstitutive
Bedeutung gerade auch für ihre eigenen (impliziten) Interpretationen. Sie trifft, so denke ich,
die fundamentale Kritik, die H. Joas an der Systemtheorie Luhmanns übt, die er
"gegenwärtig als sozusagen szentistische Parallele zum Poststrukturalismus" wahrnimmt.
(Joas 1992; 307).{84} Joas erscheint Luhmanns Systemtheorie als eine "umfassende
funktionalistische Gesellschaftstheorie, die - von der inneren Spannung zur Handlungstheorie
und zu empirischer Forschungspraxis weitgehend abgekoppelt - eine Lösung von Parsons'
ungelösten Problemen verspricht und gegenwärtig als sozusagen szentistische Parallele zum
Poststrukturalismus Furore macht". (Joas 1992; 307 - 326) "Luhmann kann zwar den
heuristischen Sinn funktionalistischer Sätze verteidigen, aber nicht mehr; der
Irrealisierungseffekt seiner Darstellungen hat zwar literarische Qualitäten und ist insofern
erkenntnisfördernd, hat aber keine wissenschaftliche Beweiskraft." (Joas 1992; 312) "Die
Kritik an Luhmann" - diese Feststellung von Joas kann durchaus auch für die
systemtheoretisch denkend und arbeitenden Literaturwissenschaftler gelten - "ist immer mit
dem Problem konfrontiert, daß von ihm jeder Einwand in seiner Theoriesprache reformuliert
und damit gleichzeitig seiner Kontrastwirkung beraubt wird." (Joas 1992; 316) Über die
"Anwendbarkeit" der Systemtheorie entscheide "offensichtlich allein der Anwender oder der
von der rhetorischen Brillanz gebluffte Anhänger." (Joas 1992; 316) Die "hermeneutischen
Identifizierungsprobleme" bei der Bezugnahme auf soziale und gesellschaftliche
Sachverhalte würden durch eine 'funktionale Analyse' keineswegs aus der Welt geschafft.
(Joas 1992; 315)
Joas selbst rekurriert auf die expressivistische kulturanthropologische und sprachtheoretische
Tradition seit Herder.{85} Er zeigt, daß die Reichweite der ausdruckstheoretisch konzipierten
Handlungstheorie hinsichtlich der Fundierung der Konzepte der Intersubjektivität und der
Sozialität noch keineswegs erschöpft ist. Allerdings hätte eine Aktualisierung heute den
veränderten gesellschaftlichen und individuellen Kommunikationsverhältnissen gerecht zu
werden und könnte sich nicht länger am Dialogmodell der Kommunikation orientieren. In der
'dritten Phase der Technisierung des Wortes'{86} sind ja Wahrnehmung, Handeln, Denken,
Lernen und Wissen mehr und mehr (massen-)medial vermittelt.{87} Die methodologischen
Konsequenzen für die Interpretationswissenschaften sind noch gar nicht abzusehen. Die
praktische Hermeneutik der Kulturwissenschaften im ganzen wird sich jedenfalls nicht länger
an der traditionellen literarischen Hermeneutik orientieren können. Selbst die Perspektiven
der 'Qualitativen Sozialforschung' dürften sich dabei als noch zu beschränkt erweisen.{88}
3.6 Semiotik der Interpretation: der literale Texte als feste Größe?
Eco erörtert mehrere interpretationstheoretische Probleme aus (s)einer semiotischen
Perspektive:{89} Worauf beziehen sich Interpretationen? Worin besteht ihr Inhalt? Wozu
interpretieren wir? Wann sind Interpretationen wahr? Jede "Textinterpretation" schließe "drei
Pole ein: (1) die lineare Textentwicklung; (2) den Leser mit seinem spezifischen
Erwartungshorizont; (3) die kulturelle Enzyklopädie der jeweiligen Sprache mit den früheren
Interpretationen desselben Textes." (Eco 1994; 154) Den Bezugspunkt von Interpretationen
bildet der Text: "Ob (...) Interpretationen annehmbar sind, entscheidet sich am Parameter des
Textes." (Eco 1994; 152) Aber die "Eigenschaften" eines Textes sind "nicht intrinsisch,
sondern relational". (Eco 1994; 154) "Auch wenn es kein Ding an sich gibt, auch wenn
unsere Erkenntnis situativ, holistisch und konstruktiv ist, sprechen wir immer über etwas; sei
dieses Etwas auch relational, so sprechen wir doch über eine gegebene Beziehung. Gewiß
ermutigt zum Interpretieren, daß unser Wissen relational ist, wir also Tatsachen nicht von
jeder Sprache ablösen können, mit der wir sie ausdrücken (und konstruieren)." (Eco 1994;
154/155) Nur - wie nehmen wir auf den Text Bezug?
Den Inhalt von Interpretationen, so Eco, macht unser Wissen darüber aus, "mit welchen
narrativen und sprachlichen Strategien" ein Autor seinen Leser herausfordert (Eco 1994;
158), wie der Text welchen "Effekt" "erzeugt" (Eco 1994; 159), "mit welchen semiotischen
Mitteln der Text seine vielfältigen und widersprüchlichen Effekte auslöst". (Eco 1994; 159)
Denn: "Es gibt eine Textintention." (Eco 1994; 131) Aber wie läßt sich die Textintention
bestimmen? Und wie der intentionale Zusammenhang zwischen sprachlichem Ausdruck und
poetischer Intention? Als ein Zweck-Mittel-Verhältnis im Sinne Ecos wohl nicht.
Den Sinn und Zweck von Interpretationen sieht Eco darin, "herauszufinden, wie und warum
ein bestimmter Text so viele gute Interpretationen anregen kann". (Eco 1994; 158) Aber was
sind dann gute Interpretationen, und welche sind überzeugend? Eco betont, "daß die Qualität
einer Interpretation sehr schwer zu beurteilen" sei. Denn "das Resultat unserer Lektüre (...)
läßt sich nicht intersubjektiv prüfen" (Eco 1994; 160), die "Akzeptanz vom Interpretationen
ist graduell abgestuft". (Eco 1994; 161) (Über die Wirkung von Aspirin lasse sich
verläßlicher urteilen als über die Wirkung von Texten.) Aber ist nicht ein diffuser Verweis
auf ein "an Popper orientiertes Kriterium" (Eco 1994; 155) interpretationsmethodisch
unzureichend, ein vages Plädoyer für "eine kohärente Interpretation" (Eco 1994; 157)
interpretationspraktisch folgenlos?
Gegen "die radikal leserorientierten Interpretationstheorien" (Eco 1994; 47) besteht Eco
darauf, daß Texte Bedeutung haben und Interpretation wahr sein sollten. Deren
Leitvorstellungen karrikiert er so: "Ein Text ist ein offenes Universum, in dem der Interpret
unendlich viele Zusammenhänge aufspüren kann." (Eco 1994; 45) "Die Sprache vermag
keine einzigartige, vorgegebene Bedeutung zu erfassen; vielmehr soll sie zeigen, daß alles
Sagbare nur die Koinzidenz der Gegensätze ist." (Eco 1994; 46) "Die Sprache spiegelt die
Mängel des Denkens wider: In-der-Welt-Sein ist nichts anderes als das Unvermögen, eine
transzendentale Bedeutung zu finden. Jeder Text, der vorgibt, etwas Eindeutiges
auszudrüken, ist ein mißlungenes Universum (...)." (Eco 1994; 46) "Der heutige TextGnostizismus" (den er darin erblickt) verfahre so: "Um den Text zu retten - das heißt, den
Trug seiner Bedeutung zu durchschauen und zu erkennen, daß Bedeutung immer unbegrenzt
ist - , muß der Leser mutmaßen, daß jede einzelne Zeile eine tiefere geheime Bedeutung
verbirgt; Wörter verhüllen das Ungesagte, statt es auszusprechen; der Leser kommt zu Ehren,
indem er entdeckt, daß Texte alles besagen, nur nicht, was der Autor ausdrücken wollte;
sobald eine vermeintliche Bedeutung aufgespürt sein soll, können wir sicher sein, daß es
nicht die wahre ist; die wahre ist immer die nächste, und so weiter und so fort; die hylics oder Verlierer - erkennt man daran, daß sie den Prozeß beenden, indem sie sagen: 'Ich habe
verstanden.' Der 'wahre Leser' dagegen versteht, daß das Geheimnis des Textes seine Leere
ist." (Eco 1994; 46) Demgegenüber besteht Eco darauf, "daß es gewisse Kriterien gibt, um
die Interpretation zu begrenzen". (Eco 1994; 47) "Wenn es etwas zu interpretieren gibt, muß
sich die Interpretation auf etwas beziehen, das irgendwie vorhanden ist und in gewissem
Maße respektiert wird." (Eco 1994; 50) Aber was ist das Vorhandene? Es entsteht, so lese ich
Eco, durch "eine dialektische Beziehung zwischen intentio operis und intentio lectoris". (Eco
1994; 71) "Von einer Textintention kann man (...) nur infolge einer Unterstellung des Lesers
sprechen." (Eco 1994; 72) Wie das? "Ein Text wird ersonnen, um den exemplarischen Leser
zu erzeugen." (Eco 1994; 72) Dabei "mutmaßt der empirische Leser nur, welchen
exemplarischen Leser der Text erfordern würde." (Eco 1994; 72) So gesehen "ist der Text
nicht bloß ein Parameter für die Bewertung der Interpretation; vielmehr konstituiert ihn erst
die Interpretation selbst als ein Objekt und nimmt dieses als ihr Resultat, an dem sie sich in
einem zirkulären Prozeß messen kann." Eben dies mache den "alten, nach wie vor gültigen
'hermeneutischen Zirkel'" aus. (Eco 1994; 72)
Der literarisch-literaturwissenschaftliche Interpret also als der exemplarische Leser, richtiger:
als der Konstrukteur des Musterlesers? "Da ich mit meinem Konzept der Textinterpretation
eine Strategie aufdecken möchte, die den exemplarischen Leser erzeugen soll, verstanden als
idealtypisches Pendant zu einem exemplarischen Autor (der bloß als Textstrategie erscheint),
wird die Absicht eines empirischen Autors ganz und gar überflüssig. Zu respektieren ist nur
der Text, nicht der Autor als eine Person Soundso." (Eco 1994; 73) Und die Rolle des
empirischen Autors bei der Konstruktion des exemplarischen Lesers? "Das Seelenleben des
empirischen Autors ist gewiß unergründlicher als seine Texte. Zwischen der mysteriösen
Entstehungsgeschichte eines Textes und dem unkontrollierten Driften künftiger Lesarten hat
die bloße Präsenz des Textes etwas tröstlich Verläßliches als ein Anhaltspunkt, auf den wir
stets zurückgreifen können." (Eco 1994; 97)
"Doch aufgrund welcher Kriterien entscheiden wir, ob eine Textinterpretation überzogen
ist?" (Eco 1994; 59) Eco denkt, "daß wir mit einem Popperschen Prinzip auskommen
können: Wenn schon keine Regeln verbürgen, welche Interpretationen die 'besten' sind, dann
läßt sich doch zumindest entscheiden, was 'schlecht' ist." (Eco 1994; 59)
R. Rorty hat Ecos semiotisches Interpretationskonzept pragmatistisch kritisiert,{90}
insbesondere seine mit der Unterscheidung "zwischen Bedeutung und Signifikanz"
zusammenhängende Unterscheidung von Textintention und Leserintention. (Rorty 1994; 104)
"Anti-Fundamentalisten wie ich", schreibt Rorty, "bedauern diese Unterscheidung zwischen
innen und außen, nicht-relationalen und relationalen Merkmalen, denn für uns gibt es gar
keine intrinsischen, nicht-relationalen Eigenschaften." (Rorty 1994; 104) Eco trenne "strikt
zwischen Interpretieren und Gebrauchen von Texten." (Rorty 1994; 103). Dabei sei es doch
so, daß "Ecos Abgrenzung zwischen Gebrauch und Interpretation" tatsächlich "kaum eine
Rolle spielt". (Rorty 1994; 104) Welchen Zweck hat dann Ecos grundsätzliche
Unterscheidung "zwischen Text und Leser, zwischen intentio operis und intentio lectoris"?
(Rorty 1994; 105) Wie ist vor allen Dingen Ecos Rekurs auf textinterne Textkohärenz zu
beurteilen? "Uns gefällt auch Ecos Reformulierung des 'alten, aber nach wie vor gültigen
hermeneutischen Zirkels'. Doch wenn Texte durch Interpretation geschaffen werden, kann
man meiner Ansicht nach kaum am Bild der internen Textkohärenz festhalten." (Rorty 1994;
107) "Bis zu seiner Beschreibung hat ein Text also ebensowenig Kohärenz wie beliebige
Punkte, bevor wir sie mit einem Diagramm verbinden. Seine Kohärenz kommt dadurch
zustande, daß man etwas Interessantes über eine Gruppe von Zeichen oder Lauten zu sagen
weiß - sie ist also eine Form, diese Zeichen und Laute zu beschreiben und damit auf andere
Dinge zu beziehen, über die wir gerne reden möchten. Diese Kohärenz ist weder intern noch
extern, sondern hängt allein davon ab, was bisher über diese Zeichen gesagt wurde. Wenn wir
die relativ unumstrittene Philologie mit ihrem Geplauder über Bücher verlassen und uns der
umstrittenen Literaturgeschichte und -kritik nähern, müssen wir stets rationale und
systematisch begründete Zusammenhänge mit dem herstellen, was wir oder andere zuvor
gesagt haben - an frühere Beschreibungen derselben Zeichen anknüpfen. Wir können aber an
keinem Punkt klar abgrenzen zwischen dem, worüber wir reden, und dem, was wir darüber
sagen, es sei denn, wir verfolgen zufällig in diesem Moment einen speziellen Zweck, haben
eine besondere intentio." (Rorty 1994; 108) Mit anderen Worten: Die Bezugnahme auf den
Text läßt sich nicht von Aussage über den Text ablösen - es sei denn, sie selbst wird zum
Inhalt einer die Bezugnahme reflektierenden Aussage. Genau das ist sprachanalytisch
gesehen wohl der entscheidende Punkt: Mit Deutungsbehauptungen (die Textverständnisse
implizieren) stellen wir die Unterscheidung von Textelementen, auf die wir Bezug nehmen,
überhaupt erst her. Wenn das aber der Fall ist, dann scheiden die wörtliche Wiedergabe und
die Paraphrase als einfachste Kandidaten für interpretative Bezugnahme erst recht aus.
Daß Eco dies nicht sieht, hängt für Rorty mit dessen semiotischer, d.h. implizit
abbildtheoretischer Sprachauffassung zusammen:{91} "Wenn ich Sprachtheorien Ecos und
anderer Autoren lese, orientiere ich mich streng an meiner bevorzugten Sprachphilosophie Donald Davidsons radikal naturalistisch-holistischer Auffassung." (Rorty 1994; 108)
"Davidson folgt Quines Projekt, eine interessante philosophische Unterscheidung zu leugnen:
die zwischen Sprache und Faktum, Zeichen und Nichtzeichen." (Rorty 1994; 109) "In meinen
Augen bieten Felsen und Quarks nur Nahrung für den hermeneutischen Prozeß, Objekte zu
konstituieren, indem wir darüber reden." (Rorty 1994; 110) "Obwohl uns ein Objekt
veranlassen mag, einen bestimmten Satz zurückzunehmen, läßt sich kein Satz an einem
Objekt überprüfen. Sätze sind nur vermittels anderer Sätze überprüfbar, mit denen sie durch
ein Labyrinth von Folgerungen verbunden sind." (Rorty 1994; 111) "Der Verzicht auf die
philosophisch interessante Grenze zwischen Natur und Kultur, Sprache und Faktum,
Universum der Semiose und anderen Universen wird plausibel, wenn man Erkenntnis mit
Dewey und Davidson nicht mehr als adäquate Repräsentation begreift, in der die Zeichen
korrekt auf Nichtzeichen zu beziehen wären." (Rorty 1994; 111) Das Problem der
wissenschaftlichen Interpretation von (literarischen) Interpretationen von Texten stellt sich in
der Perspektive Rortys so gesehen anders dar: Wie nehmen wir mit unseren problem-,
situationsbezogenen und wissensbestimmten Interpretationshandlungen reflexiv auf die
Spuren von Zeichenhandlungen Bezug, die wiederum reflexive Vergegenwärtigungen von
Spuren anderer Zeichenhandlungen sind; von welchen kulturellen Mustern der Prädikation
und der Referenz machen wir dabei Gebrauch?
Rorty wendet sich entschieden gegen textanalytische Ontologisierungen: "Für mich bedeutet
herauszufinden, 'wie ein Text wirkt', indem man seine Mechanismen semiotisch analysiert,
das gleiche wie gewisse Textverarbeitungsmenüs mit BASIC darzustellen: Wer Lust dazu
hat, mag das tun, auch wenn es für die meisten Ziele der Literaturkritik unnütz erscheint."
(Rorty 1994; 115) "Ich mißtraue also der strukturalistischen Idee, Literaturkritik müsse vor
allem Textmechanismen erforschen, ebenso wie der poststrukturalistischen Zielsetzung,
metaphysische Hierarchien aufzuspüren und zu unterwandern." (Rorty 1994; 115) Er plädiert
selbst "dafür, die Distinktion zwischen Gebrauchen und Interpretieren einfach fallenzulassen,
und nur zwischen Nutzungsmöglichkeiten für verschiedene Menschen mit abweichenden
Motiven zu unterscheiden." (Rorty 1994; 116) Interpretationstheoretisch fundierte empirische
Interpretationsforschung wäre dann die Untersuchung der Kultur(en) der verschiedenen
Gebrauchsweisen; der Intentionen, Praktiken, Gewohnheiten, Fähigkeiten, Situationen,
Umstände, Bedingungen usw., unter denen Personen so oder anders mit Texten umgehen.
Der wissenschaftliche Interpret wäre dann der reflexiv eingestellte Leser der Interpretationen
derjenigen Interpretationen, die eben die Texte selbst darstellen.
Aber wie liest er (literaturwissenschaftliche) Texte (über literarische Texte)? Rorty macht den
folgenden Unterschied "zwischen der methodischen und der inspirierten Lektüre" (Rorty
1994; 117): "Zur methodischen Lektüre neigen gewöhnlich Menschen, die keine 'Lust auf
Poesie' verspüren"; etwa solche, die sich "psychoanalytisch, leserorientiert, feministisch,
dekonstruktivistisch und neohistorizistisch" geben. (Rorty 1994; 117) "Unmethodische
Kritik, manchmal auch als 'inspiriert' bezeichnet, resultiert aus der Begegnung mit einem
Autor, einer Figur, einer Handlung, einer Strophe, einer Zeile oder einem archaischen Torso,
die das Selbstbild des Kritikers, seine Prioritäten, Werte und Ziele verändert." (Rorty 1994;
118) Sollte der Literaturwissenschaftler nicht zu beiden Lektüren fähig sein? Sollte er nicht
die Kunst der 'methodischen Lektüre' 'inspirierter Lektüren' (die eigene eingeschlossen)
beherrschen?
3.8 Radikale Interpretation: eine interpretationstheoretische Perspektive?
Die Klärung des Begriffs der Interpretation ist meines Erachtens das Kernproblem der bisher
diskutierten Konzepte (literatur-)wissenschaftlicher und literarischer Interpretation. Der
Hermeneutik wird üblicherweise unterstellt, daß sie eine verstehende, nicht aber eine
erklärende Wissenschaft sei; als ob erklärende Wissenschaften auf Interpretationen
verzichten könnten. Die Diskurstheorie propagiert, ähnlich wie der Dekonstruktivismus, auf
das Verstehen, auf die Interpretation der Texte gänzlich zu verzichten; als ob
Kommentierungen keine Interpretationen wären. Die Semiotik plädiert dafür, sich an die
textuellen und sprachlichen Strukturen des Textes zu halten; als ob über die formalen
Eigenschaften von Texten interpretationsunabhängig Aussagen gemacht werden könnten. Die
Linguistik suggeriert, daß Sprachanalyse eine und Textinterpretation eine andere Sache sei;
als ob Sprachbeschreibungen keine Interpretationen wären. Die Interpretationsphilosophie
stellt gegenwärtig alle diese Annahmen und Unterstellungen grundlegend in Frage.{92} Jede
Theorie und Analyse sprachlicher Äußerungen, Texte und Medien hat, so läßt sich D.
Davidson interpretieren, von dem elementaren Faktum auszugehen, daß keine sprachliche
Kommunikation ohne wechselseitige Interpretation denkbar ist. Interpersonelle
Kommunikation ist die Basis aller propositionalen Erkenntnis. Sprachliche Kommunikation
ist nichts anderes als die dialogische Verschränkung von Ausdruck und Interpretation. Eben
deswegen ist für das Verständnis sprachlicher Kommunikation der Begriff der Interpretation
konstitutiv; die Theorie der Sprache ist also in einer Interpretationstheorie zu fundieren.
Aber was wäre eine überzeugende Theorie der Interpretation? Davidsons (in der Philosophie
inzwischen breit erörtertes, von der Sprachwissenschaft aber kaum zur Kenntnis
genommenes) Konzept trägt dazu nach meiner Auffassung wesentliche Aspekte dazu bei. Die
komplexe interpretationstheoretische Argumentation Davidsons soll hier aber nicht en Detail
referiert werden.{93} Ich möchte sie nur in den Grundzügen skizzieren, damit ihre
interpretationspraktischen Konsequenzen deutlich werden. Davidson Theorie der
Interpretation kann man als eine Antwort auf die folgenden vier Fragen verstehen: Wieso ist
der Begriff der Interpretation epistemologisch elementar? Was sind die Prinzipien der
Interpretation? Worin besteht Interpretation? Wann sind Interpretationen rational, und wann
sind sie wahr? Indem Davidson diese Fragen beantwortet, macht er auch seine Sprachtheorie
verständlich, nach der die (beispielsweise in der kognitivistischen Psychologie derzeit noch
immer tragende) strikte Unterscheidung zwischen dem sprachlichen Wissen und dem
Weltwissen, zwischen der sprachlichen Bedeutung und der sachlichen Wahrheit (seit Quine)
keinen Sinn mehr mache. Die andere Person zu interpretieren, bestehe gewissermaßen darin,
zwischen ihrer Sprache und Welt und der eigenen Sprache und Welt eine Brücke zu schlagen.
Interpretation sei der Versuch der 'Übersetzung' des intentionalen Ausdrucks der
interpretierten Person in den intentionalen Ausdruck des Interpreten selbst - vor dem
Hintergrund des eben in der Sprache artikulierten Wissens von der anderen Person, von der
Welt und von sich selbst. Interpretation ist aber alles andere als empathetische Psychologie;
Interpretation ist vielmehr angewiesen auf eine (sprachanalytisch reflektierte) Kunst des
'Wörtlich-Nehmens' sowohl der Äußerungen der anderen Person als auch ihrer
Beschreibungen durch den Interpreten selbst.
Aber wieso ist Interpretation das elementare Faktum, von dem bei der intentionalen Analyse
der Äußerungen von Personen auszugehen ist? Ich deute Davidsons Argumentation nurmehr
an: Interpretation ist nach Davidson die Basis der Wahrnehmung, des Handelns, des
Denkens, des Urteilens, des Lernens und des Wissens. Denn soweit unser Wissen
propositionaler (also Aussagen entsprechender) Art ist - und das ja sind alle unsere
Meinungen und Überzeugungen - , ist seine Prüfung auf die intersubjektive Kommunikation
in einer gemeinsamen Sprache angewiesen. Nur mit dem intersubjektiv verläßlichen
Gebrauch der Sprache sind wir imstande, die Unterscheidung zwischen dem, wovon wir
glauben, daß es der Fall sei, und dem, was wirklich der Fall ist, tatsächlich treffen zu können.
Weil aber intersubjektive Kommunikation auf wechselseitige Interpretation angewiesen ist,
haben wir zu allererst, vor allen anderen erkenntnis- und wissenstheoretischen Überlegungen,
(ich zitiere Davidson) "die Frage aufzuwerfen, wie es einem fähigen Interpreten (also einem,
der über die angemessenen begrifflichen Mittel verfügt und die eigene Sprache beherrscht)
gelingt, den Sprecher einer fremden Sprache zu verstehen." (Davidson 1991; 1004)
Und was sind die grundlegenden Prinzipien wechselseitiger Interpretation? Sprachliche
Interpretation ist für Davidson die Basis aller propositionalen Erkenntnis. Unsere
Überzeugungen davon, was in Bezug auf die objektive, die intersubjektive und die subjektive
Welt der Fall ist, so behauptet er, sind an die Interpretation des sprachlichen Ausdrucks
unserer Überzeugungen gebunden. Interpretationen orientieren sich, so Davidson,
notwendigerweise an grundlegenden pragmatischen Prinzipien. Wann immer wir
interpretieren, setzen wir erstens voraus, daß Interpreten und Sprecher in Situationen des
gemeinsamen Redens und Handelns von denselben Dingen sprechen und in derselben Welt
leben. Und wir gehen, solange wir keine Anhaltspunkte für das Gegenteil haben, zweitens
davon aus, daß die Äußerungen der Sprecher zueinander passen und insgesamt eine stimmige
Darstellung dessen sind, wovon die Rede ist. Würden wir diese beiden Voraussetzungen
nicht machen, wären wir gar nicht zur Interpretation der Handlungen, Äußerungen und Texte
anderer Personen imstande. Wir folgen als Interpreten anderer Personen, so Davidson, dem
Korrespondenzprinzip und dem Kohärenzprinzip der Interpretation. Eben diesen beiden
pragmatischen Prinzipien, dem Kohärenzprinzip und dem Korrespondenzprinzip, zu folgen,
macht die wohlmeinende Interpretation anderer Personen aus. Und eben dann (meint
Davidson) wenn wir uns um ein wohlmeinendes (man könnte auch sagen: ein faires)
Verständis ihrer Handlungen und Äußerungen bemühen, interpretieren wir andere Personen
rational. Der beste Begriff des rationalen Verstehens sei eben der der wohlmeinenden
Interpretation.
Aber wie kommt man dann zur Wahrheit der Interpretationen? Kann man bei so einer
Interpretation der sprachlichen Äußerungen die wirklichen Absichten und die wahren
Überzeugungen anderer Personen denn tatsächlich empirisch ermitteln? Kann denn auf diese
Weise empirisch bewiesen werden, was die Sprecher tatsächlich meinten, dachten und
wußten? Handelt es sich bei dieser Art von Analyse denn nicht in der Tat bloß um
Interpretation? Der Einwand verkennt, denkt Davidson, daß wir keinen anderen als eben
diesen Zugang zu den Äußerungen und Handlungen anderer haben. Er setzt voraus, daß es so
etwas wie eine objektiv angemessene, eine ein für allemal richtige Deutung der Handlungen
und Äußerungen von Personen gebe; eine, die sich über den Prozeß und die Prinzipien der
intersubjektiven Interpretation hinwegsetzen könnte. Genau dies ist die Fiktion, die Davidson
entlarvt: Die 'wirklich richtige' Interpretation kann es nicht geben: "Da es viele verschiedene,
aber in gleichem Maße akzeptable Möglichkeiten gibt, eine handelnde Person zu
interpretieren, können wir, wenn uns daran liegt, sagen, die Interpretation oder Übersetzung
sei unbestimmt bzw. es gebe keine sachbedingten Fakten hinsichtlich dessen, was jemand mit
seinen Worten meint." (Davidson 1991; 1008)
Was aber ist eine methodische Interpretation? (Oder ist die Frage danach einfach sinnlos?)
Die methodische Interpretation verlangt keineswegs nur eine gewisse Kenntnis der Sprache,
in der Personen sich äußern, um ihre Meinungen und Überzeugungen zum Ausdruck zu
bringen. Sie verlangt auch keineswegs nur eine gewisse Kenntnis der Welt, auf die sie Bezug
nehmen. Sie verlangt vom Interpreten darüber hinaus ein erhebliches sprachreflexives und
sprachanalytisches Können. Sie erzwingt nachgerade, daß der Interpret seine eigene
Sprachkenntnis und Weltkenntnis aktualisiert. Sie erfordert also die Bereitschaft, die eigene
sprachliche und begriffliche Bildung zu erweitern. Sie motiviert interpretationskritische
Reflexion. Denn wer die Äußerungen anderer Personen in seine Sprache zu übersetzen
versucht, der muß sich auch einen Begriff davon machen, was gelingende Übersetzungen
ausmacht und ausmachen sollte. (Demnach lernen auch Wissenschaftler, wenn sie
interpretieren.)
Und die Reichweite für die philologische Praxis und Theorie der Interpretation? Davidsons
pragmatische Theorie der 'Radikalen Interpretation' eröffnet der Interpretationsforschung eine
neue Perspektive. Die Pointe der Argumentation Davidsons sehe ich darin, daß er ein anderes
Verständnis der wörtlichen Lektüre des Wortlauts eines (literarischen) Textes begründet. Den
vorliegenden 'Oberflächentext' wörtlich zu lesen, ist die einzige Chance, zu einem
begründeten Verständnis der Meinungen und Überzeugungen anderer Person zu gelangen.
Aber das Wörtlich-Nehmen ist etwa ganz anderes als das schematische Zuordnen von
(vermeintlich kontext-, situations- und kultur-invarianten) Bedeutungsinhalten und
Wahrheitswerten. "Der geübte Interpret", so Davidson, "ist bestrebt, den Äußerungen eines
Sprechers einen Aussagengehalt zuzuordnen." Und zwar so: "Im Grunde ordnet er jedem der
Sätze des Sprechers einen seiner eigenen Sätze zu. Insoweit der Interpret einwandfrei
vorgeht, liefern seine Sätze die Wahrheitsbedingungen der Sätze des Sprechers." "Unter dem
Ergebnis kann man sich eine seitens des Interpreten vorgenommene rekursive
Kennzeichnung der Wahrheit der Sätze - und damit der potentiellen Äußerungen des
Sprechers vorstellen." (Davidson 1991; 1004ff) Interpretation ist also die Kunst, sprachliche
Äußerungen von Personen so darzustellen, daß das Gefüge der Aussagen und Annahmen, der
Meinungen und Wertungen der anderen Person für den Interpreten (und für andere
Interpreten) verständlicher wird. Diese Art und Weise des Wörtlich-Nehmens macht keinen
Gebrauch mehr von der Unterscheidung zwischen 'wörtlichem' und 'nicht-wörtlichem'
Ausdruck, zwischen 'eigentlicher' und 'uneigentlicher' Rede; jedenfalls keinen, der zur
Rettung der Idee beitragen würde, im Zweifel könne der Interpret sich an den
uninterpretierten sprachlichen Ausdruck oder eine Standardinterpretation des sprachlichen
Ausdrucks halten.
Die Unvereinbarkeit sprachwissenschaftlicher Textanalyse und literaturwissenschaftlicher
Textinterpretation erweist sich, wenn man Davidson folgt, als eine Fiktion.
Interpretationstheoretisch gesehen kann es keine Grammatik ohne Interpretation und keine
Interpretation ohne Grammatik geben. Mit Schleiermachers Problem - dem der Einheit von
'grammatischer' und 'psychologischer Interpretation' - schlägt sich die Germanistik bis heute
herum. Sie könnte aber mit Bezug auf Davidsons Theorie der Interpretation ein neues
Verständnis philologischer Praxis entwickeln - und damit durchaus auch an ihre
hermeneutisch-pragmatistische Tradition im 19. Jahrhundert anschließen.{94} Allerdings:
Der Ästhetik der literarischen Texte käme man mit Davidsons Konzept bis jetzt nur sehr
abstrakt bei. Denn mit der begrifflichen Kritik an der Unterscheidung zwischen eigentlichem
und uneigentlichem, wörtlichem und figürlichem Ausdruck ist ja noch nicht allzu viel
gewonnen. Eine sprachanalytisch fundierte Praxis der Interpretation literarischer
Interpretationswelten müßte ja zeigen, wie Texte Perspektiven der Weltwahrnehmung
symbolisch artikulieren.
3.8 Ästhetik und Interpretation: Kunst als Objekt der Literaturwissenschaft?
M. Seel hat eine Theorie der Ästhetik entwickelt, die (gerade auch hinsichtlich ihrer
sprachtheoretischen Voraussetzungen) interpretationstheoretisch bedeutsam ist.{95} Sie
erweitert, wenn ich recht sehe, die Perspektive, die Davidsons Interpretationstheorie eröffnet
hat, erheblich. Seel unterscheidet zwischen der pragmatischen Richtigkeit und der
propositionalen Wahrheit ästhetischer Wahrnehmungen und Urteile. Er stellt fest, "daß wir
der nicht-propositionalen ästhetischen Erkenntnis am Kunstwerk nicht ohne das Medium
propositionaler Erkenntnis über das Kunstwerk teilhaftig werden können". (Seel 1993; 518)
Und zwar deswegen nicht, weil zwar "nicht jede Erkenntnis auf propositionale Wahrheit
zielt", daraus aber keineswegs folgt, "daß nicht jede Erkenntnis durch die Möglichkeit der
Bewahrheitung von Aussagen vermittelt ist". Bei ästhetischen Wahrnehmungen oder
Erfahrungen geht es um "Erkenntnisformen, deren Medium unter anderem wahre Aussagen
sind"; "hier haben wir es mit Erkenntnis zu tun, die sich auf dem Wege einer Gewinnung
bewahrheiteter Aussagen vollzieht - wie im Fall ästhetischer oder ethischer Erkenntnis".
(Seel 1993; 517) Das Entscheidende also ist für Seel, "daß es keine Erkenntnis diesseits
zumindest des Mediums propositionaler Wahrheit gibt". (Seel 1993; 517) "Wahrheit ist von
Richtigkeit abhängig in dem Sinn, daß es nur dort, wo es sprachliche oder sprachgebundene
oder mit Sprache verbundene Standards der Richtigkeit gibt, auch wahre Aussagen geben
kann. Aber Wahrheit geht über Richtigkeit darin hinaus, daß auch die besten Standards nicht
über Wahrheit entscheiden (sondern ihrerseits wiederum in Namen der Wahrheit revidiert
werden können)." "Richtigkeit andererseits ist abhängig von Wahrheit, weil sich nur
zusammen mit der Wahrheit von Aussagen in einer Sprache die Angemessenheit dieser
Sprache erweisen kann. Richtigkeit aber geht zugleich über Wahrheit hinaus, als sie - in der
Konstellation der Unterscheidungen, Regeln und Standards, die eine Praxis leiten Hinsichten der behauptenden Stellungnahme entwirft oder eröffnet, die dem Vollzug
entsprechender Stellungnahmen - und damit dem Anspruch auf Wahrheit - häufig
vorausliegen." (Seel 1993; 518){96}
Jedes ästhetische Urteil (und jede Interpretation ästhetischer Urteile) hat zwischen der
"Richtigkeit jeweiliger Orientierungen" und der "Wahrheit der in ihnen enthaltenen
Annahmen" (Seel 1993; 513) zu vermitteln. Das gilt insbesondere auch für die "Sprache als
Modell": "Standards der Richtigkeit einer Sprache" und "Überzeugungen hinsichtlich der
Wahrheit der Aussagen in dieser Sprache" sind nicht voneinander zu trennen. "Die
betroffenen Standards und Überzeugungen sind diejenigen einer (wie immer großen oder
kleinen) Sprachgemeinschaft." (Seel 1993; 515) "Für einen 'pragmatischen Realismus' à la
Putnam oder Wellmer", für einen "korrektiven Pragmatismus", "sind Richtigkeit,
Begründbarkeit und Wahrheit interdependente und irreduzible Begriffe, die sich
wechselseitig erläutern." (Seel 1993; 521, mit ausdrücklicher Bezugnahme auf Davidson)
Der Begriff der Wahrheit der (Interpretation der) ästhetischen Wahrnehmungen hat dann eine
klare Bedeutung: "Wahrheit ist nur in relativen Sprachen existent; dennoch ist der Anspruch
auf Wahrheit oft ein irrelativer Anspruch (...)." Denn "zu einem Wahrheitsanspruch gehört
nicht der Glaube, die eigene Auffassung sei nicht revidierbar, sondern allein die Erwartung,
daß sie nicht revidiert werde." (Seel 1993; 521) Aufzugeben sei nurmehr "der Gedanke eines
ultimativen Erkenntnisbesitzes": "die korrigierbare Rechtfertigung von Überzeugungen"
(Seel 1993; 522) macht so gesehen den Begriff der Wahrheit der Interpretation aus.
Seel geht, wie man sieht, in einem entscheidenden Punkt über Davidsons sprachanalytische
Interpretationstheorie hinaus: Er versteht ästhetische Werke (und deren Interpretationen) als
Medien der "Welterschließung": "Welterschließung ist wie das Erlernen einer neuen Sprache
für wesentlich noch unbekannte Dinge. Das Weltwissen und das Sprachwissen modifizieren
sich hier in einem Zug. (...) Das schließt nicht aus, daß wir im Nachhinein so etwas wie eine
rationale Rekonstruktion unseres veränderten Weltverhältnisses leisten können, daß wir
Gründe für diese Veränderung sowohl unserer sprachgebundenen Standards als auch unserer
sprachgebundenen Überzeugungen haben." (Seel 1993; 522)
Formen der Welterschließung im Medium der Sprache sind für Seel die gelungene
sprachliche Prägung, die innovative Metapher, innovative Theorien und Kunst - als
"Welterschließung im kleinen". (Seel 1993; 523) Insbesondere Seels Theorie der Metapher
erscheint mir nun für eine sprachanalytisch ambitionierte Interpretationsforschung als
bedeutsam.{97} Seel stellt eine "Kritik des Andeutungsparadigmas der nichtwörtlichen
Rede" (Seel 1990; 239), der Unterscheidung "zwischen buchstäblichem und metaphorischem
Ausdruck" (Seel 1990; 242) zur Diskussion, die jeder "Paraphrasentheorie" oder
"Agitationstheorie" der Metapher den Boden entzieht. (Seel 1990; 247f) Die Metapher, so
Seel, ist "eine komplexe Artikulation wahrnehmungsbildender Sichtweisen". (Seel 1990;
260) "Eine wörtliche Äußerung artikuliert einen Sachverhalt unter Verzicht auf eine
Charakterisierung der voraussetzungsvollen Relevanz der Sache, um die es geht"; eine
"metaphorische Äußerung artikuliert die sichtgebundene Relevanz ihres Gegenstands unter
Verzicht auf eine zutreffende satzinterne Charakterisierung ihres Objekts". (Seel 1990; 260)
Es ist eben so, "daß wir über sachbildende und sichtbildende Artikulationsformen zugleich
verfügen". (Seel 1990; 264) Die "Komplementarität buchstäblicher und figürlicher, direkter
und indirekter Rede" (Seel 1990; 261) ist also das auch interpretationstheoretisch relevante
Faktum, von dem auszugehen ist.
Eine sprachanalytisch reflektierte Interpretation zum Beispiel der Türhüter-Parabel Kafkas
hätte so gesehen zu zeigen, welche 'sichtgebundene Relevanz' die figürliche Sprache des
Textes artikuliert, wie Metaphern 'perspektivenartikulierend' fungieren. Eine sprachanalytisch
reflektierte Interpretationswissenschaft hätte so gesehen zu prüfen, wie Interpreten ihre
metaphernbezogenen Deutungsbehauptungen begründen.
3.9 Kultur der Interpretation: Pluralismus als Perspektive?
Mit welcher Stimme spricht der philologische Interpret? Mit wessen Stimme spricht er? Für
wen spricht er? Literarische und literaturwissenschaftliche Interpreten scheinen nicht selten
nur für sich selbst sprechen und sich selbst-darstellen zu wollen - als Meisterexegeten einer
Interpretationskultur, die außerhalb ihrer geisteswissenschaftlichen Disziplin kaum mehr
Resonanz findet; als Bewahrer einer kulturellen und ästhetischen Praxis, die mindestens ihrer
Selbstwahrnehmung nach von einer nachgerade grassierenden Sucht nach
Authentizitätssurrogaten der medialen Scheinwelten verdrängt wird. Aber das Problem
authentischen (Selbst-)Ausdrucks und authentischer (Selbst-)Interpretation in einer
vielperspektivischen kulturellen und sozialen Welt läßt sich mit derartigen
Kompensationsversuchen nicht lösen. Den Philologen als Interpretationswissenschaftlern
sollten intelligentere Antworten einfallen; zumal ja die Politische Philosophie schon gewisse
Perspektiven der Interpretation der Vielfalt der Interpretationswelten eröffnet.{98} Die
Philologie könnte Konzepte und Methoden der Wahrnehmung und Deutung der
vielsprachlichen und vielstimmigen Diskurse über nationale und kulturelle Grenzen
entwickeln.
T. McCarthy regt mit seiner Kritik des 'Multikulturellen Universalismus'{99} dazu an.
McCarthy skizziert programmatisch den Bezugsrahmen einer 'reflexiven Anthropologie' für
wissenschaftliche Interpretationen:{100} "Ethnographische Darstellungen sind immer die
Produkte komplexer, situierter, vieldeutiger und konfliktreicher Interaktionen gewesen; die
neuen 'reflexiven' Anthropologen versuchen nicht länger, diese Tatsache hinter der glatten
Objektivität realistischer Beschreibung oder den ununterbrochenen Monologen symbolischer
Interpretation zu verbergen." (McCarthy 1993; 34/35) "Blick trifft nun auf Blick,
Beschreibung auf Beschreibung, Kritik auf Kritik. Die Realitäten des Schreibens haben in
dieser zunehmend dezentrierten und multikulturellen Öffentlichkeit das ethnographische
Selbstbewußtsein deutlich gestärkt und ein radikales Experimentieren mit den Konventionen
ihres Genres bewirkt." "So sind zum Beispiel", meint McCarthy mit gezielter Kritik an den
nur quasi-dialogischen Verfahren der hermeneutisch orientierter Forschungs- und
Interpretationspraktiken, "die virtuellen Dialoge der hermeneutischen Forschung" "einer
Gestaltung tatsächlich dialogischer oder 'polyphoner' Texte gewichen, welche denen, die
dargestellt werden, erlauben, mit ihrer eigenen Stimme zu sprechen, ihre eigenen
Geschichten zu erzählen, die Ansichten der Ethnographen in Zweifel zu ziehen, alternative
Vorschläge anzubieten und dergleichen." (McCarthy 1993; 34)
Aber vermitteln sich dabei die Perspektiven der Akteure, der Betroffenen und ihrer
Beobachter? "Es ist wichtig zu erkennen", stellt McCarthy fest, "daß stilistische Fragen"
ethnographischer Darstellung "eng mit epistemologischen Fragen verbunden sind. Die
Objektivität und Angemessenheit der von teilnehmenden Beobachtern vom Standpunkt einer
'dritten' Person gegebenen Beschreibungen von Überzeugungen und Handlungsweisen, die
bereits von Darstellungen aus der Sicht der 'ersten' und der 'zweiten Person' durchdrungen
sind, kann am Ende nicht unabhängig von letzteren gewährleistet werden. Solche
Darstellungen sind im Prinzip durch die Subjekte, deren Überzeugungen und
Handlungsweisen zur Debatte stehen, anfechtbar. Dies ist einer der Grundzüge der
epistemischen Beziehungen zwischen Subjekt und Subjekt, die sie von den epistemischen
Beziehungen zwischen Subjekten und reinen Objekten unterscheiden. Subjekte können
dagegen reden, sie können die Auffassungen kritisieren, die Beobachter von ihnen haben, und
sie können alternative Darstellungen anbieten; sie können sogar Interpretationen dafür
anbieten, was mit den Beobachtern und deren einheimischen Kulturen los ist, daß sie dazu
neigen, aus ihren Darstellungen in wichtigen Aspekten irreführende Darstellungen zu
machen. Die Einbahn-Beschreibungen des klassischen Realismus disqualifizieren ihre
Subjekte als kompetente Dialogpartner gerade durch den Akt ihrer Darstellung." (McCarthy
1993; 35) Das dürfte, denke ich, bereits für literaturwissenschaftliche Interpretationen
literarischer Interpretationen gelten.
Das Faktum der Interpretativität literaler, kultureller und sozialer Welten lasse sich jedenfalls
nicht mehr mit der Metapher vom zu deutenden Text wegdenken; sie "verlagerte" ja "einfach
die Aktiv/passiv-Asymmetrie des klassischen Realismus. Der Interpret nahm weiterhin für
seine Darstellungen eine ethnographische Autorität in Anspruch, die einer tatsächlichen
Auseinandersetzung mit denen, deren Meinungen dargestellt wurden, nicht ausgesetzt war."
(McCarthy 1993; 35) Es folge ja "aus dem Bewußtsein der Konstruiertheit soziokultureller
Darstellungen nicht, daß wir ohne sie auskommen können. Schon die alltägliche
Kommunikation spielt sich als ein ständiges Vor- und Zurückgehen zwischen den
Perspektiven der ersten, zweiten und dritten Person ab, wodurch wir der Reihe die Rolle des
Sprechers, des Zuhörers und des unbeteiligten Zuschauers einnehmen. Die Idee, das Reden
über andere Personen zugunsten ausschließlich mit ihnen zu verbannen, ist in diesem Kontext
sinnlos. Genausowenig hat es in der politischen und kulturellen Öffentlichkeit heutiger
Gesellschaften oder den Geistes- und Humanwissenschaften Platz." (McCarthy 1993; 37/38)
Aber lassen sich die interkulturellen, intrakulturellen, intertextuellen und intratextuellen
Interpretationsverhältnisse denn tatsächlich noch nach Modell der Hermeneutik des
Verstehens, der Interpretation fremder Personen, Kulturen, Welten interpretieren? Inwieweit
kann man in einer Welt weiter fortschreitender Industrialisierung der Informations-,
Kommunikations- und Wissenstechnologien begrifflich noch auf dialogische Hermeneutik
setzen? Kurz: Wie weit reichen Interpretationstheorien überhaupt noch, die die Technisierung
der Interpretationswelten selbst ignorieren?
3.10 Interpretationswissenschaft vor der 'Kognitiven Wende': Interpretation als Kognition?
Bereits 1984 haben Danneberg und Müller eine verstehenstheoretische Bestandsaufnahme
der literaturwissenschaftlichen Interpretationspraxis vorgelegt,{101} in der sich eine
'Kognitive Wende' der Wissenschaftstheorie der Literaturwissenschaft andeutet. Der
Forschungsüberblick über Verstehenstheorien von S. J. Schmidt von 1986 stellt die
kognitionswissenschaftlichen Entwicklungen bis zu diesem Zeitpunkt dar.{102} Er dürfte,
was den Mainstream der Kognitionsforschung angeht, immer noch informativ sein. Die
interpretationstheoretisch wie -analytisch relevanten Aussagen lassen sich, mit der
notwendigen Kürze, etwa so rekapitulieren: Das Verstehen von sprachlichen Äußerungen,
von Texten ist so etwas wie ein Wiedererkennen von (Spuren von) sprachlichen Handlungen,
deren Muster oder Schemata wir 'im Kopf' haben. Einen sprachlichen Ausdruck zu verstehen
heiße, ihn als die Aktualisierung jenes Ausdrucksmusters wahrzunehmen, das wir im Laufe
unserer kulturell geprägten sprachlichen (literalen) Lerngeschichte erworben haben.
Selbstverständlich entsprechen die sprachlichen Ausdrucksmuster und Ausdrucksformen, die
uns in Texten begegnen, nicht immer, richtiger: in aller Regel nur in Grenzen, unseren
eigenen Ausdrucksgewohnheiten. Eben deswegen ist das Verstehen von Texten oft auch ein
sprachliches Lernen: die Aktualisierung der sprachlichen Schemata beim Verstehen von
Texten hat oft deren Modifikation zur Folge.{103} Analog ließen sich die
Interpretationspraktiken und -gewohnheiten der Literaturwissenschaftler darstellen: Das
literaturwissenschaftliche Verstehen des literarischen Verstehens literarischer Texte bestehe
in nichts anderem als der Aktualisierung derjenigen fachwissenschaftlichen Wahrnehmungsund Handlungsschemata, die im Laufe der wissenschaftlichen Sozialisation angeeignet
worden sind. Auch der Literaturwissenschaftler sieht so gesehen für gewöhnlich nur, was er
weiß. (R. Arnheim)
Zweifellos eröffnet diese Sicht der Dinge der Interpretationsforschung selbst eine neue
Perspektive: Literaturwissenschaftliche Interpretation ist eine bestimmten Gewohnheiten und
Üblichkeiten folgende kulturelle Praxis; philologische Interpretationsforschung ist jene
wissenschaftskritische kulturelle Praxis, die eben diese Gewohnheiten und Üblichkeiten des
literaturwissenschaftlichen Handelns und Wissens untersucht.
Doch dieses Konzept verliert schnell an Attraktivität, wenn man sich mit seinen sprach-,
handlungs- und kulturtheoretischen Implikationen auseinandersetzt. Die Rede von den
kognitiven Schemata verdankt sich nämlich einem (nur scheinbar auf Kant zurückgehenden)
naturalistischen Verständnis des menschlichen Bewußtseins. Man fällt in der
kognitionstheoretisch orientierten Verstehenspsychologie auf die Vorstellung zurück, unsere
'innere Natur' sei uns prä- oder postreflexiv zugänglich. Man denkt, und dafür bietet die
derzeit vorherrschende 'Kognitive Linguistik' scheinbar alle guten Gründe an{104}, die
Wissenschaft sei in der Lage, die 'Sprache des Geistes' problem-, perspektiven- und
interpretationsunabhängig zu explizieren, 'auszubuchstabieren'.{105} Gerade in der
sogenannten Künstliche-Intelligenz-Forschung ist aber diese Vorstellung inzwischen fast
schon verabschiedet.{106} Es werden inzwischen gewichtige Argumente dagegen
vorgetragen, daß sich das 'Mind-Brain-Problem' naturalistisch lösen lasse.{107} Die
'Kognitive Wende' auch der Interpretationswissenschaft hätte also eine symboltheoretische
Wende zu sein.
Mit anderen Worten: Die Kognitionsforschung kann in ihrer derzeitigen Verfassung noch
keinen Beitrag zur Klärung des Problems der Interpretation leisten; sie wäre selbst erst noch
interpretationstheoretisch zu fundieren. Sie hätte dabei von dem elementaren Faktum
auszugehen, daß Wahrnehmung, Handlung, Erkenntnis und Wissen durch symbolische
Medien vermittelte konstruktive Prozesse sind.{108} Es gibt 'keine Repräsentation ohne
Interpretation'.{109} Die kognitive Wende wird eine interpretative sein müssen.
FUSSNOTEN********************************
{1}
Vielleicht ein Motto: "Der Kommentar steht selbst zur Untersuchung an. Seine
Organisation und das, was sie bedingt, sind zu analysieren. Was die Kommentare formiert,
muß der Zuweisung einer Bedeutung zunächst vorgelagert sein. Damit also geht es um
Wissenschaft und 'Wissenschaftsgeschichte'." (Fohrmann 1988; 254)
{2}
Chadarevian, S. de: Lokales Wissen und standardisierte Praktiken. Vernunftkritische
Überlegungen zu neuen Ansätzen in der Wissenschaftsgeschichte. In: Menke, C./Seel, M.
(Hg.): Zur Verteidigung der Vernunft gegen ihre Liebhaber und Verächter. Frankfurt am
Main 1993; 66 - 83. - C. referiert exemplarisch die aktuelle Wissenschaftsforschung über die
Kultur der Naturwissenschaften.
{3}
Collins, H. M.: Changing order. Replication and induction in scientific practice.
London 1985; VII. Zitiert nach Chadarevian 1993; 67/68.
{4}
Chadarevian, S. de: Lokales Wissen und standardisierte Praktiken. Vernunftkritische
Überlegungen zu neuen Ansätzen in der Wissenschaftsgeschichte. In: Menke, C./Seel, M.
(Hg.): Zur Verteidigung der Vernunft gegen ihre Liebhaber und Verächter. Frankfurt am
Main 1993; 66 - 83.
{5}
In literaturwissenschaftlichen Zusammenhängen die Richtigkeit und Wahrheit von
Interpretationen zum Kriterium zu machen, scheint gegenwärtig nicht ganz zeitgemäß zu
sein. M. Seel zeigt aber, daß das Gegenteil der Fall ist: Die 'Richtigkeit' besteht in der
"Korrektheit des Herangehens an eine Situation oder Aufgabe"; die 'propositionale Wahrheit'
von Interpretationen "ist zutreffende Aussage" über jene Situations- oder
Sachverhaltsverständnisse, an denen wir uns einer Situation oder Aufgabe gegenüber
orientieren. Interpretationen (von Interpretationen) können im Sinne von Seel als Handlungen
verstanden werden, die beide miteinander zusammenhängende Ansprüche erfüllen müssen,
wenn sie denn Sinn machen sollen. Siehe: Seel, M.: Über Richtigkeit und Wahrheit.
Erläuterungen zum Begriff der Welterschließung. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie
3/1993; 509 - 524.
{6}
Staiger, E.: Die Kunst der Interpretation. Studien zur deutschen Literaturgeschichte.
Zürich 1955. (Vierte Auflage 1963.) Hier: "Ein Briefwechsel mit Martin Heidegger"; 34 - 49.
{7}
Siehe dagegen: Nussbaumer, M.: Was Texte sind und wie sie sein sollen. Tübingen
1991.
{8}
Zur Kritik der gegenwärtigen divergenten linguistischen Forschungspraktiken und
Forschungspräferenzen siehe beispielsweise: Switalla, B.: Die gegenwärtige germanistische
Linguistik. Eindrücke und Mutmaßungen. In: Prinz, W./Weingart, P. (Hg.): Die sog.
Geisteswissenschaften: Innenansichten. Frankfurt am Main 1990; 222 - 239. Im selben Band
findet man auch eine kurze, pointierte Bestandsaufnahme der Literaturwissenschaft als
Geisteswissenschaft: Voßkamp, W.: Literaturwissenschaft als Geisteswissenschaft. Thesen
zur Geschichte der deutschen Literaturwissenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. A.a.O.;
240 - 247.
{9}
Ein paar einschlägige Beispiele: Abel, G.: Interpretationswelten.
Gegenwartsphilosophie jenseits von Essentialismus und Relativismus. Frankfurt am Main
1993. Davidson D.: Der Mythos des Subjektiven. Philosphische Essays. Stuttgart 1993.
Goodman, N.: Weisen der Welterzeugung. Frankfurt am Main 1984. Putnam, H.:
Repräsentation und Realität. Frankfurt am Main 1991. Schneider, H. J.: Phantasie und
Kalkül. Über die Polarität von Handlung und Struktur in der Sprache. Frankfurt am Main
1992. Taylor, C.: Negative Freiheit? Zur Kritik des neuzeitlichen Individualismus. Frankfurt
am Main 1992.
{10} So auch: Frühwald, W./Jauß, H. R./ Koselleck, R./Mittelstraß, J./Steinwachs, B.:
Geisteswissenschaften heute. Eine Denkschrift. Frankfurt am Main 1991. (Teil V.:
Geisteswissenschaften und Medien.)
{11} Wellbery, D. E. (Hg.): Positionen der Literaturwissenschaft. Acht
Modellinterpretationen am Beispiel von Kleists 'Das Erdbeben in Cili'. München 1985.
{12} Altenhofer, N.: Der erschütterte Sinn. Hermeneutische Überlegungen zu Kleists
'Erdbeben in Chili'. In: D. E. Wellbery (Hg.): Positionen der Literaturwissenschaft. Acht
Modellanalysen am Beispiel von Kleists 'Das Erdbeben in Chili'. München 1985; 39 - 53.
{13}
Kittler, F.: ...
{14} Bogdal, K.-M. (Hg.): Neue Literaturtheorien in der Praxis. Textanalysen von Kafkas
'Vor dem Gesetz'. Opladen 1993.
{15} Fingerhut, K.: Umgang mit Unförmlichem. Fachdidaktische Anmerkungen zum
Problem der 'Offenheit' literarischer Texte. In: DD-Postille Nr.4, 1994; 50 - 55.
{16}
Binder, H.: 'Vor dem Gesetz'. Einführung in Kafkas Welt. Stuttgart/Weimar 1993.
{17} Bogdal, K.-M. (Hg.): Neue Literaturtheorien in der Praxis. Textanalysen von Kafkas
'Vor dem Gesetz'. Opladen 1993.
{18} Bogdal, K.-M.: 'Das Urteil kommt nicht mit einemmal'. Symptomatische Lektüre und
historische Diskursanalyse von Kafkas 'Vor dem Gesetz'. In: Bogdal, K.-M. (Hg.): Neue
Literaturtheorien in der Praxis. Textanalysen von Kafkas 'Vor dem Gesetz'. Opladen 1993; 43
- 63.
{19} Adornos Ästhetik läßt grüßen. Dazu kritisch: Seel, M.: Vor dem Schein kommt das
Erscheinen. Bemrkungen zu einer Ästhetik der Moderne. In: Merkur 9/10 1993; 770 - 783.
{20} Zur Kritik am hier offensichtlich vorausgesetzten Konzept des 'Central-Meaner' mit
Bezug auf die aktuelle 'Mind-Brain'-Debatte siehe zum Beispiel: Dennett, D. C.: The
intentional stance. Cambridge (Mass.) 1987; Dennett, D. C.: The interpretation of texts,
people and other artifacts. Report No. 15/1990, ZIF Bielefeld.
{21} Altenhofer, N.: Der erschütterte Sinn. Hermeneutische Überlegungen zu Kleists
'Erdbeben in Chili'. In: D. E. Wellbery (Hg.): Positionen der Literaturwissenschaft. Acht
Modellanalysen am Beispiel von Kleists 'Das Erdbeben in Chili'. München 1985; 39 - 53.
{22} Witte, B.: DAs Gericht, das Gesetz, die Schrift. Über die Grenzen der Hermeneutik
am Beispiel von Kafkas Türhüter-Legende. In: Bogdal, K.-M. (Hg.): Neue Literaturtheorien
in der Praxis. Textanalysen von Kafkas 'Vor dem Gesetz'. Opladen 1993; 94 - 114.
{23} Wie viele andere Kafka- oder Kleist-Interpreten auch nimmt Witte auf die
Geschichte im Kafka-Text auf eine hermeneutisch wenig reflektierte Weise Bezug. Er
identifiziert die Handlungen und Äußerungen der dargestellten Personen mit Hilfe eines naivalltagslogischen, um nicht zu sagen: alltagspsychologischen Vokabulars. Da werden
(Darstellungen von) Handlungen der Erzählfiguren als 'Andeutung' sozialer Entwertung
gedeutet (Witte 1993; 96); deren (dargestellte) äußere Erscheinung wird als ein Ausdruck von
Macht gesehen (Witte 1993; 96); die situative Dominanz der einen der beiden Erzählfiguren
wird aus der sprachlichen Darstellung des Erzählers erschlossen (Witte 1993; 96); die
Beschreibung der Einstellung einer der beiden Figuren durch den Erzähler wird als Ausdruck
ihrer Lebenssituation gewertet (Witte 1993; 96); die Charakterisierung einer der beiden
Erzählfiguren durch den Erzähler wird als eine plausible nachvollzigen (Witte 1993; 96); die
Darstellung einer Wahrnehmung einer der beiden Erzählfiguren wird als metaphorischer
Ausdruck einer positiven Perspektive des Ausgangs der Geschichte für eben diese Figur
interpretiert (Witte 1993; 96); von einer bestimmten Schlüsselstelle am Ende der Parabel
heißt es, daß sie wohl so, aber auch anders verstanden werden könne (Witte 1993; 101) - und
so fort. Bei allen diesen Feststellungen des Interpreten ist so etwas wie eine psychologische
Identikation mit der (dargestellten) Situation der (dargestellten) handelnden Personen der
verstandenen Geschichte im Spiel, genauer: eine Identifikation der Perspektive des
Interpreten mit der Perspektive des Erzählers.
{24} Unter dem sprachlichen Ausdruck x sei y zu verstehen (Witte 1993; 98); der
Ausdruck x dürfe auch als Ausdruck für das und das verstanden werden (Witte 1993; 98);
Kafkas eigenes Verständnis eines Aspekts seiner familialen Beziehungsgeschichte
kennzeichne die Symptomatik des Verhaltens einer der beiden Erzählfiguren (Witte 1993;
98), und im Beziehungsverhalten einer der beiden Erzählfiguren sei genau das
Beziehungsverhältnis des Erzählers (oder des Autors) wiederzuerkennen (Witte 1993; 99).
{25} Witte bezieht sich hier, wie übrigens auch viele andere Kafka-Exegeten, auf:
Neumann, G.: Umkehrung und Ablenkung: Fanz Kafkas 'Gleitendes Paradox'. In: Deutsche
Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 42/1968; 702 - 744.
{26}
Siehe Bogdal 1993a; 11 - 17.
{27} Hiebel, H. H.: "Später!" - Poststrukturalistische Lektüre der "Legende" 'Vor dem
Gesetz'. In: Bogdal, K.-M. (Hg.): Neue Literaturtheorien in der Praxis. Textanalysen von
Kafkas 'Vor dem Gesetz'. Opladen 1993; 18 - 42.
{28} Ähnlich denkt ja auch Witte 1993; 96, über die "Lichtmetaphorik" eines Satzes von
Kafka: Er spricht von einem "Schwebezustand zwischen Wörtlichkeit und Uneigentlichkeit
sowie Vielbezüglichkeit bzw. Unbestimmtheit dieser Uneigentlichkeit oder Figürlichkeit
Kafkas Werk; vorherrschend ist daher die Metapher(!)" (Witte 1993; 96) Das "Gesetz"
werde, metaphorisch, "mit einem Haus oder einer Stadt verglichen, in das einzutreten,
Geborgenheit oder Erfüllung bedeuten würde, vor dessen Tor aber ein Beauftragter darüber
wacht, daß nicht jedermann Zugang erhält." (Witte 1993; 95)
{29} Zur Kritik "Kritik des Andeutungsparadigmas der nichtwörtlichen Rede": Seel, M.:
Am Beispiel der Metapher. Zum Verhältnis von buchstäblicher und figürlicher Rede. In:
Forum für Philosophie Bad Homburg (Hg.): Intentionalität und Verstehen. Frankfurt am
Main 1990; 237 - 272. Der "Unterschied zwischen buchstäblichem und metaphorischem
Ausdruck liegt in der Dimension der Rede". (Seel 1990; 242) Die Metapher "artikuliert"
"Konturen der (nach Meinung des Sprechers) maßgeblichen Sicht des
Gesprächsgegenstands", (Seel 1990; 251), Metaphern erbringen eine
"perspektivenartikulierende Leistung". (Seel 1990; 253) "Eine wörtliche Äußerung artikuliert
einen Sachverhalt unter Verzicht auf eine Charakterisierung der voraussetzungsvollen
Relevanz der Sache, um die es geht"; eine "metaphorische Äußerung artikuliert die
sichtgebundene Relevanz ihres Gegenstands unter Verzicht auf eine zutreffende satzinterne
Charakterisierung ihres Objekts". (Seel 1990; 260) Es besteht eine "Komplementarität
buchstäblicher und figürlicher, direkter und indirekter Rede". (Seel 1990; 261) Es ist also so,
"daß wir über sachbildende und sichtbildende Artikulationsformen zugleich verfügen". (Seel
1990; 264)
{30} Galle, R.: Zur Kafka-Rezeption. In: Bogdal, K.-M. (Hg.): Neue Literaturtheorien in
der Praxis. Textanalysen zu Kafkas 'Vor dem Gesetz'. Opladen 1993; 115 - 139.
{31}
Robert, M.: Kafka en France. In: Obliques 3; 5 - 9. (Ohne Jahrgang.)
{32} Da ist beispielsweise die Rede vom "Eindruck einer illegitimen Verengung und
Vereinseitigung des im Werk selbst angelegten semantischen Spektrums" (Galle 1993; 122),
von "der Amibvalenz, in die der Leser Kafkas gleich eingangs dem Romanhelden gegenüber
geführt wird" (Galle 1993; 123/124), von der "Wiederholung einer Szene, die bei Kafka den
von ihr ausgehenden Effekt des Unheimlichen potenziert" (Galle 1993; 125), von der
"Affinität zwischen K. (...) und der Instanz, die den Prozeß gegen ihn führt" (Galle 1993;
125), von der "Involviertheit K.s in die ihn zerstörenden Mechanismen des Prozesses" (Galle
1993; 127).
{33} Die Hinrichtungsszene etwa im Roman Kafkas wird beim Vergleich mit der Version
Handkes - die beiden Texte hat Galle "synoptisch nebeneinandergestellt" (Galle 1993; 136) so gedeutet: "Das Besondere dieser bei Handke aufgegebenen Kafka-Zeilen dürfte darin
liegen, daß die den ganzen Roman durchziehende Ambivalenz hier noch einmal eine
besondere Verdichtung erfährt." Und als Erläuterung dieser Deutung wird den Text zitierend
und kommentierend angeführt: "'Vollständig konnte er sich nicht bewähren, alle Arbeit den
Behörden nicht abnehmen', kann zunächst einmal als ein ironisch formulierter Protest und als
eine Form der Selbstbehauptung gelesen werden, zum anderen aber wird mit der
semantischen Reihe, die von 'Pflicht' über 'bewähren' und 'Verantwortung' bis hin zum
markanten 'letzten Fehler' reicht, doch auch eine Ebene aufgerufen, die die Schuld K.s
festzuschreiben und die Instanz zu beglaubigen scheint, die das Urteil über ihn spricht."
(Galle 1993; 136) Diese "Ambivalenz Kafkas" (Galle 1993; 136) sei bei Handke nicht mehr
zu finden, Handke sei anders zu lesen: Der letzte Satz in Handkes Darstellung der
Hinrichtungsszene sei nämlich so zu verstehen: "Immanent gelesen" sei er "nur aus der
Perspektive des Erzählers in dem Sinne zu verstehen, daß K. gar nicht auf den Gedanken
kommt, das zu tun, was die 'Hoffnung' der Mörder ihm anträgt. Insoweit wird unterstrichen,
daß die Mörder und das Opfer ganz unterschiedlichen Welten angehören, zwischen denen
eine Verbindung nicht ausmachbar ist. Intertextuell gelesen liegt aber in dem 'K. dachte
jedoch nicht daran' ein expliziter Protest gegen die Reaktion von Kafkas K." (Galle 1993;
137)
{34} Seine Konstruktion einer "semantischen Reihe" zum Beispiel ist nurmehr
intuitionistisches Wörtlichnehmen von einzelnen Elementen des (Kafka-)Textes, nicht aber
das Ergebnis einer Explikation desjenigen Gefüges der Aussagen und Annahmen, das der
Text für ihn selbst zum Ausdruck bringt.
{35} Funkkolleg 'Literatur der Moderne' 1994. Studientext 16/7 (Der Autor ist D.
Kremer.)
{36} So schon W. Schapp mit phänomenologischem Blick auf die Historisierung des
Alltagsbewußtseins: Schapp, W.: In Geschichten verstrickt. 1953. (Ohne Erscheinungsort.)
{37} Seel, M.: Eine Ästhetik der Natur. Frankfurt am Main 1991. Zwar hat Seel hier vor
allem eine "Analyse des Naturschönen" im Blick, versteht diese Analyse aber durchaus auch
als "eine Einführung in die allgemeine Ästhetik". (Seel 1991; 235)
{38} Insbesondere, so Schirrmacher 1987; 4: Bloom, H.: Kabbalah and Criticism. New
York 1975.
{39} So konstatiert er später: "Doch der Roman, der diesen Prozeß erzählt, bestimmt auch
durch seinen eigenen Beitrag, den der Geistliche leistet, Schrift als das Medium, das die
Beziehung auf eine absolute Potentialität überhaupt erst 'einleitet'. Darin folgt er der
kabbalistischen Zeichentheorie, die er in seine Erzählung aufnahm." (Schirrmacher 1987;
121)
{40}
Schirrmacher 1987; 155ff.
{41}
Binder, H.: 'Vor dem Gesetz'. Einführung in Kafkas Welt. Stuttgart/Weimar 1993.
{42} Binder selbst hält diese typologische Kennzeichnung für einen interpretatorischen
Fehlgriff: die Interpreten verwendeten sie, "ohne vorher untersucht zu haben, ob die
Erzählung überhaupt die Bedingungen einer Parabel erfüllt". (Binder 1993; 4)
{43} Eine überzeugende sprachtheoretische Begründung dafür trägt H. J. Schneider bei
seiner Kritik an den aktuellen formalistisch-universalistichen Sprachauffassungen vor, deren
(vom Mainstream der bundesdeutschen Linguistik unbedacht adaptierter) Repräsentant N.
Chomsky ist: Schneider, H. J.: Phantasie und Kalkül. Über die Polarität von Handlung und
Struktur in der Sprache. Frankfurt am Main 1992. Ähnlich die Kritik an naivphänomenologischen Konzepten der Grammatik des Deutschen in: Switalla, B.: Die
DUDEN-Grammatik von 1984 - Ein Modell der grammatischen Interpretation? In: SuL
59/1987; 35 - 59.
{44}
Dazu eben: Nussbaumer, M.: Was Texte sind und wie sie sein sollen. Tübingen 1991.
{45} Kritisch dazu auch K. Weimar: "Um <den literarischen, B. Sw.> Text lesend zu
verstehen, vollziehen wir genau dieselben Operationen wie beim Lesen und Verstehen eines
jeden anderen Textes, sei er nun ein literarischer oder nicht. Wir identifizieren Striche als
Buchstaben und Buchstabengruppen als Wörter, wir bestimmen deren Bedeutung und
vernetzten diese zu Zusammenhängen." Die "'Arbeit am Text'", so Weimar mit ironischem
Unterton, "diese unsere dann folgende literaturwissenschaftliche Arbeit, ist unser Denken,
Reden und Schreiben über den gelesenen und vorläufig verstandenen Text Metakommunikation mit unserem eigenen Verständnis desselben". Literaturwissenschaft als
"Metakommunikation(!) mit(!) dem(!) eigenen(!) Verständnis(!) im Bemühen um die
Findung, Rettung, Konstituierung von Sinn" sei "seit geraumer Zeit eine unerkannte Praxis".
Weimar, K.: Gibt es eine literaturwissenschaftliche Hermeneutik? In: LuD 57/1986; 11 - 19.
{46} Zum Stand der kognitionswissenschaftlichen Textverständnisforschung: Schmidt, S.
J.: Texte verstehen - Texte interpretieren. In: Eschbach, A. (Hg.): Perspektiven des
Verstehens. Bochum 1986; 75 - 103.
{47} Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, daß die folgende Auseinandersetzung mit
literaturwissenschaftlichen Interpretationskonzepten exemplarischer Art ist. Mir kommt es
nurmehr darauf an, anhand von Beispielen elementare interpretationstheoretische Probleme
zu vergegenwärtigen und Ansätze zu ihrer Lösung anzudeuten.
{48}
Kurz, G.: Editorial zu: LuD 57/1986: "Interpretation".
{49}
Gadamer, H. G.: Der 'eminente' Text und seine Wahrheit. In: LuD 57/1986; 4 - 10.
{50} Gadamer, H.-G.: Text und Interpretation. In: Forget, P. (Hg.): Text und
Interpretation. München 1984; 24 - 55.
{51} Frank, M.: Die Grenzen der Beherrschbarkeit der Sprache. Das Gespräch als Ort der
Differenz von Neostrukturalismus und Hermeneutik. In: Forget, P. (Hg.): Text und
Interpretation. München 1984; 181 - 213.
{52} Frank spielt hier offensichtlich auf Peirce an - und setzt dessen 'abduktiven Schluß'
anscheinend mit der wissenschaftlichen Hypothesenbildung gleich. Siehe dagegen die
Pragmatismus-Vorlesungen von Peirce von 1903. In: K. O. Apel (Hg.): C. S. Peirce:
Schriften II: Vom Pragmatismus zum Pragmatizismus. Frankfurt am Main 1970; 299 - 388.
{53} Siehe Franks Schleiermacher-Interpretation: Frank, M.: Das individuelle Allgemeine.
Textstrukturierung und -interpretation nach Schleiermacher. Frankfurt am Main 1977.
{54} Fohrmann, J./Müller, H. (Hg.): Diskurstheorien und Literaturwissenschaft. Frankfurt
am Main 1988.
{55} Fohrmann, J./Müller, H. (Hg.): Diskurstheorien und Literaturwissenschaft. Frankfurt
am Main 1988; 9 - 22.
{56} Müller, H.: Kleist, Paul de Man und Deconstruction. Argumentative NachStellungen. In: Fohrmann, J./Müller, H. (Hg.): Diskurstheorien und Literaturwissenschaft.
Frankfurt am Main 1988; 81 - 92.
{57} Jäger, L.: Der saussürsche Begriff des Aposème als Grundlagenbegriff einer
hermeneutischen Semiologie. In: Jäger, L./Stetter, C. (Hg.): Zeichen und Verstehen. Aachen
1986; 7 - 33.
{58}
Stetter, C.: Saussure. In: ...
{59} Wenn denn schon zeichentheoretisch zu argumentieren versucht wird, sollte man
wenigstens die nach wie vor aktuelle semiologische Tradition zur Kenntnis nehmen, wie sie
zum Beispiel vergegenwärtigt ist in: Scherer, B. M.: Prolegomena zu einer einheitlichen
Zeichentheorie. Ch. S. Peirces Einbettung der Semiotik in die Pragmatik. Tübingen 1984.
{60} Fohrmann, J.: Der Kommentar als diskursive Einheit der Wissenschaft. In:
Fohrmann, J./Müller, H. (Hg.): Diskurstheorien und Literaturwissenschaft. Frankfurt am
Main 1988; 244 - 257.
{61} Siehe zum Beispiel: Schmidt, S. J. (Hg.): Literaturwissenschaft und Systemtheorie.
Positionen, Kontroversen, Perspektiven. Opladen 1993.
{62} Schönert, J.: Empirische Literaturwissenschaft: Verschlossene wissenschaftliche
Anstalt oder Bastion mit offenen Toren? Überlegungen zur Organisation
literaturwissenschaftlicher Theorie und Praxis. LUMIS-Schriften 5. Siegen 1985.
{63}
Schmidt, S. J.: Kommunikationskonzepte für eine systemorientierte
Literaturwissenschaft. In: Schmidt, S. J. (Hg.): Literaturwissenschaft und Systemtheorie.
Positionen, Kontroversen, Perspektiven. Opladen 1993; 241 - 268.
{64} Zum Beispiel: Joas, H.: Praktische Intersubjektivität. Die Entwicklung des Werks
von George Herbert Mead. Frankfurt am Main 1980. Joas, H.: Die Kretaivität des Handelns.
Frankfurt am Main 1992.
{65} Zum Beispiel: Jäger, L.: Über die Individualität von Rede und Verstehen - Aspekte
einer hermeneutischen Semiologie bei W. v. Humboldt. In: Frank, M./Haverkamp, A. (Hg.):
Individualität. München 1988; 76 - 94.
{66} Siehe etwa: Luhmann, N.: Was ist Kommunikation? In: Information Philosophie
1/1987; 4 - 16.
{67}
Joas, H.: Die Kreativität des Handelns. Frankfurt am Main 1992; 306 - 326.
{68} Schmidt bezieht sich hier explizit auf: Feilke, H.: Common Sense-Kompetenz.
Überlegungen zu einer Theorie des 'sympathischen' und 'natürlichen' Meinens und
Verstehens. Diss. Siegen 1992. (Im Erscheinen.)
{69} Schmidt, S. J.: Die Wirklichkeit des Beobachters. In: Merten, K./Schmidt, S.
J./Weischenberg, S. (Hg.): Die Wirklichkeit der Medien. Eine Einführung in die
Kommunikationswissenschaft. Opladen 1994; 3 - 19.
{70}
Obwohl Schmidt später Luhmanns Begriff der Kommunikation relativiert: 604ff.
{71}
Vergl.: Joas, H.: Praktische Intersubjektivität. Frankfurt am Main 1980.
{72} Schmidt, S. J.: Konstruktivismus in der Medienforschung: Konzepte, Kritiken,
Konsequenzen. In: In: Merten, K./Schmidt, S. J./Weischenberg, S. (Hg.): Die Wirklichkeit
der Medien. Eine Einführung in die Kommunikationswissenschaft. Opladen 1994; 592 - 623.
{73} Kruse, P.: Stabilität - Instabilität - Multistabilität. Selbstorganisation und
Selbstreferentialität in kognitiven Systemen. In: DELFIN 11/1988; 35 - 57.
{74} Scheffer, B.: Interpretation und Lebensroman. Zu einer konstruktivistischen
Literaturtheorie. Frankfurt am Main 1992.
{75} Goodman, N./Elgin, C. Z.: Revisionen. Philosophie und andere Künste und
Wissenschaften. Frankfurt am Main 1993. Siehe auch: Goodman, N.: Weisen der
Welterzeugung. Frankfurt am Main 1984.
{76} Groeben, N.: Der Paradigma-Anspruch der Empirischen Literaturwissenschaft. In:
In: Barsch, A./Rusch, G./Viehoff, R. (Hg.): Empirische Literaturwissenschaft in der
Diskussion. Frankfurt am Main 1994; 21 - 38.
{77} Still, A./Costall, A. (Hg.): Against Cognitivism. Alternative foundations for cognitive
psychology. New York/London/Toronto/Sydney/Tokyo 1991. Münch, D. (Hg.):
Kognitionswissenschaft. Grundlagen, Probleme, Perspektiven. Frankfurt am Main 1992.
{78}
Siehe: Rössler, B.: Die Theorie des Verstehens in Sprachanalyse und Hermeneutik.
Untersuchungen am Beispiel M. Dummetts und F. D. E. Schleiermachers. Berlin 1988.
{79} Exemplarisch: Flick, U./v.Kardorff, E./Keupp, H./v.Rosenstiel, L./Wolff, S. (Hg.):
Handbuch Qualitative Sozialforschung. Grundlagen, Konzepte, Methoden und
Anwendungen. München 1991.
{80} Schwemmer, O.: Theorie der rationalen Erklärung. Zu den methodischen Grundlagen
der Kulturwissenschaften. München 1976. Schwemmer, O.: Handlung und Struktur. Zur
Wissenschaftstheorie der Kulturwissenschaften. Frankfurt am Main 1987. Schwemmer, O.:
Die Philosphie und die Wissenschaften. Zur Kritik einer Abgrenzung. Frankfurt am Main
1990.
{81} Carrier, M./Mittelstraß, J.: Geist, Gehirn, Verhalten. Das Leib-Seele-Problem und die
Philosophie der Psychologie. Berlin/New York 1989. Müller, R.-A.: Der (un)teilbare Geist.
Modularismus und Holismus in der Kognitionsforschung. Berlin/New York 1991.
{82} Collins, H. M.: Changing Order. Replication and Induction in Scientic Practice.
London 1985. Gooding, D./Pinch, T./Schaffer, S. (Hg.): The Uses of Experiment. Studies in
the Natural Sciences. Cambridge 1989.
{83} Pasternack, G.: Empirische Literaturwissenschaft und ihre
wissenschaftsphilosophischen Voraussetzungen. In: Barsch, A./Rusch, G./Viehoff, R. (Hg.):
Empirische Literaturwissenschaft in der Diskussion. Frankfurt am Main 1994; 55 - 81.
{84} Joas, H.: Die Kreativität des Handelns. Frankfurt am Main 1992. - Inzwischen setzt
sich, wie mir scheint, auch S. J. Schmidt mehr und mehr von Luhmanns systemtheoretischer
Denkweise ab: Man lese eben seine Kritik am Luhmannschen Kommunikationsbegriff im
Zusammenhang seiner neuen Skizze einer systemtheoretischen Fundierung der
Literaturwissenschaft in: Schmidt, S. J.: Konstruktivismus in der Medienforschung:
Konzepte, Kritiken, Konsequenzen. In: Merten, K./Schmidt, S. J./Weischenberg, S. (Hg.):
Die Wirklichkeit der Medien. Eine Einführung in die Kommunikationswissenschaft. Opladen
1994; 592 - 623. Vergl.: Luhmann, N.: Was ist Kommunikation? In: Information Philosophie
1/1987; 4 - 16.
{85} Deren expressivistische Aktualisierung unternimmt bekanntlich C. Taylor; etwa in:
Taylor, C.: Bedeutungstheorien. In: ders.: Negative Freiheit? Zur Kritik des neuzeitlichen
Individualismus. Frankfurt am Main 1992; 52 - 117.
{86} Donald, M.: Origins of the modern mind. Three stages in the evolution of culture and
cognition. Cambridge (Mass.) 1991.
{87} Daß auch den Philologen dieses Faktum inzwischen bewußter ist, macht zweifellos
das Verdienst der Medientheorie S. J. Schmidts aus.
{88} Siehe etwa: Scheele, B.: Dialogische Hermeneutik. In: Flick, U./v.Kardorff,
E./Keupp, H./v.Rosenstiel, L./Wolff, S. (Hg.): Handbuch Qualitative Sozialforschung.
Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen. München 1991; 274 - 278.
{89} Eco, U.: Zwischen Autor und Text. Interpretation und Überinterpretation. Mit
Einwürfen von Richard Rorty, Jonathan Culler, Christine Brooke-Rose und Stefan Collini.
München 1994.
{90} Rorty, R.: Der Fortschritt des Pragmatisten. In: Eco, U.: Zwischen Autor und Text.
Interpretation und Überinterpretation. Mit Einwürfen von Richard Rorty, Jonathan Culler,
Christine Brooke-Rose und Stefan Collini. München 1994; 99 - 119.
{91} Eco denkt nämlich mitnichten semiologisch; er orientiert sich im ganzen weitgehend
an der semiotischen Zeichentheorie von Morris, die eine - für die Wissenschaftstheorie der
dreißiger Jahre folgenreiche - szientistische Verkürzung der Semiologie von C. S. Peirce
darstellt: Während für Peirce (kurz gesagt) Beschreibungen der sprachlichen Form nicht ohne
Darstellungen der sprachlichen Bedeutung und diese wiederum nicht ohne das Verständnis
des sprachlichen Sinns möglich sind, propagiert Morris etwa drei Jahrzehnte später reine
Syntax ohne Semantik und reine Semantik ohne Pragmatik. Die Folgen sind bekannt:
Syntaktizismus dominiert bis heute in der Linguistik.
{92} Für eine erste oberflächliche Orientierung eignet sich: Lenk, H.: Philosophie und
Interpretation. Vorlesungen zur Entwicklung konstruktivistischer Interpretationsansätze.
Frankfurt am Main 1993. Ein sehr differenziertes und hoch komplexes
interpretationstheoretisches Konzept liegt vor mit: Abel, G.: Interpretationswelten.
Gegenwartsphilosophie jenseits von Essentialismus und Relativismus. Frankfurt am Main
1993. Im folgenden nehme ich nur Beuzug auf die (verstreuten, gleichwohl aber systematisch
entwickelten) interpretationstheoretischen Erörterungen von D. Davidson. Vor allem auf den
Aufsatz: Davidson, D.: Subjektiv, Intersubjektiv, Objektiv. In: Merkur 11/1991; 999 - 1014.
(Wieder abgedruckt in: Davidson, D./Fulda, H.-F.: Dialektik und Dialog. Frankfurt am Main
1993.)
{93} Mein Verständnis der interpretationspraktischen Konsequenzen der
interpretationstheoretischen Argumentation Davidsons habe ich skizziert in: Switalla, B.: Die
Sprache als kognitives Medium des Lernens. In: Eisenberg, P./Klotz, P. (Hg.): Sprache
gebrauchen - Sprachwissen erwerben. Stuttgart 1993; 33 - 61. - Unter philosophischen
Aspekten wird Davidsons 'Theorie der Radikalen Interpretation' seit mehreren Jahren intensiv
erörtert. Zum Beispiel in: Picardi, E./Schulte, J. (Hg.): Die Wahrheit der Interpretation.
Beiträge zur Philosophie Donald Davidsons. Frankfurt am Main 1990. LePore, E. (ed.): Truth
and interpretation. Perspectives on the philosophy of Donald Davidson. Oxford 1986. - Eine
Sammlung neuerer Aufsätze von Davidson findet man etwa in: Davidson, D.: Der Mythos
des Subjektiven. Philosophische Essays. Übersetzt und mit einem Nachwort herausgegeben
von Joachim Schulte. Stuttgart 1993. (Darauf hinzuweisen, ist deshalb angebacht, weil sich
manche Interpreten Davidsons bis heute mehr auf seine älteren Veröffentlichungen beziehen
- und damit gerade seine immer deutlicher werdende Interpretationstheorie nahezu
übergehen.)
{94} Siehe: Rössler, B.: Die Theorie des Verstehens in Sprachanalyse und Hermeneutik.
Untersuchungen am Beispiel M. Dummetts und F. D. E. Schleiermachers. Berlin 1990.
{95} Seel, M.: Über Richtigkeit und Wahrheit. Erläuterungen zum Begriff der
Welterschließung. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 3/1993; 509 - 524.
G. Gabriels begrifflich klare sprach-, text- und interpretationstheoretische Unterscheidungen
werde ich hier nicht ausdrücklich berücksichtigen: Gabriel, G.: Zur Interpretation
literarischer und philosophischer Texte. In: Danneberg, L./Vollhardt, F. (Hg.): Vom Umgang
mit Literatur und Literaturgeschichte. Positionen und Perspektiven nach der 'Theoriedebatte'.
Stuttgart 1992; 239 - 249.
{96} Damit sind auch Versuche der Entwicklung einer vermeintlich post-rationalen
literaturwissenschaftlich-literarischen Ästhetik widerlegt, die derzeit im Rahmen der Debatte
über die 'Aktualität des Ästhetischen' des öfteren vorgetragen werden. Kritisch zu derartigen
Versuchen äußert sich W. Welsch. In: Welsch, W.: Das Ästhetische - eine Schlüsselkategorie
unserer Zeit? In: ders. (Hg.): Die Aktualität des Ästhetischen. München 1993; 13 - 47.
{97} Seel, M.: Am Beispiel der Metapher. Zum Verhältnis von buchstäblicher und
figürlicher Rede. In: Forum für Philosophie Bad Homburg (Hg.): Intentionalität und
Verstehen. Frankfurt am Main 1990; 237 -272.
{98} Taylor, C.: Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung. Mit Kommentaren
von Amy Gutman (Hg.), Steven C. Rockefeller, Michael Walzer, Susan Wolf. Mit einem
Beitrag von Jürgen Habermas. Frankfurt am Main 1993. - Die praktischen Konsequenzen der
Debatte über die Pluralität der kulturellen Perspektiven der Interpretation deuten sich in den
interpretationstheoretischen Skizzen der us-amerikanischen Literaturnobelpreisträgerin T.
Morrison an: Morrison, T.: Im Dunkeln spielen. Weiße Kultur und literarische Imagination.
Essays. Reinbek 1994.
{99} McCarthy, T.: Multikultureller Universalismus: Variationen zu einem Thema Kants.
In: Menke, C./Seel, M. (Hg.): Zur Verteidigung der Vernunft gegen ihre Liebhaber und
Verächter. Frankfurt am Main 1993; 26 - 45.
{100} Vergl., mit Bezug auf Herder: Lorenz, K.: Einführung in die philosophische
Anthropologie. Darmstadt 1990; 61ff.
{101} Danneberg, L./Müller, H.-H.: Wissenschaftstheorie, Hermeneutik,
Literaturwissenschaft. Anmerkungen zu einem unterbliebenen und Beiträge zu einem
künftigen Dialog über die Methodologie(!) des(!) Verstehens(!). In: DVjs 58/1984; 177 - 237.
{102} Schmidt. S. J.: Texte verstehen - Texte interpretieren. In: Eschbach, A. (Hg.):
Perspektiven des Verstehens. Bochum 1986; 75 - 103.
{103} Eine ausgezeichnete kognitions- und lerntheoretische Darstellung dieses Sachverhalts
findet man schon bei Aebli: Aebli, H.: Denken: das Ordnen des Tuns. Bd. II: Denkprozesse.
Stuttgart 1981.
{104} Über die Grenzen ihrer Geltung informiert: Gardner, H.: Dem Denken auf der Spur.
Der Weg der Kognitionswissenschaft. Stuttgart 1989. Die implizite Theorie der
Sprachfähigkeit kritisiert: Müller, R.-A.: Der (un)teilbare Geist. Modularismus und Holismus
in der Kognitionsforschung. Berlin/New York 1991.
{105} Die Literatur über die (Un-)Möglichkeit dieses Projekts füllt inzwischen fast schon
ganze Bibliotheken. Hier nur ein Hinweis auf sprachtheoretische Bedenken dagegen:
Stekeler-Weithofer, P.: Handlung, Sprache und Bewusstsein. Zum 'Szientismus' in Sprachund Ereknntnistheorien. In: Dialectica 4/1987; 255 - 300.
{106} Erstens von den KI-Forschern selbst; zum Beispiel:Winograd, T./Flores, F.:
Erkenntnis Maschinen Verstehen. Berlin 1989. Allman, W. F.: Menschliches Denken Künstliche Intelligenz. Von der Hirnforschung zur nächsten Computer-Generation. München
1989. - Zweitens von ihren philosophischen Kritikern; zum Beispiel: Dreyfus, H.: Was
Computer noch immer nicht können. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie. 4/1993; 653 -
680. Leidlmair, K.: Künstliche Intelligenz und Heidegger. Über den Zwiespalt von Natur und
Geist. München 1991. - Drittens von Neurobiologen; zum Beispiel: Florey, E.: Memoria:
Geschichte der Konzepte über die Natur des Gedächtnisses. In: Florey, E./Breidbach, O.
(Hg.): Das Gehirn - Organ der Seele? Zur Ideengeschichte der Neurobiologie. Berlin 1993;
151 - 215. - Viertens in semiologischer Perspektive; zum Beispiel: Jorna, J. R.:
Wissensrepräsentationen in künstlichen Intelligenzen. Zeichentheorie und
Kognitionsforschung. In: Zeitschrift für Semiotik 1/2 1990: 9 - 23.
{107} Carrier, M./Mittelstraß, J.: Geist, Gehirn, Verhalten. Das Leib-Seele-Problem und die
Philosophie der Psychologie. Berlin/New York 1989.
{108} Pragmatistisch: Goodman, N.: Weisen der Welterzeugung. Frankfurt am Main 1984.
Sprachanalytisch: Putnam, H.: Repräsentation und Realität. Frankfurt am Main 1991.
Medientheoretisch (und medienkritisch): de Kerckhove, D.: Touch versus Vision: Ästhetik
neuer Technologien. In: Welsch, W. (Hg.): Die Aktualität des Ästhetischen. München 1993;
137 - 168. Kunst- wie medientheoretisch: Seel, M.: Vor dem Schein kommt das Erscheinen.
Bemerkungen zu einer Ästhetik der Medien. In: Merkur 9/10 1993; 770 - 783.
{109} So der Literalitätsforscher D. R. Olson.