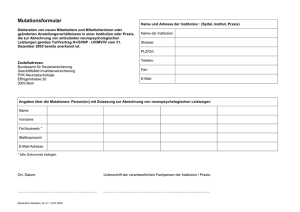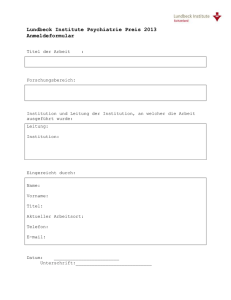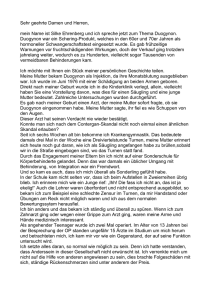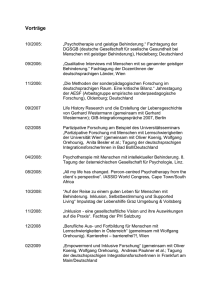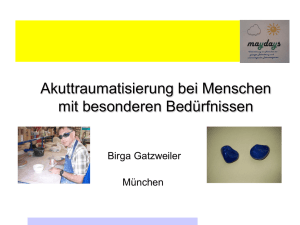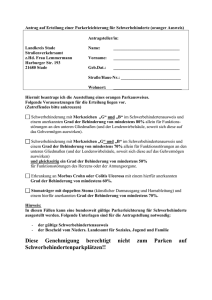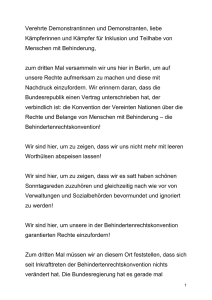Kurzfassung Referat von Felix Brem
Werbung

„ Als Heimarzt zwischen allen Stühlen?“ Klippen im Umgang mit Wohnheimen und Angehörigen (Referat an der Jahrestagung der SAGB vom 11.9.2008 in Olten) (gekürzte Version) 1. Einleitung Liebe Kolleginnen und Kollegen, in meiner 25-jährigen Praxistätigkeit als Psychiater habe ich hunderte von Menschen mit geistiger Behinderung gesehen, behandelt und betreut, und dabei viele Eltern und/oder Geschwister, sowie rund 40 Behinderteninstitutionen kennen gelernt. Erwarten Sie von mir keine umfassenden Richtlinien. Ich will lediglich einige Anregungen geben. 2. Grundfragen a) Positionierung Sind wir der Familienarzt des Patienten und seiner Angehörigen, sind wir der Heimarzt oder sind wir der individuell gewählte Arzt des Patienten? Sofern wir mit der Institution zusammenarbeiten: Auf welcher Ebene pflegen wir den Dialog. Wollen wir Vermittler sein in Konflikten zwischen Eltern und Institutionen? Wer ist eigentlich der Auftraggeber? Handeln wir bei fehlendem explizitem Auftrag von Seiten des Patienten im Auftrag der Angehörigen oder aber Vormünder, die im Tiers garant ja auch die Rechnung erhalten; handeln wir im Auftrag der Institution oder handeln wir gar im Auftrage des Kostenträgers, z.B. der IV? Unsere Stellung wird mitbestimmt durch die Haltung des Heimes bezüglich freier Arztwahl und/oder enger Zusammenarbeit mit einem von der Institution gewählten Heimarzt. Bei freier Arztwahl sind vermehrte Anstrengungen der Beteiligten für einen guten Informationsfluss, genügend Kenntnisse der Grenzen und Möglichkeiten der Institution und anderes notwendig. Von einem Vertrag rate ich eher ab, da er einengt, rate jedoch zu klaren, durchaus auch schriftlich fixierten, Regeln der Kommunikation und zum Verhalten in Notfällen, oder zu punktuellen Aufträgen. Wenn der Heimarzt gleichzeitig im Vereinsvorstand oder Stiftungsrat der Institution Einsitz hat, gerät er manchmal unvermittelt in Interessenskonflikte. b) Settingfragen. (Auch wenn die folgenden Überlegungen primär auf psychotherapeutische Tätigkeit angedacht sind, gelten sie grundsätzlich.) Diadisches Modell: Hier handelt es sich um das klassische Setting einer Zweierbeziehung zwischen Arzt und Patient unter Ausgrenzung von Angehörigen und weiteren Bezugspersonen. 2 Im Triadischen Modell werden Mitarbeiter der Institution und/oder Angehörige in die Kontakte miteinbezogen. Im Co-Therapeuten-Modell werden Angehörige und/oder Mitarbeiter in eine gleichartige Rolle gehoben und ihnen vielleicht Behandlungsaufgaben übertragen. In den Komplementär-Modellen trifft sich der Arzt einerseits mit den Patienten, andererseits mit den Teams und/oder den Angehörigen, eventuell kommuniziert auch ein Arzt mit dem Patienten und ein zweiter Arzt mit dem Team und/oder den Angehörigen. c) aktive Führung Gemäss Meinung internationaler Experten müssen Ärzte bei Menschen mit geistiger Behinderung aktiv nach möglichen gesundheitlichen Störungen suchen: Insbesondere nach Stoffwechselstörungen, Reflux, Osteoporose, nach hormonellen, neurologischen und psychischen Störungen, sowie nach Beeinträchtigungen von Gehör und Sehkraft. Wichtig dabei sind regelmässige Visiten oder Konsultationen. Sie dienen allein schon dem Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zwischen dem Arzt und dem Patienten sowie seinem Umfeld. Nahe dabei ist das Thema der Verantwortung für die allgemeine Gesunderhaltung: Fragen der Ernährung, der Bewegung, der Hygiene, der Prophylaxe mit Impfungen, Krebsvorsorge, Unfallverhütung, Gebisspflege etc.. Schon mit Fragen der Ernährung und der Bewegung bewegen wir uns stark in Bereichen, die eigentlich in den Verantwortungsbereich der Institutionen gehören. Ein besonderes Kapitel hier ist die sorgfältige und vorschriftsgemässe Aufbewahrung sowie die zuverlässige Verabreichung von Medikamenten und die Dokumentation der Verordnungen. d) Situation der Angehörigen: Sie haben oftmals Enttäuschungen und Frustrationen gerade auch von ärztlicher Seite erlebt und fühlen sich zusammen mit dem Behinderten diskriminiert. Sie haben im Erwachsenenbereich noch unrealistische Erwartungen, wie sie im Kinderbereich durch die IVFinanzierung möglich waren oder über Internet verbreitet werden. In Widerspruch geraten wir mit den Angehörigen auch bei deren Wunsch, dass der Behinderte, der eine protrahierte Krise in den Pubertätsjahren durchlief, wieder „wie früher“ sei. Nicht selten verhalten sich Angehörige sehr widersprüchlich und verbergen damit familieninterne Konflikte e) Situation der Heime Um ein Heim gut ärztlich begleiten zu können, ist es unentbehrlich, dass wir gewisse Kenntnisse haben über seine Struktur, die Kompetenzverteilung, die Entscheidungswege, die personelle Qualifikation und Besetzung usw, und uns bei gelegentlichen Besuchen und Kontakten auf verschiedenen Ebenen allmählich ein Bild machen. In Institutionen bestehen auch zahlreiche Spannungsfelder, die zu berücksichtigen sind. 3 3. Besondere Aspekte a) Beizug eines Spezialisten Wer trifft solche Entscheidungen? Machen das die Betreuungsperson oder die Angehörigen ohne Ihr Wissen, ist wahrscheinlich etwas bezüglich Vertrauen zu Ihnen schief gelaufen, oder es ist Ausdruck eines Chaos, häufig aus einer Führungs – oder Orientierungslosigkeit heraus. Die Herausforderung ist oftmals nicht die, ob eine solche Abklärung Sinn macht, sondern wie sie für den betroffenen Patienten sinnvoll gestaltet werden kann, und wie der Informationsfluss zwischen Spezialist und Heimarzt erfolgt. b) Medikamentenverordnung Für die zuverlässige Ausführung von Verordnungen und das Bemerken von Nebenwirkungen ist aktive Nachfrage unentbehrlich. Es ist sicherzustellen, dass wir den Patienten gelegentlich wieder sehen, auch zur Ueberprüfung der Medikation. Durch Medikamenten-Verordnungen kann auch die Einleitung anderer sinnvoller Massnahmen struktureller oder agogischer Art blockiert werden. c) Aufwändige Therapie Auch wohlgesinnte, personell best dotierte und durchorganisierte Institutionen geraten mit auszuführenden Behandlungen oder auswärtigen Therapien nach kurzer Zeit an eine Überforderungsgrenze, speziell wenn diese einen gewissen Zeitaufwand erfordern oder nur von wenigen Personen durchgeführt werden können. d) Klinikeinweisung Nach länger dauernden Schwierigkeiten, manchmal aber auch überraschend wird ultimativ die Einweisung in die Psychiatrische Klinik gefordert. Dies ist vielleicht Ausdruck einer Erschöpfung, vielleicht aber auch eines internen Machtkampfes der beteiligten Personen, oder gar ein Abschiebeversuch. Klinikaufenthalte für Menschen mit geistiger Behinderung sind in der Regel nicht sinnvoll sind, nur schon deshalb, weil die meisten Psychiatrischen Kliniken in der Schweiz auf die adäquate Betreuung dieser Patientenen nicht wirklich eingestellt sind. Agogische Gesichtspunkte haben auch in der Krise Priorität. Zudem verschwindet eine Verhaltensproblematik während der ersten Wochen an einem anderen Platz oft. Die Institution müsste sich auch auf die Rücknahme des betroffenen Bewohners mit einem verbesserten Betreuungsangebot vorbereiten. Leider werden den betroffenen Bewohnern gegenüber Klinikaufenthalte nicht selten als Ferienaufenthalte schön geredet, was diese durchschauen; deshalb kommen sie sich zurecht angelogen und ausgestossen vor. 4 e) Behandlungsende Gerade bei psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlungen stellt sich zuweilen die Frage, wer das Behandlungsende bestimmt. Die Patienten möchten manchmal die Zuwendung lebenslang geniessen. die Angehörigen finden den Kostenaufwand, die Institutionen den Begleitungsaufwand und die Störung der internen Abläufe zu gross und unnötig. Hier erleben wir die Machtlosigkeit, in der sich die Menschen mit Behinderung oft befinden, einmal spürbar selber mit. f) Arztwechsel Der Wunsch oder der heimliche Vollzug von Arztwechseln ist häufig Ausdruck eines Machtkampfes oder aber einer Enttäuschung. Auch wenn es uns narzisstisch kränkt, ist das Zeigen einer solchen Reaktion im Allgemeinen nicht hilfreich für den betroffenen Patienten. Sinnvoll ist, die Möglichkeit zur Aussprache über die Erwartungen und Enttäuschungen anzubieten und für einen sorgsamen Übergang mit gutem Informationsfluss an den anderen Arzt zu sorgen, am besten in einem gemeinsamen Gespräch mit ihm, mit dem Patienten und den nahe stehenden Personen. g) Übergang Kinderbereich- Erwachsenenbereich Eine besondere Situation ist der Übergang vom Kinder- in den Erwachsenenbereich, wo meist ein Institutionswechsel und damit oft auch eine Veränderung der ärztlichen Betreuung stattfinden. Hier haben Sie Gelegenheit, wirklich hilfreich zu wirken, indem Sie den betroffenen Patienten helfen, allmählich ein Vertrauen zum nachbehandelnden Arzt aufzubauen, und eine persönliche würdevolle Übergabe mit ihm gestalten. h) Zwangsmassnahmen Auch wenn wir nicht ärztliche Verantwortliche für Wohnheime sind, stehen wir doch in einer zumindest ethischen Mitverantwortung bei der Anwendung von Zwangsmassnahmen, insbesondere Einschliessungen, Fixierungen oder gar zwangsweisen Verabreichung von Medikamenten. Die Frage von Gewaltanwendung bedarf einer Kenntnis der entsprechenden kantonalen Gesetze und allenfalls Verordnungen oder Weisungen der zuständigen Amtsstellen, sodann einer Überprüfung der heiminternen Richtlinien, sowie der Nachfrage nach einer adäquaten Dokumentation der Zwangsmassnahmen und der beteiligten Personen. 4. „Fehler“ Es ist zuweilen notwendig, folgende Themen anzusprechen; jedoch sind Wortwahl und Zeitpunkt sowie Verletzlichkeiten sorgfältig zu bedenken: - Konflikte innerhalb der Familie im Umgang mit dem Patienten. 5 - Das Älterwerden und dereinstige Sterben der Eltern. Der Beizug der nichtbehinderten Geschwister ist zuweilen hilfreich. - Das Errichten einer amtlichen Vormundschaft. - Die Aufforderung sich mehr abzulösen. - finanzielle Fragen. - Medikationsverordnungen, insbesondere von Psychopharmaka. Hier klaffen die Vorstellungen von Eltern und Betreuern oder innerhalb des Betreuungsteams oft weit auseinander. - Infragestellung, einer „gründlichen“ Untersuchung bei einem Spezialisten. 5. Selbstbestimmung des Patienten Auch ein Mensch mit geistiger Behinderung hat einen eigenen Willen, der sich zumindest darin ausdrückt, dass er sich gegen Untersuchungen oder Behandlungen wehrt. Minder schwer behinderte Menschen fordern Selbstbestimmung inzwischen auch deutlich. Ein wichtiges Thema ist dabei, die Behinderung als solche sowie das Verhalten zu „entmedizinalisieren“ und endlich als Eigenschaften der Persönlichkeit zu akzeptieren. Das gemeinsame Behandlungsziel ist auch hier auszuhandeln: z.B.bessere Funktion oder nur Schmerzfreiheit? Sind wir uns im Klaren, wie gross die Abhängigkeit eines Menschen mit Behinderung von seiner Umgebung ist, wie ausgeliefert und machtlos er sich gerade auch uns Ärzten gegenüber fühlen kann und was das für Gegenreaktionen auslöst? Um für den Patienten gut da zu sein, müssen wir unseren Beitrag leisten, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Ein wichtiges Element dabei ist, dass er uns regelmässig sieht, gerade auch in Situationen, in denen an ihm keine Untersuchung oder Behandlung erfolgt. (Ich bezeichne meine Funktion mit regelmässigen Besuchen des Wohnheimes für manche Bewohner als „Fixateur externe“. ) Vor allem aber müssen wir auch lernen, mehr mit den Menschen mit Behinderung zu reden anstatt über sie. Dazu gehört das Fordern und Einbeziehen von Kommunikationsunterstützung durch die Institution. Das setzt aber auch voraus, dass wir die für eine gute „behinderte Kommunikation“ auch notwendige Zeit einräumen und dafür sorgen, dass wir dafür ungestört bleiben (Handy). 6. Was ist hilfreich In der Position als Heimarzt in all den Spannungsfeldern ist es noch wichtiger als ohnehin, möglichst mit Grossmut und Gelassenheit für den Patienten da zu sein. Unbeeindruckt sollten wir bereit bleiben, für den Patienten zur Verfügung zu stehen. Den Menschen mit Behinderung zuliebe lassen wir Machtkämpfe im Allgemeinen besser nicht eskalieren, sondern vertreten ruhig die Position und Anliegen des Patienten, soweit wir sie verstehen. Jedoch ist es sehr hilfreich, in unserem Denken immer wieder Machtfragen zu reflektieren und uns über die Kräfteverhältnisse klar zu sein. Um gute Gesprächspartner zu sein, genügt es nicht, den IV-Hilflosigkeits-Fragebogen gemäss den Wünschen der Institution zu bestätigen. Wir müssen neu über ICF im Groben Kenntnisse haben und 6 darüber, dass nun wegen der Subventionierung der Heime durch die Kantone seit der NFA auch zumindest in der Ostschweiz die genaue Erfassung und Dokumentation der Betreuungsintensität notwendig wird. Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft möchte ihren Beitrag dazu leisten, dass die fachliche Kompetenz der Aerzte im Umgang mit Menschen mit Behinderung verbessert wird, dass wir aus einem therapeutische Minimalismus herauskommen und den Zugang zu allen medizinischen Dienstleistungen wo sinnvoll auch für Menschen mit schweren Behinderungen eröffnen oder offen halten. Ich danke Ihnen. Dr. med.Felix Brem Facharzt Psychiatrie/Psychotherapie FMH Rosenstrasse 6 8570 Weinfelden [email protected]