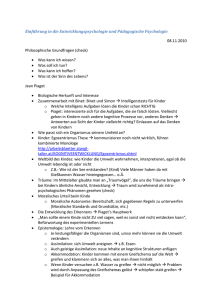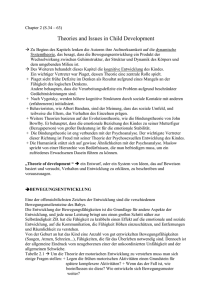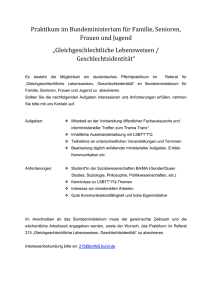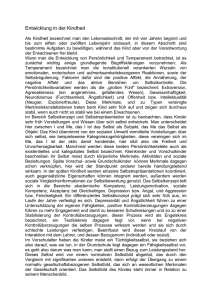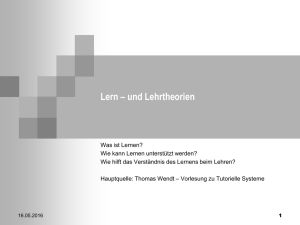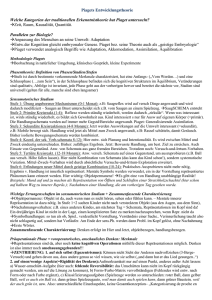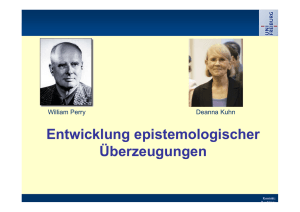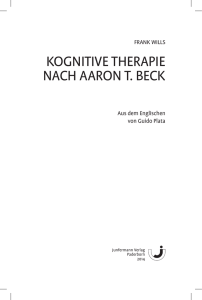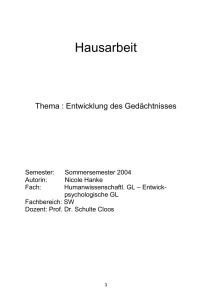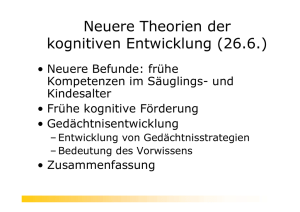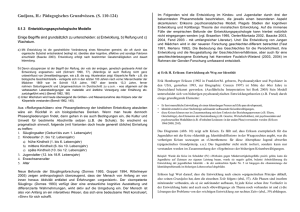zf-entwicklung-gesamt - Fachschaft Psychologie Freiburg
Werbung
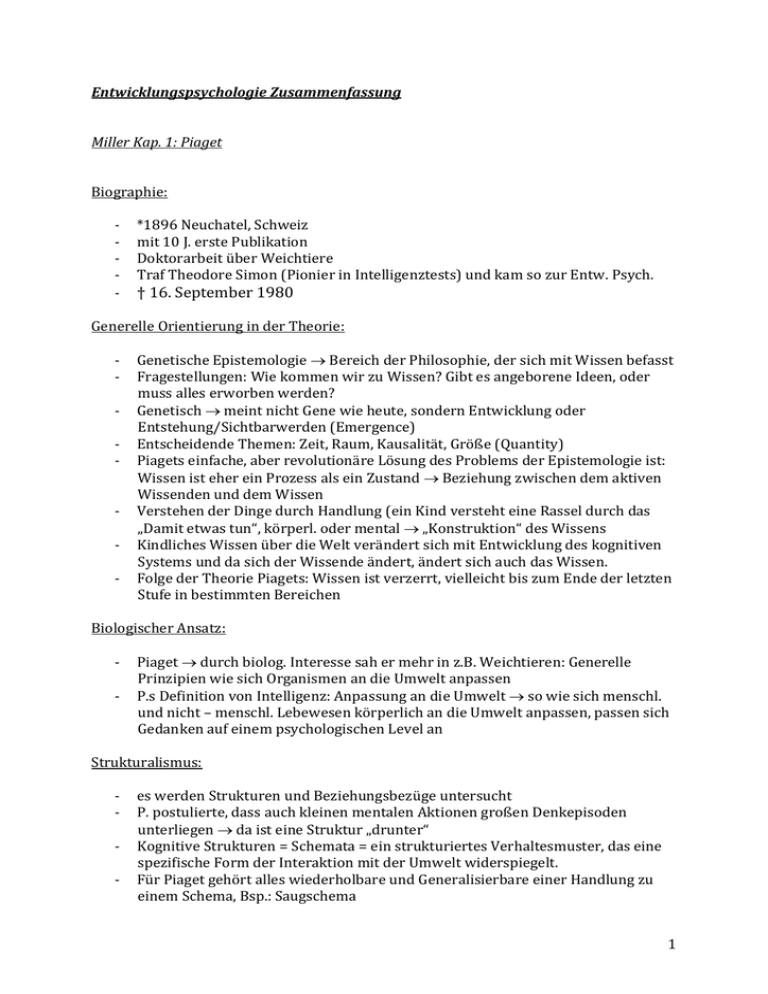
Entwicklungspsychologie Zusammenfassung Miller Kap. 1: Piaget Biographie: - *1896 Neuchatel, Schweiz mit 10 J. erste Publikation Doktorarbeit über Weichtiere Traf Theodore Simon (Pionier in Intelligenztests) und kam so zur Entw. Psych. † 16. September 1980 Generelle Orientierung in der Theorie: - Genetische Epistemologie Bereich der Philosophie, der sich mit Wissen befasst Fragestellungen: Wie kommen wir zu Wissen? Gibt es angeborene Ideen, oder muss alles erworben werden? Genetisch meint nicht Gene wie heute, sondern Entwicklung oder Entstehung/Sichtbarwerden (Emergence) Entscheidende Themen: Zeit, Raum, Kausalität, Größe (Quantity) Piagets einfache, aber revolutionäre Lösung des Problems der Epistemologie ist: Wissen ist eher ein Prozess als ein Zustand Beziehung zwischen dem aktiven Wissenden und dem Wissen Verstehen der Dinge durch Handlung (ein Kind versteht eine Rassel durch das „Damit etwas tun“, körperl. oder mental „Konstruktion“ des Wissens Kindliches Wissen über die Welt verändert sich mit Entwicklung des kognitiven Systems und da sich der Wissende ändert, ändert sich auch das Wissen. Folge der Theorie Piagets: Wissen ist verzerrt, vielleicht bis zum Ende der letzten Stufe in bestimmten Bereichen Biologischer Ansatz: - Piaget durch biolog. Interesse sah er mehr in z.B. Weichtieren: Generelle Prinzipien wie sich Organismen an die Umwelt anpassen P.s Definition von Intelligenz: Anpassung an die Umwelt so wie sich menschl. und nicht – menschl. Lebewesen körperlich an die Umwelt anpassen, passen sich Gedanken auf einem psychologischen Level an Strukturalismus: - es werden Strukturen und Beziehungsbezüge untersucht P. postulierte, dass auch kleinen mentalen Aktionen großen Denkepisoden unterliegen da ist eine Struktur „drunter“ Kognitive Strukturen = Schemata = ein strukturiertes Verhaltesmuster, das eine spezifische Form der Interaktion mit der Umwelt widerspiegelt. Für Piaget gehört alles wiederholbare und Generalisierbare einer Handlung zu einem Schema, Bsp.: Saugschema 1 Ansatz der Entwicklungsstadien: - Entwicklung vollzieht sich in Stadien = aufeinanderfolgende Ebenen der Anpassung Stadium ist ein strukturiertes Ganzes in einem Zustand des Gleichgewichts o Jedes Stadium ist gekennzeichnet durch eine spez. Struktur, die einen spez. Typus der Interaktion zwischen Kind und Umwelt ermöglicht o Jedes Stadium geht aus dem vorangegangenen Stadium hervor, integriert und transformiert es und bereitet das nachfolgende vor. o Invariate Sequenz = Die Stadien folgen in einer bestimmten Reihenfolge aufeinander o Stadien sind universell: Egal ob in Berlin oder afrikanischer Dschungel, jedes Kind hat diese Stadien, Regression in ein früheres Stadium ist nicht möglich o Vom Werden zum Sein: Zu jedem Stadium gehört eine Phase der Vorbereitung und eine Periode der Vervollkommnung Die einzelnen Stadien: - - Das sensumotorische Stadium (von Geburt bis 2J.) 1. Stufe Reflexmodifikation (bis 1. Monat) 2. Primäre Zirkulärreaktionen (ca. ein bis 4 Monate): Verhalten das sich ständig wiederholt, weil es ein interessantes Ergebnis hervorbringt, auf eigenen Körper bezogen 3. Sekundäre Zirkulärreaktionen (4-8 Monate): auf äußere Welt bezogen Ball anstoßen er rollt 4. Koordination der sekundären Verhaltesschemata (8-12 Monate): Schemata werden auf komplexe Weise kombiniert, es entwickeln sich Planung und Intentionalität 5. Tertiäre Zirkulärreaktionen (12-18 Monate): kleine Experimente werden durchgeführt Kind als Wissenschaftler 6. Erfindung neuer Mittel durch geistige Kombination (19-24 Monate): Abschluss des sensumotorischen Stadiums, Objekte und Phänomene werden nun geistig abgebildet, repräsentiert. a. Kinder geben ihr Versuch und Irrtum Verhalten auf b. Sie erfinden spontan neue Lösungen (Mittel zum Zweck) c. Sie manipulieren Vorstellungsbilder, die äußeren Phänomenen entsprechen Objektpermanenz, wir zwischen dem 6-8 Monat entwickelt Nachahmungsverhalten: kann erst dann gezielt, also zeitverzögert gezeigt werden, wenn es innerlich repräsentiert wird Symbolhandlungen: Kissen nehmen und Kopf darauf legen Symbol für Schlafen Das präoperative Stadium (2-7J) 1. Egozentrismus: Perspektivenwechsel nicht möglich: 3 Berge Versuch 2 2. Rigidität des Denkens: Umschüttversuch, Aufmerksamkeit liegt nur beim Füllstand, also nur bei einem Merkmal, das Fassvolumen wird vernachlässigt; Ergänzung einer 2dimensionalen Matrix noch nicht möglich, Klasseninklusion 3. Prä-logisches Schlussfolgern: Sicht über die Welt 4. Begrenzte soziale Kognition - Das konkret operative Stadium (7-11J) o Operation = verinnerlichte Handlung und Teil einer organisierten Struktur. o Umschüttaufgabe wird korrekt o „Erhaltungsbegriff“ o Reversibilität möglich o Mentale Operationen werden auf Objekte und Phänomene angewandt - Formal operative Stadium (11-15) o Denken ist logisch, abstrakt und hypothetisch geworden o Kognitive Möglichkeiten vervollständigt o Denken geht in spez. Weise über vorgefundene oder gegebene Informationen hinaus Gedächtnis: - Stäbeversuch: o 3-4jährige zeichnen nach einer Woche i.d.R. gleichlange Stäbe nebeneinander auf o 5-6jährige einige lange und einige kurze Stäbe o 7-8jährige können Anordnung wiedergeben o Nach einem Jahr verändert sich das hin zum nächsthöheren Entwicklungsstadium Mechanismen der Entwicklung: - Entwicklung vollzieht sich in kleinen Schritten Diese werden durch funktionale Invarianten vorangetrieben = geistige Funktionen, die während der Entw. Konstant bleiben Die elementarsten sind Organisation und Adaptation Kognitive Organisation: - Organisation bezeichnet die Tendenz des Denkens, integrierte Systeme auszuformen, deren einzelne Teile sich zu einem Ganzen verbinden. 3 Kognitive Adaptation: - Hier gehören 2 komplementäre Prozesse dazu: 1. Assimilation: o = Prozess, in dem das Individuum die Realität in seine aktuelle kognitive Organisation einpasst. o 4 Arten: Reproduktion Generalisierung Erkennen Koordination Säuglinge tendieren dazu, wiederholt (Reproduktion) an den ihren Fingern, der Brustwarze ihrer Mutter, Decken und Spielzeug (Generalisierung) zu saugen, aber jew. in etwas unterschiedlicher Weise (Erkennen) und kombiniert mit dem Beobachten von Gegenständen, dem Greifen nach ihnen und dem zum Mund Führen (Koordination). 2. Akkomodation: o = Anpassung der kognitiven Organisation an die Erfordernisse der Umwelt. o Resultat: Neuorganisation des Denkens Kognitive Äquilibration: - Jeder Organismus strebt nach Gleichgewicht mit der Umwelt Durch Assimilation und Akkomodation wird Gleichgewicht wieder hergestellt. Vorher Ungleichgewicht, weil unzureichende Interpretationsmöglichkeiten oder ungenügende Schemata vorhanden sind. Oder durch fehlgeschlagene Assimilation, Widersprüche bei 2 Urteilen, Ungleichgewicht zwischen Problemstellung und Frage Kritik der Theorie: 1. Stärken: - Zentrale Rolle der Kognition - Der integrative und heuristische Wert (Beobachtungstatsachen integrieren und sie in einen Sinnzusammenhang einordnen, der weiteren Forschung ein heuristisches Instrument an die Hand geben Kind baut Wissen aktiv auf) - Entdeckung überraschender Merkmale im kindlichen Denken (umfassende Darstellung dessen, was sich entwickelt) - Breites Anwedungsgebiet - Ökologische Validität (= Generalisierbarkeit) 2. Schwächen: - Unzureichende Bestätigung des Stadienbegriffs - Unzureichende Erklärung der Mechanismen der Entw. - Bedarf nach einer Theorie der Performanz (es fehlt eine Erklärung, wie kognitive Strukturen in Verhalten umgesetzt werden) 4 - Vernachlässigung der emotionalen und sozialen Aspekte der Entw. Z.B. Lernen durch Beobachtung Methodische und stilistische Unzulänglichkeiten (Untersuchung der 3 eigenen Kinder Stichprobe zu klein; klinische Methode im Interview mit älteren Kindern; Laboruntersuchungen) Überschätzung der älteren Kinder, Unterschätzung der jüngeren komplexer Versuchsaufbau Vernachlässigung der Entw. Nach der Adoleszenz Piaget lieferte Entwicklungsbeschreibungen, keine Erklärungen Aufgaben: Entwerfen Sie (ca. drei) verschiedene Szenarien mit verschiedenen Gewichten jeweils an den beiden Seiten der Balkenwaage und machen Sie eine Vorhersage, was ein Kind jeweils in der prä-operationalen, in der konkret-operationalen und in der formaloperationalen Stufe als Antwort geben (ankreuzen) würde (Begründung!). In welcher Beziehung steht die Annahmen von Stufen mit dem strukturalistischen Ansatz von Piaget. Warum wird die Theorie Piagets als eine konstruktivistische Theorie bezeichnet? Warum unterschätzte Piaget vielfach das Denken von Vorschulkindern? Illustrieren Sie Ihre Erklärung mit einem Beispiel Warum beinhaltet nach Piaget eine Handlung jeweils (so gut wie immer) Assimilation UND Akkomodation? 5 Musterlösung zur Vorlesung 09.11.2009 – Piaget II Von Petra Buys Aufgabe 1 Verschiedene Faktoren sind dafür verantwortlich, dass Piagets Theorie als eine konstruktivistische bezeichnet wird. Piaget versteht Wissen als Prozess; er sagt : „Das Wissen wächst mit dem Wissenden.“ Wissender bzw. Lernender und Wissen stehen also in ständiger Interaktion. In dieser Aussage stecken zwei Bestandteile des Konstruktivismus: Zum Einen ist Wahrnehmung immer voreingenommen und gefiltert (selektiv). Sie ist abhängig von unserem Vorwissen, unseren Erfahrungen und unseren Bedürfnissen (vorerfahrungsbezogener Aspekt der Handhabung von Umweltgegebenheiten ist die Assimilation, s. Aufgabe 3). Wissen kann uns also nicht einfach in den Kopf „gepflanzt“ werden, sondern es wird von jedem Lernenden aktiv konstruiert – in Abhängigkeit, wie bereits aufgeführt, von Vorerfahrung, Basiswissen und aktuellen Bedürfnissen. So erklärt es sich auch, dass ein und dieselbe Situation sich in den Wahrnehmung verschiedener Personen immer unterscheidet – in Details und Schwerpunkten oder ganz gravierend. Der zweite wichtige Aspekt der obigen Aussage bezieht sich auf die kognitive Entwicklung des Lernenden. Je höher sein kognitives Niveau ist, umso besser und differenzierter kann er Informationen aufnehmen und zu Wissen verarbeiten. Einmal aufgebautes Wissen kann dann als Grundlage für die Integration weiterer Informationen dienen und somit seinen Teil zur Interaktion beitragen. Ein weiterer bedeutender Faktor von Piagets Theorie ist das Kriterium der Viabilität, also der „Brauchbarkeit“. Nach Piaget zielt die Entwicklung auf die bestmögliche Anpassung des Organismus an die Umwelt ab (durch Akkomodation, s. Aufgabe 3). Die Konstruktion des Wissens durch den Wissenden verfolgt also vor allem das Ziel der Brauchbarkeit; der Unterstützung bei der Bewältigung seiner Umwelt – und nicht etwa das der „Wahrheitsfindung“. Aufgabe 2 Die systematische Unterschätzung der Vorschulkinder ist auf unterschiedliche methodische Ungenauigkeiten Piagets zurückzuführen. Einige davon sollen nun (z.T. mit Beispielen) auseinandergesetzt werden. Die Studien Piagets beinhalteten an verschiedenen Stellen zusätzliche Schwierigkeiten, die die Lösung der Aufgaben, welche kleinen Kindern gestellt wurden, erschwerten. Diese lagen vor allem in folgenden Bereichen: Aufgabe: Komplizierte Versuchsaufbauten führten dazu, dass Kinder die Aufgabenstellung gar nicht erst verstanden Beispiel: Drei – Berge – Versuch zur Perspektivübernahme: In unkomplizierteren Experimenten (Denkt an den Kartenversuch von den amerikanischen Studenten) hatten viel jüngere Kinder Erfolg Voraussetzungen: Es wurde Vorwissen vorausgesetzt, dass manche Kinder noch nicht hatten – ihr Misserfolg war also möglicherweise nicht auf ihr kognitives Level, sondern auf ihren Wissensstand zurückzuführen Sprache: Anforderungen an Sprachverständnis (Erklärungen folgen können) und sprachlichen Ausdruck (Lösungen explizit erklären können) waren oftmals zu hoch 6 Beispiel: Die Lösung einer Aufgabe zur Mengenkonservation wurde nur als richtig anerkannt, wenn Kinder sie genau ausformulieren und begründen konnten. Kinder, die dazu (u.U. nur sprachlich) nicht in der Lage waren, wurden als „nonconserver“, ihre Antworten als zufällig eingestuft. Versuchsleiter: Die Versuche wurden von Erwachsenen durchgeführt; etwaigen Versuchsleitereffekten wurde wenig Beachtung geschenkt Beispiel: Umschüttversuch: Die zweimalige Frage nach der Menge des Wassers konnte Kinder auf den Gedanken bringen, dass von ihnen unterschiedliche Antworten erwartet wurden. Um den Erwartungen des Erwachsenen gerecht zu werden, könnten sie durchaus nach dem Kriterium der „sozialen Erwünschtheit“ geantwortet und ihre tatsächliche Einschätzung für sich behalten haben. In Nachfolgestudien zeigte sich, dass Kinder bei einfacherer Versuchsanordnung und nonverbalen Versuchen in einigen Bereichen besser abschnitten, als Piaget es vorhergesagt hatte – in vielen Bereichen ergaben sich aber auch keine oder nur minimale Unterschiede. Insgesamt ist bei dieser Piagetkritischen Auseinandersetzung zu beachten, dass Piaget mehr Wert auf die Abfolge und das Gesamtprinzip der Stufen als auf tatsächliche Alterszuordnung gelegt hat. Dementsprechend war seiner Forschung von dem Versuch der Vermeidung falscher positiver Ergebnisse geprägt – Piaget hat es also bewusst vorgezogen, Fähigkeiten von Kindern zu „übersehen“ anstatt sie zu früh Stufen zuzuordnen, die sie noch nicht erreicht hatten. Aufgabe 3 Entwicklung vollzieht sich nach Piaget vor allem durch die zusammenwirkenden Mechanismen von Organisation (internaler Aspekt) und Adaptation (externaler Aspekt). Die Stimmigkeit und Ausgewogenheit dieser Faktoren führt zu einem Zustand der Äquilibration (innere Stimmigkeit einerseits, Gleichgewicht zwischen Assimilation und Akkomodation andererseits). Die kognitive Verarbeitung der Umwelt vollzieht sich in Tausenden kleinen Schritten, die das Kind (der Mensch) ständig vollzieht. Diese Schritte beginnen nach Piaget mit einem Versuch der Assimilation, also der Integration neuer Gegebenheiten in bestehende Schemata. Missglückt diese Assimilation ganz oder teilweise (durch direktes Fehlschlagen, empirisches Widerlegen o.ä.), entsteht ein kognitiver Konflikt, das Gleichgewicht gerät in „Gefahr“ (Disäquilibration). Das Kind (der Mensch) reagiert nun mit Akkomodation, also mit Veränderungen der kognitiven Organisation, die aus den Anforderungen der Realität resultieren. Die Akkomodation tritt also – anders ausgedrückt – in Kraft, wenn aktuelle Strukturen ein Objekt oder eine Situation nicht zufriedenstellend interpretieren können; die daraus resultierende Reorganisation führt zu anderer und besserer Assimilation. Assimilation und Akkomodation sind also eng verknüpfte Bestandteile jeder kognitiven Aktivität. Assimilationsversuche führen fast immer zu zumindest kleinen Veränderungen kognitiver Strukturen, also zur Akkomodation, welche dann wiederum (wie gesagt) im folgenden höherwertige Assimilation erlaubt. 7 Miller Kapitel 7: Vygotsky Der soziokulturelle Ansatz: - Kind in Aktion im kulturellen Kontext ist die kleinstmögliche Einheit der Studie: o Kontext = größerer kultureller Kontext, aber auch das kleiner Setting zu Hause, beim Einkaufen... ect. o Kindl. Geist (mind) ist sozial: „Der Weg von Objekt zum Kind und vom Kind zu Objekt geht durch eine andere Person.“ o Kind, die andere Person und der soz. Kontext sind verschmolzen in die Aktivität o Kinder haben bestimmte Wegen, weil sie Bedürfnisse und Ziele haben, die die Umwelt einbeziehen. o Personen in der Umwelt und die Umwelt selbst sind nicht getrennt von einander zu betrachten, sondern definieren sich als Einheit für das Kind. o Soziokulturelle Ansätze fokussieren sich auf die Teilnahme der Kinder an kulturellen Aktivitäten, wie sie die Möglichkeiten erforschen, die die Kultur ihnen durch aktive Teilnahme bei z.B. Ritualen, Geschichten, und Familienstrukturen o Vieles der Entwicklung hat mit Veränderungen darin zu tun, wie teilgenommen wird. Diese Teilnahme – Veränderungen sind verknüpft mit den Veränderungen in der Kognition. o Kultur: Bräuche, Sprache, soz. Settings (z.B. Schule), Objekte (z.B. Werkzeuge) o Vygotsky stellt dar, wie sozio – ökonomisch – kulturelle Veränderungen psychologische Veränderungen mit sich bringen. Zone der Proximalen Entwicklung: - Das ist die Zone zwischen dem was ein Kind im aktuellen Entwicklungsstadium schon lösen kann und dem, was es nur mit Hilfe eines Erwachsenen oder kompetenteren Kameraden lösen kann. Entwicklung ist der Prozess der Veränderung, nur in der Prozessbetrachtung lässt sich Entwicklung verstehen Prozess ist wichtiger als das Ergebnis (z.B. eine richtige oder eine falsche Antwort) Im Alltag beschäftigen sich Erwachsene und Kinder gemeinsam mit Tätigkeiten, bei denen sich die Kinder in Dingen üben, die für sie und ihr Leben von Bedeutung sind. Erwachsene sorgen so für „benutzerfreundliche“ Kontexte, in denen das Kind Fertigkeiten vervollkommnen kann, die es braucht um in der Kultur zu überleben und Erfolg zu haben Kultureller Lernplan „Lernen voraus“ Schulbildung oder Lehrzeit sollte sich an der Lernbereitschaft des Kindes orientieren und nicht am aktuellen Entwicklungsstand Kulturelle Lehre: Weben der Mädchen bei den Maya, s. S. 350 8 Das Intermentale konstruiert das Intramentale: - Intermental = zwischen Menschen Intramental = innerhalb eines Menschen Von dem was zwischen Personen geschieht wird das Kognitive konstruiert. Aus Diskussion und Dialog entsteht das Denken jedes „Thema“ gibt es auf 2 Ebenen, erst auf der intermentalen und dann, verinnerlicht, auf der intramentalen Kind kommuniziert mit sich selbst, so wie 2 Menschen miteinander kommunizieren als Dialog zwischen 2 Menschen wir ein innerer Dialog Transformation des Intermentalen während der Internalisierung Wissen wir so konstruiert und nicht kopiert Einfluss psychologischer Werkzeuge einer Kultur auf das Denken: - Werkzeuge können hier sein: Sprache, Diagramme, Zahlensysteme, Kunstwerke sie sind psychologische Werkzeuge und sind intern orientiert indem sie Denkprozesse verändern und Verhalten steuern Andere Werkzeuge können Computer sein, oder Schreibmaschinen, oder Axt, Pflug technische Werkzeuge, sind extern orientiert, dienen dazu Natur zu beherrschen, Dinge zu verändern Psychologische Werkzeuge verändern elementare geistige Fähigkeiten hin zu höheren geistigen Fähigkeiten wie z.B. Aufmerksamkeit und logisches Denken Sprache hier wichtiges Werkzeug, dass auch das Denken verändert soziales Instrument zur Strukturierung des sozialen Kontaktes Problemlösen von Kindern durch lautes Sprechen mit sich selbst, Sprache wird benutzt „wie Augen und Hände“, Wahrnehmen, Sprechen und handeln bildet eine Einheit. Methodologie: - - Dynamische Beurteilung: Ein Kind ist was es sein kann. Zone der proximalen Entwicklung wir untersucht Bsp.: 2 Kinder mit Intelligenzalter von 7, ein Kind kann mit Beispielen und Hinweisen Aufgaben eines 9jährigen spielend lösen, das andere Kind die eines 8jährigen, so sind die Kinder unterschiedlich voneinander Ein Kind hat weite ZPD, anders hat enge ZPD Kinder zeigen in ihrem eigenen sozialen Kontext ein höheres Maß an sozialer Kognition als im Labor (Bsp.: 2jährige ärgert ihre Schwester) Methode bei der Untersuchung der ZPD: o Mikrogenetische Methode = Beobachtung der Veränderungen in einer oder mehreren Versuchssitzungen mit dem Ziel, einen „Augenblick in der Entwicklung“ einzufangen Im Mittelpunkt steht der Prozess des Problemlösens Botschaft für heutige Forschung: Wenn man Verhalten verstehen will, muss man den Kontext genauso untersuchen wie das Kind selbst Noch besser: Verschiedene Kontexte, da Untersucher sonst nicht davon ausgehen kann, ein universellen Entwicklungsphänomen zu beobachten, die eher selten sind und von Kontext zu Kontext variieren 9 - Meist werden nicht einzelne Kinder, sondern Paare oder Gruppen untersucht, im Idealfall im Labor und im Alltag Egozentrisches und inneres Sprechen: - Enge Beziehung zwischen Denken und Sprechen Ca. im Alter von 2J. beginnt Denken und Sprechen zu verschmelzen Ab 3J teilt sich das Sprechen zwischen kommunikativem Sprechen und egozentrischem Sprechen - Ab 7/8J. wird das laute egozentrische Sprechen zum inneren Sprechen - „Stellen Kinder fest, dass sie ein Problem nicht lösen können, wenden sie sich anstatt an den Erwachsenen an sich selbst.“ - Heute „Privatsprache“, wird auch von Erwachsenen angewandt - Vergleich Piaget vs. Vygotsgy: Piaget Vygotsgy - Sprechen reflektiert die Unfähigkeit - Sprechen hilft dem Kind, seine des Kindes, die Perspektive eines Aktivitäten beim Problemlösen zu anderen zu übernehmen steuern - Egozentrisches Sprechen verliert - Egozentrisches Sprechen wird zum sich mit der Zeit inneren Sprechen - Kognition geht der Sprache voran - Sprache und Denken entwickelt - Sprache ist Ausdruck der sich sich unabhängig voneinander und entwickelnden symbolischen verschmilzt ineinander, Sprache Fähigkeiten (18-24 Monate) beschleunigt die Entwicklung des Denkens und ermöglicht Formen des Denkens, die ohne Sprache nicht mögl. wären. Entwicklung von Begriffen: - Mikrogenetische Methode: „Doppelte Stimulation“ Vorhandensein 2er Reizquellen, einen symbolischen und einen nicht-symbolischen Stimulus Wygotsgy Blöcke Spiel der verbotenen Farben Kritik: - - Stärken: o Berücksichtigung des sozial-kulturellen Kontext: Grenze zwischen Individuum und anderen ist fließend Entwicklung vollzieht sich an der Grenze zwischen Gesellschaft und Kind und nicht im Kind allein o Integration von Lernen im Alltag und Entwicklung Lernen als Motor für Entwicklung o Sensibilität für die Vielfalt von Entwicklung: Was für eine Gruppe zutrifft, muss für eine andere nicht zutreffen. Schwächen o Vage Definition der ZPD o Unzureichende Berücksichtigung des Entwicklungsaspekts Welcher Art sind die Entwicklungsprozesse? 10 o Probleme bei der Untersuchung kulturell-historischer Kontexte da teuer und aufwändig o Fehlen prototypischer Aufgaben zum Nachweis interessanter Entwicklungsphänomene Forschung wurde nicht genügend angeregt Aufgaben: Geben Sie ein Beispiel, das einem psychologischen Laien plausibel machen würde, wieso höhere kognitive Funktionen ihren Ursprung in sozialer Interaktion haben können. Warum wird die Theorie von Vygotsky als sozialkonstruktivistisch bezeichnet? Welche psychologischen Werkzeuge erwerben Sie in B.Sc.-Studium der Psychologie. Geben sie Beispiele! 11 Theorie – Theorie; O &M Kap. 12: Entwicklung begrifflichen Wissens; Sodian Begriffliche Repräsentationen 1. Begriffliche Repräsentation: - Begriffe werden durch Verknüpfungen von einer Reihe von Merkmalen zu Wissenseinheiten im Gedächtnis (Bsp: Hund, wir wissen er hat ein Fell, 4 Beine usw. Wissenseinheit kann sich auf ein Individuum oder eine Kategorie beziehen 2. Merkmalsbasierte Ansätze: a. Theorie deterministischer Merkmalsrepräsentation o Annahme, dass Begriffe Lexikoneinträgen ähneln (semantische Merkmalstheorien) o Problem: für viele Begriffe gibt es keine Definitionen im Sinne notwendiger und hinreichender Bedingungen z.B. Begriff „Spiel“ b. Theorie probabilistischer Repräsentationen o Wir repräsentieren wahrscheinliche Relationen zwischen Merkmalen und Begriffen und nicht deterministische (vorbestimmte) o Bsp.: „Flugfähigkeit“ ist ein hoch valider Hinweis darauf, dass ein objekt ein Vogel ist, jedoch wieder ein notwendiges, noch ein hinreichendes Definitionskriterium o Ähnl. Einem semantischen Netzwerk? o Problem: Der Merkmalsbegriff bleibt vage, Frage: Wie kommen Kinder dazu, dass sie wissen welche Merkmale relevant sind und welche zu ignorieren sind? 3. Theoriebasierte Ansätze - - Betrachtung größerer Systeme begrifflichen Wissens, Begriffe wie „Hund“, „Vogel“, „Auto“, „Tisch“, „Mitleid“ sind eingebettet in größere Wissensdomänen: Die biologische, physikalische und psychologische Domäne. Unser begriffliches Wissen besteht nicht nur aus Merkmalsassoziationen, sondern es enthält Annahmen darüber, warum die Welt so ist, wie sie ist. Da sie kohärente (zusammenhängende) Vorhersagen und Erklärungen für einen Phänomenbereich erlauben werden diese Annahmen als theoretische Annahmen bezeichnet. (Wellman & Gelman 1998) 4. Entwicklung begrifflicher Repräsentation - Fähigkeit Begriffe zu bilden und sie zu Induktionen zu verwenden ist nicht entwicklungssensitv, aber es ändert sich im Laufe der Entw. Die Inhalte von Begriffen quantitativer Wissenszuwachs verdeutlicht das (Hunderassenbeispiel) 12 Wissensentwicklung in grundlegenden Domänen 1. Theoretische Ansätze - Modell des Expertiseerwerbs o Kind als „universeller Novize“ o Entwicklung von Wissen wird hier analog zum Erwerb von Kulturtechniken (Bsp. lesen) und Fertigkeiten (Klavierspiel) dargestellt. o Es werden keine Annahmen über einen angeborenen Ausgangszustand gemacht oder über domänenspezifische Mechanismen. o Es genügen Infoverarbeitungsfähigkeiten und domänenspezifischer Input zur Erklärung des Expertiseerwerbs. - Modularitätstheorien o Annahme: es gibt spezialisierte Systeme für Infoverarbeitung o Manche nehmen an, dass kogn. Module eine evolutionär angelegte neurologische Basis haben. o Module müssen aber nicht notwendigerweise angeboren sein. o Jedoch starke Annahme über angeborene domänenspezifische Verarbeitungssysteme. Input aus der Umwelt ist nötig, um die modulare Verarbeitung anzuregen. o Infoverarbeitung grundsätzlich gleich bei Kindern und Erwachsenen o Minimum an Erfahrung notwendig um modulare Verarbeitung in Gang zu setzen, dann läuft die Entwicklung (z.B. der Sprache) weitgehend nach biologischen Prinzipien und die möglichen Ergebnisse sind fixiert oder variieren nur in sehr engen Grenzen - Theorie-Theorie o Vorstellung von fundamentalen „qualitativen“ Veränderungen im Laufe der kindl. Entwicklung, Domänenspezifische Entwicklungstheorie o Das ist die Theorie, dass sich die kogn. Entwicklung eines Kindes als Wandel intuitiver Theorien beschreiben lasse. Dabei hat dieser Wandel Ähnlichkeiten mit dem Wandel von Rahmentheorien (Paradigmen) in der Wissenschaftsgeschichte. o Vertreter der T-T nehmen an, das kindl. Wissen schon früh theorieähnlich organisiert ist und dass diese Theorien sich wesentlich von denen Erwachsener unterscheiden. o Im Ggs. zu Piaget, der bereichsübergreifende kognitive Strukturen annahm, lokalisiert die T-T den kogn. Fortschritt im begrifflichen Verständnis der jeweiligen Domäne. o Die früh erworbene Ausgangstheorie (auf der Basis weniger angeborener domänenspezifischer Prinzipien) bestimmt das Denken des Kindes in der Jeweiligen Domäne und leitet dessen weitere Entwicklung. o Beim Lernen durch Instruktion wird neue Information im Rahmen der intuitiven Theorie interpretiert. Der Wandel von Rahmentheorien vollzieht sich langsam über große Zeiträume hinweg und ist durch Instruktion nicht direkt und unproblematisch erreichbar. 13 2. Intuitive Physik: Basales Wissen - Prinzip der Kontinuität und Solidität, siehe Folien o Säuglinge scheinen schon in der ersten Hälfte des ersten LJ zu wissen dass Objekte solide sind. - Entwicklung physikalischen Wissens: Begrifflicher Wandel o Misconceptions, die teilweise bis ins Erwachsenenalter bestehen bleiben o Diese sind bei Kindern sehr resistent (Gleichgewichtstest Schwerpunkt liegt immer in der Mitte auf wenn Kinder Schwerpunkt ertastet haben, sobald sie die Augen öffneten wiesen sie die gefundene Problemlösung von sich und blieben bei ihrer Theorie) o Mgl Erklärung für Resistenz: Theorien sind eingebettet in alternative intuitive Theorien Bsp. Siehe Folien (vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild) - Intuitive Psychologie (Theorie of mind) o Wir erklären uns menschliches Verhalten indem wir uns selbst und anderen Wünsche und Überzeugungen zuschreiben. o Wellman 1990, Sodian o Ggs. Piaget: Er glaubte, dass Kinder erst in der Phase der konkreten Operationen (ca. 7 J.) zwischen Realität und Vorstellung (Mentalität) unterscheiden können. o Heute weiß man, dass schon 3jährige zwischen mentaler und physikalischer Welt unterscheiden können (Richtigen Hund kann mann streicheln, vorgestellten nicht) o EX: Kinder bekommen Geschichte erzählt von einem Kind, dass sein Kaninchen mit in den Kindergarten nehmen möchte. Kaninchen kann entweder im Vorgarten oder in der Garage sein. geht in die Garage und findet je nach Bedingung: Kaninchen, Nichts, Hund nach dem sie nicht suchte. Frage an die Kinder: Was wir die Figur der Geschichte als nächstes tun? Kinder antworteten im Alter von 3 Jahren so dass klar war dass sie verstehen, dass Handlungen von Zielen und Absichten abhängig sind. o Verständnis falschen Glaubens: Maxi und die Schokolade o 3jährige beantworten diese Fragen konsistent falsch. o Eigene falsche Überzeugungen: Smarites Aufgaben o 3jährige können nicht lügen im eigentlichen Sinne, sie können nicht täuschen: „Ich bin ja sooo müde“ Bsp. o Sie können nicht verstehen, dass sich subjektive Überzeugungen von der Realität unterscheiden können. o Konzept der Überzeugungen wir erst zw. 3 und 4 Jahren gelernt o Defizit: Trickobjekte, z.B. Kerze die wie Apfel aussieht Kinder von 3 Jahren sagen bei der Frage: „Wie sieht es aus?“ und bei der Frage: „Was ist es wirklich?“ – Apfel Erst 4jährige können zwischen Aussehen und Realität unterscheiden und sind so fähig zu verstehen, dass ein und dasselbe Objekt auf verschiedene Arten repräsentiert werden kann. 14 o Vorläufer Kindheit: Mit 18 Monaten unterscheiden Kinder zwischen eigenen und fremden Wünschen, wenn sie selbst Interesse an Crackern haben, der VL aber Interesse an Broccoli zeigt, so geben sie ihm den Broccoli. Noch mit 14 Monaten hätten sie ihm die Cracker gegeben. - Intuitive Biologie o Siehe Folien - Metabegriffliches Wissen: o Sieht Folien Theorie – Theorie; Miller Kap 8, 5 Seiten - Kinder werden mit der Tendenz geboren, naive oder Volkstheorien zu bilden Nach der T-T haben Kinder die angeborene Fähigkeit, Infos aus Ereignissen herauszuziehen und das hilft ihnen, ihre Theorien zu bilden 4-5jährige denken, dass Überzeugung zu Verhalten führt, sogar wenn die Überzeugung falsch ist Die Theorien sind sehr resistent desire-belief vs belief-desire siehe Folien keine wissenschaftlichen Theorien Aufgaben: Erklären Sie die Logik des Habituationsparadigmas, so dass es auch ein Informatiker, die von Psychologie kaum etwas weiß, verstehen würde. Nennen Sie Elemente aus den kindlichen Rahmentheorien, die es erschweren, die Erde als rund "zu akzeptieren". Warum erschweren es diese Elemente, die Erde als rund "zu akzeptieren"? Warum ist die Integrationsstrategie in vielen Fällen die aussichtsreichste? Musterlösung zur Theorie-Theorie Von Petra Buys Aufgabe 1: Das Habituationsparadigma beschreibt eine Methode der Säuglingsforschung. Da sehr kleine Kinder sich noch nicht sprachlich ausdrücken oder Anweisungen Folge leisten können, braucht es eine spezielle Methode, um dennoch Aufschluss über ihre geistigen Fähigkeiten zu erhalten. Das Habituationsparadigma baut auf der Tatsache auf, dass das Interesse von Säuglingen nachlässt, wenn man ihnen Objekte oder Ereignisse gleicher Art wiederholt vorführt. Dieser Gewöhnungseffekt spiegelt sich im Blickverhalten des Kindes wieder: Die so wiederholten Darbietungen werden immer kürzer und unkonzentrierter (häufiges Wegschauen) fixiert, umso häufiger sie gezeigt werden. Bei der Darbietung neuer Objekte oder Ereignisse kehrt sich dieser Effekt um: Die Blickdauer verlängert sich deutlich und das Betrachten des Gezeigten wird intensiviert. Diese Rückkehr der Aufmerksamkeit wird als Dishabituation bezeichnet. 15 Bei Verwendung der Methode werden nun Babies nach dem beschriebenen System an Objekte gewöhnt. Anschließend werden Eigenschaften des Gegenstands verändert und die – am Blickverhalten gemessene – wechselnde Aufmerksamkeit des Kindes beobachtet. Aus diesen Messungen kann abgelesen werden, welche der vorgenommenen Veränderungen vom Säugling bemerkt werden und dazu führen, dass er etwas als „neu“ wahrnimmt. In leicht abgewandelter Form kann das Habituationsparadigma dazu verwendet werden zu testen, welche generellen (z.B. physikalischen) Prinzipien Säuglinge schon verstehen und welche nicht. Hierzu werden dem Baby mögliche (Ball, der auf einen Tisch fällt) und unmögliche (Ball, der durch einen Tisch fällt) Ereignisse gezeigt. Durch die beschriebene Methode der Messung von Blickdauer wird nun betrachtet, welchem Ereignis das Kind mehr Aufmerksamkeit schenkt. Betrachtet es die unmöglichen regelmäßig wesentlich länger als die möglichen Ereignisse, wird geschlossen, dass diese ihm merkwürdig vorkommen, es also ihre „Unmöglichkeit“ wahrnimmt. Das wiederum würde bedeuten, dass der Säugling das zugrundeliegende Prinzip (in diesem Fall die Solidität von Objekten) bereits kennt und ihm Verstöße dagegen auffallen. Aufgabe 2: Eines der großen Hindernisse beim Wechsel von intuitiven zu wissenschaftlichen Konzepten – und somit eine bedeutende Schwierigkeit im Lehr-Lern-Prozess – ist die Einbettung von Misskonzepten in eine größere Rahmentheorie. Diese Rahmentheorie ergibt sich aus unzähligen Beobachtungen im Alltag und hat sich als nützlich zur Lebensbewältigung erwiesen. Aufgrund dieser hohen Kohärenz und Nützlichkeit sind Rahmentheorien und die darin enthaltenden Misskonzepte oftmals höchst resistent und durch Instruktion sehr schwer zu erreichen. Auch der Vorstellung einer flachen Erde liegen vielzählige Elemente von Rahmentheorien zugrunde, die einem tiefen Verständnis der wissenschaftlichen Erklärung „im Wege stehen“: „Fallen gelassene Objekte fallen nach unten“ Diese sehr konsistente Alltagsbeobachtung kollidiert massiv mit dem Bild einer runden Erde. Auf der anderen Seite der Kugel müssten sowohl Menschen als auch Gegenstände „von der Erde fallen“. Dieses Konzept ist zu wichtig um einfach aufgegeben zu werden; die runde Erde muss langsam integriert werden, so dass sinnvolle Zusammenhänge gefunden werden können (s.a. Aufgabe 3) „Die Erde ist unten, der Himmel oben“ „Oben“ und „unten“ sind nicht vertauschbar. Ist die Erde rund, kann diese Vorstellung nicht so einfach aufrecht erhalten werden. Ein Mensch auf der anderen Seite steht andersherum als ich, aber dennoch aufrecht; und auch bei ihm sind Erde unten und Himmel oben!? „Die Erde sieht aus wie eine Scheibe!“ Die Erde lässt sich für das Kind in unendlich vielen Alltagssituationen nur als flach beobachten. Besonders junge Kinder verfolgen zudem grundsätzlich das Prinzip, dass alles „ist“, wie es „scheint“. Warum sollte also eine Erde, die immer als flach wahrgenommen wird, plötzlich rund sein? All diese Elemente tragen dazu bei, dass Kinder in aller Regel die von außen an sie herangetragene Erklärung, die Erde sei rund, nur sehr schwer in ihr Weltbild integrieren können und stattdessen z.T. auf inadäquate „Halbintegrationen“ wie die Erde als Hohlkugel oder das Modell der „discearth“ verfallen. Aufgabe 3 16 Als Methoden für den Umgang mit Misskonzepten in der Vermittlung neues Wissens haben sich vor allem drei Strategien durchgesetzt: Die Ausklammerungsstrategie zielt darauf ab, neues Wissen „einzupflanzen“, während intuitives Wissen ausgeklammert, also ignoriert wird. Ziel ist dabei die Abspaltung des intuitiven Wissens vom wissenschaftlichen Begriffssystem und das „Absterben“ von vorher bestehenden Misskonzepten. Die Ersetzungsstrategie zielt ebenfalls darauf ab, intuitives durch neues, wissenschaftlich korrektes Wissen zu ersetzen. Dabei bezieht sie intuitives Wissen und Vorwissen aber bewusst mit ein. Ziel der Strategie ist die Ersetzung von Wissen und die Akkomodation; dies geschieht durch das Erzeugen von kognitiven Konflikten. Die Integrationsstrategie zielt darauf ab, intuitives Wissen und normatives Wissen parallel zu erhalten, jedoch nicht „nebeneinander her“, sondern vernetzt und integriert. Auch hier wird das Vorwissen intensiv thematisiert und analysiert. Anschließend wird nach Verknüpfungspunkten und Überschneidungen mit dem zu vermittelnden normativen Wissen gesucht, die als Ansatzpunkte für Wissensaufbau dienen. Die Integrationsstrategie verfügt im Vergleich zu den anderen Strategien über einige Vorteile, die sie in vielen Situationen zu der aussichtsreichsten Methode werden lässt: Im Gegensatz zur Ausklammerungsstrategie bezieht sie Vorwissen und intuitive Konzepte explizit mit ein. Dies ist ein sehr wichtiger Aspekt, da sich gezeigt hat, dass das Ignorieren der Konzepte nicht zum gewünschten Erfolg, sondern stattdessen zu einer automatischen Aktivierung des Vorwissens führt, dass dann – da unbeachtet – den Lernerfolg be- oder verhindern kann. Darüber hinaus – und dies im Gegensatz zur Ersetzungsstrategie – betrachtet die Integrationsstrategie Vorwissen nicht als „lästiges Übel“. Im Gegensatz wird die Alltagsrelevanz der vorhandenen Konzepte ausdrücklich anerkannt und genutzt. Anstatt die unliebsamen Strukturen austauschen zu wollen, werden richtige und gute Punkte im Vorwissen gesucht, auf denen dann aufgebaut werden kann. Die Integrationsstrategie nutzt Überschneidungen zwischen intuitiven und wissenschaftlichen Konzepten, um Querverbindungen herzustellen. Das Konzept wird somit nicht aus seiner Rahmentheorie „herausgerissen“ - das macht diese Methode besonders bei sehr resistenten Theorien wirksam und aussichtsreich. Ein wichtiger Kernpunkt der Theorie ist die Zusammenarbeit von Lernenden und Lehrenden. Gemeinsam arbeiten sie intuitive Konzepte heraus, suchen nach Vorund Nachteilen darin und erarbeiten sich so eine integrierte Struktur. Dies erleichtert es Kindern oftmals, Neues (selbst Miterarbeitetes!) an- und auch tatsächlich aufzunehmen. Informationsverarbeitungsansatz Miller Kap. 4 - - untersucht, wie menschliche Symbole verarbeitende Systeme, deren Kapazitäten begrenzt sind, arbeiten. Computerprogramme als Modell Entwicklungsbedingte Veränderungen in Repräsentation, Speicherung und Kombination von Informationen entstehen durch Selbstmodifikation, = wenn Kinder Regeln zur Entscheidungsfindung formulieren und sie anhand eines Feedbacks modifizieren Balkenwaage Strategieentwicklung Robert Siegler 17 Warum sind Wissen und Strategie nicht als völlig unabhängige Entwicklungsmotoren des Gedächtnisses zu sehen? Finden Sie zwei Argumente für oder gegen die Annahme, dass Variabilität und nicht die "monotone" Höherentwicklung Entwicklungs-prozesse charakterisiert (egal, ob zwei pro, zwei contra oder jeweils eine pro und contra) Beispiel: Lernstrategien bei "Ersties" im B.Sc. Psychologie Geben Sie jeweils ein Beispiel für eine Strategie, bzgl. der bei vielen "Ersties" vermutlich ein Produktionsdefizit bzw. ein Nutzendefizit vorliegt. Musterlösung zum Informationsverarbeitungsansatz Von Petra Buys Aufgabe 1: Der Informationsverarbeitungsansatz sieht Gedächtnis, Strategien, Wissen, Metagedächtnis und Gedächtniskapazität als eng verbundene Aspekte, die ein gemeinsames System bilden. Die Strategien werden dabei als kontrollierte Aktivität, mit der das Ziel einer Erinnerung angestrebt wird, verstanden. Dazu gehören systematische Wiederholung, Kategorienbildung und auch schriftliches Festhalten von Informationen. Auch Wissen betrachtet der Ansatz als Teil des kognitiven Systems; Wissen, wie Strategien, hilft der Erinnerung. Einige besondere Verknüpfungspunkte sollen veranschaulichen, an welchen Stellen Wissen und Strategie zusammenhängen und gemeinsam die Gedächtnisentwicklung vorantreiben: Strategie durch Wissen: Wissen ermöglicht in vielen Fällen erst die Bildung und Nutzung von Strategien. So können zum Beispiel nur dann größere Einheiten statt einzelnen Chunks erinnert werden, wenn das Vorwissen die Wahrnehmung der (inhaltlichen) Einheiten überhaupt erlaubt (Beispiel Schachstellung, s. VL). Hierzu gehören ebenso die Strategien Kategorisierung (nur möglich mit Vorwissen über Kategorienzugehörigkeit) sowie andere Formen der Ordnung zur besseren Erinnerung, die nur stattfinden können, wenn genug Wissen über die zu ordnenden Stimuli vorhanden ist. Kapazität: Im Zusammenhang mit der Kapazität des Arbeitsgedächtnisses besteht ein wechselseitiger Zusammenhang von Strategien und Wissen: Sind Strategien vorhanden und automatisiert, beanspruchen sie weniger Arbeitsspeicherkapazität und lassen somit mehr „Raum“ für die Aufnahme von Wissen. So können mehr Informationen berücksichtigt werden, das Lernen schreitet voran. Ebenso verhält es sich umgekehrt: Ist mehr spezifisches Vorwissen oder auch allgemeine „Lebensweisheit“ vorhanden, braucht das Kind weniger Kapazität für die Wissensaufnahme, die Einordnung und Verknüpfung mit Gedächtnisinhalten ist leichter und erweitert möglich. In diesem Fall „schaufelt“ das automatisierte Wissen Kapazität für bessere Strategieanwendung frei. Metawissen: Auch das Wissen darüber, wie (ungefähr) Wissen und Erinnern abläuft und insbesondere, welche Einschränkungen es gibt, ermöglicht erst die Bildung von Strategien (deren Notwendigkeit vorher einfach nicht bemerkt 18 wird); es ist eine Grundlage der bewussten und effizienten Strategieentwicklung und –nutzung. Aufgabe 2: Pro: Ein Argument für die Annahme der intraindividuellen Variabilität als charakteristisches Entwicklungsmerkmal wäre die Logik und Funktionalität des Konzepts. Die parallele, überlappende, wechselnde Anwendung einer Vielzahl von Strategien erlaubt Kindern das allmähliche Herauskristallisieren der effektivsten und angenehmsten Strategien durch „trial and error“ (survival of the fittest der Strategien). Durch die längere Überlappungszeit bleiben „ältere“ Strategien dabei dennoch vorhanden, so dass bei neuen Problemen auf sie zurückgegriffen werden kann (Analogie der Biodiversität: Gleichgewicht und Erhaltung auch „untergeordneter“ Arten/Strategien; bei neuen Anpassungsanforderungen kann darauf „zugegriffen“ werden). Dementsprechend spiegelt die Variabilität in Grenzen auch unser eigenes Erleben als Erwachsene wieder: Es gibt keinen klar linearen Anstieg von Fähigkeiten, Wissen und Methoden; Wissenserwerb und Entwicklung entsteht eher durch Ausprobieren, Reflektieren und die langsame Isolierung der effektivsten Methode. Contra: Die Variabilität der Entwicklung wurde vornehmlich in kurzzeitigen mikrogenetischen Settings festgestellt. Die Übertragung auf Langzeitstufenmodelle wie das von Piaget sind schwierig und wurden auch nicht systematisch vorgenommen (Miller, 2003). Es ist daher unklar, ob die „Schwankungen“ in den Fähigkeiten der Kinder nicht doch genauso im Rahmen revolutionärer qualitativer Umstrukturierungen (wie in Piagets Stufenmodell) als Unsicherheiten (Variabilität) im Zusammenhang mit den Übergängen zwischen zwei Phasen erklärt werden können. Auch bei Piaget (und vergleichbaren Modellen) befindet sich das Kind ja im ständigen Wandel, und auch „zurückfallen“ in frühere Schemata ist im Rahmen der Stufenübergänge durchaus erklärbar. Dann gäbe es also ebenfalls Variabilität in der Entwicklung, aber charakterisiert wäre sie dennoch durch einen stetigen, monotonen Aufstieg – auf lange Sicht gesehen. Aufgabe 3 Produktionsdefizit: Ein solches Defizit besteht, wenn eine Strategie zwar nicht spontan eingesetzt wird, aber hilfreich beim Problemlösen ist, wenn sie von außer induziert wurde. Für Erstsemesterstudenten der Psychologie dürfte dies zum Beispiel bei Inhalten des Praktikum I der Fall sein, wie bestimmten Beobachtungstechniken. Diese werden zum Teil spontan nicht (systematisch) eingesetzt; wenn sie jedoch vermittelt wurden, helfen sie sofort (beim ersten Ausprobieren) bei der Erweiterung, Strukturierung und Interpretation von Beobachtungen. Ein Nutzungsdefizit beschreibt die Unfähigkeit, eine vorhandene Strategie nutzbringend einzusetzen. Dies ist häufig ein vorübergehender Zustand, oft auch beim Einsatz neu erworbener Strategien. Solche Strategien finden sich zu Beginn des Psychologiestudiums häufig im Fach Statistik. Die dort vermittelten Methoden der Datenauswertung auf verschiedensten Ebenen können, sobald gelernt, eingesetzt werden, sie stehen also zur Verfügung. Dennoch erleichtern sie das Arbeiten in der 19 ersten Zeit oft nicht, das sie – gerade erst gelernt – selber viel Zeit und Aufmerksamkeit erfordern. Das Einordnen von Informationen, die Kategorisierung und konkrete Berechnung mit statistischen Verfahren ist zunächst an sich zu schwierig, um Erleichterung im Umgang mit neuen Stimuli zu bringen – sind die Verfahren jedoch erst einmal (zumindest teilweise) automatisiert, erleichtern sie die Bearbeitung von und den Umgang mit gegebene Informationen oft enorm. Lernen und Leisten im (höheren) Erwachsenenalter O&M Kap. 9 - Mittleres Erwachsenenalter: 35-65 Höheres Erwachsenenalter: 65-80 Hohes Alter: ab 80 Übergänge zwischen diesen Lebensphasen sind kontinuierlich, doch ihre Anforderungen und Möglichkeiten unterscheiden sich wesentlich. Mittleres Erwachsenenalter: verbunden mit Differenzierung und Expansion von Aufgaben, Kompetenzen und Ressourcen Hohes Alter: Konzentration der Kräfte und Nutzung vorhandener Stärken (aufgrund von biologisch bestimmten Einschränkungen) 1. Entwicklung im Erwachsenenalter: - Die generelle Architektur des Lebenslaufs: o Strukturierende Altersfunktionen nach Baltes 1997, 3 grundlegende interdependente Altersfunktionen: Die positiven Auswirkungen des evolutionären Selektionsdrucks nehmen mit dem Alter ab (nach der reproduktiven Phase) Bedarf an Kultur nimmt mit dem Alter zu (Konzept der Entwicklungsaufgaben Havighurst 1973: Entwicklungsaufgaben strukturieren die Lebensspanne als Folge von Herausforderungen, die vom Individuum als persönliche Entwicklungsziele wahr- und 20 angenommen werden, z.B. Erlernen der Muttersprache, Arbeit Familie, Pensionierung, Tod und Sterben.) Wirkungsgrad von Kultur lässt mit dem Alter nach. - Veränderung der relativen Ressourcenallokation (=Zuteilung von (geringen) Ressourcen): o Funktionserhalt und Verlustregulation werden wichtiger. - Selektive Optimierung mit Kompensation: o Allgemeine Entwicklungstheorie nach Baltes et al 1980 o Entwicklung (= Maximierung von Gewinnen und Minimierung von Verlusten) wird durch Zusammenspiel der 3 Entwicklungsprozesse hervorgebracht: Selektion = Auswahl von Funktionen, auf die sich die begrenzten Ressourcen konzentrieren, ermöglicht Spezialisierung Optimierung = Produktion von Entwicklungsgewinnen, Erwerb, Verfeinerung und Anwendung von Ressourcen um Entwicklungsziele zu erreichen. Kompensation = Aufrechterhaltung des Funktionsniveaus bei Verlusten Erwerb, Verfeinerung und Anwendung von Ressourcen um Verlusten entgegenzuwirken. o Die drei können bewusst, oder unbewusst, aktiv oder passiv, intern oder extern erfolgen. Bsp.: Rollstuhl = externe Kompensation o Mit SOK Modell kann untersucht werden, wie und in welchem Maß Personen Entwicklungszugewinne maximieren und Verluste minimieren. o Zu berücksichtigen sind neben Entwicklungszielen auch objektive (Verhaltenskompetenz der Person) und subjektive Kriterien (Werte und Selbst-Konzeptionen) o Handlungstheoretische Ausformulierung siehe Buch S 355 2. Intellektuelle Entwicklung im mittleren und höheren Erwachsenenalter - Zweikomponentenmodelle der intellektuellen Entwicklung: o Unterscheidung zwischen biologischen und kulturellen Determinanten kognitiver Leistungen. o Empirisch stützten sich Baltes et al auf die Unterscheidung zwischen alterungsanfälligen und alterungsresistenten intellektuellen Fähigkeiten. Alterungsanfällig: Leistungen, die auf Schnelligkeit, Genauigkeit und Koordination elementarer kognitiver Prozesse basieren. o Siehe Abbildungen S 357 o Fluide und kristalline Fähigkeiten: Fluid: Eher angeboren, z.B. Auffassungsgabe, generelles Verarbeitungsniveau Nicht durch Umwelt zu beeinflussen Baut am schnellsten ab Kristallin: Alles was man erlernt hat, z.B. Wortschatz, numerisches Wissen Durch Umwelt bestimmt 21 Leichter Abbau o Mechanik der Kognition: Hardware Biologische Komponente o Pragmatik der Kognition Wissen Kulturelle Dimension der intellektuellen Entw. - Relative Stabilität intellektueller Leistungen über die Lebensspanne o Nativistisch betrachtet: Extrauterines Leben wird mit leistungsfähigen Lernmechanismen begonnen Das betrifft z.B. Wahrnehmungsleistungen im Bereich der Sprache und des Gesichtererkennens Die Pragmatik der Kognition baut auf diesen vorstrukturierten, der Mechanik zuzurechnenden Kernbereichen auf. Demnach ist die kognitive Entwicklung von Anfang an auf Interaktion zwischen Pragmatik und Mechanik angewiesen. Aufgaben: Nennen Sie ein Beispiel für Domänen oder berufliche Tätigkeiten, in denen eine Abbau in der Mechanik, gut kompensierbar ist. Begründung! Nennen Sie ein Beispiele für Domänen oder berufliche Tätigkeiten, in denen eine Abbau in der Mechanik, schlecht kompensierbar ist. Begründung! Nennen Sie zwei Beispiele aus dem Alltagsleben einer pensionierten Person, in denen die schwindende Fähigkeit von Älteren Irrelevantes auszublenden (Inhibition), ein besonderes Problem darstellen stellen könnte. Aufgabe zu 60-jähriger Betriebswirtin: Erfinden Sie einen Satz, der Teil einer Antwort einer relativ weisen Person sind könnte. Begründung! Erfinden Sie einen Satz, der Teil einer Antwort einer weniger weisen Person sein könnte. Begründung! Musterlösung zum Thema „Leistung und Lernen im höheren Erwachsenenalter“ Von Petra Buys Aufgabe 1: Gut kompensierbar wäre ein Abbau der Mechanik zum Beispiel im Beruf des Kellners (unter der Annahme, dass die motorischen Einbußen sich in Grenzen halten): Die verminderte Leistungsfähigkeit des Arbeitsspeichers würde die Arbeit erschweren, da dieser z.B. für Kopfrechnen, das Merken von Bestellungen sowie die (auswendige) Kenntnis der Speisekarte benötigt wird (mechanischer Aspekt). Jedoch wird ein Kellner, der seit vielen Jahren in seinem Beruf arbeitet, zahlreiche hocheffektive Strategien zu diesen Aspekten entwickelt haben: Das Kopfrechnen hat er wieder und wieder geübt und wird darin so manchen jungen, gerade eingestellten Kellner „schlagen“, 22 Für das Merken von Bestellungen hat er zahlreiche Strategien wie Kategorisierung u.ä. entwickelt, so dass es seinen Arbeitsspeicher nur minimal belastet, Die Speisekarte kennt er seit Jahren auswendig, so dass einzelne sich verändernde Faktoren mühelos in dieses Vorwissen integriert werden können. Weniger gut kompensierbar ist ein Nachlassen der Mechanik in verschiedenen Bereichen, in denen Höchstleistungen gefordert werden – zu den Abbauerscheinungen im Alter gehört schließlich in besonderem Ausmaß auch die Senkung der oberen Leistungsgrenze. Ein Beispiel für eine solche Domäne könnte der Beruf „Fluglotse“ sein: „Ernstfälle“, in denen schnelles Denken und Handeln unter Zeit- und Leistungsdruck eine enorme Rolle spielen, kommen eher selten vor. Die in solchen Situationen erforderlichen Handlungen können also in geringerem Maße geübt und automatisiert werden, als es in den meisten Berufen der Fall ist. Für einen älteren Arbeitnehmer ist es daher schwieriger, die dann dringend erforderlichen (aber im Alter deutlich abbauenden) mechanischen Eigenschaften wie Geschwindigkeit des Denkens und Koordination mehrerer Wahrnehmungs- und Handlungsstränge durch pragmatische Fertigkeiten zu kompensieren (noch weiter erschwert dadurch, dass die Ausbildung und das Training bei Älteren länger her ist und Fortbildungen seltener angetreten werden): Aufgabe 2: Beispiel 1: Als zunehmend anstrengender und schwieriger können hier Situationen empfunden werden, die das zusammentreffen vieler Personen beinhalten – wie Familientreffen, Ehemaligentreffen usw. Durch die schwindende Fähigkeit zur Inhibition irrelevanter Reize (wie die Gespräche in der Nachbargruppe sowie vielfältige akustische, visuelle, olfaktorische u.a. Reize) können Großveranstaltungen als überfordernd und kräftezehrend im Sinne einer Reizüberflutung erlebt werden. Beispiel 2: Ähnliches kann für verschiedene Situationen im Straßenverkehr gelten: An unübersichtlichen Stellen kann es älteren Menschen schwer fallen, die Situation zu strukturieren, sich auf relevante Aspekte zu konzentrieren und so den Überblick zu behalten. So ist es möglich, dass z.B. bedrohliche Situationen nicht schnell genug eingeschätzt und als gefährlich erkannt werden. Bei solchen Situationen kann jedoch unter Umständen gut kompensiert werden: Ein Autofahrer mit jahrelanger Übung kann die Einbußen mechanischer Fähigkeiten (hier Inhibition) durch seine Erfahrung (Vergleich mit ähnlichen Situationen) und vorausschauendes Fahren ausgleichen (s.a. Bremszeituntersuchung) und somit dennoch zu einer guten Einschätzung der Situation gelangen. Aufgabe 3: „Wir werden eine Kombination finden, mit der wir alle gut leben können: Es gibt Institutionen, die dich bei der Erziehung beraten und entlasten können, ich kann meine Arbeit noch für eine Weile zurückschrauben und du kannst deine auch ein wenig reduzieren.“ Dieser Satz könnte Teil der Antwort einer „weisen“ Person sein. Verschiedene Weisheitskriterien auf deklarativer und prozeduraler Ebene werden berücksichtigt: Wissen um die Ungewissheit des Lebens und keine zu starke Festlegung auf einmal gefasste Pläne, Wissen um die Relativität von Lebenszielen: Was vor Kurzem noch wichtig war, kann unter veränderten Bedingungen an Bedeutung verlieren, 23 Kenntnis von gesellschaftlichem Wandel (auch: Das Rollenverständnis hat sich verändert, es ist nicht mehr undenkbar, dass ein Mann seine Kinder alleine aufzieht) und Kontexten des Lebens (z.B. die (deklarative) Kenntnis von möglichen Beratungseinrichtungen. „Ich habe mich fest auf meine berufliche Zukunft eingestellt; ich werde das nicht aufgeben und du solltest es auch nicht. Dein Beruf war dir doch immer so wichtig, ein Mann kann sich doch nicht nur um Kinder kümmern.“ Diese Sätze wären eher Bestandteil der Antwort einer weniger weisen Person. Die Weisheitskriterien werden hier (genau konträr zur obigen Antwort) nicht erfüllt: Die Ungewissheit des Lebens wird nicht berücksichtigt, Veränderungen „werfen aus der Bahn“, Werte und Lebensziele werden als absolut verstanden, Gesellschaftlichem Wandel wird keine Bedeutung zugemessen, es werden zudem keine konstruktiven Vorschläge zur Problemlösung beigetragen. Epistemologische Entwicklung, Artikel Hofer & Pintrich - - Natur und Rechtfertigung menschlichen Wissens, Überzeugungen über die Natur des Wissens, Theorien über das Wissen Piaget (1950): genetische Epistemologie Perry (1970): wie Schüler pluralistische Lernerfahrungen interpretieren – Weiterentwicklung durch King und Kitchner Geschlechtsunterschiede, wie epistemologisches Bewusstsein Teil des Denkens und Begründungen sein kann (Kuhn) kein Versuch der konzeptuellen Integration von Piagets Konzept, Theory of mind etc generell postulieren Theorien strukturelle, entwicklungsartige Sequenzen Perry: wie Menschen ihre eigene Lernerfahrung interpretieren zweite Gruppe: wie diese Überzeugungen sich auf das Denken auswirkenen- vor allem reflektierte Urteile dritte Gruppe: epistemologische Ideen sind ein System von Überzeugungen, eher unabhängig voneinander Perrys Schema der intellektuellen und ethischen Entwicklung: 2 große Längsschnittstudien an College Studenten- checklist of educational values fortschreitende qualitative Reorganisation der Bedeutung, invariante, hirarchische Sequenz, vom Typ Piagets, Veränderung durch kognitives Disäquilibrium, Interaktion mit Umwelt, Reaktion zu neuen Erfahrungen durch Assimilation oder Akkomodation 9 Positionen des Schemas, in 4 sequentielle Kategorien eingeteilt: 1) Dualismus = absolutes Wissen= Kuhn: Absolutismus(1+2): richtig und falsch Weltbild, Autoritäten vermitteln Wissen 2) Multiplismus = vorübergehendes Wissen = Kuhn: Multiplismus (3) Modifikation des Dualismus (4) wo es keine eindeutigen Antworten gibt, haben Autoritäten keine Macht- alle Sichtweisen sind gleich gültig 24 - - - - 3) Relativismus = unabhängiges Wissen= Kuhn: Evaluatismus (5) das Selbst als aktiver Produzent von Bedeutung (6) Wissen ist relativ 4) Bekenntnis im Relativismus = kontextuelles Wissen= reflektives DenkenVerantwortung (7-9) (siehe Renkl) Veränderungen in der Epistemologie- Veränderungen im Lernen (?) die Interpretation der Bedeutung ist kein Zeichen von Persönlichkeit sondern von entstehenden Entwicklungsprozessen Nachteile: eingeschränkte ökologische Validität, Objektivität (Beobachter etc.) wirklich Entwicklung oder Sozialisation? generell: eher Orientierung am männlichen Teil der Population (Kritik Gilligans an Kohlbergs Theorie) Belenky: nur Frauen, im Anschluss an Gilligans und Kohlbergs Rahmentheorie, keine Stufen aber Entwicklungswege (Stille, erhaltenes Wissen, subjektives Wissen, prozedurales Wissen (verbunden- Empathie und getrennt- jeder kann Fehler machen), konstruiertes Wissen- Integration von subjektiv und objektiv, kontextuell) aber keine Identifikation mit der Autorität wie bei den Männern Perry ging es eher um die natur des Wissens und Belenky mehr um die Quelle des Wissens und der Wahrheit Baxter Magolda: Implikationen in Verbindung mit dem gender: 4 qualitative Arten des Wissens (absolut, vorübergehend, unabhängig, kontextuell) Modell des reflektierten Urteils (King und Kitchener): Untersuchung der epistemologischen Annahmen über das Urteilsvermögen (reasoning) 15 Jahre Interviewstudien, Verfeinerung des Modells zu einem 7 Stufen Entwicklungsmodell reflektiertes Urteilen ist ein ultimater Ausgang und Entwicklungsendpunkt nature of knowledge und nature of justification prereflektiv (können nicht verstehen, dass es auch Fragen ohne korrekte Antwort gibt,1: Wissen muss nicht hinterfragt werden, 2: Autoritäten haben Wissen, aber nicht alle anderen, 3: temporäre Unsicherheit), quasireflektiv (4: jede Person hat ihre eigene Position, 5: Wissen ist kontextuell und relativ) und reflektiv (6: aktive Konstruktion von Wissen, 7: kritisches Hinterfragen, Wahrscheinlichkeitsurteile) Flavells Kriterien für Stufen: Organisation, qualitative Unterschiede, invariante Sequenz Mechanismen der Veränderung wie bei piaget (Assimiliation und Akkomodation) Individuen operieren aber nicht nur in einem Level: optimales und funktionales (Differenz = bandbreite- wie bei Vygotsky) Zusammenhang zwischen Alter und Stufe + Ausbildung und Stufe Argumentatives Denken nach Kuhn: wie reagieren Ind. auf alltägliche Probleme, die keine eindeutige Lösung haben (ill- structured) Vpn nach Kohorten aufgeteilt, sollten kausale Erklärungen für Probleme geben (warum sind Kinder schlecht in der Schule) wie sind sie zum urteil gekommen, auch gegenposition darstellen Beweis, Expertise, multiple Sichtweisen, Ursprünge der Theorien, Sicherheit des Urteils wiesen auf die epistemologischen Standards hin gleiche Formen wie bei Perry (absolutistisch- Sicherheit des Wissens durch Experten, multiplistisch- Leugnung der Sicherheit des Wissens durch Experten= 25 - - radikale Subjektivität, eigenes Wissen gleichwertig, evaluativ- Anerkennung von Expertise, eigenes Wissen ist weniger Sicher) nur wenigen befanden sich genau in einer Phase: decalage (Piaget)- Hinweis für Domäneneffekte? drei Fähigkeiten des argumentierens: Generierung authentischer Beweise, Generierung von Alternativtheorien, Generierung jeder Form von Gegenargument Metakognition wird benötigt (formale Operation- piaget) Dimensionen epistemologischer Überzeugungen nach Schommer: Zusammenführung von Perrys Schema und Metaverständnis- ep. Überzeugungen sind unidimensional und entwickeln sich in festen Stufen Überzeugungssystem von 5 Stufen (Sicherheit, Quelle, Struktur des Wissens + Kontrolle und Geschwindigkeit der Wissensaneignung 4 Faktoren: feste Fähigkeiten, schnelles Lernen, einfaches Wissen und sicheres Wissen- alle kontinuierlich in Zusammenhang mit Überzeugungen zu Mathe und Intelligenz Ryan: Veränderungen in den Überzeugungen führen zu Veränderungen in Informationsverarbeitungsstrategien Schommer hat die Effekte auf akademische Arbeit weiter untersucht Theoretische Grundlagen zu epistemologischen Überzeugungen Überzeugungen einer Person über die Natur des Wissens und des Lernens werden als epistemologische Überzeugungen bezeichnet (Schommer, 1990). Diese subjekti-ven Vorstellungen über die Objektivität, die Richtigkeit oder die Aussagekraft neuer Informationen und neuer Lerninhalte beeinflussen Informationsverarbeitung, Lernverhalten, Lernmotivation und Lernleistung von Individuen. Sie spielen so-wohl im Alltagsleben als auch in Studium und Beruf eine wichtige Rolle. Forschung über epistemologische Überzeugungen hat in den letzten Jahren e-norm an Bedeutung in der Pädagogik und in der Psychologie gewonnen. Dies hat vor allem damit zu tun, dass die individuelle Epistemologie als eine wichtige Kom-ponente des informellen Wissens von Lernenden erkannt wurde, die eine bedeu-tende Rolle bei der Initiierung und Aufrechterhaltung von Lernprozessen spielt. Die Relevanz epistemologischer Überzeugungen zeigt sich aber nicht nur in der Forschung, sondern auch im täglichen Lehr-Lern-Geschehen: Lehrende, die aner-kennen, dass Lernende über bestimmte epistemologische Überzeugungen verfügen und diese zur Grundlage von Lernentscheidungen machen, sehen die Lernenden mit anderen Augen (Hasanbegovic, Gruber, Rehrl & Bauer, in press). Es gelingt ihnen einfacher, Stärken und Schwächen und damit den Förderungsbedarf der Ler-nenden zu erkennen und die Lernsituation angemessen zu gestalten. Um die Tragweite der Ansätze über epistemologische Überzeugungen bewusst zu machen, wurde in der Sommerakademie in Kleingruppenarbeit zunächst der Stand der Forschung erarbeitet. Besonders erwähnenswert ist, dass auch dieser For-schung Piaget Pate stand, der sich bereits seit Anfang der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts mit der Entwicklung der Erkenntnisstrukturen beschäftigt hatte (z. B. Piaget, 1936). Sein genetisches Modell der intellektuellen Entwicklung sieht eine ständige kognitive Höherentwicklung im Kindesalter vor. Piaget ging dabei von einer Aufeinanderfolge von Entwicklungsstufen aus, die jeweils durch eine spezifische Denkstruktur gekennzeichnet sind. Auf dieser Grundlage formulierte Piagets Schüler Perry (1970) den ersten großen Forschungsansatz über epistemolo-gische Überzeugungen, der im folgenden Überblick auch zuerst angeführt wird. 26 Die in der Folgezeit entstandenen Konzeptionen über epistemologische Überzeugungen entstanden großenteils aus der Auseinandersetzung mit Perrys Arbeit, sei es, dass sie seine Auffassung weiter entwickelten, sei es, dass sie sich kritisch von ihm absetzten. Der von Perry erhobene allgemeine Gültigkeitsanspruch wurde in Frage gestellt; dies führte zu einer konstruktiven Fortentwicklung der theoretischen Grundlagen zu epistemologischen Überzeugungen. Um diese Fortschritte darzustellen, werden im Folgenden in Anlehnung an die Arbeiten von Hofer und Pintrich (1997, 2002) sechs zentrale theoretische Ansätze präsentiert: 1. Perrys Modell der intellektuellen und ethischen Entwicklung 2. Belenkys Kritik an Perrys Modell: Vernachlässigung von Geschlechterunterschieden 3. Baxter Magoldas epistemologisches Reflexionsmodell 4. King und Kitcheners Reflective Judgment Model 5. Kuhns Argumentative Reasoning-Ansatz 6. Schommers Modell unabhängiger Dimensionen Perrys Modell der intellektuellen und ethischen Entwicklung Der amerikanische Psychologe Perry war ursprünglich an Fragen von Autoritätshörigkeit und Persönlichkeit interessiert und entwickelte hierzu ein Stufenmodell, das sich an die Arbeit des Entwicklungspsychologen Piaget anlehnte. Perry (1970) meinte, die Entwicklung von Überzeugungen zum Wissen und zum Lernen, also von epistemologischen Überzeugungen, hänge weniger von all-gemeinen Persönlichkeitsmerkmalen ab als vielmehr von der Ausprägung intraindi-vidueller kognitiver Prozesse. Zur Überprüfung seiner Überlegungen entwickelte Perry zunächst die „Checklist of Educational Values“ (CLEV) und setzte diese in Untersuchungen bei amerikanischen College-Studierenden ein. Spätere Instrumente zur Erhebung epistemologischer Überzeugungen bauen zum Teil auf der CLEV auf. Mit ausgewählten Versuchspersonen führte Perry (1970) nach der Bearbeitung der CLEV ausführliche Interviews durch. Basierend auf diesen Daten nahm er in seinem Stufenmodell an, der Mensch entwickle stetig neue qualitative Vorstellungen von der Organisation des Wissens. Er formulierte ein auf neun Positionen basie-rendes Entwicklungsschema. Die Positionen lassen sich in vier Kategorien zusam-menfassen (Hofer & Pintrich, 1997): 1. Dualism: Es wird von einer absoluten Wahrheit ausgegangen, Dinge gelten als entweder richtig oder falsch, gut oder schlecht (Schwarz-Weiß-Position). 2. Multiplicity: Es wird von drei möglichen Kategorien ausgegangen, „rich-tig“, „falsch“ oder „noch nicht bekannt“. Unsicherheiten werden akzeptiert, aber es wird angenommen, dass sich diese Unsicherheiten im Prinzip in Zukunft auflösen lassen. 3. Contextual relativism: Wissen wird als relativ und kontextbezogen angese-hen. Es wird anerkannt, dass nur Weniges eindeutig richtig oder falsch ist, und dass die Aneignung von Wissen ein aktiv-konstruktiver Prozess ist. 4. Commitment within relativism: Es wird Verantwortung für die eigene Konstruktion von Wissensaneignungs- und Lernprozessen übernommen, die individuelle Annahme der Richtigkeit oder Wichtigkeit von Wissen wird 27 moralisch-ethisch begründet. Perry (1970) nahm an, dass Veränderungen – also der Übergang von einer Position zur nächsten Position oder von einer Kategorie zur nächsthöheren Kategorie – durch ein kognitives Ungleichgewicht als Reaktion auf Umwelteinflüsse herbeige-führt werden. Perry postulierte eine fortlaufende Höherentwicklung hin zu reiferen epistemologischen Überzeugungen. Ausgehend von der Annahme absoluter Wahr-heiten gelange der Mensch über die Akzeptanz vielfältiger Vorstellungen hin zu der Konzeption einer kontextabhängigen Wahrheit, die mit relativen Wissensbegriffen und schließlich in der Verantwortungsübernahme für diese relative Position endet. Belenkys Kritik an Perrys Modell: Vernachlässigung von Geschlechterunterschie-den Belenky, Clinchy, Goldberger und Tarule (1986) kritisierten die Untersuchungen von Perry (1970), weil er ausschließlich männliche Studierende befragt hatte. Sie argumentierten, dass Perrys Entwicklungsschema zu sehr auf Vorstellungen über die männliche Entwicklung epistemologischer Überzeugungen fußte. Deshalb un-tersuchten Belenky et al. (1986) in ihren Interviews ausschließlich weibliche Pro-banden. In ihren Analysen der Interviewdaten kamen sie ebenfalls zu einem Stu-fenmodell. Dieses Modell unterscheidet sich in einigen Punkten von dem Modell Perrys (1970) und soll die weibliche Entwicklung epistemologischer Überzeugun-gen angemessen darstellen. Das Modell enthält die folgenden Stufen: 1. Silence: Es wird angenommen, dass Frauen mit einem bestimmten sozialen Hintergrund - wie Armut, Isolation, Ablehnung, Unterordnung und Gewalt Schwierigkeiten haben, ihre eigenen Gedanken und Gefühle zu artikulieren. Die „zum Schweigen Gebrachten“ sehen sich in einer passiven Position, in der sie von Autoritäten dominiert werden. Sie haben den Eindruck, vieles nicht zu verstehen, wagen es nicht, „dumme“ Fragen zu stellen, sind in Dis-kussionen verunsichert und melden sich deshalb nicht zu Wort. Auch gebildete Frauen berichten von Situationen, in denen sie sich ähnlich sprachlos fühlen. 2. Received Knowing: Es wird in einer dualistischen Position von einer absolu-ten Wahrheit ausgegangen; Autoritäten stellen eine externe Quelle des Wis-sens dar, und es kommt zu einer Identifikation mit der Autorität. 3. Subjective Knowing: In gewisser Weise das Gegenteil von received know-ledge; die Autorität von anderen Personen wird angezweifelt. Wahrheit und Meinungen sind strikt individuell und gültig für die einzelne Person; es wird also von einer internen Quelle des Wissens ausgegangen. Hierbei sind Unter-schiede in der persönlichen geschlechtsspezifischen Wissenserfahrung beob-achtbar. 4. Procedural Knowing: Wissen ist ein Prozess und erfordert Arbeit; bei der Wissensaneignung sind unterschiedliche Interpretationen und Konstruktio-nen gegeneinander abzuwägen. Die Qualität des Wissens hängt von der Qua-lität der Abwägeprozesse ab. 5. Constructed Knowing: Alles Wissen ist konstruiert; Wissen ist relativ und kontextbezogen, weswegen es eine hohe Toleranz für Unsicherheiten und Widersprüche gibt. Somit spielt eine dialektische Position der „Konversati-on“ zwischen widersprüchlichen Auffassungen eine große Rolle für Wissenskonstruktionsprozesse. Baxter Magoldas epistemologisches Reflexionsmodell 28 Baxter Magolda (1992) bezog in ihre Untersuchungen im Gegensatz zu Perry (1970) und Belenky et al. (1986) Frauen und Männer in einem ausgewogenen Ver-hältnis ein. In einer Längsschnittstudie über fünf Jahre mit 70 Versuchspersonen setzte sie ihren Fragebogen „Measure of Epistemological Reflection“ (MER) ein und ergänzte diese Erhebungen durch Interviews. So konnte Baxter Magolda (1992) auch Entwicklungsannahmen methodisch gut begründet formulieren. Baxter Magolda (1992) geht in ihrem epistemologischen Reflexionsmodell davon aus, dass sich Vorstellungen über Wissen und Wissenserwerb in vier Stufen entwi-ckeln. 1. Absolutes Wissen: Unreflektierte Stufe der epistemologischen Überzeugung durch die starke Fixierung auf Autoritäten; Wissen ist sicher und von Autori-täten bestimmt. 2. Transitionales Wissen: In manchen Domänen (z. B. Mathematik und Naturwissenschaften) ist Wissen sicher, in manchen anderen Domänen (z. B. Geis-tesund Sozialwissenschaften) ist Wissen unsicher. Diese Unterscheidung verweist auf einen Übergang zu eigenständigem, subjektivem Denken und kritischer Reflexion. 3. Unabhängiges Wissen: Denken wird als von Autoritäten unabhängiger Pro-zess propagiert; es wird von der individuellen Konstruktion von Wissen und damit von dem relativen Wert von Wahrheit ausgegangen. 4. Kontextuelles Wissen: Verständnis von Wissen als ständigem Entwicklungsprozess, der von neuen Fakten und Kontexten abhängig ist. Geschlechtsunterschiede in der Entwicklung konnten in den Untersuchungen von Baxter Magolda (1992) nicht konstatiert werden. King und Kitcheners “Reflective Judgment Model” Das Reflective Judgment Model von King und Kitchener (1994) zeigt, dass sich Denkprozesse in unterschiedliche Reflexionsstufen einteilen lassen. King und Kit-chener (1994) konfrontierten Versuchspersonen mit Problemen, für die es keine eindeutigen Lösungen gibt, und baten sie, über diese laut nachzudenken. Die Ant-worten wurden wörtlich transkribiert und durch ausgebildete Rater kodiert. In Anlehnung an Dewey (1933) erwarteten King und Kitchener (1994), dass durch die Beobachtung von Personen beim Bearbeiten schwer oder nicht lösbarer Probleme besonders viel über reflexive Prozesse zu erfahren sei. Aufgrund ihrer Studien unterschieden King und Kitchener (1994) folgende Reflexionsstufen: 1. Prä-reflexive Stufe: Probleme sind grundsätzlich lösbar; Wissen ist absolut und zum größten Teil autoritätsbezogen. 2. Quasi-reflexive Stufe: Das Bewusstsein, dass Wissen nicht sicher ist, wächst; Wissen ist relativ und kontextbezogen. 3. Reflexive Stufe: Wissen wird aktiv konstruiert und muss kontextbezogen betrachtet werden. Manche Beurteilungen sind vernünftiger und gültiger als andere, aber bleiben offen für weitere Einschätzungen. Im Vergleich mehrerer Altersgruppen von Studierenden zeigte sich, dass mit zunehmendem Studienfortschritt höhere Reflexionsstufen eingenommen wurden, wobei beim Wechsel vom grundständigen Studium zum Promotionsstudium ein besonders großer Sprung auftrat. Kuhns “Argumentative Reasoning“-Ansatz 29 Kuhns (1993) Forschung zum Argumentative Reasoning zielt auf die Untersu-chung des argumentativen Denkens sowie von epistemologischen Überzeugungen und ihrer Begründung ab. Die Methode der Wahl in ihren Untersuchungen waren Interviews, in denen sie analog zu King und Kitchener (1994) den Versuchsperso-nen Fragen zu alltäglichen, schwer fassbaren Problemen stellte. Typische Fragen lauteten: "Warum versagen manche Kinder in der Schule?" oder "Was verursacht Arbeitslosigkeit?" Die Versuchspersonen mussten in den Interviews zwei einander widersprechende Meinungen jeweils überzeugend begründen. Aufgrund der Häufigkeit in der Belegung der Auswertungskategorien „Beweis“, „Expertise“, „Sicherheit“, „multiple Standpunkte“ und „Ursprung von Theorien“ unterteilte Kuhn (1993) die Versuchspersonen in drei Gruppen: Absolutisten, Multiplisten und Evaluative. 1. Absolutisten: Sie betrachten das Wissen als absolut und sind sich ihrer ei-genen Ansicht sehr sicher; dabei orientieren sie sich bei ihren Argumenta-tionen an Fakten und Expertenmeinungen. 2. Multiplisten: Sie vertrauen ihren subjektiven Ansichten und schätzen ihre individuellen Überzeugungen als genauso bedeutsam und richtig ein wie die von Experten. 3. Evaluative: Sie sind in der Lage, über Beweisführung, Alternativenfindung und Gegenargumentation verschiedene Ansichten zu reflektieren und zu bewerten, weswegen sie sich ein begründetes Urteil bilden. Besonders bemerkenswert an Kuhns Arbeiten ist die Berücksichtigung einer großen Variationsbreite bei der Stichprobenziehung, z. B. bezogen auf das Geschlecht, das Alter und den Bildungsstand. Schommers Modell unabhängiger Dimensionen Schommer (1990) entwickelte einen völlig neuartigen Ansatz zur Analyse epistemologischer Überzeugungen, der sich von der Vorstellung einer klaren Abgrenzung in verschiedene Entwicklungsphasen bzw. -gruppen löste. Sie entwarf, vor allem unter Bezug auf Perrys CLEV und auf die Arbeit von Dweck und Leggett (1988), ein Sys-tem von fünf relativ unabhängigen Dimensionen, die sie quantitativ mit Hilfe eines Fragebogens („Epistemological Questionnaire“) untersuchte. Dabei wurden die folgenden fünf Faktoren mittels 63 Aussagen, die in zwölf Subsets untergliedert waren, untersucht: 1. Quick Learning (Lernen erfolgt schnell oder schrittweise) 2. Fixed Abi-lity (Lernfähigkeit ist angeboren oder veränderbar) 3. Simple Knowled-ge (Wissen besteht aus isolierten, einfachen Fakten oder aus einem komplexen, vernetzten System) 4. Certain Knowledge (Wissen ist sicher oder unsicher) 5. Source of Knowledge (Wissen wird von Autoritäten vermittelt oder selbst aktiv konstruiert)Der Fragebogen erlaubte erstmals Aussagen über die Zusammenhänge zwischen epistemologischen Überzeugungen, Leistung und Lernstrategien und wurde ein wichtiger Wegbereiter für eine neue Linie der Erforschung epistemologische Überzeugungen. 30 Aufgaben: Erklären Sie anhand eines eigenen Beispiels in "oma-kompatibler" Weise, warum man das Nachdenken über komplexe Phänomene als "inneres Argumentieren" begreifen kann, und warum für sophistiziertes "inneres Argumentieren" epistemologische Überzeugungen von Relevanz sein können. Fiktive Interviewfrage: Können Entwicklungspsychologen endgültige Erklärungen für das Voranschreiten kognitiver Leistungen vom Vorschulalter bis in die frühe Adoleszenz finden? Geben Sie bitte einen Antwortausschnitt einer jeweils fiktiven Kommilitonin wieder, der je einer der drei von Kuhn unterschiedenen Ebene zuzuordnen wäre. Begründung! Haben sich im ihrem bisherigen Psychologie-Studium Anlässe ergeben, die Sie über epistemologische Fragen haben nachdenken lassen und die ggf. zu einer Veränderung Ihrer entsprechenden Überzeugungen geführt haben? Wenn ja, bitte kurz erklären. Wenn nein, was hätte dafür wohl passieren müssen? Musterlösung zum Thema „Entwicklung epistemologischer Überzeugungen“ Aufgabe 1: Nach Deanna Kuhn ist das Argumentieren eine wichtige Strategie zum Wissenserwerb auf sozialer Ebene oder intrapersonell als „Nachdenken“. Diese Strategie spielt besonders bei komplexen Problemen eine Rolle, wie hier an einem Beispiel erläutert werden soll. 31 Das Thema „Bahnstreik“ ist ein komplexes Thema, welches nicht auf den ersten Blick zu durchschauen ist. Es gibt keine definitive Lösung für das Problem, sogar die Ausgangssituation kann als komplex bezeichnet werden. Ebenso sind Anzahl und Art der Lösungsschritte nicht zweifelsfrei festzulegen. Um bei einem solchen Problem zu einer fundierten Meinung oder gar einer Lösung zu kommen, ist es notwendig, intensiv darüber nachzudenken, was hier einem inneren Argumentieren (argumentieren mit sich selbst) gleichkommt: Man mag die unterschiedlichen Seiten der Situation (Interessen von Bahn, Gewerkschaft, Kunden, moralische Verpflichtungen, Wirtschaft...) zunächst grob gegeneinander abwägen, um so zu einer Theorie (hier: einer Entscheidung oder Lösungsmöglichkeit) kommen zu können. Diese muss argumentativ begründet werden. Anschließend ist es weiterhin wichtig – will man sich wirklich ernsthaft mit dem Problem befassen – die eigene mit möglichen anderen Positionen zu vergleichen, die Argumente dieser anderen Positionen zu durchdenken und zu entkräften (oder aber die eigene Theorie zu modifizieren). Mit diesem argumentativen Vorgehen ist es möglich, zu einem guten, das heißt fundierten und durchdachtem Ergebnis zu kommen. Das intensive „Nachdenken“ funktioniert also ganz ähnlich dem Argumentieren zwischen mehreren Personen. Es gibt jedoch mehrere Faktoren, die Voraussetzung für dieses Vorgehen sind: Zum Einen muss der „denkenden“ Person bewusst sein, dass sie die Strategie des Argumentierens nutzen kann; sie muss merken, dass hier eine Strategie nötig ist und in der Lage sein, eine geeignete auszuwählen (Metawissen). Das gibt ihr die Kompetenz, das Argumentieren einzusetzen. Zum Anderen muss sie ein gewisses Level epistemologischer Überzeugung erreicht haben: Befindet sie sich noch auf der (nach Kuhn) absolutistischen oder der multiplistischen Stufe, ist sie sich relativ bis sehr sicher, dass ihr momentaner Standpunkt „richtig“ ist. Sie berücksichtigt verschieden Positionen nicht (absolutistisch) oder setzt sie nicht systematisch in Bezug zueinander (multiplistisch). Dementsprechend wird sie – aufgrund dieser Sicherheit – keine Notwendigkeit sehen, ihren Standpunkt argumentativ zu durchdenken und mit anderen Standpunkten zu vergleichen. Um den nötigen Antrieb für die Anwendung der Argumentationsstrategie zu erhalten, muss die Person sich also auf dem evaluatistischen Level (Kuhn) befinden und sich der Unmöglichkeit von absolutem Wissen sowie der niedrigen Sicherheit ihrer Ansichten bewusst sein und verschiedene Positionen systematisch vergleichen können. Aufgabe 2 Antwort auf absolutistischer Ebene: "Es nervt etwas, dass wir immer nur so Wischi-Waschi-Theorien vorgestellt bekommen. Ich würde es vorziehen, wenn mehr auf die Fakten, die man gefunden hat, fokussiert werden würde. Die Theorien sind ja offenbar alle nicht das "Gelbe von Ei". Begründung: Es wird auf Fakten Wert gelegt: Diese gibt es und diese sind das, was zählt. Multiple Standpunkt werden nicht als legitim gesehen oder wertgeschätzt. Antwort auf multiplistischer Ebene: "Mir scheint, dass sich da viele Entwicklungspsychologen ihre eigene Theorie "zusammengebastelt" haben. Sie erklären alles etwas, aber vieles auch wieder nicht. Eigentlich ist es völlig egal, welche Theorie man heranzieht, da ja keine bewiesen ist." 32 Begründung: Der Fokus ist nicht mehr auf den Fakten, sondern auf den multiplen Standpunkten. Diese werden als "austauschbar" und mehr oder weniger gleich legitim gesehen. Antwort auf evaluatistischer Ebene: "Wir haben ja eine Vielzahl von Theorien vorgestellt bekommen, die alle nicht die endgültige Antwort sind. Wir haben aber auch gesehen, dass man die Theorien bezüglich Ihrer Stärken und Schwächen bewerten kann. Manche Theorien, etwa Piaget, haben auch primär historischen Wert, indem sie weitere Forschung angestoßen haben. Was ich - glaube ich - gelernt habe, ist, dass man wissenschaftliche Ansätze, Theorien nicht einfach für "bare Münze" nehmen sollte. Man muss sie vielmehr kritisch bewerten und dann sehen, welchen Wert sie dann haben." Begründung: Der Fokus ist nicht mehr auf den Fakten, sondern auf den multiplen Standpunkten. Diese werden als bewertbar und mit spezifischen Stärken und Schwächen versehen eingeschätzt. Aufgabe 3 Beispiele für solche Anlässe könnten sein: Vielfältige, sich oft widersprechende Studien und Theorien zu Gebieten, jahrzehntelange Diskussionen (z.B. Anlage-Umwelt, Erklärung von Gedächtnisphänomen, Entwicklung...) Veränderung von Theorien über die Jahre hinweg, Paradigmenwechsel – oft hin zu massiv anderen Erklärungsmodellen Fällt auf, dass zu allen Theorien der Punkt „Kritik“ folgt – nichts ist unangefochten, geschweige denn „wahr“ Methodenkritik, Gegenevidenz und massivste Einschränkung sogar der „größten“ Psychologen der Geschichte (z.B. schwere Kritik an Freud, Piaget) All dies sind Situationen, die einem Studenten gerade auch der Psychologie begegnen und seine Einstellung zu epistemologischen Fragen grundlegend beeinflussen können. Es wird immer deutlicher, dass Wissen nicht absolut, sondern in höchstem Maße von der Perspektive des Betrachters sowie auch von u.a. historischen und kulturellen Faktoren abhängig ist. Die epistemologischen Vorstellungen entwickeln sich immer mehr von der Suche nach Wahrheit hin zum Streben nach erklärungsmächtiger Theorie. 33 Spracherwerb: - - - - Meilensteine und Entwicklungslinien des Spracherwerbs bereits vorgeburtlich, Wiedererkennensleistung und Präferenz rhythmisch prosodischer Merkmale, Unterscheidung von anderen zentrale Entwicklungsaufgabe 1. LJ: erwerb phonologisch- prosodischen Wissens der Muttersprache zunehmend differenzierteres Wissen über prosodische Satzgliederung frühe phonologische Entwicklung: sensitiv für lautliche Kontraste, Kategorien und Lautkombinationsregeln- Unterscheidung für andere Sprachen nimmt dabei parallel ab Einstieg in den Worterwerb: 4 Monate- Erkennung des eigenen Namens im Laustrom, 9 Monate: erstes Wortverständnis Ende des 1. LJ Wissen über suprasegmentalen r-p Charakter der Muttersprache, Regularitäten = Grundlagen für den Wortschatz und Grammatikerwerb zentrale Entwicklung im 2. LJ: lexikalische Entwicklung 10-14 Monate: produkive Nutzung, rezeptiver Wortschaftz 60 17-19 Monate, 50 produktiv, 200 rezeptiv; 9 neue Wörter pro Tag = Wortschatzspurt erste vorläufige Bedeutung nach einmaliger Präsentation = „fast mapping“, Wort Objekt Zuordnung, Extension Kinder tragen selbst Erwartungen („Constraints“) heran, viele Unter- oder Übergeneralisierungen 20 Monate: produktiv 170 (große Varianz) erste Wortkombinationen: ab 18 Monate, kommunikativ nützlich aber kontextgebunden deutsche Kinder lassen oft Artikel, Hilsverben weg, in anderen Sprachen nicht der Fall zentrale Entwicklungsaufgabe 3. LJ: Erwerb grundlegender Satzbaupläne und morphologischer Paradigmen komplexere Sätze aber häufig, durch eingeschränkte Aufmerksamkeitsspanne, auf Kosten phonologischer Details Ende des 3. LJ: nicht hier und jetzt = Planen möglich Abstrakte Regularitäten: keine lineare Annäherung an die Erwachsenensprache sondern schrittweise systeminterne Reorganisation; Indikatoren der schrittweisen Abstraktion: a) lexikalische Fehler (Übergeneralisierung) und Erwerb von Hintergrundbedeutung b) morphologische Fehler (falsche Übergeneralisierung, aber auch Rückgang durch Ersetzung mit korrekten Formen) c) fälschliche Übermarkierungen (Reorganisation der FormFunktionseinheit) Sprachsystem wird nun selber Gegenstand nicht bewusster Analyseprozesse metalinguistisches bewusstsein aber erst ab 6/7 mit Vorläufern im Vorschulalter phonemisches Bewusstsein aber erst mit Beginn des Schriftsprachenerwerbs 34 - - - - - Spracherwerb im Kontext anderer Entwicklungsbereiche: extreme Positionen: kognitiv- deterministisch oder nativistisch- modular = Kind bringt ein autonomes, modular abgekapseltes Sprachverarbeitungssystem im Sinne Fodors oder von Beginn an Universalgrammatik (Chomsky) outside in Theorie: zentrale bedeutung der kognitiven Entwicklung und des Lernens für den Spracherwerb Spracherwerb und kognitive Entwicklung: Spracherwerb als eigenständiger Problembereich aber keine vollständige Dissoziation Wortschatz hat zb gedächtnisbezogene Voraussetzungen Bootstrapping / Constraint Theorien: Zusammenwirken von bereits erworbenen sprachlichen Wissenskomponenten und spezifischen Infoverarbeitungsprinzioien Rückwirung des Spracherwerbs auf das Wissen und Konzepterwerb = theory of mind = sprachlich vermittelter Erwerb inhaltlicher und metakognitiver Wissensbestände und Selbstregulierung (Piaget, Vygotsky) Spracherwerb und sozial kommunikative Entwicklung: Kinder von Beginn an soziale Wesen Bedeutung sprachlicher Interaktion für den Spracherwerb kindliche Sensitivität für Rhythmik und Prosodie trifft auf eine entsprechend strukturierte Umweltsprache (baby talk als Unterstützung, geeignete Dialogstrukturen, gemeinsame Aufmerksamkeitslenkung) intuitive Sprachlehrleistungen 35 Geschlechtstypisierung, O+M Kapitel 19 1. Einleitung Bedeutung des Geschlechts für Individuum und Gesellschaft In wenigen Kulturen gibt es auch noch andere Geschlechtskategorien als männlich/ weiblich, z.B. nordamerikanische Indianer: „Berdaches“: sowohl für Frauen als auch Männer beschrieben, können männliches/ weibliches Verhalten zeigen; Moderne Industriekulturen: Queers, Transgenders, Drags, etc. Umwelt und Sprache Natur bestimmt männlich/ weiblich, Umwelt legt fest, was es bedeutet männlich oder weiblich zu sein; Kind macht geschlechtsspezifische Erfahrungen schon bevor es sich selbst als männlich oder weiblich ansieht. Viele Bemühungen, sprachlichen Sexismus (Titel, Berufsbezeichnungen, etc.) abzubauen. Identität Geschlecht hat für Aufbau und Aufrechterhaltung der Identität zentrale Bedeutung; Wichtig für Entwicklungspsychologie, wie die Geschlechter ihre Geschlechtstypisierung wahrnehmen, und wie dies mit Verhaltensweisen und Eigenschaften zusammenhängt; Geschlechtsspezifische und Geschlechtstypische Merkmale Biologische/ Soziale Geschlechtskategorien sind dichotom und invariant, die mit diesen Kategorien verbundenen physischen und psychischen Merkmale allerdings nicht! „Geschlechtsspezifisch“: ist ein Merkmal nur dann, wenn es tatsächlich nur bei einem Geschlecht vorkommt! trifft nur auf wenige spezifische Merkmale zu, die mit Reproduktion in Zusammenhang stehen; (z.B. Menstruation, stillen, etc.) „Geschlechtstypisch“: alle Merkmale, die relativ häufiger bei einem Geschlecht vorkommen (die meisten psychischen, aber auch physischen Merkmale!) Allgemein herrscht in Gesellschaften hinsichtlich geschlechtstypischer Merkmale ein ziemliches „Entweder – Oder“ vor; z.B. Frauen etwas besser für Kinderpflege geeignet -> schnell abgeleitet, dass nur Frauen Kinderpflege übernehmen sollten! Die Geschlechtsvariable in der psychologischen Forschung Psychologische Forschung zum Thema Geschlechterdifferenzierung kann man in 3 Gruppen unterteilen (je nach Art der Verwendung der Geschlechtsvariable): 1. Geschlecht als individuelles Merkmal 2. Geschlecht als soziale Kategorie und Stimulusvariable 3. Geschlecht als Dimension der Selbstwahrnehmung 36 Ad. 1.) Geschlecht als individuelles Merkmal: Tradition der Differentiellen Psychologie -> Geschlecht als individuelles Merkmal, Geschlecht: UV in empirischen Untersuchungen, Merkmale sind AV; Maß für Geschlechtsunterschiede: Mittelwertsdifferenzen zwischen beiden Geschlechtsgruppen; Ad. 2.) Soziale Kategorie und Stimulusvariable: Geschlecht als bedeutsame soziale Kategorie betrachtet, mit der bestimmte Rollenerwartungen und Rollendifferenzierungen verknüpft sind. alle heranwachsenden männlichen/ weiblichen Personen werden mit geschlechtsbezogenen Informationen konfrontiert Geschlecht ist also auch ein sozialer Stimulus! Man fragt nicht nur nach Unterschieden zwischen den Geschlechtern sondern eher danach, was für einen Unterschied es macht, in einem bestimmten Kontext männlich oder weiblich zu sein; Ad. 3.) Dimension der Selbstwahrnehmung und Informationsverarbeitung: Ausmaß der eigenen Geschlechtstypisierung kann ebenfalls zu einem sozialen Stimulus (für einen selbst und andere) werden. Im Vordergrund steht Selbstwahrnehmung -> wie unterscheiden sich Personen mit unterschiedlich selbst erlebter Geschlechtsidentität? Informationsquellen des Selbstkonzepts Aufbau der individuellen Geschlechtsidentität auf Grundlage mehrerer Informationsquellen: Wahrnehmung und Beobachtung von Attributen der eigenen Person Vergleich von Attributen der eigenen mit denen anderer Personen Soziale Reaktionen auf eigenes Verhalten; Sowohl Selbstwahrnehmung als auch Wahrnehmung durch andere orientiert sich in hohem Maß an sozialen Geschlechtskategorien; Geschlechtsschema – Theorien Im Lauf der Entwicklung bauen sich auf Grundlage sämtlicher Informationen Geschlechtsschemata auf -> werden zu einer Art Filter der Aufnahme und Speicherung weiterer eingehender Informationen; Beim Aufbau dieser gibt es sowohl große intraindividuelle Veränderungen als auch interindividuelle Schwankungen; Die Geschlechtsidentität als Teilaspekt der individuellen Geschlechtstypisierung Bis ca. 70er: Geschlechtstypisierung als ganzheitlicher Prozess betrachtet -> „Geschlechtsrollenübernahme“, „Geschlechtsrollenidentifikation“. Mit dieser Sichtweise waren meist noch folgende Annahmen verbunden: Übernahme von der sozialen Umwelt vorgegebenen Geschlechtsrollenstandards ist ein „natürliches“ Entwicklungsziel. Die entscheidenden Prozesse finden in der frühen Kindheit statt Die größte Bedeutung kommt dabei den Eltern zu (Bekräftigung von ge37 schlechtstypischen Verhalten) Meist nur Jungen untersucht Fast nur interindividuelle, kaum intraindividuelle Unterschiede untersucht! Alle 3 Thesen heute überholt! Wandel der Forschungsfragen 70er: Frauenbewegung -> „Frauenfragen“ beherrschen die Diskussion! Eher Vereinigung aller positiven männlichen/ weiblichen Eigenschaften Entwicklungsziel; Jugend-, Erwachsenenalter eher im Blickpunkt Spätere Entwicklung nicht mehr als determiniert angesehen Einfluss von Peers zunehmend größere Bedeutung beigemessen; 2.1. Huston Matrix Huston (1983): Differenzierung der Geschlechtstypisierung in Form einer Matrix: 4 Konstrukte (Entwicklungsdimensionen) unterschieden (Konzepte/ Identität/ Präferenzen/ manifestes Verhalten) Können sich auf jeweils 5 Inhaltsbereiche beziehen. (1998 um einen 6. erweitert) Festgestellt, dass die verschiedenen Entwicklungsmerkmale der Geschlechtstypisierung weniger eng korrelieren, als eine ganzheitliche Konzeption erwarten lässt. Geschlechtsidentität stellt demnach nur einen Teilaspekt der individuellen Geschlechtstypisierung dar; Weitere Unterscheidung: Globale Geschlechtsidentität: überdauernde Selbstwahrnehmung, eindeutig männlich oder weiblich zu sein; Spezifische Geschlechtsidentität: z.B. Erleben des eigenen Körpers, der eigenen Fähigkeiten, Interessen, Verhaltensweisen, etc. als eher maskulin oder feminin. Früher: Maskulinität und Femininität als gegensätzliche Pole betrachtet -> heute als zwei voneinander unabhängige Dimensionen aufgefasst (d.h. in einem Menschen können maskuline und feminine Anteile vereinigt sein). Es muss also nicht in allen Bereichen eindeutig eine maskuline/ feminine Identität gegeben sein, z.B. kann man homosexuell sein, und sich trotzdem als Mann/ Frau verstehen. 2.2. Individuelle konstitutive Elemente des Selbstkonzepts Kognitive Aspekte Welche kognitiven Aspekte sind wesentlich zur Aufrechterhaltung der Geschlechtsidentität? Kulturabhängig (z.B. in unserer Kultur ist äußeres Erscheinungsbild wichtiger als typisch männlich/ weibliche Fähigkeiten) Untypisches Erscheinungsbild tangiert die Geschlechtsidentität bei einer Frau mit ansonsten femininem Selbstkonzept nicht. 38 Es kann aber auch notwendig werden, sich äußerlich stärker anzupassen, damit Geschlechtsidentität nicht ins Wanken gerät -> z.B. abhängig von Subgruppen der eigenen Geschlechtsgruppe (z.B. Girlies, Emanzen, Karrieretyp, etc.) Entwicklungsverlauf Jüngere Kinder denken noch in absoluten Kategorien von Männlich/ weiblich (z.B. Junge sein bedeutet gleichzeitig auch maskulin zu sein). Beschäftigung mit geschlechtsuntypischen Aktivitäten führt somit sofort zu Gefährdung der Geschlechtsidentität. Kinder wählen lieber ein unattraktives, geschlechtstypisches Spielzeug statt einem attraktiven geschlechtsuntypischen! Erwachsene wissen, dass Geschlechtsgruppe und Maskulinität/ Femininität sich unterscheiden. Emotionale Aspekte und Verhaltenskomponenten Individuelle Geschlechtsidentität beinhaltet eine emotionale – und eine Verhaltensseite; (z.B. ersichtlich in Konflikten zwischen Kindern wegen geschlechtsuntypischen Verhalten!) Huston – Matrix: - Emotionale Anteile unter „Präferenzen“ - Verhaltenskomponente unter „geäußertes Verhalten“ Die Entwicklung der Geschlechtsidentität über die Lebensspanne Anfangs: chromosomale Festlegung XX/ XY 5. SSW: Ausdifferenzierung der Gonaden 10. – 12. SSW: Ausbildung innerer und äußerer Genitalstrukturen -> an äußeren wird das soziale/ Erziehungsgeschlecht bestimmt; Festgelegte Entwicklungsschritte Vor der Geburt müssen die Entwicklungsschritte in einem gewissen zeitlichen Rahmen auftreten; Kommt es zu einer Störung, sind alle danach ablaufenden Schritte ebenfalls gestört. Auch nach der Geburt von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter tw. feste Abfolgen (z.B. Menarche, Menopause) Kognitive/ affektive Komponenten sind allerdings auch von sozialen/ individuellen Entwicklungsvoraussetzungen abhängig. Entwicklung der Geschlechtsidentität in der Kindheit 3.1.1 Null bis zwei Jahre Habituationsexperimente man kann sehen, welche kategorialen Unterschiede wahrgenommen/präferiert werden. - Ab 3 – 6 Monaten: können Säuglinge männliche/ weibliche Stimmen auseinander halten 39 - Ab 9 – 12 Monaten: können sie männliche/ weibliche Gesichter unterscheiden wissen auch, welche Gesichter und Stimmen zusammengehören. Ab 10 – 14 Monaten: 2 Filme vorgespielt -> schauen Kinder des eigenen Geschlechts signifikant häufiger an! (besonders Mädchen!) Unterscheidung: v.a. anhand visueller Merkmale wie Haarlänge, Kleidung; Genitalien spielen noch keine Rolle; Kinder könne in diesem Alter allerdings die Frage „bist du ein Bub/ Mädchen“ noch nicht beantworten; (erst mit 2,5 – 3 Jahren) Jungen identifizieren sich stärker mit eigenem Geschlecht -> merken sich in einem Experiment typisch männliche Spielhandlungen besser! Bis zum Ende des 2. LJ können Kinder beide Geschlechter klar unterscheiden, und besitzen zumindest rudimentäres Wissen über Gegenstände/ Verhaltensweisen, die zu den Geschlechtern passen; 3.1.2 Drei bis sechs Jahre 3 Jahre: o Geschlechtszugehörigkeit wird noch nicht als erschöpfende Klasse gesehen o Kein Wissen über Geschlechtskonstanz Geschlechterkategorien Bekommen jetzt zunehmende Bedeutung –> zurückzuführen auf Tendenz zur Gruppierung von Dingen nach Ähnlichkeiten/ Verschiedenheiten in diesem Alter. Kinder erkennen, dass sie Geschlecht nicht durch Wunsch oder Erscheinung wechseln können. Geschlechtsstereotype Kinder erweitern jetzt ihr Wissen über Geschlechtsattribute -> Überzeugung, dass bestimmte Gegenstände/ Aktivitäten besser zu einem Geschlecht passen als zum anderen; Entwickeln sich bei beiden Geschlechtern etwa gleich schnell; „Gute“ Eigenschaften werden aber tendenziell dem eigenen Geschlecht zugeschrieben. Auch bestimmte metaphorische Eigenschaften werden als typisch männlich/ weiblich klassifiziert; z.B. Feuer, Haie, etc. -> männlich, Schmetterlinge Wolken -> weiblich) Vorschulalter: Geschlechtskonzepte sehr rigide -> Wahl von Spielzeug orientiert sich jetzt stark an Kriterium der Geschlechtsangemessenheit; Geschlechtshomogene Gruppen Gleichgeschlechtliche Interaktionsartner7 Veraltensmodelle werden immer wichtiger geschlechtshomogene Gruppen wichtig! Hier entwickeln sich unterschiedliche Spielkulturen. Jungen entwickeln intensiver Dominanzhierarchien, sind darauf aus, ihren Status zu sichern; Mädchen empfinden die Spielweise der Buben oft als zu grob, lassen sich weniger beeinflussen! 3.1.3 Sieben bis elf Jahre Ab 7 Jahre: Zwei entscheidende Entwicklungsvoraussetzungen gegeben, um Geschlechtskonstanz verstehen zu können: 40 - Konkret – operationales Denken: sichere Unterscheidung zwischen äußerer Erscheinung und erschlossener Wirklichkeit Erkenntnis der genitalen Grundlage des Geschlechts; Flexiblere Geschlechtsrollenstereotype Bislang rigide Geschlechtsstereotypen werden langsam flexibler. Es wird erkannt, dass auch Gemeinsamkeiten zwischen den Geschlechtern bestehen. Weiter höhere Rigidität bei: Merkmalen der Erwachsenenrolle im Vgl. zu Merkmalen der Kinderrolle Bei maskulinen Eigenschaften Eher bei Aktivitäten als bei Persönlichkeitseigenschaften Vorschulkinder urteilen über Interessen/ Vorlieben einer Person die sie nicht kennen fast ausschließlich auf Grundlage des Geschlechts; Während der mittleren Kindheit steigt die Akzeptanz nicht geschlechtstypischen Verhaltens an. Geschlechtsrollenpräferenzen Im Grundschulalter treten generelle Alterstrends gegenüber interindividuellen des Entwicklungsverlaufs in den Hintergrund. 3.2. Geschlechtsidentität in der Adoleszenz Über weitere Entwicklung in der Adoleszenz ist weniger bekannt als in der Kindheit; Beschäftigung mit dem Selbst Zunehmende Beschäftigung mit dem Selbst, erhöhte Selbstaufmerksamkeit -> Gewinnung der Identität -> Teil davon: Geschlechtsidentität; Gründe für erhöhte Beschäftigung mit dem Selbst: Jugendlicher versteht, dass es gemeinsame und verschiedene Eigenschaften und Interessen mit anderen gibt Druck von außen wächst, sich mit eigener Zukunft (Beruf/ Familie) auseinander zusetzten. Rasche und auffällige körperliche Veränderungen; Entwicklungsaufgaben (Erstmals) thematisierte Inhalte im Jugendalter: Akzeptierung des weiblichen/ männlichen Körpers Aufbau der sexuellen Orientierung Aufnahme neuartiger Beziehungen zu Gleichaltrigen Auseinandersetzung mit Geschlechtsrollen Ausbildung schulischer/ beruflicher Interessen Oft zentrieren sich Selbstwahrnehmung/ Selbstbewertung auf die Frage nach der Attraktivität beim anderen Geschlecht -> Aussehen bei Mädchen wichtiger als bei Jungen! 41 Physische Reifung In der Pubertät werden die körperlichen Geschlechtsunterschiede markanter. Körperliche Reifung bei Mädchen früher -> Förderung gleichgeschlechtlicher Freundschaften! Allerdings erhebliche interindividuelle Unterschiede! Geschlechtsunterschiede Bei schulischen Interessen in Richtung von Geschlechtsstereotypen -> beeinflusst spätere Berufswahl! Jungen ist ihre berufliche Zukunft wichtiger. Geschlechtsstereotype Kenntnis kann bei Jugendlichen vorausgesetzt werden; ob sie zu-, oder abnehmen ist nicht geklärt. Müssen sich nicht unbedingt auf die Wahrnehmung bekannter Jungen und Mädchen auswirken! Geschlechtersegregation Wird im Jugendalter eher zugunsten heterosexueller Beziehungen aufgebrochen; andere Abgrenzungsmerkmale als Geschlecht werden bedeutsam, z.B. Kleidung, Sprache, Werte, etc. 3.3. Geschlechtsidentität im Erwachsenenalter 3 neue Entwicklungsaufgaben: Eingehen dauerhafter Partnerbeziehungen Ausfüllung einer Berufsrolle Übernahme elterlicher Pflichten Verhaltenstendenzen aus Kindheit und Jugend sind entsprechend zu transformieren. Rollenvorgaben Heute immer noch starke Geschlechtsunterschiede -> Geschlechtsidentität erhält erneut eine besondere Bedeutung für die erwachsene Persönlichkeit; -> Verhaltensspielraum durch Rollenvorgaben viel enger als in der Kindheit -> führt zu strukturellen Unterschieden in sozialen Positionen von Männern und Frauen; Rolle der Frau Stärkere ökonomische Abhängigkeit Oder Doppelbelastung Führt zu Konflikte in folgenden Bereichen: Globale Geschlechtsidentität (wird nicht in Frage gestellt) Selbstkonzept eigener Femininität – Maskulinität Individuelle Präferenzen und Lebensziele Sozialer Wandel Stärkere Ausrichtung von Frauen auf den Beruf Hinausschieben des Heiratsalters 42 Absinken der Kinderzahl Aufnahme von Ausbildungen und Berufstätigkeit nach einer Phase der Hausfrauentätigkeit Komplementäre Entwicklungen bei Männern sind nicht festzustellen (außer bei stärkerer Beteiligung bei Kindererziehung) In der 2. Lebenshälfte findet dann eine gewisse Annäherung der beiden Geschlechter in ihrer Geschlechtsidentität statt -> biologische Sicht: keine Notwendigkeit von Reproduktion mehr vorhanden! Erklärungsansätze für die Entwicklung der Geschlechtsidentität Freud: Theorie der psychosexuellen Identifikation Gegenstand: Ausbildung der heterosexuellen Orientierung; Bewältigung des Ödipuskomplexes in der phallische Phase (5. LJ). Kleiner Junge begehrt die Mutter sexuell -> erlebt Vater als Rivalen -> Kastrationsängste -> identifiziert sich mit bedrohlichem Vater -> sexuelles Begehren der Mutter verwandelt sich in Zärtlichkeit -> Heterosexualität in Pubertät manifest! Mädchen: verläuft gleich, aber: an Stelle von Kastrationsangst -> Penisneid! Identifikation mit Mutter erfolgt aus Angst vor Liebesverlust. Nicht empirisch fundiert -> heute nur noch historische Bedeutung! Gegenstand aktueller Erklärungsansätze Aktuell 3 verschiedene: 1.) Aufbau der Geschlechtsidentität/ Veränderungen im Lauf der Ontogenese 2.) Unterschiede zwischen den Geschlechtern 3.) Individuelle Unterschiede innerhalb der Geschlechter schließen sich gegenseitig nicht aus, sondern ergänzen sich! 1.1 Biologische Ansätze 1.1.1 Chromosomale/ hormonelle/ neuronale Grundlagen Chromosomensatz XX/ XY führt nicht nur zum biologischen, sondern auch zum sozialen Erziehungsgeschlecht -> gehen die chromosomalen Unterschiede nur mit physischen, oder auch mit Verhaltensunterschieden einher? Da meist chromosomales/ gonadales/ morphologisches und Erziehungsgeschlecht übereinstimmen, lässt sich in Fällen von „normaler“ Entwicklung nicht sagen, welches Gewicht den einzelnen Faktoren zukommt -> Nur bei Widersprüchen auf den verschiedenen Ebenen feststellbar! Literatur: hauptsächlich klinische Bsp. Über hormonelle Faktoren; Weisen darauf hin, dass die vorgeburtlich einwirkenden Hormone zu unterschiedlichen Mustern späteren Sozialverhaltens beitragen. Jungen/ Mädchen dürften auf verschiedene Arten von Reizen emotional 43 unterschiedlich reagieren! Ob sich eher das soziale/ biologische Geschlecht durchsetzt, wird kontrovers diskutiert. 1.1.2 Evolutionäre Grundlagen der Geschlechtsdifferenzierung Geschlechtsunterschiede am ehesten dort zu erwarten, wo großer Selektionsdruck herrschte! Drei biologische Imperative: Bis ins fortpflanzungsfähige Alter überleben Sich fortpflanzen Nachwuchs aufziehen, bis dieser das fortpflanzungsfähige Alter erreicht hat; Unterschiedliche Fortpflanzungsfunktionen der beiden Geschlechter: ♀: begrenzte Zahl von Nachkommen, lange Schwangerschaft und Pflegezeit ♂: viele Nachkommen, Unsicherheit über Vaterschaft; unterschiedliche Verhaltensstrategien in der Konkurrenz um Sexualpartner! Geschlechtsunterschiede sind wahrscheinlich dann evolutionär bestimmt, wenn sie kulturübergreifend vorkommen, und wenn es geringen Sozialisationsaufwandes bedarf, um sie auszulösen; Schwächen: Gegenstand sind nur Unterschiede zwischen, nicht innerhalb der Geschlechter Angepasstheit des Verhaltens zeigt sich erst nach Erreichen der Fortpflanzungsreife -> erklärungsbedürftige Entwicklungsprozesse finden jedoch schon vor dieser Zeit statt. Keine Aussagen, auf welchem Weg die geschlechtstypischen Prädispositionen vermittelt werden. Biologische Faktoren und Verhalten beeinflussen sich wechselseitig 1.2 Sozialisationstheoretische Ansätze 4.2.1 Bekräftigungstheorie: 3 aufbauende Hypothesen Differentielle Erwartungen an Jungen und Mädchen: empirisch gut belegt, allerdings kann man daraus nicht ableiten, dass Eltern ihre Kinder deshalb auch so erziehen! Differentielle Bekräftigungen für unterschiedliches Verhalten: konnten ebenfalls nachgewiesen werden, besonders für Spielverhalten und wenn Väter einbezogen wurden. (Jungen: stärkeres Leistungs-, Wettbewerbsverhalten, mehr Strafen, Mädchen: mehr Zuwendung, Erziehung zur Sauberkeit, Unterbinden von zu wilden Spielen) -> nimmt mit zunehmendem Alter ab, und in der Adoleszenz wieder zu! Differentielle Bekräftigungseffekte: Geschlechtstypisierung nimmt aufgrund unterschiedlicher Bekräftigungsmuster zu. 44 Interpretationen Elterliches Verhalten kann sowohl als Ursache für Geschlechtsunterschiede aufgefasst werden, als auch als Folge -> möglicherweise beeinflussen Eltern nur dann das Verhalten ihrer Kinder, wenn es außerhalb des Toleranzbereichs der Geschlechtsrollenerwartungen liegt. Auch Lehrer, Geschwister, Peers haben großen Einfluss -> letztere besonders aufgrund der Tendenz zur Geschlechtersegregation! 1.2.2 Imitationstheorie Imitation von weiblichen/ männlichen Modellen führt zur Geschlechtsidentität. 3 Teilhypothesen Differentielle Beobachtungshäufigkeit: es gibt mehr Gelegenheiten zur Beobachtung gleichgeschlechtlicher Modelle als gegengeschlechtlicher -> nicht richtig -> gleich viel Kontakt zu beiden Geschlechtern außer in früher Kindheit: mehr Kontakt zu Frauen! Selektive Nachahmung: es werden eher gleichgeschlechtliche Modelle imitiert (gilt nur bedingt -> selektive Nachahmung erst, wenn geschlechtstypische Verhaltenswiesen und Einstellungen bereits ausgeprägt sind). Der gleichgeschlechtliche Elternteil ist das bevorzugt nachgeahmte Modell -> konnte nicht empirisch belegt werden! Die im Lauf des Vorschulalters auftretende zunehmende selektive Nachahmung ist eher Ergebnis kognitiver Verarbeitungsprozesse als Grundlage des Aufbaus von Geschlechtsidentität; -> verstärkt nur bereits vorhandene Tendenzen! Selbstsozialisation: Informationen über geschlechtstypisches Verhalten/ Modelle werden nicht selten vom Subjekt selbst ausgesucht! 4.3. Kognitive Ansätze Bereits in ersten LJ rudimentäres Wissen über Geschlechtsdifferenzen -> wächst an und führt zu zunehmendem Verständnis für biologische/ soziale/ psychische Geschlechterdifferenzierung; Treibende Kraft die für das eigene Geschlecht typischen Merkmale zu übernehmen, und positiv zu bewerten! Selbstsozialisation von zentraler Bedeutung Äußere Anstöße nur Erleichterung 4.3.1 Theorie Kohlbergs Prozess zur Entwicklung der Geschlechtsidentität vollzieht sich in 3 Schritten: 1. Auf Basis wahrgenommener Ähnlichkeiten vollzieht sich die Selbstwahrnehmung als Junge/ Mädchen mit ca. 2 – 3 Jahren 45 2. Mit zunehmendem Verständnis für Geschlechtskonstanz nimmt die aktive Suche nach geschlechtsbezogenen Informationen deutlich zu 3. Führt zu selektiver Nachahmung gleichgeschlechtlicher Modelle; Entscheidend: Verständnis der Geschlechterkonstanz! Aber: Geschlechtstypische Präferenzen werden bereits einige Jahre davor beobachtet -> es scheinen auch niedrigere Formen des Verständnisses der Geschlechtsdifferenzierung auszureichen! Höhere Bewertung der männlichen Rolle durch beide Geschlechter nicht mit Kohlbergs Theorie vereinbar Weiterhin ungeklärt, inwieweit Geschlechtsstereotype den Geschlechtspräferenzen vorausgehen oder auf sie folgen. 4.3.2 Geschlechtsschema Theorien: (Martin und Halverson) Geschlechtsschema: kognitive Repräsentation sämtlicher geschlechtsbezogener Informationen. Lenken die Informationsverarbeitung Steuern das Verhalten. Es handelt sich um einen aktiven Konstruktionsprozess, wobei das aufgebaute Wissen auch eine motivationale Funktion hat primär Frage danach, wie sich diese Schemata im Lauf der Kindheit entwickeln. 2 Arten von Schemata unterschieden: Allgemeines Schema von männlich und weiblich (overall ingroup – outgroup – Schema) -> Kategorisierung von Eigenschaften/ Aktivitäten/ Rollen als typisch männlich/ weiblich. Spezifisches Schema des eigenen Geschlechts (own sex schema) engere und detailliertere Version eines Teils des allgemeinen Schemas -> gleichzeitig tritt das Phänomen der Höherbewertung der eigenen Geschlechtsgruppe auf! Offene Fragen Unter welchen Bedingungen werden schemakonsistente/ schemainkonsistente Informationen beachtet und behalten? Welche Variablen beeinflussen sie subjektive Bedeutsamkeit der Geschlechtsvariablen? 5. Schlussfolgerungen und Ausblick Verschiedene Theorien sollten so integriert werden, dass das Zusammenwirken biologischer/ sozialer/ kognitiver Faktoren deutlich wird. Alle Faktoren zielen darauf ab, die individuelle Entwicklung in eine geschlechtstypische Richtung zu lenken. Ausbildung einer Geschlechtsidentität scheint also überdeterminiert zu sein. 46 Geringe Geschlechtsunterschiede die von einem Faktor hervorgerufen werden (z.B. evolutionär bedingtes stärkeres Wetteifern bei Kindern) wird dann noch von außen verstärkt. Wenn diese Faktoren über längere Zeiträume wirken, werden die Unterschiede immer größer, und generalisieren auf die unterschiedlichsten sozialen Kontexte. Entwicklung der Geschlechtsidentität ist somit als transaktionaler Prozess anzusehen. Wandel der Passung Individuum – Umwelt Die Passung von individuellen Faktoren und Umweltgegebenheiten ist einem ständigen Wandel unterworfen. Sowohl Bedeutsamkeit verschiedener, als auch Auswirkungen von gleichen Faktoren ändern sich. Geschlecht als relationale Variable Entwicklung der Geschlechtsidentität ist außer auf der individuellen Ebene auch auf anderen Ebenen zu sehen: Interpersonelle Ebene Intergruppenebene Interkulturelle Ebene Geschlechtsidentität wird damit zu einer relationalen Variable: Sozialpsychologische Ansätze geraten ins Blickfeld, welche die Entwicklungspsychologie vernachlässigt hat. 47 Wie kann man die Rigidität der Geschlechter-vorstellungen im Kindergartenalten erklären und warum "kann" diese nach dem Erkennen der Geschlechtskonstanz abnehmen? Könnte eine Teil der positiven Effekte von Mono-Edukation auf die fehlende Aktivierung von geschlechtsbezogenen Schemata zurückzuführen sein? Warum? 48 Entwicklung der Leistungsmotivation - Was ist Leistungsmotivation: - besondere Form der Zielverfolgung- Handlungen oder Handlungsergebnisse werden auf einen Tüchtigkeitsmaßstab bezogen- am Ende steht Erfolg oder Misserfolg - leistunsmotiviert = wenn die Bewertung der eigenen Tüchtigkeit den wesentlichen Anreiz für die Zielverfolgung darstellt (+normaitve Dimension- kein Schummeln) - Bezugsnormen = normative Vermittlungsglieder - durch Erfolg/ Misserfolg ausgelöste oder antizipierte Emotionen (Scham, Neid) - Leistungsmotivation als Schlüsselkompetenz zur erfolgreichen Bewältigung von zb Schule - Komponenten der Leistungsmotivation und ihre Entwicklung: - am Anfang zb Erwartungs mal Wert Theorie nach Atkinson, Selbstbewertungsmodell nach Heckhausen - Leistungsmotivation als Selbstbewertungssystem: Heckhausens Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation als Integration der Theorien von McClelland, Atkinson und Weiner - von McClelland: Leistungsm. als Resultat 2er Strebungen = 1) erfolgszuversichtliche Motivkomponente (Antizipation des Stolzes- Aufgabe angehen) 2) misserfolgsängstliche Motivkomponente- 2 Formen: aktiv und handlungsorientiert= geringes Fähigkeitskonzept, passiv und lageorientiert = soziale Folgen des Misserfolgs (Antizipation des Schams- Aufgabe vermeiden) - Leistungsmotiv als Folge gemachter Erfahrungen, habituelle Verhaltensdisposition - von Atkinson (Erwartung mal Wert): damit sie zu einer handlungsinitiierenden Motivation wird = 1) Erwartung, auch tatsächlich Erfolg zu haben 2) Wert, dem man diesem Erfolg zumisst - von Weiner (Attributionstheorie): Ursachenerklärung beeinflusst die Motivationsausprägung; Erklärungen: internal- stabil (Fähigkeiten), internalvariabel (Anstrengung), external- stabil (Aufgabenschwierigkeit), externalvariabel (Glück/Pech); Ursachenzuschreibung = Attribution - Bezugsnormen und ihre Auswirkung auf die Leistungsmotiventwicklung: - Erklärung durch Heckhausens Selbstbewertungsmodell: herausbildung erfolgszuversichtlicher oder misserfolgsmeidender Leistunsmotivation durch ontogenetisch gesammelte Erfolgs- oder Misserfolgserfahrungen - Einschätzung der eigenen Leistung immer relativ zu einer akzeptierten Bezugsnorm (individuelle oder soziale Bezugsnorm) - individuelle Bezugsnormorientierung: mit früheren Leistungen verglichen, durch Anstrengung kann kontinuierlich höhere Leistung erbracht werden - soziale Bezugsnormorientierung: Vergleich mit den Leistungen einer Bezugsgruppe (Schulklasse)- begünstigt die Entwicklung leistungsstärkerer Schüler- Erfolg auf Fähigkeiten, Misserfolg auf Pech oder mangelnden Antrengung, leistungsschwache Schüler führen allerdings dann Misserfolg auf mangelnde Fähigkeiten (internal- stabil) und Erfolg auf Zufall (external- variabel) zurück = Anstrengung lohnt sich nicht - Entwicklung der Leistungsmotivation: - nach Heckhausen: 49 - - - - - - 1) Freude am Effekt (ab 3. Monat) = Freude an absichtsvoll bestimmten Effekten = Effektmotivation 2) Selbermachenwollen (ende des 1. LJ, 2.) = solche Effekte ohne Hilfe hervorrufen, explizites Verständnis eigener Urheberschaft, auch verbal ausgedrückt, Bezugspersonen messen nun Kinder entsprechend ihres Fähigkeitsniveaus an individuellen Bezugsnormen (Lob oder Missbilligung- Stolz oder Verlegenheit) 3) Verknüpfung des Handlungsergebnisses mit der eigenen Tüchtigkeit (3.5 Jahre) = nun auch Stolz und Scham, Bezug auf Urheberschaft + Wertmaßstab von Tüchtigkeit- jetzt leistungsmotiviert und nicht nur effektmotiviert; nach Holodynski aber erst nur in Anwesenheit von Erwachsenen- erst in der Grundschule auch in Alleinsituationen bereits im Vorschulalter zeigen sich Unterschiede 4) Bezugsnormsetzung und Zielorientierung (4.5) = Kombination von eigener Tüchtigkeit und Aufgabenschwierigkeit; eigenständige Zielsetzungeigenständige Setzung von Bezugsnormen, erst nur individuell, ab Grundschule (8) dann sozial wichtig, im Laufe der Sekundarstufe nebeneinander aufgabenorientierte Zielwahl: Interesse leistungsziel/ ich- orientiert: besser als die anderen abschneiden 5) Entwicklung der Ursachenzuschreibung von Erfolg und Misserfolg: a) ab 5: Anstrengung als Erklärung für Leistung (proportionale Beziehung) b) ab 10: Fähigkeit als Erklärung c) ab 12: Glück als Erklärung Erweiterung der Erwartung x Wert- Theorie: spaltung der Kategorien von Atkinson (Motiv, Erwartung, Wert) in Subkonstrukte- Problem = Vernachlässigung der Rahmentheorie Subkonstrukte der Motivkomponente: was motiviert Menschen generell, Aufgaben in Angriff zu nehmen?- nun auch Beachtung wenn Aufgaben aus anderen Gründen angegangen werden (Interesse, Flow Erleben, Aufgabenorientierung, Lernzielorientierung, Streben nach Autonomie- oder Kompetenzerleben Covington (Selbstwerttheorie) = Selbstwertmotiv als Wunsch nach einem positiven Selbstbild- so lässt sich Vermeidungsverhalten erklären (bedrohung des Selbstwertes durch Scheitern, Anstrengung vermeiden) Subkonstrukte der Erwartungskomponente: Atkinson = subjektive Erfolgswahrscheinlichkeit Bandura (Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung) =Zutrauen in eigene Fähigkeiten Marsh (Fähigkeitsselbstkonzept) = domänenspezifisch PISA, IGLU erfassen domänenspezifische Fähigkeistselbstkonzepte (erst unrealistisch hoch, dann Sinken) Subkonstrukte der Wertekomponente: Atkinson und Heckhausen = Umkehrwert der eingeschätzten Erfolgswahrscheinlichkeit Eccles: Aufpaltung in 4 Komponenten 1) Tüchtigkeitswert = einem Tüchtigkeitsmaßstab genügen wollen 2) intrinsischer Wert = Freude (Interessen, Erleben von KompetenzMotivkompon.) 3) instrumenteller Wert = Nutzen für weitergehende Ziele 4) Kosten = negative Effekte der Bewältigung Erwartungs- und Wertekomponente stehen nicht reziprok zueinander 50 - Interesse verschiebt sich im Laufe der Schulzeit auf die Fächer, in denen man gut ist; Abwertung schützt vor einer negativen Selbstwertbilanz Bedingungen der Leistungsmotivationsgenese: drei zentrale soziale Kontexte = Elternhaus, Schule, Peers mit Einfluss auf die Leistungsmotivation Elternhaus: 2 Faktoren für eine positive Entwicklung 1) warmherzig und unterstützend 2) hohe aber realistische Leistungserwartung = herausfordernde Atmosphäre 51 Zusammenfassung Schule - Schulleistungen: das auf dem Lehrplan stehende deklarative und prozedurale Wissen in verschiedenen Domänen; Erwerb an Lerngelegenheiten gebunden - Zusammenspiel internale Prozesse und den Lernangeboten - 4 Kernbereiche: Kompetenzen in 1) Muttersprache 2) Mathe 3) Naturwissenschaften 4) Englisch - richtig „Schülerleistungen“ - offen, ob gute Fachleistungen im jeden Alter die gleiche latente Dimension widerspiegeln - will man Annahme machen, dass Geometrieleistungen sich auf der selben Dimension abbilden lassen, z.B. in 5. Und 10. Jahrgangsstufe, dann sieht man, dass diese Dimension kein psychologisches Merkmal im engeren Sinne ist, sondern vielmehr das erreichte Curriculum im Geometrieunterricht repräsentiert - Daher kann es keine psychologische Theorie zur Schulleistung geben - systematische Lerngelegenheiten- permanenter Anstieg der Leistungen, sofern kummulativ - Anknüpfung neuer Inhalte entscheidet, ob das Fachswissen verknüpft/ konsolidiert wird und ob es zu einer kognitiven Repräsentation kommt - bei kompartimentalisierten Inhalten kommt es a) zu Vergessensprozessen gelernter Inhalte b) neue Inhalte werden schwerer abgespeichert =Rolle des Vorwissens für gelingende schulische Leistungen (Renkl), je kummulativer desto positiver - Naturwissenschaften kommen zu kurz: basiert auf Piaget- in der konkretoperationalen Phasen fehlt Kindern die Voraussetzung für den Erwerb formal abstrakter Unterrichtsinhalte (Physik, Chemie) - 2. Grund ist, dass die Lehrer nicht über die fachlich-didaktische Ausbildung in beiden Fächern verfügen - Stern: Basis Vygotsky = bei gelingender Nutzung graphisch visueller Repräsentationsformen kann das aber sehr wohl möglich sein - unregelmäßiger Unterricht führt zu Vergessensprozessen epochaler Unterricht führt schon in den Ferien zu Vergessen - je nach Fach differentielle Entwicklungsverläufe - fruchtbarste Untersuchung für den Grundschulbereich: SCHOLASTIK (Schneider) = Schulorganisierte Lernangebote und Sozialisation von Talenten Interessen und Kompetenzen - Ergebnisse: Rechtschreibeleistung- keine lineare Steigerung, sondern extremer Zuwachs von der 2. zur 4. - BIJU: Kohorten- Längsschnittstudie seit 1991, Ankeritem mit einigen gemeinsamen Items, vier Messzeitpunkte, Leistungsentwicklung in Englisch und Mathe steiler als in Physik - Ergebnisse: Zuwachs in Englisch = 4 SD in Physik nur 1.7 SD durch Kompartimentalisierung, geringere Lerngelegenheiten = fehlende Anknüpfbarkeit - „Matthäus Effekt“ wer hat dem wird gegeben = Effekt der Schulform =selbstverstärkende Akkumulation von Ansehen Schere zwischen den Schulen, v.a. Gymnasium geht auseinander 52 - - - - - Entwicklung als Reifeprozess (wie bei Piaget, verschiedene Altersstufen mit unterschiedlichen Fähigkeitsniveaus) Lehrpläne definieren, welche fachlichen Kompetenzen wann erreicht werden sollen; aber auch Variabilitäten Skalenverankerung: „Item-Response-Modelle“ = probabilistische Testtheorie hinreichende Sicherheit = Lösungswahrscheinlichkeit von p=.65, welche kognitiven Operationen sind nötig, um die Items erfolgreich zu lösen (Beschreibung einer Person mit einem Fähigkeitsparameter von 500) TIMS Studie: Third International Mathematics and Science Anwendung der mathematischen Kenntnisse auf alltagsnahe Probleme 1) alltagsnahes Schlussfolgern – 20% der Auszubildenden kommen über dieses Niveau nicht hinaus-= Grundschule = konzeptueller Unterschied zwischen Intelligenz und Schulleistungen 2) einfache Anwendung mathematischer Routinen – Sekundarstufe I- 65% der Auszubildenden kommen über dieses Niveau nicht hinaus 3) mathematisches Modellieren auf einem einfachen Niveau- mathematischer Ansatz muss erschlossen werden- gelingt 70% der Gymnasiasten 4) mathematisches Argumentieren- nur 3% der Azubis und 29% der Abiturienten post hoc Vorgehen, scale anchoring PISA: programme for international student assesment + Kompetenzstufen für das Textverständnis Effekt von Fähigkeitsgruppierung: Ortswechsel bei Übergang von Primar zu Sekundar Grundschule= heterogene Lerngruppen, danach aber Leistungsgruppierung Grad der Differenzierung schwankt in den Ländern 2 Formen der FG: extern (gegliedertes Schulsystem= leistungshomogenisierte Gruppen) und Binnendifferenzierung (mikroadaptives Vorgehen) Amerika: academic track, general track, vocational track Annahme: individuelle Lernerfolge in leistungshomogenen Gruppen besser Caroll oder Bloom: homogene Gruppen benötigen ähnliche Lernzeiten= höheres Tempo und kognitives Anspruchsniveau Vorkenntnisse- positive Effekte auf Klarheit des Unterrichts und Zeitnutzung (.55) Marsh: Hongkong- gute immer gut, schlechte schlecht unabhängig von der Schulebene Deutschland: Leistungsvorteile für Gymnasiasten mit 4jähriger Grundschulefrühe Differenzierung scheint lesitungsstärkere Schüler zu fördern Köller und Baumert: individuelle Ausgangsfähigkeit hatte einen positiven Effekt auf spätere Leistungen, Schulform hatte ebenso einen substantiellen Einfluss; aber innerhalb der Schulform nur unbedeutende Unterschiede zwischen Starken und Schwachen; Grund eher die stärkere Instruktionskultur am Gymnasium leistungsfördernd; weniger als Folge makroadaptiven Verhaltens der Lehrer sondern deren Ausbildung = lesitungsstärkere Schüler profitieren von der Differenzierung psychologische Kosten: Weichen gestellt da Übergang schwer, zu geringe Durchlässigkeit, frühe Entscheidung über den zukünftigen Berufsweg, Benachteilungung von Schülern aus schwächeren sozialen Schichten a) Developmental/ Stage Environment Fit Model (Eccles) : Differenzierung zur gleichen Zeit wie die Pubertät, Schulleistungen verschlechtern sich bei Übergang, 53 - - - - - - - gleichzeitiges Absinken der intrinsischen Lernmotivation, Anstieg der Leistungsangst, erhöhte drop out Raten Konzeptualisierung der fehlenden Passung zwischen individuellen Bedürfnissen und schulischen Rahmenbedingungen: inkompatible Umweltbedingungen haben negative Einflüsse (auch auf die Motivation) mit der Pubertät kommt auch das Bedürfnis nach Autonomie und Identitätsausbildung häufig gelingt es der Schule nicht, eine Balance herzustellen kompetitives Klassenklima wirkt gegen den individuellen Wunsch nach Kompetenzerleben Folgen: negativer Effekt auf Schulleistungen und intrinsische Lernmotivation besser nach den Bedürfnissen der Jugendlichen ausgerichtete Lernumwelt deutlich positiver Fischteicheffekt (Schwarzer oder Marsh) Fähigkeitsgruppierung hat einen deutlichen Effekt auf die selbstbezogene Fähigkeitskognition bei leistungsstarken Schülern (Grundschule) beim Übergang ins Gymnasium negative Einflüsse, da sie nun nicht mehr zu den Besten gehören; sozialer Vergleich führt zum Absinken fähigkeitsbezogener Selbstkonzepte und des Selbstwertgefühls schwache Schüler fühlen sich beim Eintritt in die Hauptschule hingegen besser = mittlere Konzepte konvergieren im Laufe der Sek I „big fish little pond“ Effekt nach Marsh: 2 gleichgute Schüler- der in der schwächeren Schule hat eine höhere Wahrnehmung seiner Fähigkeiten (negative Regressionskoeffizienten auf die individuelle Selbstwahrnehmung Effekt der Leistungsgruppierung (Schulmittelwert in Mathe in Klasse 7 auf Selbstkonzept in Klasse 10 = -.33) = je leistungsstärker die Klasse, desto ungünstiger der Entwicklungsverlauf des Selbstkonzepts- gitl auch für schulische Interessen = Änderungen in der institutionellen Lernumwelt hat also große Einflüsse „Coleman- Report“:5% der Leistungsunterschiede waren auf Schuleffekte zurückzuführen Jencks: genetische Unterschiede machen 33-50 % aus, außerschulische Lernumwelt = 25-40%, unterschiedliche soziale Herkunft =6%, Unterschied im Umfang der Schulbildung 5-15%, Qualität der Grundschule 3% Eindruck der begrnezten Effizinez der Schule Lernsituation wirkt kompensatorisch auf die mangelnde Fähigkeit jüngerer, geeignete Strategien anzuwenden (Schule = executive functionaires), mit zunehmendem Alter wird das unwichtiger (siehe Universität deutlich unstrukturierter) Geary: grundlegende angeborene Fähigkeiten in Mathe (Einschätzung kleiner Mengen, grundlegendes Verständis von Relationen, präverbales Zählen, Addieren/Substrahieren = primäre Fähgikeiten Algebra = sekundär, durch Kultur/ Bildung vermittelt Variablen, die die Schulleistungsentwicklung beeinflussen: intelligenz, Fähigkeitsselbstkonzepte, schulische Interessen psychometrische Intelligenz als einer der zentralen Prädiktoren für die Schulleistungsentiwkclung in den Kernfächern (r=.50), lernen schneller, effektivere Problemlösestrategien, größere Verarbeitungskapazität 54 - - - - - - Helmke & Weinert: 1) Einfluss der Intelligenz nimmt ab, Rolle des Vorwissens nimmt zu 2) Schulleistungen beeinflussen die Intelligenzentwicklung, Intelligenz bedingung unf Folge schulischen Lernens; günstiges Lernklima führt zur Ausschöpfung kognitiver Begabungsreserven Beziehung zwischen Fähigkeit und Selbstkonzept: a) skill development approach = Fähigkeitsselbstkonzept entwickelt sich in Folge schulischer Lesitungserfahrung und deren Kausalattribution b) self enhancement approach =Selbstkonzept, vermittelt über motivationale Variablen, fördert den Lernprozess- positiver Einfluss auf die Schulleistungen = parallel verlaufende Prozesse, wechselseitige Beeinflussung: Leistungsmaße auf Selbstkonzept und umgekehrt, aber: je höher die Leistungen in dem einen Fach, desto ungünstiger die Entwicklung des Selbstkonzept im anderen =“internal/ external frame of reference“ Modell- 2 Quellen für die Entwicklung fachspezifischer Selbstkonzepte 1) interindividueller Vergleich (positiver Pfad) 2) intraindividuell (zwischen den Fächern- negativer Pfad) Interesse = Form der fachspezifischen intrinsischen Motivation, initiieren Lernprozesse und erhalten diese aufrecht; wird durch schulisches Kompetenzerleben beeinflusst Curriculum eines Landes, 4stufig: intendiert (Lehrplan), potentiell (Bücher), implementiert (behandelter Stoff), erreicht (Schülerleistungen) Lernen = relativ dauerhafte Veränderung kognitiver Strukturen Greeno: Reorganisation von Wissensstrukturen Kintsch: Umstrukturierung von mentalen Situationsmodellen Lernen als Prozess: Verstehen, Speichern, Abrufen, Anwenden – nur Längsschnittstudien sinnvoll = Veränderung des Wissens als Folge von LehrLerngeschehen, gleiche Aufgaben können aber nicht immer verwendet werden, Lösung = Ankeritem multiple choice: ökonomisch, Aufdeckung von Misskonzepten Drei Faktoren Modell: Englischleistungen- elementares Wissen, komplexes Wissen, Kommunikationsfertigkeiten (hohe Korrelation, also auch g Faktor möglich) g Faktor allgemeiner mathematischer Kompetenz in TIMSS Aufgaben: Erklären Sie, warum eine gute Deutsch-Schülerin, wenn sie von der Grundschule aufs Gymnasium kommt in aller Regel Einbußen in ihrem Deutsch-Selbstkonzept hinnehmen muss. Erklären Sie einer Person, die "nichts mit Psychologie zu tun hat" (z.B. Ihrer Oma) in Alltagsworten, jeweils einen Vorteil und einen Nachteil der deutschen dreigliedrigen Schulsystems. Angenommen eine Person, die "nichts mit Psychologie zu tun hat", würde behaupten, dass es bei der Entwicklung der Schulleistung doch in erster Linie darauf ankommt, ob ein Schüler intelligent ist oder nicht – der Rest sei Nebensache. Was wären zwei wichtige Gegenargumente? 55 Musterlösung zur Vorlesung 21.01 Schule Von Petra Buys Aufgabe 1 „Schuld“ an häufigen Einbußen im fachbezogenen Selbstkonzept leistungsstarker Schüler beim Übergang aufs Gymnasium ist der sogenannte „Fischteich-Effekt“ (big-fish-littlepond). Die hier beschriebene Schülerin hat sich in der Grundschule als besonders kompetent im Fach Deutsch erlebt sowie dementsprechende Rückmeldung erhalten. Beim Übertritt ins Gymnasium wechselt sie in eine Auswahl von Schülern, die in ihren Grundschulen gute Leistungen gezeigt haben- es verändert sich also ihr externer Referenzrahmen (Vergleichsgruppe). Sie muss nun feststellen, dass sie es nun mit stärkeren Vergleichspartnern (Mitschüler) zu tun hat, von denen mit hoher Wahrscheinlichkeit viele gleich gut oder sogar besser in Deutsch sein werden als sie selbst. Dementsprechend wird sie – vorangetrieben auch durch nun weniger enthusiastische Rückmeldung von außen (u.U. auch in Form von schlechteren Noten) - sich selbst als weniger kompetent erleben und ihr Selbstkonzept zumindest für das Fach Deutsch „nach unten korrigieren“ müssen. Aufgabe 2 Das deutsche Schulsystem unterscheidet sich von den Systemen der Mehrzahl anderer Länder vor allem durch die frühe Aufteilung der Schüler auf drei verschiedene, nach Leistung „sortierte“ Schulformen (Hauptschule, Realschule, Gymnasium nicht nach Leistungsstufen trennende Gesamtschulen gibt es verhältnismäßig selten). Dieses dreigliedrige Schulsystem wird, auch ausgelöst durch das nur durchschnittliche Abschneiden der deutschen Schüler im internationalen Vergleich (PISA-Studie), immer wieder kontrovers diskutiert. Dabei erweist es sich als äußerst schwierig, zu einer eindeutigen Empfehlung für oder gegen das dreigliederige System zu gelangen. Folgende Argument könnten in einer solchen Diskussion angesprochen werden: Pro dreigliedriges Schulsystem: Fischteich-Effekt: Dank der Aufteilung nach Leistung ist das fachbezogene Selbstkonzept (also die eigene Einschätzung darüber, wie gut man in einem Fach ist) beim Gymnasiasten und Hauptschülern sehr ähnlich. Vereinfacht ausgedrückt erleben sich Hauptschüler als ungefähr gleich kompetent wie Gymnasiasten. Das liegt daran, dass sie sich nicht mehr (wie in der Grundschule) mit der ganzen Bandbreite an Schülern vergleichen müssen, sondern nur mit Schülern, die ungefähr in ihrem Fähigkeitsbereich liegen (s. Aufgabe 1). Dieses Kompetenzerleben steigert die Motivation und kann Schulfrust verhindern - vor allem bei leistungsschwächeren Schülern. Untersuchungen haben gezeigt, dass leistungsstärkere Schüler sehr profitieren, wenn sie das Gymnasium besuchen: Vergleicht man Schüler mit ungefähr gleichen Leistungen in der Grundschule, die dann entweder aufs Gymnasium oder auf die Realschule gehen, stellt sich heraus, dass einige Jahre später diejenigen Schüler, die nach der Grundschule auf ein Gymnasium gewechselt haben, mehr Leistungszuwachs erzielt haben - sie haben also von ihrer Schulbildung mehr profitiert als diejenigen Schüler, die auf eine Realschule gewechselt haben. Contra dreigliedriges Schulsystem: Die Differenzierung findet in Deutschland in den meisten Bundesländern sehr früh (nach der 4. Klasse statt). Danach erweist es sich als sehr schwierig, zwischen den Schulformen zu wechseln (vor allem ein Wechsel „nach oben“, also auf eine höhere 56 Schulform, ist an sehr hohe Bedingungen geknüpft). Das Schulsystem ist also wenig durchlässig. Bedenkt man das Alter, in dem die Differenzierung stattfindet (10-12 Jahre), ergeben sich verschiedene Schwierigkeiten: In der Pubertät finden zahlreiche Umstellungen und Entwicklungen statt, die großen Einfluss z.B. auf das Arbeitsverhalten, die kognitive Entfaltung und die Motivation haben können. Eine Anpassung daran durch den Besuch einer nun besser zum individuellen Schüler passenden Schulform ist aber aus oben beschriebenen Gründen kaum mehr - bzw. nur noch in Richtung „niedrigere Schulform“ - möglich. Das Gleiche gilt für Migranten, die aufgrund von Sprachschwierigkeiten bis zum Zeitpunkt der Differenzierung ihre Leistungsfähigkeit noch nicht voll entfalten konnten- und später kaum mehr Gelegenheit dazu haben. Der oben beschriebene Vorteil für leistungsstärkere Schüler lässt sich umgekehrt als Nachteil für Leistungsschwächere interpretieren. In den Jahren nach der Differenzierung gehen die Leistungen von Hauptschülern und Gymnasiasten mehr und mehr auseinander („die Leistungsschere öffnet sich“) - dies könnte man sich als Grund für die großen Leistungsdifferenzen deutscher Schüler und die hohe Anzahl schlechter Schüler (s. PISA 2003) vorstellen. Aufgabe 3 1. Die Rolle, die Intelligenz für die Schulleistung spielt, ist von Beginn an nicht so groß, wie man vielleicht denken könnte. Daneben spielen Faktoren wie außerschulische Aktivitäten, Erziehung, Lern- und Arbeitshaltung, Motivation usw. eine große Rolle. Sicher kann man argumentieren, dass die meisten dieser Faktoren auch durch Intelligenz bestimmt werden- das stimmt zum Teil. Andererseits ist Intelligenz aber kein Garant dafür, dass Kinder motiviert sind, eine gute Arbeitshaltung haben oder von den Eltern gefördert werden- und somit auch keine Garantie für gute Schulleistungen. Andersherum können weniger intelligente Kinder mit einer guten Arbeitshaltung, hohem Interesse und viel Unterstützung von außen (z.B. durch Eltern) viel „ausgleichen“ und intelligentere Kinder so in vielen Fällen „überrunden“. So zeigt sich auch in verschiedenen Studien, dass Intelligenz im Laufe der Schuljahre eine immer kleinere Rolle bei der Schulleistung spielt, während die Bedeutung von Vorwissen wächst. Viele Mängel an Intelligenz können durch fundiertes Wissen ausgeglichen werden, während Intelligenz alleine dieses Wissen nie ersetzen kann (wenn intelligentere Kinder auch mehr Chancen haben, „verpasstes“ Wissen aufzuholen). 2. Es zeigt sich, dass unabhängig von der „angeborenen“ Intelligenz und von der ursprünglichen Leistung eines Kindes verschiedene Faktoren großen Einfluss auf die Schulleistung nehmen: So spielt es offenbar eine große Rolle, in welchem Bildungssystem und in welcher speziellen Klasse ein Kind „landet“ – bei welchem Lehrer, auf welcher Schule, in welchem Land, in welchem Klassenklima es also lernt. Allein die Faktoren des Bildungssystems und der Schulklasse scheinen großen Einfluss auf die Leistung von Schülern zu nehmen. Ähnlich sieht es in Bezug auf Schulformen aus: Die Leistung von Schülern steigt in sehr unterschiedlichem Ausmaß an, je nachdem, ob sie eine Haupt- oder Realschule oder ein Gymnasium besuchenauch wenn man von dem Faktor „Intelligenz“ absieht! Außerdem konnte in diesem Zusammenhang gezeigt werden, dass nicht nur die Intelligenz einen – natürlich an sich unbestreitbaren – Einfluss auf die Schulleistung hat, sondern umgekehrt auch die Schulleistung ihrerseits die Intelligenz beeinflusst, es sich also vielmehr um eine Wechselwirkung handelt. 57 Anlage-Umwelt: Asendorpf: Interaktion und Kovariation von Genom und Umwelt - Genom im Laufe des Lebens, bis auf wenige Mutationen, fast konstant genetische Aktivität und Umweltwirkungen stehen in ständiger Wechselwirkung = Transaktion (Wechselwirkung über die Zeit) Trennung schwierig, deshalb: welchen Einfluss haben genetische und Umweltunterschiede auf Persönlichkeitsunterschiede statistische Genom- Umwelt- Interaktion: beide beeinflussen sich Kovariation: Korrelationen zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und Umweltbedingungen können genetisch bedingt sein Wirkung von Genom und Umwelt auf die Entwicklung: - - - gesamte genetische Information = Genom, bestehend aus Genen, welche in verschiedenen Variante = Allelen auftreten können große Unterschiede in der individuellen Ausgestaltung (Übereinstimmung der Genome von Menschen und Affen aber 98%) Genaktivität variiert ständig (an- und abschalten: Chorea Huntington, Allel auf dem 4. Chromosom) Gentaktivität beeinflusst über biochemische Prozesse Entwicklung und Verhalten, kann Einfluss auf die Umwelt (Auswahl, Herstellen) nehmen- und umgekehrt wegen der Transaktion kann die Umwelt eines Menschen teilweise genetisch bedingt sein (Prädisposition, bestimmte Umwelten aufzusuchen) und die Genaktivität wird durch Umwelt und Verhalten beeinflusst (Phenylketonurie) Populationsgenetik: inwieweit stehen genetische und Umweltunterschiede in einer Population in Wechselwirkung mit Persönlichkeitsunterschieden Genom- Umwelt- Interaktion: - - - statistische Genom- Umwelt- Interaktion = Unterschiede im Genom wirken in Abhängigkeit von Unterschieden in der Umwelt auf Persönlichkeitsunterschiede (vice versa)- meist indirekte Schätzung in Adoptionsstudien Studie: 367 adoptierte Jugendliche, antisoziales Verhalten in Beziehung zum antisozialen Verhalten der Mutter und Problemen in der Adoptivfamilie Ergebnis: nur eine Kombination beider Faktoren sagt antisoziales Verhalten der Jugendlichen vorher Folgerung: genetische Risiken wirken sich nicht direkt aus, sondern erhöhen die Vulnerabilität durch belastende Umweltbedingungen neuere Forschung: spezifische Gene stehen mit spezifischen Umweltbedingungen in Wechselwirkung = neuseeländische Längsschnittstudie (500 Männer, 26 Jahre, Zusammenhang zwischen erfahrener Kindesmisshandlung – 3 bis 11 – und dem MAOA Gen auf dem x Chromosom und 4 Indikatoren für antisoziales Verhalten) Ergebnisse: Kindesmisshandlung erhöht das Risiko und zwar besonders bei einer niedrigen MAOA Konzentration (genetisch bedingt)- normales Allel schützt anscheinend vor langfristigen negativen Konsequenzen 58 - MAOA produziert das Enzym Monoaminoxidase A (reduziert eine exzessive Produktion von Dopamin, Noradrenalin, Serotonin unter starker Belastung) Tiermodell mit knock- out Mäusen – erhöhte Aggressivität auch bei depressiven Tendenzen (Allel des 5-HTT Gens für den Serotoninstoffwechsel) Caspi et al. Probleme bei der Replikation: polygenetische Determination, Wirkung der Gene hängt von den Umweltbedingungen ab Genom- Umwelt- Kovarianz: - - - - = bestimmte Genome finden sich gehäuft in bestimmten Umwelten (Intelligenz, Förderung durch die Eltern; Musikalität 1) passive GUK: nimmt mit zunehmendem ab (Trennung von der Familie) bedingt durch genetischen Einfluss- eher Geschwister, die auch musikalisch sind, führt zu musikalischer familiärer Umwelt 2) reaktive GUK: altersunabhängig- Reaktion der Umwelt auf die genetisch mitbedingten Persönlichkeitsanteile (Eltern kaufen Klavier) 3) aktive GUK: nimmt mit Alter zu, Einfluss von Genom auf die Umwelt, da die Träger die passende Umwelt auswählen oder gestalten achtung: keine Mechanismen zur Persönlichkeits- Umwelt- Kovarianz Forschung wirft aber neues Licht auf diese Frage: Sozialisationsforschung (Erziehungsstil der Mutter, Persönlichkeit des Kindes; interindividuelle Unterschiede (retrospektiv) konnten häufig durch genetische Unterschiede erklärt werden auch biografische Ereignisse können genetisch mitbedingt sein: durch vermittelnde Persönlichkeitsmerkmale (z.B. bei Autounfällen) Erklärung interindividueller Unterschiede zwischen Familienformen auch zu 80% genetisch bedingt + z.B. Bevorzugung der leiblichen Kinder Cleveland: genetische Selbstselektion in Familientypen (Halbgeschwister entstehen eher durch Scheidung als durch Tod und diese ist genetisch mitbestimmt- Neurotizismus man sollte aber immer nur von korrelativen und nicht von einseitigen kausalen Zusammenhängen ausgehen Zusammenfassung Geary - - Shepard: individuelle kognitive Fähigkeiten formen die Ausbreitung der Gene wie auch die Gene das Individuum formen und kulturelle Faktoren beeinflussen die Wahrnehmung (Farbkonstanz verschwindet unter dem Einfluss von Straßenlampen) unabhängig vom evolutionären Selektionsdruck biologische und kulturelle Einflüsse auf die Kognition von Kindern sollten betrachtet werden evolutionsbasiertes Modell: Mechanismen der biologisch basierten und kulturell vermittelten Fähigkeiten müssen identifiziert werden, um die genaue Wirkung zu verstehen biologisch primäre und sekundäre Fähigkeiten: primär = durch natürliche oder sexuelle Selektion 59 - - - - - - - - - sekundär = Hinzuwahl von primären Fähigkeiten für andere als evolutionär basierte Funktionen- Entwicklung nur im kulturellen Kontext Unterscheidung zu Tieren: Hinzunahme verschiedener pA für Aufgaben unabhängig von den ursprünglichen evolutionsbasierten Funktionen beim Menschen verbinden sich Biologie und Kultur- durch Kultur können dem Kind also kognitive Fähigkeiten anerzogen werden, die nichts mit Evolutionsdruck zutun haben (durch das hochspezialisierte neurokognitive System primäre Fähigkeitn sollten über alle Kulturen hinweg entdeckt werden, sekundäre nur kulturspezifisch (sie sollten in direktem Zusammenhang mit dem Ausmaß formaler Instruktion stehen, Schule) am Beispiel der Sprache: überall, Lesen aber nicht = sekundär- beinhaltet auch primäre Fähigkeiten, wie Sprache Voraussage der Leichtigkeit des Lesenlernens durch die Genauigkeit des phonologischen Systems im Kindergarten Mathematik: kartenähnliche Repräsentationen bei tieren zur Orientierung- die zugrunde liegenden kognitiven Systeme sind sehr sensibel für die Merkmale der Euklidschen Vorstellung eines 3dimensionalesn physikalischen Universums (Ratten, Bienen, Kind mit angeborener Blindheit war auch in der Lage, solche Repräsentationen aufzubauen = implizites Verständnis der Geometrie- reflektiert die Evolution des Wahrnehmunssystems, explizites Wissen ist Formalisierung dieses Wissens) implizit überall vorhanden, explizit aber nur durch formale Anleitung (Schule) Unterschiede in der Mathefähigkeiten können also auf ein unterschiedliches Lehrangebot zurückzuführen sein = viele kognitive Fähigkeiten sind universell, andere entstehen nur in spezifischen kulturellen Kontexten Entwicklungskontexte und Mechanismen: primär und sekundär bedürfen beide einem gewissen Maß an Erfahrung der Erwerb biologischer pkF: wahrscheinlich, dass viele pkF von einem domänspezifischen kognitiven System unterstützt werden, die damit verbundenen Informationsverarbeitungsprozesse beinhalten implizites Wissen über die Domäne eine begrenzte Menge von Infos wird vom Wahrnehmungssystem automatisch aus der Umwelt extrahiert skelettartige Prinzipien= Eigenschaften des kognitiven System als Basis des Erwerbs bpkF + Motivation (enthält affektive Komponente), um an Aktivitäten teilzunehmen, die diese Prinzipien herausarbeiten eine wichtige Aktivität ist das Spiel- die Funktion scheint der Erwerb erwachsenengleicher Fähigkeiten zu sein („selbstaktivierte Übung“- Übung von sozialen Rollen- manche Arten universell, andere kulturspezifisch) scheint auch mit Mathematikfähigkeiten in Zusammenhang zu stehen (Kinder spielen numerische Spiele- skelettartike Prinzipien (assoziiert mit bpkF) werden konkretisiert es gibt aber auch sekundäre Fähigkeiten, die nicht in allen Kulturen erlernt werden der Erwerb biologischer skF: scheint keine biologischen Vorteile beim Erwerb zu haben, darum ist die Aneignung generell langsam und aufwändig und findet nur unter formaler Anleitung statt (Expertiseerwerb durch anhaltende Übung) Lesen, Schreiben und Arithmetik durch die Schule (je komplexer ein System, desto mehr 60 - - - - - - - Ausbildung ist notwendig) die bskF treten also nur in hochentwickelten, tenchnologisierten Kulturen auf Schlussfolgerung: kulturelle Unterschiede in diesen Fähigkeiten beruhen also eher nicht auf unterschiedlicher Intelligenz sondern auf unterschiedlichen Schwerpunkten in der Schule + der Erwerb sollte unabhängig vom Erwerb der primären Fähigkeiten sein (keine Unterschiede Asien- Europa in primären Mathefähigkeiten aber große Differenzen im Bezug auf sekundäre, Asien im Vorteil) + Motivation ist begründet durch die Ansprüche der Gesellschaft und nicht durch angeborene Interessen (Unterschied zwischen primär und sekundär) aber: der Inhalt der sekundären Aktivitäten (Lesen, Videospiele) könnte evolutionär relevante Themen reflektieren, die eine Teilnahme motivieren intellektuelle Neugierde ist eine Basisdimension der menschlichen Persönlichkeit generelle Einflüsse auf die kognitive Entwicklung: es gibt kognitive Faktore, die den Erwerb von sowohl primären als auch sekundären Fähigkeiten beeinflussen: zB die Zielstruktur einer Aktivität- je mehr Wissen über das Zeil, desto eher werden erwachsenenähnliche Problemlösestrategien angewandt Evolution und Mathematik: biologische primäre mathematische Fähigkeiten: Anzahl weniger Items ohne Zählen erkennen, Verständnis einer Rangordnung, präverbales Zählen- in verschiedenen Kulturen und in nichtmenschlichen Primaten numerosity: neuronales Korrelat im parietal- okzipitalen Kortex einfache arithmetische Fähigkeiten scheinen qualitativ ähnlich zwischen Säuglingen und Schimpanse zu sein numerische und arithmetische Fähigkeiten sind primär und häufen sich an (Gedächtnis für Zahlen, Kenntnnis von Zahlen etc. zusammen = numerischer Fertigkeitsfaktor) dieser Faktor wurde immer wieder identifiziert (Thurstone, Spearman) biologisch sekundäre mathematische Fähigkeiten: Zählen und Nummern, Arithmetik- von Eltern angeleitet, oder durch Schule mathematisches Problemlösen / mathematisches Denken: wichtig, da nach Möglichkeiten zur Verbesserung gesucht wird mathematisches denken wurde aber nur in Gruppen gefunden, die schon viele Mathestunden hinter sich hatten; wird nur zusammen mit langanhaltender Instruktion erworben; es fällt vielen schwer Frühreife in Mathe ging mit außerordentlichen primären Fähigkeiten einher (Gedächtnis, räumliche) die dann zur Hilfe genommen werden können, um sekundäre Fähigkeiten zu entwickeln für die meisten muss aber auch das unterrichtet werden, weil kein offensichtlicher Zusammenhang zu Textaufgaben besteht mathematische Instruktion: schlecht ausgebildete amreikanische Kinder; ihr quantitatives Wissen bestimmt aber ihr späteres Einkommen die akademischen Fähigkeiten einer Arbeitskraft beeinflussen nicht nur das Wohlergehen des Einzelnen sondern haben breitere soziale Auswirkungen Kosten für die Wirtschaft wichtig, diese Fähigkeiten zu verbessern evolutionäre Philosophie und Konstruktivismus deren Argumentation: 2 Hernagehensweisen zur Erforschung der Bildung: mechanistisch und organismisch 61 - - - - - - - mechanistisch: traditionelle Lerntheorie, Informationsverarbeitungsansatz- der Lernende empfängt passiv Infos, führt zu relfexartigen Veränderungen im geizeigten Verhalten des Kindes (richtig gelöste Aufgaben)- Veränderungen zB auch in der mentalen Repräsentation treten aber ohne das konzeptuelle Verständnis des Materials auf- aber negativ gesehen: Automatisierung, Auswendiglernen etc organismisch: wird vor allem an der Weltanschauung von Piaget und Vygotsky veranschaulicht = Kinder sind aktive Lerner und müssen ihr mathematisches Wissen selbst konstruieren mathematisches Lernen ist also ein soziales Unternehmen (Zone einer potentiellen Konstruktion eines spetifischen mathematischen Konzepts) Uneinigkeit liefert den Anschub zur Veränderung oder Akkomodation der eigenen Konzepte, das Kind nähert sich dem Wissen der Gemeinschaft an Problem: der konstruktivistische Ansatz unterscheidet nicht zwischen primär und sekundär- behandelt alle Mathematik als eine biologisch primäre Domäne = bei angemessenem sozialen Umfeld können Kinder Wissen in jedem Bereich der Mathematik selbst konstruieren (eher theoretisch als empirisch) Problem: in Amerika große Freiheit, angenehmen Tätigkeiten nachzugehen, Mathe aber nicht von Natur aus interessant der Erwerb und Erhalt von sekundären Fähigkeiten benötigt aber auf jeden Fall langandauernde Übung- die Kulturellen Werte, die Schüler dabei unterstützen, sind sehr wichtig (da eben nicht von Natur aus angenehm) erzieherische Implikationen: prozedurale und konzeptuelle Fähigkeiten notwendig konzeptuelles Wissen: grundlegendes Verständnis, was überhaupt erreicht werden kann (skelettartige Prinzipien) = ein Item kann nur einmal gezählt werden prozedurale Fähigkeit: auf jedes Objekt zeigen bei primär sind die konzeptuellen Fähigkeiten eher implizit, bei sekundär schon zugänglicher (zb in Tests) häufig wird aber nur konzeptuelles Wissen gelehrt; prozedurale Fähigkeiten benötigen Übung über eine Breite von Aufgaben, bei denen eine bestimmte Prozedur angewendet werden könnte, es muss automatisiert werden um den Aufwand zu minimieren konzeptuelles Wissen ermöglicht es dem Kind, Ähnlichkeiten zwischen Aufgaben zu erkennen und die Grundprinzipien zu verstehen Möglichkeite: Schüler nach so vielen Problemlösewegen zu fragen, wie möglich; oder Aufgaben im bekannten Kontext zu präsentieren Zusammenfassung: die Prinzipien der evolutionären Selektion kann einen theoretischen Rahmen für Modelle der menschlichen Kognition und Entwicklung bieten deutlichere Unterscheidung zwischen biologischen und kulturellen Einflüssen Wichtigkeit der Schule, Motivation muss von der Gesellschaft kommen Zusammenfassung Anlage- Umwelt O+M - - kontroverse Frage, ob den Erbanlagen oder den individuell erlebten Umwelteinflüssen bei der Entwicklung des Erscheinungsbildes mehr Gewicht zugemessen werden sollte nur Genom: eugenische Maßnahmen 62 - - - - - - - nur Umwelt: Bildungsmaßnahmen etc. heute eher die Frage, welche interindivuduellen Unterschiede in beidem zur Herausprägung phänotypischer Unterschiede führen- dies ist nur spezifisch für einzelne Merkmale zu beantworten es ist eine Interaktion zwischen Individuen und ihrer Umwelt anzunehmen (unterschiedlicher Einfluss der Umwelt je nach Genom oder bereits entwickeltem Phänotyp, U. wird unterschiedlich bewertet und wahrgenommen: Technikmuseum) Konzept der spezies- normalen Umwelt: dass Kultur gelernt werden kann, hat sich als Fähigkeit in der Evolution herausgebildet Verhaltensgenetik unterschiedet Entwicklungsereignisse, die normal sind für die Spezies und die normal sind für eine Kultur das was gelernt ist, ist phänotypisch unterschiedlich, aber im jeweiligen Kontext äquivalent Kernsatz der Verhaltensgenetik: alle normalen Kinder erwerben das für die jeweilige Kultur normale Repertoire spezies- normal umfasst also einen breiten Bereich die unterschiedlichen Ausprägungen des Phänotyps unterscheiden zwischen Erfolg und Misserfolg in einer Kultur Nachweis der Bedeutung von Erbanlagen: Allele sind in 23 Chromosomenpaaren aufgereit, Orte= Gene chromosomale Besonderheiten: a) unproblematischer Nachweis der Vererbung wenn ein enger Zusammenhang zwischen phänotypischem Merkmal und chromosomaler Auffälligkeit gegeben ist (XY,XX, Trisomie 21) b) oder wenn ein Mermal oder eine Krankheit in aufeinanderfolgenden Generationen einem Erbgangsmodell entspricht (leicht bei diskreten Merkmalen. PKU = Eiweißstoffwechselstörung; sonst aber eher polygenetische Vererbung = Intelligenz, Aggressivität oder Modifikation durch den Einfluss anderer Gene – dann kann der Anlageeinfluss nicht klar nachgewiesen werden, in diesem Fall... ) 1) Reinzüchtung und Wahl ähnlicher Partner wenn Individuen mit extremen Ausprägungen jeweils ähnliche Partner wählenphänotypische Varianz wird geringer: Erbeinfluss nachgewiesen (Wahl nach Intelligenz- extreme Ausprägungen werden häufiger) 2) populationsgenetische Analysen es wird versucht, in der Population gegebene phänotypische Unterschiede auf Anlage- oder Umweltunterschiede zurückzuführen, Einzelfall kann keine Aufklärung leisten, in der Population gibt es Unterschiede im Phänotyp, unterschiedliche Anlageähnlichkeit und unterschiedliche Umweltähnlichkeit die Auflösung der Konfundierung zwischen den Ähnlichkeiten ist das methodische Problem der Populationsgenetik Untersuchungen in biologischen Familien nicht aussagekräftig- darum Adoptions- und Zwillingsstudien Zwillingsuntersuchungen: EZ sind anlagemäßig identisch, phänotypische Unterschiede müssen auf Umweltfaktoren zurückgeführt werden bei allen anderen Verwandtschaftsgraden ist beides möglich 63 - - - - - - ZZ sind sich genetisch genauso ähnlich wie Geschwister teilen aber auf Grund des gleichen Alters mehr an Kontext, Ähnlichkeitsdifferenzen zwischen ZZ und BG sind also auf größere Umweltdifferenzen bei den BG zurückzuführen (aber: geringere Ä. bei ZZ, auf Grund größerem Bedürfnis nach Individualität) bei gleichem Verwandtschaftsgrad: je ähnlicher, desto länger sie zusammengelebt haben aber: Leben in der gleichen Familie bedeuten nicht den identischen Kontext EZ ähnlicher als ZZ, aber auch Umwelt ähnlicher getrennt aufwachsende Zwillinge: aussagekräftiger, Trennung der EZ und ZZ in der frühen Kindheit;; Problem: korrelierte Umwelten durch selektive Platzierung Forschungsbeispiel der Populationsgenetik: Intelligenz größere Anlageähnlichkeit geht mit höherer IQ Ähnlichkeit einher, auch bei Aufwachsen in verschiedenen Umwelten (Indizien dafür, dass ein großer Teil der Varianz durch Unterschiede im Erbgut erklärt werden kann. EZ: a) gemeinsam: .86 b) getrennt: .75 ZZ: a) gemeinsam: .39 b) getrennt: .35 BG: a) gemeinsam: .54 b) getrennt: .47 Kinder: nicht verwandt: -.02 Maß für die Erblichkeit: E2 ist der Anteil der Gesamtvarianz eines phänotypischen Merkmals, der auf Anlageunterschiede zurückzuführen ist (vor allem Korrelation zwischen EZ und ZZ in derselben Umwelt: E2 = (rEZ-rZZ):(1-rZZ)- bei Intelligenz = .77) Untersuchungen in Adoptivfamilien: Überzufällige Ähnlichkeiten zwischen AE und AK durch 2 Quellen: 1) selektive Platzierung 2) Sozialisation Überzufällige Ähnlichkeit zwischen BE und den frühzeitig adoptierten BK kann nur (bei Ausschluss selektiver Platzierung) durch Anlageähnlichkeiten kommen Veränderung des Erblichkeitskoeffizienten mit dem Lebensalter: nicht invariant, sondern nehmen mit dem Alter zu: genetische Unterschiede und Ähnlichkeiten manifestieren sich nach der Vorschulperiode immer deutlicherUmwelteinflüsse haben in den ersten Lebensjahren zwar Effekte, aber meist keine überdauernden Plomin & Thopmson: Erblichkeitskoeffizient steigt von 20% in der frühen Kindheit auf bis zu 60% in der Adoleszenz 3 Arten der Passung zwischen Anlage und Umwelt: Plomins Typologie der Anlage- Umwelt- Korrelation = passiv, evokativ (reaktiv) und akktiv 1) passive Genom- Umwelt- Passung = Eltern und Kinder teilen einen Teil ihres Genoms, der führt zu einer bestimmten Gestaltung des Lebens durch die Eltern (Kultur, Musik, Lesen, beruflicher Status), das macht einen Teil der Lebensumwelt der Kinder aus- entspricht dieses Angebot dem Genom des Kindes liegt eine passive Passung vor (keine Entzugsmöglichkeiten) 2) evokative / reaktive Passung = das Kind erhält Angebote und Anforderungen, ausgelöst durch sein eigenes Genom (Lernangebote, Sport, Zuwendung) 3) aktive Passung = Kind wählt, passend zu seinem Genom, selbst Umweltangebote aus, beeinflusst seine Umwelt und gestaltet diese aktiv mit (soziale Kontakte, Beruf) 64 - - - - - - - - - pädagogische Förderung: im günstigsten Fall entsprechen sich Genom und Umweltangebot (alle drei Typen fallen dann zusammen); Problem bei deprivierendem familiärem Umfeld der vorherrschende Passungstyp ändert sich mit dem Lebensalter: passiv nimmt ab, aktiv nimmt zu, evokativ bleibt gleich = Grund für die Veränderung des Erblichkeitskoeffizienten passive Kovariation ist in biologischen Familien wahrscheinlicher je bedeutender evokativ und aktiv werden, desto mehr setzt sich die Anlageähnlichkeit durch aktive Passung erfordert Wahlmöglichkeiten: auch getrennt aufgewachsene EZ werden einander sehr ähnlich, weil aus einem breiten Angebot das genomtypische Ausgewählt wird Interpretation populationsgenetischer Analysen: GEDANKENEXPERIMENT = für alle sei die ideale Umwelt realisiertIntelligenzunterschiede können nicht mehr auf Umweltunterschiede zurückgeführt werden- bedeutet aber nicht, dass Umwelt unwichtig ist, nur wenn sehr viel Umweltvarianz besteht, aber keine Korrelation mit phänotypischer Intelligenz besteht kann die Umwelt ohne Bedeutung sein; umgekehrt: Reinzüchtung, Unterschiede basieren auf Umwelt, Gene aber nicht überflüssig = Begrenzung der Generalisierbarkeit- es wird nur das Verhältnis in einer Population beschrieben in der nur bestimmte Anlage- und Umweltunterschiede realisiert sind es zeigt sich aber, dass ein größerer Teil interinidivueller phän. Unterschiede auf genetische Unterschiede zurückzuführen ist (Erblichkeit der Intelligenz bei mindestens .50) Varianzanteile sind keine Merkmalsanteile: kein Rückschluss auf Anteile der Erbeinflüsse bei einzelnen PersonenErblichkeit beschreibt nur den relativen Einfluss der Anlagen (eine einzelne Messung hat keine Varianz) Ein hoher Erblichkeitskoeffizient bedeutet nicht Determination durch Anlagen: sagt über die Möglichkeiten der Umweltwirkung erstmal nichts aus, erst wenn trotz großer Umweltveränderungen der Erblichkeitsk. gleich bleibt, kann man sagen, dass sich ein Merkmal relativ unabhängig von der realisierten Umwelt entwickelt Förderung: kurzfristig- Erfolge nicht dauerhaft; langfristig = Adoption von Kindern aus sozial schwachen Familien in Mittelschichtsfamilien (unkritischer Milieuoptimismus- nur Umwelt = Watson) Die richtigen Fragen stellen: Anne Anastasi: es gibt viele Wege des zusammenwirkens, es ist sinnvoller, nach diesen zu Fragen als nach Einflussanteilen (Umwelt fördernd, behindernd, kompensierend auf genotypische Potentiale) einige Auswirkungen von Anlagen werden erst durch die Bewertung der Umwelt produziert (Schönheit, Selbstwert) Weitere Modellvorstellungen für die Erklärung von Entwicklung: - interne oder externe Bedingungen- additiv oder interaktiv - Reifung: - gengesteuerte Entfaltung biologischer Strukturen und Funktionen, setzt innere und äußere Entwicklungskontexte voraus - auf R. zurückzuführen, wenn universell und ohne Lernen 65 - - - - - - - - in der EP eher negativ- daher Methoden des Nachweises durch Ausschaltung oder Fehlschlagen von Lernmöglichkeiten (der Rest ist dann Reifung) fehlende Erfahrungsmöglichkeiten: tierversuch, Fälle extremer Deprivation oder Isolation (Wolfskinder, das Mädchen Genie war 13 Jahre isoliert) speifische Erdahrungsdeprivationen häufig (Blindheit) Reifestand: ein bestimmter Entwicklungsstand muss gegeben sein, damit Erfahrung auf fruchtbaren Boden fallen kann (Kinder können aber häufig schon viel früher Lesen lernen, 3-4jährige) sensible Perioden: Konzept aus der Embryologie, Entwicklungsabschnitte, in denen bestimmte Organe und Funktionen ausgebildet werden (pathogene Einflüsse haben so die maximal schlechte Auswirkung) Konrad Lorenz: Prägung = verhaltensmäßiges Analogon Entwicklungsabschnitte, in denen spezifische Erfahrungen maximale positive oder negative Wirkung haben) = Perioden erhöhter Plastizität unter dem Einfluss von Bedingungen Voraussetzungen für empirischen Beweis der Existenz: Messbarkeit der Einflussfaktoren, vergleichbare Untersuchungsgruppen, objektive Erfassung der Wirkung, langfristige Beobachtung der Wirkung, Schwierigkeit der Änderung entstandener Dispositionen Beginn und Ende: definiert durch den Erwerb von Erfahrungsvoraussetzungen, Kindheit als besonders sensible Periode (fehlende Unterscheidung von realität und Irrealem) Stabilität von Ängsten durch Motivation durch Vermeidung = selbststabilisierende Funktion (Vertrauen und Misstrauen in der frühen Kindheit) sensible Periode der Intelligenzentwicklung: Bewegung der kompensatorischen Vorschulerziehung, Ausgleich anregungsschwacher EntwicklungsumweltenSesamstraße Stabilisation der Intelligenzunterschiede in der Vorschulperiode aber: Kinder aus höheren Schichten haben generelle eine Aufwärtstendenz (Zweifel an der Unveränderlichkeit des IQs nach Blooms These) Kompensatorische Vorschulprogramme nur kurzfristig erfolgreich, Leistungsgewinne nicht stabil Suche nach Äquivalente zum Genom = personale Entwicklungsbedingungen, die das eigenständige Lernen fördern trotzdem: nicht nach hinten verschieben- kumulative Defizite, Chancengleichheit wahren Aufgaben: 66 Verwandtschaftsgrad Gemeinsam aufgewachsen Getrennt aufgewachsen Eineiige Zwillinge .86 (190) .75 (158) Zweieiige Zwillinge .39 (178) .35 (112) Geschwister .54 (271) .47 (28) Nicht verwandt -.02 (108) --- Welche Korrelationsunterschiede weisen im Sinne der Populationsgenetik auf Anlageeinfluss und welche auf Umwelteinfluss hin? Erklären Sie den Unterschied zwischen Kovariation und Wechselwirkung zwischen Anlage und Umwelt. Angenommen eine Bekannte, die nicht Psychologie studiert (hat), stellt Ihnen die Frage, ob man in der Psychologie weiß, zu welchem Anteil Homosexualität angeboren ist und zu welchen Anteil die Erziehung bzw. andere Umweltfaktoren dafür verantwortlich sind. Was würden sie antworten? Musterlösung zur Vorlesung Anlage-Umwelt Von Petra Buys Aufgabe 1 Nach den Annahmen der Populationsgenetik gibt es einige wesentliche Faktoren, die auf Anlage- bzw. Umwelteinflüsse hinweisen: 1. Verwandtheitsgrade stellen Abstufungen der genetischen Gemeinsamkeiten von Personen dar. Ähnlichkeiten in Merkmalsausprägungen sollten bei größerer genetischer Übereinstimmung bedeutender sein. An diesen unterschiedlichen Ähnlichkeiten lässt sich der Einfluss der Anlage abschätzen. In der dargestellten Tabelle betrifft dies insbesondere die Unterschiede in Korrelationen zwischen zusammen aufgewachsenen EZ und ZZ: Da die Zwillingspaare jeweils gleichaltrig sind, wird von einem hohen geteilten Umwelteinfluss ausgegangen- Korrelationsunterschiede (r=.86 vs. r=.39) wären danach allein auf unterschiedliche genetische Gemeinsamkeiten 67 (100% vs. 50%) zurückzuführen. Ferner ist von Interesse, dass die Merkmalsausprägungen von Geschwistern höher korrelieren (.54) als die von nicht verwandten Kindern (-.02); auch dies weist auf einen genetischen Einfluss hin (geteilte Umwelten haben alle Paare, geteilte Gene nur Geschwister). 2. Bei gleicher Ausprägung genetischer Ähnlichkeiten sollten bei Merkmalsausprägungen umso mehr übereinstimmen, je länger die betreffenden Personen zusammen gelebt haben; je größer also das Ausmaß der geteilten Umgebung ist. Aus solchen Korrelationen lässt sich der Umwelteinfluss ersehen. Hier sind vor allem die unterschiedlichen Korrelationen zwischen gemeinsam und getrennt aufgewachsenen Paaren von Bedeutung: Die durchweg höheren Korrelationen zwischen Geschwistern mit geteilter Umwelt weisen auf Umwelteinflüsse auf den IQ hin. Aufgabe 2 Kovarianz beschreibt statistisch gesehen einen linearen Zusammenhang zwischen zwei Variablen (hohe Y-Werte gehen mit hohen X-Werten einher). In der Anlage-UmweltForschung beschreibt Kovarianz ebendieses: Bedingt durch verschiedene Faktoren treten bestimmte Gene gehäuft in bestimmten Umwelten auf; d.h. genetische Veranlagung und umweltbedingte Förderung oder Unterdrückung von Merkmalsausprägungen hängen weit überzufällig zusammen. Dies wird bedingt durch die aktive Selektion von Umwelten, die zur Anlage passen (aktive Kovariation), Reaktionen der Umwelt auf die Begabungen eines Menschen (reaktive Kovariation) sowie die besonders bei Kindern auftretende passive Kovariantion, die durch die genetischen Überschneidungen innerhalb von Familien zustande kommen (Umwelt der Eltern fördert wahrscheinlich Begabungen des Kindes, da dessen Talente denen der Eltern ähneln). Interaktion bezieht sich auf eine Wechselwirkung zwischen zwei (oder mehr) Faktoren, deren Einfluss nur dann zum Tragen kommt, wenn z.B. beide Faktoren gleichzeitig auftreten. Auf die anstehende Frage bezogen bedeutet dies, dass genetische Faktoren beispielsweise die Vulnerabilität bzw. die Ansprechbarkeit für bestimmte Umweltfaktoren erhöhen oder senken können; es reichen jedoch weder nur die Anlage noch nur die Situation aus, um eine Merkmalsausprägung herbeizuführen- dies geschieht durch die Interaktion von beiden. Sowohl Kovarianz als auch Interaktion von Anlage- und Umweltfaktoren tragen dazu bei, dass die genaue Stärke des Einflusses beider Elemente nur sehr schwer trennbar ist. Aufgabe 3 Anlage und Umwelt beeinflussen sich in hohem Maße gegenseitig. So ist es wahrscheinlich, dass sich eine Person Umweltgegebenheiten sucht, die seinen Anlagen entsprechen und diese fördern, ebenso wie seine soziale Umwelt auf wahrgenommene Fähigkeiten reagieren und diese somit ebenfalls unterstützen (oder natürlich auch bremsen) kann (s. Aufgabe 2). So kommt es zustande, dass bestimmte Anlagen besonders häufig in bestimmten Umwelten auftreten. Man sieht also schnell, dass es unmöglich ist, aus einem Merkmal wie Homosexualität die Anteile von Anlage und Erziehung „herauszusortieren“. Stellte man zum Beispiel (hypothetisch!) fest, dass Homosexuelle sich meistens besonders stark mit dem andersgeschlechtlichen Elternteil identifizieren, lässt sich daraus nicht ableiten, ob dies ein Umweltfaktor ist, der zur Entwicklung der Homosexualität beiträgt, oder aber eine frühe Auswirkung einer angeborenen (Neigung zur) Homosexualität. Hinzu kommt der Faktor der Interaktion: Häufig treten auch genetisch angelegte Merkmale nur dann auf, wenn sie mit entsprechenden Umweltfaktoren zusammenfallen. Selbst wenn eine Neigung zur Homosexualität angeboren wäre ist es also möglich, dass diese nur bei ganz 68 bestimmten Umwelteinflüssen zum Vorschein kommen würde. Auch deshalb können Anlageund Umwelteinflüsse hier kaum getrennt werden – auch bei Nicht-homosexuellen Personen könnten dann die genetischen oder erzieherischen Voraussetzungen für Homosexualität gegeben sein- nur eben nicht beide. Es zeigt sich also, dass nicht geklärt werden kann, zu wie viel Prozent Vererbung und Erziehung für Homosexualität verantwortlich sind. Gemessen werden kann höchstens, welchen Einfluss verschiedene genetische Ausstattungen und Umwelten auf die Unterschiede zwischen verschiedenen Menschen in einem Merkmal haben. Dies ist zum Beispiel bei dem Merkmal „Intelligenz“ vielfach untersucht worden. Bei der Frage nach Homosexualität erweist sich das allerdings immer noch als sehr schwierig, da es sich dabei um kein Kontinuum handelt (nominalskaliert!). Wenn nur zwei mögliche Merkmalsausprägungen (ja/nein) vorhanden sind, sind Zusammenhänge zu Variablen wie Anlage und Umwelt kaum festzustellen. Identität, Miller: Erikson 69 Zusammenfassung Miller: Erikson und Freud- IDENTITÄT UND SELBSTKONZEPT - - Neo- Freudianer: Hartmann- er betonte konfliktfreie Ich Funktionen, wie Wahrnehmung, Gedächtnis und logisches Denken (das Ich integriert und organisiert hier die Persönlichkeit- bei Freud eher Verteidigung und Hemmung) Hartmann: Ich ist teilweise vom Es und dessen Trieben unabhängig White: Ich- Befriedigung durch Exploration und Kompetenzen bei der Aufgabenbewältigung Psychoanalyse kann also den Normalbereich sowie den der Pathologien angehen viele Neo- Freudianer wichen auch von Freuds biologischem Ansatz ab und bezogen auch den Einfluss von Gesellschaft und Kultur mit ein – vor allem durch Erik Erikson Biografie: - 1902 in Deutschland: sollte Kinder von Amerikanern unterrichten, die sich in Wien mit Freuds Ansatz beschäftigten, führte zum Eintritt in das Wiener Institut für Psychoanalyse - unterrichtet von Anna Freud (lernte auch von Sigmund Freud, Hartmann etc.) - 1933 in die USA ausgewandert - Harvard Medical School, Kinderanalytiker - gestorben 1994, 91 Jahre, Veröffentlichungen: Child and Society, Identity: Youth and Crisis - seine Interessen: Soldaten des 2. WK, Spiel bei normalen und „gestörten“ Kindern, Konversation bei Erwachsenen in Identitätskrisen, Rassenkonflikte, Generationenlücke, Jugendkriminalität, sich verändernde sexuelle Rollen generelle Orientierung der Theorie: - - - - - akzeptierte die generellen Begriffe Freuds: psychologische Strukturen, das Bewusste/ das Unbewusste, Triebe, psychosexuelle Stufen, Kontinuum zwischen normal und krank Erweiterung: 8 psychosoziale Stufen über die Lebensspanne, Studium der Entwicklung der Identität, Entwicklung neuer Methoden psychosoziale Stufen: körperliche Reifung hat persönliche und soziale Auswirkungen- es entwickeln sich neue Fähigkeiten, die dem Kind neue Möglichkeiten eröffnen, aber gleichzeitig wachsen auch die Anforderungen der Gesellschaft es gibt eine Passung zwischen dem Kind und seiner Kultur: Begegnung mit den neuen Bedürfnissen des Kindes durch Schule, soziale Organisationen, ein Set von Werten „Zahnrad“: Kind braucht Betreuung, Eltern wollen betreuen die Kultur hat sich über viele Generationen an das Kind angepasst und nun passt sich das Kind an die Kultur an kulturelle Relativität der psychosozialen Entwicklung: 1) alle Kinder durchlaufen zwar die gleiche Sequenz, aber jede Kultur hat ihren idiosynkratischen Weg, das Verhalten des Kindes in jeder Stufe zu dirigieren und zu verstärken (Sioux: Mädchen scheu, Jungen Jäger) 2) innerhalb der Kultur im Laufe ihrer Veränderung (Industrialisierung, Depression, Immigration) 70 psychosoziale Entwicklung findet im Sinne der epigenetischen Prinzipen statt: alles was sich entwickelt, hat einen Grundriss, aus dem dann einzelne Teile erwachsenen, jeder zu seiner Zeit (Fötus- Metapher = die Persönlichkeit wird immer differenzierter und hierarchisch organisiert und von einer spezifischen Umwelt geformt - das Kind besitzt angeborene Gesetze zur Entwicklung- Reifung und die Erwartungen der Gesellschaft kreieren 8 Krisen (jede ist am deutlichsten in einer Stufe, verteilt sich aber im Großen und Ganzen über den gesamten Verlauf der Entwicklung - jede Krise wird durch mögliche positive und negative Ergebnisse beschrieben (Autonomie vs. Scham und Zweifel)- idealer Weise sollten die positiven Aspekte dominieren - wenn sie nicht überwunden werden, kämpft die Person die frühen Kämpfe im weiteren Verlauf des Lebens (Identitätskrise auch noch im Erwachsenenalter, Erikson: es ist aber nie zu spät) - Eriksons Theorie liegt zwischen der von Piaget (sukzessive Stufen) und Freud (lockere Integration)- jede Stufe baut auf der vorausgegangenen auf und beeinflusst die Form der folgenden - Erikson/ Freud: - 1) Vertrauen vs. Misstrauen / orale Phase - 2) Autonomie vs. Scham und Zweifel / anale Phase - 3) Initiative vs. Schuld / infantil genital (ödipale Phase) - 4) Werksinn vs. Minderwertigkeit / Latenzphase - 5) Identität vs. Identitätsdiffusion / Pubertät - 6) Intimität vs. Isolation / genitale Phase - 7) Generativität vs. Selbstabsorption - 8) Integrität vs. Verzweiflung - Betonung auf Identität: - positiverer Ansatz als der von Freud - das Hauptthema des Lebens ist die Suche nach Identität- eine Aufrechterhaltung eines inneren Zusammenhanges mit den Idealen und der Identität einer Gruppe = Akzeptanz und Verständnis des Selbst und der eigenen Gesellschaft (Erikson selbst Immigrant, Probleme von Minderheiten bei der Formung einer Identität) - die Wahrnehmung der Identität sollte auf jeder Stufe erneut bestätigt werden (ähnlich der Veränderungen von Konzepten bei Piaget) - Verlust der Identität, beobachtet im 2. WK = Identitätskrise (taucht in jedem Leben auf) - Erweiterung der Psychoanalytischen Methodik: - Beitrag zu 3 Methoden. 1) direkte Beobachtung von Kindern 2) Cross- kulturelle Vergleiche 3) Psychobiografie = Analyse der psychosozialen Entwicklung berühmter Persönlichkeiten (Ghandi, Hitler, Maxim Gorki) (one must study man in action) - Erikson fasziniert davon, wie die Lösungen der universellen Stufen von Kultur zu Kultur variieren Beschreibung der Stufen: - lebenslange Belange des Ichs erreichen in der jeweiligen Stufe ihren Höhepunkt - 1) Geburt bis 1: Vertrauen vs. Misstrauen Zusammenhangen zwischen den eigenen Ansprüchen und denen der Welt Vertrauen, dass die Mutter zurückkommen wird, Gefühl der Akzeptiertheit geben und nehmen (orale Erfahrungen) Fehlschlagen: Frustration, Rückzug, Mangel an Selbstvertrauen - 2) 2- 3: Autonomie vs. Scham und Zweifel - 71 - - mehr Kontrolle, Unabhängigkeit, aber auch neue Ängste ideal: Aufbau von Selbstkontrolle ohne den Verlust des Selbstwertes die Kultur, ausgedrückt durch die Eltern, formt die neuen Kompetenzen, das Kind lernt Regeln festhalten und loslassen Fehlschlagen: anale Persönlichkeit = überkontrolliert, rigide 3) 4- 5: Initiative vs. Schuld Identifikation mit den Eltern (mehr Fokus auf soziale Seite des Ödipuskonflikts) 4) 6- Pubertät: Werksinn vs. Minderwertigkeit Kompetenz ruhigere Periode = Latenz 5) Adoleszenz: Identität vs. Identitätsdiffusion Identität = Ich Synthese und Resynthese im Laufe der Kindheit; Integration von konstitutionellen Gegebenheiten, idiosynkratischen triebhaften Bedürfnissen, Kapazitäten, Identifikationen, effektiver Abwehr, erfolgreicher Sublimierung und beständigen Rollen verschiedene Rollen, sozialer Druck das Ganze (die Identität) ist mehr als die Summe seiner Teile (vorangegangene Identifikationen) Fehlschlagen: Persönlichkeit bleibt bruchstückhaft Ideologie der Gesellschaft definiert, welche Rollen wünschenswert sind 6) junges Erwachsenenalter: Intimität vs. Solidarität geht nur bei einer integrierten Identität von Stufe 5 Fehlschlagen: Rückzug in Isolation (stereotype, kalte soziale Beziehungen) 7) mittleres Erwachsenenalter: Generativität vs. Selbstabsorption sich um die nächste Generation kümmern, Glaube an die eigenen Fähigkeiten Fehlschlagen: Stagnation, Langeweile 8) spätes Erwachsenenalter: Integrität vs. Verzweiflung Akzeptanz der Endlichkeit des Lebens Fehlschlagen: Bedauern, Angst vor dem Tod gegenwärtige Forschung auf der Basis von Erikson: - - im Gegensatz zu Freud und Piaget: Entwicklung über die komplette Lebensspanne Marcia: Anwesenheit/ Abwesenheit von Krisen und Verpflichtung führen zu 4 Identitätsstatus = Diffuse Identität, Übernommene Identität, Moratorium, erarbeitete Identität (Exploration und Verpflichtung) Krise = Auswählen zwischen möglichen Alternativen Verpflichtung = Ausmaß der persönlichen Investition in die eigenen Überzeugungen Kritik von Gilligan: nicht universell gültig zwischen Kulturen und für Männer und Frauen Mechanismen der Entwicklung: - epigenetische Prinzipien, körperliche Reifung- innerhalb dieser Grenzen sorgt die Kultur für Variation - viel mit Freud vereinbar: Triebe, Frustration, Bindung und Identifikation - lehnt aber Freuds Äquilibrium der Spannungsreduktion ab - Erikson: Entwicklung = Lösung von Konflikten zwischen entgegengesetzten Kräften - spezifischer Mechanismus der Entwicklung: Spiel – Gebrauch der Vorstellungskraft zur Bewältigung der Welt und zur Anpassung an sie, Emotionen auszudrücken, 72 - vergangene oder zukünftige Ereignisse herzustellen- so können in der Realität nicht zu bewältigende Probleme gelöst werde (Bsp.: Visualisierung, Fantasieren, Rehearsal) Spiel ist häufig ritualisiert, formal und als Common Ground in der Kultur anerkannt Rituale = Mechanismen der Entwicklung, da sie einen in den Mainstream der Kultur bringen und vorgefertigte Lösungen bereitstellen Positionen zu Entwicklungsthemen: - optimistischer im Bezug auf die Natur des Menschen- Menschen wollen nicht nur Schmerz vermeiden, sondern sind auf der Suche nach einer positiven Bedeutung der Identität - Entwicklung vor allem qualitativ, aber auch quantitativ, da die Identität stärker wird - ein sich veränderndes Kind in einer sich verändernden Umwelt und ein System von kulturell konstruierten Kontexten zur Sozialisierung des Kindes - Natur determiniert die Sequenz der Stufen und setzt Grenzen, Erikson legte aber, mehr als Freud, Wert auf die Rolle der Kultur als Einfluss auf die Entwicklung (auch die Vergangenheit und Gegenwart der Gesellschaft spielen eine Rolle - im Gegensatz zu Freud war Entwicklung für Erikson lebenslang - die Identitätsbildung ist der Kern der Entwicklung Anwendung: heute vor allem zum Counselling (Entscheidungsbildung) Bewertung der Theorie: - Erweiterung des psychoanalytischen Ansatzes - Stärken: Erweiterung der psychoanalytischen Theorie (psychosozial hinzugefügt, Kultur, Ich Identität, Normalität, Interkulturelles, Entwicklung im Erwachsenenalter) breite Perspektive (Einfluss auf das Kind durch Kultur, Geschichte) - Schwächen: Fehlende Systematik (schwer zu testen, sehr interpretativ) Mangel spezifischer Entwicklungsmechanismen (wie werden Krisen bewältigt etc Zusammenfassung: - Grundlage sind 2 von Freuds Ideen: die ersten Jahre sind am bedeutendsten, da dort die Persönlichkeit geformt wird; sie entsteht durch die Bewältigung einer invarianten Sequenz von Konflikten - jeder Konflikt betrifft eine bestimmte Domäne (oral, anal) - 2 grundlegende Modifikationen durch Erikson: 1) wichtige soziale Faktoren 2) das Leben als Suche nach Identität (Fokus auf den Fortschritt des Ich) Zusammenfassung Identität: das zentrale Thema des Jugendalters - - Zum Begriff der Identität: einzigartige Kombination von persönlichen, unverwechselbaren Daten des Individuums (Name, Alter, Geschlecht, Beruf)- kennzeichnend, unterscheidend im engeren psychologischen Sinn = einzigartige Persönlichkeitsstruktur, verbunden mit dem Bild, das andere von dieser haben + im Jugendalter: eigenes Verständnis für die Identität Abgrenzung zu Selbst (nach James): Selbst bezieht sich im ontologischen Sinne auf den Kern des Persönlichkeitssystems; der träger von Handlungen, der Akteur; Selbstwahrnehmung, Selbsterkenntnis (phänomenologisch) = Selbstkonzept 73 - - - - - - Selbstkonzept: affektive Komponente (Selbstwertgefühl- Fähigkeitskonzept- + Selbstvertrauen), kognitive Komponente (Wissen über sich selbst, Selbstwahrnehmung) Selbstschema und Selbsttheorie (Erklärung über eigene Entwicklung, Stellung in der Welt) als tiefergreifende Selbstbeschreibungen James: Selbst = I (ich) und Me (mich) = Erkennender und Erkannter, das Ich will ein klares Bild vom Gegenstand seiner Erkennens, dem mich, gewinnen Mead: me = individuelle Spiegelung des gesellschaftlichen Gruppenverhaltens; Übernahme der Haltung durch das Me = Identität, derer er sich bewusst ist; es steht für eine bestimmte Organisation in der Gemeinschaft, verlangt nach einer Reaktion; Reaktion des Subjekts auf gesellschaftliche Inhalte = I (reagiert auf die Identität) beim I wird die Freiheit und Unvorhersagbarkeit des Handelns angesiedelt = Offenheit von Entwicklung andere Unterscheidungen: persönliches/ privates (persönliche Identität, lebensgeschichtlicher Zusammenhang zwischen den Erfahrungen, die ein Mensch gemacht hat) und öffentliches/ soziales Selbst (soziale Identität, entsteht aus dem Bild, das andere sich von einem machen) „looking- glass- self“: wie sich das Individuum durch die Brille der anderen sieht (welche Bilder werden vom Ind. erfasst) Burns: Selbst wie ich bin, Selbst wie ich sein möchte, Selbst wie andere mich sehen; gegenwärtige Sicht = reales Selbst, zukünftige Sicht = ideales Selbst wahres Selbst und das Selbst als Vakuum; wahres Selbst gilt es zu entdecken (humanistischer Ansatz), Vakuummodell: anfängliche Leere der Individuumsdadurch werden bestehende Konventionen übernommen (Existentialphilosophie, Heidegger), Wahl von Identitäten zur Maskierung dieses Vakuums (Sartre) Ausgangspunkt hier ist der Begriff der Identität von Erikson: 1) Identität als Antwort auf die Frage- wer bin ich? 2) Herausbildung einer neuen Ganzheit- Integration der Elemente des alten und den Erwartungen der Zukunft 3) Integration führt zur Erfahrung von Kontinuität und Selbstsein Antwort der Identitätsfrage durch realistische Einschätzung der eigenen Person, der Vergangenheit, der Kultur (Ideologien, Erwartungen) 4) kulturelle Erwartungen werden hinterfragt (kristallisiert sich um fundamentale Probleme) 5) führt zu persönlichen Verpflichtungen 6) ermöglicht eine produktive Integration in die Gesellschaft 7) subjektives Gefühl von Loyalität und Treue, Selbstachtung, Verwurzelung die sensible Phase für die Entwicklung der Identität ist die Adoleszenz Modell der Identität nach Bosma: Inhalt der Verpflichtung, Stärke der Verpflichtung, Umfang der Exploration, um der Verpflichtung gerecht zu werden Fazit: Grundbemühungen des Individuums bei der Identitätsbeschreibung = sich selbst erkennen + das Bestreben, sich selbst zu gestalten = Selbsterkenntnis und Selbstgestaltung als die 2 Prozesse, die die Identitätsentwicklung vorantreiben Identitätsentwicklung: voller Tumulte oder ruhiges kontinuierliches Wachstum?: Jugend nicht mehr als Sturm und Drang Offer et al.: Befragung von jugendlichen- keine gravierenden Probleme, aber Geschlechtsunterschiede 74 - - - - - - - - - - - - Mullis et al.: Cooper- Smith- Inventar- Quer und Längsschnittstudie an 270 Jugendlichen; Selbsteinschätzung veränderte sich nicht (im Querschnitt, Schüler zum gleichen Zeitpunkt) aber im Längsschnitt: signifikanter Anstieg Konstanzer Untersuchung „Entwicklung im Jugendalter“ 2000 Schülerzunehmende Stabilitätswerte; stabil bleiben allgemeine Zufriedenheit, Emotionskontrolle Selbstakzeptanz Stabilität des Selbstkonzepts: relativ hohe Korrelationen zwischen den einzelnen Messungen (kognitive Komponente) aber auch die affektive Komponente schein relativ stabil zu sein (Selbstwert)- aber auch Abnahmen, vor allem bei Mädchen Fazit: Slebstkonzept, gemessen über Selbsteinschätzung verändert sich zu keinem Zeitpunkt dramatisch, Anstieg im Längsschnitt, im Querschnitt nur geringe Unterschiede zwischen den Altersgruppen Struktur der Identität und ihre Veränderung im Jugendalter: wachsende Komplexität der Identität: achtung- es wird durch die Selbstkonzeptmaße nicht die Identität als Struktur erfasst über die Zeit werden die Selbstbeschreibungen immer differenzierter und organisierter Pinquart und Silbereisen: Konstruktion kontextspezifischer Selbst, Realbild und Idealbild werden mit zunehmendem Alter deutlich getrennt, Trennung von authentischem und unauthentischem Selbst, man lernt, sich aus der Sicht anderer zu sehen, Einbeziehung der Zeitdimension (Vergangenheit und Zukunft) Methode der Selbstbeschreibung: im ausführlichen Interview- Identität komplex, aks Konstruktion der eigenen Identität, die sich nach der jeweiligen Bedürfnislage richtet, rückt kritische Lebensereignisse in den VordergrundSelbstbeschreibung kann sich nach einem Jahr drastisch ändern (inhaltliche Darstellung und Strategien der Darstellung) Identität kann nicht wie die Selbstkonzeptmessung mit Hilfe stabiler Merkmale beschrieben werden – eher umfassende Konstruktion des Selbst in seiner jeweiligen Erfahrungswelt die 4 Formen des Identitätsstatus nach Marcia (1966): Anliegen, allgemeine Gesetzlichkeiten für Jugendliche zu finden, ohne die Komplexität aufzugeben- im Anschluss an Eriksons Identitätskonzeption Verfahren zur Erfassung des aktuellen Identitässtatus Probanden werden Fragen gestellt zur Erfassung des Ausmaßes der Verpflichtung (commitment) in verschiedenen Bereichen (Beruf, Religion, Politik) zu erfassen BEISPIEL: wie bereit bist du, seinen jetzigen Beruf aufzugeben, wenn sich etwas besseres ergibt?/ Zweifel bezüglich der religiösen Überzeugung? erarbeitete Identität = vielleicht, aber ich bezweifle es, was würde dieses etwas Besseres für mich sein? / ja, gibt es Gott, aber ich habe das Problem für mich gelöst Moratorium = wenn ich’s genau wüsste, könnte ich besser antworten, etwas, das in Beziehung zu meiner Berufstätigkeit steht / ja. damit beschäftige ich mich gerade, ich kann nicht verstehen, dass es Gott und so viel Böses gibt übernommene Identität: eigentlich nicht, die Leute sind zufrieden damit und ich auch / nein, in meiner Familie bestand darüber Klarheit diffuse Identität: aber sicher, wenn sich etwas Besseres gibt, warum nicht? / ich weiss nicht, so was macht wohl jeder durch, das muss jeder selbst entscheiden, kümmert mich nicht sehr 75 - - - - - - - - Marcia fand 4 Formen der Identität (siehe oben) als jeweiligen Identitässtatus, kennzeichnen einzelne Bereiche hinsichtlich 3er Dimensionen: 1) Krise = Ausmaß an Unsicherheit, Beunruhigung 2) Verpflichtung = Umfang des Engagements, Bindung 3) Exploration = Ausmaß der Erkundung mit dem Ziel einer besseren Orientierung und Entscheidungsfindung = entscheidende Strategie der Bewältigung von Identitätsproblemen Merkmale (siehe Renkl) treten erst in der späten Adoleszenz (progressive- über das Moratorium zur erarbeitenden Identität, regressive- enden bei diffuser und stagnierende Verläufe- bei übernommen oder diffus) Untersuchungsbeispiel zur Identität als Struktur: Meilman nach Marcias Interviewes (12-24): am Anfang eher diffus, prozentualer Anstieg der erarbeiteten Id. (aber auch in der 12 Klasse nur 19% Moratorium oder erarbeitete) Identitätsformung und Bewältigungskonzepte: Neuenschwander: integrierte Id. als letzte Phase (fremdbestimmt, diffus, suchend und integriert) , Identitätsformung durch kritische Lebensereignisse, nächster Schritt durch Anstieg des Selbstwerts, neue Werte motivieren, wachsende Kontrollüberzeugung zur integrierten Id. da Jugend. nun überzeugt sind, ihre Ziele auch verwirklichen zu können keine allgemeingültige Abfolge nachgewiesen, häufig stabiler Typ, es müsste aber eine Entwicklungsskala geben (keine Ausprägung, nur Auspr. in Lebensereignissen, in LE und Selbstwert, LE- SW und Kontrollüberzeugung) Ergebnisse: zu Beginn des Identitätsformungsprozess stehen herausragende Lebensereignisse, Steigerung des Selbstwerts liegt vor der Festigung der Kontrollüberzeugung Erweiterung des Identitätsspektrums: vier Formen diffuser Identität: Marcia, 1989, Zuwachs auf 40% unter Jugendlichen (ohne feste Werteorientierung) 1) Entwicklungsdiffusion 2) sorgenfreie Diffusion (unauffällig, nur oberflächliche Kontakte) 3) Störungsdiffusion (als Folge eines Traumas, Isolation) 4) kulturell adaptive Diffusion (in Zukunft reguläre Form durch multikulti, durch Unverbindlichkeit, Offenheit und Flexibilität) traditionaler Typ: (Kraus und Straus) west/ost Deutschland- weniger Komplexität, Übernahme der elterlichen Muster, keine tiefe Verpflichtung (=Unterschied zu übernommener) Surfer: ständige Positionskorrektur, keine feste Verpflichtung, Exploration nicht zur Elaborierung Isolierte: Normalität schwer erreichbar, durch Konflikthaftigkeit der Familie, diskontinuierlicher Beruf Patchworkidentität: Endergebnis des Wachstums durch Substitution, funktional, aber sich widersprechend Identität zwischen Widerspruch und Stimmigkeit: Zentrum der Identitätsbildung = bewusste argumentative und nach relevanter Info suchende Persönlichkeit in Gang gesetzt durch die Fähigkeit zur Selbstreflexion- Erkenntnis von Widersprüchen, Hauptdiskrepanz: Real- Ideal- Diskrepanz 76 - - Selbstdiskrepanz- Theorie (Higgins) in Verbindung zu Rogers: geht mit unangenehmen Emotionen einher (actual, ideal- zukunft, ought- Verpflichtung; Selbst und andere als Einflussquellen aktual Selbst vs Ideal- Selbst: Enttäuschung, Unzufriedenheit Aufgaben: Mögliche Frage an Probanden: "Welchen Beruf wirst du mal ergreifen" Bitte jeweils (Ausschnitt aus einer) Antwort für jede der vier Identitätsstatusse formulieren. Ein Selbstkonzept, das eine leichte Selbst-Überschätzung beinhaltet, scheint optimal zu sein. Wie könnte man das erklären? Betrachten Sie die von Pinquart und Silbereisen (2000) beschriebene Entwicklungslinien und entwerfen Sie zwei fiktive (Ausschnitte aus) Selbstbeschreibungen, die sich "im Entwicklungsstand" unterscheiden (für ein Modell einer Selbstbeschreibungen siehe erste Folie der Vorlesung). Musterlösung – Identität Von Petra Buys Aufgabe 1 Übernommene Identität: „Ich werde studieren, wie meine älteren Geschwister. Wahrscheinlich Medizin, um die Praxis meiner Mutter zu übernehmen. Ja, Medizin liegt mir in den Genen.“ Erarbeitete Identität: „Da habe ich mir auch schon viele Gedanken darüber gemacht, ich bin auch bei der Berufsberatung gewesen. Mit Abitur beginnt man ja meistens ein Studium, aber ich habe mir überlegt, ob eine Ausbildung nicht besser zu mir passen würde, nämlich als...“ Moratorium: „Darüber denke ich im Moment viel nach. Ich habe mir auch schon viel durchgelesen und mache im Moment ein Praktikum in einem Bereich, der mich vielleicht interessiert. Ich möchte mich aber noch nicht festlegen, es gibt viel, was ich spannend finde.“ Diffuse Identität: „Ja, damit beschäftigen sich jetzt alle. Aber ich weiß nicht, was ich machen möchte, und ich habe auch keine Lust, mich ständig damit zu beschäftigen. Ich lasse es auf mich zukommen, es wird sich schon was ergeben.“ Aufgabe 2 77 Die Ursache dafür, dass eine leichte Selbstüberschätzung zu den besten Leistungen führt, kann in unterschiedlichen Faktoren vermutet werden: - Positive Selbstbeurteilung führt auch dazu, dass das eigene Tun als positiv bewertet wird. Dieses Vertrauen kann dazu führen, dass schwierige Aufgaben schneller und ausdauernder in Angriff genommen werden und man sich weniger leicht entmutigen lässt, wenn Schwierigkeiten auftauchen. Durch den Glauben an die Möglichkeit des Erfolgs steigt die Motivation. - Negative Erwartungen und eine Selbstunterschätzung können zu hoher Versagensangst und einer vermehrten Beschäftigung mit dem, was man nicht kann, führen. Die Gefahr für einen Misserfolg steigt, und zudem wird ein Misserfolg negativer bewertet („Ich habe ja gewusst, dass ich es nicht kann“). - Eine starke Selbstüberschätzung kann z.B. zu mangelnder Prüfungsvorbereitung sowie zu dem allgemeinen Gefühl, sich nicht anstrengen zu müssen, führen. Leichte Selbstüberschätzung führt zu erhöhter Motivation sowie zu dem Glauben, eine Aufgabe bewältigen zu können. Dabei traut man sich an schwierigere Aufgaben heran, als es bei einer komplett realistischen Selbsteinschätzung der Fall ist. Durch diese ständige Herausforderung ist die Möglichkeit zur Weiterentwicklung und zum Ausschöpfen vorhandener Potenziale optimal gegeben. Dennoch ist das Selbstvertrauen nicht maßlos, so dass die Notwendigkeit zur Arbeit an sich selbst akzeptiert und befolgt wird. Aufgabe 3 Selbstbeschreibung 1: „Ich heiße A. und bin 10 Jahre alt. Ich gehe in die 5. Klasse, ich spiele gerne Basketball, und ich habe einen Bruder (Beschränkung auf die Gegenwart). Ich bin ein selbstbewusstes Mädchen (Keine Kontextspezifität). Ich bin freundlich und lustig und Mädchen und Jungen mögen mich. In der Schule bin ich nicht so gut (keine explizite Trennung von Ideal- und Realbild). Ich bin immer gut gelaunt und eigentlich zu allen Menschen nett (authentisches Selbst?!). Ich weiß nicht, wie die Lehrer mich finden, aber sie geben mir nicht so gute Noten (schwierig, sich aus der Sicht Anderer zu sehen).“ Selbstbeschreibung 2: „Ich heiße B. und bin 15 Jahre alt. Ich gehe in die 10. Klasse. Ich habe zwei Schwestern, die jünger sind als ich. Ich mache gerne Sport, früher habe ich Volleyball gespielt, bis ich gemerkt habe, dass ich nicht so gut werden kann, wie ich gerne möchte (Differenzierung Real- und Idealbild). Jetzt tanze ich, ich glaube, dass ich darin gut werden kann, wenn ich mich anstrenge (Einbezug von Vergangenheit und Zukunft). Ich bin eigentlich recht selbstsicher, aber wenn ich mit Lehrern oder manchen anderen Autoritätspersonen spreche, bin ich manchmal eingeschüchtert, dann erkenne ich mich kaum wieder (Berücksichtigung der Kontextspezifität). Ich bin eigentlich zu allen Menschen nett, auch wenn ich sie nicht mag. Dann versuche ich, mir das nicht so anmerken zu lassen, ich tue nett, obwohl ich vielleicht sauer bin oder genervt (Berücksichtigung des unauthentischen Selbsts). Ich glaube, dass die meisten Menschen mich mögen, aber manchmal gehe ich ihnen, glaube ich, auf die Nerven, weil ich zu viel rede und manchmal albern bin (Kann sich aus Sicht Anderer sehen).“ (Insgesamt deutlich komplexer) 78 Moral, O+M: 1. Moralphilosophische Konzepte Normen Existieren in jeder Gemeinschaft als Verbote, Pflichten, Verantwortlichkeiten, Rechte, usw. Sind verschiedenartig: existieren als Traditionen, staatliche Gesetze, aber auch andere Regeln, z.B. Moden. Über die Legitimität spezifischer Normen divergieren die Überzeugungen, daraus können Konflikte entstehen -> ergibt sich aus ihrer ethischen Begründung oder aus der Legitimation des Normstifters (z.B. Religionsgründer). Diesbezüglich gibt es verschiedene wichtige Kriterien: Universalisierbarkeit Anerkanntestes Kriterium der philosophischen Ethik, z.B. formuliert in Kants kategorischem Imperativ: „Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte.“ Utilitarismus (J. Bentham, J.S. Mill, 19. Jhdt.) Maximierung des Gemeinwohls als Kriterium. Weiterentwicklungen achten darauf, dass dies nicht auf Kosten von Minderheiten geschieht. Diskurstheorien (z.B. Habermas, 1983) Keine inhaltlichen Kriterien für Normen, sondern Kriterien für die Verfahrensweise bei ihrer Findung. Ziel => idealer Diskurs => findet die richtige Lösung! (z.B. Verständigungsbereitschaft, Informiertheit, Verzicht auf Herrschaftsansprüche aller Teilnehmer). Kulturunterschiede Es sind nicht nur universalisierbare/ universelle Normen vorhanden. So unterscheiden sich z.B. individualistische und kollektivistische Gesellschaften in dem Maß an Freiheit, dass sie ihren Bürgern gewähren, bzw. im Maß an Normiertheit. Auch fordern neue Probleme in modernen Gesellschaften ständig neue Lösungen. In demokratischen Staaten sind deshalb die moralphilosophischen Kenntnisse und Überzeugungen von großer Bedeutung. 2. Psychologische Moralforschung Abgrenzung moralisches Handeln/ prosoziales Handeln aus Sympathie: letzteres ist nicht moralisch motiviert! Indikatoren von Moral: Moralische Normen regeln Handeln Bewertungsmaßstäbe; Wie erreichen Normen diese Funktion? Nötige Abfolge für Handlungsregulation durch Normen: und liefern 79 - Wissen über Normen erwerben Geltungsanspruch anerkennen Normen befolgen (Erfassbare) persönliche Indikatoren von Moral: 1.) Wissen über Normen, 2.) Moralische Urteile 3.) Moralisches Verhalten und 4.) Moralbezogene Gefühle (z.B. Scham, Schuld, Stolz). Kein einzelner Indikator liefert jedoch ausreichende Ergebnisse -> trotzdem irrtumsanfällig! (Z.B. garantiert Wissen über Normen nicht deren Anerkennung -> Delinquente!) immer mehrere verschiedene erfassen! Unterschiedliche Entwicklungs– und Sozialisationsziele Verschiedene Einflussnahmen abgeleitet. Veränderungen sind erkennbar bei: moralischen Urteilen (was ist gut/ böse, gerecht/ ungerecht) ihrer Begründung der Unterscheidung zwischen konventionellen (z.B. Mode) und moralischen Normen und in der Herausbildung eines persönlichen Entscheidungsfreiraumes der moralischen Motivation der Differenziertheit der Urteile der Konsistenz von Urteil und Verhalten 3. Die Internalisierung moralischer Normen Internalisierung Vorgegebene Normen werden als die eigenen akzeptiert. Die Vermittlung der Normen: kann argumentativ, durch positive/ negative Beispiele (Beobachtung) oder durch Belohnung/ Bestrafung (operantes Konditionieren) erfolgen. 3.1. Normvermittlung und Konditionierung Internalisierung wird operationalisiert als Tun oder Lassen ohne Bestrafung/Verstärkung ( Extinktionsresistenz): Intrinsische Belohnung: extinktionsresistentes Verhalten wird durch Aufbau einer positiven inneren Wertigkeit erzeugt, z.B. durch klassisches Konditionieren von Emotionen möglich (Koppelung Verhalten – Freude). Entzug von intrinsischer Belohnung bei normabweichendem Verhalten nie möglich (alle Tätigkeiten, die als lustvoll erlebt werden), von extrinsischer Belohnung oft auch schwierig (z.B. Aufmerksamkeit). 80 Bestrafung soll als Ausgleich zu ex – und intrinsischer Belohnung fungieren, quasi eine negative Bilanz der Verhaltensfolgen herstellen. Probleme von Strafen: Bei seltener Bestrafung: unverhältnismäßige Höhe der Strafe nötig, um Bilanz aus-zugleichen Strafe schafft keine Verhaltensalternativen Strafen garantieren keine Einsicht Strafen belasten das Verhältnis von Bestraftem und Strafendem 3.2. Normvermittlung durch Identifikation und Beobachtung Wahl von Vorbildern: „Identifikation mit dem Aggressor“ (Freud): Übernahme von Forderungen einer bedrohlichen Autorität (um Bestrafung zu entgehen) „Identifikation nach Trennung“ (Freud): um eine abwesende Person präsent zu halten, werden Merkmale von ihr übernommen Identifikation mit einer mächtigen Person (Macht durch Status, Beliebtheit, Sanktionsgewalt, sachliche Kompetenz, Gewährung von Sicherheit oder Liebe ...) Zugehörigkeit zu einer Gruppe motiviert Wahl von Vorbildern aus dieser Gruppe! Grundsätzlich kann alle die Moral betreffende Information aus Beobachtung gelernt werden. 3.3. Normvermittlung durch familiäre Sozialisation Die Familie ist die erste Instanz moralischer Sozialisation. Typologie von Erziehungsstilen (Hoffmann und Saltzstein 1967) und Folgen für die Internalisierung: Macht ausübender Stil: Verhindert Internalisierung eher, fördert nur äußere Anpassung. Verhindert Identifikation durch ein Fehlen von Liebe und Wärme. Durch externe Attribution normkonformen Verhaltens wird dieses nicht zu einem Teil des Selbstbildes. Induktiver Stil: Normen werden argumentativ erläutert, Konflikte angesprochen, der Sinn von Normen erklärt. Raum für eigene Entscheidungen ist vorhanden; diese werden kommentiert (und als Werk der Jugendlichen gelobt) und somit zu einem Teil seiner Identität. Führt zu eine „humanistisch flexiblen Moral“ (es darf nachgedacht werden). Persönliche Verantwortung wird gefördert (nur Handlungen mit Wahlfreiheit können moralisch/unmoralisch sein). Liebesentzug als Sanktion: Wirksamkeit nicht eindeutig ermittelt, hängt vom Bedürfnis der Kinder nach liebevoller Zuwendung ab. Nicht unproblematisch: führt eher zu einer ängstlich-rigiden Moral (Klammern an den Wortlaut von Regeln). 81 3.4. Normvermittlung durch Peergruppen Wichtiger Einflussfaktor für die Moral, der mit dem Verhältnis zu den Eltern variiert. Großer Einfluss nachgewiesen für Sexualnormen, Alkohol und Drogen, Delinquenz. Wie entsteht das moralische Selbst? Ziel der Moralerziehung = Einsicht, das Gebote und Verbote richtig sind, nicht nur ihre Ausführung. Förderung „freiwilligen“ moralischen Verhaltens, dezente Anregung, Würdigung als selbst gewählt: Zurückführen auf eigene Überzeugungen Bem: Selbstwahrnehmungstheorie (Person schließt von ihrem Verhalten auf Wertüberzeugnen -> auch positive Eigenschaftszuschreibungen tragen zum Aufbau eines entsprechenden Selbstbildes bei!) Internalisierung oder Selbstkonstruktion von Normen Es gibt zwei Fälle von Normabweichungen: Nicht geteilte Norm – fehlgeschlagene Sozialisation In Frage gestellte Norm – in pluralistischen Gesellschaften ist die Reflexion über die Geltung von Geboten und Verboten unvermeidbar. Eigene Überzeugungen müssen durch die Auseinandersetzung mit (konfligierenden) Normen aufgebaut werden. 4. Entwicklung des Denkens über Moral 4.1. Piagets Theorie: von der Heteronomie zur Autonomie Bis 4 Jahre: kein Normverständnis. 2 Stadien Heteronomie: Beginn des Stadiums mit 4-5 Jahren. Regeln/Normen beziehen ihre Gültigkeit von den Autoritäten, die sie vorgeben; sie werden nicht in Frage gestellt, sind unantastbar. Konflikt = Einhaltung – Nichteinhaltung. Verfehlung = Verletzung von Geboten/Verboten. Autonomie: Maßstäbe der Gerechtigkeit. Regeln als Übereinkunft. Konflikt = Sinn und Begründung. Verfehlung = Verletzung der Vertrauens. Erforscht anhand von Spielregeln (Murmelspiel)- Piaget: Gleiche Muster auch bei Urteilen über gerechte Pflichtenverteilung: wenn die Mutter die Arbeit im Haushalt verteilt, wird sie von fast allen sechsjährigen auch bei sehr ungleicher Verteilung auf die Kinder als gerecht beurteilt, von zwölfjährigen nicht. Wenn jedoch Kinder die Pflichten verteilen (z.B. Ballholen beim Fußballspielen) fordern auch sechsjährige Gleichberechtigung ( keine Autoritäten). Was ist eine gerechte Strafe? 82 Heteronomie: Sühnestrafen, oft drakonisch ohne Gespür für Verhältnismäßigkeit; Autonomie: Strafen, die Wiedergutmachung oder natürliche Konsequenzen der Verfehlung beinhalten; Altersangaben mit Vorsicht aufzufassen. 4.2. Neuere Forschung zu Piagets Themen Denken über Recht und Gesetze 11-13j. definieren Gesetze durch spezifische Beispiele; ihre Funktion ist es, Untaten einzelner zu verhindern. 15-18j. definieren Gesetze über abstrakte Funktionen wie Freiheit und Sicherheit, betonen die hilfreichen Funktionen von Gesetzen. Nur 1/3 sieht sie als modifizierbar an. Altersverschiebung im Vergleich zu Piagets Ergebnissen. Moralische und konventionelle Normen Kinder differenzieren schon früh (4-5j.) zwischen unmoralischem Verhalten (z.B. andere schlagen, immer schlecht) und Verstößen gegen Konventionen (nur schlecht wegen den Konventionen, z.B. Verstöße gegen Tischmanieren). Unterschiedliche Rechtfertigung Eltern betonen bei moralischen Normen mehr den Schaden, der entstehen kann, und bei konventionellen Normen mehr ihre Bedeutung für die soziale Organisation, so dass dieser Unterschied übernommen sein kann. Normativ regulierte vs. persönliche Bereiche 4-5j. unterscheiden klar zwischen öffentlicher Sphäre und Privatsphäre (in der die Eltern auch mehr Freiheiten geben). Konflikte zwischen Jugendlichen und Eltern ergeben sich vor allem in Bereichen, die die Jugendlichen als ihre Privatsphäre, die Eltern eher als konventionsreguliert ansehen. Privatsphäre und die Entwicklung von Rechten und Freiheiten Zusammenhang v.a. in westlichen Kulturen gezeigt. Freiheit wird schon früh als moralisch fundiertes Recht erkannt, Einschränkungen werden ebenfalls gefordert, wenn Konflikte mit anderen moralischen Prinzipien bestehen. Verantwortlichkeit und Schuld Wichtigstes Kriterium für mögliche Verantwortlichkeit ist Handlungsfreiheit (siehe Strafrecht) -> „anders handeln können“. Ausreden aus der Verantwortlichkeit (absteigende Reihenfolge): Freiheit bestreiten Vorhersehbarkeit der Folgen bestreiten Absicht bestreiten Auf Verantwortung anderer hinweisen 83 Unterscheidung zwischen Verantwortung und moralischer Schuld vor allem aufgrund der Rechtfertigung, z.B.: Verweis auf Verantwortlichkeit Dritter Auf die Priorität übergeordneter Ziele Verweis auf berechtigte, eigene Interessen (z.B. eigene Sicherheit) Hinweis auf den Vergeltungscharakter der Tat Person, die sich für eine Handlung verantwortlich fühlt, ist besonders hilfsbereit! Auch Personen, die selbstverschuldet ins Unglück gestürzt sind, können mit weniger Hilfsbereitschaft rechnen als Personen, die nicht selbstverschuldet hilfsbedürftig sind. Handlungsausgang und Absicht (Beispiel/ Piaget: kleine Kinder finden es verwerflicher, wenn ein Kind unabsichtlich mehrere Teller zerschlägt, als wenn es einen aus Wut zerstört) Bei Urteilen: Verschiebung der Gewichtung mit zunehmendem Alter weg von Handlungsausgang hin zur größeren Beachtung der Absicht aber auch viele Vorschulkinder berücksichtigen bereits beide Informationen! Verschiebung durch Sozialisation Es spricht vieles dafür, dass es sich um die Folge verbreiteter Sozialisationserfahrungen handelt, und nicht um eine notwendige Abfolge -> man kann auch schon im Vorschulalter eine stärkere Gewichtung der Intention erreichen (durch wenige Beobachtungen von Modellen!). Schon Kindergartenkinder urteilen aufgrund der Intention, wenn kein Ausgang berichtet wird -> wenn beides im Urteil enthalten, wird allerdings Ausgang schwerer gewichtet! Verteilungsgerechtigkeit und Fairness: Entwicklungssequenz zwischen 4. und 11. Lebensjahr bei der Vorstellung von gerechter Verteilung (Damon, 1980 und 1988): 1. Egozentrische Verteilung -> Verteilungskonzeptionen an eigenen Wünschen orientiert; 2. Gleichbehandlung -> wird präferiert, unabhängig von Leistung oder Bedürfnis; 3. Aufteilung nach Leistung & Beachtung von Reziprozität; 4. Konflikte zwischen Aufteilungsmöglichkeiten werden bewusst, Kompromisse werden eingegangen. Steigende Anforderungen an die Kognition, da immer mehr Aspekte beachtet werden. Abhängigkeit vom Arrangement: Schon im Vorschulalter integrieren Kinder 2 dargebotene (!) Alternativen. 4.3. Von der egozentrischen zur universalistischen Begründung normativer Urteile (Lawrence Kohlberg) Studium der Begründungen normativer Urteile anhand moralischer Dilemmata studiert (Konflikte zwischen Normen, nicht zwischen Konflikt und Neigung -> z.B. Kriegsdienstverwiegerung, Gebot „Du sollst nicht töten“ und Gesetz!). 84 Verwendete u.a. das sog. Heinz- Dilemma: Heinz hat eine krebskranke Frau -> braucht teures Medikament, hat das Geld nicht, bricht deshalb in eine Apotheke ein -> was ist schlimmer – Einbruch, oder Frau sterben lassen? Sollte man ihn verurteilen?... Kohlberg interessierte sich weniger für die getroffene Entscheidung, als für die Prinzipien, die diesen Entscheidungen zugrunde gelegt werden. Untersuchung der Prinzipien, die Entscheidungen zugrunde gelegt werden: 3 Niveaus mit jeweils 2 Stufen von qualitativen Unterschieden; I. II. III. Vormoralisches Niveau 1. Begründung durch drohende Strafen bzw. Autoritäten - 10J 2. Begründung mit eigenem Interesse (z.B. man möchte seine Frau behalten) - 13J Niveau der konventionellen Moral Begründung mit dem Erhalt wichtiger Sozialbeziehungen 3. Nur innerhalb der Familie und anderer Primärgruppen (gelingt es nicht, alle Interessen der wichtigen Bezugsgruppen zu wahren, ist eine Lösung prinzipiell nicht möglich;) – 16J 4. Ausdehnung auf übergreifende Systeme wie Staat oder Religionsgemeinschaft – 21J Niveau der postkonventionellen Moral Erkenntnis, dass das System nicht unwandelbar ist. Bemühen, Prinzipien und Werte unabhängig von Autoritäten und der Identifikation mit Gruppen zu finden. 5. System als Gesellschaftsvertrag. Utilitaristische Überlegungen häufig. Neue Dimension von Gerechtigkeit: Gerechtigkeit des Verfahrens zur Entscheidungsfindung. Menschenrechte aber unveräußerlich. 6. Suche nach allgemeingültigen ethischen Prinzipien und allgemeinen Verfahren zur Prüfung normativer Entscheidungen (vgl. Diskursethik). Weitere Entwicklung im Erwachsenenalter: häufiger Relativierung auf Kontexte und spezifische Situationen. Entwicklungsförderung des moralischen Denkens Am besten durch ein Angebot von Problemen und unterschiedlichen Meinungen. Ziel ist der Aufbau von Kompetenzen zur Lösung moralischer Probleme, nicht die Anpassung an bestehende Normen. Optimale Entwicklungsvoraussetzungen - Mehrwöchiges Training, viele verschiedene Problembearbeitungen, - Aktive Beteiligung der Schüler - Meinungsstreit - Nachholeffekte beobachtbar -> Erfolge bei Erwachsenen und älteren Heranwachsenden größer als bei Kindern! 85 Ethik- bzw. Sozialkundeunterricht: kein Effekt. Stufen der moralischen Argumentation und moralisches Verhalten Kohlbergs Stufenmodell ist nicht als Skala im psychometrischen Sinn gedacht! Ziel war eher Aufweis qualitativer Unterschiede zwischen den Stufen; Auf Niveau III. werden eher Ungerechtigkeiten in der Gesellschaftsordnung entdeckt, da alle Beteiligten berücksichtigt werden. Stufe III. ist empirisch in politisch aktiven, kritischen Gruppen überrepräsentiert. In radikalen politischen Gruppen findet man jedoch vermehrt Stufe I. (z.B. werden Opfer von Anschlägen gar nicht beachtet). Gesellschaftskritiker sind auf Stufe 4. Unterrepräsentiert. Personen auf Stufe III. sind bei Gruppendruck vermehrt nonkonform und lehnen moralisch verwerfliche Forderungen einer Autorität eher ab (Milgram 1974!). Männliche und weibliche Moral? Carol Gilligan 1984: nahm an, dass männliche Moral an Gerechtigkeit, weibliche an Fürsorge orientiert sei -> Frauen würden auf Kohlbergs Skala schlechter abschneiden, da sie männliche Gerechtigkeitsmoral erfasse! (Nicht Verteilung nach dem Bedürftigkeitsprinzip gemeint, sondern moralische vs. Altruistische Motivation, also Verantwortlichkeit vs. Mitleid/Liebe/Sensibilität für Not der Betroffenen). Allerdings: Keine empirische Bestätigung von Geschlechtsunterschieden, Frauen schneiden auf Kohlbergs Skala nicht schlechter ab als Männer; 5. Moralisches Denken und moralisches Handeln Das Urteilsniveau bei der Lösung moralischer Dilemmata determiniert noch nicht moralisches Handeln! Durch das Argumentationsniveau ist die inhaltliche Zielsetzung nicht festgelegt In den vorgelegten hypothetischen Konflikten gab es keine persönliche Betroffenheit 5.1. Moralisches Wissen vs. moralische Motivation Etwas für richtig zu halten, bedeutet nicht, sich aktiv dafür zu engagieren! Kohlberg nahm am Anfang eine Einheit zwischen moralischem Denken/ Motivation/ Handeln an, erkannte aber bald die Notwendigkeit der Trennung zwischen moralischer Norm und der persönlichen Verantwortung, sie einzuhalten. 5.2. Performanzfaktoren und moralisches Handeln Moralisches Handeln ist durch die Akzeptanz von Normen nicht gesichert. Es muss sich gegen andere Bedürfnisse, Affekte, Vorurteile, soziale Nötigungen, Angst usw. durchsetzen. 86 Performanzfaktoren sind Selbstsicherheit, Handlungskompetenz (bei sachlichen Problemen), Wissen um Möglichkeiten und Kompetenzen zur Selbststeuerung. Diese werden von Kohlberg unter dem Begriff Ich-Stärke zusammengefasst. Sie enthält Fähigkeiten zu: Aufschub von Bedürfnisbefriedigung, Antizipation längerfristiger Konsequenzen, Durchhaltevermögen bei langwierigen Aufgaben usw. Möglichkeiten zum Aufbau von Selbstkontrolle liegen zum Beispiel In der Verhaltensmodifikation (Mischel), z.B. sprachliche Wiederholung der zu erfüllenden Regel. In der objektiven Selbstaufmerksamkeit (Wicklund), die zur Aktualisierung relevanter Selbstkonzeptkomponenten führt. 5.3. Konsistenz als Indikator für die integrierende Funktion des Selbst Keller und Edelstein hinterfragten Einheit von moralischem Urteil, moralischer Motivation und moralischem Handeln. o Moralische Motivation: wahrgenommene Verantwortlichkeit -> setzt Konzept des Selbst voraus! Konstitutiv für das Selbst: Konsistenz in Selbstwahrnehmung und wahrgenommener Fremdwahrnehmung. o Indikatoren für wahrgenommene Inkonsistenz: Scham, Schuldgefühle, Rechtfertigungen, Entschuldigungen, Wiedergutmachungen. o Konsistenzherstellung: durch Erklärung, Rechtfertigung, Kompensationen -> dient wiederum der positiven Wahrnehmung durch andere und sich selbst. o Aufbau des moralischen Selbst: Bewusst werden, dass das eigene Handeln Auswirkungen auf andere hat Perspektivenübernahme und Empathie führen zum Nachfühlen dieser Folgen und damit zur ersten intrinsisch motivierten Normeinhaltung. Bewusst werden von Bewertungen anderer, die Implikationen für die Selbstbewertung haben. Das Versprechen Beispieldilemma (Keller & Edelstein 1993) für 7, 9, 12 und 15j. Kürzlich zugezogenes Mädchen lädt die Vp ins Popkonzert/Kino ein, die gleichzeitig versprochen hat, sich mit einer Freundin zu treffen, die persönliche Probleme mit ihr besprechen will. Ergebnis: Entwicklungssequenzen mit je 4 Stufen: Versprechenskonzept – genannte Gründe für die Einhaltung: 0. Keine. 1. Die Regel selbst oder die Legitimierung durch eine Autorität. 2. Persönliche Verbindlichkeiten und Folgen für den Interaktionspartner. 3. Generalisierte Norm der Gegenseitigkeit, Notwendigkeit von Verlässlichkeit. Freundschaftskonzept: 0. Wird nicht verstanden 87 1. Kontakthäufigkeit als Kriterium 2. Kriterien sind wechselseitige Nähe und Vertrauen 3. Gegenseitige Vertrautheit und Verlässlichkeit, teilen von Erfahrungen und Gefühlen, gegenseitiges Verständnis Konfliktverständnis: 0. Wird nicht konzeptualisiert. Kein Verständnis. 1. Versprechen wird nicht spontan aufgegriffen, Wünsche aller Betroffenen aber erkannt. 2. Die Norm des Versprechens rückt in den Mittelpunkt. Wer das Versprechen bricht, fühlt sich schlecht, muss sich gegenüber der Freundin rechtfertigen. 3. Die Norm des Versprechens wird verpflichtend im Sinne einer generalisierten Reziprozitätsnorm, die Freundschaftsbeziehung ebenfalls -> Probleme der Freundin erhalten moralische Relevanz; Dabei gilt als Kriterium jeweils die tatsächliche Handlungsentscheidung (Versprechen gehalten/gebrochen). Die Stufen des Versprechens-, Freundschaftskonzepts erlauben eine bessere Vorhersage der Entscheidung als das Alter! Außerdem wurden fünf Typen des moralischen Urteil gebildet: 1. Urteil basiert auf Eigeninteresse. 2. Wegen der Freundschaft und dem Versprechen wird dessen Einhaltung als richtig angesehen. 3. Betonung der Ambivalenz zwischen Freundschaft und Eigeninteresse. Keine Eindeutige Entscheidung. 4. Freundschaft vs. Altruismus: Man will auf der einen Seite das gegebene Versprechen halten, auf der anderen Seite dem Kind, das hier noch keine Freunde hat, eine Freude machen. 5. Altruismus: Man will dem neu zugezogenen Kind eine Freude machen. Zentrales Ergebnis ist die mit zunehmendem Alter immer größere Übereinstimmung von moralischem Urteil und Handlungsentscheidung. Bei den Jüngeren urteilt die Mehrheit inkonsistent, indem sie zwar angibt, dass das Versprechen zu halten auf jeden Fall richtig sei, es aber trotzdem nicht tun würde. Entwicklung der moralischen Motivation (Nunner-Winkler 1993) Grundlegende moralische Regeln ab dem 4./5. Lebensjahr fast allen bekannt -> was sich wieterentwickelt ist moralische Motivation! Keine moralischen Dilemmata, sondern Vorlage von Konflikten zwischen Normen und persönlichen Bedürfnissen. Überprüfung von Normkenntnis, Normverständnis und Begründung. Ermittlung der Motivation anhand der Zuschreibung von „moralischen“ Gefühlen (Stolz, Schuldgefühle). Längsschnittstudie an etwa 200 Kindern: 88 60% der 4-5j. und 50% der 6-7j. erwarten, dass sich jeweils das egoistisch handelnde Kind gut fühlt, weil es seine hedonistischen Bedürfnisse befriedigen kann. Bei 8-9j. sind das nur noch weniger als 30%. -> Wenn diese Emotionen als Indikator für moralische Motivation gelten, ist der Nachweis er-bracht, dass die moralische Motivation mit dem Alter ansteigt! Zuschreibung von Schuldgefühlen spiegelbildlich. Zuschreibung von Schuldgefühlen guter Indikator für moralische Motivation? 5.4. Die Funktion des moralischen Selbst Ist es, wertorientiertes Handeln auch bei Schwierigkeiten aufrechtzuerhalten. Lydon und Zana haben die Bedeutung des moralischer Aspekte des Selbstkonzepts für längerfristige prosoziale Engagements nachgewiesen. Unmoralisches Handeln wird selbstbildgefährdend. Fazit: Moralisches Engagement ist dann verlässlich, wenn es der persönlichen Identität entspricht. Aufgaben: Aufgabe 1: Antworten nach der Kohlberg-Theorie einordnen Die folgenden Antworten beziehen sich auf das Heinz-Dilemma (siehe erste Folie der Vorlesung) Nein, es ist nicht recht zu stehlen, aber es könnte nicht falsch sein, wenn er seine Ehefrau rettet; das Leben einer Person ist wichtig für ein Land. Sie könnte auch eine so wichtige Frau sein wie Betsy Ross (=berühmte Amerikanerin). Ja, er sollte stehlen, wenn er fühlt, dass das Leben seiner Ehefrau so viel wert ist, wie die Möglichkeit, für den Diebstahl ins Gefängnis zu gehen Ja. Er rettet immerhin das Leben einer Person, sie ist ein Mensch, ob er sie liebt oder nicht. Die Menschen sollten das Beste tun, um das Leben der anderen Menschen zu erhalten. Nein. Ich denke, er sollte nicht stehlen, was immer auch. Er könnte ins Gefängnis kommen, wenn er erwischt würde. Er sollte wirklich nicht stehlen. Er sollte stehlen. Weil, wenn jemand weiß, dass er sie hat sterben lassen, würde er ein schuldiges Gewissen haben. Selbst wenn er diese Person nicht genau kennen würde. Er würde es immer mit sich herumtragen, dass er das Leben dieser Person hätte retten können. 89 I.Vorkonventionelles Niveau 1. Orientierung an Strafe / Egozentrismus 2. Eigene Interessen bzw. instrumenteller Austausch / konkreter Anderer II. Konventionelles Niveau 3. Interpersonelle Anerkennung und Harmonie / Familie und primäre Bezugsgruppen 4. Soziale Anerkennung und Systemerhaltung / System wie Staat oder Religionsgemeinschaften III. Postkonventionelles Niveau 5. Sozialverträge, Nützlichkeit, individuelle Rechte / rationales Subjekt 6. Allgemeine ethische Prinzipien und Gerechtigkeit / rationales und perspektiveübernehmendes Subjekt Aufgabe 2: Bitte Volksweisheit, Zitat, Losung oder Ähnliches in dritter Spalte ergänzen Bindung: Eine Trennung der Eltern erhöht das Risiko eines Wechsels von einer sicheren in eine unsichere Bindung (siehe Zimmermann-Text). Wie könnte man dies erklären? Antworten: Nein, es ist nicht recht, zu stehlen, aber es könnte nicht falsch sein, wenn er seine Ehefrau rettet; das Leben einer Person ist wichtig für ein Land. Sie könnte auch eine so wichtige Frau sein wie Betsy Ross (=berühmte Amerikanerin). 4 Ja, er sollte stehlen, wenn er fühlt, dass das Leben seiner Ehefrau so viel wert ist, wie die Möglichkeit, für den Diebstahl ins Gefängnis zu gehen. 2 90 Ja. Er rettet immerhin das Leben einer Person, sie ist ein Mensch, ob er sie liebt oder nicht. Die Menschen sollten das Beste tun, um das Leben der anderen Menschen zu erhalten. 5 Nein. Ich denke, er sollte nicht stehlen, was immer auch. Er könnte ins Gefängnis kommen, wenn er erwischt würde. Er sollte wirklich nicht stehlen. 1 Er sollte stehlen. Weil, wenn jemand weiß, dass er sie hat sterben lassen, würde er ein schuldiges Gewissen haben. Selbst wenn er diese Person nicht genau kennen würde. Er würde es immer mit sich herumtragen, dass er das Leben dieser Person hätte retten können. 3 (Kommentar AR: Wird üblicherweise so eingeordnet, ich finde persönlich die Zuordnung nicht eindeutig) Nach Peter Zimmermann gibt es verschiedene Faktoren, die einen Einfluss auf die Kontinuität der Eltern-Kind-Bindung haben können. In diesem Zusammenhang bezeichnet er eine Trennung der Eltern als Risikofaktor für einen Übergang von einer sicheren zu einer unsicheren Bindung des Kindes. Für diese Annahme lassen sich verschiedene Gründe aufführen: Eine Trennung der Eltern beeinträchtigt die emotionale Verfügbarkeit beider Elternteile bei gleichzeitig erhöhtem Bindungsbedürfnis des Kindes. In einer emotional belastenden Situation, die das Kind nicht alleine meistern kann, wird es sich an seine primären Bindungspartner – also in aller Regel die Eltern – wenden, um Unterstützung zu suchen. Im Falle einer Trennung kann es hierbei auf Schwierigkeiten stoßen: Während ein Elternteil gar nicht mehr unmittelbar verfügbar ist (räumliche Trennung) ist es wahrscheinlich, dass auch der „gebliebene“ Elternteil durch die eigene Betroffenheit und Belastung weniger „emotionale Kapazität“ für das Kind zur Verfügung hat. Eine wichtige Voraussetzung für eine sichere Bindung sind die Feinfühligkeit und Aufmerksamkeit des Erwachsenen in Bezug auf das Kind sowie eine erlebte Konstanz der Interaktion zwischen Eltern und Kind. Feinfühligkeit und Aufmerksamkeit können durch die auch für den Erwachsenen belastende Situation (s.o.) eingeschränkt sein, 91 ebenso kann der Umgang beider Elternteile mit dem Kind längerfristig verändert sein (durch die neue Situation, Belastung, Angst, etwas falsch zu machen, „neues Leben“ der Partner etc). In einer Trennungssituation mag das Kind die Unsicherheit und (in diesem Fall) Vergänglichkeit von Bindungen wahrnehmen (wenn auch wohl nur ältere Kinder das bewusst aufnehmen können); zudem werden besonders auch jüngere Kinder Schwierigkeiten haben, die Trennung nicht auf sich zu beziehen- schließlich verlässt ein Elternteil die Familie und damit auch sie selbst. Dieses verlassen werden kann u.U. als Bindungsabbruch empfunden werden. Durch diese Faktoren kann im ungünstigsten Fall (natürlich nicht zwangsläufig!) ein Kreislauf in Gang gesetzt werden (Kind sucht vermehrt nach Unterstützung welche Eltern momentan weniger geben können Kind ist verunsichert zieht sich u.U. zurück oder wird auffällig, würde eigentlich noch mehr Hilfe und Aufmerksamkeit benötigen was Eltern noch mehr überfordert usw.), der eine sichere in eine unsichere Bindung verwandelt. 92