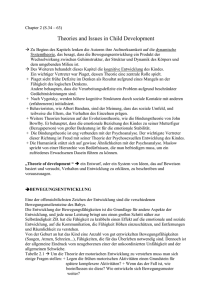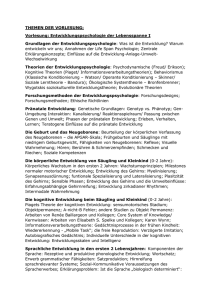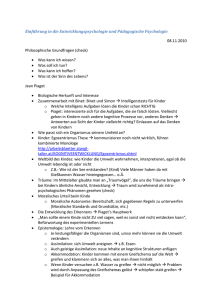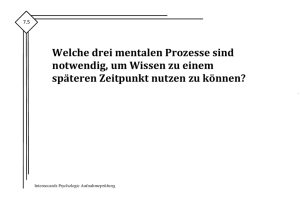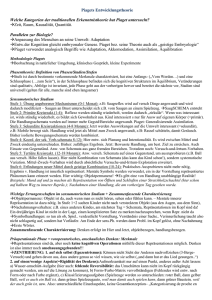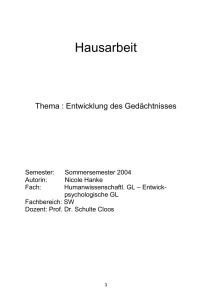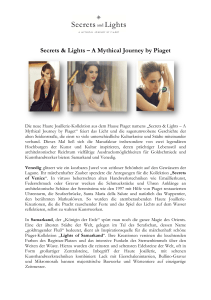Entwicklung in der Kindheit
Werbung
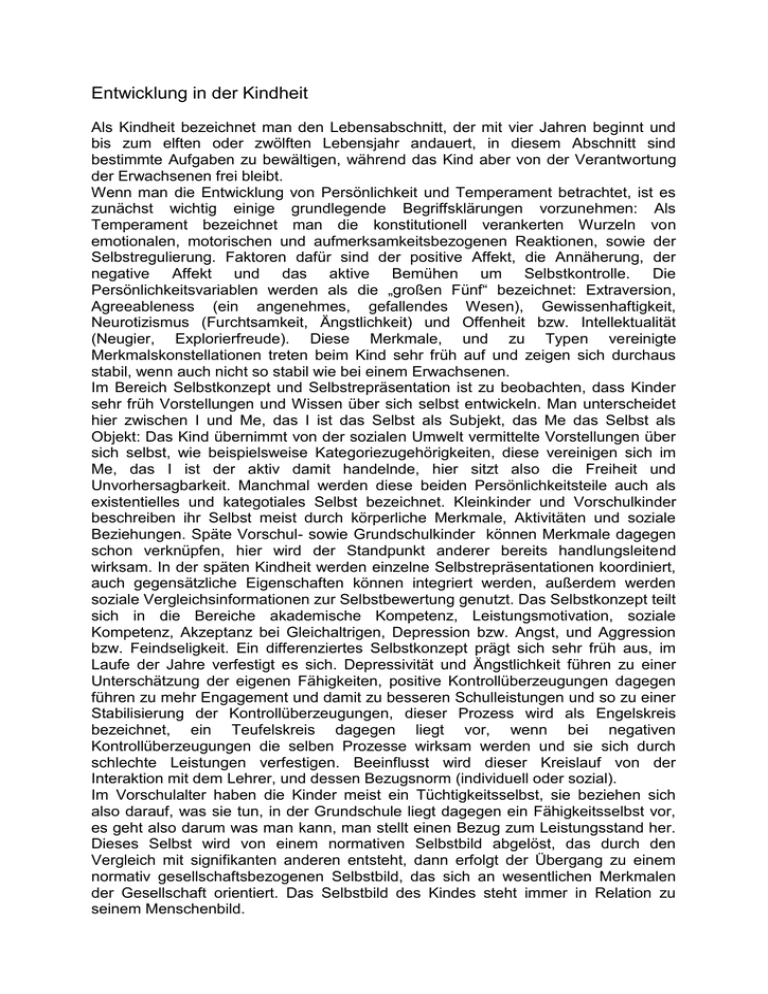
Entwicklung in der Kindheit Als Kindheit bezeichnet man den Lebensabschnitt, der mit vier Jahren beginnt und bis zum elften oder zwölften Lebensjahr andauert, in diesem Abschnitt sind bestimmte Aufgaben zu bewältigen, während das Kind aber von der Verantwortung der Erwachsenen frei bleibt. Wenn man die Entwicklung von Persönlichkeit und Temperament betrachtet, ist es zunächst wichtig einige grundlegende Begriffsklärungen vorzunehmen: Als Temperament bezeichnet man die konstitutionell verankerten Wurzeln von emotionalen, motorischen und aufmerksamkeitsbezogenen Reaktionen, sowie der Selbstregulierung. Faktoren dafür sind der positive Affekt, die Annäherung, der negative Affekt und das aktive Bemühen um Selbstkontrolle. Die Persönlichkeitsvariablen werden als die „großen Fünf“ bezeichnet: Extraversion, Agreeableness (ein angenehmes, gefallendes Wesen), Gewissenhaftigkeit, Neurotizismus (Furchtsamkeit, Ängstlichkeit) und Offenheit bzw. Intellektualität (Neugier, Explorierfreude). Diese Merkmale, und zu Typen vereinigte Merkmalskonstellationen treten beim Kind sehr früh auf und zeigen sich durchaus stabil, wenn auch nicht so stabil wie bei einem Erwachsenen. Im Bereich Selbstkonzept und Selbstrepräsentation ist zu beobachten, dass Kinder sehr früh Vorstellungen und Wissen über sich selbst entwickeln. Man unterscheidet hier zwischen I und Me, das I ist das Selbst als Subjekt, das Me das Selbst als Objekt: Das Kind übernimmt von der sozialen Umwelt vermittelte Vorstellungen über sich selbst, wie beispielsweise Kategoriezugehörigkeiten, diese vereinigen sich im Me, das I ist der aktiv damit handelnde, hier sitzt also die Freiheit und Unvorhersagbarkeit. Manchmal werden diese beiden Persönlichkeitsteile auch als existentielles und kategotiales Selbst bezeichnet. Kleinkinder und Vorschulkinder beschreiben ihr Selbst meist durch körperliche Merkmale, Aktivitäten und soziale Beziehungen. Späte Vorschul- sowie Grundschulkinder können Merkmale dagegen schon verknüpfen, hier wird der Standpunkt anderer bereits handlungsleitend wirksam. In der späten Kindheit werden einzelne Selbstrepräsentationen koordiniert, auch gegensätzliche Eigenschaften können integriert werden, außerdem werden soziale Vergleichsinformationen zur Selbstbewertung genutzt. Das Selbstkonzept teilt sich in die Bereiche akademische Kompetenz, Leistungsmotivation, soziale Kompetenz, Akzeptanz bei Gleichaltrigen, Depression bzw. Angst, und Aggression bzw. Feindseligkeit. Ein differenziertes Selbstkonzept prägt sich sehr früh aus, im Laufe der Jahre verfestigt es sich. Depressivität und Ängstlichkeit führen zu einer Unterschätzung der eigenen Fähigkeiten, positive Kontrollüberzeugungen dagegen führen zu mehr Engagement und damit zu besseren Schulleistungen und so zu einer Stabilisierung der Kontrollüberzeugungen, dieser Prozess wird als Engelskreis bezeichnet, ein Teufelskreis dagegen liegt vor, wenn bei negativen Kontrollüberzeugungen die selben Prozesse wirksam werden und sie sich durch schlechte Leistungen verfestigen. Beeinflusst wird dieser Kreislauf von der Interaktion mit dem Lehrer, und dessen Bezugsnorm (individuell oder sozial). Im Vorschulalter haben die Kinder meist ein Tüchtigkeitsselbst, sie beziehen sich also darauf, was sie tun, in der Grundschule liegt dagegen ein Fähigkeitsselbst vor, es geht also darum was man kann, man stellt einen Bezug zum Leistungsstand her. Dieses Selbst wird von einem normativen Selbstbild abgelöst, das durch den Vergleich mit signifikanten anderen entsteht, dann erfolgt der Übergang zu einem normativ gesellschaftsbezogenen Selbstbild, das sich an wesentlichen Merkmalen der Gesellschaft orientiert. Das Selbstbild des Kindes steht immer in Relation zu seinem Menschenbild. In der Kindheit ist das Spielen ein wichtiger Bestandteil, jedoch gibt es über die Funktion des Spiels verschiedene Meinungen: Einige denken es ginge darum überschüssige Energien aufzufangen, andere meinen das Spiel hätte Erholungsfunktion, wieder andere behaupten es ginge um das Einüben wichtiger Fähigkeiten und um die Ausbildung von Funktionen. Es wird zudem von Einigen die Meinung vertreten, dass es sich nur um wirkliches Spielen handelt wenn ein Spielobjekt vorhanden ist, das Spiel hat dann die Form eines Theaterstücks bezüglich des Spannungsbogens. Der Sinn des Spiels besteht in einer existentiellen Erregung die zum Bewusstwerden der eigenen Existenz führt oder in der Isolation vom Leben durch das Entweichen in eine andere Welt. Merkmale des Spiels sind der Selbstzweck, der zu einem flow-Erlebnis führen kann, der Wechsel des Realitätsbezugs und Wiederholungen, die fast an Rituale erinnern. Freuds Theorie zum Spiel dreht sich um Wunscherfüllung und Karthasis, tabuisierten Impulsen kann nachgegeben werden, es herrscht das Lustprinzip, die Karthasishypothese nimmt an, dass durch das Ausleben früherer Probleme und unerlaubter Triebwünsche eine Reinigung geschieht, das Kind wird so zum Herrscher der Situation. Wygotski nimmt an, das Spiel diene zur Realisierung unrealisierbarer Wünsche, die Kinder können attraktive Tätigkeiten der Erwachsenen ausführen, ohne aufs Erwachsen werden warten zu müssen. Piaget sieht im Spiel eine Assimilation als Gegenwehr, die Umwelt wird an das Schema des Individuums angepasst, damit setzt es sich gegen die Akkomodationszwänge der Wirklichkeit zu Wehr. Es gibt verschiedene Formen des Spiels: das sensumotorische Spiel wird häufig bei ein bis zweijährigen beobachtet, die Freude an bestimmten Körperbewegungen führt zur Wiederholung, während der Zeit wird es immer mehr auf Gegenstände gerichtet. Im Informationsspiel kommt Explorationsverhalten zum Ausdruck, hier steht der Umgang mit Gegenständen im Mittelpunkt. Beim Konstruktionsspiel werden Gegenstände genutzt um daraus einen Zielgegenstand herzustellen. Als-Ob-Spiele, auch Symbol- oder Fiktionsspiele genannt sind die eigentliche kindliche Spielform, Handlungen aus dem sozialen Umfeld, also aus der eigenen Erfahrungswelt werden hier übernommen. Das Rollenspiel, in dem die Kinder fiktive Rollen bekleiden erfordert bereits höhere soziale und kognitive Kompetenz. Regelspiele, meist Wettkampfspiele (z.B. Fußball) erfordern meist spezifische Fähigkeiten oder Kompetenzen die vorher erlernt werden müssen, hier geht es hauptsächlich um Leistungsvergleiche. Welche Spielformen auftreten ist altersabhängig. Beim Symbolsspiel bezieht sich der Akteur nicht mehr nur auf sich Selbst sondern auch auf andere Personen, die Spielhandlungen sind im Vergleich mit den vorherigen Spielformen (sensumotorisch, informativ, konstruierend) komplexer. Der Spielgegenstand wird substituiert, was eine beträchtliche kognitive Leistung erfordert, sowohl bei der bildhaften Vorstellung, als auch bei schlussfolgernden Denken. Beim Sozialspiel beziehen sich alle auf den selben Gegenstand, dies erfordert Metakommunikation also eine Einigung darüber was gespielt wird, diese Spielform tritt erst mit etwa drei ein halb Jahren auf. Das Parallelspiel ist eine Zwischenform zwischen Einzel- und Sozialspiel, die Kinder spielen nebeneinander her und beobachten sich dabei gegenseitig. Der Grund für das Spielen ist eine existenzsichernde und existenzsteigernde Wirkung, es kommt zu einem Aktivierungszirkel: Aktivierung und Erregung steigern sich bis zum Höhepunkt und fallen dann ab. Es findet ein intensiver Austausch mit der Umwelt statt, spezifische Probleme können bewältigt werden, also Erfahrungen die das Kind nicht einordnen kann, oder die unangenehm sind. Es werden sowohl Entwicklungsthematiken, wie das Ausspielen von Macht und Kontrolle und Allmachtsphantasien, als auch Beziehungsthematiken, wie Erfahrungen und Probleme in der Sozialbeziehung zu Eltern , Geschwistern und Gleichaltrigen bewältigt. Die Realitätsbewältigung erfolgt in drei Formen: Nachspielen der Realität, Transformation der Realität und Realitätswechsel. Die Schule ist für das Kind eine wichtige Umwelt, vor allem im Bereich der Intelligenzentwicklung. Unter Intelligenz versteht man die Fähigkeit sich neuen Gegebenheiten der Umwelt anzupassen und die Fähigkeit die Umwelt zu verändern. Die Intelligenzverteilung entspricht der Gaußschen Normalverteilung, wobei dem Mittelwert in den Tests der Wert 100 zugewiesen wird. Allen Einzelleistungen in den verschiedenen Bereichen liegt eine gemeinsame Intelligenzbedingung zugrunde, die als g-Faktor (Generalfaktor) bezeichnet wird. Die fluide Intelligenz entspricht am ehesten dem g-Faktor, sie enthält Leistungen des Denkens, der Wahrnehmung, des Gedächtnisses und der Motorik, sie nimmt ab einem bestimmten Alter ab. Die kristalline Intelligenz bezieht sich auf die Bereiche Wissen und Sprache, ihr Wert erhöht sich während der gesamten Lebensspanne. Die triarchische Theorie der Intelligenz unterscheidet drei Bereiche: analytische, kreative und praktische Fähigkeiten. Das individuelle Intelligenzniveau stabilisiert sich mit etwa elf Jahren, was zum einen genetische Ursachen hat, sich aber zum anderen auf die Stabilität der Umwelt, vor allem der schulischen Einflüsse zurückführen lässt. Mit der Dauer des Schulbesuchs steigt die Intelligenzleistung an, bei zwei gleichaltrigen Kindern ist im allgemeinen der intelligenter, der länger die Schule besucht hat. Bei der Entwicklung der Intelligenz gibt es viele Risikofaktoren der Umwelt: Zum Beispiel zeigt sich eine Abhängigkeit von Einflüssen durch die Mutter, ihr Verhalten, ihre Theorien über Entwicklung, ihre Ängstlichkeit, ihre psychische Gesundheit und ihr Bildungsniveau sind hier zu nennen. Auch soziale Unterstützung durch die Familie, Familiengröße, stressreiche Lebensereignisse, Beruf der Eltern und benachteiligter Minoritätsstatus machen sich bemerkbar. Wenn mehrere ungünstige Faktoren zusammenkommen summiert sich ihr Einfluss. Die Umwelt entfaltet ein genetisch bedingtes Ausgangspotential, Risikofaktoren beeinträchtigen diese Entfaltung. Die Wechselwirkungen zwischen Intelligenz und schulischer Förderung erschweren eine vorab Entscheidung über die Eignung und Zuweisung an eine bestimmte Schulart. Die fördernde Wirkung der Schule bezieht sich aber nicht nur auf die Wissensvermehrung, also die kristalline Intelligenz, es findet stattdessen eine grundsätzliche kognitive Umstrukturierung statt, da Erfahrungen aus der persönlichen Biographie nur im episodischen Gedächtnis gespeichert werden, während die Schule Kategorien und eine wissenslogische Ordnung anbietet, die zu einer Speicherung im semantischen Gedächtnis führt. Hier kommt der Schriftsprache eine wesentliche Bedeutung zu, da sie eine maximale Dekontextualisierung bedeutet. Die Schulbildung ist auch verantwortlich für das Verständnis von Syllogismen, also aus A folgt B, was folgt dann aus nicht B? Zusammenhängen. Der Kontakt und die Interaktion mit Gleichaltrigen fördert soziale Kompetenzen weit mehr als der Umgang mit Erwachsenen, da die Interaktion hier symmetrisch erfolgt. Bei der Informationsverarbeitung spielen sich folgende Prozesse ab: Der soziale Stimulus wird kodiert, also in die kognitive Struktur eingefügt, dann gedeutet, danach wird nach entsprechendem Antwortverhalten gesucht und dies bewertet, dann wird das Antwortverhalten aktiviert, Rückmeldungen erlauben das Verhalten einzuschätzen, zu verbessern oder zu korrigieren. Soziale Kompetenzen sind bereichsspezifisch. Identität wird durch die Mitgliedschaft in einer Gruppe mitbestimmt, man bezeichnet die als kollektive, oder soziale Identität, und meint damit einen Teil des Selbstkonzepts, der aus dem Wissen resultiert zu einer Gruppe zu gehören, die für das Individuum einen hervorgehobenen Wert und eine emotionale Bedeutung hat. Der Wert der Gruppe ergibt sich aus dem sozialen Vergleich mit anderen Gruppen, man spricht von Gruppenkohäsion, dem Wunsch zu einer bestimmten Gruppe dazuzugehören. Die soziale Kompetenz steht in engem Zusammenhang mit der emotionalen Regulierung, also der Fähigkeit die eigenen Gefühle unter Kontrolle zu halten. Freundschaften verändern sich im Laufe der Entwicklung, zunächst sind sie geprägt von symmetrischer Reziprozität, also von gegenseitigem Geben, dann können Hilfe und Gegenleistung über einen längeren Zeitraum koordiniert werden. Später ist eine Freundschaft durch gegenseitiges Verstehen definiert. Bei der Wahl der Freunde werden folgende Dimensionen berücksichtigt: Die Ähnlichkeit als Tiefenmerkmal, die Altershomo-, bzw. –heterogenität als Oberflächenmerkmal und die räumliche Nähe als sozioökonomisches Merkmal, welcher Dimension wie viel Bedeutung beigemessen wird verändert sich mit dem Alter. Die Entwicklung weist eine Tendenz zur zunehmenden Stabilität, zur größeren Differenziertheit von Verhaltensweisen und zur Vermeidung von Wettbewerb unter Freunden auf. Wachsende Empathie und Hilfsbereitschaft führt zu steigendem prosozialen Verhalten, die Gründe für prosoziales Verhalten verändern sich jedoch mit dem Alter: Der früheste Grund ist eine egozentrische Akkomodation, die aus dem Bedürfnis resultiert eigenes Unbehagen zu vermeiden, dann kommt es zur instrumentellen Kooperation, also zu einem Austausch von Hilfsleistungen, später bemüht sich das Individuum um eine positive Bewertung durch andere, dann internalisiert es einen Sinn für Verantwortung. Später zeigt sich ein autonomer Altruismus, der der Optimierung des Nutzens für alle dient, es ergibt sich weiter ein ausbalanciertes integriertes Netz aus sozialen Beziehungen, der höchste Entwicklungsschritt kann dann als universelle Liebe bezeichnet werden. Prosoziales Verhalten ist gekoppelt an bestimmte internale (psychische) und externale Bedingungen: Die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme muss gegeben sein und das Individuum muss eine bestimmte Stufe im moralischen Urteil erreicht haben, wobei man hier beachten muss, dass das Wissen nicht unbedingt zum Handeln führt, ist das moralische Urteil noch hedonistisch geprägt hat dies einen negativen Einfluss auf prosoziales Verhalten, ist es dagegen an den Bedürfnissen anderer orientiert zeigt sich ein positiver Einfluss. Eine weitere Bedingung ist die Fähigkeit zu Mitgefühl, wobei hier nicht Empathie sondern Sympathie gemeint ist, diese ist im Gegensatz zu Stress zu sehen, der statt Hilfsbereitschaft eher den Wunsch weckt zu entfliehen. Auch Persönlichkeitsmerkmale sind zu beachten, Selbstbehauptung und Selbstwertgefühl haben einen positiven Einfluss, Dominanzstreben dagegen einen negativen, eine hohe Emotionsregulation wirkt sich positiv aus. Auch Geschlechtsunterschiede werden wirksam, Frauen zeigen zwar nur eine etwas stärkere Tendenz zu prosozialem Verhalten aber die Art der Hilfe ist sehr unterschiedlich: Männer leisten eher konkrete Hilfe, Frauen eher verbale, durch Trösten oder Ratschläge. Familiengröße und soziale Schicht haben ebenfalls einen Einfluss auf prosoziales Verhalten, und auch der auslösenden Situation kommt große Bedeutung zu, denn sie muss zunächst als handlungsrelevant eingeschätzt werden, außerdem muss man die eigenen Kompetenzen als hoch genug sehen um zu handeln. In der Schule zeigt sich, dass Außenseiter nur sehr wenig prosoziales Verhalten zeigen. Das soziale Zusammenleben ist von Kooperation und Wettbewerb bestimmt, ab etwa neun bis elf Jahren wird der soziale Vergleich zur Normorientierung und zur Selbstbewertung genutzt. Jugendentwicklung Die Jugend beginnt mit dem Eintritt der Geschlechtsreife, man unterteilt in frühe Adoleszenz (11-14J), mittlere Adoleszenz (15-17J) und späte Adoleszenz (18-21J). Die Forschung konzentriert sich auf die Bereiche Verlauf und psychische Auswirkungen der Pubertät, Bedeutung adaptiver und konflikthafter Bewältigungsmuster für die psychische Gesundheit, pubertärer Wandel und Veränderungen in der Familieninteraktion. Hall bezeichnet Adoleszenz als Sturm und Drang Periode, also eine Zeit extremer Ausprägung des Erlebens und Verhaltens mit innerpsychischen und interpersonalen Konflikten. Die Identität spielt in der Jugend eine wichtige Rolle, man bezeichnet mit diesem Begriff eine Bindung an Sinnkonzepte, kulturelle Werte und die Orientierung an Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft innerhalb der Gesellschaft. Hier ergibt sich ein Problem in komplexen, sich rasch wandelnden Gesellschaften. Schule und Subkultur der Gleichaltrigen werden in der Jugend zu einer wichtigen Orientierungsinstanz, es kommt zu einer Entfremdung und zu Konflikten zwischen der Jugend und der Elterngeneration. Dem Jugendlichen ist ein großes Spektrum unterschiedlicher Wert- und Verhaltensalternativen geboten, dies führt aber auch zu Ungewissheit und Entscheidungsunsicherheit und so zur Desorientierung. Dieser Theorie klammert allerdings subkulturelle Unterschiede aus und pauschalisiert den Generationenkonflikt. Die Theorie der sozialisierten Angst beschäftigt sich mit der Verhaltensformung: Regelkonformes Verhalten wird von der Gesellschaft gebilligt und belohnt, regeldiskonformes Verhalten dagegen missbilligt und bestraft, das führt zu negativen Gefühlen, der sogenannten sozialisierten Angst, die durch regelkonformes Verhalten reduziert und vermieden werden kann. Dadurch dass Rollenerwartungen an Jugendliche aber unklar sind entsteht bei ihnen Unsicherheit bezüglich des Verhaltens, die Jugendlichen sehen keine Möglichkeit die sozialisierte Angst zu verringern und so kommt es zu einer emotionalen Beeinträchtigung. Zur Jugendentwicklung gibt es eine Vielzahl von Theorien, die aus allen Bereichen der Anlage Umwelt Dynamik stammen, einige legen das Gewicht auf die Anlage, andere auf die Umwelt und wieder andere gehen von einer komplexen Interaktion zwischen beidem aus. Anna Freud beschreibt die Jugend über ein Ungleichgewicht aus Es und Ich, das wegen der erhöhten Triebimpulse entsteht, zudem befinden sich Ich und Über-Ich in Konflikt, das führt zu erhöhten Ängsten, die durch Abwehrmechanismen und durch die Entwicklung neuer Formen der Impulskontrolle bewältigt werden können. Abwehrmechanismen sind die Sublimation, also die Transformation von sexuellen Impulsen in sozial akzeptierte Strebungen, die Verschiebung, also die Verlagerung der Impulse auf andere Gegenstände und Personen und die Identifikation, wobei hier die Eltern durch andere Modelle ersetzt werden, was zu einem Norm- und Wertewandel führt. Neue Bewältigungsmechanismen sind die stärkeren kognitiven Fähigkeiten und die Askese, also das Leugnen sexueller Bedürfnisse. Erikson teilt jedem Lebensabschnitt spezifische Aufgaben zu die bewältigt werden müssen, in der Jugend ist dies der Aufbau von Ich-Identität. Das Ich ist hier ein System von Einstellungen, Motiven und Bewältigungsleistungen, die Bewältigung von Krisen zeigt die wachsende Persönlichkeit. Die Entwicklung von Ich-Identität bedeutet den Aufbau von Selbst-Konsistenz, man weiß also worin über Zeit, Situationen und soziale Kontexte hinweg die Einheitlichkeit und Unverwechselbarkeit der eigenen Person besteht. In der Adoleszenz müssen sexuelle und soziale Veränderungen integriert werden, es muss eine Orientierung an der Erwachsenenwelt erfolgen, wobei man eigene Werte und Positionen finden muss. Werte, Ziele und Rollenübernahmen werden durch Krisen gefestigt. Die frühe und mittlere Adoleszenz ist wegen dem Aufbrechen bestehender Identifikationen und wegen dem Verlust der bisherigen Selbstidentifikation seht konflikthaft, eine Synthese, also das Erlangen einer stabilen und integrierten Persönlichkeitsstruktur gelingt erst in der späten Adoleszenz. Havighurst definiert Entwicklungsaufgaben als Lernaufgaben. Hierbei ist die physische Reifung eine universelle Basis dafür, wohingegen sich wegen gesellschaftlicher Erwartungen kulturell relativ spezifische Entwicklungsaufgaben stellen. Individuelle Ziele und Werte, die während des Lebens ausgebildet werden sind die treibende Kraft für die aktive Gestaltung der eigenen Entwicklung. Havighurst beschreibt sensitive Perioden die während der Lebensspanne für bestimmte Lernprozesse besonders geeignet erscheinen. Keine der Entwicklungsaufgaben in der Adoleszenz ist eine isolierte Thematik, alle sind entweder die Fortsetzung einer Kindheitsaufgabe oder Vorbereitung auf eine Aufgabe in der Erwachsenenzeit, der Jugendliche muss hier also multiple Bewältigungsleistungen vollbringen. Einige Entwicklungsaufgaben in der Jugend sind: Sich eine Peer herstellen, den eigenen Körper akzeptieren, engere Beziehungen aufnehmen, sich eine Rolle aneignen, sich von den Eltern lösen, sich über den Beruf Gedanken machen, Vorstellungen über Familie und Partnerschaft entwickeln, sein Selbst kennenlernen und Werte und eine Zukunftsperspektive entwickeln. In der kognitiven Entwicklung zeigt sich in der Jugend eine unmittelbare Erweiterung der Denkoperationen, eine quantitative Verbesserung der Informationsverarbeitung und eine Veränderung bewusstseinsbildender Prozesse. Das Denken ist nun nicht mehr länger auf die Wirklichkeit beschränkt, es können hypothetische Annahmen gemacht werden, es bildet sich die Fähigkeit zur Abstraktion heraus, Metakognition wird möglich, außerdem multidimensionales Denken, also das Einbeziehen von mehreren Aspekten und die Relativität des eigenen Denkens wird erkannt. Die kognitiven Veränderungen können mithilfe von Piagets Stufentheorie oder über den Informationsverarbeitungsansatz erklärt werden, dieser differenziert Teilfunktionen wie Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Metakognition und Strategien der Informationsverarbeitung. Hier zeigt sich im Jugendalter eine Verbesserung in der selektiven Aufmerksamkeit, in den Gedächtnisleistungen und in der Metakognition. Auch die Fähigkeit zur sozialen Kognition nimmt zu und wird zunehmend differenziert, der Jugendliche entwickelt Rollenverständnis und ein differenziertes Verständnis im moralischen Urteil. Eine zunehmende Dekontextualisierung ermöglicht formales Denken. Bei körperlichen und psychosexuellen Veränderungen ist die säkulare Akzeleration e8in wichtiges Phänomen, damit bezeichnet man die Vorverlagerung der Pubertät in den Industrienationen. Dies führt dazu, dass die Kluft zwischen biologischem und sozialem Erwachsensein immer weiter wächst. Vorverlagerte oder retardierte Reifung innerhalb der Gesellschaft hat einen Einfluss auf die psychische Situation des Betroffenen, so zeigen sich Spätreife unausgeglichener und unzufriedener und haben zudem ein negativeres Selbstkonzept, während Frühreife ein erhöhtes Risiko für Drogengebrauch und Devianz haben. Bei Jungs ist zu beobachten, dass Frühreife oft eine übernommene Identität haben, während Spätreife eine erarbeitete Identität vorweisen, bei Mädchen erweist sich Frühreife insofern als Nachteil, als das sie von der Norm der Schlankheit und Grazie abweichen, Mädchen entwickeln so viel häufiger ein negatives Körperbild als Jungs. In der Grundschule erfolgt eine Geschlechtertrennung, Freundschaftsbeziehungen und Cliquen bilden sich meist gleichgeschlechtlich, aufgrund gleicher Aktivitäten und Vorlieben. Das andere Geschlecht wird zunehmend fremdartig und exotisch. Diese Trennung ist ein notwendiger Entwicklungsschritt auf dem Weg zur sexuellen Attraktivität des anderen Geschlechts in der Jugend und im Erwachsenenalter, denn da wird das exotische erotisch. Im Jugendalter zeigen sich bei der Partnersuche eher kurzfristige Strategien, z.B. Dating. Junge Männer bezeichnen Sexualität oft als etwas das von der Beziehung losgelöst existiert, in der Sexualität finden wir ein allgemeines Leistungsprinzip. Die Koituserfahrungen haben sich in den letzten Jahrzehnten stark vorverlagert, die Geschlechter nähern sich in ihrem Sexualverhalten einander an. Erikson definiert die Identität als die Beantwortung der Frage wer man selbst ist, was Kontinuität und Selbstsein beinhaltet, die sensible Phase für die Entwicklung von Identität liegt in der Adoleszenz. Die Urteile bezüglich des Selbstkonzepts bleiben über die Jugend hinweg vergleichsweise stabil, entgegen langläufiger Meinungen ist es also keine Phase des Tumults oder des Umbruchs. Jedoch ist bei der Identitätsentwicklung festzustellen, dass das Selbstbild zunehmend differenzierter und organisierter wird, das Selbst wird kontextspezifisch konstruiert, Real- und Idealbild werden stärker getrennt und auch authentisches und unauthentisches Selbst werden unterschieden, außerdem lernen die Jugendlichen sich aus der Sicht von anderen zu sehen und die Zeitdimension wird einbezogen. Marcia unterscheidet vier Formen von Identität: Diffuse Identität, Moratorium, also einen Zustand während dem man sich grade mit Identitätsfragen auseinander setzt, übernommene Identität und erarbeitete Identität. Er urteilt mithilfe dreier Dimensionen: Krise, Verpflichtung und Exploration, also der Erkundung des in Frage stehenden Lebensbereiches. Nicht jeder durchläuft alle vier Formen und kommt am Ende bei einer erarbeiteten Identität an, es gibt progressive, regressive und stagnierende Verläufe. Beim Wechsel zwischen Identitätsformen ist meist folgender Ablauf zu beobachten: Lebensereignis, Selbstwertsteigerung, erhöhte Kontrollüberzeugung. Bei der diffusen Identität lassen sich weiterhin vier Unterformen unterscheiden: Entwicklungsdiffusion ist ein Übergangstadium zum Moratorium oder zur erarbeiteten Identität. Menschen mit sorgenfreier Diffusion sind angepasst und kontaktfreudig, aber ihre Kontakte sind meist oberflächlich, von kurzer Dauer und ohne verbindliche Werte. Störungsdiffusion ergibt sich aufgrund eines Traumas oder eines unbewältigten kritischen Lebensereignisses, diese Personen sind häufig isoliert und haben unrealistische Größenphantasien. Der Grund für eine kulturell adaptive Diffusion liegt in der multikulturellen Gesellschaft, die Offenheit, Unverbindlichkeit und Flexibilität fordert, am letzten Typ kann noch eine Ausdifferenzierung vorgenommen werden, hier findet sich der traditionelle Typ, der elterliche Muster wiederholt, Normalität ist ihm wichtig, aber im Gegensatz zur übernommenen Identität hält er sich an keine tieferen Verpflichtungen. Der „Surfer“ gleitet wach und spielerisch dahin, während er ständige Positionskorrekturen vornimmt. Der Isolierte ist dagegen rat- und hilflos, eine Patchworkidentität hat keinen festen Identitätskern. Die Selbstdiskrepanztheorie beschäftigt sich mit den intrapersonellen Konflikten, die das Individuum austrägt, hierzu werden Aktual-Selbst, also der augenblickliche Zustand, Ideal-Selbst, also der angestrebte Zustand und Sollen-Selbst, also die innere Repräsentation von Verpflichtungen unterschieden. Es gibt verschiedene Formen der Selbstdiskrepanz: Stimmen Aktual- und Ideal-Selbst nicht überein führt das zu Enttäuschung und Unzufriedenheit, Stehen Aktual-Selbst und Aktual-Andere, also das Bild, das andere von einem haben in Konflikt führt das zu Scham und Verlegenheit. Wenn Aktual-Selbst und Sollen-Andere Differenzen aufweisen wird das als bedrohlich erlebt und ruft furcht hervor. Sind Aktual- und Sollen-Selbst in Konflikt führt das zu Schuldgefühlen und Selbstverurteilung. Im Jugendalter sind hauptsächlich Real-Ideal Diskrepanzen bedeutsam. Die Theorie der symbolischen Selbstergänzung geht davon aus, dass für das eigene Selbst Symbole verwendet werden, z.B. Kleidung, Accessoires, Frisuren, verbale Ausdrücke, Musikvorlieben, etc. insbesondere wenn das Selbst verletzt oder unsicher ist, werden sie zur Kompensation genutzt. In der Jugend führt die beginnende Selbstreflexion zu einer erhöhten Selbstaufmerksamkeit und so zu einer höheren Sensibilität für Defizite und Verletzungen des Selbst, die dann kompensiert werden. Eine weitere Theorie geht von zwei unterschiedlichen Identitäten aus: einer autonomen und einer mutuellen. In der autonomen Identität wird der Mensch als Wesen begriffen, das sich selbst und seine Möglichkeiten erkennt, feste Lebensziele und Wertvorstellungen hat und über sich selbst Kontrolle besitzt. Dilemmata und Konflikten wird in dieser Phase durch Geradlinigkeit aus dem Weg gegangen, die Sozialbeziehungen sind von Respekt, Autonomie und Toleranz gegenüber anderen geprägt. Beim Übergang zur mutuellen Identität findet eine qualitative Strukturveränderung statt, es wird erkannt, dass der Widerspruch wesentlich zum Menschen gehört, man befindet sich also in permanentem Konflikt. In den Sozialbeziehungen werden Widersprüche und Unvereinbarkeiten aufgearbeitet. Für den Suizid ist die Jugend ein besonders kritisches Alter, hier ist festzustellen, dass Mädchen öfter Suizidversuche machen, Jungs ihn aber öfter vollziehen, als Motiv sind meist soziale Konflikte anzuführen. Man kann den Weg zum Suizid in verschiedene Stadien einteilen, zunächst wird er erwogen, aus sozialer Isolierung, aus Stress, Identitätsverletzung und Aggressionshemmung, auch Modelle aus der Umwelt sind hier entscheidend. Dann wird abgewogen, meist erfolgt jetzt eine Ankündigung, die als Hilferuf oder Versuch der Kontaktaufnahme zu verstehen ist. Als letztes erfolgt der Entschluss. Nach der Diskrepanztheorie liegt eine Identitätsstörung vor, die den Wunsch nach Flucht vor dem Selbst weckt. Die Distanz zwischen Real- und Idealbild ist zu groß, dann erfolgt eine Selbstattribuierung, also man weist sich selbst die Schuld daran zu, es folgt erhöhte Selbstaufmerksamkeit und negative Affekte, wie Angst und Depression. Die kognitive Destruktion des Selbst führt dann zur Enthemmung. Der Jugendliche hat die Position einer Marginalperson, also einer Randfigur, die sich zwischen Kindheit und Erwachsensein befindet. Er bewegt sich zwischen zwei Lebensregionen: der Familie und der Peer-group. Die Aufgabe die sich dem Jugendlichen stellt, ist sich von der Familie zu lösen und ein eigenständiges Leben aufzubauen, auf diesen Versuch kann die Familie in unterschiedlicher Weise reagieren: Sie kann versuchen den Jugendlichen festzuhalten oder ihn zum Teil festhalten, zum Teil ausstoßen, quasi an der langen Leine (Delegationsmodus), oder sie kann ihn ganz vernachlässigen und ausstoßen (Ausstoßungsmodus). Der Dissens zwischen Familie und Jugendlichem ist als normal anzusehen, fast bei jedem verschlechtert sich das Wohlbefinden im Elternhaus zwischen dem Zwölften und sechzehnten Lebensjahr. Eine Theorie besagt, dass die Pubertät zwangsläufig zu einer emotionalen Distanzierung führt, dagegen steht die Dämpfungshypothese, laut der eine stärkere Bindung an die Eltern zu weniger Ängstlichkeit und Depressivität führt. Auch bezüglich der Einflüsse der Berufstätigkeit der Mutter gibt es zwei Hypothesen, die eine besagt, dass der erhöhte Stress der Mutter zu weniger Zuwendung für die Kinder führt und die daher stärker gefährdet sind. Die andere geht davon aus, dass sich durch die Berufstätigkeit der Mutter ihr Wohlbefinden erhöht, was sich dann positiv auf die Familie auswirkt. Es ist zumindest nachzuweisen, dass sich in der frühen Adoleszenz kein negativer Einfluss ergibt, und das höchstens die Ablösung vom Elternhaus leichter vollzogen wird, da die Gefahr der Überbehütung nicht gegeben ist. Außerdem ist besonders beim Einfluss auf die Töchter die Modellfunktion der Mutter nicht außer Acht zu lassen. Die Peer-Gruppen erfüllen eine wichtige Funktion, da hier im Gegensatz zur Interaktion mit Erwachsenen Gleichheit und Souveränität gegeben sind. Innerhalb der Peer zeigen sich klare Dominanzhierarchien, gepaart mit altruistischem Verhalten um sich von anderen Gruppen abzugrenzen, es zeigt sich dass das dominanteste Gruppenmitglied auch am prosozialsten ist. Die ausgeprägten Jugendstile sind mit Lebensstilen nicht zu verwechseln, da sie später selten realisiert werden. Die Kommunikation innerhalb der Gruppen erfolgt auch durch soziale Interaktion also durch soziales Handeln oder durch nonverbale Kommunikation über materielle Objekte. Der Jargon ist meist kurz, knapp und stark simplifiziert und erzeugt ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Jugendliche die in Cliquen gebunden sind setzen sich meist von den Leistungsnormen der Erwachsenenwelt ab, während Isolierte die stärkste Erwachsenenorientierung zeigen. Freundschaften sind in der frühen Adoleszenz noch nicht sehr tief oder wechselseitig, dagegen wird in der mittleren Adoleszenz die Sicherheit in der Beziehung besonders akzentuiert, Loyalität und Wechselseitigkeit sind wichtig. In der späten Adoleszenz wird Freundschaft wieder zu einer entspannten gemeinsamen Erfahrung. Zusammen mit den Peers werden immer mehr Ort aufgesucht, die es ermöglichen sich dem anderen Geschlecht zu nähern, je erfolgreicher Jugendliche in ihren Partnerschaften sind, desto größer ist der Zugewinn für ihr Selbstbewusstsein. Entgegen der Annahme das Elternhaus und Peer einander entgegenwirkende Umwelten sind, zeigt sich dass ein enger Zusammenhang zwischen den als positiv wahrgenommenen Beziehungen zu den Eltern und den positiven Peerkontakten besteht. Piaget und die Informationsverarbeitungstheorien Die interne geistige Repräsentation der Welt verändert sich im Laufe der Entwicklung, die menschliche Erkenntnis ist eine Konstruktion und kein Abbild der Realität, diese Konstruktion ist eine aktive Leistung und verändert sich während der Entwicklung. Die innere Strukturierung dieser Konstruktion liefert für wahrgenommene Ereignisse mithilfe von Schemata und Skripts einen Interpretationsrahmen, diese übergeordneten Denkstrukturen sind für die kognitiven Leistungen, aber auch Beschränkungen verantwortlich. Die Entwicklung ist daher eine Veränderung der kognitiven Gesamtstruktur. Die klassische Stadientheorie besagt das die Kognition nicht nur quantitative, sondern durch Restrukturierungsprozesse auch qualitative Veränderungen erfährt, die Stadien bilden dabei eine invariante Sequenz, es können also keine Stadien übersprungen werden, und auch ein Rückfall auf ein früheres Stadium ist ausgeschlossen. Auch ist die Abfolge der Stadien universell, also nicht von kulturellen oder Umweltgegebenheiten abhängig. Piaget unterscheidet vier Hauptstadien, die sich durch charakteristische Geistige Fähigkeiten und Einschränkungen unterscheiden. Das sensumotorische Stadium ist das erste, die Aufgabe hier ist die Entwicklung eines Objektbegriffs, das Kennzeichen hierfür ist die Objektpermanenz, also die Einsicht, das Dinge auch existieren, wenn man sich nicht grade mit ihnen beschäftigt. Für ein kleines Kind gewinnen Objekte nur durch Handlungen Existenz, denn sie konstruieren sich ihre Wirklichkeit durch aktive, handelnde Auseinandersetzung mit der Umwelt. In den ersten zwei Lebensjahren erfolgt dann eine zunehmende Differenzierung zwischen Objekt und Handlung, die aber an den Handlungsspielraum gebunden ist. Die kognitive Grundlage für die Auseinandersetzung mit der Umwelt ist das sensumotorische Schema, dies ist eine spezifische Form der Interaktion mit der Umwelt , und enthält alles Wiederholbare und Generalisierbare. Einzelne Schemata werden während der Entwicklung modifiziert und miteinander kombiniert, können später auch koordiniert werden. Durch diese Koordination entstehen Mittel-Ziel Verbindungen. Den Übergang zur nächsten Phase kennzeichnet das symbolische Problemlösen, das auf Denken basiert, und nicht auf Versuch und Irrtum. Bei diesem Übergang beginnt der Spracherwerb, Imitationen können verzögert auftreten und das symbolische Spiel wird möglich. Die Kinder haben jetzt eine Vorstellung von Objektpermanenz, wenn man ihnen einen Gegenstand zeigt und ihn dann versteckt, suchen sie danach, vorher wurde er nicht mehr beachtet. Die Kinder haben jetzt alles gelernt, was man durch sensumotorische Schemata lernen kann. Die nächste Phase ist das präoperationale Denken (2-7J), eine mentale Repräsentation der Welt ist zwar vorhanden, Operationen, also eine mentale Manipulation der Repräsentation, sind aber nicht möglich. Operationen sind internalisierte Handlungen, sie erfordern mental symbolische Repräsentation, verinnerlichte Formen der Handlung, organisierte Strukturen und logische Verknüpfungen. Beispiele dafür sind Reversibilität, Negation und Kompensation. Viele Denkfehler, die bei Kindern in diesem Alter zu beobachten sind, deuten auf eben dieses Fehlen von Operationen hin: Wasser wird von einem schmalen in ein breites Gefäß gekippt, Kinder behaupten in dem Gefäß sei jetzt weniger Wasser, weil es nicht mehr so hoch steht, die Repräsentation ist also nur durch Anfangs- und Endzustand gegeben, nicht durch die Transaktion dazwischen. Die Handlung ist so nicht reversibel, kann also nicht zurückverfolgt werden. Auch ist es dem Kind nicht möglich mehr als nur eine Aufgabendimension zu betrachten, sie merken also nicht, dass die Breite des Gefäßes, die fehlende Höhe ausgleichen könnte. Auch zeigt sich in dieser Phase der kindliche Egozentrismus, sie können nicht den Standpunkt eines anderen nachvollziehen, wenn sie eine Landschaft von einer Position her sehen, ein anderes Kind von einer anderen, können sie sich nicht vorstellen, dass das andere Kind die Landschaft anders sieht. Kausalität wird in diesem Alter intentionalistisch und nicht mechanisch betrachtet, wenn sich leblose Dinge bewegen wird ihnen ein eigener Wille zugeschrieben, die Kinder haben also ein animistisches Weltbild. Der Übergang zur nächsten Phase wird mit dem Erkennen der Invarianz von Masse eingeleitet, diese kann über Reversibilität (man kann das Wasser ja auch wieder zurückschütten) erklärt werden, transitive Schlüsse können gezogen werden (wenn a=b und b=c dann a=c), eine soziale Perspektivenübernahme wird möglich, es zeigt sich kein Animismus mehr und Klasseninklusion wird gezeigt. Logische Operationen werden also möglich. Diese Phase nennt man konkret-operationales Denken, allerdings sind diese Operationen nur auf einer konkreten Anschauungsebene möglich, ab etwa 12 Jahren ist das formal operationale Denken erreicht, hypothetisches und theoretisches Denken wird möglich, Operationen können auf Operationen angewandt werden. Man kann jetzt ein wissenschaftliches Vorgehen beobachten: Eine Hypothese wird aufgestellt und sie wird systematisch getestet (eine Größe wird verändert, alle anderen konstant gehalten). Reflexionen über das eigene Denken (Metakognition) ist möglich. Der Entwicklungsmechanismus, den Piaget beim Übergang zwischen den Phasen annimmt ist ein Äquilibrationsprozess, die strukturellen Veränderungen sind das Ergebnis eines ständigen dynamischen Wechselspiels von Anpassungsprozessen. Die Struktur wird verändert wenn ein Diskrepanzerlebnis auftaucht, also ein Ungleichgewicht zwischen dem kindlichen Situationsverständnis und den Anforderungen der Situation besteht, wenn also beispielsweise Vorhersagen nicht eintreten. Das Kind strebt aber nach Gleichgewicht, ihm stehen hierzu zwei Reaktionen zur Verfügung: Assimilation bedeutet die neuen Informationen in die alten kognitiven Strukturen zu integrieren, wobei die unpassenden Komponenten ignoriert werden. Eine Akkomodation bedeutet die Anpassung der kognitiven Strukturen, an die neuen Erfahrungen, hier findet also eine Umstrukturierung statt, einen neue Phase wird erreicht. Diese Wiederherstellung des Gleichgewichts nennt Piaget Reäquilibration. Für Piagets Theorie gibt es zwei Hauptkritikpunkte: Einige Untersuchungen haben herausgefunden, dass Piaget den Ausgangszustand des Kindes, also die kognitiven Möglichkeiten, die einem Säugling zur Verfügung stehen stark unterschätzt. Die kognitiven Fähigkeiten, wie beispielsweise die Objektpermanenz waren bereits vorhanden, entsprachen aber nicht den motorischen Möglichkeiten des Kindes, wenn der Versuch entsprechend vereinfacht wird, kann das Suchen nach dem Gegenstand durchaus gezeigt werden. Auch konnten die Einschränkungen bei den logischen Operationen nicht immer bestätigt werden, auch wurden bereichspezifische Unterschiede in den Stadien gefunden, ein Kind kann also im Bereich Mathematik und Naturwissenschaften durchaus schon formal operieren, während es in sprachlichen Bereichen noch in der konkret operationalen Phase ist. Beim präoperationalen Denken konnten die Defizite durch eine Vereinfachung der Aufgaben behoben werden, der Animismus zeigte sich nur bei mangelndem Vorwissen, bei lösbaren Aufgaben wurde durchaus die Ursache für ein Ereignis gesucht. Bei transitiven Schlüssen haben die Kinder vor allem Probleme sich die Prämissen zu merken, dieses Defizit könnte also auch durch eine Erweiterung des Gedächtnisses behoben werden. Die Informationstheoretiker betrachten im Gegensatz zu Piaget das Kind nicht als Forscher oder Wissenschaftler sondern als Computer. Sie erklären die Entwicklung des Kindes über Unterschiede in der Informationsverarbeitung zwischen Kindern und Erwachsenen, es geschehen also Veränderungen in der Repräsentation und Verarbeitung. Die Grundannahme ist, dass die Informationsverarbeitung begrenzt ist, die zunehmende geistige Leistungsfähigkeit sich aber durch eine Erweiterung der Begrenzung, z.B. durch Strategien ergibt. Automatisierung erhöht die Verarbeitungsgeschwindigkeit und die Kapazität: 2 Items bei zweijährigen, 5 Items bei siebenjährigen und 7 Items bei Erwachsenen. Neo-Piaget Theorien führen die qualitative Veränderung bei Piaget auf eine quantitative Veränderung der Verarbeitungskapazität zurück. Auch bei Piaget war beispielsweise die gleichzeitige Beachtung mehrerer Aufgabendimensionen grundlegend für die Entwicklung. Differenzierte Aufgabenanalysen erfordern, je nach Lösungsweg der Aufgabe und Menge der angewandten Schemata eine höhere Kapazität. Die Stadien sind bei dieser Theorie weiterhin bereichsübergreifend, sie werden aber über den Informationsverarbeitungsansatz reinterpretiert. Case dagegen geht nicht von einem Anstieg der Kapazität sondern der Effizienz aus. Im Kurzzeit- bzw. Arbeitsgedächtnis steht ein konstanter Platz zur Verfügung, aber dadurch, dass immer weniger Platz für die Operationen benötigt wird, bleibt mehr für das Ergebnis der Operationen übrig. Auch er nimmt vier Stadien an, die denen Piagets ähneln (sensumotorische Operationen, repräsentationale Operationen, logische Operationen und formale Operationen), sie zeichnen sich durch eine fortschreitende Komplexität und Abstraktion aus. Die Übergangsmechanismen unterscheiden sich jedoch deutlich von denen Piagets, Automatisierung, biologische Reifung und die Veränderung zentraler begrifflicher Strukturen sind hier die Entwicklungsmotoren. Die Repräsentation bereichsspezifischer Wissenskerne erfolgt in semantischen Netzwerken, und kann auf domänspezifische Aufgaben angewandt werden, aber auch bereichsübergreifende Zusammenhänge werden erkannt, so dass man wieder von globalen Stadien der Entwicklung ausgehen kann. Welche Wissenskerne vorhanden sind, und welche Strukturen bereits erworben wurden beeinflussen den künftigen Wissenserwerb. Die Unterschiede zu Piagets Theorie liegen darin, dass keine logischen, sondern semantische Strukturen angenommen werden, außerdem liegt mehr Gewicht auf spezifischen Lernprozessen. Siegler betrachtet die kognitive Entwicklung als adaptive Strategiewahl, die Höherentwicklung erfolgt nicht Stufenweise, wie bei einer Treppe sondern durch sich überlappende Wellen. Er beobachtete einen U-förmigen Verlauf der Entwicklung, eine neue Strategie wird mal angewandt, und mal nicht, der Strategiegebrauch variiert also intraindividuell. Auch interindividuelle Unterschiede in der Entwicklung lassen sich ausmachen, eine breite Generalisierung ist also nicht möglich. Die von Piaget angenommenen Quellen der Entwicklung konnten von Siegler nicht bestätigt werden. In seiner Theorie steht nicht so sehr der Erwerb der Strategien, wie bei den klassischen Informationsverarbeitungsansätzen, sondern die Auswahl zwischen den Strategien, also die Selektion der Alternativen im Vordergrund. Zur Entstehung des begrifflichen Wissens wird die Theorie Theorie herangezogen, sie nimmt an, dass Wissen sich bereichspezifisch entwickelt, und das Wissen über wichtige Bereiche theorieähnlich organisiert ist. Diese Theorien ähneln wissenschaftlichen Theorien, sind aber von Laien selbst gebildet und können daher wissenschaftlichen Tatsachen widersprechen. Die Laien bilden Theorien und überprüfen sie in Auseinandersetzung mit ihren eigenen Erfahrungen und revidieren sie gegebenenfalls. Diese intuitiven Theorien sind im Gegensatz zu wissenschaftlichen nicht reflektiert, aber sie sind genauso bereichspezifisch, enthalten ontologische Festlegungen, also Definitionen welche Arten von Dingen existieren, und Kausalgesetze. Wenn also Ereignisse wahrgenommen werden, werden diese Theorien darauf angewandt, was zu einer gewissen Voreingenommenheit führen kann. Die kognitive Entwicklung wird als ein Prozess des Theorienwandels begriffen, ähnlich einem Paradigmenwechsels in der Wissenschaft. Neue Begriffe entstehen und können sowohl bekannte als auch neue Phänomene erklären, so ersetzt die neue Theorie die alte. Diese Veränderungen sind zwar dramatisch, spielen sich aber nur in der einen betroffenen Domäne ab, und haben keinen Einfluss auf andere Bereiche. Die wichtigen Domänen dieser Theorie sind intuitive Physik, Biologie und Psychologie. Moralische Entwicklung und moralische Sozialisation (Kohlberg und Piaget) Piaget begann bei seiner Untersuchung mit dem Verständnis von Spielregeln, auch hier teilte er in Stadien ein: Zunächst sind sie motorisch-individuell, dann egozentrisch, danach beginnt die Kooperation zwischen den Spielpartnern, dann werden Regeln kodifiziert und zuletzt ausgehandelt. Wenn jüngere Kinder eine Handlung beurteilen beachten sie die Größe des Schadens, ältere Kinder dagegen die Absicht, der die Handlung folgte. Piaget beschrieb den Übergang von einer heteronomen zu einer autonomen Moral. Eine heteronome Moral liegt bis etwa 10-12 Jahren vor, sie ist von einer starken Autoritätsorientierung geprägt, Regeln werden als gegeben hingenommen, Egozentrismus ist vorherrschend, Strafe wird als Vergeltung betrachtet, auch Unglück kann eine Strafe sein. Gerechtigkeit ist eine Autoritätsentscheidung, Lüge ist nichts weiter als ein hässliches Wort. Die autonome Moral entsteht mit etwa 10-12 Jahren und ist nicht länger an Autorität sondern an Prinzipien orientiert, Regeln werden als Konventionen betrachtet, es liegt Reziprozität vor, also eine Einbeziehung der Standpunkte des anderen. Strafe ist eine Wiedergutmachung und ein Lernangebot, Unglück dagegen ist das Ergebnis von Zufall oder Nachlässigkeit. Gerechtigkeit wird als Gleichheit und Bedürfnisentsprechung interpretiert, Lüge ist eine Unwahrheit, der eine Täuschungsabsicht zugrunde liegt. Kohlberg orientierte sich bei seiner Stufentheorie an Piaget, er entwickelte zunächst drei Stufen: Autoritätsorientierung, Konventionsorientierung und Prinzipienorientierung, er benannte sie dann bezogen auf die Konventionsorientierung um und teilte jeder Phase zwei Unterstufen zu: Die erste Stufe der präkonventionellen Phase („Strafe und Gehorsam“) orientiert sich an erfahrener Strafe und Belohnung, ohne die Autorität in Frage zu stellen, die zweite Stufe („naiver instrumenteller Hedonismus“) folgt der Zweckmäßigkeit, wendet also ein Kalkül an, so dass jeder einigermaßen gut wegkommt. Die zweite Phase ist konventionell, in der ersten Stufe („Interpersonelle- Gruppenperspektive“) richtet sich die Moral nach dem guter Junge, gutes Mädchen Stereotyp, die Absicht der Handlung wird mitberücksichtigt, in der zweiten Stufe („Gesellschaftsperspektive“) werden hierbei auch gesamtgesellschaftliche Aspekte miteinbezogen. In der postkonventionellen Phase ist die erste Stufe („sozialer Kontakt“) gekennzeichnet durch die Einsicht, dass eine Gesellschaft auch ungerecht sein kann, und dass Gesetze, da sie nur Konventionen darstellen verändert werden können, die zweite Stufe („universelle ethische Prinzipien“) bemüht sich darum universelle ethische Prinzipien zu finden. Eingeteilt wurden diese Stufen nach den Begründungen, die verschieden alte Kinder zu ihren Antworten auf das Heinz Dilemma gaben: Heinz Frau ist sterbenskrank, es gibt nur ein Medikament, dass ihr das Leben retten würde, Heinz hat aber nicht genug Geld es ihr zu kaufen, soll er es stehlen oder nicht? Nicht die Antwort (Ja oder Nein) war für die Einteilung wichtig, sondern die Begründungen: Nein weil es verboten ist, Ja, weil er es seinem Gewissen schuldig ist, Nein, weil die Gesellschaft zusammenbrechen würde, wenn alle so handelten etc.. Die erste Antwort wäre erste Phase, erste Stufe, die zweite dritte Phase, zweite Stufe, die dritte Antwort zweite Phase, zweite Stufe. Es zeigte sich eine hohe Korrelation mit Piagets Stufen der kognitiven Entwicklung. Die Unabhängigkeit von der Art des Dilemmas ist aber nicht gegeben, es zeigte sich, dass die Begründungen von der Nachvollziehbarkeit und von der Nähe zum Lebensbereich der urteilenden Person abhängen. Auch konnte die Frage nach der Abhängigkeit von internalisierten Autoritäten nicht beantwortet werden. Das Urteil von Frauen zeigte sich in Untersuchungen von dem der Männer verschieden, Frauen zeigen mehr Anteilnahme und beziehen die Komplexität der Situation mehr mit ein, während das männliche Urteil abstrakter und distanzierter ist, und so mehr auf Logik basiert. Die Universalität ist ebenfalls nicht gegeben, in einer kleinen dörflichen Gemeinschaft ist die zweite Phase, erste Stufe durchaus ausreichend, die Einbeziehung größerer gesellschaftlicher Zusammenhänge ist nicht nötig. Für die moralische Erziehung zeigte sich, dass das zur Kenntnisnehmen höherer Urteile keinen Effekt auf das eigene Urteil hat, dagegen die Diskussion über höhere Argumente schon. Besonders wenn diese genau eine Stufe höher liegen (Plus eins Methode) wirkt sich das auf eigenes argumentieren aus. Disäquilibrierung, also das Schaffen von Diskrepanzerlebnissen wirkte sich ebenfalls positiv aus, weswegen ähnliche Prozesse, wie bei Piagets Stufenübergang angenommen werden, die höhere Stufe ist dabei in der Lage, die Widersprüche aufzulösen und zu integrieren. Gedächtnisentwicklung Die Informationsverarbeitungstheorien konzentrieren sich auf den Erwerb von Gedächtnismechanismen und universelle Entwicklungsabläufe im Gedächtnis. Hierzu werden verschiedene Gedächtnismodelle herangezogen, besonders untersucht sind deklarative Gedächtnisinhalte, also bewusste, bzw. explizite Gedächtnisinhalte. Indirekte, bzw. implizite Gedächtnisleistungen dagegen sind die verhaltenswirksamen Nutzungen von Erfahrungen, dies läuft nicht bewusst ab. Der klassische Versuch zur Untersuchung des Gedächtnisses ist das Auswendiglernen von Wortlisten, die sich zum Teil in Kategorien einteilen lassen, das Reproduzieren kann durch freies oder unterstütztes Erinnern (Wiedererkennen) geschehen. Untersuchte Bereichsfelder sind so das strategische Lernen und das Erinnern nach absichtlichem (intentionalen) Informationserwerb, weniger erforscht ist dagegen das langfristige Lernen, störende Gedächtnisinhalte und das Lernen ohne Strategie. Unterscheiden muss man das episodische und das semantische Gedächtnis, im episodischen sind spezifische und raum-zeitlich lokalisierbare Ereignisse gespeichert, im semantischen dagegen strukturiertes und organisiertes Wissen, das vom Kernkontext unabhängig ist und langfristig erhalten bleibt. Informationserwerb und Abruf sind eng verzahnt, das episodische Gedächtnis nimmt bis zum Alter von 20 Jahren steil zu, erreicht dort einen Höhepunkt und fällt dann langsam aber stetig ab. Zur Beschreibung des Gedächtnisses gibt es drei verschiedene Modelle: Das Speichermodell, das Prozessmodell und das Gedächtnissystemmodell. Das Speichermodell nimmt drei verschiedene Teile des Gedächtnisses an: das sensorische Register, in dem alle wahrgenommenen Informationen, wie eine analoge Kopie für kurze Zeit gespeichert werden, das Kurzzeitgedächtnis, in das von der Aufmerksamkeit ausgewählte Informationen aus dem sensorischen Register gelangen, um weiterverarbeitet zu werden, und das Langzeitgedächtnis in dem die Informationen dann abgelegt werden wenn sie sinnvoll assimiliert werden konnten. Von hier ist ein erneuter Abruf in den Arbeitsspeicher, also das Kurzzeitgedächtnis möglich. Das Prozessmodell betrachtet die Verarbeitungsprozesse: Informationserwerb, Speicherung und Abruf, die Verarbeitung kann auf verschiedenen Ebenen geschehen: Eine bedeutungshaltige also tiefe Verarbeitung bedeutet die semantischen Inhalte der Information zu erfassen, eine bedeutungsarme oder oberflächliche Verarbeitung beschränkt sich auf die perzeptiven Merkmale der Information. Eine tiefe Verarbeitung führt zu einer besseren Behaltensleistung und zu einer besseren Abrufbarkeit. Das dritte Modell ist ein Komplexes Gedächtnissystem, das auch nicht deklarative Gedächtnisinhalte mit einbezieht. Darunter fallen Fertigkeiten, also prozedurale Gedächtnisinhalte, außerdem perzeptuell semantische Inhalte, also alte und neue Informationen, Dispositionen, wie Ergebnisse einer klassischen oder operanten Konditionierung und nicht assoziative Inhalte, wie Habituierung und Sensitivierung. Durch unterschiedliche Bedingungen in der Lern- und Abrufphase werden deklarative und nicht deklarative Gedächtnisleistungen gehemmt oder gefördert, Amnesien betreffen meist nur das deklarative Gedächtnis. Deklarative Speicherung ist erst ab dem dritten bis zwölften Monat möglich. Das Gedächtnis von Säuglingen wird über Präferenz oder Habituierungsmethoden untersucht: Unbekannte Gegenstände werden von Säuglingen länger betrachtet, so sind Rückschlüsse über die Repräsentationen im Gedächtnis möglich. In den ersten Wochen und Monaten zeigt sich ein gutes Gedächtnis für statische Gegenstände und ihre Merkmale, dynamische Informationen dagegen werden recht schnell wieder vergessen: Wenn man bei einem Kind Verhaltensweisen operant konditioniert, werden die erlernten Fähigkeiten bereits nach einer Woche wieder vergessen. Objektpermanenz zeigt sich im Gegensatz zu Piagets Annahmen bereits mit vier Monaten, verzögerte Nachahmung bereits mit 16 Monaten. Als kindliche Amnesie wird der Umstand bezeichnet, dass sich Erwachsene nicht an Ereignisse vor dem dritten Lebensjahr erinnern Können. Der Umfang, bzw. die Kapazität des Gedächtnisses wird gemessen an der Zahl der unverbundenen Einzelelemente die bei schneller Präsentation behalten werden, bei einem Erwachsenen sind das 7 (+-2 Items). Die Kapazität variiert mit dem Alter, die Kapazitätshypothese nimmt an, dass die Ursache für die unterschiedliche Leistungsfähigkeit des episodischen Gedächtnisses hier zu suchen ist. Die Kapazität steigt beim Kind stetig an, es ergeben sich allerdings Unterschiede beim Material (Zahlen, Bilder, Worte) was wohl auf angewandte Gedächtnisstrategien zurückzuführen ist. Dass im Erwachsenenalter Ziffern immer gleich gut gemerkt werden, die Fähigkeit für Wörter jedoch abnimmt, ist der Grund weswegen die Ressourcentheorie den Leistungsabfall nicht der Kapazität sondern der Änderung der basalen Ressourcen zuschreibt, z.B. der Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung. Die Strategiehypothese dagegen sieht die Änderung der Strategienanwendung als Grund für Änderungen in der Behaltensleistung. Strategien sind bewusstseinsfähige, absichtlich verwendete und kontrollierbare kognitive Aktivitäten, die zur Optimierung der Gedächtnisleistung führen, sie werden beim Enkodieren, Speichern und Abrufen eingesetzt, Beispiele sind Wiederholen, Organisieren nach semantischen Klassen, Elaboration des Lernmaterials und Benutzung von Gedächtnisstrategien. Kinder können die Strategien bei immer komplexeren Aufgaben anwenden, aber einige Fehler können die Behaltensleistung mindern: Das Produktionsdefizit meint, dass das Kind die Strategie zwar kennt, sie aber nicht anwendet, das Mediationsdefizit bedeutet, dass das Kind eine Strategie zwar lernt, sie aber nicht zu besseren Behaltensleistungen führt, das Wirksamkeitsdefizit bedeutet, dass obwohl die Strategie spontan produziert und verwendet wird kein Effekt zu beobachten ist. Nicht nur die Kenntnis einer Strategie ist Voraussetzung für ihre Anwendung, sondern auch gedächtnisbezogenes Wissen, also ein Metagedächtnis. Die Strategieverwendung stellt eine Kosten Nutzen Rechnung dar, am Anfang ist das Verwenden einer neuen Strategie mit einem hohen Aufwand verbunden, wegen der Unvertrautheit der Strategie, deswegen sollte man, wenn man eine neue Strategie beibringt deren Anwendung durch leichtes Material und Belohnung für erinnerte Items fördern. Im Erwachsenenalter nimmt die Behaltensleistung immer weiter ab, eine Theorie nimmt an, dass das an der eher handlungsbezogenen Organisation der Items liegt, eine andere besagt, dass durch Interferenz ganze Kategorien vergessen werden, wieder eine andere nimmt an, dass die Informationsverarbeitung instabiler wird, und eine letzte meint, dass die selbstinitiierte strategische Informationsverarbeitung nachlässt. Wissen ist die Grundlage für den Erwerb neuer Informationen, es unterteilt sich in Weltwissen und bereichsspezifisches Wissen, das vorausgegangene Wissen bedingt den Einsatz von Strategien. Die Wissenshypothese nimmt an, dass die Defizite in den Erinnerungsleistungen jüngerer Kinder auf Defizite in ihrem Wissen zurückzuführen sind. Deswegen kann auch die Menge an Vorwissen altersabhängige Defizite ausgleichen, teilweise führt es sogar zu einer generellen Verbesserung des Kurzzeitgedächtnisses, nicht nur zu einer bereichsspezifischen. Alltagsbezogene Handlungen werden von allen Altersgruppen besser memoriert, das nennt man den Handlungseffekt. Das Metagedächtnis enthält gedächtnisbezogenes Wissen, auch hier kann man ein deklaratives und ein prozedurales unterscheiden. Im deklarativen Metagedächtnis befindet sich verbalisiertes Wissen über das Lernen und das Gedächtnis, hier kann man weiter unterteilen in Personenwissen, also Wissen über die Güte des eigenen Gedächtnisses und über das anderer, Aufgabenwissen, also Kenntnisse über unterschiedliche Lern- und Gedächtnisaufgaben und Strategiewissen, also Wissen über Lern- und Erinnerungsstrategien. Das prozedurale Metagedächtnis enthält Informationen über die Nutzung des gedächtnisbezogenen Wissens bei der Bewältigung von Lern- und Gedächtnisaufgaben, beide Teile des Metagedächtnisses sind also eng miteinander verknüpft. Die Metagedächtnishypothese besagt, dass Lernen und Erinnern um so besser funktionieren, je umfangreicher das Metagedächtnis ist. Beim Kind wird das Metagedächtnis im Laufe der Entwicklung immer umfangreicher und realistischer, sowohl im deklarativen als auch im prozeduralen Teil, während kleine Kinder ihre Gedächtnisleistungen noch unrealistisch optimistisch einschätzen, werden ihre Beurteilungen mit dem Alter immer treffender. Im höheren Alter bleiben Aufgaben- und Strategiewissen konstant, das Personenwissen dagegen wird zu pessimistisch, was auf eine Übernahme des Rollenklischees zurückzuführen ist. Das implizite, also das nicht deklarative Gedächtnis weist implizite Bahnungseffekte auf: Ein früher präsentiertes Material kann verhaltensrelevant sein, auch wenn das Material selbst nicht erinnert wird. Das implizite Gedächtnis verändert sich im Laufe des Lebens kaum. Unterschiedliche Gedächtnisbereiche entwickeln sich also unterschiedlich, das deklarative Gedächtnis ist abhängig von Welt- und bereichspezifischem Wissen, den angewandten Strategien, dem Metagedächtnis und den Ressourcen. Sprachentwicklung Die Sprachentwicklung beginnt mit 10-12 Monaten und findet mit fünf Jahren einen ersten Abschluss, das ist das Zeitfenster in dem das Sprachlernen am effektivsten ist. Es entwickeln sich unterschiedliche Komponenten: Eine suprasegmentale Komponente, die prosodische Gliederung und Betonung beinhaltet und zu prosodischer Kompetenz führt. Prosodische Kompetenz bedeutet das Erkennen und die Produktion von Rhythmik, von Spracheinheiten, Tonhöhe, Lautheit, Länge der Sprachlaute und Pausengebung, sie wird als erstes entwickelt. Eine grammatikalische Komponente, die Phonologie, also die Organisation von Sprachlauten beinhaltet, sowie Morphologie, also Wortbildung, Syntax, also Satzbildung und ein Lexikon, das Wortbedeutungen enthält. Die Ausprägung dieses Bereichs führt zu linguistischer Kompetenz. Die Komponente Pragmatik enthält Sprechakte, also sprachliches Handeln und Konversation und Diskussion, also die Kohärenz in der Konversation, die Ausprägung dieses Bereichs führt zu pragmatischer Kompetenz, also dem Wissen über angemessene und kommunikative Verwendung von Sätzen. Diese bereiche sind eigenständige Wissenssysteme, die interagieren, es werden Konzepte und Regeln erworben, auch bezüglich des Zusammenspiels der Komponenten. Dies erfordert große kognitive Leistungen, die das Kind in anderen Bereichen noch nicht vollbringen kann. Das Wort spielt eine zentrale Rolle im Entwicklungsbarometer. Die Entwicklung vom Laut zum Wort, beinhaltet auch Wörter ohne Bedeutungsinhalt, die nur eine sozial- interpersonale Bedeutung haben. Sie beginnt mit ersten Lauten, geht dann zu einem Gurren über, dieses expandiert, weitet sich also auf andere Laute aus, es kommt dann zum kanonischen Lallen auf das erste Wörter folgen. Säuglinge erkennen bereits ihre Muttersprache an prosodischen Merkmalen, aus pränatalen Erfahrungen heraus. Sprachentwicklung geschieht nicht isoliert, muss also im Kontext von kognitiver sozialer und interaktionaler Entwicklung betrachtet werden. Bestimmte kognitive und sozial-affektive Mechanismen haben eine Vorläuferfähigkeit (Fähigkeit, die auf das entsprechende Phänomen vorbereitet, aber einfacher ist) und ermöglichen die Wortproduktion und den Spracherwerb. Die Aufmerksamkeit des Säuglings richtet sich sowohl auf die prosodischen Laute der Mutter, als auch auf ihre Gesichtsbewegungen, Gesicht und Mimik werden also in Einheit mit der Sprache begriffen, Affekt wird erkannt. Vorsprachliche Gesten erfordern Kognitionen, die nicht sprachliche Vorraussetzungen für den Sprachenerwerb sind, Wörter dienen also zur Kategorisierung von Objekten, Reize werden verarbeitet und Schemata entwickelt. Die Gesten entwickeln sich von vor-symbolisch, nur aus dem Kontext erschließbar, zu refferentiell, Zeigen auf einen bestimmten Gegenstand, und werden schließlich konventionalisiert, z.B. Kopfschütteln, Winken. Die Geste ist also ein Vorreiter des Spracherwerbs, jeder Meilenstein in der Sprachentwicklung bedeutet eine Reorganisation in nicht linguistischen Kognitionsbereichen. Angeboren ist dem Kind die Fähigkeit zur phonologischen Wahrnehmung und affektive und kognitive Vorraussetzungen (Bedürfnis nach Kommunikation, Aufmerksamkeit, Differenzierungsfähigkeit, Kategorisierungsfähigkeit und Regelsuche), nicht aber eine Art Universalgrammatik, sie ist Ergebnis des Spracherwerbsprozesses. Um den Spracherwerb erfolgreich zu bewältigen, müssen einige externe Vorraussetzungen gegeben sein: Der Interaktionskontext schafft das Sprachangebot und die Möglichkeit zur Nutzung der Kommunikationsfähigkeiten und bildet so die Basis für den Spracherwerb. Der Passungsgedanke meint, dass das elterliche Interaktionsverhalten auf die perzeptuellen und kognitiven Kompetenzen des Kindes abgestimmt sein muss, es läuft ein intuitives Elternprogramm ab: Mimik, Gestik und Sprechweise werden verdeutlicht und vereinfacht, es wird zwischen Wiederholungen und Neuerungen gewechselt, die Anregung wird auf den kindlichen Zustand abgestimmt, Blickkontakt wird unterstützt, auf das Verhalten des Kindes wird kontingent eingegangen. Man kann drei Phasen der Entwicklung grammatikalischer Kompetenz ausmachen: Zwischen 8-11 Monaten werden Gesten intentional eingesetzt, die Gegenstände werden dann von der Mutter bezeichnet, und die Kinder lernen das Benennen. Ab 16 Monaten sind die Kinder zu sprachlichen Ausdrücken, also Ein Wort Sätzen fähig, und können so fragen und antworten. Ab 2 ½ Jahren können mehrere zusammenhängende Äußerungen gemacht werden. Eltern und Kinder bilden ein didaktisches System, die Mutter steuert das Grammatiklernen des Kindes durch Fragen, Wiederholungen der kindlichen und eigener Aussagen, durch Expansion und einen gesprächsanregenden Stil. Mit etwa 18 Monaten ist bei den meisten Kindern die Entwicklungskritische Zahl 50 erreicht, ihr Wortschatz umfasst also mehr als 50 Wörter, es kommt jetzt zu einer qualitativen Reorganisation des Lexikons, die Kinder wollen erfahrbare Ereignisse und Objekte kategorisieren. Der Wortgebrauch hat jetzt eine abstrakte kognitive Qualität, der Wortschatz erweitert sich nun explosionsartig. Wörter werden miteinander verknüpft auch wenn ihre Bedeutung noch nicht ganz erfasst ist, die Kinder neigen in dieser Phase zur Generalisierung, alles mit Fell ist so ein Hund. Lernen durch Beschränkungen erfolgt, die Zahl der möglichen Wortbedeutungen wird eingeschränkt, in dem bestimmte Strategien angewandt werden, z.B. denkt man immer es bezöge sich auf das Ganze. Zunächst werden hauptsächlich Nomen gelernt, durch assoziative Verknüpfungen, sind aber genug Verben vorhanden, kann die Bedeutung neuer Wörter aus dem Satzkontext erschlossen werden. Bei sogenannten Late-Talkers, also Kindern die auch mit 24 Monaten noch keine 50 Wörter erreicht haben, treten meist Folgen für die weitere sprachliche Entwicklung auf, bei etwa 50% der Kinder zeigen sich später Leseprobleme, schulische Probleme oder sozial- emotionale Probleme bis hin zu Verhaltenstörungen, wegen der negativen sozialen Spirale. Entwicklung der sozialen Kognition Als soziale Kognition bezeichnet man das Wissen über die Welt der sozialen Geschehnisse, den Prozess des Verstehens von Menschen, Beziehungen, sozialen Gruppen und Institutionen, sowie die Organisation sozialer Interaktion. Verstehen ist das Aneignen von neuem Wissen und das Nutzbarmachen von vorhandenem Wissen für die Planung und Ausführung sozialer Interaktion. Dieses Wissen besteht aus Inhalten und Organisationsprinzipien. Das Individuum hat also Wissen und soziales Verständnis für sich selbst und für andere, kann mit anderen sozial interagieren, und kann auch die Interaktion zwischen anderen Verstehen. Soziale Kompetenz ist dann der Endzustand der Entwicklung von sozialem Wissen und Verstehen, und ist notwendig um die Anforderungen der Interaktion zwischen Menschen zu bewältigen. Soziale Kognition muss von der physikalischen unterschieden werden weil die Art des Denkens anders ist, es geht darum sich in andere hineinzuversetzen, Emotionen spielen eine Rolle und der Interaktionspartner reagiert auf die Handlungen. Die Objektpermanenz bezüglich sozialer Objekte erfolgt viel eher, als bezüglich dinglicher Objekte (Piaget), soziale Objekte werden also weit früher intern repräsentiert. Auch die Reversibilität und Kausalität wird in sozialen Geschehnissen früher verstanden. Zur sozialen Kognition gibt es verschiedene Theorien: Die Theorie der Personenwahrnehmung greift auf die Methode der freimündlichen Beschreibung von bekannten Personen oder sozialen Interaktionen im Alltag zurück, problematisch an dieser Untersuchungsmethode ist, dass sie auch von anderen entwicklungsrelevanten Fertigkeiten wie Sprache, Gedächtnis, Aufmerksamkeit, etc. abhängt. Es ergab sich, dass jüngere Kinder soziale Interaktion in viele verschiedene Episoden gliedern, mit dem Alter wird die Einteilung gröber, es werden weniger Einzelereignisse unterschieden. Auch verändern sich die Vorstellungen von Personen und Interaktionen über die Kindheit, die Orientierung an inneren Vorgängen nimmt gegenüber der an beobachtbarem Verhalten zu. Zudem werden die Vorstellungen differenzierter, organisierter und integrierter, an die Stelle von Verallgemeinerungen treten Verschränkungen mit dem situativen Kontext. Allerdings werden diese Ergebnisse auch von den entwicklungsabhängigen Fertigkeiten beeinflusst, da die methodische Erfassung undifferenziert ist. Der kognitiv-, strukturtheoretische Ansatz der Personenwahrnehmung beschäftigt sich mit dem Verstehen des Denkens, Fühlens und Wollens einer anderen Person, und der Entwicklung der Einsicht, dass Handeln situationsgebunden ist. Zunächst muss die Möglichkeit unterschiedlicher sozialer Perspektiven erkannt werden, dann muss ein Bedürfnis nach Erkundung dieser Unterschiede bestehen, entsprechende analytische Fähigkeiten und Fertigkeiten werden entwickelt, und diese Fähigkeiten dann eingesetzt. Die kognitive Perspektivenübernahme ist dabei grundlegend, also das Erschließen des Denkens anderer anhand der Situation. Erst mit 4-5 Jahren wird erkannt, dass andere Perspektiven möglich sind, erst im Grundschulalter können diese anderen Perspektiven dann ausformuliert werden. Erkannt wurde das an einer Untersuchung in der Kinder eine Bildergeschichte bekamen und sie so erzählen sollten, wie sie jemand erzählt der einzelne Bilder nicht gesehen hat. Emotionale Perspektivenübernahme und Empathie, also das Verstehen der Gefühle eines anderen ist bei einfachen Gefühlen ab etwa 4-6 Jahren möglich, bei komplexeren ab 8 Jahren. Empathie und emotionale Perspektivenübernahme sind nicht gleichzusetzen, bei Empathie werden die Gefühle des anderen übernommen, bei Perspektivenübernahme nur nachvollzogen, Empathie kann zu Sympathie führen, aber auch zu aversiven Gefühlen des Betroffenseins, und so zu Fluchtverhalten. Der symbolisch-interaktionistische Ansatz der Perspektivenkoordination beschäftigt sich mit dem Verständnis der eigenen Rolle und der des Gegenübers, aus der sich Erwartungen für sein zukünftiges Handeln ableiten. Die Koordination dieser Rollen bedeutet einen schrittweisen Aufbau in der sozialen Interaktion unter Berücksichtigung des Interaktionskontextes. Zwischen vier und neuen Jahren entwickelt sich ein Bewusstsein über die Subjektivität von Perspektiven, also dem unterschiedlichen Denken in unterschiedlichen Situationen. Zwischen sechs und zwölf Jahren entwickelt sich dann ein reflexives Verständnis dieser Subjektivität, das eigene Handeln kann jetzt aus der Perspektive eines anderen beurteilt werden, dessen Reaktion wird antizipiert. Zwischen neuen und zwölf Jahren erfolgt dann eine wechselseitigen Perspektivenkoordination, beide Seiten beziehen die Perspektive des anderen mit ein. Ab zwölf Jahren kann dann die Perspektive sozialer Bezugsgruppen übernommen werden, also eines sozialen Systems mit Normen und Werten. Die Handlungserklärung über den attributionstheoretischen Ansatz zeigt, dass Kinder als Attributionsschema vor allem nach dem Kovariationsprinzip verfahren, das heißt sie sehen die Ursachen einer Handlung in der Bedingung mit der das Verhalten über die Zeit variiert. Hier werden drei Gesichtspunkte miteinbezogen: Die Herausgehobenheit, ob unter anderen Bedingungen anderes Verhalten gezeigt wird, also gegenüber anderen Personen oder in anderen Situationen. Der Konsens, also ob sich andere Personen unter denselben Bedingungen genauso verhalten, und die Konsistenz, ob das Verhalten bei verschiedenen Gelegenheiten gleich gezeigt wird. Beispielsweise liegt das freundliche Verhalten von Person A gegenüber Person X dann an Person X und nicht an dem freundlichen Wesen von Person A, wenn A gegenüber anderen Personen nicht so freundlich ist, oder wenn alle gegenüber X so freundlich sind. Das Abwertungsprinzip meint, dass die Ursachen an Bedeutung verlieren, wenn mehrere angenommen werden, das kann erst ab etwa acht Jahren miteinbezogen werden. Erst ab dem Jugendalter kann das Aufwertungsprinzip angewandt werden: Die förderliche Ursache erhält einen größeren Wert, wenn sie sich gegen hemmende Faktoren durchsetzt. Wissenspsychologische Ansätze beschäftigen sich mit der Art, wie soziales Wissen repräsentiert und organisiert ist. Die Theorie über die Repräsentation von Ereignissen und Handlungssequenzen nimmt an, dass Skripten vorhanden sind um Alltagsituationen routinemäßig abzuhandeln, die Informationsverarbeitung wird so entlastet und kann komplexere Situationen analysieren. Diese Skripten sind von der Struktur in jedem Alter gleich, die Inhalte werden jedoch immer komplexer. Die Repräsentation in Schemata erleichtert Verstehensprozesse. Die interpersonale Problemlösefähigkeit, also das Einbeziehen verschiedener Handlungsalternativen, und die Fähigkeit deren Folgen abzuschätzen erhält mit der Entwicklung mehr Alternativen, die Abschätzungen werden treffender. Die naiven Theorien (theory of mind) sehen die Annahmen über die Realität, auch wenn es falsche Annahmen sind als Leitfaden für Handlungen. Kleine Kinder sehen diese Verbindung noch nicht, sie sehen also Fehlinformationen nicht als Grund für Fehlentscheidungen. Untersucht wurde das an der Geschichte vom kleinen Maxi. Den Kindern wurde erzählt, dass Maxi die Schokolade in den grünen Schrank in der Küche legt, während er beim Spielen ist nimmt die Mutter die Schokolade aus dem grünen Schrank und legt sie in den blauen. Jetzt werden die Kinder gefragt wo Maxi die Schokolade suchen wird wenn er wiederkommt. Kinder vor dem Grundschulalter behaupten im blauen Schrank, obwohl Maxi gar nicht wissen kann, dass sie nicht mehr da ist wo er sie hingelegt hat. Die Kinder haben also kein Konzept von falschen Überzeugungen, sie können im Vorschulalter auch von sich selbst nicht sagen woher sie eine Überzeugung haben, aus eigenem Erleben oder vom Hören-Sagen. Aber auch 4jährige können Täuschungsstrategien anwenden, manche Forschungen haben bei einer Vereinfachung der Aufgaben bei 3jährigen das Verständnis beobachtet, dass Realität und Überzeugungen im Widerspruch stehen können. Die soziale Kognition über Gruppen und Normen schlägt sich zunächst in interpersonalen Beziehungen nieder, hier ist interessant welche Prinzipien im Umgang miteinander verwendet werden, und wie sich deren Verständnis ändert. Zur Dominanz wurde beobachtet, dass im Vorschulalter keine Übereinkunft getroffen wird, wer was zu sagen hat, erst im Schulalter bilden sich Hierarchien heraus, sie dienen zur Vermeidung unnötiger Konflikte. Freundschaften sind mit sechs Jahren noch geprägt von Reziprozität, d.h. man gibt dem anderen was man von ihm erhalten hat, dies geschieht unmittelbar, Zug um Zug. Ab elf Jahren herrscht dann Reziprozität bezüglich der Bedürfnisse vor, man unterstützt sich gegenseitig, geht aber auf die unterschiedlichen Anforderungen ein. Ab 14 Jahren ist die Freundschaft geprägt von Vertrautheit und gegenseitigem Verstehen, Offenheit und Intimität. Auch das Akzeptieren von Autoritäten ändert sich im Laufe der Entwicklung, ein Führungsanspruch legitimiert sich für kleinere Kinder durch eine persönliche Bindung zwischen dem Kind und dem Führenden, später durch Macht, also durch die Möglichkeit zu Belohnen und durch physische Überlegenheit, etc.. Dann kennzeichnet sich eine Führungspersönlichkeit durch geistige Überlegenheit, in der Adoleszenz dann durch Führsorge und Achtung vor den Gefühlen. Bereits in der Grundschule können Gleichaltrige Autoritäten darstellen. Auch das Verständnis für soziale Rollen und Regeln und für Erwartungen, die an soziale Positionen geknüpft sind, verändert sich im Laufe der Entwicklung: Vor dem Alter von sechs Jahren ist kein Verständnis für Mehrfachrollen vorhanden, der eigene Vater ist Vater und kann nicht gleichzeitig Sohn vom Opa sein. Ein Familienkonzept (Vater, Mutter, Kind) entwickelt sich unabhängig von der Struktur der eigenen Familie. Bei Konventionen, also sozialen Regeln wurde festgestellt, dass bereits sechsjährige den Unterschied zwischen Konventionen, also Vereinbarungen und moralischen Imperativen verstehen. Die Entwicklung von ökonomischen Konzepten beginnt bereits im Vorschulalter, Kinder können Produktion und Handel voneinander trennen, in Alltagsdingen ist dieser Trennungsprozess mit etwa 10 Jahren abgeschlossen, wobei Landkinder hier einen leichten Vorsprung haben, der sich aber in der Schule ausgleicht. Wichtige Differenzierungen interpersonaler Konzepte finden erst im Jugendalter statt. Die soziale Interaktion schafft soziales Wissen und Verstehen, dieses ist aber wieder an der Ausführung der Interaktion beteiligt, woraus folgt, dass der Entwicklungsstand bestimmt, welche Erfahrungen gemacht werden. Kognitive Konflikte sind auch bei der Entstehung von sozialem Wissen zentral, eine soziale Situation ist nicht sofort assimilierbar und führt so zur Reorganisation des bisherigen Wissens. In Förderprogrammen werden solche Konflikte gezielt induziert, wobei die plus eins Methode angewandt wird (Konflikt liegt eine Stufe über der eigenen), Kinder lernen beispielsweise spielerisch Rollen zu übernehmen. Die Entwicklung von sozialer Kognition erfolgt sowohl im Kontext Familie, als auch in Verbindung mit Gleichaltrigen und anderen Entwicklungskontexten. Bei bekannten Interaktionen spielt die soziale Kognition nur eine untergeordnete Rolle, weil sie meist von Skripten geregelt werden, sie setzt erst ein, wenn die Routine versagt. Soziale Kognitionen sind die Vorraussetzung für prosoziales Verhalten, z.B. Helfen, Teilen, Anteil nehmen. Hierzu werden moralische Verpflichtungen aufgebaut, die mit anderen Handlungsimpulsen (Eigennutz, Konformität, etc.) konkurrieren. Die soziale Kognition wird zur Situationsinterpretation genutzt, also zum Erkennen der Bedürfnisse des anderen und eine sinnvolle Hilfestellung muss erkannt werden. Die hedonistischen Gründe für Hilfe nehmen während Kindheit und Jugend ab. Eine andere Person wird dann Gegenstand altruistischen Handelns, wenn der kindliche Egozentrismus überwunden ist, wenn eine Perspektivenübernahme entwickelt wurde, und wenn Mitleid von Einzelpersonen entkoppelt wurde und zu generellem Mitleid geworden ist. Bei einigen Risikogruppen können sich soziale Kognitionen nicht optimal entwickeln: Psychatrische Auffälligkeiten der Eltern führen häufig zu einer schlechten Perspektivenkoordination der Kinder, andere sozial Kognitive Prozesse können allerdings die Probleme die sich aus dem häuslichen Milieu ergeben kompensieren. Autistische Kinder haben auffällige Probleme in der sozialen Kognition, aggressive Kinder deuten häufig neutrale Situationen als provozierend fehl, in der Personenwahrnehmung zeigen sich ihre Schilderungen undifferenziert und emotional getönt. Als Interventionsprogramme eignen sich die Konfrontation mit (+1) überfordernden Situationen, Rollenspiele, die soziale Konflikte aus dem Alltag behandeln, oder ein Training zur Lösung interpersoneller Probleme, das beim Aufbau von mehr Handlungsalternativen hilft. Entwicklung des begrifflichen Wissens Die Kategorisierung erfolgt bereits im Säuglingsalter, Begriffe sind schon früh eine effiziente Organisation von Wissen, sie sind die Grundlage für Schlussfolgerungen über Unbekanntes, also für Induktion. Beim Spracherwerb ist eine rapide Zunahme neuer Begriffe zu beobachten, sie ermöglichen Schlussfolgerungen über Objekte der selben Kategorie. Bei der Entwicklung der begrifflichen Repräsentation sind für die Entwicklungspsychologie fundamentale qualitative Veränderungen von Interesse, nicht quantitative. Bruner nahm an, dass die begriffliche Repräsentation kleiner Kinder perzeptuell ist, also wahrnehmungsbezogen, und aufs äußere Erscheinungsbild beschränkt, erst ältere Kinder kategorisieren konzeptuell, also auf der Basis ihres Wissens. Wygotsky dagegen nahm an, dass die thematische Repräsentation sich zur taxonomischen wandelt, also zu einer Repräsentation, die sich auf Klassen bezieht. Piaget nahm an, dass zunächst konkrete, später abstrakte Konzepte vorliegen, alle diese Theorien erwiesen sich aber als nicht haltbar. Die Gruppierung nach thematischen Kategorien ist kleinen Kindern zwar lieber, sie sind aber auch in der Lage taxonomisch zu kategorisieren, dennoch ist ihre Kategorisierung nicht dieselbe wie bei Erwachsenen, sie bevorzugen PrototypBegriffe denen mit kritischen Attributen. Die Begriffsbildung und –repräsentation hängt vom Kontext ab. Auch abstrakte Konzepte sind bei kleinen Kindern schon möglich, Kategorien können wissensbasiert sein, sie müssen sich nicht nur auf die Anschauung beschränken. Auch konzeptuelle Kategorien, außerhalb von perzeptuellen Ähnlichkeiten können gebildet werden. Inwiefern kindliche Begriffe domän- oder kontektspezifisch sind und welche Veränderungen hier geschehen ist für die Entwicklungspsychologie relevant. Für die Wissensentwicklung in grundlegenden Domänen gibt es verschiedene theoretische Ansätze, sie teilen die grundlegenden Inhaltsbereiche: biologisch, physikalisch, numerisch und psychologisch ein, wie Piaget und die Informationsverarbeitungstheoretiker gehen manche von bereichsübergreifenden strukturellen Merkmalen aus. Das Modell des Expertisenerwerbs sieht das Kind als universellen Novizen, die Entwicklung von Wissen geschieht analog zum Erwerb von Kulturtechniken und Fertigkeiten, der Mechanismus mit dem das geschieht ist die domänübergreifende Informationsverarbeitung. Die Modularitätstheorien nehmen spezialisierte Systeme der Informationsverarbeitung an, die der Repräsentation von spezifischem Wissen und spezifischer Informationen dienen. Diese domänspezifischen Verarbeitungssysteme gelten meist als angeboren, es erfolgt also keine Entwicklung im Sinne qualitativer Veränderungen. Die Theorie-Theorie nimmt fundamentale qualitative Veränderungen an, der Wandel einer intuitiven Theorie hat Ähnlichkeit mit einem Paradigmenwechsel in der Wissenschaft (wie z.B. der Übergang zum heliozentrischen Weltbild). Intuitive Theorien enthalten einen Phänomenbereich, Kernbegriffe und Erklärungsprinzipien, bei einem Wandel ändert sich die Rahmentheorie, die dafür zuständig ist die aufgenommenen Informationen zu interpretieren. Die intuitive Physik (basales Wissen) bezieht sich auf Wissen über die Eigenschaften physikalischer Objekte: Sie sind dreidimensional, sie sind solide und fallen runter. Es ist schwer zu sagen, was angeboren und was erworben ist, da kausales Denken bereits sehr früh beobachtet werden kann. Vorschulkinder denken bereits deterministisch und sogar Säuglinge wissen, dass die Ursache zeitlich vor der Wirkung kommen muss. Bei Objekteigenschaften nehmen bereits Babys raumzeitliche Hinweise auf, sie wissen wie viele Objekte vorhanden sind, und wie sie sich bewegen, Erwachsene können dann die Objekteigenschaften zusätzlich miteinbeziehen. Erst nach der ersten Hälfte des ersten Lebensjahres können die Objekte auch quantitativ erfasst werden, beispielsweise bezüglich ihrer Größe. Erst mit 8-10 Monaten können Ereignisse, die Schwerkraft oder Trägheit verletzen von solchen differenziert werden, die das nicht tun. Erklärt wird die Entwicklung über domänspezifische Kernprinzipien oder domänspezifische Lernmechanismen, die angeboren sind. Die physikalische Intuition, ist bei Kindern und Erwachsenen sehr ähnlich, auch Vorschulkinder zeigen also ein breiteres Wissen, als Piaget angenommen hat. Fehlerhafte physikalische Vorstellungen können also ihre Ursachen in intuitiven Theorien haben, sie zeigen sich oft sehr resistent gegen Instruktion, beispielsweise haben Kinder, wenn ihnen erzählt wird die Erde sei eine Kugel verschiedene Interpretationen für diese Aussage: Manche nehmen eine Hohlkugel an, in deren Inneren die Menschen leben, andere denken, es gäbe zwei Erden, die eine Scheibe auf der wir leben und eine andere, wie der Mond, die tatsächlich eine Kugel ist. Ein Theoriewandel vollzieht sich recht langsam. Auch können Kinder Gewicht und Dichte nicht differenzieren, sie meinen ein Gewicht sei nur vorhanden wenn man es spüren kann, und gleichgroße Gegenstände müssten auch gleichviel wiegen. Es ist also eine große Menge an Wissen bereits früh vorhanden (vielleicht auch angeboren), durch Bereicherung und teils durch Umstrukturierung entsteht im Laufe der Entwicklung mehr. Die intuitive Psychologie, oder die theorie of mind, enthält Annahmen über die Absichten und Überzeugungen anderer, es erfolgt also eine Differenzierung zwischen mentaler und physikalischer Welt, diese Abgrenzung der gedanklichen Welt gegen die physikalische Realität erfolgt entgegen Piaget Theorie (7J) bereits mit etwa 1 ½ bis 2-3 Jahren. Mit drei Jahren ist das Verständnis vorhanden, dass Wünsche, Absichten und Ziele zu Handlungsentscheidungen führen. Das Verständnis für falschen Glauben und falsche Überzeugungen dagegen entwickelt sich erst mit 4-5 Jahren, erst dann können Kinder z.B. die Maxi Aufgabe lösen: Maxi legt die Schokolade in den grünen Schrank und geht dann zum Spielen, seine Mutter legt in seiner Abwesenheit die Schokolade aber vom grünen in den blauen Schrank. Wo wird Maxi die Schokolade suchen wenn er wiederkommt? Kinder unter 4 Jahren antworten im blauen Schrank, erst ältere Kinder verstehen, dass Maxi nicht wissen kann, dass die Schokolade nicht mehr im grünen Schrank ist. 3jährige erkennen auch nicht, dass sie selber falsche Vorstellungen gehabt haben: Wenn man sie fragt was in einer Smarties Packung ist, antworten sie Smarties, entdecken sie jedoch danach, dass Stifte darin sind, behaupten sie, sie hätten schon immer gesagt da seien Stifte drin. Auch haben Kinder unter 4 Jahren deswegen kein Verständnis für Lüge und Täuschung. Mit vier Jahren kann Realität und Augenschein differenziert werden, Emotionen können nachvollzogen werden. Ab 6 Jahren wird diese Differenzierung erweitert, es folgt die Einsicht, dass man auch Überzeugungen über die Überzeugungen anderer haben kann, und dass nicht nur das Sehen zu Wissen führen kann, sondern auch Schlussfolgern, man erlangt so Einsicht in die eigenen Lernprozesse. Zum Verständnis geistiger Konstruktion und Interpretation gibt es verschiedene Theorien, wie gedankliche Aktivität als Bewusstseinsstrom und die Wirkung von Vorurteilen verstanden wird. Modulationstheorien behaupten die Zuschreibung von Absichten sei angeboren und das Scheitern an entsprechenden Aufgaben, das bei jüngeren Kindern beobachtet wird, liege an Aufmerksamkeitsproblemen und an Gedächtnisproblemen, experimentell wird diese Theorie allerdings kaum gestützt. Die Simulationstheorie ergibt sich aus dem Expertisenansatz, Perspektivenübernahme erfolgt über den Zugriff auf eigene Gedanken (auf die anderer kann ja nicht zugegriffen werden), man simuliert also die Gedanken des anderen. Die Theorie-Theorie besagt, dass intuitive Theorien ermöglichen nichtbeobachtbare Vorgänge zu erschließen. Nach der Theorie-Theorie müssten also gedankliche Vorgänge bei sich und bei anderen gleichzeitig erschlossen werden, nach der Simulationstheorie müsste das erst bei einem selbst und dann bei anderen gelingen, experimentell wird eher die Theorie-Theorie gestützt. Bei der intuitiven Biologie erfolgt die Unterscheidung zwischen Lebewesen und Ding zunächst über die selbstinitiierte Bewegung, Pflanzen sind daher für die meisten Kinder bis zum sechsten Lebensjahr keine Lebewesen. Die Kategorisierung erfolgt also nach dem Verhalten, und nicht nach biologischen Kriterien. Die Biologie ist also noch keine eigene Domäne, sondern ist an die intuitive Psychologie angegliedert. 34jährige erkennen bereits, dass biologische Vorgänge, wie Wachstum und Selbstheilung nur bei Lebewesen, und nicht bei Dingen möglich sind und das diese Prozesse nicht durch psychologische Mechanismen, wie z.B. den Willen gesteuert werden. Die biologischen Intuitionen sind bei Kindern und Erwachsenen sehr ähnlich, sie nehmen beispielsweise an, dass nur biologische Merkmale, nicht aber psychologische vererbt werden. Die Ausgrenzung der biologischen Domäne aus der psychologischen geschieht etwa im Grundschulalter. Die Theorie-Theorie führt das auf einen Paradigmenwechsel zurück, die Differenzierung erfolgt jetzt nach lebendig und tot, deswegen können Pflanzen zu den Lebewesen eingeordnet werden. Der Expertisenansatz nimmt an, dass die langsame Erweiterung des Wissens dazu führt. Die Modularitätstheorie denkt, dass ein angeborener biologischer Modus zur Klassifikation biologischer Arten führt, dies konnte aber kaum nachgewiesen werden. Metabegriffliches Wissen ist Wissen und Überzeugungen über den Wissenserwerb selbst, ein unzureichendes metabegriffliches Wissen, kann ein Hindernis für den Wissenserwerb selbst sein, beispielsweise entwickelt man bei der Vorstellung Natur sei objektiv beobachtbar, und Lernen sei eine Übernahme von Faktenwissen kein Verständnis für Theorien. Bei Kindern entwickelt sich langsam ein kritischer Rationalismus, zunächst nehmen Kinder an, dass Interpretationsunterschiede auf Missverständnissen beruhen, auf einer zweiten Ebene, meinen Kinder, wenn sie mit unterschiedlichen Ansichten konfrontiert werden, jeder kann denken, was er will, sie zweifeln also an einer wahren Erkenntnis, dieser Relativismus kann zum Dogmatismus oder zum Skeptizismus führen. Jugendliche und junge Erwachsene zeigen dann bereits denn kritischen Rationalismus, die Wahrnehmung wird als subjektiv erkannt, eine Meinung wird über die Argumente geprüft. Es gibt auch drei Ebenen für das Verständnis von Wissenschaft: Auf der ersten Ebene wird nicht zwischen Ideen und Theorien unterschieden, Daten rühren aus einer konkreten Aktivität, oder aus einer Sammlung objektiver Fakten. Auf der zweiten Ebene können Theorien von Evidenz unterschieden werden, Hypothesen werden getestet, Wissenschaft ist so, die Suche nach Erklärungen. Auf der dritten Ebene wird die Rolle der Theorie im Erkenntnisprozess erkannt, Wissenschaft ist so ein Zyklus aus Theoriebildung, -prüfung und –revision.