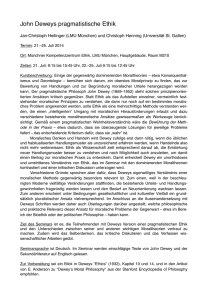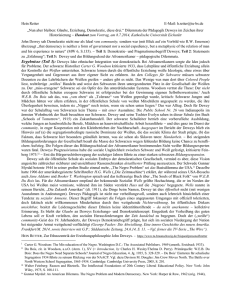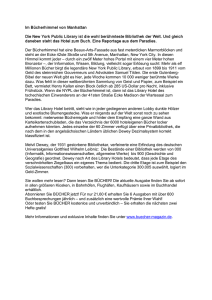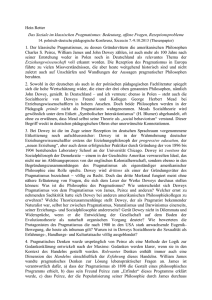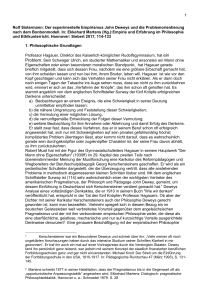Demokratie als Verkörperungskultur - uri=userpages.uni
Werbung
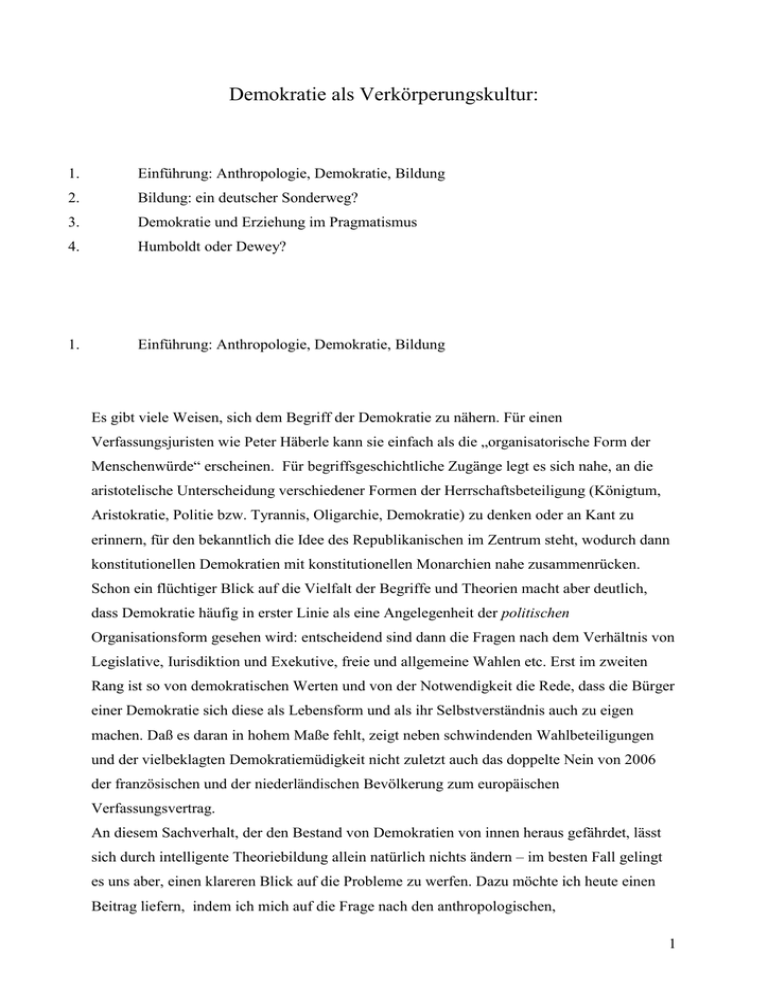
Demokratie als Verkörperungskultur: 1. Einführung: Anthropologie, Demokratie, Bildung 2. Bildung: ein deutscher Sonderweg? 3. Demokratie und Erziehung im Pragmatismus 4. Humboldt oder Dewey? 1. Einführung: Anthropologie, Demokratie, Bildung Es gibt viele Weisen, sich dem Begriff der Demokratie zu nähern. Für einen Verfassungsjuristen wie Peter Häberle kann sie einfach als die „organisatorische Form der Menschenwürde“ erscheinen. Für begriffsgeschichtliche Zugänge legt es sich nahe, an die aristotelische Unterscheidung verschiedener Formen der Herrschaftsbeteiligung (Königtum, Aristokratie, Politie bzw. Tyrannis, Oligarchie, Demokratie) zu denken oder an Kant zu erinnern, für den bekanntlich die Idee des Republikanischen im Zentrum steht, wodurch dann konstitutionellen Demokratien mit konstitutionellen Monarchien nahe zusammenrücken. Schon ein flüchtiger Blick auf die Vielfalt der Begriffe und Theorien macht aber deutlich, dass Demokratie häufig in erster Linie als eine Angelegenheit der politischen Organisationsform gesehen wird: entscheidend sind dann die Fragen nach dem Verhältnis von Legislative, Iurisdiktion und Exekutive, freie und allgemeine Wahlen etc. Erst im zweiten Rang ist so von demokratischen Werten und von der Notwendigkeit die Rede, dass die Bürger einer Demokratie sich diese als Lebensform und als ihr Selbstverständnis auch zu eigen machen. Daß es daran in hohem Maße fehlt, zeigt neben schwindenden Wahlbeteiligungen und der vielbeklagten Demokratiemüdigkeit nicht zuletzt auch das doppelte Nein von 2006 der französischen und der niederländischen Bevölkerung zum europäischen Verfassungsvertrag. An diesem Sachverhalt, der den Bestand von Demokratien von innen heraus gefährdet, lässt sich durch intelligente Theoriebildung allein natürlich nichts ändern – im besten Fall gelingt es uns aber, einen klareren Blick auf die Probleme zu werfen. Dazu möchte ich heute einen Beitrag liefern, indem ich mich auf die Frage nach den anthropologischen, 1 bildungstheoretischen und kulturphilosophischen Hintergründen des Demokratieverständnisses konzentriere. Das Stichwort dazu lautet: Demokratie als Verkörperungskultur. Darunter werde ich im folgenden ein Demokratieverständnis fassen, dass sich weniger auf Fragen des Verfassungsrechts, der politischen Partizipation etc. als vielmehr darauf richtet, wie das Verhältnis von demokratischen Idealen und praktischen Mitteln, materiellen Voraussetzungen usw. zu denken ist, und welche Implikationen dies für die Frage nach dem Verhältnis von Wahlvolk und Eliten etc. hat. Eine demokratische Kultur soll also gedacht werden als Kultur der Verkörperung, des Embodiment: Zentral ist dabei die Frage, wo und wie sich die fundamentalen Werte moderner Demokratien, wie Freiheit, Menschenwürde, Partizipation, Pluralität etc. als handlungswirksam erweisen: in Interaktionsformen, in der materiellen Kultur, in sozialen Eliten und/oder alltäglichen Sinnmustern etc. Vermutlich wird Ihnen dieser Gedanke zunächst reichlich vage vorkommen, und ich werde ihn deshalb auch gleich konkretisieren, indem ich auf ein, vielleicht das zentrale Problem moderner Demokratien eingehe: die Bildung. In Deutschland ist die Stadt Pisa zum Synonym für den heilsamen Schrecken geworden ist, der die Öffentlichkeit angesichts der fraglichen Zukunftsfähigkeit unseres Bildungssystems erfasst hat. (Ironischerweise soll dann der Name einer anderen italienischen Stadt, nämlich Bologna, und der nach ihr benannte Prozeß den Schrecken wieder bannen, zumindest in der Hochschulpolitik.) Doch ist Deutschland auch die Heimat des wohl weltweit berühmtesten Bildungspolitikers – und Universalgelehrten - , dessen Namen wiederum als ein Mantra durch die Geschichte der Bildungsdebatten geistert. Die Rede ist natürlich von Wilhelm von Humboldt. Seine Bildungspolitik war, was in den erregten Debatten der Gegenwart selten bedacht wird, von einer weit ausgreifenden Anthropologie tief geprägt- einer Anthropologie, in der der Gedanke der Verkörperung eine entscheidende Rolle spielt. Ich werde in meinem Vortrag die These vertreten, dass Humboldt unterwegs war zu einer Deutung der Zusammenhänge von Staatsverständnis, Anthropologie und Verkörperung als integralen Bestandteilen einer Kultur, die uns beim Verstehen unserer Gegenwart unentbehrlich sein könnte. Diese wegweisenden Einsichten gelangen aber, so werde ich argumentieren, nur in einer verzerrten Form zur Entfaltung, weil Humboldt idealistischen Prämissen verpflichtet bleibt, die seine genuinen Einsichten in die Bedeutung von Verkörperungsprozessen konterkarieren. In der Bildungsphilosophie des amerikanischen Pragmatismus, wie sie sich seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im direkten Zusammenhang mit dem von Humboldt inspirierten Universitätswesen der USA entwickelt 2 hat, findet sich eine Deutung von Demokratie als Verkörperungskultur, die die dualistischen und elitistischen Konsequenzen Humboldts vermeidet und als unentbehrliches Korrektiv seiner Gedanken betrachtet werden muß. Freilich leidet auch das emphatische Modell einer demokratischen Verkörperungsgemeinschaft unter gewissen Einseitigkeiten, so dass man am Ende wohl bei einer Art pragmatisierten Variante der Humboldt-Kultur ankommt. Daraus ergibt sich die Gliederung meines Vortrags: ich werde das Verhältnis von Bildung, Demokratie und Kultur zunächst im Blick auf die Traditionen Humboldts und die Frage nach einem deutschen „Sonderweg“ diskutieren, dann den verkörperungstheoretischen Fortschritt erörtern, den der Übergang von Humboldt zu Dewey mit sich bringt und abschließend zu der Misere der Gegenwart zurückkehren. 2. Bildung – ein deutscher Sonderweg? Glanz und Elend der Humboldt-Kultur werden deutlich in einem begeisterten Zitat des amerikanischen Philosophen Josiah Royce aus dem Jahre 1891, das die – damals- weltweit inspirierende Kraft eines Studiums an deutschen Universitäten zum Gegenstand hat: „A generation,“, so schreibt Royce, „dreamed of nothing but the German University. One went to German still a doubter as to the possibility of the theoretic life; one returned an idealist, devoted for time to pure learing’s sake.“ Heute ist es genau umgekehrt: von den deutschen Verhältnissen frustrierte Professoren finden in Harvard oder Yale das gründerzeitliche Göttingen oder Berlin ihrer akademischen Träume wieder. Hier ist allerdings doppelte Vorsicht am Platz. Zum einen feiert Royce hier weniger die Dominanz praxisferner Geisteswissenschaft, sondern vor allem die akademische Freiheit einer scientific community, die nicht mehr länger am Gängelband einer alles dominierenden Theologie geführt wird. Den Hintergrund dazu bildet die Transformation der Harvard University von einem theologischen Seminar zu einer klassischen, forschungsorientierten Volluniversität, wie sie in der 2. Hälfte des 19. Jahrhundert durch den Präsidenten Charles W. Elliot ins Werk gesetzt wurde. Dabei hatte Elliot die Weitsicht, zu verwirklichen, was Humboldt für die Neugründung der Berliner Universität vergeblich gefordert hatte: einen soliden Grundstock von Immobilien-Eigentum, der die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Forschung sichert. (Stiftungsvermögen Harvard: 28 Milliarden $) Zum anderen und vor allem aber ist es offensichtlich, dass der bios theoretikos der Humboldt-Kultur ihre Vertreter, um es sehr vorsichtig zu sagen, nicht gerade zu enthusiastischen Demokraten disponierte. Zu Beginn des ersten Weltkriegs haben viele namhafte Vertreter dieser geistigen Lebensform ihre ungebildeten Mitbürger an 3 Hurrapatriotismus überboten (ich erinnere nur an Sombarts „Helden und Händler“ von 1915), und zu dem zarten Pflänzchen der ersten deutschen Demokratie in der Weimarer Republik konnten sie nie ein rechtes Verhältnis finden. Dafür gibt es vielfältige Ursachen, unter ihnen aber auch, davon bin ich überzeugt, ein dualistisch-elitistisches Verständnis von Verkörperung, das eine ungute Erblast der Humboldtschen Bildungsidee darstellt. Um diesen Punkt besser herauszuarbeiten, müssen wir uns nun der Anthropologie und Bildungsphilosophie Wilhelm von Humboldts selbst zuwenden. Humboldts zentrale anthropologische Einsicht besteht darin, dass wir essentiell verkörperte Wesen sind. Das Prädikat „essentiell“ soll dabei die Differenz zu platonisierenden Anthropologien ausdrücken. Das Verhältnis des Geistigen zum Sinnlichen – diese Einsicht gewinnt Humboldt vor allem durch seine vergleichende Sprachanthropologie – ist nicht einfach das einer Form, die sich der Materie einschreibt, vielmehr bildet sich der Geist gerade in der physischen Interaktion mit der Umwelt. Der menschliche Selbstvollzug besteht nach Humboldt also darin, geistige Sinnmuster mittels – und nicht etwa nur: in – physischer Strukturen zu bestimmen, diese in jenen fortschreitend zu verkörpern. So beim Sprechen: es wird von Humboldt nicht als Entäußerung eines schon unabhängig von der Artikulation gegebenen gedanklichen Gehalts - einer lingua mentis - verstanden, , sondern als die Genese von Sinn durch die Hervorbringung des gegliederten Lauts. Verkörperung, so könnte man auch sagen, bestimmt das Geistige erst als konkrete Größe, so wie sie umgekehrt alle sozialen Interaktionsgebilde als sinnhafte bestimmt, vom flüchtigen Laut über die geschriebene Sprache bis hin zur materiellen Kultur. Weil damit die Entfaltung des Geist anders als bei Hegel prinzipiell an physische, vor allem an leibliche Strukturen gebunden wird, enthält Humboldts Bildungsbegriff durchaus eine pragmatische Dimension. So heißt es schon in seinem Frühen Aufsatz über die Grenzen der Wirksamkeit des Staates: „Der gebildete Mensch erscheint in seiner höchsten Schönheit, wenn er ins praktische Leben tritt.“ Schließlich vollzieht sich die Entfaltung menschlicher Fähigkeiten ja nicht im luftleeren Raum weltloser Kognitionen, sondern durch physische Handlungen in einer widerständigen Umwelt: „Die Selbstbildung kann nur an der Weltgestaltung fortgehen.“ Hier zeigt sich nun allerdings eine deutliche Spannung zwischen dem verkörperungstheoretischen Impuls einer- und dem idealistischen Denkhintergrund Humboldts andererseits. Sie wird besonders deutlich fassbar in dem Bruchstück Theorie der Bildung des Menschen. Hier dominiert einerseits ein Begriff des Wirkens, der Äußerung geistiger Kräfte, der nur sekundär-instrumentell mit der physischen Realität verknüpft wird. „Rein und in seiner 4 Endabsicht betrachtet“, so äußert Humboldt sich hier über die Bestimmung des Menschen, „ist sein Denken immer nur ein Versuch des Geistes, vor sich selbst verständlich, sein Handeln ein Versuch seines Willens in sich frei und unabhängig zu werden ... Bloß weil beides, sein Denken und sein Handeln nicht anders, als nur vermöge eines Dritten, nur vermöge des Vorstellens und des Bearbeitens von etwas möglich ist, dessen eigentlich unterscheidendes Merkmal es ist, NichtMensch sic!, d.i. Welt zu seyn, sucht er, soviel Welt als möglich zu ergreifen, und so eng, als er nur kann, mit sich zu verbinden.“ Diesem fichteanischen Subjektivitätspathos bleibt „auch in der Wechselwirkung der Primat der Selbstbeziehung erhalten.“ Es wird jedoch andererseits konterkariert durch die unmittelbar danach entwickelte Konzeption einer „Verknüpfung unseres Ichs mit der Welt zu der allgemeinsten, regsten und freiesten Wechselwirkung“- liege es doch in der Natur des Menschen, „beständig von sich aus zu den Gegenständen ausser ihm überzugehen....“ Nun handelt es sich bei dem hier zitierten Fragment um einen frühen, vor der Wende zur Sprachanthropologie entstandenen Text, und es ließe sich dafür argumentieren, dass der späte Humboldt mit der Entdeckung der doppelten Artikulation auch die Idee der Bildung verkörperungstheoretisch weiterentwickelt hat. Das trifft aber nur in geringem Ausmaß zu, und noch in Humboldts berühmter Akademierede Über die Aufgabe des Geschichtsschreibers lässt sich der Konflikt zwischen zwei Konzeptionen durchgängig nachvollziehen; einer idealistischen Konzeption, in der Verkörperung letztlich kontingent ist und die Ideen „sich zwar „im Zusammenhang der Weltbegebenheiten entfalten..“, ihnen aber nicht „angehören..“und dem Verkörperungsgedanken, der auf Wechselwirkung zwischen Sinn und Sinnlichkeit drängt. Zwischen der sprachtheoretischen Einsicht in die Reziprozität von physischem Zeichen und semantischem Sinn und dem idealistischen Primat der Form über die Materie besteht hier eine von Humboldt selbst nicht aufgelöste Spannung. Der Individualismus, die Dualität von selbstzweckhafter Bildung und instrumentellem Wissen (Bildung/Ausbildung), die daraus resultierende Distanz zur materiellen Kultur – alle diese spezifisch „deutschen“ Merkmale des Vorstellungskomplexes Bildung/Kultur sind davon geprägt, dass sich Humboldts Bildungsbegriff nicht auf Augenhöhe seiner verkörperungstheoretischen Einsichten bewegt. Erst der amerikanische Pragmatismus, so behaupte ich, wird – vor allem im Werk John Deweys - eine überzeugende Alternative ohne idealistische Schlagseite entwickeln, die Bildung und Erziehung vom Verkörperungsgedanken her konzipiert und daher auf den schlechten Gegensatz zwischen banalen Mitteln und edlen Selbstzwecken verzichten kann. Doch noch einmal zurück zu Humboldts Bildungsbegriff. Er scheint mir nach dem bisher gesagten durch eine eigentümliche Ambivalenz geprägt zu sein, indem er einerseits an den 5 verkörperungstheoretischen Einsichten der Humboldtschen Sprachanthropologie teil hat, andererseits aber einem Holismus der integrierten Persönlichkeit das Wort redet, die eben doch bei sich bleibt, nicht genuin intersubjektiv und tätig ist. Georg Bollenbeck hat in seiner großartigen Studie „Bildung und Kultur – Glanz und Elend eines deutschen Deutungsmusters“ gezeigt, dass Humboldt mit dieser individualistischen Emphatisierung von „Bildung“ in die Geschichte eines spezifischen deutschen Sonderwegs hineingehört. Am klarsten wird dies in einer vielzitierten Passage aus der Kawi-Einleitung, in der Humboldt Zivilisation, Kultur und Bildung unterscheidet und darin stark an das Schema aus Kants Pädagogik-Vorlesung erinnert. Bei Kant finden wir den vierstufigen Schritt DisziplinierungKultivierung-Zivilisierung-Moralisierung. Humboldt hat statt dessen einen Dreischritt von Zivilisierung, Kultivierung und Bildung, und er lässt keinen Zweifel daran, dass dieser letzte emphatische Begriff auch die Kantische Moralisierung einbegreifen soll. „Wenn wir“ so schreibt er, „in unserer Sprache Bildung sagen, so meinen wir damit etwas zugleich Höheres und mehr Innerliches, nämlich die Sinnesart, die sich aus der Erkenntnis und dem Gefühle des gesammten geistigen und sittlichen Strebens harmonisch auf die Empfindung und den Charakter ergießt.“ Gegen diesen hochemphatischen Bildungsbegriff sind vor allem zwei Einwände denkbar, die auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun haben, sich aber, so behaupte ich, dennoch als korrelative Entfaltungen einer verkörperungstheoretisch inspirierten Kritik denken lassen. Der Pointe des ersten Einwand verbirgt sich in einer Schlüsselszene der deutschen Kultur des 20. Jahrhunderts, auf deren Einschlägigkeit ich durch Dieter Thomä aufmerksam geworden bin: die Davoser Disputation zwischen Ernst Cassirer und Martin Heidegger im März 1929 in Davos. Für meine Zwecke ist hier weniger der tatsächliche Verlauf der Disputation entscheidend, in der vor allem Cassirers eigenste Intentionen wohl weitgehend missverstanden wurden und er als Vertreter eines abgelebten Neukantianismus erschien. Atmosphärisch viel aufschlussreicher ist der studentische Sketch am Abend nach dem Gigantentreffen, in dem Emmanuel Levinas als Cassirerdarsteller die Bühne betrat und immer wieder die zwei Worte „Humboldt-Kultur“ vor sich hin brummte, was langanhaltendes und abschätziges Gejohle unter den Studenten hervorrief. In den Augen der Studenten hatte Heidegger mit „Sein und Zeit“ gezeigt, wie sehr diese bildungsbürgerliche Kultur diskreditiert und überlebt war. Dabei ging es vor allem um das Pathos der existenziellen Entscheidung angesichts der irreduziblen Faktizität der Wirklichkeit, die sich nicht in geistige Formen auflösen lässt. Humboldt – und, ihm folgend Cassirer – so könnte man die Reaktion der Studenten interpretieren, haben ausgeblendet, was in der Kategorienlehre von Peirce als 6 „Firstness“ figuriert: die ungeistige, nur im Handeln sichtbar werdende Transzendenz des Lebens über das Ideal des harmonischen Individuums. Heidegger selbst (und auch sein linksexistenzialistischer Schüler Herbert Marcuse) haben aus diesem Primat des faktischen Lebens über die Bildung Konsequenzen gezogen, die weit von jeder demokratischen Kultur der Verkörperung wegführen. Dennoch macht ihre Kritik – und noch mehr die atmosphärische Reaktion ihrer Studenten – deutlich, dass Humboldts Bildungsbegriff den Geist zwar in Sprache verkörpert sein lässt, den physisch interagierenden Leib-in-einerkontingenten-Welt aber außen vor lässt. In Heideggers antiplatonischer Hermeneutik der Faktizität artikuliert sich diese Dimension freilich in einer radikal einseitigen Weise, einer Weise, die dann in dem heroisch stilisierten Kontigenzbewußtsein der Rektoratsrede ihre antidemokratischen Früchte trägt: der – ich zitiere – „schärfsten Gefährdung des Daseins inmitten der Übermacht des Seienden“ ausgesetzt, rufen die deutschen Studenten nach Führern, die Klarheit schaffen, indem sie Kontingenz reduzieren. Zwar hat Heidegger in dieses Modell einige subversive Komponenten eingebaut – etwa den Widerstand der Folgenden gegenüber den Führern - , von einem egalitären Konzept verkörperten Geistes ist er aber meilenweit entfernt. Die unantizipierbare Dynamik des Handelns wird eingesetzt, um die platonischen Restbestände in Humboldts Ideal des allseitig gebildeten Menschen zu decouvrieren,, damit wird aber im Grunde das verkörperungstheoretische Defizit des Bildungsbegriffs nur unter dem Verzeichen von Volk und Führer erneuert. Und damit komme ich zu dem zweiten Aspekt der Kritik an der Humboldt-Kultur. Er macht geltend, dass Bildung hier elitär und dualistisch gedacht wird: elitär, denn die normative Aufladung sprachlicher Sinngebilde gegenüber der materiellen Kultur ist nicht demokratisierbar, weil sie zur Voraussetzung hat, dass der Bildungsbürger durch andere von der unmittelbaren Interaktion mit den Dingen entlastend wird. Dualistisch, denn die Vorrangstellung „geistiger“ Bildungsziele entwertet die polytechnische Ausbildung zum bloßen, sinnentleerten Mittel für höhere Zwecke. Heidegger reagiert darauf nun wiederum lediglich mit einer romantisierenden Aufladung vorindustriell-handwerklicher Produktionsverhältnisse, nicht mit einem demokratischen Impuls der Vermittlung von, grob gesagt, Bildung und Ausbildung. Je idealistisch-emphatischer also, so fasse ich zusammen, der Bildungsbegriff angelegt ist, desto mehr gibt er korrelativ den Erwerb technisch-praktischer Kompetenzen der reflexionsfreien Trostlosigkeit preis. Zwecke verkörpern sich dann nicht mehr in Mitteln, Mittel erscheinen als „bloß“ instrumentelle Intervention in einer sinnfreien physischen 7 Sphäre. Mit diesen letzten Sätzen habe ich schon einen zentralen Punkt der Problemdiagnose John Deweys herausgestellt, der ich mich nun zuwende. 3. Demokratie und Erziehung im Pragmatismus John Deweys Philosophie – zusammen mit vielen anderen verwandten Bemühungen pragmatistischer Denker – kann nämlich im ganzen als eine Bemühung beschrieben werden, die unheilvollen Dualismen von Geist und Natur, Höheren Zielen und sinnentleerten Mitteln, Bildung und Ausbildung zu überwinden. Dabei lässt sich Dewey sowenig wie Humboldt der Vorwurf machen, er habe den Praxistest gescheut: auf seine Initiative geht die Gründung der ersten us-amerikanischen Laborschule im Chicago des ausgehenden 19. Jahrhundert zurück, und sein Leben lang hat sich Dewey in Bildungsfragen energisch engagiert. Sein moralischer Impuls lässt sich dabei durch eine schlichte Pathosformel beschreiben, die sein Werk durchzieht: „the ordinary experience of the common man.“ Diese gilt es ernstzunehmen, zu verbessern und demokratischer Partizipation zuzuführen. Dewey hat nichts gegen Bildungseliten – schließlich gehört er einer solche Elite selbst an - , aber er definiert ihre Bedeutung streng im Blick auf immer weitergehende Partizipation und Inklusion aller Mitglieder einer Gesellschaft. Dieses egalitär-demokratische Pathos verbindet sich bei Dewey mit einer radikalen Kritik an der Trennung von Zwecken und Mitteln zu einem Verständnis von Demokratie als einer Kultur der Verkörperung. Darin besteht der bedeutende Beitrag seines Denkens zu den Debatten um Bildung und Ausbildung und eben auch zu den aktuellen Fragen einer Kulturtheorie, die sich im Zeichen naturalistischer Reduktionismen wieder einmal öffentlich in Frage gestellt sieht. Eine Kulturtheorie, die sich angesichts der zunehmenden Deutungsmacht evolutionistischer Ansätze nicht einfach in den hortus conclusus hermeneutischen Feinsinns zurückziehen will, bedarf dringend eines mit eigenen Bordmitteln konstruierten und also nicht erst extern aufgezwungen Brückenschlags in die natürliche Existenz des Menschen (Hinweis Vortrag und Habil Norbert Meuter). Der Begriff der Verkörperung kann diese Funktion m.E. am besten übernehmen, und die Aktualität Humboldts, über seine segensreichen bildungspolitischen Aktivitäten hinaus, gründet genau hier: in der Ausarbeitung einer Anthropologie der Artikulation, die semantischen Sinn mit physischen Gliederungsmustern intern und somit antiplatonisch verknüpft. Weil Humboldt aber, darin noch Idealist, den Verkörperungsgedanken in der Idee des allseitig artikulierten Selbst aufgehen lässt, zementiert er den Gegensatz von Bildung und Ausbildung, von hehrem Selbstzweck und banalem technischem Mittel. Man könnte auch die aristotelischen 8 Kategorien benutzen und sagen: Verkörperung beschränkt sich bei Humboldt auf die – linguistische – Praxis und klammert die Poiesis aus. Deweys setzt mit seinem egalitär-demokratischen Pathos genau hier an und kritisiert diese Trennung schneidend: Seine Lieblingsbeschäftigung war die Zerstörung von Dualismen und sein Lieblingsgegner der Dualismus von Mitteln und Zwecken. Eine demokratische Kultur, die diese beiden Ehrennamen tatsächlich verdient, muß Zwecke durch Mittel verkörpern und dem bildungsbürgerlichen Kultus des Idealen entsagen – nicht etwa deshalb, weil die Ideale – wir könnten auch von den Werten der humanistischen Bildung sprechen – nichts taugen, sondern weil sie keine platonischen Entitäten darstellen, sondern handlungsleitende Orientierungen, die realisiert werden wollen. Mit der bekannten Schelersschen Unterscheidung zwischen Herrschafts-, Bildungs- und Erlösungswissen, die im deutschen Sprachraum gerne zur Aufwertung von praxisfernen Bildungsinhalten zitiert wird, kann Dewey daher nichts anfangen. Seine luzide Kritik an der Abtrennung von Sinnfragen und praktischen Problemen entwickelt er am deutlichsten in der Schrift The Quest for Certainty. Geleitet ist sie von einem radikalisierten Verständnis des Kulturellen als des Bereichs, in dem zwischen kollektiven Wertorientierungen, individuellen Innovationen und dem praktischen Leben eine Beziehung wechselseitiger Verkörperung besteht. Der axiologische Gegensatz von Mittel und Zweck ist dabei das größte Hindernis: „Mittel“, so schreibt Dewey 1929, „galten als knechtisch und das Nützliche als servil. Mittel wurden als die arme Verwandtschaft angesehen, die man ertragen muß, die aber nicht willkommen ist. Die Bedeutung von „Ideal“ ist bezeichnend für die Scheidung, die zwischen Zwecken und Mitteln bestanden hat. „Ideale“ gelten als fern und unerreichbar; sie sind zu hoch und zu fein, als dass sie durch eine Realisierung beschmutzt werden dürften. Sie dienen irgendwie dazu, „Hoffnungen“ zu wecken, aber erregen und leiten nicht die Anstrengungen, sie zu realisieren. Sie schweben auf unbestimmte Weise über dem wirklichen Schauplatz.“ (279) Die Motive dieser Kritik sind vertraut und finden sich teilweise bereits bei Hegel, in seiner ironischen Analyse der „schönen Seele, in dem Widerspruche ihres reinen Selbsts und der Notwendigkeit desselben, sich zum Sein zu entäußern und in Wirklichkeit umzuschlagen“ (PhdG 491). Aber Dewey ist radikaler: er denkt nicht nur, wie Hegel, an die Notwendigkeit eines in sich schon konstituierten Geistigen, das andere seiner selbst anzueignen; Verkörperung bedeutet für Dewey, der nicht mehr an die Selbständigkeit des Geistes glaubt, die einzige Form, in der Ideale eine nichtideologische Rolle spielen können: die Rolle nämlich, Handlungen anzuleiten. „Mangelnde Achtung vor den Mitteln“, so argumentiert er, bedeutet deshalb im Grunde, „dass die sogenannten Zwecke nicht ernst genommen werden.“ (279) Wer höhere Geistigkeit als 9 Zweck an sich selbst propagiere, verhält sich für ihn genauso wie jemand, der „eine angebliche Leidenschaft für die Malerei mit einer Verachtung gegenüber Leinwand, Pinsel und Farbe“ verbindet. In einer Welt, in der das Geistige verkörpert sein muß, sind von den Mittel getrennte Zwecke lediglich Sentimentalitäten (279). Diese verkörperungstheoretische Einsicht gilt schon auf der handlungstheoretischen Ebene, gewinnt aber im Blick auf ihre sozialen Folgen noch an Dringlichkeit. Die Abtrennung der höheren Bildung von der profanen Ausbildung, vor allem aber die axiologische Tieferstellung des Technisch-Praktischen, führt nämlich nach Dewey nur zur praktischen Bedeutungslosigkeit des Geistigen. „Nachdem sie den >Idealen< eine höfliche und fromme Reverenz bezeugt haben,“ so resümiert er nüchtern, „fühlen sich die Menschen frei, sich Angelegenheiten zuzuwenden, die unmittelbarer und drängender sind. ... Die Menschen hissen das Banner des Ideals und marschieren dann in die Richtung, welche die konkreten Bedingungen nahe legen und belohnen.“ Mir scheint, dass diese Einsicht an Aktualität zwischenzeitlich eher gewonnen hat. Beispiele sind nicht schwer zu finden. So besteht gegenwärtig die akute Gefahr, dass der Begriff der Menschenwürde, und zwar gerade wegen seiner tatsächlich zentralen Stellung für die Zivilreligion der pluralistischen Moderne, durch seine rhetorische Überstrapazierung in das von Dewey geschilderte ideologische Abseits geraten könnte. Ideale können eben auch dadurch entwertet werden, dass man sie zum Gegenstand eines praxisabstinenten, zivilreligiösen Kultus macht, der dann an die Stelle ihrer Leitfunktion für die praktische Gestaltung der Gesellschaft tritt. In seiner Schrift „Democracy and Education“ von1916 hat Dewey eine umfassende Philosophie der Erziehung ausgearbeitet, die sich gegen die Verselbständigung höherer Bildung richtet und im selben Zug eine emphatische Konzeption von Demokratie als Verkörperungskultur entwickelt. Für unsere Fragestellung fast interessanter ist aber die nahezu zeitgleich entstandene kleinere Arbeit über „Deutsche Philosophie und deutsche Politik“, in der Dewey sich ausführlich mit Fichte und dessen Kultur- und Staatsverständnis auseinandersetzt. Er analysiert Fichtes Position als die eines irregeleiteten Protopragmatisten, der an den Anfang die Tat setzt, das Subjekt aber eben gerade nicht genuin verkörpert sein läßt, sondern es der Welt als den Raum der Realisierung seines Willens gegenüber stellt. Daß dem Subjekt dabei die Fähigkeit zugestanden wird, seine Zwecke unabhängig von der Interaktion mit physischen Bedingungen zu setzen, ist für Dewey dann der Sündenfall, das Betreten einer schiefen Ebene nicht mehr empirisch rückgekoppelter Idealvorstellungen. Von diesen führt in seinen Augen eine Linie der Kontinuität hin zu aggressiven Vorstellungen von einer nationalen Mission, wie sie die ersten Jahre des ersten Weltkriegs in Deutschland 10 weithin charakterisiert haben, von der akademischen Kultur unterstützt durch die Konstruktion schlecht-idealistischer Gegensätze wie Zivilisation vs. Kultur, Gesellschaft vs. Gemeinschaft, Händler vs. Helden. Ob nun Deweys Analyse der inneren Differenziertheit des deutschen Idealismus und überhaupt der Multikausalität der historischen Entwicklung immer ganz gerecht wird, ist fraglich, spielt hier aber keine große Rolle. Denn der entscheidende Punkt, die Kritik an dem idealistischen Überspringen der falsifizierbaren Interaktion von Zwecken und Mitteln, hält unabhängig davon stand. Was Dewey überzeugend aufdeckt, ist der innere Zusammenhang zwischen demokratischen Idealen, einem Begriff der Kultur, der auf Verkörperung und nicht auf den Kultus des Idealen setzt, und einem Verständnis von Bildung, das sich dem billigen Gegensatz zwischen höherer Geistigkeit und instrumenteller Vernunft verweigert. Dewey war davon überzeugt, dass auch die Beziehung zwischen der Philosophie und den Wissenschaften sich in dem Maße verändern müsste, wie zum einen das philosophische Denken sich von seiner Funktion innerhalb eines bestimmten Stands der kulturellen Entwicklung her und nicht mehr als Suche nach ewigen Wahrheiten versteht und zum anderen sich die betreffende Kultur eine antidualistische Selbstinterpretation öffentlich zu eigen macht. Die Konsequenz dieser wünschenswerten Entwicklung läge für ihn nun aber gerade nicht in einer Indienstnahme auch noch des philosophischen Denkens für die praktischen Erfordernisse des Tages, sondern – diese Pointe sollte die Verächter des Pragmatismus aus Unkenntnis überraschen - in einer Freisetzung spekulativer Phantasie. Denn die pragmatistische Wissenschaftsphilosophie hat gegen den Positivismus immer betont, dass es keine neutrale Kenntnisnahme von Tatsachen gibt, sondern kulturelle Werte in einer intrinsischen Beziehung zur „Logik der Forschung“ stehen. „Solange wir die Wissenschaften anbeten“, kann Dewey deshalb 1931 schreiben, „und die Philosophie fürchten, werden wir keine große Wissenschaft haben. ... Weil wir Angst vor spekulativen Ideen haben, verrichten wir immer und immer wieder eine Riesenmasse an toter spezialisierter Arbeit im Bereich der ‚Tatsachen’. Wir vergessen, dass solche Tatsachen nur Daten sind, das heißt nur fragmentarische, unvollendete Bedeutungen, und wenn sie nicht zu vollständigen Ideen abgerundet werden – eine Arbeit, die nur durch Hypothesen geleitet ist, durch eine freie Imagination intellektueller Möglichkeiten – sind sie so hilflos wie alle verstümmelten Dinge.“ Der Praxisbezug der Philosophie unterbindet also nach Dewey nicht nur die spekulative Freiheit zur Erkundung des Möglichkeitsmenschen (Musil) keineswegs, er erzwingt sie geradezu, indem er sie als integralen Bestandteil einer empirischen Forschung erweist, die ihre positivistischen Selbstmissverständnisse hinter sich gelassen hat. 11 Damit bin ich bei meinem vierten und letzten Punkt angekommen: 4. Müssen wir uns zwischen Humboldt und Dewey entscheiden? Deweys antidualistische Kulturphilosophie, davon bin ich überzeugt, liefert uns das begriffliche Instrumentarium, mit dessen Hilfe wir die Korrektur jener idealistischen Einseitigkeiten angehen können, an denen die Humboldt-Kultur krankt. Eine Demokratie, die nicht auf lange Sicht zu einer sinnentleerten, periodischen wiederholten Abstimmungsprozedur verkommen will, bedarf einer Kultur der Verkörperung, in der gemeinsame, identitätsstiftende Werterfahrungen gemacht werden können. Wenn das Thema kultureller Identität aber, von der ökonomischen und technologischen Reproduktion getrennt, der literarischen Intelligenz als Sondergut zugeteilt wird, bleibt die Mehrheit der Bevölkerung, die beruflich nicht mit Sinnproduktion beschäftigt ist, außen vor. Ohne entsprechende Erfahrungen, die nur bottom-up durchlebt, nicht aber top-down verordnet werden können, geht es nicht, wie deutlich an der Krise der europäischen Einigung sichtbar wird. Und hier zeigt sich nun auch am klarsten die unheilvolle Rolle von Bildungseliten, die in sich zerrissen, weil selbst von jener fatalen Trennung zwischen höheren kulturellen Werten und technokratischen Prozessen geprägt sind. Man denke an C.P. Snows 50 Jahre alte Diagnose von den zwei Kulturen, die heute so aktuell ist wie damals, nur mit dem Unterschied, dass naturalistische Positionen zwischenzeitlich den sprachlich-literarisch geprägten Bildungskosmos noch stärker marginalisiert haben. Ich glaube, dass Humboldts einseitiges, linguistisch zentriertes Verständnis von Verkörperung eine Ursache für dieses Dilemma, näherhin für die Schwächen des spezifisch deutschen Verständnisses von Kultur und Bildung darstellt. Deweys Versuch einer Integration von Bildung und Ausbildung, von reflexiven Wertvorstellungen und intelligenter Mittelwahl, ist von einem Antidualismus geleitet, der konsequenter ist, als der halbherzige Versuch Humboldts. Kultur muß so nicht mehr in einen schlechten Gegensatz zu den naturalen Bedingungen des Menschseins gebracht werden, was wiederum die Erfahrungen und beruflichen Aktivitäten jener Mehrheit aufwertet, die mit den physischen bzw. ökonomischen Bedingungen des Lebens beschäftigt sind. Man kann sich allerdings fragen, ob Deweys holistische Engführung von Philosophie und Wissenschaft, Theorie und Praxis, Bildung und Ausbildung nicht an Plausibilität einbüßt, wenn man die extrem hochgradige Arbeitsteiligkeit und Parzelliertheit des Wissens bedenkt, die moderne Wissenschaftskulturen auszeichnen. Läßt sich das integrative Bildungsideal, wie 12 es Dewey vornehmlich im Blick auf schulische Verhältnisse nicht nur postuliert, sondern auch vielfach praktisch erprobt hat, umstandslos auf akademische Bildung übertragen? Sicher nicht, denn auch die Reflexion auf die in Forschung verkörperten Werthaltungen individueller und sozialer Art macht ja die Tatsache keineswegs obsolet, dass kleinmaschige Spezialisierung in vielen Bereichen die Voraussetzung seriöser Arbeit geworden ist. Max Weber hat das in seinem berühmten Vortrag „Wissenschaft als Beruf“ schon deutlich ausgesprochen. Die ironische Pointe besteht freilich darin, dass Webers Vortrag selbst keineswegs ein Beitrag zum bornierten, und deshalb kompetenten Spezialistentum ist, sondern, ganz im Sinne Deweys, über das Verhältnis fachlicher Leistungen zu den Wertfragen des sozialen Lebens nachdenkt. Das humboldtsche Bildungsideal setzt gegen die Zentrifugalkraft des Spezialistentums auf die zentripetale Wirkung der umfassend gebildeten Persönlichkeit, muß die Lebbarkeit dieses Ideals aber mit Elitismus und mit der dualistischen Ausgrenzung zweckrationalen Handelns erkaufen. Deweys emphatische Engführung von Demokratie und Erziehung zeichnet das Bild einer Kultur, in der gemeinsame Erfahrungen prägende Kraft haben, gestützt von einem Erziehungssystem, das nicht auf Eliten, sondern auf die Inklusion möglichst vieler Menschen abzielt. Begreift man Demokratie, wie hier vorgeschlagen, als Kultur der sozialen wie materiellen Verkörperung von Werten, ist Dewey der aktuellere Denker. Den demokratischen Vorteilen der pragmatistischen Inklusionspädagogik steht freilich die unleugbare Notwendigkeit funktionaler Eliten in einer arbeitsteiligen Welt gegenüber. Und hier behält zwar nicht Humboldts idealistisches Persönlichkeitsideal, aber doch seine Universitätsidee ihr Recht. Sie markiert nämlich die Konturen einer Universität, die bei aller hochgradigen Spezialisierung eine integrierende Kraft bewahrt, und dies nicht zuletzt dadurch, dass sie den Forschungs- und Reflexionseliten den Freiraum schafft, spekulativ das Bestehende zu überschreiten, wie es Dewey für die Philosophie gefordert hatte. Blickt man aus dieser Dewey und Humboldt integrierenden Perspektive auf die Bildungslandschaft der Gegenwart, so ergibt sich eine seltsame Inversion: Humboldts Ideale leben fort in den Mikrokosmen der amerikanischen Eliteuniversitäten, wohingegen Deweys demokratische Pädagogik nach dem Ende der „progressive Education“ in den USA und der bundesdeutschen Gesamtschuleuphorie nur noch von reformpädagogischen Schulexperimenten fortgeführt wird. Im Blick auf die Zukunftschancen partizipatorischer Demokratien kann dieser Befund nicht optimistisch stimmen. 13