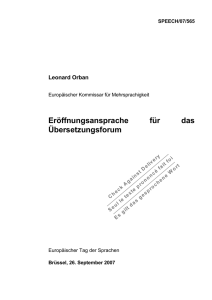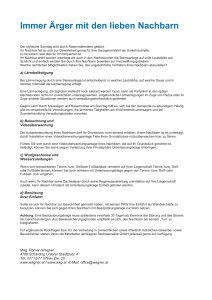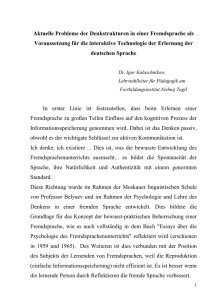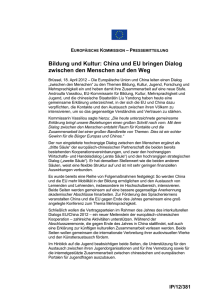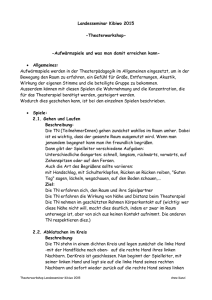Karl-Heinz Lambertz, Member of the EDUC Commission of the CoR
Werbung

Beitrag von Karl-Heinz Lambertz, Ministerpräsident der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens und Mitglied der Fachkommission EDUC des Ausschusses der Regionen, zum Thema „Förderung der Mehrsprachigkeit auf lokaler und regionaler Ebene“ anlässlich der Konferenz „Bedeutung einer mehrsprachigen Gesellschaft für die Förderung der Mobilität in den europäischen Regionen und Städten“ Bozen/Italien, 17. April 2007 Meine sehr geehrten Damen und Herren, in das Thema Mehrsprachigkeit kann man aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln einsteigen. (…) Ich komme aus einem Land mit den drei Amtssprachen Französisch, Niederländisch und Deutsch und das von vielen Nachbarn umgeben ist, die ebenfalls ihre eigene Sprache reden. Ihre Situation ist in dreifacher Hinsicht eine besondere. Ich vertrete die deutschsprachige Minderheit in Belgien. Wer 0,7% der Gesamtbevölkerung ausmacht, darf sich wohl mit Fug und Recht als Minderheit betrachten. Ich vertrete auch eine ganz kleine Region mit 73.708 Einwohnern. Eine kleine Region, die nichtsdestotrotz über die Gesetzgebungshoheit verfügt, was ihr auf europäischer Ebene schon eine besonders interessante Stellung verleiht. Und ich komme aus einem Grenzgebiet, in dessen unmittelbarer Nachbarschaft vier Sprachen gesprochen werden: Luxemburgisch, Französisch, Deutsch und Niederländisch. Die gesamte Geschichte meiner Region ist auch und nicht zuletzt die Geschichte des Umgangs mit der eigenen Sprache, und derjenigen der Nachbarn. Ein Umgang, der im Laufe der Geschichte übrigens durchaus problematisch war. Als der Versailler Vertrag 1920 beschloss, dass dieser Teil Deutschlands zu Belgien kommt, wurden dahingehend große Debatten geführt, ob die deutsche Sprache überhaupt erhalten bleiben sollte. Und als nach den Wirren der Zwischenkriegszeit und des Zweiten Weltkrieges wieder allmählich Normalität eingekehrte, stellte sich für viele Menschen in meiner Heimat auch die Frage: Können wir nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt noch ruhigen Gewissens unsere Muttersprache Deutsch reden oder müssen wir eine andere Sprache für unsere zukünftige Entwicklung wählen? Das waren alles sehr große Herausforderungen in der Vergangenheit, und sie haben die Menschen in meiner Region dazu bewegt, zum Thema Sprache – sowohl Mutter- als auch Fremdsprache und dabei ganz besonders die erste Fremdsprache Französisch - eine ganz besonders komplexe Beziehung aufzubauen. Als eigenständige Region bestehen wir vor allem und auch nur deshalb, weil wir eine andere Sprache reden als die übrigen Mitbürger unseres Landes. Wir haben begriffen, dass wir die Sprache unserer Nachbarn beherrschen müssen, wenn wir unsere Zukunft gestalten möchten. Und so lebe ich in einer Region, wo praktisch die gesamte Bevölkerung ziemlich gut, zumindest zwei Sprachen spricht: Deutsch und Französisch. Darüber hinaus sind viele Menschen bemüht, ebenfalls die niederländische Sprache zu erlernen, die in Belgien ja die meistgesprochene Sprache ist. Selbstverständlich müssen auch wir uns ganz klar mit der Situation abfinden, dass in der heutigen globalisierten Welt ohne Englisch keine Alltagskommunikation mehr möglich ist. Weil wir uns dessen bewusst sind, haben wir versucht, unsere Gesetzgebungsmöglichkeiten, unsere Handlungsmöglichkeiten vor Ort in den Dienst dieser Sprachenkompetenz zu stellen. Dazu möchte ich Ihnen die wichtigsten Dinge hier als Beispiel zitieren, um Ihnen zu erläutern, wie wir es machen - nicht weil wir es am besten machen, sondern weil wir es machen müssen, wenn wir überleben wollen. Wir haben in meiner Region das Erlernen der ersten Fremdsprache zur Pflicht gemacht - und das schon im Kindergarten: Ab dem Alter von drei Jahren werden die Kinder in meiner Heimat spielerisch mit der französischen Sprache konfrontiert und mit zunehmender schulischer Entwicklung wird Französisch als Pflichtfach in den Primar- und Sekundarschulen erteilt. Dies haben wir gesetzlich festgelegt und im Großen und Ganzen sind wir mit unserer gesetzlichen Gestaltung zufrieden. Wir sind nach Malta in Europa das Gebiet mit der höchsten Mindestgesamtstundenzahl an Fremdsprachenunterricht, und das über einen Zeitraum von neun Jahren. Wir haben aber auch noch ein anderen Weg beschritten: Wir haben den bilingualen Unterricht - insbesondere bei der Sekundarschulausbildung - zu einem Markenzeichen unserer Region gemacht, indem wir gesetzlich erlauben, dass maximal die Hälfte aller Unterrichtsstunden im Sekundarschulwesen – mit Ausnahme der Sprachunterrichtsstunden - in einer anderen Sprache als der Muttersprache erteilt werden kann. Diese Möglichkeit wird in vielen Schulen unserer Region genutzt. So haben wir auch ein sehr breit entwickeltes Netz an bilingualen Ausbildungsangeboten in der Sekundarschule. Deshalb arbeiten wir auch sehr intensiv bei der Europäischen Initiative „EMIL“ mit, was für „Enseignement d’une matière intégrée à une langue étrangère“ steht. Mit diesem System haben wir sehr gute Erfahrungen sammeln können. 2 Dennoch sind wir mit der sprachlichen Kompetenz unserer jungen Menschen und auch unserer Erwachsenen nicht zufrieden. Wir denken, dass diese noch besser und noch mehr Sprachen erlernen müssen. Wir sind auf der Suche nach Möglichkeiten, um auf dieser Ebene unsere Ausbildungsqualität zu steigern. Gerade weil wir ständig auf der Suche sind, freuen wir uns, an Tagungen wie der heutigen und an vielen anderen europäischen Austauschprojekten teilnehmen zu können. Bei der Suche nach den besten Möglichkeiten, Fremdsprachen zu erlernen, kommt es selbstverständlich ganz entscheidend auf didaktische, auf methodologische Aspekte an. Aber ich persönlich bin der Überzeugung, dass die wesentliche Frage irgendwo anders liegt. Wo liegt denn die wesentliche Problematik beim Erlernen von Fremdsprachen? Es gibt Generationen von Menschen in ganz Europa, die eine Fremdsprache gelernt haben und diese dann doch nicht richtig sprechen können. Das liegt nicht ausschließlich an der Qualität des Unterrichts. Das kann zwar auch am Unterricht liegen, liegt meines Erachtens aber vor allem an der Motivation. Ich lerne vor allem dann eine Sprache gut und gerne, wenn ich sie erlernen will! Wenn ich Gründe habe, wenn ich davon überzeugt bin, diese Sprache erlernen zu wollen. Diese Gründe können sehr vielschichtig sein. Sie können in einer globalisierten Welt zunehmend mit der Notwendigkeit der beruflichen Weiterentwicklung verbunden sein. Sie können aber auch in der Sehnsucht nach den vielen Leben begründet liegen, von denen eben gesprochen wurde, als richtigerweise zitiert wurde, dass ja jede Sprache ein neues Leben mit sich bringt. Diese Chance, andere Regionen, andere Erdteile und andere Partner zu entdecken, ist meines Erachtens die wichtigste Motivationsgrundlage, die es für die Erlernung einer Fremdsprache überhaupt geben kann. Deshalb müssen wir, denke ich, vor allem auf dieser Motivationsebene arbeiten, wenn wir erfolgreich Sprachenkompetenzverbesserung betreiben wollen. Wen müssen wir motivieren? Wir müssen natürlich in erster Linie die jungen Menschen selbst motivieren, aber selbstverständlich auch die älteren Menschen. Wir müssen auch die Eltern dieser Kinder motivieren. Wir müssen vor allem - das ist die zentrale Herausforderung - die Lehrerinnen und Lehrer motivieren, den richtigen Weg bei der Vermittlung von Sprachenkompetenz zu finden. Das setzt voraus, dass sie natürlich selbst eine sehr hohe Sprachenkompetenz besitzen und dass sie in der Lage sind, zwischen der fremden Sprache und dem, was einen jungen Menschen oder einen Erwachsenen motivieren kann, den richtigen Zusammenhang herzustellen. Da liegt für mich die eigentliche Herausforderung bei der Vermittlung von Sprachenkompetenz. Das hat nicht nur mit Sprache im engeren Sinne zu tun. Da geht es in Wirklichkeit um „interkulturelle Kommunikationskompetenz“. Von der interkulturellen Kommunikationskompetenz habe ich einmal eine wunderbare Definition gelesen habe, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte auch wenn ich weiß, dass das, was ich jetzt sage, sehr schwer zu übersetzen ist. Ich entschuldige mich bei den Dolmetscherinnen und Dolmetschern dafür. 3 Was ist interkulturelle Kommunikationskompetenz? Interkulturelle Kommunikationskompetenz ist bedeutend mehr als ein Fremdsprachenunterricht oder eine Fettnäpfchenlehre für Fortgeschrittene. Interkulturelle Kommunikationskompetenz setzt die Fähigkeit voraus, sich in die Situation des Partners, in seine besondere Lage, in seinen kulturellen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Hintergrund hineinzudenken und auf dieser Ebene mit ihm zu kommunizieren. Das ist gerade in Zeiten der Globalisierung eine große Herausforderung. Das ist natürlich auch eine besonders große Herausforderung für Europa, wenn wir wirklich wollen, dass die kulturelle Vielfalt das entscheidende Alleinstellungsmerkmal einer gelungenen europäischen Integration sein soll. Da können, so denke ich, Grenzregionen eine ganz besondere Rolle spielen. Da scheint mir auch die Notwendigkeit beim Fremdsprachenerlernen zuerst einmal die Sprache des Nachbarn zu kennen, von ganz entscheidender Bedeutung. Dass jeder heute Englisch beherrschen muss, ist ganz klar. Dies steht außer Frage und bedarf keiner Diskussion. Aber wenn ich mich bewusst dafür entscheide, die Sprache des Nachbarn, der anderen Landesteile in einem Mehrsprachenstaat oder die Sprache des Nachbarn jenseits der Staatsgrenze zu erlernen, dann mache ich weit mehr als nur eine Erfahrung in Sachen Mehrsprachigkeit. Dann versetze ich mich in die Lage, tagtäglich mit den Menschen auf einer ganz neuen Ebene zu kommunizieren, die meine unmittelbaren Nachbarn sind und die in Zeiten der Mobilität natürlich sehr schnell und vielfältig erreichbar sind. Deshalb denke ich auch, dass gerade in den Grenzregionen in Europa dieses Thema des Erlernens der Sprache des Nachbarn - etwa auch im Rahmen eines Konzeptes der rezeptiven Mehrsprachigkeit, von dem eben die Rede war - eine ganz wichtige Priorität ist und bleiben muss. Das ist viel leichter gesagt als getan! Ich selbst arbeite in zwei grenzüberschreitenden Verbünden mit - in der Großregion Saar-Lor-Lux und in der Euregio Maas-Rhein - und erlebe dort, wie schwierig es ist, von den Sonntagsreden über die Notwendigkeit des Erlernens der Sprache des Nachbarn zu der wirklich verbreiteten Realität dieses Sprachenerlernens zu kommen. Das gilt auch für Länder, wie mein Heimatland Belgien mit seinen drei Landessprachen, die man doch als ein besonderes Markenzeichen bezeichnen kann. Aber leider ist es so, dass nur sehr wenige Belgier diese drei Sprachen und selbst nicht einmal zwei dieser drei Sprachen kennen. Das ist eine negative Situation. Denn das Kennen der Sprache des Nachbars ist eine fundamentale Notwendigkeit, wenn ich mich wirklich öffnen will, wenn ich meine Entwicklung in Zusammenarbeit mit meinen Nachbarn gestalten möchte. 4 Deshalb denke ich, dass wir die Mehrsprachigkeit in Europa weiterhin systematisch fördern müssen. Wir müssen sie immer wieder einklagen. Wir müssen all das unterstützen, was dazu beiträgt, die Sprachenkompetenz zu verbessern. Wir sollten gerade auch als Europäische Union immer wieder neue Ansätze suchen, um Begegnungen, konkrete Immersionserfahrungen möglich zu machen. Denn die beste Methode, um schnell und zügig eine Sprache zu lernen, ist es, in eine andere Sprache einzutauchen und sich dort dann zu bewähren. Diese Möglichkeiten haben sich in den letzten Jahren unter anderem dank europäischer Initiativen wie dem Erasmus-Programm entscheidend verbessert. Aber da kann noch sehr viel mehr geschehen, als das, was heute geschieht. Deshalb möchte ich meine Ausführungen auch mit der Aufforderung beenden, die Möglichkeiten der Mehrsprachigkeit in Europa voll auszunutzen, alle methodologischen Erfahrungen immer wieder vernetzt in den Dienst der gesamten europäischen Bevölkerung zu stellen, um auf diese Art und Weise diese europäische Mehrsprachigkeit zu einem Trumpf für Europa, und zu einem Trumpf für Europa in einer globalisierten Welt zu machen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 5