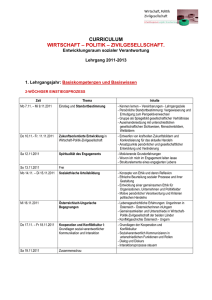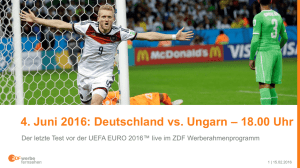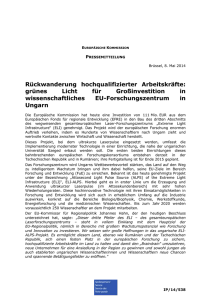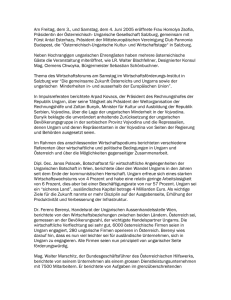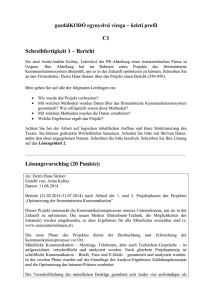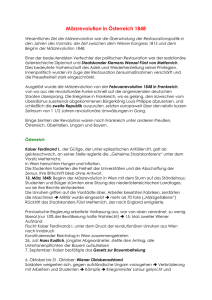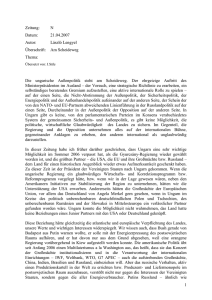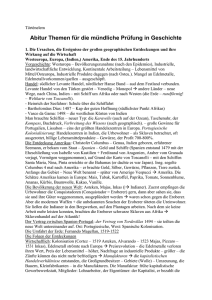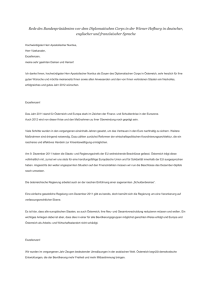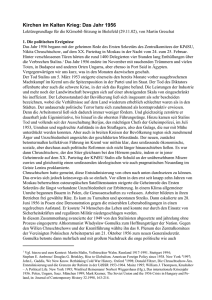Die geographische Lage von Tarian
Werbung
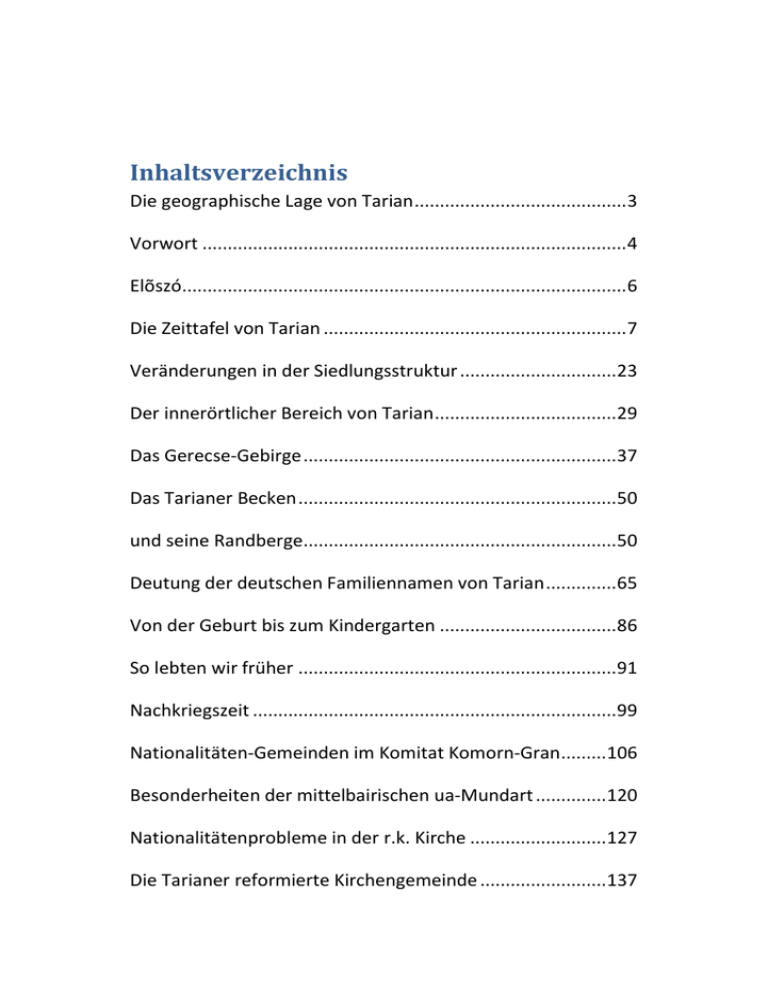
Inhaltsverzeichnis
Die geographische Lage von Tarian .......................................... 3
Vorwort .................................................................................... 4
Elõszó........................................................................................ 6
Die Zeittafel von Tarian ............................................................ 7
Veränderungen in der Siedlungsstruktur ...............................23
Der innerörtlicher Bereich von Tarian ....................................29
Das Gerecse-Gebirge ..............................................................37
Das Tarianer Becken ...............................................................50
und seine Randberge..............................................................50
Deutung der deutschen Familiennamen von Tarian ..............65
Von der Geburt bis zum Kindergarten ...................................86
So lebten wir früher ...............................................................91
Nachkriegszeit ........................................................................99
Nationalitäten-Gemeinden im Komitat Komorn-Gran.........106
Besonderheiten der mittelbairischen ua-Mundart ..............120
Nationalitätenprobleme in der r.k. Kirche ...........................127
Die Tarianer reformierte Kirchengemeinde .........................137
A tarjáni református hitközösség .........................................137
Reprivatisierung von Grund und Boden ...............................141
Ungarndeutsches Jugendlager .............................................143
Weihnachten früher .............................................................148
Heiligenkreuz ........................................................................151
Über das Schweineschlachten ..............................................164
Über die Reinhardt-Erbschaft...............................................167
Statistische Tabellen zu Tarian .. Error! Bookmark not defined.
Fotos aus dem Kindergarten, Schule, Kirche, Alltag
2
187
Die geographische Lage von Tarian
3
Vorwort
Das vorliegende Buch ist eine der vielen ungarndeutschen Dorfchroniken, die in letzter Zeit das Licht der
Welt erblickt haben. Wie alle Bücher dieser Art weist –
sicher – auch dieses Mängel auf, ist es doch von einer
Person in mühevoller Arbeit allein zusammengestellt
worden.
Was veranlasst einen Menschen, der seit mehr als
40 Jahren nicht mehr in Tarian lebt, so eine Arbeit auf
sich zu nehmen? Es ist eine geheimnisvolle innere
Stimme, die den Autor vorantrieb, immer mehr an
diesem Thema zu arbeiten. Wahrscheinlich ist es
Sehnsucht nach dem „verlorenen Paradies“ der Kindheit,
nach der Geborgenheit im Elternhaus, im Kreise der
Verwandten und Freunde sowie in der Dorfgemeinschaft, kurz nach dem, was man Heimat nennt.
Vielleicht stillt die geistige Beschäftigung mit der
verlorenen Heimat ein in der Tiefe der Seele sitzendes
Heimwe. Das Wissen über die Vergangenheit des
Heimatdorfes und der Vorfahren stärkt die Bindung an
die engere Heimat. Als wir 1946 aus Tarian vertrieben
werden sollten, schwor ich mir als 9jähriger Junge, dass
ich – aus Rache dafür – nie wieder nach Tarian
zurückkommen werde. Als ich dann 1956 das Land
freiwillig verlassen habe, durfte ich erst wieder 1964
meine Heimat besuchen, worüber ich dann doch sehr
glücklich war.
Im Zuge des politischen Tauwetters besuchte ich in
den folgenden Jahrzehnten sehr oft Tarian. Ich begann
im Jahrbuch der Ungarndeutschen („Unser Hauskalender“) und anderen Presseorganen der Deutschen
aus Ungarn regelmäßig über meinen Geburtsort und
4
seine Umgebung zu schreiben. Dazu mußte ich Material
sammeln. Dabei waren mir meine Schwester Maria und
ihr Ehemann Steffl Fülöp behilflich. Mit ihrer Hilfe stellte
ich die Namensliste der der Haushaltsvorstände von
1944 und die der ungarischen Siedler u. a. zusammen.
Kirchengeschichtliche Informationen erhielt ich von den
Pfarrern Otto Kormos und Gábor Vendrey. Die Namensliste der katholischen Pfarrer von 1756 bis heute
vervollständigte Pfr. Lajos Varga. Über die reformierte
Kirche gab mir Informationen Seelsorger Antal Szücs.
In vielen Gesprächen und durch sein Buch »Tarjáni
krónika« war mir der Tarianer Heimatdichter Josef
Mikonya eine große Hilfe bei der Gestaltung meines
Buches. Auch der Gemeindeverwaltung von Tarian –
vor allem Frau Notarin Sámson Kathi Werli, Frau Werli
Agnes Pokorny und Bürgermeister Stefan Fülöp –
möchte ich danken für die Herausgabe der statistischen
Unterlagen. Die Liste der Volksschullehrer verdanke ich
der langjährigen Schulleiterin Frau Szegedi Júlianna
Barkó-czi.
Allen Helfern sage ich herzlichen Dank!
Ich wünsche, dass dieses Buch dem Wohl der
Gemeinde Tarian und ihrer Bewohner – deutscher und
ungarischer Muttersprache – dienen möge!
Bous, im August 1996
Der Autor
5
Elõszó
Ez a könyv nem jelenhetett volna meg, ha az
anyaggyüjtésnél az alábbiakban felsoroltak nem
segítettek volna. Elsõsorban köszönetet mondok Mária
nõvéremnek és férjének, id. Fülöp Istvánnak. Az õ
segítségükkel állítottam össze az 1944es háztartási fõk
és a magyar telepesek névsorát. Egyháztörténeti
információkat Kormos Ottó és Vendrey Gábor
plébánosoktól kaptam. A katolikus papok névsorát 1756tól máig Varga Lajos plébános egészítette ki. A
református egyházról Szücs Antal lelkész adott
információkat.
Sok megbeszélés és könyve »Tarjáni krónika« által
Mikonya József, tarjáni népi költõ, nagy segítségemre
volt könyvem megfogalmazásában. A tarjáni községi
közigazgatásnak – elsõ sorban Sámsonné Werli Katalin
jegyzõnek, Werliné Pokorny Ágnesnek és Fülöp István
polgármesternek – köszönetet szeretnék mondani a
statisztikai adatok kiadásáért.
Az elemi iskolai tanítók névsorát Szegediné
Barkóczi Júliannának, aki hosszú ideig iskolaigazgató
volt, köszönhetem.
Minden segítõnek hálás köszönetet mondok!
Kívánom, hogy ez a könyv Tarján község és
népének – német és magyar anyanyelvüek – javát
szolgálja!
A
szerzõ
6
Die Zeittafel von Tarian
1240: Erste urkundliche Erwähnung von Tarian. Damals
grenzte es an die Güter der Abtei Martinsberg. Zu
dieser Zeit war der Ort eine Filiale der Schambeker
Pfarrei.
1326: Ein Meister Paul war Besitzer von "Terra Taryan".
1426: Der Ort gehörte zur Totiser Festung und zum
Komitat Gran (wie später auch zwischen 1850 und
1860).
1529: Eroberung und Verwüstung des Dorfes durch die
Türken.
1640: Wiederbesiedlung mit reformierten Ungarn.
Im 17. Jh. waren die Grafen Zichy Besitzer des Gutes
Tarian.
1646: Neue Besitzer des Dorfes sind die Csákys, nach
ihnen gehörte es dem Staat.
1674: Der Tarianer ref. Pfarrer wurde von Primas
Szelepcsényi vor den Gerichtshof nach Preßburg
zitiert.
1682: Gründung der ref. Schule (ein Klassenraum in
einem Bauernhaus)
1683: Vertreibung der Türken, Ende der Türkenherrschaft
1693: Tarian gehörte zum Hoch-burgischen Gut (Totiser
Herr-schaft).
1697: Tarian kam in den Besitz von Baron Krapf
1707: Die Dorfbewohner schlossen sich dem RákócziAufstand an.
1720: Volkszählung: Alle Bewohner waren Ungarn.
1727: Tarian kam – gemeinsam mit Totis – in den Besitz
des Grafen Esterházy.
7
1737: Esterházy siedelte 40 deutsche r. k. Familien aus
dem Schwarzwald an. So wurde Tarian ein deutsches
Mehrheitsdorf. Damals hatte es die meisten deutschen Einwohner im Kreis Totis.
1739: erste– urkundlich belegte –Taufe eines deutschen
Tarianer Kindes (r. k. Pfarrei Héreg)
1747: Am 5. Februar verfügte Josef Esterházy die
Rückgabe der von den Kalvinisten genutzten ehemaligen r.k. Kirche an die Katholiken.
1756: Bisher gehörte die Tarianer r. k. Filialkirche zu
Bajna/Weina.
> Gründung der r.k. Pfarrei, erster Pfarrer: Johann
Georg Koller
1758: Die reformierte Kirche stellte ihre Tätigkeit ein, und
nahm sie erst 1781 wieder auf.
> 192 Bauern- und Häuslerfamilien lebten schon hier.
1762: Bau der r. k. Schule: Erster Schulmeister war
Jakob Ziegler.
1779: 7. Januar Grundsteinlegung für die r. k. Kirche,
anstelle der alten bis 1747 von den Kalvinisten
genutzten Kirche.
1783: Bis auf den Turm wurde die r. k. Kirche fertiggestellt.
1785: Fertigstellung der ref. Kirche im Hinterhof des
Pfarrhauses, in gleicher Höhe mit den Scheuern
1784/87: Volkszählung: Tarian zählte 241 Familien mit
1556 Personen, davon waren 405 reformiert
1800: Anfang des 19. Jahrhunderts Eröffnung des Alten
Friedhofs Am Berg
1828: 269 Bauern- und Häuslerfamilien lebten hier. –
Errichtung der Dreifaltigkeitssäule.
1831: Die Tarianer verlangten von der Herrschaft die
Rückgabe der einzogenen Felder.
1848: Die Leibeigenschaft wurde abgeschafft.
8
Die Grundherrschaft verpachtete im September ihre
Schäferei (ca. 203 kj) an die ortansässigen jüdischen
Händler Jakob und Kaspar Singer
1849: Die Gebrüder Singer übernahmen auch die
Schnapsbrennerei mit dem dazugehörigen Land von
186 kj.
1859: Bau der Kapelle in der Totiser Straße zu Ehren
der Rosenkranzkönigin (Siehe den Text der Grundsteinlegungsurkunde, die im Sept. 1997 aufgefunden
wurde)
1863: 25. Okt. Einweihung der r. k. Kirche nach Fertigstellung des Turms
1866: Eine Cholera-Epidemie forderte 195 Todesopfer.
Daran erinnert das Rochus-Denkmal in der Untergasse, welches Andreas Werli und Gattin, Anna
Beigelbeck gestiftet haben.
> In diesem Jahr ließ Wendelin Berendi das große
Kreuz des Neuen Friedhofs aufstellen. Es stand bis
1993, damals fiel der obere Teil herunter. 1994 wurde
es durch ein neues ersetzt, welches Johann Iseli
gestiftet hat.
1881: Renovierung der Rosenkranz-kapelle
1884: Umbau und Erweiterung der r. k. Pfarrhauses
1885: Nach der Bauernbefreiung von 1848 erfolgte erst
jetzt die allgemeine Regelung des Landbesitzes in
Tarian.
1888: Anlage des 1. Kataster-Grundbuches der Gemeinde (> 1937)
1892: Festlegung der Aufnahme-Bedingungen von
Bürgern in den Gerneindeverband von Tarian: 4 Jahre
Dauerwohnsitz im Dorf, Aufnahmegebühren – je nach
Vermögen – 1-25 Heller, zahlbar an die Armenkasse.
1894: Gründung des örtlichen Kreditinstitutes
9
1896: Umbau des Hauses Nr.148 zu einem Kindergarten
durch die Gemeinde, Jahreszuschuß 600 Gulden
> Die Gemeinde gewährte zum Umbau der ref. Schule
einen Zuschuß von 300,-- Ft.
1899: Der »St. Josef«-Beerdigungsverein wurde gegrüdet.
1900: Errichtung des Kreuzes rechts von der Kapelle,
gestiftet von Jakob Kühn und Frau, geb. Anna
Bachmann aus Budapest.
Die Nowa-Rebe beginnt ihren »Siegeszug« in Tarian.
Anfang des 20. Jahrhunderts erhielt die Gemeinde
ein Post-amt mit Fernschreiber. (Vorher gehörte
Tarian postalisch zu Tardos.)
1903: Anstellung des Analphabeten József Horváth als
Kadaverwächter; Gebührenordnung für die Beseitigung eines mehr als 2 Jahre alten Pferdes oder
Rindes a) Enthäuten 1Krone, b) Ver-graben 50 Heller;
eines jünger als 2 J. alten Pferdes oder Rindes a) 50
Heller, b) 40 Heller usw.
Elisabetha Berendi, Wwe. des verstorbenen Kilian
Klausenberger, ließ auf dem Alten Friedhof ein großes
Kreuz errichten.
> Die Lehrer der r. k. Schule waren damals Georg
Braunstein und Silvester Weiß.
1906: Gründung der örtlichen freiwilligen Feuerwehr
1907: Der Schatzmeister der Gemeinde erhielt – ähnlich
wie der Dorfrichter – ein Gehalt von 160 Kronen. Die
Vorstandsmitglieder bekamen ein Tagegeld von 40
Kr., der Waisenvater und der stellvertr. Dorfrichter 60
Kr.
> Eröffnung des Neuen Friedhofs. Das große Kreuz
ließ Martin Mayer – der reichste Bauer des Dorfes –
aufstellen.
1910: Die r. k. Kirche ist gründlich renoviert worden.
10
Dr. Bodemann (später Báticfalvi) wurde Kreisarzt von
Tarian und Umgebung.
Die ref. Voksschule bekam ein neues Gebäude, in
ihm sind 30–35 Kinder unterrichtet worden.
1913 – 1914: Maserepidemie
1915: Der Kreisarzt Dr. Báticfalvi wurde von Dr. David
Deutsch abgelöst.
1914 – 1918: Über vierhundert Tarianer dienten als
Soldat im Ersten Weltkrieg. 90 von ihnen sind gefallen
(> Namensliste der Gefallenen des I. Weltkriegs).
1919: 23. März: Gründung des örtlichen kommunistischen Arbeiterrates
> Zwecks Förderung der Viehzucht übernahm die
Gemeinde von der Bauerngemeinschaft die Zuchttiere
(Stiere, Eber usw.).
1920: Bodenreform: 135 Familien bekamen je 1–9
Katastraljoch (0,58–5,18 ha), 116 Familien waren
danach immer noch ohne Land.
Umbau und gründliche Restaurierung der kath. Volksschule. Ab sofort wurde in vier Klassenräumen unterrichtet.
> In 1920er Jahren wurden mit FOKSz-Kredit die
Häuser in der heutigen Linden- und Pfadfinder-Gasse
gebaut (ca. 50).
1921: Die große Glocke der r. k. Kirche, die 1917 für
Kriegszwecke geopfert wurde, hat man durch eine
neue ersetzt.
> Die drei Nachtwächter wurden pro Person mit 500
kg Weizen im Jahr entlohnt.
1922: Die Mitglieder des Gemeindevorstands haben im
Ort 50 Kronen, außwärts 100 Kr. Tagegelder erhalten.
Der Notar erhielt eine jährliche Tagesgeldpauschale
von 3600 Kr..
11
1923: Der Kleinrichter bekam als Entlohnung 700
Kronen/Tag.
> Die Ziegelei wurde für 800 kg Weizen/Jahr an
Johann Tresl und Max Kraus für 12 Jahre verpachtet.
1925: Für den Bau der Arztwohnung nahm die
Gemeinde einen Kredit von 100 Millionen Kronen auf.
Der Umbau und Erweiterungsplan stammt aus 1924.
Der Finanzierungsplan von 5520 Goldkronen wurde
vom Bauunternehmen Ignaz Brüll in Seestadt
angefertigt.
> Am 18. Oktober wurde die Ortsgruppe des
Ungarländischen Deutschen Volksbildungsvereins
gegründet (UDV).
1926: Am 18. Juli ist die von Barbara Weiler gestiftete
Sterbeglocke (»Zinnglöckl«) der r. k. Kirche eingeweiht worden.
1927: Einweihung des Denkmals links von der Kapelle,
gestiftet von Franz Weiler und Gattin, Maria Sentner
1928: Vor der r. k. Kirche errichtete man das Denkmal
für die 90 Gefallenen des Ersten Weltkriegs (>
Namensliste)
In der Gemeinde gab es 6 Wirtshäuser und 2
»beschränkte« Ausschankstellen für 2007 Einwohner
(Stand 1926): Der Gemeiderat lehnte den Antrag von
Josef Niedermann und Genossen ab, die Zahl der
Wirtshäuser um eins zu erhöhen.
1929: Bau einer Starkstrom-Leitung im Tarianer Hotter
von Tatabánya nach Tokod. Die Gemeinde bzw. die
Bauern wurden von der Kohlegesellschaft entschädigt.
Vertrag mit der Allgemeinen Ungarischen Steinkohlen
AG, Buda-pest, der ihr für die Dauer von 60 Jahren in
der Gemarkung von Tarian Versuchsbohrungen und
den Kohlebau erlaubte.
12
> Beschluß über den Bau eines Kreis-Arzt-Hauses
(Kreditaufnahme von 15000 Gulden)
1930: Fertigstellung des ersten Arzthauses im Dorf (in
der Obergasse)
1933: Der Gemeinderat beschloß eine monatliche
"Ehrenrente" von 20 Gulden für die arbeitsunfähig
gewordene Hebamme Frau Göbécs, geb. Franziska
Tamsitz, die 35 Jahre in der Gemeinde tätig war.
1935: Die Kreisarztstelle in Tarian wurde von Dr. Ferenc
Fekete und seiner Frau, Dr. Erzsébet Gáspár
(Frauenärztin und Geburtshelferin) besetzt. Dr.
Deutsch wurde pensioniert.
> Vertrag mit Péter Pázmány aus Seestadt über die
Jagdpacht im Hotter von Tarian: Für die Jahrespacht
zahlte er 80 Goldgulden. Er behielt sie bis August
1937, danach übernahm sie der Gemeinde-Kanzleischreiber Tibor Major.
> Standgebühren für die Tarianer Jahrmärkte: 1 Kuh
oder Pferd (> 2 Jahre): 24 Filler 1 Kuh oder Pferd < 2
Jahre): 16 Filler; 1 Schaf, Ziege, Schwein, Esel: 12
Filler, usw.
1936: Beginn des Baus der Landstraße zwischen
Tatabánya und Tarian
> Gründung des Neuen Wald-Besitzervereins: Unter
den Mitgliedern wurden 572 kj Wald aufgeteilt.
> Die Landstraße zwischen Tarian und Héreg wurde
fertiggestellt.
> Beschluß zur Erweiterung des Rathauses
Die Arbeitszeit der Gemeinde-Angestellten im Rathaus betrug täglich 6 Stunden.
1937: Im September begann in der ersten Klasse der r.
k. Schule der Unterricht in ungarischer Unterrichtssprache.
> Anlage eines neuen Kataster-Grundbuches (> 1888)
13
1938: Fertigstellung der steinernen Verbindungsstraße
nach Tatabánya
Der Plan für das Haus der Gesundheit wurde fertiggestellt (> 1940).
1939: 19. Dez.: Elektrifizierung des Dorfes; Kosten pro
Haus 50 Pengö
1940: Das Dorf hatte mehr als 2500 Einwohner. 2335
lebten ständig hier, mehr als 300 waren in anderen
Orten, v. a. in Budapest Knechte und und Mägde.
Kauf des Grundstücks für das Haus der Gesundheit
(Grünes Kreuz) in der Untergasse; Vorbesitzer war
der Apotheker Elek Major. Der Kaufpreis betrug 800
Gulden.
> Am 20. Oktober wurde die örtliche Organisation des
Volksbundes der Deutschen in Ungarn (VDU)
1
gegründet .
1941: Im Tanzsaal des Schmidt'schen Wirtshauses (in
der Dorfmitte) wurde ein Kino eingerichtet.
> In der r. k. Volksschule wurde Deutsch als Unterrichtssprache eingeführt (bis 1944; Schultyp A; Reg.Verordnung 25370/1941)
1942: Am 7. Febr. feierliche Verabschiedung der 7
ersten SS-Freiwilligen aus Tarian; danach gab es
noch 5 bzw. 3 SS-Freiwillige.
1944: Am 19. März marschierten deutsche Truppen
nach Ungarn ein und am 22. März kamen deutsche
Soldaten auch nach Tarian, wo sie sich einige Tage
aufhielten.
> Im Frühjahr begann die Zwangsmusterung für die
SS; Am 28 Juni wurden 312 (?) deutsche Männer der
SS überstellt. Am 24. bzw. 28. August erfolgte die
Einberufung von 16, bzw. 93 zur SS. Anfang Nov.
folgten ihnen weitere 402.
14
> Im Mai wurde der jüdische Bursche János Krausz
zum Arbeitsdienst eingezogen. Seine betagte Mutter –
ganannt die Krausz-Jidin – wurde in Ausschwitz
vergast.
1) Der Volksbund (1938–1945) war eine Organisation der Ungarndeutschen,
die von jungen Intellektuellen mit dem Ziel gegründet wurde, die deutsche
Muttersprache und Volkskultur der Deutschen in Ungarn zu retten. Ihm ist –
unter anderen – die Einführung der deutschen Unterrichtssprache zu
verdanken (s. 1941). Trotz der positiven Ergebnisse kam der Volksbund
immer mehr unter den Einfluß der deutschen Nationalsozialisten. Das
erforderte viele Menschen- und materielle Opfer von den Ungarndeutschen,
so auch von den Tarianern. Nach den 1998 zugänglich gewordenen
,Aussied-lungslisten von 1948‘ hatte der Volksbund in Tarian insgesamt 342
Mitglieder. Von denen sind 166 in der Liste I und 176 in der Liste III
verzeichnet. Wenn wir davon ausgehen, dass man 1946 2037 ,Schwaben‘
aus Tarian vertreiben wollte, dann sind diese 342 davon nur 16,8%. Auch
diese Zahlen sind noch zu hoch, da die ,Volksorgane‘ – nachträglich – auch
solche in die Volksbundliste aufgenommen wurden, die ein zu
konfiszierendes Vermögen hatten. Wie auch das in diesem Band
veröffentlichte Bild zeigt, hatte der Volksbund hauptsächlich junge
Mitglieder… Sie suchten v. a. Unterhaltungsmöglichkeiten bei den
sonntäglichen Zusammenkünften des Vereinss. Die meisten hatten – mit
einem Schulabschluß von 6 Elementar-Klassen – keinen blassen Schimmer
davon, welch verbrecherische Ideologie hinter der Hitler-Diktatur steckt.
2) Diese Daten sind als übertrieben anzusehen, da nach den 1948
zusammengestellten Namenslisten – die dem Autor 1998 zugänglich
wurden – gingen aus Tarian nur 18 freiwillige und 38 zwangsrekrutierte
SS-Soldaten hervor! Bei den Freiwilligen wurden nur die verzeichnet, die
damals noch lebten. Der Autor addierte die Gefallenen dazu, so kam er auf die 18.
Am 2. November trieb man aus Richtung Budapest eine
Marschkolonne mit jüdischen Deportierten durch
Tarian. Übernacht hat man sie in Scheuern untergebracht. Als in einer Scheune Feuer ausbrach, trieben
SS-Leute die Fliehenden zurück. Hierbei wurde ein
40jähriger Mann totgeschlagen und viele verletzt. (>
Mikonya, S. 71/72) Am 9. November hat man die im
Dorf ausgebildeten SS-Rekruten vereidigt.
> Am 16. Dezember hat der Volksbund 38 deutsche
Familien evakuiert (> Namensliste).
15
> Am Heiligabend besetzten die Sowjets das Dorf zum
erstenmal.
1945: Am 2. Januar warfen die Deutschen zwei Bomben
auf die Straßen bei der r. k. Kirche: Schäden an der
Kirche und am Pfarrhaus.
> Am 3. Januar eroberten deutsche Truppen Tarian
von den Russen zurück.
> Am 17. Febr. wurden 23 Tarianer Levente-Angehörige im Alter von 14-16 Jahren nach Komorn
gebracht, Anfang März von dort nach Deutschland.
17.-22. März russische Phosphor-Bombenangriffe auf
die Obergasse
> Am 22. März erfolgte die zweite Besetzung Tarians
durch die Rote Armee.
> Das im Zweiten Weltkrieg beschädigte große Kreuz
auf dem Neuen Friedhof ließ Familie Josef Schlegl
renovieren.
1946: 16. März: Beginn der Enteignung der Deutschen
(120 Familien mit 859 Personen waren davon
betroffen).
> Die Aussiedlung nach Deutschland war für Ende
März geplant, wurde aber nicht durchgeführt.
> Ansiedlung der »Telepeschen« aus verschiedenen
Orten (26 Familien) und aus Egerlövõ (Komitat Heves,
50 ref. Familien; > Namensliste)
1947: 28. August: Vertreibung der Kirner "Schwaben",
die Tarianer Ungarn wollten auch die hiesigen Deutschen aussiedeln lassen.
1948: Im April gab es eine erneute »Aussiedlungsdiskussion« in Tarian. Im Rathaus wurde die Namensliste von 2037 Deutschen ausge-hängt, die nach
Deutschland vertrieben werden sollten.
> Im Herbst wurden die Konfessionsschulen verstaatlicht.
16
> Im September erneute Zwangszusammensiedlung
der Deutschen im Dorf, um für die aus der Slowakei
übersiedelnden Ungarn Platz zu machen.
Ansiedlung der »Felvidéker« aus Szõgyén (h.
Svodin): 43 r. k. Familien. ( > Namensliste)
1949: Im Sommer wurden weitere 120 Tarianer
deutsche Familien enteignet.
> Die Kreditgenossenschaft haben sie von Tarian
nach Tatabánya verlegt.
> Im Sommer wurde die erste ständige Buslinie
zwischen Héreg-Tarján-Tatabánya eröffnet.
> Am 28. August wurde die LPG (Landwirtschaftliche
Produktions-Genossenschaft) gegründet. Ihre Zentrale
befand sich in der Dorfmitte, im ehem. Haus von
Johann Pertl.
> Im gleichen Jahr wurde das Tarianer Staatsgut
gegründet, welches das ehemalige Hobenlohe'sche
Gut von Turni und einen Teil des Tarianer sowie
Tolnauer Hotters einverleibte.
> Um die LPG und das Staatsgut mit Maschinen zu
versorgen, wurde am Dorfrand – im Kischtarian – eine
MTS (Maschinen- und Traktoren-Station) eingerichtet
(3 Hallen).
Die örtliche Blaskapelle wurde neu gegründet.
1950: Die Gemeindeverwaltung wurde ausgetauscht:
Den Posten des Obernotars und Richters hat man
abgeschafft. Der Ratsvorsitzende und -sekretär nahmen ihren Platz ein.
> Die Friseure hat man als erste in die HandwerkerGenossenschaft gezwungen. Ihr Geschäft wurde in
einem Nebenraum des Schmidt'schen Wirtshauses
eingerichtet (heute Hauptstraße 19).
Bau des Entbindungsheims in der Totiser Gasse
(1965 in ein Heim für behinderte Kinder umgewandelt;
17
> 1996). 1951: Die Tarianer »Bauerngenossen-schaft«
fusionierte mit denen der Nachbardörfer (Geretsch
Áfész).
> Im Sommer Baubeginn der neuen staatlichen
Volksschule, anstelle der alten r. k. Schule.
1952: Sept.: Eröffnung des Neubaus der zweistöckigen
Volksschule
> Im Hanfland wurden 80 Bauplätze mit einer Größe
2
von 1512 m vermessen.
> Im November wurde der Ortsteil "Nichtsbrot"
elektrifiziert.
1953: Herbst: Einweihung des neuen staatlichen
Kindergartens, anstelle früheren Schulmeisterhauses
(neben dem Pfarrhaus)
> Gründung einer sog. Handwerker-Genossenschaft
der Schuster. Die Werkstatt war in der heutigen
Hauptstraße Nr. 33.
1954: Im Hanfland wurden die zwei ersten Häuser
fertiggestellt (Hilpert und Utto).
1956: Am 9. November lieferten sich aus Budapest
kommende Aufständische mit sowjetischen Panzern
hinter Kirche ein Gefecht. Fünf junge ungarische Freiheitskämpfer starben dabei (> Namensliste).
> Im Herbst sind 30 deutsche Bewohner aus Tarian in
den Westen geflüchtet (> Namensliste).
1957: Zwischen der Untergasse und dem Entbindungsheim entstand ein neues Wohnviertel (Viola- / Veilchen-/ und Petöfi-Gasse.).
1958: In der Volksschule wurde der fakultative Deutschunterricht eingeführt. ("Muttersprachenunter-richt")
1959: Die Turnipußta wurde verwaltungsmäßig Tarian
zugeordnet.
18
> Seit Beginn der Kollektivierung wurden bis jetzt 90%
der ehemals freien Bauern zum Eintritt in die LPG
gezwungen.
1960: In den 60er Jahren wurde die Obergasse
verlängert; ebenso die rechte Seite der Hintergasse.
1962: Ende Oktober wurde in der Dorfmitte das neue
Kulturhaus (300 Sitzplätze) seiner Bestimmung übergeben.
1964: Aufgrund der Amnestie der Regierung konnten die
1956 in den Westen geflüchteten Tarianer zum erstenmal die Heimat besuchen.
1972: Zusammenschluss der LPGs von Tarian und Héreg
1973: Bau einer Trinkwasserleitung;
> Errichtung einer Filiale der Totiser Teppichfabrik im
Spanngaßl
1976/77: Bau der Großbäckerei ("Brotfabrik"): Am 20.
August 1977 wurde sie feierlich in Betrieb genommen.
Betriebsleiter war Josef Stegmaier (> 1991).
1977: Zusammenlegung der Gemeindeverwaltungen von
Tarian und Héreg Der "Gemeinsame Rat" mit Sitz in
Tarian existierte bis zum 31. Dez. 1990.
1980: Anfang der 80er Jahre: Renovierung der ref.
Kirche
1981: Im ehemaligen Haus der Familie Eipl Am Berg
wurde ein Dorfmuseum eingerichtet, welches 1982
eingweiht wurde.
1982: Die LPG von Tarian und Héreg wurde von der
Gyermelyer übernommen.
1985/86: große Renovierung der r. k. Kirche (neuer
Dachstuhl, Eternitplatten, Außenanstrich)
1986: Am 1. Januar wurde der Gemeindebauhof errichtet. Er hält die gemeindeeigenen Einrichtungen in
Stand.
19
> Bau eines ABC-Kaufhauses hinter r. k. Kirche
1989: Am 29. Oktober wurden die neuen Kirchenbänke
der r. k. Kirche eingeweiht, die in der örtlichen
Werkstatt von Andreas Bachmann angefertigt wurden.
1990: Ende September wurden die ersten freien Wahlen
nach dem Sturz des Kommunismus durchgeführt:
Zum ersten Bürgermeister der Gemeinde wurde
Stefan Fülöp jun. gewählt.
> Im Dezember wurde mit Hilfe des deutschen Staates
das Kabelfernsehen eingeführt und 1991 begann das
Dorffernsehen zu senden, 750 Wohnungen waren
angeschlossen.
> Turni wurde 1991 ebenfalls ans Kabelnetz angeschlossen.
> Am 18. Dezember wurden 300 Wohnungen ans
Telefonnetz angeschlossen.
1990/91: Eine Reihe von kleinen Einzelhandelsgeschäften
(Landbedarf,
Futtermittel,
Baustoffe,
Gemischtwaren) sind entstanden.
1991: Am 27. Januar nahm Tarian das St. Georgs
Wappen als Gemeindewappen an.
> 26. Apr.: Partnerschaftsvertrag mit der hessischen
Gemeinde Staufenberg und am 28. Apr. Einweihung
des Staufenberg-Parks hinter der r. k. Kirche.
> Im Juli wurde das erste Restaurant-Pension des
Dorfes "Sziget" (Insel) eingeweiht.
> Im Herbst stellte die Tarianer Brotfabrik ihre Arbeit
ein.
> Am 27. Juli verstarb Maria Martin, geb.Treszl, im
Alter von 102 Jahren. Kein anderer Einwohner Tarians
erreichte je so ein hohes Alter.
> Vorn 1. Juli bis 20. August wurde eine
Verbindungsstraße zwischen dem Wohngebiet im
Hanfland und der Hauptstraße (Rosenstraße und
20
Rákóczi-Str.; das Weiler-Haus in der Hauptstr. wurde
dafür abgerissen.).
> Im Schulgarten wurde eine Freilichtbühne, ein
Tennisplatz und eine kleine Gaststätte errichtet.
> Der Schweizer Unternehmer Urs Felder mietete das
ehem. Gebäude der Maschinen- und Traktoren-Station, wo er 9 Arbeiter mit Fahrrad-Montage beschäftigte. 1997 wurde der Betrieb eingestellt.
1992: Gründung des »Serpen-Team« Auto Motor Sportvereins.
> Im Februar begann der Bau der Abwasserkanalisation, Kosten pro Haus 50.000 Ft, zahlbar in
neun Jahren.(> 1994)
> Im Mai wurde der "Pußteßöli" an den österr.
Unternehmer Klaus Wippel verkauft, der einen
Metallbau-Betrieb errichten ließ, der im Herbst 1993 in
Betrieb ging.
> Der Tarianer Gewichtheber, Andreas Stark, nahm in
Barcelona (Spanien) an den XXV. Olympischen
Sommerspielen (25. Juli –
• Die Tarianer und Héreger LPG sind aus der
Gyermelyer ausgeschieden. Beginn der Entschädigung und der Privatisierung von Grund und Boden.
1993: Im Sommer wurde in der Wiese des Schulgartens
– in der Nähe der Freilichtbühne – aus Kalksteinen ein
Springbrunnen gebaut.
> Unterhalb des Kalvarienbergs wurde die erste
Autowaschstraße errichtet.
> Von den Sportlern des Serpen-Teams haben in
Ralley-Cross – 3. Division – Raymund Fülöp den 4.,
Anton Kranz (gleichzeitig hervorragender Handballer)
den 10. und Robert Speyer den 18. Platz belegt. In
der Landes-Mannschafts-Punktwertung erreichten sie
den 5. Platz.
21
1994: Im Sommer wurde der an Stelle des Schießplatzes der Arbeiter-Miliz mit dem Bau eines
ungarndeutschen Begegnungs- und Kulturzentrums
begonnen. (> 1995)
> Am Ende des Jahres wurde die Abwasserkläranlage südlich der Hanflandgasse fertiggestellt.
> Am 11. Dezember wurde zum zweiten Mal ein neuer
Gemeinderat und Bürgermeister (Stefan Fülöp) und
zum erstenmal eine deutsche MinderheitenSelbstverwaltung (Frau Klinger Theresia Werli, Stefan
Brunner, Georg Schneider) gewählt.
> Am 22. August wurde Tarian ans Erdgasnetz
angeschlossen. Bis Juli 1995 wurden 770 Privatwohnungen und 11 Betriebe an das Gasnetz angeschlossen.
1995: Im Frühjahr wurde die Jagdgesellschaft »ThomasStein« der Tarianer Landbesitzer gegrün-det. Sie
zählte 30 Mitglieder.
> Am 12. Juli nahm unter Leitung von Tibor Ruppert
der Tarianer Bürgerwehr Verein seine Arbeit auf. Die
25 Mitglieder zählende Gruppe plant in Zukunft
wöchentlich mehrere Kontrollgänge durchs Dorf, um
so die Autodiebstähle und Einbrüche einzudämmen.
> Am 12. Sept. kam es – im Beisein von hohen
Vertretern aus Bonn – zur feierlichen Einweihung des
Ungarndeutschen Jugendlagers.
1996: Im Januar hat der ortsansässige Fleischhackermeister Emmerich Palatin in der ehemaligen
Brotfabrik einen Lebensmittelmarkt eröffnet. Vorher
benutzte er das Gebäude schon als Lager.
> Der Tarianer Gewichtheber, Tibor Stark – der Neffe
von Andreas Stark, > 1992 – nahm im Juli an den
XXVI.Olympischen Sommerspielen in Atlanta (USA)
teil.
22
> Bürgermeister Stefan Fülöp wurde von Staatspräsident Árpád Göncz mit dem Goldenen Verdienstkreuz
der Republik Ungarn ausgezeichnet.
Veränderungen in der Siedlungsstruktur
Unsere Gemeinde mit seinen mehr als 2000 deutschen
Bewohnern zählt zu den Nationalitäten-Dörfern, aus
denen keine Vertreibung stattfand. Da die meisten von
ihnen in der Landwirtschaft tätig waren, wurde hier bis
Anfang der 50er Jahre eine ziemlich reine Form der uaMundart gesprochen. Umso erstaunlicher ist es für den
Besucher, wenn er feststellt, dass heute dort eine
Mischsprache gesprochen wird, wie man sie sich nicht
schlimmer vorstellen kann. Nach mehr als 40 Jahren
geht die Umgangssprache ins Ungarische über, so dass
man in sprachlicher Hinsicht folgende Phasen unterscheiden kann: Reine ua-Mundart > Mischsprache
(Mundart+Ungarisch) > nur Ungarisch (bei der jüngeren
Generation).
Die Gründe dafür sind mannigfacher Art. Einer der
wichtigsten Gründe ist u. a. die Zerstörung der
geschlossenen Siedlungsweise der »Schwaben«. Darauf
soll hier ausführlich eingegangen werden. Um die
Assimilierung der Deutschen zu beschleunigen, wurden
in den ersten Nachkriegsjahren auch in solchen
Gemeinden ungarische Familien angesiedelt, aus denen
keine Vertreibung stattfand.
Tarian zählte 1945 444 Häuser (bzw. Wohneinheiten).
Davon gehörten 387 (87,2%) deutschen Familien, dazu
kamen noch 7 Familien (1,6%), bei denen ein Partner
Ungar, der andere Deutscher war. Sie wohnten
zwischen den Deutschen ( > Namensliste der Haus23
besitzer 1944); da meistens die Frau eine Deutsche war,
sprachen auch ihre Kinder deutsch. Sie waren ähnlich
wie die »Schwaben« katholisch.
Reformierten Glaubens waren dagegen die eingesessenen Ungarn. Sie besaßen 40 Häuser (9%). Die
Zahl der öffentlichen Gebäude betrug 10 (2,6%). Am 16.
Dezember 1944 sind vor der herannahenden Front 38
deutsche Familien (145 Personen) vom Volksbund aus
Tarian evakuiert worden. Nur 15 Familien sind bis
Deutschland gelangt und dort geblieben. Die anderen
kamen bald wieder zurück. ( > Namensliste der
Evakuierten)
Nach Kriegsende
hat man die leerstehenden Häuser 7
einheimische ungarische Familien und
eine
kinderreiche
deutsch-ungarische
Familie eingewiesen.
( > Wer bekam wessen Haus?) Die übrigen leeren Häuser
sowie weitere, die
durch Enteignung von
Deutschen beschlagnahmt wurden, sind
1946 von 25 Familien
aus
verschiedenen
Gegenden des Landes (vor allem aus
Tatabánya) und 50 Familien aus Egerlövõ (Komitat
Heves) in Besitz genommen worden. (> Namensliste der
„Telepeschen“)
24
Im Frühjahr 1948 wollte man aus Tarian 2037
Deutsche nach Deutschland zwangsweise aussiedeln.
Es blieb aber nur beim Plan. Im Herbst des gleichen
Jahres wurden weitere 42 deutsche Häuser für
ungarische Umsiedler aus Szögyén/Slowakei geräumt.
(> Namensliste der Felvidéker) Weitere 9 deutsche
Häuser wurden ganz oder teilweise enteignet, um sie
einem öffentlichen Zweck (Post, Apotheke, Polizei usw.)
zuzuführen.
Ein Vergleich der Ortspläne von 1945 und 1949 zeigt,
dass Deutsche im Süden des Dorfes vor der Enteignung
weitgehend verschont geblieben sind. Der Grund liegt
darin, dass hier (vor allem „Am Nichtsbrot“) arme
"Schwaben" lebten. Sie wohnten gemischt mit ebenso
armen Ungarn. Im
Gegensatz zu den
wohlhabenderen
Ungarn
und
Deutschen,
die
getrennt wohnten. Der
Ortsplan von 1949
zeigt uns, wie die einst
geschlossene
Siedlungsweise
der
Deutschen
aufgehoben
wurde.
Dasselbe
geschah
auch
in
allen
deutschen
Nationalitäten-Gemeinden,
aus
denen
keine
Aussiedlung stattfand.
Anfangs gab es im
Zusammenleben der
25
Menschen verschiedener Herkunft, Sprache und Religion Schwierigkeiten. Die Spannungen haben im Laufe
der Jahre immer mehr nachge-lassen. Das engere
Zusammenleben von Deutschen und Un-garn führte zu
einem raschen Assimilier-ungsprozess. Glaubte man
lange Zeit, das Problem der nationa-len Minderheiten
ließe sich nur durch Aussiedlung lösen, so ist man heute
der Meinung, es löse sich durch Assimilierung von
selbst. Als nüchterner Beobachter rnuß man feststellen,
dass dies leider der Tatsache entspricht. So erfreulich
die Konzessionen auch sind, die den Ungarndeutschen
in letzter Zeit gemacht wurden, so ,traurig‘ ist das
Ergebnis. Man bekommt den Eindruck, dass die
Hilfsmaßnahmen zur Rettung der Ungarn-deutschen 50
Jahre zu spät eingeleitet wurden.
Vergleicht man die Zahl der deutschen Hausbesitzer
vor 1945 und 1949, sieht man, dass rund 31 % enteignet
wurden, während 17,5 % der einheimischen Ungarn ein
Haus erhalten haben. Bei der Beschlagnahme von
Ackerland waren natürlich noch mehr Deutsche betroffen
als bei den Häusern. Mangels Unterlagen kann man nur
mutmaßen über die Höhe der Landenteignung: Sie hat
bis 1949 an die 60–70 % betragen.
Wegen der Unsicherheit (übertriebene Propaganda
im Zusammenhang mit der westlichen Aufrüstung) und
des unguten Gefühls, anderen etwas weggenommen zu
haben, sind im Laufe der Jahre viele der angesiedelten
Ungarn aus Tarian wieder weggezogen. Manche gingen
aus Heimweh in ihre Geburtsorte zurück. Viele zogen in
die Nähe der Hauptstadt, nach Totis oder Tatabánya.
Von den 50 Egerlövöer Familien haben 27 (54 %) ihr
Haus verkauft und sind weggezogen. Ebenso handelten
23 (54,8 %) von 42 Szõgyéner Familien. Von den 25
26
ungarischen Siedlerfarnillen aus verschiedenen Gegenden haben 13 (52 %) ebenfalls Tarian verlassen.
Eine Mobilität ist indes aber nicht nur bei den
angesiedelten Familien festzustellen. Von den insgesamt
117 verkauften Häusern entfallen 44 auf Deutsche
(16,24 % aller deutschen Hausbesitzer von 1949) und 9
auf eingesesseneUngarn (19,15 % aller einheimischen
ungarischen Hausbesitzer von 1949).
Von den 119 enteigneten deutschen Hausbesitzern
haben bis Ende 1975 29 (24,37 %) ihr altes Haus
zurückgekauft. Weitere 67 deutsche Familien kauften
seit 1949 ebenfalls ein Haus. Insgesamt haben in Tarian
129 Häuser durch Kauf den Besitzer gewechselt
(manche sogar 2- bis 3rnal). Unter den Käufern sind die
"Schwaben" mit 74,42 % vertreten. Der Anteil
auswärtiger Zuwanderer liegt bei 17,83 % (23 Häuser).
Seit
den
60er
Jahren ist in Ungarn
auch
eine
starke
Zunahme von Neubauten zu verzeichnen. Bis
Anfang 1976 wurden in
Tarian insgesamt 277
neue Eigenheime gebaut. 217 (78,34 %) gehören davon Deutschen. Als nächststärkste Gruppe sind
zugewanderte „Ungarn“
(darunter befinden sich
auch Deutsche und
Slowaken) mit 38 Neubauten
(13,72
%)
vertreten. Dann folgen
27
mit 15 neuen Häusern (5,42 %) die eingesessenen
Ungarn. Ferner haben 5 Umsiedler aus Szögyén (1,8 %)
und 2 aus Egerlövö (0,72 %) ein neues Haus errichtet.
( > Verzeichnis der Neubauten)
Auffallend ist der relativ starke Zuzug von auswärtigem „Ungarn“. 23 haben sich ein altes Haus gekauft
und 38 ein neues gebaut! Als Hauptgrund hierfür muß
wohl die verkehrsgünstige Lage Tarians angesehen
werden. Die Industriestadt Tatabánya ist nur 7 km
enffernt. Die Busverbindungen dorthin, aber auch nach
Budapest, Tata/Totis und Esztergom/Gran sind gut.
Nicht zuletzt lockten wohl auch die schönen Bauplätze
und die gute Luft die Fremden an. Bemerkenswert ist,
dass viele der zugezogenen Ungarn (ähnlich wie die
Szögyéner aus der Slowakei) deutsche Familiennamen
haben. Bei vielen scheint es sich um magyarisierte
Schwaben zu handeln.
1976 gab es in Tarian 737 Häuser.Nimmt man die
444 von 1949 als 100 %, dann macht das 166 %, also
eine Zuwachsrate von 66 %. Während der Anteil der
"Schwaben" am Wohneigentum 1945 87 %, 1949 60 %
betrug, lag er 1976 bei 73 %. Wir sehen also eine
aufsteigende Tendenz. Der damalige Besitzstand war
folgender: Von den 737 Häusern gehörten 539
Deutschen (73,14 %), 58 einheimischen Ungarn (7,86
%), 16 Siedlern aus Egerlövö (2,17 %), 26 Umsiedlern
aus Szögyén (3,53 %), 7 1946 zugewanderten Ungarn
(0,95 %), 63 später zugezogenen Ungarn (8,55 %),
ferner gab es noch 28 öffentliche Gebäude (3,8 %).
Allgemein kann festgestellt werden, dass sich die
Wohnverhältnisse seit Kriegsende wesentlich verbessert
haben. Neben den Neubauten gibt es viele umgebaute
und modernisierte Häuser. Seit dem Bau der
Wasserleitung (1973) gibt es in vielen Häusern
28
Spültoiletten und Bäder*. Die Zahl der Wohnräume pro
Familie und ihre Einrichtung hat zugenommen bzw.
wurde verbessert. Trotz der für die Tarianer "Schwaben"
in wirtschaftlicher Hinsicht so positiven Zahlen muß man
feststehen, dass sie in sprachlicher Beziehung noch nie
in einer so großen Gefahr waren wie in der zweiten
Hälfte des 20. Jh.s. Der Dammbruch, der mit der
Zerstörung der geschlossenen Siedlungsweise herbeigeführt wurde, konnte bis heute noch nicht repariert
werden.
Die Einführung rein ungarischer Straßennamen,
Arbeit in einer Umgebung, wo nur ungarisch gesprochen
wird, eine Flut von Mischehen und vieles andere mehr
haben die Assimilation so sehr beschleunigt, dass sie
nicht mehr aufgehalten werden kann. Es sei denn durch
die Einführung von muttersprachlichen Unterricht auf
allen Ebenen.
* Ein enormer Fortschritt gemessen an den katastrophalen
hygienischen Verhältnissen im Dorf bis in die 60er Jahre:
Waschküche, Badezimmer, fließendes Wasser, Spültoiletten waren
den meisten nur dem Namen nach bekannt. Die kleine und große
Notdurft wurde nicht selten hinter den Mäststeigen verrichtet. Es war
schon als Fortschritt anzusehen, wenn im Hinterhof ein sog. „Reterat“
(Plumpsklo) vorhanden war …
Der innerörtlicher Bereich von Tarian
Tarian ist heute – wie die meisten Dörfer der Umgebung
– ein Mehrstraßendorf. Es liegt – zusammen mit dem
benachbarten Héreg – im zentralen Becken des
Geretsch-Gebirges. Die Mitte des Dorfes – rund um die
r. k. Kirche – liegt auf einer Höhe von 192-193 m NN.
Hier befindet sich eine Art Dorfanger, auf dem die Kirche
29
steht. In südöstlicher Richtung von ihr verläuft die
Hauptstraße.
Die Dorfentwicklung muß von hier ausgegangen sein.
Der Untergrund besteht aus mehreren Metern mächtigem Löss . In ihm konnten standfeste – mit
Natursteinen ausgemauerte Gewölbekeller unter den
Häusern errichtet werden. Eine Besonderheit stellen die
sog. unterirdischen Getreidespeicher in den einstigen
Vorgärten ("Gartl") auf beiden Seiten der Hauptstraße
dar.
1
Nach Josef Mikonya handelte es sich dabei um
kegelstumpfartigesenkrechte Schächte. Am oberen
Ende hatte der Schacht einen Durchmesser von 50-60
cm, am unteren 120 bis 150 cm. Die Tiefe betrug 350–
400 cm. Der Rauminhalt lag somit zwischen 5 und 7,4
3
m . Hier konnte der Getreidevorrat einer Familie sicher
vor Feinden und Feuer aufbewahrt werden. Vor der
Einlagerung wurde der Hohlraum mit Strohfeuer
getrocknet und von eventuellen Schädlingen befreit. Als
Deckel benutzte man rote Marmorplatten, die man zur
Tarnung von oben noch mit Erde zudecken konnte.
Wollte man der Grube Getreide entnehmen, stieg ein
2
Mensch ein und füllte die Säcke . Ähnliche Getreide30
speicher legte man 1929 beim Ausbau der Hauptstraße
3
von Tolnau frei.
Der bei der Ausschachtung der Grundmauern
angefallene Löss – im Volksmund „Lahm“ genannt –
wurde mit Spreu vermischt als Mörtel benutzt. Die sog.
Kotziegel zum Hausbau fertigte man ebenfalls aus Löss
und Spreu an. Die Dächer wurden mit dem Rohr der in
der Nähe befindlichen Sumpfgebiete gedeckt. Die sog.
Langhäuser stehen senkrecht zur Straße. Die Hoffenster
und Türen blicken nach S – in Richtung Sonne. Die
Rückseite – Grundstücksgrenze zum Nachbarn – war
von der Sonne abgewandt.
Am unteren Ende der Hauptstraße wohnten die
eingesessenen Ungarn, am oberen die deutschen
Einwanderer.
Mit der allmählichen Zunahme der Bevölkerung in der
2. Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde die breite
Hauptstraße in Richtung NW verlängert. So entstand die
Obergasse (Ouwakosn, Felsõ utca, h. Jókai Gasse). Sie
wurde nicht mehr ganz so breit angelegt wie die
Hauptstraße, aber immer noch etwa 20 m breit. Ebenso
breit ist – hinter der Kirche von SW kommend senkrecht
auf die Hauptstraße stoßende – Untergasse (Undakosn,
Vadász utca).
Sie liegt ca. 9 m tiefer als die beiden anderen
Gassen. Ist also im Untergrund schon feuchter. Zwei
Wassergräben fließen unter sie hindurch. Der eine in der
Mitte, der andere am Ende. Hier befand sich einst ein
Forsthaus – Restgebäude davon befinden sich hinter der
Pension "Sziget". Der ungarische Name der Gasse
(Vadász utca: Vadász = Jäger, Förster) ist darauf
zurückzuführen.
Bis Ende der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts gab es
hier rechts der Straße einen großen Ziehbrunnen –
31
direkt gegenüber dem Haus der Gesundheit. Vor diesem
bohrte man in den 40er Jahren einen artesischen
Brunnen – vom Volk als »Wedöprunna« genannt, nach
dem ungarischen Namen "Védõház" für das Haus der
Gesundheit. Das sog. "Wedöwossa" erfreute sich bei der
Dorfbevölkerung großer Beliebtheit, da es – im
Gegensatz zu dem kalkhaltigen harten Wasser der
übrigen Brunnen – weich war, und somit gut geeignet
zum Kochen und Waschen. An Samstagnachmittagen
entstand vor dem artesischen Brunnen großes
Gedränge, die Leute fuhren mit ihren Pferde- und
Rindergespannen vor, um in großen »Standern« das
begehrte Wasser heimzufahren. Anfang der 70er Jahre
unseres Jahrhunderts stellte sich heraus, dass das
"Wedöwasser" bakterienverseucht ist, deshalb wurde
der Brunnen von den Behörden geschlossen.
Im oberen Teil der Untergasse – in der Höhe des
Rochus-Denkmals – mündet die Hintergasse (Hindakosn, Hátsó utca, heute Ady-E.-Gasse) ein. Sie verläuft
parallel zur Obergasse, ist aber viel schmaler als diese.
Die Baugrundstücke sind viel kleiner. Die Gärten der
linken Häuserreihe grenzen an einen Wassergraben, der
seinen Ursprung – z. T. – im Teichtl (ung. Szúnyog tó)
hat. In Richtung Totis baute man eine Abzweigung der
Hintergasse. 1945 gab es hinter der Kapelle nur noch 4
Häuser. Im Kischtarian (h. Kiskert- oder KleingartenGasse) standen damals links und rechts jeweils 2
Häuser. Zunehmend wurden im 19. Jh. Bauplätze
erschlossen, die entweder wegen hohen Grundwasserstandes oder Hügel in der Anfangsphase der
deutschen Besiedlung gemieden wurden.
So wurde am unteren Ende der Hauptstraße die
Senke – heute Móricz-Zsigmond-Platz – und die Löss
hügel rund um den Friedhof (Am Berg) erst spät bebaut.
32
Da sich hier ärmere Leute ansiedelten, sind heute noch
die Grundstücke sehr klein. Die ebenerdigen Häuser
stehen dicht gedrängt. Manche Familien wohnten bis
1945 gar in Höhlen, der 4–5 m hohen senkrechten
Lösswände. Von Süden betrachtet, kann man
nordwestlich des Friedhofs vier unterschiedlich hoch
liegende besiedelte "Terrassen" erkennen.
In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts
wurde das Dorf im Westen erweitert. Die Untergasse
wurde in Richtung Tatabánya fortgeführt. So entstand
die »Neue Welt« (ung. Új világ und Új telep). In den 20er
Jahren wurden in der heutigen Linde- und PfadfinderGasse mit FOKSz-Kredit etwa 50 Häuser gebaut.
Auch hier wohnten entweder Arbeiter-Bauern oder
Häusler, so dass die Baugrundstücke kleiner sind als in
der Dorfmitte. In den tiefergelegenen Straßen (Cserkész
oder Pfadfinder-Gasse u. a.) steht das Grundwasser so
hoch, dass man unter den Häusern keine Keller
errichten konnte.
Solang es nicht in jedem Hof einen Radbrunnen gab,
waren die öffentlichen Brunnen auf Plätzen und Straßen
von großer Bedeutung. In der Hauptstraße – vor dem
Haus von Johann Pertl (heute Haus-Nr. 20a) – existierte
bis in die 50er Jahre ein Radbrunnen. Ferner gab es in
der Obergasse bis in die 30–40er Jahre des 20.
Jahrhunderts in bestimmten Abständen mitten auf der
Straße 4 Brunnen. Sie wurden vor dem Zweiten
Weltkrieg zugeschüttet. Die nachsackende Erde zerstört
heute noch die Asphaltdecke an den betreffenden
Stellen. In weniger breiten Straßen, wie z. B. in der
Hintergasse, grub man Brunnen zwischen Straße und
Gehweg.
An der Straße nach Héreg – im Spann-Gassl –
existierte unweit der Brücke bis in die 60er Jahre
33
unseres Jahrhunderts ein Ziehbrunnen. Hier konnten die
Bauern bei der Heimkehr vom Hotter ihre durstigen
Haustiere tränken.
Die Obergassler holten an heißen Sommertagen
Gießwasser aus dem Spann-Gassl-Brunnen. Auf dem
heutigen Móricz-Zsigmond-Platz gab es auch einen
öffentlichen Ziehbrunnen, ebenso in der Senke unterhalb
des ref. Friedhofs und der Kellerreihe an der Straße
nach Witschke. Diesen nannte man Zigeuner-Brunnen,
weil sich hier die "Wosnzigeina" – ähnlich wie im SpannGassl – bei ihren Wanderungen durchs Land einige Zeit
aufhalten durften. Für die Bewohner des Nichtsbrot gab
es auf der Ost-Seite des kath. Friedhofs einen
Radbrunnen. Die Tiefe des jeweiligen Brunnens hing von
seiner Höhenlage ab: In 183 m Höhe war er nur 2–3 m,
in 193 m Höhe 10 und mehr m tief.
Mit der Einschränkung der privaten Viehhaltung und
dem Bau einer Wasserleitung (1973) verloren die
innerörtlichen Gemeinschaftsbrunnen ihre Bedeutung
ganz. Sie wurden nach und nach zugeschüttet. Nach
Ausbau eines Freizeitzentrums im Wiesengrund des
Schulgartens, nahe der Gaststätte „Fehér Holló“ (Weißer
Rabe), ließ die Gemeinde 1993 einen NatursteinSpringbrunnen errichten.
34
Der Friedhof der Katholiken befand sich anfangs – als
die Deutschen angesiedelt wurden – vermutlich an der
Stelle der heutigen Schule, d. h. in unmittelbarer Nähe
der Kirche. Dafür sprechen zwei Gründe: Erstens fand
man 1951 beim Neubau der Schule beim Ausschachten
des Kellers zahlreiche Knochenreste und sogar einen
Goldring; zweitens ist es auch in Deutschland Sitte, die
Friedhöfe nahe bei der Kirche anzulegen (Kirchhof).
Nach Josef Mikonya soll sich der nächste katholische
Friedhof unterhalb des Kalvarienberges befunden
haben. Diese Auffassung bestätigt das 1997 zum
Vorschein gekommene Dokument von Pfarrer Drághfy
aus dem Jahre 1858.
Als dieser auch ganz belegt war, legte man am SO-Ende
des Dorfes (Am Berg) den heutigen Alten Friedhof an.
Gegen diese Auffassung sprechen zwei Grabsteine
(siehe bei den Bildern!) – der eine aus 1789, der andere
aus 1834. Danach hat man den Alten Friedhof schon vor
und nach der Gründung des Friedhofs unter dem
Kalvarienberg (1858) benutzt. Dahinter befindet sich seit
je her der reformierte Friedhof. Der Alte Friedhof war bis
zum Eingangstor im Jahre 1906 ebenfalls voll belegt.
Der Neue Friedhof – oberhalb des alten – wurde ab
1907 als Begräbnisstätte der Deutschen eingeweiht, und
vom hinteren Ende beginnend – auf der rechten Seite
mit Erwachsenen, auf der linken mit Kindern – belegt. In
den 60er Jahren ,erreichte‘ die Erwachsenen-Seite das
vordere Ende an der Straße. Danach begann man die
Gräber auf der Kinderseite von vorn nach hinten
anzulegen. Bald werden die Gräber bis zu den
Kindergräbern reichen. Ende des Jahrtausends muß
man wahrscheinlich mit der Neubelegung des Alten
Friedhofs beginnen. In der Mitte der Kinderparzelle
befindet sich das Kriegerdenkmal – errichtet ca. 1948 –
35
für die Tarianer Gefallenen des Zweiten Weltkrieges
Hier wurden auch die 42 deutschen Soldaten zur
ewigen Ruhe gebettet, die 1944/45 in Tarian fielen.
Leider sind nur 4 namentlich bekannt: August Hermann
Gren (aus Altenkirchen/Westerwald), * Mahlert, 14. Juli
1907 – † 7. März 1945; Herbert Scholz, * 27. Juli 1921 –
† 4. Febr. 1945; Ufz. Johann Bamilik 1916–1945; Walter
Schubert 1925–1945.
Vorübergehend beerdigte man hier auch die fünf
Opfer der Revolution vom Herbst 1956. Die in der
Gemeinde gefallenen Sowjetsoldaten haben ihr
Gemeinschaftsgrab rechts am Eingang des Neuen
Friedhofs. Ihrer gedachte man jedes Jahr mit einer
offiziellen Kranzniederlegung am »Tag der Befreiung«,
am 4. Apr. Der übrigen Opfer des Krieges durfte nicht
gedacht werden, weil sie als Feinde des Kommunismus
starben.
Bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts wurden die
Toten – mangels Leichenhalle – in der vorderen Stube
ihres Wohnhauses aufgebahrt. Die Leiche wurde am
Tag der Beerdigung (Leicht) auf – von 2 Pferden
gezogenen – „Totenwagen“ auf den Friedhof gefahren.
Mit diesem Totenwagen – der in einem Häuschen an der
Héreger Str. untergebracht war – werden bis heute die
Toten zum Grab gefahren. Erst danach wurde das von
der Gemeinde erneuerte und vergrößerte »Totenhäusel«
am hinteren Ende des Alten Friedhofs gemeinsam mit
den Reformierten genutzt.
1996 baute man eine neue Leichenhalle am Eingang
zum Alten Friedhof. Diese moderne Einsegnungshalle
sucht ihres gleichen weit und breit!
36
Das Gerecse-Gebirge
Der Gerecse (Geretsch) ist ein Teil des Transdanubischen Mittelgebirges. Er ist die nordöstliche
Fortsetzung des Schildgebirges (Vértes). Von diesem ist
der Gerecse nur schwer abzugrenzen. Als die
Geographie noch »in Kinderschuhen steckte«, zählte
man einen großen Teil des Gerecse zum Vértes. Darauf
deuten auch die Namen mancher Ortschaften (Vértestolna, Vértesszölös).
Die Abgrenzung des Gerecse wird heute
folgendermaßen vorgenommen: Im Westen gegen den
Vértes (Schildgebirge) durch die Tata-Bicsker (Totis–
Witschker) Verwerfungslinie (Hauptstrecke der Eisenbahn), im Norden durch die Donau, im Osten gegen den
Pilis durch den Dorog-Piliscséver Graben und im Süden
gegen das Ofner Bergland durch das Schambeker
2
Becken. Das so abgegrenzte Gebiet ist an die 600 km
groß.
Der Geretsch ist ein ungefaltetes Schollengebirge von
unterschiedlicher Höhe. Das eigentliche Gebirge besteht
aus zwei Ketten, die von Tatabánya aus in nordöstlicher
bzw. in nord-ost-östlicher Richtung verlaufen. Letztere ist
die namensgebende Hauptkette. Senkrecht zu dieser
verlaufen niedrigere Höhenzüge in südlicher Richtung.
Während die zwei Gebirgsketten nach Osten bzw.
Süden steil abfallen, dachen sie sich gegen Norden –
zur Donau hin – allmählich ab. Der höchste Punkt ist der
634 m hohe Gipfel "Gerecse",der nördlich von Héreg
liegt. Das Gebirge ist im Osten stark abgesunken. Hier
findet man nur einige höhere Berge (z.B. bei Bajót und
Heiligenkreuz). Der östlichste Berg ist der 456 m hohe
"Nagy Gete" (Großer Geißberg)
37
zwischen Tokod und Dorog. Der zwischen Tarian und
Witschke liegende Gipfel "Nagy Somlyó" (Großer
Schaumloch; 448 m ) ist der fünfthöchste Punkt, von
dem man bei klarem Wetter den Johannis-Berg (529 m)
bei Budapest sehen kann. Südlich des Schaumlochs
findet man nur noch kleinere Berge und Hügel, die zum
Schambeker Becken überleiten.
Erdgeschichtliche Vergangenheit
Der Untergrund des Transdanubischen Mittelgebirges
besteht aus Gesteinen des paläozoischen (Paläozoikum
= Erdaltertum) Grundgebirges, welches gegen Ende des
Erdaltertums allmählich abgesunken ist. Infolge des
Sinkens wurde ein großer Teil des heutigen Ungarns
vorn Meer überflutet; nur einige Inseln ragten noch aus
den Fluten.
Im Laufe von Jahrmillionen lagerten sich im Erdmittelalter (Meso-zoikurn) aus tierischen Resten und von
Flüssen mitgeführten Sedimenten die Gesteinsschichten des Gerecse und der benachbartem Mittelgebirge
ab. In der Trias, der ältesten Formation des Mesozoikums (Beginn vor 185 Millionen Jahren, Dauer 30
Millionen Jahre), wurden die den größten Teil des
Gerecse ausmachenden Kalksteine (Dach- und Wettersteinkalke) und Dolomiten abgelagert. Heute werden die
Kalksteine in riesigen Steinbrüchen abgebaut.
38
In Tatabánya wurde aus ihnen Zement, Kalk, Karbid
und in Lábatlan an der Donau Zement hergestellt. Im
Inneren des Geretsch, wo es keine Industrie gibt,
werden aus den zerkleinerten Steinen Landstraßen
gebaut und instandgehalten. Im Jura (Beginn vor ca. 195
Millionen Jahren, Dauer 35 Millionen Jahre) entstand der
berühmte „rote Marmor“ des Gerecse. Hier handelt es
sich ebenfalls um Kalksteine, die in der mittleren
Formation des Jura (Dogger = brauner Jura, von vor 172
bis 162 Mio. Jahren vor heute) im Meer abgelagert
wurden. Der „rote Marmor“ liegt über den TriasSchichten und ist nur in der Hauptgebirgskette – westlich
39
und nördlich von Héreg – zu finden. Wegen der
leichteren Zu-gänglichkeit von Norden wird das rote
Gestein in der Nähe der Orte Tardos, Piszke und Süttö
gebrochen.
Schon in der Zeit König Matthias Corvinus' (1443 bis
1490) wurde der rote Marmor in großen Mengen
abgebaut und als Baustein verwandt. Die Treppen und
das Geländer sowie der Brunnen im Hof der Visegráder
(Plintenburger) Burg des Königs wurden aus diesem
Gestein angefertigt. Auch in späteren Jahrhunderten
benutzte man es gern als Baustein. Manche in der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts von Jakob Fellner
gebauten Denkmäler (so die Große Kirche von Totis, die
Kirche von Tarian u. a.) sind mit rotem Marmor verziert.
Bis in unsere Tage findet das rotbraune Gestein eine
vielfältige Verwendung: Als Grabstein, Tür- und
Fensterumrahmung, Treppen und Treppengeländer und
als Gehwegplatten.
40
In der Kreide (letztes Zeitalter des Erdmittelalters; es
begann vor ca. 120 Millionen Jahren und dauerte 60
Millionen Jahre) wurden in unserem Gebiet die KreideSandsteine und Mergel abgelagert. Kreidezeitliche
Mergel und im Süßwasser abgelagerte Kalksteine sowie
41
Jura-Kalke gibt es südlich von Lábatlan am Kis-Bersekhegy. Die weißen Sandsteine sind ziemlich weich und
lassen sich mit einer Holzsäge gut schneiden. Die
Bauern fertigten aus ihnen früher Tor- und Zaunpfähle
an. Manchenorts wurden aus ihnen auch Grabsteine
hergestellt.
Bemerkenswert ist, dass am SW-Rand - im N und O
von Tatabánya - neben Trias-Kalksteinen auch Kalke
aus dem Eozän anzutreffen sind, so z. B. am
Kalvarienberg und Keselö-hegy. Gegen Ende des Jura
begann sich das Gebiet langsam über den
Meeresspiegel zu erheben. An manchen Stellen des
Gebirges sind heute noch die Spuren der damaligem
Brandung der Meereswellen zu erkennen. Die
Heraushebung, die sich in der Kreide und im Tertiär
fortsetzte, ist auf die eurasische Gebirgsbildung
zurückzuführen. In dieser Zeit fand auch die Alpen- und
Karpaten-Auffaltung statt. Infolge der großen Unruhe im
Erdinnem sind die vorher zusammenhängenden Teile
des Transdanubischen Mittelgebirges auseinandergebrochen. Dabei wurden die waagrecht liegenden
Gesteinsschichten schiefgestellt (dies ist in TatabányaÚjváros u. a. gut zu sehen).
Im älteren Teil der Erdneuzeit, im Tertiär (es begann
vor 60 Mio. und endete vor 1½ Mio. Jahren), sind
manche Stellen des Gerecse weiter gehoben, andere
gesenkt oder schräggestellt – stellenweise auch
verbogen – worden. In den seichten Buchten des
Meeres entwickelte sich infolge der günstigen
Lebensbedingungen (warmfeuchtes Klima) eine üppige
Pflanzenwelt, aus der im Eozän und Oligozän (Anfang
des Tertiärs, vor ca. 48–40 Mio. J.) die Braunkohlen des
Tatabánya-Oroszlányer
und
des
Dorog-Tokoder
Beckens anstanden.
42
Versuchsbohrungen 1979/80 ergaben, dass Braunkohle auch im Becken von Tarian – im Inneren des
Geretsch-Gebirges – entstanden ist. Von Tatabánya, wo
die Abbaubedingungen immer schwieriger wurden,
verlagerte man schon damals den Bergbau ans S-Ende
des Tarianer Beckens, nach Csordakút. Im Tarianer
Ortsteil Neue Welt soll die Kohle nur in 35 m Tiefe
liegen. Wegen der Energieknappheit sollte hier ein
Braunkohlentagebau entstehen.
Am Aufbau dieser Kohlenlager sind vor allem
tropische und subtropische Pflanzen in sehr reicher
Artenzahl vertreten (Palmen, Zimt- und Kampferbäume,
Sumpfzypressen, Mammutbäume, Kastanien, Eichen,
Kiefern). Die dichte Vegetation der Buchten kam infolge
langsamen Sinkens oder einer plötzlichem Verschüttung
(Erdrutsch) unter die Erdoberfläche, wo sie unter
Luftabschluß und unter hohem Druck verkohlte.
Wie aus Funden in der Nähe von Tokod hervorgeht,
wurde hier schon in der Römerzeit Kohle im Tagebau
abgebaut und zum Heizen von kleinen Schmelzöfen und
Wohnhäusern benutzt. Man nimmt an, dass das hiesige
römische "Industriegebiet" bis ins 4. Jahrhundert n. Chr.
existierte.
Danach ist die Kohle wieder in Vergessenheit
geraten. Erst im 18. Jahrhundert begann man erneut mit
dem Abbau. Der aus dem Ruhrgebiet eingewanderte
Bergmann Anton Rückschuß hat 1780 in der Gemarkung
von Tscholnok mit dem fachgerechten Bergbau
begonnen. Gleichzeitig sorgte er auch für Abnehmer, die
er in Pest fand.
Im Westen des Gerecse begann die Ausbeutung der
reichen Kohlenlager erst ziemlich spät. Bei der Entdeckung der auf 200 Millionen Tonnen geschätzten
Tatabányaer Kohlenlager hat sich der Geologe Ludwig
43
Roth besonders verdient gemacht. Dank seiner unermüdlichen Forschertätigkeit konnte der Bergbau in der
Grube "Síkvölgy" 1896 beginnen. Die Kohle wurde in
Tatabánya wie in Dorog zur Grundlage der Industrie, die
heute den meisten Menschen dieses Gebietes Arbeit
und Brot gibt. Nur wenige sind sich dessen bewußt, dass
der Grundstein für ihre heutige Existenz vor vielen
Millionen Jahren gelegt wurde.
Gegen Ende des Tertiärs hat sich das Pannonische
Meer, welches einst ganz Transdanubien bedeckte,
allmählich zurückgezogen. Es hat eine mächtige
Tonschicht zurückgelassen. Sie wird als PannoniaSchicht bezeichnet. Am Westrand des Gerecse, in Totis,
werden aus dem Ton Brennziegel hergestellt.
Die heutigen Oberflächenformen des Mittelgebirges
sind bereits vor etwa 1 Mio. Jahren entstanden. Im
Eiszeitalter, welches vor ca. 1½ Mio. Jahren begann und
44
vor 16 000 Jahren endete, wurde die Pannonia-Schicht
von einer mächtigem Lössdecke überzogen, die im
Gerecse bis zu 10 m mächtig ist. Die vom Wind
transportierten feinsten Staubteilchen haben sich an den
Hängen des Geretschs abgelagert. Im Süden von Tarian
u.a. bildet er Steilwände, in die Weinkeller und
Höhlenwohnungen gebaut wurden. Die im Volksmund
als »Lahmgstetten« bezeichneten Löss gruben lieferten
wertvolles Baumaterial: Mit Spreu vermischt fertigte man
daraus »Kotziegel« an. Aus denen das Mauerwerk der
Bauernhäuser errichtet wurde. Der angefeuchtete
»Lehm« wurde auch zum Verputzen von Mauern
benutzt. Auf dem gelben Löss bildete sich fruchtbare
Schwarzerde. Auf ihr wächst heute u. a. Wein und Obst.
Während der Eiszeiten, in denen das nordeutsche
Tiefland, das Alpenvorland und die Alpen von einer
dicken Eisdecke bedeckt waren, war unser Gebiet
eisfrei. Wegen der niedrigem Temperaturen konnten hier
nur anspruchslose Polsterpflanzen und niedrige
Sträucher existieren. Nur in den Zwischeneiszeiten,
deren Klima dem heutigen ähnlich war, konnten sich
Laubbäume und andere, höhere Pflanzen ausbreiten.
Am Ende der letzten Eiszeit vor ca. 16 000 Jahren
begann sich die heutige Pflanzendecke auszubilden.
Heimat des Vormenschen
Der Mensch hat früh die günstigen Lebensbedingungen
(fischreiche Bäche und Seen, wildreiche Wälder und
Kalksteinhöhlen) des Geretsch erkannt. Er ist in dieser
Gegend bereits in der Altsteinzeit (ca. 650 000 bis 12
000 v. Chr.) anzutreffen. Dies geht aus den Funden von
Vértesszölös am Westrand des Gerecse hervor. In den
60er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde dort eine auf
450.000 Jahre geschätzte menschliche Siedlung mit
45
Knochenresten von Wölfen, Hirschen, Bären, Löwen
usw. entdeckt. Auf Grund seines Körperbaus und seines
Alters wird der Mensch von Vésrtesszölös zu den
Vormenschen gerechnet. Wegen seiner Einmaligkeit in
Europa ist dieser Fund in kurzer Zeit berühmt geworden.
Von 1909 bis 1911 entdeckte man in Totis ca. 250 000
Jahre alte vormenschliche Reste. In der letzten Eiszeit
lebte im Geretsch noch das Mammut.
Auf Grund zahlreicher Funde aus der Alt-, Mittel(12.000 bis 4000 v. Chr.) und Jungsteinzeit (4000 bis
1800 v. Chr.) sowie der Bronze- (1800 bis 800 v. Chr.)
und Eisenzeit (ab 800 v. Chr.) kann angenommen
werden, dass es sich hier um eines der ältesten europäischen Siedlungsgebiete handelt.
Völkisches Mischgebiet
Vor Christi Geburt lebten hier die Illyrer und Kelten. Zu
Beginn unserer Zeitrechnung wurde das Gebiet von den
Römern besetzt. Anfang des 5. Jahrhunderts finden wir
hier die Hunnen. Danach folgten die Langobarden, die
Ostgoten und die Awaren. Im 9. Jahrhundert herrschten
in dieser Gegend die Slawen. 896 erfolgte die
Landnahme der Magyaren. Nach der Vertreibung der
Türken Ende des 17. Jahrhunderts war das Gebiet des
Geretsch weitgehend entvölkert. Die Großgrundbe-sitzer
(v. a. die Familie Esterházy) riefen deutsche und
slowakische Siedler auf ihre Güter.
Ähnlich wie zur Zeit der Völkerwanderung ist das
Gebiet auch heute noch ein völkisches Mischgebiet.
Neben den genannten Nationalitäten trifft man in
manchen Dörfern auch seßhaft gewordene Zigeuner an
(z. B. Héreg). Ungarische, deutsche und slowakische
Gemeinden liegen hier eng beieinander. Die Menschen
verschiedener Muttersprache und Herkunft haben sich –
46
sofern sie nicht von ,oben‘ aufgehetzt wurden – immer
gut verstanden. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg
haben die nationalen Minderheiten viel von ihrer Identität
eingebüßt.
Fußwanderung durch den Gerecse
Wer diese Landschaft richtig kennenlernen will, der muß
1
– mit einer Wanderkarte in der Hand – abseits von den
Verkehrswegen ihre Schönheiten suchen. Am besten
beginnt man mit der Wanderung in TatabányaUntergalla. Auf dem Berg über dem Stadteil Tb.-Újváros
kann man schon von weitem ein großes Vogeldenkmal
erkennen. Es wurde anläßlich der Mil-lenniumsfeier 1896
errichtet. Der sogenannte Turul ist der Vogel der
altungarischen Sagenwelt. Die ausgestreckten Flügel
haben eine Spannweite von mehr als 14 m, das
Árpáden-Schwert in den Krallen des Vogels ist 12,5 m
lang.
Von hier oben hat man eine schöne Aussicht auf
Tatabánya, auf das Schildgebirge und in Richtung Totis.
Man sieht auch die slowakische Gemeinde Vértesszölös,
in deren Nähe die Skelettreste des ältesten Europäers
gefunden wurden. In der Nähe des Turuls befindet sich
die Höhle "Szelim" und eine weitere kleine Höhle. Beide
sind durch paläontologische Funde berühmt geworden.
Nach der Sage sollen die Türken hier die Männer der
Umgebung ermordet haben. Dies ist aber nur Gerede, in
Wirklichkeit sind die Knochenreste viel älter.
Vom Turul-Denkmal aus wandern wir nach Osten.
Der Weg führt uns über tiefeingeschnittene Hohlwege
durch schier unendliche Laubwälder, die nur hier und da
durch
Lichtungen
mit
einsamen
Forsthäusern
unterbrochen sind. In den stillen Bächen verbirgt sich
unter Steinen der begehrte Flußkrebs. Einige Kilometer
47
von unserem Ausgangspunkt entfernt befindet sich ein
Wildreservat, in dem Anfang der fünfziger Jahre Mufflons
(Wildschafe) ausgesetzt wurden.
Am Fuße des Pes-kõ-Berges (401 m) gab es einst
inmitten einer kleinen Obstplantage ein Pfadfinderheim
(cserkészház). Vor dem Zweiten Weltkrieg stand dieses
Haus den Pfadfindern zur Verfügung. Danach diente es
als Lagerhaus für das Staatsgut von Tarian, schließlich
fiel es zusammen und die Plantage verwilderte. In der
Nähe wurde aus Kalksteinen auch Kalk gebrannt.
Der Aufstieg zur Peskö-Höhle ist ziemlich schwer.
Oben angelangt, wird man für die Mühe durch die
herrliche Aussicht nach Süden reichlich belohnt. Von
hier kann man bei klarer Sicht den ganzen südlichen Teil
des Gerecse-Gebirges überblicken. Am nächsten liegt
die deutsche Mehrheits-Gemeinde Tarian. In großen
Rodungs-inseln liegen die ehemaligen Herr-schaftsgüter
Tornyópuszta, Tükrös-puszta und Gyarmatpuszta sowie
eine Reihe Einzelhöfe (tanya). Wo einst schmale
Ackerparzellen zu sehen waren, liegen heute große,
einheitlich bestellte Tafeln. Nach dem Wechsel von der
Streifen- zur Blockflur zwischen 1950 und 1990,
entstand durch die Auflösung der Staatsgüter und LPGs
infolge Reprivatisierung des Bodens eine neue kleinere
Blockflur.
Wer das Vértes-(Schild-)Gebirge kennt, dem wird
auffallen, dass es im Gerecse keine Burgen gibt. Der
Grund dafür ist in der Verkehrsfeindlichkeit des letzteren
zu suchen. Die großen Verkehrswege nach Westen
führen durch die leicht passierbaren Senken des Vértes.
Im Mittelalter wurden sie durch Burgen geschützt.
In der Pes-kõ-Höhle haben sich nach der Sage die
Bewohner von Tarian vor den Türken versteckt. Sie
sollen entdeckt und hingerichtet worden sein. Da es sich
48
um eine kleine Höhle handelt, ist diese Annahme zu
bezweifeln. Geht man vom Pes-kö aus die sanfte
Abdachung nach Norden, kommt man in die kleine
deutsche Gemeinde Vértestolna (Tolnau). Etwa zwei
Kilometer entfernt liegt das slowakische Dorf Tardos.
Von hier gelangt man ohne viel Mühe zu den
Steinbrüchen, wo der "rote Marmor" abgebaut wird. Das
Gestein liegt in dicken Platten übereinander.
Auf dem höchsten Punkt des Gebirges, dem
Gerecse-Gipfel (634 m), angelangt, bietet sich auf das
silberne Band der Donau, in Richtung Slowakei und Pilis,
eine herrliche Aussicht. Hier gibt es ebenfalls eine ganze
Reihe von
Höhlen und unterirdischen Bächen, deren Wasser zur
Donau fließt. Dies wurde mit Hilfe von Färbversuchen
festgestellt.
Wie sind die Höhlen entstanden? Das meiste Niederschlagswasser versickert im klüftigen Kalkstein. Der Kalk
wird vom Sickerwasser allmählich aufgelöst, die Spalten
werden zu weitverzweigten Höhlen erweitert. Am
Fuße des Berges liegt das ungarische Dorf Héreg.
Von hier ist eine andere ungarische Ortschaft, Bajna
(Weina), etwa sieben Kilometer entfernt. Weina ist die
Heimat des "Teufelreiters" Graf Moritz Sándor. Er war
der Schwiegersohn Mettemichs. In der Dorfmitte steht
noch das sog. Metternich-Kastell. In der Zeit des
Kommunismus wurde es total ruiniert. Der tollkühne
Reiter hat allerlei Kunststücke vollbracht, mit denen er
die Bewohner von Weina und Umgebung sowie von
Budapest und Wien in Erstaunen versetzte. Dabei zog er
sich so schwere Verletzungen zu, dass er zwei
Jahrzehnte bettlägerig war. Bis zu seinem Tode 1878
war er ein Pflegefall. Sein Grab befindet sich in der
Kapelle von Gyarmatpuszta.
49
Von Bajna gelangt man über eine Straße nach
Péliföldszentkereszt (Heiligenkreuz), dem weitbekannten
Wallfahrtsort. In der Nähe liegt der "Öreg-kõ-Berg", in
dem sich eine 35 rn lange Höhle befindet. Aus ihr
wurden zahlreiche vorgeschichtliche Knochenreste und
Gegenstände geborgen, die auf eine steinzeitliche
Besiedlung schließen lassen. In dem benachbarten Bajót
befindet sich eine gotische Kirche aus der Zeit der
Árpáden, die später im Barockstil umgebaut wurde. Von
Heiligenkreuz, das noch mit Wäldern umgeben ist,
gelangt man über das Gehöft Orisáp in das trostlose
Industriegebiet von Dorog und Tokod. Von dem kahlen
456 m hohen "Nagy Gete" (Großer Geißberg) hat man
einen schönen Rundblick auf die Umgebung. Die
waldlosen Berge liegen zum Greifen nahe. Die Basilika
von Esztergom (Gran) – in der Nähe der Donau – ist
ebenfalls zu sehen. Trotz der weniger schönen
Industriegebiete im Westen und Osten ist der Geretsch
eine schöne und interessante Landschaft.
1)
A Gerecse turistatérképe, 1 : 40 000, 1995
Das Tarianer Becken
und seine Randberge
Die Erde ist mehr als 4,5 Milliarden Jahre alt. Seit ihrer
Entstehung ändert sich ständig ihr Aussehen. Auch
unsere engere Heimat – das Tarianer Becken in der
Mitte des Geretsch-Gebirges – ist erst im Laufe der
letzten 225 Millionen Jahre entstanden. Damals – im
Erdmittelalter – war das Pannonische Becken und weite
Teile Europas und Asiens von einem großen Meer –
Thetys genannt – bedeckt. Reste dieses Meeres sind
50
heute noch das Mittel-, das Schwarze und das
1
Kaspische Meer.
Aus nördlichen Gebieten Europas und Afrikas flossen
viele Flüsse in diese Meeressenke und lagerten ihre
Sedimente (Schlamm, Sande, Kieselsteine) ab. Daraus
und aus abgestorbenen Meereslebewesen entstanden –
in 130 Mio. Jahren – unter Druck mehrere Hundert Meter
mächtige Gesteine. Zunächst lagen ihre Schichten am
Meeresgrund noch waagrecht. Der Gegendruck aus dem
Erdinneren drückte die Gesteine langsam nach oben, so
dass vor rund 100 Mio. Jahren im Pan-nonischen
Becken immer mehr Inseln aus dem flacher werdenden
2
Meer ragten. Durch weitere Heraushebung in der
alpidischen Gebirgsbildung (Entstehung der Alpen und
Karpaten) – sie begann am Ende der Kreidezeit vor rd.
100 Mio. J. – zerbrachen die Gesteinsschichten und
wurden schräggestellt.
Diese Krustenbewegungen waren in den vergangenen 10 Mio. Jahren – im Pliozän/Pleistozän –
besonders lebhaft und wiederholten sich mehrmals, so
entstand durch die Heraushebung der Randberge und
das Absinken des Beckens nach und nach das heutige
Bild des Tarianer Beckens. Es ist ca. 12 km lang, 5 km
breit und liegt 180-200 m über dem Meeresspiegel.3 Es
verläuft im Norden in N-S-Richtung, im Süden in NWSO-Richtung, und verengt sich von 5 km im N auf 1,5 km
im S. Das nördliche Ende liegt bei Héreg, das südliche
bei Tükröspuszta-Vasztély.
Das Becken ist von – in Staffelbrüchen angeordneten
– Pultschollen umgeben. Eine Pultscholle ist ein
Gebirge, dessen eine Seite steil abfällt, die andere ist ein
Flachhang, d. h. er fällt allmählich ab. Im Falle des
Tarianer Beckens schauen die Steilhänge in Richtung
51
Becken, während die Flachhänge von ihm abgewandt
sind. Die am inneren Beckenrand liegenden Berge –
erste Staffel mit Tamás-kõ (281 m), Csurgó-hegy (300
m), Kis Somlyó (382 m) im W des Beckens; Fakó-hegy
(269 m), Õr-hegy (230 m), Nagy-Seres-hegy (307 m),
Jásti-hegy (334 m), Kis Szenék (295 m) im O – sind rd.
120 m niedriger als die am äußeren Rand liegenden
Höhenzüge der zweiten Staffel. Letztere ist besonders
gut im W und N ausgeprägt. Hier fand die stärkste
Heraushebung statt. Beispiele dafür sind: Gerecse (633
m), Fekete-kõ, Fábián-kõ und Pes-kõ (401 m); südlich
von Tarian: Baglyas-hegy (433 m) und Somlyó (448 m).
Im O liegen die meisten Höhen nur zwischen 230 und
310 m, lediglich der Szenék – östlich von Héreg –
erreicht eine Höhe von 399 m. Zieht man das Gebiet des
Tolnauer Beckens in die Betrachtung mit ein, dann kann
man im W dieses Beckens noch eine dritte Staffel – mit
Öreg-Kovács (554 m), Szénás-hegy (549 m) und
Kappan-Bükk (534 m) – erkennen. Der Höhenunterschied zur zweiten Staffel (Pes-kõ) beträgt rd. 130150 m. Das Tolnauer Becken hat eine Höhe von 250300 m über NN, d. h. es liegt 70-120 m über dem
Tarianer.
Das Tarianer Becken ist als Einbruch der einst
zwischen den heutigen Randgebieten bestehenden
Gesteinsdecke zu erklären. Während sich die Ränder
allmählich herausgehoben haben, sank das einstige
Deckgestein im Becken in die Tiefe und wurde von
Abtragungsresten der letzten 10–12 Mio. Jahre
(Jungtertiär — bis heute) bedeckt.
52
53
Diese Annahme wird durch die gleichartigen Gesteine
im W und O des Beckens bestätigt. Aus der Zeit von vor
200 Mio. Jahren (Mittlerer Keuper/Trias) stammt der
Dachsteinkalk, der den Pes-kõ, Fábián- und Fekete-kõ
im W und das Kajmát-Plateau im N sowie Szenék und
den Jásti-hegy im O aufbaut.
Ebenfalls aus dem Mittleren Keuper stammt der
Hauptdolomit, aus dem die Berge Baglyas, Somlyó und
Tornyó im W sowie Nagy-Seres-hegy im O bestehen.3
Die Trias-Gesteine wurden an bestimmten – noch vom
Meer überfluteten – Stellen, hier an der W-Flanke und im
N der Hauptkette des Gerecse, von Jura-Gesteinen
überlagert. Die 172 bis 162 Mio. Jahre alten Braunen
Jura- oder Dogger-Ablagerungen „rutschten“ bei der
Heraushebung nach W und N vom Dachsteinkalk ab. Sie
werden v. a. in Tardos und Süttõ als »roter Marmor«
abgebaut. Rötlicher Kalkstein aus dem Dogger – mit
Ammonshörnern und Brachiopoden als Fossilien –
wurden auch am östlichen Beckenrand (Szenék – NagySeres-hegy) gefunden. Unfruchtbare Roterde aus der
gleichen Zeit bedeckt die Ostflanken des Somlyó-Berges
und der angrenzenden Felder (Schaumloch-Äcker).
Die Kieselsteine sind vom fließenden Wasser
abgerundete Steine unterschiedlicher Größe. Je kleiner
und runder sie sind, desto älter sind sie und umso weiter
wurden sie vom Wasser transportiert. Man findet hier
Kiesel, die 420 km weit »gerollt« wurden. Die
Feuerstein- und Kalkkiesel des Kajmát stammen vom
Berg Steinfels bei Dorog. Sie sind ähnlich wie die am
NO-Fuß des Pes-kõ liegenden Kieselsteine ca. 27 Mio.
Jahre alt (Miozän).4
Da Kalkgestein wasserdurchlässig ist, löst es sich im
kohlendioxidhaltigen Wasser auf. Das nennt man
54
Verkarstung. Dabei entstehen verschiedene Karstformen, wie Höhlen, Dolinen oder Karren. Die
miozänzeitlichen Verebnungsflächen auf den – das
Tarianer Becken umgebenden – Bergrücken sind klein,
und deshalb findet man darauf nur bescheidene
Karsterscheinungen.
Der Pes-kõ (dt. Höhlenstein) – 3 km lang und 1 km
breit – der Tarianer »Haus-Berg« weist nur einige
bescheidene Dolinen (bombentrichterartige Vertiefungen
von max. 15 m Durchmesser und 1 m Tiefe) an der
Oberfläche und 2 Höhlen an der Stirnseite der
Felsenwand auf. Diese Höhlen entstanden in den Klüften
der 2 – 4 m mächtigen Kalkschichten infolge der
Hebungsvorgänge unter Einwirkung von Thermalwasser.
Die größere Höhle befindet sich in 350 m über NN. Ihr
Vorraum ist ca. 3 m breit, 4-5 m hoch und 3 m tief. Um
sie rankt sich eine Sage (> Hotter, Bilder). Die zweite
Höhle liegt in der Höhe von 360 m. Bei ihrer Entstehung
spielten sowohl Thermal- als auch Karstwasser eine
Rolle. Über ihr befinden sich heute noch 40 m mächtige
5
Kalkschichten, die im Miozän 100 m dick waren.
In der Zeit vor 30–35 Mio. J. (Oligozän/Miozän)
entstanden im Tarianer Becken die dicht unter der
Oberfläche liegenden Braunkohlen. Das Becken entstand in mehreren Phasen. Seine Ränder bestehen aus
Meereston, Sandton, feinem Sandstein der Oberkreide
3
und des Alttertiärs. Sie treten z. B. beiderseits der
Straße am Tarianer Kalvarienberg zutage.
Nachdem sich vor ca. 27 Mio. Jahren das Meer aus
diesem Raum endgültig zurückzog, lagerten die Bäche
aus den Randgebirgen riesige Mengen an Schotter, Kies
und Sand im Beckeninneren ab. Das Klima war nach wie
vor tropisch-subtropisch.
55
Das Eiszeitalter in unserer Gegend
Vor ca. 1,5 Mio. Jahren – im Pleistozän – begann das
Eiszeitalter. Es ist in 4–5 Kaltzeiten zu untergliedern.
Zwischen ihnen lagen die Warmzeiten. Neben NordEuropa waren fast nur die Alpen und Karpaten von
Gletschern überzogen. In unserem Becken gab es
während der Kaltzeiten wegen der ca. 5 °C tieferen
Durchschnittstemperaturen eine Tundrenvegetation, d.
h. hauptsächlich Moose und Flechten sowie kniehohe
Sträucher. Die kahlen Felsen des Geretsch wurden
durch die Frostsprengung in größere Blöcke zerlegt.
Diese bewegten sich im Winter und Frühjahr an den
steilen SO-Hängen auf dem oberflächlich auftauenden
Frostboden langsam hangabwärts. Sie liegen heute
noch am Fuße des Pes-kõ und Fekete-kõ.
Der Meeresspiegel lag in den Kaltzeiten 100 m tiefer
als in den Warmzeiten. Deswegen gruben sich die
Bäche in die Verebnungs-flächen der Tertiärzeit ein
(Tiefenerosion).
Die von den eisbedeckten Gebirgen wehenden Winde
transportierten feinen gelben Staub, den Löss , in unser
Becken. Er überzieht – ähnlich einer Schneedecke – die
Unebenheiten der Landschaft und bildet an manchen
Stellen Steilwände (z. B. im SO von Tarian). Auf ihm
entstand die fruchtb
In
den Warmzeiten – sie dauerten ähnlich wie die
Kaltzeiten je Hunderttausend Jahre – lag der
Meeresspiegel um 100 m höher als in den Eiszeiten, die
Wasserläufe verloren deshalb an Transportkraft und
lagerten im Tarianer Becken ihre Schotter und Sande ab
und schütteten ihre Täler teilweise zu. Sie trugen infolge
Seitenersion die Hänge ab. So entstanden die –
teilweise mit Löss bedeckten – II. und III.
56
Schotterterrassen am St.-Ladislaus- und Tarianer Bach
5
südöstlich von Tarian.
Infolge des Wechsels zwischen Kalt- und Warmzeiten
entstand in unserer Beckenlandschaft eine unruhige
Oberfläche. Der Beckencharakter ist am besten noch im
N – zwischen Tarian und Héreg – ausgeprägt. Zwischen
den Talauen und Hügeln werden die 20-30 m
Höhenunterschiede durch sanfte Hänge überwunden.
Östlich und südöstlich von Tarian – Sövénykert,
Kisszállás, Omlási-rétek, Õrhegy – nimmt die
Reliefenergie zu, d. h. die Hänge zwischen den
Hügelkämmen und Talauen werden steiler, und somit für
die landwirtschaftliche Nutzung unrentabler. Teilweise
wird dieser Nachteil durch den Löss boden wettgemacht,
im flacheren nördlichen Teil dagegen überwiegen Sandund Schwemmlandböden. In den waldbedeckten Teilen
der Randgebirge dominiert der sog. braune Waldboden.
Im Niederwald auf verkar-steten Untergrund findet man
Humuskarbonatboden (Rendzina). Diese Böden sind –
in Jahrmillionen ent-standene – feine Verwitterungsprodukte der Gesteine unter Einwirkung des Klimas,
der Witterung sowie der Pflanzen- und Tierwelt.
Klimatische Verhältnisse
Nach dem Ende der letzten Kaltzeit vor ca. 17 000
Jahren entstand allmählich unser heutiges gemäßigtes
Klima. Im Tarianer Becken ist eine feuchtkontinentale
Variante des gemäßigten Klimas anzutreffen. Im
gesamten Geretsch-Gebirge – so auch in unserem
Becken – wurde eine Gesamt-Sonneneinstrahlung von
2
102–104 kcal/cm registriert. Das bedeutet im Jahr 1991
Sonnenstunden. Wegen der großen Entfernung zum
Meer sind die Sommer heiß und die Winter kalt. Ferner
treten Spätfröste auf. Die Wetterstation auf dem Gehöft
57
Tükrösmajor im S des Beckens registrierte – in 40
Jahren – einen jährlichen Niederschlag von 578 mm,
wovon 56,7% in der Wachstumszeit fallen.6 Die
regenbringenden Westwinde regnen sich an den Bergen
am W-Rand ab. Die Abhängigkeit von der Großwetterlage ist aber auch hier gegeben: Es gibt hier neben
sehr trockenen-heißen Sommern auch feucht-kühle,
ebenso schneereiche kalte, wie schneearme und milde
Winter.
Die natürliche Pflanzenwelt
Vegetation unserer Gegend ist nach und nach in
Tausenden von Jahren seit dem Ende der letzten Eiszeit
– unter dem Einfluß des Klimas und Bodens –
entstanden. Sie gehört zum pannonischen Florenreich
(Pannonicum), innerhalb diesem zur transdanubischen
Mittelgebirgsfloren-Region (Bakonyicum) und zu deren
Pilischer Unterflorengegend (Pilisiense). Bei ihr handelt
es sich um eine Mischform zwischen dem mediterranen
Karst-Buschwald,
den
westeuropäisch-atlantischen
Buchen-Eichen-Wald und der osteuropäisch-pontischen
Waldsteppe.
Nördlich vom Pes-kõ findet man einen geschlossenen
Eichenwald, während südlich davon v. a. WaldsteppenVergesellschaftungen überwiegen. Am weitesten
verbreitet sind – sogar noch auf den Hügeln um 250 m ü.
NN – die Eichen- und Eichenschälwälder (Quercetum
petraecerris). Die Kalkbänke und Oberfläche des Pes-kõ
sind von Karst-Buschwald der pontischen Kremmelkirsche mit Trockenrasens (Ceraso mahaleb — Quercetum pubescentis und Festucetum pallentis
Hungaricum) bedeckt. Bäume und Sträucher bilden ein
schier undurchdringliches Dickicht. Hauptvertreter unter
den Bäumen sind: Flaumeiche (Quercus pubescens),
58
Blumenesche (Fraxinus ornus) und Elsbeere (Sorbus
torminalis). In der Strauchschicht – sie ist unter allen
Pflanzenvergesellschaftungen die artenreichste –
dominieren
Kremmelkirsche
(Cerasus
mahaleb),
Kornelkirsche (Cornus mas, in der örtlichen ua-Mundart:
,Tiendl‘) und Ferula (Ferula sadleriana). An manchen
Stellen sind diese Assoziationnen von Hang-Trockenrasen mit Federgras (Stipa pulcherrima) – z. B. am
Fakóberg (269 m) – unterbrochen.
Unterhalb des Karst-Buschwaldes folgt die Stufe der
Schuttabhangwälder, so z. B. am SO-Abhang des Peskõ der Linden-Eschen-Schutt-abhangwald (Mercuriali –
7
Tilietum). Nach Wagenhoffer bekam er wohl seinen
Namen von den Linden des Schuttabhangwaldes des
374 m hohen Lindners südlich des Somlyó-Berges. Der
,Schomlochburg‘ genannter Berg (448 m) ist von
Weißbuchen-Eichen-Wäldern bedeckt, wobei ein weithin
sichtbarer breiter Streifen am N-Hang von Trockenrasen
bewachsen ist.
Entlang der Bachläufe findet man in den
tiefergelegenen Stellen des Beckens Schilf- oder
Rohrgebiete sowie Weidenbäume.
59
Fließgewässer des Beckens
Die Bachläufe überformten – infolge wiederholter
Hebungsvorgänge bis in die jüngste Zeit – die
Oberflächenformen des Beckens, so dass eine abwechslungsreiche Gitterstruktur entstand. Die Bruchlinien in Längsrichtung des Beckens bestimmen die
Laufrichtung der Bäche, die von den Bewohnern einfach
als »Graben« (ung. árok) genannt werden. Nur der
längste Bach hat einen Namen: »St.-Ladislaus-Bach«.
Er entspringt nordöstlich von Héreg aus den
Karstquellen am Fuße des Geretsch-Berges. Durch
rückschreitende Erosion arbeitete er sich vom
Beckenrand bei Héreg immer in Richtung Pusztamarót
vor und zapfte das dortige Becken an.
Der St.-Ladislaus-Bach nimmt während seines ca. 25
km langen Laufs alle Bäche des Tarianer Beckens auf:
Zuerst drei im N der Gemarkung von Héreg, dann – kurz
60
vor der Héreger Brücke – den aus dem Fekete-kõ und
Lovász-hegy kommenden Bach, dann den Bach, der den
S des Héreger Hotters entwässert und am Sövénykert
vorbeifließt. Bei der Gyermelyer Brücke nimmt er den
kurzen Bach vom Csatári-Brunnen auf. Danach fließt er
durch die Bruchlinie der Omlás-rét (dt. Bruchwiesen)
nach Süden. Unterwegs nimmt er noch von links das
Bächlein vom Mogyorós-kút (dt. Haselbrunnen) auf.
An der Maaner Brücke mündet schließlich der den W
entwässernde – durch Tarian fließende – ca. 7 km lange
Bach in ihn. Unweit dieser Brücke wurde Ende der 50er
Jahre ein Ministaudamm errichtet und der Bach zu
einem Fischweiher gestaut. Bevor der St.-LadislausBach unser Becken verläßt, nimmt er noch weitere
Bäche auf: So das Wasser einer Quelle am Fuße der
Langen-Äcker, die Bäche, die von Vasztély und
Tükröspuszta kommen.
Der W des Beckens wird von mehreren Bächen
entwässert. Der eine entspringt nördlich von Turni und
fließt nach NW am ehemaligen Kühebrunnen vorbei,
macht dann an der – aufgegebenen – Kenderesi tanya
(Õ Hotter) eine Schleife – unterwegs nimmt er das
Wasser mehrerer Quellen auf – und fließt an den
Stockwald-Äckern und am Kälberbrunnen vorbei zur
Tschurgoheit, wo eine weitere Quelle einmündet. Südlich
von Tarian – im Hanfland – erreicht er das eigentliche
Becken und mündet – in der Höhe des Kissallasch– in
der Rohrteicht-Wiesen in den Tarianer Bach.
Der Tarianer Bach wird von drei Zuflüssen gespeist,
die alle durch Tarian fließen. Der westlichste entspringt
in den Ritschmann-Wiesen und fließt durch den
Kleegarten und trennt die Neue Welt und das Hanfland
von den übrigen Gassen des Dorfes. Der mittlere
entspringt im Teichtl und hat einen kleinen Zufluß von
61
dem einstigen Fegedeki-Brunnen her. Der Bach trennt
den Kischtarian von der Hintergasse, überquert die
Untergasse und vereinigt sich mit obigem Bach im
Bereich des neuen Freizeitzentrums im Schulgarten.
Von dort fließt der Bach unter den Gärten der
Hauptstraße bis in die Höhe des Móricz-ZsigmondPlatzes, wo er sich mit dem dritten »Graben« vereinigt.
Der dritte Bach entspringt im NO des Dorfes aus dem
'Rohr' genannten Sumpfgebiet unter den Gärten der
Obergasse. Im Tal zwischen den sog. Schulmeister- und
Pfarrer-Feldern und den Gärten der Hauptstraße
überquert er im S des Dorfes den Móricz-Platz und
vereinigt sich hinter den Gärten der Witschker Straße mit
den zwei anderen. Nach dem Dammbrücke verläßt er
das Dorf und fließt westlich des Friedhofs und der
Preßhäuser – am einstigen Zigeuner-Brunnen entlang –
in Richtung des Sumpfgebiets »Rohrteicht-Wiesen«, um
sich mit dem westlichen Bach zu vereinigen. Dann strebt
er am Ochsenbrunnen vorbei der Maaner-Brücke zu, wo
er nach ca. 7 km Länge bei 140–150 m über NN in den
St.-Ladislaus-Bach mündet.
Sumpfgebiete
Die im Jungpleistozän – Beginn vor etwa 300 000 J. –
stattgefundenen erneuten Senkungen und Hebungen
führten zur Entstehung von Sumpfgebieten im Tarianer
Becken. Das Wasser der zahlreichen Karstquellen und
der Niederschlag sammelt sich in den Senken. Der
Grundwasserspiegel – über undurchlässigen Ton-,
Letten- und Mergelschichten gestaut – tritt in
tiefergelegenen Gebieten an die Oberfläche. Er liegt im
ganzen Becken ca. 150 m über
Bereich). In diesen Sumpfgebieten entstand eine
meistens von Schilf (Phragmites communis) dominierte
62
Pflanzengesellschaft. An Tieren sind die Frösche am
meisten vertreten. Daneben kamen früher noch Unken
vor. Fische gibt es kaum. Das Grünfüßige Teichhuhn
(,Wossahiendl‘) war im ,Rohr‘ auch anzutreffen.
Das größte Sumpfgebiet ist das »Rohr« entlang der
Obergasse, im N des Dorfes. Es wird – wie die meisten
anderen auch – von einer Quelle (im Volksmund 'Brindl'
genannt) gespeist. Im dichten Schilfbewuchs gibt es nur
kleinere offene Wasserstellen, wo im Sommer Frösche,
Wildenten ('Tuckanten') u.a. zu beobachten sind. In der
Zeit der kollektiven Landwirtschaft (1950–1990) dehnte
sich die Rohrfläche aus, weil die Nutzung der
benachbarten Wiesen eingeschränkt wurde. Infolge des
in den 60er Jahren im S des Beckens begonnen
Braunkohlenabbaus sank der Grundwasserspiegel ab,
was sich auch auf die Sümpfe negativ auswirkte: In dem
jetzt z. T. trockenliegenden Rohr leben nun auch
Hirsche, Wildschweine und Füchse.
Eine
ganz
andere
Zusammensetzung
der
Pflanzenwelt findet man im 'Teichtl' am Waldrand rechts
der Straße nach Tata/Totis. Hier gibt es wenig Schilf,
aber dafür mehr Binsen (ung. káka) und ,Tschadig‘
(Schwarzes Kopfriet, ung. csáté). Beide wurden von den
Bauern für Bindearbeiten im Weingarten benutzt. Wegen
der geringen Wassertiefe trocknete das Teichtl in
manchen Jahren aus, dann wurde es als Mähwiese
genutzt. Wie der ung. Name übersetzt ,StechmückenTeich‘ schon zeigt, gibt es hier viele Gelsen (>Hotter,
Fußnote 3).
Ein größeres Sumpfgebiet befindet sich im S des
Dorfes im Tal zwischen Kisszállás und dem Wald. Je
nach Wasserstand bedeckt diese 'Rohrteicht-Wiesen'
mal eine größere, mal eine kleinere Fläche.
63
Im N des Sövénykert – an der Grenze zum Héreger
Hotter – liegt ein weiteres ,Rohr‘, von einem Bach – der
in den Héreger Stier-Wiesen entspringt – duchflossen
und gespeist von Sövénykert-Quellen. (Anfang d. 20.
Jahrhunderts
soll
ein
Tarianer
Bauer
bei
Schneegestöber auf der Heimfahrt von Héreg mit
seinem Pferdeschlitten vom Weg abgekommen und hier
– zusammen mit seinen Pferden – ums Leben
gekommen sein.)
Weitere Schilfsümpfe befinden sich zwischen der
Gyermelyer Brücke und dem Csatári-Brunnen sowie am
S-Ende des Hotters unterhalb der Langen-Äcker (unweit
des Fischteiches). Durch den Bau des Ministaudamms
entstand v. a. im N des Fischweihers – in den
ehemaligen Wiesen – ein neues Sumpfgebiet mit einer
reichen Pflanzen- und Tierwelt. Diesen positiven Aspekt
für die Natur mindern die Anglerbuden rings um den
Weiher,
welche
das
Landschaftsbild
erheblich
beeinträchtigen.
Literatur/irodalom
1) Die Entwicklungsgeschichte der Erde, Leipzig, 1970, 2 Bd.e,
Formationstabelle
2) Udvarhelyi, Károly (Hrsg.), Magyarország természeti és gazdasági
földrajza, Budapest, 1968, S. 17
3) Wagenhoffer, Vilmos, A Tarjáni-medence és környéke, Manuskript/kézirat
(5 S/o. Text/szöveg + 5 S/o. Abb./ábra), ohne Jahreszahl/évszám nélkül, mit
weiteren Literatur-Angaben (s. u.)
4) Vígh, Gyula, Adatok a Gerecse-hegység nyugati részének földtani
ismeretéhez, in: Földtani Intézet évi Jelentései 1925-1928-as évekrõl,
Budapest, 1935, S. 95
5) Láng, Sándor, A Gerecse perembegysegi részeinek geomorfológiája, in:
Földrajzi értesítõ, 1956, Heft 3, S. 177-182
6) Hajósy, Ferenc, Magyarország csapadékviszonyai, 1900-1940, Budapest,
1953, S. 86-89 und 182-183
7) Fekete, G. und Járai-Komlódi, M., Die Schuttabhangwälder der Gerecseund Bakonygebirge, Annales Universitates Scienciarum Budapestensis ....
Sectio Biologica, Budapest. 1962, S. 118
64
Deutung der deutschen Familiennamen von
Tarian
Die Interpretation ungarndeutscher Familiennamen
wurde bisher so gut wie außer acht gelassen. Mit dieser
Abhandlung soll ein Impuls zur weiteren Erforschung
dieses wichtigen Indentifikationsmittels mit unserer
Herkunft gegeben werden. Die Namen liefern als relativ
altes Sprachmaterial wertvolle – geschichtliche und
sprachliche – Erkenntnisse. Seit Jacob Grimm (1785 –
1863) werden die Namen aus älteren Sprachzuständen
abgeleitet.
Im deutschen Sprachraum gab es bis zum 12. Jh. nur
Vornamen. Der Übergang zu erblichen Familiennamen
wurde wegen der Ausweitung der Handelsbeziehungen
und des Anwachsens der Städte notwendig. Die
Rechtsgeschäfte erforderten eine genaue Unterscheidung von Personen, was bei den vorher üblichen Voroder Taufnamen nicht möglich war. In Italien erfolgte
dieser Übergang schon im 8./9. Jh.
Um 1200 setzten sich – im deutschen Sprachgebiet –
die bürgerlichen Namen zu 78% aus Herkunftsnamen
[HN] (wie Koblenz, Speyer, Straubinger usw.), zu 20 %
aus Ruf- oder Vornamen [VN] (wie Martin, Thoma,
Philips, Reiner, Endres usw.) und zu 2% aus
Übernamen [ÜN], die nach geistigen und körperlichen
Merkmalen gebildet wurden, (wie Klein, Großmann,
Sauer, Eberhardt, Eichhardt, Frech, Hartmann, Stark
usw.) zusammen. Ab 1300 kamen die Berufsnamen
[BN] (wie Müller, Schneider, Schmidt, Tressel usw.) und
Wohnstättennamen [WN] (wie Bachmann, Berg,
Ortmann, Rosner usw.) in Mode. Während die Berufs65
und Übernamen bis zum Jahr 1500 auf 20 bzw. 30%
anstiegen, sank der Anteil der Herkunftsnamen in drei
Jahrhunderten auf 30 % ab. Ferner gibt es noch örtliche
Namen [ÖN], die auf lokale – örtliche – Namen
hinweisen (wie Antretter, Auer, Hollenberger, Stegmaier
u. a.)
Adam (VN): Beliebter biblischer Vorname (hebräisch =
Mensch aus Erde)
Aichele*: Deutet auf eine Wohnstätte in den Eichen hin.
Ampelner*: Hersteller von Lampen und Gefäßen aus
Zinn.
Andorfer (ON): Der Vorfahre der Andorfer stammt aus
Andorf, einem Dorf in Oberösterreich (unweit von
Passau). Heute häufig in S-Deutschland (BadenWürttemberg, besonders in Niederbayern)
Antretter (ÖN): Antrat, Antritt sind Höfe in Tirol; trat, tret
= Weidetrift; Höfe mit Weidewechselwirtschaft. Kommt
heute in Leverkusen, Köln, Lippstadt u. a. vor.
Aubele, Aubeli(n) (VN): alemannisch-schwbäbisch für
den männlichen VN
Albrecht (der an Adel Glänzende). Heute häufig in
Oberschwaben, Baden-Württemberg u. a.
Auer* (ÖN): Von der Wohnstätte in einem flachen
Wiesengelände (= die Au, Aue); als FN oft in München,
Mainz, Würzburg, Baden-Württem-berg.
Babuschek (slawisch): Großmütterchen, altes Frauchen
Bachmann (WN). Nach der Wohnstätte am Bach, einer,
der am Bach wohnt.
Barthold*: germanischer Personenname (~ Bartheld,
Bartels)
Baudendistel: Berufsname in Satzform („Bau den
Distel“), Distelanbauer: Ein Bauer, der viele Disteln in
66
seinem Acker hatte? Heute in Baden-Württemberg
(Achern und Renchen).
Bauer (BN): Ähnlich wie Schmidt usw. deutet dieser
Name auf den Beruf seines ursprünglichen Trägers hin.
Baumgartner [WN]: An Obst- oder Baumgarten wohnend, auch Besitzer von solchen (Obstgärtner)
Behringer, Beringer (ON): Einer, der aus Behringen
oder Böhringen/Württemberg stammt.
Beigelbeck, Beiglbeck (BN): Bäcker, der sich auf das
Backen von Beigeln (Mohn-, Nußrollen) spezialisiert
hat. Heute in München und Umgebung, BadenWürttemberg (Geislingen, Backnang)
Benesch (VN): Tschechisch für den männlichen
Vornamen Benedikt (= lat. der Gesegnete) Benisch
Benisch (VN) = Benesch, beliebte KF von Benedikt mit
slaw. Suffix.
Berend*, Berendi ist vom VN Bernd, Bernhard,
Behrendt abzuleiten. In den Kanzleien könnte das t mit
einem i verwechselt worden sein, so dass aus dem
Vomamen Behrendt ein scheinbar ungarischer
Familienname Berendi entstand (> Aufzeichnungen in
den Tarianer Kirchenbüchern: 1767 und 1768 wurden
dem Ehepaar Georg und Anna Berend die Söhne
Joseph und Johann geboren; > Namensliste der ersten
deutschen Siedler in Tarian). Vielleicht steckt auch eine
absichtliche Magyarisierung dahinter. Heute häufig in
SW-Deutschland (Trier, Saarburg, Mettlach, Saarbrücken, Mainz), aber auch in Hamburg, Berlin,
München, Duisburg.
Berger (ÖN): Nach der Wohnstätte am Berge, am Berg
Wohnender; eventuell auch Bergmann, Grubenarbeiter
(> Hornyák, Huj)
67
Bernwallner (ÖN): Bern = Bären, Wallner = Waldner >
der aus dem Bärenwald. Heute in Rottenburg, Freiburg
i. Br., Pocking.
Blaschek (VN): slawische Form von Blasius (zu
Blazek)[ung. Balázs]
Braun* (ÜN): Familienname, der sich auf die Augen-,
Haar- oder Bartfarbe des Trägers bezieht.
Bruder*:
Aus
vertrauter
Anrede
entstandener
Familienname ( Pratz).
Brunner (ON): obd. zu den vielen ON Brunn (Brünn) in
Bayern und Tirol; eventuell am Brunnen wohnend oder
Brunnengräber, -mann. Heute anzutreffen in Franken
und im übrigen Süd-Deutschland.
Brunnthaler, Bruntaller*: (ÖN) Einer im einen Tal mit
Brunnen Wohnender. Mit -th geschrieben kommt er v.
a. in Alt-Bayern vor.
Bundschuh (ÜN): Schnürschuh der Bauern im
Mittelalter; beim Bauernaufstand 1525 Feldzeichen der
Aufständischen; Schnürschuhträger oder aufrührerischer Mensch(?). Heute v. a. in N-Baden und im
übrigen Baden-Württemberg weitverbreitet.
Ciwis, Civiß: Könnte vom lat. Wort Civis = Bürger
kommen, aber wahrscheinlicher ist die Herkunft von
Zerbiß, Zerfaß, Zervas, Zirfaß = Servaes, Servatius.
Demnach wäre Civiß eine Koseforrn des Vornamens
Servatius. Heute in Leverkusen, Krefeld u. a.
Czerny (slawisch): ÜN »Schwarz«, d. h. ein Mensch mit
dunklen Haaren
Dantmann (BN): Tandler, Trödler mit getragener Kleidung handelnd. Heute in Oberbayern anzutreffen.
Deberling (BN): Vermutlich von Däbeler, Däbel
(Mecklenburg) = mnd. dobeler »Würfelspieler,
Würfeldrechsler.
Heute
in
Baden-Württemberg
68
(Heidenheim, Weil der Stadt, Ditzingen u. a.)
vorkommend.
Denner (zu Tanne): Bewohner einer mit Tannen
bestandenen Gegend (Flurname) oder vom ON
T(h)ann (~ Don Stuhldon*). In ganz Deutschland
weitverbreitet.
Dietschi*/ Dietsche: Bedeutete ursprünglich Kloster-,
Kirche- in Verbindung mit Schuler (= Schüler) »Kloster-,
Kirchenschüler,
angehender
Kleriker,
Student,
Scholar«. Oft anzutreffen in Mönchengladbach und
Umgebung.
Ebert*: VN Eberhart
Eberhardt (VN): Nach dem mhd.Vornamen Eberhard =
stark wie mhd.Vornamen Eberhard (= stark wie ein
Eber). Heute in Dortmund, Düsseldorf, Hannover,
Nürnberg, Stuttgart, München, Würzburg, Bruchsal.
Eichardt, Eichhardt (ÜN): Hart wie die Eiche, ein
starker, ausdauernder Mensch. In Berlin, Erfurt,
Münster, Schwerin, Ludwigshafen, Kandel u. a.
Eigner: Besitzer eines Eigengutes im Gegensatz zum
Erblehen; in Tirol auch oft Hofname. In ganz
Deutschland weitverbreitet.
Eipl, Eybel, Eibl (ON): Bewohner eines Hauses am
Eibengehölz (Flurnamen). Heute vor allem in ODeutschland und Berlin sowie in Dortmund
vorkommend.
Eiser*: Eisenmann, -händler
Ellbacher*: Einer am Ellbach Wohnender (Bach in
Saarlouis/Saarland)
Elser: ON Elsen, Elsa; ÖN Els = Erle
Endres (VN): obd. Formen für Anders, Andres =
Andreas (= der Männliche oder der Nacheifernde).
Heute in Bayern (Würzburg), Baden-Württemberg,
Saarland; Kassel.
69
Erbeskorn (BN): Erbsenhändler; zusammengesetz aus
Erbes (mundartl. Erwes = Erbse) und Korn (BN für
Getreidehändler).
Feil, Fail, Feiler (BN): Feilenhersteller, -schmied. In
ganz Deutschland weitverbreitet.
Fernekäs, Fernekeß (BN): »fem, firn« = Vojährig, alt,
abgelagert (Schnee, Wein), Bauer, der reifen Käse
herstellte. In der Pfalz (Worms, Mainz, u. a.) und im
Saarland anzutreffen.
Filips (VN): Kommt von dem männlichen VN Philipp und
bedeutet Sohn des Philipp = Philipps (gr.
Pferdefreund). Der erste Filips kam 1883 aus
Samed/Szomód nach Tarian. 1923 wurde der Name in
Fülöp magyarisiert. Andere Filips mußten in den 30er
Jahren ihren Namen in Felhõs ändern lassen. Heute
kommt er in Hannover, Hamburg, Dortmund, Karlsruhe
und Mannheim vor.
Fischer (BN): Familienname, dessen ursprünghche
Träger Fischer von Beruf waren.
Fleckenstein* (ÖN): Burg in den Vogesen im NordElsaß/Frankreich. Heute in S-Hesen, Odendwald,
Spessart, N-Pfalz anzutreffen.
Fleischhacker (BN): Bezeichnung für den Metzger oder
Fleischhauer. In ganz Deutschland weitverbreitet.
Frech (ÜN): Vom mhd. »vrech« (= kühn, keck,
verwegen, lebhaft) abgeleiteter Eigenschaftsname. In
Südwest-Deutschland u. a.
Frey: der Freie im Gegensatz zum Hörigen (Unfreien). In
ganz Deutschland weitverbreitet.
Fuchs: Teils schlau wie ein Fuchs, teils »rothaarig«, teils
Hausname: In Süddeutschland ist es heute noch üblich,
dass bestimmte Häuser am Giebel mit Tier- oder sonstigen Figuren geschmückt werden (wie Hirsch,
70
Ochs,Storch, Fuchs). In ganz Deutschland weitverbreitet.
Gi(e)gler: von Giegel = Narr. Mit -i- und -ie- geschrieben
in ganz Deutschland weitverbreitet.
Glas (BN): Glasmann, -händler
Goldschmidt (BN): Goldschmied
Glück: ÜN zu mhd. 'g(e)lücke' Glück, Geschick, Zufall;
Geschickter Mensch
Götz (VN): Koseform zu dem männlichen Vornamen
Gottfried. Weitverbreitet in ganz Deutschland.
Grob (ÜN): leitet sich von grob, derb ab. Vermutlich
kommt der später auftauchende Familienname Grof
auch von Grob, da das b im Volksmund oft als w
gesprochen wird, so dass aus Grob > Grow > Grof
wurde. Der erste Grob wanderte 1733 ins Nach-bardorf
– Tolnau – ein. Die Grofs kamen im 20. Jh. von dort
nach Tarian. Anzutreffen in Bochum, Bottrop, Essen,
Herne, Solingen, Mannheim, Konstanz.
Grof, Graf: Aufsichtsbeamter mit Gerichtbefugnissen,
Verwaltungs-beamter,Vogt, Aufseher, mitunter auch
nur im Dienste eines Grafen Stehender (> Grob). Heute
anzutreffen in Kaiserslautern, Bad Kreuznach,
Esslingen, Sigmaringen, Mannheim, München, Hannover, Düsseldorf und Berlin.
Gröschl = obd. Groschen, Gold- oder Silbermünze;
inderekter Berufsname: Jemand, der mit Geldeinnehmen zutun hat. Mit -el geschrieben heute
anzutreffen in Erlangen, München, Regensburg,
Nürnberg, Karlsruhe und Hamburg.
Grossmann (ÜN): Ein großer Mensch war Träger dieses
Namens. In ganz Deutschland weitverbreitet.
Gruber*: Meint den in einer Grube Wohnenden (z. B.
Lehmgrube)
71
Hadl*, Hadel: obd. Hettel = Geiß, Ziege; Ziegenhalter, händler
Hammer = ÜN von Schmied. Häufig in ganz Deutschland.
Handl: obd. Händler. In ganz Deutschland weitverbreitet,
besonders aber im S.
Hartdegen,
Hardegen
(ÜN):
ndd.
Herdegen,
Heerdegen; altdeutsch-fränkischer Personenname
(Thüringen, Franken); mhd. Degen = junger Held; nd.
Haudegen. In ganz Deutschland weitverbreitet.
Hartmann* (ÜN): -hard bedeutete ursprünglich »kühn«,
ein mutiger Mann. In ganz Deutschland weitverbreitet.
Hasenfratz (ÜN): In N-Deutschland bedeutet »fraatz«
Fresser, Vielfraß; daraus folgt: Hasenfresser, einer, der
viel Hasenfleisch aß. In der Schweiz und am Hochrhein
verbreitet. Von dort sollen auch die H. nach Werischwar
und von dort über Saar nach Tarian gekommen sein.
Heute noch in S-Schwarzwald häufig, aber auch
sonstwo anzutreffen.
Hau (obd.). Besitzer eines Hauses oder Holzschlages;
Hau ist ein Begriff aus der alten deutschen
Waldwirtschaft. Früher war der Gemeindewald in Haue
oder Holzschläge eingeteilt. Häufig in SÜDWESTDeutschland u. a.
Hege (zu Hag, Häge): Dornbusch, Hecke, Hag > am
Häge Wohnender. Oft in S-Deutschland anzutreffen.
Heidinger (ÖN): Vermutlich Bewohner einer Heide oder
eines Ortes in einer Heide. Häufig in Süd-Deutschland,
aber auch sonstwo.
Heilmann (VN): beliebte KF zu Heinrich. In ganz
Deutschland weitverbreitet.
Herr: (obd.) ,im Dienste eines Herrn stehend, daher
auch Bauernname‘. In ganz Deutschland weitverbreitet.
72
Heßler (ON): Herkunftsname zu den Ortsnamen Hasel,
Hesel, Heßlar, Heßler, Häßler (Thüringen, Franken,
Westfalen, Hessen). Heute in ganz Deutschland
weitverbreitet.
Hetzmann: ÜN zu 'hetzen, jagen' Wildtreiber, Jäger; KF
zu Herrmann
Hilpert*, Hilbert (VN): Althochdeut-scher PersonenName Hildebrecht (= im Kampfe glänzend). In ganz
Deutschland weitverbreitet.
Höbaus, Höbauß: Wahrscheinlich vom moselfränkischen »Baus« = Hügel Beule (Pausbacke = dicke
Backe); hö(ch) = hoch > hoher Hügel = auf einem
hohen Hügel Wohnender. Kommt in Deutschland nicht
mehr vor.
Hodapp, Hodab (ÜN): Hängt mit dem Begriff
»däppisch« zusammen. Häufig in N-Schwarzwald, aber
auch im übrigen Baden-Württemberg.
Hofmann, Hoffmann (BN): Früher Gutsverwalter an
herrschaftlichen Höfen (ähnlich Mayer), auch auf
Landgütern von Patriziern. Sehr häufig in ganz
Deutschland.
Hollenberger (ÖN): Nach der Wohnstätte am Hollenberg, d. h. auf einem Berg mit Holundersträuchern.
Denkbar wäre auch eine Herleitung von Hohl, Hohlweg.
In Großraum Würzburg v. a. anzutreffen.
Hornyak,
Hornack
(BN):
wendisch-tschechisch
»Berger« = Bergmann (?) > Huj. Beide Formen treten
in ganz Deutschland auf.
Höß*: ~ Heß; einer, der aus Hessen stammt.
Huber (BN): Bauer, Besitzer einer Hufe oder Hube
(Hofstätte mit ca. 10 ha Ackerland). Anzutreffen v. a. in
S-Deutschland.
Huj*, Huy (ÖN): 1) Der Huywald dem Harz im Norden
73
vorgelagerter, bewaldeter Höhenzug, Benediktiner
Kloster Huyburg auf der Höhen des Huywaldes; 2) Im
Saarland vorkommender Familienname – als Houy
geschrieben –, eventuell abzuleiten von frz. »houille« =
Steinkohle > BN Bergmann. 3) Stadt in Belgien (Huy)
südwestlich von Lüttich. 4) ÜN zu sorb. 'huj, wuj' Onkel,
Vetter, Oheim. Als Huy und Houy geschrieben häufig
im Saarland und im westlichen Deutschland; mit -j
geschrieben v. a. in Baden-Württemberg und Bayern.
Imelli (VN): Koseform zu dem männlichen Vorname
Immo. In ganz Deutschland nur viermal (Mainz, Aachen
u. a.) anzutreffen.
Imhoff*: nach der Wohnstätte »Im Hof«
Iseli* (BN): Vermutlich von Eisele abgeleitete Kurzform
von Eisenhändler. Kommt heute in Baden-Württemberg
vor (Weil der Stadt, Leonberg, Ettlingen u. a.).
Jelinek, Jellinek, Jelli (?) (ÜN): Slawisch »jelen« =
Hirsch > hirschähnliche Erscheinungsform oder Jäger.
Heute in Baden-Württemberg und Bayern u. a.
anzutreffen.
Kahn (BN) = Kahnschiffer, Bootsfahrer. In ganz
Deutschland weitverbreitet.
Kailbach, Keilbach (ÖN): Anscheinend ein am Bach
wohnender grober
(?) Kerl. Mit -ai- und -ei- geschrieben v. a. in N-Baden u.
a. vorkommend.
Kaindl (VN) = Kuenel, Koseform Kainradl = Konrad
(bedeutet: der weise Ratgeber). Vor allem in
Oberbayern anzutreffen.
Kaiser (ÜN): Familienname auch von Bauern, die
irgendetwas mit dem Kaiser zu tun hatten, sei es, dass sie nur bei ihm dienten.
Käsmann (BN): Käsehersteller, -verkäufer
74
Keller: Kellner, Kellermeister
Kienöfner (BN): Kien = harzreiches Kienholz (v. a.
Kiefer und Fichte), Öfner = Ofensetzer, -bauer Õ Kienofenbauer
Kirschner (BN) = Kürschner, d. h. Pelzverarbeiter,
Pelzer
Klausenberger (ÖN): Ein am Klausenberg Wohnender;
Klause = Einsiedelei (Der Hausname der Tarianer
Klausenberger war ,Beckermichl‘.) Zwei in ganz
Deutschland (Georgensmünd, Rednitzhembach).
Klein* (ÜN): Bezeichnung für kleinwüchsige Menschen.
Sehr häufig in ganz Deutschland.
Klinge(r) (ÖN): Häufig in S-Deutschland, Bewohner
eines Hauses an einer Gebirgsschlucht mit Bach. Sehr
häufig in ganz Deutschland.
Knopf : Kleiner, runder Kerl (ÜN) oder ein Knopfmacher
(BN). In ganz Deutschland weitverbreitet.
Koblenz (ON): Der erste Träger dieses Namens stammt
aus der Stadt Koblenz, wo die Mosel in den Rhein
mündet. Sehr häufig in ganz Deutschland.
Kölmel (BN): Alemannisch »Köhl« = Kohl. »Mel« geht
wahrscheinlich auf Mehl zurück und steht für
Mehlhändler, -verkäufer oder Müller. (Gibt aber mit
»köl« keinen Sinn!). Häufig in Baden-Württemberg
(Karlsruhe, Rastatt, Ettlingen, Offenburg, Schwarzwald).
Krall (zu slaw. kral, krol = König): einst im Dienste des
Königs stehender Mensch. Häufig in ganz Deutschland,
v. a. aber im N.
Kramer*: Krämer, Händler
Kranz (BN): Verkürzte Form des Berufsnamens
"Kranzbinder, -macher". Sehr häufig in ganz Deutschland.
Kraus (ÜN): obd. Krauskopf, -haar
75
Kuntz* Kunz: Koseform des altdeutschen Kaisernamens
Konrad (Kunrad)
Kupfer* (BN): Bezeichnung für den Kupferschmied. Hat
nichts mit dem »Koffer« (in den ua-Mundart »Kupfer«
zu tun!). Fast in ganz Deutschland, v. a. in München,
Nürnberg, Bamberg, Bad Homburg u. a.
Leber (BN): Wohl – von Leberwurst abgeleiteter – Übername des Fleischhackers,
Metzgers. Häufig in ganz Deutschland.
Leib = Laib: ÜN des Bäckers; mhd. »leip« = Brotlaib
oder ahd. »liob«=lieb. Sehr häufig in ganz Deutschland,
besonders aber im S.
Leininger (ON): nach den ON Leiningen b. Greiz,
Leiningen/Hunsrück, Leiningerhof (Dornham)
Leske (zu slaw. Les = Wald): Waldbewohner; sorb.
Leske= Haselnußstrauch; Vor allem im nördlichen
Deutschland anzutreffen.
Liebl (VN): obd. Koseform (Lieble, Lieblein) zu Liebhard
(= obd. Vorname). In ganz Bayern vorkommend.
Lunzer (ON): Stadtname – Lunz – in Nieder-Österreich.
Heute v. a. in S-Deutschland.
Meitner = Mäutner, Mautner: (bair.-österr.) MautEinnehmer, Zöllner
Martin (VN): Nach dem römischen Kriegsgott Mars = der
Krieger oder nach dem heiligen Martin. Familien mit
diesem Namen nannte man in Tarian auch Merx. Sehr
häufig in ganz Deutschland.
Marx (VN): Von dem männlichen Vornamen Markus,
Mark (= der Hammer) abgeleitet: Sohn des Marks (>
Merx).Sehr häufig in ganz Deutschland.
Matkovics, Matkovic: Von Matthias abgeleitet mit dem
südslawischen Suffix c.
Merx (VN) = Marx; abgeleitet von Marks. (> Martin).
Sehr häufig in ganz Deutschland, besonders im N.
76
Metlager: Einer, der Met (= gegorener Honigsaft) lagert.
Ursprünglich: Metlagerer.
Meyer, Mayer*, Maier, usw. (BN): vom Lateinischen
»major villae«, Verwalter, Pächter von Höfen; Bewirtschafter des Hauptgutshofs, Gutsverwalter, Aufseher
über das bäuerliche Abgabewesen, auch Erbpächter.
Mikonya: Vermutlich slawischer Herkunft. Es könnte
etwas mit Pferd zu tun haben. (Kónya = Stadt in der
Türkei). Kommt in Deutschland heute nur in Mühlacker
und Görlitz vor.
Monz, Manz (VN): Koseform von dem männlichen
Vornamen Mangold. Sehr häufig v. a. in SüdwestDeutschland (Saarland u. a.).
Müller (BN): Meint den Mühlenbesitzer oder den in der
Mühle Tätigen.
Nagel, Nagl: ÜN des Nagelschmiedes
Neubauer(BN): Ähnlich wie Bauer deutet dieser Name
auf den ausgeübten Beruf hin. (Gegensatz zu
Altbauer). Sehr häufig in ganz Deutschland.
Niederecker = Ecker, Eck, nach der Wohnstätte an der
unteren, niederen Ecke, an der Ecke wohnend; in Tirol:
Egger, Egg = Eck. Heute im Großraum München
anzutreffen. (Einer davon stammt auch aus Tarian.)
Niedermann = der niederwärts – weiter unten –
Wohnende
Niesner, Nießner (VN): Von Nieß, Niesel, Nißle
Koseform von Dionys; ON Niesen. Sehr häufig in ganz
Deutschland v. a. im Süden.
Oppenauer (ON): Von dem Ort Oppenau im Schwarzwald (östlich von Offenburg)
Ort(h)mann: Der am Ort, am Ende des Dorfes, der
Straße Wohnhafte. Sehr häufig in ganz Deutschland.
77
Palatin (lat.): Hügel in Rom; frühere Bezeichnung des
Pfalzgrafen (Besitzer einer Burg oder Palastes). Heute
im nördlichen Baden-Württemberg anzutreffen.
Papp: (Bay., Tirol), schwäb. Bapp; mhd. pap = Kinderbrei. Sehr häufig in ganz Deutschland.
Pertl (VN): Bertel, Koseform zu Bertold (mhd. »der
glänzend Waltende«). Sehr häufig in Oberbayern.
Pilsinger(ON): ON Pilsing in Bayern
Pinter*: Meint den Fassbinder, obd. Pinder, Pinther.
Plett (ON od. BN): Nach den Orten Plettau, Plettenberg;
häufig in Hamburg; Plätte = landschaftlich Bügeleisen,
Plätterin = Bügelfrau; Platt = Hochläche; bair.-östr.
Plätte = flaches Holzboot oder Schiff. Sehr oft im
nördlichen Deutschland anzutreffen, aber auch im S.
Pokorny (ÜN): Tschechisch-polnisch „untertänig, demütig“, ein dienerhafter Mensch. Sehr häufig in ganz
Deutschland.
Porst (ÜN): obd. Familienname, der sich von mhd.
»borst« = Borste ableitet; ein borstiger, unangenehmer
Mensch. Sehr häufig in ganz Deutschland.
Pratz (ÜN): Von Brat (slaw. »Bruder«; > Bruder);
Angeber, Muskelprotz. Oft im nördlichen Baden-Württemberg, aber auch in Bayern u. a.
Prech: Vermutlich eine Abkürzung des Holzhandwerker-Berufs, der Hanf- und Flachsbrechen (uaMundart: Prechln) herstellte. Es könnte aber auch die
Koseform von Albrecht Brecht oder Precht dahinter
stecken. Als Prech geschrieben kommt der Name in
geringer Zahl in Baden-Württemberg und Saarland vor.
Mit B geschrieben ist er sehr häufig in ganz Deutschland von N bis S, v. a. aber im westlichen Teil.
Puchler: Puchel, Püchl, Püchler = obd. Büchler > am
Buchenwäldchen Wohnender. In ganz Deutschland, v.
a. aber im S.
78
Reich*: Meint einen reichen Menschen.
Reiner (VN): Nach dem männlichen Vornamen Rainer,
Koseform von Reinhard oder Reinhold; Reinher war ein
beliebter Personenname. In ganz Deutschland, v. a.
aber in Bayern und Baden-Württemberg anzutreffen.
Reinhardt (VN): Männlicher Vorname – abgeleitet vom
germanischen Ragin-, Regin-hard, was »im Rate kühn«
bedeutet. (= Ein mutiger, starker Mensch). Sehr häufig
in ganz Deutschland, v. a. aber im N.
Reiser (oft in Bayern und Baden-Württemberg): Von
Reisig, Reisicht, Gesträuch; Beiname der Familien
Salzinger
Reismüller (ÖN): Besitzer einer Mühle im Reisig, im
Gehölz. In Baden-Württemberg und Bayern u. a.
anzutreffen.
Riemelli* (BN): alemannische Verkleinerungsform von
Riemen = Riemenschneider > ÜN des Schusters.
Heute ausgestorben.
Ries = Sumpfort (ris), feuchte Stelle im Wald; Riese =
großer Mensch, ÖN Ries, Rieß. In ganz Deutschland
vorhanden.
Riesing : Rieser (schweizerisch) alemanische Form von
Reiser; zum örtlichen Namen Ries: Reisig, Reisicht,
Gesträuch; Ortsname Ries bei Passau. Heute in ODeutschland (Chemnitz, Halle u. a.) anzutreffen.
Ritschmann (VN), auch Rutschmann, Rütschmann,
obd. Koseform zu Rudolf; ebenso: Rietsch aus Rütsch
KF zu Rüdiger bzw. Rudolf; Kommt heute in NordBaden vor.
Roland: Paladin Karls des Gr. > VN Roland – germ.
Form (H)rodnand = ruhmvoll und kühn. Sehr häufig in
ganz Deutschland.
Rosner (ON): Bezeichnet die Herkunft von Rosenau
(Schlesien, Böhmen, Mähren). Es wäre auch denkbar,
79
dass ein Rosenzüchter gemeint ist. Sehr häufig in ganz
Deutschland.
Rossmann* (BN): Roßhändler, -bauer. Sehr häufig in
ganz Deutschland.
Ruppert (VN): KF zu Rupprecht (ruhmglänzend)
Ruth*: Biblischer, weiblicher Vorname
Sahm, Sam: (Ostpreußen) slaw. Personenname Samo
oder Samtweber > Samweber (Hat nichts mit dem ung.
Wort »szám« = Zahl, Nummer zu tun!); Kommt heute in
Bad Homburg, Frankfurt a. M., Mainz u. a. vor.
Salzinger (BN): Salzsieder, -händler; Heute in BadenWürttemberg und Bayern verbreitet.
Samweber (BN): Sam(me)tweber oder Samthändler;
Kommt in Ost-Bayern vor.
Santner (ÖN): Nach einer Wohnstätte auf sandigem
Gelände; eventuell auch Sandfuhrmann, Sandgrubenbetreiber (> Sentner); Häufig in München.
Sauer (ÜN): Ein böser, grimmiger Mensch; Anzutreffen
in Bonn, Ruhrgebiet, Frankfurt a. M., Heidelberg,
Hannover, Berlin.
Schäffer*, Scheffer* (BN): Schäfer, Schafhirt, -halter
Schalkhammer (ÜN): Schalk = Leibeigener, Knecht,
Mensch in dienender Stellung, später auch von
knechtischer Gesinnung, böser, loser Mensch; Hammer
= ÜN von Schmied. Daraus folgt, dass Schalkhammer
ein leibeigener Schmied oder Schmiedeknecht war. Ist
heute nur zweimal anzutreffen (so in Wolfratshausen).
Schaller* (ÜN): mhd. Prahler, Angeber, Aufschneider.
Sehr häufig in ganz Deutschland.
Schatz (BN): Jemand, der es mit Geld- oder sonstigen
Schätzen zu tun hat, Schatzmeister. Sehr häufig in
ganz Deutschland.
80
Scheirich (zu Scheuer, Scheune): ein in der Scheuer
beschäftiger Mensch. Heute v. a. in Baden-Württemberg und Bayern vorkommend.
Schenk (BN): mhd. »schenke« = einschenkender Diener; später auch Hofamt (Mundschenk). Sehr häufig in
ganz Deutschland.
Scherlein (BN): von obd.-bair. Scherl = Schere; ÜN des
Scherenschleifers bzw. Scherers (Tuch-, Gewand- oder
Bartscherers); Kommt heute in Mittelfranken vor.
Schindler (BN): Oberdeutsch-schlesisch der Hersteller
hölzerner Dachschindel. Im Mittelalter waren Privathäuser fast nur mit Schindeln gedeckt. Sehr häufig in
ganz Deutschland.
Schlägel, Schlegl (BN) = obd. Werkzeug zum
Schlagen, vielleicht Schlächter.
Schleicher*: Ein leise gehender, schleichender Mensch.
Schmölz (BN): kommt von Schmalz, d. h. Schmalzhändler. Kommt heute in Oberschwaben (Füssen, Isny
u. a.) und im übrigen Süd-Deutschland vor.
Schneider* (BN): Berufsbezeichnung. Sehr häufig in
ganz Deutschland.
Schreck*, Schröck*(bayerisch): Einer, der anderen
Angst macht, einen Schrecken einjagt.
Schütt = obd. Schütz(e): Meint im allgemeinen den
Feldschütz, Flurschütz oder Feldhüter, aber auch den
Schützen (= Schießender).
Schwarzinger (BN): Meint wohl den Schwärzer, d. h.
den Tuchfärber. Der erste Träger dieses Namens kam
in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts aus
Österreich (Schw. Michael, * in Simonsfeld/NÖ.) nach
Tarian. Er war Schmied und k. & k. Pferdearzt i. R. und
ließ sich hier als Kuhschmied nieder. Daher der
Beiname der Schwarzingers »Kuischmidt«. Heute in
81
Baden-Württemberg, Bayern und Ruhrgebiet anzutreffen.
Schweizer: ein aus der Schweiz stammender Mensch
Seiler (BN): Hersteller von Seilen, Stricken, Schnüren,
Kordeln
Seipel*: KF zu Seipolt, Seibold; häufig in Oberschwaben, Bayern
Sentner (ÖN): Ähnlich wie Santner von Sand (Sänd)
abzuleiten (> Santner). Anzutreffen in BadenWürttemberg, Bayern, aber auch in N- und WDeutschland.
Simonek, Schimonek (VN): slawisch-polnische Form
von Simon (=Erhörung). Mit Si- geschrieben im
westlichen Deutschland von Norden bis Süden; mit
Schi- geschrieben in Hamburg und Pinneberg.
Singer (ON oder BN): Nach der Stadt Singen westlich
des Bodensees oder nach Sänger, Kantor, Musiker.
Sehr häufig in ganz Deutschland.
Skóza: Slawischer Name, dessen Bedeutung nicht
geklärt werden konnte. Kommt in ganz Deutschland nur
einmal vor (Grevenbroich).
Sommer = Jahreszeitenname, der mit der beruflichen
Tätigkeit im Sommer zu tun hat. Sehr häufig in ganz
Deutschland, besonders aber im N.
Speidler*: Speiel, Speil (obd.), Spail (ua-Mundart) =
Holzsplitter, -keil, übertrieben: Grobian.
Speier (ON): Dieser Familienname hat seinen Ursprung
in der Stadt Speyer am Rhein. Sehr häufig in ganz
Deutschland.
Springinseis (BN): Satzname, der besagt: »Spring ins
Eisengeschäft!«, d. h. Eisenhändler oder -bearbeiter. In
Deutschland ausgestorben.
82
Stegmaier (ÖN): An einem Steg ( = schmaler Fußweg)
oder Brücke wohnender Maier. = Stegmar ( > Meyer).
Besonders häufig in Baden-Württemberg.
Stein, Steiner (ON): Kommt von den häufigen
Ortsnamen Stein, Steine,
Steinau usw. Sehr häufig in ganz Deutschland.
Stemmberger*: Flurname Stämmberg, d. h. Berg mit
Bäumen (Holzstämmen)
Stockbauer (ÖN): An einer geredeten Waldstelle (mit
Baumstümpfen) wohnender Bauer. Heute sehr häufig in Bayern, aber auch
in Baden-Württemberg.
Straubinger (ON): Ist auf die Stadt Straubing in
Niederbayern zurückzuführen. Häufig in Bayern.
Strehli / Streli (ON): Ostdeutsch-slawischer Ortsname
Strehla/Elbe in Sachsen; Strehlen/Schlesien. Mit -i kein
einziger in Deutschland, aber sehr viele als Strehl und
Strehle.
Struphart / Struphaar: Aus Strupp und Hardt zusammengesetzter Name. Strupp = struppig, stachlig,
»graunpert«; Hardt = Hirte (von herde, harde). Also ein
Hirte mit zerzaustem Haar.
Stuldon*, Stuhldon: Zusammengesetzter Name aus
Stuhl + Don, d. h. Stuhlhersteller (= Tischler, Schreiner), der Tannenholz (Don, Thon) verarbeitete. Kommt
heute in dieser Kombination nicht mehr vor, aber es
gibt in Deutschland viele, die Stuhl oder Don, Ton,
Thon heißen.
Thoma, Toma (VN): Ist eine Form von Thomas (= hebr.
Zwilling, Patron der Bau- und Zimmerleute). Häufig in
S-Deutschland, aber auch sonst weitverbreitet.
Tietschi > Dietschi
Tobik (VN) = Tobias (hebr. Gütig ist Gott) mit der
slawischen Endung -k (Aus Tolnau heirateten mehrere
83
Tobik-Mädchen nach Tarian.). Bis auf einen ist die FN
in Deutschland nicht anzutreffen.
Tontsch*: männlicher Vorname, der auf Antonius, Anton
zurückzuführen ist. Von diesem FN gibt es heute noch
sehr viele in ganz Deutschland.
Tressel (BN): Leitet sich vom Drechsler über Drechsel
Drexl(er), Dressel, Dressler, Dres(e)l, Tres(e)l ab. In
Oberfranken kommt dieser Name heute noch oft vor.
Früher gab es Holz-, Knochen-(Bein-), Elfenbein- und
Bernsteindrechsler. In Tarian sagt man Tresl, schreibt
aber seit den 30er Jahren – madjarisierend – Treszl. In
allen Schreibvarianten v. a. in S-Deutschland häufig
anzutreffen. Mit -ssel v. a. im SÜDWEST in der
weiteren Umgebung von Trier + West-Pfalz, Saarland,
aber auch in Nürnberg, Augsburg, Tübingen, Berlin u.
a. Mit -ssl, -ßl in Winnenden, Bergelen, Immenstadt
usw.
Utto ist mit dem VN Otto gleichzusetzen. (= der
Besitzende). In München und Umgebung gibt es davon
heute vier; einen gibt es in Giengen, dessen Träger aus
Tarian stammt.
Vetter: Mittelhochdeutsch = Vaters Bruder, Vetter. Sehr
häufig in ganz Deutschland.
Vogel, Vogl, Fogl (ÜN) bedeutet soviel wie Vogelfänger.
Sehr häufig in ganz Deutschland.
Walter* > Wolter
Walz (VN): obd. KF zu Walt(h)er ( > Wolter). Sehr häufig
in ganz Deutschland.
We(h)rli / Werle (VN): Auch Wehrle alem. Koseform zu
Werner; Werli (Werlin) Wernher. Heutige Verbreitung:
Hamburg, Braunschweig, Baden-Württemberg und
West-Deutschland.
Weiler (ON): Ursprünglich Bewohner einer kleinen
Siedlung von der Größe einer ungarischen Pußta (3 bis
84
15 Häuser). In Süd- und Südwest-Deutschland weitverbreiteter Ortsname. Ähnlich wie Filips wurde auch
Weiler magyarisiert (1923) in Vértes. Sehr häufig in
ganz Deutschland.
Weiß (ÜN), damit ist wohl ein Mensch gemeint, der
blondes Haar hatte, zur Unterscheidung von
schwarzem Haar. Sehr häufig in ganz Deutschland.
Weißgerber (mhd. wißgerwer): Der das Leder weißgar
macht, mit Alaun gerbt. Sehr häufig in ganz
Deutschland.
Weißwasser (ON): Nach einer Wohnstätte am weißen –
schäumenden – Wasser oder nach der Ortschaft
Weißwasser in Sachsen. Heute ausgestorben in
Deutschland.
Wicha: Vermutlich slawisch »hoch, groß« > ein großer
Mensch. Von N bis S häufig anzutreffen.
Windisch (= Wendisch): der Wende oder Sorbe
(Wenden: eine slawische Volksgruppe in der Lausitz).
Sehr häufig in ganz Deutschland.
Witek, Vitek (VN): Koseform zum slawischen
Personennamen Wito-slaw; Vor allem in N-Deutschland
häufig, aber auch in S nicht selten.
Wittmer*: ON bei Wolfenbüttel
Wolter (VN): KF zu Walt(h)er (> Walz). Besonders in NDeutschland verbreitet.
Diese Interpretationen der Familiennamen lassen nur
schwer genaue Rückschlüsse auf die Herkunft der
Träger zu,da schon vor der Auswanderung nach Ungarn
eine starke Durchmischung stattfand.
Abkürzungen: KF= Koseform, ON = Ortsname, ÖN =
örtlicher Name, VN = Vorname, ÜN = Übername; ahd.=
althochdeutsch (800–1000 n. Chr.); mhd = mittelhochdeutsch
(1000–1500
n.
Chr.);
nhd.=
85
neuhochdeutsch (ab 1500 n. Chr.); obd.= oberdeutsch
(Sprachraum südl. der Mainlinie).
* Namen mit * bezeichnen die ersten deutschen Siedler
in Tarian Mitte des 18. Jahrhunderts. > Namensliste der
ersten deutschen Siedler.
Literatur: Hans Bahlow, Deutsches Narnenslexikon, 576 S., Bindlach, 1990;
Werner König, dtv-Atlas zur deutschen Sprache, 248 S., 5. Auflage, 1983;
Naumann , Horst, Das große Buch der Familiennanmen, Falken Verlag,1996
Von der Geburt bis zum Kindergarten
Wie aus der Geburten-Statistik des Dorfes zu ersehen
ist, gab es – wegen der fehlenden Geburtenkontrolle –
bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts – v. a. bei den
ärmeren Leuten – reichlich Nachwuchs. Reiche Bauern
– Deutsche und Ungarn – hatten in der Regel weniger
Kinder, um ihren Besitz nicht zu zersplittern. D. h. ihnen
muß schon eine Art Verhütung oder Abtreibung bekannt
gewesen sein.
Die Schwangerschaft – im Volksmund »In-anderenUmständen-sein« genannt – war mehr oder weniger
dem Zufall überlassen. So kam es oft vor, dass auch
ältere Frauen noch Kinder zur Welt gebracht haben.
Eine medizinische Betreuung der Schwangeren war so
gut wie unbekannt. Wegen der schweren körperlichen
Arbeit, die Frauen auch während der Schwangerschaft in
Haus und Feld verrichteten, gab es sicher manche
Fehlgeburten. Ebenfalls hoch war – wegen der
fehlenden Hygiene und nachgeburtlichen medizinischen
Betreuung – die Säuglings- und Kleinkinder-Sterblichkeit.
Die Geburt erfolgte so gut wie immer in den beengten
räumlichen Verhältnissen der häuslichen Wohnung. Nur
die Hebamme und einige erfahrene ältere Frauen waren
86
dabei. Heißes Wasser und saubere Leintücher waren die
einzigen hygienischen Hilfsmittel. Traten bei der Geburt
Komplikationen auf, wie Steißlage oder war ein
Kaiserschnitt notwendig, versuchte man die Gebärende
noch mit dem Pferdewagen ins Spital oder zum Arzt zu
bringen. Nicht selten starben dabei Mutter und Kind…
Jede Familie hatte eine Patenfamilie. Sie übernahmen
gegenseitig die Tauf- und Firmpatenschaft aller ihrer
Kinder. Das vererbte sich über mehrere Generationen.
Die Patenschaft wurde in der Regel von der Mutterseite
weitergepflegt. War die Mutter von auswärts, kamen die
Pateneltern des Vaters, bzw. deren
Kinder in Frage. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg kam
es zu einer Auflockerung dieser Tradition. Die Patin
nannte man Godl (Kautl), den Paten Göd (Keit).
Etwa vier Wochen vor der Geburt eines Kindes
besuchten die Eltern die Godl, um sie zu bitten, die
Patenschaft zu übernehmen. Das bezeichnete man als
»Anreden«. Nach der Geburt kam die Hebamme (Heifammin) noch eine Woche zu der Wöchnerin, um das
Neugeborene zu baden und um sie in Sachen Hygiene
zu beraten. Die junge Mutter blieb im Winter etwa eine
Woche im Bett, im Sommer nur drei Tage! Es war
87
Tradition, dass im Wochenbett die Mutter von der Patin
versorgt wurde. Sie brachte das daheim gekochte
Mittagessen (Suppe, Fleisch und Kuchen) in einem
besonderen Essgeschirr – dem sog. Goudlhäifa – mit.
Im Gegensatz zu heute taufte man die Neugeborenen
schon 2-3 Tage nach der Geburt, damit es im Falle eines
frühen Todes – ungetauft – als Heide in die Hölle kommt.
Die Anmeldung des Kindes im Pfarramt und im Rathaus
nahm die Hebamme vor. In der Regel war die Taufe am
Sonntagnachmittag nach der Litanei (Segen). Dem
Täufling wurde ein weißes Kleid angezogen, auch das
Kissen (Polster) war weiß. Die Godl brachte als Geschenk noch ein weißes Tuch mit, mit dem das Kind
zusätzlich zugedeckt wurde. Das Kind wurde nur von der
Patin und der Hebamme in die Kirche getragen. Beim
Verlassen des Hauses sagte die Godl: »Den Heid tragen
wir raus, den Christ bringen wir nach Haus.«
Am Abend des Tauftages feierten die Eltern und die
Paten ein wenig. Zum Abendessen gab es Hühnersuppe, gekochtes Fleisch mit Tomaten- (Paradeis-) oder
Meerrettich- (Krein-) Soße und Gebäck (Pocherei).
Die Erstgeborenen bekamen meistens den Vornamen
der Eltern, die Nachgeborenen den der Paten- oder
Großeltern. In der Ansiedlungszeit gab es noch die Vornamen Heinrich, Konrad, Philipp, Bartholomäus, Joachim. Später kamen immer mehr Johann, Josef,
Michael, Georg, Franz, Anton u. a. auf (> Namenslisten).
Bei den Mädchen und Frauen gab es anfangs noch
Dorothea, Angela, Viktoria und Ottilia, diese wurden
dann abgelöst durch Maria, Anna, Theresia, Franziska,
Barbara u. a. Diese Vornamen hatten den Vorteil, dass
man sie sowohl deutsch als auch ungarisch gebrauchen
konnte. Typisch deutsche Vornamen gab es – bis auf
einen – schon vor dem Zweiten Weltkrieg keine mehr.
88
Ein alter Mann in der Obergasse – Georg Weiler – wurde
Hans-Jürgl-(Hauns-Üagl) Vetter genannt, wohl in Erinnerung an die Herkunft der Vorfahren aus dem Schwarzwald, wo man zu Georg Jürg(l) oder Jörg(l) sagt.
Die Nachkriegsjahrzehnte brachten auch auf dem
Gebiet der Vornamen eine Madjarisierung: Immer mehr
deutsche Eltern gaben ihrem Kind einen ungarischen
Vornamen, wie László, Attila, Béla, Tibor, Ildikó, Ilonka,
Csilla usw. Damit wollte man auch eine – spätere –
Benachteiligung im Leben verhindern. Eine ähnliche
Erscheinung gibt es auch in Deutschland, wo Träger
ausländischer Familiennamen – gewissermaßen als
Ausgleich – typisch deutsche Vornamen haben…
Der Säugling war im ersten Lebensjahr in ein Kissen
(Polster > Polsterkind) eingewickelt. Das Kind wurde
diagonal auf das Kissen gelegt, danach das untere Ende
und die zwei Seitenecken eingeschlagen, schließlich mit
einer breiten Schleife (Maschn) zusammengeschnürt.
Auch die Ärmchen wurden so eingebunden. In dieser –
beengten – Lage hatte es nicht viel Bewegungsfreiheit.
Es konnte nur auf dem Rücken liegen. Wenn es weinte
(röehrte), gab man ihm zur Beruhigung einen Schnuller
(Zuzl) oder man formte aus etwas Mohn bzw. Zucker –
in ein Taschentuch (Schnäuztiachl) eingebunden – eine
kleine Kugel und steckte sie dem Kind in den Mund…
Während das Polsterkind anfangs meistens noch im
Bett neben der Mutter lag, kam es später in die Wiege
(Wieagn). Sie stand längs vor dem Bett der Mutter und
konnte von dieser – bei Bedarf liegend – bewegt werden.
Größere Kinder lagen – bei Platzmangel und der war
immer gegeben – nachts wieder neben der Mutter
(Muada). Die Nestwärme tat den Kindern gut. Sie fühlten
sich geborgen neben der Mutter. Schon früh begann sie
– morgens und abends – mit dem Kind zu beten.
89
Waren die Kinder älter waren, teilten sich machmal 23 Geschwister ein Bett, wobei eines mit dem Kopf auch
am Fußende liegen mußte, damit sie genug Platz hatten.
Kleinstkinder
wurden auch
schon aufs
Feld
mitgenommen. Sie lagen auf dem Wagen, während die
Eltern arbeiteten. Bei manchen Kindern löste dieses
Alleinsein Ängste aus. Man versuchte die Kinder
ohnehin durch Angstmachen vor bestimmten Gefahren,
die überall lauerten (z. B. durch Giftschlangen, offene
Brunnenschächte), zu schützen. Man erzählte ihnen z.
B., dass bei Dunkelheit die »Nachtkuh« (Nochtkuah)
käme und die Kinder mitnimmt. Deshalb kehrten die
Kinder bei Dunkelheit rechtzeitig heim…
Bemerkenswert ist noch, dass in den ersten
Lebensjahren bis in die 40er Jahre des 20. Jahrhunderts
alle Kleinkinder – also auch die Buben – ein Kleid
trugen, das hinter zugeknöpft war! Erst im Kindergarten
begann man den Buben Hosen und Janker anzuziehen.
Die Mädchen (Madl) trugen schon im Kindergarten die
ortsübliche Volkstracht mit Joperl (eine Art Bluse) und
Kiedl (Faltenrock). Die ungarischen Mädchen dagegen
trugen bereits im Kindergarten ein einteiliges Kleid, d. h.
sie waren wie ihre Mütter »herrisch« (hearrisch)
gekleidet. Im Sommer gingen natürlich alle Kinder barfuß
(bloßfüßig), was manche Fußverletzungen mit sich
brachte.
Tarian war eine der wenigen Gemeinden in Ungarn,
die vor dem Zweiten Weltkrieg einen staatlichen
Kindergarten hatten. Vermutlich war beabsichtigt, die
deutschen Kinder schon hier in ungarischer Sprache zu
erziehen. Da die deutschen Kinder kein Wort ungarisch
sprachen, fiel es den meisten sehr schwer, sich
einzugewöhnen, zumal sie den ganzen Tag drinbleiben
mußten. Über die Mittagszeit mußten sie sich zum
90
Schlafen hinlegen. Da die Zahl der deutschen Kinder
überwog, sprachen sie meistens untereinander auch ihre
Muttersprache.
Als sie dann – wieder getrennt von den reformierten
ungarischen Kindern – eingeschult wurden, begannen
erst recht die Probleme mit dem Ungarischen, da im
Kindergarten, außer einigen Kinderreimen nicht viel
hängenblieb…
1)
Die Taufe (Artikel über die Tarianer Taufsitten). In: Deutscher Kalender,
1982, Budapest, S. 146/47
So lebten wir früher
Einst, als die meisten Menschen noch in der
Landwirtschaft beschäftigt waren, herrschte im Juli und
August auf dem Dorf ein reges Treiben. Es war die Zeit
der Getreideernte. Das »Romocha« – wie man bei uns
die Ernte nannte – erforderte viele fleißige Hände, da
damals noch alles von Hand gemacht wurde. Als im Juli
das erste Getreide reifte, fingen die Bauern mit den
Erntevorbereitungen an. Zuerst wurde die Sense
(Sengst) gedengelt, d. h. durch Hammerschläge
geschärft. Dazu brauchte man ein Dengelstöckel,
welches aus einem etwa dreißig Zentimeter langen
Rundholz bestand. Dieses war am unteren Ende
zugespitzt, damit man es in den Boden schlagen konnte.
Am oberen Ende befand sich der Dengelamboß, auf den
man die Sensenschneide drauflegte. Mit der linken Hand
wurde das Sensenblatt gehalten, mit der rechten
Millimeter für Millimeter die Hammerschläge ausgeführt.
So ist die stumpfe Schneide langsam wieder scharf
geworden.
91
Das Dengeln – bei uns als Dangeln bezeichnet –
wurde gewöhnlich im Sitzen ausgeführt. Dazu schlug
man das Dengeletöckel in den Boden, daneben legte
man eine Wolldecke (Kotzen). Der Dengler setzte sich
darauf und nahm das Stöckel zwischen die ausgestreckt
auf dem Boden liegenden Beine. Die rhythmischen
Klänge des Dengelns waren weit hörbar.
Im Gegensatz zur Grassense bekam die Getreidesense noch einen Rechen (Recherl) in die Nähe des
Blattes montiert, damit die Halme beim Mähen schön
zusammenblieben. Das war für das Garbenbinden, von
größter Wichtigkeit. Die schwerste Arbeit bei der Ernte
hatte der Mäher (Mohder). Für ihn war es eine große
Anstrengung, den ganzen Tag über bei großer Hitze zu
mähen. Dies galt besonders für den bis zu zwei Meter
hohen Roggen (Trad). Die erste Mohd war die
schwerste, da rechts zum Ausholen mit der Sense kein
Platz vorhanden war. Eine abgemähte Reihe (Mohd) war
etwa hundertzwanzig Zentimeter breit. Alle Mohden
wurden so gemäht, dass sich die abgeschnittenen
Halme an die noch stehenden anlehnten, was den
nächsten Arbeitsgang erleichterte.
Der Mäher hatte am Hosengürtel (Housenriema) den
Wetzsteinköcher (Kumpf) hängen. In ihm befand sich der
Wetzstein (Weitzsta) mit etwas Wasser. Von Zeit zu Zeit
mußte die stumpf gewordene Sense mit dem Wetzstein
nachgeschärft (gewetzt) werden.
Hinter dem Mohder folgte meist eine Frau mit der
Sichel in der rechten Hand. Sie hieß bei uns
Aufwöhl(n)erin und hatte die Aufgabe, die Halme zu
einer Garbe (Gorem) zusammenzuraf-fen. Neben ihr
ging der sog. Bandbreiter (Pandlprada), ein Kind,
welches die Strohbänder auf den Boden legte, mit denen
die Garben zusammengebunden wurden.
92
Wenn genügend Arbeitskräfte vorhanden waren,
konnte eine weitere Person das Binden der Garben
übernehmen. Zum Binden benutzte man den sog.
»Bindnagel« (Pintnogl): Einen ca. 50 cm langen – an
einem Ende spitzen – Holzstab. Mit seiner Hilfe wurde
das gebundene Strohseil mehrmals gedreht, damit es
die Garbe fest zusammenhielt.
Die über ein Meter langen Strohseile wurden aus
taunassem Stroh vor Sonnenaufgang (da war es noch
feucht) gedreht, gebündelt und aufs Feld mitgenommen.
War das ganze Feld abgeerntet, begann das
Einsammeln der Garben. Sie wurden zu Garbenkreuzen
(Mandeln) zusammengesetzt. Ein Mandel bestand aus
dreizehn Garben, die kreuzweise – je drei aufeinander –
mit den Ähren nach innen gelegt wurden. Die dreizehnte
Garbe bildete den Abschluß. Ihre Ähre legte man in
Richtung der regeenabgewandten Seite.
Nach dem Schnitt folgte das Einfahren (Einfiehn). Zu
diesem Zweck wurden die kurzen Wagen zu langen
umgebaut. Dies geschah dadurch, dass die Seitenleitern (Latern) ausgetauscht wurden. Nachdem man
93
eine lange Verbindungsstange zwischen Vorder- und
Hinterachse eingesetzt hatte, befestigte man die langen
Leitern an beiden Seiten mit je zwei Leisten (Leicksen).
Um die Ladefläche zu vergrößern, erhielt der Wagen
noch einen Ernteaufbau. Dazu brachte man vorne und
hinten einen Querbalken an, der etwa einen Meter nach
links und rechts über die Leitern hinausstand. An ihnen
wurden mit kräftigen Holzstiften zwei Längsstangen
befestigt, so dass beim Einfahren des zu dreschenden
Korns möglichst viel geladen werden konnte.
Bevor das Getreide heimgeholt wurde, mussten –
entsprechend den Brandvorschriften – große Bottiche
(Stander) mit Löschwasser und Feuerhaken im Hof
bereitgestellt werden.
Für uns Kinder war das Getreideeinfahren immer eine
aufregende Sache. Wir durften auf dem Wagen mitfahren. Auf der Hinfahrt konnte man sich zwischen die
weit auseinander-stehenden Leitersprossen setzen und
die Beine nach unten baumeln lassen. Während der
Fahrt sprangen wir auf und ab
Man fühlte sich schon wie ein Erwachsener, wenn
man beim Aufladen
dem Vater mit der
Gabel
die
Garben
reichen durfte. Das
Beladen des Wagens
mußte
sorgfältig
vorgenommen werden.
Zuerst
wurde
der
untere Teil zwischen
den Leitern gefüllt. Am
Oberrand der Leitern
angelangt, wurden die Garben quer zur Längsrich-tung
des Wagens mit den Ähren (Ächa) nach innen auf die
94
Längsstangen gelegt. Nachdem links und rechts eine
Reihe Garben gesetzt war, kamen wieder welche in die
Mitte.
Wenn vier-fünf Lagen so aufeinander gestapelt
waren, wurde die ganze Ladung mit dem Wiesbaum
gesichert. Der »Wiespaam« war eine kräftige Stange,
die in Längsrichtung in der Mitte auf die Ladung gelegt
und mit Stricken an den Aufbauten des Wagens
festgebunden wurde. Wegen der holprigen Feldwege
war es ratsam, beim Beladen des Emtewagens größte
Sorgfalt walten zu lassen, um ein Umkippen des
Wagens oder ein Abrutschen der Garben zu vermeiden.
Das Getreide wurde in den Hinterhöfen der Langhäuser in Form von Getreidemieten – Tristen –
gestapelt. Je nachdem, ob ein Bauer viel oder wenig
Getreide geerntet hatte, waren die Tristen größer oder
kleiner ausgefallen. Es gab Weizen-, Roggen-, Gersteund Hafertristen (Waz-, Trad-, Gerschten- und Hofertristen). Sie mußten fachmännisch gesetzt werden. Die
Ähren der Garben lagen stets nach innen zu, um so die
Verluste zu verringern. Bei schlechtem Wetter breitete
man eine große Leinenplane (Ploche) über den oberen
Teil der Triste.
Nachdem das Getreide eingefahren war, begann das
Dreschen (Maschiniern). Vor Erfindung der Dreschmaschine hatte man mit dem Dreschflegel die Getreideähren ausgeklopft, oder man ließ Tiere über sie laufen.
Körner und Spreu wurden bei Wind durch Worfeln
voneinander getrennt. Später kam die »Windmühle« in
Gebrauch. Sie wurde von Hand angetrieben und diente
lediglich durch künstliche Winderzeugung zum Trennen
von Spreu und Korn. Kleinere Getreidemengen wurden
sogar noch nach dem zweiten Weltkrieg so gedroschen.
95
Um größeren Schaden zu vermeiden, war jeder
Bauer bestrebt, möglichst schnell beim Dreschen an die
Reihe zu kommen. Das war nicht immer so einfach, da
im Dorf höchstens zwei-drei Dreschmaschinen im
Einsatz waren. Die Besitzer waren reiche Bauern.
Anfangs wurde die Dreschmaschine über einen etwa
vier Meter langen, breiten Transmissionsriemen von
einer riesigen Dieselmaschine angetrieben. Da dieser
Motor sehr schwer war, mußte er von Zugtieren von
einem Hof in den anderen gezogen werden; ebenso die
eigentliche Dreschmaschine.
Später (nach der Elektrifizierung) wurde er von leichteren Elektromotoren oder Traktoren abgelöst. Wegen
seiner Größe war es auch schwer, den Dreschkasten, d.
h. die eigentliche Dreschmaschine, in die oft engen
Hinterhöfe zu schaffen. Manchmal mußten Äste von im
Weg stehenden Bäumen abgesägt werden. Um besser
rangieren zu können, zogen und schoben oft Menschen
diese riesige Maschine.
Beim Dreschen waren viele Helfer nötig. Da war
zunächst der Maschinist, der für die richtige Aufstellung
und das Funktionieren der Maschine zuständig war.
Dann kam noch – zumindest nach 1945 – eine
Amtsperson – der Kontrolleur – dazu. Er achtete darauf,
dass alles, was gedroschen auch gewogen und
registriert wurde.
Der Sackmann füllte die Säcke mit Korn und legte sie
auf die Waage. Die Sackträger trugen die abgewogenen
Säcke, die über fünfzig Kilogramm schwer waren, über
die schmalen steilen Holzstiegen auf den Speicher
(Boden) über dem Wohnhaus. Die Säcke wurden meist
gleich ausgeleert. So konnte das Getreide trocknen, und
man sparte Säcke, da die leeren wieder zur Maschine
zurückgebracht wurden.
96
Auf der Getreidetriste standen zwei Personen, um die
Garben mit der Gabel auf den Dreschkasten zu werfen.
Dort wurden die Garben von dem Bandöffner
(Pandlaufmocha) in Empfang genommen. Die von ihm
geöffnete Garbe übergab er dem Fütterer (Fiadara). Er
stand knietief vor dem Selbsteinleger und gab die
Getreidehalme mit den Ähren voran in die sich schnell
drehende – mit Eisenstiften besetzte – Trommel.
Im Inneren der komplizierten Maschine wurden Korn,
Spreu, Stroh und Schmutz sortiert und an verschiedenen
Stellen nach außen abgegeben. Das Stroh wurde über
den Schüttler am Hinterende nach außen befördert. Zwei
Frauen schoben es von hier mit Holzgabeln zur
Strohtriste, auf der wiederum mehrere Männer mit dem
Tristensetzen beschäftigt waren.
Weitere zwei Personen waren damit befaßt, die Spreu
– Amm genannt – mit dem Rechen unter der
Dreschmaschine hervorzuziehen. Danach wurde sie in
große Körbe getan und meist von Kindern (Ammtroga) in
den Schuppen (Schupfe) oder Scheune (Scheuer)
getragen. Damit viel Amm hineinging, mußten wir es
eintreten, was wegen der Grannen (Kraan) und des
Staubes ziemlich unangenehm war.
Die Helfer beim Maschinieren kamen aus der
Verwandtschaft und Nachbarschaft. Wenn der Drusch
fertig war, wurden alle reichlich bewirtet. Das war die
ganze Entlohnung für die harte Arbeit. Während die
Helfer noch aßen und tranken, bauten die Leute des
Nachbarn die Dreschmaschine schon ab und zogen sie
in den nächsten Hof, so dass möglichst wenig Zeit mit
Stillstand verlorenging.
Zum Abschluss der Drescharbeit wurde der Hof
aufgeräumt. Die Körnerabfälle kehrte man feinsäuberlich zusammen, um sie an die Hühner zu verfüttern.
97
Die Strohtristen wurden von dem Bauern persönlich
„zugemacht“, d. h. nach obenhin verjüngt gesetzt, damit
möglichst wenig Feuchtigkeit in sie eindringen konnte.
Gersten- und Haferstroh wurden von Weizen- und
Roggenstroh gesondert aufbewahrt, da die ersteren mit
Kleeheu gemischt zum Füttern dienten. Weizenstroh
diente als Streu (Stra) für das Vieh. Aus handgedroschenem Roggenstroh machte man die Schapn
(Schauben = gebündeltes Roggenstroh), die man als
Matrazenvorläufer ins Bett legte. Die Spreu wurde, mit
Rübenschnitzeln und Kleie (Kleiem) vermengt, verfüttert.
So schnell wie möglich fuhr man mit dem Weizen und
Roggen in die Mühle nach Totis oder Schitte, um
Aus dem Mehl neues Brot backen zu können.
Frischgebackenes Weißbrot war für uns Kinder damals
der Inbegriff von Glück …
Am Ende des Sommers waren die Hinterhöfe und
vorderen Teile der Gärten voll von Stroh- und Heutristen,
zwischen denen man vorzüglich Fangen- und
98
Versteckspielen konnte. Zum Ärger der Eltern kletterten
wir manchmal auch auf die Tristen hinauf ... Im Zuge der
Aussiedlung, Enteignung und des zunehmenden Drucks
auf die Ungarndeutschen ging in den 40er und 50er
Jahren die Zahl derer, die noch maschinieren konnten,
rapide zurück. Bald gab es niemanden mehr. Heute sieht
man nur noch selten die alten Scheuern, Schupfen oder
gar die Tristen.
Soll man es bedauern, dass mit den gesellschaftlichen und technischen Umwälzungen die alte
Form des Erntens und Dreschens verschwand?
Außenstehende werden diese Frage mit "ja"
beantworten. Sie sehen darin einen Verlust der
ländlichem Romantik. Andererseits werden diejenigen,
die diese schwere Arbeit verrichteten keine Träne dieser
Zeit nachweinen. Bedenkt man, mit wie wenigen
Arbeitskräften heute geerntet wird, so sieht man doch
deutlich den Fortschritt, der dem Wohl des Menschen
dient oder dienen sollte.
Nachkriegszeit
Als die Sowjets nach langem Kampf unser Dorf am 16.
März 1945 zum zweiten Mal besetzten, sagte ein
deutschsprechender Soldat der Roten Armee (offenbar
ein Volksdeutscher) zu einer deutschen Bauernfrau:
»Wenn Sie wüßten, was nach dem Krieg kommt, dann
würden Ihnen die Haare zu Berge steigen.« Die einfache
Frau konnte damals nicht ganz begreifen, was der
Rotarmist eigentlich meinte. Erst ein Jahr später wußte
sie, was er ihr damit sagen wollte. Die Hungersnot war
noch nicht zu Ende, die Familien beweinten noch ihre im
Krieg gefallenen Angehörigen, als im März 1946 ein
neues Leid über Tarian kam.
99
1
Am 16. März begann das Requirieren .
2
Unter der Führung eines jungen Mannes – Kállai Miklós
– aus Budapest beschlagnahmte man von den
deutschen Bauern das Frühjahrssaatgut (Gerste, Hafer,
Mais). Dabei wirkte ein kleiner Teil der eingesessenen
Ungarn eifrig mit. Es war nicht genug, daß ein Teil des
deutschen Vermögens requiriert wurde, zwei Familien
mußten ihr Haus ganz räumen. In diese und in zwei
leerstehende Häuser wurden eingesessene ungarische
Familien eingewiesen.
Im März 1946 waren in Tarian »Kontrollkommissionen«
tätig. Ihren Namen trugen sie zu recht, denn sie
kontrollierten, wer von den Deutschen das meiste
Vermögen hatte, den setzten sie dann auf die
»Volksbundliste«, ganz gleich, ob er tatsächlich Mitglied
des Volksbundes war oder nicht. Im Laufe des Monats
März wurden weitere Enteignungen durchgeführt. Die
noch nicht enteigneten deutschen Bauern mußten mit
ihren Pferdewagen nach Tatabánya–Obergalla fahren
und die 52 ungarischen Siedler-(Telepesch) Familien3
aus Egerlövõ (Komitat Heves) mit ihren Habseligkeiten
abholen. Außer diesen Siedlern kamen noch etwa 29
weitere Familien, meist kommunistische Arbeiterfamilien
aus Tatabánya, nach Tarian. Aus ihren Kreisen
rekrutierten sich die Funktionäre der KP.
Wir schrieben den 28. August 1947, als die
Nachricht eintraf, daß aus Környe/Kirne (Komitat
Komorn, ca. 20 km von Tarian entfernt) die ,Schwaben‘
4
nach Deutschland ausgesiedelt würden . Die Arbeit auf
den Feldern wurde wieder eingestellt. Viele Deutsche
suchten in der Pfarrei Trost, denn der damalige Pfarrer
Imre Fütty stand ihren Problemen aufgeschlossen
gegenüber.
100
Die Siedler von Tarian fuhren nach Kirne und
nach Budapest in die Ministerien, um zu erreichen, daß
anschließend die Tarianer ,Schwaben‘ ausgesiedelt
werden. Sie bekamen auch die Zusage, daß ihr Wunsch
erfüllt wird. Deswegen haben sie keinen Deutschen
mehr aus dem Dorf gehen lassen. Sie standen mit
Mistgabeln und Holzhacken an den Ausfallstraßen.
Wenn jemand nach Tatabánya auf den Wochenmarkt
gehen wollte, dem haben sie alles weggenommen. Es
versteht sich fast von selbst, daß die Polizei dabei eifrig
mitgewirkt hat. Manche bekamen als Bezahlung für die
beschlagnahmte Ware eine Tracht Prügel…
Wegen der Einengung der Bewegungsfreiheit und der
ständigen Ungewißheit war im Herbst 1947 in Tarian die
Verzweiflung groß. Die Gemüter hatten sich kaum
beruhigt, als im April 1948 erneut das Gerücht der
Aussiedlung auftauchte4. Im Gemeindehaus wurde
sogar die Namensliste der auszusiedelnden Bewohner
ausgehängt. 2037 ,Schwaben‘ wollte man nach
Deutschland vertreiben. Die Leute stellten wieder die
Arbeit ein. Sie waren sehr verbittert. Die Männer fertigten
große Kisten an, in denen sie das wichtigste Hab und
Gut unterbringen konnten. So warteten wir auf die
Ausweisung.
Es vergingen Wochen, bis sich die Menschen
wieder beruhigten. Die Habseligkeiten wurden wieder
aus den Kisten geholt. Vor der Ernte enteignete man von
den ,Schwaben‘, denen man zuvor noch etwas gelassen
hatte, die besten Felder samt Frucht. Die wenigen
Deutschen, die im Sommer 1948 noch etwas zu
dreschen hatten, wurden beim Dreschen benachteiligt.
Zuerst durften die Siedler und eingesessenen Ungarn ihr
Getreide dreschen, dann kamen erst die Deutschen an
101
die Reihe. Die noch vorhandenen "Kulaken" (reiche
Bauern) kamen natürlich zuallerletzt dran.
Vierundzwanzig Stunden nach dem Dreschen
mußte sämtliches Getreide mit Ausnahme der Kopfquote
und des Saatgutes bei der staatlichen Sammelstelle für
wenig Geld abgeliefert werden. Dieser Getreidespeicher
befand sich im enteigneten Bauernhaus von Stefan
Vértes (Weiler), welches in der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts von dem berühmten Barockbaumeister
Jakob Fellner gebaut wurde. Trotzdem hat man es
abgerissen. Heute befindet sich das Wirtschaftshaus
»Fekete-kõ « darin…
Im September 1948 begann eine neue Zwangszusammensiedlung der »Schwaben«. In jedem – für
Ungarn nicht geeigneten – Haus wurden mindestens
zwei deutsche Familien untergebracht. Da nicht genug
leere Gebäude zur Verfügung standen, wurden
nachträglich
auch
solche
Familien
auf
die
Enteignungsliste gesetzt, die ein größeres Vermögen
und ein schönes Haus hatten, obwohl sie sich vorher zu
Ungarn bekannt haben.
Durch die dauernden Umsiedlungen im Ort und
Enteignungen wurde das ganze Dorf durcheinander
gebracht. Man war offensichtlich nicht nur auf das
Vermögen der Leute aus, sondern man wollte sie auch
verunsichern und einschüchtern.
Im Oktober 1948 trafen die ungarischen Umsiedler aus
der Slowakei, dem ehemaligem Oberungarn (Felvidék =
Oberland) in Tarian ein. Es sind insgesamt 43 Familien
angekommen. Ihr mitgebrachtes, bewegliches Vermögen wurde aus Svodin/Szõgyén mit 5 Güterzügen bis
Totis/Tata transportiert, von dort mit Lastautos nach
Tarian gefahren. Es dauerte Wochen, bis der Hausrat
der neuen Siedler aus Totis abtransportiert war. Die aus
102
Szõgyén
stammenden
Ungarn
verließen
ihre
angestammte Heimat unter Zwang im Rahmen des
ungarisch-tschechoslowakischen
Bevölkerungsaustauschs.
Obwohl die Felvidéker (= Oberländer) ihre ganze
bewegliche Habe mitbringen durften (Familie Sámson
5
kam mit 14 Waggon Mobiliar an!) und in Tarian Haus
und Ackerland bekamen, waren doch viele unter ihnen,
die ihrer alten Heimat lange nachtrauerten. Am Rande
sei es vermerkt, daß manche Familien von ihnen
deutsche Namen hatten wie Schweizer, Wolter, Elser,
Stegmar, Hos usw. Ihre Vorfahren sind assimilierte
Deutsche aus Német-Szõgyén (Deutsch-Södjen), das
mit Magyar-Szögyén zu Szõgyén vereinigt wurde…
Ursprünglich hätten die Felvidéker in der 7 km entfernten
slowakischen Gemeinde Tardos untergebracht werden
sollen, und zwar in den Häusern, die in die Slowakei
umgesiedelten Slowaken zurückgelassen haben.
Deswegen wurden die Eisenbahnzüge mit dem Hausrat
nur bis Totis geleitet, da dieser Bahnhof zu Tardos am
nächsten liegt. Die Slowaken von Tardos hatten wenig
Ackerland, ihre Häuser waren klein (in einem Hof
wohnten nicht selten 4 bis 5 Familien). Sie waren zum
großen Teil in den Roten Marmor-Brüchen in der Nähe
beschäftigt. Die 1948 ausgewanderten Slowaken ließen
so gut wie kein Vermögen zurück. Da für sie die
Auswanderung freiwillig war, sind nur wenige – ärmere –
Familien aus Tardos fort.
Angesichts der schlechten Bedingungen weigerten sich die Felvidéker, nach Tardos zu ziehen. Sie
wollten in Ungarn für ihr Haus und Ackerland, welches
sie in der Slowakei aufgeben mußten, angemessen
entschädigt werden. Was lag näher, als daß man ihnen
in den benachbarten deutschen Gemeinden – Tarian,
103
Tolnau, Augustin –, wo es genug schöne Bauernhäuser
und Felder gab, auf Kosten der entrechteten ,Schwaben‘
den erlittenen Schaden gutmachte.
Nun wohnten in Tarian fünferlei Menschen: Zwei
katholische Gruppen (»Schwaben« und Felvidéker) und
zwei reformierte Gruppen (eingesessene Ungarn und die
Siedler aus Egerlövõ) sowie die religiös indifferente
Gruppe der »auswärtigen Ungarn«. Das Zusammenleben dieser durch die Nachkriegsereignisse zusammengewürfelten Menschen war nicht ganz reibungslos.
In den ersten Jahren verging kaum ein Wochenende, an
dem es keine Schlägerei gab. Jede Gruppe wollte im
Dorf den Ton angeben. Die Egerlövõer rauften mit den
Schwaben, die Felvidéker mit den eingesessenen
Ungarn. Aus Tatabánya mußte öfters die Polizei nach
Tarian kommen, um den Messerstechereien eine Ende
zu setzen …
Im Laufe des Sommers 1949 wurden weitere
deutsche Familien enteignet. Die Häuser mußten
innerhalb von 8 Stunden geräumt werden. Von dieser
Maßnahme waren vor allem die Besitzer von
Wirtshäusern (6) und Gemischtwarengeschäften (8) –
sofern ihre Häuser nicht schon vorher beschlagnahmt
wurden – sowie von Fleischbanken (2) betroffen.
Von nun an gab es im Dorf nur noch zwei Wirtshäuser,
ein Lebensmittelgeschäft und eine Fleischerei. Besitzer
6
war die »Bauerngenossenschaft« .
Zu Beginn der 50er Jahre waren die Meinungsverschiedenheiten zwischen den einzelnen Gruppen
noch immer groß, doch war hier und da schon eine
Verbesserung des Verhältnisses zu verzeichnen. Die
Egerlövõer Siedler – die langsam anfingen wegzuziehen
– nahmen teilweise die früheren Besitzer in ihr Haus
7
zurück. Die Felvidéker blieben dagegen unerbittlich . Mit
104
der fadenscheinigen Begründung, daß die Behörden
sagen könnten, „Wenn Ihr Euer Haus mit anderen teilt,
dann ist dies ein Zeichen dafür, daß es zu groß ist,
deshalb geben wir Euch ein kleineres!“, lehnten sie
jeden Vorschlag, die früheren, rechtmäßigen Besitzer in
ihr Haus aufzunehmen, ab. Wegen dieser starren
Haltung bestand zwischen den beiden katholischem
Gruppen eine erhebliche Spannung. Die ,Schwaben‘
gaben den Felvidékern die Schuld wegen der
Enteignung. Sie warfen ihnen auch unchristliches
Verhalten vor, indem sie sagten: „Wenn ihr Felvidéker so
religiös seid, warum übt Ihr die christliche Nächstenliebe
nicht aus?!“ Doch dies alles nützte nichts.
Nach dem Motto »Divide et impera!« (Teile und
herrsche!) wurden in Tarian vielfach auch die
,Schwaben‘ gegeneinander ausgespielt, da man das
Feld des einen einem anderen gab8. Nicht nur in den
Besitzverhältnissen, sondern auch in den Seelen der
Menschen
wurde
ein
heilloses
Durcheinander
angerichtet. Die Folge davon war, daß die ,Schwaben‘
resignierten. Sie zogen sich vollkommen zurück.
Niemand wollte etwas von Politik wissen. Die
neuangesiedelten Ungarn fühlten sich indessen auch
nicht sehr wohl in Tarian.
Nach und nach verkauften viele Telepeschen das
ihnen anvertraute Haus und zogen entweder wieder
nach Egerlövõ oder nach Érd/Hanselbeck. Ein Teil der
Felvidéker tat dasselbe. Sie wanderten nach Totis ab.
Das Abwandern der Siedler ist teils auch auf die
Propaganda zurückzuführen, die dauernd vor der neuen
deutschen Gefahr sprach. Auf Grund dessen hofften
wiederum viele Schwaben im Stillen, sie würden bald ihr
Vermögen zurückerhalten. Es hieß immer: „Jetzt dauert
es nicht mehr lang“. Im Oktober 1956 schien es so, als
105
ob diese geheime Parole Wirklichkeit würde. So
mancher glaubte schon, die Zeit sei gekommen, um mit
den Kommunisten abrechnen zu können. Doch diese
Optimisten wurden bitter enttäuscht. Sie mußten –
nachdem der Aufstand niedergeschlagen war – für ihr
voreiliges Handeln hart büßen …
Jahrzehnte vergingen, ein Großteil der Geschädigten ist gestorben. Ihre Kinder und Enkel vergaßen in
der materiellen Hetze das Unrecht und ihre Volkszugehörigkeit…
Eine teilweise Wiedergutmachung für das erlittene Unrecht erfuhren die Deutschen mit dem sog.
Entschädigungsgesetz Anfang der 90er Jahre. Mit den
Entschädigungsscheinen haben sie begonnen, wieder
Land zu erwerben. Wenn auch nur wenige daran denken, sich wieder als Landwirte zu betätigen.
Die 45jährige national-kommunistische Herrschaft in
Ungarn ruinierte die Deutschen nicht nur wirtschaftlich,
sondern brach auch ihr von den Vorfahren ererbtes
Volkszughörigkeitsbewußtsein. Immer weniger junge
Menschen erlernen die deutsche Muttersprache. Der
Deutschunterricht in der Schule zeigt bei den wenigsten
den wünschenswerten Erfolg …
Nationalitäten-Gemeinden im Komitat KomornGran
Während das Komitat Raab-Ödenburg ganz in der Oberungarischen Tiefebene liegt, gehört das Komitat
Komorn-Gran bereits zum Transdanubischen Mittelgebirge und dessen nörd-lichen Ausläufern. Genauer
gesagt gehört der nördliche Teil des Schildgebirges, der
106
ganze Geretsch, das Hügelland von Bársonyos, ein
kleiner Teil des Pilischergebirges und der Nordostzipfel
des Buchenwaldes hierher.
Die Nationalitäten-Dörfer findet man hauptsächlich im
östlichen und südlichen gebirgigen Teil des Komitats.
Der Grund dafür ist im Verlauf der türkischen Grenze
(siehe Karte!) um 1600 zu suchen. In den von den
Türken besetzten Mittelgebirgen wurden die ungarischen
Dörfer zum großen Teil als Folge der ständigen
Kampfhandlungen vernichtet. In dem 1683–85 von den
Türken befreiten Komitat waren zweiundneunzig
Siedlungen verwüstet.
Die Bevölkerung wurde auch im Rákóczischen
Freiheitskampf (1704–1711) stark dezimiert. Wie im
ganzen Land kam es auch im Komorner Komitat im
Laufe des 18. Jahrhunderts zur Neubesiedlung der
entvölkerten Landstriche. Die weltlichen (Est-erházy,
Grassalkovics) und Kirchlichem (Klarissinnen von Alt107
Ofen. en) Grundherren riefen deutsche und slowakische
Siedler auf ihre Güter.
Aber auch vor der türkischen Zeit muss es hier schon
Deutsche gegeben haben. In der Gemeinde Kocs
(westlich von Tata/Totis) soll der Wagen (ung. kocsi)
erfunden worden sein, nachdem ein gewisser Johann
Hammermayer Anfang des 15. Jahrhunderts das 5. Rad
ersann. Es befindet sich über der Vorderachse und dient
zur Richtungsänderung beim Fahren.
1920 lebten im Komitat Komorn rd. 105000
Menschen, davon waren 82,89 % Ungarn, 12,64 %
Deutsche, 3,27 % Slowaken und 1,2 % Sonstige. 1930
waren von 154000 Einwohnern 12,14 % Deutsche und
4,3 % Slowaken. Diese Angaben sind sicher nicht ganz
korrekt, da sie aus einer Zeit stammen, in der man alles
darangesetzt hat, die Zahl der Nichtmadjaren zu
verringern.
Die ersten Siedler kamen neun Jahre nach der
Vertreibung der Türken, 1694 aus Schwaben nach
Dorog. 1699 kamen Elsässer nach Schitte, wo zwanzig
Jahre später von 29 Familien 24 deutsche waren. Im
Jahre 1700 sollen sich auch 18 Familien aus dem Elsass
in Tscholnok niedergelassen haben. Die Haupteinwanderungswellen kamen erst im Laufe des 18.
Jahrhunderts. Damals waren auf dem heutigen Gebiet
des Komitats 42 Ortschaften (30 deutsche, 12
slowakische) von Nationalitäten besiedelt. So kommt es,
dass heute noch von den 72 Siedlungen etwa die Hälfte
als Nationalitäten-Dörfer gelten.
Die deutschsprachigen Siedler sind hauptsächlich aus
dem bairischen Dialektraum (Österreich, Bayern und
Böhmen) gekommen. So ist es nicht verwunderlich, dass
man 250–300 Jahre nach der Ansiedlung in vielen
Gemeinden heute noch den mittelbairischen ua-Dialekt
108
hier hören kann. Das Schwäbische und Alemannische
wurde – unter Einfluß von Wien – von dem Bairischen
weitgehend verdrängt.
In Tolnau finden wir noch einen fränkisch gefärbten
Dialekt. In , Woje und Schitte spricht man einen uiDialekt. In den zwei ersteren Dörfern wurden
Heidebauern aus West-Ungarn angesiedelt. Fast jedes
Dorf hat einen anderen Einschlag in seiner Mundart. Es
handelt sich also um Mischdialekte, die sich erst in
Ungarn aus Elementen der Urheimat entwickelten.
Die jüngste deutsche Gemeinde im Komitat Komorn
ist Kirwa. Sie wurde 1785 mit der Ansiedlung von 61
Familien gegründet. Die Masse der Siedler kam aus dem
S-Schwarzwald. Infolge Einheirat aus den benachbarten
deutschen Dörfern haben auch sie ihren alemannischen
Dialekt verloren und nahmen die ua-Mundart an.
Auf dem Gebiet des 2250 km2 großen Komitats
finden wir 5 Städte, 77 Straßendörfer, Weiler (Pußten)
und Einzelhofsied-lungen (Tanyas). Bei den Pußten oder
Weilern handelt es sich um kleinere Siedlungen, die
einst Mittelpunkte eines Groß-grundbesitzes waren. Der
Großgrundbesitzer
wohnte
im
Kastell,
seine
Bediensteten in den 10-15 Häusern der kleinen
Siedlung. Bis Anfang der 90er Jahre waren die Pußten
Zentren von Staatsgütern.
In den breiten Straßen der Dörfer findet man
verschiedene Haustypen. Am weitesten verbreitet sind
die ebenerdigen mit dem Dachfirst senkrecht zur Straße
stehenden
Häuser.
Das
ist
die
sogenannte
Langhausform. Vor dem Haus hatte man früher einen
kleinen Vorgarten (Gartl) für Blumen. In den
vergangenen Jahr-zehnten fiel das Gartl Umbauarbeiten
zum Opfer.
109
Daran
schließt
sich
der
Wohnteil an. Er besteht aus der
vorderen Stube (vraunige Stuum),
der Küche (Kuchl) und der
hinteren Stube (hintrige Stuum).
Der Eingang ist an der Hofseite
durch die Küche. Von der Straße
gelangt man durch das kleine Tor
(Türl) auf den Gang (Flur), der bei
einfacheren Häusern von einem
etwa
ein
Meter
breiten
Dachvorsprung überdacht ist. Wohlhabendere Leute
bauten einen Säulengang. Der Dachvorsprung ist breiter
und durch Säulen abgestützt. In manchen Häusern
findet man nach der hinteren Stube eine zweite Küche.
An den Wohntrakt schließt sich der Wirtschaftsteil an.
Zunächst folgt die Kammer, von der aus man auf den
Dachboden (im vorderen Teil des Hauses) und in den
Gewölbekeller gelangen kann. Dann folgen die Ställe mit
dem Heuboden. Schweine- und Hühnerställe stehen
meistens gesondert.
Beim Schweinestall älteren Typs handelt es sich um
einen Holzstall (Mäststeig), der etwas erhöht auf Balken
oder Steinen steht. Bei reicheren Bauern stand quer zum
Hof am Ende des Hauses die Scheune (Scheuer).
Dahinter standen die Stroh- und Heuhaufen (Tristen).
Im Hof findet man neben den Mäststeigen und Ställen
für Geflügel noch den Brunnen. Der 10-12 m tiefe
Brunnen war früher mit Steinen ausgemauert, heute
überwiegen aber die Betonringe. Auf dem Brunnengestell finden wir ein Dach zum Schutz der Walze mit
Seil und Eimer (Amber) und des Rades. Der Hof wird auf
der Süd- bzw. Ost-Seite von der Rückwand des
Nachbarhauses abgeschlossen. An der Straßenfront
110
befindet sich neben dem Türl noch das Tor und Tür an
der Straßenseite. Sie ist aber meistens verschlossen.
Das oben beschriebene Langhaus ist eine Mischform
zwischen dem mitteldeutschen Gehöft und dem südwestdeutschen Einhaus. Häuser ähnlicher Anord-nung –
aber dennoch anders aussehend – finden wir in der
Pfalz.
Wohlhabendere Leute, v. a. Geschäftsleute, haben
sich ein Querhaus gebaut. Es steht mit dem Dachfirst
parallel zur Straße. Vielfach finden wir in der Mitte eine
große Toreinfahrt. An das Querhaus schließt sich nach
hinten noch ein Langhaus an. Im Querhaus waren
meistens gewerbliche Räume untergebracht.
Die Häusler- und Arbeiterhäuser auf den Dörfern
bestanden nur aus einer Stube und einer Küche. Daran
schlossen sich Kammer, kleiner Stall und Schuppen an.
Nach 1945 vollzog sich auf dem Gebiet des
Hausbaus
auch
ein
großer
Wandel.
Der
Funktionswandel im Berufsleben der Menschen wirkte
sich auch auf Haus und Hof aus. Während früher 80-90
% der Menschen in der Landwirtschaft beschäftigt
waren, waren es 1968 nur noch 30 %1. Die Menschen
sind in die sich entwickelnde Industrie abgewandert. Die
früheren Bauern-häuser wurden Arbeiterhäuser. Die
Scheunen wurden abgerissen und die Ställe umgebaut.
Falls der Hof breit genug war, baute man an der
Straßenfront noch ein zweites Zimmer an. So
entstanden L-förmige Haustypen.
Die ab den 50-60er Jahren in großer Zahl
entstandenen Neubauten sind bereits viereckig mit zwei
Zimmern, Küche und Diele. Die zwei Zimmer befinden
sich an der Straßenseite. Der Eingang ist an der
Hofseite, er führt in das Vorzimmer. Von dort gelangt
man in das eine Zimmer und die Küche. In das zweite
111
Zimmer kommt man über die Küche. Im Hof befinden
sich die Ställe für die Kleintierhaltung. Obwohl die alten
Häuser alle nach dem gleichen Grundschema gebaut
sind, haben sie doch ihr individuelles Gepräge. Das läßt
sich von den Neubauten nicht mehr sagen.
Ähnlich wie im Hausbau läßt sich ein Wandel auch in
der Flurform feststellen. Von der Dreifelderwirtschaft
über die Fruchtwechselwirtschaft – mit Flurzwang und
ohne – führt der Weg zu der großbetrieblichen
Landwirtschaft der kommunis-tischen Ära. Während vor
1945 die Gemarkung (Hotter) in viele lange schmale
Parzellen geteilt war, gab es von 1950 bis 1993 riesige
einheitlich bestellte Tafeln. d. h. eine Großblockflur.
Die alte Streifen-Parzellierung ist in gebirgigen
Gegenden des Komitats heute noch anzutreffen. In allen
Gemeinden unseres Gebiets betrieb man gemischte
Landwirtschaft. Das heißt: Die Bauern befaßten sich mit
Viehzucht, Ackerbau sowie Wein- und Obstbau.
Vor dem Zweiten Weltkrieg überwog im Komitat
Komorn die bäuerliche Bevölkerung. Die Zahl der
Arbeiter war auf den Dörfern gering, da es kaum
Verkehrsverbindungen in die Städte gab. Die Bauern
kann man je nach Betriebsgröße in Zwergbauern (unter
1 kj = unter 0,57 ha), Kleinbauern (>1–5 kj = >0,57–2,87
ha), Mittelbauern (>5–50 kj = >2,87–28,7 ha),
Großbauern (>50–100 kj = >28,7–57,47 ha) und
Großgrundbesitzer (>100- über 1000 kj = >57,47– über
574,7 ha) einteilen2.
Wie in der deutschen Urheimat der Einwanderer
herrschte auch hier die Realteilung vor, d. h., sie haben
ihr Ackerland unter ihren Erben gleichmäßig aufgeteilt.
Da die Kinderzahl im Durchschnitt bei 4–5 lag, ist es
nicht verwunderlich, wenn die Zahl der kleinen
landwirtschaftlichen Betriebe überwog. Aber nicht nur
112
das Feld, sondern auch die Häuser wurden unter den
Erben geteilt. So gab es in der Mitte des 20.
Jahrhunderts Höfe, wo 2–3 Familien wohnen.
Zur Illustration der bäuerlichen Sozialstruktur seien
hier einige statistische Zahlen – 1935 veröffentlicht – für
den Kreis Totis angeführt*. Von der Gesamtzahl der
Bauern gehörten damals 98,66 % zu den Zwerg-, Kleinund Mittelbauern. Sie besaßen zusammen aber nur
42,76
%
des
Ackerlandes!
Während
die
Großgrundbesitzer mit ihren 0,71 % Anteil 52,95 % der
landwirtschaftlichen Fläche bewirtschafteten. Also ein
krasses Mißverhältnis in der Verteilung des Landes.
Die mittlere Betriebsgröße hätte bei gleichmäßiger
Verteilung des Ackerlandes auf alle Betriebe bei 10 kj
(5,9 ha) liegen müssen. Die tatsächliche mittlere
Betriebsgröße lag bei den Zwergbauern bei 0,4 kj (0,23
ha), den Kleinbauern bei 2,4 kj (1,38 ha), den
Mittelbauern bei 13,68 kj (7,8 ha), den Großbauern bei
68,65 kj (39,45 ha) und den Großgrundbesitzern bei
745,81 kj (428,63 ha).
Da die Zahl der Kinder groß und das zur Verfügung
stehende Land knapp war, blieb für die Jugend nur die
Möglichkeit, ein Handwerk zu erlernen oder in die Stadt
abzuwandern. Die Abwanderer zog es vor allem nach
Budapest, wo sie als Knechte, Kutscher oder Dienstmädchen sehr gefragt waren, sie waren nämlich
durchweg fleißig und zuverlässig. Nach einigen Jahren
sind die meisten wieder in ihre Heimatdörfer
zurückgekehrt, wo sie geheiratet haben und bescheidenes Dasein führten.
In 15 deutschen Gemeinden des Komitats wurden in
den Jahren 1925-1931 Ortsgruppen des Ungarländischen Deutschen Volksbildungsvereins (UDV) gegründet. Während sich seine Arbeit unter schwierigeren
113
Bedingungen mehr im Stillen vollzog, trat der Volksbund
der Deutschen in Ungarn (VDU) 1938–1944 durch seine
Versammlungen mehr in die Öffentlichkeit und ins
Bewußtsein der Menschen. So kam es denn auch zu
mehr Ortsgruppengründungen im Komorner Komitat als
beim UDV. Zwischen 1940 und 1942 wurden in 24
Gemeinden Ortsgruppen des Volksbundes ins Leben
gerufen. Nur ein Teil, der deutschen sympathisierte mit
dem Volksbund (in Tarian 16,8%), der andere Teil ahnte
schon instinktiv, was nach dem Krieg folgen wird. Das
Engagement der einen und die Zurückhaltung der
anderen führte schon Jahre vor Kriegsende zur Spaltung
der deutschen Bevölkerung.
Die Folgen zeigten sich bald. Mit dem Herannahen
der Front (Dezember 1944) wurden von den rund 22000
Deutschen im Komitat Komorn (nach VDU-Unterlagen)3
aus 17 Ortschaften 4800 von der deutschen Wehrmacht
evakuiert. Die zurückgelassenen Haustiere und Nahrungsmittelvorräte dienten der Versorgung der Soldaten.
Die Zahl von 4800 Evakuierten scheint mir viel zu hoch
gegriffen. Aus Tarian z. B. sollen 362 Personen
evakuiert worden sein. Josef Mikonya berichtet von
2915. Mir sind namentlich nur 145 bekannt, von denen
noch vor Kriegsende 98 zurückgekehrt sind ( >
Namensliste). So ähnlich dürfte es auch in anderen
deutschen Dörfern gewesen sein.
Kaum hatten sich die Menschen von dem Schock des
Krieges erholt, folgte 1946 die Enteignung von
Deutschen. In erster Linie waren davon die Volksbündler
betroffen, aber auch andere. Daraus erkennt man, dass
die Zugehörigkeit zum Volksbund nur ein Vorwand war.
Aus ärmeren Komitaten des Landes kamen ungarische
Siedler in die deutschen Dörfer. Sie erhielten Ackerland,
Haus und Vieh. Damit wurde nicht nur der wirtschaft114
liche Ruin der »Schwaben« eingeleitet, sondern auch
ihre beschleunigte Assimilierung ins Ungarntum. Die
verheerenden Folgen sind heute deutlich sichtbar.
1947 machte sich in den deutschen Dörfern des
Komitats wieder Angst und Unsicherheit breit, das
Gerücht von der bevorstehenden Aussiedlung der
Deutschen ging um. Aber nur aus Kirwa, Leinwar, Somor
und kirne erfolgte eine Vertreibung (aus den ersten drei
Dörfern schon 1946). Im Jahr darauf sprach man erneut
von der Aussiedlung der Deutschen und Slowaken.
Tatsächlich wurden aber Slowaken nur aus Bokod,
Piliscsév, Tardos u. a. auf freiwilliger Basis in die
Slowakei umgesiedelt. Rund 70 000 Slowaken verließen
damals Ungarn. Im Austausch kamen Madjaren aus dem
ehemaligen Oberungarn in das benachbarte Komitat,
aber auch in deutschbewohnte Komitate Süd-Ungarns.
Da meist arme Slowaken ihr Glück im Mutterland
suchten, die nicht viele Immobilien hinterließen, siedelte
man die "Felvidéker" (= Oberländer), wie man die
Ungarn aus der Slowakei bezeichnet, hauptsächlich in
deutschen Dörfern an.
Das machte die Enteignung von weiteren deutschen
Familien erforderlich. In mancher Ortschaft lebten nun 45 Sorten Menschen. Die räumliche Enge in den
Häusern, die andere Sprache, Religion und Herkunft
führte im ersten Jahrzehnt des Zusammenlebens häufig
zu schweren Auseinandersetzungen.
Im Zuge der Umgestaltung der Wirtschaft und des
politischen Lebens (Kollektivierung der Landwirtschaft,
Verstaatlichung der Industrie, Machtübernahme der
Kommunisten) kam die Bevölkerung des Komitats erneut
in Bewegung. Viele ungarische Siedler verließen wieder
die Nationalitäten-Dörfer. So mancher früherer
Eigentümer kaufte bei dieser Gelegenheit sein Haus
115
wieder zurück. Um den politischen Druck zu entgehen,
wanderten auch Deutsche in die industriellen
Ballungsräume ab. Immer mehr Menschen suchten ihren
Lebensunterhalt in der Industrie. Die Zahl der Pendler,
die täglich aus den Dörfern in die Städte zur Arbeit
fahren, ist stark angestiegen.
Von dem 144 600 ha landwirtschaftlichen Areals des
Komitats bewirtschafteten 1968 die Staatsgüter 29 %
und die LPGs 35 %. Der Rest entfiel auf die Hofstellen
der LPG-Bauern, auf Arbeiter-Bauern und selbständige
Bauern. Bei dem – zu dieser Zeit – noch in Privatbesitz
befindlichen Ackerland und Weingärten handelte sich um
gebirgiges Gelände, das mit Maschinen nicht zu
bestellen war. Die Zahl der Staatsgüter wurde von 1952
bis 1968 – durch Zusammenlegung – auf weniger als die
Hälfte reduziert. Die durchschnittliche Größe lag 1968
bei 4700 ha!
Als in den fünfziger Jahren die Kollektivierung mit
allen Mitteln vorangetrieben wurde, gab es in jedem Dorf
eine LPG. Viele Gemeinden des Komitats wurden aber
erst in den sechziger Jahren zu "sozialistischen Dörfern",
was soviel bedeutet, dass es keine selbständigen
Bauern mehr gab. Die Kollektivierung erfolgte in allen
Dörfern gleich; egal, ob Deutsche, Ungarn oder
Slowaken die Bewohner waren.
Anfang der 70er Jahre war die Zahl der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften etwa auf
die Hälfte zusam-mengeschrumpft, da jeweils zwei
zusammengelegt wurden. 1968 gab es im Komitat 36
LPGs und 9 Staatsgüter. Die durchschnittliche
Betriebsgröße der LPGs betrug 1400 ha! Seit der
Erhöhung der landwirtschaftlichen Aufkaufspreise und
der Liberalisierung auf wirtschaftlichem Gebiet – in den
60er Jahren – ist der materielle Anreiz, in einer LPG zu
116
arbeiten, viel größer geworden. Das führte zur
Konsolidierung der großbetrieblichen Landwirtschaft.
Von 1960 bis 1968 stieg im Komitat das
Jahreseinkommen eines LPG-Bauern von 8993 Forint
(Ft) auf 23686 Ft. Das sind rund 2000 Ft im Monat. Zur
gleichen Zeit verdiente hier ein Industriearbeiter 2170
Ft/Monat. Während in den ersten Jahren die Deutschen
von der Mitgliedschaft in einer LPG nichts wissen
wollten, war in den vergangenen Jahrzehnten ihre Zahl
ziemlich hoch. In mehreren Gemeinden war ein
"Schwabe" LPG-Vorsitzender. Leiter oder Arbeiter, die
Deutschen wurden überall geschätzt, weil sie gründlich
und zuverlässig waren.
Wie hätte sich die ungarische Landwirtschaft
entwickelt, hätte es die Kollektivierung nicht gegeben?
Da eine weitere Zersplitterung der 1,4 Mio. landwirtschaftlichen Betriebe kaum mehr möglich war, weil
sie fast nicht mehr in der Lage waren, die Familien zu
ernähren, ist anzunehmen, dass eine ähnliche
Entwicklung wie in der westdeutschen Landwirtschaft
eingetreten wäre. Das heißt, auch ohne Kollektivierung
hätte ein Großteil der Bauernbetriebe aufgegeben
werden müssen. Für die Existenz der Nationalitäten
hätte das aber eine langsamere Assimilierung bedeutet.
Wichtige Schmelztiegel für die Madjarisierung der
Natio-nalitäten sind die Industriegebiete um Tatabánya
und Dorog. Während die Deutschen und Slowaken sich
auf den Dörfern noch einigermaßen halten konnten,
wurden sie in den Ballungszentren vom Madjarentum
aufgesaugt. Obwohl auf den Dörfern in den vergangenen
50
Jahren
die
Assimilierung
ziemlich
weit
vorangeschritten ist, findet man bei den Minderheiten
noch ein starkes Zusamrnengehörigkeitsgefühl6. Man
redet eine Misch-sprache oder Ungarisch, fühlt aber
117
noch deutsch oder slowakisch. Das sieht man auch
daran, dass man sich seinen Ehepartner nach wie vor
aus der eigenen Volksgruppe sucht. Die allerjüngste
Entwicklung brachte allerdings viele Mischehen mit einer
hohen Scheidungsrate, was früher gänzlich unbekannt
war. Das sind allerdings auch Begleiterscheinungen des
modernen Industrie-zeitalters.
Das Überleben der Nationalitäten im Komitat KomornGran – wie in ganz Ungarn – hängt davon ab, ob es
ihnen gelingt, ihre Jugend in eigenen Schulen in der
Muttersprache und Kultur zu unterrichten. Da es dafür
keine materielle Grundlage, aber auch keine Einsicht
und geistige Bereitschaft gibt, werden die Nationalitäten
in absehbarer Zeit verschwinden. Ungarn wird damit auf
geistigem Gebiet ärmer werden. Es wird keine
Meinungsverschiedenheiten zwischen Ungarn und
Nichtungarn geben. Aber das wird nicht bedeuten, dass
es nicht andere Konflikte geben wird …
ung./deutscher Name
Ácsteszer
Agostyán-Augustin
Aka
Alsógalla-Untergalla
Baj-Woje (Wallern)
BakonysárkányScharkan
Csolnok-Tschaunok
Ansiedlungszeit Herkunft der Siedler
Bevölk.1935/70
18. Jh. aus verschied.Geb.
1733 bair. Sprachraum
600
576
(95% deutsch)
18. Jh. bair. Sprachraum
1735 bair. Sprachr.u. Elsass
1770 (1941)
(45% deutsch)
1745
1200
und W-Ungarn
1777/78
dt-e Vereine4
VDU 11.5.41
UDV 16.1.26
VDU 7.7.40
VDU 11.5.41
UDV 25.3.28
VDU 1.12.40
Elsass-Lothringen
1782
VDU 20.1040
bair. Sprachraum u.
andere Gebiete
170091738
Elsass
3381
?
118
UDV 15.1. 26
(88% deutsch)
UDV 18.3.30
VDU 10.5.41
UDV 20.2.27
VDU 29.9.40
(57% deutsch)
Dág-Dag(ed)
18. Jh.
?
VDU 29.9.40
1045 (42% dt.)
Dorog
1694
schwäbischer
UDV 10.5.31
5863 10000
Sprachraum
VDU 30.6.40
(17 % deutsch)
Dunaszentmiklós Niklo 18. Jh.
bair. Sprachraum
UDV 16.1.26
600
586
VDU 10.5.41
(95 % deutsch)
Felsögalla-Obergalla
1733
Würzburger Raum
UDV 25.3.28
17110 (1941)
bair.- alleman. Raum
VDU 17.10.40
(13 % deutsch)
Kecskéd- Kätschke
173591744 heut. Baden-Württemberg UDV 14.1. 26
1049
1642
VDU 17.11.40 (91 % deutsch)
Könye-Kirne
1745
Wieselburger Komitat
UDV 13.1.26
2275
4228
VDU 28.7.40 (54 % deutsch)
Leányvár-Leinwar
1755
aus versch. dt. Geb.
VDU 30.6.40
1326 1520(?) (80 % deutsch)
Máriahalom-Kirwa
1785
Geb. des heut. BadenUDV 10.1.26
803 ? Würrtemberg u. a.
VDU 29.9.40
(96 % deutsch)
Mogyorósbánya
1720
Slowaken u. Deutsche
692 900(?)
18% deutsch
Nyergesújfalu- Neudorf 1700,1732
heut. BadenWürttemberg
- VDU 8.12.40
2546 4916(?)
17% deutsch
Piszke (h. Lábatlan)
1732
Elsaß-Lothringen
1436 4800(?)
madjarisiert
Süttö-Schitte
1720
Elsass
VDU 8.12.40
1600 1803 (? ) 60% deutsch
Szomód-Samed
1750
heut. Baden Württemberg
1500 1775(?) madjarisiert
Szomor-Sumur
1720 verschied. dt Gebiete
893 667(?)
1737
Schwarzwald und
80% deutsch 2065 2821
bair. Sprachraum
85% deutsch
1702-1732
versch. dt. Gebiete
1499 4500(?) 75% deutsch
Tarján-Tarian
Tát-Taath
119
UDV 18.1.25
VDU 21.7.40
UDV 18.10.25
VDU 20.10.40
VDU 29.9.40
Várgesztes-Gestiz
1735
VDU 24.2.41
Vértessom1ó - Schemling - 1737
889 1286
deutsch
Vértestolna - Tolnau i. Sch. 1733
586 605
bair. u. elsäßischer Sprachraum
361 576
92% deutsch
bair. u. elsäßischer
UDV 10.3.28
Sprachraum VDU
28.7.40 95%
Franken und andere deutsche Gebiete
UDV 18.10.25 VDU 20.10.40
Quellen/Forrásmunkák:
1) Statisztikai évkönyv 1968 (Statistisches Jahrbuch Ungarns 1968), S. 49899
2) O'sváth, Andor: Komárom-Esztergom egyelõre egyesített vármegyék múltja
és jelene, 1938 (Vergangenheit und Gegenwart der vorläufig vereinigten
Komitate Komom und Gran)
3) Tafferner, Anton: Evakuierungsmaßnahmen des Volksbundes ....
Volkskalender der Deutschen aus Ungam, München , 1970, S. 51-53
4) Flach, Paul: Die Ortsgruppengründungen des Volksbundes der Deutschen
in Ungam, Volkskalender der Deuschen aus Ungam, 1968, S.127-142
5) Mikonya, József, Tarjáni krónika, Tarján község a történelem tükrében
(Tarianer Chronik, Die Gemeinde Tarian im Spiegel der Geschichte), 1992,
S. 82. o.
6) Demeter Zayzon Mária, Öntudatosodás és önfeladás között–
Nemzetiségszociológiai vizsgálatok Komárom-Esztergom megyei németek és
szlovákok körében (Zwischen Bewußtwerden und Selbstaufgabe –
Nationalitäten-soziologische Untersuchungen in den Reihen der Deutschen
und Slowaken im Komitat Komorn-Gran), Tatabánya 1993, 134 o./S., 1
térkép/Karte
Besonderheiten der mittelbairischen ua-Mundart
Die ua-Mundart ist eine der größten deutschen Dialekte
in Ungarn. Sie wird in NO-Transdanubien gesprochen.
Der Name »ua« kommt daher, dass das u als Inlaut als
ua gesprochen wird: Mutter -> Muada, Blut -> Pluat, Kuh
-> Kua u. a. (-> Die Flurnamen...; -> So lebten wir... )
Es ist kein Geheimnis, dass der Weiterbestand der
deutschen Minderheit in Ungarn in sehr starkem Maße
gefährdet ist. Dies trifft besonders für die Deutschen im
Transdanubischen Mittelgebirge zu. Besucht man heute
120
von Deutschen bewohnte Dörfer, hört man nur noch
selten ein deutsches Wort. Unterjungen Menschen
deutscher Herkunft findet man kaum welche, die den
Dialekt ihrer Eltern oder Großeltern sprechen.
Woran liegt es, dass die Nationalitätenjugend kein
Interesse zeigt für die Sprache der Vorfahren? Sicher
spielen dabei die bitteren Erfahrungen, die die ältere
Generation in den Jahrzehnten vor und unmittelbar nach
dem Zweiten Weltkrieg gesammelt hat, auch einegewisse Rolle. Wichtiger ist m. E. die Zerstörung der
geschlossenen Siedlungsweise der Deutschen. Während früher ganze Dörfer oder Straßenzüge von
Deutschen bewohnt waren, ist dies jetzt nicht mehr der
Fall. Durch die Aus- und Umsiedlung wurde auch die
sprachliche Umgebung radikal verändert. (-> Die Nachkriegszeit) Die Kinder werden dadurch schon auf der
Straße mit der Staatssprache konfrontiert.
Infolge der Umstrukturierung im politischen und
wirtschaftlichen Bereich mußten sehr viele »Schwaben«
ihren Beruf in der Landwirtschaft aufgeben und in der
Industrie neue Arbeit suchen. Dies hat den Madjarisierungsprozeß ebenfalls beschleunigt.
Nach 1945 war es auch mehr Schwabenkindern
möglich, höhere Schulen zu besuchen als vorher ( ->
Statistik). Das war auch in Tarian der Fall. Jene, die
Abitur gemacht oder die Universität besucht haben, sind
für das Volkstum verloren, da sie meistens außerhalb
ihrer engeren Heimat Beschäftigung finden. Dadurch
gehen der deutschen Volksgruppe die Intellektuellen
verloren, die für die Pflege der Sprache so bitter nötig
wären.
So ist es nicht verwunderlich, dass der Weg unserer
Landsleute von der Muttersprache über die Misch121
Sprachigkeit früher oder später zur Staatssprache führen
wird. Mit anderen Worten: Die Großeltern sprechen fast
nur deutsch, die Eltern lernten auch mehr oder weniger
nur ungarisch, die Enkel sprechen nur noch ungarisch.
Die Massenmedien (Fernsehen, Rundfunk, Presse,
Kino) tragen natürlich auch dazu bei, dass die Jugend
immer mehr assimiliert wird.
Wie die sprachwissenschaftliche Forschung erwiesen hat, ist die Mischsprachigkeit, wie sie auch bei
den Min-derheiten in Ungarn anzutreffen ist, mit großen
Gefahren für die geistige Entwicklung verbunden. Da der
Mensch im wesentlichen einsprachig angelegt ist,
besteht die Gefahr, falls er in einem mischsprachigen
Milieu aufwächst, dass er weder seine Muttersprache
noch die Staatssprache richtig beherrscht. Bei genauem
Hinsehen finden wir dies bei der breiten Masse der
nationalen Minderheiten in Ungarn bestätigt.
Da die Möglichkeit zum nichtigen Erlernen der
Muttersprache im Kindergarten und in der Schule für die
große Masse der Kinder - trotz der seit 1990 verbesserten Situation - nicht gegeben ist, geht die Jugend
unbewußt einen Weg, der zur Einschmelzung ins
Staatsvolk führt. Von der psychischen Seite her gesehen
ist das verständlich.
Vielfach findet man unter Jugendlichen auch die
irrige Meinung, es lohne sich nicht, den Dialekt zu
erlernen, da er mit dem Hochdeutschen nichts gemein
hat. Bei genauem Hinsehen findet man gerade das
Gegenteil bestätigt. Beim Sammeln von Wörtern der
vom Aussterben bedrohtem ua-Mundart in Tarian und
Umgebung sind mir eine Reihe von Besonderheiten
aufgefallen, die hier kurz besprochen werden sollen.
Bei meiner Arbeit fiel mir auf, dass - wie nicht anders
zu erwarten - sehr viele Gemeinsamkeiten mit dem
122
Österreichischen, Bairischen und Süddeutschen vorhanden sind. Auf der anderen Seite sind wiederum viele
Wörter anzutreffen, die man im oberdeutschen
Sprachraum nicht oder nicht mehr findet. Die Zahl der
Lehnwörter aus dem Ungarischen ist auch beträchtlich.
Man muß zunächst unterscheiden zwischen Wörtern, die
im Hochdeutschen (a) nicht vorkommen und solchen, die
zwar vorkommen, aber deren Aussprache in der
Mundart anders ist (b).
Hier sind nun einige Beispiele zu Punkt a): Für
Specht sagt man Pampecker, zur Elster Kagratschkatl,
zur Libelle Glasschneider, zum Blutegel Pluatzuzl, für
Stechmücke Gelsen oder Gölsn, für (Albino-)Kaninchen
Kiniglhas, zur Weintraube Weinper(= Weinbeere), zur
Waldrebe Lülischwiedn, zum Meerrettich Krein, für
Quecke (= Ackerunkraut) Beier, zur Frucht der
Komelkirsche Dirndl-Tiandl, zum Schweinestall Mäststeig, zur Schusterahle Schuhwertl, zur Kommode
Schubladkasten, zum Gespräch Dischkursch, zum
Rauch Rauger, zum Spielzeug Gespiel-Gspül, zum Kies
Schauder oder Schoder, zur Speckgriebe Grammel, zum
Hamster Gritsch, für Geschwür Aß, für Eiterbläschen
Wimmerl, für Holzschlappen Klumpen, für grobes Sieb
Reider, für Rheuma Reißen, für Steingutflasche mit
dickem Bauch Plutzer, für nächstes Jahr aufs Johr.
Zu schwätzen sagt man neben plappern auch
pletschkern oder plauschen, zu ohrfeigen (schlagen)
anpritschn, zu anstoßen (mit dem Glas) titschn, zu
wärmen gwarmen, zupanieren auspochen, zu kühlstellen
einfrischn, zu hören losn, zua ufs Wort hören auflosn, zu
verschleppen verza(rr)n (zu zerren), zu verwöhnen
vergweinen, zu nach etwas greifen glangen (von
langen), zu einpacken einpackieren.
123
Für albern, kindisch pflegt man dalked oder
toikert zu sagen, zu laufend, immer wieder alleritt, zu
steil (Berg), plötzlich gach, zu langsam stad, zu duftig,
duftend gschmecked.
Bei Wörtem, die im Hochdeutschen vorkommen,
deren Aussprache aber in der Mundart anders ist (b),
finden wir vor allem im Bereich der Selbstlaute oder
Vokale eine starke Lautverschiebung. So wird das o
vielfach als au gesprochen: doch -> dauch, Loch ->
Lauch, Brombeere -> Braumb(ee)r. Das ö wird als e
oder ei gesprochen: Löffel -> Leiffl, Böschung ->
Besching, können -> keinna, das Gröbste -> Greibste.
Der ei Laut wird in der Mundart als a gesprochen: heim > ham, Eichel -> Achl, Ei(er) -> Ar, Geiß -> Gaß, aber
Weide -> Wiedn, Ziesel -> Zeisl. Die Laute ee, e und er
werden zu aa und a: leer -> laar, leeren -> auslaarn,
schwer -> schwar. Schere -> Schar.
Der Laut ü wird einerseits zu ie und andererseits
ie zu ü: viel -» vül. Stiel -> Stül, Kiel ->Kül, Tür -> Tier,
grün -> grie(n), Schlüssel -> Schliessl. Ü kann auch als u
gesprochen werden: rücken -> rucken, Stück -> Stuck.
Der Selbstlaut a wird fast immer als o gesprochen:
klagen -> klogen, Hase -> Hos, Wasser -> Wosser,
Waage -> Woog. Aber a kann auch als ä gesprochen
werden und umgekehrt: scharren -> schä(rr)n, nähen ->
nahn-, blähen -> blahn. Bei den Mitlauten oder
Konsonanten finden wir nur bei b eine Lautverschiebung:
b wird zu w Babi (Barbara) -> Wawi, Schober ->
Schauwer, b kann auch als (e)m ausgesprochen
werden: verderben -> vrderem, Garbe -> Gorem, Stube > Stuum.
Die Endung -ung wird meistens zu -ing:
Böschung -> Besching, Leitung -> Leiting, Stimmung ->
Stimming.
124
Typisch für die bairische Mundart in NordostTransdanubien ist das Auslassen von Konsonanten:
Laden -> Loden -> Loen, Brett -> Brettel -> Breel,
stehlen -> stöhln -> stöln. Charakteristisch ist ferner die
Unterdrückung des unbetonten e am Ende von Wörtern:
Katze -> Kotz, Hase-> Hos. Manchmal wird an das
unbetonte e noch ein n drangehängt: Fliege -+ Fliegn.
Die Infinitivendung -en der Verben wird meistens als -a
gesprochen, z. B. gwarma (wärmen), larma (lärmen). Die
Vorsilbe er- wird durch der- ersetzt, z. B. erschießen
heißt derschießn -> taschießa.
Eigenartig istauch die Befehlsform oder der Imperativ:
trinkt -> trinkts, schreibt -> schreibts! Das s kommt von
E's (= Ihr), d. h. tinkt E’s = trinkt's! Die Möglichkeitsform
oder der Konjunktiv ist auch anders als im Hochdeutschen: Ich täte -> i tared, ich möchte -> i meiched,
ich wäre -> i wared.
Die Mehrzahlbildung der Hauptwörter folgt
ähnlichen Regeln wie im Hochdeutschen: Singular und
Plural der Substantive: Föd - Föda, Ocka - Aka, Wiesn Wiesen, Koatn - Kartn, Peik - Peanga, Oafa, Oafn - Öife,
Öifn.
Es ist interessant, dass in der transdanubischen
ua-Mundart von den drei Formen der Vergangenheit nur
das Perfekt vorkommt. Man sagt also: »lch hab
gesungen«, aber nicht: »lch sang« oder »lch hatte
gesungen«. Eine weitere Möglichkeit, die Vergangenheit
auszudrücken, ist: »lch habe gesungen gehabt«. Bei
dem persönlichem Fürwort „wir" findet man stets „mir".
„E's“steht dagegen für „Ihr" und „Sie"(Höflichkeitsform Nominativ Plural). Für „euch, euer" und „Sie" (Akkusativ)
verwendet man dagegen „enk, enker, eingi, eingri".
Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass in
der ua-Mundart (sicher auch in anderen donauschwä125
bischen Dialekten) keine genaue Unterscheidung
von(harten und weichen Konsonanten möglich ist:
Leiting - Leiding, bumpern - pumpern. Diese Tatsache
bereitete uns beim Erlernen des Ungarischen, wo es
darauf ankommt, die Mitlaute genau zu unterscheiden z. B. bor (Wein) - por (Staub), manche Schwierigkeit.
Aus der Fülle der Lehnwörter aus dem Ungarischen seien auch noch einige Bei- spiele angefiihrt:
Pogatscherl - pogácsa, Juari - Gyuri, Joschi - Józsi,
Oldamasch - áldomas, Raadasch (Zugabe) - ráadás,
Schor (Reihe) - sor, Leckwar - lekvár, Golitzl - gálic,
Tschadig - csáté, Tscholomadi - csalamáde, Tschinger csinger, Tschinagel, Tschinogn - csónak.
Viele Fremdwörter lateinischer, französischer,
italienischer und anderer Herkunft sind unserer Mundart
und mit dem Ungarischen gemeinsam: Tschik, Trafik,
Paradeis, Paprika usw.
In der ua-Mundart gibt es keinen sächsischen
Genitiv. Der Genitiv wild durch Umschreibung angedeutet. Man sagt also nicht z. B. »Mayers Haus«,
sondern »dem Mayer sein Haus«. Unbekannt ist auch
der sogenannte germanische Plural, d. h. die Angabe
der Mehrzahl durch ein -s: Jungs, Mädels, Kerls.
Als Verkleinerungsform kommt hier nur die
Endung -l in Frage: Kind - Kindl (oder Kinderl), Tür - Türl,
Brücke - Brickl.
In dieser kurzen Abhandlung konnten die
wichtigsten Besonderheiten der bairisch-österreichischen Mundart in Transdanubien natürlich nur angedeutet werden. Im Hinblick auf die Erhaltung des deutschen Volkstums hätte man schon vor Jahrzehnten die
ungarndeutschen Mundarten erforschen müssen*. Man
hätte noch zu einer Zeit, als die Menschen in einem
intakten Sprachmilieu lebten, ein ungarndeutsches Wör126
terbuch herausgeben und das der breiten Öffentlichkeit
zugänglich machen sollen. In Publikationen (Zeitungen,
Kalendern und Büchern) hätten spezifisch ungarndeutsche Wörter mehr Verwendung finden sollen (wie
dies in der österreichischen Schriftsprache auch der Fall
ist).
Mit dem Anschluss Tarians ans Satellitenfernsehen und anschließender Verkabelung sind seit
Dezember 1990 im Dorf auch deutsche Fernsehsendungen zu empfangen. Dies wird zwar den Dialekt
vor dem Aussteiben nicht retten, aber es könnte dazu
beitragen, dass Deutsch im Dorf weiterlebt und gepflegt
wird. Dazu wird auch die Partnerschaft mit Staufenberg
(seit April 1991) beitragen.
Aufgrund der veränderten Lebensumstände ändert sich auch der Mundartwortschatz, alte Wörter - aus
dem bäuerlichen Lebensbereich - sterben aus, neue
kommenhinzu. Dank des Kontakts der Tarianer mit dem
deutschen Sprachraum, der seit den 60er Jahren des
20. Jahrhunderts kontinuierlich zunimmt, finden neue
Wörter Eingang in die Alltagssprache...
*) 1) Huterer, Claus Jürgen, Das Ungarische Mittelgebirge als Sprachraum,
Halle/S., 1963
2) Ders., Aufsätze zur deutschen Dialektologie, Budapest, 1991
Nationalitätenprobleme in der r.k. Kirche
Nachdem Zweiten Weltkrieg machte die sprachliche
Diskriminierung auch vor den Kirchentüren nicht halt. In
der Zeit des stärksten Nationalismus zwischen den
beiden Weltkriegen hatten die nationalen Minderheiten
(Deutsche, Slowaken, Kroaten, Serben und Rumänen)
wenigstens teilweise noch Gelegenheit, das Wort Gottes
127
in ihrer Muttersprache zu hören. Dies wurde nach 1945
anders. Von nun an wurde auch in solchen Gemeinden
ungarisch gepredigt, in denen die Mehrheit der
Gläubigen Nicht-Magyaren waren. Auf politischem
Gebiet verhielten sich die Deutschen vollkommen
passiv. In den kirchlichen Organisationen blieben sie
jedoch weiterhin aktiv. Sicher, die Priester hatten in den
gemischtsprachigen Pfarrgemeinden einen schweren
Stand, sie mußten die bestehenden Gegensätze, die
hauptsächlich wirtschaftlicher und sprachlicher Natur
waren, ausgleichen.
Im Zeichen des politischen Tauwetters 1955/1956
machte die Regierung auch der deutschen Minderheit
Konzessionen. In dieser Zeit erfolgte die Gründung des
»Verbandes der deutschen Werktätigen in Ungarn«. In
den deutschbewohnten Dörfern wurde die Forderung
nach erneuter Einführung der deutschen Sprache in der
Kirche immer lauter. In unserer Gemeinde, in der ca. 90
% der Katholiken deutscher Muttersprache waren, wurde
die Diskussion darüber mit solcher Heftigkeit geführt,
dass zwei Seelsorger nacheinander versetzt werden
mussten.
Der Tarianer r. k. Pfarrer Dr. Béla Erdössy fasste
1
(1957) seine Meinung über die Nationalitätenfrage
folgendermaßen zusammen: „Ich muß gestehen, dass
ein großer Teil der Priester, so auch meine drei
unmittelbaren Vorgänger auf dem starren nationalistischen Standpunkt steht, der etwa so lautet: ,Wer
ungarisches Brot ißt, der soll auch ungarisch reden, wer
das nicht tun will, der gehe nach Deutschland.‘ Die
Kirche und so auch ich stehen dem Standpunkt des
christlichen Universalismus, denn ,Da ist nicht mehr
Grieche und Jude, Barbar, Skythe, Knecht und Freier,
128
sondern alles und in allen Christus.‘ (Paulus an die
Gemeinde in Kolossä 3, 11). Die Kirche steht also über
den Völkern und sie will diese für Christus gewinnen.
Pius XI. sagte 1926 zu den Seelsorgern: ,Die Priester
sollen bei den Völkern niemals den Eindruck erwecken,
dass die Kirche sie in der Aufrechterhaltung ihres
angestammten nationalen Charakters hindert. Die Kirche
anerkennt alle ererbten Gefühle, so auch das Festhalten
an der eigenen Volksgruppe. Sie ist deshalb katholisch,
weil sie alle Nationen und Rassen umfaßt und weil die
Religion niemals gegen die Erhaltung der nationalem
Eigenart benutzt werden kann.‘ (in »Schöne Zukunft«,
Jahrgang 6, Nr.11)
Hier sei auch der Beschluß der 8. Internationalen
Minderheiten-Konferenz vom Jahre 1932 in Genf
angeführt: Nach Anhören der berufenen Vertreter der
Kirchen stellt der Kongreß mit großer Genugtuung fest,
dass seine Forderung, welche sich um die Erhaltung des
Volkscharakters bemüht, mit der Lehre der Kirchen
übereinstimmt. Die Kirchen bauten seit Jahrhunderten
ihr Funktionieren auf die Volkstümlichkeit und sie
anerkannten und anerkennen das heilige Recht der
Gläubigen, ihre religiösen Pflichten in ihrer Muttersprache zu erfüllen. Er bittet die Kirchen, sie mögen die
natürlichen Rechte der Minderheiten unterstützen. Es
braucht gar nicht gesagt zu werden, dass die jetzige
Verfassung und ihre Exekutive den Minoritäten jedes
Recht zubilligt. Natürlich macht sie damit die nach dem
Krieg begangenen Fehler nicht gut.«
Im folgenden schildert Pfarrer Dr. Erdõssy seine
Erlebnisse in der Pfarrgemeinde von Tarian: „Von diesen
Thesen ausgebend entschloß ich mich, die stiefmütterliche Behandlung (der Deutschen) zu ändern,
welche sowieso nicht mehr aufrechtzuerhalten war,
129
nachdem 1956 die deutsche Sprache in den Schulen
freiwilliges Fach wurde, nachdem man im Jahre 1957
deutsche Gymnasien eröffnet hat, 1958 der
Ratsvorsitzender einer mit deutscher Muttersprache
wurde.
Am Christkönigsfest 1957 fügte ich meiner Predigt
einige deutsche Worte hinzu und in der Messe wurde
auch ein deutsches Lied gesungen. Am 1. Dezember
wählten wir dann Herrn Josef S. zum Kantor, von dem
wir wußten, dass er uns in unseren sprachlichen
Anliegen unterstützt. Das alles geschah nicht wegen der
deutschen Sprache, sondern zur Stärkung des Glaubenslebens.
In Sachen Sprachengebrauch ist jede Entscheidung
dem Oberhirten vorbehalten. Ich versäumte jedoch, die
Genehmigung des Oberhirten einzuholen. Es war ein
Fehler, vor der Entscheidung der deutschen Sprache in
der Kirche Raum zu geben, da wir dadurch auch den
Zorn der ,Felvidéker‘ (ungarischen Siedler) hervorgerufen haben. Diese Nachgiebigkeit war aber nur
geringfügig. Außer den oben erwähnten Fall erklangen
nur ein-zwei Weihnachtslieder nach den Messen.
Am 20. Januar 1958 suchte mich eine Delegation
unter Führung des Faßbinders Josef Straubinger auf und
verlangte mit Nachdruck die Wiedereinführung der
deutschen Sprache. Am 2. Februar hielt der
Kirchenvorstand in dieser Angelegenheit eine Sitzung
ab. Wir haben den Wunsch der Gläubigen mit der
Halbierung der Messen umrissen. Die Antwort des
Oberhirten gestattet für eine dreimonatige Probezeit
monatlich eine deutsche Messe in der Hoffnung, dass
dadurch die Zahl der Kirchgänger zunimmt. (…)
Die Probezeit ist abgelaufen. Inzwischen hat auch ein
Artikel der (Budapester) Neuen Zeitung (14. Febr. 1958)
130
3
die hitzige Gruppe ermuntert.
Die Zahl der
Kirchenbesucher hat zwar nicht wesentlich zugenommen, die Deutschen waren sich auch nicht einig, die
Tonangeber blieben auch weg, aber wir haben die
Erlaubnis bekommen.
Die Freude verderben die Felvidéker, da sie nicht in
die deutsche Messe kommen. In die frühere Messe
können sie auch nicht kommen, sie lehnen das
Steuerzahlen ab, sie sind auf mich böse.
So dass man sich mit der Sache noch befassen
muss.
In den deutschsprachigen Messen habe ich auch
gemeinsame ungarische Gebete eingeführt. So kann nur
von gemischtsprachigen Messe die Rede sein.
Die Zahl der ungarischsprachigen Messen ist rund
4mal größer als die der gemischtsprachigen. Ich
versuchte noch einmal die Sprachenfrage zugunsten der
ungarischen Sprache zu regeln. Auf der Sitzung vom 7.
Dezember 1958 machte ich verschiedene Vorschläge,
die deutschsprachigen Vertreter stimmten jedoch alles
entschieden nieder. Die Felvidéker mußten auch
einsehen, dass das Nationalitätengefühl sehr tiefe Wurzeln hat, nicht nur außerhalb des Pfarrgemeinderats,
sondern auch innerhalb.
Unter Vorsitz des Chefs der Diözesankanzlei György
Vitányi fand dann am 25. Januar 1959 erneut eine
Sitzung statt. Er teilte uns mit, dass von nun an infolge
der zunehmenden Madjarisierung der Gemeinde nur
noch einmal im Monat im Hochamt und in einer anderen
Messe deutscher Gesang erlaubt sei. Dies wurde dann
auch nach gewissem Widerspruch und Zögerung
verwirklicht. Gott gäbe, dass diese Entscheidung Frieden bringen möge.“
131
Eines Tages werden die Historiker dieses nationalistische, unchristliche Verhalten der Oberhirten und
Pfarrer der Ungarischen Katholischen Kirche gegen über
den Ungarndeutschen verurteilen. Wie obiges Zitat zeigt,
haben sie den Wunsch nach deutschen Gottesdiensten
mit fadenscheinigen Argumenten abgelehnt. Den
Wunsch von zweitausendeinhundert eingesessenen
Deutschen ablehnend erfüllten sie den Willen der etwa
200 eingesiedelten Felvidéker…
Seither sind rund 40 Jahre vergangen und an der
sprachlichen Situation der Tarianer »Schwaben« hat
sich nichts verändert. Einige Pfarrer zeigten in dieser
Zeit Verständnis für die Deutschen, so z. B. Otto Kormos
und Gábor Vendrey, aber alles blieb beim alten!
Ohne die Opferbereitschaft der Tarianer Deutschen,
auch der im Westen lebenden, wäre die r. k. Kirche
heute eine Ruine! Sie haben – trotz der diskriminierenden Behandlung durch die Kirchenführung – die
von ihren Ahnen erbaute Kirche nicht im Stich gelassen
…
Die Lage hat sich Anfang der 90er Jahre sogar noch
verschlechtert: Jahre lang gab keinen Pfarrgemeinderat.
Nach der dem Sturz des Kommunismus keimte
erneut die Hoffnung, dass sich in dieser Angelegenheit
etwas zum Besseren verändern werde. Ich schrieb 1989
zwei offene Briefe an die Vorsitzenden der ungarischen
und deutschen Bischofskonferenzen.2 Der ungarische
Oberhirte zeigte sich – wie ich aus seiner Umgebung
erfuhr – darüber erbost! Obwohl er kurz zuvor bei einem
Besuch in der Karpato-Ukraine die dortigen Ungarn zum
Festhalten an der Muttersprache ermunterte, hielt er es noch nicht einmal für nötig, auf meine
Bitte – den Ungarndeutschen speziell auch in der
132
Erzdiözese Gran dieselben Rechte einzuräumen – zu
antworten ...
Der Ortspfarrer wehrt die Bitte nach deutschsprachigen Gottesdiensten in gewohnter Manier ab: Die
Leute würden kein Deutsch mehr verstehen! Darüber
gibt es natürlich keine Untersuchung. Der Pfarrer spricht
selber kein Wort deutsch, wie sollte er die Lage
beurteilen? Sporadisch abgehaltene deutsche Messen
sind sehr gut besucht!
Römisch-katholische Pfarrer von Tarian
1 Koller, Johann Georg
1756 – 1762
2 Légrádi, Ferenc
1762 – 1807
3 Viturka, Georgius
1807 – 1810
4 Balásy, Ferenc
1810 – 1814
5 Szent Iványi, József
1814 – 1850
6 Dragfy, Nándor
1851 – 1879
7 Toczek, János
1879 – 1904
8 Pálmai, Ferenc
1904 – 1914
9 Niederrnann, Josef
1914 – 1937
10Lezsánszki, József
1937 – 1947
11 Fütty, Imre
1947 – 1948
12 Szabó, Lajos
1948 – 1957
13 Dr. Erdössy, Béla
1957 – 1960
14 Kormos, Ottó
1960 – 1968
15 Miklós, László
1968 – 1971
16 Parádi, Gyula
1971 – 1976
17 Juhász, László
1976 – 1983
18 Vendrey, Gábor
1983 – 1989
19 Varga, Lajos
1989 –
133
Reformierte Seelsorger
1 P. Pátkai, Sámuel
1732–1763
2 Von 1763 bis 1785
keine
Matrikeleintragungen
3 Györi, Imre
1785–1801
4 Kenesey, József
1801–1806
5 Sólyomfi, Gábor
1806–1811
6 Torday, Mihál
1811–1848
7 Horváth, Sámuel
1848–1850
8 Szabó, Pál
1850–1859
9 Gál, Lajos
1860–1866
10 Balassa, Lajos
1867–1868
11 Somogyi, Antal
1869–1875
12 Mészáros,Károly
1775–1876
13 Kelemen,János
1877–1887
14 Virágh,Sándor
1887–1891
15 Pongrácz,János
1891–1892
15 Nagy, Kálmán
1892–1907
16 Besse, Lajos
1908–1953
17 Kocsis, Sándor
1954–1955
18 Perjési, Ferenc
1955–1959
19 Vargha, Kálmán
1959–1970
20 Németh, Lajos
1970–1972
21 Szabó, István
1972–1977
22 Németh, Lajos
1978–1981
23 Máté, Sándor
1982–1985
24 Tóth, Péter
1986–1989
25 Tislér, Géza
1989–1990
26 Szücs, Antal
1991–
2) Mitgeteilt von Pfr. Antal
Szücs, 1995
134
Dorfrichter von Tarian
1 Werli, Simon
1774
2 Weiler, Nikolaus
1780
3 Kranz, Josef
1787
4 Iseli, Josef
1790
5 Sedelmayer, Adam
1800
6 Miller, Johann
1804
7 Lottenberger, Stefan
1809
8 Újszászi Péter
1819
9 Iseli, Peter
1826
10 Somogyi István
1845
11 Bachmann, Martin
1846
?
?
12 Götz, Paul
1858
?
?
13 Mayer, Martin
1894
14 Pertl, Johann
1900
15 Berendi, Michael
1903
16 Schalkhammer,
Andreas
1907
17 Weiler,Franz
1919
18 Goldschmidt, Franz
1924
19 Pertl, Georg
1927
20 Goldschmidt, Franz
1934
21 Kranz, Anton
1939
22 Szalai László
1945-50
3
Ratsvorsitzende
Über die Amtsinhaber der Ratsvorsitzenden in der Zeit
von 1950 bis 1990 liegen keine genauen Aufzeich135
nungen vor. Sie wurden von der kommunistischen Partei
je nach Bedarf ein- und abgesetzt. Diese Zeit ist in der
Gemeindegeschichte als eine Phase der Stagnation
anzusehen, obwohl wichtige Maßnahmen – wie die Erweiterung des Dorfes, der Bau der Wasserleitung 1973 –
in diese Epoche fallen …
Namen der Ratsvorsitzenden in der Reihenfolge ihrer
Amtszeit mit 1950 beginnend und 1990 endend:
1
2
3
4
5 Molnár Károly
6 Rajna Sándor
7 Dékány János
Ollé Gábor
Balogh Ferenc
Kupor Józsefné
Korpás Sándor
3) Mikonya, József; S. 30. Von wann bis wann sie ihr Amt ausgeübt haben,
konnte J. M. nicht ermitteln. Die Schreibweise der Familiennamen wurde der
deutschen Rechtschreibung angepasst.
136
Die Tarianer reformierte Kirchengemeinde
A tarjáni református hitközösség
Wie aus der Zeittafel ersichtlich, wurde Tarian nach
seiner Vernichtung durch die Türken (1529) erst wieder
1640 mit reformierten Ungarn besiedelt. Sie hatten ab
1646 eine Pfarrgemeinde. 1673 (nach anderen Angaben
1674) wurde ihr Seelsorger vor den Gerichtshof nach
Preßburg zitiert. Über sein weiteres Schicksal ist nichts
bekannt.
Aufgrund der als Carolina resolutio genannten
Gesetze Nr. 25 und 26 des Jahres 1681 wurde die
Tätigkeit der reformierten Kirche und die Gründung von
Konfessionsschulen erlaubt. Daraufhin wurde 1682 in
Tarian auch die reformierte Schule gegründet. Sie
bestand aus einem Klassenraum in einem Bauernhaus.
1731 wurde in der 2. Carolina resolutio das Recht auf
freier Glaubensausübung in den 1681 aufgezählten
Ortschaften bestätigt. Tarian gehörte sicher zu den
genannten Siedlungen, denn 1732 begann hier der erste
– namentlich bekannte – ref. Pfarrer Sámuel P. Pátkai
seine Tätigkeit. (> Namensliste der ref. Pfarrer) In seine
Dienstzeit fiel die Ansiedlung der ersten 40 deutschen r.
k. Siedler (1737).
Wie sich der doppelte Gegensatz – Religion und
Volkszugehörigkeit – auf das Zusammenleben der
Ungarn und Deutschen auswirkte, wissen wir nicht.
Sicher war die Verfügung des Grundherrn, Josef
Esterházy, vom 5. Februar 1747, die von den Calvinisten
genutzte Kirche samt der 65 Pfund Glocke an die
Katholiken zu übergeben, nicht geeignet, den Frieden zu
fördern. Auch dann nicht, wenn es sich um die
137
Rückgabe einer ehemaligen katholischen Kirche handelt,
wie behauptet wird.
Die feindliche Haltung des Grundherrn
und der r. k. Kirchenführung gegenüber den
Reformierten wirkte sich bestimmt auch auf
das gemeine Volk aus. Dennoch wird nirgendwo über offene Konflikte zwischen
beiden Volksgruppen berichtet. Im Endeffekt
saßen beide im gleichen Boot, d. h. sie
waren bis 1848 Leibeigene (Fronbauern)
und danach Klein- und Mittelbauern, die hart für ihr
tägliches Brot arbeiten mussten.
1758 – nach anderen Quellen 1763 – stellte die ref.
Kirche ihre Tätigkeit in Tarian ein und nahm diese erst
wieder 1783 bzw. 1785 auf. Die letzten Eintragungen
von reformierten Christen in die r. k. Matrikel von Tarian
erfolgten am 11.März 1787, am 10.Mai 1788 und am
13.Dezember 1789. Von 1779 bis 1785 dauerte der
Neubau der ref. Kirche im Hinterhof des Pfarrhauses.
Offensichtlich ließ es der Grundherr nicht zu, sie auf
einem Dorfplatz zu errichten, sondern nur im Hinterhof,
in gleicher Höhe wie die Scheunen. ( > Foto) Die Häuser
der Calvinisten befanden sich – seit jeher – in der Nähe
ihrer Kirche. So kam es auch zu einer räumlichen
Trennung der beiden Glaubensgemeinschaften. Die
Reformierten wurden von uns nach dem Reformator
Johann Calvin (1509–1564) Calviner genannt (korrekt
muss es Calvinisten heißen).
Schräg gegenüber des ref. Pfarrhauses (heute:
Rákóczi Str. 61) wurde 1910 eine neue ref. Schule
gebaut. Hier wurden alle ref. Kinder des Dorfes von dem
jeweiligen Kantor-Lehrer in einem Klassenraum
unterrichtet. 1948 wurden beide Schulen – die
katholische und reformierte – verstaatlicht. Obwohl das
138
ref. Schulgebäude (heute: Rákóczi Str. 66) 1991 der ref.
Kirchengemeinde zurückgegeben wurde, ist es ungewiß,
ob es jemals wieder eine ref. Schule geben wird, da es
zu wenig ref. Kinder gibt. Aber auch die katholische
Kirche wird wohl aus Kostengründen keine eigene
Volksschule haben wollen.
Während des Ersten Weltkriegs wurde eine Glocke
der ref. Kirche für Kriegszwecke requiriert (ähnliches
geschah auch mit einer Glocke der r. k. Kirche im
Zweiten Weltkrieg). Die ref. Kirche wurde im Zweiten
Weltkrieg von einem Artilleriegeschoss getroffen. Der
Schaden wurde nach dem Krieg bald behoben.
In den folgenden Jahrzehnten verschlechterte sich
der bauliche Zustand der Kirche immer mehr. In den
80er Jahren stellte man fest, dass die Holzbalken der
Deckenkonstruktion vermodert sind, so dass man –
wegen Einsturzgefahr – schon an die Schließung
dachte. Als der damalige Seelsorger Péter Tóth 1989 zu
Studienzwecken in die USA ging, wandte er sich mit
Bittbriefen an die Hilfsorganisation der amerikanischen
Kirchen. Das Kuratorium einer kirchlichen Stiftung
bewilligte 21000 US-$ für die Renovierung der ref.
Kirche von Tarian.
Die Gläubigen im Ort sammelten 35000 Ft, so dass –
mit obiger Summe – im Endeffekt 2,1 Millionen Ft zur
Verfügung standen. Damit konnte die Kirche ganz
erneuert werden. 1991 sind folgende Arbeiten durchgeführt worden: In die Decke wurden neue Betonträger
eingezogen. Die Decke selbst errichtete man aus
betonierten Kassetten. Ein neuer Dachstuhl mit
Eternitplatten bedeckt, neuer Anstrich der Turmverkleidung sowie neue Dachrinnen kamen hinzu. Die
Wände bekamen einen neuen Putz und Anstrich.
Außerdem hat man alle Fenster und Türen erneuert
139
sowie einen Mosaikfußboden gelegt. Sándor Kiss und
seine Familie warben als Kirchendiener unter den ref.
Gläubigen freiwillige Helfer, die den örtlichen Baumeister
Andres Straubinger bei den Renovierungsarbeiten unterstützten.
Die so eingesparten Gelder erreichten die Summe,
die das Presbyterium und die Gläubigen als Bargeld
sammelten. Trotzdem reichte das Geld nicht auch noch
für die Renovierung des Pfarrhauses. Es konnte nur mit
einem Außenputz versehen werden. Wegen der
Überalterung der Gläubigen und der verschlechterten
Lebensbedingungen, muss die Innenrenovierung des
Pfarrhauses für spätere Zeiten verschoben werden.
Nach Aussagen vom damaligen Pfarrer Antal Szûcs* – er wohnte in Héreg
und betreute auch die dortigen ref. Gläubigen, heute lebt er als Pensionär in
Tarian – gab es Ende 1995 in Tarian 160 Erwachsene und 30 Kinder
calvinischen Glaubens. Die Abnahme der Geburten und die größere
Alterssterblichkeit wird zu einem weiteren Rückgang der Calvinisten führen ...
140
Reprivatisierung von Grund und Boden
Die wirtschaftliche Grundlage von Tarian war von jeher
der Boden. Seinet wegen kamen die ersten deutschen
Siedler in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts hierher,
als in ihrer alten Heimat das Ackerland zu knapp wurde.
Als die Zahl der Einwohner des Dorfes immer größer
wurde, nahm auch die Größe der Bauernbetriebe – trotz
langsamer Vergrößerung des Hotters – ab (> Statistik).
Die Nagyatádische Bodenreform von 1920 brachte in
Tarian keine wesentliche Besserung (> Zeittafel).
Manche konnten ihre Familie nur ernähren, indem sie als
Tagelöhner oder Industriearbeiter Geld verdienten.
Die Bodenreform von 1946 war der Anfang vom Ende
der ungarndeutschen Bauernhöfe. Landesweit wurden
neben den Großgrundbesitzern auch die deutschen
Mittel- und Kleinbauern enteignet. Diese Enteignungswelle war etwa 1960 mit der Vollkollektivierung der
Landwirtschaft abgeschlossen. Wegen der ungerechten
und entschä-digungslosen Enteignung der »Schwa-ben«
klangen in deren Ohren die Propaganda-Schlag-wörter
»Befreiung« und »Bodenreform« wie Hohn!
Jahrzehnte vergingen, bis 1989/90 der Kommunismus
in Ungarn abgewirtschaftet hatte. Nach dem Übergang
zu einer demokratischen Regierungs- und marktwirtschaftlichen Wirtschaftsform beschloß am 15. März 1990
das ungarische Parlament die Entschädigung der
ehemaligen (Land-)Besitzer, wobei die Ungarndeutschen zunächst ausgeschlossen blieben. Später
zeigte sich das Parlament großzügiger und beschloß
auch die Entschädigung der ausgewiesenen Ungarn141
deutschen. Viele der Enteigneten erlebten diese
Wiedergutmachung nicht mehr …
Da das Land arm war, konnte es den Betroffenen den
erlittenen Schaden nur teilweise ersetzen und das auch
nur in Form von „Entschädigungsscheinen“ (ung.
kárpótlási jegy), die sie bei der Versteigerung von Land
und sonstigen Immobilien einlösen konnten.
In Tarian kam es im September 1993 zur Landversteigerung aus dem Besitz der LPG. 88 Tarianer und
14 Auswärtige aus Tatabánya, Totis und Kirne – von
denen 5 aus Tarian stammen – erwarben dabei
606,7825 ha Land. Nach der Nutzungsart überwiegt das
Ackerland, dann folgt der Wald und schließlich Weide-,
Öd- und Sumpfland.
Insgesamt wurden von den 88 Tarianern Entschädigungsscheine im Wert von 9,97 Millionen Forint (Ft) bei
der Versteigerung umgesetzt. Je nach der Größe des
enteigneten Vermögens fiel die Höhe der Entschädigungssumme unterschiedlich aus. Von Null bis 10000
Ft erhielten 9 Familien (10%), von 11000–30 000 Ft 11
Familien (12,2%), von 31 000–60000 Ft 13 Familien
(14,4 %), von 61 000–100 000 Ft 18 Familien (20 %),
von 101 000–200 000 Ft 26 Familien (28,9 %), von 201
000 – 300000 Ft 8 Familien (8,9 %), von 301000–
400000 Ft 1 Familie, von 401000–500 000 Ft 2 Familien
((2,2 %) und von 501 000–650 000 Ft 2 Familien (2,2
%).
Die neuen Landbesitzer mußten sich – aufgrund des
Gesetzes XXV/23/1 aus dem Jahre 1991 – verpflichten,
das Land in den nächsten 5 Jahren nicht aus der
landwirtschaftlichen Produktion herauszunehmen, es
seuchen- und unkrautfrei zu halten. Bei Nicht-einhaltung
dieser Verpflichtung geht das Land entschädigungslos in
den Besitz des Staates über.
142
Da man mit den Entschädigungsscheinen sonst nicht
viel hätte anfangen können – es sei denn, man hätte sie
zu einem Bruchteil ihres Nennwertes gegen Bargeld an
Spekulanten verkauft – war es wohl die beste Lösung,
mit ihnen Land zu kaufen. Natürlich bietet das Land
heute nicht mehr die Sicherheit, wie einst bei unseren
Vorfahren. Kaum einer der neuen Besitzer denkt daran,
sich als Bauer niederzulassen. Sie sehen es eher als
eine Anlage an, die nicht so schnell an Wert verliert, wie
das Geld.
Im Hinblick auf die angestrebte Mitgliedschaft
Ungarns in der Europäischen Union (EU) wird das so
erworbene Land – angesichts der Überproduktion und
großen Subventions-Brachflächen – auch von seinem
bisherigen Wert verlieren…
Ungarndeutsches Jugendlager
Tarian ist seit September 1995 um eine Einrichtung
reicher: Damals wurde in Anwesenheit hochrangiger
Politiker aus Deutschland und Ungarn das Jugendlager
eingeweiht. Die mit deutscher Finanzhilfe von rund einer
halben Million Mark errichtete Jugendbegegnungs- und
Fortbildungsstätte liegt in einer malerischen Umgebung
– umgeben von bewaldeten Gebirgszügen – ein
Kilometer von Dorf entfernt.
143
Sie besteht aus einem schmucken Gemeinschaftshaus mit einem großen Versammlungsraum,
Küche, sanitären Anlagen und Schlafräumen in der
Mansarde. Daneben gibt es noch fünf kleinere Häuser
mit je drei Dreibettzimmern und einem größeren
Aufenthaltsraum mit Kochnische. Ferner ist auf dem Gelände noch eine kleine Dienstwohnung für die von der
Gemeinde angestellte Jugendpflegerin. Diesen Posten
hat Frau Ildikó Erös, geb. Szalczinger inne. Ihre Aufgabe
ist es, die Jugendlichen zu betreuen und Beschäftigungen in deutscher Sprache durchzuführen. Nach 1990
sah die Gemeinde Tarian eine Chance, etwas für die
Verständigung der hier lebenden Nationalitäten zu tun.
Nach Auflösung der kommunis-tischen Arbeitermiliz war
ihr Schießplatz auf diesem Gelände verwaist. Da es seit
der Bodenreform von 1920 zum Tarianer Hotter gehörte,
stellte die Gemeinde bei der Staatlichen Vermögensverwaltung den Antrag, den Platz wieder an sie
zurückzugeben. Vor der Bodenreform befand sich an
dieser Stelle Wald. Nach der Rodung haben unsere
Eltern hier 5–10 m breite Äcker erworben, die sie
Stockfeld nannten. Sie hatten ihre Raten dafür noch
144
nicht abbezahlt, als man ihnen das Land wieder ohne
Entschädigung abnahm. Das neugegründete Staatsgut
Tornyópuszta bewirtschaftete die Felder von 1946 bis
1956.
Nach dem Volksaufstand von 1956 hat die
Arbeitermiliz (ung. munkás-örség) von Tatabánya hier
einen Schießplatz errichtet. Am 20. Dezember 1993 ist
das Gelände wieder in den Besitz der Gemeinde
übergegangen. Bevor es genutzt werden konnte, mußte
es zunächst entsorgt werden, d. h. von Munition und
Altöl gereinigt werden. Anschließend wurde unter
Vermittlung von Géza Hambuch vom Deutschen
Verband in Budapest ein Antrag an das Auswärtige Amt
in Bonn auf finanzielle Unterstützung zum Bau einer
Jugendbegeg-nungsstätte gestellt. Zunächst wurde ein
Zuschuß von DM 450000,-- gewährt. Später kamen noch
weitere 68000,-- DM hinzu. Die Partnergemeinde
Tarians, Staufenberg/Hessen, beteiligte sich am Bau mit
Baumaschinen und anderen Geräten. Die Finanzhilfe
aus Deutschland wird als eine Art Wiedergutmachung an
den Ungarndeutschen für den erlittenen Schaden nach
1945 betrachtet.
Der Aufenthalt von Jugendlichen hier soll zum
gegenseitigen Verständnis der verschiedenen BevölTarian ist seit September 1995 um eine Einrichtung
reicher: Damals wurde in Anwesenheit hochrangiger
Politiker aus Deutschland und Ungarn das Jugendlager
eingeweiht. Die mit deutscher Finanzhilfe von rund einer
halben Million Mark errichtete Jugendbegegnungs- und
Fortbildungsstätte liegt in einer malerischen Umgebung
– umgeben von bewaldeten Gebirgszügen – ein
Kilometer von Dorf entfernt. Sie besteht aus einem
145
schmucken Gemeinschaftshaus mit einem großen Versammlungsraum, Küche, sanitären Anlagen und Schlafräumen in der Mansarde. Daneben gibt es noch fünf
kleinere Häuser mit je drei Dreibettzimmern und einem
größeren Aufenthaltsraum mit Kochnische. Ferner ist auf
dem Gelände noch eine kleine Dienstwohnung für die
von der Gemeinde angestellte Jugendpfle-gerin. Diesen
Posten hat Frau Ildikó Erös, geb. Szalczinger inne. Ihre
Aufgabe ist es, die Jugendlichen zu betreuen und
Beschäftigungen in deutscher Sprache durch-zuführen.
Nach 1990 sah die Gemeinde Tarian eine Chance,
etwas für die Verständigung der hier lebenden
Nationalitäten zu tun. Nach Auflösung der kommunistischen Arbeitermiliz war ihr Schießplatz auf diesem
Gelände verwaist. Da es seit der Bodenreform von 1920
zum Tarianer Hotter gehörte, stellte die Gemeinde bei
der Staatlichen Vermögensverwaltung den Antrag, den
Platz wieder an sie zurückzugeben. Vor der
Bodenreform befand sich an dieser Stelle Wald. Nach
der Rodung haben unsere Eltern hier 5–10 m breite
Äcker erworben, die sie Stockfeld nannten. Sie hatten
146
ihre Raten dafür noch nicht abbezahlt, als man ihnen
das Land wieder ohne Entschädigung abnahm. Das
neugegründete Staatsgut Tornyópuszta bewirt-schaftete
die Felder von 1946 bis 1956.
Nach dem Volksaufstand von 1956 hat die
Arbeitermiliz (ung. munkásõrség) von Tatabánya hier
einen Schießplatz errichtet. Am 20. Dezember 1993 ist
das Gelände wieder in den Besitz der Gemeinde
übergegangen. Bevor es genutzt werden konnte, mußte
es zunächst entsorgt werden, d. h. von Munition und
Altöl gereinigt werden. Anschließend wurde unter
Vermittlung von Géza Hambuch vom Deutschen
Verband in Budapest ein Antrag an das Auswärtige Amt
in Bonn auf finanzielle Unterstützung zum Bau einer
Jugendbegeg-nungsstätte gestellt. Zunächst wurde ein
Zuschuß von DM 450000,-- gewährt. Später kamen noch
weitere 68000,-- DM hinzu. Die Partnergemeinde
Tarians, Staufenberg/Hessen, beteiligte sich am Bau mit
Baumaschinen und anderen Geräten. Die Finanzhilfe
aus Deutschland wird als eine Art Wiedergutmachung an
den Ungarndeutschen für den erlittenen Schaden nach
1945 betrachtet.
Der Aufenthalt von Jugendlichen hier soll zum
gegenseitigen Verständnis der verschiedenen Bevölkerungsgruppen beitragen.
(UP, 11/95, S. 31)
147
Weihnachten früher
Als die Menschen noch viel ärmer waren als heute,
standen die christlichen Feiertage viel höher im Kurs als
in der jetzigen Zeit. Die Kinder freuten sich schon
Wochen vorher auf das Christkindl. Die Eltern und
älteren Geschwister verstanden es, den Kleinen die
Ankunft des Jesu Kindes so spannend erscheinen zu
lassen, dass wir es kaum erwarten konnten, bis
Weihnachten kam. Bis zu einem bestimmten Alter
glaubten wir, dass an Heiligabend die Christkindl wirklich
über eine „Himmelsleiter“ vom Himmel herabsteigen und
von Haus zu Haus gehen, um die Frohbotschaft über die
Geburt Christi zu verkünden.
Vor Einbruch der Dunkelheit schauten wir schon
neugierig die Gasse entlang, wo am Dorfrand die
Himmelsboten herabsteigen sollten. Die Erwachsenen
besorgten schon Tage vorher einen Weihnachtsbaum
aus dem Weinamer Wald. Da es keine Fichten gab,
diente bei uns ein anderer Nadelbaum, der Wacholder –
Kronawittn genannt – als Weihnachtsbaum. Dieser
wurde liebevoll mit Nüssen, Äpfeln und Salonzucker
geschmückt (auf'kranzelt).
Als es dunkel wurde, gingen die Christkindl – am
Ende der Straße beginnend – von Haus zu Haus, um
den Kleinkindern die Geburt Christi zu verkünden. Die
Kinder mußten hinter dem Tisch sitzend auf die Ankunft
der Christkindl warten. Bevor sie die Stube betraten, gab
man ihnen den geschmückten Weihnachtsbaum und die
Geschenke, ohne, dass die Kinder das sahen. Sie
stellten alles auf den Tisch. Singend trugen sie den Text
des Christkindlspieles vor. Neben der religiösen
Unterweisung diente der Besuch der Christkindl auch
148
der Disziplinierung der bösen Kinder, die anstelle von
Geschenken die Rute bekamen!
Auch für die braven Kinder
fielen die Geschenke ziemlich
bescheiden aus. Wenn man einen
Bleistift, einen Bleistiftspitzer oder
eine Tafel Schokolade bekam,
war man schon überglücklich. Da Süßigkeiten rar waren,
wurden nach Weihnachten die Salonzucker vom Weihnachtsbaum heimlich gegessen.
Bis Ende der 40er Jahre war die Sprache der
Christkindl deutsch. Danach ungarisch. Später gab es
wegen des atheistischen Drucks auf die Jugend, keine
Jugendliche mehr, die Christkindl spielen wollten …
Ende der 60er Jahre erlaubte man wieder das
deutsche Christkindlspiel. Lehrerinnen ließen von ihren
Schülern den Text aufschreiben ( > unten).
Damit begann die Wiederbelebung einer alten
Tradition. Ob es je gelingen wird, das Tarianer
Christkindlspiel so neu zu beleben, wie es früher war, ist
fraglich.
Man kann nicht Lebensformen einer kleinbäuerlichen
Gesellschaft in eine Industriegesellschaft übertragen.
Andere Lebensumstände bedingen auch andere Formen
der Religiösität.
149
Text des Christkindelspiels
Personen: Josef, zwei Engel, zwei Hirten
1. Engel: Gelobt sei Jesus Christus, schön' guten Abend
gebe Euch Gott! Von Gott, von Gott sind wir gesandt.
Den Zepter in meiner Hand, die Krone auf unser'm
Haupt, das hat Gott, der Vater, uns erlaubt. Maria,
Maria tritt herein mit deinen zwei Hirtelein!
Maria: Herein bin ich getreten. Wenn alle Kinder schön
fleißig beten und singen, dann werd' ich ihnen die
goldenen Gaben bringen. Wenn sie aber nicht schön
fleißig beten und singen, dann wird die Rute umherspringen.
2. Engel: Maria, Maria sprich nicht so hart, es wird
geschehen nach Deinem Wort.
Maria: Jetzt will ich mich noch einmal bedenken, noch
werde ich den Kindern die goldenen Gaben schenken.
1. Engel: Es soll sein, oh herzliebster Josef mein. Komm
rein und wieg das Kindelein ein!
Josef: Wie soll ich das Kindelein einwiegen? Ich kann
meinen alten Steifbuckl nicht bücken. Jungfrau rein, ich
wieg' das kleine Kindelein ein.
Engel und Maria: Es soll sein, oh herzliebster Josef
mein! /Refrain/ Was soll dem Kind seine Wiege sein?
Josef. Krippe soll die Wiege sein!
Engel und Maria: Es soll sein .... /Refrain/ Was soll dem
Kind sein Hemdelein sein?
Josef: Schlarlein* soll sein Hemdlein sein!
Engel und Maria: Es soll sein .... /Refrain/ Was soll dem
Kind sein Name sein?
Josef: Jesus soll sein Name sein!
Alle: Jesus soll sein Name sein. Gloria, Gloria, wie einig
ist das Leben. Wir wiegen mit Freude das kleine
Jesulein, und lass uns stolz Dir dienen in alle Ewigkeit.
150
Auf, auf Ihr Hirten, das Schäflein das schläft, das Kind
ist geboren, wir haben's gesehen. Die Engel vom
Himmel sie kommen herab, sie eilen, sie eilen zum
Bethlehem-Stall. Dort finden sie das Kindelein.
DasKindelein grüßen, da fallen sie alle zu Füßen. Oh
Jesulein süß und oh Jesulein süß, der Tag ist
vergangen, die Nacht kommt herbei, ist Jesus, Maria
und Josef dabei. Gelobt sei Jesus Christus in aller
Ewigkeit! Glückselige Feiertage! Spannt ein, spannt ein
in unseren Wagen, dass wir die Straße den Himmel
hochfahren! Wir wünschen Euch, glückselige Weihnachtsfeiertage!
1) Gesammelt im Auftrag von Theresia Lunczer von Tarianer Schülerinnen
des Kossuth-Gymnasiums Budapest. Veröffentlicht in: Unser Hauskalender
1990, S. 141/42
Schlar = Schleier
Heiligenkreuz
Im Morgengrauen
– wir sagten dazu
»Vortogs« – versammelten
sich
die Tarianer Wallfahrer vor der
Kirche, um mit der
Fußprozession
nach
Heiligenkreuz zu wallfahren. Schon Tage
vorher wurde unter den Burschen
abge-sprochen,
wer das schwere
151
Metallkreuz und die Kirchenfahnen tragen wird. Es war
eine Auszeichnung, aber auch eine schwere Aufgabe,
wenn man als Träger ausersehen wurde. Auf dem rund
32 km langen Hin- und Rückweg wechselten die Träger
einander ab. An der Spitze der Prozession ging der
„Kreizltroga“ dann folgte der Pfarrer mit den Ministranten
und nach ihnen die Gläubigen. Die Fahnenträger gingen
an beiden Seiten.
Zunächst ging es betend und singend auf der
steinernen Landstraße bis Héreg, von dort am Ostrand
vorbei auf Feld- und Waldwegen über Wald-lichtungen
mit Wiesen und Obstanlagen (Szénás-rét und Hosszú
dülö). Dann im Wald bis zu dem Forsthaus mit
Ziehbrunnen (in der nähe des Weilers Pusztamarót).
Hier wurde eine Rast eingelegt. Dann ging es unterhalb
des Gehöfts „Cservölgyi major“ vorbei, über die Straße
Bajna-Bajót, der Bajóter Bach wurde überquert und der
Fußweg über den Kökényes-(Schlehen-) Berg genommen. Der Anstieg von 180 auf 313 m Höhe machte
vielen Wallfahrern zu schaffen. Kleinkinder, die zum
erstenmal mit einer Prozession mitgingen, fürchteten
diesen Berg besonders, da man ihnen erzählte, dass sie
oben angelangt, eine eiserne Kette durchbeißen
müßten! Sie waren natürlich erleichtert, als sie
feststellten, dass das Ganze nur ein Scherz war.
Nach dem Abstieg kam man auf die Straße von Bajót
nach Heiligenkreuz. Bevor der vom Wald umgebene
Wallfahrtsort erreicht wurde, formierte sich die
Prozession erneut, um so feierlich Einzug halten zu
können. Man zog zunächst an den unterhalb der Kirche
beiderseits der Straße haltenden Pferdewagen vorbei,
und ging dann an den Verkaufsständen entlang in die
Kirche. Am Vormittag nahm man an einer Messe teil,
dann traf man sich mit den anderen Pilgern, die mit dem
152
Wagen oder Kutsche kamen, um etwas zu essen,
Geschenke einzukaufen.
Besonders beliebt waren die bunten LebzeltenRosenkränze („Löbzöten-Petten“), die man – um den
Hals gehenkt – als Geschenk für die Daheimgebliebenen mitbrachte. Nach der Litanei und den Besuch
des Kalvarienbergs sowie der Lourdes-Grotte am späten
Nachmittag hieß es den 3-4stündigen Rückweg
anzutreten. Kurz vor Einbruch der Nacht kam die
Prozession in Tarian wieder an. Viele Schaulustige
warteten schon an der Héreger Straße und im SpannGassl auf sie. Die Teilnehmer riefen den Wartenden zu:
»An scheina Gruaß von Halignkreiz!« Die Mitbring-sel
machten besonders die Kinder froh. Die Prozession zog
– unter Glocken-geläut – noch in die Kirche, wo sie sich
auflöste. Für die Teilnehmer ging ein ereignisreicher Tag
zu Ende...
Wie ging's weiter nach 1950?
Viele ältere Landsleute unserer Gegend, kennen diesen
bekannten Wallfahrtsort. Sie sind schon als Kinder gern
dorthin gepilgert. Für alle war die Wallfahrt nach
Heiligenkreuz (ung. Péliföld-szentkereszt) stets ein
schönes Erlebnis. Als Bub war ich immer überglücklich,
wenn ich mit dem Wagen mitfahren oder mit der
Prozession mitgehen durfte. Um meine Jugenderlebnisse aufzufrischen, entschloß ich mich bei meinem
Besuch in der alten Heimat (1965), auch Heiligenkreuz
aufzusuchen. Die Sonne schien heiß vom wolkenlosen
Himmel, als wir uns zu dritt, zu Fuß und zum Teil mit
dem Bus, auf den Weg nach dem lange nicht gesehenen
Wallfahrtsort machten.
Der von bewaldeten Höhen umsäumte Ort schien
unter der drückenden Mittagssonne wie ausgestorben.
153
Außer ein paar spielenden Kindern war kein Mensch zu
sehen. Die Wirtschaftsgebäude des ehemaligen Klosters
standen verwahrlost da. Schon an dem nicht mehr
vorhandenen Zaun und Tor merkte man sofort, dass sie
den Besitzer gewechselt haben.
Die Wallfahrtskirche sah damals noch fast so aus wie
vor zwanzig Jahren. Leider ließ sich nicht dasselbe auch
von dem einst so schönen, über zweihundert Jahre alten
Kalvarienberg sagen. Die Kreuzweg-Stationen waren
alle beschädigt. Durchweg merkte man die Spuren
mutwilliger Zerstörung. Dies galt ganz besonders für den
letzten Teil des Kreuzwegs.
Unser Besuch in Heiligenkreuz wäre unvollständig
gewesen, hätten wir nicht auch die von der Kirche einen
halben km entfernte Lourdes-Grotte besucht. Wo an
Wallfahrtstagen Tausende von Menschen zur Muttergottes beteten, trafen wir jetzt nur drei Pilger an.
Geschichte des Wallfahrtsortes
Trotz seines unscheinbaren Äußeren hat der Ort eine
große geschichtliche Vergangenheit. Von Funden aus
der Umgebung schließt man darauf, dass hier schon der
Mensch der Steinzeit, aber auch der Bronze- und
Eisenzeit gelebt hat.
Nach der Befreiung des Landes von der türkischen
Herrschaft in den Jahren 1683/84 wurde die nähere und
weitere Umgebung des heutigen Wallfahrtsortes von
deutschen und slowakischen Kolonisten besiedelt. Sie
waren, ähnlich wie die wenigen eingesessenen Ungarn,
zum größten Teil katholisch. In den ersten Jahrzehnten
des 18. Jahrhunderts begann sich das religiöse Leben in
der Diözese Gran von der langen islamischen Herrschaft
allmählich zu erholen.
154
Aus dem Protokoll einer kirchen-amtlichen Kontrolle
von 1732 in Heiligenkreuz erfahren wir, dass die
baufällige schwibbögige Kirche an den Festtagen KreuzAuffindung (3. Mai) und Kreuz-Erhöhung (14. September) von großen Menschenmengen aus den
umliegenden Dörfern besucht wurde.
Über die Entstehung der Wallfahrten ist in dem
Schriftstück folgendes zu lesen: »Es ist unbekannt, wie
die Heiligenkreuzer Wallfahrten entstanden sind.« Nach
mündlicher Überlieferung soll ein pflügender Bauer ein
Kreuz gefunden haben, welches den Ausschlag für den
Bau der Wallfahrtskirche gegeben haben soll. 1738 ließ
Fürstprimas, Erzbischof Emmerich Esterházy die heute
noch stehende Kirche und ein Kloster erbauen.
Obwohl die Bauzeit zehn Jahre betrug, waren die
Kirchenmauern so schwach, dass man es nicht wagte,
aus Backsteinen einen Turm daraufzuset-zen. Aus
diesem Grund hat die Wallfahrtskirche auch heute noch
einen Holzturm. Die ersten Priester von Heiligenkreuz
waren Einsiedler.
1763 hat Erzbischof Franz Barkóczy die wegen ihrer
Strenge berühmten, bloßfüßig und ohne Kopfbedeckung
gehenden Nazarener hier angesiedelt. Sie konnten aber
in Heiligenkreuz nicht lange tätig sein, da Joseph II.
1782 alle Eremitenorden aufgehoben hatte. In der Zeit
danach waren an dem Wallfahrtsort weltliche Seelsorger
tätig.
Als Fürstprimas Johann Scitovszky den Entschluß
faßte, den Paulaner-Orden in Ungarn wieder heimisch
zu machen, bestimmte er Heiligenkreuz als Stätte ihres
Wirkens. 1860 ließ er aus Polen drei Patres und einige
Brüder kommen, die aber wegen der schlechten
Lebensverhältnisse nach sieben Jahren das Land wieder
verließen. Die Pfarrei wurde nachher wieder von
155
weltlichen Priestern verwaltet. 1906 machte der
damalige Erzbischof Vaszary einen neuen Versuch, die
Paulaner in Heiligenkreuz anzusiedeln. Nach dreijähriger
Tätigkeit haben aber auch sie den Wallfahrtsort für
immer verlassen.
Im Jahre des Konstantin-Jubiläums, 1913, wurde hier
der Salesianer-Orden ansäßig. Die von Don Bosco
gegründete Salesianische Gesellschaft wurde auf
ungarischem Boden von dem ehemaligen Direktor des
ungarischen Gymnasiums in Fiume, Dr. Karl Zafféry
organisiert. Johann Csernoch, Erzbischof von Gran, hat
ihn mit seiner kleinen Gruppe eingeladen, nach
Heiligenkreuz zu kommen, um dort die erzieherischen
und sozialen Ideen Don Boscos zu verwirklichen. Trotz
der Schwierigkeiten während des Ersten Weltkrieges
begann der junge Orden in Heiligenkreuz mit der
Aufbauarbeit. 1925 wurde das alte Kloster aufgestockt.
1931 begann man den Kalvarienberg nach dem Plan
von Zoltán Gáthy umzubauen. Nach seiner Fertigstellung war es einer der schönsten Kalvarienberge des
Landes.
Bis 1922 war am Wallfahrtsort gleichzeitig auch ein
Konvikt. Seit 1936 existierte in Heiligenkreuz eine
theologische Hochschule der Salesianer. 1932 baute
man eine steinerne Verbindungs-straße bis zur Orisáper
Abzweigung. In den Jahren des Zweiten Weltkrieges
wurde ein großes Unterkunftshaus für die Pilger gebaut.
Der Krieg hatte hier glücklicherweise keinen
nennenswerten Schaden angerichtet. Nach 1945 wurde
der Ort an Wallfahrtstagen wieder von großen
Menschenmengen besucht. Die Prozessionen kamen
nicht selten aus 40 bis 50 km Entfernung. Alle
Nationalitäten (Ungarn, Deutsche und Slowaken)
suchten und fanden hier Trost. Die wichtigsten
156
Wallfahrtstage sind: Der 3. Mai (Auffindung des Heiligen
Kreuzes), der 14. September (Anbetung des Heiligen
Kreuzes) und der 20. Oktober (St. Wendelinus). Den
letzteren haben die »Schwaben« aus der alten Heimat
mitgebracht. ( > Die Heiligen von Heiligenkreuz)
Seit der Ansiedlung der Salesianer ging es mit der
Entwicklung ständig aufwärts. Die Priester von
Heiligenkreuz waren nicht nur gute Seelsorger und
Wirtschaftler, sondern auch vorbildliche Kindererzieher.
Sie wußten die Jugend zu fesseln.
Die segensreiche Arbeit der Salesianer nahm im
Jahre 1950 in Heiligenkreuz ein jähes Ende. Der Orden
wurde vom Staat aufgelöst. Die Priester sind zum Teil in
Pfarreien versetzt worden. Die Klostergebäude, das
Unterkunftshaus für Pilger, das Gebäude der
theologischen Hochschule sowie das Ackerland (ca. 35
kj = 20 ha) und der Wald wurden enteignet. Die am
Wallfahrtsort verbliebenen drei Seelsorger mußten ein
Jahr lang in einem Zimmer wohnen, während die übrigen
Gebäude versiegelt waren und leer standen. 1951 hat
man der Kirche wieder einige Räume vom Kloster zur
Verfügung gestellt. 1953 richtete man in den bislang
leerstehenden Gebäuden eine Bergbauschule ein. Hier
wurden Hauer (Steiger) der nahegelegenen Grube
Mogyorósbánya ausgebildet. Die erwähnten mutwilligen
Zerstörungen am Kalvarienberg waren ihr Werk.
Heiligenkreuz ist heute auch mit dem Bus zu
erreichen: Von Gran aus über Dorog, Tokod oder Taath;
von Schambek aus über Somor und Weina; von
Tatabánya über Tarian und Weina. Viele Pilger nutzen
nun diese günstige Gelegenheit, dem Gnadenort einen
Besuch abzustatten. Am schnellsten kommt man
natürlich mit dem eigenen PKW dorthin.
157
Neubelebung des religiösen Lebens
Im Herbst 1989 empfing uns bei einem Besuch – ähnlich
wie schon 1965 – ein Bild der Trostlosigkeit: Verfallene
Wirtschaftsgebäude, die kleine Wallfahrtskirche auf dem
Hügel verschlossen. Auf einem vergilbten Zettel an der
Tür stand: Honig zu verkaufen. Es schien so, als ob der
Niedergang des Wallfahrtsortes seit meinem letzten
Besuch fortgeschritten wäre... Links um die Kirche
herum wollten wir auf den einst so herrlichem
Kalvarienberg gehen.
Alles schien ausgestorben und menschenleer, als wir
plötzlich auf eine junge Frau mit einem Kreuz um den
Hals stießen. Sie rechte hinter der Kirche Heu
zusammen. Noch bevor wir »Guten Tag!« wünschen
konnten, kam sie uns mit einem »Gelobt sei Jesus
Christus!« zuvor. Ich war überrascht, hier eine
Vertreterin der Kirche anzutreffen, da seit dem Tod des
letzten Pfarrers die Pfarrstelle verwaist war.
Schnell kamen wir ins Gespräch. Die junge Frau gab
uns bereitwillig Auskunft. Ob sie einem neuen, hier
ansässigen Orden angehöre? – wollte ich wissen.
Daraufhin erzählte sie uns, dass sie als gemischte
Gruppe seit 1989 mit Erlaubnis des Erzbischofs von
Gran hier leben. Der Gruppe gehören achtzehn
Personen im Alter von 21 bis 28 Jahren an, darunter drei
Ehepaare mit 5 Kindern, ein verlobtes Paar und
Alleinstehende.
Auch ein Novize, d. h. ein Klosterbruderanwärter,
gehörte zu ihnen. Der Älteste unter ihnen ist der
»Pastor«, d. h.Gruppenleiter. Die Vereinigung trägt den
Namen »Gemeinschaft des Löwen von Juda und des
Opferlamms« (ung. A Júda Oroszlánja és az Áldozati
Bárány Közössége). Sie ging aus einer Budapester Betgemeinschaft hervor. Ziel dieser Vereinigung ist die
158
Förderung des christlich-jüdischen Dialogs und die
Kontemplation (Beschaulichkeit) ...
Unsere Gesprächspartnerin lud uns, nach der Besichtigung des Kalva-rienberges, zu einem Besuch in die
Kirche ein. Die Kalvarienstationen wiesen – trotz
begonnener Aufräumarbeiten – noch Spuren mutwilliger
Zerstörungen auf. Unweit von hier befinden sich
deutsche Soldatengräber. Die Soldaten fielen im März
1945 beim deutschen Rückzug. Beim Verlassen des
Kalvarienberges kamen wir am ehemaligen Pilgerheim
vorbei, das nach 1948 zunächst in eine Steigerschule
und später in ein Gefängnis umgewandelt wurde. (1990
wurde es aufgelöst.) Vom Berghang konnten wir
Gefangene und Wärter beobachten. Der Gegensatz zu
früher wurde einem dadurch besonders bewußt...
Im schlichtem sauberen Gotteshaus wartete bereits
unsere Gesprächspartnerin. Andere Mitglieder der
religiösen Gemeinschaft traten in Erscheinung: Ein
junger Mann kniete – tief versunken – im Altarraum und
betete, andere kamen hinzu. Wir religiös abgestumpften
Westler waren beeindruckt von so viel Frömmigkeit und
innerer Ruhe, die diese jungen Leute ausstrahlten. Der
Geist von früher scheint in ihnen weiter zu leben.
In der Sakristei erfuhren wir, dass die Gemeinschaft
ihren Lebensunterhalt durch den Verkauf von lkonen,
Honig und Gesangscassetten bestreitet. Die lkonen
werden in eigener Werkstatt (St. Josef) hergestellt, die
Cassetten und der Honig sind ebenfalls Eigenproduktion.
Die Heiligen von Heiligenkreuz
In der Kirche fielen uns zwei Heiligenstatuen auf. Beim
genauen Hinsehen entdecktem wir den hl. Wendelinus,
nach dem die Stadt St. Wendel im Saarland benannt ist.
159
(In der dortigen Basilika steht der Sarkophag des
Heiligen.) Ihm gegenüber steht die Statue des hl.
Florian. Die Entdeckung von gleich zwei Heiligen aus
dem deutschen Sprachraum in diesem entlegenen
Winkel Ungarns war für uns ein zusätzliches Erlebnis.
Wie kam die deutsche Heiligenverehrung nach Ungarn?
Darüber gibt es keine genauen Aufzeichnungen. Ebenso
wenig weiß man über die Entstehungsgeschichte des
Wallfahrtsortes. Nach der Legende soll ein Bauer beim
Pflügen auf ein Kreuz gestoßen sein. Dieses Datum wird
als »Tag der Kreuzauffindung« (4. Mai) bezeichnet. Das
ist auch die Zeit der Frühjahrswallfahrt. Bemerkenswert
ist, dass der Todestag des hl. Florian mit diesem Tag
übereinstimmt!
160
Die Herbstwallfahrt am 20. (21., 22.) Oktober erinnert
an den hl. Wendelinus. Die Kreuzerhöhungswall-fahrt
findet am 14. September statt. Wegen der großen Dichte
deutscher Dörfer in der Umgebung ist anzunehmen,
dass deutsche Einwanderer im 18. Jahrhundert „ihre“
Heiligen mitgebracht haben. Der Wallfahrtsort soll seit
1735 bestehen. Viele Orte wurden zur gleichen Zeit mit
Deutschen und Slowaken besiedelt, die nach Heiligenkreuz pilgerten und so zu seinem Aufblühen beitrugen.
Dies ist auch aus der Kirchengeschichte des einige
Kilometer entfernten deutschen Dorfes Taath zu
entnehmen.
Was wissen wir über »unsere« Heiligen? Warum
haben unsere Vorfahren gerade sie verehrt? Auch
hierüber ist nichts genaues bekannt. Aber vielleicht gibt
uns ihre Lebensgeschichte eine Erklärung über ihre
Verehrungswürdigkeit.
Der heilige Wendelin soll der Legende nach ein
irischer Königssohn gewesen sein. In Wirklichkeit war er
vielleicht ein fränkischer Einsiedler des 6. Jahrhunderts.
Er beschloß, das Weltliche zu meiden und sich ganz
Gott zu weihen. Deshalb wurde er in der Gegend von
Trier Einsiedler. Er war nahe am Verhungern, als ihn der
Graf von Tholey (Saar) zu seinem Schweinehirten
machte. Wegen seiner Tüchtigkeit wurde er bald auch
Hirte über die übrigen Tiere.
Weil ihn das Gesinde verleumdete, zog er sich wieder
in die Einsiedelei zurück. Hier besuchten ihn die Bauern
in Scharen, um sich bei ihm Rat zu holen, wenn ihr Vieh
erkrankte. Wegen seiner Beliebtheit beim Volk wurde er
dann schließlich Abt des Klosters Tholey. Er starb im
jahre 617. Sein Grab in St. Wendel ist seit dem Jahre
1000 bezeugt.
161
Der hl. Wendelinus wird in rund 160 Wallfahrtsorten
als beliebter Vieh- und Feldpatron verehrt. Deshalb liegt
zu seinen Füßen ein Lamm und hält er einen Hirtenstab
in der Hand. Da unsere Ahnen fast alle Bauern waren,
ist es nicht verwunderlich, dass sie gerade ihn verehrten
und um seine Hilfe flehten.
Der hl. Florian soll um 250 n. Chr. in dem kleinen Dorf
Zeiselmauer (damals Römisches Reich, heute NiederÖsterreich) geboren sein. Er genoß eine christliche
Erziehung, die ihm u. a. durch seine Mutter zuteil wurde.
Schon in jungen Jahren war er ein erfolgreicher Beamter
und einer der einflußreichsten Männer der römischem
Verwaltung. Als die Christen-Verfolgungsdekrete des
Kaisers Diokletian veröffentlicht wurden, floh er nicht –
wie viele andere – in die Berge, sondern bekannte sich
zu seinem Glauben. Weil er – trotz Folter – seinem
Christentum nicht abschwor, wurde er zum Tode
verurteilt und am 4. Mai 297 in der Enns ertränkt. Er soll
in St. Florian begraben sein. Der barocke Neubau der
dortigen Stiftskirche wurde zwischen 1686 und 1708
errichtet.
In dieser Zeit zogen die ersten Auswanderer nach
Ungarn. Die Standhaftigkeit des hl. Florian mag ihnen –
umgeben von Not und Tod – beim Aufbau eines neuen
Wallfahrtsortes ein leuchtendes Vorbild gewesen sein.
Sein Märtyrertod war während der wechselvollen
255jährigen Geschichte des Ortes nicht nur für die
Gläubigen, sondern auch für die verfolgten Priester der
letzten Jahrzehnte ein gutes Vorbild …
162
163
Über das Schweineschlachten
1
Bevor mit der Mast begann, wurden die Ferkel kastriert ,
so ließen sie sich besser mästen. Gemästet wurde mit
Küchenabfällen, die im sog. Trankeimer (Trankamba)
gesammelt wurden. Daneben bekamen die „Mäistsäu“
noch Gersten- und Maisschrot, damit sie möglichst viel
an Gewicht zunahmen. Während früher das ungarische
Landschwein Mangalica gehalten wurde, wird neuerdings mehr Fleischrassen der Vorzug gegeben, da das
Schweineschmalz von Pflanzenölen verdrängt wurde.
Hausschlachtungen wurden in Tarian nicht vom
Fleischhacker, sondern vom Schlachter (Schlochta)
durchgeführt. Er war hauptberuflich Bauer, verdiente
sich in den Wintermonaten mit dem Schlachten etwas
dazu. Sein Werkzeug bestand aus einem langen
Schlachtmesser, einer Wurstspritze (mit verschiedenen
Trachterln für Blut-, Leber- und Bratwurst), einer
Fleischwolf (Fleischmühl), einem Holzstab (Staberl) zum
Reinigen der Därme und einer Handvoll dünnen
Holzstäbchen (Spahnl) zum Verschließen der Blut- und
Leberwürste. Dazu kam noch der Klauenzieher
(Klauenziaga), ein Eisenhaken mit Griff zum Abziehen
der Klauen. Alles in einen Tornister gepackt, machte sich
der Schlachter in aller Herrgottsfrühe auf zu den Leuten,
die ihn zum Schlachten bestellten. Das Schwein bekam
am Vorabend schon nichts mehr zu fressen, damit seine
Därme leer waren.
Während in den Kesseln schon das Wasser kochte, bot
man dem Schlachter noch einen Schnaps oder Glühwein
an. Dann ging es an die Arbeit: Einige kräftige Männer
zerrten das Schwein aus der Mäststeige, warfen es zu
164
Boden, legten es auf eine Seite und hielten es fest. Der
Schlachter näherte sich mit einem langen Messer, stach
in den Hals und durchschnitt die Halsschlagader. Das
herausströmende Blut wurde in einer tiefen Schüssel
aufgefangen und gleichzeitig mit einem Holzlöffel
umgerührt, damit es nicht gerinnt. Daraus machte man
später die Blutwürste.
Das tote Schwein wurde in eine große Holzmulde – in
jüngster Zeit in eine Stahlblechwanne – gelegt und mit
dem kochendheißen Wasser überbrüht. Damit das heiße
Wasser überall die Haare weichmachte, wurde es mit
langen Eisenketten im Trog öfters herumgedreht.
Gleichzeitig kratzten die Helfer mit scharfen Messern die
Borsten ab. Von den Füßen wurden auch die Klauen
abgezogen. Wenn das Abkratzen beendet war, wurde
das Schwein über dem Trog auf ein großes Brett gelegt
und mit den Hinterbeinen nach oben auf den Galgen
(Goling) gehengt.
Dieser ist ein großes Holzgestell mit einem dicken
Querbalken und zwei Stützen am Rand. Die Sehnen an
den Unterschenkeln der Hinter-beine wurden freigelegt
und das Schwein mit kräftigen Holznägeln am
Querbalken befestigt, danach hob man die Stützen
langsam, bis der Galgen – an die Hauswand gelehnt –
aufrecht stand.
Dann hat man das Schwein von oben nach unten auf
der Bauchseite aufgeschnitten, wobei die inneren
Organe in einen Weiling (große, tiefe Emaille-Schüssel)
gelegt und zur Weiterverarbeitung ins Haus gebracht
wurden. Magen, Dick- und Dünndarm sowie Harnblase
(Bloder) sind auf dem Misthaufen entleert worden.
Danach wurden sie mit dem Staberl umgeletzt, d. h.
umgestülpt, mit Essigwasser und einem Holzschaber
gereinigt. Inzwischen bereitete man schon die Füllung
165
für die Blutwürste, manchmal auch Leberwürste sowie
Bratwürste vor. Der Schlachter bestimmte die Gewürzmischung und die Art sowie Menge der Zutaten. In die
Bratwürste kam mit dem Fleischwolf zerkleinertes
mageres und fettes Fleisch gemischt mit rotem Paprika,
Knoblauch und Salz. Gebraten wurden sie nur am
Schlachttag oder 1-2 Tage danach. Sonst aß man sie
nachdem Räuchern roh. Sie wurden luftig auf dem
Boden aufgehängt und hielten sich Monate lang.
Für die Blutwurst wurde eigens weißes Kastenbrot im
häuslichen Backofen gebacken. Das dann in Würfel
geschnitten mit dem Blut und den Gewürzen vermischt
die Füllung ergab.
Die 100–200 kg schweren Mastschweine schlachtete
man vorwiegend im Winter. Dank der vielen helfenden
Hände konnte man an einem Tag das ganze Fleisch
verarbeiten. In großen Kesseln – meist in tragbaren
Kesselöfen (Kestlheisl), die im Hof standen – wurden die
Blut- und Leberwürste sowie der Schwartenmagen
(Schwoatnsock) ausgekocht. Die Füllung für letzteren
bestand aus allerlei – weniger guten – Fleischsorten, z.
B. Ohren, Kopf, Schwanz, die im Kessel gekocht
(Kestlfleisch) und danach kleingeschitten – mit
Gewürzen vermischt – in den Magen und die Harnblase
(Ploda) gefüllt wurden. Danach wurden sie wieder im
Kessel gekocht. Schließlich legte man ein Brett mit
einem Gewicht darauf, damit sie eine abgeflachte Form
bekamen. Falls der Schwartenmagen nicht frisch
verzehrt wurde, hat man ihn noch geräuchert und so für
längere Zeit haltbar gemacht.
Beim Kochen der Blut- und Leberwürste platzte die
eine oder andere, das ergab zusammen mit dem
Kochwasser die sog. Wurstsuppe, die man am
Schlachttag und einige Tage danach aß. Auch die
166
Verwandten und Nachbarn waren froh, wenn sie davon
bekamen. Die Helfer aßen auch noch Kesselfleisch mit
Brot, bevor die Hausfrau sie am Ende des Schlachttages
– beim sog. Wurstmahl (Wuaschtmoi) – mit Bratfleisch,
Würsten u. a. reichlich bewirtet hatte.
Die 5–10 cm dicken Fettschichten der Mangalica hat
man in Würfel geschnitten und im Kessel
»ausgelassen«, d. h. so stark erhitzt, bis das Schmalz
aus
dem
Fettgewebe
herausgelöst
war
(Schmoizauslossn). Danach schöpfte man das heiße
Schmalz in eine sog. „Schmalzdose“ (Schmoizteisn) ab.
Das waren ca. 20-l-Eimaille-Eimer mit einem
verschließbaren Deckel. Die übriggebliebenen Grieben
(Grammeln) hat man noch ausgepreßt und längere Zeit
aufgehoben. Man aß sie kalt – gesalzen – mit Brot oder
aufgewärmt mit Pellkartoffeln.
Das nicht zu Würsten verarbeitete Fleisch –
Schinken, Speck u. a. – wurde ein-zwei Wochen in
große Holzgefäße in eine Salzlösung gelegt und danach
im häuslichen Rauchfang geräuchert. Nach dieser Salzund Rauchkonservierung hängte man es auf dem
luftigen Speicher (Boden) auf, wo es in den
Wintermonaten steinhart gefror. Bis in den Sommer
hinein war das ein Nahrungsvorrat für die hart
arbeitenden Menschen.
1)
Diese Arbeit wurde von dem sog. „Fadlschneider“ durchgeführt. Das Mundartwort
»Fadl« für Ferkel kommt aus dem Bairischen »Fackl«.
Über die Reinhardt-Erbschaft
Die Älteren unter den Tarianern werden sich noch
erinnern, dass 1958 der ehemalige Notar Endre Pataky
167
ein Schreiben an die Reinhardt-Verwandtschaft
herausgegeben hat, in dem er sie darüber informierte,
dass ein reicher Verwandte von ihnen in Indien ein
großes Vermögen hinterlassen hat. Die Nachricht schlug
wie eine Bombe ein: Jeder, der irgendeinen Verwandten
gleichen Namens unter seinen Vorfahren hatte, meldete
sich im Rathaus, um von dem sagenhaften Vermögen
etwas zu bekommen …
Wer war dieser reiche Mann, dessen Goldvermögen
seit mehr als 100 Jahren in weiten Teilen Europas die
Reinhardt-Verwandten in helle Aufregung versetzt? Er
soll Walter mit Vornamen geheißen haben und um 1720
geboren sein. Als Geburtsort geben die Presseberichte
viele Orte an, so Kopenwien bei Würzburg, Straßburg,
Vorarlberg, St. Anna/Rumänien, Slawonien/Kroatien,
Luxemburg und natürlich Tarian und Untergalla/Ungarn.
Er soll – als Tischlergeselle, Söldner oder Offzier –
gegen Mitte des 18. Jahrhunderts nach Indien
gekommen sein, wo er 1757 an der Seite der Franzosen
gegen die Engländer gekämpft hat. Über seine
»Heldentaten« als Soldat gibt es auch unterschiedliche
Aussagen. Später schlug er sich auf die Seite der Inder
und trat in den Dienst des Großmoguls von Delhi. Dieser
schenkte ihm für seine Verdienste das Fürstentum
Sardhana, wo er aus Baumwoll- und Zuckerrohrplantagen ein großes Vermögen erwarb. Er heiratete das
Tanzmädchen Begum Sumroo. Sein Fürstenhaus
richtete er in der Stadt Agra ein, wo er 1778 starb. Sein
Grabmal ist bis heute erhalten geblieben.
Da Reinhardt keine Nachkommen hatte, adoptierte er
David Ochterlong, den unehelichen Sohn seiner Frau.
Sie verwaltete das Vermögen Reinhardt bis zu ihrem
Tode im Jahre 1836. Im gleichen Jahr übernahm die
englisch-indische Regierung die Verwaltung des
168
Vermögens. Die drei Erben von David Ochterlong – der
1851 starb – prozessierten gegen diese Entscheidung.
Sie erhielten 1856 eine Abfindung von 250000 Pfund.
Sie prozessierten weiter; der letzte Prozeß in dieser
Sache fand 1872 statt.
Später erst wurden die in Deutschland und anderen
europäischen Ländern lebenden – echten und vermeintlichen – Verwandten Reinhardts auf das riesen Vermögen aufmerksam. Seither geistert dieses Thema durch
die Boulevardpresse. Anwälte, Konsulate und einfache
Leute nahmen sich der Sache an. Es wurden Interessengemeinschaften gegründet und viele Zeitungsartikel
geschrieben. Manche haben sich in den finanziellen
Ruin gestürzt, nur um an die 2 t Gold heranzukommen.
Alles war umsonst!
Das letzte „Goldfieber“ erfaßte die Tarianer 1988.
Damals glaubten noch viele an die große Erbschaft. Wir
sollten diesen Traum endlich vergessen!
Auszug aus dem Gesetz Nr. LXXVII des Jahres 1993
über die Rechte der nationalen und ethnischen
Minderheiten
auf dem Territorium der Republik Ungarn
(Am 7. Juli 1993 vom Parlament angenommen)
§ 11
Die einer Minderheit angehörenden Personen haben
das Recht, die familienbezogenen Traditionen der
Minderheit zu achten, die familiären Beziehungen zu
pflegen, ihre Familienfeste in ihrer Muttersprache zu
begehen und die Abwicklung der damit verbundenen
kirchlichem Zeremonien in ihrer Muttersprache zu
beanspruchen.
169
§ 12
(1) Die einer Minderheit angehörende Person hat das
Recht, den eigenen Vornamen und den ihres Kindes frei
zu wählen, ihren Vor- und Zunamen entsprechend
den
Regeln
ihrer
Muttersprache
in
das
Personenstandsbuch eintragen zu lassen und in
amtlichen Dokumenten – in dem durch Rechtsnormen
festgelegten Rahmen – anzuführen. Im Falle der
Eintragung mit nichtlateinischer Schreibweise ist die
gleichzeitige Anwendung der phonetischen Schreibweise
mit lateinischen Buchstaben verbindlich.
(2) Auf Wunsch können die Eintragung in das
Personenstandsbuch und die Ausstellung sonstiger
persönlicher Dokumente – laut Festlegungen des
Absatzes (1) – auch zweisprachig erfolgen.
§ 13
Die einer Minderheit angehörende Person hat das
Recht
a) auf das Kennenlernen, die Pflege, Mehrung und
Weitergabe ihrer Muttersprache, Geschichte, Kultur und
Traditionen;
b) auf Teilnahme am muttersprachlichen Unterricht
und Bildung-,
c) auf Schutz der mit ihrem Minderheitendasein
zusammenhängenden persönlichen Daten entsprechend
den Festlegungen in einem gesonderten Gesetz.
§ 14
Die einer Minderheit angehörende Person hat das
Recht, sowohl zu staatlichen und gemeinschaftlichen
Institutionen der Mutterländer und Sprachnationen zu
170
auch zu in anderen Ländern lebenden Minderheiten
Beziehungen aufrechtzuerhalten.
Kivonat az 1993-as LXXVII-es sz. törvénybõl
a Magyar Köztársaság területén élö
nemzetiségi és etnikai kisebbségek jogairól
(jóváhagyva a parlament 1993. július 7-i ülésén)
11. §
Egy kisebbséghez tartozó személyeknek joguk van, a
kisebbség családi
tradicióinek tiszteletben tartására, a családi kapcsolatok
ápolására, családi
ünnepségeiket anyanyelvükön megtartani és azokkal
kapcsolatos egyházi
szertartásokat anyanyelvükön igénybevenni.
12. §
(1) Egy kisebbséghez tartozó személynek joga van,
saját
és gyermekének
keresztnevét
szabadon
választania,
családés
keresztnevét
az
anyanyelvének helyesírási szabályai szerint az
anyakönyvbe bevezetetni és hivatalos okmányokban
– a jogszabályok által meghatározott formában –
feltüntetni. Nemlatin írásmód esetén egyideijüleg a
fonetikus írásmód latinbetükkel kötelezö.
(2) Kivánatra az anyakönyvi bejegyzések valamint
egyéb személyes okmányok kiállítása – az (1) fejezet
meghatározása alapján – kétnyelvüen is törtenhet.
13. §
Egy kisebbséghez tartozó személynek joga van
171
a) anyanyelvének, történelmének, kultúrájának és
tradícióinak megismerésére, ápolására, gyarapítására
valamint továbbadására;
b) az anyanyelvi oktatáson és müvelödésen
résztvennie;
c) egy külön törvény meghatározása alapján a
kisebbségi léttel összefüggö személyi adatok védelmére.
14. §
Egy kisebbséghez tartozó személynek joga van,
anyaországainak és nyelvinemzetiségeinek valamint
más országokban élö kisebbségek állami és közösségi
intézményeivel kapcsolatokat fenntartani.
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
Im hinteren Bereich des Hofes der Langhäuser befanden sich
die Mäststeigen. Bei ihnen handelten sich um hölzerne
Schweineställe, die aus einem überdachten Teil und einem
Auslauf bestanden. Darin hatten ein-zwei Mästschweine
Platz. Wenn sie 100-150 kg schwer waren, wundensie in den
Wintermonaten geschlachtet. Sie lieferten fürs ganze Jahr
Schinken, Speck, Wurst und Schmalz.
Die Hausschlachtung war eine wichtige Säule der
Selbstversorgung der Dorfbevölkerung.
186
187
Köchinen auf der Hochzeit von Franz Salzinger und
Kathi Simanek in den 1950er Jahren
188
Hochzeitszug in der Obergasse Mitte der 1950er Jahre
Männer nach der Messe, von links nach rechts: Fuchs,
Fülöp (Filips), Steiner, Singer, Weiler, Stein, Marx und
Schatz
189
Dorfmitte: Pertlsches Haus mit einem gemeindeeigenen
Radbrunnen. In den 50er Jahren wurde er zugeschüttet.
Nach der Enteignung Ende der 1940er Jahre befand
sich hier die Zentrale der LPG.
Das eiplsche Haus am Berg (heute Moritz-ZsigmondPlatz): Nach dem die Familie Eipl ausstarb, kaufte der
Gemeinde das Haus und richtete darin ein Dorfmuseum
ein.
190