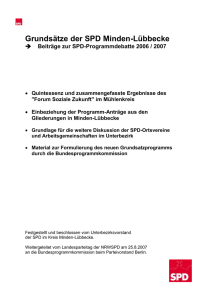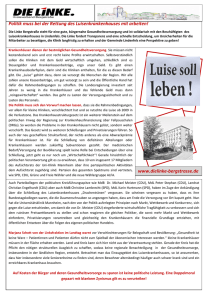Bundestagswahlen 2006
Werbung
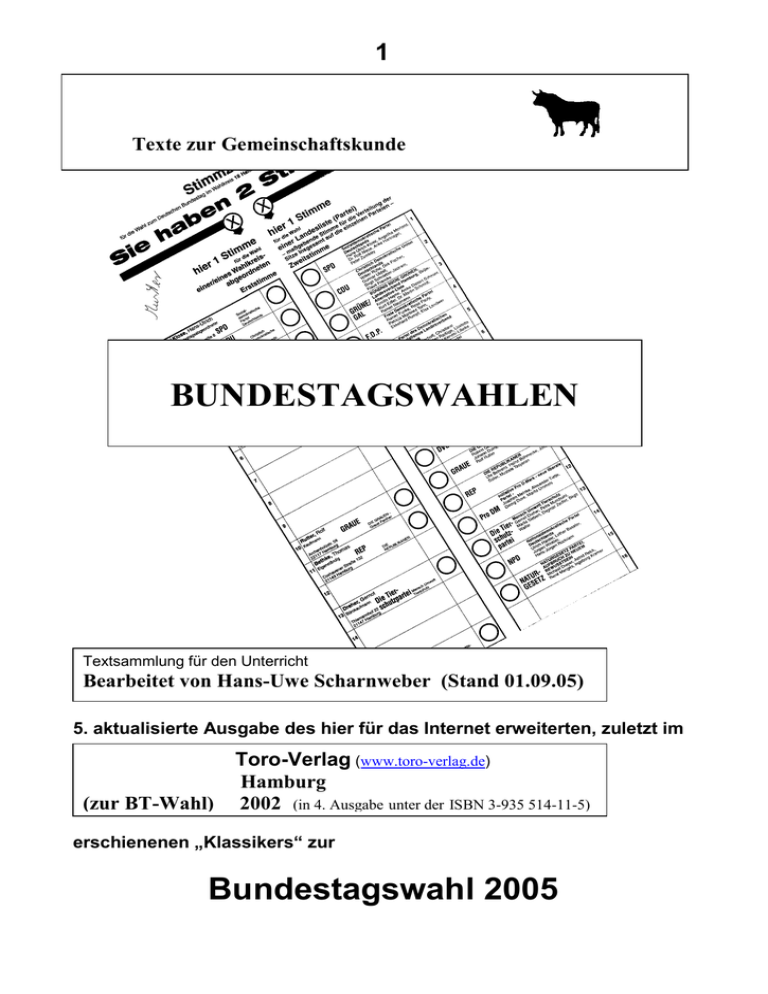
1 Texte zur Gemeinschaftskunde BUNDESTAGSWAHLEN Textsammlung für den Unterricht Bearbeitet von Hans-Uwe Scharnweber (Stand 01.09.05) 5. aktualisierte Ausgabe des hier für das Internet erweiterten, zuletzt im (zur BT-Wahl) Toro-Verlag (www.toro-verlag.de) Hamburg 2002 (in 4. Ausgabe unter der ISBN 3-935 514-11-5) erschienenen „Klassikers“ zur Bundestagswahl 2005 2 INHALTSVERZEICHNIS Seite Einleitung 3 Testbogen „Parteinamen und Stellung der Parteien zueinander“ 4 I. Wahlkampf Stammwähler – Wechselwähler Nichtwähler Parteienfinanzierung / Wahlkampfkosten Aufstellung Parteispenden (ab DM 40.000) 1997-2000 (Auszug) Sachthemen im Wahlkampf Parteiensteckbrief / Wahlkampfthemen und Programme Wahlslogans 1972-1994 5 39 43 51 59 60 64 70 II. Der Bundestag und die Abgeordneten Die Parlamentarier Lobbyismus – Die »fünfte Gewalt« im Staate 72 76 98 III. Wahlrecht und Wahlsystem Mehrheitswahlrecht Verhältniswahlrecht Mischwahlsystem der Bundesrepublik Deutschland 5%-Sperrklausel Grundmandats- oder Alternativklausel/ Drei Direktmandate Vergabe der Mandate nach dem Hare/Niemeyer-System Überhangmandate Stimmzettel 112 112 116 117 127 128 129 134 137 IV. Kandidatenauswahl Aufstellung der Wahlkreiskandidaten Landesliste Aus der Sicht eines Kandidaten Frauenanteil an den erfolgversprechenden Kandidatenplätzen und im Deutschen Bundestag 142 147 153 161 V. Parteien / Auszug aus dem Parteiengesetz 163 VI. Die Bundesländer 165 VII. Berliner Wahlkreise und die PDS 166 VIII. Der Wähler Einzelne Ergebnisse der Repräsentativen Wahlstatistik Diskussion um die Herabsetzung des Wahlalters 176 178 184 IX. Demoskopie 190 X. Wahlausgang 197 Index 162 202 3 Einleitung Viele Wege führen nicht nur nach Rom, sondern auch zur Erarbeitung einer Unterrichtseinheit im Fach „Politik“/“Gemeinschaftskunde“/“Staatsbürgerkunde“. Es gibt meistens nicht den Königsweg. Der Einstieg in das Thema sollte von der Aktualität und der Leistungsfähigkeit der Schüler bestimmt sein. Mögliche »Einstiege«: Besprechung von Wahlplakaten. Das ist dann allerdings zeitlich immer schon sehr nah am Wahltag und lässt nicht mehr so viel Zeit für grundlegenden, umfassenden Unterricht zu dem demokratiezentralen Thema „Wahlen“, da nach dem Wahlabend das Interesse der Schüler an dem Thema sehr schnell erlahmt. Bericht(e) aus der jeweiligen Lokalpresse über eine Parteiversammlung, auf der ein Direktkandidat für den Wahlkreis, in dem die Schule liegt, aufgestellt wird. (Nur 10 % von 93.651 befragten Wählern kannten 2002 ihren ins Parlament gewählten Direktkandidaten; geschweige denn den unterlegenen Gegenkandidaten der anderen großen Partei!) Wahlkreise in Berlin: Es ist immer wieder spannend zu verfolgen, wer in den einzelnen Wahlkreisen von welcher Partei nominiert und gegeneinander antreten wird, wer es von den anderen Parteien in Berlin-Mitte und den Ostberliner Wahlkreisen wagt, sich der durch den Ausgang der Wahl ’02 etwas entzauberten Phalanx der SED-Nachfolger PDS zu stellen! (Die PDS hatte als Ergebnis dieser Wahl – bis auf zwei ihrer Direktkandidaten - nicht als Partei mit Gruppen- oder Fraktionsstatus in den Bundestag einziehen können, wird es aber 2005 nach der Verbindung mit der WASG schaffen.) Bericht über die Aufstellung der Landesliste einer Partei auf ihrer Landesdelegiertenversammlung. Bisher boten immer wieder die Aufstellungen der Landeslisten insbesondere der Grünen Spannung: Welcher Parteiflügel, der der »Realos« oder der der »Fundis«, kann einen seiner Leute auf einen der aussichtsreichen vorderen Listenplätze hieven? In der Tagesdiskussion befindliche politische Streitfragen: Man kann eine die Gemüter der Bevölkerung erregende, aber möglichst nicht allzu komplexe Streitfrage als Einstieg in das Thema wählen – wobei mir z.B. die Diskussion um Zuwanderung nicht geeignet zu sein scheint, wenn man dafür nicht über genaue demographische Daten bezüglich der Bevölkerungsentwicklung in der Bundesrepublik und deren Auswirkungen auf unsere gesamten sozialen Sicherungssysteme verfügt! Ein ganz anderer Einstieg: Kleiner Test des vorhandenen Grundwissens. Ein Testbogen mit z.B. Partei-Abkürzungen kann als Grundlage dienen. Ein solcher möglicher Testbogen ist auf der nächsten Seite abgedruckt. Der Test sollte von einer Schülergruppe ausgewertet werden. Als Lehrer werden sie sich über das Ergebnis sicher nicht allzu sehr wundern! Zum Schluss der Stunde können Sie jedem Klassenmitglied für jedes Elternteil einen solchen Zettel mit nach Hause geben. Die Eltern werden gebeten, diese Zettel am Wochenende ebenso anonym auszufüllen. In der nächsten Politikstunde werden die Zettel dann ausgewertet. Auch dieses Ergebnis wird Sie nicht ernstlich wundern. Ich tröstete mich immer mit dem Gedanken: Woher soll’s kommen, wenn die Eltern keinen Politikunterricht bei mir hatten! Ein weiterer Test: Schülerkleingruppen können in einer Fußgängerzone oder auf dem Wochenmarkt mit Testbogen, harter Unterlage und Kugelschreiber bewaffnet Erwachsene um die Ausfüllung des Testbogens bitten, das Geschlecht des Antwortenden (und eventuell seine Altersgruppe 18-30, 30-40, 40-50, 50-65, über 65) notieren, sich vor Augen führen, dass sowieso nur die interessierteren Erwachsenen mitmachen werden - und nicht die uninteressierten und damit noch wesentlich schlechter informierten -, und dann deren Ergebnisse auswerten. Dann wird auch bei Ihren Schülern möglicherweise Ernüchterung eintreten, wenn sie selbst kurz vor einer Bundestagswahl so erschreckende Erfahrungen über das nicht vorhandene - aber eigentlich erforderliche - Minimalwissen von Wahlberechtigten über sich zur Wahl stellende Parteien und Politiker sammeln sollten, wie sie teilweise als Ergebnisse von Wählerbefragungen vor laufender Kamera als abschreckende Beispiele genüsslich gezeigt werden; aber möglicherweise wird bei Ihren Schülerinnen und Schülern auch Neugierde wachgerufen, mehr hinter die Dinge zu schauen! 4 TESTBOGEN: „PARTEINAMEN UND STELLUNG DER PARTEIEN ZUEINANDER“ Zu Wahlen tritt eine Vielzahl von – manchmal über 30 - Parteien an, die alle nur das eine wollen: Das Kreuz des Wählers hinter ihrem Namen, um ins Parlament gewählt zu werden. Nicht alle Parteien sind gleich »wichtig«. Deswegen sind ja auch nicht alle in den jeweiligen Parlamenten vertreten. Doch zunächst die allgemeinen Fragen, bevor nähere Fragen zu den Parteien gestellt werden: Welchen Namen hat das Landesparlament? ................................................................. Welchen Titel hat der/die Regierungschef/in des Landes? ........................................................ Wie heißt sie/er (Vorname + Nachname)? ................................................................. Welchen Namen hat das Bundesparlament? ................................................................. Für wie viel Jahre wird das Bundesparlament gewählt? ................................................................ Wann wird es das nächste Mal gewählt (Datum!)? ................................................................ In welcher Stadt tagt das Bundesparlament? ................................................................. Wie heißt das Gebäude, in dem es tagt? ................................................................. Welchen Titel hat der/die Regierungschef/in des Bundes? ........................................................ Wie heißt sie/er (Vorname + Nachname)? ................................................................. Wie heißt der/die Gegenkandidat/in? ................................................................. Wer/was wird durch die Bundestagswahl gewählt? ................................................................. Der zu jeder Abkürzung zugehörige Parteiname ist vollständig ausgeschrieben hinter dem jeweiligen - alphabetisch angeordneten – Kürzel des Parteinamens zu notieren: 1) „CDU“: .......................................................................................................................... 2) „CSU“: .......................................................................................................................... 3) „DVU“: .......................................................................................................................... 4) „FDP“: ..............................................................................................................…......... 5)„Grüne“: .......................................................................................................................... 6) „NPD“: ........................................................................................................................... 7) „PDS“: ........................................................................................................................... 8) „REP“: ........................................................................................................................... 9) „SPD“: ........................................................................................................................ 10) „WASG“: ....................................................................................................................... Manche dieser 10 Parteien werden als eher „links“, manche als eher „rechts“ im Parteienspektrum stehend eingeschätzt – was immer das auch im Einzelnen für einen Parteiprogrammpunkt heißen mag. Die meisten behaupten von sich, in der „Mitte“ zu stehen. Wir möchten gerne wissen, wie Ihrer Meinung nach die einzelnen Parteien einzuordnen sind. Machen Sie bitte auf der Skala an der betreffenden Stelle ein Kreuz und notieren Sie bitte dort die Nummer des ParteiKürzels: linksextrem -10 links linke Mitte -5 MITTE 0 rechts rechte Mitte 5 rechtsextrem 10 5 I. Wahlkampf „Das Regieren in einer Demokratie wäre wesentlich einfacher, wenn man nicht immer wieder Wahlen gewinnen müsste“ (George Clemenceau, französischer Staatsmann 1841-1929). Und das in der Bundesrepublik Deutschland – wie in insgesamt 18 der 25 EU-Staaten – gemäß Art. 39 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz1 (bislang) alle vier Jahre immer wieder. [Die 7 anderen EU-Länder Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Malta und Zypern haben für die Legislaturperiode ihres jeweiligen Landesparlamentes einen Fünf-Jahres-Rhythmus vorgesehen, der - als Besonderheit - in Großbritannien nach den Vorstellungen des Premierministers verkürzend variiert werden kann: Wenn er sich im politischen Aufwind glaubt, darf er vor Ablauf der aktuellen Legislaturperiode an einem von ihm beliebig gewählten Datum Wahlen ansetzen lassen.] Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) Papier sprach sich, wie sein Vorgänger Herzog als Bundespräsident, wiederholt für eine Verlängerung der Wahlperiode von vier auf fünf Jahre aus, wie sie - bis auf Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt - in 12 unserer 16 Bundesländer schon gehandhabt wird, weil der größte Bremsklotz für vernünftige Sacharbeit die Periode des Wahlkampfes sei: Politiker könnten nicht ausreichend gestalten, wenn sie sich „von Wahl zu Wahl hangeln“ müssten! (Das müssen sie aber auch bei einer 5-jährigen Legislaturperiode!) Diese Meinung, die Legislaturperiode zu verlängern, weil dann mehr sinnvolle Sacharbeit geleistet werden könne, vertritt auch Bundestagspräsident Thierse: Das erste Jahr benötigten neue Mitglieder des Bundestages für die Einarbeitung, im vierten und letzten Jahr könne wegen des dann anstehenden Bundestagswahlkampfes für die nächste Legislaturperiode kaum mehr parlamentarisch sinnvoll gearbeitet und kaum noch sachorientiert entschieden werden. Namhafte Politiker sind sich einig: Das Weniger an demokratischer Wahlbeteiligung werde durch ein Mehr an konstruktiver Politik allemal aufgewogen – wenn sie denn durchgesetzt werden kann und nicht durch unterschiedliche Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat blockiert wird, wie es die beiden großen politischen Blöcke schon exerziert haben! Mit dieser Einschätzung dass eine längere Legislaturperiode tendenziell zu einem Mehr an konstruktiver Politik führen könne, werden die Befürworter, wie u.a. auch der Alt-Bundespräsident Herzog, grundsätzlich Recht haben. Doch es schreckt der Blick auf die Kehrseite der Medaille: eine zu einem fürchterlichen Gewürge auf der Regierungsbank mit Dauerblockade im Bundesrat ausartende Hängepartie noch einige Jahre Restlaufzeit ertragen zu müssen, während die lustlos gewordene Regierung zum Jagen getragen werden muss, die Regierung nur noch bis zum nächsten von den Regularien vorgesehenen Wahltermin mehr oder minder dahin vegetiert und nicht mehr kraftvoll regiert! Ein solches Gewürge führte 2005 in der zweiten Amtszeit der Kanzlerschaft Schröder nach drei Jahren zu der gewollt und geplant verlorenen Vertrauensabstimmung, um eine vorgezogene Wahl des 16. Deutschen Bundestages zu ermöglichen. Wegen des von unserer Verfassung – bisher – verweigerten Selbstauflösungsrechts des Deutschen Bundestages eine fünfjährige Agonie als Alternative statt einer nur vierjährigen??? Nach Art. 94 der Paulskirchenversammlung von 1849 hatte das „Volkshaus“ zu einer Zeit, als das Bundesparlament kaum etwas zu bestimmen hatte, eine Legislaturperiode von (nur) drei Jahren – wie heutzutage Neuseeland -, nach Art. 24 der Bismarckschen Reichsverfassung von 1871 hatte der Reichstag eine Legislaturperiode von fünf Jahren und gemäß Art. 23 der Weimarer Verfassung von 1919 von vier Jahren. Der Deutsche Bundestag ist (bisher) bei diesem Mittelwert geblieben. Der Politologe Schneider formuliert das Gegenargument: „Selbstverschuldete Terminnot rechtfertigt nicht die Änderung des Prinzips: Besser Denkbeton beseitigen, statt Pfründen verlängern.“ 1 Üblicherweise abgekürzt als: Art. 39 I 1 GG oder auch Art. 39 (1) 1 GG. Das Grundgesetz, unsere Verfassung, hat aus dem historischen Grund der Teilung Deutschlands nach dem Verlust des von den Nazis vom Zaun gebrochenen Zweiten Weltkrieg den Namen „Grundgesetz“ (GG) erhalten, denn man wollte im Bereich der ehemaligen Alt-Bundesrepublik Deutschland nicht eine neue „Verfassung“ für nur den Westteil des ehemaligen Deutschen Reiches schaffen, bevor nicht die unter alliierter Vormundschaft stehenden Teile des ehemaligen West- und Mitteldeutschlands wiedervereint seien. So wählte man, um den Übergangscharakter dieser zu schaffenden grundlegenden Staatsnorm deutlich zu machen, den Begriff „Grundgesetzt“, der dann aber nach der Wiedervereinigung beibehalten wurde, weil das GG in 45 Jahren eine eigene demokratische Tradition entwickelt hatte. 6 Wir werden wegen der in unserer Verfassung festgelegten Regelungen unsere Regierungen ja nicht so schnell los wie die Italiener: In den 56 Jahren von 1949-2005 gab es bei uns nur fünf verschiedene Regierungskonstellationen mit sieben Bundeskanzlern; die Italiener haben ein Vielfaches davon verschlissen. Und bei den Italienern und in den anderen Ländern der EU mit fünfjähriger Legislaturperiode wirkt sich deren Verlängerung bekanntermaßen auch nicht unbedingt besser aus als bei uns! Trotzdem sollte nach dem Anfang 2003 publik gewordenen Willen der Bundestagsparteien SPD, CDU/CSU und Bündnis90/Die Grünen eine Initiative der SPD auf Verlängerung der Legislaturperiode auf fünf Jahre ab 2006 gelten, wobei nach den Vorstellungen der Grünen die Wahlbürger einen »Ausgleich« für ihr dann beschnittenes Wahlrecht durch die Verankerung von Volksentscheiden im Grundgesetz erhalten sollten. An dieser von der CDU/CSU bislang nicht gewollten (aber im Zuge der Europa drohenden Vollmitgliedschaft der Türkei in der EU vielleicht bald doch begrüßten) Verknüpfung war in der 14. Legislaturperiode ein gleicher Vorstoß zur Verlängerung der Legislaturperiode um ein Jahr gescheitert: Die CDU/CSU konnte sich mit der Drohung von mehr Macht für den Souverän in Einzelfragen durch die Einführung von Volksentscheiden nicht anfreunden. Nachdem die an sich erst 2006 anstehende Bundestagswahl unter rechtlichen Verrenkungen2 um trotz der gegebenen einschränkenden Verfassungsbestimmungen vorfristig Neuwahlen zu ermöglichen, Kritiker wenden ein: zu ertricksen - äußerst kurzfristig innerhalb von vier Monaten auf September 2005 vorgezogen worden ist, war keine Zeit mehr für eine Gesetzesänderung zur Verlängerung der Legislaturperiode geblieben, denn zwei Stunden nach der Schließung der Wahllokale bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hatte mit der Ankündigung des Bundeskanzlers, alles für eine Auflösung des Bundestages Erforderliche in die Wege zu leiten, der Bundestagswahlkampf 2005 begonnen. Nach der Wahl ist vor der Wahl! Weil alle Parteien 2005 die Neuwahl - irgendwie - wollten, der vom BVerfG als Hüter der Verfassung streng bewachte Weg über Art. 68 GG aber nur schwer zu gehen ist, hätte selbst unter Beibehaltung des projektierten kurzfristig anstehenden Wahltermins bei entsprechendem politischen Willen die Verfassung innerhalb von circa vier Wochen noch so geändert werden können, dass dem Deutschen Bundestag durch eine diesbezügliche Verfassungsänderung unter welchem Quorum auch immer - Zweidrittel- oder Dreiviertel-Mehrheit der gesetzlichen Mitglieder des Deutschen Bundestages - ein Selbstauflösungsrecht zuerkannt worden wäre, welches ihm die Mütter und Väter der Verfassung 1949 im Parlamentarischen Rat auf Grund der in der Weimarer Republik mit dem Deutschen Reichstag gesammelten Erfahrungen, der keine einzige volle Legislaturperiode bestanden hatte, verweigert hatten, um dem demokratischen Neuanfang eine möglichst hohe Stabilität des Parlaments und der Regierungen zu gewährleisten. Dabei ist dieses historische Argument gegen ein Selbstauflösungsrecht schief, ja sogar falsch, denn der Deutsche Reichstag war bei Regierungskrisen immer gemäß Art. 25 vom Reichspräsidenten aufgelöst worden, wenn die Verfassungsfeinde von links (Kommunisten: Aufbau eines Rätesystems nach kommunistischem Vorbild gewollt) und von rechts (Nationalsozialisten: Dolchstoßlegende propagiert und politische Morde an den als „Novemberverbrechern“ beschimpften Reichsministern Erzberger und Rathenau verübt) sich zwar in der Gegnerschaft gegen die oft von der SPD geführten Regierungen einig waren und sie abwählten, sich aber auf keinen neuen Reichskanzler einigen konnten. Die richtige Antwort auf diesen Missstand war die Einführung des konstruktiven Misstrauensvotums. Der Reichstag hatte nie seine Selbstauflösung beschlossen, ja nie beschließen können: weil auch er – wie der Bundestag - kein Selbstauflösungsrecht besessen hatte! Daher kann die Verweigerung des Selbstauflösungsrechts für den Bundestag nicht mit dem als Totschlagsargument vorgetragenen historischen Hinweis auf Weimar geadelt werden! Die Berliner Republik ist außerdem nicht die Weimarer Republik: Es spricht nach mehr als einem halben Jahrhundert demokratischer Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland nichts dafür, dass in unserer jetzigen Demokratie das Parlament so schnell und leichtfertig aufgelöst würde, wie 2 Es liest sich nicht nur ein bisschen »blöd«, es ist auch so: Die Abgeordneten der Regierungskoalition mussten - wie bei Kohls ebenfalls so konstruierter geplant negativ verlaufener Vertrauensabstimmung - dem Kanzler gegenüber ihr Vertrauen in seine politische Führung im damit angestrebten Wahlkampf dadurch ausdrücken, dass sie ihm trotz zahlenmäßiger Mehrheit in namentlicher Abstimmung mehrheitlich die zur Abstimmung gestellte Vertrauensbekundung verweigerten! 7 es von 1919-1933 der Fall gewesen war. Trotzdem wurde bisher – im Gegensatz zu laut Innenexperte der SPD Wiefelspütz: allen(!) Verfassungen der 16 Bundesländern – kein Selbstauflösungsrecht des Parlaments in die Verfassung des Bundes, das Grundgesetz, aufgenommen. Darum wurde wiederholt ein juristisch nicht immer sauber begehbarer Notweg über die Stellung der Vertrauensfrage gesucht, die nicht als missbrauchsfähiges Selbstauflösungsrecht konzipiert worden ist, sondern als Disziplinierungsinstrument für einen in einer Sachfrage von seiner eigenen Partei oder der Regierungskoalition nicht mehr getragenen Kanzler, um auf diesem Weg die eigenen Abgeordneten hinter sich bringen und die Reihen schließen zu können. Aber weder die Abstimmung, die im Sommer 1972 auf die Vertrauensfrage von Willy Brandt hin stattfand, noch die, die 1982 auf den Antrag Helmut Kohls folgte, zielten auf eine durch Disziplinierung des Regierungslagers erzwungene Bekundung parlamentarischer Unterstützung ab, sondern im Gegenteil auf ihre Verweigerung. Bei der von Helmut Schmidt 1982 gestellten Vertrauensfrage hingegen, sollte die FDP weiterhin an die Seite der SPD gezwungen werden – ohne dass Schmidt eine Parlamentsauflösung beabsichtigt hatte. Auch die von Schröder 2001 gestellte Vertrauensfrage sollte bestätigende Klarheit schaffen. Seine 2005 gestellte Vertrauensfrage jedoch hatte das Ziel des geplanten Scheiterns mit der Folge der Auflösung. Der meist sehr prinzipientreue Abgeordnete und Rechtsanwalt Ströbele von den Grünen war gegen den wegen der Verfassungslage des dem Parlament (bisher) nicht zugestandenen Selbstauflösungsrechts eingeschlagenen Weg und verweist darauf, dass das Grundgesetz durch bewusste Entscheidung (bisher) kein Selbstauflösungsrecht des Parlaments vorsehe: "Was jetzt praktiziert werden soll, ist aber in der Sache nichts anderes“. "Der Wunsch, die Blockade zwischen dem Bundesrat und dem Bundestag aufzulösen oder ihr eine durch Neuwahlen gestärkte rot-grüne Koalition entgegenzusetzen, ist - so richtig er politisch auch ist - keine stichhaltige Begründung für die Vertrauensfrage und Neuwahlen", assistierte der rechtspolitische Sprecher der Grünen, Jerzy Montag. Und der Bonner Staatsrechtler Josef Isensee erläuterte, Schröder müsse nicht nur behaupten, sondern zunächst dem Bundespräsidenten und dann wohl auch dem BVerfG nachvollziehbar(!) aufzeigen, dass das Parlament seine Regierung lähme. Die (nach der vom BVerfG 1998 verbotenen Ersetzung von Überhangmandaten im Verlauf der Legislaturperiode auf eine Stimme Mehrheit zusammengeschmolzene) rot-grüne Mehrheit im Bundestag sei jedoch – auf niedrigst möglichem Niveau - stabil: "Gerade die Linken in der SPD und die Grünen überbieten sich in Treueschwüren zum Kanzler". Das mag für die bisherigen Abstimmungen gegolten haben, doch jeder, der die politische Entwicklung innerhalb der SPD verfolgt hat, hat erkennen können, dass Bundeskanzler Schröder für seine weitere Reformpolitik innerhalb seiner eigenen Partei keine stetige Mehrheit mehr hinter sich gehabt hatte: Die mit der Agenda 2010 verbundenen Nöte, Belastungen und Verängstigungen der unteren Bevölkerungsschichten bis rauf in den Mittelstand hatten bei den letzten Landtagswahlen zu einer zunehmenden Wahlabstinenz großer Teile der SPDStammwählerschaft geführt. Die erlittenen Wahlschlappen hatte daraufhin den linken Flügel der SPD bei jeder sich bietenden Gelegenheit meist verdeckt, zunehmend aber offen, rebellieren lassen: „Das können wir nicht mehr mittragen.“ Die Forderungen seiner Partei-Linken wurden unter dem Eindruck der Abspaltung eines linken Gewerkschaftskaders und dessen Neugründung der WAGS als soziale oder sozialistische Alternative zur zu wirtschaftsfreundlich empfundenen Politik des Kanzlers so massiv vorgetragen, dass Kanzler Schröder sich von dem linken Flügel der SPD nicht nur ständig vor das Schienenbein getreten gefühlt, sondern richtig gehend „erpresst“ gefühlt hatte und nicht mehr hatte sicher sein können, die von ihm für das von ihm für unverzichtbar angesehene Reformwerk als notwendig erachteten weiteren sozialen Grausamkeiten durchsetzen zu können. Wenn einem ständig fernsehwirksam vor’s Schienenbein getreten wird, erscheint mir die Stellung der Vertrauensfrage nicht als unangemessen oder gar willkürlich, aber die damit bezweckte Auflösung des Bundestages zur Herbeiführung von als Kanzlerplebiszit gedachten Neuwahlen kann den innerparteilichen Konflikt nicht lösen: durch Neuwahlen wird die SPD weder in ihrer Programmatik noch in der politischen Ausrichtung ihrer Mandatsträger auch nur einen Millimeter weiter nach »rechts« in Richtung des Seeheimer-Kreises rücken. Selbst gewonnene Neuwahlen könnten somit dem SPD-Kanzler nicht den Umgang mit seiner Partei und damit das Regieren dauerhaft erleichtern! Wegen der von manchen so erachteten „unechten Vertrauensfrage“ – u.a. die sächsische SPD- 8 Bundestagsabgeordnete Jelena Hoffmann kritisierte die von SPD-Partei- und Fraktionschef Franz Müntefering vorgeschlagene Enthaltung bei der Abstimmung über die Vertrauensfrage als "schizophren": es gehe nicht an, dem Kanzler als MdB das Vertrauen zu entziehen und es ihm damit aber gleichzeitig als SPD-Abgeordnete wunschgemäß auszusprechen, damit der Kanzler an vorderster Stelle für seine Partei in den Wahlkampf ziehen könne – äußerten einige MdBs verfassungsrechtliche Bedenken über den eingeschlagenen Weg und zwei kündigten ein Organklageverfahren vor dem BVerfG an, wenn der Bundespräsident den Deutschen Bundestag auflösen sollte. Der ebenfalls klagwillige Grünen-Abgeordnete Werner Schulz sprach von einer "Farce, einem billigen Schmierenthater". Der Kanzler wünsche sich eine Volksabstimmung über seine derzeit laufende Politik. "Eine Stimmungsdemokratie sieht unser Grundgesetz aber nicht vor", sagte der frühere DDR-Bürgerrechtler. Eine entsprechende Klage reichten laut einer Meldung der Süddeutschen Zeitung auch die vier Splitterparteien Republikaner, Tierschutzpartei, ÖDP und die Partei "Das Zentrum" ein – meiner Einschätzung nach mangels hinreichender besonderer eigener Betroffenheit ohne hinreichende Erfolgsaussicht, denn die publizierten Gründe, man hätte sich wegen der Kürze der Zeit und des bei der geringen Mitgliederzahl erhöhten organisatorischen Aufwandes für die einzelnen Mitglieder nicht ausreichend auf die Wahl vorbereiten, z.B. nicht Kandidaten wählen und nicht dies und das machen können, trifft für alle Parteien mehr oder minder in gleichem Maße zu: eine große Volkspartei hat viel mehr zu bekleben und benötigt daher viel mehr Wahlhelfer, die ihr auch nicht in beliebigem Umfang zur Verfügung stehen: Welcher Hartz-IV-Empfänger mit viel Freizeit geht denn noch für die SPD Plakate kleben?! Ohne den Rücktritt eines Kanzlers wäre ein Selbstauflösungsrecht die juristisch sauberere Lösung als ein durch wenigstens Stimmenthaltung derjenigen Minister, die gleichzeitig Bundestagsabgeordnete(!) sind - was nicht immer der Fall ist und den Nichtparlamentariern unter ihnen in dieser Frage kein Stimmrecht zuerkennt -, oder die Stimmenthaltung einer der die Regierung bildenden Fraktionen mehr oder minder konstruiert verlorenes Vertrauensvotum bei an sich bestehender parlamentarischer Mehrheit: „’Wer Schröder liebt, soll sich enthalten’, lautet ... die Parole, die Fraktionschef Müntefering ausgegeben hat. Solche Aufforderung zur politischen Josephsehe kommt jeden braven Parteisoldaten hart an, um so mehr, als er sich ja bald für Schröder todesmutig in die Wahlschlacht werfen soll“ (DIE WELT 01.07.05) Glaubwürdigkeitsproblem Kommentar von Klaus M. Frieling Wenn die Abgeordneten der Koalitionsparteien ihren Bundeskanzler unterstützen wollen, dann stimmen sie am Freitag nicht für Gerhard Schröder. Wenn Parlamentarier der rot-grünen Mehrheit im Bundestag hingegen für den Regierungschef votieren, stellen sie sich gegen ihn. Alles klar? Oder doch eher ein weiteres Ärgernis für die frustgeplagten Wahlbürger, die entschiedenes politisches Handeln der Berliner Akteure erwarten und keine kleinkrämerischen Winkelzüge? Das paradoxe Geplänkel im Vorfeld der Vertrauensabstimmung wirft ein Schlaglicht auf die politische Lage Deutschlands. Die reformorientierte Politik von Kanzler Schröder hat die sozialdemokratische Basis verstört. Als Folge ging ein ums andere Bundesland für die SPD verloren. Verständlich also, dass der Kanzler nach dem Wahldebakel im einstigen roten Stammland NordrheinWestfalen die Nagelprobe suchte – wohl wissend, dass die Rezepte der bisherigen politischen Nutznießer Union und FDP für das Wahlvolk nicht weniger bitter sind. Und so rechnet er sich offenbar wirklich noch Chancen auf eine Wiederwahl aus, will jedenfalls nicht zurücktreten. Gerade das wäre der einfachste und verfassungsrechtlich einwandfreie Weg hin zu Neuwahlen. Doch eben auch ein Eingeständnis des Scheiterns – und Schröder sieht sich nicht als gescheitert an. Die Idee der vorgezogenen Neuwahl entsprang wohl eher seinem Kalkül, den Wählern noch einmal eine Chance zu geben, aus Furcht vor Schlimmerem ihren Frieden mit seiner Agenda 2010 zu machen. Nun ja, man wird sehen... Zudem muss man schauen, ob die parlamentarische Praxis auch beim Bundespräsidenten und vor dem Verfassungsgericht Bestand haben wird. Vernehmlich grummeln derzeit nur die über Neuwahlen, die sich ausrechnen können, ihr Mandat – aus ihrer Warte ein Jahr zu früh – zu verlieren. Und Verlierer könnte es viele geben nach dem prognostizierten Wahltermin am 18. September. 9 Verlieren könnte auch die politische Glaubwürdigkeit: Was soll der Bürger denn erwarten von Politikern, die dagegen stimmen, weil sie dafür sind? CELLESCHE ZEITUNG 28.06.05 Das Grundproblem des von Kanzler Schröder als so bedrängend empfundenen Handlungsverlustes wäre selbst in dem nach den Ergebnissen der laufenden Befragungen relativ unwahrscheinlichen Fall einer gewonnenen Wahl aber trotzdem nicht gelöst: Eine Neuwahl nach verlorener Vertrauensabstimmung oder durch ein in die Verfassung aufgenommenes Selbstauflösungsrecht könnte für die Regierungsparteien bestenfalls ja nur das Stimmenverhältnis im Bundestag aufrecht erhalten, nicht aber zusätzlich das im Bundesrat verändern, das sich dort durch den Sieg der CDU in der Landtagswahl in NRW zu Gunsten der Morgenluft witternden Bundestagsopposition und der davor schon bestehenden Mehrheit der CDU im Bundesrat weiter zur CDU hin verschoben hatte. Selbst bei einem (hypothetisch angenommenen) Obsiegen des SPD-Kanzlers und seiner Koalition wäre die das Neuwahlvorhaben ausgelöst habende Blockadesituation zwischen Bundestag und Bundesrat also nicht entschärft! Und die nach seiner Beurteilung der politischen Lage – ihm allein steht die diesbezügliche Beurteilungskompetenz zu! - nicht mehr gesehene Mehrheit in seiner eigenen Partei zur Durchsetzung weiterer von nicht nur ihm als notwendig erachteter Reformschritte, weil in der SPD mit den »Alt-Linken» und den »halbherzigen Modernisierern» zwei unvereinbare Richtungen gegeneinander stehen, wird sich durch eine Neuwahl auch nicht zu Gunsten der »Reformpolitikbejaher« in der SPD verschieben, denn die innerparteilichen linken Reformkritiker werden in ihren Wahlkreisen wohl annähernd alle wiedergewählt werden, wenn sie nicht ihren Parteiaustritt erklären und zur WASG überwechseln! Das Grundgesetz ist nach seiner ersten Verkündung 1949 bis 2005 durch 51 Verfassungsänderungen immer wieder den Erfordernissen der jeweiligen Zeit angepasst worden. Es ist nicht einsehbar, dass dem Deutschen Bundestag in einer Ausnahmesituation nicht ebenso ein „Notausstieg“ über ein Selbstauflösungsrecht zuerkannt werden könnte, wie es die Verfassungen anderer demokratischer Länder ihren Parlamenten ermöglichen und wie es in ungefähr der Hälfte der Verfassungen unserer Bundesländer vorgesehen ist: In Bayern und in Nordrhein-Westfalen kann der Landtag sogar mit einfacher Mehrheit seine Selbstauflösung beschließen, wann einer einfachen Regierungsmehrheit gerade danach ist! SPD und CDU/CSU hätten 2005 vor der von fast allen Parteien gewollten Neuwahl eine ausreichende Stimmenanzahl für eine Verfassungsänderung aufbringen können, die die Grünen und die FDP – trotz begrüßter Neuwahlaussicht – nicht wollten. Das GG lässt - bisher - gemäß Art. 68 I GG aber nur dann eine vorgezogene Neuwahl zu, wenn der Bundeskanzler mit einer Vertrauensfrage gescheitert ist, er daraufhin den Bundespräsidenten bittet, das Parlament - binnen 21 Tagen - aufzulösen, und das Parlament bis zu seiner bevorstehenden Auflösung nicht schnell das Gesetz des Handelns wieder an sich reißt und eine zusammengeraufte Parteienkoalition durch ein konstruktives Misstrauensvotum mit der Mehrheit der Abgeordneten den alten Kanzler ab- und gleichzeitig – das ist das Konstruktive daran - einen neuen Bundeskanzler gewählt hat, der sich nun auf diese (neue) parlamentarische Mehrheit stützen kann. Ist das nicht der Fall, muss gemäß Art. 39 I 4 GG eine Neuwahl innerhalb von 60 Tagen stattfinden. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat in zwei Entscheidungen deutlich zum Ausdruck gebracht, dass es unter den geltenden Verfassungsbestimmungen von dem schon zweimal3 - von 3 In der Geschichte der Bundesrepublik war die Vertrauensfrage vor dem 01.07.05 bislang erst viermal gestellt worden: 22.09.1972: Im Streit über die Ostpolitik hatte die SPD/FDP-Koalition zuvor ihre Parlamentsmehrheit verloren. Willy Brandt unterlag – durchaus gewollt - bei der Vertrauensabstimmung mit 248 Nein- zu 233 Ja-Stimmen, u.a., weil die Mehrheit seiner Minister sich nicht an der Abstimmung beteiligt hatte. Der Kanzlergegenkandidat der CDU, Barzel, hatte jedoch das konstruktive Misstrauensvotum nicht für sich entscheiden können, weil zwei ihm fehlende Stimmen für je DM 50.000,- vom MfS(?) gekauft worden waren. Bundespräsident Heinemann löste das Parlament auf. Die daraufhin am 19. November durchgeführte Neuwahl stärkte beide Regierungsparteien und verschaffte Brandt wieder eine regierungsfähige Mehrheit, die auch weiterhin hielt, als Helmut Schmidt nach dem Rücktritt Brandts im Zuge der Guillaume-Spionageaffäre die Kanzlerschaft übernahm. 10 Brandt und Kohl - eingeschlagenen Schleichweg zu vorzeitigen Neuwahlen über den Weg des konstruiert(!) negativ verlaufenen Vertrauensvotums nicht sehr viel hält und es hat darum diesbezüglich einschränkende Kriterien aufgestellt: "Die Auflösung des Bundestages setzt stets eine politische Lage der Instabilität zwischen Bundeskanzler und Bundestag voraus und erfordert, daß der Bundeskanzler der stetigen parlamentarischen Unterstützung durch die Mehrheit des Bundestages nicht sicher sein kann." Um erneutem Missbrauch vorzubeugen, untersagten die Richter damals eine vorzeitige Parlamentsauflösung, für die Fälle, dass ein Kanzler, "dessen ausreichende Mehrheit im Bundestag außer Zweifel steht", versuchen würde, "sich zum geeignet erscheinenden Zeitpunkt die Vertrauensfrage negativ beantworten zu lassen mit dem Ziel, die Auflösung des Bundestages zu betreiben", sich ein Bundeskanzler zur Begründung der Vertrauensfrage lediglich auf "besondere Schwierigkeiten der in der laufenden Wahlperiode sich stellenden Aufgaben" berufen würde, die Mehrheitsparteien argumentieren würden, "ein über ein konstruktives Misstrauensvotum neu gewählter Bundeskanzler bedürfe neben seiner verfassungsmäßigen Legalität noch einer durch Neuwahlen vermittelten Legitimität". Das BVerfG billigte Kohls Vorgehen mit erheblichen Bedenken wegen von ihm gesehener "tiefgreifender Richtungskämpfe" innerhalb der FDP, weil nicht alle FDPler die Koalition mit der SPD hatten brechen wollen; im Bundesvorstand der FDP war der Koalitionsbruch nur mit drei Stimmen Mehrheit gebilligt worden, 20 der 32 Abgeordneten hatten die ersten Ergebnisse der Koalitionsgespräche mit der CDU abgelehnt, einige Abgeordnete der FDP (z.B. der jetzige EU-Kommissar Verheugen) waren zur SPD gewechselt. Den Leitsätzen des BVerfGs konnte entnommen werden, dass das BVerfG es wegen der im Grundgesetz getroffenen Regelung in seiner damaligen Zusammensetzung als unzulässig ansah, wenn in einer schwierigen politischen Lage eine Vertrauensfrage nur gestellt wird, um sie negativ beantwortet zu bekommen, um sich so zu einem zeitlich nahen genehmen Zeitpunkt in Neuwahlen flüchten zu können. Neuwahlen sollen nicht ertrickst werden können! Es müssten durch das Vorliegen einer "außergewöhnlichen politischen Krisensituation" unabweisbar handfeste Gründe für eine Neuwahl gegeben sein! Der ehemalige Präsident des BVerfGs, Benda, äußerte sich zu der Problematik in einem Interview in der WELT (22.06.05) mit den Worten: „Da appelliert ein Bundeskanzler an seine eigenen politischen Freunde, die ihn bisher unterstützt haben und von denen der Regierungssprecher mit einem gewissen Stolz berichtet, daß sie ihm mehr als 20mal die Kanzlermehrheit besorgt haben, ihm vertrauensvoll das Mißtrauen auszusprechen. Das ist ein in sich eingebauter Widerspruch. 05.02.1982: Helmut Schmidt forderte mit einer von ihm beantragten, an eine Sachfrage gekoppelten Vertrauensabstimmung von SPD und FDP die Billigung seiner Wirtschaftspolitik. Er hatte die Wahl nicht verlieren wollen, sondern eine wirkliche Bestätigung seiner Politik gesucht und mit 269 Ja- und 224 Nein-Stimmen auch erhalten. Dennoch ging der Konflikt in der Koalition weiter. Schmidt wurde dann ein halbes Jahr später mit Hilfe seines bisherigen Koalitionspartners FDP am 1. Oktober per Misstrauensvotum durch die gleichzeitige Wahl Helmut Kohl gestürzt. Die FDP ging eine neue Koalitionsehe mit der CDU/CSU ein. 17.12.1982: Helmut Kohl hatte geplant, seine per Misstrauensvotum an die Macht gekommene Regierung durch eine Neuwahl bestätigen zu lassen. Dafür musste er, wie Schröder es ihm 2005 nachmachen möchte, das Parlament trotz bestehender Koalitionsmehrheit auflösen lassen. Er tat dies über den Weg einer »unechten« Vertrauensabstimmung und unterlag wie beabsichtigt mit 218 Nein- zu 8 Ja-Stimmen bei 248 Enthaltungen aus der Regierungskoalition. Bundespräsident Karl Carstens löste erst drei Wochen später, am Ende der ihm von der Verfassung zugebilligten Bedenkfrist, den Deutschen Bundestag auf. Das Wahlergebnis am 6. März 1983 bescherte Kohl einen klaren Sieg. Das BVerfG billigte nachträglich mit erheblichen juristischen Bauchschmerzen Kohls Vorgehen, schuf aber, um einem erneuten Missbrauch zu wehren oder ihn wenigstens zu erschweren, mit seinem Urteil hohe Missbrauchsdämme 16.11.2001: Gerhard Schröder verband seine von ihm beantragte Vertrauensfrage mit der Abstimmung über den Einsatz der Bundeswehr im Anti-Terror-Kampf. Er gewann mit 336 Ja- zu 326 Neinstimmen. Auch Abgeordnete von Rot-Grün, die zuvor dagegen waren, hatten letztendlich für den Kanzler gestimmt, um den Fortbestand der Koalition zu sichern. Die Vertrauensabstimmung hatte also in diesem Falle als das Disziplinierungsinstrument gewirkt, als das es einem Kanzler von Verfassungswegen an die Hand gegeben worden ist. 11 Jener, der seine Ministerkollegen dazu bringt, dabei mitzumachen, muß selbst beurteilen, ob er damit eine sehr gute Optik erzeugt. Für mein Empfinden produziert er so nur eine Art optische Täuschung. Der Bürger soll den Eindruck haben, die Fraktion stehe fest zum Chef. Ich bin sehr gespannt auf die Rede des Bundeskanzlers, die eine rhetorische Höchstleistung sein müßte. Denn mit all den einander widersprechenden Argumentationslinien müßte er schlüssig erklären: Wählt mich ab, aber dann Wochen später bitte gleich wieder neu.“ Da blinkt bei dem ehemaligen Präsidenten des BVerfGs richterlich verklausulierte Ablehnung durch! Man mag sich gar nicht vorstellen, wie der Fall hätte gelöst werden müssen, wenn der Bundeskanzler die von ihm gestellte (möglicherweise an die Entscheidung in einer Sachfrage gekoppelte) Vertrauensfrage offensichtlich bewusst verloren, der Bundespräsident das Parlament trotzdem aufgelöst hat und das BVerfG das verweigert hätte, weil keine »echte« Vertrauensabstimmung vorgelegen habe! Die Abstimmung mit dem geplanten, nur durch abgesprochene Stimmenthaltungen erreichten Unterliegen in der Vertrauensfrage wurde von zwei Abgeordneten des Regierungslagers als „unecht und unehrlich“ angesehen. Der Abgeordnete der Grünen Schulz erklärte des Weiteren im Bundestag und ließ in seiner beim BVerfG im Wege einer Organklage eingereichten Klagschrift gegen die vorzeitige Auflösung des Deutschen Bundestages erklären, dass ein von einem Bundeskanzler aus persönlichem Argwohn heraus gespeistes, nur „gefühltes Misstrauen“ kein hinlänglich tragfähiger Grund für eine Auflösung unseres Bundesparlamentes sein könne, die ihm sein auf vier Jahre erteiltes Abgeordnetenmandat entzieht. Natürlich habe ein Bundeskanzler einen Beurteilungsspielraum, der aber kein Freibrief sei, denn sonst hätten wir in Deutschland keine Parlaments-, sondern einen Kanzlerdemokratie! Es müssten belastbare Fakten dafür genannt werden, dass nicht nur Abgeordnete im politischen Meinungskampf nicht nur ab und zu anderer Meinung seien als der Kanzler, sondern dass dem Bundeskanzler die erforderliche Regierungsmehrheit auf Dauer verloren zu gehen drohe. Dem Bundespräsidenten wurden als angeforderte Dokumentation nur Presseartikel mit Mutmaßungen und Spekulationen von Journalisten der Tagespresse vorgewiesen, bevor er die „Drucksache 15/5930“ mit dem Text: „Unterrichtung durch den Bundespräsidenten. Gemäß Artikel 68 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland löse ich hiermit auf Vorschlag des Bundeskanzlers den 15. Deutschen Bundestag auf.“ den Abgeordneten in ihr Postfach legen ließ. Zu beachten sei auch, dass der Bundeskanzler keine einzige Abstimmung verloren habe, auch zwischen der Ankündigung der beabsichtigten Parlamentsauflösung über das Nadelöhr des Art. 68 GG und der dann gut einen Monat später gestellten Vertrauensfrage nicht! Die Abgeordnete der SPD Hoffmann hatte eine in die gleiche Richtung zielende Klage eingereicht. Auch Splitterparteien hatten mit dem Argument geklagt, dass sie im Gegensatz zu den größeren und großen Parteien kaum Zeit und Geld für die Vorbereitung des Wahlkampfes hätten. Das in meinen »Juristenaugen« einzige das Klagebegehren möglicherweise tragende »Zeit-Argument« hätte sein können, dass sie, die in keinem Bundes- oder Landesparlament vertreten sind und sich daher laut BWahlG über eine Mindestanzahl einzureichender UnterstützerUnterschriften für die Wahlteilnahme jedes Mal erst qualifizieren müssen, dass sie in der kurzen Zeit nicht die für eine Anmeldung beim jeweiligen Landeswahlleiter benötigten Unterschriften beibringen könnten. Ohne eine in Anbetracht der Fristenverkürzungen angebrachte und erforderliche Reduzierung der Anzahl der beizubringenden Unterschriften würden sie in ihrem Recht, eine von ihnen geplante Partei an der Wahl teilnehmen zu lassen, verfassungswidrig behindert. Doch damit hatte das BVerfG sie nicht hören wollen, weil alle Parteien unter Zeitdruck stehen und der Bundeswahlleiter alle in seinem Parteienregister verzeichneten Vereinigungen und Parteien sofort nach der Ankündigung des Stellens der Vertrauensfrage und damit einen Monat bevor sie in den Bundestag eingebracht worden war, angeschrieben und auf die sich abzeichnende Entwicklung hingewiesen hatte. In der Tagesschau vom 23.08.05 wurde dann als (angeblicher) Ablehnungsgrund des BVerfGs hinsichtlich der von Splitterparteien eingereichten diesbezüglichen Klagen mitgeteilt: Die Stellung der Vertrauensfrage diene nicht dem Schutz der kleinen Parteien, da diese nicht im Bundestag vertreten seien. Ein meiner Meinung nach nicht hinreichendes Argument, denn die Stellung der Vertrauensfrage dient keiner(!) Partei(!). Die Stellung der Vertrauensfrage beabsichtigt ausschließlich, die Handlungsfähigkeit des Verfassungsorgans Bundeskanzler zu stärken. Hätten die Richter des BVerfGs die Stellung der Vertrauensfrage als unzulässig verworfen, hätten sich - ohne ein Selbstauflösungsrecht des Parlaments - die großen Volksparteien notfalls ohne 12 Neuwahlen auf die Bildung einer großen Koalition einlassen müssen, wenn eine bisherige Regierungsmehrheit nicht mehr arbeitsfähig sein sollte oder nicht mehr weiterwursteln wollte, weil alle ihre Gesetzesvorhaben im Bundesrat blockiert oder im Vermittlungsausschuss bis zur Unkenntlichkeit verwässert würden. Das BVerfG hat sich mit 7:1 Stimmen entschieden, den Ablauf der Vertrauensabstimmung nicht als verfassungswidrig einzustufen und so die angelaufenen Wahlvorbereitungen nicht zu unterbrechen. Eine "unechte" Vertrauensfrage mit dem Ziel einer vorgezogenen Wahl sei grundsätzlich zulässig. Das gelte auch schon vor einem offenen Zustimmungsverlust des Kanzlers im Bundestag - und zwar dann, wenn der Regierungschef durch mangelnden Rückhalt gezwungen sei, von wesentlichen Inhalten seines politischen Konzepts abzurücken. Ein solcher interner Vertrauensverlust müsse im politischen Prozess - und auch bei der Stellung der Vertrauensfrage - nicht notwendigerweise offen gelegt werden. „Eine Erosion und der nicht offen gezeigte Entzug des Vertrauens lassen sich ihrer Natur nach nicht ohne weiteres in einem Gerichtsverfahren darstellen und feststellen.” Bei "verdeckter Minderheitssituation" sei eine "unechte Vertrauensfrage" möglich. Da habe ein Regierungschef einen weiten Beurteilungsspielraum, den das BVerfG nicht für sich beanspruchen könne. Das bedeutet nichts anderes, als die Einschätzung des Bundeskanzlers, er habe künftig keine ausreichende Mehrheit mehr, selbst dann durchgehen zu lassen, wenn er die wesentlichen Gründe dafür nicht offenlegen kann oder will. Was "im politischen Prozess in legitimer Weise nicht offen ausgetragen wird", so fünf der acht Richter, müsse "unter den Bedingungen des politischen Wettbewerbs auch gegenüber anderen Verfassungsorganen nicht vollständig offenbart werden". Die Richter machten deutlich, dass in einer Situation, in der der Kanzler seinen politischen Kurs nicht durchhalten könne, eine "unechte" Vertrauensfrage mit dem Ziel vorgezogener Wahlen grundsätzlich zulässig sei. Der Kanzler allein entscheidet, ob er im Rahmen der gegebenen parlamentarischen Verhältnisse noch politischen Gestaltungsraum für sich sieht - weder Bundespräsident noch Verfassungsrichter dürfen dieser Einschätzung eigene Beurteilungen entgegensetzen. Es sei denn, die Kanzlerdarstellung ließe sich "zweifelsfrei" widerlegen. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner mündlichen Begründung deutlich gemacht, dass es sich mit den politischen Gründen für oder gegen Neuwahlen zwar befassen könne, sich letztlich aber über die Beurteilungskompetenz der an der Auflösung des Parlaments über den Weg der Stellung der Vertrauensfrage beteiligten Verfassungsorgane Bundeskanzler, Bundestag und Bundespräsident, ob und wann Neuwahlen beschlossen werden sollten, nicht hinwegsetzen wolle. Solche Einschätzungen hätten "Prognosecharakter" und seien an höchstpersönliche Wahrnehmungen gebunden. Der nicht offen gezeigte Entzug des Vertrauens lasse sich in einem Gerichtsverfahren nicht ohne weiteres feststellen. "Ob der Kanzler über eine verlässliche parlamentarische Mehrheit verfügt, kann von außen nur teilweise beurteilt werden", heißt es in dem Urteil. Deshalb könne das Gericht die Einschätzung des Kanzlers, er sei für seine künftige Politik nicht mehr ausreichend handlungsfähig, nur eingeschränkt überprüfen. Das „dissenting vote“, das abweichende Urteil des Bundesverfassungsrichters Jentsch hingegen lautete knapp zusammengefasst: Das Grundgesetz kenne kein konstruiertes Misstrauensvotum, eine aktuelle Krisenlage der Bundesregierung sei nicht zu erkennen, denn jede Regierung müsse notfalls mit knappen Mehrheiten regieren. Das gehöre zum politischen Geschäft. Den von Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) vorgetragenen Gründen lasse sich seine politische Handlungsunfähigkeit nicht entnehmen. Dissens gehöre zum Wesen der innerparteilichen Demokratie. Die Entscheidung des Bundeskanzlers entbehre einer nachvollziehbaren Tatsachengrundlage. Zudem kenne das Grundgesetz kein "konstruiertes Misstrauen" des Kanzlers gegenüber dem Parlament. Somit sei die Auflösung des Bundestages verfassungswidrig geschehen und hätte gestoppt werden müssen, um eine Schwächung des Parlamentes zu Gunsten der Machtfülle des Kanzlers zu unterbinden. Die Mehrheitsentscheidung des BVerfGs erlaube einem Bundeskanzler, "über eine 'unechte' Vertrauensfrage Neuwahlen herbeizuführen, wenn er die akklamatorische Bestätigung seiner Politik für erforderlich hält, um parteiinterne Widerstände zu überwinden". Gestehe man dem Kanzler einen derart weiten Ermessensspielraum zu, dann komme dies einem parlamentarischen Selbstauflösungsrecht "sehr nahe", das im Grundgesetz nicht vorgesehen sei. Bedenkens- 13 und beachtenswerte Argumente, die darauf abzielen, dem Deutschen Bundestag durch eine Verfassungsänderung ein verfassungsrechtlich klar geregeltes Selbstauflösungsrecht zuzugestehen! Der unterlegene Kläger Werner Schulz (Grüne) kommentierte noch in Karlsruhe das Urteil mit den Worten: "Der Kanzler hat jetzt ein Parlamentsauflösungsrecht, das Parlament hingegen nicht. Der Regierungschef kann sich nun auf bloßes Misstrauen und bloße Prognose hin für eine Auflösung entscheiden.“ Der mit der Entscheidung eingeschlagene Weg zu einer erweiterten Kanzlerdemokratie sei ein fataler Irrweg. In jeder auf Zusammenwirken angelegten Gesellschaft muss geklärt werden, wie die Entscheidungsstrukturen für die politische Gestaltung des Zusammenlebens organisiert werden sollen. Das kann in einem: „Führer befiehl – wir folgen!“, bestehen. Doch damit haben wir in unserer Geschichte, haben die Völker Europas und der Welt durch unsere Schuld zu schlechte Erfahrungen gesammelt. Die Entscheidungsstrukturen können aber auch so organisiert sein, dass eine wonach auch immer definierte Bevölkerungsgruppe die Bevölkerungsmehrheit ohne jegliche demokratische Legitimation majorisiert, wie es z.B. die Führung der PDS-Mutter SED gegenüber der Bevölkerung Ostdeutschlands durch getürkte Wahlen, durch Wahlbetrug und den die Bürger als „Schild und Schwert der Partei“ nach Gestapo-Manier bespitzelnden Geheimdienst MfS 40 Jahre lang getan hat. Und nicht immer bricht ein solches die Bevölkerungsmehrheit majorisierendes System dann friedlich zusammen. Das konnte z.B. an den Auseinandersetzungen der Hutus und der Tutsis in Uganda und Ruanda gesehen werden, wo sich in den Kämpfen um die politische Macht im Lande die Stämme gegenseitig abschlachteten, als sich die von einer adäquaten politischen Teilhabe ausgeschlossenen 85 % Hutus gegen die sie auch noch in den Jahrzehnten nach der Entkolonialisierung dominiert habenden 15 % Tutsis wandten und sie in einem kollektiven Blutrausch abschlachteten. Ähnliche Motive liegen den Selbstmordattentaten im Irak zu Grunde, mit denen die sunnitische Bevölkerungsminderheit, die 500 Jahre lang das Land beherrscht hatte, den Übergang der Macht durch demokratische Wahlen unter UNO-Aufsicht auf die schiitische Bevölkerungsmehrheit zu verhindern versucht. Die fairste Ausgestaltung des Zusammenlebens ist die Organisation einer Gesellschaft nach wie auch immer näher ausgestalteten demokratischen Prinzipien, indem die Betroffenen selber frei(!) entscheiden können, welchem/r der zur Auswahl stehenden Bewerber/innen um die politische Führungsposition sie politische Macht über sich selbst geben wollen. Der amerikanische Präsident Lincoln gab 1863 auf dem Schlachtfeld von Gettysburg eine in ihrer Schlichtheit klassische Definition von Demokratie: „Government of the people, by the people, for the people.“, wobei diese Machtübertragung durch wirklich freie Wahlen vorgenommen werden muss und immer nur auf vorher festgelegte Zeit für eine Legislaturperiode geschehen darf, damit nach Ablauf der Legislaturperiode ein Machtwechsel möglich bleibt. „Ballot, not bullet.“ “Der Stimmzettel, nicht die Gewehrkugel“, soll darüber entscheiden, wer diese Macht auf Zeit in der jeweils bevorstehenden Legislaturperiode ausüben soll. Auszufüllen ist der Stimmzettel möglichst von den stimmberechtigten Betroffenen höchstpersönlich in allgemeinen, (pressions-)freien, gleichen und geheimen Wahlen; es sollte keine Bevollmächtigung eines Anderen möglich sein - wie sie aber in Frankreich und Großbritannien gehandhabt wird und in der Ukraine die Hauptquelle des Wahlbetruges gewesen war. „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.“, heißt es als Grunderfordernis für einen demokratischen Staatsaufbau etwas versteckt in Artikel 20, Absatz 2 Grundgesetz, unserer Verfassung, und damit unserer höchsten staatlichen Gesetzesnorm: Demokratie delegiert durch freie Wahlen Macht von »unten« nach »oben«, von den durch die Maßnahmen der von den Wahlbürgern des Volkes frei gewählten Regierung später Be- 14 troffenen zu den zukünftigen Entscheidungsträgern. Wahlen stellen somit die unmittelbarste Form der politischen Teilhabe der Regierten dar. Damit die Wähler eine sinnvolle Auswahl – außer nach der Person des jeweiligen Spitzenkandidaten nach dem für personalisierte Wahlkämpfe gültigen Motto: „Ich oder er/sie“ - unter den sich zur Wahl Stellenden treffen können, müssen Vorstellungen und Interessen gebündelt und zu einem Konzept zusammengefasst werden, das dann den Wählern als – hoffentlich aussagekräftiges - Wahlprogramm zur Abstimmung präsentiert wird, damit die Wähler nicht in der Art eines »Impulskaufes« ihre Kreuze setzen müssen. Diese Interessenbündelung vorzunehmen und die sich daraus ergebende politische Zielrichtung festzulegen, ist in einer Massengesellschaft die Aufgabe von Parteien. Wie sollte man sonst den Willen von ca. 62 Millionen Wahlbürgern in den unterschiedlichsten Sachfragen kanalisieren und einer Entscheidung zuführen? Niemand weiß - trotz aller mehr oder minder latent wabernden unterschwelligen Parteiverdrossenheit - etwas Besseres. Deshalb sind Parteien notwendig, ja unverzichtbar: Parteien sind in demokratisch organisierten Gesellschaften im staatlich-gesellschaftlichen Raum durch Mitwirkung an der politischen Willensbildung der jeweiligen Gesellschaft als »Transmissionsriemen« organisierter Vertrauenswürdigkeit ihrer Anhänger um Durchsetzung von Gruppeninteressen bemühte, an allgemeinen politischen Wahlen teilnehmende freiwillige Zusammenschlüsse mit von ihren jeweiligen Wählern geglaubter besonderer politischer Kompetenz. Man braucht die Parteien dieserhalb nicht zu lieben, sollte sie aber zur Durchsetzung seiner vorrangigen(!) Zielvorstellungen – mit allen Zielvorstellungen stimmt man meist nicht überein(!) - nutzen! Oft muss eine (gewichtete) 51-%-tige Zustimmung zu den von einer Partei vertretenen Zielen ausreichen, um auf dem Stimmzettel hinter ihrem Namen das sie gegenüber den Mitbewerbern bevorzugende Kreuz zu machen. Um es an einem die künftigen Bundestags- und Europawahlen möglicherweise mitentscheidenden Beispiel deutlich zu machen: Wer den Umbau unseres Gesundheitssystems in der von den Grünen und der SPD angestrebten sozial schonenderen Weise will, vielleicht sogar aus irgendwelchen ganz persönlichen Gründen 2005 einen Bundeskanzler Schröder für besser für unser Land hält als eine Bundeskanzlerin Merkel, wer aber auf der anderen Seite eine der EU drohende Vollmitgliedschaft der Türkei aus grundsätzlichen Erwägungen heraus für verhängnisvoll für sowohl unser Land als auch für Europa hält und daher ablehnt, muss die beiden Seelen in seiner Brust abwägen und entscheiden, was ihm nach seiner individuellen Gewichtung am wichtigsten ist. Die Abwägung könnte dann im Extremfall sogar so aussehen: Man kann Schröder für den besseren weil in Regierungsdingen erfahreneren Bewerber halten, weil der z.B. schon als Ministerpräsident ein Bundesland und sieben Jahre lang die Bundesrepublik als Bundeskanzler regiert hat, wohingegen seine Konkurrentin noch keine gleichwertige Regierungsverantwortung vorweisen kann – ein Handicap, das jeder Newcomer zwangsläufig hat -, man kann Schröder für den besseren Kandidaten halten, weil er uns vor dem Irak-Krieg-Abenteuer an der Seite der USA bewahrt hat, was bei einer CDURegierung nicht so gewiss gewesen wäre(!), weil des Weiteren seine Partei, die SPD, mehr für soziale Gerechtigkeit steht als die CDU mit ihren für die „kleinen Leute“ einschneidenderen arbeitsrechtlichen Vorstellungen, die von dem CDU-Koalitionspartner in spe, der FDP, noch weiter verschärft werden könnten, weil ... . Aber Bundeskanzler kommen und gehen. Und nach welchem Modell unser Gesundheitswesen umgebaut wird, ist – jedenfalls für mich – relativ zweitrangig, da es unser Leben nicht grundlegend und einschneidend beeinflussen wird. Dieses Motivationsbündel ist daher auf jeden Fall relativ zweitrangig gegenüber der unser künftiges Leben in Deutschland und der Europäischen Union einschneidend verändernden Vision einer möglicherweise vollzogenen Vollmitgliedschaft der asiatischen(!) Türkei in der Europäischen(!) Union, in der außereuropäische Länder nichts, absolut nichts zu suchen haben! „Marokko ist kein europäischer Staat.“ Mit dieser zutreffenden Begründung war 1997 das Aufnahmebegehren des nordafrikanischen Marokko in die EU von der Europäischen Kommission abgelehnt worden. Analog muss diese Begründung auch für die asiatische Türkei gelten, die ebenfalls kein europäischer Staat4 ist! 4 Näheres dazu siehe im Internet auf den Websites: www.Hans-Uwe-Scharnweber.de oderwww.cdq.de 15 Das Gremium, in dem alle Staaten vertreten sein sollten, ist die UNO, nicht aber die EU! Wir Europäer drängen uns ja auch nicht in die Afrikanische Union (AU) oder andere vergleichbare überregionale Zusammenschlüsse! Warum sollten wir dann außereuropäische Staaten in die Europäische Union aufnehmen, aufnehmen müssen? Nur weil der türkische Ministerpräsident Erdogan sich in Infamie versucht und uns Europäern einreden will, dass die EU sein Land als Vollmitglied akzeptieren müsse(!), weil die EU nur so den (von ihm diffamierend eingesetzten) Begriff des „Christenklubs“ vermeiden könne? Wer diese mit einer Mitgliedschaft der Türkei in der EU zwangsläufig verbundene Veränderung der Bundesrepublik und der EU nicht will, muss, wenn er seine Stimme an seinem vorrangigen Wahlziel gemessen am effektivsten einsetzen will, trotz eventueller Bejahung einiger Wahlprogrammziele der SPD und Ablehnung einiger Wahlziele der Union bei den kommenden Bundestags- und Europawahlen die in seinem Bundesland kandidierende Unionspartei wählen, um Schaden von unserem Staat abzuwenden. Wahlenthaltung bei widerstreitenden persönlichen Interessen oder aus Verärgerung heraus ist keine Alternative: Dann bestimmt letztlich die Mehrheit der anderen, die an der Wahl teilgenommen haben, wer regieren darf und seine Vorstellungen durchsetzen können soll! Doch dazu später noch Genaueres. „Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit“, umschreibt Art. 21 I 1 GG (1949 zum ersten Mal in der deutschen Verfassungsgeschichte seit dem Auftreten von Parteien in der Paulskirchenversammlung 1848) ihre staatspolitisch unverzichtbare Aufgabe, die auch der Grund für ihre großenteils stattliche staatliche Teilfinanzierung ist. Mit ihren - zur Verdeutlichung der gesellschaftspolitischen Entwürfe hoffentlich unterschiedlichen Programmen haben die Parteien sich als staatspolitische Scharniere zwischen dem Volk und seiner von dem Volk zu wählenden, von den bei der letzten Wahl siegreichen Parteien gebildeten Regierung dem Votum der Wähler/innen zu stellen und um die Stimmen der Wähler/innen zu werben. Dabei sollte aus den Programmen klar hervorgehen: Was will welche Partei auf welchem Weg mit letztlich welchem Ziel unter Einsatz welcher Mittel zu wessen Vorteil und zu wessen Nachteil erreichen? Und allein die einzelne Wählerin und der einzelne Wähler entscheiden – informiert rational, ahnungsvoll gefühlsmäßig, traditionell, mit oder ohne Wut im Bauch oder leider, von (wegen der realen Sachlage unumgänglich notwendigen) Verzichtsgesetzen in den Harnisch gebracht, gänzlich irrational und eventuell auch völlig ahnungslos – wo sie/er ihr(e)/sein(e) Wahlkreuz(e) macht. Eine Stimmabgabe bei Wahlen ist das stärkste Instrument der politischen Einflussnahme eines parteilosen gewöhnlichen Wahlbürgers, der sich nicht die ausgesprochene Mühsal kontinuierlicher abendlicher, nächtlicher und oft sein freies Wochenende beanspruchender Parteiarbeit antun will und nur bei Wahlen seine Hoffnungen oder seinen aufgestauten Grimm zum Ausdruck bringen möchte: Wenn Demos, wütende Leserbriefe und vielleicht sogar Parteiaustritte nichts bewirken - das an anderer Stelle des Wahlzettels als bei der letzten Wahl gesetzte Kreuz kann die politische Landschaft verändern: Demokratie ist Machtkontrolle durch mögliche Machtkorrektur! Der völlig unangebrachte Kommentar eines Journalisten nach der Bundestagswahl 2002, mit dem der den von ihm als ärgerlich empfundenen Wahlausgang in einer Schlagzeile kommentierte: „Das Volk hat seine Macht missbraucht, weil es die falsche Regierung gewählt hat!“, brachte den Bundesinnenminister in Harnisch und ließ ihn – völlig berechtigt! - nach dem Demokratieverständnis des Schreiberlings fragen. Hinter der ministeriellen Kritik steht allerdings die Vorstellung, dass »das Volk« mit einer demokratischen Wahlentscheidung gar keinen Machtmissbrauch begehen könne. Ist das aber so? Jede Macht kann missbraucht werden, auch die »des (’dummen’ weil verführbaren) Volkes«! Man muss nur die Aufnahme vom 18.02.1943 – nach weitgehender Zerstörung vieler deutscher Städte durch alliierte Bombergeschwader und nur zweieinhalb Wochen nach der Niederlage von Stalingrad am 31.01.1943 - aus der Kroll-Oper hören, als Goebbels in seiner »Sportpalast-Rede« 16 fragte: „Wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt noch vorstellen können?“ Rasende Beifallsstürme und ein tosendes: „Ja!“, war die enthusiasmierte Antwort. Da hatte das von den Nazis narkotisierte Volk seine Macht missbraucht; und entsprechend der genannten göbbelschen Prognose und des hitlerschen Versprechens: „Deutsches Volk, gib mir vier Jahre Zeit, und ihr werdet Deutschland nicht wiedererkennen!", waren dann nach zwölf Jahren Naziherrschaft meine - mir streng verbotenen - Spielplätze ab und zu Trümmergrundstücke in Deutschlands völlig zerbombten Städten. Die Empörung des »Verfassungsministers« ob dieses hanebüchenen Journalisten-Geschreibsels bezüglich des Ausgangs der Bundestagswahl 2002, das Volk hätte seine Macht missbraucht, ist bestimmt voll berechtigt, aber wenn Links- und Rechtsextreme Wahlergebnisse wie in der Weimarer Republik erzielen würden, wenn ein die Massen verführender Volksagitator - ähnlich Hitler erneut in demokratiegefährdender Weise bei Wahlen als Rattenfänger eine große Anhängerschaft hinter sich versammeln würde, dann stände auch ich nicht an, das Fazit zu ziehen: „Mit einem solchen Wahlergebnis hätte das von einem Demagogen verführte Volk seine Macht missbraucht!“ Man kann aber nicht den 2002 über Stoiber siegreichen Schröder mit Hitler und dessen Machtmissbrauch vergleichen! Nach dem den rhapsodisch gefassten Art. 20 II GG für den Bereich der parlamentarischen Vertretung auf Bundesebene näher ausführenden Bundeswahlgesetz (BWG) haben laut dessen § 12 die im In- und (seit 1985 einige und der Modifizierung 1998) alle im Ausland lebenden wahlberechtigten Angehörigen des deutschen Staatsvolkes einschließlich der eingebürgerten ehemaligen Ausländer5 mit zumindest einem Anspruch auf einen deutschem Pass, die sich wenigstens einmal drei Monate ununterbrochen im Bundesgebiet aufgehalten haben – und nicht etwa auch hier wohnende EU-Bürger6, ausländische Geschäftsleute, Wissenschaftler und Asylanten –, die Möglichkeit, durch ihren Wahlakt mitzubestimmen, wer für eine genau limitierte Zeit bundesstaatliche „Staatsgewalt“ im Namen des (deutschen) Volkes ausüben soll, indem sie durch ihre Stimmabgabe die Zusammensetzung des parlamentarischen Gremiums Deutscher Bundestag (Legislative/gesetzgebende Gewalt) bestimmen, der dann seinerseits nach den Vorgaben der Verfassung die Zusammensetzung der anderen – von ihm dann unabhängigen - staatlichen Gewalten (Exekutive/ausführende Gewalt und Judikative/rechtsprechende Gewalt) beeinflusst. Ungefähr 50.000 Wahlunterlagen gehen jedes Mal zu Deutschen in alle Welt und müssen dann zum Wahltag rechtzeitig zurückgekommen sein und am Wahlabend zur Auszählung bereitliegen. Das ist natürlich bei einer vorgezogenen Bundestagswahl mit ihren verkürzten Fristen (bis zum 35. Tag vor der Wahl muss das aktuelle Wählerverzeichnis erstellt sein und zur Einsicht ausliegen, der Stichtag, zu dem die Kreis- und Landeswahlausschüsse über die Zulassung der Wahlvorschläge entscheiden müssen, wurde vom 58. Tag auf den 30. Tag vor der Wahl vorgezogen, über wegen einer Ablehnung eingereichte Beschwerden müssen die Wahlausschüsse bis zum 24. Tag vor der Wahl entschieden haben, erst dann können die Stimmzettel in den Druckauftrag gegeben werden, die Tonnen Papier sind schon zuvor bestellt worden, die Briefwahlfrist ab Antragstellung wurde von sechs auf nur drei Wochen vorgezogen, die rund 80.000 Wahllokale und rund 10.000 Briefwahl-Bezirke müssen eingerichtet und die erforderlichen rund 630.000 Helfer für insbesondere die Wahllokale müssen auf die Schnelle beschafft werden) organisatorisch sehr schwierig zu bewerkstelligen! Aber schon die Bundestagswahl 1990 hatte nur wenige Wochen nach der Wiedervereinigung stattgefunden und deswegen ebenfalls mit stark verkürzten Fristen organisiert werden müssen. Dem Wahlakt der Bürger gehen Wahlkämpfe der Parteien und ihrer Bewerber um die Sitze im Parlament, die Mandate, voraus. Diese Wahlkämpfe sind werbliche Veranstaltungen der „machtversessenen und machtvergessenen“ (Alt-Bundespräsident von Weizsäcker) Parteien – und 5 Von den Russlanddeutschen wählen rund 75 % die CDU/CSU, eingebürgerte Türken zu über 60 % die SPD, ein größerer Prozentsatz auch die Grünen; auf dieses ihr zutendierende Wählerreservoir muss jede Partei Rücksicht nehmen. 6 Bei Kommunalwahlen hingegen sind unter bestimmten Voraussetzungen auch Ausländer wahlberechtigt. 1989 wollten die Grünen das aktive und das passive Wahlrecht für Bundestagswahlen auf alle Ausländer ausdehnen, die sich mindestens seit 5 Jahren berechtigt in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten. 17 weisen auch nur den Wahrheitsgehalt von „werblichen Veranstaltungen“ auf; eine Definition, die Gerichte im Gegensatz zu »zugesicherten Eigenschaften« gerne verwenden, wenn sie die erhobenen Ansprüche eines zu blauäugigen Zeitgenossen wegen des marktschreierischen Anpreisens einer Ware aufgrund dessen zu großer Leichtgläubigkeit, die jedem Normalsinnigen sofort oder mit einem bisschen Nachdenken hätten auffallen müssen, abweisen. „Problemlösungsvorschläge verkommen zu blassen Instrumenten im Machtkampf. Geht es aber nur noch um die Macht, spricht keine Partei gerne offen wirkliche Probleme an. Das hat sich z.B. im letzten Wahlkampf [2002; der Verf.] gezeigt: Keine der beiden Seiten hat sich getraut, notwendige Grausamkeiten beim Namen zu nennen. Dadurch schwindet das Zutrauen der Bürger in die Politik“, so Alt-Bundespräsident von Weizsäcker (STERN 05.12.02). Die Politiker in Deutschland ängstigten sich bisher derart vor dem Kreuz des Souveräns auf dem Stimmzettel, dass sie Wahlen bislang für notorisch unvereinbar hielten mit ernsthaften Reformen! Und mit der schonungslosen Wahrheit! Alle Parteien vertrauten bisher auf das schlechte Gedächtnis der Wahlbürger spätestens am Wahltag. Sie glaubten, sie könnten die schon lange notwendigen einschneidenden Reformen an einer wirklichen Auseinandersetzung mit dem Wähler mit eventuellen Konsequenzen für die Mandatsvergabe(!) - einfach vorbeimogeln; bis schließlich nach 16 Jahren CDU-Herrschaft unter Kohl wegen der von der CDU/CSU-FDP-Koalition bewusst unterlassenen oder verschleppten notwendigen Reformen der Reformdruck zu groß geworden war. Ein Buch zu der Thematik, welche gesellschaftlichen Probleme anstehen, was Politik leisten müsste und wie Politik darauf reagiert oder reagieren müsste, könnte sein: Beck, U.: „Worauf es ankommt“. Es wird dargestellt, welche Ziele in Politik umgesetzt werden müssten, was die einzelnen Parteien wollen und wie ehrlich ihre Programme sind. Erste Reformen wurden nach Jahren endlich mit der Agenda 2010 eingeleitet; die Auswirkungen von insbesondere „Hartz IV“ sind schon in Ansätzen offenbar geworden – und nicht nur die aktuell Betroffenen, sondern auch die, die für sich die Gefahr des »Abrutschens« befürchten, ängstigen sich davor; ohne dass durch nationale Maßnahmen »die Globalisierung» mit ihren vielfältigen Auswirkungen zurückgedreht werden könnte. Das aber ist der Anspruch der Betroffenen und der Gefährdeten an »die Politik«. Zur Wahl 2005 müssten die teilweise inzwischen entwickelten unterschiedlichen Konzepte der Parteien zur Lösung der weiterhin drängenden Reformen dem Wähler zur Abstimmung mit dem Wahlzettel vorgelegt werden! Fraglich ist, wie sich die Wähler nach dem Greifen von „Hartz IV“ und seinen ersten sozialen Schleifspuren verhalten werden: Nach der politischen Erfahrung sind Gewinner von Reformen nur sehr kurze Zeit dankbar, Verlierer aber geradezu rachsüchtig! Aber wie gering ist andererseits der Prozentsatz der Wähler, die wirklich - spätestens im Wahlkampf - unangenehme Wahrheiten hören wollen? „Man soll nie vergessen, dass die Gesellschaft lieber unterhalten als unterrichtet sein will“, meinte der zum »Benimm-Papst« gemachte Adolph Freiherr von Knigge vor vielen Jahrzehnten. Aus dieser Erkenntnis heraus deutete sich, angeheizt von der »YELLOW -PRESS«, 2005 wohl wieder ein »Wahlkampf der Nebensächlichkeiten« an, in dem es auf jeden Fall den marktschreierischen Massenblättern mehr um einen (retouchierten) Schwitzfleck unter dem Arm der Kandidatin anlässlich eines privaten Konzertbesuches in Bayreuth als um von den Parteien zur Wahl gestellte Programminhalte ging! Und man konnte sich besorgt fragen: Sind die Wähler noch zu retten? Der bisherige Teufelskreis: Da kaum jemand unangenehme Wahrheiten hören und zur Kenntnis nehmen wollte, gab es auch kaum Politiker, die sie sagten! Welcher Politiker will unangenehme Wahrheiten von sich aus in einer „Schweiß-Blut-und-Tränen-Rede“ nach dem Motto: „Gut ist, was weh tut!“ als Quasi-Offenbarungseid öffentlich bekennen? Damit weckt man soziale Ängste, erringt aber üblicherweise keine Wahlerfolge, sondern gefährdet den angestrebten Wahlsieg in hohem Maße! „Die Parteien halten Verwöhn-Wahlkämpfe für den einfachsten Weg“ (von Weizsäcker). Der skeptische Menschenkenner Georg Christoph Lichtenberg befand: „Vom Wahrsagen lässt sich's wohl leben auf der Welt, aber nicht vom Wahrheit sagen.“ Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Lehman, und der damalige Präses der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kock, forderten als Kirchenvertreter in ihren Pfingstansprachen 2003 von den Politikern und von jedem einzelnen Bürger mehr Mut zu Reformen. Nötig sei Mut zur Überprüfung 18 auch der eigenen Interessen im Interesse des Gemeinwohls. Das meist mit der Vergabe von kleinen Wahlkampfgeschenken7 (neudeutsch: „give-aways“) verbundene schon fast prostitutive »Ranschmeißen« mancher Kandidaten an ihre potentiellen Wähler in zweifelhaften Game-Shows, anderen „Events“ und sogar an FKK-Stränden in Deutschland oder an Urlaubsstränden im Ausland 1998 und 2002 fördert nicht die so dringlich erforderliche Sachauseinandersetzung! Wer völlig unkritisch als Parteivorsitzender mit einer „18“ unter der Schuhsohle an FKK-Stränden um Wähler wirbt, darf sich nicht wundern, wenn die Wähler ihm oder „seiner“ Partei allenfalls Klamauk, aber kaum qualifizierte Sacharbeit zutrauen! Und leider wird von dem einzelnen Wähler zu oft geglaubt, was ihm nach dem Mund geredet wird. Aber: „Wenn wir nur noch das sehen, was wir zu sehen wünschen, sind wir bei der geistigen Blindheit angelangt“, mahnte vor mehr als 100 Jahren Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach. „In einem Abwägungsprozess, wollen wir weiter regieren, hat sich die SPD und die Bundesregierung und auch der Bundesfinanzminister fürs Weiterregieren entschieden und gegen die Ehrlichkeit.“, zitiert der stellvertretende Chefredakteur des STERN, Jörges, am 23.12.02 in einer Kolumne seines Blattes „Lügen des Jahres – Die Lüge ist der Normalfall“ den von seinem Grünen Landesverband an einer erneuten Bundestagskandidatur gehinderten Haushaltsexperten Oswald Metzger über seine eigene damalige Regierungskoalition. Vor dem Wahlbetrugs-Untersuchungsausschuss legte Metzger nach: „In Wahljahren wirst du belogen. Das wird seit Jahrzehnten von allen Parteien so gemacht.“ Weiter heißt es in dem angesprochenen Stern-Artikel vom 23.12.02: „Die Lüge ... als Mutter vieler Kinder: Schwindel, Täuschung, Verstellung, Verdrehung, Vertuschung, Halbwahrheit, Schönfärberei, Irreführung, Betrug. Und, und, und. Wobei wir nicht päpstlicher sein wollen als der Papst: Die Lüge ist so alt wie die Politik. Sie klebt an ihr wie der Rüde an der läufigen Hündin. Politiker haben immer behauptet, der Wähler sei blöd und wolle betrogen werden. Doch so alarmierend wie in diesem Jahr war der Befund noch nie in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die Lüge ist der Normalfall der Politik geworden. Überall. ... Denn Kassandra, das glaubt man zu wissen, wird nicht gewählt.“ „Welcher halbwegs Kultivierte glaubt, von den Politikern die Wahrheit zu erfahren? Wer will denn die Wahrheit hören? Es will keiner die Wahrheit hören. Das Wahlvolk will belogen werden. Aber es fordert Qualität! Das Ganze muss Stil haben und eine gewisse Eleganz ausstrahlen“, ätzte der Kabarettist Georg Schramm in einem Fernsehauftritt über die parteipolitischen Auseinandersetzungen zum Wahrheitsgehalt von Wahlaussagen. Und die Westfälische Zeitung (01.07.05) lästerte im Zuge der verschwimelten Bemühungen um eine vorgezogene Neuwahl durch ein konstruiert negativ ausgehendes Vertrauensvotum: „Wo steht denn, dass Politiker das Volk nicht belügen dürfen? Aber sie sollten dabei wenigstens Erfolg haben!“ Das Wahlvolk will - leider - angenehm »illusioniert«, sprich beschwindelt, werden. Und das bitte mit Qualität, denn man will gerne glauben und möglichst viel Angenehmes für sich und seine Lieben erhoffen! Das Unangenehme wird - nur allzu menschlich - gerne verdrängt. „Die Menschen glauben fest an das, was sie wünschen“ (Julius Cäsar 100-44 v.Chr.). „Der Wähler ist ein armes, dummes Würstchen, das man beliebig quälen kann. Ängstlich ist er obendrein. Unfähig, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Das Würstchen will belogen werden. War doch immer so im Wahlkampf. Lass es in dem Irrglauben, dass man ihm nichts nimmt, sondern ihm vieles geben wird. So in etwas nehmen Deutschlands Spitzenpolitiker derzeit ihr Wahlvolk wahr. Anders ist es nicht zu erklären, dass in Talkshows, Zeitungsinterviews und bei Marktplatz-Reden jede Partei vornehmlich Gutenachtgeschichten mit Happy End auftischt, die schön ablenken, aber realitätsfern sind. ... Immer nur leicht verkäufliche statt auch mal schwer verdauliche Ware anzubieten, das läuft auf eine schleichende Entmündigung des Wählers hinaus. Alles, was schnell und billig an den Mann zu bringen ist, wird auf den Markt geworfen, verpackt in wenigen Slogans. ... Kaum jemand präsentiert Qualität, also belastbare, geschlossene Konzepte, die 7 Die bei uns dazu verwandten Skatkarten, Kugelschreiber und dergleichen sind aber nicht der Rede wert im Vergleich mit den Wahlgeschenken bei Wahlen im armen NO Brasiliens: dort werden kostenlose Sterilisationen als Wahlkampfgeschenke eingesetzt (STERN 18.08.05). 19 detailliert Reformen bei den Zukunftsthemen Arbeitsmarkt, Bildung, Steuern, Gesundheit, Rente, Sozialsysteme und Globalisierung vernetzen und beschreiben. Für Politiker liegt die Verlockung des Unpräzisen darin, dass der Wähler nach Gefühl und Sympathie entscheiden muss, wer seine Erwartungen am ehesten erfüllt. Man muss dann keine Wählergruppe vergrätzen und nach dem Wahltag nicht die Fahne einrollen, weil versprochen eben doch nicht versprochen ist. ... politische Unschärfe aus Angst vor dem Wähler. ... Wir sind das Wahlvolk, aber wir können uns leidtun.“ (STERN Editoral 11.08.05) Vielleicht liegt gerade in der Symbiose von Politikern und Wählern das Problem. Ob da Rat von außerhalb der Politik eine Änderung bewirken kann? Aufstand der Professoren Deutschlands führende Wirtschaftswissenschaftler fordern in einem gemeinsamen Appell mehr Ehrlichkeit von der Politik. Notwendig seien drastische Reformen von Stefan von Borstel Nicht weniger als 241 Wirtschaftsprofessoren haben mit Blick auf den bevorstehenden Wahlkampf an die Politik appelliert, den Wählern die Wahrheit über die Strukturkrise in Deutschland zu sagen. "Als Hochschullehrer für Volkswirtschaftslehre warnen wir eindringlich davor, Illusionen zu erzeugen und damit die Akzeptanz notwendiger Reformen zu untergraben", heißt es in einem "Hamburger Appell", der von den drei Hamburger Wirtschaftsprofessoren Thomas Straubhaar, Bernd Lucke und Michael Funke initiiert wurde. Die Professoren beklagen darin einen "erschreckenden Mangel an ökonomischem Sachverstand" in der wirtschaftpolitischen Debatte in Deutschland. "Wir appellieren an das Verantwortungsbewußtsein der gewählten Volksvertreter, der Versuchung einfacher Lösungen zu widerstehen und statt dessen ungeschönte Antworten auf die drängenden ökonomischen Fragestellungen zu geben", heißt es weiter. Es ist das erste Mal, daß sich der ökonomische Sachverstand im Wahlkampf in dieser Form zu Wort meldet. Ähnliche Aktionen von Wirtschaftsprofessoren hatte es nur bei der Debatte um die einheitliche europäische Währung in den neunziger Jahren gegeben. Deutschland befinde sich in einer "tiefen strukturellen Krise, die drastische und schmerzhafte Reformen verlangen", konstatieren die Wirtschaftsprofessoren. Doch gerade in Vorwahlkampfzeiten scheine die Bereitschaft der Politiker gering, "diese Tatsache den Bürgern mit der gebotenen Deutlichkeit vor Augen zu führen". Statt dessen erlägen maßgebliche Politiker der Versuchung, wissenschaftlich nicht fundierte Konzepte zu propagieren, "die das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden sollen", kritisieren die Ökonomen mit Blick auf Forderungen aus der SPD, mit höheren Lohnabschlüssen die Binnenkonjunktur anzukurbeln. "Klassenkämpferische Rhetorik tut ein Übriges, um Investitionen zugunsten anderer Standorte zu verdrängen", warnen die Volkswirte. Die Wirtschaftsprofessoren empfehlen äußerste Lohnzurückhaltung sowie einen strikten Sparkurs mit weitreichenden Einschnitten in allen Bereichen. Davon könnten auch die sozialen Sicherungssysteme nicht ausgenommen bleiben. "Wer Gegenteiliges behauptet, wird den wirtschaftlichen Herausforderungen Deutschlands nicht gerecht und führt in populistischer Weise die Bürger in die Irre." Elf Punkte sollten nach Ansicht der Ökonomen besonders beachtet werden. Das Programm der Hochschullehrer in Auszügen: DIE WELT 30. Juni 2005 Die Thesen der Forscher Eingriffe stören 1. Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage ist eine bedeutende und komplex strukturierte ökonomische Größe, die sich einer nachhaltigen Steuerung weitestgehend entzieht. Die Nachfrage der Deutschen muß keineswegs überwiegend Nachfrage nach deutschen 20 Produkten sein - eine Vielzahl von Produkten ist ausländischer Herkunft oder enthält bedeutende ausländische Vorleistungsanteile. Dazu kommt, daß alle erwirtschafteten Einkommen, Lohneinkommen genauso wie Gewinneinkommen, Nachfragewirkungen entfalten; selbst Ersparnisse finanzieren stets die Nachfrage eines Kreditnehmers. Eingriffe stören die Struktur der Gesamtnachfrage, führen aber kaum zu ihrer Erhöhung. Der Staat kann nicht alles steuern 2. Gleichwohl ist die Nachfrage nach deutschen Waren und Dienstleistungen wichtig. Sie wird geprägt durch deren Qualität, Innovativität und nicht zuletzt durch deren Preis. Diese Bestimmungsgründe der Nachfrage entziehen sich jedoch dem unmittelbaren Einfluß staatlicher Wirtschaftspolitik. Sie sind vielmehr geprägt durch die Qualifikation der Arbeitnehmer, durch die Modernität der Maschinen, durch Forschung und Entwicklung und die Kosten der Produktion. Die Löhne müssen runter 3. Deshalb sind die Arbeitskosten ein Schlüssel zur Überwindung der deutschen Wachstumsschwäche. Wer behauptet, Deutschland könne und müsse ein Hochlohnland bleiben, handelt unredlich oder ignorant. Millionen von überwiegend geringqualifizierten Arbeitslosen finden seit Jahrzehnten zu den herrschenden Löhnen keine Beschäftigung mit ungebrochen steigender Tendenz. Die unangenehme Wahrheit besteht darin, daß eine Verbesserung der Arbeitsmarktlage nur durch niedrigere Entlohnung der ohnehin schon Geringverdienenden möglich sein wird. Eine Abfederung dieser Entwicklung ist durch verlängerte Arbeitszeiten, verminderten Urlaubsanspruch oder höhere Leistungsbereitschaft möglich. Überzogene Ansprüche 4. Eine Kompensation der Geringverdienenden durch den Sozialstaat ist in gewissem Umfang möglich. Aber dafür muß die Sozialpolitik von Lohnersatzleistungen zu Lohnzuschüssen wechseln. Das deutsche System der Lohnersatzleistungen von der Sozialhilfe über das Arbeitslosengeld bis zur subventionierten Frührente erzeugt Lohnansprüche, die der Markt nicht mehr befriedigen kann. Staatliche Hilfen müssen aktivierend wirken als Partner der Wirtschaft, nicht als Konkurrent. Investitionen werden verhindert 5. Zu den Bedingungen wirtschaftlichen Erfolgs gehören Investitionen. Diese erfolgen nur, wenn den erheblichen Verlustrisiken attraktive Gewinnmöglichkeiten gegenüberstehen. Hohe Arbeitskosten und hohe Steuerlasten mindern unternehmerische Gewinne und damit unmittelbar die Investitionsbereitschaft. Klassenkämpferische Rhetorik tut ein Übriges, um Investitionen zugunsten anderer Standorte zu verdrängen. Staatsverschuldung stranguliert die Binnenkonjunktur 6. Investitionen sind langfristige Entscheidungen, die nicht nur heutige, sondern auch zukünftige steuerliche Belastungen berücksichtigen müssen. Die unkontrolliert wachsende Staatsverschuldung der Bundesrepublik Deutschland wird zu Recht als zukünftig anstehende Steuerbelastung wahrgenommen. Dasselbe gilt für die unterfinanziert wachsenden Zahlungsverpflichtungen der sozialen Sicherungssysteme. Jede Ausdehnung der Staatsverschuldung schwächt die Binnenkonjunktur, weil strukturelle Ungleichgewichte verschärft statt kuriert werden, so daß Bürger und Unternehmen mit gesteigerter Vorsicht wirtschaften müssen. Das kaufkrafttheoretische Argument, in einer wirtschaftlichen Stagnation dürfe man sich nicht "kaputtsparen", ist bequem, aber falsch. Einschnitte sind unvermeidbar 7. Deshalb muß eine verantwortungsbewußte Finanzpolitik streng stabilitätsorientiert sein. Die Konsolidierung der Staatsfinanzen erfordert weitreichende Einschnitte in allen Bereichen der öffentlichen Ausgaben. Davon können auch die sozialen Sicherungssysteme nicht ausgenommen bleiben. Reformvorschläge, welche die Anzahl der Beitragszahler in demselben Maße erhöhen wie die Anzahl der Anspruchsberechtigten, werden den Herausforderungen nicht gerecht. Mehr Leistungsorientierung 8. Bildung und Ausbildung der Deutschen sind wichtige Standortfaktoren, die zunehmend in die Kritik geraten. In der Tat sind ernstzunehmende Defizite unübersehbar und 21 münden schnell in den Ruf nach verbesserter Mittelausstattung im Bildungswesen. Dabei wird oft übersehen, daß große Fortschritte allein durch vermehrten Ansporn zu Fleiß, Wißbegier und strenger Leistungsorientierung erzielt werden könnten. Zukunftstechnologie wird behindert 9. Ähnlich verhält es sich mit Forschung und Entwicklungstätigkeiten. Auch hier liegt weniger ein finanzielles als vielmehr ein strukturell-institutionelles Problem vor. So wird die Forschungstätigkeit in Deutschland in wesentlichen Zukunftstechnologien durch rigide staatliche Vorgaben behindert oder zur Verlagerung ins Ausland genötigt. Konkurrenz belebt 10. Die binnenwirtschaftlichen Probleme und Herausforderungen werden verschärft durch den ständig stärker werdenden Konkurrenzdruck im europäischen Binnenmarkt und die sich weiter entfaltende Globalisierung. Beide außenwirtschaftlichen Einflüsse stellen aber zugleich große Chancen für die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands dar, denn sie ermöglichen effizientere Produktionsbedingungen und eröffnen die Vorteile der internationalen Arbeitsteilung. Globalisierung als Chance 11. Die öffentliche Diskussion zum Thema Globalisierung in Deutschland wird leider häufig einseitig geführt. Während im Rahmen des Strukturwandels notwendigerweise auftretende Arbeitsplatzverluste in den Medien sehr stark thematisiert werden, fehlen klare Aussagen zu den positiven Auswirkungen der Globalisierung. Die vertiefte internationale Arbeitsteilung ist der zentrale Motor zur Steigerung unseres Lebensstandards und ermöglicht einen höheren Lebensstandard durch größere Produktvielfalt und billigere Produkte. DIE WELT 30. Juni 2005 „Der Politiker denkt an die nächsten Wahlen, der Staatsmann an die nächste Generation“ (William Gladstone 1809-1898). „Die Tragödie sei: Die Politiker denken nur in Monaten, sie wollen gar nicht den großen Wurf, sie seien wie kleine Kinder: ’Die schießen den Ball weg und brüllen laut ’Tor’’“, fasste der STERN (16.04.03) das Gesprächsergebnis mit dem Politikprofessor Schmid über seine als Mitglied der Rürüp-Kommission zur Rettung unseres Sozialstaates durch die Sanierung unserer sozialen Sicherungssysteme gesammelten Erfahrungen mit Politikern zusammen. Schmid: „Jetzt weiß ich, wie Politiker sich aufführen. Ich weiß nun, was Irrationalität heißt.“ Ein beliebiges Beispiel für einen ohne Sinn und Verstand, auf jeden Fall ohne ein bisschen Nachdenken weggeschossenen Ball mit gleichzeitigem „Tor!“-Gebrüll lieferte die (als kommende Bundesbildungsministerin einer von der CDU geführten Bundesregierung gehandelte) baden-württembergische Kultusministerin Schavan als Kandidatin für den Posten des/der Ministerpräsidenten/in ihres Bundeslandes: Um das gesellschaftlich gravierende Problem muslimischer Hasspredigten in Moscheen besser in den Griff zu bekommen, regte sie am 14.11.04 an, dass durch ein Gesetz bestimmt werden solle, dass in den rund 2.500 Moscheen in Deutschland nur noch in deutsch gepredigt werden dürfe; eine ohne jegliches Nachdenken „aus dem Bauch heraus“ wohlfeil in den politischen Raum gestellte populistische Forderung - und wohl eher ihren Ambitionen auf den Stuhl des/der badenwürttembergischen Ministerpräsident/in geschuldet, um in der parteiinternen Mitgliederbefragung zu punkten. „Law made simple“, oder: wie sich die kleine Annette »das Recht« vorstellt. Natürlich hat der Gedanke Schavans auf den ersten Blick etwas Bestechendes. Jeder juristisch Unbeleckte - und dazu gehört als Theologin und Pädagogin auch Schavan: darum waren ihre diesbezüglichen Äußerungen mehr peinlich als ärgerlich - glaubt sofort, dass Schavan mit ihrer eingängigen Forderung für das Hassprediger-Problem das „Ei des Kolumbus“ gefunden habe. Aber mit einem bisschen Nachdenken, das ich von einem/einer herausragenden Politiker/in verlange, hätte sie selber darauf kommen müssen(!), dass sie ihren Vorschlag „in die Tonne treten“ sollte; und wenn sie es nicht macht, dann wird es das Bundesverfassungsgericht machen, dessen bin ich absolut sicher, denn Art. 4 II GG regelt: „Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.“ Zur Freiheit des kultischen Handelns gehört nach heutigem Verständnis, dass der/die Gottesdienstbesucher/in auch verstehen können müsse, was sein/ihr Prediger ihm/ihr sagt. Auch demjenigen, der keine 22 ausreichenden Deutschkenntnisse besitzt, sichert unser Grundgesetz als eines der wenigen in unserer Verfassung vor gesetzlichem Eingriff geschützten Rechte eine „ungestörte Religionsausübung“ zu. Das Recht der freien Religionsausübung wird innerhalb der Schranken der durch das Grundgesetz konkretisierten Wertordnung vorbehaltlos gewährt. Wir leben nicht mehr in der Zeit vor einigen hundert Jahren, als in der katholischen Kirche der Gottesdienst ausschließlich auf Latein abgehalten wurde und die Glaubensschäfchen teilweise erst im Beichtgespräch die Konkretisierung dessen erfuhren, was ihnen ihr Priester in einer ihnen fremden Sprache im Gottesdienst verkündet hatte. Und wie sollte es mit dem in Art. 3 GG normierten Gleichheitsgrundsatz zu vereinbaren sein, wenn muslimische Prediger gezwungen würden, in einer ihren Gläubigen teilweise unverständlicher Sprache zu predigen – wobei hinzu kommt, dass z.B. die vom türkischen Religionsministerium geschickten Imame nicht unbedingt Deutsch sprechen können oder nicht über die Besorgung von Alltagsgeschäften hinausgehende deutsche Sprachkenntnisse verfügten – und katholische Priester einer polnischen Gemeinde, orthodoxe Pfarrer einer russisch-orthodoxen Gemeinde, afrikanische Geistliche ihren Gottesdienstbesuchern aus dem afrikanischen Heimatland in der ihnen vertrauten und teilweise allein verständlichen Sprache die Segnungen ihrer Mutterkirche zukommen lassen können? BEERDIGUNG IN WOLFSBURG Ergreifender Abschied von Nowak Unter großer Anteilnahme ist am Samstag der ehemalige Bundesliga-Profi Krzysztof Nowak beigesetzt worden. Rund 1500 Trauergäste, darunter viele ehemalige Mitspieler, nahmen Abschied vom polnischen Nationalspieler und Mittelfeldregisseur des VfL Wolfsburg. Wolfsburg - Nowak war vor zehn Tagen im Alter von 29 Jahren an den Folgen der unheilbaren Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) gestorben. Er hinterlässt Ehefrau sowie zwei Kinder (vier und neun Jahre). Die Beisetzung fand auf dem Wolfsburger Waldfriedhof statt. Zuvor hatten rund 600 Menschen beim Requiem in der St. Christophoros Kirche Nowak die letzte Ehre erwiesen. Sowohl das Requiem als auch die Beisetzung fanden in deutscher und polnischer Sprache statt. ... (SPIEGEL ONLINE 06.06.05) Auf Grund unserer Geschichte wird es bestimmt kein verantwortlicher Politiker in Deutschland wagen, aus Russland hierher gezogenen Juden eine Predigt in der ihnen verständlichen Sprache zu verbieten, wenn sie als frisch Hierhergezogene nicht deutsch sprechen können. Quintessenz: Wegen der Religionsfreiheit und des Gleichbehandlungsgrundsatzes kann Schavan den des Deutschen teilweise unkundigen Muslimen das grundgesetzlich geschützte Recht der „ungestörten Religionsausübung“ nicht nehmen! „Die Gerichtssprache ist deutsch.“, heißt es in § 184 Gerichtsverfassungsgesetz; die »Religionssprache« ist nicht ebenso verbindlich geregelt, und aus grundgesetzlichen Erwägungen heraus kann man das auch nicht machen. Das hätte Schavan wissen und bedenken müssen(!), bevor sie ihr Bauchgefühl so unkontrolliert rausplapperte. Das kann man von einer Ministerin auch dann verlangen, wenn sie keine juristische Ausbildung absolviert hat! In dem undurchdachten »Bauch-Vorschlag« der damaligen Aspirantin auf den Posten des Ministerpräsidenten und jetzigen Aspirantin auf den Posten der Bundesbildungsministerin im Falle eines Wahlsieges der Union im vorgezogenen Bundestagswahlkampf 2005 steckt ein weiterer Grundrechtsverstoß, nämlich der gegen den mit Verfassungsrang ausgestatteten, vom Rechtsstaatsprinzip abgeleiteten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit aller den Bürger belastenden staatlichen Maßnahmen: Der Staat soll nicht mit Kanonen auf uns Spatzen schießen dürfen! Auf das Problem der Predigtsprache in Moscheen angewandt, gäbe es eine die Gläubigen weniger belastende Maßnahme staatlicher Kontrolle: von den vielen eingedeutschten Türken und Arabern geht sicher auch ein Teil zur Polizei – und kann deswegen ohne weiteres zum dienstlichen Predigtbesuch in einer Moschee abgestellt werden; da braucht nicht den des Deutschen nicht ausreichend kundigen Gottesdienstteilnehmern wegen einiger Hassprediger das Verstehen der geistlichen Labsal unmöglich gemacht zu werden! 23 Schon die »alten Römer« wussten: „Si tacuisses, philosophus mansisses!“ [„Wenn Du geschwiegen (und kein dummes Zeug geredet) hättest, hätte man dich weiterhin für einen Philosophen halten können!“] Den Spruch hätte Schavan beherzigen müssen! Ein anderer blödsinniger Vorschlag aus Politikermund: Als gerade die Diskussion um die zur Erhöhung der Jahresarbeitszeit geplant gewesene bewegliche Verlegung unseres Nationalfeiertages auf immer den ersten Sonntag im Oktober gelaufen war, hatte der normalerweise vernünftig nachdenkende und abwägende Vize-Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen-Bundestagsfraktion Ströbele, von Bundesumweltminister Trittin unterstützt, - wegen ihres „blinden Flecks“ in Sachen Multikulti dieses Mal wenig oder gar nicht nachdenkend - aus einer Multikulti-Gutmenschen-Attitüde heraus zwei Wochen nach der Ermordung des niederländischen Filmemachers van Gogh multikultibewegt bauchgesteuert angeregt, in Deutschland einen christlichen Feiertag abzuschaffen und dafür einen muslimischen Feiertag einzuführen, um damit (angeblich) die Integration zu fördern. „Es ist Appeasement in seiner groteskesten Form, wenn man auf die eskalierende Gewalt islamistischer Fundamentalisten in Holland und anderswo mit dem Vorschlag reagiert, in Deutschland doch einen muslimischen Feiertag einzuführen“, wurde ihnen daraufhin in Anspielung auf die fehlgeschlagene Beschwichtigungspolitik der Alliierten Hitler gegenüber vorgeworfen. Schon Churchill hatte mit Blick auf das Monster Hitler festgestellt: „Beschwichtigen heißt, ein Krokodil zu füttern, in der Hoffnung, dass es einen zuletzt frisst.“ Die Vorsitzende der Einwanderungskommission, Süssmuth, machte richtigerweise darauf aufmerksam, dass in keinem arabischen Land irgendjemand auch nur auf die (blödsinnige) Idee käme, für eine christliche Minderheit einen muslimischen Feiertag abzuschaffen und dafür einen christlichen einzuführen, geschweige denn, dass es Politiker öffentlich anregen würden! (In SaudiArabien sind die Errichtung christlicher Kirchen und das Feiern christlicher Gottesdienste verboten, die Türkei machte jahrelang und macht noch immer christlichen Geistlichen ihre Arbeit so schwer, dass die teilweise nur als Sozialattaches der Botschaft eines europäischen Landes getarnt ihre Gläubigen betreuen konnten und können!) Aber manchen Politikern scheint dereinst das Himmelreich gewisser zu sein, als anderen Menschen, denn der HERR hat in der Bergpredigt versprochen (Matthäus 5/3): „Selig sind, die geistlich arm sind; denn ihnen gehört das Himmelreich.“ Das zitierte Urteil des Professors Schmid über »Politiker«: „Jetzt weiß ich, wie Politiker sich aufführen. Ich weiß nun, was Irrationalität heißt.“, deckt sich mit dem unzulässig verallgemeinernden und darum in den meisten Einzelfällen sicher falschen und vielen sich redlich mühenden Politikern gegenüber ungerechten Urteil des jüdischen Schriftstellers Rafael Seligmann, der das Shoa-Projekt in Berlin gerne gestoppt gesehen hätte und aus seiner Verärgerung über den in seinen Augen unsinnigen Weiterbau überzogen über Politiker ganz grundsätzlich urteilte: „Der Mensch unterscheidet sich vom Affen durch seinen Verstand. Selbst Politiker sollten davon gelegentlich Gebrauch machen, ihre Fehler einsehen und korrigieren“ (Stern 30.10.03). Richtig an dieser schon hämischen Polemik ist, das Politik auch aus der rechtzeitigen Abänderung erkannter Fehler bestehen muss, selbst dann, wenn der Wählerklientel aus sachlogisch zwingenden Gründen für eine zukünftige Besserung der Verhältnisse Opfer zugemutet werden müssen, und dass politische Lebenslügen wie z.B. „Die Rente ist sicher!“, nicht trotz anders lautender demographischer Zahlen Jahrzehnte lang wie ein tibetanisches Mantra gebetsmühlenartig perpetuiert werden dürfen, weil die nackte Wahrheit bei der nächsten Wahl Wählerstimmen kosten könnte! Aber wenn nach vielen für die notwendigsten Reformen an unseren sozialen Sicherungssystemen verlorenen Kohl-Jahren Kanzler Schröder nach einer ebenfalls verlorenen Amtsperiode dann endlich seine Agenda 2010 verkündete und umsetzte(!), um den Reformstau aus den 16 Jahren der vorangegangenen CDU/CSU/FDP-Regierungszeit und seinen eigenen vier ersten Regierungsjahren aufzulösen, zeigte sich die Irrationalität vieler Wähler, die die der Politiker bei Weitem übertrifft: Aufgeputscht von linken Gewerkschaftern, die sich teilweise in der WAGS gesammelt haben, von Interessenverbänden und der PDS, die zwar alle die entgegenstehenden realen wirtschaftlich Fakten kennen, aber für ihre Klientel nicht wahrhaben wollen, wird mehr verlangt, als die sozialen Si- 24 cherungssysteme auf Grund der demographischen Verwerfungen zu leisten in der Lage sind und in insbesondere den nächsten Jahrzehnten zu leisten in der Lage sein werden! Wenn zu wenige Kinder aufgezogen werden und so die wichtigste Leistung für die Zukunftssicherung unseres Volkes vernachlässigt wird, dann gibt es eben weniger zu verteilen, als die Rentner, die unbestritten ihr Leben lang gearbeitet haben, gerne hätten! Leider nimmt kaum ein Politiker Forderungen auf, die eine Änderung der Familienpolitik bewirken würde, wie sie in Frankreich selbstverständlich ist, das darum nicht oder wenigstens nicht in unserem Ausmaß unseren düsteren Zukunftsprognosen entgegen sieht: „Im Jahr 2035 werden die Deutschen das Volk mit dem höchsten Durchschnittsalter weltweit sein. ... Die meisten unserer Probleme – beispielsweise das komplett umlagenfinanzierte Sozialsystem – hängen mit der schwächelnden Geburtenrate zusammen. Immer weniger Erwerbstätige müssen immer mehr Rentner und Pensionäre ernähren. Die Implosion des Landes droht, eine in Millionenschritten abnehmende Bevölkerungszahl bedeutet schwindende Nachfrage. Das Wachstum bleibt aus. Seit Jahren ist diese Szenarium bekannt. Dennoch gibt es keinen Politikentwurf, der mit aller Kraft gegensteuert. Denn das würde Konzepte erfordern, die über mehrere Legislaturperioden angelegt sind, was Politikern bekanntlich schwer fällt. Lieber sind ihnen Entscheidungen, deren Ernte noch vor der nächsten Wahl in die Scheuer fährt8. Unsere Titelgeschichte [„Land ohne Kinder – Die familienfeindliche Gesellschaft: Wie Deutschland seine Zukunft verspielt“] ist nur ein weiterer Weckruf an die Politik. Ganz gleich, wer dieses Land künftig regiert, egal, ob die Mehrwertsteuer nun um zwei oder vier Prozent klettert – die sogenannte Reproduktionsverweigerung ist das entscheidende Zukunftsthema. Lösungen, bei denen junge Frauen risikolos und selbstverständlich Kind plus Beruf vereinen können, lassen sich in unseren Nachbarländern besichtigen, ... Beispielsweise in Frankreich, wo ein Großteil der milliardenschweren Familienförderung in die Finanzierung von Krippen, Tagesmüttern und Haushaltshilfen fließt. ... Deutschland hat die niedrigste Geburtenrate in der Europäischen Union. Die Republik vergreist – Resultat einer völlig verfehlten Familienpolitik. Wir investieren viel Geld in Familien, aber mit weit weniger Erfolg als die Franzosen. Und die letzten mutigen Mütter bezahlen einen schmerzhaft hohen Preis.“ Auf Grund der demographischen Daten wurde u.a. in dem STERNArtikel „Land ohne Kinder – Die familienfeindliche Gesellschaft: Wie Deutschland seine Zukunft verspielt“ (30.06.05) ein Zukunftsszenario für 2060 inszeniert, in dem es heißt: „Außerhalb der Ballungsgebiete wurden in den vergangenen 30 Jahren [also 2030 = in 25 Jahren!] sämtliche Schulen geschlossen. Das Sterben dieser Einrichtungen begann im Jahr 2020, als verfügt wurde, dass ein Schulweg von 150 Kilometern für ABC-Schützen zumutbar sei. ... Das am selben Tag der Abriss der schon seit Jahren leer stehenden Städte Bremerhaven und Gelsenkirchen beschlossen wurde und außerdem das Bundesamt für Statistik vermeldete, Deutschland habe jetzt unter 55 Millionen Einwohner, nannte er [ein Ministerpräsident] einen ’unglücklichen Zufall’. Das ist kein Horrorszenario, sondern voraussichtlich unsere Zukunft. Mit 8,7 Geburten auf 1.000 Einwohner hat Deutschland ... die niedrigste Geburtenrate der Europäischen Union und rangiert in einem Weltbankvergleich zwischen 190 Staaten auf Platz 185. ... Was eist als ’Alterspyramide’ bezeichnet wurde – viele Kinder, wenig Senioren – ist hierzulande längst zum angefressenen Pilz mutiert. Schon im Jahr 2035 werden die Deutschen das Volk mit dem höchsten Durchschnittsalter weltweit sein; jeder Berufstätige muss dann für einen Ruheständler aufkommen. Bis 2050 wird die Bevölkerung laut einer Studie der Vereinten Nationen um fasst ein Drittel von heute 82,5 Millionen Einwohnern auf 50,8 Millionen schrumpfen. ... Eine halbe Million Zuwanderer pro Jahr wäre nötig, um die Bevölkerung dann halbwegs stabil zu halten. ... Das Deutschland von morgen wird ein Land der leeren Häuser sein, bewohnt von Greisen ohne Enkel, mit verlassenen Dörfern, verödeten Vierteln, vereinsamten Spielplätzen, verfallenen Schwimmbädern und stillgelegten Bahngleisen. ... In vier Dekaden wird ein Neun-Millionen-Heer von über 80-Jährigen versorgt werden müssen – aber von wem? Der Staat wird einspringen müssen – aber mit was? Denn mit der Bevölkerung werden auch die Steuereinnahmen schrumpfen; viele der ohnehin wenigen jungen Erwerbstätigen werden vor der erdrückenden Abgabenlast ins prosperierende Aus8 Ein völlig missglücktes Bild in der Formulierung des STERN-Chefredakteur.editorials (30.06.05), weil „Ernte“ nicht selber fahren kann! 25 land fliehen. Zurück bleiben die Alten und die Verlierer. ... Die Deutschen haben die Implosion ihrer Bevölkerung bislang stillschweigend zur Kenntnis genommen. Der größte zu erwartende demographische Kollaps seit der Pest im Mittelalter, den Auswanderungswellen im 19. Jahrhundert und dem Zweiten Weltkrieg erfolgt ohne Aufschrei. Immer noch gibt es in Deutschland nichts, was man ernsthaft als Gesellschafts- und Familienpolitik bezeichnen könnte. ... ’Kinder kriegen die Leute sowieso’, hatte der [erste Bundes-]Kanzler und achtfache Vater [Konrad Adenauer; der Verf.] 1956 deklariert. Ergänzt durch den [Adenauers] Zusatz ’und danach sollen sie gefälligst alleine zusehen, wie sie mit ihnen zurechtkommen’, ergibt das den Grundsatz, nach dem Politiker aller Schattierungen bis heute handeln. Mit bizarren Folgen. ... Die Familie ist längst ein Sanierungsfall; Familienpolitik aber ist genau das geblieben, was Schröder 1998 abschätzig über sie gesagt hat: nämlich ’Gedöns’.“ Pro Kopf gibt der deutsche Staat weit mehr für Familienpolitik aus als das in dieser Beziehung erfolgreichere „Frankreich mit seiner Geburtenrate von 12,7 Kindern pro 1.000 Einwohner. Doch das Geld ist falsch investiert. ...“ Es gab vor ungefähr einer Generation eine Briefmarke mit dreifacher Darstellung der absehbar drohenden Entwicklung der Alterspyramide in Deutschland: Vielleicht haben die deutschen Politiker hinten dran geleckt – entschlossen umgesteuert haben sie jedenfalls nicht! Es bleibt das Phänomen: Warum verhalten sich oder sind deutsche Politiker so viel dümmer als ihre Kollegen in den europäischen Nachbarländern, die diese ihrem Land drohende Entwicklung genau so gesehen, aber im Gegensatz zu den deutschen Politikern zukunftsverantwortlich darauf reagiert haben? Und wann hören wir - mit über einer Generation Verspätung(!) - jetzt endlich etwas von den zur Zukunftsgestaltung berufenen Politikern darüber, wann und wie unsere Verhältnisse denen in den hinsichtlich der wichtigsten Aufgabe der Zukunftsgestaltung offensichtlich erfolgreicheren Staaten der EU angeglichen werden sollen? Die meisten Politiker denken aber leider nur bis zur nächsten Wahl – und nicht an die nächste Generation, geschweige denn die nächsten Generationen; wie es schon der britische Premierminister Gladstone vor über 100 Jahren von seinen Politikerkollegen gefordert hat! Natürlich gibt es Ausnahmen, aber die haben sich trotz ihrer Einflussmöglichkeiten selbst als Führungspolitiker mit diesbezüglichen Forderungen nicht durchsetzen können. So erklärte Lothar Späth noch in den Zeiten als baden-württembergischer Ministerpräsident, und das ist über eine Generation her: „Wer die Zahlen der demographischen Entwicklung kennt und dem davor nicht graut, dem kann vor nichts grauen!“ Nicht einmal als erfolgreicher Ministerpräsident eines erfolgreichen Bundeslandes hatte er seine Politikerkollegen zu dem im wahrsten Sinne des Wortes „not“-wendigen Sinneswandel veranlassen können! Schlimm wäre eine aus der Enttäuschung über solche Politiker und ihre Politikentwürfe resultierende Wahlverweigerung, weil eine Wahlverweigerung – wie später noch vorgerechnet wird – immer die in extremistischen Parteien operierenden Rattenfänger an den politischen Rändern einer Gesellschaft stärkt! Politiker fokussieren ihr Handeln meist nur mit einem »Tunnelblick« auf das Datum ihrer erhofften Wiederwahl und denken leider zu wenig über den nächsten Wahltermin hinaus in langen gesellschaftlichen Entwicklungslinien: Sie denken meist nur das unabweisbar Notwendige für das Morgen bis zum nächsten Wahltermin, kaum aber als Staatsmänner mit langem Atem für die langfristige Bewältigung der anstehenden unabweisbaren Strukturreformen über das jeweils sich gerade auftuende Finanzloch hinaus an das Notwendige für das Übermorgen! Außenpolitisches Beispiel: Die jahrzehntelange Herumdruckserei in Sachen EUMitgliedschaft der Türkei. Die auf Grund der geostrategischen Interessen der USA9 der jahrzehntelangen Herumdruckserei zugrunde liegende politische Feigheit der Europäer gegenüber sowohl den USA wie auch der Türkei hat bei letzterer unberechtigte Hoffnungen auf eine Vollmitgliedschaft geweckt. Und die us-amerikanische Außenministerin Rice scheute sich nicht, anlässlich der zeitgleich mit dem schon ausgebrochenen Bundestagswahlkampf 2005 stattgefundenen EU9 Bis zum Zusammenbruch der UdSSR Sicherung der Südostflanke der NATO gegenüber dem Warschauer Pakt und heutzutage Sicherung der südkaukasischen Öllieferungen über die Pipelines in die türkische Hafenstadt Ceyhan. 26 Verfassungsreferenden in Frankreich und den Niederlanden ganz massiv aus den us-amerikanischen Interessen heraus, die nicht(!) kongruent mit den europäischen sind, von den Europäern und den sich im Wahlkampf befindlichen Deutschen die Aufnahme der Türkei in die EU zu fordern, obwohl sie genau weiß, was für ein brisantes Wahlkampfthema das im bundesdeutschen Wahlkampf werden kann. Sie wollte wohl gegenüber der CDU/CSU Pflöcke einschlagen. Dieses Dilemma in der Türkeifrage haben sich die europäischen Politiker aber selbst eingebrockt, weil sie aus politischer Feigheit heraus den USA und der Türkei gegenüber jahrzehntelang nie eindeutig „Nein!“ gesagt haben! Die Ausnahme ist die Kanzlerkandidatin Merkel, die mit beispielhaftem politischen Mut nach Ankara gereist war und dort(!) den Türken klargemacht hat, dass sie versuchen werde, eine gleichberechtigte Vollmitgliedschaft der asiatischen Türkei in der Europäischen Union zu verhindern: Kein Mensch verlangt von den USA, dass sie Mexiko zur Behebung von dessen Problemen in ihren Staatenverbund aufnehmen müssten, aber die USA entblöden sich nicht, von den Europäern zu verlangen, ein asiatisches Volk in die Europäische Union aufzunehmen! „Man kriegt geboten, was man sich bieten lässt!“ Wer soviel politischen Mut aufbringt wie Merkel, der bringt hoffentlich auch den Mut auf für die Fortsetzung der von Schröder mit ebenso viel politischem Mut in Gang gesetzten, aber dann irgendwie steckengebliebenen notwendigen innenpolitischen Reformen! Das Wegdrücken der Realität aus ihrem Bewusstsein und der sich daraus zwingend ergebenden langfristigen Anforderungen zur Zukunftsgestaltung ist die vorherrschende Strategie zu vieler Politiker! Man müsste Konfuzius (um 551-470 v. Chr.) zur Pflichtlektüre für Politiker machen, denn der hatte vor 2.500 Jahren schon gesagt: „Wenn der Mensch nicht über das nachdenkt, was in ferner Zukunft liegt, wird er das schon in naher Zukunft bereuen.“ Das erleben wir jetzt sehr schmerzhaft in z.B. der Diskussion um die Umstrukturierung unseres Rentensystems, das auch noch das Alter der nächsten Generation/en finanziell absichern sollte, es aber nicht mehr in ausreichendem Umfang kann, weil es nicht frühzeitig genug nachjustiert worden war, als sich die Entwicklung vor einer Generation, um 1970, abzeichnete. (Und wir erleben es in Sachen EU-Mitgliedschaft der Türkei.) Bei einem solchen Ergebnis der Bestandsaufnahme erweisen sich alle Parteien als Teil des schon mehrere Jahrzehnte bestehenden Problems »Auflösung des Reformstaus«, da sie alle zu lange gezögert haben, Reformvorstellungen zu entwickeln, den Umbau des Sozialstaates anzupacken und den Bürgerinnen und Bürgern ihr jeweiliges Lösungskonzept zur Abstimmung durch Wahlen vorzulegen. Das führt zu dem von den Politikern beklagten Verlust an Vertrauen in ihre Arbeit und in sie selbst. So vertun die Politiker Zeit, die unsere Gesellschaft nicht mehr hat, um Lösungen zu finden, die langfristig nicht ausreichen. Wie aber weiter? Die Parteien verharren fast alle in einem Untätigkeitskartell. Politiker sind zuvorderst an den nächsten Wahlen interessiert – seit fast 2.500 Jahren nichts Neues: schon Aristhophanes geißelte in der wahrscheinlich 411 v. Chr. uraufgeführten Komödie „Lysistrate“ Politiker als miteinander „verschworene Klubmänner für Ämterbesetzung“. Alt-Bundespräsident von Weizsäcker gab 1999 öffentlich zu Protokoll: „Verhalten und Einfluss der Parteien auf den Staat haben den Ruf begründet, dass sie sich den Staat zur Beute gemacht haben.“ Heutzutage ist dieses Verhalten der Parteivertreter durchaus verständlich, denn bei »Berufspolitikern« ohne eigenes Standbein in einem anderen Berufsbereich hängen Existenz und erhoffte Chance einer möglichen Karriere von dem Ausgang der jeweils nächsten Wahl ab. Auf dieses kurzfristige Ziel richten sich ihre meist kurzatmigen Bemühungen. Doch wenn Entscheidungen beinahe ohne Rücksicht auf Zukunftserfordernisse überwiegend oder gar fast ausschließlich unter dem Gesichtspunkt ihrer Auswirkungen auf die nächste Wahl getroffen werden, leidet die Fähigkeit, die fälligen Reformen für den Rückbau des Staates vom inzwischen überbeanspruchten Wohlfahrtsstaat nach damaligem skandinavischen Vorbild zum Sozialstaat vorzunehmen, wie es die Skandinavier und Niederländer in den 90-er Jahren nach einer Dekade der gesellschaftlichen Diskussionen noch rechtzeitig und darum ohne zu schmerzhafte Einschnitte geschafft und so den Sozialstaat in ihrem Land gerettet haben. Wir, und insbesondere unsere Politiker, hingegen meiden die uns auf Grund des demographischen Wandels unserer Gesellschaft – Stichwort: »Überalterung der Gesellschaft« - unausweichlich bevorstehende Diskussion, häufen 27 statt dessen zur kurzfristigen Finanzierung der Rentenkasse und der Arbeitslosigkeit ohne grundlegende Sanierung der sozialen Sicherungssysteme zu viele Schulden auf und leben so zu Lasten späterer Generationen, die irgendwann den bei Banken und Privatleuten aufgehäuften Schuldenberg abtragen müssen. Wir leben – unter politischer Führung unserer Politiker - über dem, was wir uns eigentlich nur leisten dürften. „Wenn wir so weitermachen, sind wir die Zechpreller der nächsten Generation“, assistiert der als Finanzwissenschaftler ebenfalls in die RürüpKommission berufene Prof. Raffelhüschen. Jede Generation kann sich letztlich nur das leisten, was sie zuvor geleistet hat, wenn Generationengerechtigkeit ein vorrangiges politisches Ziel staatlichen Handelns sein soll! Heutige Rentner erhalten aus dem Sozialsystem im Durchschnitt 200.000 Euro mehr, als sie eingezahlt haben. Wer dagegen jetzt in den Beruf einsteigt, wird 145.000 Euro mehr einzahlen, als er zurückbekommt (Stern 03.07.03). „Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser wird, wenn es anders wird, aber soviel kann ich sagen: Es muss anders werden, wenn es gut werden soll“ (Lichtenberg 1742-1799). Oder der Alt-Bundespräsident Herzog bei Abgabe des Berichts der nach ihm als Vorsitzendem benannten Kommission der CDU zur Lage und Umgestaltung unserer Sicherungssysteme am 30.09.03: „Bliebe alles beim Alten, flöge das System in die Luft!“ Vielleicht muss es uns - nach dem Grundprinzip »pathologischen Lernens« - aber erst noch schlechter gehen, ehe Politiker und Interessenvertreter zu einschneidenden(!) Veränderungen bereit sind, da es bei uns an Staatsmännern fehlt, die über den Zeitpunkt der nächsten Wahl hinaus durch das Unterbreiten einsichtiger langfristig wirkender Alternativvorschläge problemlösende Führung artikulieren und durchsetzen können – auch und gerade in Wahlkampfzeiten! „Ich frage mich, wer eigentlich noch Interesse daran hat, Probleme zu lösen. Es geht überhaupt nur noch um Machterhalt.“, zitiert der SPIEGEL (26.05.03) den ehemaligen CDU-MdB Blens, der 19 Jahre lang Mitglied des Bundestages gewesen war und 12 Jahre lang den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat leitete. „Die permanente Gegenwart blockiert alles“ wird der Fraktionsvize der SPD Müller in demselben Artikel zitiert. „Das Rechte erkennen und nicht tun, ist Mangel an Mut“ (Konfuzius). Und wenn es einer endlich anpackt und zu lösen versucht, erste Reformen in Angriff nimmt, die selbst die Vertreter der Großkirchen als unausweichlich notwendig bezeichnen, dann wird ihm von den eigenen Parteimitgliedern aus den Gewerkschaften von hinten kräftig in die Knie getreten! „Dabei sind die Änderungen bei Arbeitslosengeld, Krankengeld und Kündigungsschutz nur eine zaghafte und verspätete Reaktion auf den demographischen Wandel. Damit lässt sich noch kein neues Fundament für die soziale Sicherheit von morgen gießen. Bleibt es dabei, wäre das wie ein oberflächlicher Hausputz an einer Sozialstaatsruine, die eigentlich ein Fall für die Abrissbirne ist. Wir brauchen steuerfinanzierte Grundsicherungsmodelle mit breiter Beteiligung der Bevölkerung wie in europäischen Nachbarstaaten. ... Die Agenda 2010 ist ein längst überfälliger Anfang, aber noch immer kaum mehr als die Skizze für den langen Weg bis zum Jahr 2020, wenn nur noch jeder fünfte Erwerbstätige unter 30 ist. Wie lassen sich dann Arbeitsmarkt, Renten- und Gesundheitssysteme noch halbwegs gerecht organisieren? Darauf muss die Politik uns Wähler einstellen. Sonst bricht der Wandel so rasch über diese Republik herein, dass sie ihn gar nicht mehr gestalten kann“ (Editorial STERN 08.05.03). Unser Sozialstaat war unter den Voraussetzungen einer damals erheblich kürzeren mittleren Lebenserwartung – die um 1900 nur ca. 40 Jahre betrug –, einer ausgeglichenen Alterspyramide mit vielen Jungen und relativ wenigen Alten und einer deutlich höheren Geburtenrate geschaffen worden. Diese Voraussetzungen sind durch zwei Weltkriege und den durch die »Pille« mitverursachten demografischen Wandel verpufft. Die ursprüngliche Pyramide hat ihre Form durch die vielen nach oben in die hohen Jahrgänge wachsenden Alten und die immer weniger werdenden Jungen jetzt die Form eines sich bedrohlich entwickelnden Atombomben-Pilzes erhalten! Die EnqueteKommission des Deutschen Bundestages zur Bevölkerungsentwicklung hat folgende Rechnung aufgemacht: Die Lebenserwartung von Frauen steigt bis 2050 im Mittelwert auf 85 Jahre, die der Männer auf 78. Zugleich sinkt die Zahl der Geburten, die »Reproduktionsrate« sinkt auf 1,34 Geburten pro Frau. In wenigen Jahrzehnten ist jeder Neunte über 80 Jahre alt. Wenn es rein nach 28 den (unvernünftigen!) Wünschen ginge, will laut einer Emnid-Umfrage vom Juni 03 jeder Vierte Deutsche sogar 120 Jahre alt werden, notfalls durch Mittel der Gentechnik. Auch wenn es so schlimm nicht kommen wird, bleibt jetzt schon die Frage: Wem sollen die immensen Kosten der absehbar rapide zunehmenden Überalterung der Gesellschaft aufgebürdet werden, da ein „sozialverträgliches Ableben“ (so der ehemalige Ärztekammerpräsident Vilmar in einer viel gescholtenen und zum Unwort des Jahres 1998 gekürten Formulierung) weder gewährleistet ist noch erzwungen werden kann? Die Zeitbombe tickt: Noch stehen 100 Jüngeren im erwerbsfähigen Alter »nur« 40 Senioren gegenüber; in einem halben Jahrhundert werden es 2050 doppelt so viele sein: Dann würden 100 Beitragszahler 80 immer länger lebende Rentner durchfüttern und für ihre Pflege sorgen müssen. Das geht aber nicht: Wie sollten die Jüngeren dann ihren eigenen Lebensunterhalt finanzieren und auch noch Kinder großziehen können, um die Zukunftsfähigkeit der deutschen Gesellschaft zu sichern? Also müssen den Rentnern durch die Einführung eines demografischen Faktors, wie immer er auch genannt werden wird, ihre erhofften Rentenansprüche beschnitten werden, muss die Finanzierung unseres Krankenversicherungssystems umgebaut werden: Unsere sozialen Sicherungssysteme sind nicht sicher! Eine in einem internationalen Wettbewerb aller Industrienationen stattfindende, bald dringlich benötigte geregelte Zuwanderung geeigneter Bewerber kann die unweigerlich auf uns zukommenden Problem nur mildern, nicht aber lösen. Wobei das Argument der CDU, Zuwanderung sei falsch, da aus den Zuwandernden irgendwann ja selbst einmal Rentenempfänger würden, weshalb die deutschen Frauen mehr, nämlich 2,0 statt wie zuletzt 1,34 Kinder bekommen sollten, bewusst Ausländer diskriminierend ist, denn die angestrebten deutschen Mehrgeburten werden ja genau so spätere Rentenempfänger: Dem Rentensystem ist es egal, welcher Nationalität oder Ursprungsnationalität die Rentenzahler sind: immer werden aus Einzahlern bei Wahrung der Anspruchsvoraussetzungen spätere Rentenempfänger! Die Bundesrepublik würde sich aber Zeit erkaufen, wenn jetzt schon gut ausgebildete Ausländer hier arbeiten würden und nicht erst gewartet werden müsste, dass die noch nicht gezeugte und geborene Generation erst noch groß gezogen und ausgebildet werden muss! Von der CDU/CSU wird die Notwendigkeit einer (geregelt verlaufenden) Zuwanderung bestritten und das Thema Zuwanderung zum Wahlkampfthema erhoben: Neues Recht macht eine Million Zuwanderer zu Deutschen Kritik aus Reihen der Union über hohe Quoten Berlin - Das seit dem 1. Januar 2000 geltende Staatsbürgerschaftsrecht hat eine Million Zuwanderer zu Deutschen gemacht. Nach Angaben der Migrationsbeauftragten der Bundesregierung, Marieluise Beck (Grüne), sind seither etwa 800 000 eingebürgert worden - 200 000 Kinder ausländischer Eltern erhielten mit ihrer Geburt die deutsche Staatsangehörigkeit. Damit seien in den vergangenen fünf Jahren mehr Menschen eingebürgert worden als in den 20 Jahren vor der Reform. "Dies ist ein wichtiger Beitrag zur rechtlichen Integration, aber auch zur politischen Teilhabe in unserer demokratischen Gesellschaft", sagte Beck bei Vorlage der Broschüre "Wie werde ich Deutscher?". Beck plädierte dafür, diesen integrationspolitischen Weg weiterzugehen. "Angesicht rückläufiger Einbürgerungen und einer recht unterschiedlichen Einbürgerungspraxis in den Ländern brauchen wir in unseren Städten und Gemeinden ein einbürgerungsfreundliches Klima, das Einbürgerungen befördert und aktiv über die Möglichkeiten des Erwerbs der deutschen Staatsbürgerschaft informiert." Die ehemalige Vorsitzende der Zuwanderungskommission der Regierung, die CDU-Politikerin Rita Süssmuth, wies die Kritik von Bayerns Innenminister Günther Beckstein (CSU) und UnionsFraktionsvize Wolfgang Bosbach an der Zuwanderungspolitik zurück. "Deutschlands Problem ist zur Zeit nun wirklich nicht die Zuwanderung, schon gar keine massenhafte Zuwanderung", sagte Süssmuth. Es gebe aber ein Problem mit der Integration, was auf die Versäumnisse der Vergangenheit verweise. Den Vorstoß von Beckstein und Bosbach, demzufolge Rot-Grün eine massenhafte Einwanderung anstrebt, wertete Süssmuth als "Versuchsballon". Auch die stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Ursula Engelen-Kefer, übte scharfe Kritik an der Ankündigung von Beckstein und Bosbach. "Das ist populistisch und schürt Fremdenhaß", sagte sie. 29 Die aktualisierte Broschüre "Wie werde ich Deutscher" richtet sich an Ausländer, die sich einbürgern lassen wollen. Der Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft ist an Voraussetzungen geknüpft. Ein Ausländer kann einen Antrag stellen, wenn er rechtmäßig seit acht Jahren in Deutschland lebt. Er muß sich zur demokratischen Grundordnung bekennen, ausreichende Sprachkenntnisse haben, er darf nicht wegen Straftaten verurteilt sein und muß seinen Lebensunterhalt sichern können. DIE WELT 22. Juni 2005 Union: Zuwanderung wird heißes Wahlkampfthema Neuer Streit um demographische Probleme Manchmal hat Wolfgang Bosbach die Nase voll von der Zuwanderungsdebatte. Vor allem, wenn er einmal wieder auf einem Podium den Prügelknaben geben soll. Fast immer hört der CDUInnenpolitiker dann diesen Satz: "Über eins sind wir ja einig: Ohne massive Zuwanderung ist die demographische Katastrophe unvermeidlich. Das ist sogar der Union klar." Dann fragen Moderatoren mit unschuldigem Augenaufschlag: "Oder sehen Sie das etwa anders, Herr Bosbach?" Jeder weiß natürlich, daß der CDU-Mann es anders sieht und gleich als Watschenmann wird herhalten müssen. Kaum hat er gesagt, Zuwanderung schaffe mehr Probleme als sie löse, hagelt es schon Vorwürfe: "latent ausländerfeindlich" sei er, "unbelehrbar" oder "vorgestrig". Bosbach ärgert dies auch deshalb, weil er fest davon überzeugt ist, für die Mehrheit der Bürger zu sprechen. Deshalb wollen CDU und CSU im Wahlkampf auch die Anti-Zuwanderungskarte spielen. "Die Wahl ist eine Richtungsentscheidung, wie wir die demographischen Probleme Deutschlands lösen wollen", sagt Bayerns Innenminister Günther Beckstein (CSU). "Mit massenhafter Zuwanderung, wie weite Teile von Rot-Grün es planen, oder ohne Zuwanderung, dafür mit aufwendiger Familienpolitik, längerer Lebensarbeitszeit und permanenter Fortbildung, wie die Union verlangt." Diese Alternative werde "massiv im Wahlkampf thematisiert - und zwar von der ganzen Union, nicht nur von der CSU", so Beckstein. Bosbach stimmt dem zu, schließlich stehe die große Mehrheit der Deutschen hinter der Zuwanderungspolitik seiner Partei, wie alle Umfragen bewiesen. Nur spiegele sich das nicht "in der veröffentlichten Meinung wider", sagt Bosbach. "Da dominiert die Ansicht, nur Massenzuwanderung könne Rentenkollaps und Vergreisung verhindern. Diesen Irrtum müssen wir ausräumen." Die Union ist überzeugt, daß weder das Rentensystem kollabiert noch das Land vergreist, wenn auf die große Wanderung verzichtet werde. Vielmehr habe Deutschland noch Jahrzehnte Zeit, wieder eine bestandserhaltende Geburtenrate (zwei Kinder pro Frau) zu erreichen. Die wirtschaftlichen Folgen der alternden Gesellschaft ließen sich durch viele Maßnahmen abfedern. Diese Zeit müsse aber genutzt werden, um den Willen zur Elternschaft und damit die Geburtenrate (derzeit 1,34 Kinder je Frau) zu stärken. Sehr gelegen kommt den Unionisten eine jüngst publizierte Studie des Wiener Instituts für Demoskopie. Die hat, wie ihr Verfasser Sergei Scherbov einräumt, das Zeug zur Wahlkampfmunition. Schließlich besagt sie, das deutsche Rentensystem lasse sich mindestens bis 2050 ohne Zuwanderung erhalten; und ein alterndes Deutschland müsse keineswegs seine Innovationskraft verlieren. Würde die Lebensarbeitszeit um zwei Monate pro Jahr erhöht, wäre laut Studie das Verhältnis von Beitragszahlern und Rentenempfängern im Jahr 2050 undramatischer als befürchtet. Derzeit kommen auf 1000 Berufstätige 260 Rentner, im Jahr 2050 wären es mit verlängerter Arbeitszeit 380, ohne längere Arbeit dagegen 650. Auch das Schreckbild einer innovationsarmen Greisengesellschaft erklärt die Studie für absurd. Das Wissen um die verlängerte Lebenserwartung beeinflusse nachweislich das Verhalten. Die Deutschen bildeten sich schon jetzt viel länger fort als vor 20 Jahren, blieben länger ehrgeizig im Beruf, bauten in höherem Alter Häuser oder investierten in Geschäfte. "Ein heute 40jähriger verhält sich wie ein 30jähriger vor 20 Jahren", sagt Scherbov, "weil er noch genausolang zu leben hat wie ein 30jähriger damals." 30 Daß ihr Kampf gegen Zuwanderung und für mehr Kinder scheitern kann, ist den Unionsgranden bewußt. "Trotzdem", sagt Beckstein, "muß man es zumindest probieren, alles andere wäre leichtfertig. Denn Zuwanderung schafft Probleme und verändert das Land keineswegs nur positiv." Diese Ansicht versuche Rot-Grün zu tabuisieren, wirft er dem gegnerischen Lager vor. Dahinter stehe bei "vielen Rot-Grünen der alte Wunsch, die Multikulturalisierung Deutschlands doch noch durchzusetzen", meint Beckstein. Schließlich sei es nur der Union zu verdanken, daß das Zuwanderungsgesetz keine Migration der Massen, sondern der Eliten gestatte. Der permanent beschworene demographische Zwang zur Zuwanderung sei oft nichts anderes als "ein letzter Versuch, alte rot-grüne Utopien durchzuboxen". Die Union wolle dies im Wahlkampf als "Multikulturalisierung durch die Hintertür" enttarnen, sagt der bayerische Innenminister. Natürlich sei nicht garantiert, daß die Strategie der Geburtenförderung aufgeht, sind sich beide Unionspolitiker einig. "Sollte dieser Versuch aber mißlingen, hätten wir wirklich ein Problem", räumt auch Bosbach ein. Till-R. Stoldt DIE WELT 19.06.05 Keine Zeit für Kinder Allensbach-Studie: Berufsausbildung geht für Mehrheit der Frauen und Männer vor von Frank Diering Berlin - Lange Bildungs- und Ausbildungszeiten und der grundsätzliche Vorrang des Berufs vor Nachwuchs sind bei vielen Paaren in Deutschland der Grund für Kinderlosigkeit. Das ist das Ergebnis einer vom Bundesfamilienministerium in Auftrag gegebenen Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach, die in Berlin vorgestellt wurde. So sind für nur sieben Prozent der 1856 befragten Frauen und Männer im Alter zwischen 16 und 44 Jahren Kinder Voraussetzung für gesellschaftliche Anerkennung - für den Beruf indes gilt das bei 29 Prozent. Folglich wollen 69 Prozent der Bundesbürger, daß sowohl der Mann als auch die Frau erst eine Berufsausbildung abgeschlossen haben, ehe sie Kinder bekommen. Bis 1990 hatten fast 60 Prozent der Frauen zwischen 25 und 29 Jahren bereits Kinder, heute ist es mit 29 Prozent nicht einmal mehr die Hälfte. "Es muß endlich Schluß sein damit, daß Kinder als Armutsrisiko oder als Plage empfunden werden", sagte Bundesfamilienministerin Renate Schmidt (SPD) und forderte einen Mentalitätswechsel. Sie verlangte mehr familienfreundliche Hochschulen in Deutschland. Zudem könnten ihrer Ansicht nach Regelungen für Ausbildung in Teilzeit helfen. Unternehmen, Gewerkschaften und Politik müßten gemeinsam weitere Anstrengungen unternehmen. Schmidt betonte außerdem: "Andere Länder zeigen: Bildung muß früh beginnen, damit Ausbildung früher enden kann." Das Ziel sei, "daß wir Deutschland bis zum Jahr 2010 gemeinsam zum familienfreundlichsten Land Europas machen". Was den Wunsch nach Kindern anbelangt, förderte Professorin Renate Köcher von Allensbach jedoch ernüchternde Daten zu Tage. So nimmt vom 35. Lebensjahr an der Kinderwunsch rapide ab. Zudem, so Köcher, "verhindert höhere Qualifizierung viele Familiengründungen, lange Ausbildungszeiten sind familienfeindlich und eine Elternschaft vor Dreißig paßt nicht ins Leitbild." So wünschten sich 94 Prozent der 16- bis 26jährigen Frauen und 86 Prozent der Männer Kinder, aber zwischen 35 und 44 Jahren seien es nur noch 45 Prozent der Männer und sogar nur 30 Prozent der Frauen - bei über 40jährigen sind es sieben Prozent. In einfachen und mittleren Bildungsschichten kämen die Kinder heutzutage später, "aber sie kommen", so Köcher. In höheren Bildungsschichten gebe es zwar auch Geburten - aber diese erfolgten immer später und immer seltener. Das führe zu steigender Kinderlosigkeit bei gut ausgebildeten Frauen. Seit 1991 sei ihr Anteil unter den 20- bis 44jährigen Frauen von 24 Prozent auf 31 Prozent gestiegen. Letztlich habe sich zwischen 1975 und 1995 die Ausbildungszeit in Deutschland deutlich ausgedehnt. Junge Menschen würden heute einen Lehrberuf 2,4 Jahre später beenden, sie verließen die Fachhochschule fast drei Jahre und die Universität 1,8 Jahre später. Köcher: "Zwar meint die große Mehrheit, daß die beste Zeit für Geburten für Frauen zwischen 20 31 und 25 Jahren liegt. Doch de facto erwarten 38 Prozent Nachteile und nur 25 Prozent Vorteile, wenn sie in diesem Alter Kinder bekommen." DIE WELT 21. April 2005 Die Gesamtproblematik unserer kollabierenden sozialen Sicherungssysteme müsste/muss das große Thema der nächsten Wahlkämpfe werden! U.a. nachdem z.B. Wirtschafts- und Theologieprofessoren vorschlugen, wegen der Überalterung der Gesellschaft bei teuren Therapien wie Dialysebehandlungen, Herz- und Krebserkrankungen und der Versorgung mit künstlichen Gelenken die Einführung einer Altersbegrenzung von 75 Jahren vorzunehmen. Der katholische Theologieprofessor Wiemeyer, Berater der Deutschen Bischofskonferenz: Es müssten in Zeiten knapper werdender Ressourcen „vor allen Dingen medizinische Leistungen für Jüngere bereitgestellt werden, aber nicht jede lebensverlängernde Maßnahme für sehr alte Leute“ durchgeführt werden (HH A 02.06.03). Weil die hinter den Problemen des Arbeitsmarktes, der Renten- und Gesundheitssysteme stehenden Sachfragen aber von den in der Gesamtproblematik nicht drinsteckenden Wählern gar nicht in ihren Auswirkungen auch nur ansatzweise überblickt, geschweige denn durchschaut werden können, wäre es den Wählern sicher am liebsten, der Reformstau würde ohne zu große »Gerechtigkeitslücken« in einem Konklave, einer großen Kooperation der wissenden Vernünftigen aller Parteien oder gar einer großen Koalition der beiden großen Volksparteien aufgelöst. Leider konnten sich die Parteien bisher weder zu dem einen noch zu dem anderen Weg bereit finden. Im Falle einer großen Koalition, die notwendig werden kann, wenn CDU/CSU und FDP, die sich gegenseitig schon fest versprochen haben, wegen des möglichen Wahlerfolges des neuen Linksbündnisses aus PDS und WASG nicht die absolute Mehrheit der Sitze im 16. Deutsche Bundestag erringen sollten, wäre die Stimmenmehrheit so groß, dass man sich Stimmenabweichungen von parlamentarischen Lobbyisten/-vertretern leisten könnte, und die Länderkammer Bundesrat fungierte nicht mehr als Verhinderungsorgan der jeweiligen Opposition im Deutschen Bundestag. So aber mit den unterschiedlichen Machtverhältnissen in Bundestag und Bundesrat blockiert die eine Parteienkoalition im Bundesrat, was die andere zuvor im Bundestag beschlossen hat; und umgekehrt. „Die Lähmungswirkungen des Parteienwettbewerbs übertreffen seine Problemlösungskraft bei weitem“, zieht der Politikwissenschaftler Kielmannsegg das Fazit aus seiner Lagebeurteilung und trifft damit den Nerv der Wähler. Auf diese ungute Art wird der diffus empfundene Problemdruck immer größer – und werden die erforderlichen Einschnitte auf Grund der mit der unaufhaltsam zunehmenden Überalterung wachsenden Probleme wegen vergeudeter Zeit immer tiefer gehen müssen: dann ist ein radikaler Kurswechsel statt eines sanften Umsteuerns im wahrsten Sinne des Wortes »not-wendig«. Diesem Befund der bisher zu unser aller Lasten eindrucksvoll nachgewiesenen Problemlösungsinkompetenz entsprechend gering ist das Ansehen des Deutschen Bundestages – und erst recht der Parteien(!) - bei der Bevölkerung: In der größten Befragung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, der unter der Schirmherrschaft des Altbundespräsidenten von Weizsäcker von STERN, McKinsey, T-Online und ZDF 2003 durchgeführten Internet-Befragung „Perspektive Deutschland“, erreichte der Deutsche Bundestag - knapp vor den Arbeitsämtern, den Institutionen der Gesetzlichen Rentenversicherung und letztlich den im Ansehen bei den Bürgern völlig diskreditierten Parteien (2004 laut einer Forsa-Umfrage nur noch 12 % vertrauensvolle Zustimmung) - gerade mal den viertschlechtesten Wert. 71% der Befragten empfanden bezüglich des Deutschen Bundestages dringenden Verbesserungsbedarf und 43 % hatten kein Vertrauen mehr in die höchste legislative Institution unseres Landes. Bei der Wiederholung der Befragung 2004 hatte sich dieser Wert nach den ersten Reformbemühungen ohne durchgreifende Verbesserung der Gesamtlage (mit Einschnitten bei hauptsächlich sozial Schwächeren) auf 49 % verschlechtert. „Das Parlament ist im ganzen Land gleichermaßen diskreditiert. Nur in Berlin, Sitz der Regierung, vertrauen den Parlamentariern noch mehr als ein Drittel der Bürger.“ Der Prozentsatz des Vertrauens reicht von 36 % in Berlin bis 26 % in Bayern und, als Schlusslichter, 25 % in Sachsen und Thüringen (Stern 24.04.03). Dieses niederschmetternde Ergebnis ist für die ostdeutschen Ländern noch verständlich, weil man dort auf das Erblühen der heimischen 32 Landschaften wartet. Aber ein solcher Wert für Bayern? Wo doch nach Meinung des bayerischen Ministerpräsidenten die im Vergleich zu den Ostdeutschen klügeren Menschen wohnen! Bei der 2004 zum dritten Mal wiederholten Befragung „Perspektive Deutschland“ gaben 86,4 % der hauptsächlich per Internet Befragten an, sie sähen bei den Parteien den größten Verbesserungsbedarf: 67,9 %, und damit zwei Drittel, gaben ihr Misstrauen gegenüber »den politischen Parteien« kund; das war der höchste Misstrauenswert gegenüber einer Institution in unserem Land. Als am vertrauenswürdigsten waren der ADAC, das Rote Kreuz und Greenpeace angesehen worden, an letzter Stelle standen »die Parteien«. Für zu vollmundige Politiker-Versprechungen sprichwörtlich geworden sind inzwischen die von dem ehemaligen CDU-Kanzler Kohl versprochenen »blühenden Landschaften« in Ostdeutschland, mit denen er seinen triumphalsten Wahlsieg als »Kanzler der Einheit« errang. Großflächig »blühende Landschaften« im Osten hat bisher jedoch niemand entdecken können. Auf die warten nach ca. 950 Mrd. Euro netto transferierter finanzieller Aufbauhilfe - nicht nur die Ostdeutschen immer noch vergeblich. Nach Ansicht vieler Ostdeutscher gilt das gebrochene Wort - besonders wenn ihnen die Wahrnehmung von Partikularinteressen in Aussicht gestellt oder gar versprochen wurde, dieses Wort aber hinterher nicht gehalten werden konnte, wie z.B. im Fall der angekündigten, dann aber doch nicht vollzogenen Stillegung des größten Truppenübungsplatzes Wittstock, weil die Bundeswehr ja schließlich irgendwo üben muss. Aber eine durch jährlich rund 120 Milliarden Subventionen aus den alten Bundesländern (die sich im Gegensatz zu den östlichen nach dem gemeinsam verlorenen Zweiten Weltkrieg durch ihre Westanbindung an die freie Welt über fast ein halbes Jahrhundert politisch und wirtschaftlich frei entwickeln konnten) bewerkstelligte allgemeine Besserung der allgemeinen Lebensumstände für die Bevölkerung in Ostdeutschland, wie sie unter der Pleite gegangenen SED-Herrschaft undenkbar gewesen wäre - man denke nur an die 12-15-jährige Wartefrist für die Zuteilung eines schon bei der Auslieferung hoffnungslos veralteten Autos wie des Trabis, die jahrelange Wartefrist für die Zuteilung eines Telefonanschlusses u.s.w. -, eine allgemeine Besserung der allgemeinen Lebensumstände hat es dort ganz offensichtlich überall gegeben – ohne dass das die Akzeptanz der Demokratie bei den in ihren übersteigerten(!) Erwartungen enttäuschten Ostdeutschen gestärkt hätte und Ostdeutschland sich wegen der fehlenden Arbeitsplätze und der Auswirkungen der Hartz-IVReformen unter Anheizen der sozialen Situation durch die dafür ursächlich verantwortliche, in PDS umbenannte SED auf dem Weg in eine labile Demokratie befindet: in dem vom statistischen Bundesamt vorgelegten Datenreport 2004 wurde ausgeführt, dass jeder zweite Ostdeutsche die demokratische Staatsform nicht für die beste halte, ein Viertel derjenigen, die fast alle nie auch nur entfernt eine Demokratie kennen gelernt haben, weil sie von 1933-1945 unter der Nazidiktatur und von 1945-1998 unter der von der Sowjetunion installierten Diktatur der PDS-Mutter SED gelebt haben, meinte, es gäbe eine bessere Staatsform als die Demokratie – ohne sagen zu können, wie die ausgestaltet sein sollte; und drei Viertel der Ostdeutschen halten den Sozialismus mit seiner Arbeitsplatzgarantie in völlig ineffizienten Betrieben, der den SED-Staat - trotz der der Bundesrepublik abgeluchsten Milliarden für den staatlichen Menschenhandel mit den zur Devisenbeschaffung produzierten politischen Häftlingen und den durch staatliche Wegelagerei an den Transitstrecken nach West-Berlin abgepressten Beträgen in ebenfalls Milliardenhöhe - in den Ruin getrieben hat, nachdem sie jetzt selber »Westautos« fahren können, noch immer oder schon wieder(!) für eine gute Idee, die bloß schlecht realisiert worden sei. Sie weigern sich, die Lehre aus dem bankrott gegangenen sozialistischen Experiment zu ziehen und wählen weiterhin die SED-Nachfolgerin PDS: „Die dümmsten Kälber wählen ihre Schlachter selber!“, rief Stoiber den Wählern der „Linkspartei .PDS“ zu, „die Erwartungen weckt, die kein Staat der Welt erfüllen kann“ (Freie Presse 20.08.05). „Die PDS profitiert vom Eindruck, dass Schröder der Osten kaum interessiert, Stolpe dort als Identifikationsfigur ein Totalausfall ist und Angela Merkel in der CDU reüssieren kann, wenn sie ihre Herkunft verdrängt“( FR 01.11.04); was ein Jahr später nicht mehr der Fall war. Das Bruttoinlandsprodukt der ostdeutschen Länder mit ihrer unterentwickelten Wirtschaft beträgt nur 61 % des westdeutschen, die privaten Konsumausgaben konnten aber laut Berechnungen des Arbeitskreises „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder“ Dank der Subventionen aus dem wirtschaftlich gesünderen Westen auf 82 % der westdeutschen angehoben werden. Und 33 das ist gut so! Brachten aber den Bundeshaushalt in Schieflage und beunruhigte die Währungswächter der EU wegen mehrfachen Überschreitens der 3-%-Defizitgrenze. Mit diesem Hinweis soll nicht die Subventionierung der östlichen Empfänger-Bundesländer durch die westlichen Geberländer irgendwie grundsätzlich in Frage gestellt werden: Das deutsche Volk hat als Schicksalsgemeinschaft die aus der Kriegslüsternheit der Nazis immer noch resultierenden Kriegsfolgelasten gemeinsam zu schultern, und da der Westen Deutschlands 40 Jahre lang eine prosperierende Wirtschaft in einer stabilen Demokratie aufbauen konnte, hat er den Ostdeutschen so lange zu helfen, bis sie gleichgezogen und das aufgeholt haben, was die Herrschaft der PDSVorgängerin SED den gleich fleißigen und gleich innovativen Ostdeutschen wegen des Einflusses der UdSSR unmöglich gemacht hatte! Das Vertrauen in Stadt- und Gemeindeverwaltungen hingegen ist fast überall mehr als doppelt so groß wie für den anonym vor sich hin werkelnden Deutschen Bundestag – weil man in seiner örtlichen Umgebung eher überschaut und hautnah miterlebt, was passiert. Politik ist Zukunftsgestaltung, und Zukunft kann man nicht genau vorhersehen. Trotzdem muss ihre Gestaltung im vorhersehbaren Rahmen angepackt, das als langfristig notwendig Erkannte kurzfristig mehrheitsfähig gemacht werden. Das geht nur über Versprechungen für die Zukunft. Diese Bündelung von auf die Zukunftsgestaltung gerichteten Wählerinteressen ist die vordringlichste Langzeitaufgabe der Parteien in einer Demokratie: Niemand weiß etwas Besseres. Wenn die politischen Parteien in den Augen der Wähler/innen in diesem Punkt versagen, schaffen sie sich ein erhebliches Glaubwürdigkeitsproblem - und unserem politischen System dadurch ein erhebliches Demokratieproblem, das politische Rattenfänger mit meist auf Vorurteilen basierenden »einfachen« Lösungsvorschlägen auf den Plan rufen kann! Die niederschmetternden Umfragewerte bezüglich des Ansehens der Parteien: 61 % der Bevölkerung haben kein Vertrauen in die Arbeit der politischen Parteien! Wie sollten sie auch, wenn sie für sich bisher die Mühsal politischer Sisyphosarbeit in Parteien gescheut und darum keinen Einblick in deren oft mühevolle Arbeit gewonnen haben. Und das Wälzen schwerer Steine hört im Bereich der Politik nie auf! Das hinterlässt Spuren: in den Seelen und – für uns Außenstehende offensichtlicher - auf den Gesichtern unserer Spitzenpolitiker. Man braucht sich nur einmal Bilder aus verschiedenen Jahren anzuschauen und man entdeckt die unter fast völliger Aufopferung von Freizeit hart erarbeiteten Runen in den Gesichtern der Spitzenpolitiker: Politikgestaltung kann ein mörderischer Job sein! Und das für eine vergleichsweise kärgliche Bezahlung, denn über die Jahre in die Privatwirtschaft abgewanderte Spitzenpolitiker verdienten dort ein Vielfaches eines Ministergehaltes; selbst dann, wenn man dem Ministergehalt das bisher gezahlte Einkommen eines Abgeordneten als „Schatteneinkommen“ hinzuzählt! Und die in die Privatwirtschaft abgewanderten Spitzenpolitiker mussten sich dabei nicht mehr – als Gipfel der Freudlosigkeit - mit ihrer ihnen manchmal nur sehr unwillig folgenden eigenen Partei abquälen. Politik ist Zukunftsgestaltung, und Zukunft kann man – von sich über Jahre und Jahrzehnte klar abzeichnenden großen Entwicklungslinien wie z.B. der Notwenigkeit der Errichtung atomarer Endlager für den Atommüll aus den Kernkraftwerken und den Krankenhäusern oder dem demographischen Wandel in der Bevölkerungsstruktur abgesehen - nicht genau vorhersehen. Das ist jedem einsichtig. Wahlkampfaussagen zur bei Mandatserteilung durch den Wähler von einer Partei beabsichtigten Zukunftsgestaltung wurden bisher deswegen nicht als justiziabel angesehen, weil der Wähler nach vier Jahren eh die Möglichkeit hat, sich umzuentscheiden, wenn er sich inzwischen von der oder den zentralen Wahlkampfaussage/n der von ihm bei der letzten Wahl gewählten Partei verschaukelt glaubt, weil er die im als »Polittainment« oder »Wahlverkaufsveranstaltung« inszenierten Wahlkampfgeschehen laut hinausposaunten Parolen zu leichtgläubig für bare Münze genommen und nicht hinterfragt hatte. Die marktschreierisch unter das Volk gebrachten angeblich neuen, oft aber (ur-)alten Parolen [1976: Freiheit oder Sozialismus (CSU)] werden ein bisschen neu verpackt [1994: Freiheit statt Volksfront (CSU)] und dann dem Wähler anzudrehen versucht – es ist fast wie beim Umetikettieren von Lebensmitteln mit abgelaufenem 34 Mindesthaltbarkeitsdatum -, wenn es nicht ausnahmsweise mal um ein wenigstens angedeutetes alternatives Konzept geht, wie z.B. im hoffentlich so durchgeführten personalisierten(?) Richtungswahlkampf 2005 um die weitgehende Umgestaltung unseres Gesellschafts-, Wirtschafts- und Gesundheitssystems oder die Verhandlungen der Europäischen(!) Union mit der asiatischen(!) Türkei um eine von letzterer angestrebte und von der SPD und den Grünen in diesem Wusch unterstützte, von CDU und CSU aber mehrheitlich abgelehnte Vollmitgliedschaft in der Europäischen(!) Union, die nach nicht nur hier vertretener Meinung durch nichts durchgreifend zu rechtfertigen wäre.10 „Es wird nirgends so viel gelogen wie vor der Wahl, im Krieg und nach der Jagd“ (Bismarck 1815-1898). Als Optimist ist man dazu verdammt zu hoffen, dass es ganz so schlimm nicht sei oder kommen werde, wie es uns die jeweiligen Oppositionspolitiker und die Kabarettisten, die beide von der Übertreibung leben und zwischen deren Aussagen oft kein Unterschied zu erkennen ist, glauben machen wollen - auch wenn der Blick auf die jahrzehntelangen Versprechungen zu z.B. der Sicherheit der Rente und die wirkliche Lage der Rentenkassen Düsteres über den Wahrheitsgehalt von Politikeraussagen offenbart hat. Man kann sich ja mal versprechen, aber das Jahrzehnte lang? „Ein ’Rentenlügen-Untersuchungsausschuss’ hätte schon seit Jahrzehnten ständig tagen müssen“ (Welt am Sonntag 27.04.03). Ganz so rosig, wie die jeweilige Regierung die Lage darstellt, ist sie ganz gewiss aber auch nicht: Ein gewisses Maß an Misstrauen gegenüber Regierungsaussagen, wenn Regierungen ihre angeblichen Erfolge über den grünen Klee loben, erscheint unabdingbar notwendig, um hinterher nicht zu sehr desillusioniert zu sein! Dabei ist für uns Wähler schwer abzuschätzen, wie Regierung und Opposition in ihren Darstellungen über abschätzbare gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen den schmalen Grat meistern zwischen unrealistischen Hoffnungen (»blühende Landschaften«), möglicherweise nur bewusst fahrlässigen Prognosen („die Renten sind sicher“ zu einer Zeit, als viele Politiker den sich anbahnenden gesellschaftlichen und von Bevölkerungswissenschaftlern schon längere Zeit prognostizierten Wandel in der Bevölkerungsstruktur noch nicht so ganz wahrhaben wollten) bis zu bewusst vorsätzlich(!) falschen Prognosen („die Renten sind sicher“ zu einer Zeit, als sich für jeden offensichtlich die gesellschaftlichen Verhältnisse so geändert hatten, dass ohne eine Änderung im Rentensystem keine Altersabsicherung mehr möglich war; erst Bundeskanzler Schröder leistete auf seinem »Agenda-2010-Parteitag« 2003 den für die gesamte politische Kaste der Bundesrepublik seit mindestens 20 Jahren fälligen Offenbarungseid, als er öffentlich erklärte: „Es muss sich schon sehr viel ändern, damit Wohlstand und soziale Sicherheit auch nur so bleiben, wie sie sind. Mehr sollten wir den Menschen auch nicht versprechen. Wir werden uns von manchem, was uns lieb – und leider auch: teuer – geworden ist, verabschieden müssen“ (Stern 05.06.03). Wo sind auf einer schwammigen Skala mit u.a. den Skalenpunkten unrealistische Hoffnungen, begründete Hoffnungen, unvorhersehbare, unkalkulierbare, kalkulierbare Risiken, fahrlässige, bewusst fahrlässige bis bewusst vorsätzlich falsche Prognosen z.B. Aussagen über die Entwicklung der Staatsfinanzen im nächsten Viertel- oder Halbjahr und wo von vornherein als unbezahlbar erkennbare und von den Wählern auch als solche erkannte Wahlversprechen einzuordnen? Das zu klären, beanspruchte ein von der veröffentlichten Meinung mehrheitlich als überflüssig eingeschätzter Parlamentarischer Untersuchungsausschuss »Wahlbetrug«. Dass die Wahlverlierer der Bundestagswahl von 2002 aber in schon fast bewundernswerter Verdrängung der mehr als vollmundig abgegebenen und von den Redaktionsexperten der wachsamen Presse von vornherein als unbezahlbar erkannten und auch so der Öffentlichkeit übermittelten eigenen Wahlversprechen seine Einsetzung forderten und mit ihrem Minderheitsrecht aus Art. 44 I GG - auf Antrag eines Viertels der Mitglieder des Bundestages muss ein Untersuchungsausschuss eingesetzt werden - durchsetzten, mutete eher nach dem „Haltet-den-Dieb!“-Ruf des flüchtenden Diebes an, mit dem der von sich ablenken will. „Was soll herauskommen? Angriff, Gegenangriff, gegenseitige Schmutzladungen. Geschädigt ist am Ende das Ansehen der Parteien. Die Einsetzung des Ausschusses ist die Fortsetzung des Wahlkampfes. ... Im Übrigen hat die Demokratie die Mittel, die sie braucht: Hat sich ein Politiker erkennbar zu weit von der Wahrheit entfernt, wird er bestraft – bei 10 Näheres dazu siehe im Internet die Websites: www.Hans-Uwe-Scharnweber.de oder www.cdq.de 35 der nächsten Wahl durch die Bevölkerung, aber doch nicht durch einen Quasi-Richter im Parlament, wie es der Untersuchungsausschuss ist“ (Alt-Bundespräsident von Weizsäcker STERN 05.12.02). Der damalige Bundespräsident Rau sprach allen Wählern aus dem Herzen, als er in seiner Weihnachtsansprache 2002 - schon fast volksliedhaft einfach und darum so einprägsam formuliert forderte: „Wer politisch handelt, muss sagen, was er tut und tun, was er sagt!“ Vielleicht sollte man den Satz aus aktuellen Anlässen noch um ein Wort ergänzen: „Wer politisch handelt, muss sagen, was er tut und - selber - tun, was er sagt!“ Das gilt für beide: Regierung und Opposition, denn beide handeln politisch. Die Wahlbürger bestimmen in dem bisher alle vier Jahre stattfindenden Wahlakt die Zusammensetzung des parlamentarischen Gremiums Deutscher Bundestag, der – von einigen nachträglich aus ihrer Partei ausgetretenen Parlamentariern abgesehen - bisher nur aus Parteimitgliedern bestand. Zur Bundestagswahl 2002 standen 3.542 Parteibewerbern, davon 1.028 Frauen (29 %), aus 24 der von dem Bundeswahlausschuss zur Wahl zugelassenen 31 Parteien nur 60 völlig chancenlose unabhängige Einzelbewerber gegenüber. Durch die Bundestagswahl wird formal ausschließlich die Zusammensetzung unseres Bundesparlaments, des Deutschen Bundestages, gewählt, nicht der Bundeskanzler! Das unterscheidet unsere Bundestagswahl von der Wahl des amerikanischen Präsidenten oder des französischen Staatspräsidenten in einer landesweiten Direktwahl durch deren jeweiliges Volk. Schön wäre es, wenn bei einer Bundestagswahl über politische Inhalte, vielleicht sogar über von den Parteien erarbeitete und zur Abstimmung gestellte Zukunftsprojekte und nicht über inhaltsleere Floskeln wie „Die SPD ist eine Gefährdung des Standortes Deutschland“ von der rechten und „Die Union ist eine Gefährdung des sozialen Friedens“ von der linken Seite abgestimmt würde. Die Aufgabe der Parteien im Bundestag ist die Interessenvertretung ihrer Wähler, in Abstimmung mit dem Bundesrat die an den objektiven Notwendigkeiten oder den – manchmal nur behaupteten - Wählerinteressen ausgerichtete Gesetzgebung, die Wahl einer Regierung durch die Parlamentsmehrheit (und sei es auch mitten in einer Wahlperiode durch ein konstruktives Misstrauensvotum, wie 1972 gegen Bundeskanzler Brandt vergeblich versucht und 1982 gegen Bundeskanzler Schmidt erfolgreich in die Tat umgesetzt, so dass der damalige Oppositionsführer Kohl mit Hilfe der bis dahin mit der SPD verbundenen FDP an die Regierung gekommen war) und die Kontrolle der Regierung; selbstverständlich nur sehr eingeschränkt durch die siegreichen, die Regierungskoalition bildenden Parteien, hauptsächlich jedoch durch die bei der letzten Wahl zahlenmäßig unterlegene Opposition, der zur effektiven Wahrnehmung dieser Kontrollfunktion als schärfste Waffe die Erzwingung der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Verfügung steht. Weitere gelegentliche aber ebenfalls wichtige Aufgaben des Bundestages sind bei Bedarf die Beteiligung an der Wahl des Bundespräsidenten und der Richter unseres höchsten und wichtigsten Gerichts, des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG). Die Parteien ihrerseits nehmen durch ihre Vorauswahl der Kandidaten einen bestimmenden Einfluss darauf, wer den Wählern als Repräsentant zur Wahl überhaupt angeboten wird, sowohl in den einzelnen der 299 Wahlkreise, wie auf den Landeslisten. Der Wähler kann keinen Kandidaten als Direkt- oder Listenkandidaten einer Partei oder gar als Bundeskanzlerbewerber auswählen. Es gibt keine „Primaries“ (Vorwahlen für Präsidentschaftsbewerber im 36 us-amerikanischen Wahlsystem) und keine Bundeskanzlerstimmzettel! Die Parteibewerber soll(t)en so zugkräftig sein, dass sie möglichst viele Wähler veranlassen, ihre Stimme für eine der sie umwerbenden Parteien, deren Spitzenkandidaten und deren – den Wählern meistens un(!)bekanntes - Programm abzugeben; das wird 2005 z.B. von dem linken Wahlbündnis durch die Aufstellung zweier populistischer Spitzenkandidaten als Aushängeschild versucht. Nach der Verfassung zielt der Wahlkampf darauf, einem von den Mitgliedern oder ihren Delegierten beschlossenen Parteiprogramm zur Realisierung zu verhelfen; in der Realität stimmen die Wahlbürger aber meist ohne jegliches tiefer gehendes Sachwissen für den jeweiligen Spitzenkandidaten oder eine laut und offensiv herausgestellte Parole. Das nicht der/die Bundeskanzler/in, sondern eine Partei und/oder ihr Wahlkreisdirektkandidat gewählt wird, ist z.B. für den Fall sinnvoll, dass der siegreiche Bundeskanzlerkandidat nach der Wahl, aber vor seiner Ernennung versterben sollte! Dann braucht es keinen erneuten Wahlgang zu geben, weil die siegreiche Partei dann einen Nachfolger nominiert und mit Stimmenmehrheit wählt. Einen erneuten Wahlgang muss es aber geben, wenn einer der nominierten Direktkandidaten in einem Wahlkreis vor der Wahl versterben sollte. Da hat es schon mehrfach aus diesem Grund Nachwahlen gegeben. Wenn keine Partei die absolute Mehrheit der Sitze im Parlament erringt, müssen Parteienkoalitionen gebildet werden, die sich in einem (juristisch nicht einklagbaren!) Koalitionsvertrag versprechen, bestimmte gemeinsam abgestimmte Politikvorhaben umsetzen zu wollen. Hat sich eine Parteienkoalition hierauf geeinigt, wird – laut Art. 63 I GG auf Vorschlag des Bundespräsidenten, der sich mit den Parteivertretern bespricht und dann dem Parlament nur einen aussichtsreichen Kandidaten mit einer wahrscheinlichen Mehrheit im Parlament vorschlägt11 – üblicherweise der Spitzenkandidat der größeren oder größten Regierungspartei im Parlament ohne Personalaussprache von den Abgeordneten der (Koalitions-)Mehrheit zum Bundeskanzler gewählt. [Der Posten des Vizekanzlers, der laut Art. 69 I GG vom Bundeskanzler aus der Reihe seiner Minister ernannt wird, geht dann regierungsintern nach der Geschäftsordnung der Bundesregierung ohne weitere Wahl im Parlament an den Spitzenkandidaten eines kleineren Regierungskoalitionspartners. Im Fall einer CDU-CSU-FDP-Koalition wurde bisher der Spitzenkandidat der FDP Vizekanzler, was die von der CDU eigenständige CSU auch schon mal gerne für den Spitzenmann ihrer Partei beansprucht hätte - besonders wenn deren Spitzenmann meint, besser zu sein als die beiden anderen Parteiführer! So wurde Ende Juli 2004 mit Blick auf die turnusmäßig eigentlich 2006 stattfindende Bundestagswahl die abschätzige Beurteilung Stoibers über die dann 2005 doch in diese Position gekommene CDU-Kanzlerkandidatin Merkel und den FDP-Vorsitzenden Westerwelle kolportiert - und anschließend selbstverständlich pflichtschuldigst dementiert -: Bei Schröder und Fischer habe man es „nicht mit Leichtmatrosen zu tun“. Es sei eine „Fehleinschätzung“ zu glauben, Angela Merkel und Guido Westerwelle seien das Duo der Zukunft. „Die können Schröder und Fischer nicht das Wasser reichen.“ (Und wurden darum gerne von der Presse im Umkehrschluss als „Leichtmatrosen“ zitiert.) Die Union werde es schwer haben, mit einer ostdeutschen Protestantin (gemeint war: einer Frau, dazu ohne Kinder) und einem Junggesellen aus Bonn (gemeint war: einem Schwulen) das bürgerliche Lager zu gewinnen (STERN 12.08.04) – eine der bei Stoiber üblichen Sottisen, zu denen auch gehörte, dass er das Urteil des EuGH zur Frage der Wehrberechtigung von Frauen in der Bundeswehr mit dem Satz kommentiert hatte: „Demnächst wird die Gleichstellungsrichtlinie erzwingen, dass der nächste Bundeskanzler eine Frau ist.“ Nun hat er den Salat und darf bald unter einer Bundeskanzlerin Merkel – wie seine Berliner Wachhunde fordern - „an herausragender Stelle“ mitregieren! Falls die CSU-Politiker Strauß oder Stoiber zum Kanzler gewählt worden wären, hätte nicht die größte Regierungskoalitionspartei den Kanzler gestellt, und es wäre vermutlich auch nicht der Spitzenmann der größten Partei Vizekanzler geworden, sondern der FDP-Spitzendkandidat.] 11 Im Gegensatz zu den eingeschränkten Möglichkeiten des deutschen Bundespräsidenten ist der türkische Staatspräsident in der Auswahl des Abgeordneten, den er dem Parlament zur Wahl des Ministerpräsidenten vorschlägt, völlig frei. 37 Doch wen umwerben die Parteien? »Mündige Bürger« oder »Stimmvieh«? Wahltage sind Zahltage: Es werden von enttäuschten Wählern Rechnungen beglichen, indem sie eine zuvor gewählte Partei bei der nun anstehenden nächsten Wahl z.B. mit Stimmentzug abstrafen und – dummerweise (Näheres s. S. 25 „Nichtwähler“) - gar nicht mehr zur Wahl gehen. „Alle paar Jahre machen die Wähler ihr Kreuz. Und hinterher müssen sie’s dann tragen.“, fasste die Publizistin Berg-Khoshnavaz ihren Frust in Worte. Von hoffnungsfrohen Wählern werden durch eine entsprechende Stimmabgabe neue Kredite ausgegeben. Die Wahlkreuze sind immer eine Vergabe von Vertrauenskrediten. Aber Kredite können faul werden! Das muss nach Ablauf einer in den meisten Demokratien auf vier oder fünf Jahre angesetzten Wahlperiode überprüft werden; und überprüft werden können. Diese Möglichkeit als unaufkündbares und ohne einschränkende Tricksereien effektiv ausübbares, notfalls einen Machtwechsel herbeiführendes Bürgerrecht – nicht Menschenrecht! - zu haben, ist der unschlagbare Vorzug der (von ihren Gegnern im Laufe der Geschichte oft verächtlich „bürgerlich“ geschmähten) Demokratie vor allen anderen Politikmodellen zur Organisation einer Gesellschaft, weil bei ihr der Irrtum nicht »auf ewig« institutionalisiert wird, sondern nach Ablauf der vorher limitierten Wahlperiode überprüft werden kann! Wenn ein Wechselwähler sich umorientiert, fällt beides zusammen: es wird sowohl ein notleidend gewordener Kredit beim alten Kreditnehmer abgewickelt, als auch an einen anderen politischen Bewerber ein Vertrauensvorschuss erteilt. „Wahlen sind manchmal die Rache des Bürgers. Der Stimmzettel ist auch ein Dolch aus Papier“, so der ehemalige britische Premierminister Lloyd George. Das haben schon einige Parteien in verschiedenen Ländern erfahren: Bei der Wahl zum türkischen Parlament 2002 scheiterten alle drei der in den Wahlkampf gezogenen Regierungsparteien auf Grund ihrer jahrelang nachgewiesenen Inkompetenz und Korruptionsanfälligkeit an der 10-%-Hürde des türkischen Wahlgesetzes. Es kamen so ausschließlich vorherige Oppositionsparteien ins türkische Parlament, von denen die »gemäßigt islamistische« AKP dann auf Grund ihres höheren Stimmenanteils von 35 % der Stimmen nunmehr mit 363 von 550 Abgeordneten die Regierung bilden konnte – es fehlten ihr nur 4 Stimmen an einer verfassungsändernden Zwei-Drittel-Mehrheit - und die sozialdemokratisch ausgerichtete Republikanische Volkspartei CHP die Opposition stellte: Fast die Hälfte der Wähler ist nicht im Parlament vertreten; und mit rund 35 % der Wählerstimmen kann man eine verfassungsändernde Zwei-Drittel-Mehrheit zusammenbekommen! Oder bei den Parlamentswahlen in Kanada 1993, da wurde die bis zu dieser Wahl die Regierung stellende Partei ebenfalls erdolcht: Sie verlor - verursacht durch das in Kanada nach britischem Vorbild geltende relative Mehrheitswahlrecht - 156 ihrer 158 Sitze! Am Wahltag versucht der (jedenfalls von der Idealvorstellung her) »mündige Wähler« das politische Gestaltungsrecht für die Dauer der nächsten Legislaturperiode durch seine Stimmabgabe an die Partei seines (möglicherweise nur eingeschränkten) Vertrauens zu übertragen. Ist aber der wahlberechtigte »Normalbürger« in seiner großen Masse wirklich »mündig« und bereit, eine rationale Entscheidung zu treffen? Sind Lieschen Müller und ihr statistischer Lebenspartner Otto Normalverbraucher überhaupt mündige Bürger? Wohl nicht, denn sonst hätten wir sicher nicht eine solche durch Unerträglichkeiten gekennzeichnete »Spaß-Unkultur« als Wahlkampf, die einige Politiker für »events« nutzen zu müssen glaubten, indem sie sich zu Unerträglichkeiten begaben, um dort von Fernsehkameras gestreichelt zu werden; und die andere wie Manna vom Himmel fallen ließ - teilweise während 2002 die Elbe-Flut Häuser wegriss! Damit kann ein wirklich „mündiger Bürger“ doch nicht beeindruckt und veranlasst werden, einer Partei für vier Jahre das politische Gestaltungsrecht zum Umbau der Lebensgrundlagen unserer Gesellschaft zu übertragen! Wie kann sich der wirklich »mündige Bürger« gegenüber dem »Stimmvieh« behaupten? Kritisch wird es schon bei der Gruppe der festgefügten, unbeirrbaren Stamm- und Traditions- 38 wähler, deren Parteibindung aber seit ungefähr 1970 ständig abnimmt. So kann sich die CDU nicht mehr »der Katholiken«, die SPD nicht mehr »der Arbeiterschaft« sicher sein! „Ich bin der Vertreter der Arbeiterschaft!“, tat nach gewonnener Landtagswahl der designierte neue nordrheinwestfälische Ministerpräsident der CDU, Rüttgers, noch vor seiner Ernennung kund und wies mit diesem Satz darauf hin, dass die SPD die Landtagswahl deswegen verloren hatte, weil die Arbeiter und die Arbeitslosen sich überproportional von ihrer Stammpartei losgesagt und die CDU gewählt hatten. Rheinischer Merkur 15.03.02 CDU/CSU / Zuwanderung, Biopolitik - die Distanz zu den Kirchen wächst Entfremdung auf Raten Neuere Positionen zeigen: Die Union entwickelt sich zu einer liberal-konservativen Partei. Das "C" spielt immer seltener eine echte Rolle. Autor: MATTHIAS GIERTH Das Verhältnis zwischen den Unionsparteien und den Kirchen ist seit längerem gespannt. Misstöne gab es in der Zuwanderungsdebatte. Und mit der Bundestagsentscheidung über den Stammzellimport, den vor allem Parlamentarier von CDU und CSU als Zünglein an der Waage ermöglichten, haben die Differenzen einen neuen Höhepunkt erreicht. Rottenburg-Stuttgarts Bischof Gebhard Fürst drohte, christliche Wähler würden die Haltung der Union in der Biopolitik nicht vergessen. Kölns Kardinal Joachim Meisner sprach vom "C" als "Etikettenschwindel". Die Union antwortete ihrerseits deutlich: Die Erwartungen der Kirchen, so Friedrich Merz im Bundestag, seien "vielleicht aus dem Lehramt heraus" artikulierbar. In den politischen Abwägungen könne dies "nicht ohne weiteres im Verhältnis 1:1" nachvollzogen werden. Tatsächlich ist es nicht Aufgabe einer Partei - auch nicht der "C"-Parteien -, kirchliche Positionen ohne Abstriche umzusetzen. CDU und CSU sind keine christlichen Parteien, wie es keine christliche Politik per se gibt. Nicht zufällig mahnt das Zweite Vatikanische Konzil, dass es "in Fragen der Ordnung irdischer Dinge" auch unter Christen "berechtigte Meinungsverschiedenheiten" geben kann. Pluralität in der Zuwanderungsdebatte ist deshalb vom christlichen Standpunkt aus ebenso unproblematisch wie etwa in Fragen der Ausgestaltung des Sozialstaats. Doch gilt dies auch für die Bioethikdiskussion? Man wird dies verneinen müssen. Denn es geht hier nicht - im Sinne einer Sachhierarchie um eine Randfrage, die so oder anders beantwortet werden könnte. Es geht um den Kern des Christlichen: den Menschen selbst, sein Leben, seine Würde. Letztere ist nach christlicher Ethik nicht diskutierbar. Deshalb verpflichtet das Attribut "christlich", muss sich eine von Tradition und kirchlicher Lehrmeinung - Katholiken und Protestanten liegen hier auf gleicher Linie - abweichende Haltung tatsächlich den Vorwurf des Etikettenschwindels gefallen lassen. Die Zuwanderung ist ein »altes« Wahlkampfthema, dass schon im Bundestagswahlkampf 2002 eingesetzt werden sollte, dann aber von der Elbe-Flut und dem Irak-Krieg aus der Prioritätenliste der Wähler verdrängt worden war. Damals stand in der taz ein Kommentar, von dem das heute noch Gültige lautete: TAZ 02.03.02 Kommentar Die Union setzt auf Zuwanderung Gestern hat der Bundestagswahlkampf begonnen. Wir wissen noch nicht viel über die Taktik der Kontrahenten, aber eins ist klar: Es wird um Zuwanderung und Ausländer gehen. Diese Frage ist entschieden, die Union will es so. ... ... wir werden einen Ausländerwahlkampf erleben. Wenn es das Gesetz gibt, wird die Union weiter dagegen polemisieren, wenn es scheitert, wird Stoiber sich als Garant gegen solchen Unfug inszenieren. ... Dem rot-grünen Zuwanderungsgesetz kann man viel vorwerfen - dass es ein Dekret von oben ist, gewiss nicht. Im Gegenteil: Es ist ein Kompromiss. Das weiß auch die Union. 39 ... Die Fronten sind vermischter als 1999. Kirchen, Gewerkschaften und Unternehmer stützen Rot-Grün, die Union hingegen ist ziemlich allein zu Hause. ... Ein Ausländerwahlkampf braucht klare, suggestive Fronten: Hier sind wir, Beschützer der Deutschen, dort die Weltverbesserer, die uns fremde Habenichtse auf den Hals hetzen. Kein Missverständnis: Ein Ausländerwahlkampf ist immer eine üble, ressentimentvergiftete Veranstaltung. ... STEFAN REINECKE Stammwähler - Wechselwähler Die bei einem immer noch großen Teil der Wähler auch selbst durch hanebüchene Skandale (historische Beispiele z.B. Barschel-Affäre, Parteispenden-Affären) oft nicht zu erschütternde Parteifixierung der Stamm- und Traditionswählergruppe scheint gegen ihre Mündigkeit zu sprechen. Wegen der zahlenmäßigen Bedeutung dieser jeweiligen parteieigenen Gruppierung - die Zahlen divergieren allerdings: teilweise nehmen Parteienforscher von den Wählern einer Partei (u.a. je nach dem »Ideologisierungsgrad« der Mitglieder einer Partei verschieden) nur noch 10-11 % als »Kern-Stammwähler«12 und eine ungefähr gleichgroße Zahl als »Rand-Stammwähler« an - gilt bei jeder Partei die grundsätzliche Maxime: "Wir dürfen unsere Stammwähler nicht verprellen!" oder: "Stammkundschaft geht vor Laufkundschaft!" Darum sind die hauptsächlichen, meist plakativ-inhaltsleeren Wahlkampfaussagen – z. B. 1976: „Freiheit statt Sozialismus“ (CDU) als Beispiel von angsterregend gedachter „negative campagning“ - auf die »Stammkundschaft« zugeschnitten. Sie sollen der Mobilisierung der Stammwähler dienen, sie an die Wahlurnen treiben. Aber mit der Stammkundschaft einer Partei allein lässt sich heutzutage grundsätzlich keine bleibende Mehrheit mehr erringen. Dafür ist die jeweilige parteieigene Stammkundschaft, an der Gesamtzahl aller Wahlberechtigten gemessen, zu sehr abgeschmolzen. Das war in der Zeit der großen gesellschaftlichen Konfrontationen (insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Zeit des »Kalten Krieges« und nach dem Beitritt der ostdeutschen Länder zum Alt-Bundesgebiet) anders, als Parteien einzelne Wahlkreise mit extrem hohen Zweitstimmenanteilen gewannen – in oder über Bayern gab es z.B. den Spruch: „Hier wird selbst ein Gartenzaun ins Parlament gewählt, wenn er nur schwarz gestrichen ist.“, und über SPD-Arbeiterhochburgen im Ruhrpott wurde in gleicher Weise gelästert - und sich - als Spiegelbild des Wahlerfolges anderer Parteien - in anderen Wahlkreisen mit extrem niedrigen Werten vernichtend geschlagen geben mussten. Hier die Wahlkreis-Extremwerte für die im Bundestag vertretenen Parteien und die PDS (Höchstwert / niedrigster Wert): CDU/CSU 82,0 % 1949 in Biberach / 9,2 % 1949 in Uelzen; SPD 68,7 % 1972 in Duisburg I / 7,4 % 1949 in Biberach; FDP 40,3 % 1949 in Waiblingen / 0,9 % 1957 in Vechta-Cloppenburg; Bündnis 90/Die Grünen 26,0 % 1998 in Berlin-KreuzbergSchöneberg / 0,8 % 1980 in Ingolstadt; PDS 37,8 % 1994 in Berlin-Lichtenhain-Friedrichsberg / 0,1 % 1990 in Deggendorf. Da die »Geographie der Macht« Deutschland auch nach der Bundestagswahl 2002 als ziemlich klar zweigeteiltes Land auswies – CDU/CSU-naher katholischer Westen und Süden, SPD-naher 12 Die entsprechenden Bevölkerungsgruppen, aus denen sich die Stammwähler vorzugsweise rekrutierten, schmelzen zusammen: Zwischen 1961-95 verringerte sich der Anteil der Arbeiter an allen Erwerbspersonen in dieser klassischen „Kerntruppe“ der SPD-Stammwähler, die zu zwei Dritteln SPD wählten und immer noch wählen, von 50 auf 35 %. Die Gruppe der regelmäßigen katholischen Gottesdienstbesucher, von denen drei Viertel Stammwähler der Unionsparteien sind, verringerte sich von früher 60 % auf nunmehr höchstens 30 %; in absoluten Zahlen: von ca. 12 auf ca. 5 Millionen. So schmilzt zwangsläufig der Prozentsatz dieser Stammwählergruppen einer Partei an der Gesamtwählerschaft. Und es wandelt sich, bewirkt durch eine Abnahme des prozentualen Anteils der Arbeiterschaft an der Bevölkerung und eine entsprechende Zunahme der Angestellten und Beamten in einer sich tendenziell verstärkt entwickelnden Dienstleistungsgesellschaft, der „Wählercharakter“ der Parteien.. Am Beispiel der SPD aufgezeigt: Der Anteil der Arbeiter an ihrer Wählerschaft sank um die Hälfte, der Anteil der Angestellten und Beamten stieg auf das Dreifache. Das Ergebnis ist ein Wähler, für den aus der Sozialisation des Elternhauses überlieferte langfristige Grundorientierungen eine immer geringere Rolle spielen. (Vgl. Hartenstein, W.: Fünf Jahrzehnte Wahlen in der Bundesrepublik: Stabilität und Wandel in: Aus Politik und Zeitgeschichte 24.05.02 S. 39 ff) 40 evangelischer oder konfessionsloser Norden und Osten - hier die entsprechenden Parteiwerte auf der Ebene einzelner Bundesländer: CDU/CSU 60,0 % 1976 in Bayern / 16,9 % 1949 in Bremen; SPD 58,1 % 1972 in Bremen / 18,2 % 1990 in Sachsen; FDP 28,1 % 1949 in Hessen / 2,2 % 1998 in Mecklenburg-Vorpommern; PDS 23,6 % 1998 in Mecklenburg-Vorpommern / 0,2 % 1990 im Saarland; Bündnis 90/Die Grünen 16,2 % 2002 in Hamburg / 1,1 % 1980 im Saarland. Inzwischen geht die Marschrichtung von der »zweigeteilten Republik« in die »schwarze Republik«. Das Wählerverhalten hat sich seit den Anfängen der Bundesrepublik aber sehr gewandelt: Stamm- und Traditionswähler haben nicht mehr den wahlentscheidenden Stellenwert! Heutzutage weiß man, dass letztlich die Laufkundschaft, dass die Wechselwähler der »Mitte« eine Wahl entscheiden! Die Wähler werden in immer größerem Maße Wechselwähler – u.a. deswegen, weil sich die Parteien in ihren programmatischen Wahlaussagen immer mehr angeglichen haben und so der Persönlichkeitsfaktor des Kanzlerkandidaten verstärkt zum Tragen kommt: Bei der Bundestagswahl 1998 wechselten 10,8 % der Wähler von den von dem Kanzler Kohl geführten Unionsparteien zur SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Schröder, der im Fernsehen wesentlich besser »rüber gekommen« war und später als „Medienkanzler“ bezeichnet wurde. Dass die Wähler in zunehmendem Maße zu Wechselwählern werden, dass der Wähler wählerisch wird, ist gut so, denn dann müssen die Parteien sich mehr um die wirklichen Bedürfnisse der Wähler mühen, auf deren frühere kritiklose Loyalität sie sich immer weniger verlassen können. Hinzu kommt, dass eine jede Demokratie vom Machtwechsel lebt, zu dem es nur durch informierte Wechselwähler kommt. Sie sind das Salz im wohlmundenden(!) Eintopf der Demokratie. Vor 30 Jahren waren maximal 10 % der Wähler Wechselwähler, heute sind es ca. 35 %, wobei die Parteibindung im wirtschaftlich verunsicherten oder enttäuschten Osten am geringsten ist, die Wähler dort schneller als in einem anderen Teil der Bundesrepublik einen Parteiwechsel vollziehen. So muss die Stammkundschaft zwar mobilisiert werden, um den immer größer werdenden Anteil der Laufkundschaft jedoch muss mit ganzem Einsatz gekämpft werden! Der Nachteil sich nicht informierender, vagabundierender »bauchwählender Wechselwähler« ist die Tendenz zur Oberflächlichkeit in der Politik: „Wie im Theater nicht das Stück und der Text für mehr oder weniger Beifall sorgen, sondern die Darstellung durch die Schauspieler und die Qualität der Inszenierung, so entscheiden auch auf der politischen Bühne gelungene Auftritte und die Tagesform über den Erfolg. Wenn Politik auf diese Weise präsentiert wird, nimmt es nicht wunder, wenn sich die Zuschauer häufiger von einem Akteur ab- und einem anderen zuwenden.“13 Doch was ist ein Wechselwähler genau? Es scheint ein scheues Tier zu sein, das den meisten Lexika und Nachschlagewerken irgendwo zwischen „Wechseljahre“, „Wechselstrom“, „wechselwarm“ und „Wechselwild“ verloren geht. Genau definiert wird der Wechselwähler meistens nicht. „Wähler, der nicht jedes Mal die gleiche Partei wählt.“, heißt es in einem Wörterbuch. Er ist auf jeden Fall ein Unzufriedener – wobei sich die Unzufriedenheit nicht auf politische Inhalte beziehen muss: Heino wählt aus Ärger Heino (66), Volksmusiker mit Sonnenbrille, will aus persönlichen Gründen bei der nächsten Bundestagswahl für Angela Merkel stimmen. „Im Grunde bin ich Sozialdemokrat. Aber die haben mir immer das Bundesverdienstkreuz verweigert, dann tut es denen auch nicht weh, wenn ich jetzt mal die CDU wähle.“ Allgäuer Zeitung 28.07.05, nach einem Interview von Heino in der Illustrierten „Max“. Vielleicht tröstet es Heino, der mit seiner schönen Stimme als Gabe der Natur durch den Verkauf von 50 Mill. Schallplatten Millionen verdiente, ohne dabei etwas für unsere De13 Vgl. Hartenstein, W.: Fünf Jahrzehnte Wahlen in der Bundesrepublik: Stabilität und Wandel in: Aus Politik und Zeitgeschichte 24.05.02, S. 41 41 mokratie geleistet zu haben, dass der Autor bisher auch kein Bundesverdienstkreuz erhalten hat, als er im Auftrag des Hamburger Landesamtes für Verfassungsschutz seinen Lehrerberuf und seine Beamtung auf Lebenszeit aufgab und sich dem Hamburger Staat und der Bundesrepublik Deutschland - unter jahrelangem Gehaltsverzicht und Verzicht auf Rentenanwartschaften - zur Verhinderung eines zweiten Falles Guillaume zum Schutz des Bundeskanzlers Schmidt 7 ½ Jahre als Doppelagent zur Verfügung stellte, ein juristisches Zweitstudium unternahm – und anschließend weitere 7 ½ Jahre vor parlamentarischen Gremien und unterschiedlichen Gerichtszweigen durch oft mehrere Instanzen um seine bürgerliche Existenzgrundlage kämpfen und klagen musste, weil ihm der Hamburger Staat – trotz (ungewöhnlicherweise) zweimaliger(!) diesbezüglicher Aufforderung des Petitionsausschusses der Hamburger Bürgerschaft – seine vor Aufnahme der Agententätigkeit als conditio sine qua non versprochene Wiedereinstellung als Lehrer verweigerte!!! Im Gegensatz zu Heino, der Millionen verdiente, hat der Autor für unsere Demokratie Freiheit (Gefahr der Enttarnung und jahrelanger Gefangenschaft in Bautzen), Gesundheit (die DDR-Gefängnisse hatten nicht den Ruf von Sanatorien) und Eigentum eingesetzt und teilweise aufgeopfert (freiwilliger Gehaltsverzicht für die Dauer der Doppelagententätigkeit, erzwungener Gehaltsverzicht für die Jahre des Kampfes um Wiederanstellung nach Beendigung der Doppelagententätigkeit und permanenter zukünftiger Vermögensschaden, weil bei der Berechnung der Altersversorgung die 15 Jahre fehlen!). (SPIEGEL 39/85, S. 103 ff: „Würdest du auch eine Bonner Sekretärin heiraten?“) In aller Bescheidenheit mein persönliches Fazit: Wenn einer von uns beiden – Heino oder ich - für seine durch viele und jahrelange Entbehrungen selbstlos erbrachten Verdienste um unsere Demokratie ein Bundesverdienstkreuz verdient hat, dann eher ich. Aber vielleicht sieht Heino das ja anders. Jedenfalls scheint er noch daran zu arbeiten, diese seine Seele annagende Lücke zu füllen, denn er stellte sich in einem Interview mit der Zeitung mit den schreiend großen Lettern ungefragt der Politik als Bundestagsbeauftragter für deutsches Volksliedgut zur Verfügung: "Selbstverständlich stünde ich als überparteilicher Parlamentsbeauftragter für das deutsche Volkslied zur Verfügung", sagte der 66-Jährige dem Boulevardblatt. Wie bescheiden: »Bundeskultusminister« muss es nicht sein. Und noch eine Bemerkung an Heino, die ich ihm leider nicht auf seine wegen Neugestaltung außer Funktion gesetzte Website schreiben konnte: Es gibt politischere, politisch angemessenere Gründe, Wechselwähler zu werden! Gemeinhin versteht man unter Wechselwählern nur diejenigen Wähler, die bei zwei aufeinander folgenden gleichrangigen Wahlen für das Bundes- oder das Landesparlament ihre Stimme/n einer anderen Partei als bei der Wahl zuvor geben. Aber diese Definition erklärt den Begriff nicht ausreichend. Denn es gibt auch andere Wechselwähler: Wähler, die teilweise innerhalb desselben Wahljahres ihre Wahlentscheidung nach der zu wählenden Körperschaft unterschiedlich fällen und sie dann über mehrere Wahlperioden bis zur Erreichung des angestrebten politischen Ziels beibehalten, was der üblichen Definition des Wechselwählers aber gerade widerspricht. So wählte ich bei der Wahl zur Hamburger Bürgerschaft fast die letzten 20 Jahre lang nach meiner früheren SPD-Mitgliedschaft die CDU, viele Male aber bei der fast zeitgleichen Wahl zum Deutschen Bundestag zunächst die SPD, dann die Grünen. Ich behielt diese Wahlentscheidungen über mehrere Wahlperioden bei, weil ich in Hamburg nach mehr als 30 Jahren SPD-Regierung und im Bund nach zu vielen Jahren CDU-Regierung unter Kohl sowohl auf Landes- wie auf Bundesebene unbedingt den politischen Wechsel wollte: in Hamburg wollte ich den „roten Filz“ beendet wissen und im Bund die langjährige restaurative CDUHerrschaft unter Kohl mit ihrem als drückend empfundenen Reformstau, damit die wahren Probleme der Zukunftssicherung unserer Gesellschaft endlich angepackt werden. Solche über mehrere Wahlperioden in ihrer Stimmabgabe auf ein bestimmtes aber unterschiedliches politisches Ziel hin orientierte Wähler, die auf verschiedenen politischen Ebenen so lange ihre Stimme der gleichen, aber nach der unterschiedlichen politischen Ebene verschiedenen Parteien geben, bis sie ihr Ziel 42 erreicht haben, definiere ich als „langfristig fixierte“ Wechselwähler, denn auch sie handeln nicht nach dem Credo jedes Stammwählers: „Right or wrong: My party“ als politische Grundüberzeugungstäter auf allen politischen Ebenen. Teilweise entscheiden sich Wechselwähler erst am Wahltag für eine bestimmte Partei. Die Halbwertzeiten der Parteibindung werden immer kürzer; besonders im bindungsverunsicherten und wirtschaftlich enttäuschten Osten Deutschlands. Und gerade solche die Wahlen entscheidenden Wechselwähler lassen sich von einer argumentationsarmen Materialschlacht an Straßenbäumen am wenigsten beeinflussen! Durch das »Zupflastern« der Straßenbäume und der Laternenpfähle mit einfallsloser Wahlwerbung - "eine ritualisierte Form gesellschaftlicher Verschwendung" (Enzensberger) -, durch solche sinnleeren Plakataktionen werden aber nicht die eine Wahl entscheidenden Wechselwähler beeinflusst, sondern nur die Hunde bei der Verrichtung eines ihrer Grundbedürfnisse irritiert; einen anderen Effekt hat dieser »Fall-out« durch den mittels Scheinkommunikationsinkontinenz in Gang gesetzten »Plakat-Overkill« nicht mehr! Durch inhaltsleere Plakatparolen kann keine Mobilisierung von Wählermassen erreicht werden. 2002 konnte man als jeweils einzige Information auf großen Plakaten lesen: „Zeit für Taten CDU“. Da fragte man sich bei dem einige Jahre zuvor wegen seines Kampfes gegen das »KruzifixUrteil« des BVerfGs bundesweit als äußerst undemokratisch aufgefallenen Kanzlerkandidaten aus der CSU, der mit Schaum vor dem Mund seine Bayern (zunächst) zum Widerstand gegen das in letzter und höchster Instanz ergangene Urteil aufgerufen hatte: Zeit für welche Taten? Kruzifixe nun bundesweit in jedes Klassenzimmer? In u.a. Berlin war diese inhaltsleere Parole dann auch von politischen Gegnern mit zwei zusätzlich angebrachten weißen Zetteln abgeändert worden auf: „16 Jahre Zeit für Taten gehabt CDU“. „Wir sorgen für Bewegung FDP“. Etwa mit einer unter der Schuhsohle des Parteivorsitzenden angebrachten „18“, die der kleinkindhaft-albern in die Fernsehkameras reckte? Oder Steuersätze runter: für Millionäre auf Krankenschwestern- und Facharbeiter-Niveau, ohne die geringer Verdienenden in gleichem(!) Umfang zu entlasten? Und wenn man schon dachte, es ginge nicht mehr blöder, fand sich ein Werbeplakat für die Partei von Bundeskanzler Schröder: „Wir in Deutschland SPD“. Zugegeben: Inhaltlich richtig. Aber welch eine grandiose informative und motivierende politische Aussage! So etwas ist Scheinkommunikationsinkontinenz pur! Für laue Parteimitglieder ohne Ambition zu oft schlafzehrender nächtelanger inhaltlicher Mitarbeit in Parteigremien ist solcher Schwachsinn zum Austreten aus den Parteien, damit eine solche politische Inhaltslosigkeit nicht auch noch von den eigenen Mitgliedsbeiträgen finanziert wird! Und da wundern sich die Parteien über den allerorten anzutreffenden und bejammerten Mitgliederschwund14 von ca. 500.000(?) Mitgliedern in den letzten eineinhalb Jahrzehnten! So können Parteien nicht attraktiv sein. Eine Mobilisierung insbesondere der die Wahl entscheidenden Wechselwähler erreicht man eher durch inhaltliche und inhaltsreiche Erwähnungen und Informationen in Rundfunk und Presse, insbesondere aber in unserer „Fernsehdemokratie“ durch inhaltsreiche(!) Fernsehpräsenz oberhalb des Big-Brother-Niveaus und durch informierende Berichterstattung in diesem Medium. Gefragt, wie man Wahlen gewinne, antwortete Bundeskanzler Schröder einmal in seiner gewohnt humorvoll-schnoddrigen Art: „BILD, BILD am Sonntag und Glotze!“ Das wichtigste Medium ist das Fernsehen und darum ist es ausschlaggebend wichtig, welches Image die Medien, und 14 Von 1990 (Rechenschaftsberichte der Parteien) bis 2004 (www.wikipedia.de und WELT 21.12.04) entwickelten sich die Mitgliederzahlen der einzelnen im Bundestag (PDS: fast immer) vertretenen Parteien mit folgenden Werten: SPD (949.600) 606.474, CDU (777.800 ) 584.000, CSU (186.000) 173.700, FDP (168.200) 64.560, PDS (200.000) 65.753, Grüne (39.900) 44.000. Für Mitte 2005 wurden kurz vor dem Wahlkampf in Zeitungen (u.a. SZ 10.06.05) für einige Parteien, die eine Chance haben, in den 16. Deutschen Bundestag einziehen zu können, folgende Mitgliederzahlen angegeben: SPD 605.000, CDU 574.526, CSU 173.000, FDP 64.150, PDS 60.000, Bündnis 90/Die Grünen 44.250, DVU 15.000, WASG 6.500, NPD 5.300. 43 da insbesondere das Fernsehen, von den Kandidaten transportieren. Der Zuschauerzuspruch zu dem Fernseh-Rededuell zwischen den beiden Spitzenkandidaten 2002 war so groß, dass die Privatsender die Werbeblöcke vor und nach der Diskussion für € 64.000 pro Werbeminute verkaufen konnten! In den Stäben beider Parteien betreiben Dutzende von Mitarbeitern Konkurrenzbeobachtung. Kein Schritt des Gegners bleibt unbemerkt, kein Interview, keine Talkshow, kein Werbespot, kein Foto. Erhält ein Kandidat z.B. in den Nachrichten mehr Fernsehzeit, die mit der Stoppuhr kontrolliert wird, gibt es gleich großes Protestgeschrei. Wechselwähler können nur durch wirkungsvoll dargebotene inhaltsreiche Medienpräsenz überzeugt und zu einer bestimmten Stimmabgabe veranlasst werden, nicht aber durch Klamauk! Nichtwähler Es gibt aus dem Jahr 1994 eine Tabelle der Motive von Nichtwählern für ihre Wahlverweigerung, die wohl noch immer Gültigkeit beanspruchen kann (Ursula Feist: Nichtwähler 1994 in: Aus Politik und Zeitgeschichte 23.12.1994, S. 44/45) Kommentiert wurde der an der nachstehenden Tabelle abzulesende Befund mit der Feststellung: Gewichtet man die Motive der Nichtwähler von 1994, wird deutlich: Wahlenthaltung ist mehr und mehr eine bewusste und wohlüberlegte Entscheidung, nicht bloß Resultat von politischer Apathie und Desinteresse. Neben politischer Unzufriedenheit und aktuellem Protest signalisiere Wahlverweigerung auch wachsende Skepsis gegenüber der Wahl als dem wesentlichen Instrument repräsentativ-demokratischer und konventioneller Partizipation in ihrer Funktion der Interessenvermittlung zwischen unten und oben. Als Gründe für die Nichtteilnahme an der Wahl wurden folgende Motive (in %) genannt: West Ost Kein Interesse mehr an der Politik 38 25 Zu wenig vertrauenswürdige und sachkundige Politiker 35 33 Mangelnder Einfluss auf die Politik bzw. die Politiker 34 31 Protest gegen schlechte Politik 32 32 Zustand der Parteien; Parteien gefallen nicht mehr 25 21 Zu viele Wahltermine, zu viele Wahlen 12 13 Überdruss an politischer Berichterstattung in den Medien (Fernsehen, Radio, Zeitungen, Zeitschriften) 6 8 Keine Angabe 20 24 Der aus Unzufriedenheit über mangelnde Einflussmöglichkeiten gewachsenen politischen Lethargie und Apathie ein wenig abzuhelfen und dem aktuellem Protest einen gangbaren Weg zu ebnen, ist das im November 2004 online gegangene Internetprojekt Campact (www.campact.de ) als gemeinnütziger Verein geschaffen worden. Durch "Komplexitätsreduktion" schwer zu durchdringender politischer Vorgänge sollen Bürger informiert und aktiviert werden, die wenig Zeit haben, indem in "5-Minuten-Infos" schnell zugängliche Informationen über politisch relevante Themen angeboten, konkrete Forderungen aufgestellt und wirksame Protest-Instrumente geschaffen werden, die u.a. darin bestehen, dass Mails mit vorgefertigtem oder auch mit eigenem Text an Wahlkreisabgeordnete geschickt werden können; wie ich das persönlich und sehr mühselig selbst zusammengestellt und insbesondere in der Frage der EU-Mitgliedschaft der Türkei mit allen Bundes- 44 tags- und Europaparlamentsabgeordneten selbst exerziert habe. Aber wenn man so ein Projekt alleine unternimmt, wird man kaum zur Kenntnis genommen: Es hilft nur die große Zahl potentieller Wähler! Campact will – wie auch Lobbycontrol (siehe Unterpunkt Lobbyismus) - zu einer politisierten Bürgergesellschaft beitragen und so der politischen Passivität im Lande Beine machen. Die Zeiten, da man als »guter Staatsbürger« ganz fraglos zur Wahl ging, scheinen vorbei zu sein. Die Zahl der Wähler nimmt kontinuierlich ab, die Zahl der Nichtwähler wächst von Wahl zu Wahl; am auffälligsten ist diese Entwicklung bei Kommunal- und Europawahlen zu beobachten: Da gilt schon fast der auf Wahlen abgewandelte Spruch „Stell’ dir vor, es ist Wahl – und keiner geht hin!“ Bei manchen Wahlen ist der Anteil der Nichtwähler an der Gesamtwählerschaft größer als der Anteil, den die beiden großen Volksparteien SPD und CDU/CSU zusammen erreichen! Wahlen degenerieren so zu Misstrauensvoten. Zum Glück hat dieser Trend noch nicht auf Bundestagswahlen durchgeschlagen. Die werden von der Mehrzahl der Wähler – noch? – als zu wichtig angesehen. Wahlverweigerung darf aber nicht bloß monokausal als politisches Desinteresse grundsätzlicher Nichtwähler interpretiert werden, die kein Interesse (mehr) am politischen Geschehen hätten: sie kann auch eine Form des noch »sanften« Protestes der durch das oft fruchtlose »Parteiengezänk«, mit dem Problemlösungen verhindert werden und dem politischen Gegner daran die Schuld in die Schuhe zu schieben versucht wird, der durch den oft nicht mehr nachvollziehbaren Parteienhader Enttäuschten sein. Wahlverweigerung ist aber auch als ein klares Signal bekennender Nichtwähler möglich, die mit »ihrer« (bisherigen) Partei äußerst unzufrieden sind und sie durch Wahlenthaltung abstrafen wollen – bevor sie zum politischen Gegner oder gar zu den Radikalen »abzudriften« drohen, oder diese tatsächlich wählen, wie es der Bauernverband in Schleswig-Holstein einmal mit der CDU gemacht hatte und die Bauern mehrheitlich der Verbandsempfehlung gefolgt waren und statt der rechten abstrafend eine rechtsextreme Partei gewählt hatten; wie es auch vermutlich zwei CDU-Abgeordnete im sächsischen Landtag bei der Wahl »ihres« Ministerpräsidenten 2004 gemacht haben: der CDU-Spitzenkandidat sollte für das Wahldebakel von 16 % Stimmenverlust abgestraft werden, weil er die seit der Wiedervereinigung bestehende absolute Mehrheit verloren hatte, Sozialdemokraten mit ins Boot holen und dafür zwei Ministerposten an die SPD abgeben musste. Und dafür der absolute politische Tabu-Bruch, dass zwei Abgeordnete(!) einer demokratischen Partei ihre Stimme dem Gegenkandidaten von der NPD gaben, einer Partei, deren sich selbst als „nationalrevolutionär“ bezeichnender Vorsitzender Voigt u.a. gesagt hat: „Das Holocaust-Denkmal in Berlin ist aus gutem Beton, der hält Jahrhunderte und eignet sich darum vorzüglich als Fundament für einen Neubau der Reichskanzlei!“, der im Zusammenschlagen von „Linken“ im schleswig-holsteinischen Landtagswahlkampf 2005 nicht mehr als eine „Abwehrmaßnahme“ zu sehen vermochte. (Die Gewaltbereitschaft vieler NPD-Mitglieder und großer Teile ihrer Anhängerschaft bis hin zu den Skinheads könnte zu einem Knackpunkt für die politische Zusammenarbeit mit der dreimal so mitgliederstarken und stärker an unser politisches System angepassten DVU werden, die sich nicht so gerne in die Ecke der Saalschläger gestellt sehen möchte wie NPDler, für die es – wie zur Zeit des „Kampfes für die Bewegung“ während des Aufbaus der NSDAP15 – zum Ehrenkodex zu gehören scheint, mindestens eine Verurteilung wegen eines Gewaltdeliktes vorweisen zu können.) Die Wähler und sogar die gewählten Abgeordneten wählten mit ihren Stimmen für NPD, DVU oder REPs den Protest, nicht aber Kompetenz, denn Lösungen für unsere schwierigen gesellschaftlichen Probleme haben die Rechtsextremisten außer ihrem militant-provokativen „Ausländer raus!“ 15 "Ich habe in meiner Arbeit für die N.S.D.A.P. mehr als dreißigmal vor Gericht gestanden und bin achtmal wegen Körperverletzung, Widerstandsleistung und ähnlicher für einen Nazi selbstverständlicher Delikte vorbestraft. An der Abzahlung der Geldstrafen trage ich heute noch und habe zudem noch weitere Verfahren laufen. Ich bin ferner mindestens zwanzigmal mehr oder weniger schwer verletzt worden. Ich trage Messerstiche am Hinterkopf, an der linken Schulter, an der Unterlippe und am rechten Oberarm. Ich habe ferner noch nie einen Pfennig Parteigeld beansprucht oder bekommen, habe aber auf Kosten meines mir von meinem Vater hinterlassenen guten Geschäfts meine Zeit unserer Bewegung geopfert. Ich stehe heute vor dem wirtschaftlichen Ruin.“ Zitiert nach Focke, H./ Hohlbein, H.: Stationen auf dem Weg zur Macht Hamburg 2. Aufl. 1983 S. 56 45 und einem "weißen Europa der Vaterländer" nicht anzubieten! Sie gerieren sich in "soldatischer Männlichkeit" mit ihrem Drei-Säulen-Konzept "Schlacht um die Köpfe, um die Straße und die Wähler" als "Heimatschutzpartei". Der stellvertretende Bundesvorsitzende und Fraktionschef der NPD im Sächsischen Landtag Apfel nach der Wahl zum Sächsischen Landtag: „Uns hat gewählt, wer noch Deutscher bleiben will.“; aber Millionen Menschen – u.a. auch ich - sehen keine Veranlassung oder gar Notwendigkeit, ihre Staatsbürgerschaft zu wechseln und würden trotzdem nie NPD wählen! Apfel und sein Fraktionskollege Gansel vertraten im Sächsischen Landtag am 60. Jahrestag der Bombardierung Dresdens 2005 die Ansicht: " Der Bomben-Holocaust von Dresden steht ursächlich weder im Zusammenhang mit dem 1. September 1939 noch mit dem 30. Januar 1933. ... Mit dem heutigen Tag haben wir auch in diesem Parlament den politischen Kampf gegen die Schuldknechtschaft des deutschen Volkes und für die historische Wahrhaftigkeit aufgenommen." Hoffentlich müssen wir solche historisch falschen Hetzreden nicht in ein paar Monaten im Deutschen Bundestag hören! Denn natürlich steht die – militärisch vermutlich nicht zwingend notwendig gewesene - Bombardierung Dresdens in ursächlichem Zusammenhang damit, dass die Nazis zur Umsetzung und Verbreitung ihrer Rassenideologie nach geheimer Aufrüstung 1939 den Zweiten Weltkrieg mutwillig vom Zaun gebrochen haben. Schon 1923/24 und damit 15 Jahre vor dem von ihm befohlenen Beginn des Zweiten Weltkrieges hatte Hitler nach dem Putsch in München vom 8./9.11.1923 während seiner Inhaftierung und der Festungshaft in Landsberg in seiner ab 1925 erschienenen politischen Propaganda-, Rechtfertigungs- und Programmschrift „Mein Kampf“ als Ziel seiner Politik formuliert: „Die Außenpolitik des völkischen Staates hat die Existenz der durch den Staat zusammengefassten Rasse auf diesem Planeten sicherzustellen, indem sie zwischen der Zahl und dem Wachstum des Volkes einerseits und der Größe und Güte des Bodens andererseits [auf Kosten der Nachbarvölker durch Krieg zur Gewinnung von „Lebensraum“ im Osten; der Verf.] ein gesundes natürliche Verhältnis schafft.“ Nicht die Alliierten haben im tiefsten Frieden Dresden überfallen, sondern die Deutschen haben das mit dem getürkten Überfall auf den Sender Gleiwitz als vorgeschobenem angeblichem Rechtfertigungsgrund und dem anschließenden Beschuss der Westernplatte gemacht. Die Alliierten haben sich gewehrt und die mordende Pest des Nationalsozialismus bekämpft, als ihnen der Kampf durch den Überfall Deutschlands auf Polen aufgezwungen worden war. Apfel hingegen bezeichnete die Alliierten in seiner Rede im Sächsischen Landtag am 13.02.2005 als „Massenmörder“ und nannte den 8. Mai 1945 den "Tag der vermeintlichen Befreiung Deutschlands". 7 Monate später sollen solche Äußerungen im Deutschen Bundestag möglich werden, weil nicht genügend Wahlberechtigte zur Wahl gehen und deswegen den Rechtsextremen der Sprung über die 5-%-Hürde unverantwortlich erleichtert wird? Die NPD sieht sich als durchaus militante Gesinnungsgemeinschaft, als "nationaler Widerstand" für ein "neues Deutschland", drängt wieder einmal in den Deutschen Bundestag und könnten dieses Mal durch die Bündelung der rechtsextremen Kräfte Erfolg damit haben! Ein als ehemaliger(?) Rädelsführer der inzwischen verbotenen Schlägertruppe „Skinheads Sächsische Schweiz“ (SSS) wegen schweren Landfriedensbruchs, Bildung einer kriminellen Vereinigung, gefährlicher Körperverletzung und Nötigung durch u.a. Training seiner Gefolgsleute für Übergriffe auf Einzelpersonen und die Erstürmung von Gebäuden, systematische Computererfassung der erkorenen politischen Feinde und maskierte brutale Überfälle mit einer Bewährungsstrafe zu zwei Jahren Haft verurteiltes NPD-Mitglied – Kommentar zu dem Urteil: „Meine Freunde und ich haben nur unsere Freizeit nach den eigenen Vorstellungen gestaltet!“ -, ein verurteiltes NPD-Mitglied, das mit seinem Schlägertrupp auf NPD-Veranstaltungen als Saalschutz tätig war und sich in der Öffentlichkeit nicht so zurückhaltend äußern muss, wie es die Parteiführung aus taktischen Gründen für angeraten erachtet, zum STERN (27.01.05): „Die rechte Bewegung steht generell für eine andere Gesellschaftsform. Deshalb bringen auch Gespräche mit anderen demokratischen Institutionen nichts. Es wird nie einen Konsens geben. Wenn man nationaler Sozialist ist, dann ist die Gesinnung schlicht nicht zu vereinen mit der Demokratie. Ich kenne viele NPDler seit Jahren, auch höhere wie den [Abgeordneten des Sächsischen Landtags und Geschäftsführer der NPD-Fraktion; der Verf.] Leichsenring. Die sind nicht weichgespült. Die denken genau wie ich. Wir wollen ein anderes Land.“ Die Rechtsextremisten – man beachte, dass sie sich gerne als „nationale Sozialisten“ bezeichnen, mehr ist aus strafrechtlichen Gründen nicht opportun - sammeln die politisch 46 Verdrossenen um sich, die meist wegen mangelhafter Bildung keine großen Zukunftshoffnungen haben können – und es nicht in einen „Fernseh-Container“ geschafft haben. Im vor rund zwei Wochen vereinbarten "Deutschland-Pakt" legten NPD und DVU eine langfristige Kooperation fest. Der Vereinbarung zufolge kandidiert die NDP zur Bundestagswahl 2006. Dabei sollen auch 15 Kandidaten, die der DVU angehören oder ihr nahestehen, aufgestellt werden. Die DVU kandidiert dagegen bei der Europawahl 2009 - mit sechs oder sieben NPD-Vertretern. Für die kommenden Landtagswahlen vereinbarten beide Parteien folgendes: Die NPD kandidiert am 20. Februar für den Urnengang in Schleswig-Holstein und am 22. Mai in Nordrhein-Westfalen. Die DVU tritt in Sachsen-Anhalt (Frühjahr 2006), Bremen (Frühjahr 2007), Hamburg (Frühjahr 2008), Thüringen (Frühjahr 2009) und in Brandenburg (Herbst 2009) an. Bei allen anderen Landtagswahlen bis Ende 2009 wird die DVU auf eine Kandidatur verzichten, wenn sich die NPD den Wählern stellt. Bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Berlin und Thüringen sowie bei der Wahl in einem weiteren bislang noch nicht genannten Bundesland soll die jeweils kandidierende Partei auch Vertreter des rechtsgerichteten Bündnispartners auf ihrer Liste zulassen. Durch das Bündnis mit der DVU will NPD-Chef Udo Voigt seine "Volksfront von rechts" schmieden. Was ist das Ziel der Kooperation von DVU und NPD? Mit ihrer Zusammenarbeit wollen NPD und DVU das rechtsextreme Wählerpotential besser ausschöpfen. Experten sehen es bundesweit bei zehn bis 15 Prozent der Wahlberechtigten. In Sachsen erreichte die NPD aus dem Stand 9,2 Prozent der Wählerstimmen. Es gibt auch Gedankenspiele, daß NPD und DVU eine neue Partei gründen. Hierfür müßten in allen Bundesländern jeweils 2000 Unterschriften gesammelt werden. Die Buchstabenkombinationen DVU und NPD dürften im Parteinamen nicht vorkommen. Die Republikaner stehen noch abseits. Deren langjähriger Chef Franz Schönhuber wurde von der NPD als medien- und europapolitischer Berater gewonnen. Klappt 2006 der Einzug in den Bundestag, so hofft Voigt, solle Schönhuber Alterspräsident des Parlaments werden. DIE WELT 01.02.05 Die Rechtsextremisten wollen also „ein anderes Land“: Und was wollen wir Demokraten? Diese Demokratiefeinde aus an politische Verantwortungslosigkeit grenzender persönlicher Lethargie heraus durch bloße Wahlenthaltung stärken? Die Pest des Nationalsozialismus hat sich schon einmal als Leben verschlingender Moloch europaweit ausgebreitet. Nach dessen Niederringung durch eine globale Kraftanstrengung waren ca. 6 Millionen Menschen in Vernichtungslagern und anderweitig umgebracht worden, hatten ca. 50 Millionen Menschen im von den Nazis angezettelten Zweiten Weltkrieg ihr Leben lassen müssen, waren Millionen andere auf der ganzen Welt vertrieben worden und hatte Deutschland mit den Ostgebieten von der Oder-Neiße-Linie „bis an die Memel“ mehr als ein Viertel seines Staatsgebietes verloren! Schon allein dieses eine Mal war einmal zuviel für die Welt und für unser Vaterland gewesen. Darum dürfen wir den wiedergängerischen braunen Untoten keine politischen Mandate übertragen werden! Nichtwähler müssten sich klar machen: Laue Demokraten machen engagierte Demokratiegegner stark! Durch ihre Stimmenthaltung wählen Wahlverweigerer indirekt Radikale, die eine nach dem Prinzip von Führerbefehl und Parteigenossen-Gehorsam verfasste »andere Republik« anstreben und dafür unsere freiheitliche Lebensordnung beschneiden und ihnen Unliebsame nach ihrem nicht nur verbal »niederstiefelnden« Marschtritt ausrichten wollen! Das machen sich »laue« Demokraten und schon relativ Demokratieferne aber leider nicht klar, denn sonst dürfte es keine demokratieorientierten Nichtwähler geben und sie müssten – und wenn vielleicht auch mit zusammengebissenen Zähnen, bis die Selbstachtung es verbietet - eine demokratische Partei wählen. Weil sich Nichtwähler den hinter ihrer Wahlverweigerung stehenden Funktionszusammenhang zu 47 Gunsten der Radikalen aber meist nicht klar machen, hier der hoffentlich überzeugende rechnerische Beweis: Je mehr die Wahlbeteiligung sinkt, desto größer wird der prozentuale(!) Anteil der absolut gesehen relativ gleichgroß bleibenden Anzahl von Wählern radikaler Parteien an der Gesamtheit der effektiven Wähler: Wenn von 1.000 Wählern (nur) 40 links- und (nur) 40 rechtsradikal wählen, dann haben wir ein leichtes, aber durchaus handhabbares gesellschaftliches Problem. Beide radikalen Gruppierungen hätten dann ja nur je 4 % der Wählerstimmen auf sich vereint und dürften nach unserem Wahlrecht mit seiner 5-%-Hürde nicht in unser Bundesparlament einziehen. Damit keine Illusionen entstehen: das rechtsradikale Potenzial ist leider wesentlich größer als die zur Verdeutlichung des Gedankenganges der Notwendigkeit der Teilnahme an der Wahl gegriffene Zahl von „nur“ 4 %! Bei der Landtagswahl 1998 im für Lehr- und Beschäftigungsverhältnisse ziemlich perspektivlosen Sachsen-Anhalt hatten schon beängstigende 30,3% der 18-29-jährigen jungen Männer die außer „Ausländer raus!“ programmlose rechtsradikale DVU gewählt! Bei der Landtagswahl 2004 waren es in Sachsen 18 % der 18 bis 29 Jahre alten jungen Männer, die ihre Stimme der NPD gegeben hatten. Die rechtsextremen Parteien werden von den eher bildungsfernen „Modernisierungsverlierern“ gewählt, die das dumpfe Gefühl haben, immer benachteiligt zu sein und die es auch sind, weil sie von klein auf ihre Zeit lieber in Fernsehkonsum der untersten Niveauklasse und in das Hören von dröhnendem Rechts-Rock (von Neofolk über Deutschrock und dumpfen Hatecore bis NS-Black-Metal mit Texten gegen Demokratie und Ausländer) investier(t)en, als in meist nur durch kontinuierlich harte Arbeit zu erwerbende Bildung. Leider ist es nicht so, dass alle Wahlberechtigten ihr Wahlrecht wahrnehmen: Es gibt leider einen großen (und zumindest bei Landtagswahlen wachsenden) Prozentsatz von Nichtwählern. Der speist sich aber kaum aus dem Reservoir der Radikalen: Die gehen auf jeden Fall als Überzeugungstäter stramm oder sehr rot oder sehr alternativ zur Wahl - je nachdem, welcher radikalen Ausrichtung sie anhängen! Bei (teilweise mehr als) 20 % Nichtwählern, wie es bei uns bei Bundestagswahlen der Fall ist, würden in diesem rechnerischen Beispiel dann »nur« 800 Wähler von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Von bloß 800 abgegebenen Stimmen machen die je 40 für eine rechts- und eine linksradikale Partei votierenden Radikalen jedoch jeweils schon 5 % der abgegebenen Stimmen aus! Da die Sitzvergabe immer nach dem erreichten Prozentsatz der abgegebenen Stimmen vorgenommen und nicht an dem Prozentsatz aller an sich Wahlberechtigten gemessen wird, hätte jede dieser radikalen Parteien die 5-%-Hürde allein schon wegen der Wahlträgheit der Nichtwähler überwunden! Bei einer ob ihrer Gleichgültigkeit wegen dieser verheerenden Auswirkung für einen Demokraten schon langsam beängstigend geringen Wahlbeteiligung von nur 60 % und sogar darunter, wie sie immer mehr bei Wahlen für Landesparlamente üblich zu werden scheint, erringen radikale »4-%-Parteien« nur auf Grund dieses lahmarschigen »Nichtwähler-Sponsoring« fast 7 % der Parlamentssitze! Damit wären unter Zugrundelegung dieses Zahlenbeispiels die Radikalen jeder Coleur nur auf Grund der Trägheit der Nichtwähler im Parlament vertreten! Jeder Nichtwähler muss sich darüber klar sein: Wer nicht wählen geht, wählt gleichwohl - indirekt - linke und rechte Radikale! Auf Grund dieses zwingenden mathematischen Zusammenhanges riefen bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland 2004 wegen des u.a. auch durch die Wahlträgheit der Bürger befürchteten (und dann auch tatsächlich mitverursachten) Erstarkens der Rechtsradikalen die Bischöfe beider Großkirchen aus Sorge um unsere Demokratie - ohne Wahlempfehlung für eine christliche Partei - dazu auf, das Wahlrecht wahrzunehmen und wählen zu gehen. In der 15. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages erstarkten die Rechtsradikalen 2004 bei Landtagswahlen in Ostdeutschland (Stimmen für die NPD in Reinhardtsdorf-Schöna 23,1 %, in Hohnstein 18,3 %, in Rathmannsdorf 17,9 %). Das schuf Appetit auf mehr, so dass sich die Rechtsradikalen für die Bundestagswahl 2006 zu Wahlbündnissen oder verbundenen Listen zusammenschließen wollen, um im braunen Verbund die 5-%-Hürde zu überwinden; ein Erfolgsre- 48 zept, das die Linken von PDS und WASG nachahmten. Und wer begeht den demokratischen Tabubruch und wählt solche Rechtsextremisten? NPD-Wähler Jung, männlich, mäßige Bildung Die NPD rekrutiert ihre Wähler keineswegs nur aus dem Heer der Arbeitslosen. Der Prototyp des sächsischen NPD-Wählers ist jung, männlich und eher gering gebildet, wie FOCUS berichtet. Arbeitslose und Arbeiter halten sich mit 16 und 17 Prozent die Waage. Die meisten Wähler hatte die NPD bei der Landtagswahl in Sachsen im September 2004 mit 18 Prozent in der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen. Ältere Wähler orientieren sich in Sachsen zunehmend um, der Anteil der NPD-Wähler schrumpft drastisch: In der Altersgruppe 30 bis 44 Jahre wählen zwölf Prozent die NPD, 45 bis 59 Jahre neun Prozent, über 60 Jahre nur noch drei Prozent. Hauptsächlich Realschüler Abitur oder einen Hochschulabschluss haben nur vier Prozent der Wähler, 15 Prozent haben die Realschule, sieben Prozent die Hauptschule besucht. Der Anteil der männlichen Wähler war mit elf Prozent um vier Prozent höher als der Anteil der weiblichen Wähler. Verlierertypen ohne Perspektive „Es sind Modernisierungsverlierer ohne Perspektive und mit dem Gefühl, immer benachteiligt zu werden", definiert Extremismusforscher Uwe Backes vom Dresdner Hannah-Arendt-Institut. Dieser Pessimismus sei vor allem im Osten anzutreffen. „Die NPD nutzt das aus und gibt sich sozial statt national", so Backes. Für sechs Prozent aller Ostdeutschen ist die NPD laut einer Umfrage des Leipziger Instituts für Marktforschung eine „bürgernahe, ehrliche Partei, die den etablierten Parteien Dampf macht“. „Keine Chance im Bundestag“ „Im Bund kommen die nie über fünf Prozent", prophezeit der Chemnitzer Politikwissenschaftler Eckhard Jesse und verweist auf die neuesten Umfragen, denen zufolge die Rechten in der Wählergunst stagnieren. „Probleme bleiben ungelöst“ „Am Ende wird sich die NPD selbst zerfleischen, weil sie am Spagat zwischen sozialer Fassade und Nazi-Ideologie scheitert.“ Auch Soziologe Bacher bezweifelt den dauerhaften Erfolg, da die rechten Parteien nicht in der Lage seien, Probleme zu lösen. NPD-Wähler Rubach sieht das nicht anders: „Die kümmert sich genauso wenig um Arbeitsplätze wie die CDU.“ (Focus 14.02.05) Weil es die Extremisten stärkt, ist die - in der BRD mögliche - Wahlverweigerung ein zwar demokratisches Recht, das aber die Demokratie schwächt! Dieses Wissen ist schon zweieinhalb Jahrtausende alt: „In unserem Staate halten wir den, der an der Politik keinen Anteil nimmt, nicht für einen friedfertigen, sondern für einen unnützen Menschen.“ Perikles, Athener Staatsmann 499-429 v.Chr. Diese Überlegung spricht für eine Wahlpflicht, wie sie in manchen Ländern, in Europa z.B. in Belgien, Luxemburg, Griechenland, der Türkei und Zypern, besteht! Eine Wahlpflicht ist vom Prinzip her nicht undemokratisch - denn es besteht ja nicht die Pflicht zur Wahl der Regierungspartei -, entspricht aber nicht dem freiheitlichen Staatsbürgerbild des Grundgesetzes, das auch die Freiheit des Fernbleibens vom Wahlgang16, die Wahlenthaltung, gewährt. Darum schwankte die Wahlbetei16 Das in der Bundesrepublik keine Wahlpflicht besteht, kann auch in anderem Zusammenhang wichtig sein: So hatte z.B. das BVerwG als Revisionsgericht 1997 die rechtliche Gleichstellung der Zeugen Jehovas mit den beiden Großkirchen - entgegen den Entscheidungen der beiden Unterinstanzen VG und OVG Berlin - abgelehnt. Die Ablehnung der von den Zeugen angestrebten (und letztlich 2005 jedenfalls in Berlin durchgesetzten) Anerkennung ihrer kirchli- 49 ligung bei bisherigen Bundestagswahlen zwischen maximal 91,1 % 1972 im gesamten Bundesgebiet (Extremwert nach oben in einem Bundesland: 92,9 % 1976 im Saarland) und minimal 77,8 % 1990 (Extremwert nach unten in einem Bundesland: 64,7 % 1949 in dem damals noch eigenständigen Württemberg-Hohenzollern). Ohne bestehende Wahlpflicht muss jedoch jedem uninteressierten Wahlbürger auf dem Überzeugungsweg klar gemacht werden: „Wer einer Wahl fern bleibt, der wählt indirekt trotzdem, denn er stärkt so den prozentualen Anteil der Radikalen!“ Dieses Grundwissen zu vermitteln und seinen Schülern einzubläuen: „Es ist mir völlig egal, welche demokratische Partei ihr später einmal wählen werdet, aber geht auf jeden Fall zur Wahl und nehmt euer Wahlrecht wahr, damit der Prozentsatz der Radikalen an den abgegebenen Stimmen möglichst niedrig gehalten wird, denn die „braunen und die roten Nazis“ haben Deutschland, jeweils auf ihre Art, ins Unglück getrieben!“, sollte das Grundanliegen eines jeden Politiklehrers sein, wenn er über Wahlen unterrichtet. Aber vielleicht hilft das in irgend einer Form zustande kommende neue Linksbündnis, die Rechtsradikalen aus dem Bundestag fernzuhalten und die Linksradikalen der Kommunistischen Plattform der PDS zurückzudrängen. (Vergleichen Sie den auf Seite 186 f. wiedergegebenen Artikel des Stellvertretenden Chefredakteurs des STERN Hans-Ulrich Jörges: „Das Fenster der Linken“.) Seit der Bundestagswahl 2002 kann es keine Ausrede mehr sein, wenn bekennende Nichtwähler – um sich zu entschuldigen - klagten: „Ich weiß aber nicht, was ich wählen soll, und ich kann mich doch nicht durch mehrere Kilo Partei- und Parteiwahlprogramme durcharbeiten! Da halte ich es für besser, gar nicht zu wählen.“ Der Frau und dem Mann konnte durch zahlreiche Internetangebote wie z.B. www.ich machepolitik.de des Bundesministeriums für Familie, Frauen, Senioren und Jugend, durch „www.mitmischen.de“ des Deutschen Bundestages und sehr schön durch das Internet-Highlight „www.wahl-o-mat.de“ geholfen werden. Nach niederländischem Vorbild des „Instituut voor Publiek en Politik“ in Amsterdam von 1987 hatte die unter Garantie politisch geschmacksneutrale „Bundeszentrale für Politische Bildung“ unter Mithilfe Berliner Politikstudenten 2002 das erste Mal eine Wahlentscheidungshilfe erarbeitet und als Wahl-O-Mat ins Internet gestellt: Die Politikstudenten hatten 70 Fragen zu wichtigen Politikfeldern zusammengestellt und diesen Fragenkatalog den im Bundestag vertretenen Parteien mit der Bitte um Beantwortung zugeschickt. Die authentischen, autorisierten(!) Antworten der Parteien auf diese Fragen wurden auf ihre „Trennschärfe“ hin untersucht. Es blieben 27 Antworten übrig, an denen Differenzen unter den Parteien deutlich wurden. chen Organisation als Körperschaft des öffentlichen Rechts wurde dabei interessanterweise vom BVerwG mit deren mangelnder Loyalität zum Staat begründet Und die wurde nicht nur darin gesehen, dass die Zeugen Jehovas den Staat als „Werkzeug des Satans“ ansehen und darum elementare Grundrechte und Grundpflichten ablehnen. Es werde den Mitgliedern nicht nur der Wehr- oder Zivildienst verboten – worin sie sich nicht von den angesehenen Quäkern unterscheiden –, sondern jede politische Betätigung untersagt. Ausdrücklich hob das BVerwG in seiner Entscheidung außerdem die für ihre Sektenmitglieder verbindliche Weigerung der Zeugen Jehovas hervor, an Wahlen teilzunehmen. Das sei ein „verfassungsrechtlich nicht hinnehmbarer Widerspruch zum Demokratieprinzip“. Damit fehle den Sektenmitgliedern die „unerlässliche Loyalität zum Staat“. Ende 2000 war dieser Rechtsstreit dann beim BVerfG gelandet. Und das schrieb dem BVerwG als Weihnachtsgeschenk ins Stammbuch: Zwar können nur „rechtstreue“ Religionsgemeinschaften den grundsätzlichen Anspruch auf Anerkennung des angestrebten Status‘ erheben. Dazu gehöre die Beachtung der fundamentalen Verfassungsprinzipien, aber eine über die Grundsätze der Verfassung hinausgehende „Staatsloyalität“ dürfe von den Zeugen Jehovas nicht eingefordert werden. Das religiöse Verbot, an staatlichen Wahlen teilzunehmen, sei, da keine Wahlpflicht bestehe, nicht aus sich heraus demokratiefeindlich, denn eine solche Entscheidung treffe jeder Nichtwähler; vor allen Dingen stehe hinter dieser Entscheidung kein demokratiefeindliches anderes Staatsverständnis und Staatskonzept. Ein solches Verhalten einer gewissen Staatsferne sei durch die Religionsfreiheit gedeckt. Gern gesehene und vom BVerwG wenigstens indirekt eingeforderte Wahlbeteiligung steht nicht über der grundgesetzlich geschützten Religionsfreiheit! Wie gut, dass das BVerfG den anderen Obergerichten des Bundes Nachhilfeunterricht in der wertenden Auslegung unserer Grundrechte erteilt – wenn es dabei nicht selber irrt. 50 Diese herausgefilterten 27 Fragen wurden dem interessierten Internet-Nutzer einzeln nacheinander zur Beantwortung vorgelegt. Er konnte die aus der jeweiligen Frage ersichtliche politische Einstellung bejahen, verneinen, ihr bedingt zustimmen oder sich seiner Meinung hierzu enthalten. Nach der Einzelbeantwortung jeder Frage tat sich zum Schluss ein Fenster auf, in dem größere Politikfelder angegeben waren, und jeder ratsuchende Mitspieler konnte in diesem Fenster angeben, welche/r Bereich/e ihm besonders wichtig sei/en. (Dahinter stand wohl eine mathematische Gewichtung der zuvor gegebenen Antworten nach den eigenen Politikschwerpunkten.) Nach Drücken des Ergebnis-Knopfes wurden die Parteien in der Reihenfolge angegeben, in der die Einstellung des Ratsuchenden mit den authentischen autorisierten Antworten der einzelnen Parteien übereinstimmte: Um seine vielfältigen politischen Vorstellungen optimal zur Geltung gebracht zu wissen, müsste man dann »nur« die zuerst angegebene Partei mit dem größten Grad der Übereinstimmung wählen! Und hat sich so das Durchackern der Wahlprogramme – was eh keiner macht – erspart. Für die Bundestagswahl 2005 war diese Internet-Entscheidungshilfe erneut zur Verfügung gestellt worden; allerdings waren die Fragen dieses Mal durch die Befragung von 17 Jungwählern entworfen worden! Das kam natürlich in der Prioritätenliste der vorgeschlagenen Politikfelder zum Ausdruck, aus denen die nach den Antworten der Generalsekretäre von SPD, CDU/CSU, den Grünen, FDP und der Linkspartei.PDS 30 trennscharfe Thesen herausgefiltert worden waren. Durch eine die Stimmabgabe zu einzelnen Thesen verdoppelnde Gewichtung konnten Schwerpunkte gebildet werden. Das Ergebnis zeigt differenziert die Nähe zu den von den genannten Parteien inhaltlich vertretenen Positionen; ohne Rücksicht auf die Person des jeweiligen Spitzenkandidaten! Die Kür im Politik-Unterricht liefern die Schüler, denen vorgegeben wird: „Beantwortet bitte – ohne zuvor die Ergebnisse eures eigenen Tests mit den Antworten der Parteien abgeglichen zu haben alle vorgegebenen Fragen einmal so, als wenn ihr der Partei X zutendiert. Wir wollen einmal sehen, wer es schafft, dass nach so gezielter Beantwortung der Fragen bei der Ergebnisdarstellung wirklich die Partei X als Partei mit der größten Übereinstimmung ausgewiesen sein wird.“ Und die Hohe Schule hat geschafft, wer je nach Wunsch durch Beantwortung der Fragen im Sinne der Parteiziele jede Partei an die erste Stelle rücken lassen kann, denn dazu muss er ja sehr gut darüber Bescheid wissen, was jede Partei anstrebt, was sie mehr oder minder verwirklichen will. Dann ist er ein wirklich gut informierter Staatsbürger! Und wir Politiklehrer haben gute Arbeit geleistet und unser Ziel erreicht. Nichtwähler wählen nicht nur indirekt Radikale, sie schaden auch eindeutig ihren eigenen Interessen: Wegen der 2002 mit teilweise mehr als 12 % wesentlich geringeren Wahlbeteiligung der Wähler in Ostdeutschland bei der Bundestagswahl 2002 (Wahlbeteiligung in Bayern 81,5 %, in Sachsen-Anhalt 68,8 % und damit dort ein Rückgang um 8,3 %) haben die Ostdeutschen insgesamt zehn mögliche »ostdeutsche« Parlamentssitze bei der Verteilung der einer bestimmten Partei zustehenden Sitze verloren und nur 58 von durchaus möglichen 68 ostdeutschen errungen, denn die Verteilung der Sitze im Bundestagsplenum - zur Ermittlung der einer Partei im Parlament insgesamt zustehenden Anzahl von Sitzen nach einer gar nicht existierenden, nur rechnerisch fiktiv angenommenen »Bundesliste« als Ergebnis einer gedanklichen Listenverbindung aller Landeslisten einer Partei - auf die einzelnen Landeslisten einer Partei zur Ermittlung der konkret aus einem bestimmten Bundesland in den Bundestag einziehenden Abgeordneten wird ebenfalls - wie die Errechnung der Anzahl der Gesamtsitze – parteiintern nach dem Hare-Niemeyer-System auf Grund des prozentualen Anteils der in den einzelnen Ländern errungenen Wählerstimmen vorgenommen; und der war in den westdeutschen Ländern halt beträchtlich höher, so dass 2002 mehr westdeutsche Politiker in den Bundestag eingezogen sind, als es bei gleich hoher Wahlbeteiligung in den östlichen Bundesländern der Fall gewesen wäre. Konsequenz: »Die Ostdeutschen« sind nach der Wahl 2002 eindeutig nur durch die Trägheit ihrer wahlunlustigen Landsleute im Parlament regional unterrepräsentiert. Erkenntnis: Wer nicht (ausreichend) wählt, ist auch nicht bestmöglich vertreten und kann darum seine Interessen nicht bestmöglich zur Geltung bringen! Montagsdemos auf den Straßen ostdeutscher Städte sind kein Ersatz für an sich zu leistende qualifizierte Interessenswahrnehmung im Parlament. Hoffentlich eintretender Lerneffekt und Abhilfe: Wählen gehen! 51 Und manchmal kann es auf wirklich jede Stimme ankommen: 1998 gewann im Wahlkreis Neustrelitz/Strasburg/Pasewinkel der Kandidat der SPD diesen Wahlkreissitz mit nur 13(!) Stimmen Vorsprung vor seinem Mitbewerber von der CDU. Anderes, wichtigeres Beispiel: Die Präsidentenwahl in den USA, die George W. Bush jun. 2000 an die Macht brachte, wurde durch ein Plus von 366 Stimmen in New Mexico und 537 der mehr als dubios verrechneten Stimmen in Florida entschieden, nachdem ein Wahlcomputer 14.000 Stimmen für den Gegenkandidaten Al Gore gelöscht hatte; Tausende unterprivilegierte Afro-Amerikaner, die mehrheitlich die Demokraten wählen, waren ohne jeden Grund oder teilweise mit der (falschen) Begründung, die Wahlzettel seien ausgegangen(!!!) oder das Wahllokal sei geschlossen, von der Wahl ausgeschlossen worden oder ihre Namen waren auf Listen von in manchen Staaten nicht wahlberechtigten Straftätern gesetzt, ihnen waren von ihrer Wohnung weit entfernte Wahllokale zugewiesen worden – jede elfte afroamerikanische Stimme wurde so laut einer Untersuchung der New York Times nicht gewertet -, es waren bewusst missverständliche „ButterflyStimmzettel“ verwandt worden, die zu einer Fehlbuchung zu Ungunsten Al Gores verleiteten und schließlich war die Nachprüfung zehntausender Stimmzettel mit Hilfe des mehrheitlich konservativrepublikanischen Obersten Gerichts mit dem Argument verhindert worden, dass die in der amerikanischen Verfassung gesetzte Frist zur Ernennung der Wahlmänner unbedingt(?) eingehalten, darum die nachprüfende Auszählung abgebrochen werden müsse, und der zufällig gerade erreichte Stand als endgültig angenommen werden solle! (Und 6 Mill. Stimmabgaben, fast 3 % der Stimmen aus ganz Amerika sind, u.a. wegen der veralteten Lochkartenmaschinen in Florida, mit denen die individuelle Stimmabgabe der Wähler kenntlich gemacht werden sollte, verschwunden. So gewannen der Republikaner George W. Bush die Wahl mit einem manipulierten Vorsprung von 903 Stimmen – und die USA überfielen den Irak!) Fristwahrung vor Richtigkeit und damit vor Gerechtigkeit: ein nach unserem Verständnis juristisch unhaltbares Ergebnis, aber der Supreme Court hat – unverständlicherweise und für uns nicht nachvollziehbar - so entschieden! Bei der Wahl 2004 tauchten ebenfalls eine Reihe von Ungereimtheiten auf, die sich wieder zugunsten Bushs ausgewirkt haben sollen. So gab es in einigen Wahlbezirken eine Wahlbeteiligung bis zu 136(!) %. In Ohio z.B., dem Schlüsselstaat des Jahres 2004, wurde nachträglich festgestellt, dass sowohl abgegebene Stimmen doppelt gezählt worden waren, wie auch, dass Wähler zweimal abgestimmt hatten. Solche himmelschreiend skandalösen Vorkommnisse sind bei uns aufgrund des sehr genauen, bundeseinheitlich geltenden Bundeswahlgesetzes und seiner zweifelsfrei kontrollierenden Handhabung nicht möglich; Gott sei Dank! Das Recht ist die Hoffnung der Schwachen – aber Hoffnungen können bitter enttäuscht werden, insbesondere dann, wenn die zur Zähmung der Starken oder sonst Übermächtigen erlassenen (Wahl-)Gesetze nicht greifen! Parteienfinanzierung / Wahlkampfkosten Es ist die unverzichtbare staatspolitische Aufgabe der Parteien, den Willen der Anhänger und Sympathisanten innerhalb der Bevölkerung zur Formulierung der dann von der Partei zu vertretenden Ziele zu verbalisieren, zu kanalisieren und dann innerhalb der Wahlbevölkerung hierfür um Zustimmung zu werben. Das geschieht hauptsächlich in Wahlkämpfen. Dafür müssen den Parteien ohne jeden Zweifel auch ausreichende finanzielle Mittel durch sowohl den Staat als auch private Geldgeber zur Verfügung gestellt werden, denn so ein Wahlkampf kostet richtig Geld. SPD rechnet mit 20 Millionen Wahlkampfkosten Hamburg - Wahlkämpfe kosten Geld. Dessen werden sich die Kassenwarte der Parteien bewußt sein: Knapp 27 Millionen Euro blätterte die SPD 2002 für ihren Wahlsieg hin. Für die CDU lag die Rechnung bei gut 21 Millionen (ohne CSU), und selbst die Grünen und die FDP ließen sich ihren Stimmenfang deutlich über zehn Millionen Euro kosten. Bei akutem Mitgliederschwund und fällig gewordenen Spendenrückzahlungen können solche Beträge selbst bei großen Parteien 52 nicht aus der Portokasse genommen werden. Doch zumindest bei SPD und CDU sieht man sich deshalb nicht gleich vor dem finanziellen Ruin. Die bevorstehenden Ausgaben kommen unverhofft, doch für Notfälle dieser Art sind Rücklagen verfügbar; und kurzfristige Wahlen haben auch Vorteile: Kosten für Plakatierer und Hallenmieten müssen nicht für ein Jahr, sondern nur für vier Monate veranschlagt werden. Die SPD kalkuliert vorsichtig mit 20 Millionen. Die CDU hält sich noch bedeckt, rechnet aber auch mit Einsparungen. Schwieriger wird es für die kleinen Parteien. Die PDS etwa, die nicht auf vergleichbare Ressourcen zurückgreifen kann, gerät in die Bedrouille. Nur ein Bruchteil der zuletzt fünf Millionen Euro werden aufzutreiben sein. hpbw HH A 25.05.05 „... In Berlin, wo sich die Wahlalternative zu einem Fünftel aus ehemaligen PDS-Mitgliedern zusammensetzt, bleiben die mitregierenden Linkssozialisten dabei, daß Mitglieder der WASG keine Aussichten auf die ersten sechs Listenplätze haben werden. Klar ist, daß nur die PDS in der Lage ist, einen flächendeckenden Bundestagswahlkampf zu finanzieren. Vier Millionen Euro hat sie dafür vorgesehen. Daraus speist sich auch ein eigenes Budget für die Spitzenkandidaten Gregor Gysi, Oskar Lafontaine, Lothar Bisky, Dagmar Enkelmann, Petra Pau und Gesine Lötzsch. Bei den Westlinken herrscht dagegen Personal- und Geldnot. Eine Million Euro werden für einen eigenständigen Wahlkampf veranschlagt, sollte ein Linksbündnis doch nicht zustande kommen. Vorständler Thomas Händel hat jedoch nach WELTInformationen im internen Kreis eingeräumt, daß die WASG lediglich über 180 000 Euro verfüge. 400 000 Euro glaubt er, von Spendern einwerben zu können. Den Rest müßte man sich von Banken leihen. Einzige Sicherheit dafür wäre die Rückerstattung einer Kostenpauschale für den Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen. Auf die hat Anspruch, wer mehr als ein Prozent der Stimmen geholt hat. Die WASG war aus dem Stand auf 2,2 Prozent gekommen. Das Geld wird allerdings erst im Frühjahr 2006 überwiesen.“ DIE WELT 29.06.05 Die Parteien versuchen, sich darüber auszuschweigen, was ihre eigene Partei an Mitteln einsetzt, teilweise belogen sie die Öffentlichkeit und den Bundestagspräsidenten nach besten Kräften und finanzierten Wahlkämpfe aus »schwarzen Kassen«. Bislang war das bis Anfang 2002 leider deswegen relativ folgenlos möglich, weil diese betrügerische Handlungsweise im Parteiengesetz nicht unter Kriminalstrafe gestellt war. Wenn der Schwindel aufflog, musste halt Strafgeld gezahlt werden. So wurden der in diesem Punkt besonders belasteten CDU für ihre »Durchstechereien« die staatlichen Mittel um viele Millionen gekürzt. Aber es mussten keine persönlichen Konsequenzen vor dem Strafrichter getragen werden. Nach den Änderungen des Parteiengesetzes zum 01.07.02 sind gemäß § 31 d Parteiengesetz hierfür nunmehr auch persönliche Konsequenzen bis hin zu 3 Jahren Gefängnis zu tragen. Die CDU wurde zweimal bei dem Einsatz »schwarzer Kassen« zur Beeinflussung der Wahlentscheidung gutgläubiger Wähler erwischt: Der vormalige Bundeskanzler Kohl hatte mehrere Mill. DM unerlaubt »schwarz« nach eigenem Gutdünken eingesetzt, und die hessische CDU hatte ebenfalls einen Finanzskandal, weil sie Geld aus »schwarzen Kassen« in der Schweiz als angebliche Vermächtnisse von Juden wieder in die Bundesrepublik zurückgeschummelt hatte. Der ehemalige CDU-Bundesinnenminister Kanther wurde als erster von der Neuregelung betroffener Politiker wegen seiner »kreativen« Handhabung der Finanzen der hessischen CDU als ihr Schatzmeister in der ersten Instanz zu einer auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzten Haftstrafe von eineinhalb Jahren und 25.000,- € Bewährungsauflage verurteilt. Die CSU stand ihrer großen Schwester kaum nach und hatte Ende 2001 ebenfalls einen ParteienFinanzskandal wegen unlauter erlangter Spenden über »Spenden-Abos« ihres wirtschaftlich selbständigen Parteiorgans „Bayernkurier“ durchzustehen, für die die Partei(!) – und nicht die wirtschaftlich selbständige Zeitung als angeblicher Spendenempfänger – Spendenquittungen ausstellte. Mit diesen angeblichen Spendenquittungen der CSU verschafften sich die Spender beim Finanzamt Steuervorteile durch Geltendmachung der Beträge in ihrer Steuererklärung. Und die CSU erschlich sich auf dem Weg der Parteienfinanzierung in Millionenhöhe den 50-prozentigen staatlichen Zuschuss auf die in den falschen Spendenquittungen aufgeführten Beträge! 53 2002 kochte ein Spendenskandal innerhalb lokaler Organisationen der rheinländischen SPD (»Kölner Klüngel«) hoch, der aber bei weitem nicht CDU-Ausmaße erreichte. Der kostete sofort Nominierungen für die Bundestagswahl, und Hauptsünder mussten - im Gegensatz zur CDU - die Partei verlassen, weil die SPD den Augiasstall schnell auszumisten suchte. Der ehemalige FDP-Landesvorsitzende von NRW hätte der FDP einen großen wirtschaftlichen Schaden zugefügt haben können, weil er 2002 einen Anti-Israel-Flyer mit Geld von einem angeblich verdeckt treuhänderisch gehaltenen Konto eines Geschäftspartners aus dem Emirat Dubai bezahlt haben will. (Eine vorherige Einlassung von ihm besagte dagegen, dass die Kosten aus dem Privatvermögen bezahlt worden seien. Weil diese gegenteilige Einlassung an Eides Statt abgegeben worden war, interessierte das natürlich den Staatsanwalt: § 156 StGB!) Bei einer verdeckten, in dem Rechenschaftsbericht der FDP nicht ausgewiesenen Spende müsste die BundesFDP den dreifachen Betrag der verdeckten Spende an die Bundestagsverwaltung abführen. Die diesbezüglichen Untersuchungen wurden dann eingestellt, als sich der verantwortliche Politiker und erfahrene Fallschirmspringer aus großer Höhe bewusst in den Tod gestürzt hatte, um nicht die Konsequenzen tragen und den damit verbundenen Ansehensverlust ertragen zu müssen. Andere Parteien hatten ihre Finanzskandale in anderen Legislaturperioden. Nach der seit dem 01.07.02 geltenden Änderung des Parteiengesetzes werden solche Durchstechereien nun mit strafrechtlichen Konsequenzen geahndet, die - wie schon erwähnt - gemäß § 31 d Parteiengesetz bis zu 3 Jahren Gefängnis reichen können. Wahlkampfkosten: Von dem CDU/CSU-Kandidaten Edmund Stoiber wurden für die damals anstehende »normale« Bundestagswahl 2002 - verkürzte Wahlkämpfe wie 2005 sind natürlich billiger! - an finanziellen Aufwendungen genannt: für die SPD DM 80 Mill., für die CDU 40 Mill. und die CSU 6 Mill. Diese Zahlen muss man nicht für bare Münze nehmen. Oft liegen die Aufwendungen um ein Beträchtliches höher. Die eigenen Sympathisanten sollen aber ob der aufgetischten Ungerechtigkeit hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Mittel das Weinen kriegen und tief in ihren Geldbeutel greifen! Mehrere hundert Mill. €, zumindest an letztlich erbrachten geldwerten Leistungen (wie z.B. dem Kleben der Plakate durch Parteimitglieder, Werbekampagnen-Entwurf durch befreundete Werbeagentur, ...), ist wohl kein zu hoch angesetzter Betrag für »normale« Wahlkämpfe. Die vorgezogene Bundestagswahl 2005 lässt solche Ausgaben nicht zu – und die Parteikassierer aller Parteien atmen wegen des relativ geringen finanziellen Aderlasses für den Kurzwahlkampf auf! Die Wahlkampfkassen Die Parlamentsparteien haben für ihre Neuwahlkampagnen etwas weniger Geld als bisher für Bundestagswahlkämpfe üblich. Das rührt vor allem daher, dass seit 2002 nur drei statt vier Jahre zur Verfügung standen, um die Kasse zu füllen. Der SPD-Vorstand hat am Montag ein Wahlkampfbudget von rund 25 Millionen Euro gebilligt (2002: 30 Millionen). Strittig war zuletzt vor allem, wie viel Geld neben den zentralen Werbekampagnen noch für die einzelnen Wahlkreise bereitgestellt wird (jetzt: je 8300 Euro, etwa zehn Prozent weniger als vor drei Jahren). In der CDU ist von "etwas weniger" Mitteln als 2002 die Rede, als 20 Millionen Euro für den Wahlkampf ausgegeben wurden. Auch die Unionsparteien liegen damit im Trend sinkender Kampagnenetats. Bei den Grünen ist von 3,8 Millionen, bei der FDP von 4,5 Millionen Euro die Rede. Die Massenkommunikation wird nicht zuletzt wegen der geschrumpften Etats ganz auf die letzten zwei bis drei Wochen konzentriert, wenn das Wahlvolk aus dem Urlaub zurück ist. FR 08.06.05 Der SPIEGEL (25.07. und 01.08.05) schätzte die Ausgaben für den Bundestagswahlkampf 2005 auf rund 60 Mill. Euro, wovon auf die CDU/CSU 23 Mill. € (und damit minus 3 Mill. € gegenüber 54 den Wahlkampfkosten von 2002), SPD 25 Mill. € (- 2 Mill. €) und die PDS ca. 4 Mill. Euro entfallen könnten. Die Welt publizierte am 24.08.05, dass die Parteien umdisponiert hätten: Der Bundestagswahlkampf 2005 solle nunmehr etwas über 60 Mill. € kosten, wobei auf die CDU 18 Mill. (-3 Mill. € gegen über 1998) entfielen, auf die CSU 5 Mill. (-1,3 Mill. €), SPD 27 Mill. € (+ 2Mill. €), Grüne 3,8 Mill. €, FDP 3,5 Mill. € und DIE LINKSPARTEI.PDS 4,250 Mill. €. Der diesjährige Wahlkampf wird im Vergleich zu normalen Wahlkämpfen ein besonders preiswerter sein. Die Parteien sparen Millionen dadurch, dass sie weniger Geld für Auftritte, Saalmieten, Politikerreisen und andere Spesen ausgeben müssen und die teuren, langfristig geplanten »Agenturwahlkämpfe« entfallen, weil man wegen der Kürze der Zeit mehr »aus der Lamenge« (verballhorntes Kunstwort aus dem Französischen „la main“ = „die Hand“ und damit gemeint »aus der hohlen Hand heraus«) handeln muss. (Nachweisbare) Herkunft des Geldes: Das Geld stammt überwiegend aus: - Mitgliedsbeiträgen der Parteimitglieder, wobei von Vater Staat für jeden eingenommenen Beitrags-Euro als Belohnung noch einmal € 0,38 draufgelegt werden; das ist gut für mitgliederstarke Parteien17 und machte von den im Bundestag vertretenen Parteien z.B. im Jahr der Bundestagswahl 1998 bei der SPD 52 % der Einnahmen aus, bei der CDU 40 %, den Grünen 38 %, der CSU 29 %, der FDP 21 % und der PDS 45 %. - je nach Partei unterschiedlich hohen und erheblichen (teilweise Zwangs-)Abgaben der Abgeordneten von ihren Diäten sowohl an ihre örtliche Parteiorganisationen als auch an ihre jeweilige - vom Steuerzahler mit 288.907 € monatlichem Grundbetrag plus 6.032 € pro einzelnen Abgeordnete/n - finanziell nicht kärglich ausgestattete Fraktion und teilweise auch an Projekte im Wahlkreis. Die PDS und die Grünen sind dabei besonders happig; letztere verlangen von ihren Mandatsträgern 19 % als »freiwillige Parteispende«: wer sich nicht dazu bereit findet, wird nicht wieder auf einer Landesliste nominiert. - Erstattung einer Wahlkampfkostenpauschale durch den Staat in Höhe von z. Zt. € 0,85 für die ersten 4 Millionen erhaltener Zweitstimmen und € 0,70 für jede weitere, wenn eine Partei bei der letzten Bundestags- und/oder Europawahl bundesweit mindestens 0,5 % der Zweitstimmen oder 10 % der Stimmen in einem Wahlkreis erzielt hat. Gezahlt wird nach dem Gleichbehandlungsgebot auch an die »politischen Schmuddelkinder« in der Parteienlandschaft, deren Ziel es ist, unseren Rechtsstaat abzuschaffen; es wird nicht differenziert nach genehmen staatstragenden und in mehr oder minder offener Konfrontation zur Demokratie stehende Parteien. Eine Wohlverhaltensklausel als Voraussetzung für Zahlungen würde die Tür wenigstens einen Spalt zu Manipulationsmöglichkeiten öffnen. Das will man nicht. Daher muss auch an die Feinde unserer Demokratie gezahlt werden. Die Wahlkampfkostenpauschale wird gezahlt, ohne dass ein Verwendungsnachweis über die tatsächlichen Ausgaben verlangt wird. Die Einnahmen hierfür aus staatlichen Mitteln betrugen bei der SPD im Jahre 1998 32 % der Einnahmen, bei der CDU 29 %, den Grünen 32 %, der CSU 27 %, der FDP 27 % und der PDS 32 %. - ordnungsgemäße(!) Spenden, wobei auch hier von Vater Staat auf jeden eingenommenen Spenden-Euro bis zu einem Spendenbetrag in Höhe von bisher € 3.300,- pro Jahr pro Spender als natürliche Person als Erfolgsprämie für eigene Bemühungen der Parteien um solche Spenden bislang noch einmal € 0,38 zugezahlt wurden; das wirkt sich bei Parteien mit starkem Spendenaufkommen günstig aus und ist damals als bewusster Ausgleich für die im Vergleich zur SPD mitgliedschwächeren Parteien so geregelt worden. 17 Für Mitte 2005 wurden kurz vor dem Wahlkampf in Zeitungen (u.a. SZ 10.06.05) für einige Parteien, die eine Chance haben, in den 16. Deutschen Bundestag einziehen zu können, folgende Mitgliederzahlen angegeben: SPD 605.000, CDU 574.526, CSU 173.000, FDP 64.150, PDS 60.000, Bündnis 90/Die Grünen 44.250, DVU 15.000, WASG 6.500, NPD 5.300. 55 Zur Klarstellung: Insbesondere nicht erlaubt ist die Finanzierung der Parteien a) weder durch verborgene Zahlungen wohlmeinender Dunkelmänner in die (offiziell gar nicht vorhandene) »schwarze Kasse« einer Partei oder durch bewusst und nur für die Öffentlichkeit »anonymisierte« Spenden mittels eines dazwischengeschalteten Notariats in eine Parteikasse - wie es Ende 2002 die wirtschaftsnahe italienische Regierung als Gesetzesvorlage ins italienische Parlament brachte -, denn das würde Abhängigkeiten schaffen und vermutlich auch politische Entscheidungsprozesse beeinflussen, b) noch durch Zahlungen einer parteinahen Stiftung oder der vom Steuerzahler mit 288.907 € monatlichem Grundbetrag plus 6.032 € pro einzelnen Abgeordnete/n finanziell nicht kärglich ausgestatteten Fraktion an ihre jeweilige Partei oder deren Untergliederungen, worin das BVerfG, als es diese Praxis unterband, eine unzulässige „Querfinanzierung“ zwischen Fraktion und Partei und eine Verwischung der Gründe für die staatliche Subventionierung der verschiedenen Zuwendungsempfänger gesehen hat: Das BVerfG will in der jeweiligen Finanzierung eine klare Grenzlinie gezogen und gewahrt wissen zwischen durch parteinahe Stiftungen wahrgenommener staatsbürgerlicher Bildung, von den Parlamentsfraktionen geleisteter Parlamentsarbeit und den von den Parteien geführten Wahlkämpfen. Dementsprechend wurde das Parteiengesetz geändert. Mit der pauschalen Wahlkampfkostenerstattung zusammen darf die Summe aller staatlichen Zuschüsse und Leistungen zu den Beitrags- und Spendeneinnahmen einer Partei aber nicht höher sein als die im gleichen Jahr von einer Partei erwirtschafteten Eigenerlöse! 50 % der Einnahmen einer jeden Partei müssen laut Urteil des BVerfG privat eingeworben werden, um so die Parteien zu zwingen, sich wählerorientiert zu verhalten – Grundsatz der Bürgernähe der Parteien - und die Parteien nach dem damit korrespondierenden Grundsatz der Staatsferne nicht zu abhängig von den Infusionen des Staates zu machen. Diese bis zu 50 % reichende staatliche Finanzierung der Parteien ist die relative Höchstgrenze der Alimentierung einer Partei durch staatliche Zahlungen. Die Parteien sollen den Staat aber nicht durch Beschluss im Bundestag nach Belieben durch aufgeblähte Parteiapparate ausplündern dürfen. Darum wurde durch Urteil des BVerfGs eine absolute Höchstgrenze für alle staatlichen Leistungen an alle Parteien zusammen festgelegt, die immer mal wieder inflationsmäßig angepasst wird; seit 2002 liegt sie bei € 133 Mio. Vom Grundsatz her ist es zu begrüßen, wenn private Geldgeber die Tätigkeit der Parteien durch Spenden unterstützen. Privatpersonen dürfen unterstützen, wen sie wollen. Bei großen finanzkräftigen Institutionen und Verbänden dagegen bekommen nicht staatsbürgerlich, sondern einseitig politisch motivierte Geldzuwendungen zumindest ein »Geschmäckle« und werden bedenklich, weil man sich Parteien durch hohe Zuwendungen gefügig machen kann! Wenn finanzstarke Verbände oder Institutionen Parteien einseitig unterstützen, kann sich das durchaus auf deren Handlungen auswirken! Darum hatte das BVerfG angeordnet, dass die Herkunft von Spenden in Höhe ab (bis 1986 und nach dem BVerfG-Urteil wieder ab 1994 geltend) DM 20.000 und nunmehr € 10.000,- in Rechenschaftsberichten an den Bundestagspräsidenten offenbart werden müsse. Diese Intention unseres obersten Gerichts kann aber unschwer dadurch umgangen werden, dass ein Spender seine Geldzuweisung/en entsprechend klein stückelt. Da werden den Parteien von Privatpersonen zugedachte Beträge auf mehrere Familienangehörige so aufgeteilt, dass die Einzelbeträge unterhalb der Publizitätsgrenze bleiben. Noch leichter ist es, wenn Firmenkonglomerate ihre Unterstützung einer bestimmten Partei verschleiern wollen: Sie weisen unterhalb der Publizitätspflicht liegende kleingestückelte Teilbeträge des zugedachten Betrages über Einzelbeträge von Tochterfirmen an. Das ist rechtlich zulässig, wenn Tochterfirmen als eigene Rechtspersönlichkeit rechtlich selbständig am Rechtsverkehr teilnehmen. 56 Von daher gesehen sind die veröffentlichten »Großspenden« ab nunmehr € 10.000,- realistisch betrachtet größere Spenden von Zuwendern, die das Licht der Öffentlichkeit nicht scheuen. Solche über der Publizitätsgrenze liegenden Großspenden fallen natürlich – wen wundert’s – sehr unterschiedlich aus. Der Bericht des Bundestagspräsidenten über die bei ihm eingereichten Rechenschaftsberichte der Parteien (Drucksache 14/7979 vom 10.01.02) wies für das Wahljahr 1998 u.a. folgende Anzahl publizitätspflichtiger Einzelspenden von mindestens DM 20.000,- aus: 1998 SPD Anzahl der Großspenden 56 Mittelwert/Spende in DM 43.832 CDU 122 103.652 CSU 37 74.067 Grüne 99 27.984 FDP 46 72.351 PDS 13 28.516 Für 1999, das Nach-Wahljahr, wurde laut derselben Drucksache ausgewiesen: SPD Anzahl der Großspenden 40 Mittelwert/Spende in DM 49.750 CDU 101 90.790 CSU 24 115.030 Grüne 103 30.083 FDP 33 43.881 PDS 25 29.647 Die von den mit staatlichen Zuschüssen bedachten Parteien beim Bundestagspräsidenten eingereichten und von ihm veröffentlichten Rechenschaftsberichte über die Parteifinanzen sollen der Intention nach wirklichkeitsgetreue Rechenschaftsberichte sein, sind aber – wie Skandale immer wieder deutlich machten – zum Teil nur (un-)schöne Volksmärchen. „Geld hat bestechende Eigenschaften“ (Werner Mitsch). Die finanziellen Einflüsse auf Politiker laufen unterhalb der Publizitätsgrenze und möglichst sehr diskret ab. Wellen schlug der Fall des in dieser Hinsicht besonders erfolgreichen Rüstungslobbyisten Hunzinger, der sich über mehrere ihm gehörende Firmen Politiker aus verschiedenen Parteien bis hinauf zu einem stellvertretenden Ministerpräsidenten eines Bundeslandes (Döring, FDP) und dem damaligen Bundesverteidigungsminister (Scharping, SPD) in finanzieller Gewogenheit bis Abhängigkeit hielt: Wohlfeile Umfragen, gut honorierte Gastvorträge, Spenden haarscharf unterhalb der Publizitätsgrenze, skandalträchtige Privatdarlehen, persönliche Gefälligkeiten an einzelne Politiker wie z.B. eine dem Ego schmeichelnde Professur für den Verteidigungsminister Scharping an einer Privat-Universität und teure Klamotten bei einem exquisiten Herrenausstatter, Werbung für ein schwer verkäufliches Buch des hessischen Ministerpräsidenten Koch kurz vor dessen Wahl in Hessen, Annoncen in Zeitungen und bei privaten Rundfunkstationen für bestimmte Politiker, Wahlkreisspenden an Rüstungspolitiker, ... . Der Gefälligkeiten und damit der Einflussnahmen sind viele! Und nicht jeder Politiker ist so souverän wie während der Französischen Revolution Graf Mirabeau als einer der Revolutionsführer mit seinem Wahlspruch: „Ich lass’ mich bezahlen, aber ich verkauf’ mich nicht.“, der die Revolutionsziele vertrat, sich aber vom französischen König aus dessen Privatschatulle bezahlen ließ, was dazu führte, dass nach Aufdeckung dieses Skandals von dem sich zu recht betrogen fühlenden Volk die Gebeine des zwischenzeitlich Verstorbenen aus dem Grab gekratzt und durch Paris geschleift wurden. Westerwelle bekam Geld von PR-Unternehmer Hunzinger Berlin - FDP-Chef Guido Westerwelle hat vom umstrittenen PR-Unternehmer Moritz Hunzinger zwischen 1995 und 1998 Zahlungen von knapp 30 000 Mark (rund 15 300 Euro) erhalten. Das berichtet das Magazin "Focus". Auf einer internen Liste, in der Hunzinger alle Schecks in diesem Zeitraum aufführte, stehe der damalige Generalsekretär der FDP drei Mal mit einer Gesamtsumme von 29 999,99 Mark, schreibt das Magazin. Ein Scheck habe mit 9999,99 Mark genau einen Pfennig unter der Grenze gelegen, ab der Abgeordnete Spenden für ihre politische Tätigkeit beim Bundestagspräsidenten melden müssen. Hunzinger sagte, Westerwelle habe sich 20- bis 30mal im Auftrag 57 seiner Firma mit Kunden getroffen. Ein FDP-Sprecher erklärte zu dem Bericht: "Alle Zuwendungen sind überprüft und nach Recht und Gesetz behandelt worden." Auf der Liste der Schecks von Hunzinger stehen nach dem Magazinbericht mehr als 20 Spitzenpolitiker. So soll CSU-Landesgruppenchef Michael Glos im Februar 1997 von Hunzinger 14.375 Mark als Honorar für Vorträge erhalten haben. Glos habe es versäumt, die Nebeneinkünfte beim Bundestagspräsidenten anzugeben. Das habe der CSU-Politiker erst am Freitag nachgeholt, so "Focus". HA (HH A 11.04.05) Davon war den Rechenschaftsberichten der Parteien natürlich so gut wie nichts zu entnehmen. Hunzinger-Spenden waren mit folgenden Beträgen ausgewiesen worden: 1997 1998 1999 Gesamt: CDU 76.000,002 70.782,61 146.782,61 CSU 30.000,003 129.920,00 159.920,00 Spende durch: 1 Moritz Hunzinger persönlich, 2 Hunzinger SPD - FDP 25.0001 45.0001 70.000 Public Relations GmbH, Grüne 3 Hunzinger Information AG Im Zuge des durch Hunzinger verursachten Lobbyistenskandals tauchten aber Firmenpapiere auf, denen zu entnehmen war, dass der »Beziehungsmakler« Hunzinger privat und über seine Firmen – manchmal mit DM 19.999 möglichst sorgsam bis gerade unterhalb der Publizitätsgrenze – parteiübergreifend direkt und indirekt erheblichen finanziellen Einfluss genommen hatte! (Wobei die Unterlagen dem Lobbyisten im Mai 1999 von einem Angestellten in Fotokopie entwendet worden sind und daher nicht alle Leistungen des gesamten Jahres ausweisen können, denn sonst erklärt sich z.B. nicht der firmenintern nachfolgend für die CDU 1999 ausgewiesene Betrag in Höhe von nur DM 10.000, obwohl die vorstehende offizielle Spendenaufstellung des CDU-Rechenschaftsberichts einen wesentlich höheren Betrag von DM 70.782,61 ausweist.) So hatten laut STERN (25.07.02) in Wirklichkeit Bundestagsparteien zu veröffentlichende oder einzelne Abgeordnete nicht veröffentlichungspflichtige DM-Direktzuwendungen von Hunzinger in mindestens folgender Höhe erhalten: CDU CSU 1997 25.500 19.000 1998 106.000 30.000 1999* 10.000 150.000 Gesamt: (141.500) 199.000 Gesamt: (202.283) (* Nur bis zum Mai des Jahres 1999) SPD 19.000 20.000 19.000 58.000 FDP 62.500 205.000 60.000 327.500 Grüne 15.000 17.500 19.900 52.400 Auch diese (durch unerlaubte Anfertigung einer Fotokopie) bekannt gewordene firmeninterne Aufstellung scheint nicht vollständig zu sein: 2005 kam heraus, dass Hunzinger 1998 DM 19.999,- an die hessischen Grünen gespendet haben soll. Die Spende musste nicht veröffentlicht werden, weil sie unter der damaligen Grenze von 20.000 Mark gelegen hat. Die "Süddeutsche Zeitung" schrieb laut WELT vom 01.04.05, die Spende soll in einem Zusammenhang mit einem Auftritt des damaligen Fraktionsvorsitzenden Joschka Fischer vor Wirtschaftsführern gestanden haben. „... Die Grünen wiesen die Vorwürfe, es gebe Ungereimtheiten bei Fischers Finanzgebaren, zurück. Der hessische Grünen-Sprecher Kai Klose sagte, Hunzinger habe das Geld 1998 an den Frankfurter Kreisverband gespendet. Die Spende sei gemäß den damaligen Bestimmungen ohne den Namen des Spenders im Rechenschaftsbericht der Partei aufgeführt worden. Grünen-Bundesschatzmeister Dietmar Strehl betonte, 58 Fischer habe seinen Vortrag im "Politischen Salon" Hunzingers an keine finanziellen Bedingungen geknüpft. "Er hat weder ein Honorar erhalten noch eine Spendenzusage erbeten." Von den Firmen Hunzingers seien von 1998 bis 2002 insgesamt 29 950 Euro an die Grünen gespendet worden. Auch die Vizesprecherin im Auswärtigen Amt, Antje Leendertse, erklärte, Fischer habe "kein Honorar" erhalten. Dieser Darstellung widerspricht Moritz Hunzinger jedoch energisch: "Herr Fischer hat von mir ein Honorar erhalten. Was er mit dem Geld gemacht hat, ist sein Bier", sagte Hunzinger der WELT. Der PR-Manager verweist auf einen Brief an Fischer vom 17. August 1998, in dem die Honorarzahlung schriftlich vereinbart worden sei. Tatsächlich wird in dem Schreiben an den "Sehr geehrten, lieben Herrn Abgeordneten Fischer", das der WELT vorliegt, ein "Honorar in Höhe von DM 19 999" bestätigt. "Bitte lassen Sie mir aufgeben, wie Sie die Anweisung wünschen", heißt es weiter. Hunzinger sagt heute, seiner Erinnerung nach sei der Betrag bar in einem Briefumschlag ausgehändigt worden. ...“ (DIE WELT 05.04.05) Im Hamburger Abendblatt vom 26.07.02 hieß es in dem Artikel „Hunzinger und kein Ende“ über vermutlich einen längeren Zeitraum als die vorstehend explizit im STERN angeführten drei Jahrgänge: „Hunzinger spendete in den neunziger Jahren laut ’Wirtschaftswoche’ den Liberalen 390 000 Mark, der CDU 290 000 Mark, der CSU 213 000 Mark, der SPD 109 000 Mark und den Grünen etwa 50 000 Mark. Nur die PDS ging leer aus. Die Hälfte der Spenden erschien nicht in den Rechenschaftsberichten, da sie unter die meldepflichtige Summe von 20 000 Mark gestückelt wurden. Hunzinger zahlte auch Vortragshonorare an Politiker, die diese als Spenden weiterleiteten.“ Dabei musste jedem bedachten Politiker klar sein: „In der Welt der Netzwerke gibt es auf Dauer keine Leistung ohne Gegenleistung“. Es sei „ein ganz normales System des Gebens und Nehmens“ gewesen; so das niemanden überraschende Bekenntnis des in seiner Arbeit sehr erfolgreichen Lobbyisten Hunzinger. Die Spendierfreude des Lobbyisten Hunzinger kostete 2002 den damaligen Bundesminister der Verteidigung und 2004 einen stellvertretenden Ministerpräsidenten und Wirtschaftsminister seines Bundeslandes ihr jeweiliges Amt. Die nachfolgende Aufstellung über in den Jahren 1997-2000 erhaltene Großspenden von mindestens DM 40.000,- der in diesen Jahren im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien (die Publizitätsgrenze in den Rechenschaftsberichten der Parteien an den Bundestagspräsidenten lag zwar bei DM 20.000, trotzdem wurden darin aufgeführte geringere Spendenbeträge unterhalb der 40.000-Mark-Grenze für diese Aufstellung nicht berücksichtigt) ist nur ein für diese als Unterrichtshilfe gedachte Ausarbeitung relativ willkürlich zusammengestellter Auszug aus den vom Bundestagspräsidenten veröffentlichten offiziellen Rechenschaftsberichten der Parteien; es gibt viel mehr Spenden von mindestens DM 40.000,-. Diese Aufstellung kann aber Exemplarisches deutlich machen; besonders wenn man im Internet nachforscht, wer hinter den Namen steckt. (Wer so viel Geld zu »verschenken« hat, der ist im Internet als Stütze der Gesellschaft zu finden.) Was der Parteibetrieb so kostet, geht ebenfalls aus den dem Bundestagspräsidenten vorgelegten Rechenschaftsberichten der Parteien hervor, ist aber für das Thema „Bundestagswahlen“ nur von marginaler Bedeutung und wurde darum in dieser Unterrichtshilfe nicht mit aufgenommen. 59 Auszug der Spenden 1997-2000 von mindestens DM(!) 40.000,- (Zusammenstellung H.-U. Scharnweber) 60 Was der Parteibetrieb so kostet, geht ebenfalls aus den dem Bundestagspräsidenten vorgelegten Rechenschaftsberichten der Parteien hervor, ist aber für das Thema „Bundestagswahlen“ nur von marginaler Bedeutung und wurde darum in dieser Unterrichtshilfe nicht mit aufgenommen. Sachthemen im Wahlkampf Beim Wahlkampf sollte es um die Erörterung von Sachthemen gehen, nicht nur um Stimmungen oder gar eine Schönheitskonkurrenz; und auf jeden Fall nicht um einen auf einem x-beliebigen Foto wegretuschierten Schwitzfleck am Ärmelrand des Kleides der Kandidatin anlässlich eines privaten Konzertbesuches in Bayreuth, über den in den Publikationsorganen mit den schreiend großen Lettern mehr geschrieben wurde, als über die Inhalte der Programme! Und auf jeden Fall auch nicht um Wählerbeschimpfung oder Wählerverarschung durch Spitzenpolitiker, wie es der CSU-Vorsitzende Stoiber vorexerziert hat, denn Wählerbeschimpfung ist kein politisches Sachargument – auch nicht in der heißen Phase eines Wahlkampfes! Wo bleibt der Aufstand der CDU-Wähler? Von ALFRED MERTA Die stillen Helden dieses Jahres sind die CDU-Wähler. Sie haben Rot-Grün in Kiel und Düsseldorf abgesetzt. Und sie sind, folgt man den Umfragen, auch entschlossen, die Union im Bund an die Macht zu bringen. Diese Menschen müssen jetzt erkennen, wie wenig Achtung die Spitzen der Union vor ihren eigenen Anhängern haben. Anstatt den Vertrauensvorschuß der Wähler mit einem klugen, seriösen Wahlkampf zurückzuzahlen, führen sich CDU und CSU auf wie von Sinnen. Da wird auf unterem Niveau hingesödert und hergekaudert. Konzepte zu Wirtschaft und Arbeitslosigkeit – Fehlanzeige. Die Kanzlerkandidatin wirkt schwunglos, mißgünstig beäugt von den CDU-Ministerpräsidenten. Und mit seinen durchgeknallten Sprüchen treibt der CSU-Regionalpolitiker Stoiber nicht nur die Union in die Krise, sondern reißt wie mit dem Tapeziermesser alte Wunden bei Ost- und Westdeutschen auf. Wo bleibt der Aufstand der CDU-Wähler? Nur sie, die den Höhenflug der Parteifunktionäre erst möglich gemacht haben, können ihre Politiker noch zur Vernunft bringen. In Briefen, Telefonaten, durch Protest bei Wahlkampfveranstaltungen. Sie hätten die Sympathie vieler früherer Rot-Grün-Wähler, die sich mit dem Machtwechsel abgefunden haben und auf eine handwerklich ordentliche Regierungsarbeit hoffen. Mit dieser Union droht die Neuwahl in fünf Wochen keine Befreiung, sondern ein weiterer Niederschlag zu werden. Schröder kann man nicht mehr bekommen, Merkel kann man so nicht wollen. Es ist zum Verzweifeln. Das fragte der BamS-Kommentator am 14.08.05 in der CDU-freundlichen Springer-Zeitung. Die Kandidaten sollten nicht nur wie Models auf dem »Cat-Walk« laufen und letztlich doch recht substanzlose Standardreden um zwei, drei von ihnen als zentral herausgestellte Worthülsen herum ablassen. Welche Themen die heiße Phase eines Wahlkampfs prägen werden, ist vorher nie genau absehbar. Es hätten 2002 u.a. die schlechte wirtschaftliche Lage Deutschlands, die Arbeitslosigkeit und die Zuwanderungsfrage werden können. Mit sehr viel Glück für den Wähler hätten sogar über Allgemeinplätze („mehr Eigenverantwortung“/ „keine Aufkündigung der Solidargemeinschaft“) hinaus die Modelle der Parteien für den von allen Einsichtigen auf Grund der demographischen Verwerfungen als dringend notwendig erachteten Umbau des Sozialstaates Bundesrepublik Deutschland erörtert werden können. Praktisch wurde es dann aber eine »Elbe-Flutkatastrophen-« und in der Endphase schließlich eine »Irakkrieg-Nichtbeteiligungs-Wahl«. Die Bundestagswahl 2005 könnte – und sollte(!) – neben der Erörterung innenpolitischer Lösungsmodelle für die anstehenden Reformen – grobe Wahlvarianten: »Hartz-IV« grundsätzlich beibehalten und nötigenfalls eventuell etwas modifizieren (SPD und Grüne), »Hartz-IV« verschärfen (CDU/CSU und insbesondere FDP) oder »Hartz-IV« abschaffen, ohne die dadurch entstehen- 61 den weiteren Schulden finanzieren zu können (Die Linkspartei. PDS) - von der außenpolitischen Auseinandersetzung um die von den europäischen Staats- und Regierungschefs projektierte, von der überwiegenden Bevölkerung Europas vermutlich aber nicht gewollte Mitgliedschaft der asiatischen Türkei in der Europäischen Union geprägt sein, da es in der Bundesrepublik Deutschland mit ihrem System der repräsentativen Demokratie durch gewählte Volksvertreter ohne die Möglichkeit eines Volksentscheides für den Wahlbürger keine andere Möglichkeit gibt, zu diesem Problemkreis Position zu beziehen und Flagge zu zeigen. Neben dieser die gesamte Zukunft der europäischen Staaten aufs Tiefste beeinflussenden und prägenden Problematik müssten alle anderen Sachthemen verblassen: Gemessen an der Bedeutung dieser Frage erscheint es relativ gleichgültig, wie z.B. das Krankenversicherungssystem, ob als Bürgerversicherung, reine oder irgendwie mischfinanzierte Kopfpauschale („solidarisches Gesundheitsprämien-Modell mit Arbeitgeberanteil“), künftig organisiert werden soll. Solche wichtigen Sachthemen gehören in einen Wahlkampf, damit der Souverän durch seine Wahlentscheidung deutlich machen kann, was er mit sich machen lassen will! EU-Vollmitgliedschaft der Türkei? Die Union blickt auf 2006 Wahlkampfthema Türkei - Skepsis bei der FDP von Andreas Middel und Nikolaus Blome Was den Beginn von Beitrittsverhandlungen der EU mit der Türkei angeht, sind CDU und CSU dabei, sich ins Unvermeidlich zu fügen - und schmieden Pläne für das Jahr 2006 und danach. Die Opposition geht davon aus, daß im offiziellen Beschluß des EUGipfels am Freitag die von der Union geforderte "zweite Option" einer "privilegierten Partnerschaft" nicht ausdrücklich genannt wird. Dann hätte sich die Bundesregierung durchgesetzt, die als "Ziel" der Verhandlungen nur die Vollmitgliedschaft nennen will, damit es zu keinen unkalkulierbaren Reaktionen der türkischen Regierung kommt. Für einen Rest Unsicherheit sorgt derzeit noch der französische Staatspräsident Jacques Chirac. Er plant für Mittwoch abend einen Fernsehauftritt, in dem er auch seine TürkeiPosition erläutern will. Zudem ist es der Bundesregierung nach Informationen der WELT bislang nicht gelungen, vor dem EU-Gipfel eine gemeinsame Position mit Paris festzulegen. Damit würden die beiden größten EU-Staaten zum ersten Mal seit Jahren ohne gemeinsame Absprache in einen wichtigen EU-Gipfel gehen. In Regierungskreisen wird auf die innenpolitischen Nöte Chiracs verwiesen, die ihn zu Türkeiskeptischen Tönen zwängen. Bundeskanzler Gerhard Schröder hatte sich beim letzten deutsch-französischen Treffen in Lübeck noch zuversichtlich geäußert, zu einer gemeinsamen Verhandlungsposition zu kommen; Kanzleramt und Außenministerium hatten sich über Wochen um eine "abgestimmte Position" mit den Franzosen bemüht. Ohne Erfolg. Innenpolitisch will die Union den Streit um den Türkei-Kurs am Donnerstag noch einmal anheizen: In einer Bundestagsdebatte wird die CDU-Vorsitzende Angela Merkel ihr Modell eine "privilegierten Partnerschaft" erneut ausbuchstabieren. Ihre Hoffnung, der Kanzler werde ihr in der Debatte antworten, bleibt aber unerfüllt - statt dessen spricht Außenminister Fischer. Er wird darauf verweisen, daß die Europäische Union sich mit dem Beginn der Verhandlungen nicht auf eine spätere Aufnahme festlege. Voraussichtlich wird die Verhandlungsaufnahme verbunden mit einem bisher nie dagewesenen Passus, wonach die Verhandlungen auch scheitern können und es eine Art Notbremse für die EU gibt: Wenn der Reformeifer der Türkei nachläßt, können die Verhandlungen ausgesetzt oder abgebrochen werden. Nicht zuletzt an der SPD-Basis wird das gut ankommen, weil dort die Skepsis gegen einen Türkei-Beitritt groß ist. Die Union wiederum will den Türkei-Streit auch im Wahlkampf 2006 austragen. Tatsächlich bietet sich das Thema politisch an, weil sich Regierung und Opposition fun- 62 damental unterscheiden. Aber: Im Jahr 2006 werden die Verhandlungen mit der Türkei in Details verstrickt sein - und ein Ende wird allseits erst um das Jahr 2015 erwartet. Ob sich also die Wähler in Massen mobilisieren lassen, ist fraglich. In einer EmnidUmfrage für die WELT finden es 62 Prozent der Befragten "nicht gut", wenn die Union aus dem Türkei-Beitritt ein Wahlkampfthema macht. Zudem kann die Union nicht mit der vollen Unterstützung ihres liberalen Partners rechnen. "Die FDP wird in einer Bundesregierung darauf achten, daß die Verhandlungen wirklich ergebnisoffen geführt werden", sagte der Fraktionsvorsitzende der Liberalen, Wolfgang Gerhardt, der WELT. "Eine Rücknahme eines EU-Beschlusses wird es aber mit uns nicht geben", so Gerhardt. CSU-Chef Edmund Stoiber und CDU-Chefin Angela Merkel hatten zuvor erklärt, sie würden nach einem Regierungswechsel im Jahr 2006 alles daransetzen, um eine Vollmitgliedschaft der Türkei zu verhindern. "Niemand kann heute das Endergebnis von Beitrittsverhandlungen der EU mit der Türkei vorwegnehmen. Weder Joschka Fischer noch Edmund Stoiber", sagte Gerhardt dazu. Vom Ziel der Vollmitgliedschaft abzugehen, erfordert an einem bestimmten Punkt der Verhandlungen zudem, das neue Verhandlungsziel einer "privilegierten Partnerschaft" auszurufen. Ohne den formellen Beschluß eines EU-Gipfels ist das allerdings nicht möglich. (DIE WELT 15.12. 2004) EU-BEITRITT Rot-Grün warnt Union vor Anti-Türkei-Wahlkampf Die Vorsitzenden von SPD und Grünen, Franz Müntefering und Reinhard Bütikofer, haben den Kurs von Angela Merkel in der Türkei-Politik kritisiert. Die CDUChefin hat angekündigt, dass sie die Ablehnung einer Vollmitgliedschaft zum Thema des Bundestagswahlkampfs machen will. Berlin - Müntefering warnte die Union davor, mit dem EU-Beitrittswunsch der Türkei Wahlkampf zu machen. Er könne sich nicht vorstellen, dass die Opposition den Beitrittswunsch der Türkei zur Europäischen Union 2006 tatsächlich offensiv zum Thema mache, wenn alle anderen EU-Länder die Aufnahme von Verhandlungen mit Ankara beschließen. Merkel sei mit ihrer Forderung nach einer "privilegierten Partnerschaft" für die Türkei selbst innerhalb der konservativen Parteien in Europa weitgehend isoliert. Was die Motive für die Haltung der Union angehe, wolle er ihr zwar nichts Böses unterstellen. "Es ist aber schon auffällig, mit welchem Populismus Teile der Union in letzter Zeit die Themen Migration und Zusammenleben der Kulturen behandeln." Dies sei für die Stimmung im Lande und die Integration der Ausländer in Deutschland "weiß Gott nicht gut". Bütikofer sagte, die Bürger würden bis zur Bundestagswahl 2006 merken, "dass die große reformpolitische Leere der Union bemäntelt werden soll". "So einen Schwindel, egal ob er als Türkenfurchtkampagne oder als Patriotismuskampagne aufgezogen wird, so einen Schwindel werden die Leute nicht durchgehen lassen." Nach seiner Ansicht "zielt die Kampagne der Union vor allem auf die Mobilisierung innenpolitischer Ressentiments". Er sei aber überzeugt, es gebe in der Union doch zu viele, die wüssten, dass das ein Spiel mit dem Feuer wäre. Ein solcher Kurs gehe einfach nicht. "Das können Rechtsradikale machen, so eine Politik. Das kann nicht die CDU machen." Niemand könne heute sagen, ob die Türkei wirklich in 10 oder 15 Jahren Mitglied der EU werden könne, sagte der Grünen-Vorsitzende. "Niemand von uns hat das der Türkei versprochen oder kann das versprechen." Bevor die Türkei Mitglied der EU werden könne, seien noch viele Veränderungen notwendig. "Aber wir stehen zu unserem Wort. Wir sind bereit, der Türkei - wenn sie diese Veränderungen auf sich nimmt - den Weg nach Europa mit zu öffnen." (SPIEGEL ONLINE 17.12.04) 63 Eigene Beiträge zu dieser Problematik versage ich mir an dieser Stelle aus Gründen des sehr beschränkt zur Verfügung stehenden Platzes. Ich verweise ersatzweise auf die Websites www.HansUwe-Scharnweber.de und www.cdq.de mit der diesbezüglichen Ausarbeitung: EU-Beitritt Türkei? EU-Erweiterungsdebatte Türkei: Warum die Türkei nicht in die EU gehört Hans-Uwe Scharnweber wo alle Argumente des Für und Wider eines Beitritts der Türkei zur EU und Stellungnahmen von Beitrittsbefürwortern und -gegnern zusammengetragen und bewertet worden sind. Mit der Problematik des Beitritts der Türkei zur EU steht u.a. auch die Problematik der Zuwanderung in einem mehr oder weniger engerem Zusammenhang. „Kinder statt Inder!“, ist inzwischen passe, denn es könnte sich – abgesehen von größeren Teilen der CDU - die Erkenntnis durchgesetzt haben, dass bei der Gebärunlust deutscher Frauen mit einer Reproduktionsrate von nur 1,34 Kindern pro Frau Wirtschaftskraft und Sozialsysteme nur erhalten werden können, wenn die zu geringe Geburtenrate mit Zuwanderung wenigstens teilweise ausgeglichen wird. „Kinder und (gut ausgebildete) Inder!“, müsste die Parole lauten, weil die Deutschen ein überalterndes, ein sterbendes Volk sind. Im Jahr 2035, in einer Generation also, werden die Deutschen das Volk mit dem höchsten Durchschnittsalter weltweit sein (STERN 30.06.05 „Land ohne Kinder“) - was ungeheure Probleme für unseren Städtebau, unsere Wirtschaft und Gesellschaft und unsere Sozialsysteme bedeutet! „’Hamburg braucht mehr qualifizierte Ausländer’ Senator Peiner: Asiaten und Osteuropäer für mehr Wachstum Hamburg – Finanzsenator Peiner (CDU) will Hamburg zu einer Zuwanderungsstadt machen. ’Wenn wir international zu den Gewinner-Städten zählen wollen, dann braucht Hamburg qualifizierte Zuwanderer aus China, Indien und Osteuropa’, sagt Peiner. Nur auf diese Weise sei langfristig wirtschaftliches Wachstum zu sichern. ... Peiner will eine breite Diskussion anstoßen, um gesellschaftliche Akzeptanz zu schaffen. Es müsse mit dem Vorurteil aufgeräumt werden, dass der Zuzug qualifizierter Ausländer den Verlust von Arbeitsplätzen für Einheimische bedeute. Es entstünde vielmehr wirtschaftliche Dynamik, die für neue Arbeitsplätze sorge. ... Wir können in Anbetracht unseres Generationenaufbaus und der Bevölkerungsstruktur nur wachsen, wenn auch Menschen ’von draußen’ dazu beitragen. Das bedeute, dass Hamburg einem modernen Zuwanderungsgesetz zustimme, das den Zuzug von ausländischen Fachkräften und Studenten ermögliche. ... ‚Die Stadt muss deshalb der globalisierten Wirtschaft Rechnung tragen und weltweit um Zuwanderung werben.’ Hamburg müsse langfristig denken und bald damit anfangen. ... Wo aber sollen die Zuwanderer herkommen? ’Vor allem aus Indien, China und Osteuropa. Dort müssen wir präsent sein mit offensiver Werbung, um Menschen nach Hamburg zu locken’, so Peiner. Als Zielgruppen nennt er Studenten, junge Selbstständige, Wissenschaftler, Facharbeiter und Servicekräfte. ’Vom Professor bis zum Hotelpagen müssen alle Menschen willkommen sein, die arbeiten wollen. Wir brauchen insbesondere junge Leute für einen vernünftigen Generationsaufbau’, so Peiner. ... Peiner nennt die Integration dieser Zuwanderer als das Schlüsselproblem dieses Konzepts. ... ’Der Senat muss sich klar positionieren’, fordert Peiner. Das beinhalte auch die Unterstützung für ein modernes Zuwanderungsrecht. ...“ Hamburger Abendblatt 19.09.03 (leicht gekürzt) 64 Aber den Wählern war verständlicherweise das (innenpolitische) Kleid »Hartz-IV« (= drohender sozialer Abstieg bei Arbeitsverlust) näher als der (außenpolitische) Rock Türkei. Außenpolitische Themen spielten in dem Wahlkampf keine Rolle. Parteiensteckbrief / Wahlkampfthemen und Programme Eine Partei sollte ihrer programmatischen Aussagen wegen gewählt (oder nicht gewählt) werden wobei es schön ist, wenn mehr als (nach persönlicher Einstellung gewichtete) 51 % der Schwerpunkt-Vorstellungen des Wählers und der Wahlaussagen der bevorzugten Partei übereinstimmen. Mit allen Zielen einer Massenpartei wird wohl kaum jemand übereinstimmen (können). Dafür sind die Spektren der Massenparteien einfach zu groß: Wie sollten z.B. der Arbeitgeber- und der in der CDA organisierte Arbeitnehmerflügel der CDU deckungsgleiche Vorstellungen entwickeln und vertreten? Bei der Formulierung der Parteiprogramme kann es nur um einen mit Blick auf die eigene Wählerklientel Um herauszufinden, ob man mit den wichtigsten Wahlzielen einer Partei übereinstimmt, muss sich der Wähler aber wenigstens grob über die Ziele der für ihn in Betracht kommenden Parteien informieren, wenn er sich nicht ausschließlich an der Personen der jeweiligen Kanzlerkandidaten orientieren will; was aber auch zulässig ist, da die Spitzenkandidaten ja die Parteiziele verkörpern. Das Erscheinungsbild der Kandidaten wird von ihrer Darstellung in den Massenmedien, insbesondere im Fernsehen, geprägt. Es wäre aber – zum Glück(!) - falsch anzunehmen, die Medien würden »Kanzler machen«; zum Glück deswegen, weil man sonst annehmen könnte oder müsste, dass nach italienischem Vorbild des Medien-Tycons und Regierungschefs Berlusconi auch bei uns durch die größte wirtschaftliche Medienmacht eine Kanzlerschaft »organisiert« werden könnte. Aber unterstützend werden die Massenmedien, und hier insbesondere das Fernsehen, auch bei uns tätig, und sei es nur indirekt: Eine Regierung, die kurz vor der Wahl große Aktivitäten entwickelt, kommt dann halt öfter im Fernsehen vor als eine Opposition, die – sehr geschickt(!) – jede Woche der Öffentlichkeit ein neues Mitglied ihres „Kompetenzteams“ präsentiert, um sich irgendwie über Wochen in den Schlagzeilen zu halten. (Das geht aber nur bei »normalen« Wahlkampagnen, nicht aber bei einer wegen einer gescheiterten Vertrauensabstimmung übers Knie gebrochenen sehr kurzfristigen Wahlkampagne.) Dieses Unterthema „Parteiensteckbrief/Wahlprogramme“ fordert Gruppenarbeit geradezu heraus. Die Schüler sollten sich - Iosgelöst(!) von ihrer eigenen Parteipräferenz - zu Gruppen zusammenfinden und das Wahlkampfgeschehen der zu ihrem Gruppenauftrag gehörenden Partei verfolgen sowie die Wahlaussagen zu Schwerpunkten des Wahlkampfes zusammentragen. Die plakativen Aussagen sollten dann in einer großen Tabelle synoptisch gegenübergestellt werden. Eine solche Tabelle kann zu einem Zeitpunkt, wenn noch niemand ahnt, welches Thema sich letztlich als wahlentscheidendes Thema herauskristallisieren wird – und es kann immer passieren, dass sich ein zuvor nicht als solches erkanntes Thema in den Vordergrund schiebt (2002: Elbe-Flut, Irak-Krieg) -, in ihrer Grundstruktur z.B. folgendermaßen aufgebaut sein: I. Parteiensteckbrief: 1. Vorsitzende/r 2. Spitzenkandidaten der jeweiligen Landesliste des eigenen Bundeslandes 3. Zahl der Mitglieder a) BRD / West / Ost b) im eigenen Bundesland 4. Bekannte Politiker a) BRD b) aus dem eigenen Bundesland 65 II. Programmaussagen zu den Punkten der Innenpolitik: 1. Arbeitsrecht / gesetzlicher Mindestlohn / Geltung von Flächentarifverträgen / Tarifrecht und Öffnungsklauseln / Beschneidung von Gewerkschaftseinfluss in den Betrieben / Betriebsverfassungsrecht (= Abschaffung der paritätischen Mitbestimmung?) 2. Arbeitslosigkeit / Kündigungsschutz erst ab 11, 20 oder 50 Mitarbeiter / Regelungen für ältere Arbeitnehmer 3. Gesamtwirtschaftliche Situation / Steuern und Staatsverschuldung / Konsolidierung der öffentlichen Finanzen 4. Umgestaltung des Steuerrechts 5. Familienpolitik 6. Gesundheitswesen / Krankenkassen / Gesundheitspolitik / Pflegeversicherung (Auf dem Weg zur »2-Klassen-Medizin«? Bürgerversicherung contra Kopfpauschale/Gesundheitsprämie, Mischsystem oder völlige Privatisierung) 7. Sicherung der Renten 8. Sozialleistungen / Hartz IV 9. Organisiertes Verbrechen / Innere Sicherheit 10. Wohnungsnot in Ballungszentren / Leerstände in östlichen Bundesländern 11. Umweltfragen 12. Ausländer / Asylanten / Zuwanderung 13. Forderungen aus dem Kreis der Muslime? 14. Rechtsradikalismus / NPD- und DVU-Problematik, insbesondere in Ostdeutschland 15. Neu formierte Linke? 16. Ökosteuer - Atomausstieg - Energiepolitik 17. Von den einzelnen Parteien angekündigte (weitere) Reformprojekte III Außenpolitik: 1. Deutschland und die UNO / Auslandseinsätze der Bundeswehr als UNO-Truppe 2. Deutschland und die EU nach der Erweiterung um die 10 neu aufgenommenen Mitglieder und die Ablehnung des Verfassungsentwurfes für Europa in Gründungsmitgliedsländern Auswirkungen dieser Erweiterung auf die Deutschen und die EU 3. EU-Beitritt Türkei? 4. Euro-Währung und ihre Folgen („Euro = Teuro?“) Hilfreich für die Erstellung der vorstehenden Tabelle sind zusammenfassende Darstellungen in den Medien wie z.B.: Was die Union von der SPD unterscheidet Gesundheit, Rente, Arbeitsmarktpolitik: Die WELT dokumentiert den Diskussionsstand der Volksparteien in den Reform-Politikfeldern Berlin - Bisher ist unklar, was nach der Bundestagswahl auf die Wähler zukommt. Es gibt noch keine abgestimmten Wahlprogramme. Parteitagsbeschlüsse und die Aussagen von Spitzenpolitikern lassen allerdings erste Konturen über die unterschiedlichen Wege von SPD und Union erkennen. Die beiden Parteien unterscheiden sich auf dem Gebiet der Steuer-, Gesundheits- und Mitbestimmungspolitik stark voneinander. Die politische Praxis sieht am Ende aber häufig anders aus. Die WELT dokumentiert die wichtigsten Forderungen in den verschiedenen Themenfeldern. Steuern Die SPD hält am bestehenden Einkommensteuertarif fest. Steuervergünstigungen sollen "sozial gerecht" abgebaut und die Unternehmensteuern in Europa stärker harmonisiert werden. Die Gewerbesteuer soll nach Ansicht der SPD erhalten werden. Es gibt zudem Sympathien für eine rechtsformunabhängige Unternehmensbesteuerung. Die Union ist für eine Vereinfachung des Steuersystems und will die Gewerbesteuer abschaffen. Die Reform des Steuerrechts soll sich nach Vorstellungen der Union in zwei Schritten vollziehen: Eine Senkung der Steuersätze auf 39 Prozent (Spitzensteuersatz) und 66 zwölf Prozent (Eingangssteuersatz). In einer ersten Phase soll ein linear-progressiver Tarif gelten, der im Laufe der Zeit auf einen Stufentarif (12, 24,39 Prozent) umgestellt werden soll. Gesundheitspolitik Die SPD will die gesetzliche Krankenversicherung zu einer Bürgerversicherung ausweiten, hat aber noch kein fertiges Konzept vorgelegt. Grundsätzlich soll jeder Bürger, also auch Selbständige, Beamte und alle Besserverdienenden, Mitglied der gesetzlichen Krankenversicherung werden. Für bislang privat Versicherte wird es Übergangsregelungen geben. Beitragspflichtig sollen neben dem Arbeitseinkommen auch alle Kapitaleinkünfte sein. CDU und CSU haben sich auf ein gemeinsames Konzept zur Einführung einer Gesundheitsprämie geeinigt. Vorgesehen ist, daß jeder Erwachsene, also auch nicht erwerbstätige Ehepartner, eine Pauschale von 109 Euro im Monat zahlt. Zusätzlich gibt es einen lohnabhängigen Arbeitgeberbeitrag, der bei 6,5 Prozent eingefroren wird. Künftige Ausgabensteigerungen hat somit der Versicherte allein zu tragen. Geringverdiener erhalten Zuschüsse. Die Versicherung der Kinder soll aus Steuermitteln finanziert werden. Rentenversicherung Hier plädiert die SPD-Linke ebenfalls für eine Bürgerversicherung. Von Regierungsseite gibt es aber keine derartigen Pläne. Das tatsächliche Renteneintrittsalter, das bei 60 Jahren liegt, soll schrittweise dem gesetzlichen Renteneintrittsalter von 65 Jahren angenähert werden. Eine Heraufsetzung auf 67 Jahre wird abgelehnt. Auch eine Stärkung der Familienkomponente in der Rente ist nicht geplant. Die Union hat bisher kein gemeinsames Rentenkonzept. CDU und CSU wollen aber die Familienkomponente im Rentensystem stärken. Neben einer verbesserten Anrechnung der Kindererziehungszeiten bei der Rente wird eine Entlastung der Eltern bei den Beiträgen erwogen. Die Finanzierung ist unklar. Wer 45 Berufsjahre vorweisen kann, soll abschlagsfrei in Rente gehen können. Arbeitsmarkt Die SPD lehnt Änderungen beim Kündigungsschutz ab. Die Ausweitung des Entsendegesetzes soll Lohndumping verhindern. Die Union fordert, den Kündigungsschutz bei Betrieben bis zu 20 Mitarbeitern bei Neueinstellungen aufzuheben. In der Arbeitslosenversicherung sollen nach Vorstellungen der Union die Beiträge von 6,5 auf 5,5 Prozent gesenkt werden. Im Gegenzug sollen die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen entfallen. Um die Vermittlung von Langzeitarbeitslosen zu fördern, sollen die Einstiegslöhne in bestimmten Fällen zehn Prozent unter Tarif liegen können. Die Christdemokraten wollen die Zuständigkeit für das Arbeitslosengeld II voll auf die Kommunen übertragen und die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I stärker nach Beitragsjahren staffeln. Mitbestimmung Die SPD ist gegen Änderungen bei der Mitbestimmung und gegen eine Legalisierung von betrieblichen Bündnissen für Arbeit. Dagegen will die Union im Betriebsverfassungsgesetz die Schwellenwerte für die Freistellung von Betriebsräten oder bestimmte Arbeitsschutzvorschriften deutlich erhöhen. Betriebliche Bündnisse für Arbeit sollen rechtlich abgesichert und das sogenannte Günstigkeitsprinzip neu definiert werden. Damit werden Abweichungen vom Tarifvertrag leichter. Energie Die SPD will den Anteil erneuerbarer Energien auf bis zu 20 Prozent ausbauen und am Ausstieg aus der Atomenergie festhalten: Demnach soll spätestens nach 32 Kalenderjahren ein Atomkraftwerk stillgelegt werden. Nach dem Willen der Union sollen die Laufzeiten der Atomkraftwerke verlängert und das Endlager schnell errichtet werden. Neue Kraftwerke sind nicht vorgesehen. Erneuerbare Energie sollen nicht länger subventioniert, sondern dem Wettbewerb ausgesetzt werden. cbs/dsi DIE WELT 28.05.05 Arbeit, Steuern, Soziales: Wer plant was? Die Parteien vor der Wahl: Am stärksten unterscheiden sie sich bei der Steuer- und Gesundheitspolitik. Bildung hat für alle Vorrang. Von Günther Hörbst 67 Hamburg - Mit der Ankündigung von Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD), die Bundestagswahl auf diesen Herbst vorziehen zu lassen, hat der Wahlkampf begonnen. Die Positionen, die SPD und Grüne sowie Union und FDP dabei vertreten, unterscheiden sich in vielen Punkten - am deutlichsten in den Bereichen Steuern und Gesundheit. Allgemein läßt sich sagen, daß die FPD für radikale Privatisierungen und Entstaatlichungen in allen Bereichen eintritt, die SPD dagegen dem Weg der Reformagenda 2010 treu bleiben will. Nachfolgend ein Überblick über die wichtigsten Themen und Positionen. Arbeitsmarkt Die Union will den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung über abgespeckte Leistungen der Bundesagentur für Arbeit von 6,5 Prozent auf fünf Prozent senken. Dadurch sollen 150 000 neue Arbeitsplätze entstehen. Vor allem aber soll der Kündigungsschutz gelockert werden. Das dürfte für gehörig Zündstoff sorgen. Er soll nach dem Willen von CDU und CSU erst greifen, wenn ein Unternehmen mindestens 20 Mitarbeitern hat, und für über 50jährige gar nicht mehr gelten. Langzeitarbeitslose sollen nach Antritt einer neuen Stelle ein Jahr lang zehn Prozent unter Tarif bezahlt werden können. Die Liberalen gehen da noch einen Schritt weiter: Der Kündigungsschutz soll erst ab 50 Mitarbeiter greifen, die Bundesagentur für Arbeit soll zerschlagen und in eine beitragsfinanzierte Versicherungs- sowie eine steuerfinanzierte Arbeitsmarktagentur getrennt werden. SPD und Grüne sehen in diesem Bereich keinen grundlegenden Änderungsbedarf. Die Hartz-Reformen für den Arbeitsmarkt mit der Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe sowie dem Umbau der Bundesagentur für Arbeit sollen unverändert weitergeführt werden und ihre Wirkung entfalten. Eine Lockerung des Kündigungsschutzes wird strikt abgelehnt. Wirtschafts- und Tarifpolitik Die Union will einen radikalen Bürokratieabbau, um vor allem den Mittelstand zu entlasten. Sie will Abweichungen vom Flächentarifvertrag gestatten, wenn die Belegschaften zustimmen. Firmen sollen mehr Bündnisse für Arbeit in ihren Unternehmen umsetzen dürfen. Mitbestimmung und der Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit und Kindererziehung soll eingeschränkt werden. Managergehälter sollen offengelegt werden. Das lehnt jedoch die FDP kategorisch ab. Die Manager sollen das selbst entscheiden dürfen. Für SPD und Grüne besteht bei der Mitbestimmung kein Handlungsbedarf, die Offenlegung der Gehälter wurde erst kürzlich beschlossen. Flächentarifverträge sollen nicht angetastet werden. Gesundheits- und Sozialpolitik Hier prallen zwei Philosophien aufeinander. Die Union will das Gesundheitssystem mit einem Prämienmodell (109 Euro pro Kopf und Monat, 6,5 Prozent fester Arbeitgeberanteil) reformieren. Das Modell wurde von CDU und CSU Ende 2004 zwar beschlossen, ist in der Union aber weiter sehr umstritten. Vor allem die Finanzierung ist nicht gesichert. Der Ausgleich für jene, die die 109 Euro monatlich nicht aus eigener Kraft aufbringen können, müßte aus Steuern geleistet werden. Viele Experten halten das für nicht finanzierbar. Vor allem deshalb nicht, weil sich die Union nicht über ein Steuermodell einigen konnte, das zu diesem Prämienmodell gepaßt hätte. Die SPD will das Gesundheitssystem dagegen über die sogenannte Bürgerversicherung reformieren. In diese müßten alle Bürger einzahlen, auch Beamte und Selbständige. Dadurch soll die Zahl der Beitragspflichtigen vergrößert und das System gerechter werden. Zudem sollen alle Kapitaleinkünfte wie Zins- und Mieteinnahmen in die Beitragspflicht einbezogen werden. Auch die paritätische Finanzierung soll bleiben - die Arbeitgeber zahlen also weiter die Hälfte dazu. Detaillierte Konzepte für ein solches Modell existieren jedoch noch nicht. Steuerpolitik Der Union fehlt hier nach wie vor ein stimmiges Konzept. Die berühmte "Bierdeckel-Reform" des inzwischen abgetretenen CDU-Finanzexperten Friedrich Merz (drei einheitliche Steuersätze von 12, 24, 36 Prozent, Wegfall vieler Vergünstigungen) wurde auf Betreiben der CSU abgewandelt. Nun soll der Höchststeuersatz zunächst nur auf 39 Prozent gesenkt werden, die Steuerlast dabei weiter zwischen 13 und 39 Prozent linear-progressiv (mit dem Einkommen steigt die Steuerlast) ermittelt werden. Erst später soll der Stufentarif 12, 24, 36 eingeführt werden. Richtig konkret ist das aber alles noch nicht. Die Liberalen haben ein fertiges Konzept: Bei der Einkommensteuer soll es einen Stufentarif von 15, 25 und 35 Prozent geben. Die Union will zudem die Unternehmensteuern senken, die Gewerbesteuer abschaffen und die Erbschaftsteuerregelung für Unternehmer reformieren. Die SPD plant keine Steuersenkungen. Sie hält an der Gewerbesteuer fest und möchte die Unternehmensteuern nur insofern verändern als sie auf eine Angleichung in der EU drängt. So soll "Steuerdumping" verhindert werden. Steuervergünstigungen sollen abgebaut werden, allerdings sozialverträglich. Darin sind sich die Sozialdemokraten mit den Grünen einig. 68 Energie- und Umweltpolitik Kernaussage der Union wird sein, daß die Nutzung der Kernenergie als Option erhalten und die Laufzeiten von Kernkraftwerken verlängert werden. SPD und Grüne halten am Atomausstieg fest und wollen den Ausbau erneuerbarer Energieformen weiter forcieren. Außen- und Sicherheitspolitik Die Union lehnt eine Vollmitgliedschaft der Türkei in der EU ab. Statt dessen soll es nur eine sogenannte privilegierte Partnerschaft geben. Rot-Grün hat mit seiner Mehrheit im Bundestag dagegen Beitrittsgespräche mit der Türkei beschlossen und verweist auf die jahrzehntelangen Versprechungen an die Türkei für einen Beitritt. Union wie SPD bemühen sich um eine ständige Mitgliedschaft Deutschlands im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Die SPD ist uneins über die Beibehaltung der Wehrpflicht, die Union ist geschlossen dafür, die FDP geschlossen dagegen. Die Liberalen setzen sich stattdessen für eine Berufsarmee ein. Familienpolitik Rot-Grün will Deutschland mit einem Aktionsplan bis 2010 zum familienfreundlichsten Land Europas machen. Dazu sollen vor allem die Zahl der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder unter drei Jahren deutlich erhöht sowie mehr Ganztagsschulen gebaut werden. Statt Erziehungsgeld soll es in den ersten 12 Monaten nach der Geburt ein Elterngeld geben, das etwa die Hälfte des letzten Einkommens betragen soll. Die Union hatte im letzten Wahlkampf mit der Einführung eines Familiengeldes geworben, war konkrete Konzepte dazu aber schuldig geblieben. Konkret gefordert hatte die CDU zuletzt, Ausgaben für Tagesmütter sollten von der Steuer abgesetzt werden können. Bildungspolitik Alle Parteien wollen für Bildung und Forschung mehr Geld bereitstellen. SPD und Grüne sind klar gegen Studiengebühren für das Erststudium, Union und FDP sind dafür. Die SPD will an der bisherigen BAföG-Förderung festhalten. Die Union strebt hingegen bei der Studienfinanzierung einen Mix aus Gebühren, zu verzinsenden Privatdarlehen, Zuschüssen und "Freiplätzen" für Bedürftige und besonders Begabte an. HH A 25. Mai 2005 Die teilweise sehr umfangreichen Partei-Wahlprogramme werden hier nicht abgedruckt; sie, und Kommentare dazu, sind leicht im Internet zu finden. Z.B. kommentierte die linke taz das Wahlprogramm der linken Grünen wie folgt: Viel Stoff für grüne Träume In ihrem Wahlprogramm entwerfen die Grünen auf vierzig Seiten eine schöne neue Zukunft. Dass sie noch nicht Realität ist, liegt vor allem an der SPD AUS BERLIN LUKAS WALLRAFF Claudia Roth sagt, sie sei jetzt ziemlich froh, zufrieden und auch stolz. Es war nämlich "ein schönes Stück Arbeit", das grüne Wahlprogramm zu schreiben. Als man schließlich fertig wurde, brach ein neuer Tag an "und die Vögel haben gezwitschert". Wahrscheinlich vor Freude. Alle sollen glücklich werden, wenn es nach den Grünen geht. Nicht nur die Tiere, die natürlich weiter geschützt werden. Sondern auch die Menschen - vor allem jene, die noch keine Arbeit haben. Deshalb steht zum ersten Mal nicht die Ökologie im Kapitel Nummer eins, sondern Arbeit. Das Programm, das Roth und ihr Chefkollege Reinhard Bütikofer gestern präsentierten, ist "eines für alle". Oder, wie Bütikofer formulierte, "unsere Vorstellung davon, wie Politik im gesamtgesellschaftlichen Interesse gemacht werden soll". Ganz schön staatstragend. Aber auch ganz schön kreativ. Wer die vierzig Seiten durchliest, bekommt viel Stoff zum Träumen. Niemand muss mehr Angst vor Armut haben. Es gibt eine soziale, armutsfeste Grundsicherung und ein kostenloses Vorschuljahr für alle. Neue Umweltschutzideen schaffen Arbeit - und die wird gleichmäßig verteilt. Das bedeutet: mehr Jobs für viel mehr Menschen, bei kürzeren Arbeitszeiten, Mindestlöhnen und niedrigen Lohnnebenkosten. Alles solidarisch finanziert von den Starken, die den Schwachen helfen. Nach der Lektüre stellt man fest: Ja, es muss wirklich schön sein, in einem Land zu leben, in dem die Grünen an der Macht sind. Ach, das waren sie bereits? Fast hätte man es, vor lauter Glück, vergessen. Doch auch für jene, die sich noch daran erinnern, dass die Grünen in den letzten sieben Jahren mitregierten, ohne dass auch nur eine dieser schönen Ideen umgesetzt wurde, hält das Programm Erklärungen parat. So 69 ist ein eigenes Kapitel den "schwarzen und roten Blockaden" gewidmet, die leider, leider eine schnellere Politik für das allgemeine Glück verhindert haben. Die CDU etwa, erfährt man, habe ihre Zustimmung zu den notwendigen Reformen "mit erpresserischen Forderungen verbunden". Daraus lässt sich zwar der böse Umkehrschluss ziehen, dass sich die Grünen bereitwillig erpressen ließen. Aber was hätten sie auch tun sollen? Schließlich stand als Partner nur eine "strukturkonservative Partei der großen Konzerne", die SPD natürlich, zur Verfügung. Was man daraus nun wieder folgern soll? Eine rot-grüne Perspektive für die Zukunft kaum. Eigentlich legt das Programm nur einen Ausweg nahe: eine absolute Mehrheit für die Grünen, die aus ihren Fehlern (doch, die gab es!) gelernt haben. "Es war ein Fehler", schreiben sie, "die Arbeits-, Wirtschaftsund Sozialpolitik in den letzten Jahren zu stark der SPD zu überlassen." Vor nicht allzu langer Zeit klang das noch anders. Da priesen sich die Grünen als "Reformmotor", der den notwendigen Umbau des Sozialstaats erst richtig in Gang brachte. Als CDU-Politiker im Osten wagten, an Hartz IV herumzumäkeln, beschimpfte sie Bütikofer als "Memmen" und "Weicheier". Auch Kritik aus eigenen grünen Reihen wurde abgebügelt. Vorbei. Inzwischen sagt der Parteichef selbst, zunehmend sensibler, Hartz IV sei doch "nicht armutsfest". Und einige Forderungen der Linken, wie Grundsicherung und höhere Besteuerung von Reichen, wurden aufgenommen. Vage. "Wir formulieren keine Details", erklärte Bütikofer. Es gehe um "Grundlinien". Ob sich damit die Parteitagsmehrheit Mitte Juli auch begnügt? Der Chef der Grünen Jugend, Stephan Schilling, und Fraktionsvize Christian Ströbele kündigen bereits Änderungsanträge an: "Etwas konkreter muss es schon werden." taz Nr. 7696 vom 22.6.2005 Hier sollen - beispielhaft - Kommentare und »Schwerpunkte« als Vorlagen für Diskussionen über Themen folgen, die eine Weile lang aktuell sein werden, bis sich die Machtverhältnisse in der einen oder anderen Richtung verschoben haben: Süddeutsche Zeitung 04./05.05.02 (Auch zur BT-Wahl 2005 in den Grundzügen immer noch aktueller Ausschnitt aus einem Interview) JÜRGEN TRITTIN: Es geht nur noch um die Alternative Rot-Grün oder Schwarz-Gelb „Die Kanzlerfrage entscheiden die kleinen Parteien“ Trittin: [...] Die Wurst, um die es geht, ist, wer dieses Land künftig regiert. Da gibt es zwei Angebote, die sich klar unterscheiden. Und Frankreich hat gezeigt, dass bei einer solchen Wahl kein Platz für Denkzettel oder andere Strafaktionen ist. Davon profitiert die politische Rechte. Das müssen auch wir unserer Wählerschaft vermitteln. SZ: Rot-Grün scheint weit von einer Mehrheit entfernt zu sein: Sehen Sie nicht die Gefahr, dass auch grüne Sympathisanten Schröder wählen, um zumindest Stoiber zu verhindern? Trittin: Die Wahl wird nicht entschieden zwischen Union und SPD. In der Frage, wer das Land regiert, gibt es eine eindeutige Alternative: Rot-Grün oder Schwarz-Gelb. Das ist seit SachsenAnhalt klar. Damit ist auch das Blinzeln der SPD zur FDP vorbei. Schröder hat verstanden, dass die FDP sich maßlos überschätzt. Sie glaubt, sie ziehe sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf, und wird bald merken, dass sie nur eine Perücke in der Hand hat. SZ: Schröder sagt, es gehe um „der oder ich". Trittin: „Der alleine oder ich alleine“ ist nicht die Kanzlerfrage. Die Kanzlerfrage entscheidet sich über das Abschneiden der kleinen Parteien. Und da muss jeder wissen, auch der Grüne, ob er lieber Zuhause bleibt, oder ob er die PDS unterstützt, deren grandiose Regierungskünste man gerade in Berlin beobachten kann, oder ob er die FDP wählt, deren Vize Möllemann Verständnis für Terroranschläge der Palästinenser hat. SZ: Im Wahlprogramm der SPD steht nicht viel zur Umweltpolitik. Bei den Grünen ist es das erste Kapitel. Ist das die Arbeitsteilung in der Koalition? Trittin: Das hat mit Arbeitsteilung nichts zu tun: Es gibt keine andere Partei, die so sehr mit dem Thema Ökologie identifiziert wird und in diesem Bereich so hohe Kompetenzwerte erreicht. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir eine wirkliche Modernisierung des Standortes Deutschland 70 nur hinbekommen, wenn wir die ökologischen Aspekte beachten. Insofern gibt es da auch keine Konflikte mit der SPD. Wir liefern eher die Ergänzung. [...] SZ: Von so viel Eintracht sind Sie bei der Ökosteuer weit entfernt. Experten sagen, die Erhöhung müsse weiter festgelegt werden, damit sich die Wirtschaft darauf einstellen könne. Die Grünen wollen das nicht. Kuschen vor dem Kanzler? Trittin: Unsinn. Abgesehen davon, dass die Ökosteuer die deutsche Wirtschaft um jährlich 2 Milliarden Euro entlastet, gibt es Einvernehmen über den Grundsatz, dass der Verbrauch endlicher Ressourcen runter muss und dass dafür ein Preissignal notwendig ist. Und wir haben ja auch etwas erreicht: Die Kohlendioxid-Emissionen der privaten Haushalte sind um 18 Prozentpunkte niedriger als vor 4 Jahren. Das Prinzip ist also richtig. Wir werden die Öko-Steuer auch weiter ausbauen. Dennoch warne ich davor, das auf den Benzinpreis zu verkürzen. Wir brauchen eine umfassende ökologische Finanzreform. Da müssen dann auch die umweltpolitisch widersinnigen Subventionen von bis zu 30 Milliarden Euro jährlich angepackt werden, zum Beispiel für die Steinkohle oder die Landwirtschaft. Dieses Geld könnte man auch in Form von Steuersenkungen an die Bürger weitergeben, wenn auch nicht von heute auf morgen. SZ: Selbst die Union will die Ökosteuer nicht abschaffen. Da müssen Sie sich doch trauen, sie zu erhöhen. Trittin: Wir sind in der Frage als Bundesrepublik nicht frei, wir müssen uns auch an Vorgaben der EU halten. Das muss sich übrigens auch die Union klar machen. Die europaweite Schadstoffabgabe, die sie fordert, würde nach jetzigem Stand in der EU dazu führen, dass die Steuer in der Bundesrepublik erst einmal richtig hoch gehen würde. Im Vergleich zu anderen Ländern liegen wir nämlich auf diesem Gebiet eher im unteren Bereich. SZ: Gibt es für Sie und ihre Partei eigentlich für die nächste Legislaturperiode ein ähnlich identitätsstiftendes Projekt wie den Atomausstieg? Trittin: So eine grundsätzliche, historische Frage wie der Atomausstieg stellt sich nicht alle vier Jahre. [...] Märkische Oderzeitung 15.3.2002 Machtbewusste PDS will auf Platz drei Von UWE KRÜGER ... Mittelfristig, das haben die Linkssozialisten schon auf vorherigen Parteitagen betont, wird ein Mitte-Links-Bündnis im Bund angestrebt. „Die Regierung hat ... Arbeitsplatzversprechen nicht gehalten und mit Reformen die Superreichen bedient." Daraus wird der Schluss gezogen: „Deutschland braucht diese PDS, die gegen die Vorherrschaft des Großkapitals in Staat und Gesellschaft ankämpft ... In den alten Bundesländern ist es der PDS dagegen bislang nicht gelungen, flächendeckend zu punkten. ... konzentrieren sich die Linkssozialisten auf die neuen Bundesländer und zeigen damit, wo ihr eigentlicher Schwerpunkt liegt. Indirekt ist das das Eingeständnis, dass die PDS eine ostdeutsche Regionalpartei bleibt. WAHLSLOGANS 1972-1994 (aus: Monika Toman-Banke: Die Wahlslogans von 1949 bis 1994 in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 51-52/94 ; 23.12.1994, S.47-55) 1972: Deutsche. Wir können stolz sein auf unser Land. Wählt Willy Brandt (SPD) Wissen und Tatkraft. Bayern für Deutschland (CSU) F. D. P.- Laßt Vernunft walten 71 1976: Aus Liebe zu Deutschland. Freiheit statt Sozialismus (CDU) sicher, sozial und frei (CSU) Deutschland vor der Entscheidung: Freiheit oder Sozialismus (CSU) Der bessere Mann muß Kanzler bleiben: Helmut Schmidt. Deshalb SPD Leistung wählen. Die Liberalen (FDP) 1980: Diesmal geht's ums Ganze / Für die Regierung Schmidt/Genscher, gegen Alleinherrschaft einer Partei, gegen Strauß. Diesmal F. D. P. Bundeskanzler Helmut Schmidt: Sie können etwas für Ihr Land tun. Geben Sie Ihre Stimme meiner Partei. SPD. Franz Josef Strauß / Kanzler für Frieden und Freiheit (CDU) Strauß wählen / Den Sozialismus stoppen (CSU) 1983: Arbeitslosigkeit, Schulden, Pleiten / Nicht wieder SPD / Arbeit, Frieden, Zukunft / Miteinander schaffen wir's (CDU) Hoffnung für Deutschland (CSU) Beide Stimmen oder Lichtblick / 6. März (CSU) Im deutschen Interesse (SPD) Deutschland braucht wieder einen Bundeskanzler, der es packt. Hans-Jochen Vogel (SPD) Freiheit braucht Mut (FDP) 1987: Damit unsere Kinder leben können: Umweltsünder hart packen (SPD) Weiter so, Deutschland (CDU) Zukunft durch Leistung (FDP) 1990 (erste Wahl nach der Wiedervereinigung): Ja zu Deutschland / Ja zur Zukunft / Gemeinsam schaffen wir's (CDU) Freiheit / Wohlstand / Sicherheit (CDU) Genscher wählen. FDP wählen / Die Liberalen / Das liberale Deutschland Oskar Lafontaine / Der Neue Weg / Ökologisch, sozial, wirtschaftlich stark (SPD) 1994: Freu' Dich auf den Wechsel, Deutschland (SPD) Damit es weiter aufwärts geht / Sicher in die Zukunft (CDU) Diesmal geht's um alles (FDP) Freiheit statt Volksfront (CSU) Danach gab es als inhaltsleere Geschwätzigkeit: 1998 Keep Kohl (CDU) Wir sind bereit / Innovation und soziale Gerechtigkeit (SPD) 2002 Zeit für Taten CDU Wir tun was für Deutschland SPD / Wir in Deutschland SPD Wir sorgen für Bewegung FDP Als »Krönung« inhaltsleerer Wahlwerbung kann die (vorgeblich) politisch gemeinte Wahlwerbung der PDS im sächsischen Landtagswahlkampf 2004 angesehen werden: 72 „Apfelsinen und keine Orangen“. (STERN 02.09.04) [Laut Wörterbuch sind Apfelsinen und Orangen Synonyme!] II. Der Bundestag und die Abgeordneten Die SPD lag 2002 mit einem Zweitstimmenvorsprung von insgesamt nur 6.027 Stimmen vor der CDU/CSU; das entspricht 0,01 % der Wähler; der bisher knappste Vorsprung zwischen den beiden großen Parteiblöcken, wobei der Vorsprung der SPD gegenüber der CDU in manchen Gebieten Ostdeutschlands zweistellig war. Erstmals seit 1949 gelang es keiner der beiden großen Parteiblöcke, über die 40-%-Marke zu kommen, da SPD und CDU/CSU je 38,5 % der Zweitstimmen auf sich vereinen konnten. Die Bundestagswahl 2002 erbrachte im Einzelnen folgendes Ergebnis des Wählervotums (Auszug): Gegenstand der Nachweisung Wahlergebnis der Wahl zum 15. Deutschen Bundestag 2002 Erststimmen Zweitstimmen Wahlberechtig- 61 432 868 te x Wähler x x 79,1 -3,1 741 037 1,5 0 586 281 1,2 Gültige 47 841 724 98,5 0 47 996 480 98,8 0,1 SPD 20 059 967 41,9 -1,9 18 488 668 38,5 -2,4 251 94 37,45 CDU 15 336 512 32,1 -0,2 14 167 561 29,5 1,1 190 43 22,63 CSU 4 311 178 9 1,7 4 315 080 9 2,2 58 12 20,69 GRÜNE 2 693 794 5,6 0,7 4 110 355 8,6 1,9 55 32 58,18 FDP 2 752 796 5,8 2,7 3 538 815 7,4 1,1 47 10 21,28 PDS Gesamt/ Mittelwert 2 079 203 4,3 -0,6 1 916 702 4 -1,1 2* 603 2 193 100,00 Ungültige 48 582 761 x % Anzahl % 61 432 868 x Veränderung zu 1998 in %Punkten x 48 582 761 x x x 79,1 -3,1 -0,1 Sitze Veränderung zu 1998 in %Punkten x Wahlbeteiligung Anzahl Sitze Frauenan- Frauenanteil abso- teil innerlut halb Partei % 32,01 * Die beiden als Direktkandidatinnen gewählten Abgeordneten der PDS haben weder einen Gruppen- und erst recht keinen Fraktionsstatus. Sie gelten als »unabhängige« Abgeordnete. Die Regierungskoalition aus SPD und den Grünen errang 2002 auf Grund des guten Wahlergebnisses von Bündnis 90/Die Grünen einen knappen Vorsprung von 577.567 Stimmen (= 1,19 % der Wähler) vor der Opposition aus CDU/CSU und der FDP, da die FDP weit unter ihren mit der propagierten 18-%-Kampagne hochgeschraubten Erwartungen zurückgeblieben war. SPD und Grüne ringen dieses Mal jeder für sich um Stimmen, wären auch zur Fortsetzung der Regierungskoalition bereit – was keine Änderung gegenüber der jetzigen Situation wäre -, doch davon scheinen beide bei realistischer Betrachtung der Wählerstimmung nicht mehr auszugehen, so dass die SPD sehen muss, eine möglichst gute Ausgangsposition für eine eventuell notwendige, auch schon von einigen ihrer Spitzenpolitiker ins Auge gefasste große Koalition zu erringen, die ihr linker Flügel aber ablehnt, der sich wieder mehr als »sozialdemokratisch« erkennen möchte, 73 ein "sozialeres Profil" der SPD fordert und mehr oder minder eingestandene Sympathien zu den Zielen der „Linkspartei. PDS“ mit ihren inzwischen unbezahlbar gewordenen Sozialstaatsversprechungen, „die kein Staat der Welt erfüllen kann“ (Freie Presse 20.08.05) empfindet. Die Linkspartei schürt die Illusion, dass der Sozialstatt ohne Rücksicht auf die Kosten und die wirtschaftliche Situation und Zukunft Deutschlands noch weiter ausgebaut werden könne, obwohl die »Schuldenuhr« jetzt schon schwindelerregend-astronomische Schuldenwerte des Staates anzeigt und es kaum etwas Unsozialeres gibt, als wenn die gerade das politische Sagen habende Generation unter Verstoß gegen jegliche Grundsätze von Generationengerechtigkeit Schulden macht, die von nachfolgenden Generationen getilgt werden müssen und so die nachfolgenden Generationen ihrer Zukunftsgestaltung beraubt, da alle verfügbaren Mittel für die Schuldentilgung verwandt werden müssen! Die ältere Generation darf nicht die Zechprellerin nachfolgender Generationen sein! Für den Ausgang der vorgezogenen Wahl 2005 zeichnet sich nach den Umfragen ein Sieg der Union ab, dessen in Mandate umgerechnete Höhe u.a. mit von dem Ergebnis für die unter der Führung der PDS neu formierte Linkspartei abhängt. Zweitstimmenanteil bei den bisherigen Bundestagswahlen (alle Angaben in %) CDU / CSU SPD FDP Grüne PDS Sonstige Wahlbeteiligung Nichtwähler 1949 31,0 29,2 11,9 27,9 78,5 21,5 1953 45,2 28,8 9,5 16,5 86,0 14,0 1957 50,2 31,8 7,7 10,3 87,8 12,2 1961 45,3 36,2 12,8 5,7 87,7 12,3 1965 47,6 39,3 9,5 3,6 86,8 13,2 1969 46,1 42,7 5,8 5,4 86,7 13,3 1972 44,9 45,8 8,4 0,9 91,1 8,9 1976 48,6 42,6 7,9 0,9 90,7 9,3 1980 44,5 42,9 10,6 1,5 0,5 88,6 11,4 1983 48,8 38,2 7,0 5,6 0,4 89,1 10,9 1987 44,3 37,0 9,1 8,3 1,3 84,3 15,7 1990 43,8 33,5 11,0 3,8 2,4 5,5 77,8 22,2 1994 41,4 36,4 6,9 7,3 4,4 3,6 79,0 21,0 1998 35,2 40,9 6,2 6,7 5,1 5,9 82,2 17,8 2002 38,5 38,5 7,4 8,6 4,0 3,0 79,1 20,9 CDU / CSU SPD FDP Grüne PDS Sonstige Wahlbeteiligung 2005 2009 2013 Nichtwähler Diese in Prozenten ausgedrückten Stimmanteile mussten und müssen natürlich unter den Bedingungen unseres Wahlsystems in seiner damals jeweils gültigen Fassung in die auf Grund dieser Werte errungenen Mandate umgerechnet werden, denn nur die errungenen Mandate entscheiden über die gestalterischen Möglichkeiten einer Regierung/skoalition. Die bisherige Mandatsverteilung im Deutschen Bundestag ergibt sich aus nachfolgendem Überblick. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die „gesetzliche Anzahl der Mitglieder“ des Parlaments mehrfach verändert wurde. Sie ist in der nachfolgenden Tabelle in der Spalte „Gesamtzahl“ abzulesen. 74 Sitzverteilung im Deutschen Bundestag nach den Wahlergebnissen bei den bisherigen Bundestagswahlen Gesamtzahl Sonstige 24 52 55 50 49 49 48 53 52 53 49 PDS 115 191 215 192 196 193 177 190 174 191 174 FDP CSU 131 151 169 190 202 224 230 214 218 193 186 B.90/ Grüne CDU 1949 1953 1957 1961 1965 1969 1972 1976 1980 1983 1987 SPD (Überschreitung der jeweiligen „gesetzlichen Mitgliederzahl“ des Parlaments durch Überhangmandate) 52 80 402 48 45 487 41 17 497 67 499 49 496 30 496 41 496 39 496 53 497 27 34 498 42 46 497 Wiedervereinigung 1990 239 268 51 8 79 17 662 1994 252 244 50 49 47 30 672 1998 298 198 47 47 43 36 669 Verkleinerung der gesetzlichen Zahl der Mitglieder ab 2002 auf 598 (299 mit der Erststimme gewählte Direktkandidaten plus 299 MdBs über die Landeslisten) 2002 251 190 58 55 47 2 603 2005 2009 2013 SPD CDU CSU Grüne FDP Linke Sonstige Gesamt Die (u.a. in Art. 121 GG so bezeichnete) gesetzliche Mitgliederzahl des Deutschen Bundestages war 1990 um die Zahl der Abgeordneten aus den neu gebildeten ostdeutschen Wahlkreisen erhöht worden. Sie beträgt seit der Verkleinerung des Parlaments und dem Neuzuschnitt der Wahlkreise zur Herstellung von mehr Wahlgerechtigkeit durch gleichen Erfolgswert der Stimmen mit der Wahl 2002 nunmehr 598 Mandate (299 Wahlkreis- oder Direktmandate plus - seit 1953 - die jeweils gleiche Anzahl an Listenmandaten, die davor nur 40 % der Direktmandate betrug). Daraus errechnet sich als Mittelwert: 61,4 Mill. Wähler bundesweit durch 299 Wahlkreise = 205.351 Wahlberechtigte pro Wahlkreis. Nunmehr soll auch die zulässige Abweichung in der Größe der einzelnen Wahlkreise um nicht mehr als 15 % nach oben (= 236.154 Wahlberechtigte) und unten (= 174.589) schwanken und auf absolute 25 % nach oben (= 256.689) und unten (= 154.013) begrenzt werden, bei deren Überschreiten auf Grund der Bevölkerungsentwicklung und der erheblichen Binnenwanderung von dem arbeitsplatzarmen Osten zum arbeitsplatzreicheren Westen unter Beachtung der Ländergrenzen(!) ein Neuzuschnitt der Wahlkreise - wie schon 1965, 1980 und zuletzt 2002 - zwingend vorzunehmen ist. Entsprechend dieser Neuregelung ist mit Gesetz vom 17.03.05 für die BT-Wahl 05 eine erste Wahlkreiskorrektur erfolgt. Wenn aber gleichviele Wahlberechtigte in einem Wahlkreis wohnen sollen, dann sind die Wahlkreise in dünnbesiedelten Gebieten zwangsläufig ausgedehnter als in Großstädten. So ist der ausgedehnteste Wahlkreis - in Mecklenburg-Vorpommern gelegen, mit weniger als 50 Einwohnern/km2 - so groß wie das gesamte Bundesland Saarland mit seinen vier Wahlkreisen! 75 Spiegel Online 22.09.02 76 In den neuen Bundesländern bereitet die Reduzierung der Mandate auf Grund der dramatisch zurückgehenden Bevölkerungsanzahl allen Parteien Kopfzerbrechen, denn die ostdeutschen Länder und Parteiorganisationen fürchten künftig eine geringere Repräsentanz im Gesamtparlament und damit das Problem, ihre speziell ostdeutschen Interessen nicht im gebotenen Maße zu Gehör bringen zu können! Diese Reduzierung der Interessenvertreter Ostdeutschlands durch den Bevölkerungsschwund wurde 2002 durch die selbstverschuldet geringe Wahlbeteiligung noch verstärkt!!! Wer seine Wähler nicht mobilisieren kann, den bestraft die geringere parlamentarische Repräsentanz! Beispiel für diesen Wirkmechanismus von einer Landtagswahl: Bei der bayerischen Landtagswahl 2003 hatte die CSU im Vergleich zur vorherigen Landtagswahl, bei der sie gemessen an den errungenen Parlamentssitzen nicht so fulminant gut abgeschnitten hatte, 2003 insgesamt ca. 120.000 Stimmen weniger erhalten. Weil aber 40 % der vorherigen SPD-Wähler die Teilnahme an der Wahl verweigert hatten, wirkte sich der absolut gesehen verlustreiche Stimmenanteil der CSUWahlkreisergebnisse gegenüber der Bundestagswahl 2002 bei der Landtagswahl 2003 wegen der insgesamt geringen Wahlbeteiligung prozentual aber so aus, dass sie - das erste Mal in der bundesdeutschen Parteiengeschichte - im Parlament eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Mandate errang! Neben der nunmehr grundsätzlich vorgesehenen Anzahl von 598 Abgeordneten gab es immer wieder eine Vergrößerung der Anzahl der Parlamentssitze durch sogenannte „Überhangmandate“. In der 15. Legislaturperiode gab es nach dem Neuzuschnitt der Wahlkreise zur Herstellung von in etwa einer gleich großen Anzahl von Wahlberechtigten pro Wahlkreis nur noch 5 Überhangmandate: Für die SPD aus Hamburg 1, Sachsen-Anhalt 2 und Thüringen 1 und für die CDU aus Sachsen 1. Damit erhöhte sich in der 15. Legislaturperiode die Gesamtzahl der Abgeordneten anfangs auf 603. Die Parlamentarier "Bonn ist Mittelmaß. Im Parlament sitzen nur solche, die nicht die genügende Intelligenz aufbringen und trotzdem zu viel Geld kommen wollen." So zitierte der STERN vom 26.03.92 den damaligen Bundesverkehrsminister Krause (CDU), der sich natürlich nicht als dem Mittelmaß zugehörig ansah und zusätzlich zu seinem Ministerposten selber auch noch Abgeordneter gewesen war und dadurch - wie damals üblicherweise alle anderen Minister auch – volle Mehrfachbezüge sowohl als Minister als auch ein „Schatteneinkommen“ als Abgeordneter vereinnahmen konnte, was aber später beschnitten und in einigen Bundesländern ganz abgeschafft wurde. „Das Image von Politikern ist schon seit längerem nicht mehr das Beste. Einerseits wollen die Menschen in ihnen Vorbilder sehen, zum anderen aber trauen sie ihnen von vornherein erst einmal alle Schlechtigkeiten zu. Recht machen können Politiker es der Bevölkerung anscheinend ohnehin nicht, egal, was immer sie tun oder unterlassen“ (Das Parlament 27.10.03). „Endlich weiß ich, was Wahlrecht bedeutet. Alle vier Jahre kann ich mitbestimmen, welchem Politiker ich zu einem üppigen Lebensabend verhalfen darf, und das schon im Alter von 55 Jahren.“ (Leserbrief K. H. Inzlingen STERN 21.11.02) „Wo kommen wir hin, wenn wir die politische Elite unseres Landes nicht mehr angemessen bezahlen?“ (Leserbrief T. K. Isernhagen STERN 21.11.02) Sind die Abgeordneten so schlecht, wie »Nestbeschmutzer-Kollegen« oder kochende Volksseelen manchmal behaupten? Was haben sie zu tun? Sind sie überbezahlt? 77 Aus einer Bundestagssitzung (FAZ 11.2.1964) • 17.00 Uhr: Der Abgeordnete Clemens Riedel, Bäckermeister aus Frankfurt (CDU), steht am Rednerpult des Bundestages und hält eine Rede. . . Auf der Regierungsbank lenkt der Bundesfinanzminister Dahlgrün die Betrachtung auf sich: er ist nämlich der einzige Minister, der anwesend ist... Die Bundesratsbank ist völlig leer... Im Plenarsaal sind 89 Abgeordnete. ... • 17.04 Uhr: Der Abgeordnete Riedel verlässt das Rednerpodium... Der Abgeordnete Dr. Albrecht Aschoff (FDP)... betritt das Podium. ... • 17.13 Uhr: Bundesinnenminister Hermann Höcherl kommt mit wehenden Rockschößen auf die Regierungsbank. ... Seinem Kollegen Dahlgrün wird das Wort erteilt: Schlusswort in der ersten Lesung über die Mehrwertsteuer. ... Die Abgeordneten Serres (CDU) und Behrens (SPD) lesen Zeitung. ... Mindestens ein Dutzend Abgeordnete von jetzt noch 76 Anwesenden lesen oder schreiben Briefe. • 17.22 Uhr: Der Bundesjustizminister Ewald Bucher nimmt neben dem Innenminister Platz ... Bucher versenkt sich sofort in tiefes Aktenstudium, obwohl der Abgeordnete Hermann Busse (FDP) einen Gesetzentwurf seiner Fraktion ... begründet, der in Buchers und Höcherls Ressort gehört. ... Mitten im Plenarsaal stehen ... die Abgeordneten Gradl, Blumenfeld und Bausch im Gespräch; der FDP-Abgeordnete Starke schlendert zur SPD hinüber ... zwei SPD-Abgeordnete lesen ein Groschenblatt. ... • 17.35 Uhr: Die Abgeordneten Brese (CDU) und Frau Korspeter (SPD) haben ein Gespräch begonnen ... • 17.42 Uhr: Von jetzt 83 Abgeordneten hören etwa 15 dem Redner zu. ... • 17.48 Uhr: Der Abgeordnete Fritz Sänger (SPD) auf dem Rednerpodium. Inzwischen haben Wehner und Schmitt-Vockenhausen in der ersten Reihe der SPD-Fraktion Platz genommen. Höcherl und von Hase, endlich auch Minister Bucher hören zu. ... • 18.00 Uhr: Noch immer spricht der Abgeordnete Sänger. Im Plenarsaal sind 52 Abgeordnete. Der Bundestag hat 519 Mitglieder; 64 sind beurlaubt, davon 14 zur Teilnahme an Ausschusssitzungen des Europäischen Parlaments; 22 sind jetzt im Bundestagsrestaurant zu entdecken. Da im Augenblick kein einziger Bundestagsausschuss tagt: Wo sind die übrigen 381 Abgeordneten? Es ist Mittwoch, der 5. Februar 1964. Daran hat sich – außer dem Datum, dem Thema und den genannten Personen – nichts geändert. Nachfolgend Ausschnitte aus einem Artikel aus dem Hamburger Abendblatt vom 30.3.1992 Spiegelbild VON ANDREAS THEWALT Aus nahezu jeder einschlägigen Meinungsumfrage oder wissenschaftlichen Studie der vergangenen Jahre quillt die immer gleiche ernüchternde Botschaft: Die weit überwiegende Mehrheit der Deutschen hat zum Bundestag ein gebrochenes Verhältnis und von den Abgeordneten eine miserable Meinung. Gleichzeitig aber geistern ziemlich krause Vorstellungen von der Arbeitsweise des Parlaments durch die Öffentlichkeit. Auch das finden die Forscher regelmäßig heraus. Kaum ein Stammtisch kommt aus ohne kollektive Aufregung über Plenardebatten vor leeren Abgeordnetenbänken, über die vermeintlich übertriebene Reiselust von Volksvertretern. Und wenn es ums liebe Geld geht, sind der Empörung kaum noch Grenzen gesetzt: Beim Stichwort Diäten steigt das Adrenalin in der gesamten Republik auf bedrohliche Werte. Man kann sich auch an der kräftigen Anhebung der Abgeordnetenbezüge reiben. Aber der Streit wird nie zu schlichten sein. Denn wer könnte zweifelsfrei festlegen, welche Besoldung angemessen wäre? Selbstverständlich lässt sich bei manchem Volksvertreter auch Kritikwürdiges finden. Es gibt faule Abgeordnete, es gibt auch dumme, hintertriebene und welche, denen man keinen Gebrauchtwagen abkaufen würde. Zeitgenossen solchen charakterlichen Zuschnitts finden sich leider überall, aber gottlob überall als Minderheit. Das ist im Bundestag nicht anders. Insofern ist das Parlament Spiegelbild der Gesellschaft: Die weit überwiegende Mehrheit der Abgeordneten gehört aber nicht an den Pran- 78 ger. Wer Parlamentarier ist, der zahlt mit einer 70-Stunden-Woche und mit FreizeitVerzicht. Er lebt viel aus dem Koffer, hastet im Wahlkreis von Verein zu Verein, hat sich im Jahr schnell um mehrere tausend Eingaben von Bürgern zu kümmern und wird viel Geld los für Spenden, Ehrenpreise und Mitgliedsbeiträge verschiedenster Art. In Bonn sitzt er in manchem der über 200 Ausschüsse, Arbeitskreise und Gremien des Bundestages. Da wird viel Sachverstand verlangt. Es ist ein weitverbreiteter Irrtum zu glauben, die Politik machten einige wenige Mächtige in Parteizentralen, Koalitionszirkeln oder in Kungelrunden beim Kanzler unter sich aus, und die Parlamentarier nickten deren Beschlüsse nur noch willfährig ab: Gesetzgebungsarbeit ist Kärrnerarbeit. Geleistet wird sie zum Gutteil von eher unbekannten Hinterbänklern, die mehr Prügel als Lob kassieren, weil es selten allen recht zu machen ist. Man muss Parlamentarier deshalb nicht bemitleiden. Sie haben ihr Los frei gewählt. Man wird aber bei genauem Hinsehen anerkennen müssen, dass ein Großteil der Abgeordneten über jeden Eigennutz hinaus mit viel Engagement und Fleiß etwas aufbringen, was in unserer Gesellschaft selten geworden ist: Einsatz für die Gemeinschaft. Der zahlt sich auch aus, denn unser Staatswesen ist ja keineswegs in schlechter Verfassung. Kritik muss sich das Parlament dennoch gefallen lassen. Schließlich lebt Demokratie vom Meinungsstreit. Wer aber Abgeordnete angreift, sollte nicht eilfertig deren Redlichkeit bezweifeln. Das wird weder ihrer Rolle noch ihrer Leistung gerecht. „Der ideale Politiker, der all den Ansprüchen der Bürger gerecht wird, ist ein gebildeter Mensch, nach Möglichkeit aber „einer von uns", der die Sprache des "einfachen Mannes" spricht. Er kennt sich mit allen Gesetzen und Vorschriften sowie in den Labyrinthen der Verwaltung glänzend aus, damit er jedem Petenten zu seinem Recht verhelfen kann, ist aber keinesfalls Beamter. Das Einkommen des idealen Abgeordneten liegt nur geringfügig unter dem Sozialhilfesatz. So ist es ihm ein leichtes, für jedes Sportturnier oder jede Rassekatzenausstellung in seinem Wahlkreis einen Pokal zu stiften, ganze Festzelte mit Freibier zu bewirten und jede Spendenaktion großzügig zu unterstützen. Daneben bildet er fleißig Rücklagen für die Zeit nach dem Mandat, denn bei der Altersversorgung begnügt er sich mit einer Mindestrente. Der Idealparlamentarier nimmt an jeder Plenardebatte von der ersten bis zur letzten Minute teil, glänzt mit frei vorgetragenen Sachbeiträgen zu jedem behandelten Thema, hat aber immer Zeit, um Besuchergruppen zu empfangen oder an Vereinsfesten teilzunehmen. Er schlägt keine Einladung aus und bleibt bis zum Ende jeder Veranstaltung, führt aber ein vorbildliches Familienleben und ist am Wochenende ab 7 Uhr morgens für jedermann erreichbar. Der Traumpolitiker kämpft eisern für Recht und Gesetz, was er mit der Fähigkeit verbindet, jeden Schwarzbau nachträglich genehmigen zu lassen. Er sorgt dafür, dass Umgehungsstraßen zügig gebaut werden, ohne dass dabei ein Grashalm geknickt wird. Er übernimmt Verantwortung in einem Dutzend von Vereinen und Organisationen, hütet sich aber vor jeder Ämterhäufung. Mit dem politischen Gegner geht er hart ins Gericht, wahrt dabei aber stets hohe Streitkultur.“ Edmund Stoiber auf dem Passauer Symposion zur Parteiendemokratie, abgedruckt in: Das Parlament Nr. 46; 06.11.1992 (Edmund Stoiber: Seit Mai 1993 bayerischer Ministerpräsident, zur Bundestagswahl 2002 Kanzler-Kandidat der CDU/CSU) Verobjektiviert wurde die wöchentliche Arbeitszeit der Abgeordneten – unterschieden nach den 21 Sitzungswochen (= 40 % der Abgeordnetentätigkeit im Jahre 2004) und den 31 sitzungsfreien Wochen (= 60 % der Abgeordnetentätigkeit im Jahre 2004) – mit folgenden wohl kaum geschönten 79 Näherungswerten angegeben, die man einfach braucht, wenn das Mandat gewissenhaft wahrgenommen wird: In Sitzungswochen: 28 Stunden für Sitzungen in der Fraktion, den Ausschüssen und dem Plenum 19 Stunden für Informationen und Kontakte zwischen den Abgeordneten, mit Sachverständigen, Wahlkreisbesuchern, Presse, ... 18 Stunden Verwaltungsroutine für das Lesen der Bundestags- und Fraktionsdrucksachen, von Presseberichten, Erledigung von Post und E-Mails, ... 7 Stunden für die Ausarbeitung von Reden und fachliche Vorbereitung 9 Stunden Reisen zu Tagungen, in den Wahlkreis, zu Veranstaltungen Summa summarum eine 81-Stunden-Woche, die man sich nur dann aufbürdet, wenn man eine Leidenschaft für das politische Geschehen und politisches Mitgestalten hat (oder als Narziss »etwas darstellen« will). In sitzungsfreien Wochen: 33 Stunden für Informationen und Kontakte innerhalb der örtlichen Parteigremien und im Wahlkreis 12 Stunden für Weiterbildung, die Einarbeitung in gesellschaftspolitisch relevante Themen, der Besuch von Kongressen 12 Stunden Verwaltungsroutine 5 Stunden für Sitzungen mit örtlichen Parteigremien 17 Stunden für Sonstiges, u.a. für Reisen, Beruf, Parteikongresse mit ihren nächtlichen Diskussionen Auch fast eine 80-Stunden-Woche! In seiner 14. Legislaturperiode tagte unser Bundesparlament in 253 Plenarsitzungen und 2.644 Ausschuss- und Unterausschusssitzungen. Es hatte 869 Gesetzesvorlagen beraten. Für diesen Arbeitsaufwand und diesen zeitlichen Einsatz mit dem damit verbundenen erheblichen permanenten(!) Freizeitverzicht werden die Abgeordneten wirklich nicht zu hoch bezahlt! Erstaunlich ist nur, dass in der 15. Legislaturperiode 370 der 601 Abgeordneten neben der pauschal errechneten 80-Stunden-Woche, die - wie Abgeordnete, die ihr Mandat ernsthaft wahrnehmen, glaubwürdig versichern - für die gewissenhafte Wahrnehmung des Mandats auch wirklich benötigt wird, noch Zeit für gemeldete lukrative Nebenjobs finden, an deren Bezahlung gemessen die Diäten inklusive aller anderen Zuwendungen teilweise nur ein kleines Zubrot sind! Der in der 15. Wahlperiode verstorbene ehemalige Wirtschaftsminister Rexrodt mit „Zweitl(!)ohnsitz“ in Berlin war z.B. neben seiner Abgeordneten-Nebenerwerbstätigkeit und seiner Funktion als Kassenwart seiner Partei und ihr Berliner Landesvorsitzender des weiteren als Berater und Gutachter mehrerer Firmen und Versicherungen, als Kurator in Vereinen und Stiftungen und als zehnfacher Aufsichts- und Beirat diverser Unternehmen tätig. Gut eineinhalb Seiten füllten die aufgeführten Hauptjobs des liberalen Volksvertreters im Bundestags-Handbuch. Parteiinterne Kritiker sprachen darum laut STERN 22.01.04 von einem „Nebenerwerbs-Politiker“, einem „Lobbyisten, der sein Mandat als Betriebsplattform benutzte“ und dadurch, dass er seine Hauptarbeitskraft in seine privatwirtschaftliche Erwerbstätigkeit statt in seine Abgeordnetentätigkeit steckte, „Diätenbetrug“ begangen hätte. Dann muss er natürlich während der Sitzungen des Deutschen Bundestages oft fehlen: Spitzenreiter in der Fehlliste ist der CSU-Abgeordnete Dr. Gauweiler, der jede dritte Sitzung versäumte – und während der Zeit als Rechtsanwalt (RA) ein Mehrfaches verdiente, als er als MdB erhält. „’Laut Grundgesetz steht es Abgeordneten frei, ob sie an Sitzungen teilnehmen oder nicht’, verteidigt sich Gauweiler“ (STERN 03.02.05) Bei den Sitzungen nicht so oft fehlen muss, wer mehr Tage arbeitet, als das Jahr überhaupt Tage hat: 80 „CDU-Politiker arbeitet 407 Tage pro Jahr - Merkel verhängt Maulkorb Der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Bietmann macht das Unmögliche möglich. Er arbeitet an mehr Tagen als das Jahr überhaupt Tage hat - nämlich an 407. Als Bundestagsabgeordneter arbeitet er 220 Tage und für seine Nebentätigkeiten braucht er 187 Tage. Neben der Arbeit im Parlament ist Bietmann unter anderem auch bei einer Kanzlei, bei Stromversorgern, Banken und der Kirche angestellt. Kommentieren durfte er dies jedoch nicht, denn Fraktionschefin Merkel hat einen Maulkorb verhängt. So dürfen sich CDU-Fraktionsmitglieder nicht an Umfragen zu Nebenjobs beteiligen. An der Fraktionssitzung der CDU, die die Nebenjobs zum Thema hatte, nahm Bietmann nicht teil.“ (stern shortnews 25.01.05) Der Kölner CDU-Abgeordnete Bietmann ist Rechtsanwalt und MdB – in dieser Reihenfolge: „Er ist der Chef einer großen Kanzlei von Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern, Professor in Erfurt, Stadtrat in Köln und Mitglied in neun Aufsichtsratsgremien. Allein für diese ist er 187 Arbeitstage im Jahr tätig, recherchierte das TV-Magazin ’Kontraste’“ (STERN 03.02.05) Dessen Reporter hatten die Institutionen, Verbände, Gremien, … angerufen, die der Abgeordnete im Bundestagshandbuch als Nebentätigkeitsjobs angegeben hatte, und nachgefragt, wie viele Tage im Jahr der Abgeordnete für sie arbeite. Diese Angaben waren addiert worden. Das Ergebnis waren die genannten 187 Tage. „Bezahlte "Nebentätigkeiten" von Abgeordneten sind in mehrfacher Hinsicht bedenklich: Sie führen zu fragwürdigen Einkommensunterschieden unter den Abgeordneten (deren Chancen bezüglich einer lukrativen Nebentätigkeit sehr unterschiedlich sind), sie entziehen den Abgeordneten Zeit und Kraft für ihre eigentlichen Aufgaben und sie ermöglichen sachwidrige Einflüsse von Verbänden und Unternehmen, die Abgeordnete (als Funktionäre, Berater oder Angestellte) in ihre Dienste nehmen, wobei häufig fraglich und kaum kontrollierbar ist, ob die betreffenden Abgeordneten für ihr Salär eine angemessene Gegenleistung erbringen.“, fasst der Jurist Hippel die Bedenken zusammen (FR 23.06.05) Da bliebe als Lösung des Problems nur eine angemessene Bezahlung der Abgeordnetentätigkeit, verbunden mit dem Verbot anderweitiger „Erwerbstätigkeit“. Das ist in anderen Ländern wie z.B. den USA so geregelt: Dort dürfen Kongressmitglieder keinen Beruf ausüben und Nebeneinkünfte maximal in Höhe von 15 Prozent ihrer Diäten beziehen. Vielleicht sollte die Führung eines eigenen Unternehmens oder die Verwaltung eigenen Vermögens von dem „Nebenerwerbsverbot“ für Abgeordnete ausgenommen werden. Doch wenn Abgeordnete eigene Unternehmen weiterführen dürfen, dann müssten z.B. Rechtsanwälte ihre Praxen weiterführen und damit Mandanten betreuen dürfen, Unternehmensberater ihrer Tätigkeit weiterhin nachgehen dürfen – was wieder mindestens sehr nah an Lobbyistentätigkeit ranreicht. Häufig lassen sich Mandat und Mandant vorteilhaft miteinander verbinden: „Bundestag ist Anwalts Liebling“ betitelte deshalb der STERN einen diesbezüglichen Artikel: Von den 117 Juristen unter den MdBs sind 70 als Anwälte tätig, manche »nebenbei«, andere hauptberuflich. Das ist sehr praktisch: Abgeordnete müssen es dem Bundestagspräsidenten melden, wenn sie von einem Großkonzern Gehalt beziehen, wer hingegen dieselben Konzerne juristisch berät, darf das aus Gründen des „Mandantenschutzes“ verschweigen. Man hat bisher kein eindeutiges Abgrenzungskriterium gefunden, hat sich aber andererseits auch nicht nach skandinavischem oder angelsächsischem Vorbild zu der Verpflichtung für Abgeordnete zu totaler Transparenz entschließen können, obwohl man dort beobachten kann, dass eine solche Regelung durchaus praktikabel ist. Abgeordnete, wie z.B. der Abgeordnete der Grünen Ströbele, die bewusst keine Nebenjobs haben – Ströbele ist nur Nominalanwalt einer kleinen Kanzlei, ohne dort zu arbeiten -, sagen in Fernsehrunden, dass sie bei dem zeitlichen Einsatz, den ernsthafte Abgeordnetentätigkeit erfordert, gar keine Zeit für eine Nebentätigkeit fänden. So sah es auch das BVerfG in einem Grundsatzurteil 1975 und 15 Jahre später eine unabhängige Expertenkommission, die 1990 feststellte, dass das ernsthaft und verantwortlich wahrgenommene Mandat „die volle Arbeitszeit und Arbeits- 81 kraft eines Menschen in Anspruch nimmt“ und auch die Kiesel-Kommission 1993, als die die „Unvereinbarkeit von Erwerbsberuf und Mandat“ konstatierte und die Kommissionen damit eine „angemessene“ Bezahlung und die überaus gute Ruhestandsversorgung der VollzeitAbgeordneten rechtfertigten. „Im Sinne der Erfinder der parlamentarischen Demokratie ist das Wirken der zahlreichen Nebentäter jedenfalls nicht. Ein Journalist, der 20 Stunden in der Woche nebenher für eine Partei Papiere schreibt – kann der noch objektiv über Politik berichten? Ein Bundesligaschiedsrichter, der in der Geschäftsstelle von Bayern München arbeitet, kann der noch unparteiisch pfeifen? Nur Abgeordnete unterstellen sich eine nachgerade übermenschlichen Fähigkeit zur Unabhängigkeit von ihren Finanziers. Quer durch die Parteien finden sich aber genügend Beispiele, das noch immer gilt: Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Zwischen den jeweiligen Nebentätigkeiten der Parlamentarier und ihren politischen Positionen gibt es jedenfalls eine große Nähe“ (STERN 20.01.05); und damit Raum für „Missverständnisse“ und bewusst vorgenommene mutwillige Verdunkelungsmaßnahmen. In dem „Wöchentlichen Zwischenruf aus Berlin“ schreibt der Stellvertretende Chefredakteur an anderer Stelle derselben Ausgabe sehr rigoristisch: „… der Job neben dem Mandat [ist] ein Anschlag auf das Mandat. Entweder ist der Job gar kein richtiger, dann ist das Tor zu Lobbyismus und Korruption aufgestoßen. Oder der Job wird vernachlässigt, was die Demokratie unterspült und Verfassung wie Abgeordnetengesetz verhöhnt. … Welchen Sinn hat eine laut Grundgesetz ’die Unabhängigkeit sichernde Entschädigung’, wenn sich Abgeordnete daneben doch in die Abhängigkeit eines Jobs begeben dürfen?“ Es gehe „um die Qualität von Politik und die Funktionsfähigkeit des Parlaments. Um Nebenerwerbs-Abgeordnete mit VollzeitDiäten oder Voll-Parlamentarier ohne Nebeninteressen. Die nicht lügen (müssen), wenn gefragt wird, warum das Plenum wieder mal so leer ist. Die im Bundestag und seinen Ausschüssen sitzen – statt in Kanzleien und Kontoren und damit den Beamten, die nebenher nicht arbeiten dürfen, das Terrain überlassen. Die anstelle anonymer Berater und Beamter jene Gesetze entwerfen oder zumindest verstehen, zu denen sie die Hände heben. Die sich den Küchenkabinetten und Kungelklubs widersetzen, die Parlamentarier und Parlamente als Marionetten und Puppentheater begreifen. Die Regierung und Fraktionsführung auf die Finger schauen. Die im Leben stehen, weil sie sich um das Leben ihrer Wähler in den Wahlkreisen kümmern. Wer das nicht kann oder will, darf nicht Abgeordneter werden. So einfach ist das.“ (Jörges im STERN vom 20.01.05) Der Abgeordnete Ströbele erklärt glaubwürdig, dass er sich wegen seiner zeitfressenden Abgeordnetentätigkeit als MdB überhaupt nicht um seine Rechtsanwaltskanzlei kümmern könne, auf die er als Freiberufler ja angewiesen bleibt, wenn er nicht mehr als Abgeordneter in den oder einen der nächsten Bundestage gewählt werden sollte. Dann muss er seine Anwaltskanzlei praktisch wieder neu aufbauen, denn ihm hält kein öffentlich-rechtlicher Arbeitgeber vier Jahre lang einen Arbeitsplatz frei, auf den er bei Nichtwahl zurückkehren könnte! Er steht dann vor einem schwierigen wirtschaftlichen Neuanfang mit Einkommenseinbußen, bis die Praxis vielleicht wieder ins Laufen gebracht werden und ihn und seine Familie ernähren kann. Wer als Anwalt, Dozent, Geschäftsführer oder in sonstiger herausragender Position während der Mandatszeit nicht weiterarbeitet, hat hinterher kaum eine Chance auf Rückkehr in seinen alten Job. „Er müßte als abhängiger Diäten-Junkie und stromlinienförmiger Soldat des Fraktionschefs mit allen Mitteln um seinen Verbleib im Parlament kämpfen. Dabei krankt das Parlament bereits an einem krassen Mangel an Mittelständlern und Persönlichkeiten mit Erfahrung aus der Privatwirtschaft“ (DIE WELT 08.01.05). Gegen Aufwandsentschädigungen für gesellschaftlich notwendige Tätigkeiten z.B. im Rahmen der Versichertengemeinschaft lässt sich ernstlich nichts sagen, zumal solche mehr oder minder ehrenamtliche Tätigkeit von Abgeordneten auch erwartet wird. Wenn die "Nebeneinkünfte" aber eine bestimmte Höhe überschreiten, stellt sich die Frage, ob die erwartete Gegenleistung Zeit genug für das steuerfinanzierte Mandat lässt – oder das Mandat zu einer mehr oder minder kaschierten Lobbyistentätigkeit des Abgeordneten entartet ist. Die Problemlage wurde in STERN 20.01.05 am Beispiel des CDU-Abgeordneten Reinhard Göhner aufgezeigt: 82 „Der Christdemokrat hat im Bundestag eher eine Art Zweitlohnsitz. Als Abgeordneter erhält er jährlich rund 84.000 Euro steuerfreie Kostenpauschale. Die Haupteinnahmequelle des 52 Jahre alten Juristen … ist die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Die sogenannte Nebentätigkeit als BDA-Hauptgeschäftsführer bringt Göhner pro Jahr gut 300.000 Euro ein – mehr als der Kanzler verdient. Wissen können das aber nur Insider. Denn der Veröffentlichungspflicht unterliegt allein der Job; wie viel der Einsatz seinem Arbeitgeber wert ist, sollen die Wähler nicht erfahren. … Damit keine Missverständnisse aufkommen: Was Reinhard Göhner macht, ist vollkommen legal. Aber ist es auch anständig? Wen vertritt er im Bundestag: das Volk, das ihn gewählt hat, oder seinen Arbeitgeber, an dessen (Über-)Weisungen er eigentlich gebunden ist? Wem dienen seine aus Steuermitteln bezahlten Mitarbeiter im Parlament: dem Abgeordneten oder dem BDA-Vertreter? Und lässt sich das überhaupt unterscheiden? Wenn der Mann mit dem akkurat gestutzten Vollbart im Bundestag redet, ist jedenfalls schwer zu erkennen, ob da ein CDU-Wirtschaftspolitiker spricht oder ein Arbeitgeberlobbyist. Egal, ob er gegen die Ausbildungsplatzabgabe wettert oder gegen den Kündigungsschutz, ’dieses Beschäftigungshemmnis’ – eine andere als die BDAPosition könnte Göhner kaum verfechten, schließlich, so urteilt dessen Parteifreund Kurt Biedenkopf, seien Verbandsfunktionäre durch ihren ’Arbeitsvertrag verpflichtet, die Interessen des Verbandes zu vertreten’. … Sie sind zumindest verglichen mit ihren Kollegen ohne Zubrot, allenfalls Teilzeitkräfte.“ Gleiches gilt für jeden anderen Banken-, Großkonzern- und Verbandsvertreter, eingeschränkt auch für Gewerkschaftsführer und -funktionäre, wenn sie sich über SPD-Listen in den Bundestag wählen lassen. Die IG-Metall z.B. bietet ihren Funktionären an, für – im Vergleich zu den Arbeitgeberverbänden - jedoch „nur“ maximal die Hälfte der alten Bezüge für sie tätig zu sein; allerdings müssen die dafür auch noch in ihrer alten Tätigkeit stundenweise arbeiten: sie erhalten – im Gegensatz zu manchen anderen Verbandsvertretern – kein Zusatzeinkommen ohne Arbeitsleistung. Aber diese Verbands- und Gewerkschaftsvertreter würden ja auch ohne ihre Verbandsanbindung ihre politischen Grundsätze vertreten, von deren Richtigkeit sie überzeugt sind und um die durchzusetzen sie sich der Partei angeschlossen haben, die ihren Vorstellungen am nächsten steht. Kein politischer Mensch, der in die Politik geht, ist interessenlos. Die grundgesetzliche Abgeordnetenprosa aus Art. 38 GG – „Sie [die Abgeordneten] sind Vertreter das ganzen Volkes“ - zeichnet ein wirklichkeitsfremdes Idealbild. Es wäre allerdings ein Fortschritt, wenn Interessensanbindungen dem Wähler vor der Wahl bekannt gemacht sind – was die SPD noch in dem letzten Vierteljahr vor der vorgezogenen Neuwahl durch ein Gesetz zu erreichen sucht - und sich Abgeordnete mindestens im Plenum des Bundestages eines „Fensterredenbeitrages“ enthalten müssten, wenn die Interessen ihres Arbeitgebers in irgendeiner Weise berührt sind. Doch die „Fensterreden“ im Bundestag sind nicht der entscheidende Teil ihrer Tätigkeit: die findet in den Ausschüssen statt, wenn Gesetzesvorhaben beraten werden. Sollten „interessengebundene“ Abgeordnete auch dort schweigen müssen? Sie sind oft die einzigen Sachverständigen, deren Sachwissen dringlich benötigt wird, um praktikable Gesetze zu erlassen – wenn keine Verbandsgegenmacht im Ausschuss sitzt allerdings leider oftmals zu Gunsten ihres Verbandes und zu Lasten der Bürger, wie der von Landwirten dominierte Agrarausschuss jahrzehntelang vorexerziert hat! Die Schlussfolgerung, die für die Abgeordneten daraus zu ziehend ist, die neben ihrer Abgeordnetentätigkeit als Bundestagsabgeordnete ausreichend Zeit für viele lukrative erwerbswirtschaftliche Nebentätigkeiten zu finden wissen (wie der oft wie Manna vom Himmel gefallene ehemalige Landesvorsitzende der FDP in Nordrhein-Westfalen, der darüber hinaus zuletzt – bis dato rechtlich zulässig - zur selben Zeit sowohl in NRW ein Landtags- und zusätzlich in Berlin ein Bundestagsmandat innehatte!!!) überlasse ich Ihnen! Nach der Gehaltsaffäre des vorletzten CDU-Generalsekretärs Laurenz Meyer (Monatseinkommen 13.000,-€, Nachfolger Kauder mit Rücksicht auf die Parteikasse nur 8.500,- €), der nach seinem Nichtausscheiden bei dem Energieriesen RWE rund 125.000 € zunächst von ihm so deklarierte (angebliche) Abfindung erhalten hatte (deren steuerlich begünstigte Zuwendung ja nur beim Aus- 83 scheiden aus einem Arbeitsverhältnis rechtlich zulässig ist), was doch sehr den Geruch von gut honorierter Lobbyistentätigkeit ausstrahlte, selber aber monatelang gefordert hatte, im Zuge der Hartz-IV-Reform die Zumutbarkeitsregelungen für Arbeitslose zu verschärfen und nun für alle erkennbar „öffentlich Wasser gepredigt und heimlich Wein getrunken“ (Heinrich Heine) und sich damit um seine politische Glaubwürdigkeit gebracht hatte, äußerte Bundestagspräsident Thierse noch vor dem Rücktritt Meyers am 21.12.04 gegenüber der FR glasklar: "Ganz pauschal finde ich, dass Abgeordnete Nebeneinkünfte nicht benötigen." Dies gelte vor allem, wenn ihnen "keine wirkliche Arbeitsleistung zugrunde liegt", große Konzerne ihnen aber trotzdem ein Gehalt bezahlen. „Wenn ich zur Wahl gehe, möchte ich Volks- und keine Firmenvertreter wählen. Und ich habe auch keine Lust, über ständig steigende Strom- und Gaspreise die Nebeneinkünfte jener Politiker zu finanzieren, die bei Energieversorgern auf der Gehaltsliste stehen“ (Leserbrief Blesing in STERN 27.01.05) SPD-Fraktionsvize Michael Müller ist dagegen, dass Abgeordnete überhaupt noch Nebentätigkeiten ausüben. "Wenn man sein Abgeordnetenmandat ernst nimmt, ist dies ein Vollzeit-Job." Allerdings gehen dann fast ausschließlich nur noch Berufspolitiker von der Uni und Beamte/Angestellte des Öffentlichen Dienstes mit Rückkehrrecht auf ihren Arbeitsplatz direkt in die Parlamente und es fehlte der Sachverstand aus anderen Bereichen der Gesellschaft, z.B. der von erfolgreichen Unternehmern, wenn die nicht als Verbandsvertreter Mitglied einer Partei werden und sich – selbstverständlich bei vollem Gehalt – als Interessenvertreter ihres Verbandes auf den Kandidatenlisten »ihrer« Partei aufstellen und in das Parlament wählen lassen. Im 15. Deutschen Bundestag stammt rund ein Drittel der 603 Mitglieder aus der Beamtenschaft, insgesamt 54 % sind als Beamte und Angestellte Angehörige des Öffentlichen Dienstes (davon sind – nur(?) - 50 Lehrer) und Funktionäre von Parteien und Verbänden (STERN 20.01.05). Nur 100 Parlamentarier sind in der freien Wirtschaft angestellt. Insgesamt 152 Abgeordnete sind selbständig tätig, die meisten davon im Handel. Auf deren wirtschaftlichen Sachverstand, auf Sachverstand aus allen gesellschaftlichen Bereichen ist ein Parlament aber angewiesen. Und da Abgeordnete bei der nächsten Wahl eventuell nicht wiedergewählt werden, wenn ihre Partei z.B. (eventuell erdrutschartig) einbricht wie die PDS, die in der 15. Legislaturperiode nicht mehr als Partei, sondern nur noch mit zwei Direktkandidaten im Parlament vertreten war, oder wenn ein Wahlkreiskandidat der anderen konkurrierenden Volkspartei das Wahlkreismandat gewinnt, ist auch der Arbeitsplatz als Mitarbeiter eines MdB recht ungesichert. Verbandsvertreter und öffentlich Bedienstete können bei Beendigung ihres Mandates problemlos auf ihren vom Arbeitgeber freigehaltenen Arbeitsplatz zurück. Große Firmen verhalten sich freiwillig ähnlich, aber ein Anspruch auf ein solches Verhalten seines privaten früheren Arbeitgebers hat ein Abgeordneter nicht. Und ein Freiberufler ist noch schlechter dran, wenn er keinen Betrieb hat, der während seiner Parlamentstätigkeit von einem Geschäftsführer weitergeführt wurde. Darum müssen viele Abgeordnete, die im Schnitt kaum zwei Legislaturperioden eine Parlamentsaufgabe wahrnehmen, den Kontakt zu ihrem früheren Arbeitsfeld aufrecht erhalten und Vorsorge für ihren Wiedereintritt in das Berufsleben jenseits einer Abgeordnetentätigkeit treffen; und das geschieht dann verständlicherweise oft in der Form einer Interessentätigkeit, die dem späteren Rückkehrer in den Zivilberuf Chancen eröffnet. Verbandsvertreter, die in den Bundestag einziehen und dort im Interesse ihres Verbandes Entscheidungen zu beeinflussen versuchen, wird von ihren Verbänden keine Schmälerung ihrer Einkommen für zusätzlich geleistete Arbeit zugemutet. Das Abgeordnetenstatut regelte bisher nur, dass die Höhe der nicht anmeldungspflichtigen Nebeneinkünfte weder 3.000 € im Monat noch 18.000 € im Jahr übersteigen dürfe. Höhere Einkünfte von „anderen“ als von der Bundestagsverwaltung gezahlte Diäten dürfen erzielt, müssen dem Bundestagspräsidenten aber gemeldet werden. Sie werden jedoch – im Gegensatz zu gesetzlichen Regelungen in manchen anderen Ländern – wegen des auch für Abgeordnete geltenden Steuergeheimnisses nicht veröffentlicht, sodass ein Wähler bisher nicht zu erkennen vermochte, wem oder welchen Interessen ein Abgeordneter sich - außer seinem Gewissen - verpflichtet fühlen könnte: kein Unternehmer, kein Unternehmen und kein Verband zahlt Zusatzeinkommen ohne die Hoffnung auf bevorzugte Berücksichtigung seiner Interessen. Schließlich ist auch in Unternehmenskreisen das Sprichwort bekannt: „Wes’ Brot ich ess’, des’ Lied ich sing’.“ Eine Zeitung spottete darum: „Die Bundesrepublik ist sozial geworden: Neben der Lohnfortzahlung im Sozialfall gibt es auch die Lohnfortzah- 84 lung im Mandatsfall.“ Und ein Schelm ist, wer Böses dabei denkt! SPD und Grüne brachten darum am 30.06.05, einen Tag vor der dann geplant negativ verlaufenen Vertrauensabstimmung, mit »Kanzlermehrheit« ein Gesetz durch, das – analog den Regelungen in manchen anderen Ländern – eine Offenlegungspflicht für Abgeordnete über ihr Zusatzeinkommen – von wem, wofür – statuieren soll. Nebeneinkünfte von Abgeordneten: Die Bundestagsabgeordneten müssen künftig alle Einkünfte aus Nebentätigkeiten beim Parlament angeben. Diese werden dann pauschaliert in drei Stufen veröffentlicht. Darüber hinaus wird klargestellt, daß Parlamentarier außer Spenden keine Zuwendungen ohne entsprechende Gegenleistungen mehr annehmen dürfen. (HH A 01.07.05) Grünen-Fraktionsgeschäftsführer Volker Beck schlägt eine Verrechnung der Einkünfte aus Nebentätigkeiten mit den Diäten der Abgeordneten vor: "Man sollte die Einkommen ab einer bestimmten Grenze mit der Entschädigung der Bundestagsabgeordneten verrechnen, so dass der Anspruch auf Entschädigung abschmilzt", sagte Beck. Beck fordert, dass Nebeneinkünfte auf die Diäten angerechnet werden, sobald ein Abgeordneter mehr als die Hälfte seines Einkommens durch andere Verdienste erwirtschafte. Dabei sei "nicht die Grenze entscheidend", so der Politiker, "sondern das Prinzip, dass Nebentätigkeiten nicht die Arbeit im Parlament überlagern dürfen". Im Parlament gebe es leider ein paar Abgeordnete, die ihr Mandat als Möglichkeit für eine bessere Akquise in ihrem Hauptgeschäft betrachten würden. "Es ärgert mich, wenn Kollegen im Parlament faktisch nicht auftauchen oder ich von manchen Abgeordneten höre, sie müssten in der sitzungsfreien Zeit als Anwälte richtig Geld verdienen und hätten deshalb keine Zeit für eine Ausschussanhörung", erklärte Beck. Die Begründung für eine An-/Verrechnung der »Neben-(?)« oder Haupt(?)-Einkünfte mit den Diäten könnte sein: Wer seinen ihn beauftragenden Wählern seine aufgabengemäß voll einzusetzende Arbeitskraft teilweise entzieht, weil er etwas für ihn selbst finanziell Lukrativeres unternimmt, kann für die nur teilweise geleistete Arbeit auch nur eine Teilgratifikation beanspruchen, da sonst ein (rechtlich bisher nicht zu fassender) »Betrug am Wähler« vorläge; fraglich ist, ob eine solche Regelung gerichtsfest wäre, wenn ein Abgeordneter auf die Auszahlung seiner Diäten klagen würde. Darum ist es wohl klüger, Abgeordneten-Lobbyistentätigkeit gegen Bezahlung zuzulassen, die aber offengelegt werden muss: verdeckte Lobbyistentätigkeit mit undurchsichtigen Zahlungen darf es nicht geben, damit politische Entscheidungsprozesse durchschaubar bleiben. Der Wähler müsste vor der Wahl entscheiden können, ob er sich von jemandem vertreten lassen will, der sich – auf Grund seiner für ihn lukrativeren Nebentätigkeiten - den Wähleranliegen möglicherweise nur begrenzt widmen will und kann. Darum müssten Nebenjobs, die ein sich um ein Mandat Bewerbender nach seiner Wahl beizubehalten gedenkt, auf dem Wahlzettel vermerkt sein. Zur Klarstellung: Nach geltendem Recht müssen zwar entgeltliche Nebentätigkeiten ab einer Mindestgrenze beim Bundestagspräsidenten angezeigt und (nur) ihm muss die Höhe der anzeigepflichtigen Nebeneinkünfte offen gelegt werden. Einkünfte aus beruflichen Tätigkeiten hingegen müssen (in Deutschland!) jedoch – mit dem Verweis auf das Steuergeheimnis - bislang überhaupt nicht angezeigt werden; selbst dann nicht, wenn sie aus beruflicher Lobbyistentätigkeit stammen. In manchen Demokratien müssen sämtliche Einkünfte offen gelegt werden, auch die Einkünfte aus eigener selbständiger beruflicher Tätigkeit. Eine solche Regelung, gegen die sich bei uns die Politiker vehement sträuben, wird in angelsächsischen und skandinavischen Demokratien nach „Informationsfreiheitsgesetzen“ als unabdingbare Voraussetzung für das Funktionieren der Demokratie angesehen! Dort haben tatsächlich alle Abgeordneten „gläserne Taschen“. In diese Richtung wollen sich nach den Gehaltsskandalen 2004 die deutschen Politiker ein wenig mehr bewegen. Es solle für alle Bürger klar werden, "wer in der Politik wie viel, von wem und was erhält". Ausnahmen von der Pflicht zur Veröffentlichung soll es nur für den Bereich der "Berufsgeheimnisträger" wie etwa Ärzte oder Anwälte geben. Zum Schutz der Abgeordneten solle das Bundestagspräsidium auf Antrag die Zulässigkeit von Tätigkeiten und Einkünften beurteilen und feststellen, dass sie nicht zu beanstanden seien. Verstöße sollen mit Geldstrafen geahndet werden. Die Grünen appellierten an die Unternehmen, "grundsätzlich auf fortgesetzte Lohnzahlungen bei gewählten Abgeordneten zu verzichten". 85 Doch wie wird man Bundestagsabgeordneter? Indem frau/man sich in örtlichen und Landesparteigremien so lange tummelt, Verbindungen knüpft und Koalitionen schmiedet, zur Not, wenn sonst nichts mehr geht, je nach Charakter manchmal auch ein bisschen gegen Mitbewerber intrigiert (früher bei einigen CDU-Aufsteigern sehr beliebt: der zweckdienlich gemunkelte Vorwurf angeblicher Homosexualität des Konkurrenten), bis am Ende eine Kandidatur innerhalb der Partei erkämpft ist. Dann hat der Wähler das Wort. Ein einzelnes Bundestags-Abgeordnetenmandat kostete den Steuerzahler 2003 mit allen sich daraus ergebenden Kosten monatlich ca. 91.545,61,- €, wovon der Abgeordnete monatlich 7009,- € zu versteuernde Grundentschädigung (das eigentliche »Gehalt«, die in der attischen »Demokratie« von Perikles vor 2.500 Jahren - 457 v. Chr. - als zu zahlende Tagegelder eingeführten „Diäten“ des Abgeordneten, damit auch Nicht-Besitzende es sich leisten konnten, zur Förderung des Staatswohls Ämter für die Gemeinschaft zu übernehmen) plus gemäß § 12 Abgeordnetengesetz (AbgG) eine jährlich an die steigenden Lebenshaltungskosten angepasste steuerfreie Aufwandsentschädigung als Aufwandsentschädigung in Form eines pauschalen Kostenersatzes ohne Nachweispflicht über die tatsächliche Verwendung „zur Abgeltung seiner durch das Mandat veranlassten Aufwendungen“ für insbesondere Bürokosten (auch wenn er seine Arbeit so organisiert, dass er dafür nicht extra ein Büro anmieten muss) und, da es keine Sitzungsgelder gibt, seine Übernachtungskosten in Berlin während der Sitzungswochen, in Höhe von (2004) 3.551,- €, also einen teilweise zweckgebundenen und teilweise steuerfreien Gesamtbetrag in Höhe von 10.512,- € erhält. Hinzu kommen 9.000,- € Einmalzahlung pro Jahr für „Sachleistungen im Rahmen der Amtsausstattung des Berliner Büros“ (für insbesondere Büroklammern, Druckerpatronen, Schreibgeräte, Handykosten, …). Da ein Bundestagsabgeordneter seine Aufgaben im Parlamentsbetrieb nicht alleine wahrnehmen kann, er z.B. Personal benötigt, das ihm zuarbeitet, für ihn recherchiert und zeitfressenden Bürokram organisatorisch bewältigt, muss er am Sitz des Bundestages in Berlin zwei bis drei Mitarbeiter beschäftigen. Verliert der Abgeordnete sein Mandat, verlieren die Mitarbeiter – mit einer Kündigungsfrist von sechs Wochen zum Quartalsende - ihren Job. Rohrpost gegen Jobangst Von Yassin Musharbash Die Bundestagsneuwahl wird viele Mitarbeiter von Abgeordneten den Job kosten. Am Mittwoch wird die Bundesagentur für Arbeit deshalb erstmals im Bundestag selbst Beratung anbieten. Besonders in der SPD-Fraktion geht die Angst um. Berlin - Für alle Betroffenen, deren Nachname mit den Buchstaben A - L anfängt, findet der erste harte Blick auf ein mögliches neues Leben außerhalb des Parlaments am Mittwoch statt. Von 8 bis 16 Uhr, im Anhörungssaal 3.101 des zum Bundestag gehörigen Maria-Elisabeth-Lüders-Hauses, hält die Bundesagentur für Arbeit ihre erste Informationsveranstaltung ab; die zweite, für die Nachnamen zwischen M und Z, ist für den 13. Juli angesetzt. Für alle, die dort hingehen, wird es ein verfrühter, für die meisten ein trauriger Schritt sein: Bis zu 4200 Parlamentsbeschäftigte drohen durch die Bundestagsneuwahl arbeitslos zu werden; darunter sind etwa 2100 Mitarbeiter von Abgeordneten und den Fraktionen. "Ich hatte eigentlich vorgehabt, mich ab Ende des Jahres nach einer neuen Stelle umzusehen", berichtet ein 33-jähriger Mitarbeiter einer SPD-Abgeordneten aus NordrheinWestfalen. Doch die Ankündigung von SPD-Chef Franz Müntefering vom 22. Mai, dass seine Partei Neuwahlen anstrebe, hat diesen Plan zunichte gemacht. Die Suche nach einer neuen Beschäftigung muss jetzt extrem forciert werden, parallel muss der studierte Germanist auch noch einen hektischen Wahlkampf organisieren helfen. Die Begeisterung ist niedrig, der Frust dafür umso höher, zumal die Wiederwahlchancen der Abge- 86 ordneten gering sind. So geht es derzeit vielen Mitarbeitern, vor allem bei der SPD - die Umfragen sind miserabel, nach aktuellen Schätzungen drohen allein über 100 Direktmandate verloren zu gehen. Der sorgenvolle Blick in die Zukunft spiegelt sich auch in mehreren Rundschreiben, die von der "MitarbeiterInnenvertretung der SPD-MdB" seit der Neuwahl-Ankündigung an die Betroffenen versendet worden sind. "Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ereignisse haben sich in den letzten Tagen regelrecht überschlagen", heißt es in der ersten "Sonderrohrpost" vom 25 Mai. "Wir alle müssen auf unterschiedlichste Weise mit der neuen Situation klar kommen". Im Anhang: Ein Formular, in dem man unter anderem "Besonderen Qualifikationen" und "Berufswunsch, Vollzeit - Teilzeit" eintragen kann - erste Ansätze einer informellen "Jobbörse", zu der es weiter heißt: "Wir werden weiterhin in allen Gremien der Fraktion für die Mitarbeiterschaft die Werbetrommel rühren und versuchen, die betroffenen Kolleginnen und Kollegen unterzubringen." Ähnlich geht auch die CDU/CSU-Fraktion vor. "Flexible Handhabung" Denn auch die anderen Fraktionen haben ihre Mitarbeiter und die Mitarbeiter ihrer Abgeordneten schon vor Wochen über die rechtlichen Regelungen in Kenntnis gesetzt. Besonders wichtig: Bundestag und Bundesagentur haben sich auf kulante Fristen geeinigt, zu denen man sich arbeitssuchend beziehungsweise arbeitslos melden muss, um seine Ansprüche nicht zu schmälern. Eigentlich müsste dies drei Monate vor Beendigung der Tätigkeit geschehen. Weil aber dann noch niemand sicher sagen kann, ob sein MdB wieder ins Parlament einzieht, kann diese Deadline nicht eingehalten werden. Dass die Bundesagentur für Arbeit Informationsveranstaltungen abhält und nach der Wahl sogar ein Verbindungsbüro im Reichstagsgebäude einrichten wird, ist unterdessen nichts Ungewöhnliches. Ähnliche Vereinbarungen werden auch getroffen, wenn in Großunternehmen Massenentlassungen anstehen. Trotzdem wirft die Wahl Probleme besonderer Natur auf. Ein von der SPD"MitarbeiterInnen-Vertretung" aufgegriffenes Dilemma betrifft zum Beispiel den Bundestagskindergarten am Spreeufer: "Probleme zeichnen sich dann ab", heißt es im aktuellen Rundschreiben vom 1. Juli, "wenn das Beschäftigungsverhältnis hier im Haus wegfällt. Da es sich um einen Betriebskindergarten handelt, wäre nur eine Übergangsfrist von drei Monaten gewahrt. Danach müssten die Kinder aus der Einrichtung genommen werden." Hier bemühe man sich um eine "flexible und unbürokratische Handhabung". Siegesgewissheit bei der FDP Weit weniger detailliert sind die Handreichungen für Mitarbeiter von Abgeordneten aus der CDU/CSU-Fraktion gediehen - natürlich spielt dabei eine Rolle, dass den Umfragen zufolge eher Mandate hinzukommen als verloren gehen dürften. Problematisch ist die Neuwahl daher vor allem für jene Mitarbeiter, deren MdB nicht mehr antreten, weil ihnen für die Jobsuche weniger Zeit als gedacht bleibt. Der Tenor sei "eher entspannt" gewesen, erinnert sich eine Mitarbeiterin aus dem Büro einer CDU-Parlamentarierin, die das Rundschreiben nach der Lektüre auch gleich wieder gelöscht hat. Vor allem seien darin die rechtlichen Maßgaben enthalten gewesen - von Panik aber keine Spur. Bei der FDP, berichtet der Mitarbeiter eines liberalen Bundestagsabgeordneten, sei überhaupt keine Rundmail gekommen - abgesehen von einem Schreiben an alle Mitarbeiter, das die Bundestagsverwaltung verfasst hat, und in dem auf die AgenturVeranstaltungen und die Meldefristen hingewiesen wird. So sei das aber nun mal mit politischen Jobs auf Zeit, sagt der junge Mann, da könne man sich doch kaum beschweren, wenn die schöne Zeit ein Ende habe, zumal man ja "in einem Land lebt, indem man sich über die anschließende Versorgung nicht beschweren kann". Die Zuversicht, dass es zu einem Machtwechsel durch eine schwarz-gelbe Koalition kommt, ist hier nicht zu übersehen. Dabei steht die FDP derzeit in den Umfragen nicht einmal besonders gut da. Sonderfall Oppositionszuschlag Ein Sonderfall sind die Grünen. Auch hier droht der Machtverlust, doch dämmen zwei Umstände die Panik erheblich ein. Zum einen besteht für die Sonnenblumen-Partei nämlich nach allgemeiner Auffassung noch eine reelle Chance, dass das Ergebnis von 87 2002 gehalten oder verbessert werden kann und die Zahl der MdB gar nicht sinkt - anders als bei der SPD, wo das als Gewissheit gilt. Und zum zweiten: Selbst, wenn am Ende ein Stimmenverlust unter dem Strich steht, dürfte es bei den Grünen nur wenige Entlassungen geben. Denn traditionell fällt es den Grünen leichter als den anderen Fraktionen, ihre Leute in anderen Posten unterzubringen. Das Thema sei "ernst", aber "kaum jemand muss wirklich Angst haben", heißt es aus der Fraktion. Etwas gedämpft werden die Konsequenzen des drohenden Abzugs von den Fleischtöpfen der Macht übrigens durch einen Paragrafen im Abgeordnetengesetz, der den sogenannten Oppositionszuschlag regelt. Nach Paragraf 50, Absatz 2 erhält eine Fraktion in der Opposition mehr Geld als eine Fraktion gleicher Größe, die an der Regierung mitwirkt. Die Grünen mussten wegen dieser Regelung bei Regierungseintritt 1998 sogar Mitarbeiter entlassen. Vielleicht ist es die Erinnerung daran, die die Mitarbeiter bei CDU/CSU und FDP von Häme gegenüber ihren Kollegen abhält. SPIEGEL ONLINE 05.07.05 Glück haben die Mitarbeiter, die von „Nachrückern“ oder den neuen MdBs nach einer Wahl übernommen werden, was von denen meist gemacht wird, wenn die Mitarbeiter der eigenen Partei zuneigen, da die Mitarbeiter auf den Parlamentsbetrieb spezialisiert sind und sich in dem Geschäftsbetrieb auskennen. Insgesamt werden von allen Bundestagsabgeordneten rund 900 wissenschaftliche Mitarbeiter und 500 Sachbearbeiter, Sekretärinnen und Schreibkräfte beschäftigt. Für deren Bezahlung kommt die Bundestagsverwaltung gegen Nachweis bis zu einer immer wieder angepassten Höhe von zur Zeit insgesamt 9.910,00 € pro Abgeordneten auf (Stand 01.05.04), die aber nicht mehr – wie im EU-Parlament noch immer zulässig – für Mitarbeiter verwendet werden dürfen, die mit dem Abgeordneten verwandt, verheiratet oder verschwägert sind oder waren, um nicht so das „Familieneinkommen“ undurchsichtig zu erhöhen. (Einige Abgeordnete halfen sich bei dieser einschränkenden Neuregelung anfangs mit „Überkreuzbeschäftigungen“: „Stellst Du meine Ehefrau ein, dann stelle ich deine ein.“) Beschäftigt ein Abgeordneter solche ihm nahestehenden Personen, so werden die Kosten für ein solches Beschäftigungsverhältnis nicht ersetzt. Gemäß § 12 III AbgG: „Die Abrechnung der Gehälter und anderen Aufwendungen für Mitarbeiter erfolgt durch die Verwaltung des Bundestages. Eine Haftung des Bundestages gegenüber Dritten ist ausgeschlossen. Die Mitarbeiter sind nicht Angehörige des öffentlichen Dienstes. Es bestehen keine arbeitsrechtlichen Beziehungen zwischen den Mitarbeitern und der Verwaltung des Bundestages.“ bezahlt die Bundestagsverwaltung diese Mitarbeiter also nur, ist aber nicht deren Dienstherr und kann nicht von ihnen auf Lohnfortzahlung verklagt werden! Letztere Pauschale in Höhe von 9.910,00 € pro Abgeordneten für wissenschaftliche Mitarbeiter/Sachbearbeiter, Sekretärinnen und/oder eventuelle Schreibkraft wurde mit der Begründung auf diese Höhe angehoben, dass die Anzahl der Wahlkreise herabgesetzt worden sei und dadurch zwangsläufig die einzelnen Wahlkreise (im Mittelwert von vorher 185.244 auf nunmehr 205.351 Wahlberechtigte pro Wahlkreis) vergrößert worden seien: die Wahlkreise seien dadurch teilweise so groß geworden, dass ein zweites Abgeordnetenbüro im heimischen Wahlkreis eingerichtet werden müsse. (Wer kein zweites Büro einrichtet, erhält die erhöhte Pauschale ebenfalls, da das Geld ja „pauschal“, d.h. ohne einzelnen genauen Verwendungsnachweis, aus dem staatlichen Füllhorn ausgeschüttet wird.) Nicht in Anspruch genommene Gelder für Mitarbeiter verfallen. Nimmt ein Abgeordneter an vom Bundestagspräsidenten im Benehmen mit dem Ältestenrat festgelegten Sitzungstagen nicht an Sitzungen teil, ohne beurlaubt zu sein, so wird die Pauschale um 100,- € pro Sitzungstag gekürzt. Aufschlussreicher für die Beurteilung der Angemessenheit der (zu versteuernden) monatlichen Diäten und der (steuerfreien) monatlichen Aufwandspauschale ist die journalistische Verarbeitung 88 einer Aufstellung auf der Basis einer Vorlage der Bundestagsverwaltung für den Ältestenrat (STERN 20.03.03): „Aldi-Parlament Der Bundestag ist billiger als sein Ruf. Das drittgrößte Parlament Europas kostet samt allen Mitarbeitern, Fraktionen, Sach- und Reisekosten, Gebäuden und inklusive der [99; der Autor] Europa-Abgeordneten im Jahr 534,2 Millionen Euro. Auf jeden Bundesbürger entfallen damit jährlich 6,47 Euro. Pro Wähler gerechnet ist der Bundestag das billigste Parlament in der Europäischen Union. Das geht aus einer Vorlage des Bundestages an den Ältestenrat hervor. In Deutschland vertritt ein Abgeordneter im Schnitt 101 879 Wahlberechtigte – doppelt so viele wie im europäischen Durchschnitt (50 803). Entsprechend billiger sind die Abgeordneten. ...“ Die Aufwendungen für das Europa-Parlament beliefen sich im Haushaltsentwurf 2003 auf knapp 10,96 Mill. €, die für den Bundestag auf 552,020 Mill. €. Daraus ergibt sich: 552.020.000 € : 603 MdBs = 91.545,61 € Gesamtkosten pro Abgeordnete/n 552.020.000 € : 82.558.000 Einw. = 6,69 € pro Einwohner der Bundesrepublik Mit diesen in den europäischen Kontext gestellten aufschlussreichen Zahlen müsste sich jede sachliche Diskussion über die (hauptsächlich an der angeblich zu hohen Diätenregelung für die Bundestagsabgeordneten festgemachten Diskussion bezüglich der) Kosten für unser Bundesparlament erledigt haben. Jährlich 6,69 € pro Einwohner für die Kosten des gesamten Parlamentsbetriebes einschließlich Diäten, Zuschüssen zur Fraktionsarbeit, Reise- und Personalkosten, Gebäudeunterhaltung usw. müsste uns ein unser nationales Geschick lenkendes Parlament wert sein! Für einen Vergleich der Angemessenheit der »Mandatseinkommen« gegenüber in der Wirtschaft gezahlten Gehältern folgende Angaben: Laut STERN 28.11.02 verdiene bei Aldi, zusammengesetzt aus Tarifgehalt und Prämienzulage für den erreichten Umsatz, eine der drei bis vier normalen Filial-Arbeitskräfte, wenn sie als VollzeitArbeitskraft arbeiten könne, was meist nicht der Fall sei, 2.400,- € im Monat, der Filialleiter im weißen Kittel 3.400,- €. Jeder für sechs bis acht Filialen zuständige Bezirksleiter mit meist Fachhochschulausbildung erhalte 6.000,- € plus einen Mittelklasse-Audi als Dienstwagen, jeder für sechs bis acht Bezirksleiter verantwortliche Verkaufsleiter 10.000,- € monatlich plus Dienstwagen und jeder Geschäftsführer eines Zentrallagers ca. 17.000,- € plus einen Mercedes der E-Klasse als Entlohnung für die Verantwortung für ca. 500 Mitarbeiter und 60 bis 80 Läden. Diese an die Entlohnung von Abgeordneten heranreichenden oder deren Entlohnung übertreffenden Angestellten haben aber nicht die Zusatzkosten eines Abgeordneten für eine Sekretärin im Wahlkreis- und/oder Abgeordneten-/Bürgerbüro, Büromiete am Heimatort zur Abhaltung von Bürgersprechstunden, Telefon dort, Porto, die Miete für eine Zweitwohnung in Berlin oder Ersatz der in den Sitzungswochen anfallenden Hotelkosten zu tragen – und nicht deren Verantwortung für die Geschicke des ganzen Volkes! Manchem Abgeordneten bleiben nach Steuern, Beiträgen und Spenden netto nur 2.950,- € im Monat, wie es neben wenigen anderen Gleichgesinnten der sozialdemokratische Abgeordnete Michael Roth mit seiner ins Internet gestellten Steuererklärung belegt! Und das ist für eine solch verantwortungsvolle Führungsposition, wie sie ein Bundestagsabgeordneter qua Amt innehat, zuwenig! Da verdiente ein Fußballschiedsrichter 2005 bei einem einzigen 90-minütigen Einsatz in der 1. Bundesliga mit 3.068,- € (brutto) pro Spiel (seine Linienrichter-Assistenten und Zweitliga-Schiedsrichter erhalten 1.534,€), deren er im Schnitt zwei pro Monat leitet, als Nebeneinnahme mehr, als ein pflichtbewusster Abgeordneter nach vier mindestens 70-stündigen Arbeitswochen am Ende eines Monats zum Leben hat. Abgeordnete sind nicht überbezahlt! Aldi ist nur einer der Discounter in Deutschland. Bei den anderen Discountern wird sich eine ähnliche Gehaltsstruktur herausgebildet haben. An diesen Einkommen oder dem von Bankfilialleitern gemessen ist die Bezahlung der Abgeordneten wirklich nicht zu hoch! 89 Zum weiteren Vergleich die für 2004 ermittelten Mittelwerte der Gehälter von Geschäftsführern. Das durchschnittliche Jahresbruttogehalt eines Geschäftsführers unabhängig von Branchen- und Firmengröße liegt bei rund 95.000 Euro. Die Mehrheit aller Geschäftsführer arbeitet jedoch in kleineren Unternehmen mit einem bis 50 Mitarbeiter. Ihr Gehalt bewegt sich meist unterhalb von 100.000 Euro. Erfolgbeteiligung ist bei Geschäftsführern üblich. Die meisten der von PersonalMarkt untersuchten Geschäftsführer erhalten einen Großteil ihrer Bezüge in Form von variablen Gehaltsbestandteilen. So verfügen 76 Prozent über einen Firmenwagen, fast 40 Prozent bekommen eine betriebliche Altersvorsorge, und 56 Prozent erhalten erfolgsabhängige Prämien. Gehälter von Geschäftsführern Branchen, Top Five Durchschnitt Banken 238.458 € Luftfahrt 183.677 € Pharma 182.119 € Konsumgüter 171.472 € Autoindustrie 166.840 € Branchen, Low Five Forschungsinstitute 77.149 € Bildungsinstitutionen 76.796 € Hotels/Gaststätten 75.090 € Handwerk 71.644 € Soziale Einrichtungen 65.839 € SPIEGEL ONLINE 04.11.04 Ein Durchschnittskicker der Fußball-Bundesliga verdiente zu ungefähr derselben Zeit laut STERN vom 27.02.03 mit Prämien rund 34.000 € pro Monat! (Auch wenn er grottenschlecht kickte!) Der kann seinen Beruf allerdings nur ein kurzes Sportlerleben lang ausüben. Doch Abgeordnete für teilweise nur eine oder zwei Wahlperioden sind genau so kurz »am Drücker« und erhalten eine Altersentschädigung erst dann, wenn sie dem Deutschen Bundestag mindestens zwei Wahlperioden angehört haben. Bei einer aus persönlichen Gründen kurzfristigeren Dauer der Parlamentszugehhörigkeit – also abgesehen von vorzeitigen Neuwahlen: da wird die abgekürzte Wahlperiode als vollständig abgeleistet gewertet - werden sie in der gesetzlichen Rentenversicherung nachversichert. An anderen hohen Einkommen für nicht so verantwortungsvolle Tätigkeit gemessen werden die Abgeordneten wirklich nicht zu hoch bezahlt. Völlig unterbezahlt ist der „Vorstandsvorsitzende der Deutschland AG“, der Bundeskanzler: die Topmanager des Landes, die ein großes Unternehmen führen, erhalten oft das Zehnfache und mehr. Generellere Kritik übte Lufthansa-Aufsichtsrat Jürgen Weber: "Politiker sind absolut unterbezahlt. Der Bundeskanzler, der das Unternehmen Deutschland führt, bekommt nicht einmal das Gehalt eines mittelständischen Firmenchefs." Unternehmensberater Berger mahnte: "Gute Politiker, wenn wir sie denn haben, verdienen zuwenig. Die Position des Politikers ist viel zu schlecht bezahlt." Auch Prof. Rürup warnte, dass ein Wechsel in die Politik nur für Beamte, nicht aber für Führungskräfte der Wirtschaft attraktiv sei. Weil ein Bundeskanzler an der Bedeutung seiner Tätigkeit gemessen zu wenig verdient, muss wenigstens für eine angemessene Altersabsicherung gesorgt werden! Politikergehälter sind unter viel Freizeitverzicht hart erarbeitet. Das Wort „Diäten“ ist zu Unrecht zu einem Fäkalwort der Demokratie verkommen. Als Stein des Anstoßes bleibt nur die für die relativ 90 kurze Zeit der Mandatsinhaberschaft sich selbst zugestandene hohe Altersabsicherung: Nach achtjähriger Zugehörigkeit im Parlament erhält ein Abgeordneter mit dem 65. Lebensjahr eine Altersentschädigung von 1682,- Euro im Monat. Das sind 24 Prozent seiner Abgeordnetenentschädigung. Kein sonstiger Arbeitnehmer erhält nach 8-jähriger Mitarbeit in einem Unternehmen ein Viertel seiner monatlichen Bezüge als Rentenanspruch! Mit jedem weiteren Jahr Zugehörigkeit zum Bundestag entsteht der Pensionsanspruch ein Jahr früher als vor dem 65. Lebensjahr, frühestens jedoch ab dem 55. Lebensjahr. Vom 9. bis zum 23. Jahr der Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag erhöht sich die Pension um drei Prozent pro Jahr auf maximal 69 % der Diäten. Das sind 4836,- Euro im Monat. Die Diäten »orientierten« sich seit 1977 erstmalig – der Bedeutung des Amtes durchaus angemessen - an der Besoldungsgruppe B 6 für kommunale Wahlbeamte, seit der Neufestsetzung 1995 an dieser Gruppe oder an der von Richtern an einem obersten Bundesgericht der Besoldungsgruppe R 6 [ohne dass die Richter davon erhebliche(!) Zwangsabgaben an Parteigremien und eine Fraktionskasse leisten müssen(!)], lagen aber z.B. Anfang 2005 dann doch um ca. 950,- € unter diesem Niveau, denn die Gehälter von Richtern und (Ober-)Bürgermeistern werden im Zuge der allgemeinen Einkommensentwicklung problemlos erhöht, doch bei der wegen des 1975 ergangenen „Diäten-Urteils“ des BVerfGs von den Abgeordneten "vor den Augen der Öffentlichkeit" selbst zu beschließenden Erhöhung ihrer Entschädigung gibt es fast jedes Mal großes Geschrei in der Öffentlichkeit – „Selbstbedienungsparlament!“ -, so dass entsprechende Anpassungen nicht immer durchgebracht wurden und werden. Das kann nur damit zusammenhängen, dass: a) alle anderen Einkommensbezieher nicht über die Höhe ihrer Gehälter durch Parlamentsbeschluss in eigener Sache befinden können, wie aber die Abgeordneten im Bund und in den Ländern, wobei die »nur« der Kontrolle durch die Öffentlichkeit, insbesondere der Medien, unterworfen sind – und sich nicht unbedingt immer davon stören lassen, wenn der Protest nicht zu lautstark ausfällt, bei lautstarkem Protest allerdings gaben sie wiederholt nach und koppelten sich von der Einkommensentwicklung ab; b) die Erhöhungen vor Erreichen dieses Niveaus teilweise recht üppig ausgefallen waren, so dass aus dieser Erinnerung heraus noch ein nicht mehr zur Ruhe gekommenes Misstrauen weiterbesteht; c) die Pensionsberechtigungen der anderen Bezieher der Besoldungsgruppe B 6 nicht so exorbitant hoch geregelt sind, wie die von der Diätenregelung losgelöste, bisher äußerst üppig ausgestattete Altersversorgung der Abgeordneten18, die – von bisher Anstoß erregenden Nichtanrechnungsregelungen aus anderen Tätigkeiten einmal abgesehen - aber gerechterweise höher ausfallen muss als bei den anderen zum Vergleich herangezogenen Besoldungsbeziehern, da bei der nächsten Wahl von einem auf den anderen Tag abwählbare Parlamentarier für ihre Altersabsicherung anders versorgt werden müssen als Richter, die ihr Amt bis zu ihrer Pensionierung ohne Existenzgefährdung in Ruhe ausüben können und d) durch jahrelange, teils nächtliche Parteiarbeit als Hobby und Leidenschaft auch Menschen als Abgeordnete ins Parlament gespült werden, die sich außerhalb von Parteizirkeln keine sonderlich qualifizierte Ausbildung in dafür notwendigen jahrelangen Mühen erarbeitet haben und trotzdem - zum Teil als bloße Dorfkneipenbesitzer, einfache/r Angestellte/r mit gerade nur Realschulabschluss, bloße Abiturienten: 4 % der Parlamentarier des 15. Deutschen Bundestages verfügen über keinerlei(!) berufliche Erfahrung, ... – wie die durch sehr viele Jahre Aus- und Weiterbildung höchst qualifizierten obersten Bundesrichter bezahlt werden (wollen), die sich durch ihre jahrelange höchst qualifizierte Ausbildung wahrlich Problemlösungskompetenz erarbeitet haben, die bei vielleicht sogar einem großen Teil der 18 Nach nur acht Jahren Parlamentszugehörigkeit erhält ein ehemaliges MdB 1.683 € Pension, die für jedes weitere Jahr um 3 % bis zum Höchstwert von 4.837 € steigt und ab dem 55. Lebensjahr ausgezahlt wird (Stand 2005). 91 Abgeordneten auf ihrem Spezialgebiet sicher vorhanden ist, bei zu vielen aber schmerzlich vermisst wird. „Die meisten Menschen wenden mehr Zeit und Kraft daran, um die Probleme herumzureden, als sie anzupacken“ (Henry Ford). Und Abgeordnete sind auch Menschen! Das durch immer wieder auftretenden jahre-, ja sogar jahrzehntelangen Reformstau offenbar werdende Fehlen von ausreichender Problemlösungskompetenz in z.B. den Bereichen unserer sozialen Sicherungssysteme bei so hoher Entlohnung »frustet« die Wähler - die es selber nicht besser könnten, über deren Haupt aber der nicht aufgelöste Reformstau bedrohlich wie ein Damoklesschwert schwebt. Hinzu kommt die teilweise sehr offensichtliche Ungleichgewichtigkeit bezüglich der in das Amt eingebrachten Ausbildung und Befähigung bei obersten Bundesrichtern einerseits und Bundesparlamentariern andererseits bei gleichem Gehaltsanspruch und sogar noch erhöhtem Rentenanspruch. Das stört das feine Gerechtigkeitsempfinden der Staatsbürger! Darauf gründet ihr Neidreflex gegenüber Parlamentariern, der jedoch gegenüber obersten Bundesrichtern zu Recht nicht durchschlägt: Bloß eine höhere Schulausbildung ohne jede weitere Aus- und Weiterbildung zur Erarbeitung und Erlangung von Menschenführungs- und Problemlösungskompetenz in schwierigen Zusammenhängen, oder sogar noch ein Weniger an Schulbildung, wie ein nicht weiter qualifizierter Schulabschluss mit angehängter Lehre, oder ohne sie, oder teilweise nur eine als »training on the job« erfolgte Ausbildung als Straßenkämpfer qualifizieren allgemein nicht für die Tätigkeit eines der rund 598 plus möglicherweise X Bundestagsabgeordneten aus Überhangmandaten oder der bislang gleich hoch bezahlten 99 Abgeordneten des Europäischen Parlaments, die die Geschicke unseres Landes oder der Europäischen Gemeinschaft zum Besten des Gemeinwohls steuern sollen. Als bloße Abiturientin oder bloßer Abiturient, die außer Schulwissen nichts weiter gelernt haben, könnte man auf unserem Arbeitsmarkt in einer der Fleischklops-Läden für ca. 8-10 €/Stunde fettige Fritten und Bouletten in süßen Brötchen über einen Tresen reichen, Kindern als unqualifizierte Aufsicht das Rotznäschen putzen oder eine relativ unqualifizierte Bürotätigkeit ausüben, mehr nicht. Und das männliche Gegenstück kann auf dem Bau als Hilfskraft, als Briefträger oder als Taxioder Kurierfahrer jobben. Bei einer Tätigkeit als Bundestagsabgeordnete/r wird dann von Leuten, die sowieso nach Berlin gegangen wären und als Studenten von BAFöG gelebt hätten, der Bedeutung des Jobs gemäß eine finanzielle Gleichbehandlung mit obersten Bundesrichtern beansprucht, die sich im Gegensatz dazu höchst qualifiziert haben ausbilden müssen, ohne dass viele Abgeordnete - unter denen es allerdings auch Professoren gibt(!) - in ihrer Mehrzahl dem Ausbildungsniveau oberster Bundesrichter auch nur im Entferntesten entsprechen! Und dann wundern sich die MdBs über Volkes Meinung zu Diätenerhöhungen? Erstaunlich! Abgeordnete ohne gleiche Qualifikation wie oberste Bundesrichter dürfen sich nicht wundern, dass ihnen vom Gerechtigkeitsgefühl der Wähler nicht gleiche Entlohnung zugestanden wird, weil die Masse der Wähler darin eine Verletzung ihres Gerechtigkeitsempfindens sieht; auch wenn dabei ohne ein bisschen Überlegung völlig unqualifizierte Vorurteile herausgerülpst – und gedruckt!!! - werden: „Ich bin mit jeder Reform einverstanden, die nach dem Prinzip verfährt, dass vor dem Gesetz alle gleich sind. Also damit, dass unser zukünftig arbeitsloser Bundeskanzler ein Jahr lang so viel Arbeitslosengeld bezieht wie ich zurzeit (obwohl er nicht so lange gearbeitet hat wie ich) und danach so viel Rente bekommt wie ich nach einjähriger Arbeitslosigkeit.“ Leserbrief von H. W. aus Urmitz im STERN vom 08.05.03 Juristische Anmerkung zu diesem polemischen Leserbrief: Der Gleichheitssatz aus Art. 3 GG verlangt nach dem schon von dem größten Gelehrten der Antike mit Wirkung in die Neuzeit, Aristoteles (384 – 322 v. Chr.), aufgestellten Gleichheitsgrundsatz, wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches seiner Eigenart entsprechend ungleich zu behandeln. Andersherum ausgedrückt ist es dem Staat also verboten, wesentlich Gleiches willkür- 92 lich ungleich und wesentlich Ungleiches willkürlich gleich zu behandeln. Wenn man diese Elle an den Leserbrief legt, dann erübrigt sich jeder weitere Kommentar. Wie könnte Abhilfe in der leidigen Diäten- Mandatsausstattungs- und Versorgungsfrage aussehen? Hippel schlägt vor: Solange die Volksvertreter selbst über die Diäten bestimmen, besteht naturgemäß die Gefahr und der Verdacht, dass sie sich über Gebühr bedienen, wobei nicht nur überhöhte Diäten, sondern auch übertriebene Pauschalzahlungen für Unkosten, unangemessene Steuerprivilegien und übertriebene Sozialleistungen denkbar sind. Entsprechend dem elementaren Rechtsgedanken, dass niemand in eigener Sache entscheiden darf, liegt es nahe, dem Parlament die Entscheidung in Fällen eigener Betroffenheit zu entziehen und sie einer unabhängigen Sachverständigenkommission zu übertragen oder falls dies aus verfassungsrechtlichen Gründen unzulässig ist - eine solche Kommission zumindest als Gutachter einzuschalten. Diese Kommission könnte dann auch über die Frage befinden, ob und in wieweit ein Parlamentsmandat mit bestimmten sonstigen Funktionen (Aufsichtsratsposten, "Beraterverträgen" und ähnliches mehr) vereinbar ist und bis zu welchem Ausmaß "Nebentätigkeiten" der Abgeordneten bzw. "Nebeneinkünfte" zulässig sind. Falls verbindliche Entscheidungen der Kommission aus verfassungsrechtlichen Gründen unzulässig sind, wären auch bloße Empfehlungen der Kommission hilfreich, denn angesichts der sensibilisierten Öffentlichkeit könnten die Parlamentarier solche Empfehlungen schwerlich ignorieren. Da es keine bessere Alternative gibt, sollte man es jedenfalls mit diesem Weg versuchen. FR 23.06.05 Eine – wohl nur theoretische – Problemlösung wäre eine an der bisher absolvierten Ausbildung und Tätigkeit orientierte ganz individuelle Entlohnung für jeden einzelnen Abgeordneten entsprechend dem Entlohnungssystem des Öffentlichen Dienstes, aber dagegen spricht die immer populäre Forderung: „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit.“ Nach Vorkenntnissen individuell abgestufte »BAT-Abgeordnete« für die (nur angeblich) gleiche Tätigkeit vom Meinungsführer und Experten in der eigenen Fraktion bis hin zum Hinterbänkler wird es nicht geben. Keiner hat bisher die für eine »angemessene« Entlohnung notwendige »Elle der Gerechtigkeit« gefunden! Die einzige Möglichkeit zum Abbau des Wählerunbehagens bezüglich der Diätenregelung sehe ich in einer von den Parteien zu beachtenden Mindestqualifikation bei der Auswahl der uns später vorgesetzten Bundestags- und Europaparlamentskandidaten! Und davon sind die Parteien teilweise sehr weit entfernt, wie jeder selbst überprüfen kann, wenn er sich in einer grundsätzlichen Sache (z.B. verhängnisvoll drohender EU-Beitritt der Türkei) an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages wendet (auf seine das Problem auf 150 Seiten sehr detailliert darstellende Websites www.Hans-Uwe-Scharnweber.de und www.cdq.de verweist) und dann sogar rüpelige bis rotzfreche Antworten erhalten kann, wie es dem Autor von einem SPD-Abgeordneten mit (laut Selbstdarstellung auf seiner Abgeordneten-Website des Deutschen Bundestages) „mittlerem Bildungsabschluss“ passiert ist: Das war der untere Teil der wünschenswerten Bildung, den oberen hat er ausweislich seines Briefstils nicht mehr erreicht! Jede Gesellschaft braucht ab einer Größe, die keine direkte Demokratieausübung mehr zulässt, Menschen, die nicht nur Politik mit Leidenschaft betreiben, sondern darüber hinaus auch noch sehr gut ausgebildet sind, die anstehende Probleme erkennen und zu lösen fähig und bereit sind, denn „wenn Abgeordnete Missstände erkennen, ist es ihre verfassungsrechtliche Pflicht gesetzgeberisch zu handeln, um Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Der Gesetzgeber ist der Erstinterpret der Verfassung. Er ist immer als Erster am Drücker.“ So der als 93 Präsident des Bundesverfassungsgerichts oberste Richter unseres Landes, Papier, in einem STERN-Interview (12.05.05). (Siehe später noch: IV. Kandidatenauswahl.) Und wenn man »gute« Leute mit entsprechendem geistigen Horizont im Bundesparlament haben will, die die Geschicke von über 80 Millionen Menschen verantwortlich steuern sollen, dann muss man sie auch gut bezahlen. Da führt kein Weg dran vorbei! Doch die meisten Abgeordneten, und insbesondere deren Meinungsführer, weisen immer wieder nach, dass sie – vielleicht sogar systemimmanent bedingt – selbst die schon längere Zeit anstehenden Probleme meist nicht rechtzeitig erkennen und eventuell auch überhaupt nicht lösen können und auch gar nicht lösen wollen, denn sonst legte sich nicht schon seit Jahrzehnten, seit dem Ende der Regierungszeit Schmidt und dem Beginn der Kanzlerschaft Kohl, der von uns Regierten so oft schmerzlich empfundene Reformstau zur u.a. erforderlichen Anpassung unserer sozialen Sicherungssysteme immer wieder wie Mehltau über das Land! Beispiel: Noch in seiner Funktion als Ministerpräsident von Baden-Württemberg sagte der nachmalige Jenoptik-Chef Lothar Späth vor Jahrzehnten(!): „Wer die Daten der demographischen Entwicklung kennt und dann nachts noch schlafen kann, dem kann vor nichts mehr grauen!“ Und was ist in den seit dem Ende der Kanzlerschaft Schmidt verflossenen fast 30 Jahren geschehen? Auf jeden Fall zu lange nichts und zu spät viel zu wenig Entscheidendes, denn unsere sozialen Sicherungssysteme kollabieren! Die Politik hat die Erkenntnisse der Wissenschaftler nicht zur Kenntnis nehmen und schon gar nicht handeln wollen! „Wenn es 13 schlägt Die Politik scheut noch immer die volle Wahrheit ... alle, die stoischen Realitätsverweigerer wie die zaudernden Sozialreformer, teilen ja die quälende Ahnung: Es wird wohl noch viel schlimmer kommen, als wir uns heute eingestehen. Die ganze Wahrheit liegt längst nicht. auf dem Tisch. Diese Wahrheit ist einfach und bitter: Er ist aus, der Traum vom nie endenden Wohlstand in unerschöpflicher staatlicher Fürsorge. Und die großen Volksparteien, die ihre Berufung stets in der Verteilung der Zuwächse sahen, sträuben sich mit allen Fasern, dem Volk diese Diagnose in der notwendigen Brutalität zu offenbaren. Lieber verschreibt man Placebos: vier, fünf Reformpillen – und alles ist wieder gut. Bald. Nur ein wenig Geduld. Von wegen. Nichts wird rasch wieder gut sein. Sprechen wir ein paar Wahrheiten offen aus. Wahrheit eins: Die deutsche Wirtschaft ist keine Wachstumsmaschine mehr. ... Wahrheit zwei: Es gibt Arbeit en masse in Deutschland, aber nicht zu den hier geläufigen Löhnen – folglich wuchert die Schwarzarbeit wie Unkraut im warmen Frühlingsregen. Dagegen gibt es nur ein Rezept: Arbeitskosten senken. Wahrheit drei: Kein Arbeitsloser kann künftig noch den Anspruch erheben, in seinem erlernten Beruf wieder Beschäftigung zu finden, er muss bewegt werden, den Job nach überschaubarer Frist zu wechseln – und weniger zu verdienen. Die Kürzung des Arbeitslosengeldes, die Absenkung der Arbeitslosenhilfe auf Sozialhilfeniveau verfolgt exakt diesen Zweck. Und: Sozialhilfeempfänger müssen unter Androhung der Verelendung zu Arbeit gezwungen werden. Wahrheit vier: Die arbeitenden Jungen können den Lebensstandard der Alten nicht länger garantieren, er sinkt tendenziell. Rente erst ab 67 wäre, da kaum jemand Beschäftigung in diesem Alter fände, nichts anderes als Rentenkürzung. Die Milliardenlawine der Beamtenpensionen wird dabei noch nicht einmal diskutiert; Pensionslasten und Schuldendienst werden – wenn nichts passiert – schon in wenigen Jahrzehnten die Staatshaushalte komplett auffressen. Wahrheit fünf: Die Staatskassen sind und bleiben leer. ...“ (STERN 08.05.03) Von welcher/n Partei/en hört man solche Wahrheiten, die den politisch aufgeklärten Wählern schon längst bewusst sind, im Wahlkampf? Wo werden über allgemein gehaltene Sprechblasen – „Mehr Freiheit und Selbstverantwortung für die Bürger“ - hinausgehende diskutierbare Lösungskonzepte angeboten? Um diese Themen hätten schon seit 25 Jahren die 94 Wahlkämpfe geführt werden müssen und müssten die Wahlkämpfe der nächsten 12 Jahre geführt werden! Ich will Konzepte vorgelegt bekommen und darüber abstimmen dürfen! Aber woher soll bei Leuten, die in ihrer persönlichen Karriere als Berufspolitiker vom Wohlwollen ihrer jeweiligen Parteiführung abhängig sind, Mut zum Querdenken kommen, zur politischen Gestaltung und - entgegen vieler mit Klauen und Zähnen verteidigter Besitzstände! - eventuell sogar zum Umbau von insbesondere gesellschaftlichen Dinosauriern wie des Gesundheitssystems und unserer Sozialsysteme? Reformen, die immer auch erzwungenen Verzicht Betroffener und damit daraufhin organisierten Widerstand von betroffenen Wählergruppen bedeuten, sind auf Grund der demographischen Verwerfungen in unserer Gesellschaftsstruktur offensichtlich notwendig. „Viel’ Feind’, viel’ Ehr’“ – aber keine allzu günstigen Voraussetzungen für eine Wiederwahl, wie der Wahlerfolg der Linkspartei durch die Stimmen der sich sozial bedroht Fühlenden überdeutlich macht! Die bei unserem Wahlsystem von ihrer Parteiführung sehr abhängigen Abgeordneten möchten ja auch in der nächsten Legislaturperiode von der Partei aufgestellt werden und wieder ins Parlament einziehen können und nicht in ihre vielleicht eher »dumpfe« Tätigkeit, aus der sie mit politischer Leidenschaft ausgebrochen waren, um etwas Spannenderes zu machen, zurück müssen. Da haben es »Querdenker« schwer, die auch schon mal ihre Partei gegen den Strich bürsten, um auf die Notwendigkeit neuer Antworten auf gesellschaftliche Herausforderungen hinzuweisen. Eine größere Unabhängigkeit der Abgeordneten von ihrer Partei – und gleichzeitig eine größere Abhängigkeit weil Verantwortlichkeit vom und gegenüber dem Wähler – kann man durch ein anderes Wahlsystem erreichen, muss dann aber dessen Ungerechtigkeiten, insbesondere den wegen der »Papierkorbstimmen« nicht mehr gleichen Erfolgswert einer Wählerstimme, in Kauf nehmen: Nach dem Mehrheitswahlrecht gewählte Abgeordnete sind von ihrer Parteiführung unabhängiger, weil sie darauf verweisen können, dass die Mehrheit der Wähler ihres Wahlkreises hinter ihnen stehe, sie das Mandat nicht durch die mehr oder minder starke Parteibindung der Wähler ohne Ansehung der Person des Kandidaten einer Partei erhalten hätten. Wollen wir dafür aber den wegen des mit diesem System verbundenen ungleichen Erfolgswertes einer Wählerstimme systemimmanenten gravierenden Nachteil der mehrheitswahlbedingten „Papierkorbstimmen“ mit vielleicht außerparlamentarisch randalierenden und in unseren Straßen kämpfenden oppositionellen Gruppen in Kauf nehmen? Gehabt haben wir das ja schon - trotz unseres im Vergleich zum Mehrheitswahlsystem »gerechteren« Wahlsystems, in dem der Wählerwille der Wahlbürger im Ergebnis der Sitzverteilung besser abgebildet wird als durch das Mehrheitswahlsystem! In diesem skizzierten emotionalen Spannungsverhältnis spielt sich die Diskussion um eine »angemessene« Entlohnung der Abgeordnetentätigkeit ab und wird sich auch weiterhin abspielen, da es üblicherweise keine anderen qualifizierenden Zugangsvoraussetzungen für eine Abgeordnetentätigkeit gibt als Leidenschaft für auf jeden Fall freizeitausfüllende bis freizeitraubende und oft kraftzehrende politische Tätigkeit und einen als Hobbybeschäftigung unter viel Freizeitverzicht auf teilweise nervigen Parteiversammlungen oft jahrelang abends und nachts oder an Wochenenden breit gesessenen Hintern. Weil es zur verantwortlichen Ausübung des Amtes eines obersten Bundesrichters dessen mehr bedarf, neidet denen auch niemand die Bezahlung, die die Abgeordneten für ihre anerkanntermaßen ebenfalls herausragend wichtige Tätigkeit ihrerseits anstreben. Zu den durch die einem Abgeordneten gewährte steuerfreie Kostenpauschale abgedeckten Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Mandat gehören z.B. eine Sekretärin im Wahlkreis- und/oder Abgeordneten-/Bürgerbüro, Büromiete am Heimatort zur Abhaltung von Bürgersprechstunden, Telefon dort, Porto, die Miete für eine Zweitwohnung in Berlin oder Ersatz der in den Sitzungswochen anfallenden Hotelkosten. Allerdings hat das BVerfG in seinem Diäten-Urteil 1975 die Kostenpauschale in ihrer bisherigen undifferenzierten Art als verfassungswidrig bezeichnet und das u.a. damit begründet, dass die rund zwei Dutzend in und um Berlin und drum herum in relativer Nähe wohnenden „Heimschlä- 95 fer“ ebenfalls die in den Betrag eingerechneten € 1.000,- Mehraufwendungen für eine Zweitwohnung erhalten, ohne in Berlin eine Zweitwohnung nehmen zu müssen, wie Abgeordnete, die auf Grund der Entfernung von Berlin zu ihrem Wahlkreis auf eine Zweitwohnung angewiesen sind. Die Abgeordneten hätten zu unterschiedliche Aufwendungen, um ihnen eine so pauschal bemessene steuerfreie Kostenpauschale zukommen zu lassen, die für einige Abgeordnete ein steuerfreies Zusatzeinkommen darstelle. Das sei ein Verstoß gegen den in Art. 3 GG normierten Gleichbehandlungsgrundsatz, der verlange, dass Gleiches gleich und Ungleiches seiner Eigenart entsprechend ungleich behandelt werde. Eine „Unabhängige Kommission zur Überprüfung des Abgeordnetenrechts“ hatte daraufhin 1993 unter Vorsitz des damaligen Präsidenten des Bundesarbeitsgerichts, Kissel, gefordert, die Kostenpauschale auf umgerechnet rund € 500,- drastisch zu senken und höhere Kosten nur noch gegen Vorlage von Einzelbelegen zu erstatten (STERN 02.01.03). Dafür müsste aber das Abgeordnetengesetz geändert werden. Und wer ändert Bundesgesetze – oder auch nicht: Der »Bundesgesetzgeber«. Ohne Schnickschnack ganz direkt: Die Bundestagsabgeordneten müssten in eigener Sache ihre eigene teilweise bestehende ungerechtfertigte Begünstigung abschaffen, was relativ problemlos bewerkstelligt werden könnte, wenn die pauschalierte Regelung gestrichen und es einen Kostenersatz nur in Höhe nachgewiesener Kosten gäbe. Aber von Fröschen kann man nicht erwarten, dass sie den Sumpf trocken legen, in dem sie leben. So erhält jeder weiterhin undifferenziert und ohne jeden Verwendungsnachweis eine jährlich zum 1. Januar eines Jahres an die Entwicklung der Lebenshaltungskosten angepasste Kostenpauschale, die 2004 in Höhe von 3.551,- € gezahlt wurde. Der Bundestagspräsident - entsprechend der staatlichen Hierarchie nach dem Bundespräsidenten als »zweiter Mann im Staate« eingestuft - erhält doppelte Abgeordnetendiäten, die Kostenpauschale wie alle Bundestagsabgeordneten, 2004 eine Amtsaufwandsentschädigung von € 1.023,-, einen Dienstsitz für Empfänge u.s.w. und einen Dienstwagen. Sonderzahlungen wie z.B. 13. Gehalt, Weihnachts- oder Urlaubsgeld, die die meisten Arbeitnehmer – und auch die für die Beurteilung der Angemessenheit der Bezahlung vergleichsweise herangezogenen obersten Bundesrichter - erhalten, gibt es hingegen nicht. So verfügen die Abgeordneten letztlich aber »nur« über "ein Gehalt, das jeder Sparkassendirektor erreicht", wie eine Zeitung schrieb; hinzuzufügen wären Chefredakteure wichtiger Zeitungen, hohe Kommunalbeamte, Hauptabteilungsleiter beim Rundfunk, Geschäftsführer in der Bauwirtschaft, Geschäftsführer von (mindestens mittelgroßen) Verbänden und Gewerkschaftsspitzenfunktionäre, nach Vermutung des STERN (14.08.03) auch die Büroleiterin der Kanzlerkandidatin der CDU – Spitzenleistungsträger halt. Sogar die ranghöchsten Beamten der Bundestagsverwaltung verdienen in der Besoldungsgruppe B 5 mehr als ihre »Chefs«, die Abgeordneten, geschweige denn die obersten Richter mit ihrer B-6-Besoldung. Unter diesem Gesichtspunkt ist die Bezahlung der Abgeordneten des Deutschen Bundestages sicher der Bedeutung ihres Amtes angemessen – wenn(!) die Qualität der Abgeordneten ebenfalls der Bedeutung des Amtes angemessen ist. Das ist aber vom System her leider nicht gewährleistet, schon jetzt im Einzelfall nicht der Fall und wird weiter offensichtlich werden, wenn rechtsextremistische Abgeordnete in den Deutschen Bundestag einziehen sollten und dort solche Reden wie im sächsischen Landtag halten, für die sie inzwischen bundesweit berüchtigt sind. Unter dem (Ein-)Druck der kritischen Öffentlichkeit haben die Bundestagsabgeordneten ihr Gesamteinkommen in den vergangenen Jahren weit unterdurchschnittlich angehoben. Die allgemeine Einkommensentwicklung verlief positiver! Das wird den Abgeordneten nicht gerecht, die (qualifizierte Arbeit leisten und) nur über ihre Abgeordneten-Einnahmen verfügen können. Zwei Drittel der Abgeordneten verfügen über keine Zusatzeinnahmen. Es wird geschätzt: Rund ein Drittel der Abgeordneten hat zusätzliche Einnahmen – was, wenn nicht aus eigenen Wirtschaftsunternehmen oder Praxen stammend, entweder Abhängigkeiten und Interessenwahrnehmung im Sinne des Entsenders ausdrücklich honoriert - wenn z.B. Vertreter großer Konzerne und Verbände Mitglieder des Parlaments werden, dort im Sinne des bisherigen Arbeitgebers agieren und dafür ihr bisheriges Gehalt weiterbezogen oder noch weiter- 96 beziehen - oder was Abhängigkeiten schaffen kann; es gilt die Volksweisheit: „Wes’ Brot ich ess’, des’ Lied ich sing’!“ Es gibt Bestrebungen, Nebentätigkeiten von Abgeordneten gänzlich zu untersagen: Denn wer sein Abgeordnetenmandat ernsthaft wahrnimmt, hat keine Zeit für im höheren Umfang honorierbare Nebentätigkeit/en! Diese Bestrebungen führten aber bisher deswegen zu keinem Erfolg, weil Abgeordnete im Mittelwert nur zwei Legislaturperioden im Parlament sitzen und schon während dieser Zeit sehen müssen, von welcher Tätigkeit sie sich und ihre Familien danach ernähren können. Ein weiteres Drittel der Mandatsträger hat zwar bisher nur die normalen AbgeordnetenEinkünfte, hoffe aber auf Besserung in absehbarer Zeit durch Zusatzeinnahmen mittels lukrativer Nebenjobs. Und ein weiteres Drittel wird auf unabsehbare Zeit ausschließlich von den Diäten und der Pauschale leben müssen. Die Gehälter sind - gemessen an der Wichtigkeit der Aufgabe - nicht exorbitant hoch, eher zu niedrig! Eine Kommission befand 1990, dass die Einnahmen der Bundestagsabgeordneten aus ihrer Abgeordnetentätigkeit 30-40 % zu niedrig gelegen hätten. Deswegen wurden sie dann sehr maßvoll erhöht. Der Grünen-Abgeordnete Ströbele findet, dass die Einnahmen nun Bundesrichter-Niveau hätten und angemessen seien. Da befindet er sich jedoch in der Minderheit seiner Kollegen. Aber die in nur sehr wenigen Jahren ersessene oder erarbeitete äußerst üppige Altersversorgung für schon wenige Jahre Parlamentstätigkeit wird von Experten zu Recht angeprangert. Deswegen gab es schon einmal einen Vorstoß der FDP, der dann allerdings versandete, die Bundestagsabgeordneten entsprechend ihrer Aufgabe wie Wirtschaftsmanager – an welchem Erfolg zu messen? - zu bezahlen, sie dann aber für ihre Altersversorgung selbst aufkommen zu lassen. Bisher müssen sie dafür keinen Beitrag leisten! Das ist der Ausgleich für die zu niedrig angesetzten Diäten und die mit dem Amt verbundenen Vergünstigungen. Nur wenige Abgeordnete sind bereit, sich »Gläserne Taschen« zuzulegen und sich dann auch dort reinschauen zu lassen: weil diese Abgeordneten meist keine privaten Nebeneinnahmen durch eigene Firmenbeteiligungen, Verbands- oder Vorstandsposten beziehen. Es war festzustellen: Je linker eine Partei, desto geringer war die zusätzliche Ausstattung von Teilen ihrer Abgeordneten mit finanziell meist recht lukrativen Aufsichtsratsposten oder Ähnlichem, und darum waren deren Abgeordnete meist auskunftsbereiter! Was ich bekomme MdB Hubert Hüppe CDU Ein Bundestagsabgeordneter verdient nicht schlecht. In meinem früheren Beruf hätte ich so viel Geld nicht bekommen können. In Gesprächen mit Ihnen erfahre ich, dass es Bürgern undurchsichtig ist, wie viel jeder MdB bekommt. Das liegt auch an den Nebeneinkünften vieler Abgeordneter, weil Sie zusätzlich einem anderen Beruf nachgehen, in Aufsichtsräten sitzen, Ämter und Kommunalmandate mit finanziellen Aufwandsentschädigungen innehaben oder mit anderen Zuwendungen in Verbindung gebracht werden. Ich übe keine Nebentätigkeit aus, beziehe keine zusätzlichen Entschädigungen und habe auch keinen Aufsichtsratsposten. Die Bürger, Sie, sollen wissen, wie viel Geld ich bekomme, denn schließlich sind Sie meine Arbeitgeber und ich beziehe mein Einkommen aus Ihren Steuern. Damit Sie das auch tatsächlich überprüfen können, veröffentliche ich meinen Einkommensteuerbescheid. [Hier nicht abgedruckt, da im Internet nachzulesen.] Inzwischen haben sich die Bruttodiäten 2004 auf Euro 7.009,- erhöht. [Der Autor] 97 Zusätzlich erhalte ich wie jeder Abgeordnete eine steuerfreie Kostenpauschale in Höhe von 3.417,- € [inzwischen für 2004 auf € 3.551,- erhöht; der Autor], die im Einkommenssteuerbescheid nicht auftaucht. Dieser Betrag wird häufig nicht erwähnt. Die Kostenpauschale wird für den Aufwand für die Zweitwohnung (bei mir Hotelkosten), für Fahrtkosten mit dem PKW, insbesondere im Wahlkreis, für die Wahlkreisbüros, Porto usw. gezahlt. Einen Kostennachweis muss ich dafür nicht erbringen, allerdings darf ich auch keine Werbungskosten bei der Steuer geltend machen. Hamburger Abendblatt 6.12.1995 Aufsichtsräte, Verbände: Wo sich unsere Parlamentarier nützlich machen Unermüdlich - nicht nur im Bundestag Von ANDREAS THEWALT Inbrünstig stöhnen Bundestagsabgeordnete gern bei jeder Gelegenheit über ihren unermüdlichen Einsatz für Volk und Vaterland. Tag und Nacht unterwegs, 70, 80 Stunden jede Woche rackern sie, so sagen sie, für des Bürgers Wohl. Wer solch herkulisches Wirken bestaunt, der muss schier an ein Wunder glauben, wenn er sieht, welche Nebentätigkeiten viele Parlamentarier mit der Ausübung ihres Mandats unter einen Hut bringen. Das Bundestags-Handbuch weist aus, wofür sich Mitglieder des Hohen Hauses außerparlamentarisch noch Zeit zu nehmen wissen. Zum Beispiel Otto Graf Lambsdorff, der liberale Wirtschaftsminister a.D. und FDP-Ehrenvorsitzende. Wenn der Adelsmann nicht gerade das Volk vertritt, dann versieht er 13 Beirats- oder Aufsichts-Mandate in renommierten Unternehmen, von der Victoria-Versicherung bis zur Volkswagen AG. Ebenso macht er sich nützlich im Verwaltungsrat des Zweiten Deutschen Fernsehens oder als Vorsitzender diverser Vereine, sofern er nicht gerade als Ehrendomherr im Domstift zu Brandenburg an der Havel gebraucht wird. Der Unionsmann Heinz Riesenhuber, ehemals Forschungsminister, versieht elf solcher Posten, darunter bei der Allianz und der Siemens AG. Sozialdemokrat Hans Berger aus Bochum, Chef der Gewerkschaft Bergbau und Energie, macht sich für acht Unternehmen nützlich, darunter im Aufsichtsrat der VEBA, RWE und Ruhrkohle AG. Statistisch gesehen sitzt im Durchschnitt fast jeder zweite Abgeordnete in einem Aufsichtsrat oder einem vergleichbaren Amt. In Großunternehmen werden sie nicht selten mit 20.000 Mark und mehr pro Jahr vergütet. Häufiger noch als in Firmen sind Parlamentarier in Öffentlichen Körperschaften aktiv. Sie agieren in Fernsehräten, Kontrollausschüssen, im Regulierungsrat des Postministeriums, als Stadträte, Bürgermeister oder Sparkassenvorstand. Mehr als 350 Ämter dieser Kategorie versehen Bonner Politiker. Auch mit rund 160 Verbandsämtern sind Abgeordnete gesegnet. Anke Fuchs (SPD) steht beispielsweise an der Spitze des Mieterbundes. Reinhard Göhner von der CDU führt die Geschäfte der Polstermöbelindustrie. Solche Lobby-Aktivitäten nähren seit Jahren die Diskussion, ob Abgeordnete durch derlei Tätigkeiten nicht in einen Interessenkonflikt mit ihrer Parlamentsarbeit geraten. 1987 wurden deshalb Verhaltensrichtlinien verabschiedet. Abgeordnete verpflichten sich, Tätigkeiten für Unternehmen, Verbände oder Interessenorganisationen anzuzeigen. Welche Einkünfte sie damit erzielen, bleibt allerdings geheim. Sie müssen zwar ebenso wie Spenden der Bundestagspräsidentin kundgetan werden. Veröffentlich werden sie jedoch nicht. Den "gläsernen Abgeordneten" gibt es nicht. Einige wenige Parlamentarier, die Sozialdemokraten Norbert Gansel und Peter Conradi, legen jedoch jedes Jahr ihre Steuererklärung offen. Mit ihren Bestrebungen, ihre Parlamentskollegen zum Offenlegen von Nebeneinkünften zu zwingen, hatten sie indessen keinen Erfolg. Das rühre ans Steuer- und Betriebsgeheimnis selbständiger Unternehmer, argumentieren Gegner solcher Transparenz. Manche Abgeordnete verraten hinter vorgehaltener Hand, dass die Diäten für sie ohnehin nur eine Entschädigung bedeuten und sie außerhalb des Parlaments gutes Geld hinzuverdienen. Dazu gehören etliche Rechtsanwälte, Apotheker, Landwirte und auch Hochschullehrer. Diese dürfen dank einer Sonderregelung weiter in Forschung und Leh- 98 re aktiv sein. Nahezu jeder dritte Abgeordnete gibt an, nicht ausschließlich auf Diäten angewiesen zu sein. LOBBYISMUS – Die »fünfte Gewalt« im Staate Interessenvertretung ist ein Wesenselement der Politik. Interessenvertretung und Politikberatung, das betonen alle Seiten, ist legitim. Im Grundsatz ist jede Partei eine Lobbyorganisation für das - nicht immer nur - allgemeine Interesse ihrer(!) Wähler. Und jeder Abgeordnete ist der Lobbyist seines Wahlkreises. Da halten sich dann aber die Mandatsträger zumindest der Regierungskoalitionsparteien die Waage, wenn jeder etwas für seinen Wahlkreis herausschlagen will; die Abgeordneten der Oppositionsparteien haben auf Grund der Wählerentscheidung schlechtere Karten, da sie nicht so gut »an die Fleischtöpfe herankommen«. Das Kerngeschäft des Lobbyismus ist die Vermittlung von Partikularinteressen in die Entscheidungszentren der Politik hinein. Das heißt dann bei den Verbandsvertreter, "rationales Zusammenwirken von Gesetzgeber und Wirtschaft". Die Chancengleichheit der unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen ist aber dann gefährdet, wenn eine Gruppe auf Grund ihrer Verbandsmacht und einer eventuell fehlenden Gegenverbandsmacht ihren speziellen Anliegen besonderes Gehör verschaffen kann. Die Woche 15.8.97 (leicht gekürzt) Wie Piraten Interessenverbände reden immer stärker im Bundestag mit: 700 Parlamentarier werden umringt von 10.000 LOBBYISTEN von ALEXANDER NEUBACHER Für jemanden, der seine Fäden gerne fein im Verborgenen spinnt, ist Wolfgang G. Lange eine reichlich grob gestrickte Erscheinung. Borstenkurzes Haar, stoppelscharfer Bart; der Mann feuert Wortsalven ab wie „Überwachung, Beschaffung, Zugriff“ und dass er ein „Awacs" sei, ein Feindaufklärer, der über dem Bonner Gesundheitsministerium seine Kreise zieht. Gelegentlich wird Lange gar zum Jagdbomber. Als Geschäftsführer der Lobby-Agentur Medical Consult Bonn macht er Front gegen Horst Seehofers Gesundheitsreformen, ließ Hebammen nach Bonn marschieren und Pharma-Vertreter böse Briefe schicken. Grass-root campaign nennt der Lobby-Mann diese Form der Basisrevolte: Wurzelbehandlung. Leute wie Wolfgang G. Lange gibt es viele in Bonn. Die meisten nennen sich Consultant oder Repräsentant, haben Erfahrung als Rechtsanwalt oder Journalist [...]. Wie viele Lobby-Söldner es inzwischen gibt, weiß keiner. Sicher ist nur, dass kaum eine Firma auf sie verzichtet. Großkonzerne wie Siemens, Veba, Daimler-Benz oder BMW leisten sich meist gleich ein ganzes Team eigener Repräsentanten. Und die kleineren Unternehmen beauftragen freie Consultants wie Wolfgang G. Lange, der sich vor allem auf ausländische Pharmakonzerne spezialisiert hat. „Der Trend geht zu schlagkräftigen, kleinen Einheiten", sagt Peter Jeutter, Chef der Agentur Jeutter Consulting, „unabhängigen Spezialisten für projektbezogene Allianzen". [...] Der Staat als Beute. Knapp 700 Bonner Parlamentariern steht ein Heer von weit mehr als 10.000 Lobbyisten gegenüber; das „Geschmeiß" (Ludwig Erhard) sitzt längst in allen Beraterrunden. Wobei die Unterscheidung zwischen Volks- und Interessenvertreter immer schwerer fällt. Im Rechtsausschuss herrscht eine Anwältemehrheit, im Landwirtschaftsausschuss bestimmen Landwirte. [...] Das Dilemma: Einerseits leidet die Politik unter den Lobbyisten, andererseits kommt sie ohne diese nicht aus. Der Sachverstand von Insidern ist bei komplizierten Initiativen und Verordnungen nicht zu ersetzen. Und auch politisch lässt sich Interessenvertretung von Bauern, Autofirmen und Medizinern prinzipiell rechtfertigen, solange das Volk eben auch aus Landwirten, Automobil- 99 herstellern und Ärzten besteht. [...] Lobby bedient sich vielfältigster Methoden und wirkt sehr gerne sehr diskret. „Klinkenputzen" gehört ganz selbstverständlich zum Geschäft. Die gewerbsmäßigen Interessenvertreter tummeln sich in den Ministerien, leisten Überzeugungsarbeit bei Fachbeamten. Das sind nämlich häufig diejenigen, die Entwürfe für neue Gesetze oder Verordnungen konzipieren. Schon in diesem Frühstadium betreiben Lobbyisten gern „Seelenmassage". Ausschließlich negativ zu werten ist das beileibe nicht. Denn Ministeriale wie Politiker räumen freimütig ein, dass sie ohne den Sachverstand von Wirtschaft, Gewerkschaften und Verbänden kaum auskommen könnten. Niemand würde etwa bestreiten, dass Automobilbauer vom Auto mehr verstehen als Beamte oder Parlamentarier und Minister. Die wiederum müssen Gesetze und Verordnungen aber erst beschließen. Also setzen Lobbyisten, Verbände und Unternehmen auch hier an. Sie machen sich Politiker gewogen oder setzen sie gleich ganz offiziell auf ihre Lohnliste. Unions-Mann Reinhard Göhner dient beispielsweise der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) als Hauptgeschäftsführer. Ehemalige Politiker oder hohe Beamte werden auch gerne als Lobbyisten angeworben. Doch Lobbyismus ist keineswegs ausschließlich die Domäne der Wirtschaft. Sozialverbände etwa sind nicht minder rührig und die Gewerkschaften ebenfalls. Amtierende oder ehemalige Spitzenfunktionäre aus deren Reihen sitzen oder saßen im Bundestag [...] Doch wie einem ungebührlichen Einfluss von Lobbyisten vorbauen? Ein Patentrezept hat noch keiner gefunden. Neueste Lobbyisten-Zahlen: 300 Unternehmen und ca. 1.780 Verbände beschäftigen Lobbyisten – von denen ca. 4.500 Personenausweise für den Bundestag haben - in einer solchen Anzahl, dass auf jeden MdB mehr als drei Verbände und zehn Lobbyisten kommen, die Gehör finden und ihr jeweiliges Anliegen vortragen wollen und sogar, wenn es für die Interessen ihres Verbandes hart auf hart kommt, teure Pressekampagnen zur bewussten Fehlinformation der auf Grund mangelnden Sachwissens weniger gut oder völlig uninformierten Öffentlichkeit führen, um Vorteile für ihre Auftraggeber herauszuschlagen; erinnert sei beispielhaft an Kampagnen von Lobbyisten der Tabakindustrie, die jegliche Gefahr des Rauchens zu bestreiten pflegten. Ähnlich macht(e) es die Zuckerindustrie. Zu den vorgenannten Zahlen hinzu kommen die selbständigen Lobbyisten, die von Unternehmen für besondere Aufträge angeheuert werden. Die Verbände haben den Staat durch ihre Lobbyisten, ihre Finanzierungs- und Spendenpraxis(!) fest im Griff: nicht nur reine Privatleute, sondern auch Politiker und Teile der Beamtenschaft in den verbandsrelevanten Ministerien! Bevor das Landwirtschaftsministerium 2001 in Ministerium für Verbraucherschutz und Landwirtschaft umgewandelt und umbenannt wurde, „galt es als verlängerter Arm des Bauernverbandes und der Minister – meist selbst Landwirt – als Oberster Lobbyist der Bauern.“19 Es werden Millionen als »Gleitmittel« zur Durchsetzung der Verbandsziele ausgegeben, damit die Verbandsziele eine bevorzugte Förderung erfahren. Die Lobbyistentätigkeit aus den nationalen Parlamenten setzt sich im Europarlament fort: sei es, dass schon durch Lobbyistentätigkeit auf nationaler Ebene »gefilterte« und gepuschte Anliegen nationaler Gruppen in das EU-Parlament getragen werden oder dass dort erst die Lobbyistentätigkeit ansetzt, weil das Problem nicht auf nationaler Ebene zur Lösung ansteht. Als erstes Beispiel für letzteren Sachverhalt sei der erbittert geführte Kampf um die von der EU geplante Software-Richtlinie angeführt: Die großen internationalen Konzerne wollen Software als Patent schützen, die kleinen und mittelständischen Firmen wollen ihm »nur« Urheberrechtsschutz zubilligen lassen, um für ein Problem eigene Lösungen finden zu können. Eine EU-Kommissarin oder EU-Abgeordnete machte durch Rückgriff auf ein Beispiel aus der Literatur sehr schön deut19 Feldenkirchen, M.: Sie wollen nicht die bösen Buben sein in: Das Parlament 06.01.03, S. 9 100 lich, worum es geht: Wenn für Shakespeares „Romeo und Julia“ Patentschutz erteilt worden wäre, hätte sich für dessen Dauer kein anderer mehr mit dem Sujet „zwei Jugendliche lieben sich wegen ihrer miteinander verfeindeten Elternhäuser hoffnungslos und beschließen daher ihre gemeinsame Selbsttötung“ befassen dürfen. Da für Literatur aber »nur« der Urheberrechtsschutz gilt, konnten andere Schriftsteller diesen Grundkonflikt aus ihrer Sicht heraus bearbeiten und darstellen. Bei Software-Patentschutz gäbe es z.B. nur einen Browser als Internet-Zugangsmöglichkeit, den alle anderen lizenzpflichtig benutzen müssten, nur ein Format, ... . Weitere Entwicklungen wären nicht möglich gewesen. Darum lehnte das EU-Parlament mit überwältigender Mehrheit gegen 14 Ablehnungen und 18 Enthaltungen den Vorstoß der internationalen Softwarekonzerne zur Patentierung selbst einfachster Softwarebausteine ab. Ein weitres Beispiel erbitterter Lobbyistentätigkeit auf europäischer Ebene ist im Bereich des Biopatentschutzes die Patenterteilungspraxis des Europäischen Patentamtes bei der Patenterteilung auf schon längst in den Menschen, Tieren oder Pflanzen seit Beginn der Evolution vorhandene, nun aber entdeckte Gensequenzen. Die EU hatte 1998 eine Biopatentrichtlinie verabschiedet. Die EU-Richtlinie "Über den Schutz biotechnologischer Erfindungen" sieht einen sehr weitreichenden Patentschutz vor, der alle mit einer Gensequenz verbundenen Funktionen – nicht nur die bekannten, sondern auch die erst noch zu entdeckenden(!) - umfasst. U.a. die Umweltschutzorganisation Greenpeace weist immer wieder mit Aktionen darauf hin, dass „Entdecken“ und „Erfinden“ zwei völlig verschiedene Sachverhalte sind, die patentrechtlich nicht gleich behandelt werden dürfen. Die Konsequenz: Konkurrierende Wettbewerber konnten schon erfolgreich daran gehindert werden, an der von der Natur geschaffenen Genstruktur weiterzuforschen, weil zu Anfang der Entwicklung halt nicht sauber unterschieden worden war, dass genetische Informationen nicht „erfunden“, sondern „vorgefunden“ werden! Greenpeace warnte bisher vergeblich, dass mit solcherart undifferenziert vergebenen Patenten auf Gensequenzen oder gar ganze Gene die jeweiligen Firmen zu Lasten der Allgemeinheit die weitergehende Forschung behindern und auf Kosten der Allgemeinheit erhebliche Profite machen würden. Greenpeace versucht, die durch Lobbyistentätigkeit mitverursachte Vergabepraxis der Patente auf bereits Vorhandenes als unsinnig zu entlarven und die eingerissene ungute Patentvergabepraxis zurückzudrehen, damit unsinnig erteilte Patente entweder durch Gerichtsurteile oder eine EU-Richtlinie wieder kassiert werden: Man beschrieb wissenschaftlich - als erster - die Currywurst, stellte ein paar Untersuchungen hinsichtlich der Auswirkungen des Verzehrs von Currywurst an und beantragte ein »Trivialpatent« auf die Currywurst. Nach der Vergabepraxis von Patenten für biologische Entdeckungen müsste Greenpeace das beantragte Patent auf die Jahrzehnte gegessene Currywurst erteilt werden, denn Greenpeace hat zuerst Zusammenhänge mit dem Wurstverzehr beschrieben; die anderen hatten bislang nur reingebissen: weiß oder rot. Und das zack, zack! Würde es weiterhin den Irrsinn der Patentschutzerteilung geben, könnten weiterhin Firmen mit zu weitreichend erteiltem Patentschutz andere von der Erforschung von Gensequenzen zur Bekämpfung von Krankheiten selbst dann ausschließen, wenn die Patentinhaberin gar kein Interesse an der von der anderen Firma bearbeiteten Fragestellung mit ganz anderen Medikamententwicklungen hat. Die Gegner zu großzügiger Patentierungen weisen immer wieder darauf hin, dass zwischen bloßen „Entdeckungen“ des ohne das Zutun der Entdeckerfirmen Vorhandenen einerseits und „Erfindungen“ andererseits nicht nur sprachlich, sondern auch juristisch unterschieden werden müsste: Ein vorhandenes Gen, eine bestimmte Gensequenz, die darauf beruhende Funktion und die ohne Zutun des Menschen ablaufende Arbeitsweise des Gens dürften nicht patentiert werden, sondern nur auf Grund dieser Beobachtung entwickelte diagnostische Testverfahren und Medikamente. Die Bio-Patentrechtrichtlinie der EU von 1998 müsste insoweit genauer gefasst oder abgeändert werden. Es ist schon vorgekommen, dass ein bestimmtes Brustkrebsgen patentiert wurde und nun niemand mehr daran arbeiten darf. Die Patientinnen sind durch die Patentierung einer bloßen Entdeckung in die direkte Abhängigkeit einer Firma geraten. Andere, vielleicht bessere oder kostengünstigere Verfahren können nicht mehr entwickelt werden, und die forschenden Firmen stellen sofort ihre Arbeit ein, wenn sie feststellen, dass sie in den Bereich des patentierten Gens kommen. Andere biologische Zusammenhänge können nicht mehr untersucht werden, auch dann nicht, wenn die Patentinhaberin gar nicht daran denkt, in der sich für die andere Firma auftuenden Rich- 101 tung weiterzuarbeiten. Jede weitere Forschung anderer Firmen als der Patentinhaberin auf das Gen ist für die Nicht-Inhaber des Patents wirtschaftlich sinnlos und mit so hohen Patentverletzungskosten bedroht, dass eine trotzdem forschende Firma von der Patentinhaberin in den Konkurs getrieben werden kann – nur weil die Entdeckerfirma das Gen oder die bestimmte Gensequenz zuerst beschrieben hatte. Teilweise wurden Gensequenzen und Gensequenzmutationen patentiert, die nicht nur beim Menschen, sondern auch bei Pflanzen auftreten. Es wurde auf Grund der bloßen Beschreibung einer bestimmten Maiseigenschaft Mais patentiert, der schon über 1.000 Jahre in Mexiko angebaut wird. Jeder, der den Mais jetzt weiterhin anbaut, muss nun Gebühren an die Patentinhaberin zahlen! Außerdem wurde jede Arbeit an den zu weitgehend patentierten Genen von der Patentinhaberin abgewürgt. Das ist die Auswirkung »erfolgreicher« Lobbyistentätigkeit! Auch »der Mensch« ist nicht mehr »frei«: Es gibt durch die zu großzügige Patentgewährung des Europäischen Patentamtes, dessen Wirkungsbereich sich weit über Europas Grenzen hinaus erstreckt, schon ca. 800-1.000 Patente auf menschliche Gene. Und diese Tendenz weitet sich durch einen Konstruktionsfehler des Europäischen Patentamtes weiter aus: Das Europäische Patentamt finanziert sich durch die Einnahmen aus der Erteilung von Patenten. Da besteht die Tendenz, möglichst viele, andere von der Nutzung dann ausschließende Patente zu erteilen, um möglichst hohe Einnahmen zu erzielen! Das Wohl der Kranken gerät unter die Räder! Die Patentierung biotechnologischer „Entdeckungen“ müsste umgehend gestoppt, schon erteilte Patente auf bloße Entdeckungen müssten widerrufen werden - wenn das noch möglich ist. Ein letztes hier angeführtes Beispiel für in den einzelnen Ländern der EU sehr erfolgreiche Lobbyistentätigkeit, die sich täglich sowohl national, übernational in der EU und zusätzlich supranational in den Entwicklungsländern auswirkt, ist das Wirken der nationalen Bauernverbände. Wegen deren äußerst erfolgreicher nationaler und eu-weiter Lobbyistentätigkeit müssen die Bürger der EU u.a. gemessen an den Weltmarktpreisen völlig überhöhte Preise für Agrarprodukte zahlen! Als Beispiel sei auf die schon skandalöse Zuckerordnung der EU verwiesen: Nach Berechnungen der britischen Hilfsorganisation Oxfam kostet die EU-Zuckermarktordnung, die den Preis des Zuckers innerhalb der Union auf einem bis zu vierfachen Wert über den Weltmarktpreisen hält, die europäischen Steuerzahler und Verbraucher 1,6 Milliarden Euro jährlich. Wegen der künstlich hochsubventionierten Gewinnspanne gilt bei europäischen Bauern die Zuckerrübe als „Königin der Ackerfrüchte“. Der von der EU festgelegte Mindestpreis für Zucker aus Deutschland betrug (2004) 632,- € pro Tonne, der Weltmarktpreis zur selben Zeit aber lediglich 160,- € pro Tonne. Die europäischen Verbraucher mussten also pro Tonne 472,- € Aufschlag bezahlen, als wenn sie ihren Bedarf auf dem Weltmarkt gedeckt hätten, nur weil die Landwirte besser organisiert sind als die amorphe Masse der Verbraucher. Aus diesem Grund gehören Zuckerrübenbauern zu den bestverdienenden Landwirten in der EU – auf Kosten der Konsumenten, die pro Jahr rund 6,5 Mrd.(!) € für das zu Gunsten der Bauern künstlich verteuerte Produkt mehr bezahlen müssen, als erforderlich wäre. 34 % des bäuerlichen Einkommens in der EU stammen aus Brüsseler Subventionstöpfen. Die EU verteilte im Jahr 2004 insgesamt 44,7 Milliarden Euro auf die Landwirtschaft ihrer 25 Mitgliedstaaten. Hauptprofiteur ist Frankreich, das im vergangenen Jahr 9,4 Milliarden Euro aus dem Gemeinschaftstopf erhielt. Deutsche Landwirte bekamen mit 5,0 Milliarden Euro die Hälfte. Auch in die britische Landwirtschaft flossen Mittel - fast vier Milliarden Euro. Die Agrarpolitik ist der einzige Bereich, der "vergemeinschaftet" ist, der also vollständig von der EU finanziert wird. Diese Subventionierung der europäischen Bauern geht natürlich nicht nur zu Lasten der Verbraucher in der EU, die diesen Wahnsinn durch völlig überhöhte Preise subventionieren müssen, sondern auch zu Lasten der Bauern in den warmen Entwicklungsländern, deren viel preiswerterer Rohrzucker durch hohe Zölle vom europäischen Markt ferngehalten wird. Wenn die EU ihre Rübenbauern nicht mit Subventionsspritzen auf den Äckern halten würde, müsste die Union sieben Millionen Tonnen Zucker jährlich importieren, statt fünf Millionen so hochsubventioniert zu exportieren, dass die viel preiswerter arbeitenden Rohrzuckerbauern ihren viel preiswerteren Rohrzucker nicht einmal mehr auf ihren einheimischen Märkten los werden können! Ohne die unfaire Subventionspolitik der EU – 70 Mrd. € im Jahre 2002 – hätten die unterentwickelten Ländern zusätzliche Einnahmen in Höhe von 20 Mrd. € jährlich erzielen können. 102 Die entgehen den Bauern in den Entwicklungsländern, weil sich für sie angesichts z.B. der kollabierten Zucker-Weltmarktpreise weder Exporte noch Neuinvestitionen in ihre Landwirtschaft lohnen, da die EU mit ihrer unfairen Zuckermarktordnung alle Bemühungen der Kleinfarmer in Entwicklungsländern wieder zunichte macht. Insbesondere die kleinen südafrikanischen Bauern sehen keine Möglichkeit, ihren konkurrenzlos preiswerten Rohrzucker in die EU verkaufen zu können. Das geben mit ihrer Lobbyistentätigkeit erfolgreiche Verbände als „erfolgreiche Regierungsberatung“ aus, Verbände mit entgegengesetzten Zielen sprechen hingegen von „HardcoreLobbyismus“. Die EU-Zuckermarktordnug läuft 2006 aus. Die bisherigen Subventionen für die Zuckerrübenbauern und die Zuckerindustrie sollen zusammengestrichen werden. Eine neue Regelung mit geringeren Subventionen soll bis 2014/15 gehen. Die Preissenkungen sollen in zwei Schritten binnen zwei Jahren kommen. Für weißen Zucker soll der Preis um 39 Prozent verringert werden: von derzeit 631,9 Euro auf 385,5 Euro je Tonne. Für Zuckerrüben soll der Preis um 42,6 Prozent herabgesetzt werden: von jetzt 43,6 Euro auf 25,05 Euro je Tonne. Die Landwirte sollen zu 60 Prozent durch eine so genannte entkoppelte Prämie entschädigt werden. Das heißt, sie bekommen das Geld dann garantiert und unabhängig von der Menge der Produktion. Allerdings müssen sie umweltschonend anbauen. Die Kommission plant zudem einen Topf für die Branche, um unrentablen Produzenten den Ausstieg schmackhaft zu machen. Der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Gerd Sonnleitner, nannte die Vorschläge "unerhört, unerträglich und unverantwortlich". Die Pläne seien eine Kampfansage, sagte am Rande des Bauerntages in Rostock. "Wir nehmen mit allen und mit jedem den Kampf auf." Die Bauern würden nicht auf Einkommen verzichten, damit Brasilien zum weltweiten Monopolisten werde. Die Zuckermarktordnung ist nach Verbandsangaben Existenzgrundlage für mehr als 46 000 Bauern und mehr als 26 000 Beschäftigte der Zuckerbranche. Die EU-Kommission hatte hingegen 2004 klar gemacht, dass die Zuckermarktordnung keineswegs zum Erhalt der Arbeitsplätze beitrage. Binnen zehn Jahren seien 17 000 Arbeitsplätze in der Industrie abgebaut worden. Seien 1990 noch 240 Raffinerien gezählt worden, so seien es 2001 nur noch 135 in der EU gewesen. Die EU steht bei der Reform auch unter massivem Druck der Welthandelsorganisation WTO, unfaire Handelspraktiken aufzugeben. Brasilien, Thailand und Australien hatten Ende April ein Streitverfahren vor der WTO gewonnen. Die WTO erklärte, die EU verkaufe durch Subventionen künstlich verbilligten Zucker auf dem Weltmarkt. Zahlreiche arme Länder aus Afrika, der Karibik und des Pazifikraums exportieren Zucker zu garantierten, hohen Preis in die EU. Diese will nun schon 2006 mit einem Hilfsfonds in Höhe von 40 Millionen den dortigen Herstellern angesichts der geplanten Preissenkungen bei der Umstellung auf andere Pflanzen helfen. FR 23.06.05 Selbstverständlich demonstrierten die stets zu Demonstrationen bereiten Bauern unter Anleitung ihres Verbandes in Berlin. Das Fernsehen multiplizierte die Wirkung durch Übertragung der verbandszielwirksam inszenierten Demonstration. Die zuckerverarbeitende Industrie hingegen forderte im Sinne ihrer Industrie - und der Verbraucher - rasch niedrigere Preise, damit ihre Verbandsmitglieder den Rohstoff Zucker günstiger einkaufen können. Das wurde nicht mehr im Fernsehen gezeigt und war nur vereinzelt und nur der Tagespresse zu entnehmen. Nicht jeder Verband schafft es halt, hinreichend Ärger zu provozieren, um damit ins Fernsehen zu kommen und so sein Anliegen einer größeren Öffentlichkeit ganz direkt vor Augen zu führen. Es ist eben viel fernsehwirksamer, wenn der Bauernverband Fernsehsender wissen lässt, dass er im Zuge einer Traktordemonstration Mitglieder seines Verbandes mit Traktoren vorfahren und Zuckerrüben vor dem Parlament abkippen oder Milch vergießen lassen wird! 103 Die harmloseste Art der Beeinflussung ist von Verbänden finanzierte Schleichwerbung, durch die z.B. der Verband der Zigarettenindustrie erreichte, dass in viel geschauten Fernsehserien eine „sympathische Raucherfigur“ eingebaut wurde, „die selbstverständlich und sichtbar mit allen positiven Effekten raucht“ (STERN 31.10.02). Zur Abwendung verbandsschädlicher Bestrebungen wird zur Not auch versucht, Gegner der Verbandspolitik lächerlich zu machen. Im Falle der Abwehr der Wirkung publizierter Gutachten, die den Verbandszielen schaden könnten, versuchen im Extremfall einige rigorose Verbände und ihre Vertreter, durch erfundene falsche Behauptungen oder bestellte und großzügig bezahlte (Gegen-) Gutachten, Verbandsziele zu befördern und dabei nötigenfalls auch hartnäckigen Gegnern zu schaden und deren Ruf zu beschädigen oder – und da wird es bedenklich für das Funktionieren unseres Gemeinwesens - „Funktionsträger in Politik und Verwaltung“ zur „Minimierung des Eingriffswillens“ zu veranlassen, wie es z.B. im STERN (31.10.02) mit genauer Nennung von Beträgen am Beispiel des Verbandes der Zigarettenindustrie nachgewiesen wurde. So kam die Weltgesundheitsorganisation WHO bei einem europaweiten Vergleich der Schutzbestimmungen gegen das Rauchen zu dem Ergebnis, dass Deutschland (zusammen mit Dänemark und Großbritannien) in seiner Gesetzgebung den geringsten Nichtraucherschutz biete - was natürlich auf die effektive Arbeit der Lobbyisten des Verbandes der Zigarettenindustrie bei Politikern und in Ministerien zurückzuführen ist! In dem Stern-Artikel heißt es weiter: „Zurzeit blockiert das rot-grün regierte Deutschland als einziges EU-Land bei WHO-Verhandlungen in Genf eine Übereinkunft zur Ächtung von Tabakwerbung. Die ’Internationale Koalition tabakkritischer Nichtregierungsorganisationen’ hat Deutschland gerade der ’Marlboro-Mann-Preis’ verliehen – ’für das Nachplappern von Argumenten der Tabakindustrie in der Debatte um Tabakwerbeverbote’.“ 2005 sagte die Präsidentin der Deutschen Krebshilfe, Schipanski: “Die Deutschen werden von einer aggressiven Raucherwerbung überflutet.“ Und das alles, obwohl die Zigarettenindustrie Raucher durch die Beimengung von Stoffen bewusst nikotinabhängig zu machen versucht: Rauchen: Krebsforscher klagen an Sucht - der Vorwurf: Zusatzstoffe in Zigaretten wie Menthol, Zucker und Kakao verstärken die Abhängigkeit. Berlin/Hamburg - Die Zigarettenhersteller haben Manipulationen stets geleugnet. Doch jetzt sind sich Wissenschaftler sicher: Die Industrie mischt seit Jahrzehnten chemische Zusatzstoffe in den Rohtabak. Das Ziel, so Martina Pötschke-Langer vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ): "Die Abhängigkeit möglichst schnell mit nur wenigen Zigaretten zu erreichen und die Sucht dauerhaft aufrechtzuerhalten." DKFZ-Experte Heinz Walter Thielmann forderte gestern in Berlin ein Verbot krebs- und suchterregender Zusatzstoffe. Das Verhalten der Hersteller sei, so Rechtsexperte Michael Adams von der Universität Hamburg, "eine strafbare gemeingefährliche Vergiftung". Dieser Tatbestand betreffe auch den Vertrieb. Damit handele es sich laut Strafgesetzbuch um einen "gewerbsmäßig betriebenen Betrug". Eine Anklage sei sehr wahrscheinlich. Er wies darauf hin, daß Lightzigaretten noch gefährlicher seien als normale Zigaretten. Wie kommen die Kritiker zu ihren Vorwürfen? Sie berufen sich auf ehemals vertrauliche und heute im Internet zugängliche Dokumente der Tabakindustrie, die das Forschungszentrum jetzt in dem Band "Die Tabakindustrie I" veröffentlicht hat. Daraus gehe die Liste der Zusatzstoffe hervor: Menthol, Zucker, Kakao, Ammoniak, Harnstoff und andere Substanzen. Besonders erschütternd sei, daß die Hersteller Werbestrategien und Produkte gezielt auf Kinder und Jugendliche abstimmten. Zum Beispiel beim Menthol: Der Stoff ermögliche ein tiefes Inhalieren des sonst schmerzhaften Rauches. Mit Zucker werde der strenge Tabakgeschmack überdeckt. Die Tabakverordnung erlaube seit 1977 alle auch für Lebensmittel zulässigen Zusätze, erklärte Thielmann. Dabei bliebe jedoch außer acht, daß aus vielen dieser Stoffe bei der Verbrennung gesundheitsschädliche Verbindungen entstünden. So würden aus Feuchthaltemitteln, Zucker und Aromen beispielsweise krebserregende Epoxide, Nit- 104 rosamine und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe gebildet. "Ein ohnehin gefährliches Produkt wird noch gefährlicher gemacht", sagte Martina Pötschke-Langer. Ohne diese Zusätze wären Zigaretten "kratzig und wenig attraktiv", ergänzt Thielmann. Niemals zuvor habe eine Kindergeneration derart gefährliche Produkte konsumiert, sagte Pötschke-Langer. Bis zum 17. Lebensjahr rauche fast die Hälfte aller Jugendlichen. Täglich sterben in Deutschland 400 Menschen an den Folgen des Rauchens, so Pötschke-Langer. Dahinter stehe ein Riesengeschäft. Jurist Adams: "Ein lebenslanger Raucher bringt netto knapp 30 000 Euro." (HH A 18.03.05) Als ein anderes Beispiel sei auf die deutsche Autoindustrie verwiesen: Sie lief Sturm, als die EU dabei war, die Altautoverwertungsverordnung zu beschließen und brachte ihre Abgeordneten in Stellung. Das wiederholte sich, als die EU etwas gegen die Gefährlichkeit von Feinstäuben/Schwebstoffen/ Aerosolen tun wollte, die laut EU-Nachrichten 07.04.05 für insgesamt 65.000 Tote jährlich wegen Krebs, Herz-Kreislauf-, Atemwegs- und Lungenerkrankungen allein in Deutschland ursächlich sind. Diese Feinstäube sind, wenn sie groß sind, fünfmal so groß wie Bakterien oder weniger als zehn Mikrometer groß, weniger also als ein Hundertstel Millimeter, ein Zehntel bis ein Fünfzigstel so dick wie ein Haar. Ultra-Feinstäube sind noch bis zu 100-mal kleiner und können darum über die Lunge und das Blut in die Zellen eindringen. Unter einer hohen Belastung mit Feinstäuben kann der Sauerstoffgehalt des Blutes so weit abnehmen, dass der Herzmuskel schlecht mit Sauerstoff versorgt wird. Das wiederum kann die Herzmuskelfunktion beeinträchtigen. So dürften die ungefilterten Abgase von Dieselmotoren verantwortlich sein für u.a. zahlreiche Sekundentode von scheinbar gesunden Personen; das ist die Hälfte aller Menschen, die später einmal an einem plötzlichen Herztod sterben (STERN 28.07.05). Um die Todesfälle durch Feinstäube und insbesondere UltraFeinstäube zu reduzieren, sei es jedoch notwendig, auch Grenzwerte für den feinsten Feinstaub unter 2,5 Mikrometer festzuschreiben, der hauptsächlich durch Dieselruß verursacht werde. „Fahrzeuge, vor allem Dieselautos, sind für etwa die Hälfte der gesundheitsschädlichen Feinststaubbelastungen mit ultrafeinen Partikeln verantwortlich. ... Aber auch in Innenräumen gibt es zahlreiche Quellen für diese winzigen Partikel. Gesundheitlich besonders problematisch in diesem Zusammenhang ist Zigarettenrauch, aber auch, wenn in größeren Mengen Räucherstäbchen oder Kerzen verbrannt werden. Dadurch bekommen wir im Nu in Innenräumen wesentlich höhere Konzentrationen als draußen an einer vielbefahrenen Straße.“, äußerte der Epidemiologe am Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle, Prof. Herbarth, in einem Interview im STERN 07.04.05. Beim Thema Feinstaub wird deutlich, wie sehr Umwelt- und Gesundheitsschutz zusammenhängen. Menschen können die Feinstaubpartikel weder sehen noch riechen noch auf der Haut spüren. Sie entstehen hauptsächlich durch die Natur (z.B. Pollenflug), durch Verbrennungsprozesse in der Industrie (40 %), beim Heizen der Wohnungen und Betriebe, durch Stäube (Bodenerosion und Getreideverarbeitung) und durch den Fahrzeugverkehr: Asphalt-, Reifen- und Bremsenabrieb sowie Rußpartikel aus Dieselmotoren verursachen etwa 30 % der Feinstäube. Ihre Verursachung geschieht also nicht monokausal durch das Auto. Eine dauerhafte Erhöhung der Feinstaubkonzentration um zehn Mikrogramm pro Kubikmeter verringert die durchschnittliche Lebenserwartung der Bevölkerung nach Schätzungen der EU um in etwa neun Monate. Feinstaub verkürze die Lebenserwartung der EU-Bürger um 8,6 Monate und die der Deutschen sogar um durchschnittlich 10,2 Monate, warnte Roberto Bertollini vom WHO-Regionalbüro für Europa in Rom und forderte konsequentere Maßnahmen zur Luftreinhaltung. "Durch die Verhinderung der Feinstaub-Toten könnte die EU jährlich bis zur 161 Milliarden Euro sparen." Die entsprechenden Zahlen für Deutschland lägen bei bis zu 34 Milliarden Euro pro Jahr (DIE WELT 15.04.05). Deswegen arbeitete die EU seit 1996 an einer Feinstaubverordnung, die dann 1999 (1999/30/EG) erlassen wurde und die schon längst von den Mitgliedsländern hätte umgesetzt sein sollen, was die Bundesrepublik aber bis 2005 wieder mal nicht rechtzeitig gemacht hatte(!). "Hauptquelle für die Feinstaubpartikel sind Dieselfahrzeuge", erklärte Professor Erich Wichmann vom GSF- 105 Institut für Epidemiologie in Neuherberg bei München. "Es ist dringend erforderlich, zu handeln", erklärte Wichmann. An verkehrsreichen Straßen, wo die Belastung besonders hoch ist, verursacht Dieselruß laut einer Untersuchung des Umweltbundesamtes etwa 50 % des Staubes (STERN 07.04.05), weshalb die EU 2004 beschließen wollte, dass mangels anderer leicht umsetzbarer Verminderungsstrategien im Bereich der Industrie Dieselautos nur noch mit eingebautem Rußfilter verkauft werden dürften. Die Dieselmotoren sollten deswegen besonders schnell durch Rußfilter gesundheitsverträglicher gestaltet werden, weil die Partikel aus Dieselmotoren besonders klein sind, deswegen besonders tief in den Körper eindringen und ihn daher in besonderer Weise schädigen. Einen solchen Rußfilter hatte Peugeot schon, nicht aber die deutsche Automobilindustrie. Die hatte bis dahin auf innermotorische Rußverhinderungsstrategien gesetzt, aber bislang keine befriedigende technische Lösung gefunden - und so die Rußfilterentwicklung verschlafen. Darum wurde von VW der „Autokanzler“ so in Stellung gebracht, dass in Brüssel ein Aufschub der Einbauverpflichtung für Rußfilter in Dieselautos erreicht wurde. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisierte in mehreren Kampagnen, dass politische Einflussnahme der Automobilwirtschaft "dringend nötige Umweltgesetze" wie die Steuerförderung für den Einbau dieser Filter ausgebremst habe (SPIEGEL ONLINE 14.01.05). Das ist „Hardcore-Lobbyismus“ zu Lasten der gerechtfertigten Gesundheitsbelange der Allgemeinheit! Ein bisschen peinlich war es allerdings für die Deutsche Umwelthilfe, als herauskam, dass Rußfilterhersteller die Arbeit des Verbandes mit sechsstelligen Eurobeträgen unterstützt hatten; aber die Ziele der DUH werden dadurch ja nicht falsch, wenn sie nach dem Motto des Grafen Mirabeau in der Zeit der Französische Revolution handelt: „Ich lass’ mich bezahlen, aber ich verkauf’ mich nicht!“ Die DUH ihrerseits unterstützt Klagen gegen westdeutsche Kommunen wegen der Überschreitung der Grenzwerte an mehr als 35 Tagen im Jahr. In der Debatte über gefährlichen Feinstaub wird allerdings oft übersehen, dass nach einer Studie des Mailänder Krebsforschungsinstituts eine Zigarette soviel Feinstaub an die Umwelt abgibt wie ein Dieselfahrzeug in 100 Minuten. Wobei wir wieder bei der Zigarettenindustrie und ihrer Lobbyarbeit wären. Erwähnt werden soll auch die Pharmabranche, die sich mittels »ihrer« Abgeordneten querzulegen versucht, wenn Gesetze beschlossen werden sollen, die ihr zu Gunsten der Sozialkassen ihre Verdienstmöglichkeiten zu beschneiden drohen; zuletzt zu beobachten, als es im Zuge der Gesundheitsreform um die Deckelung der Kosten durch die erweiterte Festpreisregelung für Medikamente und die Anerkennung unwesentlich veränderter alter Produkte als Neuschöpfung mit damit verbundenem (weiteren) Patentschutz ging. Für so geartete Fälle haben Firmen und Verbände aus allen Bereichen der Wirtschaft sich Abgeordnete durch Weiterzahlung hoher Gehälter – selbstverständlich neben den Diäten – gehalten. Die firmen- oder verbändegebundenen Parlamentarier fungierten im Parlament als Frühwarnsystem ihrer Entsender und waren bemüht, Parlamentsentscheidungen zu Gunsten der ihnen verbundenen Firmen und Verbände zu beeinflussen. So hat sich schon allein durch die Verschiebung der Einführungspflicht von Rußfiltern für Dieselmotoren für die Autofirmen das »Abgeordneten-Sponsoring« bezahlt gemacht! Nun ist es legitim, dass gesellschaftliche Gruppen ihre Vertreter auch in das Parlament bringen. Das ist sogar gewollt, damit möglichst viele gesellschaftliche Gruppen im Parlament vertreten sind und so Sachverstand aus den verschiedensten Bereichen in die parlamentarische Tätigkeit einfließen kann, und um zu verhindern, dass der Deutsche Bundestag hauptsächlich ein Parlament der öffentlich Bediensteten wäre. Es ist daher zu begrüßen, wenn große Konzerne Mitarbeiter für eine Parlamentstätigkeit freistellen und ihnen analog der Regelungen im Öffentlichen Dienst ein Rückkehrrecht für den Fall der Beendigung ihrer Mandatstätigkeit einräumen. Jeder Mensch ist teils freiwillig und teils sogar unfreiwillig in gesellschaftliche Gruppen eingebunden und vertritt nach seinen Überzeugungen deren Interessen: er ist. z.B. Katholik, Arbeitnehmer, Gewerkschafter, Selbständiger, Bayer, Autofahrer, Kaninchenzüchter, Sportler … Diese Art von Interessenvertretung ist legitim und gewollt, damit im Parlament möglichst 106 das gesamte Spektrum des gesellschaftlichen Lebens zum Tragen kommt. Der Deutsche Bundestag ist keine berufsfreie Zone und keine interessenfreie Versammlung. Wer aber als Politiker auf der Gehaltsliste eines Unternehmens steht, dafür jedoch keine Arbeit leistet oder nichts Adäquates tut, wird zwar nicht, wie in Russland leider zu oft üblich, für sein gezieltes Abstimmungsverhalten (zwischen 500.000 bis 1 Mill. €) bezahlt, offenkundig aber für seinen politischen Einfluss. Weil ein Abgeordneter, der von Konzernen eine Art "bedingungsloser Zusatzdiät" bezieht, sich dem Verdacht der Käuflichkeit aussetzt, hat das BVerfG 1975 die Gesetzgeber verpflichtet, wirksame Vorkehrungen gegen "arbeitlose" Zahlungen an Abgeordnete zu treffen. Es dürfe keine speziell bezahlte Lobbyistentätigkeit von Abgeordneten geben. Transparenz ist die einzige Chance, Legales von Illegalem unterscheiden zu können. Diesbezügliche Regelungen hat bisher (Ende 2004) aber nur der Niedersächsische Landtag getroffen. Der Verfassungsrechtler und Parlamentskritiker von Arnim plädiert dafür, dass Abgeordnete nicht nur die Art, sondern auch die Höhe ihrer Nebeneinkünfte öffentlich machen müssen. Dann würde der Wähler selbst erkennen, dass beispielsweise ein Ausschussvorsitzender im Bundestag gar nicht in der Lage sein kann, nebenbei noch ein volles Salär eines Unternehmens zu verdienen: „Tut er es dennoch, spricht alles dafür, dass er gekauft wurde“ (Interview in DIE WELT 18.01.05). „Der frühere Chef des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Hans-Olaf Henkel, plädierte für die Veröffentlichung aller Nebenbezüge von Bundestagsabgeordneten sowie der dafür geleisteten Extra-Arbeitszeit. Nur so könnten mögliche Interessenkonflikte deutlich werden, erklärte Henkel“ (DIE WELT 08.01.05). Und das auch nur unvollkommen, denn in dem „Verbändestaat“ Bundesrepublik gibt es einen Merksatz: „Politikern muss man nicht plump ein Extragehalt zahlen: es gibt ja das Mittel der Spenden und Honorare für Vortragstätigkeiten und Beratungen.“ Weil das aber keine kontinuierlichen Zahlungen sind, werden Beraterverträge geschlossen, die oft gewollt nebulös formuliert sind. So zahlte der CDU-nahe Medienmogul Leo Kirch seinem Freund Helmut Kohl nach dessen Ausscheiden aus dem Kanzleramt von 1999-2002 jährlich 600.000 Mark plus Spesen für eine Beratertätigkeit „zu aktuellen wie strategischen politischen Entwicklungen in Deutschland und Europa“ (STERN 20.01.05). So ein bewusst nebulös gehaltener Beratervertrag ist schon im Bereich leistungsloser Abgeordneten-Nebeneinkünfte anzusiedeln! Obwohl das BVerfG geurteilt hat, dass eine Bezahlung an Abgeordnete, der keine Leistung entspricht, nicht rechtens sei, finde ich es sogar in Ansehung der Gefahr einer möglichen Interessenkollision im Einzelfall in Ordnung, wenn Abgeordnete von ihren potenten Firmen auf freiwilliger Basis für den Fall einen Gehaltsausgleich erhalten, dass sie bei ihren früheren Arbeitgebern mehr verdient haben, als ihr Mandat ihnen einbringt; schließlich sollte man die Parlamentarier und ihre Familien nicht dafür bestrafen, dass Spitzenleute, deren Sachverstand im Parlament dringend(!) gebraucht wird – ein Parlament kann nie genug Sachverstand haben(!) -, in die Politik gehen und mit ihrem hoffentlich vorhandenen Weitblick dem Staatswesen dienen und so das Gemeinwohl fördern. Wirtschaftspolitik z.B. wird am besten von Volks- und Betriebswirten durchschaut, und nicht von Sozialarbeitern oder Geisteswissenschaftlern, biotechnologische Fragen von Biologen und Medizinern, … Wenn man einerseits eine firmen- oder verbandsgebundene Bezahlung von Abgeordneten ablehnt, andererseits aber eine »finanzielle Patriotismus-Bestrafung« hochqualifizierter Menschen, die in die Politik gehen und dort unter Einkommensverzicht ihr Spezialwissen der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, wie es in den USA recht verbreitet ist, vermeiden will, bliebe nur der Weg eines finanziellen Ausgleichs über staatliche Zuschüsse bis zur Höhe des bisherigen, vor Eintritt in das Parlament erzielten Einkommens. Das schüfe aber unter den Abgeordneten eine Mehr-Klassen-Gesellschaft. Und das will man auch nicht. Da scheint der gangbarste Weg zu sein, eine Bezahlung des MdB durch seinen bisherigen oder neuen Auftraggeber unter Offenlegung der Interessegebundenheit zuzulassen und die Diäten auf das von dritter Seite gezahlte Einkommen in bestimmtem Umfang oder vollständig anzurechnen. Abgeordnete sollten ihre Firmen- oder Verbandsverbundenheit öffentlich machen müssen. Dabei wäre es nicht ausreichend, wenn ein Wirtschaftsanwalt, der (fast) ausschließlich für einen 107 potenten Verband oder Konzern als Justitiar arbeitet, angäbe, er sei „Rechtsanwalt“. Für die geforderte und angestrebte Transparenz in dem Beziehungsgeflecht möglicher Abhängigkeiten würde es auch nicht genügen, wenn ein Abgeordneter ausschließlich angäbe, er sei Inhaber einer Beraterfirma! Aus einer so bewusst verschleiernden Angabe könnte nicht auf mögliche Verquickungen mit Gruppeninteressen geschlossen werden. Und es ist eindeutig zuviel, wenn Firmen und Verbände »ihren« Abgeordneten ihre früheren Gehälter zusätzlich zu den Einkommen als Abgeordnete zahlen und sich so »ihre« Abgeordneten halten! Denn solches »Abgeordneten-Sponsoring« verfestigt in unzulässiger Weise Abhängigkeiten, die sich auch gegen das Gemeinwohl auswirken können, so dass wir die ungefilterten Rußpartikel oder als Passivraucher den Zigarettenqualm der unvernünftigen Zeitgenossen einatmen, von der Papier- und der chemischen Industrie über zu hohe genehmigte oder ungenehmigte Schadstoffeinleitungen verunreinigtes Wasser trinken mussten und vielleicht noch müssen, das oft nicht ausreichend gefiltert worden war oder gefiltert wird, ... Und es müsste – aber wie, über Stiftungen? - sichergestellt bleiben, dass nicht nur zahlungskräftige Gruppen Vertreter ins Parlament schicken, sondern auch denen kritisch gegenüberstehende Gegengruppen. Die Macht der Lobbyisten außerhalb und – im Extremfall durch Verbandsvertreter als Abgeordnete - auch innerhalb des Parlaments ist so groß, dass der ehemalige Arbeitsminister Blüm angesichts einer von ihm angestrebten aber nicht in der angestrebten Form erreichten Gesetzesänderung klagte: "Die Verbände übernehmen die Herrschaft, und der Staat wird zum Notar, der lediglich das Ergebnis der Kungelei beglaubigt." Ein Politologe sprach in einem seiner Bücher vom »Verbändestaat«, weil die Verbände eine Art Neben- und Gegenregierung gebildet hätten. Ihre Macht ist so stark, dass Politiker sich selbst angesichts leerer Staatskassen scheuen, einzelnen Verbänden gegen deren Widerstand Subventionen zu kürzen, weil dann Gegenmacht mobilisiert wird. Die Verbände und die von ihnen bezahlten Lobbyisten handeln nach der Berufsmaxime: „Lerne klagen, ohne zu leiden.“ Nur so schlägt man am effektivsten Subventionen heraus. Ernst zu nehmende Politiker sehen einen Ausweg nur darin, allen Verbänden nach der Rasenmähermethode 10 % der gewährten Subventionen zu kürzen: Dann habe man nur einmal ein großes Geschrei, dass aber bald wieder abklingen werde, weil es alle Interessengruppen gleichmäßig getroffen habe. Ein anderer Ausweg könnte in der Schaffung von mehr Transparenz liegen. Diesen Weg beschreitet „Lobbycontrol“ (www.lobbycontrol.de/blog). Das im Internet als Weblog angelegte Projekt, seit Anfang Mai 2005 online, will den Einfluss wirtschaftlicher Eliten auf die Politik transparent machen, ohne freilich direkt massenhafte Proteste auszulösen. Da in den herkömmlichen Medien oft nicht ausreichend über Hintergründe des Lobbying berichtet wird, soll mit diesem Projekt ein Gegengewicht zur stark professionalisierten PR- und Lobbyszene in Deutschland geschaffen werden. Lobbycontrol steht dabei in der Tradition ameisenhafter journalistischer Aufklärungsarbeit vieler. Es zählt zu den "Watchblogs" wie bildblog.de oder spindoktor.de, die Fehlentwicklungen in Politik, Wirtschaft oder Medien anprangern. Mittelfristig soll aus dem Watchblog sogar ein "Watchdog" werden, eine Organisation angelsächsischen Stils, die Missstände nicht nur in Internetforen im Stile von wikipedia.de benennt, sondern mittels Pressemitteilungen, öffentlicher Veranstaltungen und insbesondere auch weitergehender Internetaktivitäten aktiv bekämpft. Schon Kurt Tucholsky hatte über das Abhängigkeitsverhältnis der Abgeordneten von den Lobbyisten bissig bemerkt: "Sie dachten, sie wären an der Macht, dabei waren sie nur an der Regierung." Zunehmend wächst die Einsicht, dass die »Lobbykratie« domestiziert werden müsste: Aber wie sollen z.B. einige Parteien ihre wichtigsten Geldgeber domestizieren? Kaum ein Hund beißt die ihn fütternde Hand des Herrchens! Sonst kriegt er Prügel - kommt ins Tierheim oder wird ein »Laborhund« mit nur noch minimaler Lebenserwartung. Je verbandsabhängiger und damit verbandsdruckempfindlicher eine Partei(führung) ist, desto weniger wird man von ihr ehrlicherweise eine Verbesserung der inzwischen ziemlich aus dem Ruder laufenden unguten Verhältnisse erwarten dürfen! Die vor 40 Jahren gestartete Initiative zur Schaffung eines die Macht der Verbände kontrollierenden Verbändegesetzes ist – wie nicht 108 anders zu erwarten - im Sand verlaufen. „Der kooperative Staat hinterlässt eine Lücke im Regelungsbereich der Verfassung, die nicht mehr völlig zu schließen ist“, stellte der Richter am Bundesverfassungsgericht Grimm fest. Funktionsträger in Politik und Verwaltung haben grundsätzlich das Allgemeininteresse zu vertreten, während Lobbyisten aufgaben- und auftragsgemäß ausschließlich die Privatinteressen der sie finanzierenden Geldgeber zu fördern suchen. Und man kann nicht davon ausgehen, dass die Summe der Privatinteressen das Allgemeininteresse ergäbe! Die Lobbyisten betätigen sich als die Helfer der Vampire des Staates, die für sich soviel Lebenssaft wie möglich aus dem Staat zu saugen versuchen – bis er blutleer ist und nicht mehr ausreichend Geldmittel zur Finanzierung dringend notwendiger Gemeinschaftsaufgaben vorhanden sind. „Es gibt zu viele Lobbyisten“ ist die in seinem Buch „Die Demokratie verrät ihre Kinder“ offensiv vertretene zentrale These des früheren Europa-Chefs von Greenpeace und jetzigen Geschäftsführers der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch, Thilo Bode. Auszüge aus einem Interview im Hamburger Abendblatt vom 17.05.03: „Bode: Die Demokratie in den westlichen Industrieländern wird heute viel zu sehr von Partikularinteressen dominiert. Das Allgemeinwohl wird dagegen vernachlässigt. Dies gilt vor allem für wichtige Zukunftsfragen wie die Reform der sozialen Sicherungssysteme. ... Es gibt derzeit in vielen Industrieländern Reformstaus. Deutschland ist kein Einzelfall. In der Bundesrepublik gehören vor allem die Unternehmerverbände und Standesvertretungen wie kassenärztliche Vereinigungen, Beamtenbund oder Gewerkschaften zu den Blockierern. Dabei haben die Industrieverbände den größten Einfluss. Der mächtigste ist der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). ... Zukunftsprobleme werden aufgeschoben. Die Folgen sieht man an der Renten- und Gesundheitsreform. Ihre Lösung wird mit jedem Jahr teurer. Wenn man wartet, bis der ganze Staat pleite ist, wird es zweifach teuer: Man muss heute mehr zahlen und hat dadurch weniger, um für morgen vorzusorgen. Außerdem wird bei den Schwächsten gespart. ... Wir haben es hier mit einem grundlegenden Versagen der Demokratie zu tun. Die Lobbyisten sind mittlerweile so stark organisiert, dass demokratische Entscheidungen möglichst viele Interessengruppen befriedigen, aber nicht mehr den Willen des Wählers repräsentieren. ... Es gibt [für Lobbyarbeit; der Verf.] zum einen den direkten Einfluss über die Bundestagsabgeordneten, die im Parlament sitzen. Die meisten Abgeordneten sind nicht unabhängig, sondern Handlanger von Verbänden. Auch die Bürokratie ist von Lobbyisten durchsetzt. ... Dazu kommt der Einfluss der Verbände über die Medien. ... Im vergangenen Jahr [2002; der Verf.] hat der Verband der Zigarettenindustrie dem Gesundheitsministerium ganz legal 11,8 Millionen Euro überwiesen. Und zwar für eine Kampagne, um Jugendliche vor dem frühen Einstieg beim Rauchen zu warnen. Ein Schelm, wer Schlechtes dabei denkt. ... Abendblatt: Die Bundesregierung setzt sich schließlich auch gegen ein [europaweites; der Verf.] Werbeverbot für Zigaretten ein, ganz im Sinne der Tabakindustrie ... Bode: Viel schlimmer finde ich aber die im System angelegte extreme Kurzatmigkeit und Teillösungsmentalität der Politik. Dem Bürger werden keine Konzepte mehr unterbreitet. Er kann deshalb auch nicht beurteilen, welches Konzept ausgewogen oder zukunftsweisend ist. Abendblatt: Welche Möglichkeiten demokratischer Einflussnahme hat der Bürger überhaupt noch, außer alle vier Jahre zur Wahl zu gehen? Bode: Auch ich habe kein revolutionäres Konzept parat. Zur Wahl gehen reicht jedenfalls nicht. Der Bürger kann sich eigentlich nur selbst in Gruppen organisieren, um sich zu wehren.“ Anmerkung: Solchen Gruppen fehlt dann aber meist das Fachwissen und die Manpower, um z.B. in den hochkomplizierten gesetzlichen Verästelungen unserer sozialen Sicherungssysteme die Auswirkungen (möglichst alternativ) vorgeschlagener Reformen überschauen und berechnen zu können. Da ist der einzelne Bürger dann wieder auf Gedeih und Verderb auf die Berechnungen hoch spezialisierter Verbände angewiesen. Er kann nur hoffen, dass sich die gegensätzlichen Einflussversuche konkurrierender Verbände – wenn es sie gibt! - ausgleichen und in deren Kämpfen um Einfluss überprüfbare Zahlen auf den Tisch kommen. Aber der Bürger kann die 109 Grundentscheidung mittreffen, ob z.B. bei Kranken über 75 oder 85 Jahre nur noch zur Schmerzlinderung erforderliche Operationen vorgenommen, den „betagten“ Kranken teure medizinische Leistungen jedoch versagt werden sollten, wie es z.B. ein Professor für katholische Theologie oder der Vorsitzende der Jungen Union wegen der zunehmenden Finanzierungszwänge in einer alternden Gesellschaft forderten, indem der Wahlbürger die Partei wählt, die das ihm einleuchtendste Konzept vertritt. Konkurrenzlos agierende Verbände, die gemäß ihres Verbandszwecks ja ausschließlich Verbandsinteressen durchsetzen wollen, bilden hingegen eine latente Gefahr für das Allgemeinwohl! Bundeskanzler Schröder bezeichnete die Lobbyisten als „Kettenhunde der Verbände“, für die Beziehungen alles sind – und deren »Geschäftskapital« sich nach einem Regierungswechsel möglicherweise als ziemlich wertlos herausstellen kann, wenn andere Parteien, zu denen keine so intensiven Beziehungen aufgebaut werden konnten, ans Ruder des Staatsschiffes kommen. Darum müssen Lobbyisten ständig nach allen Seiten hin ihre Fäden spinnen, in deren Netz sich die Entscheidungsträger in der Politik und dann indirekt die von deren Entscheidungen abhängigen Bürger verfangen sollen. Ärgerliches Beispiel aus jüngster Zeit: Die durchgesetzte einheitliche »Beratungsgebühr« pro Medikament für die bloß Schubladen ziehenden Apotheker, die ausschließlich den Patienten das fertig abgepackte Medikament auf den Verkaufstresen legen, das ihnen von ihrem Arzt verordnet und dessen Anwendung vom Arzt meist schon auf dem Rezept notiert worden ist. Die honorierte »Beratung« besteht ausschließlich im Hervorkramen der Packung und dem Kassieren des Geldes. Zwangsabgabe ohne jegliche Gegenleistung! Äußerst ärgerlich!!! Ein weiteres Ärgernis in diesem Zusammenhang waren für mich all die Jahre die überhöhten Arzneimittelpreise der deutschen Pharmakonzerne, die ihre hier entwickelten und hier produzierten Produkte in Deutschland wesentlich teurer anboten als im europäischen Ausland, wohin sie ja erst noch kostenträchtig transportiert werden mussten. Kanada und andere Staaten hatten ein so »erfolgreiches« Geschäftsgebaren durch staatliche Preiskontrollen für Medikamente verhindert, nicht so die Bundesrepublik. Da war auch die Lobby am Werk! Zum Glück ist dieses unanständige Preisgebaren durch die Konkurrenz im Ausland agierender Internet-Apotheken, die auch deutsche Patienten beliefern, und die Freigabe von ReImporten deutscher Arzneimittel aus dem Ausland etwas eingeschränkt worden. „Die Pharmakonzerne ärgern sich maßlos über die Konkurrenz, die ihnen die noch immer üppigen Gewinne abgräbt. Angeführt von Roland Koch, CDU-Ministerpräsident im Pharmafirmen-Standort Hessen, jammerte ihre mächtige Lobby den Gesundheitsreformern die Ohren so voll, dass laut Gesetz Importpillen nur noch erlaubt sind, wenn sie 15 Prozent oder mindestens 15 Euro billiger sind als hiesige Ware. ’Da fallen künftig viele Medikamente aus dem Raster, die nur 14 Euro billiger sind’, klagt [der Arzneimittel-Reimporteur Edwin K.; der Autor] Kohl. Auch die deutschen Krankenkassen sind sauer. ’Selbst für 14 Euro Ersparnis pro Mittel wären wir schon dankbar’, sagt AOKExperte Robert Stork“ (STERN 04.03.04). Das ist effektive Lobbyarbeit! Am effektivsten ist es natürlich, wenn es einer Lobby – sehr zum Ärger eines mit ihr um politischen Einfluss konkurrierenden Verbandes – gelingt, ihre Vertreter gleich in den Bundestag zu bringen, wo sie sich dann als stimmberechtigte Bremser betätigen können, wenn ihre Verbandsinteressen in einer Art und Weise berührt werden, die ihnen nicht passt. Keine andere Interessenvertretung habe einen solchen Einfluss auf die Gesetzgebung, wie die Gewerkschaften, klagte der BDI-Präsident Rogowski, da 40 % aller Parlamentarier Gewerkschaftsmitglieder seien, obwohl nur jeder vierte bis fünfte Arbeitnehmer gewerkschaftlich organisiert ist: „Und das ist zuviel.“ Der BDI-Präsident war 2003 diesbezüglich „not amused“! Die Krone der Lobbyistentätigkeit besteht darin, dass es ein Verband schafft, ein ganzes Ministerium - einschließlich des Ressortleiters! - den eigenen Wünschen und Vorstellungen zu unterwerfen. Daran gemessen war in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland der erfolgreichste Verband der Bauernverband. Und das gilt im Rahmen der EU für alle europäischen Bauernverbände, für deren Belange mehr als 40 % der EU-Etatmittel für teilweise die unsinnigsten Maßnahmen der Anbauförderung und anschließenden Überschussvernichtung durch Wegkippen von Milch und Wein oder dessen Destillierung zu Alkohol, Zermatschen von Obst- und Gemüseüberschüssen mittels dafür eingesetzter Planierraupen, ... zur Verfügung gestellt werden, die dann fehlen, wenn 110 es um die Finanzierung der überlebenswichtigen Ausgaben für Zukunftsgestaltung in einer globalisierten Weltwirtschaft geht: der Forschungsetat der EU zur Förderung von Zukunftstechnologien beträgt demgegenüber nur 12 % (STERN 16.06.05)! Mit 40 % Vertretern der Abgeordneten stellen Gewerkschafter aus allen Berufsgruppen die größte Lobby-Gruppe im Parlament, noch vor den Beamten, die ja auch teilweise gewerkschaftlich organisiert sind und von denen die größte Gruppe durch die Lehrer repräsentiert werden. Dem SPDPolitiker Wehner wird das Bonmot zugeschrieben: „Das Parlament ist mal voller, mal leerer – aber immer voller Lehrer!“ Ein schönes Bonmot – das aber nicht stimmt: es gibt im 15. Deutschen Bundestag nur 78 Lehrer. Die größte Gruppe bilden die Juristen 117, die damit 20 % aller MdBs stellen. Allerdings überschneiden sich bei dieser Betrachtung die einzelnen Gruppen, denn es gibt z.B. gewerkschaftlich organisierte Lehrer und Juristen. Um den Einfluss der für ihn ärgerlichen Konkurrenz-Lobby zu beschneiden, verstieg sich der Präsident des „Bundesverbandes der Deutschen Industrie“ (BDI) zu der Forderung: „Deutschland braucht ein neues Wahlrecht!“ Als Änderung unseres Wahlsystems schlug er vor, das Verhältniswahlrecht abzuschaffen und statt dessen ein personalisiertes Wahlrecht dergestalt einzuführen, dass auf den Stimmzetteln auch Mitgliedschaften in Verbänden angegeben werden müssten: Die Spekulation des Arbeitgebervertreters ging natürlich dahin, bei den schwindenden Mitgliederzahlen der Gewerkschaften darauf zu setzen, dass empfindliche Individualisten-Nasen der Arbeitnehmer sich vom »Gewerkschaftsmief« abgestoßen fühlen könnten: Es wird auf einen »Igitt-Effekt« beim nicht gewerkschaftlich gebundenen Wähler gehofft. Der Einfluss seines auf anderen Faktoren fußenden Interessenverbandes würde ja erhalten bleiben, sich möglicherweise sogar ausdehnen, wenn die Zahl der Gewerkschaftsvertreter im Parlament reduziert werden könnte. So weit wie der BDI-Präsident war bisher noch keine Lobby gegangen, dass sie – letztlich zur besseren Durchsetzung ihrer eigenen Verbandsziele - eine Änderung unseres Wahlsystems gefordert hätte. Das rührt an das Fundament unserer Demokratie! Dann könnte ja auch gefordert werden, dass auf dem Stimmzettel angegeben werden müsste, ob und gegebenenfalls welcher religiösen Bindung ein Bewerber angehört, um ebenfalls einen Igitt-Effekt der Andersgläubigen oder der kirchenfernen Wähler – z.B. der Atheisten: „Von Rom werden wir uns nicht regieren lassen!“ - hervorzurufen, zumal die Glaubenskongregation des Vatikans (vormals: „Inquisition“) 2003 in Fragen der »Homo- und Lesben-Ehe« auf 12 Seiten Richtlinien für katholische Politiker veröffentlichte, von denen die sich leiten zu lassen hätten und in denen es heißt: „Wenn alle Gläubigen verpflichtet sind, gegen die rechtliche Anerkennung homosexueller Lebensgemeinschaften Einspruch zu erheben, dann sind es die katholischen Politiker in besonderer Weise. ... Wenn sie mit Gesetzesvorlagen zu Gunsten homosexueller Lebensgemeinschaften konfrontiert werden, sind folgende ethische Anweisungen zu beachten: ... hat der katholische Parlamentarier die sittliche Pflicht, klar und öffentlich seinen Widerspruch zu äußern und gegen den Gesetzentwurf zu votieren. Die eigene Stimme einem für das Gemeinwohl der Gesellschaft so schädlichen Gesetzestext zu geben, ist eine schwerwiegend unsittliche Handlung“ (Allgäuer Zeitung 01.08.03). Und die wird trotz Art. 46 GG [Indemnität und Immunität der Abgeordneten] (1) Ein Abgeordneter darf zu keiner Zeit wegen seiner Abstimmung oder wegen einer Äußerung, die er im Bundestage oder in einem seiner Ausschüsse getan hat, gerichtlich oder dienstlich verfolgt oder sonst außerhalb des Bundestages zur Verantwortung gezogen werden. ... [Hervorhebung vom Autor] (2) [Regelung der Immunität = Aussetzen der Strafverfolgung von Abgeordneten für Straftaten außerhalb der Indemnität (= strafrechtliche Verantwortungsfreiheit) zur Gewährleistung des Parlamentsbetriebes] nicht nur mit kirchlichem Liebesentzug bestraft. Zur Drangsalierung von Abgeordneten durch z.B. wegen nicht glaubenskonformer Abstimmung verweigerte Teilhabe an den ihrem Glauben heiligen Sakramenten, durch Erzeugung von Gewissenspein für die Umstände im »ewigen Leben« oder der »ewigen Verdammnis« auf Grund des durch eine nicht kirchenkonforme Entscheidung verlustig gegangenen Seelenheils stehen der katholischen Kirche ja ganz andere Mittel zur Verfügung! 111 Hunderttausende Jahre Fegefeuer oder gar „ewige Verdammnis“ sind keine Kleinigkeit für einen gläubigen Katholiken! Und ungefähr ein Drittel der Abgeordneten im Deutschen Bundestag sind der katholischen Kirche verbunden. Diese Leitsätze der katholischen (= allgemeinen, die Erde umfassenden) Kirche gelten natürlich nicht nur für und in Deutschland, sie gelten, dem Anspruch der katholischen Kirche entsprechend, weltweit. Davon konnte der Präsidentschaftskandidat der Demokraten im us-amerikanischen Wahlkampf 2004 einen Choral singen: Kerry machte kaum Worte um seinen Glauben als aufgeklärter Katholik, bis ihn wegen seiner nicht der katholischen Lehrmeinung entsprechenden politischen Auffassungen z.B. in der Frage der Abtreibung „Bischöfe mit der Verweigerung der heiligen Kommunion abstraften und sogar die Stimmabgabe für ihn zur beichtpflichtigen oder in die Verdammnis führenden Sünde erklärten. Kerrys liberale Haltung zur Stammzellenforschung und zur Abtreibung ("Eine Entscheidung, die eine Frau mit ihrem Arzt und mit Gott ausmachen muß") brachte ihn, der im Wahlkampf mit Rosenkranz und Bibel reist, auf den Index mancher Bischöfe. Es ist ohne Beispiel in der amerikanischen Geschichte, die an Erweckungen und messianischen Figuren keinen Mangel hat, daß katholische Kirchenführer ihn exkommunizieren wollen, statt ihn gegen den Vatikanverdacht zu verteidigen wie 1960 John F. Kennedy“ (DIE WELT 27.10.04). Wegen der in Artikel 4 Absatz 1 Grundgesetz (Art. 4 I GG) grundgesetzlich geschützten positiven20 wie negativen21 Religionsfreiheit wird bei staatlichen Wahlen aus guten Gründen nicht nach der Zugehörigkeit zu Glaubensgemeinschaften gefragt, obwohl sich die religiöse Überzeugung eines Mandatsträgers in der Gesetzgebung des Deutschen Bundestages – z.B. in den Bereichen Regelung des § 218 StGB, Gentechnik, und da insbesondere der PID, der Stammzell- und verbrauchenden Embryonenforschung, im Kinder- und Eherecht, in der Frage der Anerkennung gleichgeschlechtlicher Lebensformen - sehr wohl niedergeschlagen hat, insbesondere wenn die katholische Kirche Pressionsversuche auf politische Entscheidungen vorzunehmen versuchte, als sie sich durch einzelne staatliche Gesetzesvorhaben in ihren Glaubensgrundsätzen zentral herausgefordert fühlte und dann z.B. ihre Schäfchen unter den Wählern dazu aufrief, ihre Stimmabgabe von ihrer Kirchenzugehörigkeit abhängig zu machen, selbst der CDU demonstrativ nahe legte, auf das „C“ in ihrem Namen zu verzichten oder ihr gar mit der Gründung einer den Zielen der katholischen Kirche verbundeneren, einer »kirchenhörigeren« Partei als Konkurrenz gedroht hatte! Genau so verhält es sich mit der in Art. 9 III GG ebenfalls grundgesetzlich geschützten positiven und der negativen Koalitionsfreiheit, „zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden“. Aus gutem Grund wurde auch bezüglich dieses Grundrechts auf eine bei manchen Wählern möglicherweise stigmatisierend wirkende Angabe auf den Stimmzetteln verzichtet. Lobbyisten verstehen sich verständlicherweise wesentlich positiver, nicht als Inhaber unzulässig in den Privatbereich vermachteter politischer Strukturen, sondern zunächst - und das völlig zu Recht - als berufene Vertreter von durch sie zu Gesprächen mit politischen Entscheidungsträgern gebündelten Interessen bestimmter Wirtschaftsrichtungen oder Bevölkerungsgruppen. Lobbyarbeit sei weniger egoistische Interessenvertretung als „Politikberatung“. Ohne das in den Verbänden gebündelte Wissen sei eine qualifizierte ministerielle Facharbeit oft nicht möglich. Lobbyisten seien das „Sprachrohr der Basis im politischen Geschäft“. In eigener Überhöhung sehen sie sich gar als Leuchttürme der Demokratie: In totalitären Staaten wie z.B. in der NS- oder der SED-Diktatur habe es zwar für wichtige Bereiche eine von der jeweiligen Staatspartei kontrollierte Massen- oder Berufsorganisation, aber keine freien Verbände gegeben. Wenn Interessenvertretung nicht stattfände, würde demokratische Politik nicht stattfinden. Auch wenn eigene Einschätzung und Lobpreisungen richtige Sachverhalte ansprechen, ist kaum noch fraglich, ob mit solchen Argumenten die oft wider besseres Wissen »bürgerverarschende« weil z.B. Gesundheitsgefährdungen und eingetretene Körperverletzungen bestreitende oder auch »nur« unzulässig verharmlosende Verbände- und Lobbyistentätigkeit – siehe z.B. die das Ge20 21 Recht auf freie Wahl der Mitgliedschaft in einer Religionsgemeinschaft Durch das Bundesverfassungsgericht aus Art. 4 GG abgeleitetes Recht auf Nichtzugehörigkeit zu irgendeiner Religionsgemeinschaft 112 sundheitsrisiko und Suchtpotential des Rauchens jahrzehntelang bestreitende Zigarettenindustrie oder die die der Umwelt als unser aller Lebensgrundlage abträglichen, Luft, Böden und Gewässer verseuchenden Emissionen der (insbesondere chemischen) Industrie herunterspielende Verbandstätigkeit – verharmlost, ja schon fast glorifiziert werden kann! III. Wahlrecht und Wahlsystem Regelmäßige Wahlen zu staatlichen politischen Gremien in Bund, Ländern und Gemeinden, die dadurch bewirkte Vergabe staatlicher Macht auf Zeit(!), und die Art der Durchführung dieser Wahlen sind wesentliches Merkmal und notwendiger Bestandteil jeder Demokratie, in der alle Macht vom (Wahl-)Volk ausgeht, wie es bei uns durch Artikel 20 II 1 GG in unserer höchsten staatlichen Norm festgelegt ist. Diese Macht wird von jedem einzelnen Wahlberechtigten durch die Wahrnehmung seines aktiven Stimmrechts ausgeübt – so er an der Wahl teilnimmt. Politische Wahlen dienen der Legitimation von Parteien und müssen darum in ihren Voraussetzungen, ihrem Ablauf, ihrer Auswertung auf unterer Ebene und letztens der Feststellung des landesweiten Endergebnisses transparent und demokratisch unangreifbar sein. Politische Wahlen dienen ausschließlich der Legitimation von Parteien, nicht der anderer gesellschaftlicher Interessengruppen. Darum versuchen die Interessengruppen ihrerseits, Einfluss auf die Parteien und die von ihnen aufzustellenden Kandidaten zu gewinnen, ohne dass die damit verbundenen Probleme in der Verfassung oder dem Bundeswahlgesetz geregelt wären. Schon dieser Hinweis zeigt, dass Wahlrechtsfragen weder rein rechtliche, noch rein machttechnische, noch rein mathematische, sondern eminent politische Fragen sind. Sie sind eine zentrale Frage für jedes politische Gemeinwesen, weil ihre Auswirkungen in alle Verästelungen des politischen Lebens ausstrahlen. Das jeweilige Wahlsystem in seiner konkreten Ausprägung beeinflusst u.a. die Struktur der Parteienlandschaft und der Parteien selbst, die Kandidatenauswahl, die Zusammensetzung des Parlamentes und damit die Zusammensetzung der Regierung, die Meinungs- und Urteilsbildung der Wähler, ihre politischen Aktivitäten und nicht zuletzt die Stellung der Interessenverbände in der Gesellschaft und deren teilweise ganz massive Einflussnahme auf alle Parteien und die Gesetzgebung, z.B. in Fragen der Atomkraftnutzung, des Umweltschutzes, der Gentechnologie, der Pflegeversicherung, der Abwehr von Gefahren des Rauchens, ... Wahlrechtsfragen sind für kleinere Parteien schiere Überlebensfragen. Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Prinzipien, das Mehrheits- und das Verhältniswahlprinzip, nach denen durch eine Wahl staatlich Macht vergeben werden kann. Die Entscheidung für ein bestimmtes Prinzip und seine spezifische Abwandlung hat Einfluss auf die Organisation des gesamten politischen Lebens in einem Staat. Mehrheitswahlrecht Reines Mehrheitswahlrecht In diesem Wahlsystem gewinnt ausschließlich der siegreiche Direktkandidat ein Mandat. Bei einem Mehrheitswahlsystem, z.B. nach englischem Vorbild, könnten in der Bundesrepublik wohl nur CDU, CSU und SPD auf Dauer überleben; vielleicht auch noch die PDS als Berliner Regionalpartei wie die CSU in Bayern, wenn sich die PDS – u.a. durch die Eingehung des Linksbündnisses mit der WASG - von ihrer 2002 erlittenen Wahlschlappe erholt hat. In der »Vereinigungs-Wahl« 1990 gab es zwei Ausnahmen, die die Regel - nur die großen Par- 113 teien können einen Wahlkreis direkt gewinnen - durchbrachen: Die FDP in der Stadt Halle und die PDS durch ihren damaligen Vorsitzenden Gysi in dem früheren »SED-Stadtteil« BerlinMarzahn. Das war unabhängigen Kandidaten seit 1953 und denen kleinerer Parteien seit 1957 (FDP) nicht mehr gelungen. Seit 1953 hatten nur die großen Parteien die Direktmandate gewonnen. Seit der Wiedervereinigung hat sich dieses Bild aber partiell geändert: Die PDS hat in Berlin mehrfach 3-4 Wahlkreise gewonnen und sich so immer wieder in den Bundestag gerettet, bis sie 2002 – obwohl sie sich Hoffnungen auf bis zu 7 Wahlkreise in Berlin, Schwerin, Rostock und Halle gemacht hatte - nicht mehr die nach der »Grundmandatsklausel« mindestens drei für einen Einzug als Partei in den Bundestag erforderlichen Direktmandate erringen konnte. Nur in den Berliner Wahlkreisen 86 und 87 schafften es die Direktkandidaten von der PDS 2002 ins Parlament, weil – aus Respekt vor dem direkten Votum des Souveräns - mit der Erststimme direkt gewählte Abgeordnete auf jeden Fall in das Parlament einziehen. So fehlte der PDS mindestens ein drittes gewonnenes Direktmandat, um andere Parteimitglieder über den unterhalb der 5-%-Hürde liegenden Zweitstimmenanteil in den Bundestag hieven zu können. Die PDS konnte ihren Anspruch als gesamtdeutsche Partei nicht verwirklichen, will das aber 2005 durch den Zusammenschluss mit der WASG schaffen. Dieser Anspruch als gesamtdeutsche Partei wurde zwar immer wieder postuliert, hatte aber mit der Realität nichts zu tun. Bis 2005 hatten wir hoffen können, dass beendet werde, was gar nicht hätte anfangen dürfen: Eine mit einer solchen diktatorischen Vergangenheit belastete Partei wie die in PDS umbenannte SED hätte nie in dem demokratischen Gremium Bundestag vertreten sein dürfen! (Im Internet schrieb ein sarkastischer Spötter vor Jahren: „Was ist der Unterschied zwischen der DDR und der PDS? Die DDR war die SED leid, und die PDS ist die SED-light!“ Dieses SED-light-Image versuchte die PDS nach der verheerenden Wahlniederlage 2002 durch ein neues Parteiprogramm abzustreifen, in dem sie mit dogmatischen und stalinistischen Strukturen breche – merke: bis zur Vorlage des neuen Programms hat es die jetzt eingestandenermaßen also doch gegeben! – und sich in der Wirtschaftspolitik durch ihr »Godesberger-Programm der PDS« der Realität öffne, welches ihre (damalige) Vorsitzende aber gleichzeitig als „kapitalismuskritischer und sozialistischer als vor zwei Jahren“ charakterisierte. Es gebe aber in dem 2003 vorgelegten Entwurf keinerlei Traditionsbezug mehr zur früheren SED. Doch wenn der Geist, der stets verneinte, was anderen Ländern Wohlstand brachte, nun nicht mehr ausdrücklich beschworen wird, so ist er dennoch in den Köpfen vieler PDSler, insbesondere derer, die zu der innerhalb der PDS eingebundenen „Kommunistischer Plattform“ gehören! ANALYSE Letzte Chance Die PDS kann auf Dauer nur bundespolitischen Einfluss behalten, wenn ihr die Westausdehnung gelingt. Doch davon ist sie meilenweit entfernt. Deswegen sind die Bündnisgespräche für sie so wichtig. VON PITT VON BEBENBURG Was hat die PDS nicht alles getan, um sich vom Image der ewigen Ossi-Partei zu befreien, die bloß eine Ansammlung von Polit-Mumien aus DDR-Zeiten darstellt. Sie hat sich zur "bunten Truppe" erklärt, hat halbwegs prominente West-Zeitgenossen auf ihren Listen kandidieren lassen, hat sich von ausgebufften Westlinken Wege weisen lassen wie derzeit von ihrem Wahlkampfmanager Bodo Ramelow, einem Gewerkschafter aus dem Westen. Sie hat sich als Friedenspartei profiliert, die zu den Organisatoren der AntiIrak-Krieg-Proteste zählte, und als Sozialpartei, die zur Attacke auf Hartz IV blies. Genutzt hat es ihr im alten Teil der Republik bis heute nichts. Zwei oder drei Prozent peilt Parteichef Bisky für die alten Bundesländer an, nicht ohne Grund: So viel müssten es im Westen schon sein, damit die Fünf-Prozent-Hürde bei der Bundestagswahl genommen werden kann - dank der Stärke der PDS im Osten der Republik, wo sie Volkspartei ist. Doch die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein kam die PDS Anfang des Jahres gerade noch auf 0,8 Prozent, glatte 0,6 Punkte weniger als bei der Wahl zuvor. In NordrheinWestfalen sah es auch nicht besser aus: 0,9 Prozent, zwei Zehntel weniger als fünf Jah- 114 re davor. Und nebenbei: Nicht einmal halb so viel, wie die linke Westkonkurrenz WASG holte, obwohl die auch nicht so stark war, wie sie gehofft hatte. In genervter Stimmung erklärt mancher PDS-Stratege das Projekt Westausdehnung bereits für gescheitert. Niemand tut das so deutlich wie Ex-Parteichef Gregor Gysi. Andererseits wissen die Sozialisten, dass sie als erklärte Regionalpartei Ost wenig Zukunft haben würden. Der bundespolitische Einfluss steht und fällt damit, auch jenseits der früheren DDR einen Fuß auf den Boden zu bekommen. Nicht zuletzt, weil die traditionelle Basis ein Auslaufmodell ist - Jahr für Jahr verliert die überalterte PDS mehrere tausend Mitglieder, viele davon noch SED-Parteigänger aus DDR-Zeiten. Die Wahlalternative ist deswegen von Anfang an beides gewesen für die PDS: bedrohliche Konkurrenz einerseits, Chance zur Verjüngungskur andererseits. Parteichef Bisky hat es schon ausgesprochen, als über die Gründung der WASG noch diskutiert wurde: "Man kann sie als Partner ansehen, aber auch als Konkurrenten." Im Klartext: Wird die neue Linkspartei-West stark, dann gräbt sie der PDS dauerhaft die Möglichkeit ab, im alten Bundesgebiet Fuß zu fassen. Wird die neue Linkspartei-West aber auf eine geschickte Weise integriert, dann macht sie die PDS zu der Partei, die sie schon seit Jahren gern wäre: eine gesamtdeutsche linke Alternative zu Rot-Grün. Die seit eh und je äußerst machtbewusste PDS weiß um diese für sie historische Gelegenheit, sich auf Dauer im Parteienspektrum zu verankern - oder weiter dahinzusiechen. Davor stehen freilich die eigenen Interessen der WASG, deren Mitglieder ihre Gründe hatten, nicht einfach in die PDS einzutreten, sondern als Opposition zum gesamten Parteienspektrum aufzutreten. Nicht zuletzt deswegen steht in den Sternen, ob es der PDS gelingen wird, den Neuwahl-Schachzug des Kanzlers in ihrem Sinne zu nutzen - und im Westen Fuß zu fassen. Szenario große Koalition PDS und WASG könnten am Ende nicht nur das linke Spektrum verändern, sondern letztlich sogar die Republik. Sollte die Linkspartei nämlich in den nächsten Bundestag einziehen, dann könnte die Situation entstehen, in der die Mehrheit weder für SchwarzGelb noch für Rot-Grün reicht. In diesem Fall würde alles auf eine große Koalition hinauslaufen. Politisch ginge das den Linken gegen den Strich, strategisch würde es sie nur weiter festigen: als sichtbare Alternative zu den "Neoliberalen" in allen Lagern. FR 03.06.05 Zu der Problematik PDS und Linkes Bündnis später Genaueres in einem Extrapunkt, da an dieser Stelle das Wahlrecht und Wahlsystem der BRD schwerpunktmäßig abgehandelt wird. In der Wahl 2002 gelang es dem von seiner Partei abgehalfterten fundamentalistisch orientierten »linken« Grünen Ströbele, in Berlin ein Direktmandat in dem neu gebildeten Wahlkreis KreuzbergPrenzlauer Berg-Friedrichshain zu erringen, der im Zuge des bundesweiten Wahlkreisneuzuschnitts und der Bezirksreform in Berlin mit der Angleichung der Wahlkreise an die dortigen neuen Bezirksgrenzen aus Bestandteilen dreier früherer Wahlkreise gebildet worden ist. Es ist das erste Direktmandat, dass je von einem Grünen errungen wurde. Dementsprechend unabhängig tritt der Abgeordnete nun auf und bürstet seine auf »Realo«-Kurs liegende Parteimehrheit mit Vorliebe gegen den Strich! Für die Wahl 2005 verzichtet die Ikone der Linken in der Partei Bündnis 90/Die Grünen auf seine Absicherung durch einen vorderen Listenplatz auf der Berliner Landesliste seiner Partei und kämpft ausschließlich um die Wiedererringung des Direktmandats in seinem Wahlkreis KreuzbergPrenzlauer Berg-Friedrichshain. Bei Anwendung des reinen Mehrheitswahlsystems ist in einem Wahlkreis derjenige Kandidat erfolgreich, der die meisten der abgegebenen Stimmen auf sich vereint. 115 Helmut Kohl z.B. scheiterte viermal bei dem Versuch, in seinem (Wohn-)Wahlkreis Ludwigshafen-Oggersheim als Direktkandidat gewählt zu werden - auch noch als schon lange Jahre amtierender Bundeskanzler! Die Parteibindung der mehrheitlich sozialdemokratisch geprägten Wählerschaft dieses Wahlkreises war einfach zu groß gewesen. Erst 1990 schaffte er es im fünften Anlauf nach schon 8 Jahren Bundeskanzlerschaft, mit 44,7 % der Erststimmen das Direktmandat zu erringen. Davor hatte er keinen »Kanzlerbonus« für sich in die Waagschale werfen können. Bei der übernächsten Wahl 1998 scheiterte er wieder – als immer noch amtierender Bundeskanzler! Die bundesweit völlig unbekannte SPD-Kandidatin Barnett hatten den amtierenden Bundeskanzler in der Bewerbung um das Direktmandat geschlagen und mit 47,9 % der Erststimmen einen höheren Prozentsatz von Erstwählerstimmen auf sich vereinigen können, als vier Jahre zuvor der amtierende Bundeskanzler, der 1994 mit 46,0 % gewählt worden war. Bei Anwendung des Mehrhaitswahlrechts kann, wie in den USA und seit 1429 in Großbritannien, eine relative Mehrheit der Stimmen genügen – wer die meisten Stimmen auf sich vereint, gewinnt - oder aber es muss laut Wahlgesetz des jeweiligen Landes, wie z.B. in Frankreich, eine absolute Mehrheit (50 %) der abgegebenen Stimmen erreicht werden. Gilt zur Erringung eines Mandates das Erfordernis des Erreichens der absoluten Mehrheit ist eventuell ein zweiter Wahlgang notwendig, an dem dann entweder nur noch die beiden erfolgreichsten Kandidaten des ersten Wahlganges in einer "Stichwahl" teilnehmen dürfen, oder bei erneut freier Kandidatenaufstellung dann derjenige gewählt ist, der die - zumindest relativ - meisten Stimmen auf sich vereint. Alle anderen Stimmen - und das kann die Mehrheit der Wahlberechtigten sein - fallen weg. Es sind deswegen so genannte „Papierkorb-Stimmen“: Präsident Georg W. Bush jun. erhielt – selbst unter Einrechung der fragwürdigen aber wahlentscheidenden Stimmen aus Florida - bei seiner ersten Wahl insgesamt 539.897 Stimmen weniger(!) als sein ihm unterlegener Gegenkandidat Al Gore, aber der hatte mehr Papierkorbstimmen. Ein solches Ergebnis wäre bei einem Verhältniswahlrecht nicht möglich! U.a. darum wird das Mehrheitswahlrecht von dessen Kritikern als »ungerecht« empfunden. Die Wähler/innen, deren Stimmen »in den Papierkorb wandern«, sind darum im politischen Spektrum des Parlaments nicht repräsentiert. Das kann insbesondere bei relativer Mehrheitswahl sehr ungerecht sein. Beispiel: Wahlkreis X Kandidat A Kandidat B Kandidat C (100.000 Wahlberechtigte, die alle wählen). Es erhält: 35.000 Stimmen 34.000 Stimmen und 31.000 Stimmen Nach den Grundsätzen der relativen Mehrheitswahl ist Kandidat A mit 35 % der abgegebenen Stimmen in diesem Wahlkreis gewählt, 65 % der Wähler/innen dieses Wahlkreises sind im Parlament nicht repräsentiert. „The winner takes it all!“ Das auf die anderen Wahlkreise hochgerechnet oder »hochgedacht« würde bedeuten, dass im Extremfall nur eine Partei im Parlament vertreten ist, die nur um die 35-40 % der Wähler repräsentiert. Es gäbe in einer solchen Zusammensetzung des Parlaments keine wirksame Opposition, die der Regierung auf die Finger kuckt – oder notfalls auch haut! Das ist kein unrealistisches Gedankenspiel, sondern wurde schon mehrfach Realität: Im südafrikanischen Königreich Lesotho waren einmal nur Abgeordnete der königstreuen Regierungspartei vertreten; in der kanadischen Parlamentswahl 1993 verloren die regierenden Konservativen (auch) auf Grund des Mehrheitswahlsystems 156 ihrer zuvor 158 Parlamentssitze, weil die Kandidaten der Opposition in den einzelnen Wahlkreisen immer einen Tick besser abgeschnitten hatten und die nur um ein Geringes niedrigere Anzahl der Stimmen für die Regierungspartei so zu wertlosen Papierkorbstimmen gehäckselt wurden! Wegen dieser »ungerechten« Mandatsvergabe beim Mehrheitswahlrecht hat vor einigen Jahren Neuseeland das bis dahin vom ehemaligen Mutterland übernommene britische Mehrheitswahl- 116 recht abgeschafft und das deutsche Wahlrecht – mit allerdings einer auf drei Jahre verkürzten Legislaturperiode - übernommen. Eine solche Parlamentskonstellation wie in Kanada 1993 kann in der Bundesrepublik Deutschland auf Grund des »gerechteren« Wahlsystems der personalisierten Verhältniswahl so nicht passieren. Aber in hart umkämpften Wahlkreisen ohne einen zu hohen Stammwähleranteil mit drei annähernd gleichstarken Parteibewerbern, wie es in einigen Wahlkreisen Berlins der Fall ist, kann eine solche Konstellation bei der Wahl des Direktabgeordneten des Wahlkreises jederzeit auftreten. So gewann 2002 der Wahlkreiskandidat der Grünen in Berlin-Friedrichshain/-Kreuzberg das bisher einzige Direktmandat für die Grünen mit gerade einmal 31,6 % der abgegebenen Stimmen. Und bei der ersten Bundestagswahl 1949 gewann ein Kandidat in Miesbach als »bisher schlechtester Gewinner« seinen Wahlkreis mit sogar nur 23,4 % der Erststimmen; allerdings ist dieser Wert nicht mit den heutigen Werten vergleichbar, denn damals gab es pro Wähler nur eine Stimme, die die Funktion der heutigen Erst- und Zweitstimme in sich vereinte. Nach den Grundsätzen der absoluten Mehrheitswahl müssten sich im vorstehenden Rechenbeispiel die Kandidaten A und B einer Stichwahl stellen, woraus durchaus der im ersten Wahlgang zunächst unterlegene Kandidat B als Sieger hervorgehen könnte, wenn es ihm im anschließenden »Stechen« des zweiten Wahlgangs gelänge, eine ausreichende Anzahl von Stimmen, die beim ersten Wahlgang auf den Kandidaten C entfallen waren, nunmehr auf sich zu ziehen. Das Mehrheitswahlsystem garantiert – entgegen einem weit verbreiteten Irrglauben oder aufgrund einer bewussten Fehlinformation - keine parlamentarische Mehrheit. So gab es z.B. 1974 im britischen Unterhaus eine Pattsituation. Verhältniswahlrecht Reines Verhältnis-Wahlrecht Bei Anwendung des reinen Verhältniswahlsystems spiegelt die spätere Zusammensetzung des Parlaments das prozentuale Verhältnis der bei der Stimmabgabe auf die einzelnen Parteien entfallenen Stimmen recht exakt wider. In einem derart zusammengesetzten Parlament kann es aber viele Splittergruppen geben, die eine Regierungsbildung erschweren: Im serbischen Parlament bestand die Regierungskoalition bis 2003 aus 20 Klein- und Kleinstparteien. Und die Opposition war genau so zersplittert, eine ordnungsgemäße Parlamentsarbeit nicht möglich. Ähnliche Verhältnisse hatten wir in der Weimarer Republik. Nach den ersten freien Wahlen in Polen 1991 waren 29 Parteien im Sejm, davon 11 mit nur einem Abgeordneten, ein Alptraum für jede Parlamentsarbeit, so dass dann in Polen für die nächste Wahl die 5-%-Sperrklausel eingeführt wurde. Um der drohenden Zersplitterung des Parlaments bis eventuell gar zur Funktionsunfähigkeit zu steuern und die Bildung stabiler parlamentarischer Mehrheiten mit dem Ziel der Ermöglichung einer stabilen Regierungsmehrheit zu fördern, soll – als deutsche Erfindung zur Verhinderung der Wiederholung des Alptraums Weimarer Parteienverhältnisse – eine Sperrklausel Abhilfe schaffen. Sie soll den Einzug zu unbedeutender politischer Vereinigungen in das jeweilige Parlament unterbinden. Masochistisch versagen die Niederlande sich trotz ihres Verhältniswahlsystems jede Sperrklausel - und haben dann natürlich mit den negativen Auswirkungen einer zu großen Parteienvielfalt im Parlament, den sehr schwer zu bewerkstelligenden Regierungskoalitionsbildungen, zu kämpfen. Ähnlich Schwierigkeiten entstehen, wenn die durch die Sperrklausel aufgebaute Hürde zu niedrig angesetzt ist. Abschreckendes Beispiel war Israel mit seiner vordem 1-%-Sperrklausel und den dadurch bedingten Wahlerfolgen der Orthodoxen mit ihrem verhängnisvollen Einfluss auf die Politik des Landes. Darum erfolgte dort eine Änderung auf nunmehr 1,5 %. Es steht noch nicht fest, ob eine Sperrklausel so niedrig angesetzt bleiben kann. Andererseits darf bei der grundsätzlichen Entscheidung für das Verhältniswahlrecht eine Sperrklausel auch nicht zu hoch angesetzt sein, weil sie sonst das Aufkommen neuer Parteien - nach 117 Meinung des BVerfGs: unzulässig - erschweren würde. (Sollte der Gesetzgeber allerdings zum Mehrheitswahlrecht umschwenken, würde das BVerfG eine solche gravierende Änderung unseres Wahlsystems auch mitmachen, obwohl die Einführung des Mehrheitswahlrechts für die kleinen Parteien wesentlich restriktiver ist, als es selbst eine höher angesetzte Hürde als die 5-%-Klausel wäre.) Das BVerfG hat sich zuletzt 1997 geäußert und – ohne eine Untergrenze anzusprechen die Hürde mit höchstens 5 % als tolerierbar angegeben; an der dann in der darauf folgenden „Einigungswahl“ die westdeutschen Grünen gescheitert waren und nur deren Ostvertreter in den Bundestag hatten ein ziehen können. Aber im internationalen Vergleich gibt es auch höhere Grenzwerte: In Georgien ist die Sperrklausel auf 7 % hochgesetzt, in der Türkei auf 10 %, wo sie wohl die Aufgabe hat, das Entstehen einer kurdischen Partei zu verhindern, bei der Wahl 2002 aber bewirkte, dass alle drei Regierungsparteien an dieser Hürde scheiterten und nicht mehr ins Parlament einziehen konnten! Nur zwei bisherige Oppositionsparteien schafften es ins Parlament. Die 10%-Hürde, die früher bei den Wahlen zum Bayerischen Landtag Geltung hatte, musste nach Klage vor dem BVerfG abgeschafft werden: Mehr als 5 % seien [in der BRD] nicht zulässig. Wahlsystem und Auswirkungen Letztlich gültige Aussagen über die Auswirkungen eines bestimmten demokratischen Wahlsystems auf das spätere Wahlergebnis und die Regierungsfähigkeit des Wahlsiegers sind nicht möglich. Ein bestimmtes demokratisches Wahlsystem garantiert noch lange keine parlamentarische Mehrheit! Nach beiden Systemen kann es zu einer instabilen Mehrheit von nur einer Stimme kommen. (Adenauer war mit nur einer Stimme Mehrheit - seiner eigenen zum ersten deutschen Bundeskanzler gewählt worden. In Großbritannien gab es einmal eine Regierungsmehrheit von auch nur einer Stimme.) Es können allerdings tendenzielle Aussagen gemacht werden: Das Mehrheitswahlrecht fördert die Ausbildung weniger großer Parteien bis hin zum Zwei-Parteien-System, wenn es keine zwar kleinen aber in ihrer angestammten Region starke Regionalparteien gibt. Das deutsche Beispiel hierfür ist die CSU. Das Mehrheitswahlrecht wirkt der Ausbildung von Weltanschauungsparteien entgegen (kann aber durch den Wegfall der "Papierkorbstimmen" sehr ungerecht sein). Weiterer Vorteil: Der Wähler kann direkt entscheiden, welcher Kandidat ihn und seine Region im gesamtstaatlichen Parlament vertreten soll. Das Verhältniswahlrecht ermöglicht tendenziell kleinere Parteienbildungen bis hin zu Parteienzersplitterungen, was eine Regierungsbildung sehr erschweren kann. Weltanschauungs- und/ oder Interessenparteien gewinnen an Gewicht. Das Wahlergebnis spiegelt den Wählerwillen insgesamt gerechter wider, als es unter den Voraussetzungen des Mehrheitswahlrechts der Fall ist, weil keine Wählerstimmen als Papierkorbstimmen wegfallen. Fazit: Es gibt kein ideales Wahlsystem schlechthin! Es gibt bei der Wahl des Wahlsystems kein »richtig« oder »falsch«, nur eine Tendenz mehr in die eine oder in die andere Richtung. Vorund Nachteile stehen sich immer gegenüber und müssen durch Prioritätensetzung gegeneinander abgewogen werden. Darum gibt es fast 200 (unterschiedliche) Wahlverfahren als Mischwahlsysteme – das entspricht in etwa der Anzahl der Mitgliedsstaaten der UNO. Im internationalen Vergleich gilt das Mischwahlsystem der Bundesrepublik Deutschland als eines der fairsten. Mischwahlsystem der Bundesrepublik Deutschland Das seit 1949 eingeführte Wahlsystem der Bundesrepublik Deutschland für die Bundestagswahl ist ein Mischwahlsystem. Es ist eine durch Vergabe von (bei der ersten Wahl 1949 nur einer Stimme, die sowohl für den Kandidaten wie dann auch für seine Partei gewertet wurde, 118 dann seit 1953 zur Ermöglichung von Wahlkreisabsprachen durch „Stimmen-splitting“ bei der Vergabe der Erst- und der Zweitstimme) zwei unabhängig(!) voneinander abgebbaren Stimmen, der Erststimme für die Wahl des Direktkandidaten und der Zweitstimme für die Wahl der Landesliste einer Partei, ausgeübte und in seinen Grundzügen trotz einiger Modifikationen seit 1956 gültige personalisierte (Erststimme für den – laut Umfragen: den meisten Wählern seines Wahlkreises unbekannten - Direktkandidaten) Verhältniswahl (Zweitstimme für die Partei) mit (im Unterschied zur Reichstagswahl, bei der jede Partei für je 60.000 Stimmen einen Parlamentssitz erhielt, so dass die Zahl der in den Reichstag gewählten Abgeordneten je nach Wahlbeteiligung zwischen 459 und 647 Abgeordneten ständig schwankte) unbeweglicher Mitgliederzahl des zu wählenden Parlaments mit von den Parteien geschlossenen, durch den Wähler nicht veränderbaren Landeslisten, auf deren Aufstellung er als Nicht-Parteimitglied keinen Einfluss hat. Das Wahlverfahren wird in seinen Einzelheiten durch die Bundeswahlordnung geregelt. Diese gliedert sich in Wahlvorbereitung, Wahlhandlung und die Feststellung des Wahlergebnisses. Paragraph 16 des Bundeswahlgesetzes schreibt vor, dass als Wahltag ein Sonntag oder ein gesetzlicher Feiertag festgelegt wird. Damit soll im Sinne der Allgemeinheit der Wahl gewährleistet sein, dass möglichst viele Wahlberechtigte zur Wahl gehen können. Der wichtigste Punkt der Wahlvorbereitung ist die Kandidatenaufstellung in den einzelnen Wahlkreisen und auf den Landeslisten. Es gehören jedoch noch viele weitere, meist technische Schritte dazu, die aber für das Verständnis einer Bundestagswahl nicht so entscheidend sind und daher hier aus Platzgründen übergangen werden. Manchmal wird unser Mischwahlsystem auch als Verhältniswahl mit vorgeschalteter Mehrheitswahl bezeichnet, denn letztlich ist es ein modifiziertes Verhältniswahlsystem, bei dem viele Wähler nicht wissen, was sie mit ihren zwei Stimmen tun, weil ihnen deren genaue Funktion nicht bewusst ist. Die beiden Stimmen werden üblicherweise in der Wahlkabine abgegeben; seit 1957 ist – trotz Bedenken, ob die Stimmabgabe eigenhändig, eigenständig und geheim erfolgt ist - für den Fall der „glaubhaft“ gemachten Verhinderung, am Wahltag das Wahllokal aufsuchen zu können, die Möglichkeit zur Stimmabgabe per Briefwahl geschaffen worden. Zunehmend wird von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Der stetig wachsende Prozentsatz der Briefwähler lag 1998 bei rund 15 % und 2002 bei 18 %. Die Stimmabgabe per Briefwahl muss bis 18.00 Uhr am Wahltag im Wahlbezirk eingetroffen sein, um bei der Auszählung des Wahlergebnisses berücksichtigt werden zu können; dass heißt im Klartext, dass die Stimmzettel spätestens mit der Samstag-Post dort eintreffen müssen. Erst- und Zweitstimme müssen bei der Wahl nicht zwangsläufig für einen (fast ausschließlich einer bestimmten Partei) angehörenden Kandidaten und dann auch für dessen Partei abgegeben werden! Die Präferenz kann bei der Vergabe der Erst- und der Zweitstimme unterschiedlich aufgeteilt, „gesplittet“, werden. Von dieser taktischen Möglichkeit unseres Wahlsystems machen inzwischen rund 20 % der Wähler überlegten Gebrauch. Das „Stimmensplitting“ ist insbesondere dann sinnvoll, wenn man mit seiner Erststimme nicht den Wahlkreiskandidaten der eigenen (kleinen) Partei wählen will, weil er eh keine Chance hat, gegen die Vertreter der beiden großen Volksparteien das Direktmandat zu gewinnen; da macht es mehr Sinn, den als Direktkandidaten zu wählen, dessen Partei der eigenen am nächsten steht. Oder, wenn man seine Zweitstimme in Verleugnung seiner eigentlichen Parteipräferenz zu einer der großen Parteien einer kleinen Partei gibt, die in Gefahr steht, ohne die Blutzufuhr durch solche »Leihstimmen« nicht den Einzug in das Parlament zu schaffen, wo sie aber als Koalitionspartei für die größere, ihren Wahlaussagen am nächsten stehende Partei 119 dringlichst benötigt wird, weil die keine Chance hat, die absolute Mehrheit zu erringen, und darum auf die mit der Stimme gesponserte kleine Partei als Koalitionspartner angewiesen sein wird. Das könnte sehr wohl auch für die anstehende Bundestagswahl der Fall sein! (Vergleichen Sie den auf Seite 186 f. wiedergegebenen Artikel des Stellvertretenden Chefredakteurs des STERN HansUlrich Jörges: „Das Fenster der Linken“.) Ich habe bei der Bundestagswahl 2005 noch eine andere, ohne nähere Erklärung möglicherweise zunächst recht abartig bis schon fast pervers anmutende Variante des Stimmensplittings praktiziert: mit meiner Erststimme wählte ich den Direktkandidaten der SPD für meinen Wohnsitz Hamburg-Harburg, den ehemaligen Bürgermeister Klose, und mit meiner Zweitstimme die CDU: „Nanu, kann der sich nicht entscheiden?“, mögen Sie denken. Doch, ich kann, und zwar sehr rational: Für meine Stimmabgabe war entscheidend und wird es auch noch für einige Bundestags- und Europawahlen aus an anderer Stelle – www.Hans-Uwe-Scharnweber.de / Politisches / „EU-Beitritt der Türkei? EU-Erweiterungsdebatte Türkei: Warum die Türkei nicht in die EU gehört“22 - dargelegten Gründen sein, wie ich mein übergeordnetes Wahlziel der Verhinderung eines EU-Beitritts der Türkei am besten zur Geltung bringen kann. Das bedeutete 2005 für mich ganz konkret: Als Partei kam deswegen nur die CDU in Betracht. Ich hätte dann auch ihren mir unbekannten farblosen Direktkandidaten wählen können. Doch ich fand es wichtiger, in einem Spiel über drei Banden den Direktkandidaten der SPD Klose mit seiner mir bekannten ablehnenden Haltung in der Frage einer EU-Mitgliedschaft der Türkei mehrfach zu sprechen, ihm meine Gründe als Wechselwähler für die Nichtwahl seiner Partei darzulegen, damit bei der SPD in der internen Abrechnung am Tag nach der Wahl ganz klar ist, warum sie u.a. Stimmen von wertkonservativen sozialliberal orientierten Wählern nicht erhalten hat, und ihn dann mit meiner Erststimme zu wählen: Damit wollte ich die innerparteiliche Opposition innerhalb der SPD – rund ein Viertel der SPD-Fraktion in der 14. Legislaturperiode - in der »Türkei-Frage« stärken, damit dort in der Schicksalsfrage für Europa der von mir für notwendig gehaltene Umdenkungsprozess in Gang gesetzt und am Leben erhalten wird. Die Genossen sollen ihre Niederlage nicht eindimensional auf »Hatz-IV« schieben, wenn sie »mit verheulten Augen« ihre Wunden lecken werden! Sie sollen klar sehen und leckend umdenken! Oder in ihrer ihnen vom Souverän zugewiesenen Zweitrangigkeit dort verharren, wo sie keinen gravierenden Schaden für Europa anrichten können! Sie sollen so lange »Wunden lecken«, wie uns Wahlbürgern als Souverän, von dem der Theorie nach alle staatliche Gewalt ausgeht, die Möglichkeit vorenthalten bleibt, in einer für Europa so existenziellen, meines Erachtens sogar schicksalhaften Frage unseren politischen Willen kundtun zu können. [(„’Nichts ist vollkommen!’, seufzte der Fuchs.“ (gegenüber dem kleinen Prinzen): Die CDU/CSU ist als einzige Parlamentsfraktion gegen die Einführung eines Volksentscheides! Die Parteien SPD, Grüne, FDP und Die Linke.PDS sind dafür.] Stimmen-Splitting praktizierende und so einen möglichen Koalitionspartner wählende taktische Parteiwähler sind nicht als echte Wechselwähler anzusehen, auch wenn sie in einer bestimmten Entscheidungssituation, wenn der Ausgang einer Wahl auf Spitz’ und Knopf zu stehen scheint, die lässliche Sünde begehen, ihre Zweitstimme nicht der ihnen politisch ansonsten näher stehenden großen Volkspartei zu geben, sondern mit ihrer »Leihstimme« bei dem gewünschten Koalitionspartner eine Bluttransfusion vorzunehmen, um dessen parlamentarisches Überleben zu sichern. Klassische Leihstimmenpartei war in der Geschichte der Bundesrepublik die FDP. So wählen sinnvollerweise nur rund ein Drittel der der FDP zuneigenden Wähler »ihren« Direktkandidaten: Um ihre Erststimme nicht zu verschenken, da der FDP-Kandidat gegenüber den Kandidaten von CDU/CSU und SPD grundsätzlich keine Chance hat, ein Direktmandat zu erringen, unterstützten sie lieber den Kandidaten der Partei, mit der die FDP-Führung vor der Wahl eine Koalitionsabsicht angekündigt hatte. Und ca. 5-7 % der Wähler dieses potentiellen größeren Koalitionspartners wählten nicht unbedingt »ihre« Partei, wenn abzusehen war, dass »ihre« Partei es nicht allein schaffen würde, die absolute Mehrheit der Sitze zu erringen, der kleinere potentielle Koalitionspartner aber »schwächelte« und die Gefahr bestand, dass er nach Auszählung der Stimmen we22 Der Titel musste so sperrig lang sein, damit möglichst viele Suchmaschinen die ins Internet gestellte 158seitige Ausarbeitung finden, wenn als Suchbegriff entweder „EU-Beitritt Türkei“ oder „EU-Erweiterung“ eingegeben wird. 120 gen der 5-%-Hürde abhanden gekommen sein könnte. Aber neben der FDP profitierten auch die Grünen von dieser Möglichkeit. Und wenn es den Wählern der »neuen Linken« wirklich und ausschließlich um »linke« Politikinhalte geht, dann müssten sie sich – abgesehen von einigen ostdeutschen Wahlkreisen, in denen sich diese Formation berechtigte Hoffnungen machen darf, ihren Wahlkreiskandidaten als Direktkandidaten durchbringen zu können - ebenfalls so verhalten, dass sie mit ihrer Erststimme den Wahlkreiskandidaten der SPD und mit ihrer Zweitstimme den Kandidaten ihrer Partei wählen, um zu verhindern, dass der Wahlkreisgegenkandidat der CDU oder CSU als dort gewählter Wahlkreisdirektkandidat in den Deutschen Bundestag einzieht. Durch den Vergleich der Erststimmen- und der Zweitstimmenergebnisse wird zu erkennen sein, ob die linken Wähler taktisch richtig oder ideologisch festgefahren wählen. Solche aus wahltaktischen Gründen bei anderen Parteien auftauchenden »Leihstimmen« verfälschen natürlich die ursprüngliche Parteipräferenz der taktisch so vorgehenden Wähler, nicht aber deren übergeordnetes politisches Ziel der Regierungsbildung durch die Partei, der sie sich gefühlsmäßig verbunden fühlen. Um eine noch größere, am Wählerwillen orientierte »Wahlgerechtigkeit« herbeizuführen, wird sehr vereinzelt angeregt, unter Verzicht auf a) die Grundmandats- oder Alternativklausel zum Einzug ins Parlament bei Verfehlen der 5%-Hürde, b) die Möglichkeit der Erringung von Überhangmandaten und c) unser Zweistimmensystem mit der Möglichkeit des Stimmensplittings neben grundsätzlich dann nur einer Erststimme eine »Nebenstimme« zu dem Zweck einzuführen, dass ein Wähler mit dieser Stimme seine Zweitpräferenz für eine andere Partei für den Fall zum Ausdruck bringen können solle, dass die Partei seiner Erstpräferenz an der 5%-Hürde scheitere. Dieser unpraktikable Vorschlag ist aber wohl eher ein politikwissenschaftliches Glasperlenspiel. Wegen der die Frage der zahlenmäßigen Zusammensetzung des Parlaments letztlich entscheidenden Zweitstimme liegt der Schwerpunkt unseres Wahlsystems auf dem Verhältniswahlsystem. Die Bestimmungen des Grundgesetzes hinsichtlich von Wahlen sind: GG Artikel 20 [Grundlagen staatlicher Ordnung; ...] (1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. (2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke In Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. ... GG Artikel 38 [Wahl] (1) Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. (2) Wahlberechtigt ist, wer das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat; wählbar ist, wer das Alter erreicht hat, mit dem die Volljährigkeit eintritt. (3) Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz. Art. 38 (1) GG mit seiner Bestimmung, dass Abgeordnete an Aufträge und Weisungen nicht gebundene und nur ihrem Gewissen unterworfene Vertreter des ganzen Volkes seien, spiegelt die Verfassungstheorie wider. Die Praxis sieht natürlich anders aus: Wie jeder Verband hat auch eine Parlamentsfraktion nur Erfolg, wenn sie geschlossen auftritt; dafür zu sorgen ist Aufgabe des Fraktionsführers. Mit den Mitteln des Fraktionszwanges und der Probeabstimmung versucht er 121 sicher zu stellen, dass seine Fraktion bei wichtigen Beschlüssen einheitlich votiert – was er mit diesen Mitteln aber nicht garantieren kann, wie trotz an sich bestehender rechnerischer Mehrheit u.a. die gescheiterten Wahlen eines SPD-Kandidaten für den Posten des Ministerpräsidenten von Niedersachsen, einer SPD-Kandidatin für den Posten der Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein und eines CDU-Kandidaten als Gegenkandidat für den damaligen Bundeskanzler Brandt gezeigt haben, wobei bei der zuletzt angesprochenen Wahl das MfS zwei Stimmen gekauft hatte, was ein CDU-Abgeordneter später eingestanden hatte: er habe DM 50.000,- dafür erhalten, dass Brandt in dem konstruktiven Misstrauensvotum entgegen allen Erwartungen nicht gestürzt worden war. Art. 38 (2) GG ist ein Beispiel dafür, wie verquast unverständlich Juristen einen einfachen Sachverhalt auszudrücken vermögen. Gemeint ist: Wählen (= aktives Wahlrecht) und gewählt werden (= passives Wahlrecht) ist ab Volljährigkeit mit vollendetem 18. Lebensjahr möglich. Die 1970 vorgenommene Entkoppelung von damaliger Volljährigkeit mit 21 Jahren und der Ausübung des aktiven Wahlrechts mit 18 Jahren – obwohl die Grenze der Volljährigkeit weiterhin auf 21 Jahre festgeschrieben blieb - machte Sinn, nachdem zuvor die Wehrpflichtgrenze ebenfalls abgesenkt worden war: Wenn die jungen Männer als Soldaten ab ihrer Einberufung zum Militärdienst mit 18 Jahren eventuell ihren Kopf für eine politische Entscheidung hinhalten müssen – jüngstes Beispiel: Irak-Krieg -, dann sollen sie auch die Möglichkeit haben, mit darüber abzustimmen, welche Partei/enkoalition die Regierung führen soll und sie eventuell in einen Krieg schicken könnte! Das haben wir 2002 erlebt, als sich die Regierungskoalition aus SPD und den Grünen vehement gegen eine von den USA gewünschte Teilnahme am Irak-Krieg ausgesprochen hatte und die CDU/CSU aus Bündniserwägungen wohl mit in das Irak-Abenteuer gezogen wäre, wenn sie die Wahl gewonnen hätten! Auf die schon einmal vorgenommene Entkoppelung von Volljährigkeit einerseits und dem Mindestalter für die Wahrnehmung des aktiven Wahlrechts andererseits wird von den Befürwortern einer weiteren Absenkung dieser Altersgrenze auf 16 (Grüne und PDS) - ja schon auf 14 und von ganz spinnerten sogar auf nur 12 (Hurrelmann) und damit sogar unterhalb der Strafmündigkeitsgrenze - Jahre verwiesen. Dieser überzogenen Forderung der Absenkung des Wahlalters auf »nur« 16 Jahre fehlt aber jede innere Berechtigung, wie sie 1970 die Ableistung des Wehrdienstes darstellte. Absenkung des aktiven Wahlrechts auf 16 Jahre, weil man ab diesem Alter einen Mofa-Führerschein erwerben und sich laut § 4 des Jugendschutzgesetzes „ohne Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person“ bis 24 Uhr in Gaststätten aufhalten darf? Der Wettlauf um immer frühere Wahlberechtigung wirkt doch recht peinlich! Der damalige Vorsitzende des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages, Eylmann, sprach von einer "Tendenz zur Bagatellisierung des Wahlakts". Es macht in meinen Augen auch keinen Sinn, dass im Zuge der Herabsetzung der Volljährigkeitsgrenze von 21 auf 18 Jahre zum 01.01.1975 nunmehr 18-Jährigen auch gleich das passive Wahlrecht zugestanden wurde: Anfangs konnte man sich erst ab einem Mindestalter von 25 Jahren als Bundestagskandidat aufstellen lassen. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes waren der durchaus richtigen Meinung gewesen, dass es für die Arbeit des Parlamentes sinnvoll wäre, wenn Abgeordnete einige Lehrjahre des Lebens mehr auf dem Puckel hätten als nur die Erreichung des für die Ausübung des aktiven Wahlrechts erforderlichen Alters! 1970 war die Altersgrenze für die Ausübung des passiven Wahlrechts auf die damalige Volljährigkeitsgrenze von 21 Jahren abgesenkt worden. Nunmehr liegt sie bei 18 Jahren. Die Festlegung einer höheren Altersgrenze für die Möglichkeit zum Abgeordneten gewählt zu werden, war ein weiserer Beschluss des Gesetzgebers, da die Arbeit eines Abgeordneten doch eine gewisse Lebenserfahrung und eine durch eine möglichst qualifizierte Ausbildung erworbene Problemlösungskompetenz voraussetzen sollte, die ein 18-Jähriger niemals haben kann! Die Mütter und Väter des Grundgesetzes (GG) im verfassungsgebenden Parlamentarischen Rat hatten durchaus die Möglichkeit einer an Parteiinteressen orientierten Einflussnahme der jeweiligen Parlamentsmehrheit auf die Wahlgesetzgebung gesehen. Sie hatten aber trotzdem bewusst 122 darauf verzichtet, einen späteren Bundes- oder Landesgesetzgeber durch entsprechende Vorgaben im Grundgesetz zu sehr zu binden. Er sollte Gestaltungsfreiheit haben, denn in der Weimarer Republik hatte sich das in der Weimarer Verfassung verankerte Wahlrecht als zu schwerfällig erwiesen. Darum wurden nun anlässlich des Neuanfanges nach dem Zweiten Weltkrieg nur einige zentrale Grundanforderungen an ein freiheitliches und »gerechtes« Wahlsystem für die Wahl des Deutschen Bundestages in Art. 38 I GG festgeschrieben - "... werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt" -, die an die Abhaltung demokratischer Wahlen für den Deutschen Bundestag gestellt werden müssen. Diese allgemeinen Grundsätze an ein demokratisches Wahlsystem sind für die Wahlen in den Ländern zu den Landtagen in den Flächenstaaten, den Bürgerschaften in Hamburg und Bremen und dem Berliner Abgeordnetenhaus seit dem politischen Neuanfang nach dem Sturz der Nazi-Diktatur durch die Alliierten 1945 in den jeweiligen Landesverfassungen und in den entsprechenden Landeswahlgesetzen geregelt. Dort müsste die gesetzlich angeordnete Geltung der vorstehend genannten allgemeinen Wahlrechtsgrundsätze ebenfalls zu finden sein. Dieser Hinweis erfolgt nicht ohne Grund: Bei der Wahl in Hessen 2003 war der gleich näher ausgeführte Grundsatz der „gleichen“ Wahl wegen des unterschiedlichen Erfolgswertes der Stimmen auf Grund zu unterschiedlicher Wahlkreisgrößen noch immer nicht eingehalten worden! Mit diesen Grundanforderungen ist aber keine Auswahl für ein sich zwangsläufig daraus ergebendes Wahlsystem getroffen. Unser Wahlsystem könnte jederzeit ohne eine Verfassungsänderung verändert werden – z.B. in ein Mehrheitswahlsystem nach britischem Vorbild -, solange die Grundanforderungen gewahrt bleiben. Mit der Grundanforderung „allgemein“ ist gemeint, dass jeder deutschen Staatsbürgerin und jedem deutschen Staatsbürger (nicht Wohnbürger/in, sondern Inhaber eines deutschen Üasses!), wenn sie/er nicht entmündigt ist und nicht ihre/seine bürgerlichen Ehrenrechte durch ein Gerichtsurteil verloren hat, ab Volljährigkeit (mit Vollendung des 18. Lebensjahres) das aktive Wahlrecht zusteht. Darum gibt es z.B. »fliegende Wahlurnen«, mit denen Gefängnisinsassen, Kranken in Krankenhäusern und Nonnen und Mönchen in Klöstern die Teilhabe an der Wahl ermöglicht werden soll – auch wenn das Reich letzterer nicht von dieser Welt ist. Der Wahlgrundsatz der Unmittelbarkeit einer Wahl besagt, dass die Wählerinnen und Wähler ihre Bundestagsabgeordneten direkt wählen. Es werden bei der Wahl keine zu delegierenden »Wahlmänner« und/oder »Wahlfrauen« zwischengeschaltet, wie es bei der Wahl des USamerikanischen Präsidenten der Fall ist, der – im Gegensatz zur Regelung in der Bundesrepublik – von seinem Volk durch an das Wählervotum gebundene zwischengeschaltete Wahlfrauen und Wahlmänner gewählt wird. Wohlgemerkt: Es werden – auch wenn es die großen Parteien in ihrer Wahlwerbung der personalisierten Wahlkämpfe anders erscheinen lassen wollen – ausschließlich die Bundestagsabgeordneten direkt gewählt, und zwar nach Partei(!)präferenz der Wähler, nicht der Bundeskanzler! Der wird vom Wahlvolk nur indirekt gewählt, weil er als Spitzenkandidat des siegreichen Parteienbündnisses nach der Wahl gemäß Art. 63 I GG „auf Vorschlag des Bundespräsidenten vom Bundestag ohne Aussprache gewählt“ und dann mit der Regierungsbildung beauftragt wird. Der Wahlgrundsatz, dass eine Wahl, die diesen Namen auch verdient, frei zu sein habe, bedeutet, dass auf Wählerinnen und Wähler von keiner Seite ein irgendwie gearteter Druck ausgeübt werden darf, zu Gunsten oder zu Ungunsten des einen oder anderen Kandidaten zu stimmen. Dieser Grundsatz wurde z.B. in der (Ex-)DDR unseligen Angedenkens ständig verletzt. Es muss nicht nur überhaupt eine, sondern es muss eine wirkliche Wahlmöglichkeit eröffnet sein, keine Scheinwahl durch »Zettelfalten«. Der Dramatiker Tom Stoppard definierte zur Verdeutlichung einseitig überspitzt: "Nicht das Wählen macht die Demokratie aus, sondern das Zählen." Die DDRBürger konnten die Einheitsliste ankreuzen, ohne dabei auswählen zu dürfen. Und um ihr Wahlrecht betrogen wurden sie dann ein zweites Mal: hinterher, beim Auszählen mit vorgegebenem, 123 hinmanipuliertem amtlichen angeblichem Endergebnis, um eine behauptete überwältigende - meist über 90 % liegende - Zustimmung der Bürger zu den Zielen der PDS-Mutter in den gelenkten Massenpublikationsmitteln als Ergebnis der Wahlfälschung zum Schlechtesten geben zu können. Zweifel an der Freiheit der Wahl könnten in z.B. Israel aufgekommen sein, wo 1998 die sephardische Orthodoxenpartei Schas versprach: „Wer für uns stimmt, dem ist das Paradies sicher.“ Prompt verfünffachte die Partei die Zahl ihrer Sitze (von eins auf fünf). Ähnlich verlief 2005 die Wahl des iranischen Präsidenten, als vom erzkonservativen Wächterrat zunächst alle Reformkandidaten abgelehnt worden waren und dann ein Alibi-Reformer in den Kreis der Bewerber aufgenommen wurde, nur sechs von über 1.000 Kandidaten überhaupt zugelassen und die gläubigen Wähler dann außerdem noch von den Mullahs unter Druck gesetzt wurden, den konservativen Kandidaten zu wählen. Im Gegensatz zu manchen anderen demokratischen Ländern wie z.B. Belgien und Österreich gehört in der Bundesrepublik – wie in den meisten demokratisch verfassten Ländern - zum Grundsatz der Wahlfreiheit auch das Recht zur Wahlenthaltung oder dem völligen Fernbleiben von der Wahlurne. Aber es war schon detailliert erläutert worden, dass Nichtwähler indirekt wählen, und zwar Radikale, weil deren relativ gleich bleibende absolute Stimmenzahl umgerechnet als prozentualer Stimmenanteil durch eine geringe Wahlbeteiligung überproportional anwächst. Der mit dem Adjektiv „gleich“ umschriebene Wahlrechtsgrundsatz bedeutet die Anerkennung des grundsätzlichen Prinzips „one man – one vote“, bedeutet, dass jede abgegebene Stimme grundsätzlich das gleiche Gewicht für die Zusammensetzung des Bundestages hat. Das BVerfG 1998: „Der Grundsatz der Gleichheit der Wahl gebietet, daß alle Staatsbürger das aktive und passive Wahlrecht in formal möglichst gleicher Weise ausüben können und die Stimmen der Wahlberechtigten beim Verhältniswahlsystem nicht nur den gleichen Zählwert, sondern grundsätzlich auch den gleichen Erfolgswert haben. Das Stimmengewicht der Wahlberechtigten (Zählwert- und Erfolgswertgleichheit jeder Stimme) darf nicht abhängig gemacht werden von Besitz, Einkommen, Steuerleistung, Bildung23, Religion, Rasse, Geschlecht, politischer Einstellung oder – wie bei uns ständig überprüft – durch zu unterschiedlich große Wahlkreise: Vor der Reform des Zuschnitts der Wahlkreise zur Bundestagswahl 2002 konnten zur Bundestagswahl 1994 im Wahlkreis Gelsenkirchen I schon 151.854 deutsche Wahlbürger einen Abgeordneten für sich ins Parlament schicken. Den 316.458 Wahlbürgern im Wahlkreis Augsburg-Land stand »nur« das im Erfolgswert geschmälerte gleiche Recht zu, obwohl sie – gemessen an der Möglichkeit der Wähler im Wahlkreis Gelsenkirchen I - bei Beachtung des Wahlgrundsatzes der Gleichheit jeder Stimme das Recht auf zwei Abgeordnete, die ihre Belange im Deutschen Bundestag vertreten sollten, gehabt haben müssten! [Mit »juristischen Bauchschmerzen« ließ das BVerfG das wegen zu großer Abweichungen in der Größe der Wahlkreise teilweise ungerechte Wahlergebnis von 1997 ein letztes Mal passieren, weil die Neuregelung der Wahlkreise ja schon in Angriff genommen worden war. Trotz dieses BVerfGUrteils, dass der Mittelwert der Wahlberechtigten eines Wahlkreises um nicht mehr als ein Drittel abweichen dürfe, war bei der Hessischen Landtagswahl im Februar 2003 in den dortigen Wahlkreisen immer noch eine übergroße Diskrepanz festzustellen: Der Wahlkreis Wiesbaden umfasste rund 52.000 Wahlberechtigte, der Wahlkreis Gießen II war mit über 110.000 Wahlberechtigten mehr als doppelt so groß! Deswegen hielten Verfassungsrechtler die Hessische Landtagswahl 2003 von vornherein für verfassungswidrig – worüber letztlich das Hessische Landesverfassungsgericht zu entscheiden hatte.] Die trotz der wiederholten Reformen und Bemühungen um eine Angleichung durch ständigen Zuzug und Weggang immer unterschiedlich bleibende Größe der Wahlkreise ist eine Einschränkung des Grundsatzes der Wahlgleichheit. Sie muss daher im tolerierbaren Rahmen gehalten werden – wobei die gesetzlich anzuordnende »Tolerierbarkeit« interpretationsbedürftig ist. Das ist dann die Aufgabe der Verfassungsgerichte. 23 „Wenige Menschen denken, und doch wollen alle entscheiden.“ (Friedrich II, der Große) 124 Weitere in gewissem Rahmen tolerierte Einschränkungen des Wahlgleichheitsgrundsatzes sind die 5-%-Sperrklausel – Stimmen für Parteien unterhalb dieser Grenze haben, da sie bei der Vergabe der Parlamentssitze wegfallen, keine Zählwertgleichheit – und die Regelung der Überhangmandate, die bewirkt, dass zusätzlich Abgeordnete in das Parlament entsandt werden und so abgegebene Stimmen unter bestimmten Voraussetzungen einen größeren Erfolgswert haben können. Der Wahlgrundsatz einer geheimen Wahl erklärt sich zweifelsfrei aus der Wortbedeutung: Eine geheime Wahl muss rechtlich und organisatorisch so abgesichert sein, dass gewährleistet ist, dass niemand gegen den Willen eines Wahlberechtigten erfährt, wie ein anderer gewählt hat. Nur so ist eine wirklich freie Wahlentscheidung der Wahlberechtigten gesichert. Dabei ist es gleichgültig, wie die Stimmabgabe festgehalten und registriert wird: ob durch Ankreuzen auf einem Stimmzettel, der in einem Briefumschlag oder nur gefaltet in die Wahlurne gesteckt wird, oder durch Knopfdruck elektronisch, wie das bei der Wahl 2002 in schon 29 Gemeinden möglich war, dabei flächendeckend in Köln, Dortmund und Cottbus. (Es werden auch schon seit einiger Zeit Überlegungen für eine Stimmabgabe per Internet angestellt, aber die damit verbundenen Sicherheitsprobleme sind noch nicht befriedigend gelöst. Selbst in den fortschrittsgläubigen USA, wo man gerne auf jeden technischen Hipe aufspringt, werden Internet-Wahlsysteme von den Experten – zumindest vorerst noch – vehement abgelehnt: Wahlen per Internet könnten zu "groß angelegtem, systematischem Wahlbetrug" führen.) Weil das GG sich ansonsten über das einzuhaltende Wahlverfahren ausschweigt, wurde gemäß dem in Art. 38 III GG ergangenen Auftrag das Bundeswahlgesetz (BWG) geschaffen. Aber wir haben eben ein Bundeswahlgesetz; es ist nicht so wie in den USA, wo jeder einzelne Bundesstaat sein eigenes Wahlgesetz erlässt! Jeder Bundesstaat hat bei der Wahl des US-Präsidenten seine eigenen Regeln für die Wahl der letztlich den Präsidenten wählenden Wahlmänner; dabei ist es grundsätzlich sogar möglich, dass ein Staatsparlament die Wahlmänner ohne Berücksichtigung des Wahlergebnisses ernennen kann (wie es 2000 in Florida passiert wäre, wenn der US Supreme Court nicht die Nachzählung gestoppt hätte). Die Grundzüge des in der Bundesrepublik für Bundestagswahlen zurzeit geltenden Wahlrechts sind nach diesen Bestimmungen folgende: „§ 1 BWG Zusammensetzung des Deutschen Bundestages und Wahlrechtsgrundsätze (1) Der Deutsche Bundestag besteht vorbehaltlich der sich aus diesem Gesetz ergebenden Abweichungen aus 598 Abgeordneten. Sie werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl von den wahlberechtigten Deutschen nach den Grundsätzen einer mit der Personenwahl verbundenen Verhältniswahl gewählt. (2) Von den Abgeordneten werden 299 nach Kreiswahlvorschlägen in den Wahlkreisen und die übrigen nach Landeswahlvorschlägen (Landeslisten) gewählt.“ Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass laut § 1 Absatz I Satz 2 BWG - im Gegensatz zu z.B. manchen kommunalen Wahlrechten - ausschließlich Deutsche(!) wahlberechtigt sind, und wer Deutscher ist, regelt das Staatsangehörigkeitsgesetz. Wer nicht - eventuell nicht mehr - Deutscher ist, darf an der Wahl nicht teilnehmen! Das ist an sich eine Selbstverständlichkeit, wird aber in Zehntausenden von Fällen von Türken, die sich hier hatten einbürgern lassen und hinterher wieder verbotenerweise und darum heimlich ihre Ursprungsstaatsbürgerschaft als Doppelstaatsbürgerschaft angenommen hatten, missachtet; das geschah deswegen heimlich, weil das geänderte deutsche Staatsbürgerschaftsrecht regelt, dass in solchen Fällen automatisch der Verlust der deutschen Staatsbürgerschaft eintritt, womit dann neben allen erneut greifenden ausländerrechtlichen Regelungen auch die Wahlberechtigung für Bundestagswahlen entfällt! Und nicht hinzunehmen ist außerdem, wenn das Ursprungsland seine ehemaligen Bürger in diesem Betrug an unserer Staatsbürgerschaft komplizenhaft unterstützt: 125 „50 000 Türken beschafften sich illegal den Doppelpaß Union: Regierung unterschätzt das Problem von Ansgar Graw Berlin - Die Union hat die Bundesregierung aufgefordert, von der türkischen Regierung eine Liste mit den Namen von rund 50 000 türkischstämmigen Personen mit illegaler doppelter Staatsangehörigkeit zu verlangen. Die Innenpolitiker Wolfgang Bosbach (CDU) und Hartmut Koschyk (CSU) sagten vor Journalisten, die Bundesregierung unterschätze offenkundig die Probleme, die mit dieser Frage zusammenhingen. Zuvor hatte die Bundesregierung in der Beantwortung einer Kleinen Anfrage der Union unter Berufung auf offizielle Angaben aus Ankara die Zahl der türkischstämmigen Personen, die sich nach Erlangung der deutschen Staatsangehörigkeit erneut einen zusätzlichen türkischen Paß beschafft hatten, auf etwa 50 000 beziffert. Das Verfahren widerspricht dem am 1. Januar 2000 in Kraft getretenen deutschen Staatsangehörigkeitsrecht, nach dem Deutsche ausländischer Abstammung, die sich wieder die ursprüngliche Staatsangehörigkeit beschaffen, automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren. Obwohl diese Rechtslage bekannt war, hat die türkische Regierung nach Darstellung der Union per Runderlaß vom 10. September 2001 alle Gouverneursämter angewiesen, die in Deutschland verlangten Registerauszüge zu manipulieren und so den Wiedererwerb der türkischen Staatsangehörigkeit gegenüber deutschen Behörden zu verschleiern. ... Koschyk wies ... auf das Problem der Teilnahme an Wahlen hin. So habe die SPD bei der Bundestagswahl 2002 nur um 6027 Stimmen vor der Union gelegen. Der CSUPolitiker forderte dazu auf, eine solche unklare Situation bereits vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Mai zu vermeiden. Bosbach wie Koschyk erklärten allerdings, es gehe nicht um eine Anfechtung zurückliegender oder künftiger Wahlen.“ (DIE WELT 10.03.05) Schily geht gegen illegale Doppelpaßinhaber vor Innenminister fordert von Türkei Liste von Wiedereingebürgerten - Mögliche Folgen für NRW-Wahl von Ansgar Graw Berlin - Die Bundesregierung verlangt von der Türkei umfassende Informationen über türkischstämmige Bürger, die illegalerweise im Besitz sowohl der deutschen als auch der türkischen Staatsangehörigkeit sind. Bundesinnenminister Otto Schily (SPD) erklärte nach einem Treffen mit seinem türkischen Kollegen Abdülkadir Aksu in Berlin, er habe von der Regierung in Ankara eine entsprechende Liste mit Personen gefordert, die nach Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft zusätzlich ihre alte Nationalität wieder angenommen haben. Eine solche doppelte Staatsbürgerschaft ist in Deutschland nicht erlaubt. ... Der SPD-Politiker sagte, das Ergebnis der ...wahl solle nicht durch die Stimmen dieser so genannten Rückeinbürgerer beeinträchtigt werden. Nach dem novellierten deutschen Staatsbürgerschaftsrecht müssen die betroffenen Doppelstaatler ihren deutschen Paß abgeben und dürfen hierzulande nicht mehr wählen. Die CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach (CDU) und Hartmut Koschyk (CSU) hatten vor einem Monat die Bundesregierung aufgefordert, in Ankara auf die Herausgabe einer solchen Namensliste zu bestehen. Aksu ließ gestern jedoch offen, ob die Türkei dieser Aufforderung Schilys nachkommen wird. Aksu sagte, die deutschstämmigen Türken hätten wieder einen türkischen Paß beantragt, weil es vor dem Jahr 2000 "in Deutschland die Annahme gab, daß die doppelte Staatsbürgerschaft eingeführt wird". ... Nach Darstellung der Union hatte die türkische Regierung per Runderlaß vom 10. September 2001 alle Gouverneursämter angewiesen, die in Deutschland verlangten Registerauszüge zu manipulieren, um den zusätzlichen Wiedererwerb des türkischen Passes gegenüber deutschen Ämtern zu verschleiern. ... 126 DIE WELT 12.04.05 Faruk Sen, der Direktor des Zentrums für Türkeistudien (ZfT), wies laut DIE WELT vom 07.04.05 schon vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen auf die Bedeutung der 180.000 in NRW wahlberechtigten türkischen Migranten hin. Er forderte sie auf, die Bestimmungen des Staatsangehörigkeitsrechts zu achten, das seit dem 01.01.00 eine doppelte Staatsbürgerschaft ausschließt. Es müsse akzeptiert werden, wenn die Landesregierung Doppelstaatler aufdecken wolle, um die Legitimität der Wahl nicht zu gefährden. Das galt nicht nur für die Landtagswahl in NRW, sondern gilt für die kommenden Bundestags- und die kommenden Europawahlen! Die SPD hatte die Bundestagswahl 2002 vor der CDU/CSU mit einem Zweitstimmenvorsprung von nur 6.027 Stimmen gewonnen. Da können zehntausende von Türken unberechtigt abgegebene Stimmen das Wahlergebnis ohne weiteres verfälschen! Da die türkischen Einwanderer bisher zu rund 60 % zur SPD und zu 9-14 % zur CDU tendierten (SPIEGEL 04.10.04) und sich dieses Wahlverhalten noch deshalb verstärken wird, weil SPD und Grüne für eine Vollmitgliedschaft der Türkei in der EU eintreten, die CDU/CSU aber nur eine „privilegierte Partnerschaft“ zulassen will, könnten durch die Staatsbürgerschaftsmanipulationen der Türken die Chancen der Parlamentsvertretung der in den Umfragen vorne liegenden CDU/CSU erhblich geschwächt werden! Das Gebiet der Bundesrepublik ist also in 299 Wahlkreise eingeteilt; diese sind in ca. 81.000 Wahlbezirke und weitere ca. 10.000 Briefwahl- und Sonderwahlbezirke unterteilt. (Zur organisatorischen Bewältigung des Wahltages werden deshalb ca. 600.000 Bürger in den Wahlvorständen benötigt.) Eine ständige Wahlkreiskommission, die gemäß § 3 BWG aus dem Präsidenten des Statistischen Bundesamtes, einem Richter des Bundesverwaltungsgerichtes und fünf weiteren (in ihrer Funktion nicht festgelegten) Mitgliedern besteht, hat die Bevölkerungsentwicklung innerhalb der Wahlkreise zu beobachten und dem Gesetzgeber gegebenenfalls Änderungsvorschläge bezüglich der Änderung von Wahlkreisgrenzen zu unterbreiten. Gemäß § 3 (2) BWG sind dabei u.a. folgende Grundsätze zu beachten: Die Ländergrenzen sind einzuhalten. Die Zahl der Wahlkreise in den einzelnen Ländern soll deren Bevölkerungsanteil an der Bevölkerung der Bundesrepublik soweit wie möglich entsprechen. Diese Wahlkreise sind grundsätzlich von Nord nach Süd und von Ost nach West, und innerhalb eines Landes ebenfalls von Ost nach West durchnummeriert. So befindet sich der Wahlkreis (WK) Nr. 1 in Flensburg/Schleswig im nördlichsten Schleswig-Holstein. Die Bevölkerungszahl der Deutschen eines Wahlkreises – die Berechnung erfolgt also ohne Berücksichtigung der nicht stimmberechtigten ausländischen Mitbürger - soll von der immer wieder statistisch zu erhebenden durchschnittlichen Bevölkerungszahl der Wahlkreise um nicht mehr als 15 % nach oben oder unten abweichen. Beträgt die Abweichung mehr als 25 %, ist zwingend eine Neuabgrenzung vorzunehmen! Die Wahlkreise sollen ein zusammenhängendes Gebiet bilden. In dem Gesetz steht aber nicht das juristisch bedeutsamere Wörtchen „müssen“. »Soll-Bestimmungen« sollen zwar beachtet werden; ein wohlerwogener Verstoß gegen diese bloße »Soll-Bestimmung« zieht aber keine Ungültigkeit der Wahl nach sich! Die Grenzen der Gemeinden, Kreise und kreisfreien Städte sollen nach Möglichkeit eingehalten werden. Die letzte Wahlkreisänderung ist mit Gesetz vom 17.03.05 vorgenommen worden. 127 Beispiel in Hamburg aus eigener Anschauung: Der neu zusammengestückelte Wahlkreis Hamburg-Bergedorf/Harburg, in dessen südlichstem Teil ich lebe, ist durch die breit fließende Elbe getrennt. Das eher dienstleistungsgeprägte Bergedorf hat 266.000 Einwohner, davon 227.600 in diesem Fall ausschlaggebende Deutsche, und das verstärkt dem Arbeitermilieu verhaftete Harburg 208.000 Einwohner, davon 172.300 Deutsche. Der Bergedorfer Teil des Wahlkreises liegt im Osten Hamburgs nördlich der Elbe, der Harburger rund 25 km davon entfernt südlich der Elbe im südlichsten Hamburg. Es gibt keine direkte Verbindung zwischen den beiden eigenständigen Stadtteilen. Man muss die Elbe queren und über das Zentrum Hamburgs fahren, um von dem einen Wahlkreisteil in den anderen zu kommen. Da hängt nichts zusammen, weder geographisch noch sonst wie! Und weil ein Wahlkreis aus diesen beiden „Großstädten“ mit dann insgesamt 399.900 deutschen Einwohnern viel zu groß wäre, um den Richtlinien für die Wahlkreisgröße zu entsprechen, wurden von beiden bisherigen Wahlkreisen überall Teile abgezwackt und anderen Hamburger „Großstädten“ (Bezirken in Großstadtgröße) zugeschlagen, um alles irgendwie „passend“ zu machen, damit wenigstens die Landesgrenzen gewahrt blieben. 5-%-Sperrklausel Um der in jedem Verhältniswahlsystem angelegten Parteienzersplitterung und den damit verbundenen Auswirkungen vorzubeugen – insbesondere der der bei vielen im Parlament vertretenen Parteien immer schwierigen Mehrheitsbildung für eine stabile Regierungsmehrheit, worunter der demokratische Neuanfang nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg in der Weimarer Republik litt -, muss eine Partei, damit sie bei der Vergabe der Listenmandate überhaupt berücksichtigt werden kann, grundsätzlich (seit 1953 nicht nur über nur ein24 Bundesland, sondern über das ganze Wahlgebiet gerechnet) mindestens 5 % aller abgegebenen Zweitstimmen erringen: „5-%-Sperrklausel“ = “ 5-%-Hürde". Wer eine Partei wählt, die diese Hürde nicht überwindet, dessen Stimme wird (auch) im Verhältniswahlsystem wegen der mit der Sperrklausel bezweckten Schlechterstellung der Kleinstparteien zu einer „Papierkorbstimme“. Durch die zu überwindende 5-%-Hürde soll durch die Konzentration der Parteien im Parlament die Regierungsbildung trotzt des zu Grunde liegenden Verhältniswahlrechts gefördert werden. So hat die 5-%-Sperrklausel den Einzug der rechtsradikalen NPD, die z.B. schon 1969 ohne Direktmandate zu erlangen - 4,3 % der Wählerstimmen im Westteil der BRD auf sich vereinen konnte, in den Bundestag verhindert. Ob die 5-%-Sperrklausel auch noch ab 2005 ausreicht, den Einzug der unter der NPD Listenführerschaft vereinten rechtsradikalen Parteien NPD (ca. 5.000 Mitglieder plus Sympathisanten) und DVU (ca. 11.500 Mitglieder plus Sympathisanten) – der NPD-Vorsitzende Voigt Ende 2004: "Es wächst zusammen, was zusammengehört.", die Führung der REPs (ca. 8.000 Mitglieder plus Sympathisanten) hat aber wegen der offen demokratiefeindlichen Tendenzen in NPD und DVU ein Zusammengehen mit der von denen geplanten "Volksfront von rechts" (NPD-Vorsitzender Voigt) abgelehnt – wenigstens in den Deutschen Bundestag zu verhindern, bleibt abzuwarten: Jede demokratische Gesellschaft hat sowohl an ihrem linken wie an ihrem rechten Rand ein Extremistenpotential von im Mittelwert zwischen 5-15 %, das aber auch höher ausfallen kann; so erreichte z.B. im Nachbarland Frankreich der Vorsitzende der rechtsradikalen Front National, Le Pen, bei der Präsidentschaftswahl 2002 die zweithöchste Stimmenzahl und kam so in die Stichwahl um das Präsidentenamt. 24 Die zu niedrig angesetzte Hürde von 5 % in nur einem Bundesland hatte nicht die gewünschte Auswirkung der Parteienkonzentration im Parlament: im ersten Deutschen Bundestag waren 12 Parteien vertreten. 128 So liegt nach dem Erstarken von NPD und DVU in Ostdeutschland und ihrem durch die vereinten Kräfte in "absolut gleichberechtigter partnerschaftliche Zusammenarbeit" bewerkstelligten Einzug in zunächst zwei ostdeutsche Landtage (in Brandenburg die DVU mit 6,1 % und in Sachsen die NPD mit 9,2 %) ein Einzug Rechtsradikaler als "nationale Rechte" und "Partei- und Systemalternative" in den Bundestag durchaus im Bereich des Möglichen, hätte aber eine sogar noch verheerendere politische Signalwirkung in der BRD und insbesondere im Ausland, als es der Einzug von NPD und DVU in die Landesparlamente und das Fiasko bei der Wahl des sächsischen Ministerpräsidenten Ende 2004 hatte, als zwei Abgeordnete – vermutlich aus dem Lager der CDU – ihre Stimme dem rechtsextremen Gegenkandidaten gaben! Beunruhigend in diesem Zusammenhang ist, dass bei den Landtagswahlen im Saarland und 2004 in Sachsen mehr als 10 % der Jungwähler eine rechtsextreme Partei wählten! Auch die Grünen sind nicht nur bei ihrem bundesweiten Aufbau von der 5-%-Klausel betroffen gewesen: Bei der „Vereinigungswahl“ 1990 scheiterten die westdeutschen Grünen wegen des bei dieser Wahl ausnahmsweise in Ost und West getrennt gewerteten Wahlgebietes und verpassten so für vier Jahre den Einzug in den Deutschen Bundestag; nur ihre ostdeutschen Gesinnungsgenossen von Bündnis 90 waren im Osten erfolgreich und damit im Bundesparlament vertreten. Darum versuchten die Grünen und die von der Sperrwirkung ständig bedrohte PDS 1990, die Abschaffung des „Quorums“ (einer Sperrklausel) zu erreichen. Auch die FDP scheiterte auf Länderebene wiederholt an dieser Hürde und sähe gerne die Verringerung des Quorums auf 3 % oder seine Abschaffung. Das BVerfG hat das „Quorum“ von 5 % abgesegnet, gleichzeitig aber deutlich gemacht, dass es eine höhere Sperrklausel nicht hinnehmen würde – obwohl die Einführung des Mehrheitswahlrechts sich für kleine Parteien als eine viel höhere Hürde erweisen würde! Allerdings gibt es zu diesem (nur) grundsätzlichen Erfordernis der Überwindung der 5-%-Hürde eine alternative Möglichkeit des Einzuges in den Deutschen Bundestag, mit der das Ziel, Kleinoder Kleinstparteien von der parlamentarischen Repräsentanz fernzuhalten, wieder unterlaufen wird. Grundmandats- oder Alternativklausel / Drei Direktmandate Die Sperrwirkung der 5-%-Klausel kann jedoch wieder unterlaufen werden, wenn eine kleine Partei mit bundesweit weniger als 5 % der Zweitstimmen irgendwo im Bundesgebiet mindestens 3 Direktmandate erkämpft. (Vor der Verschärfung 1956 genügte schon die Erringung eines einzigen Direktmandates für den Einzug in das Bundesparlament.) Zur Erringung der erforderlichen 3 Direktmandate können schon 0,6 % der Wählerstimmen ausreichen, so dass eine offensichtliche Ungleichgewichtigkeit zwischen den beiden Sitzvergabehindernissen 5-%Klausel und Alternativ- oder Grundmandatsklausel besteht: Die Alternativ- oder Grundmandatsklausel kann von einer bloß regionalen Schwerpunktpartei wesentlich leichter überwunden werden! Trotz dieses offensichtlichen Verstoßes gegen das Prinzip des gleichen Erfolgswertes jeder abgegebenen Stimme wurde die Grundmandatsklausel vom BVerfG mit dem Argument abgesegnet, dass eine solche Partei „eine besondere politische Kraft“ darstelle, weil sie offensichtlich politische Anliegen aufgegriffen habe, „die eine Repräsentanz im Parlament rechtfertigen“.25 Gelingt es einer Partei, die mindestens benötigten 3 Direktmandate zu erringen, dann erhält sie sogar nicht nur diese 3 Mandate, sondern - entsprechend den auf sie in den einzelnen Ländern entfallenen Stimmen - insgesamt die ihrem Anteil am bundesweiten Zweitstimmenergebnis entsprechende Anzahl von Parlamentssitzen, auch wenn sie damit nicht die erst ab 5% der Mitglieder des Bundestages beginnende Fraktionsstärke erreichen kann. Sie hat dann nur einen Gruppenstatus minderen Rechts, der sich auch finanziell sehr nachteilig be25 Urteil des BVerfGs 2 BvC 3/96 S. 20 f 129 merkbar macht, denn sie erhält dann nicht den monatlichem Grundbetrag von 279.056 € plus 5.296 € pro Abgeordnete/n (STERN 05.12.02). Dass die Grundmandats- oder Alternativklausel im Vergleich zu der hohen Hürde der 5-%Sperrklausel »ungerecht« ist und der Erfolgswert einer erfolgreichen Wählerstimme für drei Direktmandate bis auf das 33-fache(!) des Erfolgswertes einer für die Überwindung der 5-%Hürde abgegebenen Stimme betragen kann, führte wiederholt zur Forderung nach Abschaffung der Grundmandatsklausel. Bei der Bundestagwahl 1957 war die DP wegen der entscheidenden Wahlhilfe der CDU, die in drei Wahlkreisen auf die Aufstellung eines Direktkandidaten bewusst verzichtet und ihre Wähler (erfolgreich) aufgefordert hatte, den Direktkandidaten der DP zu wählen, um diese Partei auf diese Weise als Koalitionspartei in den Bundestag zu hieven, mit nur 3,4 % Zweitstimmenanteil in den Bundestag gekommen, nicht jedoch der ebenfalls als Koalitionspartei der CDU agiert habende BHE mit 4,6 % der Stimmen ohne Direktmandat, von dem man angenommen hatte, dass er die 5-%-Hürde aus eigener Kraft überwinden würde. Bei der Bundestagswahl 1994 errang die PDS mit 258.695 Erststimmen 4 Direktmandate und zog damit in den Bundestag. Hätte sie weniger als die drei erforderlichen Direktmandate errungen, hätte sie ungefähr das Zehnfache an Zweitstimmen erringen müssen, um dann die 5-%-Hürde zu überwinden. Die FDP konnte nicht die Grundmandatsklausel für sich nutzbar machen. Somit war der Erfolgswert einer für die PDS abgegebenen Erststimme zehnmal so hoch wie der Erfolgswert einer für die FDP abgegebenen Zweitstimme. Und das ist unter dem Verfassungserfordernis des gleichen Erfolgswertes einer abgegebenen Wählerstimme mindestens bedenklich! Darum geht die Forderung dahin, einer Partei die direkt errungenen Mandate zwar zu belassen, sie aber nicht von dem Erfordernis der Überwindung der 5-%-Hürde freizustellen; ein Zustand, wie ihn die PDS nach der Bundestagswahl 2002 mit ihren zwei gewonnenen Direktmandaten erreicht hatte. Dagegen hatte es die PDS bei der BT-Wahl 94 durch die Erringung der 4 Ostberliner Direktmandate ohne die Überwindung der 5-%-Hürde erreicht, 26 weitere Abgeordnete in den Bundestag zu bringen, ohne damit Fraktionsstärke zu erreichen. Als die PDS 2002 nur 2 Direktmandate errang, kamen nur diese beiden direkt gewählten Abgeordneten in den Bundestag auf die schlechtesten zu vergebenden Plätze am zugigen Gang, ohne Pultablage und Telefon; für den um mehr als 60 Abgeordnete verkleinerten Bundestag bei so viel Platz eine mir unwürdig erscheinende Schikane. Sie konnten aber 2002 keine weiteren Mandate »nachziehen«, weil die »Grundmandatsanzahl« von mindestens drei zu erringenden Direktmandaten nicht erreicht worden war. Mit nur zwei Abgeordneten wurde ihnen nicht einmal ein einfacher Gruppenstatus zuerkannt, bei dessen Zuerkennung ihnen knapp 12.000 € monatliche Förderung zugestanden hätte. Sie hatten damit die gleiche rechtliche Stellung wie die beiden in derselben Legislaturperiode aus ihren Fraktionen und Parteien ausgeschlossenen Abgeordneten: Möllemann (vor seinem Ausschluss FDP) und Hohmann (vor seinem Ausschluss CDU). Solche Abgeordneten haben im Parlament nur noch eingeschränkte Mitwirkungsrechte: sie dürfen z.B. keine großen Anfragen stellen und erst recht keine Gesetzentwürfe einbringen. Aber sie haben das Recht, sich im Plenum zu jedem Tagesordnungspunkt zu melden und in genau festgelegten, knappen Zeitlimits zu sprechen. Vergabe der Mandate nach dem Hare/Niemeyer-System Parlamentssitze können nicht zu 0,8 % an einen und zu 0,2 % an einen anderen Abgeordneten vergeben werden. Eine Sitzvergabe muss aus biologischen Gründen ganzzahlig sein (Integritätsforderung an das Verteilungssystem). Die Summe der errechneten ganzzahligen Anteile muss der Summe der zu vergebenden Sitze genau entsprechen (Summenforderung) und darf nicht »einen im Sinn« haben und den weglassen oder hinzufügen, damit die Rechnung aufgeht. Und die einzelnen Anteile der Parteien an der Gesamtheit der zu vergebenden Sitze soll dem errungenen (Zweit-)Stimmenanteil entsprechen (Proportionalitätsforderung). Und schließlich muss die Reihenfolge der Berechtigung ohne Losverfahren eindeutig zu ermitteln sein (Eindeutigkeitsforderung für die Reihenfolge bei der Vergabe). Diese verschiedenen Forderungen an das an- 130 zuwendende Verteilungssystem unter einen Hut zu bringen ist nicht einfach und gelingt keinem System ganz lupenrein. Die Sitzvergabe im Bundesparlament wird nach dem Zweitstimmenanteil unter Verwendung des 1985 eingeführten „Hare/Niemeyer-System“ berechnet. Es hat das bis 1983 verwandte d’Hondtsche-Höchstzahlverfahren mit seinen systemimmanenten Mehrdeutigkeiten abgelöst, weil das außerdem die großen Parteien begünstigt, der für eine Regierungskoalition bitter benötigte kleinere Koalitionspartner aber gerne seine Schmächtigkeit begünstigt sehen wollte. Die Macht in Bonn war zwar nicht eine Messe, aber im Zweifelsfall einen Parlamentssitz wert! Darum wurde das BWG mit der Mehrheit der Regierungskoalition so geändert, dass durch das neu anzuwendende Verfahren tendenziell kleinere Parteien begünstigt werden. Aber auch dieses Verfahren hat seinerseits Nachteile: Bei kleinen Anteilen hat es erhebliche Abweichungen von der Proportionalität und es kann zu wiederholten unlogischen „Rücksprüngen“ kommen, demzufolge einer Partei ein zuvor zuerkannter Sitz wieder entzogen wird! (Darum muss immer eine Kontrollrechnung mit einem um einen Sitz erhöhten Gremiumsumfang durchgeführt werden!) Wegen u.a. dieser „unlogischen Rücksprünge“ wendet der Deutsche Bundestag intern für die Besetzung von Ausschüssen und die Ermittlung von deren Vorsitzenden das dem System d’Hondt ähnelnde „Rangmaßzahlverfahren nach Sainte Lague/Schepers“ an, bei dem die Gesamtzahl der Stimmen durch die Anzahl der Stimmen für die einzelnen Parteien dividiert und dieser Quotient nacheinander mit 0,5/ 1,5/ 2,5/ ... multipliziert wird. Die Sitze werden dann nach den niedrigsten Zahlen verteilt. Dieses System soll die »gerechtesten« Ergebnisse liefern: Wenn das so ist, dann fragt man sich als logisch denkender Mensch natürlich, warum dieses »gerechteste« Verrechnungssystem, das dem Bundestag ja bekannt ist, nicht auch für die Verteilung der Parlamentssitze auf die einzelnen Parteien angewandt wird, wie es der Bundeswahlleiter zur Verrechnung vorgeschlagen hat? Eine einleuchtende Antwort, warum das nicht so ist, gibt es nicht! Die Anwendung des als bedingt fehlerhaft erkannten Systems nach Hare/Niemeyer kann wohl nur mit menschlichen Beharrungstendenzen erklärt, aber nicht plausibel gemacht werden. Wenden wir uns darum der Verteilung der Parlamentssitze nach Hare/Niemeyer zu. Das von dem britischen Rechtsanwalt Hare im 19. Jahrhundert vorgeschlagene und 1970 von dem deutschen Mathematiker Niemeyer in Erinnerung gerufene und darum Hare/Niemeyer-Verfahren genannte Verrechnungsverfahren („Quotenverfahren mit Restausgleich nach größten Bruchteilen“) liest sich komplizierter, als die Rechnung letztlich ist, wenn man Schritt für Schritt vorgeht. Nach der Bundestagswahl 2002 hatte sich für die Ermittlung der Vergabe der Sitze im Parlament auf die einzelnen Parteien nachfolgende Berechnung ergeben. (Wegen der bei der Wahl 2002 in Spalte 2 eingetretenen, bisher noch nie vorgekommenen Beson- 131 derheit26 mit ihren Auswirkungen für die Berechnung wird vorstehende Veranschaulichung aus exemplarischen Gründen hier beibehalten und muss nach jeder Wahl selbsttätig aktualisiert werden.) Für die Vergabe der Parlamentssitze an die Parteien nach dem „Hare/Niemeyer-System“ sortiert man in den einzelnen Wahllokalen zunächst ungültige Stimmzettel aus, zählt dann die Erststimmen aus und stellt so beim Landeswahlleiter durch Aufaddieren der Ergebnisse aus den einzelnen Wahllokalen letztlich fest, wer den jeweiligen Wahlkreis nach dem Prinzip der relativen Mehrheitswahl errungen hat. Das könnte rein theoretisch auch ein Bewerber ohne Parteienbindung sein. Vorgekommen ist das bisher aber ausschließlich 1949 einmal, als nur mit einer Stimme gewählt wurde; seitdem nach der Umgestaltung unseres Wahlsystems 1953 mit Erst- und Zweitstimme gewählt wird, jedoch nicht mehr: Selbst dem ehemaligen Oberbürgermeister und Ehrenbürger von Bonn gelang das nicht, als Daniels sen. verärgert über »seine« Partei, die CDU, in CDU-naher Anbindung als freier Bewerber kandidierte. Da wurde dem renommierten Ehrenbürger ein unbekannter, »blasser« Parteivertreter vorgezogen: Die Deutschen wählen – auch bei der Vergabe der Direktmandate – indirekt Parteien und bisher nie parteiungebundene Persönlichkeiten! Die Wahl des nach der Wiedervereinigung zwar parteilosen aber gleichwohl für die PDS auf deren für renommierte Nicht-Parteimitglieder (zum Stimmenfang zusätzlicher Wähler) geöffneten Liste angetretenen und darum von der PDS-Klientel gewählten Dichters Stefan Heym ist da kein Gegenbeweis. Wenn das so ist und also auch die Erststimme fast ausschließlich nach Parteizugehörigkeit vergeben wird, dann erhebt sich wirklich die Frage nach dem Sinn der praktisch wertlosen Erststimme, da ja fast alle wichtigen oder als wichtig erachteten Kandidaten sowieso auf der Landesliste »abgesichert« sind; aber eben nur fast alle. Durch die Beibehaltung der Erststimme kann allerdings ein nach Meinung der (meist nur relativen) Mehrheit der Wähler eines Wahlkreises überragender Kandidat in den Deutschen Bundestag gewählt werden, der bei den innerparteilichen Kämpfen und Querelen um die Nominierung auf einem der aussichtsreichen Plätze der Landesliste unterlegen war – siehe 2005 der Kandidat der Grünen in Berlin Friedrichshain, Ströbele, der auf die ihm nur an aussichtsloser Stelle zugestandene Nominierung auf der Landesliste der Berliner Grünen verzichtete und sich verärgert aber hoffnungsvoll nur noch um die Wiederwahl als Direktkandidat seines bei der vorherigen Wahl errungenen Wahlkreises bewarb. Ein weiterer Gesichtspunkt für die Beibehaltung der Erst- neben der für die Verrechnung der Mandate wichtigeren Zweitstimme ist die Möglichkeit, durch die Erringung dreier Direktmandate auch dann in den Bundestag gelangen zu können, wenn eine Partei ohne die Ausnahmeregelung der sogenannten Grundmandatsklausel an sich an der 5-%-Hürde gescheitert wäre. Des Weiteren haben Wähler kleinerer Parteien, deren Vorzeige-Direktkandidat üblicherweise keinerlei Chance hat, das Direktmandat zu erwerben, das zu erringen er angeblich antritt, die Möglichkeit, durch ihr Stimmensplitting mit ihrer Erststimme den Direktkandidaten der Partei zu unterstützen, mit der ihre Partei nach der Wahl koalieren will: es wird also eine »umgekehrte Leihstimme« vergeben. Und schließlich kann die besondere regionale Bedeutung einer Partei in einem Bundesland durch die Erringung von mit der Erststimme gebildeter Überhangmandate zum Ausdruck kommen. Alles in allem ein durch seine Ausdifferenzierungen um größtmögliche »Wahlgerechtigkeit« bemühtes System, das darum (laut einer im Internet gefundenen diesbezüglichen Notiz) von Neuseeland übernommen wurde, als es das Mehrheitswahlrecht wegen seiner inhärenten »Ungerechtigkeiten«, mit denen die Briten sehr gut leben können, abschaffte. Weil durch diese starren Landeslisten der Parteien für mindestens 90 % der Kandidaten schon vor der Wahl allein auf Grund ihres Parteilistenplatzes feststeht, dass sie in den Bundestag einziehen 26 Durch die Bundestagswahl 2002 kamen als in ihrem Wahlkreis gewählte Direktkandidaten zwei PDS-Abgeordnete in den Deutschen Bundestag, ohne dass ihre sowohl an der 5-%-Hürde wie auch an der Grundmandatsklausel gescheiterte Partei als Gruppe oder Fraktion im Parlament vertreten war. 132 werden, wird seit dem Gutachten der Enquete-Kommission „Verfassungsreform“ von 1976 erwogen, dem Wähler (gemäß dem bayerischen Landeswahlrecht) die Möglichkeit zu geben, durch die Einführung „begrenzt offener Listen“ die Reihenfolge der Kandidaten zu verändern. Beim Ausscheiden eines Abgeordneten aus dem Parlament gibt es bei uns – im Gegensatz zu z.B. dem Wahlsystem in Großbritannien – keine Nachwahlen, sondern seit deren Abschaffung 1953 nur eine Ergänzung durch zuvor nicht in das Parlament eingezogene »Nachrücker« von der jeweiligen Landesliste der betroffenen Partei. Nach Feststellung der in dem jeweiligen Wahlbezirk für die Wahl des Direktkandidaten von jedem Bewerber erreichten Stimmen werden die Zweitstimmen ausgezählt und diese Ergebnisse dem Landeswahlleiter gemeldet, der sie seinerseits an den Bundeswahlleiter weiterleitet. Dort weiß man dann, ob eine Partei über das gesamte Bundesgebiet gerechnet mindestens drei Direktmandate gewonnen hat. Wenn weder das der Fall ist noch eine Partei die 5-%-Hürde überklettert, sie aber ein oder zwei Sitze als Direktmandat/e gewonnen hat, so zieht man von der Zahl der zu vergebenden Sitze zunächst diejenigen der direkt gewählten Kandidaten ab, die keiner im Bundestag vertretenen Partei angehören (Beispiel für 2002: Gesetzliche Zahl der Abgeordneten 598 minus 2 in Berlin direkt gewählte PDS-Wahlkreisabgeordnete = 596 noch zu vergebende Mandate), da gewählte - parteilose oder parteigebundene - Direktkandidaten immer in den Bundestag einziehen. Nach der Ermittlung der Anzahl der nach dem Abzug der erfolgreichen Bewerber a) ohne Parteibindung oder b) zwar mit Parteibindung aber wegen Verfehlens der 5-%-Hürde nur als (auf der Basis des Mehrheitswahlprinzips direkt gewählte) Wahlkreisvertreter ohne Chance auf einen Gruppen- oder Fraktionsstatus in den Bundestag direkt einziehenden Abgeordneten dann noch zu vergebenden Sitze im Bundesparlament an jede dort einziehende Partei geht man dann zunächst von rein fiktiven »Bundesparteilisten« - die es ja gar nicht gibt: es gibt nur die bei dem Bundeswahlleiter eingereichten, aber seit 1957 verbundenen Landeslisten der jeweiligen Parteien - und deren Zweitstimmenanteil aus. Für die Zuteilung der Sitze nach dem Hare/NiemeyerSystem werden also in einem ersten Rechenschritt die Zweitstimmen jeder Partei aus jedem Bundesland zusammengezählt und deren Summe durch den 1%-Wert der Gesamtzahl (Gesamtzahl durch 100) aller abgegebenen gültigen Zweitstimmen geteilt. Dadurch ergibt sich der prozentuale Anteil einer Partei an der Gesamtzahl aller abgegebenen gültigen Stimmen. Man weiß jetzt, welche Partei die 5-%-Hürde überwunden hat. Die Anzahl der auf eine Partei bundesweit entfallenen Zweitstimmen entscheidet also grundsätzlich die Wahl und somit über die Zusammensetzung des Bundestages: Die Zweitstimme ist, wenn die Mindestvoraussetzungen (5 % der Zweitstimmen oder drei Direktmandate) erfüllt sind, also erstrangig und die Erststimme zweitrangig. Nach dieser ersten Stufe der Berechnung steht also fest, welche Parteien die Mindestvoraussetzung erfüllt haben und in den Bundestag einziehen dürfen. Die Zweitstimmen der Parteien, die keine der beiden Mindestvoraussetzungen (5 % oder 3 Direktmandate) erfüllt haben, werden für die zweite Stufe der Berechnung gestrichen. In einem zweiten Rechenschritt, der sogenannten Oberverteilung für das gesamte Wahlgebiet, wird bestimmt, wie viel Sitze einer Partei an der Gesamtzahl der (noch) zu vergebenden Sitze zustehen: Dafür wird die verbliebene Gesamtzahl der Sitze mit der Anzahl der gewonnenen Zweitstimmen der zur Berechnung anstehenden Partei multipliziert und dann durch die Gesamtzahl der (verbliebenen) Zweitstimmen aller zu berücksichtigenden Parteien dividiert. Der vor dem Komma stehende Zahlenteil dieser »krummen« Zahl gibt an, wie viel Sitze einer Partei auf jeden Fall zustehen. Die restlichen noch zu vergebenden Sitze werden dann nach dem jeweils verbliebenen höchsten Nachkommawert an die Parteien vergeben. Zwar steht so jetzt der gesamte Anteil einer Partei für das gesamte Wahlgebiet Bundesrepublik Deutschland an der Gesamtzahl der Sitze im Bundestag fest, aber es ist noch völlig unklar, aus welchem Bundesland, von welcher Landesliste einer Partei welcher Abgeordnete ganz konkret in den Deutschen Bundestag einziehen soll, um eines der seiner jeweiligen Partei zustehenden Mandate wahrzunehmen. 133 Die erforderliche innerparteiliche Verteilung der errungenen Gesamtzahl der Parlamentssitze einer Partei auf ihre einzelnen Landeslisten wird in einem dritten Rechenschritt ebenfalls nach dem Hare/Niemeyer-System als sogenannte Unterverteilung berechnet. Kontrollfrage an die Schüler: Für welche Partei entfällt aus welchem Grund dieser dritte Rechenschritt der Unterverteilung auf einzelne Landeslisten? Natürlich für die CSU, da sie keine Listenverbindung eingeht und ausschließlich als bayerische Regionalpartei antritt! Für diesen Rechenschritt der Unterverteilung der Mandate auf einzelne Landeslisten ist äußerst wichtig, wie viel Stimmen der Landesverband einer Partei im Vergleich zu den anderen ihrer Landesverbände errungen hat: Zweitstimmen-Wahlenthaltung oder generelle Wahlverweigerung schlagen jetzt – wie bei der Wahl 2002 für Ostdeutschland - für die regionale Vertretung negativ zu Buche! Wer nicht wählt, kann nicht repräsentiert werden – und wählt indirekt Radikale! Nachdem feststeht, wie viele Abgeordnetenmandate für eine bestimmte Partei aus welchem Bundesland nach dessen beim Bundeswahlleiter eingereichter Landesliste zu besetzen sind, werden die in diesem Land für diese Partei in den einzelnen Wahlkreisen direkt gewählten Abgeordneten zuerst und auf jeden Fall berücksichtigt: Wahlkreismandat geht vor Listenmandat! Nach Abzug der in einem Bundesland erreichten »Erststimmen-Direktmandate« wird in einem vierten Rechenschritt die der jeweiligen Landesgruppe einer Partei auf Grund des erlangten Zweitstimmenanteils zustehende Anzahl an Parlamentssitzen, bei Bedarf und nach Streichung der erfolgreichen Direktmandatsträger von der Landesliste, durch Listenbewerber ohne direkt errungenes Wahlkreismandat von den Landeslisten nach der dort angegebenen Reihenfolge ergänzt. Auf diese Weise werden nach den 299 Wahlkreis-/Direktkandidaten die 299 restlichen über die Listen ihrer (Landes-)Parteien zu wählenden Parlamentarier bestimmt. Die gewählten Abgeordneten müssen erklären, ob sie die Wahl annehmen. Das ist nicht immer der Fall: Bei der Bundestagswahl 2002 verzichteten vier der gewählten Abgeordneten von vornherein auf die Ausübung des ihnen übertragenen Mandats; an prominentester Stelle der unterlegene Spitzenkandidat Stoiber, der verständlicherweise viel lieber Ministerpräsident in Bayern blieb, denn Oppositionspolitiker in Berlin zu werden. Hätte eine Partei auf einer Landesliste weniger Bewerber aufgestellt, als später Mandate auf ihre Liste entfallen, gingen der jeweiligen Landesliste diese nicht ausgeschöpften Plätze verloren! Sie könnten auch nicht durch Rückgriff auf andere Landeslisten dieser Partei für die Präsenz ihrer Bundespartei im Bundestag ergänzt werden. Die Anzahl der Sitze im Bundestag würde sich um die einer Landesliste so verlorengegangene Anzahl nicht benannter aber nach dem Ergebnis der Wahl an sich erfolgreicher möglicher Bewerber verkleinern. Das ist jedoch noch nie passiert. Aufgeschlüsselt nach Ländern ergab sich 2002 nachfolgendes Wahlergebnis: 134 Überhangmandate Umgekehrt ist es aber wiederholt vorgekommen, dass eine Partei in einem Bundesland durch den Gewinn vieler Direktmandate eine größere Anzahl an Mandaten errungen hat, als ihrer Landesliste nach dem prozentualen Zweitstimmenanteil bei bundesweiter Verrechnung an sich zugestanden hätten. Als ursächlich werden - einzeln oder in einer Kumulierung der nachfolgend aufgeführten Gründe - a) zu klein geschnittener Wahlkreise bei der Wahlkreiseinteilung, b) geringer Wahlbeteiligung im Vergleich zu anderen Bundesländern, c) knapper Erststimmenmehrheiten in mindestens einem Bundesland, d) Stimmensplittings und/oder e) starker Drittparteien, insbesondere dann, wenn die wegen der 5-%-Hürde nicht an der Sitzverteilung nach Hare/Niemeyer teilnehmen – um nur die wichtigsten der sich gegenseitig beeinflussenden Ursachen für das Entstehen eines Überhanges an Mandaten zu nennen – angesehen. Diese zusätzlichen Mandate durfte und darf eine Partei dann als sogenannte "Überhangmandate" behalten, denn ein direkt gewählter Abgeordneter kommt auf jeden Fall in den Bundestag, auch wenn es sich dabei um einen »überproportionalen« Abgeordneten handelt. Das BVerfG entschied 1998: Die Überhangmandate sind eine „notwendige Folge des besonderen Charakters der personalisierten Verhältniswahl“ und (noch) nicht als verfassungswidrig anzusehen, weil der Wahlgrundsatz der Stimmengleichheit nur in „noch hinzunehmender Weise verletzt“ werde. Wie würde das BVerfG die Sachlage aber beurteilen, wenn bei einer knappen Wahlentscheidung einige Überhangmandate den Ausschlag über den Wahlausgang gäben und das Votum der Wähler auf den Kopf stellten, indem der oder die nach erhaltenen Zweitstimmen errechnete/n „Wahlverlierer“ durch einige wenige Überhangmandate die Mehrheit der Sitze im Parlament erhielte/n? 1977 waren die Überhangmandate nur deshalb als noch verfassungsgemäß beurteilt worden, weil das Stimmenverhältnis der acht Bundesverfassungsrichter des erkennenden Senats 4:4 ausgefallen war und bei einer Stimmengleichheit nach dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz (BVerfGG) (noch) kein Verfassungsverstoß festgestellt werden kann. Vier der acht Richter vertraten die Ansicht, dass die Über- 135 hangmandate als „Folge der gesetzgeberischen Entscheidung“ für unser Wahlsystem anzusehen seien, wobei sie dem Gesetzgeber einen „breiten Entscheidungsspielraum“ zubilligten. Gleich viele Richter waren aber der Meinung, dass die Überhangmandate wegen ihres Verstoßes gegen den im Grundgesetz festgelegten Wahlrechtsgrundsatz der Stimmengleichheit einen Verstoß gegen unsere Verfassung darstellen, da Wahlen der Legitimierung der zu wählenden Regierung dienen und die nicht gegen eine Mehrheit der Stimmen nur auf Grund von Überhangmandaten an die Macht kommen dürfe! Bei nur noch 598 Sitzen entspräche z.B. 1 Überhangmandat ungefähr 0,17 Prozentpunkten. Die SPD gewann die Wahl 2002 vor der CDU/CSU mit einem Zweitstimmenvorsprung von nur 6.027 Stimmen; das entspricht 0,01 % der Wähler. Ein Überhangmandat für die CDU hätte also den »Mehrheitswillen« der Wähler »gekippt«. In absoluten Zahlen: Bei 61.432.868 Wahlberechtigten bei der Bundestagswahl 2002 waren bei 598 zu vergebenden Sitzen maximal 102.731 Wählerstimmen erforderlich, um ein Mandat zu erringen; weil nur 48.582.761 Wähler ihr Wahlrecht wahrgenommen hatten, war ein Mandat im Mittelwert mit 81.242 Wählerstimmen zu erringen gewesen. So viele zusätzliche(!) Wählerstimmen war also 2002 ein einziges Überhangmandat »wert« gewesen. Die Koalition aus SPD und Bündnis 90/Die Grünen errang 2002 zusammen 47,1 % der Zweitstimmen, die angestrebte Koalition aus CDU, CSU und FDP kam auf 45,9 %. Das ergibt einen hauchdünnen Vorsprung von nur 1,19 %, der durch 7 Überhangmandate hätte »gekippt« werden können! Und es gab schon Wahlen, in denen mehr als 10 Überhangmandate angefallen waren (1994: 16 / 1998: 13); zum Glück teilweise auch für den politischen Gegner. Ein von den Wählern »unbeabsichtigter« Regierungswechsel allein durch die Überhangmandate ist also nicht unwahrscheinlich: Im Deutschen Bundestag gab es drei Abstimmungen über das Amt des Bundeskanzlers, bei der die Mehrheit auf Überhangmandaten beruhte. Dies waren: am 15.09.1949 die Wahl Konrad Adenauers mit 202 (bei 202 nötigen) Stimmen und einem CDU-Überhangmandat, am 15.11.1994 die Wahl Helmut Kohls mit 338 (bei 337 nötigen Stimmen) und 12 CDUÜberhangmandaten, und am 16.11.2001 die Vertrauensfrage Gerhard Schröders mit 336 Stimmen Zustimmung, bei 334 Stimmen Kanzlermehrheit und davon 10 Überhangmandaten der SPD. Einen »Überhangsmandats-Machtwechsel« hat bei der Schaffung der Überhangmandate niemand gewollt – und kann auch keiner ernsthaft wollen! Vor dieser Gefahr warnt der Parteienforscher Behnke.27 Eine Grundvoraussetzung für ein befriedetes Gemeinwesen ist bei einer Wahl nach dem Verhältnismäßigkeitsprinzip die Kongruenz von Stimmen- und Mandatsanteil: Die Partei mit den meisten Wählerstimmen hat auch die meisten Mandate zu beanspruchen! U.a. darum wird von Einzelnen die Rückkehr zum Einstimmensystem von 1949 gefordert, wo – ohne die Möglichkeit eines Stimmensplittings - die für einen Kandidaten abgegebene Stimme gleichzeitig für seine Partei zählte. Gleichzeitig würde dadurch die Stellung der Wahlkreiskandidaten gestärkt, was die Parteien veranlassen könnte, bei der Auswahl ihrer dem Wähler vorzusetzenden Kandidaten sorgfältiger vorzugehen. Aber die Rückkehr zum ursprünglichen Wahlsystem würde wohl zu Lasten der kleinen Parteien gehen – und die werden als »Mehrheitsbeschaffer« gebraucht, so dass es zu keiner solchen »Rückentwicklung« kommen wird! Durch Überhangmandate kann sich die Anzahl der Sitze im Bundesparlament über die gesetzlich vorgesehen Anzahl hinaus vergrößern. Das spielte bis zur Wiedervereinigung meist so gut wie keine Rolle, denn 27 1949 gab es 2 Überhangmandate (1 CDU, 1 SPD), 1953 dann 3 (2 CDU, 1 DP), Behnke, J.: Ein integrales Modell der Ursachen von Überhangmandaten in: Politische Vierteljahresschrift 1/03 S. 4165 (64) und in Aus Politik und Zeitgeschichte B 52/2003 (22.12.03), S. 21-28 136 1957 ebenfalls 3 (alle CDU), 1961 dann schon 5 für die CDU, 1965-1976 keine, 1980 nur 1 (SPD), 1983 für die SPD 2 und 1987 nur 1 für die CDU. Dann aber 1990 bei der Vereinigungswahl 6 für die CDU, 1994 die bisher höchste Zahl von 16 (12 für die CDU, so dass die CDU/CSU/FDP-Koalition ihre knappe 2-Stimmem-Mehrheit auf einen 10-Stimmen-Vorsprung ausbauen konnte, 4 für die SPD; 8 der 12 Überhangmandate waren in Ostdeutschland entstanden), 1998 alle 13 für die SPD und – bis auf eines in Hamburg – alle in Ostdeutschland und 2002 nach der Wahlkreisreform und der damit verbundenen Angleichung der Wahlkreisgrößen bezüglich der Wahlberechtigten in der 15. Legislaturperiode 5 zusätzliche Sitze durch Überhangmandate: 4 für die SPD und 1 für die CDU; 4 davon wieder in Ostdeutschland durch die unterdurchschnittliche Wahlbeteiligung und den Wegfall der an den Verrechnungsgrenzen – mindestens 5 % der Zweitstimmen oder mindestens 3 Direktmandate - gescheiterten PDS-Stimmen. Durch Überhangmandate entsteht ein vom Verhältniswahlrecht an sich nicht gewolltes »Übergewicht« zugunsten der jeweils begünstigten Partei - ohne Ausgleichsmandate zur Reduzierung dieses unverhältnismäßigen »Übergewichts« für die anderen Parteien vorzusehen. Ein bei einer Bundestagswahl errungenes Überhangmandat ist ein „Störenfried des Proporz“! Ein Ausgleich für mögliche Überhangmandate ist zwar auf Länderebene bei der Wahl für die Landtage von Baden-Württemberg, Bayern, Schleswig-Holstein und der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus geregelt, nicht aber für die Bundestagswahl. Entstehung von Überhangmandaten A) Der »Normalfall« ohne Überhangmandate (bei angenommenen 100 zu vergebenden Sitzen) Partei Partei A Partei B Partei C Gesamt Direktmandate 30 20 0 50 Zweitstimmen in % 46 44 10 Ergänzungsmandate Mandate über Landeslisten insgesamt 16 46 24 44 10 10 50 100 Die Parteien erhalten im Parlament so viele Mandate, wie es ihrem prozentualen Anteil an Zweitstimmen entspricht. Die direkt gewonnenen Mandate werden von dieser Anzahl der einer Partei insgesamt zustehenden Sitze abgezogen. B) Entstehung von Überhangmandaten durch vermehrten Gewinn von Direktmandaten (bei angenommenen 100 zu vergebenden Sitzen) Partei Direktmandate Partei A 48 Partei B Partei C 2 0 Zweitstimmen in % („nur“) 46 44 10 Ergänzungsmanda- Mandate te über Landeslisten insgesamt 48, davon 2 0 Überhangmandate 42 44 10 10 137 Gesamt 50 50 102 Erhält eine Partei mehr Direktmandate, als ihr nach dem Anteil der Zweitstimmen an ProporzMandaten zustehen, behalten die direkt gewählten Abgeordneten auf jeden Fall ihr Mandat. So entstehen auf Grund fehlender Proporz-Mandate die zusätzlichen ausgleichslosen „Überhangmandate". Wichtigste direkte Ursachen für die Entstehung von Überhangmandaten sind: 1. viele in Wahlkreisen – eventuell durch Stimmensplitting(!) - gewonnene Direktmandate, 2. im Verhältnis dazu weniger Zweitstimmen. Nachgeordnete Ursachen sind: 3. unterdurchschnittliche Wahlbeteiligung in einigen Bundesländern (Ostdeutschland!), 4. »fehlerhaft« zugeschnittene Wahlkreise, 5. Reststimmenverwertung im Verhältnisausgleich bei durchschnittlicher Wahlbeteiligung Überhangmandate für eine Fraktion oder Gruppe können jedoch im Laufe einer Legislaturperiode wieder verloren gehen: Scheidet ein direkt gewählter Abgeordneter aus dem Bundestag aus und verfügt die Partei dieses (dann ehemaligen) Abgeordneten in dem betreffenden Bundesland, aus dem der (ehemalige) Abgeordnete stammt, über Überhangmandate, so kann dieser Sitz nicht durch einen Listenkandidaten im Nachrückverfahren erneut besetzt werden. Die Partei des ausgeschiedenen Abgeordneten verliert diesen Sitz im Bundestag. Das hat das BVerfG im Fall eines verstorbenen Abgeordneten 1998 so entschieden. Stimmzettel Sie sollten sich immer(!!!) einen Original-Stimmzettel besorgen! Wahlämter unterstützen Lehrer bei der Einübung der Schüler in staatsbürgerliches Verhalten. Jeder Schüler sollte eine handhabbare Kopie der inzwischen meist über DIN-A-4 großen Formulare zur Verfügung haben. Auf 490 Tonnen weißem Papier 80g/m2 werden die Stimmzettel gedruckt. Dieses Papier muss geordert und nach der Festlegung der Kandidaten durch die zuständigen Parteigremien, die Einreichung der Teilnahmeunterlagen durch die Parteien, soweit sie nicht in einem Landtag oder dem Bundestag mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten sind, und die Überprüfung durch den Bundeswahlleiter bedruckt werden. Bei vorgezogenen Neuwahlen innerhalb der damit verbundenen verkürzten zeitlichen Abläufe ergeben sich große logistische Probleme! Auf dem Stimmzettel wird links jeweils mehr eine Person und rechts jeweils mehr eine Partei herausgestellt. Die Überschriften geben an, dass es sich links um die Wahl des Wahlkreisabgeordneten (Direktkandidaten) und rechts um die Landesliste (nicht Bundesliste, die gibt es nicht!) einer Partei handelt. Der Name des Wahlkreiskandidaten kann auch rechts noch einmal auftauchen. Im rechten Teil sind (meistens) jeweils fünf Namen angegeben, darunter meistens auch der Name mindestens einer Frau - aber nicht immer, weil nicht alle Parteien die Aufstellung einer (böswillig) so genannten Frauenquote beschlossen haben. 138 139 Einer Eintragung im linken oder rechten Block muss nicht eine Eintragung auf der jeweils anderen Seite des Stimmzettels entsprechen, der entsprechende Zeilenplatz im Nachbarfeld kann also frei bleiben. Alle auf den Stimmzetteln aufgeführten Parteien müssen, wenn sie nicht im Bundestag oder in einem der Landtage vertreten sind, durch das »Genehmigungs-Nadelöhr« des vom Bundeswahlleiter geleiteten Bundeswahlausschusses. 2002 hatten sich 47 Parteien und politische Vereinigungen um eine Kandidatur bemüht. 2005 durften letztlich 24 Parteien mit Landeslisten an der Bundestagswahl teilnehmen. Einige Splitterparteien traten dabei nur in einzelnen Ländern an. Dies war bei der Bundestagswahl 2005 nicht anders. Bundeswahlausschuss lässt 34 Parteien antreten Zur Bundestagswahl am 18. September können 34 Parteien antreten. Auch die Linkspartei bekam grünes Licht - trotz juristischem Zweifel wegen umstrittener Listenverbindungen in einzelnen Bundesländern. Ohne Prüfung wurden einstimmig in der öffentlichen Sitzung acht Parteien zugelassen, die entweder im Bundestag sitzen oder in einem Landtag mit mindestens fünf Abgeordneten bereits vertreten sind. Dabei handelt es sich um SPD, CDU, CSU, Grüne, FDP sowie um die Linkspartei - den Zusammenschluss von PDS und WASG - sowie die rechtsextremen Parteien DVU und NPD. Von den weiteren 58 politischen Vereinigungen, die ihre Beteiligung angemeldet hatten, erfüllten nach Ansicht des Wahlausschusses nur 26 die notwendigen Voraussetzungen. Drei weitere zogen ihre Anmeldung zurück. Einigen der Kleingruppierungen wurde die Anerkennung aus formalen Gründen verweigert, weil etwa vorgeschriebene Unterlagen fehlten. Bei anderen gab es massive Zweifel an ihrem Parteienstatus. "Titanic"-Partei darf antreten Zugelassen wurde unter anderem eine "Allianz für Gesundheit, Frieden und soziale Gerechtigkeit", in deren Führung der umstrittene Mediziner und "Vitamin-Guru" Matthias Rath sitzt. In der Sitzung gaben die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) und auch die WASG ihren Rückzug bekannt - ihre Kandidaten treten auf den Listen der Linkspartei an. Zu den Kleingruppierungen mit oft weit unter 100 Mitgliedern, denen die Anerkennung verweigert wurde, gehörten die "Partei der Nichtwähler", eine "Überpartei" oder eine "Bergpartei". Auch die Gruppe "Keine Partei entspricht meinem Wählerwillen" stieß auf Ablehnung. Bundeswahlleiter Johann Hahlen stellte bei einigen Bewerbern die Ernsthaftigkeit der Kandidatur in Frage. Eine Partei, die mit dem Satiremagazin "Titanic" in enger Verbindung steht, wurde aber zugelassen. Nach längerem Hin und Her wurde auch die "Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands" (APPD) anerkannt. Gegen ihre Ablehnung können die Parteien Einspruch einlegen. Ohne Prüfung zur Wahl zugelassen wurden: SPD CDU CSU Bündnis 90/Die Grünen FDP Linkspartei DVU NPD Nach Prüfung wurden zugelassen: Statt-Partei Die Unabhängigen Die Republikaner Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative 140 Die Partei Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale Pro Deutsche Mitte Bayernpartei Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands Feministische Partei Die Tierschutzpartei Bürgerrechtsbewegung Solidarität Die Grauen Deutsche Gemeinschaft für Gerechtigkeit Perspektive 50Plus - Bürger- und Wählerinitiative für Brandenburg Humanistische Partei Ab jetzt... Bündnis für Deutschland Allianz für Gesundheit, Frieden und soziale Gerechtigkeit Deutsche Zentrumspartei Humanwirtschaftspartei Partei Rechtsstaatliche Offensive Partei Bibeltreuer Christen Deutsche Soziale Union Familien-Partei Deutschlands Christliche Mitte Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands (Financial Times Deutschland 12.08.2005) Die Stimmzettel werden damit also je nach Bundesland unterschiedlich groß und fast ebenso lang sein, wie bei der letzten Wahl. § 30 Bundeswahlgesetz Stimmzettel (1) Die Stimmzettel, die zugehörigen Umschläge und die Wahlbriefumschläge (§36 Abs. 1) werden amtlich hergestellt. (2) Der Stimmzettel enthält 1. für die Wahl in den Wahlkreisen die Namen der Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge, bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien außerdem die Namen der Parteien und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem das Kennwort, 2. für die Wahl nach Landeslisten die Namen der Parteien und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, sowie die Namen der ersten 5 Bewerber der zugelassenen Landeslisten. (3) Die Reihenfolge der Landeslisten von Parteien, die im letzten Deutschen Bundestag vertreten waren, richtet sich nach der Zahl der Zweitstimmen, die sie bei der letzten Bundestagswahl im Land erreicht haben. Die übrigen Landeslisten schließen sich in alphabetischer Reihenfolge der Namen der Parteien an. Die Reihenfolge der Kreiswahlvorschläge richtet sich nach der Reihenfolge der entsprechenden Landeslisten. Sonstige Kreiswahlvorschläge schließen sich in alphabetischer Reihenfolge der Namen der Parteien oder der Kennwörter an. Das ist alles gesetzlich geregelt und muss auch gesetzlich unzweideutig geregelt sein. Abschreckendes Beispiel: Missverständliche Stimmzettel mit daraus resultierender Stimmzettelungültigkeit entschieden die US-Präsidentschaftswahl zu Gunsten von Georg W. Bush jun. gegen Al Gore 141 durch eine (teilweise manipulierte) Differenz von 300 Stimmen. Auf dem vorstehend wiedergegebenen Musterstimmzettel ist z.B. der damalige Verteidigungsminister Rühe sowohl Direktkandidat für den Wahlkreis 18 Hamburg-Harburg als auch die Nr. 2 auf der Landesliste der CDU Hamburgs. Das war z.B. deswegen erforderlich, weil im »roten« Hamburg zumeist sämtliche Direktmandate von der SPD gewonnen wurden und wohl auch weiterhin gewonnen werden. Ein Hamburger CDU-Wahlkreiskandidat muss darum noch durch einen vorderen Listenplatz auf der Landesliste seiner Partei abgesichert werden, wenn er sich Hoffnungen machen will, als Abgeordneter in den Bundestag einziehen zu können. (Man kann aber ohne Abgeordnetenmandat Bundesminister werden, wenn der Kanzler einen dazu beruft und vom Bundespräsidenten dazu ernennen lässt: vor der vorgezogenen Neuwahl 2005 hatten vier Minister des Kabinetts Schröder kein Bundestagsmandat inne.) Mit der Erststimme wird gemäß § 5, 2. Satz Bundeswahlgesetz (§ 5, 2. S BWG) ein Wahlkreisabgeordneter nach dem Prinzip der relativen Mehrheitswahl direkt gewählt: Wer die meisten Erststimmen errungen hat, auch wenn es unter 50 % der abgegebenen Erststimmen sind, ist direkt gewählt. [Das höchste Erststimmen-Ergebnis erzielte 2002 der Abgeordnete Ernst Hinksen (CSU) mit 74,6 %, das niedrigste der Abgeordnete Hans Christian Ströbele (B 90/Grüne) mit 31,6 % in dem sehr umkämpften, damals neu gebildeten Berliner Wahlkreis Kreuzberg-Prenzlauer Berg-Friedrichshain gegen annähernd fast gleichstarke Konkurrenten.] Mit der Zweitstimme wird gemäß dem in § 6 BWG näher beschriebenen Verfahren die (in der Reihenfolge ihrer Kandidaten vom Wähler bei Bundestagswahlen nicht beeinflussbare) Landesliste einer Partei im jeweiligen Bundesland des Wählers gewählt. (Darum kann unser Wahlsystem als personalisierte Verhältniswahl mit gebundenen Listen charakterisiert werden.) Der Prozentsatz der Gesamtzahl der erhaltenen Zweitstimmen der nötigenfalls aufaddierten 1 bis höchstens 16 Landeslisten einer Partei (da sollte die Gelegenheit zur Kontrollfrage an Ihre Schüler: „Welche Partei erstellt nur eine Landesliste?“ unbedingt genutzt werden!) – zu einer real gar nicht existierenden und nur für die nachfolgend anzustellende Berechnung und nur gedanklich zahlenmäßig erstellten »Bundesergebnisliste« einer Partei - im Verhältnis zu dem erlangten Prozentsatz der genau so aufaddierten Stimmen für die Landeslisten der konkurrierenden Parteien entscheidet letztlich über den Anteil der Sitze einer Partei im (im Reichstagsgebäude tagenden) Deutschen Bundestag. Abweichungen von dem so ermittelten Ergebnis der Sitzverteilung im Bundesparlament können sich insbesondere durch Überhangmandate ergeben. Bei der Bundestagswahl 2005 gab es zum ersten Mal die Variante, dass der abtrünnige ehemalige SPD-Vorsitzende Lafontain als nordrhein-westfälischer Spitzenkandidat der neu gegründeten, mit der PDS in noch ungeklärtem Verhältnis verbundenen Linkspartei WASG in NRW auftrat und sich gleichzeitig in einem saarländischen Wahlkreis als Direktkandidat bewerben wollte. Der Bundeswahlleiter segnete die Kandidatur in zwei Bundesländern als rechtens ab: Lafontaine will Direktmandat SAARBRÜCKEN ap Der frühere SPD-Chef und frisch gekürte NRW-WASG-Spitzenkandidat Oskar Lafontaine will sich zusätzlich zu seinem NRW-Listenplatz um ein Direktmandat in Saarbrücken bewerben. Das teilten die saarländischen Verbände von WASG und PDS gestern mit. Ein Gegenkandidat für Lafontaine innerhalb des noch zu gründenden Linksbündnisses sei derzeit nicht in Sicht, so die PDS. Nach Angaben des Bundeswahlleiters ist es rechtlich möglich, gleichzeitig für eine Landesliste und für ein Direktmandat in einem anderen Land zu kandidieren. taz Nr. 7697 142 IV. Kandidatenauswahl "Der Zustand der Bundesrepublik liegt zum Teil an der Auslese der politisch führenden Persönlichkeiten. Es sind wahrscheinlich nicht die besten." (Karl Jaspers, Philosoph, 1966) "Die Politiker sind ihr Geld nicht wert." (Erwin Scheuch, Kölner Soziologie-Professor, laut STERN 09.04.92) „Die Abgeordneten glauben, ihre Pflicht schon dann getan zu haben, wenn sie sich gewählt ausdrücken“ (Bert Berkensträter). „Unsere Abgeordneten geben ihr Bestes für das Allgemeinwohl. Mag sein, dass einige etwas naiv sind. Aber wo steht denn, dass für die Übernahme eines Bundestagsmandats ein dreistelliger IQ erforderlich ist?“ (Leserbrief Dr. Matthias Delvo im STERN 33/02) Und der 80-jährige Politologe Hennis fällte 2004 in der Rückschau auf sein langes Forscherleben im Bereich Politische Wissenschaft das Verdikt: „Heute regieren Leichtfertigkeit und Mittelmaß. … Die Malaise heute ist, dass die Politiker nicht mehr die Kenntnis haben, die sie haben müssten. Sie kommen … in den Bundestag und verstehen von nichts etwas – außer davon, wie man im Ortsverein eine Mehrheit organisiert“ (Stern 29.01.04). Soweit Beispiele aus pauschalierenden Politiker-Beschimpfungen. Über die Qualitäten eines längst verstorbenen bayerischen Dorfgastwirts und CSU-MdBs – getreu dem lateinischen Motto „nihil nisi bene“ (über Verstorbene „nichts, wenn nichts Gutes“) ohne Namensnennung - hatte sich DIE ZEIT wegen dessen auffallender geistiger Schlichtheit vor Jahrzehnten einmal dahingehend geäußert, dass sich dessen Anwesenheit im Deutschen Bundestag nur dadurch rechtfertigen lasse, dass in einer größeren Ansammlung von Leuten eben auch solche »geistigen Tiefflieger« anzutreffen seien! Und das kann ich aus eigener Erfahrung an einem Einzelfall nur unterstreichen: Weil ich es aus vielen wohlerwogenen Gründen für verhängnisvoll hielt – und weiterhin für verhängnisvoll halte -, dass eine Mitgliedschaft der asiatischen(!) Türkei in der Europäischen(!) Union auch nur erwogen, geschweige denn in Angriff genommen wird, habe ich 2003/2004 ein halbes Jahr meiner Freizeit geopfert und alles zusammengestellt, was dafür und was dagegen spricht, viele Autoren und (teilweise angebliche) prominente »Meinungsführer« zitiert, mich mit ihren Argumenten auseinandergesetzt und die Befürworter einer Vollmitgliedschaft der Türkei argumentativ widerlegt. Das auf der mir von einer Hamburger Webdesign-Agentur zur Verfügung gestellten Website www.cdq.de oder auf meiner www.Hans-Uwe-Scharnweber.de nachzulesende Ergebnis hatte ich jedem Mitglied des 15. Deutschen Bundestages und jedem deutschen Mitglied des Europaparlamentes zugemailt, um vor der verhängnisvollen Entwicklung zu warnen: Da wird ein Zug ohne funktionierende Bremse auf ein abschüssiges Gleis gesetzt! Neben einer Europaparlamentarierin der Grünen, die mir ihre Ausarbeitung pro Aufnahme der Türkei schickte und die ich auf der angesprochenen Website ebenfalls ins Netz gestellt habe, antwortete der Südosteuropabeauftragte der SPD im 15. Deutschen Bundestag, Jörg Tauss, ein Mann, der laut Selbstdarstellung auf seiner eigenen Abgeordneten-Website als Gewerkschaftsfunktionär mit „mittlerem Bildungsabschluss“ in den Bundestag gekommen ist, aber er antwortete - als wenn wir »auf dem Bau« wären, wo nach einem Wort des ehemaligen hessischen Ministerpräsidenten Börner (SPD) politische Auseinandersetzungen statt mit Argumenten „mit der Dachlatte ausgetragen“ wurden - in einer rüpeligen, ehrabschneidenden und ausgesprochen dümmlichen Weise, weil ich hinsichtlich des drohenden EU-Beitritts der Türkei nicht seine Ansichten teile. Statt auch nur eines einzigen bedenkenswerten, vielleicht sogar überzeugenden Sachargumentes, das es nach nicht nur meinem Dafürhalten aber nicht gibt, wurde er angreiferisch und „persönlich“: Er glaube nicht, dass ich durch ein Doppelstudium Historiker, Fachlehrer für Politik und Volljurist und aus meinem Engagement für die deutsche Wiedervereinigung und Einheit 16 Jahre lang SPDMitglied28 und SPD-Wähler gewesen sei. Als ich mich gegen Tauss’ diffamierende Unterstellungen 28 bis ich nach siebeneinhalb Jahren Doppelagententätigkeit für das Hamburger Landesamt für Verfassungsschutz zur Verhinderung eines zweiten Falles Guillaume an Kanzler Helmut Schmidt (unter Aufopferung meiner Beamtung auf Lebenszeit zur Aufnahme des vom MfS gewollten juristischen Zweitstudiums, um in ein Bundesministerium oder das Bundeskanzleramt eingeschleust werden zu können) wegen der Behandlung durch die Hamburger SPD in dieser Sache unter Protest aus der SPD ausgetreten war, weil ich - statt 143 verwahrte, ihm aus politischer Zielsetzung etwas vorgelogen zu haben, zu dem Persönlichen auf den SPIEGEL-Artikel (39/85, S. 103 ff) über mein (Teil-)Schicksal: „Würdest du eine Bonner Sekretärin heiraten?“ verwies, anhand dessen er meine Angaben in der Bibliothek des Deutschen Bundestages sofort und sehr leicht hätte überprüfen können, und ihm zum Sachlichen sagte, dass es meiner Auffassung nach kein letztlich durchschlagendes(!) Argument für einen Beitritt der Türkei zur EU gebe, beschimpfte er mich als u.a. „Späth-Freund“ und dass mein Fall zeige, dass es nicht um jeden schade sei, der die SPD verlassen habe (und darum seit 1985 in Hamburg die CDU gewählt hat, bis ich den Machtwechsel mit herbeiführen konnte, denn wer seine eigenen Agenten ohne jeden Pfennig Geld in jahrelange Prozesse treibt, damit sie ihre für den Staat und unsere Demokratie aufgeopferte bürgerliche Existenzgrundlage zurückerhalten, darf keine Regierungsmacht übertragen bekommen!!!). Wenn er das Urteil, es sei nicht um jeden schade, der die SPD verlassen habe, über seinen ehemaligen Parteivorsitzenden Lafontaine gesagt hätte, hätte ich ihm aus Überzeugung zustimmen können; aber mir - trotz des Hinweises auf den SPIEGEL-Artikel - so etwas zu bieten, wo ich nach der Kenntnis der Nazi-Verbrechen als äußerst engagierter, zum Engagement für unsere Demokratie aufrufender und selber dazu bereiter Politiklehrer [der bereit war, das auch bei größter persönlicher Belastung (im Geheimen) seinen Schülern vorzuleben, wozu zu erziehen er sich als Politiklehrer sehr engagiert bemüht hatte] und guter SPD-Parteisoldat versucht hatte, unter Einsatz von Freiheit (Möglichkeit mehrjähriger Haft in einem Stasi-Gefängnis nach Aufdeckung meiner Doppelagententätigkeit), Gesundheit (die Haftumstände mit den Arbeitsnormen in den DDR-Gefängnissen waren, wenn man es verhalten formuliert, »gesundheitsabträglich«) und Eigentum (jahrelanger Gehaltsverzicht und geschmälerte Pension) den SPD-Kanzler Helmut Schmidt vor dem Verrat zu bewahren, der seinen Vorgänger das Amt gekostet hatte, empfand ich als bodenlose Unverschämtheit. Ich empfinde es dagegen eher als Auszeichnung, von ihm (diffamierend gemeint) als „Späth-Freund“ tituliert worden zu sein. Und außerdem bedachte Tauss in seiner Dämlichkeit nicht, dass u.a. auch Helmut Schmidt als Grandseigneur der SPD in dem Punkt EU-Beitritt der Türkei meine Ansichten teilt; und nicht seine. Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil. Darum antwortete ich Tauss, dass ich nach seinen Mails seine Selbstdarstellung auf seiner Abgeordneten-Website mit der „mittleren Bildung“ unbedingt glaube: Leider habe er sich bisher nur den unteren Teil der Bildung bis zur Mittleren Reife hin erarbeitet; ausweislich seiner diffamierenden Mails fehle der obere Teil einer für die Tätigkeit als Abgeordneter wünschenswerten vollständigen Bildung noch. Außerdem sei er selten dämlich, mich in diffamierender Absicht einen „SpäthFreund“ zu titulieren, da ich mich erstens bei Späth, Schmidt u.a. in besserer intellektueller Gemeinschaft befinde als er mit seinen nicht zu Ende gedachten Argumenten und er zweitens nach seiner mir entgegengehaltenen Logik als „Kohl-Freund“ tituliert werden müsste!!! Damit hatte ich ihm dann doch sein zu großes Maul gestopft! Aber das ein MdB so wenig Bildung, Menschenverständnis und intellektuelle Fähigkeiten hat, situationsangemessen eine Mail zu beantworten, gab mir zu denken! eines einfachen Danks oder gar eine in Hamburg zur Ehrung besonderen Engagements vorgesehene Auszeichnung für „treues Dienen“ oder ein Bundesverdienstkreuz erhalten zu haben - weitere siebeneinhalb Jahre gegen den Hamburger Staat auf Wiedereinstellung als Lehrer hatte klagen müssen (SPIEGEL 39/1985 S. 103 ff: „Würdest du auch eine Bonner Sekretärin heiraten?“), so dass ich wegen der fehlenden 15 Jahre Dienst als Lehrer in einem Jahr nur über eine sehr geschmälerte Pension werde verfügen können! „Sozial gerecht handeln Menschen, wenn sie bereit sind, in das Gemeinwesen all das einzubringen, was um des Gemeinwohls willen notwendig ist, ob es gesetzlich vorgeschrieben ist oder darüber hinaus geht.“ Karl Kardinal Lehmann (Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz ) Auf Grund meiner leidvollen Erfahrungen als Rechtsanwalt in eigener Sache sehe ich nunmehr vorgelagert nicht so sehr das Problem des Politiklehrers: „Wie veranlasse ich Menschen zum Engagement für unsere staatliche Gemeinschaft?“, sondern als (ehemaliger) Rechtsanwalt das an die bürgerliche Existenz des Einzelnen gehende oder existenzvernichtende Problem: „Wie schützt man einen zum (übergroßen) Engagement für unseren Staat bereiten Bürger vor eben diesem Staat?“ 144 An diesem hier ausgebreiteten persönlich erlebten Beispiel habe ich ganz persönlich erfahren, was für dümmliche »geistige Hau-draufs« es in den Deutschen Bundestag schaffen, weil sie sich als einzige Qualifikation in ihrem Ortsverein eine Mehrheit in ihrem Parteizirkel zu verschaffen verstanden haben, von den Schicksalsfragen Deutschlands und der EU aber nicht allzu viel verstehen und – wo »geistige Führerschaft« erforderlich wäre - noch nicht einmal das geistige Format haben, die ihnen dargelegten Argumente überhaupt nachzuvollziehen, geschweige denn argumentativ zu entkräften; was ja auch nicht geht, da es kein letztlich durchschlagendes Argument für, aber viele schlüssige Argumente gegen eine EU-Mitgliedschaft der Türkei gibt! Wenn es trotz Barschel- und anderer Skandale noch eines weiteren Beweises für das unzureichende politische Gespür, das mangelnde politische Verantwortungsgefühl, ja die Verantwortungslosigkeit und die teilweise erbärmliche intellektuelle geistige und charakterliche Ausstattung mancher Politiker im Bundesparlament und in Länderparlamenten bedurft hätte, dann wurde er nach der Landtagswahl in Sachsen 2004 durch einen absoluten demokratischen Tabubruch geliefert, als zwei Abgeordnete aus dem demokratischen Lager – höchstwahrscheinlich von der CDU, die den Stimmenverlust ihrer bisher mit absoluter Mehrheit regiert habenden Partei nicht verkraftet hatten – statt ihren eigenen Ministerpräsidentenkandidaten zu wählen, in zwei Wahlgängen den Gegenkandidaten der NPD gewählt hatten! Weil die verweigerten Stimmen an der absoluten Mehrheit fehlten, konnte der CDU-Ministerpräsident Milbradt erst im dritten Wahlgang mit relativer Stimmenmehrheit gewählt werden! Dieses Verhalten kommentierten die Nürnberger Nachrichten mit den Worten: „Gefährliche ’U-Boote’ Sachsen: Stimmen für die NPD schaden Deutschland Wie dumm muss man als Abgeordneter einer demokratisch gesinnten Partei eigentlich sein, um dem NPD-Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten seine Stimme zu geben? Da mögen die Rachegelüste gegenüber dem Amtsinhaber und die persönliche Enttäuschung über geplatzte Karriereträume noch so groß sein: Über das Votum für einen Rechtsextremen sollte man trotzdem nicht einmal nachdenken, geschweige denn das Kreuz hinter seinem Namen machen. Schließlich gibt es auch noch die Möglichkeit der Enthaltung oder der Nein-Stimme. Die beiden Abweichler, woher sie auch immer kommen mögen, haben ihrer sächsischen Heimat großen Schaden zugefügt. Schlimm genug war schon der Wahlerfolg der NPD, die mit 9,2 Prozent im Freistaat fast so stark wurde wie die SPD. Und nun die kaum für möglich gehaltene Steigerung: Die geistigen Brandstifter sitzen also nicht nur im Parlament, sie werden auch noch mit mehr Stimmen gewählt, als ihre Fraktion vorweisen kann. Die Grüne Antje Hermenau hat Recht, wenn sie sagt, dass diese Ministerpräsidentenwahl alle Ausgrenzungsversuche gegenüber der NPD zunichte macht. … HARALD BAUMER“ (Nürnberger Nachrichten 11.11.04) Und andere Zeitungskommentare sekundierten: „In einer hämischen Presseerklärung boten die Anti-Demokraten gestern den "politisch heimatlos gewordenen Abgeordneten die parlamentarische Zusammenarbeit" an. Entsprechend groß war das Entsetzen beim Stehempfang nach der trotz dieses moralischen Debakels durchgezogenen Wahl des sächsischen Ministerpräsidenten. "Ein Tag, an dem Demokraten Faschisten wählen, markiert einen Wendepunkt", sagte Sozialdemokrat und Alterspräsident Cornelius Weiss der WELT“ (DIE WELT 11.11.04). „Wer aus parteitaktischen Spielchen oder aus Frust die neuen Nazis stärkt, zerstört Demokratie. Wer mit dem Feuer spielt, anstatt es zu löschen, darf sich nicht wundern, wenn dem Parlamentarismus und den demokratischen Parteien Zustimmung und Anhänger abhanden kommen“ (FR 11.11.04). „Ihre Erfolge verdankt die Partei dort und anderswo daher ebenjenem Muster, das jetzt zwei Politiker demokratischer Parteien im Landtag salonfähig gemacht haben: Wenn’s grad in den 145 Kram passt, stimmt man auch mal rechtsextrem. Das untergräbt den Konsens: Wer achtlos NPD wählt, handelt nicht besser, als wer es absichtsvoll tut“ (taz 11.11.2004). Diese auf die »U-Boot-Landespolitiker« bezogenen Urteile gelten natürlich »cum grano salis« auch bei Bundestagswahlen für Wähler und eventuelle Abgeordnete rechtsradikaler Parteien! Natürlich ist die Anfang dieses Kapitels mitgeteilte, meist professorale Schmähkritik an Abgeordneten wie die vorstehend zitierten Stimmen zu pauschal und trifft längst nicht auf jeden Abgeordneten zu. Im Deutschen Bundestag sitzen ja auch höchstqualifizierte Politiker wie z.B. Professoren, die nachgewiesen haben, dass sie etwas von ihrem Fach verstehen, oder die ehemaligen Regierungschefs des Bundeslandes Hamburg, Klose und Runde. Am letzteren Beispiel festgemacht: Wer in der Lage war, ein Bundesland zu führen, der hat seine Qualifikation für eine Abgeordnetentätigkeit im Deutschen Bundestag grundsätzlich nachgewiesen – wenn er nicht die Bodenhaftung völlig verliert und wie Scharping handelt! Aber es sitzen leider auch zu viele andere als Möchtegern-Politiker oder Lobbyisten im Bundesparlament. Auf die zielen die professoralen Verrisse. Die Kandidaten für einen Sitz im Deutschen Bundestag müssen zur Wahrnehmung des „passiven Wahlrechts“, sprich: um gewählt werden zu können, zum Zeitpunkt der Wahl also nur noch volljährig sein (bei der Landtagswahl in Hessen dagegen muss ein Kandidat ein Mindestalter von 21 Jahren erreicht haben), nicht aber unbedingt vollsinnig; doch das werden sie schon sein, ohne dass Kandidaten einen IQ-Test absolvieren müssen. Früher bestand für die Wahrnehmung des passiven Wahlrechts zum MdB eine sehr sinnvolle Altersgrenze von 25 Jahren; die wieder eingeführt werden sollte! Die Aufstellung der Kandidaten, die eine echte Chance haben, in den Bundestag gewählt zu werden, ist die Visitenkarte einer Partei und eine wesentliche Vorentscheidung über die Zusammensetzung und die Qualität des Parlaments. Auf Delegiertenversammlungen wird um die aussichtsreichen Plätze heftig gerungen. Das sollte nach den Grundsätzen innerparteilicher Demokratie geschehen, geschieht aber nicht immer mit demokratischen Mitteln. Bundesweit bekannt wurden die Praktiken innerhalb der Münchner Ortsgruppe der CSU bei der Aufstellung von Kandidaten für ein örtliches Gremium: „Für den Beitritt zur CSU und ein bestimmtes Abstimmungsverhalten seien bis zu 500 Euro gezahlt worden. Alle an den Manipulationen Beteiligten hätten gewußt, daß Frau Hohlmeier an der Spitze einer Befehlskette gestanden habe. Der 24 Jahre alte Zeuge ist wegen der Unregelmäßigkeiten bei der Mitgliederaufnahme - zusammen mit anderen JU-Funktionären - zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Vor dem Untersuchungsausschuß hatten drei Staatsanwälte seine Angaben zur Rolle von Frau Hohlmeier als glaubwürdig bezeichnet. Der Zeuge blieb auch bei seiner Darstellung, daß er ein Telefonat mitgehört habe, in dem Frau Hohlmeier ausführlich über den Mitgliederkauf informiert worden sei.“ (DIE WELT 15.04.05) Die Strauß-Tochter musste von ihrem Amt als Kultusministerin zurücktreten. Die von den Parteien getroffene Kandidatenvorauswahl an Sach- und Personalkompetenz wird dann dem Wähler am Wahltag »in der Wahl nach der Vorauswahl« in einer »Wahl ohne Auswahl«, so der Verwaltungsrechtler von Arnim (Die Welt 21.06.02), zur Abstimmung präsentiert. Wegen des mehr oder weniger parteifixierten Wählerverhaltens sind rund 90 % der präsentierten Kandidaten von vornherein gewählt. Sie stehen schon vor der Bundestagswahl allein durch ihre Nominierung als Kandidat entweder in einem sicheren Wahlkreis oder auf einem der vorderen Plätze auf der Landesliste ihrer Partei fest, auch wenn sie nach ihrer Nominierung, aber noch vor der Wahl politisch untragbar geworden sein sollten, wie die beiden damals amtierenden Bundesminister Scharping (Verteidigung) und Däubler-Gmelin (Justiz) kurz vor der Bundestagswahl 2002, die wegen eines je eigenen Skandals ihre Posten aufgeben mussten, gleichwohl aber als bei der vorangegangenen Nominierung amtierende Bundesminister durch Absiche- 146 rung auf einem der vorderen Plätze auf der Landesliste ihrer Landesparteiorganisation wieder in den 15. Deutschen Bundestag einziehen konnten. Der durch die „Wahl vor der Wahl“ größtenteils entmündigte Wähler legitimiert also überwiegend eine von kleinen Zirkeln getroffene Vorauswahl und stimmt meist nur noch über die unbestimmten 10 % der Bewerber ab. Aber an denen entscheidet sich eventuell die Frage, welche Partei/en die Regierungsbildung übernehmen darf/dürfen. In der »Wahl vor der Wahl« werden die parteiinternen Bewerber um die vom Wahlgesetz vorgesehenen 598 Bundestagsmandate von rund einem Zehntel der ca. 2 Mill. Parteimitglieder vorsortiert - wobei es nicht immer mit rechten Dingen zugehen muss und deswegen schon gerichtliche Auseinandersetzungen um die Nominierung stattfanden -, so dass dann in den Wahlkreisen und auf den Landeslisten der 43 zur Wahl 1998 zugelassenen Parteien noch 5.062 Kandidaten, davon 1.408 Frauen, übrig blieben; zur Wahl 2002 waren nur noch 31 Parteien zugelassen, von denen 24 dann schließlich antraten. Sie stellten 3542 Kandidaten auf, davon 1028 Frauen (was über alle Parteien gerechnet einem Frauenanteil an den Kandidaten von 29 % entspricht). Diese Auswahl geschieht nicht vorrangig nach Ranküne innerhalb der Parteiorganisation, aber leider auch nicht unbedingt nach beruflicher Qualifikation. Von einem in seinem zivilen Beruf als Kneipenwirt tätig gewesenen Abgeordneten der CSU schrieb die ZEIT einmal: „Seine Anwesenheit in diesem Gremium läßt sich nur damit rechtfertigen, daß in einer großen Gruppe auch immer solche Menschen vertreten sind.“ Es entscheiden also nicht einmal 0,3 % der Bevölkerung, worüber 62 Mill. Wahlberechtigte am Wahltag abstimmen. Der ehemalige CSU-Abgeordnete Dr. Riedel sagte einmal: "80 engagierte CSU-Leute bestimmen, wer 200.000 Wahlberechtigten im Wahlkreis angeboten wird." Und darin kann ein Fehler im System liegen. Vielleicht wären „Primaries“ in der Art, wie sie in den USA abgehalten werden und eine größere Beteiligung der Parteimitglieder oder der Wahlberechtigten eines Stimmbezirkes ermöglichen, sinnvoller, denn durch die Macht der Parteigremien kämen „die bravsten Parteisoldaten, die schlimmsten Schwätzer, die am Schluss im Ortsverein immer die Fenster zu- und das Licht ausmachen“ auf die vorderen und damit sicheren Listenplätze, lautet das Resümee des SPIEGEL (26.05.03), der deswegen in seiner Artikelserie über die Schwachstellen unserer Demokratie für eine Abkehr vom Verhältnis- und eine Hinwendung zum Mehrheitswahlrecht plädiert. Die Gefahr für uns alle: Je jünger und je unqualifizierter die MdBs letztlich sind, über je weniger Wissen und Problemlösungskompetenz sie verfügen, desto größer ist der Kompetenzverlust des Parlaments gegenüber Verbändewissen und einer hochspezialisierten Ministerialbürokratie und sogar des einzelnen Abgeordneten gegenüber dem Herrschaftswissen seiner eigenen Parteiführung durch deren wissenschaftliche Apparate. Das erhöht die Manipulierbarkeit von Abgeordneten: Wer nichts oder nicht genügend weiß, muss zuviel glauben! Er ist verführbar durch jede nicht zu dick aufgetragene kaschierte Lüge und - vermutlich noch wesentlich gefährlicher – jede interessegeleitet verbreitete Halbwahrheit, jedes vielleicht auch noch »wissenschaftlich« verbrämte Vorurteil. Durchaus mühsam erarbeitetes Wissen und die Fähigkeit zur Zusammenschau sind die Voraussetzungen für differenziertes und kreatives Denken, das seinerseits erforderlich ist, um in immer enger werdenden finanziellen Spielräumen sachangemessene Lösungen zu finden und - falls notwendig „nur ihrem Gewissen unterworfen“ (Art. 38 I 2 l. HS GG) sogar mit nicht immer karriereförderlichem Rückgrat gegenüber der eigenen Parteiführung - politisch gestaltend tätig werden zu können. Darin besteht die Aufgabe der Abgeordneten, dafür wählen wir sie! Die Auswahl der Kandidaten wird vermutlich auch durch die Mitgliederstruktur einer Partei bestimmt. Ich vermute: Je jünger der Altersmittelwert der Mitglieder einer Partei, desto jünger der Altersmittelwert der Kandidaten. Da könnte sich in naher Zukunft eine Wende ergeben, denn die Parteien vergreisen, jedenfalls die Volksparteien. Die politische Reformfreudigkeit des Parlamentes wird durch diese Entwicklung vermutlich nicht gestärkt werden. Der Politikwissenschaftler Niedermayer hat die Entwicklung der Altersstruktur der Parteien untersucht und kam zu dem Ergebnis: Die Mitglieder der deutschen Parteien werden immer älter. Der Anteil der über 60-Jährigen liegt inzwischen bei deutlich über einem Drittel. Schon bald wird jedes 147 zweite Parteibuch bei SPD, CDU und CSU einem Menschen jenseits des 60. Lebensjahres gehören - sofern sich die Entwicklung der vergangenen Jahre fortsetzt. 1993 betrug der Anteil der unter 60-Jährigen bei der CDU 31,7 %, Ende 2003 war er auf 45,7 % gestiegen. Noch dramatischer verlief die Entwicklung bei der SPD. Dort waren Ende 1993 (nur) 26 % der Mitglieder über 60 Jahre alt, Ende 2003 hingegen hatte sich der Prozentsatz auf 42,2 % verändert und damit dem der CDU ziemlich angenähert. Ähnlich verläuft die Entwicklung innerhalb der CSU-Mitgliedschaft. »Jüngste« Partei ist dieser Untersuchung zufolge die FDP, bei der sich der Anteil der unter 30-Jährigen auf 11,7 % beläuft; der entsprechende Wert beträgt bei der CSU 5,9 Prozent, der CDU 5,4 Prozent und bei der SPD 4,6 Prozent. Ursächlich dafür mag - neben der allgemeinen Entwicklung der Demographie in der Bundesrepublik - sein, dass es jungen Menschen zu mühselig ist, sich langjährig für ihnen zu »trockene« Parteiarbeit zu engagieren – und dann jahrelang auf ihre Chance warten zu müssen. In der SPD drängen daher bei der absehbaren Wahlschlappe 2005 die Jungen, die den Wiederaufbau leisten müssen, nach vorne; jedenfalls scharren sie schon vernehmlich mit den Hufen, was alte und altgediente Posteninhaber um ihre Pfründe zittern lässt. Das wird in den anderen Parteien auch noch kommen, wenn der Sieg nicht mehr so glanzvoll ausfällt und sich Alte und Junge um die weniger werdenden Plätze streiten müssen. Aufstellung der Wahlkreiskandidaten Die Vorbereitungen der Parteien auf die Bundestagswahl durch die Auswahl ihrer jeweiligen örtlichen Wahlkreiskandidaten, der innerparteiliche Kampf um den Posten als örtlicher Wahlkreiskandidat, beginnt ca. eineinhalb Jahre vor dem Wahltermin. Vor der überraschenden Ankündigung von vorgezogenen Neuwahlen am 22.05.05 hatten daher schon langsam die (normalen) Vorbereitungen auf den Wahltermin 2006 begonnen: Volker Rühe tritt nicht mehr an Bundestag: Harburgs CDU-Kreischef Fischer könnte Ex-Verteidigungsminister ersetzen. Eine Ära geht zu Ende: Ex-Bundesverteidigungsminister Volker Rühe will nach 29 Jahren im Bundestag nicht wieder für das Parlament kandidieren. Rühe begründete seinen Rückzug damit, daß er mit seinen außenpolitischen Positionen in der CDU "isoliert" sei. Allerdings dürfte auch eine Rolle gespielt haben, daß Rühe in der Hamburger CDU kaum noch verwurzelt war und sein Rückhalt immer schwächer wurde. Noch ist offen, wer sich statt Rühe für die CDU um das Direktmandat im Wahlkreis 24 (HarburgBergedorf) bewerben wird. Als möglicher Kandidat gilt der Harburger Kreischef Ralf-Dieter Fischer. Auch dem langjährigen CDU-Bürgerschaftsabgeordneten und früheren Sprinkenhof-Chef Karl-Heinz Ehlers werden Ambitionen nachgesagt. Spannend wird es auch im CDU-Kreisverband Altona-Elbvororte, wo sich ein Zweikampf im Wahlkreis 20 abzeichnet. Der CDU-Kita- und Jugendexperte Marcus Weinberg hat sich bereiterklärt, nach 2002 zum zweiten Mal ins Rennen zu gehen. Zuvor hatte die Blankeneser CDU die Wirtschaftsjuristin Karin Prien als Bewerberin nominiert. Die Altonaer CDU entscheidet über den Bundestagskandidaten auf einer Mitgliederversammlung, auf der spontan auch noch weitere Kandidaten antreten können. Auch in der Eimsbütteler CDU ist noch nicht geklärt, wer im Wahlkreis 21 antreten soll. Die Bürgerschaftsabgeordnete und Wirtschaftsexpertin Barbara Ahrons, die bei der vergangenen Bundestagswahl erfolglos in Eimsbüttel antrat, will sich erneut um die Kandidatur bewerben. "Ich rechne aber damit, daß auch andere antreten wollen", sagte sie dem Abendblatt. 148 Als unumstritten gilt, daß in den drei restlichen Wahlkreisen erneut die derzeitigen Bundestagsabgeordneten kandidieren: Antje Blumenthal im Wahlkreis 19 (Mitte), CDU-Landeschef Dirk Fischer im Wahlkreis 22 (Nord) sowie Jürgen Klimke im Wahlkreis 23 (Wandsbek). Bei der SPD ist die Kandidatenkür in zwei Wahlkreisen umkämpft. In Nord bewerben sich drei Sozialdemokraten: Als aussichtsreichster Bewerber gilt Bezirksamtsleiter Matthias Frommann, der gegen Martin Gödde und Christian Christiansen antritt. Nach der Vorziehung der Bundestagswahl dürften Frommanns Chancen als erfahrenster Bewerber eher noch gestiegen sein. In Eimsbüttel konkurrieren der ehemalige Juso-Chef Niels Annen und Ex-Bürgerschaftspräsidentin Dorothee Stapelfeldt. Annen spielt in der Bundespartei eine wichtige Rolle, ist aber in Hamburg bisher eher unbekannt. Er fordert einen Generationswechsel in der Partei und steht für linke Positionen wie die Erhöhung der Erbschaftsteuer. Stapelfeldt ist vor allem in Hamburg bekannt. "Ich bin seit 20 Jahren in Eimsbüttel verwurzelt und will die Eimsbüttler Interessen in Berlin vertreten", sagt sie. Stapelfeldt hätte als einzige Frau einen sicheren Listenplatz, weil die SPD im Wechsel Männer und Frauen nominiert. Als unumstritten gilt, daß die Bundestagsabgeordneten Ortwin Runde in Wandsbek, Johannes Kahrs in Mitte und Olaf Scholz in Altona wieder antreten. Nach anfänglicher Kritik ist auch die erneute Kandidatur von Ex-Bürgermeister Hans-Ulrich Klose in Harburg-Bergedorf ungefährdet, der dem Bundestag seit 22 Jahren angehört. pum/jmw HH A 24.04.05 Klose und Mertens geraten unter Druck Wahl: Kritik an SPD-Kandidaten für den Bundestag: zuwenig Wahlkreisarbeit - zu blaß. Bei den SPD-Kandidaten für die Bundestagswahl 2006 zeichnet sich ein Generationswechsel ab. Der Stuhl von Ex-Bürgermeister Hans-Ulrich Klose - seit 22 Jahren Abgeordneter im Wahlkreis 24 (Harburg-Bergedorf) - wackelt. Auch die erneute Kandidatur der Eimsbütteler Bundestagsabgeordneten Angelika Mertens, der Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium, ist fraglich geworden. Nach Informationen des Abendblatts ist in Harburg-Bergedorf eine komplizierte Gemengelage entstanden. Das liegt zunächst an Hans-Ulrich Klose selbst. Ursprünglich hatte er seinen Parteifreunden bedeutet, nicht noch einmal antreten zu wollen. Doch bei einem ersten Gespräch mit den Kreisvorständen von Harburg und Bergedorf hat der Ex-Bundestags-Fraktionschef durchblicken lassen, daß er sich doch nach wie vor für den Geeignetsten hält. Die Klose-Kritiker werfen dem Außenpolitik-Experten vor, zuwenig Wahlkreisarbeit zu leisten. Überdies sei sein politischer Stern in Berlin gesunken, seit er sich beim Thema Irak-Krieg gegen Bundeskanzler Gerhard Schröder gestellt hat. Außerdem wird Klose zum Zeitpunkt der Bundestagswahl 69 Jahre alt sein. Andererseits: An der Parteibasis genießt er nach wie vor große Sympathien. Die Lage wäre vermutlich einfacher, wenn es eine klare Alternative zu dem prominenten SPDMann gäbe. Noch kursieren mehrere Namen: Der Bergedorfer Bezirksamtsleiter Christoph Krupp, der SPD-Vorsitzende Ties Rabe und das Landesvorstandsmitglied Christel Oldenburg aus Bergedorf zählen ebenso dazu wie der Harburger SPD-Chef Frank Richter oder die Bürgerschaftsabgeordneten Wolfgang Marx und Sabine Boeddinghaus. In Eimsbüttel könnte es für Staatssekretärin Mertens nach zwölf Jahren im Bundestag eng werden. Manchen Parteifreunden gilt die Abgeordnete als zu blaß. Vorstellbar ist, daß die stellvertretende SPD-Landesvorsitzende und frühere Bürgerschaftspräsidentin Dorothee Stapelfeldt oder die Vize-Kreischefin Carola Ensslen an ihre Stelle tritt. Sollten sich die Eimsbütteler wieder für eine Frau entscheiden, hätte das einen strategischen Vorteil: Auf der Landesliste würde sie weit oben landen, weil hier Männer und Frauen im Wechsel plaziert werden. Wie berichtet, bewerben sich im Wahlkreis 22 (Nord-Wandsbek) drei Männer um die Nachfolge der gestorbenen Bundestagsabgeordneten Anke Hartnagel: Bezirksamtsleiter Matthias Frommann, SPD-Kreisvize Martin Gödde sowie Christian Carstensen, früherer Referent von ExBausenator Eugen Wagner. Die Abgeordneten Ortwin Runde (Wandsbek), Olaf Scholz (Altona) und Johannes Kahrs (Mitte) gelten als ungefährdet. pum (HH A 08.04.05) 149 Annen tritt gegen Stapelfeldt an Bundestagswahlkampf: Kommt es in der Eimsbütteler SPD zur Kampfkandidatur? In der Eimsbütteler SPD zeichnet sich eine Kampfkandidatur für die Bundestagswahl 2006 ab: Die frühere Bürgerschaftspräsidentin und stellvertretende Landesparteichefin Dorothee Stapelfeldt will nach Informationen des Abendblatts für den Wahlkreis 21 kandidieren. Gegen die Kunsthistorikerin wird voraussichtlich Bundesvorstandsmitglied Niels Annen, Ex-Bundeschef der Jusos und Vorsitzender der Hamburger Schülerkammer, antreten. Wie berichtet, hatte es in der Eimsbütteler SPD Bedenken dagegen gegeben, daß die jetzige Bundestagsabgeordnete Angelika Mertens, die den Wahlkreis 2004 direkt holte, nach zwölf Jahren im Bundestag noch einmal kandidiert. Mertens, die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium ist, dürfte auf eine erneute Kandidatur verzichten. Sollte sich Stapelfeldt gegen Annen durchsetzen, hätte das für die Eimsbütteler SPD einen strategischen Vorteil: Als einzige Frau hätte Stapelfeldt einen sicheren Listenplatz, weil Männer und Frauen im Wechsel plaziert werden. Dagegen zeichnet sich im Wahlkreis 24 (Harburg-Bergedorf) Kontinuität ab: Die erneute Kandidatur von Ex-Bürgermeister Hans-Ulrich Klose - seit 22 Jahren im Bundestag - gilt als sicher. Zunächst gab es Bestrebungen in den Parteikreisen, Klose zum Verzicht zu bewegen, um einen Generationswechsel einzuleiten. Klose wird zum Zeitpunkt der Wahl 69 Jahre alt sein. Doch jetzt überwiegt die Einschätzung, daß die Popularität des Politikers in dem knappen Wahlkreis entscheidend sein könnte. Im Wahlkreis 22 (Nord/Wandsbek) gibt es drei SPD-Bewerber: Aussichtsreichster Kandidat ist Nord-Bezirksamtsleiter Matthias Frommann. Auch die beiden Konkurrenten Martin Gödde und Christian Carstensen kommen aus dem SPD-Kreis Nord, was zu leichten Verstimmungen bei den Wandsbeker Parteifreunden geführt hat, die sich übergangen fühlten. Als völlig ungefährdet gelten die erneuten Kandidaturen von Ex-Bürgermeister Ortwin Runde (Wandsbek), Johannes Kahrs (Mitte) und Olaf Scholz (Altona). pum (HH A 21.04.05) Bundestag: SPD-Kandidaten stellen sich vor Die SPD Eimsbüttel wird erst nach der Sommerpause entscheiden, wer für sie 2006 als Bundestagskandidat antritt. Am 18. Mai werde der Kreisvorstand den genauen Zeitplan erarbeiten, sagte Kreischef Jan Pörksen gestern. Am späten Freitag abend hatte die bisherige Bundestagsabgeordnete und Verkehrs-Staatssekretärin Angelika Mertens dem Kreisvorstand offiziell mitgeteilt, daß sie nicht wieder antreten werde. "Angelika Mertens hat viel für Hamburg und für Eimsbüttel erreicht", sagte Kreischef Pörksen. Ihr Interesse an der Eimsbütteler Bundestagskandidatur meldeten offiziell die frühere Bürgerschaftspräsidentin Dorothee Stapelfeldt (49) und der frühere JusoBundeschef Niels Annen (32) an, der auch Mitglied des SPD-Bundesvorstands und der Programmkommission ist. Die Kandidaten sollen sich nun in den Eimsbütteler Distrikten vorstellen. jmw (HH A 25.04.05) Herrlich, rot und frauenfrei Durchmarsch der Männer in den Bundestag sorgt für Diskussionen in der Hamburger SPD. Angeblich ist niemand daran schuld, aber wiederholen soll sich so was möglichst nicht. Allein schon wegen der eigenen Glaubwürdigkeit gegenüber der CDU von Sven-Michael Veit Diese Entwicklung sei "bedauerlich", räumt Hamburgs SPD-Parteichef Mathias Petersen ein. Sie sei sogar "sehr bedauerlich", findet Katrin Behrmann, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF). "Eher an Zufall" glaubt eine prominente Bürgerschaftsabgeordnete, die nicht so gern genannt werden möchte, von "alten Männern, die an Sesseln kleben", spricht ein Fraktionskollege, der ebenfalls keinen Wert auf namentliche Erwähnung legt: Die Kandidatenaufstellung zur Bundestagwahl 2006 sorgt für Diskussionen in Hamburgs SPD. Vier Platzhirsche wollen sich erneut als Direktkandidaten in ihren Wahlkreisen aufstellen lassen: Johannes Kahrs (Mitte), Hans-Ulrich Klose (Harburg-Bergedorf), Ortwin Runde (Wandsbek) und 150 Olaf Scholz (Altona) haben nach momentanem Stand auch keine Gegenwehr zu befürchten. In Nord bewerben sich drei Männer um das politische Erbe der vor einem Jahr verstorbenen Anke Hartnagel. Einzig in Eimsbüttel dürfen SPD-Frauen noch hoffen. Nachdem die Abgeordnete Angelika Mertens am Sonntag ihren Verzicht auf eine erneute Kandidatur bekannt gab, meldeten Niels Annen und mit Dorothee Stapelfeldt sogar eine Sozialdemokratin ihre Ansprüche an (taz berichtete). Im Höchstfall also eine Frau und fünf Herren entsendet die SPD in die Hauptstadt, falls sie - wie seit Jahrzehnten üblich - sämtliche Wahlkreise in der Hansestadt gewinnen sollte. Es droht aber auch ein maskuliner Sixpack. Von einer "moralischen Verpflichtung der Partei zur Gleichberechtigung" spricht nun Behrmann, einen echten Einfluss aber hätte die ASF darauf nicht. Die SPD-Quotenregelung von 40 Prozent Frauen "gilt nur für Listenwahlen" wie die zur Bürgerschaft. Das hat bisher auch geklappt: Von den aktuell 41 SPD-Abgeordneten im Rathaus sind 19 weiblich (46,3 Prozent). Bei der CDU sind es lediglich 21 Prozent, was Behrmann nach der Wahl im vorigen Jahr noch als "peinlich" gebrandmarkt hatte. Um der eigenen Glaubwürdigkeit willen seien deshalb SPD-intern "Debatten" zu führen. So wollte sich gestern Abend der ASF-Vorstand der Frauenfrage annehmen. Auch im Landesvorstand - Frauenanteil: neun von 23, mithin 39% - "sollten wir dieses Problem selbstkritisch hinterfragen", findet Parteichef Petersen. Allerdings könne er "nur appellieren", denn die sieben Kreisverbände würden allesamt "strikt auf ihre Autonomie pochen". Eine "direkte Eingriffsmöglichkeit" hätten weder er noch der Landesvorstand insgesamt, in dem die fünf Kreischefs und zwei Kreischefinnen eigentlich über kurze Kommunikationswege verfügen. Koordination aber, weiß Petersen, "gibt es da nicht". Ein Problem, dass sich wegen der Hamburger Wahlrechtsreform verschärft auch bei Bürgerschaftswahlen stellen wird. Wenn die Partei in den künftigen Wahlkreisen überwiegend Männer ins Rennen schickt, kann sich die Listenquote schnell erledigen. Das aber ist der SPD bewusst. "Damit das da nicht passiert", so Petersen, arbeite eine Vorstandskommission "intensiv" an neuen Regelungen. Geleitet wird dieses Gremium von seiner Stellvertreterin Stapelfeldt - Sensibilität für das Thema sollte also ausreichend vorhanden sein. taz Hamburg 26.04.05 Gysi will wieder in den Bundestag Frankfurt/Oder - Der frühere PDS-Vorsitzende Gregor Gysi (PDS) will 2006 als Spitzenkandidat für den Bundestag kandidieren. Das berichtete die "Märkische Oderzeitung". Er wolle sich um das Direktmandat für Berlin-Pankow bewerben. dpa HH A 20.04.05 Generationswechsel in der CSU Alteingesessene Bundestagsabgeordnete müssen Feld räumen - Erbitterter Kampf um die Mandate von Hans-Jürgen Leersch München - Palastrevolution in der CSU: In einer ganzen Reihe von Bundestagswahlkreisen mußten alteingesessene Abgeordnete für jüngere Politiker nach Kampfabstimmungen das Feld räumen. Auch wenn Bundespräsident Horst Köhler bisher nicht bekanntgegeben hat, ob er den Bundestag auflösen wird, tagen bereits bei allen Parteien die Wahlmännergremien zur Aufstellung der Direktkandidaten für den Bundestag. In der CSU wird der Kampf um die Mandate besonders heftig geführt. Vor drei Jahren - beflügelt durch Edmund Stoibers Kanzlerkandidatur - holten CSUKandidaten 43 der 44 Direktwahlkreise in Bayern. Außerdem rückten 15 überwiegend junge CSUPolitiker über die Landesliste in den Bundestag. Sie fürchten um ihre Wiederwahl. Die Linkspartei und auch eine durch Angela Merkels Kanzlerkandidatur stärkere CDU könnten die Bayern Mandate kosten. Folglich suchten Nachwuchspolitiker ihr Glück in den Wahlkreisen, wo zum Teil seit Jahrzehnten unangefochtene CSU-Größen residierten, die in Berlin zur sogenannten Schafkopf-Connection zählen, weil man sich abends gern zum Bier und Kartenspielen trifft. Besonders heftige Kämpfe tobten im Wahlkreis Passau. Dort gibt es drei CSUBundestagsabgeordnete - neben dem CSU-Direktmandatsinhaber Klaus Rose (63) die Listenabge- 151 ordneten Gerlinde Kaupa (52) und Andreas Scheuer (30). Scheuer entschied den Kampf mit 75 von 119 Stimmen für sich. Rose, zu Zeiten der letzten Kohl-Regierung Staatssekretär im Verteidigungsministerium, geht in den Ruhestand. Er verabschiedete sich mit der Bemerkung, jetzt sei der "von vielen gewünschte Generationswechsel" eingetreten. Ein Staatssekretärkollege von Rose, der Amberger Abgeordnete Rudolf Kraus (64), verlor ganz knapp. Kraus war es zwar noch gelungen, die Bewerbung seiner Listen-Kollegin Barbara Lanzinger (50) in seinem Wahlkreis zu verhindern. Aber der Kampf hatte seine Position offenbar geschwächt. Mit nur einer Stimme Unterschied verlor Kraus gegen den zuerst als Außenseiter gehandelten Neumarkter Oberbürgermeister Alois Karl (54). Deutlicher verlor der Weidener Direktwahlkreisinhaber Georg Girisch (63). Sein 37 Jahre alter Herausforderer Albert Rupprecht erhielt 80 Prozent der Delegiertenstimmen. Zu früh verzichtet hatte Wolfgang Zeitlmann (63). Er kündigte kurz vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen an, nicht erneut für den Bundestag kandidieren zu wollen. Die Neuwahlankündigung machte die Pläne, bis Herbst 2006 in Berlin bleiben zu können, zunichte und den Weg für die Juristin Daniela Raab (29) frei. Schimpfend über seine Nachfolgerin ("Ein Kandidat braucht Lebenserfahrung"), verabschiedete sich Zeitlmann von seinen Delegierten. Problemlos ging der Wechsel im Wahlkreis München-Land über die Bühne. Nachdem Martin Mayer (63) verzichtet hat, kann Georg Fahrenschon (37) die Nachfolge antreten. Einer der alten Garde dürfte jedoch wieder das Ticket nach Berlin bekommen: Hans Raidel (63) setzte sich im Wahlkreis Donau-Ries gegen Herausforderin Doris Meyer (50) durch. Für jüngere Abgeordnete wie Dorothee Mantel (27), die keine Chance sahen, in einem Wahlkreis zum Zuge zu kommen, bleibt jetzt die Hoffnung auf einen guten Listenplatz. Ihre Liste will die CSU am 22. Juli aufstellen. DIE WELT 06.07.05 Diese »normale« Entwicklung der Wahlvorbereitungen wurde dann plötzlich durch die um ein Jahr vorgezogene Neuwahl überholt. Aber gleichgültig, ob vorgezogene Neuwahl oder regulär zum Ende einer Legislaturperiode anstehende Neuwahl, gelten für die Kandidatenaufstellung grundsätzlich nachfolgend aufgeführte Kriterien: Aufstellung der Auswahlkriterien für eine Nominierung als MdB: Die Vorwahl ist zu unterscheiden nach: 1.) der Aufstellung der Wahlkreis- oder Direktkandidaten und 2.) der Festlegung der Reihenfolge der Parteibewerber auf der Landesliste ihrer Partei. Die vorstehenden Beispiele bezogen sich auf die Nominierung für die Wahlkreiskandidatur der jeweiligen Partei in einem der Wahlkreise, in dem von einer Partei in einem innerparteilichen örtlichen Auswahlverfahren ein Bewerber benannt wird, der dann bei der Wahl auf der linken Spalte des Stimmzettels aufgeführt ist. Die Gesichtspunkte zu 1.) für die Auswahl der Wahlkreiskandidaten sind in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit: a) bereits innegehabtes Mandat b) Anziehungskraft des Bewerbers auf neue Wählerschichten c) fachliche Qualifikation d) (örtliche) Parteiarbeit e) Ortsverbundenheit f) Bewährung in der Kommunalpolitik g) Erwartung hoher Wahlkreisaktivität. 152 Bei der Aufstellung der Kandidaten für die Wahl des Wahlkreisabgeordneten einer Partei entscheiden beinahe ausschließlich die örtlichen Parteiorganisationen. Die zu einem Wahlkreis gehörenden Parteiunterorganisationen wie Orts- und Kreisverbände kämpfen notfalls gegeneinander um Einfluss auf die Nominierung des Wahlkreiskandidaten. Die Landesvorstände versuchen zwar ab und zu, einen »informellen« Einfluss auszuüben, doch gegen zu direkte Beeinflussungsversuche sind die unteren Parteiorganisationen allergisch. Sie wachen eifersüchtig über ihre Eigenständigkeit. Nachfolgend ein auf der Internet-Seite des Abgeordneten M. Roth (SPD) gefundener Bericht aus der Heimatpresse seines Wahlkreises über seine parteiintern unumstrittene Nominierung als von der SPD in den Bundestagswahlkampf 2002 geschickter Wahlkreiskandidat für den Wahlkreis 171, Werra/Meißner/Hersfeld. Es verwundert aber doch, wie viel Parteiprominenz aus Berlin anrücken musste, um die Nominierung in trockene Tücher zu wickeln! Vielleicht ja deswegen, weil es sich auch hier um einen neu zugeschnittenen Wahlkreis handelte und man von der Parteispitze her unliebsamen Überraschungen gleich im Vorfeld mit einer Unterstützungsoffensive vorbeugen wollte! In diesem Bericht spiegeln sich alle vorgenannten, für eine Nominierung als Wahlkreiskandidat wichtigen Gesichtspunkte wider: „Mit einem eindrucksvollen Ergebnis nominierten die Delegierten des ersten Parteitages der SPD im neu gebildeten Wahlkreis 171, Werra-Meißner-Hersfeld, den 31jährigen Michael Roth zum gemeinsamen Kandidaten für den bevorstehenden Bundestagswahlkampf. Knapp 97 Prozent der Stimmen konnte der Bundestagsabgeordnete aus Heringen am Samstagnachmittag im voll besetzten Bürgerhaus in Sontra für sich verbuchen. Damit hat die SPD im neuen Wahlkreis ihren Kandidaten nominiert. In seiner Bewerbungsrede zog Michael Roth Bilanz über seine mehr als dreijährige Zeit als Bundestagsabgeordneter. Als zukunftsweisende Weichenstellung bezeichnete Roth die weitere finanzielle Unterstützung des Bundes für die Bad Hersfelder Festspiele. Ebenso positiv ist die Sicherung und das personelle Anwachsen des Zolls in Bad Hersfeld. Ein weiterer großer Erfolg ist der Erhalt der Bundeswehr in Rotenburg. Das Divisionskommando Luftbewegliche Operationen wird sich nach Abzug des Panzergrenadierbataillons 52 in der Alheimerkaserne ansiedeln. Auch die Ansiedlung des Postverteilzentrums Niederaula mit rund 800 Beschäftigten und die Weichenstellungen für das Gewerbegebiet Ostheimmachen macht deutlich, dass in enger Teamarbeit mit den Kollegen aus dem Landtag, der Landkreise und der Kommunen immer wieder Erfolge zu erringen sind. Im weiteren Verlauf seiner Rede betonte Roth, dass die SPD mit 29 sozialdemokratischen Bürgermeistern, 168 Ortsvereinen und fast 7.000 Sozialdemokraten die prägende politische Kraft in der Region des neuen Wahlkreises darstellt. Hieraus erwächst eine besondere Verantwortung, vor allem aber auch enorme Gestaltungsmöglichkeiten für die Zukunft der Region. Roth setzt auf eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Werra-Meißner-Kreis und dankte insbesondere seinem Vorgänger Joachim Tappe für dessen erfolgreiches Wirken. Für den neuen Wahlkreis sehe er große Chancen, die es gemeinsam zu nutzen gelte. Roth kündigt einen kraftvollen, fairen und leidenschaftlichen Bundestagswahlkampf an. Zuvor würdigte Dr. Peter Struck, Chef der SPD-Bundestagsfraktion, die Arbeit des jungen Bundestagsabgeordneten Michael Roth in Berlin. Mit Kompetenz und Engagement habe Roth es verstanden, sich innerhalb der Fraktion zu einem wichtigen Gesprächspartner in Sachen Europa und Kultur zu machen. Einen derartigen Status habe wahrlich nicht jeder "Neue" in so kurzer Zeit. Struck eröffnete seine Rede vor den Delegierten mit Darlegungen zu dem Bundeswehrbeschluss und der Vertrauensfrage des Kanzlers im Deutschen Bundestag am vergangenen Freitag. Ein Fraktionsmitglied der SPD muss auch bereit sein, höchst unangenehme Entschlüsse dann mitzutragen, wenn die Fraktions-Mehrheit dies so einfordert. Auch dies gehöre zur Demokratie. Die Vorstellung, etwa durch mangelnde Geschlos- 153 senheit in den eigenen Reihen eines Tages mit Frau Merkel oder den Herren Stoiber oder Westerwelle regieren zu müssen, sei unerträglich. Die Grünen müssten sich künftig sehr genau überlegen, wie sie sich zur Koalition und den daraus sich ergebenden Verpflichtungen stellen wollen. Das Instrument der Vertrauensfrage sei legitim und eingedenk der gravierenden Tragweite der Bundeswehr-Entscheidung auch gerechtfertigt. Jedenfalls gebe es jetzt an der uneingeschränkten Solidarität zu den USA im Kampf gegen den internationalen Terror nichts mehr zu deuteln. Den Vorschlag zur Wahl Michael Roths zum SPD-Bundestagskandidaten des Wahlkreises 171 brachte der Erste Stellvertretende Vorsitzende des SPD-Unterbezirks HersfeldRotenburg, Landrat Roland Hühn ein. Er würdigte Roth als einen "Kreuz-Buben" für den Wahlkreis, eine besondere Trumpfkarte, in der sich Teamgeist, Dynamik, Engagement und Kompetenz vereint. Auch der Vorsitzende des Unterbezirks Werra-Meißner, Lothar Quanz MdL, würdigte den Kandidaten als hervorragenden "Team-Spieler".“ Landesliste Die Festlegung der Plätze auf der Landesliste einer Partei wird bei normalem Fristablauf der Legislaturperiode ca. ein halbes Jahr vor der Wahl auf den Landesparteitagen vorgenommen. Hier übt die Parteispitze einen größeren Einfluss aus. Die Kandidatenkür kann man am besten in einem kleinen Bundesland beobachten. Beispiele aus dem Stadtstaat Hamburg: SPD: An der Spitze der Landesliste wird es eng Bundestagswahl: Tritt Olaf Scholz gegen Hans-Ulrich Klose an? Bislang gilt nur Ex-Bürgermeister Ortwin Runde als gesetzt. Von Peter Ulrich Meyer Die dramatisch schlechten Umfragewerte für die Bundestagswahl haben bei den Hamburger Sozialdemokraten zu tiefer Verunsicherung und hektischer Betriebsamkeit hinter den Kulissen geführt. Weil nicht mehr sicher ist, daß die SPD alle sechs Wahlkreise direkt holt (wie 2002), hat die Landesliste plötzlich eine zentrale Bedeutung. Wenn die Delegierten des Parteitages am kommenden Dienstag zusammenkommen, könnte mit ehernen Traditionen der SPD gebrochen werden und es zu Kampfkandidaturen um die aussichtsreichen Listenplätze kommen. Eine feste Tradition ist, daß die Landesliste nach Anciennität - also nach Bundestags"Dienstalter" - aufgestellt wird. Das würde bedeuten, daß Ex-Bürgermeister Hans-Ulrich Klose, der Direktkandidat des Wahlkreises Harburg/Bergedorf, die Liste auf Platz eins anführt. Klose sitzt seit 22 Jahren im Bundestag. Doch die alte Ordnung ist in den vergangenen Tagen durcheinandergeraten. Dabei geht es vor allem um einen Namen: Olaf Scholz, Ex-SPD-Generalsekretär und Direktkandidat des Wahlkreises Altona/Elbvororte. Dieser Wahlkreis gilt für die SPD als unsicher. Scholz könnte den Versuch unternehmen, gegen Klose anzutreten, um so einen sicheren Listenplatz zu ergattern. Das Argument der Scholz-Unterstützer könnte der Generationswechsel sein. "Es macht keinen überzeugenden Eindruck, wenn die Liste die Generation 60 plus anführt", heißt es aus der SPD. Klose ist 68, Scholz dagegen erst 47 Jahre alt. Die Lage wird komplizierter dadurch, daß ein dritter Mann im Rennen ist: ExBürgermeister Ortwin Runde, Direktkandidat des Wahlkreises Wandsbek. Runde verfügt bei den Parteitags-Delegierten über ein hohes Renommee und hat sich im übrigen geschickt als moderater Kritiker von Bundeskanzler Gerhard Schröder profiliert, ohne je illoyal zu wirken. Mit anderen Worten: Gegen Runde wird sich kaum jemand trauen zu kandidieren. 154 Nach derzeitiger Lesart gelten allenfalls die ersten vier Listenplätze als sicher. Vollends verworren wird die Lage dadurch, daß die SPD-Liste eigentlich im Wechsel Männer und Frauen aufweisen muß. Die einzige Frau, die bislang in den Bundestag will, ist ExBürgerschaftspräsidentin Dorothee Stapelfeldt. Am heutigen Sonnabend entscheidet sich, ob sie oder Ex-Juso-Chef Niels Annen Direktkandidat für den Wahlkreis Eimsbüttel wird. Dabei werden jetzt Annen deutlich bessere Chancen eingeräumt. Trotzdem ist Stapelfeldt Listenplatz zwei so gut wie sicher. In der SPD nennen sie das den "Chromosomen-Faktor". Derzeit ist noch offen, wen der Landesvorstand für Platz eins vorschlägt. Sollte es Runde sein, wofür einiges spricht, würde er vermutlich ohne Gegenkandidaten gewählt. Dann ist wahrscheinlich, daß sich Klose und Scholz auf Platz drei begegnen. Es sei denn, Klose verzichtet freiwillig und beschränkt sich auf die Direktkandidatur im Wahlkreis. Andernfalls würde der Verlierer auf Platz fünf landen und wäre darauf angewiesen, seinen Wahlkreis direkt zu gewinnen. Auf Platz vier müßte streng genommen wieder eine Frau folgen. Denkbar ist, daß die frühere Präsidentin der Hochschule für Wirtschaft und Politik, Dorothee Bittscheid, kurzfristig ihre Kandidatur erklärt. Es gilt als sicher, daß Johannes Kahrs, Direktkandidat des für die SPD relativ sicheren Wahlkreises Mitte, gar nicht für die Landesliste kandidiert. HH A 25. Juni 2005 Duell der Ex-Bürgermeister Bundestag: Seit gestern sicher: Zwei Kandidaten für Platz 1 beim Nominierungs-Parteitag. Das Rennen um die aussichtsreichen Listenplätze der SPD für die Bundestagswahl wird immer spannender. Jetzt kommt es zum Duell der beiden Ex-Bürgermeister. Wenn die Delegierten des Nominierungs-Parteitages heute abend im Bürgerhaus Wilhelmsburg zusammenkommen, dann wird es für Platz eins zwei Kandidaten geben: Ortwin Runde, Erster Bürgermeister von 1997 bis 2001, und Hans-Ulrich Klose, Erster Bürgermeister von 1974 bis 1981. Der Landesvorstand der SPD beschloß gestern abend nach tagelangem Ringen folgenden Vorschlag für die Landesliste: Der Name Rundes steht auf Platz eins, gefolgt von Ex-Bürgerschafts-Präsidentin Dorothee Stapelfeldt auf zwei, Ex-Innensenator Olaf Scholz auf drei, Dorothee Bittscheid, frühere Präsidentin der Hochschule für Wirtschaft und Politik, auf vier und Klose auf fünf. Unmittelbar nach der Entscheidung des Vorstands kündigte Klose nach Abendblatt-Informationen an, er wolle gegen Runde auf Platz eins kandidieren. Nach dem Reißverschlußprinzip sollen sich Männer und Frauen auf der Liste abwechseln. Umstritten: die Plätze der Männer. Hinter den Kulissen hat es in den vergangenen Tagen ein Gerangel mit harten Bandagen gegeben, das an die Hochphase der SPDFlügelkämpfe erinnert. Dabei haben die heutigen Auseinandersetzungen mit den Kategorien links und rechts nur noch wenig zu tun. In der Traditionspartei SPD galt bei der Aufstellung der Liste bislang das AnciennitätsPrinzip - entscheidend war das Bundestags-"Dienstalter". Das hätte bedeutet: Klose auf Platz eins, Scholz auf drei, Johannes Kahrs - SPD-Abgeordneter des Wahlkreises Mitte - auf fünf und Runde auf sieben. Offiziell gilt als Wahlziel der SPD, alle Wahlkreise direkt zu gewinnen - wie seit 1994 stets. Doch die extrem schlechten Umfragewerte lassen auch erfahrene Sozialdemokraten am eigenen Erfolg im Wahlkreis zweifeln. Die logische Folge ist das Streben nach einem möglichst sicheren Listenplatz. Allenfalls die ersten vier Plätze gelten bei den Sozialdemokraten intern als sicher. Zunächst ließ Ex-Bürgermeister Runde durchblicken, daß ihm der Listenplatz sieben nicht passe. Er wolle auf Platz drei gegen Scholz antreten. Scholz ist ein SchröderMann, Runde hat sich mit moderater Kritik am Kanzler-Kurs profiliert, ohne illoyal zu sein. Weil Scholz eine Kandidatur gegen den von Parteitagen geschätzten Runde zuwe- 155 nig aussichtsreich erschien, ließ er ankündigen, er wolle gegen Klose auf Platz eins antreten. Dann entdeckte auch Runde seine Sympathie für die Spitzenposition, was Scholz aus bekannten Gründen veranlaßte, sich nun auf Platz drei zurückzuziehen. Jetzt kommt es also zum Aufeinandertreffen zwischen Runde und Klose, der früher intern erklärt hatte, er wolle auf Platz eins oder gar nicht auf der Liste kandidieren. pum HH A 28. Juni 2005 Runde schlägt Klose Kandidat: Im Duell der Ex-Bürgermeister stimmten 204 Sozialdemokraten für Runde, auf Klose entfielen 126 Stimmen. Die SPD geht mit Ortwin Runde als Spitzenkandidaten in den bevorstehenden Bundestagswahlkampf. Der 61jährige setzte sich bei der Landesvertreterversammlung im Duell der ehemaligen Bürgermeister deutlich gegen Hans-Ulrich Klose (68) durch. Für den Wandsbeker Runde stimmten 204 Sozialdemokraten, auf Klose entfielen 126 Stimmen. "Ich danke euch für das Vertrauen. Und ich bin ganz sicher, daß Uli und ich beide in den Bundestag einziehen werden", sagte Runde im Anschluß. "Uli wird seinen Wahlkreis gewinnen." Auf Platz zwei der Liste wurde Ex-Bürgerschaftspräsidentin Dorothee Stapelfeldt gewählt, die vergangenes Wochenende als Wahlkreiskandidatin dem Juso Niels Annen unterlegen war. Auf Platz drei folgt Ex-Parteichef Olaf Scholz, auf vier Dorothee Bittscheidt, die frühere Präsidentin der HWP. Klose verzichtete nach seiner Abstimmungsniederlage auf den vom Landesvorstand für ihn reservierten Platz fünf der Liste - der ohnehin wenig aussichtsreich ist. Klose: "Ich habe statt dessen die Absicht, meinen Wahlkreis direkt zu gewinnen." Er tritt in Harburg-Bergedorf an. Mit Rundes Sieg über Klose hat sich auch der Sozial- gegen den Außenpolitiker durchgesetzt. "Die Reformen der rot-grünen Regierung waren im Grundsatz richtig. Aber wir müssen die Bürger und ihren Unmut ernst nehmen", sagte Runde. Er forderte eine gerechtere Politik, in der "besonders die mit den starken Schultern" Opfer zu bringen hätten. Vieles bei den Arbeitsmarkt- und Sozialreformen sei nicht im Sinne der SPD gewesen. "Das waren Kompromisse mit der Union, und das müssen wir im Wahlkampf auch deutlich machen", so Runde. Als Beispiel nannte er den Spitzensteuersatz, dessen Senkung auf 42 Prozent von der CDU durchgesetzt worden sei. ... Klose hatte wie auch Runde versucht, die Personalentscheidung zu entschärfen. "Ich kämpfe nicht gegen Ortwin Runde. Im Gegenteil: Gemeinsam kämpfen wir gegen Merkel, Stoiber und Westerwelle." Von Kampf wurde viel geredet an diesem Abend. Aber so recht Stimmung mochte nicht aufkommen - zu deprimierend scheint die Lage der Partei angesichts der miesen Umfragewerte. Und so klang es eher bemüht, wie Parteichef Mathias Petersen versucht hat, die Partei einzuschwören. "Wir wollen und wir werden alle sechs Wahlkreise direkt gewinnen", sagte Petersen. Er warnte die SPD davor, die neue Linkspartei zu leicht zu nehmen. "Das wird nicht einfach mit den Populisten Gysi und Lafontaine. Wir müssen die inhaltliche Auseinandersetzung suchen und führen", erklärte Petersen. Mit etwas mehr Inbrunst wurde da schon die Personalpolitik debattiert. Der Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs, der im als sicher geltenden Wahlkreis Mitte als Direktkandidat antritt, kritisierte das Abrücken vom Dienstalter-Prinzip - früher war immer der dienstälteste Abgeordnete auf Platz eins gewählt worden. "Ich halte das für einen Fehler und weiß nicht, ob die neue Entwicklung jetzt ein Signal für den Aufbruch ist", sagte Kahrs. Viele Genossen waren da anderer Meinung: Sie hätten lieber einen jüngeren Politiker oder eine Frau als Spitzenkandidatin gesehen. kum/schmoo HH A 29. Juni 2005 156 Dirk Fischer führt Landesliste an CDU: Aufstellung der Kandidaten zur Bundestagswahl: Klimke auf Platz zwei. Wegen der ausgezeichneten Umfragewerte sollte die Aufstellung der CDU-Landesliste zur Bundestagswahl eine Harmonie-Sache werden. Es gab am Freitag abend im CurioHaus dann auch nur einen Mißton: Ein Teil der Altonaer CDU fühlte sich beim Vorschlag der sogenannten Wahlkommission der Parteispitze für die Liste schlecht behandelt. Die Blankeneserin Karin Prien, die bei der Direktkandidatur Marcus Weinberg in Altona unterlegen war, war nur für den letzten, 13. Platz vorgesehen. Statt dessen sollte die Altonaer Bürgerschaftsabgeordnete Karen Koop auf Platz acht antreten. Auch Koop kommt aus dem Kreisverband Altona, hatte aber anders als Prien bislang gar kein Interesse am Bundestag bekundet. "Frau Koop kann nicht als Kandidatin des Kreises Altona bezeichnet werden", empörte sich der Blankeneser CDU-Vorsitzende Dirk Ahlers, der eine bessere Plazierung für Karin Prien forderte. Als Ahlers dann andeutete, es könnte eine Wahlanfechtung geben, falls Koop gewählt würde, rief er damit den Landesvorsitzenden Dirk Fischer auf den Plan. "Es gibt keinerlei Anfechtungsgründe. Wir machen einen Vorschlag, und die Versammlung ist frei zu wählen, wen sie will", rief Fischer unter starkem Beifall. Prien verzichtete darauf zu kandidieren, und so liefen die Wahlen ab, wie die Parteistrategen es geplant hatten: ohne Gegenkandidaturen. Die Landesliste führt Parteichef Dirk Fischer an, der mit 87,9 Prozent gewählt wurde. Auf Platz zwei setzte sich der Wandsbeker Bundestagsabgeordnete Jürgen Klimke durch. Auf Platz drei folgt mit Antje Blumenthal die erste Frau. Nach langer Zeit hat sich mit Marcus Weinberg auf Platz vier wieder ein Altonaer Bundestagsdirektkandidat einen als sicher geltenden Platz erobert. Auf Platz fünf kam der Eimsbütteler Direktkandidat Wolfgang Beuß. Es folgen: Ralf-Dieter Fischer, Frank Schira, Karen Koop, Viviane Spethmann, André Trepoll, Klaus-Peter Hesse und Nicole Sieling. pum (HH A 25. Juni 2005) FDP - Kampf um Spitzenkandidatur Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Funke und Müller-Sönksen erwartet Von Matthias Schmoock Morgen entscheidet Hamburgs FDP bei ihrem Nominierungsparteitag in Schnelsen darüber, wer als Spitzenkandidat auf Platz eins der Landesliste kommt - und damit ein relativ sicheres Ticket für den Bundestag erhält. Insider gehen davon aus, daß es zwischen dem langjährigen Bundestagsabgeordneten Rainer Funke und dem ehemaligen FDP-Fraktionschef Burkhardt Müller-Sönksen ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben wird. Auch der ehemalige Bürgerschaftsabgeordnete Wieland Schinnenburg schneidet bei internen Umfragen gut ab. Spannend wird die Wahl auch, weil voraussichtlich weitere Kandidaten ihren Hut in den Ring werfen werden. Neben der ehemaligen Bürgerschafts-Vizepräsidentin Rose Pauly werden nach AbendblattInformationen morgen mit großer Wahrscheinlichkeit auch Cornelia H. Lehmann und Rolf-Dietrich Staud antreten. Thomas-Sönke Kluth, der ursprünglich ebenfalls im Rennen war, hat seine Kandidatur wieder zurückgezogen. Der Kampf um Platz eins der Liste wird inzwischen mit harten Bandagen geführt. Dem Vernehmen nach ist das Tischtuch zwischen Funke und Müller-Sönksen endgültig zerschnitten, die beiden sprechen nur noch das Nötigste miteinander. Wie berichtet, präsentiert sich Funke seinen Anhängern als solider Parteiarbeiter, der Müller-Sönksen immer offener die nötige Seriosität abspricht. Der ehemalige Fraktionschef wiederum wird von denjenigen unterstützt, die Funke zu wenig Engagement für Hamburg vorhalten und nach 22 Jahren einen anderen Bundestagskandidaten wünschen. 121 Delegierte sind morgen zur Abstimmung aufgerufen. Wegen der vielen Kandidaten wird vermutlich keiner der Favoriten im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erringen 157 können. Im zweiten Durchgang wird es eine Stichwahl zwischen den beiden Erstplazierten geben. Letztlich wird dann derjenige die Liste anführen, der seine Unterstützer am besten mobilisieren kann. Während Rainer Funke und Burkhardt Müller-Sönksen auf der Landesliste kandidieren, geht Schinnenburg für den Bezirk Wandsbek ins Rennen. Rainer Funke hat vor allem Unterstützung in Harburg und Bergedorf, Müller-Sönksen in Teilen von Eimsbüttel und Mitte, Schinnenburg in Wandsbek und Rose Pauly in Altona. Die Entscheidungen mancher Wahlkreise, zum Beispiel im Bezirk Nord, gelten als weitgehend offen. Allen Kandidaten kann aber auch zugetraut werden, Stimmen aus den anderen Bezirken "abzugreifen". HH A 28. Juni 2005 Sager und Hajduk gewählt Direktkandidaten: Beide setzten sich bei der GAL-Mitgliederversammlung klar durch. Es war eine Mitgliederversammlung der widersprüchlichen Stimmungen: Während die beiden Spitzenkandidatinnen der GAL für die Bundestagswahl, Krista Sager und Anja Hajduk, ihre Parteifreunde mit kämpferischen Reden auf die bevorstehende Kampagne einstimmten, rechnen Teile der Basis schon fest damit, daß die Partei sehr bald auch in Berlin Opposition sein wird. Sager und Hajduk, die bereits im Bundestag sitzen, wiesen in der Grundschule Meerweinstraße (Winterhude) entschieden den SPD-Vorwurf zurück, die Grünen seien für die Neuwahlen verantwortlich. "Den Genossen tut die vorgezogene Wahl schon leid. Die Milch bekommen sie aber nicht mehr in die Tüte, und wir lassen sie uns nicht in die Schuhe schütten", rief Sager unter Beifall. "Wir lassen uns die Rolle des Scheiterns nicht zuschieben, aber wir scheuen Neuwahlen nicht", betonte Hajduk. Die Grünen würden mit "klarem, scharfem Profil in den Wahlkampf ziehen, aber ohne Populismus". ... Die Grünen dürften sich von niemandem eine "heimliche Sehnsucht nach der Opposition" einreden lassen. "Wenn die Genossen nicht aus dem Quark kommen, dann reicht es nicht mehr." ... "Es ist PR statt Politik gemacht worden. Wir befürchten, daß wir nicht mehr in der Bundesregierung vertreten sein werden", sagte der einstige Oberrealo Jo Müller ... . Müller, der spontan gegen Sager auf Platz eins der Landesliste antrat, hatte keine Chance: Sager setzte sich mit 100 zu 22 Stimmen bei 16 Enthaltungen durch. Anja Hajduk landete ohne Gegenkandidat mit 115 von 119 Stimmen auf Platz zwei. Auf die weiteren, nicht aussichtsreichen Plätze kamen die Bürgerschaftsabgeordneten Jens Kerstan, Till Steffen und Manuel Sarrazin. pum HH A 27. Juni 2005 In Berlin erregte bei der Aufstellung der Landesliste der Grünen eine Personalie besondere Aufmerksamkeit, weil der Sohn des 68’er Studentenführers Rudi Dutschke dort für einen als sicher eingeschätzten Listenplatz kandidierte, ohne in der Partei entsprechend fest eingebunden gewesen zu sein: Ströbele und Dutschkes Sohn treten an Berlin - Der Mitbegründer der Grünen, Hans-Christian Ströbele, will bei Neuwahl des Bundestages erneut um ein Direktmandat kämpfen. Der 65 Jahre alte Parteilinke kündigte an, daß er auf einen Listenplatz verzichte und wieder im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg antreten wolle. Dort war er 2002 als erster Grüner direkt in den Bundestag gewählt worden. "Ich habe noch lange nicht fertig", sagte Ströbele. Er werde für den linken Kurs seiner Partei streiten. Mit dem Slogan "Ströbele wählen heißt Fischer quälen" hatte Ströbele, der als Gegenspieler von Außenminister Joschka Fischer gilt, in dem 158 Ost-West-Bezirk 2002 fast 32 Prozent der Erststimmen errungen. Die endgültige Entscheidung über Ströbeles Kandidatur soll Ende Juni fallen, wenn die Mitgliederversammlung der Grünen in dem Wahlkreis tagt. Zuvor hatte Marek Dutschke (25), Sohn des 1979 verstorbenen Studentenführers Rudi Dutschke, Interesse an einem sicheren Listenplatz angemeldet - aber nur, wenn Ströbele sich nicht dafür bewerbe. Denn der sei unter allen Kandidaten der jugendlichste. ap/dpa HH A 03.06.05 BT-Wahl Grüne Listenplätze in Berlin Künast gesetzt, Dutschke verliert Nochministerin Renate Künast hat ihren Job gemacht. Die begabteste grüne Machtfrau, die viele lieber neben Joschka Fischer als an der Spitze des Verbraucherministeriums wollen, hat Listenplatz 1 der Berliner Ex-Alternativen für die Bundestagswahl errungen. Künasts Wahl fand allerdings weniger Aufmerksamkeit als die eines Mannes. RudiMarek Dutschkes Auftritt degradierte die Frage von Platz eins auf "Interessiert nicht". Alle guckten auf den Dutschke-Filius, der für Platz 2 kandidierte - und dann klar gegen Wolfgang Wieland verlor (516 zu 104 Stimmen). Kritik gab's vorher: Ein Delegierter fragte ihn: "Wieso muss dein Marsch durch die Institutionen ganz oben anfangen?" taz Nr. 7694 vom 20.6.2005 Das Methusalem-Komplott Fast alle Parteien versorgen zuerst Alt-Gediente mit sicheren Listenplätzen für den Bundestag von Martin Lutz Von Martin Lutz und Hans-Jürgen Leersch Berlin - Die Sozialdemokratie räumt ihrem Nachwuchs kaum Chancen ein. Nach wie vor gilt der alte Grundsatz: "Wer neu kommt, muß sich hinten anstellen." Nach Prognosen könnte die SPDBundestagsfraktion mit ihren derzeit 249 Abgeordneten um bis zu 80 Mandate schrumpfen. Deshalb ist das Gerangel um die vorderen Listenplätze, die einen Einzug in das Parlament sichern, dort am größten. Da haben es junge Hoffungsträger besonders schwer. Die SPD setzt auf die alte Garde. Vor allem Minister, Parteiprominenz und Alt-Abgeordnete werden abgesichert. In Niedersachen wittert Sigmar Gabriel seine Chance, in der Hauptstadt eine wichtige Rolle in der Sozialdemokratie zu übernehmen. Jahrelang mußte der frühere Ministerpräsident "in Hannover Steine klopfen". Jetzt hat er sich im Bezirk Braunschweig über den Listenplatz fünf ein Ticket in den Bundestag gesichert. Den Wahlkreis für ihn hat Wilhelm Schmidt (61), der Fraktionsgeschäftsführer im Bundestag, freiwillig geräumt. Gabriel gehört mit der Parteilinken Andrea Nahles (35), in Rheinland-Pfalz auf Platz vier, zu den wenigen Newcomern, die sich ein Parteiticket nach Berlin sichern konnten. Zu ihren Gunsten verzichtete der ehemalige Verteidigungsminister Rudolf Scharping (58). In Hamburg konnte sich Ex-Juso-Chef Niels Annen immerhin als Direktkandidat für den Bundestag durchsetzen. Zwar blieb dem 32-Jährigen ein sicherer Listenplatz verwehrt, doch läßt sich der Wahlkreis Eimsbüttel gewinnen. Dort holte die SPD zuletzt 51,3 Prozent. Auf Platz eins kandidiert der frühere Bürgermeister Ortwin Runde (61), der den Außenpolitikexperten Hans-Ulrich Klose (68) verdrängte. Den zweiten Platz belegt Ex-Bürgerschaftspräsidentin Dorothee Stapelfeld, die Annen bei der Kandidatur im Wahlkreis unterlag. Auf Platz drei folgt ein Hoffnungsträger der Parteioberen, der ehemalige SPD-Generalsekretär Olaf Scholz (47) aus Altona. Vor allem in Nordrhein-Westfalen haben die Jüngeren das Nachsehen: Zwar tritt der Vorsitzende der Landesgruppe im Bundestag, Hans-Peter Kemper (61), nicht wieder an. Doch von den ersten zehn Kandidaten auf der Landesliste ist nur die Bundestagsabgeordnete Kerstin Griese (39) von der Parteiströmung "Netzwerk" jünger als 50 Jahre. Auf Platz eins steht Partei- und Fraktionschef Franz Müntefering, gefolgt von Fraktionsvize Angelica Schwall-Düren (seit 1994 im Bundestag), Eike Hovermann (seit 1995) und Mnisterin Ulla Schmidt (seit 1990). In Ostdeutschland treten mehrere jüngere Sozialdemokraten an. Jeweils auf Platz zwei stehen der Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises, Klaas Hübner (38), in Sachsen-Anhalt und Lan- 159 desgruppenchef Carsten Schneider (29) aus Erfurt in Thüringen. In Brandenburg wird zwar erst am 6. August über die Liste entschieden. Schwere Generationenkämpfe hat die CSU hinter sich. Eine erbitterte Schlacht tobte im Wahlkreis Passau, wo sich schließlich der 30jährige Andreas Scheuer gegen den früheren Verteidigungs-Staatssekretär Klaus Rose (63) durchsetzte. Auch im Wahlkreis Weiden gewann der 37jährige Albert Rupprecht gegen den bisherigen Abgeordneten Georg Girisch. Andere Vertreter der älteren Generation verließen kampflos die Bühne. So machte - wenn auch widerwillig - Wolfgang Zeitlmann (Rosenheim) den Platz frei für Daniela Raab (29). Im Wahlreis München-Land folgt Georg Fahrenschon (37) auf Martin Mayer (63). Auch bei der Landeslistenaufstellung der CSU kamen jüngere Kandidaten zum Zuge. Dorothee Mantel (27) steht auf Platz acht der Liste und dürfte damit auf jeden Fall wieder in den Bundestag einziehen. Schwieriger wird es für Melanie Oßwald (29), die auf Listenplatz 27 kam. Für die Nürnbergerin hängt alles davon ab, daß die CSU gut abschneidet und die vor ihr auf der Liste stehenden Kandidaten mit eigenem Wahlkreis direkt nicht verlieren. Derzeit liegt die CSU in Umfragen bei 63 Prozent. Zu den jungen CSUKandidaten, die am 18. September bereits zum zweiten Mal antreten, gehören Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg (33, Kulmbach), Stephan Mayer (31, Altötting) und Stefan Müller (30, Erlangen). In der CDU hatte deren jüngster Abgeordneter Jens Spahn (25) aus Ahaus zwar keine Probleme, in seinem münsterländischen Wahlkreis Steinfurt-Borken wieder aufgestellt zu werden. Doch auch bei der CDU gilt der Grundsatz, daß sich die Jungen hinten anstellen müssen. In Recklinghausen kandidiert JU-Chef Philipp Mißfelder (25), in Siegen Ulrich Künkler (33) und in Aachen Marcel Philipp (34). Die CDU in Baden-Württemberg hat vier junge Walkreis-Kandidaten. Es sind Thomas Bareis (30), Olav Gutting (34), Conny Meyer (33) und Andreas Jung (30). In Berlin tritt Kai Wegener (32) als Direktkandidat an und in Brandenburg Katharina Reiche (32), die 2002 in Stoibers Mannschaft war. In Hessen gibt es immerhin fünf junge CDU-Direktkandidaten. Hier treten Helge Braun (32), Frank Gotthardt (34), Holger Haibach (33) und Kristina Köhler (27) an. Der fünfte Kandidat Michael Brandt (31) tritt in Fulda an - eigentlich eine CDU-Hochburg. Da sich hier aber der aus der CDU ausgeschlossene Martin Hohmann als Direktkandidat bewirbt, wird das Rennen spannend. In anderen Bundesländern kommen bei der CDU kaum jüngere Direktkandidaten zum Zuge. In Rheinland-Pfalz etwa nur Julia Klöckner (32). Bei der FDP ist das Kontingent jüngerer Politiker gegenüber der letzten Wahl etwa gleich, nachdem es damals einen großen Erneuerungsschub gab. Newcomer sind dieses Mal die Ausnahme: In Hamburg verdrängte der kurzeitige Fraktionschef der Bürgerschaft, Burkhardt Müller-Sönksen (45), den Bundestagsabgeordneten Rainer Funke (64). In Niedersachsen steht Patrick Döring (31), Fraktionschef im Stadtrat von Hannover, auf Platz sechs. In Bayern hat der Juli-Kandidat Horst Meierhofer (33) Platz fünf ergattert. Zwei Jüngere, Patrick Meinhardt (39) und Juli-Landeschef Florian Toncar (27), belegen in Baden-Württemberg die Plätze sieben und acht. Im Osten schafften es Thüringens FDP-Chef Uwe Barth (40) und der Dresdener Jan Mücke (32) auf die Plätze eins und zwei. Sonst setzen die Liberalen erneut auf bewährte Kräfte wie den 28jährigen Bundestagsabgeordneten Daniel Bahr. Sein achter Listenplatz gilt noch als sicher, wenn seine Partei die Fünf-Prozent-Hürde schafft. Die Grünen setzen wie die anderen Parteien auf altbewährte Politiker wie Parteichefin Claudia Roth oder Außenminister Joschka Fischer. Neu in den Bundestag kommen voraussichtlich Bärbel Höhn aus Nordrhein-Westfalen und Wolfgang Wieland aus Berlin, die aber schon "Polit-Oldies" sind. Der junge Hoffnungsträger Gerhard Schick (33), der Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Finanzen, erreichte Platz 8 in Baden-Württemberg. Jugendliches Alter und ein prominenter Name sind allerdings auch bei den Grünen noch keine Garantie für ein Bundestagsticket: Marek Dutschke, Sohn des verstorbenen APO-Führers Rudi Dutschke, schaffte es nicht in Berlin. Mitarbeit: MZ DIE WELT 26. Juli 2005 160 Bei CDU/CSU, SPD, den Grünen und der FDP werden die vorderen Plätze in den großen Bundesländern u.a. an die Parteiprominenz vergeben, wenn sie bundesweit eingesetzt werden muss und darum keine Zeit für Kärrnerarbeit in einem eigenen Wahlkreis erübrigen kann. Ferner sind diese Plätze für Verbandsvertreter vorgesehen, die die mühselige Arbeit der Wahlkreisagitation scheuen oder wegen ihrer Verbandstätigkeit nicht erübrigen können, die als Direktkandidaten hoffnungslos unterlegen wären, auf deren Fachwissen die späteren Bundestagsfraktionen bei ihrer gesetzgeberischen Tätigkeit aber oft nicht verzichten können und für deren Nominierung der hinter ihnen stehende Verband oft eine erkleckliche Summe in die Parteikasse zur Finanzierung der Wahlkampfvorhaben zahlt! Und wenn zum Ärger des BDI-Präsidenten Rogowski auf den vom Wähler in ihrer Reihenfolge nicht veränderbaren Landeslisten ganz vorne politisch aktive Gewerkschafter abgesichert sind und die klassische Arbeitnehmerpartei SPD dann auch noch die Wahl gewinnt und den Regierungschef stellt, dann läuft ihm die Galle über, weil er für die Betriebe seines Interessenverbandes gerne das durchsetzen würde, was die Gewerkschaften als selber ruppige Arbeitgeber bis zu der Erhebung seiner Forderung nach einem anderen Wahlsystem in eigenen Betrieben und Bildungseinrichtungen bedenkenlos bei ihren eigenen Angestellten an vorenthaltenen Arbeitnehmerschutzrechten vorexerzieren, dem BDI-Präsidenten aber durch ihren parlamentarischen Einfluss verwehren, und er fordert ein geändertes Wahlsystem, das seinen Hoffnungen auf Beschneidung des gewerkschaftlichen Einflusses im Parlament mehr Raum geben könnte. (Wenn er sich von einem geänderten Wahlsystem keine »Besserung« seines Ärgernisses versprechen würde, würde er es ja nicht fordern!) Abgesehen von der Einflussnahme durch Lobbyistentätigkeit ergaben sich für die wichtigsten der ca. 1.500 Verbände außer a) ihrer zum Teil erheblichen Finanzkraft (BDI; Deutscher Sparkassen- und Giroverband) Einflussmöglichkeiten bisher hauptsächlich b) durch eine schlagkräftige Organisation und eine schnell mobilisierbare und stets demonstrationsbereite Mitgliederschaft (Bauernverband) oder c) durch ein großes Mitgliederpotential und den dezenten Hinweis auf dessen Bedeutung bei Wahlen (Vertriebenenverbände; ADAC als Autofahrerlobby und die dann zurückgenommene Ankündigung der Grünen, den Benzinpreis auf DM 5,- pro Liter anheben zu wollen). Die gemessen an ihrem direkten Einfluss auf die Abgeordnetentätigkeit und damit auf die Gesetzgebung wohl mächtigste Interessenvertretung stellen, wie an anderer Stelle schon näher ausgeführt, die Landwirte auf Grund ihres herausragenden Organisationsgrades. Zwar sind nur noch etwas mehr als 1 % (900.000) der Deutschen in der Landwirtschaft tätig, aber die kassieren laut Agrarbericht allein ca. 28 Mrd. DM [14 Mrd. €; der Verf.] an Subventionen. Weitere 16 Milliarden [8 Mrd. €; der Verf.] zahlen die Verbraucher durch die künstlich hochgehaltenen Preise für Agrargüter. Fast 28.000,- DM [14.000,- €; der Verf.] Zuschüsse entfallen jährlich auf jeden im Agrarbereich Beschäftigten. 34 % des Einkommens erzielen die deutschen Landwirte auf Grund ihrer Verbandsmacht durch staatliche Subventionen. Wegen der ähnlich gelagerten Verhältnisse in den anderen Ländern der EG machen die Bauern Europas die Wirtschaftsgemeinschaft inzwischen für alle Nicht-Landwirte fast unbezahlbar. „Bauern zahlen so gut wie keine Steuern und Sozialabgaben, sie dürfen ihre Traktoren steuerbegünstigt betanken, sie kassieren, wenn sie viel produzieren, und sie erhalten Zuschüsse, wenn sie die Produktion verringern. Sie bekommen - in perverser Umkehr des Verursacherprinzips - sogar Geld dafür, dass sie es unterlassen, das Grundwasser mit Gülle zu verseuchen. Wie schaffen sie das? Hilfreich ist da an erster Stelle natürlich das eigene Ministerium, an dessen Spitze aus Tradition ein Landwirt steht. Dazu sitzen im 35 Parlamentarier starken Agrarausschuss allein 20 Abgeordnete, die über einen eigenen Hof oder eine Ausbildung mit der Landwirtschaft verbunden sind, aber kein einziger Vertreter der Verbraucher. ...“ (STERN 19.03.92; die Unterstützungszahlungen liegen heute beträchtlich höher als 1992!). 161 Außer für die Parteiprominenz werden die Plätze auf den Landeslisten zur Absicherung von Parteimitgliedern verwandt, die bereit sind, in einem für eine gegnerische Partei »sicheren« Wahlkreis als chancenloser Direktkandidat anzutreten und so wenigstens Präsenz zu demonstrieren (erinnert sei an die vielen erfolglosen Direktkandidaturen Helmut Kohls, auch als damals amtierender(!) Bundeskanzler, in seinem Wohnwahlkreis Ludwigshafen-Oggersheim, den er nur zweimal, 1990 im fünften und 1994 im sechsten Anlauf, gewonnen und dann als immer noch amtierender Bundeskanzler wieder verloren hatte). Wer als Direktkandidat einer der großen Parteien in »seinem« Wahlkreis unterliegt, zieht wegen dieser Absicherungspraxis meist trotzdem über die Landesliste seiner Partei in den Deutschen Bundestag ein, weil die meisten Bewerber für ein Direktmandat auf der Landesliste ihrer Partei einen vorderen Listenplatz erhalten. Der Grünen-Abgeordnete Ströbele, der keine Aussicht auf einen ihn absichernden Listenplatz hat, verzichtete darum 2005 auf eine Nominierung auf der Landesliste seiner Partei und konzentrierte sich ganz auf die Wiedererringung des von ihm 2002 gewonnenen Berliner Wahlkreises. Wer sich im Parlament – seinem Gewissen folgend - durch Unterlaufen der Fraktionsdisziplin missliebig gemacht hat, hat schlechte Chancen, wieder als Listenbewerber aufgestellt zu werden. „Der Abgeordnete, der sich auf die ... festgelegte Gewissensnorm beruft, bekommt – zumindest bei der SPD-Fraktion – frech zur Antwort: ’Na, dann kannst du dich ja bei der nächsten Wahl von deinem Gewissen aufstellen lassen’ – ein Satz, aus dem die Allmacht der Parteien spricht“ (SPIEGEL 26.05.03). Aus der Sicht eines Kandidaten Ein Grüner: Christian Ströbele FORUM 15.03.02 Von Torsten Krauel Werner Schulz, Parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen im Bundestag und einst Mitbegründer des Neuen Forums in der DDR, galt weithin als politisches Auslaufmodell, wie es im Autoland Deutschland heißt. Das war voreilig. Die Berliner Grünen wählten ihn, den erklärten Gegner der PDS und gelegentlichen Befürworter schwarzgrüner Koalitionen, auf den sicheren zweiten Platz der Landesliste. Die beiden vorderen Plätze sind die einzigen, die grünen Kandidaten in Berlin den Einzug in den Bundestag garantieren. Der Sieg über die prominenten West-Grünen Andrea Fischer und Christian Ströbele bedeutet erstens, dass der auf die DDR-Bürgerrechtler verweisende Namenszusatz "Bündnis 90" im Parteinamen endlich wieder ernst genommen werden darf. Er bedeutet zweitens, dass sich der politische Charakter der Grünen im nächsten Bundestag ändern wird: Mit Ströbele ist der Wortführer des linken Flügels daran gescheitert, seine Wiederwahl abzusichern. Der Sieg des Bürgerrechtlers ist deshalb drittens das bislang auffälligste Indiz dafür, dass der Mut zu Reformen weitere mutige Schritte nach sich zieht. Denn ohne die 1998 beschlossene Verkleinerung des Bundestages wäre es zu seiner Wahl kaum gekommen. ... Grüne aus den Landschaften zwischen Ostsee und Erzgebirge hatten es schwer, mit ihrer befreiten Weltsicht Gehör zu finden. Der Sieg von Werner Schulz wird das ändern. Dies wird auch deshalb geschehen, weil Ströbeles Scheitern eine Besinnung der Grünen auf neue Prioritäten signalisiert. Die Abgeordnetenhauswahl hat die Frage geklärt, wer in der Hauptstadt als Bannerträgerin linkspazifistischer Ideen angesehen wird. Es ist die PDS, nicht der linke Grünenflügel. Die ökobürgerlichen Grünen haben daraus die Konsequenz gezogen. Die Abkehr von Ströbele ist gleichbedeutend mit der Hinwendung zu einem Wählerpotenzial, das in der politischen Mitte vermutet wird. In einer rot-roten 162 Stadt ist die Stärkung eines freigeistig-pragmatischen, von der SED schikanierten Akademikers wie Schulz eine Kampfansage an den Alleinvertretungsanspruch der früheren SED auf den »Osten«. Die Berührungspunkte einer solchen grünen Basis mit bürgerlichen Schichten ist größer als diejenige mit der Kreuzberger Szene oder mit dem Kadermilieu. Das Ringen mit der FDP um den dritten Platz hat auch in Berlin begonnen. Es hat nicht zuletzt deshalb begonnen, weil Ströbeles Wahlkreis Kreuzberg, in welchem die Grünen stärkste Partei waren, mit dem Prenzlauer Berg und Friedrichshain verschmolzen wurde. Dort wetteifern SPD und PDS um die Spitzenstellung. Die Verringerung der Bundestagssitze auf 599, die damit verbundene Reduzierung der Wahlkreise von 328 auf 299 und ihr geografischer Neuzuschnitt zerstört in ganz Deutschland für alle Parteien alte Gewissheiten. Wahlkreise, die für CDU oder SPD sichere Direktmandate waren, müssen nun im ehrlichen Wettstreit erobert werden, und sichere Plätze auf den Landeslisten werden weniger. Die Parteien werden gezwungen, sich darüber klar zu werden, welche Inhalte und Personen ihnen wichtig sind. ... Es sind Richtungsentscheidungen. Sie zwingen die Parteien zur Entscheidung darüber, welche Debatten der nächste Bundestag führen soll und welche nicht. Die Entscheidung der Berliner Grünen für Schulz ist ein Indiz dafür, dass durch die Wahlkreisreform die vorwärtsgewandte Mitte gestärkt werden wird, nicht die Ränder. Der Abschied von alten Wahlkreisen ist auch der Abschied von alten Illusionen, der endlich Platz für neue, zeitgemäße Träume schafft. Frauenanteil an den erfolgversprechenden Kandidatenplätzen und im Deutschen Bundestag „Ohne Frauen geht es nicht. Das hat sogar Gott einsehen müssen“ (Eleonora Duse). Durch eine Frauenquote, die am entschiedensten bei der PDS und den Grünen gehandhabt wird, versuchen die Parteien, den Anteil der Frauen kontinuierlich zu erhöhen. Warum? Wegen des Bonmots von Marlene Dietrich: „Frauen sind viel vernünftiger als Männer. Oder haben Sie schon eine Frau erlebt, die einem Mann wegen seiner Beine nachrennt?“ Sicher nicht! Da gibt es auch völlig konträre Äußerungen von z.B. emanzipierten Frauen über ihre nicht so zur entschiedenen Emanzipation bereiten Geschlechtsgenossinnen! Aber schließlich stellen die Frauen mit 32,1 Mill. Wählerinnen (52,3 %) gegenüber 29,3 Mill. Wählern (47,7 %) das größte Wählerkontingent! Wahlergebnis der Wahl zum 15. Deutschen Bundestag 2002 Partei Erststimmen SPD 20.059.967 CDU 15.336.512 CSU in % Zweitstimmen in % Sitze Frauenanteil Frauenanteil absolut % 41,9 18.488.668 38,5% 251 94 29,5% 190 43 4.311.178 32,1 9.0 14.167.561 4.315.080 9,0% 58 12 GRÜNE 2.693.794 5,6 4.110.355 8,6% 55 32 FDP 2.752.796 5,8 3.538.815 7,4% 47 10 PDS 2.079.203 4,3 1.916.702 4,0% 2 2 37,45 22,63 20,69 58,18 21,28 100,00 608.274 10,3 1.018.361 3,0% 0 100,0% 603 193 32,01 Sonstige Gesamt Partei 47.841.724 100,0% 47.555.542 Erststimmen in % Zweitstimmen in % Sitze Frauenanteil Frauenanteil absolut % Im 15. Deutschen Bundestag sind die Frauen mit 32,01 % (193 von 603) vertreten; allerdings in den einzelnen Parteien unterschiedlich stark: Bei der PDS mit 100 % (es sind nur zwei Direktkandidatinnen durchgekommen), bei den Grünen mit 58,18 % (32 : 55), der SPD 37,45 % (94 : 251), 163 der FDP 21,28 % (10 : 47) und als Schlusslicht die Unionsparteien CDU 22,63 % (43 : 190) und CSU 20,69 % (12 : 58). Dem sei der Anteil der Frauen an der Mitgliederschaft der Parteien gegenüber gestellt: Der Frauenanteil der Parteimitglieder betrug Ende 2003 bei den Grünen 37,1 %, der SPD 29,9 %, der CDU 25,2 %, der FDP 23,4 % und der CSU 17,9 %. V. Parteien / Auszug aus dem Parteiengesetz Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz) In der Fassung vom 31. Januar 1994 Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen § 1 Verfassungsrechtliche Stellung und Aufgaben der Parteien (1) Die Parteien sind ein verfassungsrechtlich notwendiger Bestandteil der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Sie erfüllen mit ihrer freien, dauernden Mitwirkung an der politischen Willensbildung des Volkes eine ihnen nach dem Grundgesetz obliegende und von ihm verbürgte öffentliche Aufgabe. (2) Die Parteien wirken an der Bildung des politischen Willens des Volkes auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens mit, indem sie insbesondere auf die Gestaltung der Öffentlichen Meinung Einfluss nehmen, die politische Bildung anregen und vertiefen, die aktive Teilnahme der Bürger am politischen Leben fördern, zur Übernahme öffentlicher Verantwortung befähigte Bürger heranbilden, sich durch Aufstellung von Bewerbern an den Wahlen in Bund, Ländern und Gemeinden beteiligen, auf die politische Entwicklung in Parlament und Regierung Einfluss nehmen, die von ihnen erarbeiteten politischen Ziele in den Prozess der staatlichen Willensbildung einführen und für eine ständige lebendige Verbindung zwischen dem Volk und den Staatsorganen sorgen. (3) Die Parteien legen ihre Ziele in politischen Programmen nieder. (4) Die Parteien verwenden ihre Mittel ausschließlich für die ihnen nach dem Grundgesetz und diesem Gesetz obliegenden Aufgaben. [Der BVerfG-Richter Mahrenholz machte auf Grund der Praktiken der Parteien trotz gebotener richterlicher Zurückhaltung aus Abs. 2 den Satz: „Die Parteien wirken an der Unwillensbildung des Volkes mit.“] § 2 Begriff der Partei (1) Parteien sind Vereinigungen von Bürgern, die dauernd oder für längere Zeit für den Bereich des Bundes oder eines Landes auf die politische Willensbildung Einfluss nehmen und an der Vertretung des Volkes im Deutschen Bundestag oder einem Landtag mitwirken wollen, wenn sie nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse, insbesondere nach Umfang und Festigkeit ihrer Organisation, nach der Zahl ihrer Mitglieder und nach ihrem Hervortreten in der Öffentlichkeit eine ausreichende Gewähr für die Ernsthaftigkeit dieser Zielsetzung bieten. Mitglieder einer Partei können nur natürliche Personen sein. (2) Eine Vereinigung verliert ihre Rechtsstellung als Partei, wenn sie sechs Jahre lang weder an einer Bundestagswahl noch an einer Landtagswahl mit eigenen Wahlvorschlägen teilgenommen hat. (3) Politische Vereinigungen sind nicht Parteien, wenn 1. ihre Mitglieder oder die Mitglieder ihres Vorstands in der Mehrheit Ausländer sind oder 2. ihr Sitz oder ihre Geschäftsleitung sich außerhalb des Geltungsbereichs dieses Ge- 164 setzes befindet. § 5 Gleichbehandlung (1) Wenn ein Träger öffentlicher Gewalt den Parteien Einrichtungen zur Verfügung stellt oder andere öffentliche Leistungen gewährt, sollen alle Parteien gleichbehandelt werden. Der Umfang der Gewährung kann nach der Bedeutung der Parteien bis zu dem für die Erreichung ihres Zweckes erforderlichen Mindestmaß abgestuft werden. Die Bedeutung der Parteien bemisst sich insbesondere auch nach den Ergebnissen vorausgegangener Wahlen zu Volksvertretungen. Für eine Partei, die im Bundestag in Fraktionsstärke vertreten ist, muss der Umfang der Gewährung mindestens halb so groß wie für jede andere Partei sein. (2) Für die Gewährung öffentlicher Leistungen in Zusammenhang mit einer Wahl gilt Absatz 1 während der Dauer des Wahlkampfes nur für Parteien, die Wahlvorschläge eingereicht haben. (3) Öffentliche Leistungen nach Absatz 1 können an bestimmte sachliche, von allen Parteien zu erfüllende Voraussetzungen gebunden werden. … 165 VI. Die Bundesländer Name qkm Partei Baden- BW Günther Oettinger Württemberg (Rangfolge) Stuttgart 35.751 München 70.549 CDU Bayern BY Edmund Stoiber Berlin BE Klaus Wowereit Brandenburg BB Matthias Platzeck SPD Bremen Hamburg HE Roland Koch Wiesbaden MV Harald Ringstorff Vorpommern Niedersachsen Nordrhein- Pfalz 47.618 Düsseldorf 34.083 SL Peter Müller Sachsen SN Georg Milbradt Sachsen- ST Wolfgang Böhmer Mainz 19.847 Saarbrücken 2.569 Dresden 18.414 Magdeburg 20.445 (13.) CDU Schleswig- SH Peter Harry Carstensen Thüringen Kiel CDU TH Dieter Althaus 15.763 16.172 (11.) 356.951 Mitglieder im Bundesrat Regierungspartei / Regierungskoalition Mitglieder im Bundestag Wahlkreise (G. vom 17.03.05) Bevölkerungsdichte (8.) 0,545 6 CSU 45 90 4 SPD + PDS (1.) 12 24 56 - 65 4 SPD + CDU (15.) 10 20 1667 54 - 55 (16.) 1,736 3 SPD + CDU (3.) 2 4 2299 19 - 24 (13.) 6,092 3 CDU (2.) 6 12 288 169 - 189 (5.) 1,726 (7.) 75 (14.) 8,003 (4.) (1.) 4,059 12 - 18 3 SPD + PDS 7 14 25 - 53 6 CDU + FDP (12.) 531 5 CDU 21 42 (16.) 168 18,080 29 58 88 - 151 (4.) 6 CDU + FDP 64 128 205 199 - 213 (7.) 1,058 (9.) 4 SPD + FDP 15 30 412 296 - 299 (15.) 4,300 (5.) 3 CDU 4 8 234 152 - 168 (6.) 2,499 (8.) 4 CDU + SPD 17 34 122 66 - 75 (11.) 2,823 4 CDU + FDP (14.) 10 20 179 1 - 11 (9.) 2,357 (12.) 82,38 37 74 (11.) 87 (10.) (12.) Erfurt CDU Gesamt (8.) (6.) 7 CDU + FDP/DVP 3811 76 - 87 2,567 (10.) CDU Holstein (2.) (9.) Anzahl 176 214 - 258 3,398 (4.) CDU Anhalt (3.) (2.) SPD Saarland 23.174 Hannover CDU RP Kurt Beck 21.115 (6.) CDU Westfalen Rheinland- Schwerin NW Jürgen Rüttgers 755 (R.) 299 259 - 295 12,439 (7.) SPD NI Christian Wulff 327 (15.) CDU Mecklenburg- 29.477 (16.) CDU Hessen 892 (5.) SPD HH Ole von Beust 10,694 (14.) Potsdam SPD Hamburg E/qkm Nummer (1.) Berlin HB Henning Scherf Mill. (Rangfolge) (3.) CSU Bremen Einwohner Fläche qkm Hauptstadt Regierungschef Länderkürzel Land Bundesländer (Stand 30.06.05) 4 CDU + SPD (10.) 11 22 147 190 - 198 (13.) 231 4 CDU 9 18 299 598 70 166 VII. Berliner Wahlkreise und die PDS Seit der BT-Wahl 1994 ist alles anders! Vier Ostberliner Wahlkreise sind in das Blickfeld der politisch interessierten Öffentlichkeit geraten. Sie standen auch für die BT-Wahl 2002 wieder im Mittelpunkt des Interesses und das wird auch bei künftigen Bundestagswahlen so sein. Die Berliner Wahlergebnisse weichen vom Bundesgebiet ab, weil die PDS - oder ab 2005 das von ihr dominierte Linksbündnis - hier drittstärkste Partei ist. Zum Phänomen PDS Kommentar Hans-Uwe Scharnweber: Warum die PDS für keinen historisch empfindenden Demokraten wählbar ist Ich habe schon an anderer Stelle die Meinung vertreten, dass es zwar prinzipiell jede Menge sozialistischer Parteien geben darf, wenn Wählergruppen es so wollen, aber es müsste unter demokratiebewussten "mündigen Bürgern" ebenso selbstverständlich sein, dass es genau so wenig eine sich als Nachfolgerin der SED verstehende und sogar ausgebende PDS geben darf, wie auf der anderen Seite des Parteienspektrums ja auch eine NSDAP oder eine irgendwie umetikettierte Nachfolgerin dieser Partei schon aus demokratischem Grundkonsens heraus nicht mehr wählbar ist: Beide Parteien haben durch viele ihrer Führer, Mitglieder und die von ihnen jeweils gesteuerte Geheimpolizei - z.B. das MfS als "Schutz und Schirm der Partei" - die (Menschen-)Rechte ihnen missliebiger Bevölkerungsteile mit Polizeiund Militärstiefeln zertreten, zu viele Verbrechen wurden von diesen beiden Parteien in ihrer gesellschaftspolitischen Omnipotenz in dem der jeweiligen Partei unterworfenen Staatswesen über u.a. staatlich angeordneten Kindesraub bis hin zum vielfachen (SED) oder millionenfachen (NSDAP) Mord begangen; teilweise mit demselben Fallbeil! Das kann nicht sonderlich verwundern, denn bei einem Systemvergleich der Funktion des Rechts im NS- und im SED-Staat stellt man fest, dass in beiden die gleiche Fallbeiljustiz gegenüber dem politischen Gegner herrschte. Der Unterschied zwischen den beiden durch diese Parteien aufgerichteten Unrechtsregimen war - wenn man von den systematischen Massenmorden der Nazis an Juden, Roma und Sinti einmal (kurz) absieht, denn so etwas hat es im SED-Staat zum Glück nicht gegeben - für zu viele Unterdrückte aus der eigenen Bevölkerung teilweise nur quantitativ, nicht aber qualitativ: Jeder politisch Andersdenkende konnte straflos terrorisiert und in seiner bürgerlichen und teilweise auch in seiner physischen Existenz vernichtet werden. Justizmorde gab es in beiden Regimes! Die Methoden der GESTAPO sind durch das MfS zum Teil noch effektiver angewandt worden. Aus diesem historischen Wissen leitet das Wort des ersten Nachkriegsvorsitzenden der SPD, Kurt Schumacher: "Die Kommunisten der SED sind nur rotlackierte Faschisten!", seine Berechtigung her. Wegen dieser historischen Fakten hatte nach der Wende eine Minderheit vorher bloß idealistischer, sozialistisch-fortschrittsgläubiger aber auf dem linken Auge betriebsblinder SED-Mitglieder als Akt der Selbstreinigung für eine Selbstauflösung ihrer Partei gestimmt. Diese Minderheit war jedoch der weiterhin ideologieverhafteten und/oder auf das damals noch milliardenschwere/schwer geglaubte SED-Parteivermögen lüsternen Mehrheit von Systemverweigerern unterlegen. Das Ganze war so unappetitlich, als wenn die NPD den Obersalzberg für ihr Parteivermögen gefordert hätte! Bei dem leider fehlgeschlagenen Selbstreinigungsprozess kam nicht viel mehr heraus als eine Umetikettierung von SED in (eine zugestandener Maßen nun demokratischer angelegte) PDS. Wenn sich aber eine Partei in ihrem Selbstverständnis als Nachfolgerin einer solchen verbrecherischen Organisation wie der SED (mit ihrem Geheimdienst MfS) unseligen Angedenkens sieht, müsste sie damit für jeden über minimales historisches Wissen verfügenden demokratieorientierten "mündigen Bürger" genauso unwählbar sein wie die NPD oder die DVU - geschweige denn, dass ein geschichtsbewusster Demokrat seinen Namen damit be- 167 sudeln sollte, als unabhängiger Kandidat oder als Parteimitglied für die PDS, NPD oder DVU zu kandidieren! Auch wenn man die Ideologie der PDS-Mitglieder nicht goutieren kann, so wird die Mehrheit von ihnen aus ideologisch zwar verbohrten, menschlich aber honorigen Personen bestehen; die Geschichte ihrer Partei aber ist beileibe nicht honorig! Da ist von SED-Machthabern zu viel gequält, gemeuchelt und gemordet worden! Bei diesen unbestreitbaren, nun für alle offenbar gewordenen historischen Fakten können nur geschichtslose, entweder politikverdrossene oder auf Politikklamauk versessene (letztlich demokratiefeindliche) Unverbesserliche eine Partei wählen, die sich selber als Nachfolgerin der Versagerpartei SED bezeichnet und auch so begreift, die mit ihrer Ideologie schon einen Staat zu Grunde gerichtet hat! Ob eine Partei mit Blut an den Händen nach einer einfachen Umbenennung aus ihrer besudelten diktatorischen Vergangenheit heraus in einem neuen System politisch weiterexistieren oder gar wieder politische Macht übertragen bekommen darf, ist nach meiner Wertung eine primär moralische und erst sekundär eine politische Frage! Wer das akustisch und intellektuell versteht, aber nicht begreift und z.B. weiterhin die jahrelange Verletzung der Menschenrechte durch Mauerbau und Stacheldraht als „friedensstiftende Maßnahme“ umdefiniert, wie es die beiden Parteifize der PDS zwei Monate vor dem 40. Jahrestag des Mauerbaues taten, kann sich ein Nachdenken über politische Moral sparen! (Der Landesparteitag der PDS sprach dann aber zwei Tage später mit großer Mehrheit wenigstens sein „Bedauern“ über die insgesamt mindestens 1065 Mauertoten und bei Fluchtversuchen auf der Ostsee ums Leben gekommenen aus. Ohne dieses geäußerte „Bedauern“ hätte der unterstützende Beitrag der PDS zum Sturz des Regierenden Bürgermeisters der CDU von Berlin durch SPD und Grüne nicht akzeptiert werden können. Es hätte die lokalen Parteiorganisationen von SPD und Grünen vermutlich »zerrissen«. In nachfolgenden Diskussionen und Papieren kam die SED-Nachfolgeorganisation über ein „Bedauern“ nicht hinaus und verweigerte die von ihren Gegnern geforderte „Entschuldigung“ für das während DDRZeiten begangene Unrecht. Was hätte die andere Wortwahl geändert? Ist das vielleicht nur ein semantischer Streit? Wenn man der rigorosen Meinung ist, dass es keine Nachfolgeorganisation einer diktatorisch geherrscht habenden Partei geben darf, dann ist es wirklich nur ein semantischer Streit. Wenn man aber einer derart durch u.a. Hunderte von Toten diskreditierten Nachfolge-Partei einer diktatorisch geherrscht habenden Partei die von ihr auf Grund des bei Wahlen zu Tage getretenen Wählerwillens Unverbesserlicher beanspruchte Regierungsverantwortung zugestehen will – und die Lebensrealität geht in den meisten östlichen Bundesländern in diese Richtung und wird von Leuten getragen, die sich 15 Jahre nach der Wiedervereinigung nicht entblöden kundzutun: „In der DDR waren wir glücklicher. Wenn jemand die Mauer wieder aufbauen wollte, würde ich sagen: Ja.“ (STERN 09.09.04) -, dann muss man sich die Frage gefallen lassen: Was wäre, wenn sich (nach einer dafür allerdings erst noch vorzunehmenden Gesetzesänderung) NPD, DVU oder die Republikaner (bisher durch Strafnormen verbotenerweise) offen als Nachfolgeorganisation der NSDAP ausgäben, gerade einmal mühsam ein „Bedauern“ über »gewisse Auswüchse« während der NS-Zeit zum Ausdruck brächten, eine Entschuldigung verweigerten und nach dieser sich für die Öffentlichkeit mühsamst abgerungenen historischen - zunächst meist nur verbalen - Bewältigung der grässlichen Untaten ihrer Vorgängerin nunmehr in unserer Demokratie Regierungsmitverantwortung beanspruchten? Wenn sie 12 Jahre nach dem Zusammenbruch des Nazi-Regimes in Berlin mitregiert hätten? Ein ehemaliger Bürgerrechtler aus der DDR kritisierte das analoge Verhalten der PDS so: Die PDS will zwar das unangenehme Erbe der SED los sein, aber mit deren Kasse und Mitgliedern aus der historischen Verantwortung verschwinden. Ein polemisch verkürztes Argument, gewiss, aber wie wollte man ihm widersprechen? Eine PDS, die sich nicht als Nachfolgepartei der SED begriffe und ausgäbe, wäre moralisch unangreifbar und demokratisch legitim, eine Regierungskoalition mit ihr eine legitime Gestaltungsmöglichkeit des politischen Lebens. Es rührt aber an 168 die Grundlagen einer Demokratie und den Konsens zwischen Demokraten über das Grundverständnis von Demokratie, wenn eine Partei, die ausdrücklich die Nachfolge einer diktatorischen, ihre Herrschaft mit Terror bis zur physischen Vernichtung ihrer Gegner durch Fallbeil oder Genickschuss zementiert habenden Partei in einer Demokratie Gestaltungsrechte für sich in Anspruch nimmt, wenn eine solcherart unter historisch empfindenden Demokraten völlig diskreditierte Partei in einer demokratischen Gesellschaft auf welcher politischen Ebene auch immer an Regierungsmacht beteiligt wird. Das sehen neben den geschichtslosen ewig-gestrigen Systemverweigerer, die eine andere Bundesrepublik wollen, aber leider auch die ebenfalls geschichtslosen jungen Wähler der PDS völlig anders. Denen ist der historische Ballast der SED-Nachfolgeorganisation völlig gleichgültig! Doch man kann sich nicht einfach aus der Geschichte fortstehlen, wenn sie einem nicht (mehr) passt! Das müsste auch Schülern zunächst bewusst gemacht und das muss an einigen Beispielen klargestellt worden sein, ehe die PDS-Hochburgen in Ostberlin näher untersucht werden. Nur mit diesem Hintergrundwissen kann man sich dem Phänomen der PDSHochburgen und ihrer Wählerschaft in Ostberlin adäquat zu nähern versuchen - und wird nach Meinung des der kommunistischen Ideologie unverdächtigen "Wossis" "König Kurt" Biedenkopf doch fehlgehen: "Der Westen versteht nichts von der PDS! Die westlichen Parteien geben den Ostdeutschen nicht ihre Würde, dass ihr Leben in der früheren DDR nicht umsonst gelebt war." Das ist das tiefere Geheimnis des Wahlerfolges der PDS in Ostdeutschland. Wegen dieses Spezifikums hat die PDS in Westdeutschland nie ein Bein an die Erde bekommen. Das blieb auch so, solange die PDS ausschließlich als „PDS“ firmierte. Das in einem DLF-Interview geäußerte biedenkopfsche Urteil deckt sich mit Umfrageergebnissen, denen zufolge mehr als 90 % der "Ossis" den "Besser-Wessis" keinen blassen Schimmer über ihre früheren Lebensumstände zubilligen. Keiner der großen Westparteien ist die Integration der Ostdeutschen, insbesondere der ehemals privilegierten Regierungskader und Parteifunktionäre, in hinreichendem Maße gelungen, denn keine der großen Westparteien gibt diesen Ostdeutschen der insbesondere 40-60-Jährigen das Gefühl, dass ihr Leben vor der Wiedervereinigung (irgendwie) auch lebenswert gewesen war. Wer der SED zugejubelt und alles abgenickt hatte, musste ja auch nur unter der kommunistischen Mangelwirtschaft leiden und saß nicht in Bautzen! Die SED, ist die Partei, »die mit dem MfS regierte«. Wer in Bautzen oder anderswo gesessen hatte, ohne kriminelles Unrecht begangen zu haben und vielleicht nur die Geltung der zwar in internationalen Verträgen für die Bürger der DDR vereinbarten, ihnen innerstaatlich aber vorenthaltenen Menschenrechte eingefordert hatte, oder sonst von dem SED-Staat verfolgt worden war, ist nicht in Gefahr, die Nachfolger seiner ehemaligen Gefängniswärter zu wählen. Bei den - geschichtslosen - älteren PDS-Wählern, die noch rund 80 % der Mitglieder ausmachen, zählt - trotz nunmehr bestehender Reisefreiheit, eigener westlicher Autos statt der "Rennpappe" und dem nunmehrigen Besitz damals nicht selbstverständlicher Versorgungsgüter wie Telefone u.s.w. - ausschließlich dieses erhalten gebliebene vergangenheitszugewandte, dumpf wabernde Lebens- und "Wir"-Gefühl aus der SED-Zeit und die Erinnerung an ihren (meist herausgehobenen) früheren Arbeitsplatz, nicht aber das nach der Wende selbst von ihnen nicht mehr zu unterdrückende Wissen um die Verbrechen "ihrer" damaligen Partei, deren bewusste Nachfolge die PDS in Anspruch nimmt, die in ihren Reihen immer noch eine "kommunistische Plattform" duldet. Nur in Brandenburg und in Sachsen gelang es durch die von den Persönlichkeiten der dortigen Ministerpräsidenten ausgehende Integrationskraft, Ulbrichts und Honeckers Erbengemeinschaft prozentual kleiner zu halten als in den anderen ostdeutschen Bundesländern. Das Niederlegen von Kränzen an den Resten der Mauer durch die PDS zum Gedenken an den 40. Jahrestag des Mauerbaus empfanden die SED-Opfer so, als wenn NPD, 169 DVU oder die Republikaner am 20. Juli zur Erinnerung an das 1944 versuchte Attentat auf Hitler an der Hinrichtungsstätte Plötzensee zum Gedenken an die Märtyrer Kränze niederlegen würden. Innerlich zu tiefst getroffen haben sie – für mich durchaus verständlich – außer sich vor Schmerz über das ihnen und ihren Angehörigen von der „ParteiMutter“ der PDS, der SED unseligen Angedenkens, zugefügte, teilweise ihre Liebsten getötet habende Unrecht die von der PDS gestifteten Kränze empört zertreten! Und sollte es nach Jahrzehnten keine noch lebenden Opfer der SED-Diktatur mehr geben, dann besteht das Problem der historisch-moralischen Diskreditierung einer diktatorisch geherrscht und dabei gemordet habenden Partei unter Demokraten trotzdem weiter! Wenn das nicht so wäre, dann könnten NPD, DVU und Republikaner - analog dem sofortigen Vorgehen der PDS - nach über einem halben Jahrhundert äußerer Häutung schamlos und ungestraft die Nachfolge der NSDAP beanspruchen, antreten und von unserer schnell vergessenden Gesellschaft Absolution verlangen! Gegner einer Zusammenarbeit zwischen historisch unbelasteten Parteien einerseits und der PDS andererseits sprechen daher von einem „schamlosen Tabubruch“ (Westfälische Nachrichten 13.06.01). Das von 1984-89 sogar dem Politbüro angehörende ehemalige SED-Mitglied Schabowski äußerte sich auf Grund seiner intimen Mitglieder- und Strukturkenntnisse sowohl der SED unseligen Angedenkens wie auch der jetzigen PDS im SPIEGEL 09.07.01 dahingehend: „Die PDS ist nicht die Nachfolgepartei der SED, sondern deren Fortsetzungspartei – nur ohne Moskau." Vielleicht wird durch den Zusammenschluss von PDS und WASG zur „Linkspartei.PDS“ der bisher ausgebliebene Selbstreinigung angestoßen, nach dessen Abschluss von einer inhaltlich neuen Linkspartei und nicht nur von einer bloßen Umetikettierung gesprochen werden könnte. Weil ein Kritikpunkt war, dass die Wessis das Phänomen PDS nicht verstehen könnten, ein Kommentar aus den Dresdner Neueste Nachrichten vom 20.06.05 zu dem PDS-WASGProjekt: Kommentar Lafontaine-Eintopf von Dieter Wonka Vor der Bundestagswahl 2002 beeindruckte Guido Westerwelle eine staunende Öffentlichkeit und entsetzte Nachdenkliche mit der kühnen These, Millionen von Stimmen seien für die kleine FDP möglich, wenn es nur gelinge, den Volkszorn gegen miese Verhältnisse, eine schlechte Regierung und einen überquellenden Staat zu mobilisieren. Befeuert damals von Jürgen Möllemann zeigte sich der liberale Parteiführer als schwankender Jüngling zwischen Klamauk und Großkotz. Die Sache ging schief. Auf Möllemanns Weg wandelt jetzt wieder einer. Lafontaine, dem mal der "Fremdarbeiter" heraus rutscht, der aus bloßem Populismus heraus mit Volksbefragungen spielt, sprach bei seiner Kür zum Listenführer der Polit-Selbsterfahrungsgruppe namens WASG vom "Irrenhaus" des Bundestages. In diesem säßen nur noch Politiker als Erfüllungsgehilfen der diversen Wirtschafts- und Heuschreckenverbände. Dem Mann rutscht ziemlich viel heraus, was nicht nur historisch kontaminiert ist. Nur er, der Oskar von der Saar, sei berufen, in dieser dramatischen Lage die Massen zu gewinnen, aus dem Elend zu befreien und den Unterdrückten einen neuen Wohlstand zu versprechen. Mit dieser Hybris zeigte sich Lafontaine schon 1990, als er als Kanzlerkandidat der SPD eiskalt die Wiedervereinigung zur schlichten Rechengröße in Oskars Weltbild reduzierte. Als Demagoge ist er zweifellos ein ganz Großer. Kein Wunder, dass die Riege der Systemverweigerer aus der PDS-Wärmestube glänzende Augen bekommen: Mit Lafontaine und Gysi wäre man kaum noch aufzuhalten. Dann ließe sich vielleicht auch die Schmach des System-Untergangs tilgen. Wieder einmal könnte ein Saarländer das große Wort führen, so als ließe sich die Zeit zurück drehen. Manchen WASG-Aktivisten aus Ost wie West dreht es bei so viel Zeitreise den 170 Magen um. Ohne Konzept die Krise einfach überholen. Das muss doch selbst den vielen PDS-Realisten komisch vorkommen, die sich mühsam auf den Weg gemacht haben in die soziale Marktwirtschaft - auch durch verantwortliches Mitregieren. Weg mit Hartz IV ist das Ein-Punkt-Programm der WASG. In ihr bündelt sich eine Menge an berechtigtem Protest und viel Wünsch-Dir-Was. Ein Lafontaine sammelt dort nicht das empörte Bürgertum zum Zweck der Korrektur der Politik der Herrschenden. Diese eitle Kampfausgabe eines Agitators nutzt alle Clubs für eigene Zwecke. Hilfreich ihm zur Seite schlängelt sich ein Club von WASG-Funktionären, die einfach auch mal oben ankommen und wirklich wichtig sein wollen. Die Linke hat es schwer in diesen Tagen. Aber diesen hanebüchenen Eintopf aus Lafontaine, gewürzt mit Gysi, gespickt mit PDS-Traumtänzern sollten die Bürgerbewegten von der Anti-Hartz-Front nicht als Garnitur schmücken. Hier wird missbraucht statt ernst genommen. Das Hamburger Abendblatt (27.05.05) brachte die Sentenz: „Heute gebärden sich die Brandstifter von gestern als Biedermänner und so unverfroren wie verlogen als Anwälte der kleinen Leute. ... Oskar Lafontaine und Gregor Gysi könnten einer solchen Truppe vielleicht zu einer gewissen Bedeutung verhelfen. Denn beide sind unterhaltsame Selbstvermarkter, taugen als Volkstribun und treiben sich gern in Talkshows herum. Sie könnten den Blick darauf verstellen, daß hinter ihnen eine ziemlich trübe und ziemlich politikunfähige Truppe steckt. Daß ausgerechnet sie ein politisches Programm liefern könnten, das auch nur halbwegs realitätstauglich wäre, das kann nur erwarten, wer auch noch an den Weihnachtsmann glaubt.“ In der Frankfurter Rundschau (03.06.05) wurde analysiert: „PDS und WASG könnten am Ende nicht nur das linke Spektrum verändern, sondern letztlich sogar die Republik. Sollte die Linkspartei nämlich in den nächsten Bundestag einziehen, dann könnte die Situation entstehen, in der die Mehrheit weder für Schwarz-Gelb noch für Rot-Grün reicht. In diesem Fall würde alles auf eine große Koalition hinauslaufen. Politisch ginge das den Linken gegen den Strich, strategisch würde es sie nur weiter festigen: als sichtbare Alternative zu den "Neoliberalen" in allen Lagern.“ Das große Interesse an den Berliner Wahlkreisen hängt damit zusammen, dass die grundsätzliche Regelung der 5-%-Sperrklausel unseres Wahlsystems dadurch wieder außer Kraft gesetzt werden kann, wenn es einer »Splitterpartei« mit einem Stimmenanteil von unter 5 % gelingt, irgendwo im Bundesgebiet mindestens drei Direktmandate zu erringen. Dann ziehen nicht nur diese direkt gewählten Wahlkreisabgeordneten in das Parlament ein, sondern gemäß dem prozentualen Anteil an Zweitstimmen auch noch weitere Kandidaten dieser - eventuell nur regional - etwas groß geratenen Splitterpartei über verschiedene Landeslisten. Weil in Ostberlin 1994 vier Bewerber der PDS um ein Direktmandat mit Erststimmen-Mehrheit gewählt worden waren, wurden durch die vier erfolgreichen Wahlkreisbewerber 26 weitere PDS-Mitglieder in den Bundestag gehievt. So etwas erregt natürlich Aufsehen. 1998 kam die PDS bundesweit über 5 %, so dass sich die Problematik gar nicht erst stellte. Das Land Berlin hatte nach 1998 auf Grund seiner neueren Bevölkerungszahl beim bundesweiten Neuzuschnitt der Wahlkreise einen Wahlkreis verloren. Die verbliebenen Wahlkreise mussten daher ebenfalls neu zugeschnitten werden. Gleichzeitig wurde eine Bezirksgebietsreform vorgenommen. Die Grenzen der neu abzugrenzenden Wahlbezirke haben sich an den Grenzen der neu zugeschnittenen Bezirke zu orientieren. Und dabei sind die PDS-Hochburgen betroffen!! Die PDS schrie auf, dass ihr das Wasser abgegraben werden solle: Man versuche auf diese Weise, ihren Einzug in den Bundestag zu verhindern. Und tatsächlich: 2002 konnte sie nur 2 Direktmandate in Berlin erringen. Da sie auch die 5-%Hürde nicht überwunden hatte, blieb sie endlich draußen vor der Tür, wo sie als umbenannte Nachfolgerin der in der (Ex-)DDR diktatorisch geherrscht habenden SED von Anfang an schon hingehörte! Nur ihre beiden gewählten Direktkandidaten konnten in das Parlament einziehen. 171 DER TAGESSPIEGEL 16.10.00 Neue Wahlkreiseinteilung ebnet PDS-Hochburgen in Ost-Berlin ein Bezirksfusion Der PDS kommen in Berlin die Direktmandate abhanden Mit der Bezirksgebietsreform werden auch die Wahlkreise neu zugeschnitten Ulrich Zawatka-Gerlach Die PDS hat ein Problem. Wenn sie 2002 wieder in den Deutschen Bundestag einziehen will, muss sie die Fünfprozenthürde überspringen oder drei Direktmandate erringen. Aber schon bei der Bundestagswahl 1998 kam sie nur auf knappe 5,1 Prozent, und Direktmandate sind der PDS - jedenfalls in Berlin - nur noch in Hellersdorf/Marzahn und Lichtenberg/Hohenschönhausen sicher. Denn die zwölf Wahlkreise in Berlin werden neu zugeschnitten, in Anpassung an die Bezirksgebietsreform. Die Wahlkreise Friedrichshain/Lichtenberg und Mitte/Prenzlauer Berg, zwei Hochburgen der PDS, in denen 1998 Christa Luft und Petra Pau siegten, gibt es dann nicht mehr. Noch hat der Bundestag die Wahlkreisreform nicht beschlossen, aber voraussichtlich wird sich die Neugliederung an den zwölf Berliner Großbezirken orientieren, die Anfang 2001 gebildet werden. Nur Charlottenburg-Nord soll (wie bisher) bei Spandau bleiben und Prenzlauer Berg ein kleines Stück an Friedrichshain/Kreuzberg abgeben. Der Rest von "Prenzelberg" wird mit Weißensee und Pankow zu einem neuen Wahlkreis verbunden. Und genau dort steckt für die PDS das erste Problem: Ihr Direktkandidat könnte, das Wahlergebnis von 1998 umgerechnet, diesen Wahlkreis mit 33,5 Prozent der Erststimmen gegen die SPD (36,5 Prozent) nicht gewinnen. Das zweite Problem ist für die PDS der neue Wahlkreis Mitte/Tiergarten/Wedding. In diesem westlich dominierten Gefilde wird sie mit Sicherheit weit hinter SPD und CDU liegen. Im Wahlkreis Treptow/Köpenick, der unverändert bleibt, zog der SPD-Kandidat Siegfried Scheffler schon 1998 am ehemaligen PDS-Parteichef Lothar Bisky vorbei. Bisky steht 2002 nicht wieder zur Wahl. Ein PDS-Wahlbewerber, der weniger zugkräftig ist, wird in einem Stadtgebiet, das von Jahr zu Jahr bürgerlicher wird, erst recht nicht die SPD hinter sich lassen können. Was der PDS als sichere Bank bleibt, sind der alte GysiWahlkreis Hellersdorf/Marzahn (1998: 46,7 Prozent) und der neu zugeschnittene Wahlkreis Lichtenberg/Hohenschönhausen (das Ergebnis 1998 umgerechnet: 42,5 Prozent). ... Auf ein drittes Direktmandat im übrigen Ostdeutschland kann die PDS nicht vertrauen. Wohl nur in Rostock hätte sie eine kleine Chance. Also bleibt die Hoffnung, bundesweit wieder auf fünf Prozent der Stimmen zu kommen. Oder ein Super-Kandidat, der im - ansonsten aussichtslosen - Wahlkreis Prenzlauer Berg/Weißensee/Pankow die Wähler hellauf begeistert. Dem müsste die SPD dann Paroli bieten. .... Die Hochburgen der bisherigen PDS liegen in den Ostberliner Bezirken, wo die PDS-Mutterpartei SED einst ihre Funktionäre in riesigen Neubau-Plattensiedlungen angesiedelt und mit für DDRVerhältnisse außergewöhnlich gutem Wohnraum versorgt hatte. Diese frühere Kader- und Funktionärsschicht bildet noch immer das Rückgrat der von SED in zunächst SED-PDS, dann PDS und nun ein drittes Mal in „Die Linkspartei. PDS“ umbenannten örtlichen Parteiorganisationen. Da haben nach dem Zusammenschluss von PDS und WASG zur Linkspartei die wenigen versprengten WASGler keine Chance, großen Einfluss zu nehmen. 172 HELLERSDORF Tagesspiegel 25.08.00 Unsere schöne Plattenstadt Hellersdorf ist grau und hässlich? Unsinn - hier wird mit Kunst und Grün nur so um sich geworfen Kerstin Kohlenberg Am Anfang war die Platte. Und das nicht zu knapp. 28 000 Wohnungen stehen in Hellersdorf auf 300 Hektar. Eine Riesenwohnungssoße, die pünktlich ein Jahr vor der Wende fertig wurde. Die ersten Mieter stapften in Gummistiefeln in ihre Wohnungen. Die Infrastruktur war - na ja, sagen wir mal: bescheiden. Dann kam die Wende und die Frage: Was machen mit einer solchen Großsiedlung? Rudolf Kujath sitzt im Baukasten neben der U-Bahnstation Hellersdorf und wirft mit Kunst und Grün um sich. Genau darauf hat er bei der Entwicklung von Hellersdorf gesetzt. Grünflächen, Parks, künstliche Seen. Fassadenkunst, Kunst auf den Plätzen, Kunst auf dem Dach. Kujath ist der Geschäftsführer der WoGeHe, der Wohnungsbaugesellschaft Hellersdorf, der fast das ganze Stadtviertel gehört. Geplant war Hellersdorf ursprünglich zum Schlafen. Das Einkaufen spielte in der DDR-Planung von Hellersdorf eine untergeordnete Rolle. Die Aufgabe für Kujath war also klar: Die Schlafburg musste zu einer Stadt erweckt werden. Mit Geschäften, Grünflächen und unterschiedlichen Kiezen, denn nur wenn man sein Haus ohne große Anstrengung in der Masse der Platten wiedererkennt, kann sich ein Gefühl von "zu Hause" einstellen. Und nur dann fühlen sich die Leute wohl und wollen wohnen bleiben. Ein rotes Viertel entstand, ein Marktplatz, ein städtisches Viertel mit Fachhochschule und viele grüne Viertel. Das Projekt Hellersdorf fing an zu leben und ist nun, zehn Jahren danach, eines der beiden Berliner ExpoProjekte, das in Berlin und Hannover ausgestellt ist. MARZAHN Wochenpost (Berlin) 20.10.94 (Ausschnitte) von Renate Rauch Gysis Hinterhof Wie in Berlin-Marzahn die PDS triumphierte In den Satellitenstädten Marzahn/Hellersdorf (BT-Wahlkreis 261) leben 284.000 Einwohner - ihr Durchschnittsalter: knapp 32 Jahre. Die Familieneinkommen sind die höchsten in den neuen Bundesländern, das Nettoeinkommen pro Haushalt beläuft sich auf 3000 DM, mehr als in vielen Westberliner Stadtteilen. In Kreuzberg etwa liegt es bei 2300 DM. 52 % aller Erwachsenen haben Abitur, Fach- und Hochschulbildung, 97 % einen Berufsabschluss - alles gute Startbedingungen für die marktwirtschaftliche Erfolgsgesellschaft. Dennoch ist das Viertel eine Hochburg der PDS: PDS 37,7 % der Zweitstimmen (SPD 32,2 %, CDU 19,4 %, Bündnis90/Grüne 4,5 %, FDP 1,7 %, Republikaner 2,0 %) Bei Erststimmen fiel die Wahl noch klarer aus: Gysi gewann 48,9 %. [Die Autorin vergleicht Marzahn mit Disneyland:] Ein Dorfkern, dem das Dorf amputiert wurde, eine Ellipse von zwei Kopfsteinpflasterstraßen um einen Anger mit Kirche herum. Große Bäume, kleine Häuser. ...Hier hat der Abgeordnete Dr. Gregor Gysi sein Wahlkreisbüro.... Disney-Marzahn ist umzingelt von Beton, Honeckers ehrgeizigem Wohnungsbauprojekt. Fünf- und elfgeschossige lange Kästen, Zwanziggeschosser, flache Kinderkombis und Mehrzweckgaststätten. Der alte Dorfkern war als gesellschaftliches Zentrum geplant, mit Handwerk und Geschäften, als Museum einer Lebenskultur, die Marzahns Neubauten nicht besaßen. Dafür Zentralheizung und Bad, was für die Erstbewohner meistens eine Errungenschaft war. Inzwischen sind die Mieten fast auf das Siebenfache gestiegen, doch Geld wird höchstens in dringende Reparaturen gesteckt. ... Als Marzahn bezogen wurde, gab es Legenden im Westen. Nur SED-Mitglieder bekämen hier Wohnungen, Mitarbeiter von Ministerien und so weiter, aus dem zuverlässigen Sachsen importiert. Und die, so kann man heute nahtlos begründen, seien natürlich das jetzige Trutz- und Frustpotential, das PDS wählt. Obwohl sich mit dieser Begründung nicht erklären lässt, wieso auch am Prenzlauer Berg die PDS auf über 33 % kam. 173 Für Marzahn kriegten auch ganz normale Leute die Zuweisung. Ohne Parteibuch, aber mit Kind, das über das Warten in der Einzimmerwohnung mit Außenklo schon ins schulpflichtige Alter gekommen war. Erstaunlicherweise richteten die Leute sich ein in den Betonblocks. Die Wegzugsquote war gering. Nicht alle guten Genossen von einst sind heute stramme PDS-Parteigänger. Einige haben den Sprung in die Marktwirtschaft bestens geschafft und laufen jetzt wieselflink an jenen vorbei, mit denen sie einst Hausfeste feierten. Dafür gibt mancher, der zu DDR-Zeiten keineswegs die Fahne raushängte, diesmal seine Stimme der PDS. „Damit die in Bonn bisschen erschrecken und merken, uns gibt es noch."... An der Haltestelle der Straßenbahn, die nicht fährt, weil die Schienen herausgerissen sind, drängen zwei Kumpel einen dritten, der aussieht wie Besuch aus dem Westen, ihre feuchte Meinung auf. „Inne DDR durfste ja nich inne Opposition sein. Und jetzt wolln eben alle Opposition sein, weil wir inne Demokratie leben. Und da wählen die einen eben PDS, weil se gegen Bonn opponieren. Und die anderen wählen CDU. Nich, weil se den Dicken unbedingt so jut finden. Die wolln der alten DDR noch nachträglich ein Schnippchen schlagen, verstehste? Weil die sich darüber ärgert." Eine prima Erklärung. So wie es bei den Gewählten nur Sieger gibt, gibt's bei den Wählern nur Opposition. „Ick hab ooch opponiert", sagt der zweite stolz. „Ick hab jar nich gewählt." „’Mal will die PDS eine stramme parlamentarische Regierungspartei sein, mal Bündnispartner für die Entrechteten, mal eine Art ostdeutsch-folkloristischer Politikersatz’, urteilt der Soziologe Helge Meves. Der muss es wissen, denn er ist Mitglied der PDS …“ (STERN 02.09.04) Vor der vorgezogenen Neuwahl 2005 wurde der angestrebte Zusammenschluss zwischen der neuen linken, hauptsächlich von von der SPD und ihrer Agenda 2010 enttäuschten Gewerkschaftsfunktionären getragenen, inzwischen rund 9.000 Mitglieder umfassenden Partei „Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit“ (WASG) und der rund 60.000 Mitglieder umfassenden PDS vollzogen. Das »gemeinsame« Parteienprojekt heißt nun „Die Linkspartei. PDS“ und firmiert mit dem Logo: „Die Linken. PDS“; wobei mit Rücksicht auf Ressentiments in der westdeutschen Bevölkerung das Kürzel „PDS“ weggelassen werden kann. Die SED hat sich damit zum dritten Mal umbenannt: Von zunächst SED auf „SED-PDS“, dann nur noch „PDS“ und nun „Die Linkspartei. PDS“. Der Bundeswahlleiter (DLF 25.07.05): Rein rechtlich handelt es sich bei der Linkspartei um eine umbenannte PDS, da es nach dem BWahlG eine gemeinsame Liste mehrerer Parteien nicht geben dürfe. Die (alte) PDS ist rechtsidentisch mit der (angeblich neuen) Linkspartei. Die Lausitzer Rundschau, als ostdeutsche Zeitung ganz nah dran am Puls des ostdeutschen Geschehens, kommentierte den Zusammenschluss von PDS und WASG am 18.07.05 mit dem aus einer früheren ostdeutschen Werbekampagne zitierten Spruch: „Raider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nix!“ Die Rheinische Post sprach von einer „zweifach umgeschminkten SED“, die große Versprechungen für die ärmeren Schichten der Gesellschaft mache (u.a. gesetzlicher Mindestlohn von € 1.400,- brutto, dann in einer Nachbesserung nach erregter interner Diskussion 1.000 € netto) und eine Mindestrente von € 800,-), ohne einsichtig nachweisen zu können, woher bei den bekanntermaßen leeren Staatskassen und den demographischen Verwerfungen das Geld für die versprochenen Wohltaten kommen solle, weil ihr die von der PDS vorgeschlagene Gegenfinanzierung nicht vertrauenswürdig erschien. DER SPIEGEL (15.07.05): Die Linkspartei verdanke „... ihren Triumph einer allergischen Abwehrreaktion der Bevölkerung, die sich gegen alles richtet, was nach Reformen riecht.“ Die Sozialsysteme ächzten unter der Last der eingegangenen Versprechungen, die Wählergruppen verlangten ungerührt nach mehr. Das Volk sei es leid, auf die Reformdividende zu warten. Nun seien vor allem jene diskreditiert, die Veränderungen aus der Notwendigkeit heraus wagten. Die angeblich neue Partei „Die Linke. PDS“ spiele sich zum Anwalt der Verlierer auf. Die einzelnen gesellschaftlichen Gruppen haben einen verengten Blick auf das Gemeinwohl und versuchen für ihre Klientel herauszuholen, was herauszuholen geht. Die Linkspartei sei nicht nur 174 eine Partei des Protestes. Eine Protestentscheidung verbessere die Labenslage ja nicht. „Die Linkspartei ist nicht nur eine Partei des Protestes, sondern auch eine Partei der Versprechen. Ihr Wahlprogramm würde überschlägig 50 Mrd. Euro kosten, wenn es Wirklichkeit würde.“ Und das, obwohl 2005 erstmals mehr Bundesbürger überwiegend von staatlichen Transferleistungen wie Rente, AG II oder BAFöG lebten als von versicherungspflichtiger Beschäftigung. Die Forderungen mussten dann reduziert werden auf immer noch illusionäre 1.200-1.250 € für einen Mindestlohn und 750 € für die staatliche Grundsicherung; auch noch völlig überzogen: „SPD-Chef Franz Müntefering warf der Linkspartei im "General-Anzeiger" vor, Steuererhöhungen im Umfang von 70 Milliarden Euro anzustreben, gleichzeitig aber "Geschenke" in Höhe von bis zu 155 Milliarden Euro zu versprechen“ (SPIEGEL ONLINE 10.08.05). Ein Kommentar in der Thüringer Allgemeinen vom 28.08.2005 zu dem am Vortag beschlossenen Wahlprogramm: Anbohren Das linke Wahlprogramm spaziert durch einen Märchenwald. PDS und WASG teilen mit vollen Händen aus, was nicht da ist. 1000 Euro Mindestlohn wollte der Parteivorstand, 1400 Euro verlangte man im Saal. Warum aber streiten? Die Höchstsumme gilt. Schließlich müssen weder Gysi noch Lafontaine die Mittel erwirtschaften. Da fallen einem die Ideen geradezu in den Schoß für 800 Euro Mindestrente, 250 Euro Kindergeld, 420 Euro Arbeitslosengeld II, gebührenfreie Kindertagesstätten und Studienplätze. Nichts scheint leichter, als Geld dafür einzutreiben, vornehmlich bei der Wirtschaft, bei gewinnstarken Unternehmen. Mercedes und Henkel - ungeachtet eigener Zukunftssorgen - sollen angebohrt werden, damit flächendeckend die schwachen Ostunternehmen 1400 Euro Mindestlohn zahlen können. Ein solches Programm führt die deutsche Wirtschaft in wenigen Jahren auf DDR-Niveau. Machbar erscheint noch der Plan, die Steuern für Gutverdiener wieder höher zu setzen. Damit zumindest ließen sich einige Milliardenlücken im Staatsetat und den Sozialkassen schließen, vor deren Existenz die Linkspartei einfach die Augen verschließt. Von Ingo LINSEL Es hatten sich rechtliche Schwierigkeiten für ein Zusammengehen von WASG und PDS ergeben: Eine weitgehend gleichberechtigte Kandidatur von WASGlern auf PDS-Listen, womöglich systematisch nach dem Reißverschlussverfahren, wäre ein unerlaubter verdeckter gemeinsamer Wahlvorschlag zweier Parteien. Es wären nach unserem Wahlgesetz unzulässige „Mischlisten”. Darum war keine gemeinsame Liste von WASG und PDS möglich, da zur Bundestagswahl laut § 7 BWG keine Listenverbindungen verschiedener Parteien, sondern nur Listenverbindungen verschiedener Landesverbände derselben Partei29 erlaubt sind. Darüber haben die Landeswahlausschüsse, der Landes- und der Bundeswahlleiter zu wachen. Würden sie es nicht tun, könnte die Wahl hinterher vor dem Bundesverfassungsgericht angefochten werden. Neben diesen rechtlichen Schwierigkeiten gibt es auch historisch motivierte und begründete Vorbehalte in der jeweiligen Mitgliederschaft gegen den Partner, mit dem man sich in ein gemeinsames Bett zu legen nun beschlossen hat: einerseits wollten die PDSler weiterhin als „PDS“ erkennbar sein, andererseits gab es innerhalb der WASG Vorbehalte, weil insbesondere die Bürgerrechtler der (Ex-)DDR unter den Kommunisten gelitten hatten, als sich die SED noch nicht in PDS umbenannt hatte. Diese SED-Opfer empfinden das Kürzel PDS wegen der SED-Mutter immer noch und völlig zu Recht als Makel. Die PDS hofft auf die hauptsächlich in den alten Bundesländern erringbaren Prozente, die die WASG in die Beziehung mit einbringen könnte, so dass die bisherige ostdeutsche Regionalpartei ab Zusammenarbeit oder irgendwie geartetem »Zusammenschluss« auf absehbare Zeit vom Da29 So schließen sich z.B. die Landesverbände der CDU zusammen, es gibt aber keine Listenverbindung zwischen der CDU und der (eigenständigen) CSU; erst nach der Wahl schließen sich die weiterhin eigenständige CDU und die weiterhin eigenständige CSU im Deutschen Bundestag mit jeweiliger Billigung der Mehrheit der anderen Parteien zu einer vom Gesetz erlaubten Fraktionsgemeinschaft zusammen. 175 moklesschwert der Überwindung der 5-%-Hürde verschont bliebe, falls sie wieder nicht, wie 2002, die zum Einzug in den Bundestag berechtigenden drei Direktmandate erringen würde; und die WASG hofft auf Geld und Organisationskraft der PDS und ebenfalls die Wählerstimmen von PDSlern im Westen. In dieser neuen Linkspartei ist ganz klar, wer Koch und wer Kellner ist: Die PDS formuliert das Programm, allein sie stellt die Kandidaten auf ihren auch für Nicht-Parteimitglieder »offenen« Listen auf, wobei nicht unbedingt die zwischen den Parteien vereinbarten 25 % der Sitze für WASGKandidaten freigehalten wurden und WASG-Kandidaten niedergestimmt worden sind; so gab es Unstimmigkeiten bei der Aufstellung der offenen Landeslisten für Nordrhein-Westfalen und Bayern, auf denen auf den aussichtsreichen Plätzen nur jeweils zwei Kandidaten von der WASG berücksichtigt wurden. Die PDS bezahlt den Wahlkampf – und sie allein erhält die Wahlkampfkostenerstattung für die bis zu 11-13 % prognostizierte Wählerstimmen, obwohl sie alleine vermutlich höchstens auf 5 % der Stimmen käme! So lohnt sich das Vorgehen für die PDS finanziell! Die Angst der Rechten vor der Linkspartei Die rechtsextreme NPD befürchtet das Abwandern von Protestwählern zu WASG und PDS. Auch Parteienforscher glauben an eine "Schnittmenge" beim Wählerpotenzial - zumal Oskar Lafontaine gleichfalls gegen "forcierte Zuwanderung" wettert AUS BERLIN ASTRID GEISLER UND KLAUS JANSEN Das hat den Streitern der "Volksfront von rechts" gerade noch gefehlt. Nach dem lamentablen Abschneiden bei den letzten Landtagswahlen waren sie ohnehin weitgehend desillusioniert, jetzt macht sich bei ihnen auch noch Angst um die letzten Stimmen breit - die Stimmen der sozial frustrierten, politisch heimatlosen Protestwähler. "Viele enttäuschte Wähler werden sich nun dem Linksbündnis zuwenden, obwohl sie ohne das linke Bündnis vielleicht eher die nationale Opposition gewählt hätten", warnt ein Kamerad in einem einschlägigem Neonazi-Internetforum. Andere sehen noch viel schwärzer. Jetzt hätten sich wohl "alle Hoffnungen auf rechte Erfolge bei Wahlen in nächster Zeit weitgehend zerschlagen", lamentiert ein Neonazi. Schließlich seien die meisten Protestwähler frustriert über soziale Ungerechtigkeiten "aber weder Nationalisten noch Rassisten". Sie würden ihre Denkzettel demnächst bei den Kandidaten mit der "Gutmenschen-Legitimation" abgeben - also bei den Gregor Gysis und Oskar Lafontaines, die für das neue Linksbündnis antreten wollen. Mit der rechten Volksfront liebäugeln, das Kreuzchen aber schließlich beim linken Wahlbündnis machen? So paradox die These klingen mag - Fachleute halten sie für durchaus stichhaltig. "Eine neue Linkspartei wird viel bündeln, was sonst nach rechts abgedriftet wäre", urteilt der Duisburger Parteienforscher Karl-Rudolf Korte. Auch Richard Hilmer vom Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap sieht "Schnittmengen" in der Wählerschaft von Rechtsextremen und PDS/WASG. Zum einen wollten sich beide als Alternative zu den etablierten Parteien präsentieren und Nichtwähler mobilisieren, die sich "politisch nicht mehr richtig vertreten fühlen". Zum anderen setzten beide Gruppierungen auf das Thema soziale Gerechtigkeit, um bei sozial frustrierten Arbeitslosen und Arbeitern zu punkten. "Hartz IV muss weg" oder "Quittung für Hartz IV": Schwer zu sagen, welche Forderung auf der PDS-Fahne steht und welche auf dem NPD-Banner. So austauschbar sind die Angebote indes nur auf den ersten Blick. "Ganz deutlich wird der Unterschied, wenn man die Ausländerfeindlichkeit betrachtet", sagt Meinungsforscher Hilmer. Auf dieses Alleinstellungsmerkmal legt man auch in der Berliner NPD-Zentrale wert, selbst wenn Parteifunktionäre die Vokabel "ausländerfeindlich" nicht im aktiven Wortschatz haben. Natürlich seien die Hartz-IV-Frustrierten bei der Bundestagswahl eine wichtige Klientel, sagt NPD-Bundesgeschäftsführer Frank Schwerdt. "Aber wir haben ei- 176 nen ganz anderen Lösungsansatz für soziale Fragen als das Linksbündnis." Die Linke habe die Zuwanderungspolitik schließlich vorangetrieben. Glaubt man dem NPD-Sprecher Klaus Beier, dann will die Partei im Wahlkampf auf die linke Konkurrenz reagieren. Die soziale Frage bleibe Thema Nummer eins, aber mit klarerem "nationalen" Akzent. Da wird das Linksbündnis gewiss nicht nachziehen, allein weil WASG und PDS sich auf ein antifaschistisches Selbstverständnis berufen. Allerdings stimmt das die rechtsextreme Basis nicht optimistischer. Schließlich, sorgt sich ein Kamerad, streue Lafontaine bei seinen Talkshow-Auftritten ebenfalls "nationale Phrasen". Zum Beispiel, "dass es hierzulande zuerst um den deutschen Arbeitnehmer gehen sollte". Fehlalarm eines allzu nationalen Sozialisten? Nicht unbedingt. Die Rechtspostille Junge Freiheit merkte Anfang Juni an, Lafontaines Beamtenschelte sei genau wie sein Ja zur Einschränkung des Asylgrundrechts auch bei "potenziell ,rechten' Protestwählern" angekommen. Wer sich selbst überzeugen will, kann auch in Lafontaines jüngstem Polit-Wälzer "Politik für alle" nachlesen. "Die forcierte Zuwanderung wird in Deutschland einzig von den oberen Zehntausend gefordert, die von deren Folgen gar nicht oder nur am Rande betroffen sind", schreibt der Ex-SPD-Chef. Und fordert, der Staat müsse "zuallererst für diejenigen sorgen, die seine Bürger sind". Meinungsforscher Hilmer ist allerdings sicher, dass die rechtsextreme "Volksfront" auch ohne Konkurrenz von links chancenlos wäre. "Die haben viel größere andere Probleme." So fehlten NPD und DVU vorzeigbare Kandidaten. Außerdem habe sich die "Volksfront" seit den spektakulären Wahlerfolgen in Ostdeutschland bereits publikumswirksam selbst vorgeführt: "Wenn eine Partei ,Arbeit für Deutsche' propagiert, aber ihre Zeitung in Polen drucken lässt - dann kriegen die Wähler das schon mit." (taz Nr. 7691 vom 16.6.2005) VIII. Der Wähler Zur Wahl zum 15. Deutschen Bundestag im September 2002 waren 61.432.868 Mill. Wählerinnen und Wähler zugelassen, davon 32,1 Mill. Frauen und 29,3 Mill. Männer. Alle Wähler sind mit Namen und Wohnanschrift in Wählerverzeichnissen erfasst. Dabei haben wir es leichter als die Mongolen, die fast zur Hälfte den gleichen Nachnamen tragen: Borjigin nach dem Stammesnamen von Dschingis Khan, auf den sich alle irgendwie beziehen wollen, nachdem die Kommunisten ihnen in ihrem revolutionären Wahn ihre Nachnamen genommen hatten und die Mongolen sich nach der Beendigung der kommunistischen Herrschaft neue geben mussten. „Sie machten die Mongolen zu einem Volk, das sich von da an mit Vornamen begnügte. … Erst 1997 verpflichtete ein neues Gesetz die 2,5 Millionen Mongolen, sich wieder einen Nachnamen zuzulegen. Da sie ihren alten vergessen hatten oder nicht kannten und die Wahl freiwillig war, nannten sich die meisten stolz nach dem Klannamen ihres alten Reiterhelden Dschingis Khan. Ämter verzweifeln daran, Banken, Kreditkartengesellschaften und Telefonbuchdrucker kapitulieren“ (DIE WELT 27.10.04). Und natürlich ebenso die für die Ausrichtung der Wahl zuständigen Behörden. Andere Schwierigkeiten haben z.B. die USA bei der Erstellung der Wählerverzeichnisse in den einzelnen Bundesstaaten: Da die USA weder Ausweis- noch Meldepflicht kennen, sich oft nur mit einem Führerschein ausweisen, ist das von den einzelnen Bundesstaaten in eigener Verantwortung ganz unterschiedlich geregelte System der Stimmabgabe und Auswertung fehleranfällig; und da die Präsidentschaftswahlen ausschließlich Angelegenheit der einzelnen Bundesstaaten sind, die Hauptstadt Washington aber herausgelöst aus der bundesstaatlichen Gliederung in dem der direkten Verwaltung durch den Bundeskongress unterstehenden District of Columbia liegt, durften die Einwohner Washingtons bis 1961 nicht an den Präsidentschaftswahlen teilnehmen. Das ist so, als wenn die Einwohner Berlins auch nach der Wiedervereinigung weiterhin nicht an den Bundes- 177 tagswahlen hätten teilnehmen dürfen, wie sie es nach dem Krieg wegen des Status’ Berlins als von den Alliierten gemeinsam verwaltete Stadt jahrzehntelang nicht durften. In den USA muss man sich als Neuwähler mangels auf der Grundlage von Meldeunterlagen erstellbarer Wählerlisten vor der Wahl als Wähler registrieren lassen – wobei von Republikanern gegenüber Afro-Amerikanern Schindluder durch Verweigerung der Registrierung betrieben oder ihnen weit entlegene, für sie kaum erreichbare Wahllokale zugewiesen wurden, da sie mehrheitlich den Demokraten ihre Stimmen geben; für unseren bundeseinheitlich geregelten Wahlablauf undenkbar. So eine laxe Erfassung der Wahlberechtigten lädt natürlich zu Missbrauch geradezu ein: In den mit unseren Bundesländern vergleichbaren (Teil-)Staaten der USA, in denen die Zustimmung für einen der Kandidaten auf der Kippe stand, sollen sich über die Landesgrenzen hinweg vermehrt Wähler aus den Nachbarstaaten gemeldet haben, die dort nicht als wohnhaft gemeldet sind. In Alaska sind bei der Präsidentenwahl 2000 mehr Menschen in die Wählerlisten eingetragen gewesen, als es wahlberechtigte Einwohner gab. In Indiana wimmelten die Wählerverzeichnisse von Toten, Schwerverbrechern, die nicht wählen dürfen, und mehrfach Registrierten Zur Wahl erscheinende Wähler werden darum mit der Wahlliste der letzten Wahl verglichen: Wer da nicht drauf steht, gilt erst einmal als „provisorischer Wähler“, dessen Wahlberechtigung bei einem Kopf-an-Kopf-Rennen hinterher durch Wahlkommissionen oder letztlich gerichtlich zu klären versucht wird; ein Zustand, den wir nicht kennen, da bei uns die Wählerverzeichnisse aufgrund der bestehenden Meldepflicht erstellt werden können. Die Zeitung "Columbus Dispatch" fand bei der Überprüfung von Wählerlisten in Ohio ein Mordopfer und zwei gesuchte Terroristen. In der BRD hatten die weiblichen Wahlberechtigten 2002 ein numerisches Übergewicht von 2,8 Mill. Stimmen (das aber fast ausschließlich in der Gruppe der über 60-Jährigen zum Tragen kam). U.a. das macht Frauen für Politiker interessant! Wer wüsste nicht gerne, was Frauen denken! Die Parteien interessiert es – jedenfalls alle vier Jahre einmal. So hat man durch intensive Forschung z.B. herausgefunden, dass Frauen je älter, desto konservativer wählen als Männer, aber nicht so extrem. Die Rechtsextremen werden zu zwei Dritteln von Männern gewählt, die nicht wahrhaben wollen, dass, wer eine rechtsextreme Partei wie die NPD oder die DVU mit ihrer Glorifizierung nationalsozialistischen Gedankenguts wählt, schlicht die Nazi-Verbrechen bis hin zum industriell betriebenen Massenmord leugnet, die dazu führten, dass Deutschland rund ein Viertel seines Staatsgebietes von 1937 verlor und nun nicht mehr „… bis an die Memel“ reicht, wie es in der ersten Strophe des Liedes der Deutschen heißt, die von den Rechten gerne als politische Provokation gesungen wird; nur zu einem Drittel besteht die Wählerschaft der rechtsextremen Parteien aus Frauen. Für Frauen soll es für ihre Stimmabgabe auch entscheidend sein, wie »nah« eine Partei an ihren alltäglichen Problemen sei. Gilt das aber nicht auch für jeden (männlichen) Wähler? Wie wenige Wähler geben schon ihre Stimme einer Partei, die ihre Probleme nicht aufgreift?! Jedenfalls lohnt es sich für jede Partei, genau hinzuhören, wie es die Frauen gerne hätten, denn sie können Wahlen entscheiden – wenn ihr Prozentsatz an tatsächlichen Wählerinnen mindestens genau so hoch ist, wie der der männlichen Wähler. „Wer nicht die Frauen hinter sich hat, bringt es im Leben zu keinem Erfolg“ (Oscar Wilde). Die Wahlsoziologie versucht, mittels einer repräsentativ erstellten Wahlstatistik das Wahlgeheimnis »der« Wähler - aber nicht das des einzelnen Wählers(!) - zu lüften, ohne den in Art. 38 (1) S.1 GG mit Verfassungsrang normierten Grundsatz der geheimen Wahl zu verletzen. Das geschieht durch Vergabe von (nach den Gesichtspunkten Geschlecht und 5 Altersgruppen; nicht jedoch namentlich!) gekennzeichneten Stimmzetteln in 3.000 dafür besonders ausgewählten, für repräsentativ erachteten Stimmbezirken (Wahllokalen). Die Repräsentative Wahlstatistik hat den Vorteil, die tatsächliche Wahlbeteiligung und Stimmabgabe darstellen zu können, da sie nicht auf Umfragedaten, sondern auf der Auszählung von Wählerverzeichnissen und Stimmzetteln in den ausgewählten Stichprobenwahlbezirken beruht. 178 In den ausgewählten Stimmbezirken wird nach dem gleichen Verfahren gewählt wie in anderen Wahlbezirken auch, die Wählerinnen und Wähler müssen zusätzlich lediglich über ihr Geschlecht und die Zugehörigkeit zu einer Altersgruppe Auskunft geben. Die Altersgruppen sind dabei so ausgewählt, dass Rückschlüsse auf die Stimmabgabe einzelner Personen und damit Verletzungen des Wahlgeheimnisses in jedem Falle ausgeschlossen sind. Einzelne Ergebnisse der Repräsentativen Wahlstatistik: „Sind Männer politisch interessierter als Frauen und gehen sie darum in einem größeren Prozentsatz zur Wahl?“ „Wie nahmen die 3,3 Mill. Jungwähler, die 2002 das erste Mal wählen durften, ihr Wahlrecht wahr?“ „Wird zu wählen für eine staatsbürgerliche Pflicht gehalten? In welcher Bevölkerungsgruppe eher ja?“ Die einen Monat vor der Bundestagswahl 2002 herausgekommene 14. Shell-Jugendstudie hatte Schlimmes befürchten lassen, denn dort hatten sich nur 34 % als politisch interessiert geoutet; gerade 35 % wollten ganz sicher an der Wahl teilnehmen, 37 % hielten eine Teilnahme an der Wahl aber noch für sich vorstellbar. Die Fakten der Repräsentativen Wahlstatistik für die in ihrer Endphase wegen des bevorstehenden Irakkrieges stark emotionalisierten Wahl: Wahlbeteiligung von Männern und Frauen in den einzelnen Altersklassen: Insgesamt (%) Männer (%) Frauen (%) 18 - 21 69,6 69,9 69,3 21 - 25 68,0 68,3 67,7 25 - 30 71,8 71,3 72,2 30 - 35 75,7 74,4 77,0 35 - 40 79,0 78,0 79,9 40 - 45 80,3 79,2 81,4 45 - 50 81,1 80,3 81,9 50 - 60 84,0 83,7 84,4 60 - 70 85,9 86,3 85,5 70 und mehr 77,4 83,3 74,1 Die Wahlbeteiligung der unter 30-Jährigen liegt bei 69,9 %. Die niedrigste Wahlbeteiligung zeigt die Altersgruppe der 21 bis 24-Jährigen. Mit 68,0 % lag die Wahlbeteiligung um 11,1 Prozentpunkte unter der Wahlbeteiligung aller Altersgruppen (79,1 %), wobei die 21 bis 24jährigen Frauen sogar lediglich eine Beteiligung von 67,6 % verzeichneten. Das korrespondiert mit den Ergebnissen der in der 14. Shell Jugendstudie „Jugend 2002“ publizierten Befragung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen: Nur 4 % der Befragten bezeichneten sich als stark interessiert an Politik und weitere 26 % als interessiert. Demgegenüber bezeichneten sich 40 % als wenig und weitere 30 % als gar nicht interessiert. Der Trend der Interessiertheit der bis 24-Jährigen an Politik ist seit 1991 wieder kontinuierlich rückläufig, lag aber bei der Bundestagswahl von 1990 mit 17,4 % unter dem Mittelwert der Wähler über alle Altersgruppen noch bedeutend tiefer. Alter, Geschlecht, Bildungsniveau und das politische Interesse der Eltern beeinflussen signifikant das Interesse oder Desinteresse der Jugendlichen und jungen Erwachsenen an der Politik. „Weiblich“ und „Hauptschülerin“ bringt am wenigsten Interesse für politische Belange auf. Der niedrigste aller ermittelten Werte zur Wahlbeteiligung entfiel mit 59,7 % auf die ostdeutschen Frauen der Altersgruppe der 21 bis 24-jährigen. Hier war der Trend zur „ZuschauerDemokratie“ am ausgeprägtesten. Die Altersgruppe der 60 bis 69-Jährigen, von der zur Wahl zu gehen noch als selbstverständliche politische Pflicht angesehen wird, hat mit 85,9 % die höchste Wahlbeteiligung zu verzeichnen. Da 179 diese Altersgruppe zudem unter allen zehn Altersgruppen der Repräsentativen Wahlstatistik zur Wahlbeteiligung mit ca. 10,1 Mill. Menschen die zahlenmäßig größte ist, kommt deren hoher Wahlbeteiligung besondere Bedeutung zu. Der höchste aller ermittelten Werte zur Wahlbeteiligung entfiel mit 87,6 % auf die westdeutschen Männer der Altersgruppe zwischen 60 und 69 Jahren. Neben Informationen über die Wahlbeteiligung erbringt die Repräsentative Wahlstatistik auch Erkenntnisse über das Wahlverhalten in der Unterscheidung nach Alter und Geschlecht der Wähler. „Wählen Frauen anders als Männer?“ Stimmabgabe bei der Bundestagswahl 2002 nach Parteien, Altersgruppen und Geschlecht SPD CDU/CSU Insgesamt gewertet 18 - 25 39,2 5,4 25 - 35 37,9 6,0 35 - 45 40,7 5,1 45 - 60 40,9 8,0 60 und mehr 39,6 6,5 Insgesamt 39,9 9,6 GRÜNE 8,6 9,7 10,7 7,5 3,2 7,2 PDS FDP Sonstige REP SCHILL 3,5 3,3 3,7 4,8 4,2 4,1 8,9 9,2 6,6 6,4 4,9 6,6 1,0 0,9 0,5 0,5 0,2 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5 0,7 4,5 3,9 3,1 2,3 1,6 2,6 SPD CDU/CSU Männer alleine gewertet 18 - 25 36,0 37,5 25 - 35 35,2 37,5 35 - 45 39,2 37,1 45 - 60 39,6 38,9 60 und mehr 38,0 47,0 Zusammen 38,1 40,6 GRÜNE PDS FDP Sonstige REP SCHILL 8,3 9,1 9,4 7,2 2,8 6,8 3,8 3,6 3,6 5,0 4,9 4,4 9,5 10,1 7,2 6,6 5,3 7,1 1,2 1,3 0,7 0,7 0,4 0,7 0,9 1,0 1,0 1,0 0,7 0,9 SPD CDU/CSU Frauen alleine gewertet 18 - 25 42,8 33,0 25 - 35 40,6 34,4 35 - 45 42,2 33,1 45 - 60 42,1 37,1 60 und mehr 40,9 46,1 Zusammen 41,5 38,7 GRÜNE PDS FDP Sonstige 8,9 10,3 12,1 7,9 3,4 7,6 3,1 3,1 3,7 4,6 3,7 3,8 8,2 8,3 6,1 6,2 4,7 6,1 4,9 4,5 3,5 2,6 1,9 3,1 4,0 3,3 2,8 2,1 1,3 2,2 REP SCHILL 0,8 0,6 0,4 0,3 0,1 0,3 0,6 0,5 0,6 0,6 0,3 0,5 Die SPD verbucht nur im Westen ähnlich hohen Zuspruch in allen Altersgruppen. Frauen bevorzugten SPD, Männer CDU/CSU Die Frauen votierten insgesamt mit 50,5 % für Rot-Grün und entschieden so die Bundestagswahl 2002. Das war auch bei den anschließenden Landtagswahlen der Fall, sodass ein Kommentator der taz schrieb: „Die Wahlen der letzten zwei Jahre hat gewonnen, wer die Mehrheit der über 60jährigen Frauen auf seiner Seite hatte. Das war beim rot-grünen Sieg 2002 so, bei 180 Ole von Beusts Sieg in Hamburg, bei Henning Scherf in Bremen, der als einziger Sozialdemokrat den Abwärtstrend der SPD stoppen konnte. Bei dieser Gruppe, die übrigens in Zukunft noch wachsen wird, kommen kühle Modernisierer oder gar scharfe Polarisierer nicht gut an, verständnisvolle, moderate Figuren, die Empathie ausstrahlen, hingegen schon. Nur wer diese Rolle spielen und ausfüllen kann, wird 2006 gewinnen. Das ist für Merkel/Westerwelle ein echter Nachteil.“ (Franz Walter in taz 08.12.04) Der Stimmenanteil der Männer bei Rot-Grün betrug hingegen nur 44 %. Männer bevorzugten bei der Bundestagswahl 2002 die CDU/CSU, Frauen hingegen fühlten sich eher zur SPD hingezogen: Bei den Männern lagen die Unionsparteien mit 40,6 % um 2,5 Prozentpunkte vor der SPD, bei den Frauen belegte die SPD mit 41,5 % und 2,8 Prozentpunkten Vorsprung den Spitzenplatz. Die SPD erreichte ihr bestes Ergebnis mit 42,8 % bei den Jungwählerinnen zwischen 18 und 24 Jahren. Für das beste Ergebnis für die Unionsparteien sorgten mit 47,0 % die über 60-jährigen Männer. Aus anderen (hier nicht aufgeführten) Aufstellungen wird ersichtlich: Der besondere Erfolg der Union bei den Älteren ist ein westdeutsches Phänomen. FDP und GRÜNE haben – in Ost wie West – weniger Rückhalt bei den Älteren. Die PDS liegt in allen Altersgruppen unter 20 Prozent. Aus solchen Statistiken analysieren „Spin-Doctors“ und andere »hinter der Front« arbeitende Parteistrategen die Defizite ihrer Partei bei einzelnen Wählergruppen und überlegen zusammen mit den von ihnen beauftragten Werbeagenturen30, wie sie ihre »DefizitGruppen« mit welchen neuen, genau auf diese Gruppen zielenden Absichtserklärungen in dem Wahlprogramm zur nächsten Wahl besser »anmachen« können, um so aus diesen Gruppenreservoirs mehr Stimmen herauszuholen; bei einem prognostizierten Kopf-an-KopfRennen - bei der Wahl 2002 betrug der äußerst knappe Stimmenvorsprung für Rot-Grün letztlich nur 6.027 Stimmen = 0,01 % der potentiellen Wähler – ist eine solche Wahlkampfstrategie durchaus überlegenswert! Es ist dabei ein bisschen wie auf St. Pauli: Die Damen SPD (Körbchengröße 605.000 Mitglieder), CDU (574.526), CSU (173.000), FDP (64.150), PDS (60.000) und Bündnis 90/Die Grünen (44.250) zeigen in dafür vorgesehenen Schaufenstern grell geschminkt herausgeputzt und anregend gekleidet ihr verführerisches Angebot, lassen ahnen, wozu sie fähig sein könnten, wenn der Kunde es ausdrücklich wünscht und bereit ist, den Preis dafür zu entrichten. Sie verlocken den Suchenden mit dem Versprechen auf große Freude, ja sogar auf bisher nicht in Erfüllung gegangene Träume, wenn man bereit sei, ihren Reizen zu erliegen und sich mit ihnen bis zur Stimmabgabe einzulassen. Ein paar bisher nicht so gut ins Geschäft gekommene, teilweise sehr bizarr gekleidete und verschroben denkende, anscheinend unter den gängigen Drogen Rassismus, Chauvinismus, Religion, Welterweckung und Welterrettung stehende Damen lungern an den unbeachteteren Plätzen rum und versuchen im Rahmen ihrer Möglichkeiten ebenfalls, auf ihr Angebot aufmerksam zu machen und Freier zu kobern. Solchermaßen zustande gekommene Wahlprogramme haben dann aber immer den politischen Geburtsfehler, dass mit ihnen nach dem Motto: „Darf’s noch ein bisschen mehr sein, als bei der Regierung angepriesen?“ meist eine eierlegende Wollmilchsau kreiert und angepriesen wird, von der man von vornherein weiß, dass man zu den damit angekündigten Wohltaten später nicht wird stehen müssen, weil man alles nicht in Erfüllung Gehende auf den Koalitionspartner wird schieben können, der die Realisierung der (vollmundigen) Klientelversprechungen - leider, leider - nicht zugelassen habe. Das sei halt das Kreuz von Koalitionsregierungen, das man tragen müsse. 30 Im Bundestagswahlkampf 2005 wurde für die SPD die Düsseldorfer Werbeagentur "Butter" genannt, für die CDU die Werbeagentur "McCann-Erickson" in Berlin. Die CSU setzt seit 2002 auf die Münchner Agentur "Serviceplan", die Grünen arbeiten seit Jahren eng mit der Berliner Agentur "Zum goldenen Hirschen" zusammen. Die FDP ließ sich von der Werbeagentur "von Mannstein political communication" beraten, mit der sie sich in ihrem Landtagswahlkampf in NRW werbewirksam hatte in Szene setzen lassen, und die PDS arbeitet seit 1994 mit der Agentur "Trialon" aus Berlin-Pankow zusammen, die für den Wahlkampf 2005 "DiG/Plus" mit ins Boot geholt haben. 181 Aber nicht nur die jüngeren großstädtischen Frauen insbesondere aus dem evangelischen oder konfessionslosen Nord- und Ostdeutschland nehmen – durch die Ergebnisse der Repräsentativen Wählerstatistik nachweisbar - für sich in Anspruch, die Bundestagswahl 2002 für Rot-Grün entschieden zu haben – und leiten daraus gesellschaftspolitische Wünsche oder gar Forderungen an die rot-grüne Bundesregierung ab, die sie dann bei der Formulierung der Regierungsziele für die neue Legislaturperiode berücksichtigt wissen wollen. Andere Gruppen behaupten ebenfalls, der Regierungskoalition letztlich zum Sieg verholfen zu haben. So schrieben türkische Zeitungen, dass Schröder und Fischer nur auf Grund der Stimmabgabe der türkischstämmigen Wähler die Bundestagswahl 2002 gewonnen hätten. Ganz interessant ist, dass sich alle türkischen Medien darin einig zu sein schienen, dass das Stimmverhalten der türkischstämmigen Deutschen Rot-Grün zum Wahlsieg verholfen habe (Hürriyet: Schröder sei wegen der ihm zum Sieg verholfen habenden Stimmen türkischstämmiger Wähler „Kanzler von Kreuzberg“); das ist aber durch die Ergebnisse der Repräsentativen Wählerstatistik nicht nachweisbar, denn die unterscheidet in ihren Gruppenbildungen nur nach Geschlecht und Alter, nicht aber nach Ursprungsnationalität: (Nur) Wer Deutscher ist, darf bei einer Bundestagswahl seine Stimmen abgeben - gleichgültig, ob er aus Russland oder der Türkei oder sonst woher nach Deutschland eingewandert ist. Solche Behauptungen wie die einer ausschlaggebenden Bedeutung einer bestimmten Zuwanderungsgruppe muss erst noch durch andere Instrumentarien, wie z.B. Befragungen, geklärt werden. 2002 hätten (laut türkischer Medien) die rund 471.000 türkischstämmigen Wähler mit deutschem Pass mehrheitlich für Rot-Grün gestimmt, für die auch jeweils eine Abgeordnete im 15. Deutschen Bundestag sitzt. Der Stimmenunterschied zwischen den beiden Lagern ist aber mit rund 600.000 Stimmen größer als die Anzahl der wahlberechtigten türkischen Einwanderer. Trotzdem bleibt richtig, dass die türkischen Einwanderer zu rund 60% zur SPD und zu 9-14 % zur CDU tendieren (SPIEGEL 04.10.04). Die Bedeutung dieser zu berücksichtigenden Klientel wächst proportional zu den Wählerstimmen, die sie in die Waagschale werfen können. Bei der Bundestagswahl 2005 sollen schon fast eine Million Deutsche türkischer Abstammung wahlberechtigt sein – wenn sie sich nicht nach ihrer Einbürgerung durch die verbotene und darum von ihnen heimlich vorgenommene nachträgliche Wiederannahme der türkischen Staatsbürgerschaft als Zweitstaatsbürgerschaft entsprechend den Bestimmungen des Staatsbürgerschaftsgesetzes wieder ausgebürgert haben! Diese Klientel ist nicht für rechtsradikale Parteien, aber insbesondere für Rot/Grün interessant! Dementsprechend werden sich deren Wahlprogramme verändern in Richtung auf: Konkrete Maßnahmen gegen eine Diskriminierung von Muslimen, die Etablierung des Islam in den zahlreichen Bestimmungen des deutschen Staatsrechts, Initiativen zur Ermöglichung des Beitritts der Türkei zur EU in absehbarer Zeit, ... Je abhängiger sich eine Partei von Stimmen aus dem muslimischen Wählerreservoir wähnt, desto mehr wird sie ihr Programm in diese Richtung ausgestalten: Parteiendemokratie hat ja das Ziel der Bündelung von Wählerinteressen aus unterschiedlichen Gruppierungen! Diese Wählerinteressen müssen sich in den Wahlprogrammen wiederfinden. Wer auf keine Stimmen aus diesem Reservoir hoffen kann, wird möglicherweise als sektiererischer bibeltreuer Christ den angeblich christlichen Charakter der EU propagieren und hervorheben, der die Aufnahme muslimischer Staaten in die christliche Werte- und Staatengemeinschaft verbiete, um einer Islamisierung Europas vorzubeugen, wie sie insbesondere in Bezug auf einen EU-Beitritt der Türkei befürchtet wird. Wer Rassist, Nationalist oder Chauvinist ist und zu einer solchen Partei tendiert, wird mit Hinweis auf die »deutsche Blutsgemeinschaft« oder ein ähnliches ideologisches Kriterium ebenfalls eine Vollmitgliedschaft der Türkei in der EU ablehnen. Und neben diesen überpointierten Kriterien gibt es eine Reihe von politischen, historischen, kulturellen und möglicherweise auch wirtschaftlichen Kriterien, die eine Ablehnung einer Mitgliedschaft der Türkei in der EU angeraten erscheinen lassen. Alle solche Gesichtspunkte pro und contra finden sich dann in den Parteiprogrammen oder den Wahlkampfaussagen wieder. 182 Auffällig ist, das die SPD bei Männern und Frauen in allen Altersgruppen ähnlich hohen Zuspruch erfahren hat. Die Werte aller Altersgruppen differierten nur um 3,0 Prozentpunkte (zwischen 37,9 % bei den 25 bis 34jährigen und 40,9 % bei den 45 bis 59jährigen »Brandt-Wählern«). Bei der CDU beträgt diese Differenz immerhin 11,4 Prozentpunkte (zwischen 35,1 % bei den 35 bis 44jährigen und 46,5 % bei den ab 60jährigen, eher kirchlich gebundenen und oft alleinstehenden früheren »Adenauer-Wählerinnen« aus der Gründungsphase der Bundesrepublik). Den GRÜNEN haben 7,6 % der Frauen und 6,8 % der Männer ihre Zweitstimme gegeben. Sie erreichen ihr bestes Ergebnis mit 12,1 % bei den 35 bis 44jährigen Frauen, die in den aufmüpfigen achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts politisiert wurden, ihr schlechtestes bei den ab 60jährigen Männern (2,8 %). FDP und PDS haben jeweils einen leichten Stimmenvorsprung bei den Männern (7,1 % zu 6,1 % bzw. 4,4 % zu 3,8 % bei den Frauen). Die geschlechtsspezifischen Unterschiede sind also nicht so groß wie bei den beiden großen Volksparteien, sie reichen von 0,8 Prozentpunkten bei den GRÜNEN bis zu 1,0 Prozentpunkten bei der FDP. Zusätzlich fällt auf, dass Männer eine größere Vorliebe für kleinere Parteien haben: dieser aus den GRÜNEN, der FDP, der PDS und den sonstigen Parteien bestehenden Gruppe gaben sie 21,4 % der Stimmen. Bei den Frauen lag dieser Anteil nur bei 19,7 %. Die PDS, die nach dem amtlichen Endergebnis 4,0 % der Zweitstimmen erhielt, konnte nach dem hier vorgelegten Ergebnis der Repräsentativen Wahlstatistik nur in der Gruppe der 45 bis 59jährigen Männer die Fünf-Prozent-Hürde überspringen (5,0 %). Die Gruppe der Älteren hat in der PDS ein übergroßes Gewicht. Die kleineren Parteien haben mehr Rückhalt bei den jüngeren Wählern als bei den Älteren. „Unterscheidet sich das Wahlverhalten der Ost- von den Westdeutschen?“ Verteilung der Zweitstimmen in den alten und in den neuen Bundesländern SPD CDU/CSU PDS FDP GRÜNE Sonstige Deutschland 38,5 38,5 4,0 7,4 8,6 3,0 Früheres Bundesgebiet 38,3 40,8 1,1 7,6 9,4 2,8 Neue Länder und Berlin Ost 39,7 28,3 16,9 6,4 4,7 3,6 Die starken Stimmanteile der PDS in den neuen Ländern gehen u.a. auf Kosten der GRÜNEN, vor allem jedoch auf Kosten der Union. Dieses Ergebnis beruht gleichermaßen auf den Werten von Männern und Frauen aller Altersgruppen. Nach diesen Ergebnissen hat jede Partei die Möglichkeit zu überlegen, wie sie einzelne Gruppen ansprechen will. Das ist dann die Aufgabe ihrer Wahlkampfstrategen. Süddeutsche Zeitung 13.10.1994 (leicht gekürzt) Die Hochburgen werden geschleift Immer mehr Bürger wägen nüchtern ab, welche Partei ihren Interessen am meisten dient Von Christian Schneider Mannheim, im Oktober - Es gibt sie nach wie vor, die traditionellen Hochburgen der Parteien, und auf die Stammwähler dort können sich Wahlkampfmanager und Generalsekretäre immer noch verlassen. [...] Hochburgen, so bilanzieren die Mannheimer Wahlforscher, sind für die Parteien "nach wie vor von immenser Bedeutung". Sie sind gewissermaßen das Biotop, dessen jeweils sehr spezifische Sozialstruktur den Humus abgibt, auf dem die Wähler-Präferenzen für eine ganz bestimmte Partei gedeihen. Die CSU etwa, so skizziert die Forschungsgruppe Wahlen, findet einen besonders guten Nährboden in Stimmkreisen mit extrem niedriger 183 Bevölkerungsdichte und ländlicher Prägung, wobei der Katholikenanteil in diesen Stimmkreisen "noch weit über dem Durchschnitt in Bayern liegt". Mehr noch: je häufiger der Kirchgang, desto größer der Stimmenanteil für die CSU. Spiegelbildlich verkehrt ergibt sich das SPD-Biotop - städtisch geprägt, hohe Bevölkerungsdichte, "extrem niedriger Katholikenanteil", dafür aber hohe gewerkschaftliche Zugehörigkeit. Ähnliche sozio-kulturelle Biotope gibt es natürlich auch für alle anderen Parteien. [...] Die Stammwähler stehen in Treue fest. Indes - wer's glaubt, wiegt sich in falscher Sicherheit. In Wirklichkeit bröckelt es nämlich schon ziemlich heftig an den vermeintlich unverrückbaren Mauern der Partei-Bastionen, müssen sich Parteien und Politiker wohl auf unruhigere Zeiten einstellen. Denn, so sagt Dieter Roth von der Forschungsgruppe Wahlen, "die Hochburgen werden geschleift". [...] Die Beobachtung ist nicht neu [...] . Schon seit Anfang der achtziger Jahre registrieren die Wahlforscher eine deutliche Veränderung des Wählerverhaltens. Zwar wird es nach deren Überzeugung Partei-Hochburgen auch weiterhin geben, aber die Zahl der Stammwähler schrumpft, während das Lager der Wechselwähler immer größer wird. Vor wenigen Jahren noch waren etwa 15 Prozent der Wähler Wanderer zwischen den Parteien. Mittlerweile aber gelten schon ein Viertel bis ein Drittel der Wähler als Grenzgänger zwischen den Parteien. [...] Die Herrschenden bekommen den Wandel immer öfter zu spüren. Nach Angaben der Forschungsgruppe Wahlen haben bis 1987 Wähler bei insgesamt 110 Möglichkeiten auf der Landes- und Bundesebene nur fünfmal eine Regierung eindeutig abgewählt. So etwas macht Parteien fett und träge. Seit 1987 aber wurde bei 21 Urnengängen schon siebenmal einer Regierung der Laufpass gegeben. Die Wechselwähler haben es möglich gemacht. Auf die Wähler, so jammern untere Partei-Funktionäre neuerdings verunsichert, sei kein Verlass mehr. Der Hamburger Politikwissenschaftler Joachim Raschke sieht das freilich anders. Für ihn ist der Wähler weder dumm, noch undankbar, noch verdrossen, diagnostizierte er in einem Vortrag vor der SPD-nahen Georg-von-VollkmarAkademie in München, vielmehr würden die Wähler endlich „erwachsen" und emanzipiert. Raschke begrüßt dies als die "Stunde der Demokratie". Es würde nicht mehr nur gewählt, sondern tatsächlich "ausgewählt". Man gibt seine Stimme ganz bewusst einer Partei und nicht mehr nur aus "Tradition", wie es jedenfalls früher der Fall war und jetzt nur noch für die zusammenschmelzende „Kerntruppe“ der Stammwählerschaft einer Partei gilt: drei von vier katholischen Kirchgängern wählten und wählen die Unionsparteien, zwei von drei gewerkschaftlich organisierten Arbeitern die SPD. Ähnlich sieht es auch Dieter Roth von der Forschungsgruppe Wahlen. Im gleichen Maße, wie sich die traditionellen Milieus verändern oder auflösen, verändert sich auch das Wählerverhalten. Roth nennt beispielhaft den Wandel in der "roten Hochburg Kohlenpott". Wenn eine Zeche geschlossen wird, ist das entweder mit einem Verlust des Arbeitsplatzes oder mit einem Wohnungswechsel verbunden. In beiden Fällen verändert sich das soziale Geflecht, kommen neue Erfahrungen und Ansichten hinzu. Wer seinen Job verliert und vorzeitig aufs Abstellgleis geschoben wird, lockert möglicherweise auch seine Bindungen zur Gewerkschaft. Damit aber entfällt auch die politische Einflussnahme oder Meinungsbildung über eine "Vorfeldorganisation". Den gleichen Umstand, nämlich weitgehender Ausfall der Meinungsbildung durch eine Vorfeldorganisation, bekommen natürlich auch die Unionsparteien zu spüren als Folge des steten Schwunds pflichtbewusster Kirchgänger. 1953 gingen noch 60 Prozent der Katholiken - traditionelle Wähler der Unionsparteien - regelmäßig zum Gottesdienst,1993 waren es nur noch 29 Prozent. Ähnlich stark ist ja auch der Aderlass bei den Gewerkschaften. Zu spüren bekommen die Parteien jetzt aber auch die Folgen der Bildungsexplosion der siebziger Jahre und die damit einhergehende Veränderung der Berufsstruktur in der Bundesrepublik. Das Ergebnis ist ein Wähler, der bei seiner Entscheidungsfindung immer autonomer wird und der auf alte Bindungen und Traditionen pfeift. Für ihn, so sagen die Forscher, sind Parteien nicht mehr als Gruppierungen, die einem dabei helfen können, die eigenen Interessen zu op- 184 timieren und durchzusetzen. Daraus ergeben sich wechselnde Koalitionen: Von Fall zu Fall wird entschieden, wann man sich mit wem verbündet. Man geht nicht mehr wie in früherer Zeit mit einer Partei durch dick und dünn. Qualvolle Eiertänze Vor allem die Wähler in Ost-Deutschland, so erläuterte vor wenigen Tagen Dieter Roth von der Forschungsgruppe Wahlen vor amerikanischem Publikum in Washington, setzen bei ihrer Wahlentscheidung mehr auf nüchternes Abwägen als auf Emotion. Beispiel PDS: zwar lehne die Mehrheit der Ostdeutschen die SED-Nachfolgepartei aus ideologischen Gründen ab, was aber andererseits viele dieser ostdeutschen Wähler nicht davon abhalte, die PDS als Kämpfer für ihre Interessen zu "instrumentalisieren". Nach den Erkenntnissen der Mannheimer Wahlforscher stimmen nur 82 Prozent der PDS-Wähler mit der Ideologie dieser Partei überein, während gleichzeitig aber 99 Prozent der PDSWähler der Meinung sind, diese Partei werde gebraucht, um die Interessen der Ostdeutschen zu vertreten, weil die Bundesregierung in Bonn Ostdeutschland vernachlässige. ... [Die Parteien haben auch selbst Wechselwähler gezüchtet.] Wo es nämlich kaum noch Unterschiede gibt zwischen einer "sozial-demokratisierten CDU" und einer "christdemokratisierten SPD", fällt der ständige Frontenwechsel leichter als in früheren Jahren. Nicht mehr länger Partei-Programme sind das Bindemittel zwischen Partei und Wähler, sondern immer öfter aktuelle Aussagen zu Einzelproblemen. Mit anderen Worten: Den Politikern wird schärfer auf die Finger geschaut, und zwar nicht nur im Wahljahr, sondern während der ganzen Legislaturperiode. Noch allerdings scheinen Parteien und Politiker nicht recht zu wissen, wie sie mit dem mündig gewordenen Wähler umgehen sollen. Bei der Forschungsgruppe Wahlen in Mannheim hat man einen Trend zum "permanenten Wahlkampf" ausgemacht. Notwendige, aber unpopuläre Entscheidungen würden allenfalls noch zu Beginn einer Legislaturperiode getroffen, danach schwinde mit dem ängstlichen Blick auf den Wechselwähler die Risikobereitschaft von Parteien und Politikern, und aus dem gleichen Grund würden politische Aussagen immer ungenauer "Niemand will sich mehr festlegen". Wem fielen da nicht die qualvollen Eiertänze um Asylkompromiss und Pflegeversicherung ein? Wo der Bürger eigentlich politisches Handeln erwartet, tritt die Politik aus Angst vor dem Wähler auf der Stelle .... Doch mögen die Politiker auch stöhnen, "die Wahlen", sagt der Mannheimer Wahlforscher auch, "werden spannender". Diskussion um die Herabsetzung des Wahlalter Soll es mehr Bürgerbeteiligung geben? Diese Frage umfasst möglicherweise auch eine Diskussion über die Herabsetzung des Wahlalters. Hierzu drei – mir teilweise sehr fragwürdig, zumindest aber sehr diskussionsbedürftig erscheinende – Meinungen, deren verdeckt mitschwingenden ideologischen Illusionen, Fragwürdigkeiten, Einseitigkeiten und teilweise falschen Behauptungen herausgearbeitet werden und so die unterbreiteten Vorschläge auf ihre Praktikabilität in unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit hin überprüft werden sollten. Schließlich geht es ja nicht um die Wahl der »Lieblingsmargarine« oder der »Lieblingscornflakes« mit den für Kinder interessantesten, als Kaufanreiz, ja Kaufdruck auf die Eltern im Wege der »Quängel-Auswahl« beigepackten Beilagen: DIE ZEIT 8.3.1996 Klaus Hurrelmann: Jugendliche an die Wahlurnen! Auch Zwölfjährige müssten über die politische Zukunft mitentscheiden. BIELEFELD. - Nach geltendem Recht werden Jugendliche von Werbung und Kreditwirt- 185 schaft wie selbständige Kunden angesprochen. Mit vierzehn Jahren erreichen sie, so steht es im Grundgesetz, ihre Religionsmündigkeit. Sie können die Zugehörigkeit zu einer Kirchengemeinde unabhängig von den Eltern bestimmen. Von diesem Alter an sind sie auch - im Rahmen der flexiblen Vorschriften des Jugendgerichtsgesetzes - strafmündig. Für ihre Schulausbildung sind sie ohnehin voll verantwortlich. Erst mit achtzehn Jahren aber erreichen Jugendliche die "Volljährigkeit", daran sind das aktive und passive Wahlrecht gekoppelt. Bis zu diesem Zeitpunkt werden sie im parlamentarischen System als nicht existent behandelt. Auch das steht im Grundgesetz. Die Trennung der Bevölkerung in einen wahlberechtigten und einen nicht wahlberechtigten Teil muss in einer Demokratie sorgfältig begründet werden. Heute schließen wir außer den sieben Millionen "Ausländern" und einigen wenigen "Entmündigten" fünfzehn Millionen Deutsche unter achtzehn Jahren vom Wahlrecht aus. Die gängige Begründung ist, sie hätten nicht die „Reife", um dieses wichtige Bürgerrecht auszuüben. Eine konsequente demokratische Verfassung muss aber von der Idee ausgehen, dass jeder Mensch eine Stimme hat. Abweichungen von diesem Grundsatz bedürfen deshalb zumindest einer Rechtfertigung. Meiner Ansicht nach sind die bisherigen Argumente für die Festlegung eines "Sperralters" von achtzehn Jahren heute nicht länger stichhaltig. Jugendliche sind heute selbständiger als früher. Sie müssen sich - vermittelt über die Massenmedien - mit allen wichtigen gesellschaftlichen und politischen Fragen auseinandersetzen. Ob wir diese Entwicklung nun unter pädagogischen Gesichtspunkten begrüßen oder nicht - Tatsache ist: Jugendliche sind heute in ihrem Lebensalltag wie Erwachsene gefordert, ihren eigenen Weg zu finden. Aus welchem Grund sollte ihnen die politische Partizipation, die sich besonders im Bürgerrecht auf Wahl ausdrückt, vorenthalten werden? Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes kommt Kindern ab der Geburt der volle Gehalt der Grundrechte zu. Deshalb ist es nicht nachzuvollziehen, dass in Artikel 38 des Grundgesetzes das aktive und passive Wahlrecht von der Vollendung des achtzehnten Lebensjahres abhängig gemacht werden. Anfang der siebziger Jahre war diese Altersgrenze schon einmal geändert worden; sie lag vorher bei 21 Jahren. Nach Artikel 20 geht alle Staatsgewalt vom Volke aus und wird von ihm in Wahlen ausgeübt. Nach Artikel 38 aber wird genau der Teil des Staatsvolkes von der Wahl ausgeschlossen, der ein besonderes Interesse an der Umsetzung langfristiger politischer Perspektiven hat: die junge Generation. Wahlen werden immer stärker, wie Graf Lambsdorff vor einigen Jahren scharfsichtig erkannte, "in den Altersheimen entschieden". Ein eigentümlicher Generationsvertrag! Die kognitive Entwicklungsforschung zeigt, dass in der Altersspanne zwischen zwölf und vierzehn Jahren ein intellektueller Entwicklungsschub stattfindet. Er befähigt Jugendliche dazu, abstrakt, hypothetisch und logisch zu denken. Parallel hierzu steigt in dieser Altersspanne auch die Fähigkeit, sozial, moralisch und politisch zu denken und entsprechende Urteile abzugeben. Wollen wir von einer "Reife" der Urteilsfähigkeit - nicht der gesamten Persönlichkeit - sprechen, dann ist sie in diesem Alter gegeben. Aus diesen Überlegungen heraus spricht vieles dafür, das Wahlrecht auf ein Alter von zwölf bis vierzehn Jahren abzusenken. Auch Untersuchungsergebnisse, die wir über politische Interessen von Jugendlichen haben, sprechen für einen solchen Schritt. Jugendliche erweisen sich - allen Vorurteilen der Älteren zum Trotz - als politisch durchaus interessiert und informiert. Auffällig ist, dass es immer häufiger Schülerinnen und Schüler sind, die sich spontan, unkonventionell, oft auch gefühlsbetont zu vielen politischen Themen äußern. Es sind nicht mehr so sehr die Studierenden, die noch in den sechziger Jahren die Rolle der unabhängigen Barometer für unser politisches System übernahmen. Die sind heute viel zu stark mit dem Aufbau ihrer eigenen Berufslaufbahn und der Sicherung ihres Lebensunterhalts im Studium beschäftigt. Mädchen sind in dieser Rolle noch sensibler als Jungen. Ihr politisches Sachinteresse ist zwar meist niedriger als das der Jungen, ihre emotionale Beteiligung an politischen Themen aber ist höher. Politiker machen es sich zu einfach, wenn sie diese gefühlsbetonte Herangehensweise als "unpolitisch" abwerten. Jugendliche wollen, dass Politik 186 nicht nur allein mit dem Kopf, sondern auch mit Seele und Gefühl gemacht wird. Lassen wir sie endlich an die Wahlurnen! Klaus Hurrelmann ist Sozialwissenschaftler an der Universität Bielefeld Ein juristischer Hinweis: Auch wenn Hurrelmann mit seiner Eingangsbehauptung „Nach geltendem Recht werden Jugendliche von Werbung und Kreditwirtschaft wie selbständige Kunden angesprochen.“, möglicherweise einen soziologischen Sachverhalt richtig beschreiben sollte, so ist dieser Satz in seiner Verallgemeinerung zumindest fragwürdig, rechtlich aber auf keinen Fall zu halten, weil er sich nur auf einen kleinen Warenkorb beziehen kann: Gemäß § 110 BGB [„Taschengeldparagraph“] können von einem Minderjährigen Rechtsgeschäfte grundsätzlich nur im Rahmen seines Taschengeldes abgeschlossen werden. Für alle darüber hinausgehenden Rechtsgeschäfte, aus denen der Minderjährige (= unter 18 Jahre) nicht ausschließlich einen rechtlichen Vorteil erlangt (z.B. Geschenke ohne daran geknüpfte Verpflichtung), bedarf der Minderjährige gemäß § 107 BGB der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters. Bis diese Einwilligung vorliegt, ist ein von einem Minderjährigen geschlossener Vertrag gemäß § 108 I BGB „schwebend unwirksam“ und muss auf Verlangen des Erziehungsberechtigten rückabgewickelt werden. Aus diesen eingeschränkten, vollständig vom Willen des jeweiligen Erziehungsberechtigten abhängigen rechtlichen Möglichkeiten die Forderung zu erheben, Jugendlichen (ab 14 Jahre), ja Kindern das aktive Wahlrecht zuzuerkennen, ist sogar noch unter studentischem Niveau. Das ein Professor so unausgegorene Forderungen erhebt, sehe ich als Jurist als ein Skandal an! Auch die weitere Eingangsbehauptung, dass Minderjährige „für ihre Schulausbildung ... ohnehin voll verantwortlich“ seien, ist schlicht falsch. Schade, dass man einem Hochschullehrer für die Verbreitung von solchem Schwachsinn nicht seine Professur aberkennen kann, damit solch ein Unsinn nicht noch in ein professorales Gewand gekleidet werden kann! DIE ZEIT 8.3.1996 Horst Eylmann : Mit jungen Stimmen eine bessere Politik ? Weltweit herrscht Konsens: Wähler sollten mindestens 18 Jahre alt sein BONN. - Das Bemühen, der vielberedeten Politikverdrossenheit31 zu Leibe zu rücken, treibt zuweilen seltsame Blüten. Eine der bizarrsten ist die Absenkung des Wahlalters. Die sonst eher bedächtigen Niedersachsen marschieren voran; SPD und Grüne setzten das aktive Kommunalwahlrecht auf sechzehn Jahre fest. Aber das ist erst der Beginn. Schon kommt aus der SPD-Fraktion in Bonn die Ankündigung, man werde noch in dieser Legislaturperiode eine Senkung des Wahlalters für die Bundestagswahl beantragen. Die Begründung lieferte eine Anhörung der Kinderkommission des Bundestages, in der Juristen und Jugendforscher meinten, es gebe keinen Grund, Jugendliche nicht schon mit vierzehn wählen zu lassen. Zwei minderjährige Schüler hatten kürzlich mit ihrer Klage beim Bundesverfassungsgericht auf Einräumung des Wahlrechts nur aus formalen Gründen keinen Erfolg. Der enttäuschte Kläger Benjamin (16) äußerte sein Unverständnis; er habe doch nur one man one vote verlangt. Dass es dabei auf das Alter nicht ankommen könne, denken auch wohlmeinende Familienpolitiker, die zwar Kinder und Jugendliche nicht an die Urne lassen, aber ein Familienwahlrecht der Eltern statuieren wollen. Wer beispielsweise fünf minderjährige Kinder hat, soll fünf zusätzliche Kreuze machen dürfen. Das erinnert an das alte preußische Dreiklassenwahlrecht, nur dass damals das Vermögen ein stimmenvermehrendes Kriterium war, nicht die Kinderzahl. Über diesen letzten Vorschlag kann man getrost den Mantel des Vergessens breiten, denn der höchst persönliche Charakter der Wahlentscheidung lässt eine Vertretung nicht zu. Leider ist aber zu befürchten, dass die Senkung des Wahlalters auf der Tagesordnung bleibt, schon weil manche hoffen, auf diese Weise linke Wähler gewinnen zu können. Wer seine Kritik auf dieses parteitaktische Kalkül konzentriert, greift jedoch zu kurz. Die eigentliche Gefahr des Vorstoßes liegt in seiner Tendenz zur Bagatellisierung 31 Zum „Wort des Jahres“ 1992 gewählt 187 des Wahlakts. Strafrechtlich sind Vierzehn- bis Siebzehnjährige nur verantwortlich, wenn sie zur Zeit der Tat in ihrer geistigen und sittlichen Entwicklung reif genug waren, das Unrecht der Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln. Wer noch nicht achtzehn Jahre ist, kann ohne Zustimmung der Eltern rechtswirksam kein Moped kaufen. Er soll davor geschützt werden, rechtlich erhebliche Erklärungen abzugeben, deren Tragweite er nicht übersieht. Wer demgegenüber Jugendlichen das Wahlrecht einräumen will, weist diesem eine mindere Bedeutung zu. Dabei ist die Wahl in einer repräsentativen Demokratie der einzige Akt, mit dem der politische Wille des Volkes unmittelbar in staatliche Machtpositionen umgesetzt wird. Der Einwand, Vierzehnjährige könnten doch auch ihre Religion wählen, vergleicht Birnen mit Äpfeln. Das religiöse Glaubensbekenntnis, mit dem sich der Mensch "letzte" Sinnfragen seiner Existenz zu beantworten sucht, hat einen völlig anderen Charakter als die vom mündigen Staatsbürger rational zu vollziehende Wahlentscheidung. Deren Folgen treffen nicht allein den Wähler. Vielmehr gestaltet er mit seiner Entscheidung die Zukunft des Gemeinwesens verantwortlich mit. Persönlichkeitsentwicklung und Sozialisationsprozess sind bei Jugendlichen noch nicht soweit fortgeschritten, dass man ihnen generell die Fähigkeit zusprechen kann, diese politische Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Dass darüber weltweit Konsens herrscht, zeigen die Wahlgesetze, die in allen Staaten das Wahlalter bei mindestens achtzehn Jahren festlegen. Die Behauptung, mit der Jugend ziehe die neue Zeit, gehört vom Wandervogel bis zur Idolisierung der Jugend in der Kultur- und Konsumwelt der Postmoderne zur mythischen Überhöhung dieser Lebensphase. Nun soll also auch die Politik mit Hilfe des Jugendwahlrechts in eine neue, bessere Richtung bewegt werden. Psychologen und Soziologen sagen uns, die heutige Jugendwelt sei in erster Linie an Unterhaltung interessiert und daran, Spaß zu haben. Man kann also wohl erwarten, dass die jungen Wähler den Wahlakt nicht zu bedeutungsschwer bewerten. Easy voting - das dürfte die Sache treffen. Einen Trost gibt es noch: Umfragen haben gezeigt, dass die Mehrheit der Jugendlichen eher skeptisch ist und sich noch nicht reif für ein Wahlrecht fühlt. Junge Leute hatten schon immer ein gesundes Misstrauen gegen erwachsene Berufsjugendliche, die sich bei ihnen anbiedern wollten. *** Horst Eylmann, CDU, war Mitglied des Bundestags und Vorsitzender des Rechtsausschusses. Zwei Kinder – vier Stimmen Eltern sollen künftig für ihre Kinder wählen können. Ein Plädoyer der FDP-Politiker Hermann Otto Solms und Klaus Haupt zur Änderung des Grundgesetzes Wahlrecht von Geburt an – das klingt im ersten Moment nach einer exotischen Forderung. Ist sie ernst zu nehmen? Oder stecken dahinter nur abstruse Umtriebe von PolitSektierern? Worum geht es? Obwohl das Grundgesetz in Artikel 6 die Familie unter besonderen staatlichen Schutz stellt, haben sich die Lebensverhältnisse der Familien im Vergleich zum Durchschnitt der Bevölkerung in den vergangenen Jahren kontinuierlich verschlechtert. Kinder zu haben ist mittlerweile eines der größten Armutsrisiken. ... Diese und andere Formen der Benachteiligung von Familien sind keineswegs beseitigt. Doch nicht nur die Familien von heute leiden unter dieser Verteilungsungerechtigkeit, auch die Kinder als die Erwachsenen von morgen finden ihre Interessen in der Politik nicht angemessen berücksichtigt. In vielen Bereichen werden immense Lasten in die Zukunft verschoben – zum Nachteil künftiger Generationen. ... Die Vereinbarkeit von Kindern und Beruf ist in Deutschland bei weitem nicht so fortgeschritten wie in den meisten unserer Nachbarländer. Folge: Die deutsche Gesellschaft wird immer älter, ja, sie vergreist regelrecht. ... Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ... gilt, dass sie zwar zum Staatsvolk unserer Verfassungsordnung zählen, aber dennoch kein Wahlrecht haben. Dabei ist auf- 188 grund der demographischen Entwicklung davon auszugehen, dass die Interessen der jungen Generation immer schlechter vertreten werden. Denn der Einfluss von Familien auf politische Entscheidungen wird aufgrund ihres abnehmenden Bevölkerungsanteils noch weiter zurückgehen. Bevölkerungswissenschaftler erwarten, dass um das Jahr 2030 jeder dritte Bundesbürger 60 Jahre und älter sein wird. Die Politik wird in Zukunft immer stärker ihre Prioritäten an den Interessen alter und kinderloser Menschen orientieren – denn deren Gewicht an der Wahlbevölkerung nimmt immer mehr zu. Wir können aber die Zukunft der Familien und damit der ganzen Gesellschaft nur sichern, wenn wir den Familien die Chance geben, auf politische Entscheidungen mehr Einfluss zu nehmen als bisher. Deshalb fordern wir die Ausweitung der politischen Repräsentation auf die junge Generation. Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren – und damit 20 % des Volkes – darf nicht generell der Einfluss auf die Ausübung der Staatsgewalt versagt werden. Wir bereiten deshalb einen interfraktionellen Antrag vor, mit dem das Thema „Wahlrecht von Geburt an“ erst mal in den Bundestag eingebracht werden soll. Darin wird eine Grundgesetzänderung gefordert, die ein Wahlrecht ab Geburt vorsieht. Kinder sollen dabei Inhaber des Wahlrechts werden, das aber treuhänderisch von den Eltern beziehungsweise Sorgeberechtigten ausgeübt wird, bis ihre Kinder die Volljährigkeit erreicht haben. Für die Ausübung des Kinderwahlrechts sollte eine einfache und beide Elterteile möglichst gleichberechtigende Regelung vorgesehen sein. Das könnte durch abwechselnde Wahl der beiden Elternteile oder halbe Stimmen erfolgen. Mit dem Wahlrecht ab Geburt steigen die Chancen, familien- und kinderfreundliche Politik durchzusetzen. ... Die Zahl der Wahlberechtigten würde nach heutiger Bevölkerungsstruktur um rund 14 Millionen steigen. Eine derartige Reform passt durchaus in unsere Verfassungsordnung. Das in Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz verankerte demokratische Prinzip umfasst die Grundsätze der Allgemeinheit und Gleichheit von Wahlen. Wenn die gesamte im Staat vorhandene Herrschaftsgewalt vom Volke ausgeht, müssen alle zu diesem Staatsvolk gehörenden Menschen als prinzipiell gleich angesehen und in das Wahlrecht einbezogen werden. Dass dennoch Kinder und Jugendliche nach Artikel 38 GG ausgeschlossen sind, wird damit begründet, dass das Wahlrecht eine gewisse Beurteilungs- und Verstandesreife des Wahlberechtigten voraussetze. Bei Volljährigen wird diese Beurteilungsfähigkeit generell unterstellt, selbst wenn sie nicht in jedem Einzelfall gegeben ist. Insofern wird das Kriterium der Verstandesreife keineswegs konsequent angewendet. Im Übrigen ist dieses Kriterium in unserer Verfassung grundsätzlich keine Voraussetzung für die Gewährung von Grundrechten. Eltern sollen bei der Ausübung des Wahlrechts in Stellvertretung ihres Kindes dessen wachsende Fähigkeiten zu selbstständigem, verantwortungsbewusstem Handeln berücksichtigen. Die Wahlentscheidung sollte von den Eltern, soweit es nach dem Entwicklungsstand des Kindes angezeigt ist, mit dem Kind besprochen werden. Kritiker unserer Initiative halten uns vor, sie verletzte den Grundsatz, wonach die Wahl durch den Wähler höchstpersönlich zu erfolgen habe. Doch der Grundsatz der Höchstpersönlichkeit ist ohnehin – und aus gutem Grund – nicht ausdrücklich in der Verfassung verankert. In der Praxis wird er bereits vielfach durchbrochen. Die Möglichkeiten zur Briefwahl und zur Beauftragung eines Wahlhelfers sind ebenso klare Abweichungen. Im Ausland, etwa in Frankreich oder Großbritannien, gibt es noch weitergehende Ausnahmen. Keinesfalls ist ein solches ohnehin nur eingeschränkt gültige Rechtsprinzip aber wichtiger als der Grundsatz der prinzipiellen Beteiligung des gesamten Volkes an der Staatsgewalt in einer Demokratie. Ein Wahlrecht von Geburt an ist keine fixe Idee, sondern eine Entscheidung für die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft und eine Chance für ein kinder- und familienfreundlicheres Deutschland. Zu dieser Initiative vereinigen sich gewichtige Persönlichkeiten, wie der Altbundespräsident und ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts Roman Herzog, Ex-Verfassungsrichter Paul Kirchhof, Kardinal Karl Lehmann, Bundesfamilienministerin Renate Schmidt (SPD), die Bundestagsvizepräsidentin Antje Vollmer (Grüne), 189 der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff (FDP) und der frühere Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) Hans-Olaf Henkel.“ Dieser Initiative schlossen sich 40 Parlamentarier an. Die Grundidee eines Kinderwahlrechts ist nicht so neu, wie die aufgekommene Diskussion vermuten lässt. Die Grundzüge gehen zurück auf den Widerständler Carl Goerdeler, der sie nach dem misslungenen Anschlag des 20. Juli 1944 in der GestapoTodeszelle in seinem Manifest für die politische Zukunft Deutschlands skizzierte. Mit dem Beginn der Demographie-Debatte in Deutschland hat der alte Ansatz neue Aktualität erlangt. Die Befürworter sehen ihn im Zusammenhang mit der Zukunftsfähigkeit unseres Landes in einer vergreisenden Gesellschaft, in der »die Alten« als wichtigste Wählerklientel versucht sein könnten, ihre Belange zu Lasten der zukünftigen Generation/en durchzudrücken. Als Argumente bringen die Befürworter eines aus Gründen der „Generationengerechtigkeit“ von den Eltern bis zur Volljährigkeit des jeweiligen Kindes treuhänderisch auszuübenden „Kinderstimmrechts“/“Familienstimmrechts“ ab Geburt darauf, dass Kinder auch zum Staatsvolk gehören und eine Gleichheit der Stimmen durch das derzeitige Wahlrecht ihrer Ansicht nach verhindert werde (STERN 08.05.03). Solms: Man dürfe einem Staatsbürger nicht einfach das Wahlrecht als Grundrecht entziehen. Ein sehr fragwürdiges Argument! (Mit dem Argument könnte man ebenso albern auch schon fast dafür plädieren, dass Kinder von Geburt an das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung und Eltern deswegen kein Recht hätten, die Kinderzimmer zu kontrollieren, oder dass die Verschwiegenheitspflicht der Beamten in dienstlichen Belangen abgeschafft gehöre: schließlich hätten wir Rede- und Meinungsfreiheit! Das Grundgesetz kennt Staatsbürger minderen Rechts: Beamte wird z.B. kein Streikrecht zugestanden.) „Familienrecht Teufel macht sich für Reform stark Eltern sollen Wahlrecht ihrer Kinder ausüben Stuttgart - Nach Ansicht des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Erwin Teufel (CDU) sollen Eltern bei Wahlen im Namen ihrer Kinder zusätzliche Stimmen abgeben können. In der Diskussion um das so genannte Familienrecht machte sich der Regierungschef am Samstag erneut für eine entsprechende Reform stark. Eine entsprechende Änderung des Wahlrechts hatte Teufel bereits im September 2003 gefordert. Zuvor hatten sich schon der sächsische Ministerpräsident Georg Milbradt und Parteienvertreter aus dem Saarland für ein neues Wahlrecht ausgesprochen. Das beim Familienwahlrecht am häufigsten diskutierte Modell sieht vor, dass die Eltern das Wahlrecht ihrer Kinder unter 18 Jahren treuhänderisch ausüben. Das Wahlrecht selbst soll allerdings schon von Geburt an bei den Kindern liegen. Angesichts des steigenden Durchschnittsalters der Wähler müssten die Interessen von Kindern und Familien bei politischen Entscheidungen besser berücksichtigt werden. "Damit kann sichergestellt werden, dass sich Politik wieder an längerfristigen Zukunftsthemen orientiert." Es sei ein "Alarmsignal", dass praktisch alle wichtigen familienpolitischen Entscheidungen der vergangenen Jahre vom Bundesverfassungsgericht und nicht von den gewählten Abgeordneten getroffen worden seien. "Hier zeigt sich deutlich, dass unser Parlament an einer ganz zentralen Stelle, nämlich bei Familie und Zukunftsthemen, einen blinden Fleck hat." Der Bundestag berät zurzeit einen Antrag von Abgeordneten aller Parteien, der ein Familienwahlrecht zum Ziel hat. Die Hürde zur Durchsetzung einer solchen Reform ist allerdings hoch: Sowohl im Bund als auch in Baden-Württemberg wäre eine Verfassungsänderung erforderlich, da Grundgesetz und Landesverfassung ein Wahlalter von 18 Jahren vorschreiben. "Zum Volk gehört man nicht erst ab dem 18. Geburtstag, sondern von Geburt an", sagte Teufel dazu. dpa/lsw“ (Stuttgarter Nachrichten 22.01.05) 190 Die Befürworter eines Kinderwahlrechts argumentieren: Ein kinderloses Ehepaar habe bei einer Wahl genau doppelt so viel politisches Gewicht wie eine Alleinerziehenden-Familie mit drei Kindern - in der aber zweimal so viele Staatsbürger leben. Sie verweisen außerdem darauf, dass, wer Kindern und Jugendlichen das Wahlrecht grundsätzlich vorenthalte, die prinzipielle Gleichheit der Staatsbürger in Frage stelle und der Parlamentarische Rat bei der Schaffung des Grundgesetzes in der Verfassung als Wahlrechtsgrundsätze nur „allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim“ angeführt, nicht aber die Höchstpersönlichkeit der Vornahme des Wahlaktes bestimmt hat. Aus der Nichtnennung der Höchstpersönlichkeit versuchen die Befürworter eines Stimmrechts von Geburt an Honig zu saugen. Eine 28-millionenfache Übertragung je eines halben Stimmrechts auf jedes Elternteil per Gesetz schließe zudem eine Käuflichkeit der Stimme aus. Als Argumentationskrücke verweisen die Befürworter ferner darauf, dass man in Frankreich und Großbritannien [mit der Möglichkeit des „I want someone else to vote for me (a proxy vote)“] sehr wohl einen bevollmächtigten Vertreter für sich wählen lassen könne, wenn man sich verhindert glaube. Aber was sagt das über die Gedankenwelt des Parlamentarischen Rates aus, als der unsere Verfassung schuf? Nichts! Für die Verfassungsmütter und -väter war ein Kinderwahlrecht gar nicht vorstellbar. Für sie galt der Grundsatz: „One man, one vote!“ Ein gehäufeltes Stimmrecht für Eltern war für sie undenkbar. Und das für sie Undenkbare konnte natürlich nicht im Grundgesetz geregelt werden. Die Gegner eines Kinderstimmrechts sehen Vorschläge für die Einführung eines „Kinderstimmrechts“/“Familienstimmrechts“ als „populistisch motivierten Unsinn“ an. Kinder, die noch erzogen und ausgebildet werden müssen, und Erwachsene seien nicht gleich! Ein Stellvertreterwahlrecht untergrabe zudem das Prinzip der Stimmengleichheit, da einige Wähler - die Eltern - mehr Stimmen hätten als andere. Und was solle gelten, wenn die heranwachsenden Kinder ein bestimmtes Stimmverhalten fordern? Wie könnten die Kinder eine Stimmabgabe in ihrem Sinne kontrollieren? Am 1. April 2004 debattierte das Bundestagsplenum unter der Drucksachen-Nummer 15/1544 den Antrag "Mehr Demokratie wagen durch ein Wahlrecht von Geburt an". Misstrauische Wähler vermuten hinter der Kampagne für ein von den Eltern stellvertretend für ihre Kinder wahrzunehmendes Wahlrecht von Geburt an ein verdecktes finanzielles Manöver abgefeimter Parteipolitiker: „Familienfreundliche Politik lässt sich auch ohne Kindermehrstimmen gestalten. Dies ist eine Sache des politischen Willens. Genau betrachtet steckt eine Verbesserung der Parteienfinanzierung dahinter. Aus 41 Millionen Wählerstimmen werden dadurch 50 Millionen à fünf Euro Wahlkampfkostenerstattung, und für Familienpolitik bleibt noch weniger Geld übrig.“ G. W. / Weingarten (STERN 22.05.03) (Natürlich hält eine solche Polemik einer genauen Überprüfung mit den den Parteien wirklich gezahlten Beträgen für die Wahlkampfkostenerstattung von € 0,70 für jede weitere Stimme und einer Gegenüberstellung dieses minimalen Betrages im Verhältnis zum Volumen des Gesamtetats nicht stand!) Letzte Meldung in Sachen Kinderwahlrecht: Kirchhof spricht sich für Kinderwahlrecht aus Der im Wahlkampfteam der Union für Finanzen zuständige Paul Kirchhof will Familien ein größeres Gewicht einräumen: Laut einem Zeitungsbericht spricht er sich für ein Wahlrecht für Kinder aus - laut einer Umfrage trauen die Deutschen dem Kabinett von Kanzler Schröder mehr zu als Merkels Wahlkampfteam. Berlin - Eine dafür notwendige Verfassungsänderung halte er für "erwägenswert", sagte Kirchhof der "Welt". Das Problem der alternden Gesellschaft lasse sich nur in den Griff bekommen, "wenn wir die Menschen dazu veranlassen, das zu tun, was sie wollen: nämlich Kinder zu bekommen. Und da stimmen die Rahmenbedingungen nicht", sagte Kirchhof. Erneut betonte er die Bedeutung der Familie für den Zusammenhalt des Staates. "Dieser Staat braucht die Familie, um eine Nation bleiben zu können." Erst vor wenigen Wochen war ein parteiübergreifender Vorstoß für die Einführung eines Kinderwahlrechts gescheitert. Der Bundestag hatte im Juni mit großer Mehrheit einen entsprechen- 191 den Antrag wegen verfassungsrechtlicher und praktischer Bedenken abgelehnt. Eltern hätten bei Wahlen stellvertretend für Jugendliche unter 18 abstimmen sollen. ... SPIEGEL ONLINE 24.08.05 IX. Demoskopie „Mal sehen, wer recht hat.“ Umfragen sind ein zweischneidiges Schwert. Sie sind mit Erhebungsunsicherheiten und mathematischen Fehlerquoten behaftete, ausschließlich auf den Befragungszeitraum bezogene abgefragte und dann auf eine größere Bevölkerungsanzahl hochgerechnete Erforschungen einer momentanen Meinung, eines gerade aktuellen Trends, der auch – eventuell durch neue, einschneidende Ereignisse (Elbeflut!) - relativ schnell wieder »kippen« kann. Je brisanter eine Fragestellung ist, desto unsicherer müssen die demoskopischen Institute sein, dass die von ihnen Befragten bereit waren, sich zu »outen« und ihre wahre Meinung zu offenbaren. So wird sich kaum ein Prolet bei Befragungen gegenüber Fremden, sondern eher am Stammtisch gegenüber seinen Saufkumpanen dazu bekennen, dass seiner Meinung nach Frauen von ihren Männern durch Schläge zu »richtigem« Verhalten angehalten werden müssten, doch hauptsächlich von Männern handgreiflich verübte häusliche Gewalt ist – quer durch alle Bevölkerungsschichten - ein großes gesellschaftliches Problem. Die viel zu wenigen Frauenhäuser sind voll von geprügelten Frauen und Kindern. Wegen dieser Befragungsunsicherheiten wird von den Meinungsforschungsinstituten oftmals versucht, bei Umfragen auch Kontrollfragen einzubauen, um von deren ungeschützterer Beantwortung einen Rückschluss auf die »Richtigkeit« der zuvor erhaltenen Antworten auf »kritische« Fragen vornehmen zu können und die zuvor erhaltenen Antworten nach wahrscheinlichem Wahrheitsgehalt durch mathematisch-statistische Methoden überprüfend aufzubereiten. Die Befragungsergebnisse von annähernd je nach Kassenlage 1.000 bis 2.000 Personen (der MikroZensus) werden durch mathematische Faktoren, die zu dem streng gehüteten Geheimnis eines jeden demoskopischen Institutes gehören, »gewichtet« und so auf die Gesamtbevölkerung (den Makro-Zensus) hochgerechnet. Das Ergebnis einer Umfrage kann sehr entscheidend von der den jeweiligen Befragten vorgelegten Fragestellung abhängig sein. Richtige Fragestellung und richtige Gewichtung der repräsentativ zufällig Befragten, deren Antworten dann mathematisch auf die gesamte Bevölkerung »hochgerechnet« werden, sind entscheidend für die »Richtigkeit« der Ergebnisse einer Umfrage. Da die Gesetze der Mathematik parteipolitischen Manipulationen entzogen sind und somit die mathematisch-statistischen Methoden der Aufbereitung der durch die Befragung vor Ort erhaltenen Rohdaten gleich sind, sollten sich die Ergebnisse der im annähernd gleichen Zeitraum vorgenommenen Umfragen renommierter demoskopischer Institute bei annähernd gleicher Fragestellung wegen unterschiedlicher Gewichtungsfaktoren maximal nur in einem Toleranzbereich von 3 % unterscheiden. Sie müssen damit aber trotzdem nicht den realen Gegebenheiten entsprechen, wenn die Befragten zuvor keine ehrlichen Antworten gegeben hatten. So gaben z.B. anlässlich der Wahl zur Hamburger Bürgerschaft 2001 nur wenig mehr als 5 % der Befragten an, die »rechts« der CDU anzusiedeln gewesene Partei des sich damals als Landes-Sheriff gerierenden Law-and-orderPopulisten Schill wählen zu wollen. Alle demoskopischen Institute sagten ungefähr diesen Wahlerfolg voraus. Seine Partei erhielt jedoch aus dem Stand heraus 19,4 % der Wählerstimmen der mit 192 der Politik der Mitte-Links-Koalition aus SPD und den Grün-Alternativen Unzufriedenen - und der neue Hamburger Mitte-Rechts-Senat aus CDU, der Schill-Partei und der FDP hatte mit dem neuen Innensenator zweieinhalb Jahre lang ein Dauerproblem, bis es seinetwegen zu vorgezogenen Neuwahlen kam. Ähnlich falsch sind die Ergebnisse, wenn die Interviewten nach ihrer rechtsextremen Affinität befragt werden. Da bekennt sich auch ein wesentlich geringerer Teil der späteren rechtsextremen Wähler zu seiner geplanten Stimmabgabe für eine der rechtsextremistischen Parteien. Dieses »Befragtenschwindels« ungeachtet – bei »kitzligen« Fragestellungen geben Befragte halt nicht immer ihre wahre Meinung kund - sollten die im annähernd gleichen Zeitraum vorgenommenen, nicht durch politische Ereignisse in besonderer Weise unterschiedlich berührten Antworten auf annähernd gleiche Fragestellungen und die Ergebnisse der aus diesen erhobenen Rohdaten ermittelten Hochrechnungen der Umfrageergebnisse annähernd gleich sein, weil man davon ausgehen kann, dass die auf der Straße stehenden oder am Telefon hängenden Befrager unterschiedlicher Institute von den Befragten gleichermaßen angeschwindelt werden. Da wundert es, dass sich im Februar 04 ungefähr vier Monate vor der Wahl zum Europaparlament 2004 mit dem Konfliktthema einer irgendwann zur Entscheidung anstehenden Vollmitgliedschaft der Türkei in der EU zwei Umfragen mit annähernd gleicher Fragestellung um mehr als die tolerierbaren 3 % Umfrageungenauigkeit unterschieden: SPIEGEL 21.02.04: „Die Türkei bewirbt sich um die Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Sollte die Türkei Ihrer Meinung nach mittel- bis langfristig in die EU aufgenommen werden?“ TNS Infratest (1.000 Befragte) vom 16./17.02.04 für den SPIEGEL: Ja = 54 % / Nein = 37 % STERN 26.02.04: „Soll die Türkei in die EU aufgenommen werden?“ Forsa (1.005 Befragte) vom 19./20.02.04 für den STERN: Ja = 38 % / Nein = 57 % 16 bis 20 Prozent Differenz bei den Ergebnissen für Zustimmung oder Ablehnung: Das darf nicht sein! Solche Abweichungen machen die Demoskopie noch suspekter, als sie manchen schon ist. Churchill meinte spöttisch: „Ich glaube nur an die von mir selbst gefälschten Statistiken.“ Und ein Spruch, den ich an einem Regal des Statistischen Landesamtes Hamburg entdeckte: „Die Statistik ist wie ein Bikini: Was sie zeigt, ist verwirrend – aber die Hauptsache verbirgt sie.“ Diese dargestellten Unsicherheiten ergeben sich schon bei Meinungsumfragen, die sich auf die Meinung zu einem gegenwärtigen Zeitpunkt beziehen. Prognosen für eine künftige Einstellung und ein möglicherweise daraus resultierendes künftiges Verhalten wie schon Monate vor einem Wahltermin in der klassischen „Sonntagsfrage“ abgefragt – „Wenn am nächsten Sonntag Wahl wäre: Welche Partei würden Sie wählen?“ - lassen sich noch wesentlich unsicherer gewinnen: Je entfernter das künftige Ereignis ist, auf das sich die Umfrage bezieht, desto unsicherer wird das Ergebnis einer auf der aktuellen Umfrage basierenden Vorhersage selbst dann, wenn nicht oder kaum geschwindelt wird, weil sich Einstellungen mit aktuell dazwischen tretenden Ereignissen ändern können: Die CDU/CSU sah sich ein Vierteljahr vor der Bundestagswahl 2002 im Bündnis mit der die 18-%-Marke anstrebenden FDP als wahrscheinlichen Wahlsieger, aber dann kam die verheerende Elbe-Flut und die Gefahr des Ausbruchs des Irak-Krieges mit deutscher militärischer Beteiligung, und die SPD konnte unter ihrem geschickt agierenden Bundeskanzler Schröder die CDU/CSU doch noch kurz vor der Ziellinie mit nur 6.027 Stimmen Vorsprung, 0,01 % der potentiellen Wähler, abfangen; die Regierungskoalition gewann die Wahl mit einem Stimmenvorsprung von nur 1,19 % der tatsächlichen Wähler, dem bisher knappsten Ausgang einer Bundestagswahl. Diese 1,19 % halten sich in dem Toleranzbereich der jeder hochgerechneten Umfrage anhaftenden Aussageungenauigkeit von hinnehmbaren 3 %. Nach boshafter Demoskopenmeinung sind Wahlen "eine Veranstaltung zur Überprüfung der demoskopischen Vorhersage". Und der Mathematiker Ulmer befand überspitzt: „Wahlvorhersagen auf Grund von Befragungen sind der reine Schwindel. Sie sind ein wissenschaftlich verbrämtes Orakel der Neuzeit.“ Er kann großenteils Recht haben. Das hat der Abgeordnete der SPD Jakob Maria Mierscheid nachgewiesen, dessen Website Sie unter Bundestag.de finden können, wo auch sein Konterfei mit Nickelbrille zu sehen ist; einfach den Namen in das Such- 193 feld eingeben. Es lohnt sich, denn er hat festgestellt - und das ist an den übereinander gelegten Kurven der Stahlproduktion und des SPD-Stimmenanteils sehr gut abzulesen -, dass von 1945 bis 1998 der Stimmenanteil der SPD in verblüffender Weise mit dem Index der deutschen Rohstahlproduktion - gemessen in Mio. Tonnen - im jeweiligen Jahr der Bundestagswahl korrelierte und nannte seine Beobachtung das „Mierscheid’sche Gesetz“, das im Juli 1983 im SPD-Parteiorgan „Vorwärts“ veröffentlich worden ist. In der Tat waren die darauf fußenden Prognosen - von Ausnahmen abgesehen - in der Vergangenheit frappierend präzise: 1998 zum Beispiel produzierte die Bundesrepublik 41 Millionen Tonnen Rohstahl, die SPD erzielte 40,9 Prozent der Stimmen. Und 1987 lagen nur 0,9 Prozentpunkte zwischen dem Wahlergebnis und der Vorhersage nach dem „Mierscheid’schen Gesetz“. Das müsste die SPD im Wahljahr 2005 hoffen lassen, in dem die Stahlproduktion Rekordhöhen erreicht - wenn die durch Beobachtung gefundene Korrelation zwischen Stahlproduktion und SPD-Stimmenanteil nicht zu schön wäre, um wahr zu sein. „Einwände gegen das Prognostizieren nach Mierscheid sind allerdings nicht ganz unberechtigt. Denn der Abgeordnete mit der auffälligen Nickelbrille ist mehr als ein Hinterbänkler, er ist ein Phantom - ersonnen von fröhlichen SPD-Parlamentariern in ausgelassenen Bonner Zeiten. Immerhin: Auf eine offizielle Homepage auf dem Bundestagsserver hat Jakob Maria Mierscheid es trotzdem gebracht“ (SPIEGEL ONLINE 30.06.05). Nicht ganz so abwertend wie der Mathematiker Ulmer meinte Churchill ironisch: „Prognosen sind schwierig: besonders, wenn sie die Zukunft betreffen!“ Schon öfters stellte sich heraus, dass auf den Wahltag hochgerechnete Prognosen nur bis 17:59:59 Uhr am Wahlsonntag galten. Demoskopische Umfragen bezüglich einer Parteienpräferenz bei einer bevorstehenden Wahl sind also keine sicheren Vorhersagen. Für Wahl 2005 lautete die Vorhersage von Forsa rund drei Wochen vor der Wahl laut STERN 25.08.05: Derzeit will nicht einmal die Hälfte der SPD-Wähler von 2002 für die SPD stimmen. … Forsa-Chef Güllner ist sogar überzeugt, dass dieses Jahr „weder die Kandidaten noch die Themen wahlentscheidend sein werden“. Laut Güllner gelte Schröder zwar nach wie vor als der bessere Kanzler. Seit Februar hat sich aber „die Überzeugung verfestigt, dass Rot-Grün das Land schlecht regiert“. Deshalb wählen die Menschen jetzt CDU - allerdings ohne große Hoffnung, dass es danach besser wird. „Resignative Wechselstimmung“ nennt das Renate Köcher, Chefin des Allensbach-Instituts. Besonders absurd an diesem Wahlkampf ist, dassdass die Mehrheiet der Bevölkerung die SPD einfach nicht wählen will, obwohl sie mit allen Kernforderungen des SPDWahlmanifests übereinstimmt: … „Die SPD kann jetzt zwar ihre inhaltlichen Sprüche auf Plakate kleben“, resümiert Güllner, „und die Menschen stimmen den Aussagen sogar zu. Wählen werden sie die SPD dennoch nicht. Sie haben einfach das Vertrauen verloren.“ „Vorhersagen“ sind auch die am Wahlabend ab Punkt 18.00 Uhr gezeigten Hochrechnungen nicht, das aber aus einem anderen Grund: Meinungsforschungsinstitute und eventuell auch die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten wählen sich nach ihren Unterlagen für repräsentativ gehaltene Stimmbezirke aus und bitten dort jeden (z.B.) sechsten Wähler, wenn er nach Abgabe seiner auf dem amtlichen Stimmzettel angekreuzten Partei und dem Einwerfen des Stimmzettels in die verschlossene Wahlurne das Wahllokal verlässt, für das fragende Institut auf einem institutseigenen Fragebogen – ebenfalls anonym(!) - anzukreuzen, wie er gerade gewählt habe. Diese während des Wahltages vorgenommene Befragung - nicht mit der auf zukünftiges Wahlverhalten abzielenden Fragestellung „Wie würden Sie wählen, wenn …?“, sondern der auf das gerade vorgenommene Abstimmungsverhalten abzielenden Frage „Wie haben Sie gerade gewählt?“ - wird dann rund drei Stunden vor Wahlschluss abgebrochen, ausgezählt, mit institutseigen angenommenen Faktoren gewichtend hochgerechnet und uns dann im Fernsehen um 18.00 Uhr präsentiert, bevor die Wahlurnen in den Wahllokalen überhaupt geöffnet, geleert und die Stimmzettel ausgewertet wer- 194 den konnten. Der Erfolg der Hochrechnung hängt dann – neben der Ehrlichkeit der wiederholenden Stimmabgabe - davon ab, wie repräsentativ das ausgewählte Wahllokal gewesen ist und wie gut die zur Gewichtung und Hochrechnung gewählten Faktoren die Gesamtwählerschaft widerspiegeln. Süddeutsche Zeitung 30.4./1.5.02 (leicht gekürzt) Spiel mit verdeckten Karten Die Methoden der Meinungsforscher sind undurchsichtig und die Wähler zunehmend unberechenbar Die Umfragen zeigten eine große Koalition. Am Wahlabend in Sachsen-Anhalt war dann die Verblüffung groß: bei Siegern, Verlierern - und Wahlforschern. Die Möglichkeit einer schwarz-gelben Koalition hatte niemand vorhergesehen. Noch in der letzten, am Freitag vor der Wahl veröffentlichten Umfrage hatte das Berliner ForsaInstitut eklatant neben dem Wahlergebnis gelegen (Grafik). [...] Die Meinungsforscher sehen dennoch wenig Grund, ihre Methoden zu überdenken. „Das waren keine Prognosen, sondern nur momentane Stimmungsbilder", erklärt ForsaChef Manfred Güllner zu Sachsen-Anhalt. „Unmittelbar vor der Wahl wusste ein Viertel der Wähler nicht einmal, dass überhaupt Wahlen stattfinden", sagt Güllner. Für die Demoskopen wird die Unstetigkeit der Wähler zunehmend zum Problem, denn sie verkaufen ihre Zahlen durchaus mit dem Anspruch, das Verhalten der Wähler vorauszusagen: „Wenn am nächsten Sonntag Wahlen wären. . .", heißt es in der „Sonntagsfrage". Was als Ergebnis in den Medien präsentiert wird, ist jedoch nicht nur die statistische Zusammenfassung der Antworten. Die „Rohdaten" werden, vielmehr stark überarbeitet, geknetet und gebürstet, bevor sie veröffentlicht werden. Es beginnt mit der Zahl der Befragten: Meist sind es zwischen 1090 und 2000 zufällig aus dem Telefonbuch ausgewählte Personen, die als repräsentativ für die Gesamtbevölkerung gelten. „Zu wenig“, kritisiert der Statistiker Helmut Küchenhoff von der Universität München, „beim Ergebnis großer Parteien muss man dann mit Fehlermargen von bis zu drei Prozentpunkten rechnen. Oft wird aber schon eine Schwankung von einem Prozentpunkt als politischer Trend ausgewiesen". Wenig Wunder, dass die Institute Verlässlichkeit ihrer Zahlen allenfalls im Kleingedruckten nennen. [...] Wesentlich ist auch die Befragungsmethode. Während die drei fürs Fernsehen tätigen Institute Infratest-dimap, Forsa und Forschungsgruppe Wahlen die Bürger per Telefon befragen, stützt sich das Institut für Demoskopie (IfD) in Allensbach auf ein Netz von Interviewern, die in ihrem weiteren Bekanntenkreis in stundenlangen Gesprächen die politische Stimmung erkunden. [...] Ist die Vorauswahl getroffen, beginnt die eigentliche Kunst. Die Demoskopen brauchen Tricks, um den Befragten eine Wahlentscheidung zu entlocken, die diese oft noch gar nicht getroffen haben: Hierzu müssen die Interviewten Politiker erkennen, Sympathie-, Kompetenz- und Vertrauensnoten geben, Parteien und politische Themen auf Skalen ordnen. Sie müssen auch angeben, welche Koalition sie am liebsten hätten und was sie bei der letzten Wahl gewählt haben - die sogenannte Recall-Frage. Daraus destillieren die Demoskopen eine „längerfristige Grundüberzeugung", auf deren Basis sie das Rohergebnis der Sonntagsfrage nach streng gehüteten Geheimrezepten „ gewichten". Auf direktem Weg sind politische Präferenzen kaum zu erfahren. In Kontrolluntersuchungen stellten Demoskopen fest, dass Reihenfolge und Formulierung der Fragen das Ergebnis verzerren können. Und ein beträchtlicher Anteil der Befragten lügt - besonders Anhänger extremistischer Parteien. Auf die vom Berliner Infratest-dimap-Institut in Sachsen-Anhalt geradeheraus gestellte Recall-Frage wollte sich anfangs nur ein Prozent der Befragten dazu bekennen, bei den Landtagswahlen 1998 DVU gewählt zu haben; tatsächlich war die rechtsradikale Partei damals auf 12,9 Prozent gekommen. „Dann formulierten wir die Frage diplomatischer und aus einem Prozent wurden schließ- 195 lich acht", sagt Richard Hilmer, der Geschäftsführer von Infratest-dimap. [...] Auf welchem Weg die Demoskopen von den Rohdaten einer Erhebung zur veröffentlichten Prognose kommen, bleibt Betriebsgeheimnis der Institute - fast so streng gehütet wie das Coca-Cola-Rezept. Der Statistiker Friedrich Ulmer von der Universität Wuppertal zweifelt, dass es dabei nur streng wissenschaftlich zugeht: „Die Wahlforscher nehmen meist das alte Wahlergebnis und schreiben es behutsam fort. So lange die politischen Lager stabil sind, funktioniert das." Umschwünge wie in Sachsen-Anhalt sind so kaum zu prognostizieren. Dennoch befürchten die Demoskopen bei der Bundestagswahl im Herbst kein Debakel wie in Sachsen-Anhalt. „Die höhere Wahlbeteiligung erlaubt bessere Prognosen", sagt Forsa-Chef Manfred Güllner. [...] Hilmer räumt aber ein, dass sein Geschäft immer schwieriger wird: „Die Wähler reagieren immer schneller und sensibler", sagt er. Bei der Bundestagswahl 1998 haben sich laut Umfragen - 16 Prozent der Wähler erst am Wahltag für eine Partei entschieden. „Das werden wir m September wieder sehen", glaubt Christina Holtz-Bacha vom Institut für Publizistik der Universität Mainz. „Da kann ein Fernsehduell ein paar Tage vorher den Ausschlag geben." [...] Mit Wahlprognosen wird versucht, Politik zu machen (z.B. Zweitstimmenkampagne der FDP 1990 zur Verhinderung einer von ihr befürchteten absoluten Mehrheit der CDU und 2005 zur Ermöglichung einer schwarz-gelben Koalitionsregierung): Eine Partei, die in der Befragung der Wähler zu klar vorn liegt, fürchtet, dass ihre Wähler nicht mehr für den Wahlgang mobilisiert werden könnten, weil eh schon alles gelaufen sei. Führt eine Partei nur ein bisschen, so hofft sie auf den "Bandwaggon-Effekt". Es sollen von den unentschlossenen Wählern möglichst noch einige, dem menschlichen Herdentrieb folgend, auf den Tanzwagen, der den Zirkus-Umzug anführt, wo die »Musik spielt« und sich das »angesagte« Lebensgefühl Bahn bricht, aufspringen. "Die Wähler wollen zu den Siegern gehören und tendieren im Zweifelsfall zu dem vermeintlichen Wahlgewinner", argumentieren die Vertreter dieser These. Nichts sei erfolgreicher als der Erfolg! Eine Partei, die in den Umfragen abgeschlagen ist, hofft auf den "Underdog-Effekt". Mitleidsstimmen (für den "unterlegenen Hund") zählen auch. "Gerade den gemutmaßten Verlierern geben die Schwankenden ihre Stimme, um deren Niederlage im Rahmen zu halten", hoffen die von der prognostizierten Wählergunst vermeintlich Benachteiligten. Keiner weiß bisher genau, ob sich diese beiden skizzierten Effekte nicht möglicherweise aufheben. Obwohl höchstens ein Drittel der Wähler die Umfrageergebnisse zur Kenntnis nimmt – viele kennen ja nicht einmal die sich zur Wahl stellenden Parteien oder die aussichtsreichen Kandidaten für das Amt des Bundeskanzlers -, ist wegen befürchteter negativer Ausflüsse publizierter Ergebnisse von Meinungsumfragen vor Wahlen in einer Vielzahl von Ländern die Bekanntgabe in den letzten Wochen vor einer Wahl verboten. Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hofft, dieses Problem durch eine angekündigte Untersuchung aufdecken zu können; ob es - zweifelsfrei - gelingen wird, ist fraglich. Bisherige Ergebnisse der Forschung lassen ansatzweise erkennen: Veröffentliche Umfragen während des Wahlkampfes können möglicherweise sowohl die Wahlbeteiligung wie auch das Abstimmungsverhalten beeinflussen. Wenn durch einen zu großen Vorsprung einer Partei schon alles »gelaufen« zu sein scheint, ist es schwer, deren Anhänger zur Stimmabgabe zu mobilisieren – insbesondere bei schönem Wetter. Zwar ändern Wähler durch die Kenntnisnahme von Umfrageergebnissen nicht ihre Parteipräferenz, und wer parteigebunden ist, wählt weiterhin so wie beabsichtigt, aber strategisches Wahlverhalten, z.B. durch Stimmensplitting und Leihstimmenvergabe, wird durch die Prognose eines (angeblich) knappen Wahlausganges provoziert. Ähnlich sei es mit dem „Fallbeil-Effekt“ (Reumann) der 5-%-Hürde. Wenn sich auch die Parteipräferenz der »entschlossenen« Wähler nicht durch die Bekanntgabe der „Zwischenergebnisse“ in den publizierten Meinungsumfragen verändert, so könnte sehr wohl bisher Unentschiedenen eine Wahloption deutlich werden, könnten sie zu einer (möglicherweise 196 ihre Stimmen aufsplittenden) Stimmabgabe aktiviert werden. Dabei habe der „BandwaggonEffekt“ ein leichtes Übergewicht gegenüber den Auswirkungen des „Underdog-Effekts“. Der „Anti-Loser-Effekt“, der der »Bandwaggon-Partei« Stimmen zutreibt, weil Teile der Wählerschaft sich vom vermeintlichen Verlierer zurückziehen, überwiege den „Anti-Winner-Effekt“, der durch seine Stimmabgabe den Absturz einer Partei zu mildern oder zu verhindern suche. Aber in Mehrparteiensystemen wie in der Bundesrepublik Deutschland mit ihren verschiedenen Koalitionsmöglichkeiten zwischen Parteigruppierungen sei der „Underdog“ nicht immer genau bestimmbar. Als im Wahlkampf zur Bundestagswahl 2002 vor der Elbe-Flutkatastrophe und dem drohenden Irak-Krieg zunächst die Unionsparteien und die sich schon im erträumten Erfolg von 18 % Wählerstimmen badende FDP als die klaren Gewinner aussahen, die bis dahin regierende Koalition aus SPD und Grünen als die klaren Wahlverlierer gehandelt wurden: wer war am Wahltag schließlich der Underdog, der mit einer Mitleidsstimme aufgepäppelt werden sollte? So schlägt die Parteipräferenz dann doch wieder durch. Aber auch wenn es nicht gelingt, den Einfluss dieser beiden gegensätzlichen Tendenzen genau zu erfassen, sind Meinungsforschungsinstitute ein zusätzliches Artikulationsforum für Wähler und erfüllen für die Parteien eine wichtige Feedback-Funktion: Je mehr Wahlberechtigte und insbesondere den Parteien wichtige Wählergruppen im Vorfeld einer Wahl sich als unentschlossen »outen«, desto genauer betrachten die Parteien die Ergebnisse der Umfragen. So wird dann z.B. schnell noch ein verbessertes Frauenprogramm nachgeschoben, um bei der Mehrheit der Wähler, den Frauen, gut anzukommen. Und je unentschlossener sich Wählergruppen äußern, desto größer wird der Einfluss der den Ursachen nachspürenden Meinungsforschungsinstitute, der darauf beruht, dass einerseits die sie beauftragenden Parteien die Gründe für die erhoffte aber bislang ausgebliebene Zustimmung zu erfahren suchen, um ihre Wahlkampf-Feinabstimmung danach ausrichten zu können, und weil andererseits die Ergebnisse der Umfragen nicht nur den sie beauftragt habenden Parteien zur Verfügung stehen, sondern die Ergebnisse auch in den Medien veröffentlicht werden. Und wer sieht sich da gerne abgeschlagen bloßgestellt? Das kann die Wahlkampfstrategen zur Änderung ihrer zuletzt eingeschlagenen Taktik veranlassen. Selbst noch während der heißen Phase der Wahlkämpfe werden bis dahin gültige Wahlaussagen öfters noch ergänzend akzentuiert oder notfalls abgeändert, wenn Meinungsforschungsinstitute einen – vermeintlichen – Akzeptanzmangel in einer für die Partei relevanten Wählergruppierung feststellen zu können glauben. Der Satz von Heiner Geißler: „Wir leben in einer Demokratie, nicht in einer Demoskopie“, ist nur in seiner Grundaussage richtig. Um etwaigen Manipulationen mit Wahlumfragen von vornherein vorzubeugen, sind in Großbritannien und Frankreich die Publizierung von Wahlumfrageergebnissen kurz vor Wahlen verboten. In den 60-er Jahren wurde dieser Ansatz auch in der Bundesrepublik diskutiert. Wegen von manchen Politikern befürchteter Auswirkungen der Publizierung der Ergebnisse von Wahlumfragen, die – wie die Institute selbst nie müde werden zu betonen - immer nur ein momentanes(!) Stimmungsbild wiedergeben, nicht aber eine gesicherte Prognose über den noch einige Monate oder zuletzt nur noch Wochen in der Zukunft liegenden Wahlausgang zulassen, geraten die Umfrageinstitute immer wieder in die Schusslinie derjenigen Parteien, die sich durch die Publizierung der Institutszahlen benachteiligt wähnen. Dabei sind jedenfalls die großen Institute – schon allein aus Selbstschutz! - zu seriös, um sich (jedenfalls zu offensichtlich) vor einen Parteikarren spannen zu lassen; auch die parteinahen: 2002 war Forsa in großer Nähe zur SPD und Allensbach zur CDU. Lügen hätten immer kürzer werdende Beine: Spätestens nach dem Wahltag müssten zu fehlerhafte eigene Prognosen ja gerechtfertigt werden! So war 2002 bezüglich der Wahldemoskopie EMNID für ntv, Infratest-dimap für die ARD, die Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF, Forsa für RTL und Allensbach für die FAZ tätig. Ein als unseriös gebrandmarktes Institut würde ja zwischen den Wahlen von der Wirtschaft nicht mehr mit Aufträgen für Umfragen betraut werden! Das ginge an die Existenz! Darum lässt sich kein Institut gerne den Ruch parteiwillfähriger Ergebnismanipulation anhängen! Trotzdem gibt es mas- 197 sive Pressionen: Hoffentlich wird lange unvergessen bleiben, wie der Kanzlerkandidat der CDU/CSU bei der Bundestagswahl 2002, Stoiber, dem Meinungsforschungsinstitut Infratest-dimap mit an dessen wirtschaftliche Substanz gehenden Konsequenzen für den Fall seines Wahlsieges drohte, denn Infratest-dimap hatte die Majestätsbeleidigung begangen, keine für die CDU/CSU so günstigen Zahlen zu vermelden wie die anderen Institute. Dieses Institut sei offensichtlich zu regierungsnah. Darum werde man nach einem Wahlsieg dorthin keine Aufträge mehr vergeben! Peinlich nur für die CDU/CSU, dass sich die Zahlen von Infratest-dimap trotz der größten zeitlichen Ferne der Erhebung vom Wahltag nach der Wahl als durchaus der Wirklichkeit angenähert herausstellten. Die Prognosen 2002 zum Vergleich Infratest 13.09. SPD 38,5 % CDU/CSU 36,0 % Grüne 8,0 % FDP 8,5 % PDS 4,7 % FG Wahlen 13.09. Emnid 14.09. 40,0 % 37,0 % 7,0 % 7,5 % 4,5 % 39,0 % 37,0 % 7,0 % 8,0 % 5,0 % Allensbach 17.09 37,0 % 37,3 % 7,2 % 10,1 % 4,4 % Forsa 18.09. 40,0 % 38,0 % 7,0 % 8,0 % 4,0 % tatsächlicher Wahlausgang 38,5 % 38,5 % 8,6 % 7,4 % 4,0 % Nach der Wahl wird sogar teilweise nachgekartet: Der Stoiber-Berater Spreng äußerte am 10.10.02, ca. drei Wochen nach der Wahl, in einem in der ZEIT erschienenen Interview die Meinung: „Allensbach hat den Schaden für die CDU vergrößert.“ Das CDU-nahe Allensbach hatte über Monate einen großen Vorsprung der CDU/CSU/FDPOpposition publiziert und erst in den beiden letzten Wochen vor der Wahl, für die CDU/CSU verblüffend, die Werte seiner Prognosen denen der anderen Institute angeglichen. Wenn der StoiberBerater sich noch nach der Wahl hierüber verärgert zeigte, dann lässt das zumindest erkennen, dass er ein Anhänger der »Band-waggon-Theorie« war und in der Endphase des Wahlkampfes schmerzlich feststellte, dass die Wähler im Begriff gewesen waren, den Musi-Tanzwagen seines Chefs zu verlassen und dort mitzufahren, wo nach Flutkatastrophe und Anti-Irakkrieg-Kampagne in den letzten Wochen vor der Wahl nunmehr die Musik zu spielen schien. Allensbach sah seinerseits nach der Wahl große Rechtfertigungszwänge für die eigenen Fehlprognosen und behauptete, die die Regierungskoalition begünstigenden Prognosen der anderen Institute hätten erst zu der Trendumkehr geführt; was das Allensbacher Institut ebenfalls als einen Anhänger der »Band-waggon-Theorie« ausweist. X. Wahlausgang Direkt nach der Wahl ..... „Im Anschluss an die Wahlhandlung ermittelt der Wahlvorstand ohne Unterbrechung das Wahlergebnis im Wahlbezirk“, heißt es in § 63 Bundeswahlordnung (BWO). Dort und in den anschließenden Paragraphen ist geregelt, was ermittelt werden soll, wie es ermittelt wird und wie in Zweifelsfragen entschieden werden soll. Eine zeitlich vorgelagerte Maßnahme zur Verhinderung von Wahlbetrug ist die unbeobachtete persönliche Stimmabgabe in der Wahlkabine und die verdeckte Abgabe des Stimmzettels in die Wahlurne durch den Wähler. Es liegt – im Gegensatz zu den in den USA häufig verwendeten Wahlmaschinen – so immer ein Wahlzettel vor, der im Zweifelsfall kontrolliert werden kann. Obwohl nicht extra angeordnet, hat die Auszählung nach Schließung der Wahllokale auf jeden Fall öffentlich zu geschehen, um Manipulationen bei der Auszählung von vornherein möglichst zu unterbinden. Die Wahlvorstände werden geschult, damit die Auszählungen – im Gegen- 198 satz zu den USA, wo es keine einheitlichen Auszählungsstandards gibt: ob z. B. bei den Lochkarten nur vollständig durchgestanzte Löcher als gültige Stimmen gewertet werden oder ob schon leicht eingerissene Stimmfelder reichen, wurde je nach Wahlbezirk anders gehandhabt, und die Wahlen unter Verwendung elektronischer Wahlmaschinen fertigen keinen Papierausdruck an, so dass die Stimmabgabe hinterher nicht kontrolliert werden kann und Manipulationen Tür und Tor geöffnet sind - damit also die Auszählungen nach den gesetzlich vorgegebenen einheitlichen Gesichtspunkten vorgenommen werden. Das Ergebnis der Auszählung ist dann vom Wahlvorstand an den Kreiswahlleiter und von dort an den Landeswahlleiter zu melden. Alle Landeswahlleiter melden das aufsummierte Ergebnis aus ihrem Bundesland an den Bundeswahlleiter, der dann die weiteren Berechungen vornimmt und ermittelt, wie viel Sitze im Bundesparlament einer Partei zustehen und wer als Abgeordneter in den Deutschen Bundestag einziehen darf. Das „vorläufige amtliche Endergebnis“ liegt gegen 04.00 Uhr des nächsten Tages nach der Wahl vor. Bis dahin halten alle Presseorgane die Druckerpressen möglichst an, wenn ihre Vertriebswege es nicht erfordern, dass sie mit ungenaueren Zahlen herauskommen müssen. Wichtig zu wissen ist noch, dass die Wahlunterlagen sicher aufgehoben werden müssen, damit eine jederzeitige Überprüfung möglich ist und das Wahlergebnis jederzeit nachvollziehbar bleibt. § 87 BWO regelt, dass die Unterlagen (frühestens) 60 Tage vor der nächsten Wahl vernichtet werden dürfen, wenn der Landeswahlleiter nicht mit einer früheren Vernichtung einverstanden ist, weil es kein Wahlprüfungsverfahren gibt. So soll möglicher Wahlbetrug bis zum nächsten Wahltermin aufgedeckt werden können. In der DDR durften keine Wahlkabinen benutzt werden, und es konnte nichts ausgewählt werden, da nur eine von der SED zuvor abgenickte Einheitsliste zur Nicht-Wahl stand, die schon vor der Wahl den Ausgang der Wahl und damit die Sitzverteilung im nicht frei gewählten Parlament festlegte. Zusätzlich wurde noch von der SED angeordneter Wahlbetrug beim Aufaddieren der Ergebnisse aus den einzelnen Stimmbezirken begangen, auf einer Ebene also, die von interessierten Bürgern nicht mehr leicht zu kontrollieren war. Doch die Bürgerrechtsbewegungen schickten in jedes Wahllokal zur Auszählung ihre Vertrauensleute und nahmen die Addition dann für sich vor, wobei die nachträglichen Wahlmanipulationen der SED dann offensichtlich wurden: Die Ergebnisse wurden zu dem Prozentsatz an angeblicher Zustimmung zurechtgelogen, wie die SED ihn vorher festgelegt hatte. Wahlbetrug wurde in der DDR von der Staatspartei SED von Staats wegen angeordnet und selbstverständlich vom anordnenden Staat möglichst vertuscht, auf jeden Fall aber gedeckt. Weil Wahlfälschung auch nach DDR(!)-Gesetzen strafbar war, wurden die Wahlfälscher der SED, deren Fälschungen von der Parteiführung der SED und obersten Staatsführung der DDR angeordnet worden waren, nach den Anschluss Ostdeutschlands – wegen ihrer persönlichen Zwangslage zum Glück nur sehr milde – bestraft. Wahlbetrug in der Bundesrepublik Deutschland hingegen gründet ausschließlich auf dem Fehlverhalten Einzelner, und nicht auf der Anordnung der stärksten Regierungspartei. Das ist ein himmelweiter Unterschied! Die beiden (nun ehemaligen) CSU-Stadträte von Dachau, die 2002 – als vorläufig letzter bekannt gewordener Fall von Wahlbetrug - die Bürgermeisterwahl in ihrer Stadt durch Manipulation von mindestens 422 Briefwählerstimmen bis hin zum Selbstausfüllen der Stimmzettel durch die Fälscher an Stelle der gebrechlichen Wahlberechtigten in Altersheimen – was schon immer, auch für Bundestagswahlen(!), als Schwachstelle erkannt wurde - zu Gunsten ihres Kandidaten so verfälschten, dass der CSU Kandidat mit 57 (nach anderen Meldungen mit 54) Stimmen Vorsprung die Stichwahl gewann, und die zuvor 3.500 Stimmzettel der Stadtratswahl nach der Wahl hatten verschwinden lassen, wohl hatten verschwinden lassen müssen, hatten keine staatliche Rückendeckung. Sie wurden daher mit den als Strafe für Wahlfälschung im Strafgesetzbuch in den §§ 107 a ff angedrohten strafrechtlichen Sanktionen belegt: Der Haupttäter erhielt zwei Jahre Haft auf Bewährung und musste zusätzlich eine Geldbuße von 125.000 € zahlen (HH Abendblatt 29.01.03). Außerdem musste die Wahl wiederholt werden – die der zuvor ins Amt geschummelte CSU-Bürgermeisterkandidat auf Grund der Trotzreaktion der Wähler wegen der bundesweiten Auseinandersetzungen um den Wahlbetrug dann gewann: „Mir san mir!“ „Wahrscheinlich bleibt, dass die SPD die Wahl trotz Schröder verliert und die Union sie trotz Mer- 199 kel gewinnt.“, prophezeite der STERN 11.08.05. Ist es so gekommen? Oder anders? Oder ganz anders? Wenn das Wahlergebnis feststeht, müssen die sich daraus ergebenden Konsequenzen gezogen werden. Mögliche Fragestellungen für die ersten Erörterungen am Tage nach der Wahl: Wurde die Kanzler-Frage wie zunächst von den Demoskopen und – auf deren Vorhersagen fußend – dann von den Massenmedien vorausgesagt entschieden? Wurde Opposition vom Wähler honoriert? Haben – nach O-Ton Stoiber 2004 – die zwei „Leichtmatrosen“: „die protestantische Ostdeutsche und der Junggeselle aus Bonn“ (gemeint waren: eine kinderlose ostdeutsche protestantische Frau und ein Schwuler), es geschafft, den SPD-Kanzler aus dem Amt zu drängen? Welche Rolle hat dabei das neue Linksbündnis „Die Linkspartei. PDS“ gespielt? Wie viel Prozent Wählerstimmen nahm sie der SPD nach der Wählerwanderungsstatistik ab? Schaffte es „Die Linkspartei. PDS“ in den Bundestag? Ist „Die Linkspartei. PDS“ in der gesamten Bundesrepublik die drittstärkste politische Kraft geworden? Welche Perspektive tut sich gegebenenfalls damit auf? Wo ist „Die Linkspartei. PDS“ wie stark vertreten? Ist die „Hartz-IV-Reform-weg-Partei“ eine ostdeutsche Regionalpartei geblieben? Gelang ihr »als Geist, der stets verneint« und der keine ökonomisch vertretbaren konstruktiven eigenen Rezepte zur Lösung der anstehenden Probleme anzubieten hat, was sich als Konsequenz des demographischen Wandels der bundesrepublikanischen Gesellschaft zur Sicherung der uns alle absichernden Sozialsysteme an Notwendigkeiten ergibt, gelang ihr nach fast vier Jahren Ritt auf der Rasierklinge in Richtung Bedeutungslosigkeit als PDS nunmehr als Unmuts- und Protestbewegung „Die Linkspartei. PDS“ wegen insbesondere der ostdeutschen Befindlichkeiten im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Hartz-IV-Reform der Wiedereinzug in den Deutschen Bundestag? In wieweit gehen die nach dem Zusammenschluss mit der WASG und nach der dritten Umbenennung erreichten Prozentwerte über die von der PDS bisher erreichten Werte hinaus? Zeichnet sich ab, was der Stellvertretende Chefredakteur des STERN, Jörges, mit seiner am 07.07.05 im STERN abgedruckten Analyse heraufziehen sah: „Das Fenster der Linken Oskar Lafontaine und Gregor Gysi mischen die deutsche Politik nicht nur auf, sie können sie tiefgreifend verändern – vielleicht sogar historisch DER WÖCHENTLICHE ZWISCHENRUF AUS BERLIN VON HANS-ULRICH JÖRGES Die Neuen beginnen als Aussätzige. Das kennt man, aus der Gründerzeit der Grünen. Auf der Rechten ignoriert man sie, wohlgefällig. Sie sind ja dabei, den Gegner, die SPD, zu skelettieren. Auf der Linken stigmatisiert man sie, hasserfüllt: Verräter und rachsüchtig der eine, Talkshow-geil und unseriös der andere. Und programmatisch von vorgestern alle beide. Oskar Lafontaine und Gregor Gysi betreten als Randständige, Unberührbare die Bühne. Doch die haben sie schon jetzt rasant umdekoriert, und das wird so weitergehen. Die Linkspartei, aus PDS und WASG in abenteuerlicher Hast zusammengenagelt, ist dabei, die deutsche Politik zu verändern. Das historisch zu nennen ist nicht zu gewagt. Denn ein relevanter Teil der Wähler sieht sie völlig anders als die Etablierten, auch die Medien, fühlt sich gerade wegen der ausgekübelten Verachtung von ihr angesprochen. Aus purem Protest oder politisch wohlbedacht. Dass die Linkspartei noch vor ihrer offiziellen Gründung zweistellige Zustimmung bei Umfragen findet, ist nicht weniger als eine Sensation. Helmuth Schmidt hatte den Umweltschutz heimatlos werden lassen – und das historische Zeitfenster für die Gründung der Grünen geöffnet. Gerhard Schröder hat das Linkssoziale 200 heimatlos gemacht – nun steigen Lafontaine und Gysi durchs Zeitfenster der Neuwahl ins politische Haus. Alle Versuche, es noch rasch von innen zu schließen, sind vergebens. Sie sind schon drin. Heuschrecken-Tapete, Reichensteuer, Reform der HartzReform – kurzum: rote Girlanden – machen die SPD nicht sympathischer, sondern unglaubwürdig. Bestätigen das linke Original, überführen das halblinke Plagiat. In solcher Dekoration dürfen Lafontaine und Gysi gar darauf hoffen, kulturelle Hegemonie zu erobern. Allein der Schatten, den sie vorausgeworfen haben, hat schon genügt, um die gesamte Parteiendebatte nach links zu verrücken. Von der SPD über die Grünen bis tief hinein in die CDU. Steuerentlastung für „Reiche“ wagt keiner mehr. Die Menschen sind klug, sie beobachten das mit feinem Gespür für Opportunismus – und ein Teil von ihnen nimmt es als klare Empfehlung für die Linkspartei. Lafontaine und Gysi gewinnen verbitterte Nichtwähler, herumirrende Protestwähler, auch aus dem Magnetfeld der Rechtsradikalen, und traditionelle Linkswähler. Das verändert die Parteienarithmetik fundamental. Die Wahlbeteiligung steigt – und der Anteil der Konservativen, die in ihrem Spektrum längst alle mobilisiert haben, was zu mobilisieren ist, sinkt relativ. Die Union muss die Hoffnung auf eine absolute Mehrheit fahren lassen, für die FDP wird die Wahl zum Existenzkampf. Die Lager, das rot-rosarot-grüne und das schwarz-gelbe, rücken im Wahlergebnis enger aneinander, als zu erwarten war. Mit anderen Worten: Union und FDP dürften knapper siegen, als sie erhofft haben. Womöglich muss die Union die Liberalen gar huckepack nehmen, mit Leihstimmen. Reichte auch das nicht, käme die große Koalition, denn miteinander bündnisfähig werden SPD, Linkspartei und Grüne nach den Emotionen diese Wahlkampfs sicher nicht sein. Die SPD verabschiedet sich einstweilen als mehrheitsfähige Partei. Das beginnt im Bund und dürfte sich in den Ländern fortsetzen. Die Linkspartei kann dort ähnlich reüssieren wie einst die Grünen. Damit verlieren die Sozialdemokraten nach Schröder ihre politische Gestaltungskraft. Sie werden zurückgeworfen auf die Rolle des kleineren Partners in großen Koalitionen, zur Macht adoptiert von der dominierenden CDU, die nun gleich zwischen drei Partnern wählen kann: SPD, FDP und Grünen. Oder sie sind, bittere Alternative, in einem höchst fragilen Bündnis eingezwängt zwischen Linkspartei und Grünen, ihren bisherigen Zerfallsprodukten – und das unter dem politischen Diktat Lafontaines, der die Bedingungen stellen kann. Und der es in der Hand hat, die SPD aus dieser ungemütlichen Lage zu befreien. Denn der abtrünnige träumt davon, im stern-Gespräch hat er es vergangene Woche offenbart, die Linkspartei in eine dann wieder große linke Volkspartei SPD hineinzuführen. Der Fusion von PDS und WASG vom Wahlbündnis zu einer einzigen Partei, deren Vorsitzender Lafontaine heißen dürfte, würde also die Fusion dieser Linkspartei mit der SPD folgen, deren Vorsitzender zu werden Lafontaines nicht einmal mehr verheimlichter Wunsch ist. Das klingt verwegen heute, und die erste Riege der Sozialdemokraten zeigt ihm dafür den Vogel. Aber diese Riege wird bald nach der Wahl von der Bühne abtreten oder heruntergeschubst werden. Und dann beginnt eine neue Ära, mit neuen Figuren und neuem Kompass. Historisch hätte das Projekt für die SPD einen großen Reiz: Sie könnte nachholen, was sie nach der deutschen Wiedervereinigung nicht gewagt hat – und die nun in der Linkspartei eingeweichte PDS schlucken. Kratzt gar nicht mehr.“ Mögliche Koalitionen: Welche Koalitionen sind nun nach dieser Bundestagswahl möglich? Kann die CDU/CSU mit Hilfe einer anderen Partei oder anderer Parteien die Koalition aus SPD und den Grünen ablösen? Gibt es rechnerisch nur die Möglichkeit einer »großen Koalition«? 201 32 Wie ist das politische Gewicht der Koalitionäre zueinander? Ist Koalitionshandel ein Kuhhandel? Ansprüche der Regierungskoalitionsparteien auf die Position des Vizekanzlers und bestimmte Ministerposten (gegebenenfalls CSU contra FDP). Hat die FDP sich stabilisieren können? Auf welchem Niveau? Gab es im gesamten Bundesgebiet aus Unzufriedenheit mit der bei den demokratischen Parteien offenbar gewordenen mangelnden Lösungskompetenz angesichts drängenden Reformstaus bei vielschichtigen Problemen Zulauf zu den »Rechtspopulisten« und/oder Rechtsradikalen mit ihren vereinfachenden Lösungskonzepten? Rechtspopulismus und Rechtsextremismus als von Wählerunzufriedenheit profitierende Protestparteien? Schafften es die »verbundenen« Rechtsradikalen in den Deutschen Bundestag? Oder konnten die etablierten Rechtsparteien die Demokratie stärken, indem sie zu den Rechtsradikalen tendierende Wähler an sich gebunden haben? Oder schwenkten die Protestwähler vermehrt zur „Linkspartei“? Wie wirkte sich die Wahlbeteiligung für die rechtsextremen Parteien aus? Detailuntersuchung Ostdeutschland: „Die deutsche Einheit ist missraten. Und entsprechend sehen die Wahlergebnisse aus.“, sagte der Ost-Autor eines der bekannten Romane über die Wiedervereinigung und die damit verbundenen Befindlichkeiten der Ostdeutschen „Helden wie wir“, Thomas Brussig. Wie sehen die Befindlichkeiten der Ostdeutschen aus? Haben die Ostdeutschen mal so richtig »die Sau rausgelassen« und als ostdeutsche Protestbewegung die zum dritten Mal umbenannte Partei wiedergewählt, die als SED mit ihren falschen Wirtschaftsrezepten die DDR wirtschaftlich so gegen die Wand gefahren hatte, dass die netto ca. 950 Mrd. € Wirtschaftshilfe aus den alten Bundesländern (ca. 1.500 Mrd. Bruttotransfer minus Steuerrückflüsse) den Sanierungsfall Ostdeutschland auch nach mehr als 15 Jahren noch nicht von den bis mindestens 2019 vereinbarten hohen Transfer-Leistungen abnabeln konnten? Wurde die Wahl nach dem kühl kalkulierten32 süddeutschen Abwatschen der „nicht so klugen“ „frustrierten“ ostdeutschen Bevölkerungsteile – neudeutsch: »Ossi-batching« -, die die Wahl nicht wieder entscheiden dürfen“, durch den CSU-Chef Stoiber und den ihm beispringenden baden-württembergischen Landeschef Oettinger „erneut im Osten“(?) entschieden? „Wir haben leider nicht überall so kluge Bevölkerungsteile wie in Bayern“, zensierte der bayerische Ministerpräsident Stoiber die ostdeutschen (Linkspartei-)Wähler. Machten »die Ostdeutschen« die Wahl wegen Hartz-IV zu einer »Rachewahl«, indem sie die „Hartz-IVReform-weg-Partei“ zur stärksten Partei in Ostdeutschland wählten? Abschneiden der rechtsradikalen Parteien insbesondere im Osten? (NPD 2002: Bundesweit zwar nur 0,45 %; aber in Brandenburg 1,53 %, in Sachsen 1,42 %, dabei dort in den Wahlkreisen Annaberg/Aue 2,26 %, Sächsische Schweiz/Weißeritzkreis 2,2 % und Oberhavel/Havelland II 1,99 %.) 5-%-Hürde und Splitterparteien: Haben kleinere Parteien in der politischen Landschaft Zukunftschancen? Bleibt der Zweitstimmenanteil der großen Volksparteien wieder unter 40 %, so dass Koalitionsbildungen schwierig werden? Ist die Gruppierung der Nichtwähler die zweit- oder die drittstärkste »Partei«? Inwieweit sind die Wähler (überhaupt noch) konfessionell gebunden? Wie haben die rund 300.000 türkischstämmigen (eingedeutschten und nicht durch heimliche Wiederannahme der Ursprungsstaatsbürgerschaft als Zweitstaatsbürgerschaft wegen Verstoßes gegen das Einbürgerungsgesetz wieder ausgebürgerten) Wähler nach der Debatte über den EU-Beitritt der Türkei gewählt? Wenn durch die verbalen Anrempeleien und Rüpeleien im Westen 1 % Wähler mehr für die CDU/CSU gewonnen werden, dann ist der absolute Gewinn größer als der Verlust von möglicherweise 4 % Wählerstimmen im Osten. 202 Index Abgeordnete 72 Abgeordnetenmandat, Kosten 85 Altersversorgung, üppige 96 Anti-Loser-Effekt 195 Anti-Winner-Effekt 195 Arbeitszeit der Abgeordneten 78 Aufwandsentschädigung 85 Ballot, not bullet 13 Bandwaggon-Effekt 195 Befragungsunsicherheiten 191 Bevölkerungsentwicklung 27 Bezahlung von Politikern 33 Bezahlung, angemessene 81 Bundeskanzlerin 36 Bundesländer 5 Bundestag 72 Bundestag, Aufgaben des 35 Bundestagswahl, Wahlziele 35 Bundesverfassungsgericht 9 Bürger, mündige 37 Campact 43 BVerfG 9 Defizitgrenze 33 Demokratie 5, 13, 15, 37 Demoskopie 190 Diäten 54, 85, 90 Diätenbetrug 79 Diäten-Urteil des BVerfGs 94 Eigenerlöse 55 Einflussnahmen durch Gefälligkeiten 56 Einzelbewerber 35 Elternwahlrecht 187 Exekutive 16 Faktor, demografischer 28 Fernsehdemokratie 42 Funktionäre im Parlament 82 Gestaltungsrecht durch Wahlsieg 37 Glaubwürdigkeitsproblem 33 Gleichbehandlungsgrundsatz 22 Gleichheitsgrundsatz 91 Gleichstellungsrichtlinie 36 Grundentschädigung 85 Grundmandatsklausel 170 Halbwertzeiten der Parteibindung 42 Handlungsverlust 9 Hare-Niemeyer-System 50 Hassprediger 21 Hasspredigten 21 Heimschläfer 95 Höchstgrenze, absolute für staatliche Leistungen 55 Höchstgrenze, relative 55 Hunzinger 56 Immunität der Abgeordneten 110 Indemnität von Abgeordneten 110 Judikative 16 Kandidatenauswahl 146 Kassen, schwarze 52 Kinderwahlrecht 189 Koalition, große 31 Koalitionsvertrag 36 Kommission zur Überprüfung des Abgeordnetenrechts 95 Kostenpauschale 94 Landesliste 153 Landeslisten 35 Legislative 16 Legislaturperiode 5 Legislaturperiode, Verlängerung 6 Leichtmatrosen 36 Lernen, pathologisches 27 Lobbycontrol 107 LOBBYISMUS 98 Lobbyistenskandal 57 Lobbykratie 107 Machtwechselmöglichkeit 40 Makro-Zensus 191 Mehrheitswahlrecht 94 Meinungsforschungsinstitute 195 Mierscheid’sche Gesetz 192 Mikro-Zensus 191 Missbrauch der Vertrauensfrage 10 Misstrauensvotum, konstruktives 6, 9 Mitarbeiterbeschäftigung 85 Mitglieder des BT, gesetzlich vorgesehene Anzahl 74 Mitgliederschwund 42 Mitgliederzahlen, Parteien 06/05 42 Mitgliedsbeiträge 54 Mitleidsstimmen 195 Mobilisierung von Wählern 42 Nachwahlen 36 Nebeneinkünfte 79 Nebeneinkünfte, Anrechnung 84 Nebenerwerbs-Politiker 79 Nebenjobs 79 Nebentätigkeiten 79 Nettoeinkommen MdBs 88 Neuwahlen 7 Nichtwähler 43 Nichtwähler-Sponsoring 47 Organklageverfahren 8 Papierkorbstimmen 94 Parlamentarier 76 203 Parlamentsauflösung, vorzeitige 10 Parteibewerber 36 Parteibindung 38 Parteien 15, 26, 32, 163 Parteien, Ansehen der 33 Parteien, Aufgabe der 35 Parteien, Aufgabe von 14 Parteien, Langzeitaufgabe 33 Parteienfinanzierung 51 Parteiengesetz 163 Parteiensteckbrief 64 Parteiprominenz auf vorderen Plätzen der Landeslisten 160 Parteispendenskandale 52 Paulskirchenversammlung 5 PDS 166 PDS-Vorgängerin 33 Problemlösungsinkompetenz 31 Publizitätsgrenze 56 Publizitätspflicht über Nebeneinkünfte von Abgeordneten 84 Querfinanzierung, unzulässige 55 Rechenschaftsberichte über Parteifinanzen 56 Reichsverfassung von 1871 5 Religionsausübung 22 Religionsfreiheit, negative 111 Sachleistungen für Büroausstattung 85 Schavan 21 Scheinkommunikationsinkontinenz 42 Schicksalsgemeinschaft, Kriegsfolgelasten 33 SED, PDS-Vorgängerin 33 Selbstauflösungsrecht 5, 6, 7, 8, 9 Selbstauflösungsrecht in Länderverfassungen 7 Selbstbedienungsparlament 90 Sicherungssysteme, soziale 28 Sitzverteilung im Bundestag seit 1949 74 Sozialstaat 27 Spenden 54 Spenden, anonymisierte 55 Sperrklausel 170 Spin-Doctors 179 Spitzenkandidaten 36 Staatsgewalt 13 Stammwähler 38, 39 Stammwählerschaft 7 Stiftung, parteinahe 55 Stimmabgabe 15 Stimmrecht, aktives 112 Stimmverhalten 177 Stimmvieh 37 Stimmzettel 37 Stückelung von Geldzuweisungen 55 Taschen, gläserne 84, 96 Testbogen 4 Traditionswähler 38, 39 Transparenz 107 Türkei 6, 14, 23, 61 Überalterung der Gesellschaft 27 Überhangmandate 76 Überkreuzbeschäftigungen 87 Underdog-Effekt 195 Untätigkeitskartell 26 Unterrepräsentanz durch Wahlenthaltung/verweigerung 50 Untersuchungsausschuss 34 Unvereinbarkeit von Erwerbsberuf und Mandat 81 Verbände 160 Verbände, Gefahr durch konkurrenzlos agierende 109 Verbändegesetz 107 Verbändestaat 107 Verbandsvertreter 83 Verbandsvertreter, Absicherung der 160 Verfassungsänderung 9 Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 22 Vertrauen 26 Vertrauensabstimmung 5 Vertrauensfrage 7, 9 Vertrauensfrage, unechte 7 Vizekanzler 36 Volksentscheide 6 Volkshaus 5 Vorauswahl der Kandidaten 35 Wahl 5 Wahl vor der Wahl 146 Wahl, vorgezogene 5 Wahlabstinenz 7 Wahlalter, Herabsetzung des 184 Wahlausgang 197 Wahlaussagen, Wahrheitsgehalt von 18 Wahlberechtigte 16, 176 Wahlbetrug 198 Wahlen 112 Wahlen als Rache des Bürgers 37 Wahlenrechtsgrundsätze 13 Wahlenthaltung 15, 48 Wähler 176 Wahlergebnis, Auszählung 197 Wählerverzeichnisse 176 Wahlkampf 5, 60 Wahlkampfaussagen zur Zukunfstgestaltung 33 Wahlkämpfe 16 Wahlkampf-Feinabstimmung 196 Wahlkampfkosten 51 Wahlkampfkostenpauschale 54 204 Wahlkampfthemen 60, 64 Wahlkreise 35 Wahlkreise, Berliner 166 Wahlkreise, Neuzuschnitt der 74 Wahlkreiseinteilung 171 Wahlkreiskandidatenaufstellung 147 Wahl-O-Mat 49 Wahlperiode 5 Wahlperiode, Verlängerung 5 Wahlpflicht 48 Wahlprognosen 194 Wahlrecht 112 Wahlrecht von Geburt an 190 Wahlslogans 70 Wahlsoziologie 177 Wahlstatistik, repräsentative 177 Wahlsystem 112 Wahltag 37 Wahlumfragen 192, 196 Wahlverweigerung 44, 48 Wahlwerbung, einfallslose und sinnentleerte 42 Wahrhaftigkeit von Wahlaussagen 35 Wandel, demographischer 27 WASG 114, 141, 169, 170, 173 Wechselwähler 39, 40, 42 Wechselwähler, 42 Weimarer Verfassung 5 Werbeagenturen 180 Zukunftsgestaltung 33 Zusatzeinnahmen 95 Zuwanderung 28, 38, 63 Zweitstimmenanteil bei den bisherigen Bundestagswahlen 73