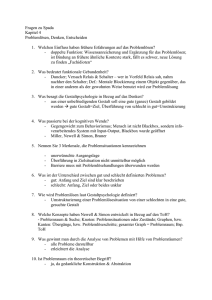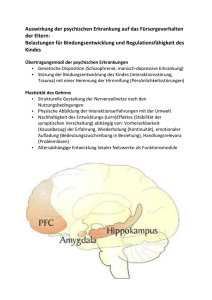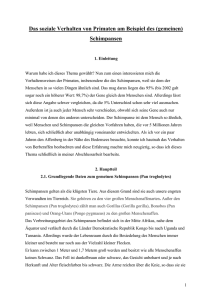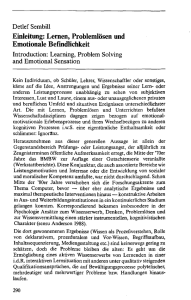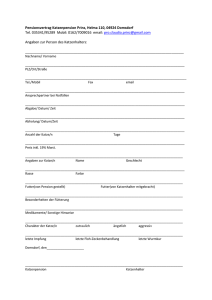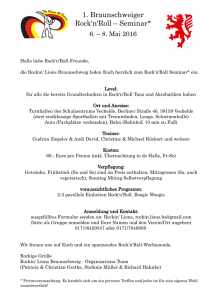landolt - Seelensammler.de
Werbung
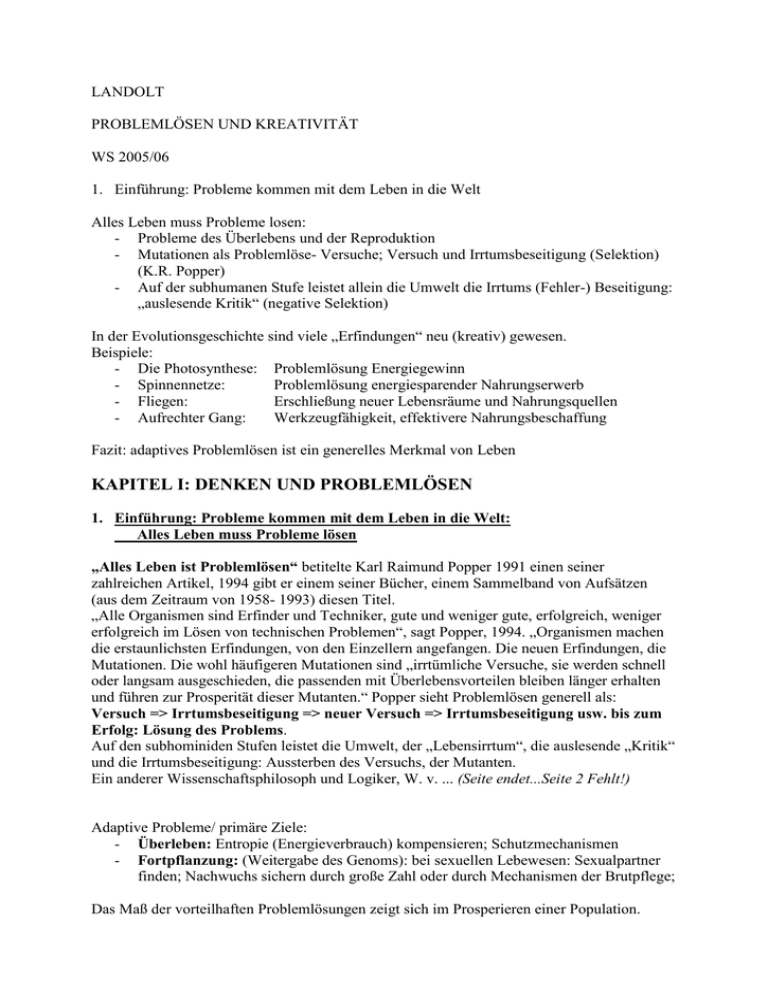
LANDOLT PROBLEMLÖSEN UND KREATIVITÄT WS 2005/06 1. Einführung: Probleme kommen mit dem Leben in die Welt Alles Leben muss Probleme losen: - Probleme des Überlebens und der Reproduktion - Mutationen als Problemlöse- Versuche; Versuch und Irrtumsbeseitigung (Selektion) (K.R. Popper) - Auf der subhumanen Stufe leistet allein die Umwelt die Irrtums (Fehler-) Beseitigung: „auslesende Kritik“ (negative Selektion) In der Evolutionsgeschichte sind viele „Erfindungen“ neu (kreativ) gewesen. Beispiele: - Die Photosynthese: Problemlösung Energiegewinn - Spinnennetze: Problemlösung energiesparender Nahrungserwerb - Fliegen: Erschließung neuer Lebensräume und Nahrungsquellen - Aufrechter Gang: Werkzeugfähigkeit, effektivere Nahrungsbeschaffung Fazit: adaptives Problemlösen ist ein generelles Merkmal von Leben KAPITEL I: DENKEN UND PROBLEMLÖSEN 1. Einführung: Probleme kommen mit dem Leben in die Welt: Alles Leben muss Probleme lösen „Alles Leben ist Problemlösen“ betitelte Karl Raimund Popper 1991 einen seiner zahlreichen Artikel, 1994 gibt er einem seiner Bücher, einem Sammelband von Aufsätzen (aus dem Zeitraum von 1958- 1993) diesen Titel. „Alle Organismen sind Erfinder und Techniker, gute und weniger gute, erfolgreich, weniger erfolgreich im Lösen von technischen Problemen“, sagt Popper, 1994. „Organismen machen die erstaunlichsten Erfindungen, von den Einzellern angefangen. Die neuen Erfindungen, die Mutationen. Die wohl häufigeren Mutationen sind „irrtümliche Versuche, sie werden schnell oder langsam ausgeschieden, die passenden mit Überlebensvorteilen bleiben länger erhalten und führen zur Prosperität dieser Mutanten.“ Popper sieht Problemlösen generell als: Versuch => Irrtumsbeseitigung => neuer Versuch => Irrtumsbeseitigung usw. bis zum Erfolg: Lösung des Problems. Auf den subhominiden Stufen leistet die Umwelt, der „Lebensirrtum“, die auslesende „Kritik“ und die Irrtumsbeseitigung: Aussterben des Versuchs, der Mutanten. Ein anderer Wissenschaftsphilosoph und Logiker, W. v. ... (Seite endet...Seite 2 Fehlt!) Adaptive Probleme/ primäre Ziele: - Überleben: Entropie (Energieverbrauch) kompensieren; Schutzmechanismen - Fortpflanzung: (Weitergabe des Genoms): bei sexuellen Lebewesen: Sexualpartner finden; Nachwuchs sichern durch große Zahl oder durch Mechanismen der Brutpflege; Das Maß der vorteilhaften Problemlösungen zeigt sich im Prosperieren einer Population. Mutationen sind keine beabsichtigten Problemlösungen, sie bilden die Voraussetzungen für gezieltes Problemlösen bei den Organismen Beispiel: Mutationen, die zur Vergrößerung des Gehirns führen Symbolische Repräsentation als effektives Mittel zum Problemlösen beginnt vermutlich schon in der subhumanen Stufe Beispiel: Schimpansen als Problemlöser internes Repräsentieren von Zuständen und Strategien. ... Gang, die Befreiung der Hände bei den ersten Australopithecinen => Erschließung neuer Lebensräume, effektivere Nahrungsbeschaffung mit Händen, die zum Werkzeuggebrauch fähig sind (schon bei Schimpansen und Bonobos) schließlich die Befähigung, Werkzeuge mit Werkzeugen herzustellen (Meta- Werkzeuge): Neandertaler und vor allem der Homo sapiens des Neolithicums. Metawerkzeuge können Schimpansen und Bonobos noch nicht herstellen; bei Homo ergaster (Vorfahre des homo erectus) und bei homo erectus ist dies strittig, Popper, die „evolutionären Erkenntnistheoretiker“ und neuerdings die „Evolutionspsychologie“ setzen produktives, adaptives Problemlösen nicht erst beim Menschen an. Schon mit den ersten Lebewesen kamen Probleme in die Welt (vor dem Leben gab es keine Probleme!). Probleme kommen mit Zielen („Soll- Zustände“) in die Welt. Die primären Ziele für Lebewesen sind Überleben und Reproduktion, dafür ist Energiebeschaffung notwendig. Probleme für Lebewesen gibt es daher längst vor dem Auftauchen von Bewusstsein und bewusst kontrollierten Strategien. Schon die ersten Lebewesen mussten die Entropie (Energieverbrauch) kompensieren durch (aktive) Zufuhr von Energie aus der Umwelt; sie mussten aber auch Mechanismen erfinden, um sich vor zerstörenden Energien aus der Umwelt zu schützen, damit sie ihre funktionalen Strukturen, wenigstens bis zur Reproduktion, aufrechterhalten können. So gesehen hat Popper mit seiner lapidaren These „Alles Leben ist Problemlösen“ Recht. Jede neue Mutation erzeugt neue strukturelle und funktionale Bedingungen für das Verhalten des Organismus. Ein bestimmter Promille-Satz dieser Mutationen ist erfolgreich, d.h. sie führen zu tatsächlich neuen (kreativen) Problemlösungen, die Vorteile für die Träger solcher Mutationen bringen. Das Maß der Vorteile zeigt sich indirekt am Prosperieren der Population: Individuen mit vorteilhaften Eigenschaften fürs Überleben haben statistisch mehr Nachkommen (für die letzten hundert Jahre gilt dies beim Menschen in wirtschaftlichen hoch entwickelten Ländern nicht mehr), für die meisten Lebewesen gilt diese Regel: Die Mutationen selbst sind natürlich keine gezielten Problemlösungen, sie passieren unbeabsichtigt in bestimmten Raten. Sie bilden die geeigneten oder ungeeigneten Ausstattungen, die „Mitgift“ zum Problemlösen. Diese Begabungen, zufällig entstanden, bilden die Voraussetzungen für gezieltes, bei höheren Wirbeltieren (bewusst) intendiertes Problemlösen. Beispiel: die Mutationen, die bei den Homo- Typen zur Vergrößerung des Gehirns im Laufe von 2 ½ Mio. Jahren geführt haben, waren nicht beabsichtigt, aber sie führten dazu, dass schließlich eine Gruppe, der homo sapiens (sapiens), mit diesem Hirn eine komplexe, syntaktisch rekursive und semantisch referentielle Sprache erfinden konnte, und die Gehirne dazu fähig waren, diese Sprache(n) zu erwerben. Die Sprache brachte ein enormes Maß an Vorteilen zum Problemlösen: sozialer und technischer Art, sodass dieser Typus Mensch alle anderen Konkurrenten, die diese Fähigkeit nicht in dem Ausmaß besaßen, verdrängen konnte. Mit dem Auftreten von symbolischen (mentalen) Repräsentationen von Zuständen kamen neue Mittel des Problemlösens in die Welt: Nicht nur die sinnlich präsenten Ist-Zustände einer Situation, sondern auch nicht-sinnlich gegebene Soll- oder Ziel-Zustände können modellartig vorgestellt werden. Wir wissen nicht viel darüber, wann und bei welchen Wesen diese Repräsentationsfähigkeiten und die bewusste Manipulation von symbolischen Inhalten erstmals auftraten. Wolfgang Köhlers Schimpanse „Sultan“ scheint gewisse Repräsentations-Fähigkeiten, die erheblich über die sinnlich-präsente Situation hinausgehen, gehabt zu haben, und er war fähig, die sinnlich gegebene „Ordnung“ der Kisten und Stöcke so umzubauen („umzustrukturieren“), dass sie für die Zielerreichung brauchbar wurden. Die neue Anordnung der Dinge (Kisten, Stöcke) war ihm nicht sinnlich präsent, er musste sich diese „vorstellen“, das tat Sultan vermutlich in der Zeit zwischen dem Scheitern des ersten Versuchs, die Banane zu erreichen, und dem Zeitpunkt des neuen Versuchs, bei dem er Kisten aufeinander zu stapeln und Stöcke ineinander zu stecken begann. Wolfgang Köhler beschreibt die Phase zwischen Scheitern (zuerst Wut, allmähliche Beruhigung, scheinbar untätiges Sitzen) und dann plötzlich Aufspringen, Kisten aufeinander stapeln. Diese Phase nannten die Gestaltpsychologen „Inkubation“. In dieser Phase laufen kognitive „Umstrukturierungsprozesse“: Vielleicht hat Sultan nachgedacht, vorgestellt, wie die herumliegenden Kisten (Wahrnehmungsfeld) so kombiniert werden können, dass er sie gleichsam als Leiter (zur Banane) benutzen kann: interne (kognitive) Neuordnung des IstZustandes, dann geht Sultan zur Tat und probiert seine Idee, die Neuordnung, aus. 2. Charakteristika von Problemen und Problem- Typen Einige Beispiele: P1: Sie haben ein Wespen- Nest im Dachboden. Wie entfernen sie dieses ohne Gift? Sie haben keinen Schutzanzug P2: Sie möchten eine Blumenbank an ihrer Gartenmauer konstruieren. Die Mauer besteht aus so genannten Fenstersteinen. Sie besitzen nur ein Brett, Dachlatten, einen Meterstab, eine Säge, keine Nägel oder Schrauben! Sie möchten die Bank nicht auf dem Boden, nicht auf der Mauer sondern an der Mauer haben. P3: Das Quadrat- Problem (aus Platons Dialog Menon): Konstruieren sie aus einem gegebenen Quadrat eines das (beweisbar!) genau den doppelten Flächeninhalt hat. P4: Bilden sie ein Wort aus RLPMEBO. (Es gibt bei sieben nicht redundanten Elementen 5040 Möglichkeiten) P5: Sie sind in Sibirien: Sie müssen eine feste Blockhütte auf Perma-Frostboden bauen, so dass Türe und Fenster nicht aus dem Lot geraten, wenn die Jahreszeiten wechseln. Diese Beispiele zeigen folgende Merkmale: 1) Alle zeigen einen Ist-Zustand (Sachlage, Ausgangslage) 2) Alle beinhalten ein Ziel (Ziel-Zustand) 3) Alle Beispiele, sofern sie Ihnen neu sind, machen ihnen Schwierigkeiten: Sie können nicht auf Anhieb das Ziel erreichen. Sie sind „problemata“ (griech.: das vor (die Füße) geworfene), sie sind nicht einfach Routine-Aufgaben. Für Probleme ist typisch, dass sie Barrieren zwischen Ist- und Ziel- Zustand enthalten. Die Lösung ist nur durch die Beseitigung der Barrieren möglich. Die Beseitigung der Barrieren noch nicht bekannt 4) Alle Beispiele zeigen mehr oder weniger klar bestimmte Ist- und/oder ZielZustände. Ist- und/oder die Ziel-Zustände sind entweder vage oder klar definiert. Die Vagheit ist eine zusätzliche Barriere auf dem Weg zur Ziel-Erreichung. – Bei P1 sind Ist- und Ziel- Zustände ziemlich klar definiert; Bei P2 ist der Ist- oder Ausgangszustand klar, das gilt auch für P3. Die Ziel- Zustände dagegen sind nicht ausreichend klar. Wir wissen in P2 nur, es soll eine Blumenbank an der Mauer sein, aber nicht, wie sie angebracht ist und wie die Träger der Bank aussehen. In P3: Quadrat- Problem wissen wir nur, das neue Quadrat soll genau die doppelte Fläche haben, aber wir wissen nicht, wie groß dafür die Seiten sein müssen. In P4 ist der Ausgangs-Zustand klar, aber der Zielzustand ist extrem unterbestimmt. Wir wissen bei diesem Anagramm- Problem nur, dass ein sinnvolles Wort gefunden werden soll, nicht aber wissen wir, welches das sein wird. Gemessen an den 5040 möglichen Permutationen ist der Zielzustand sehr vage. Wir wissen nicht, welche Buchstaben- Anordnung das sinnvolle Wort ergibt. Dennoch lösen die meisten dieses Anagramm relativ schnell. P5: Ziel-Zustand wohl definiert. Der Ist-Zustand ist ohne Kenntnisse der Physik von Permafrostböden nicht bekannt. Die richtige Diagnose des Ist- Zustandes ist selbst ein TeilProblem des ganzen Problems. Bei Diagnose- Problemen kennen wir nicht alle relevanten Variablen des Ist-Zustandes (Intransparenz des Ist-Zustandes) Beispiel: Fieber 40° (Oberflächen Ist-Zustand) Problem: was sind die möglichen Ursachen des Fiebers, was ist der „Tiefen“-Ist-Zustand? Welche von vielen möglichen Variablen löst 40° Fieber aus? Viren oder Bakterien? P6: Sie sind Bürgermeister einer Kleinstadt. Sie sollen 12 Jahre lang die Stadt managen. Ihr oberstes Ziel soll sein, stets das Wohlergehen der Stadt zu realisieren. In diesem Problem sind Ihnen die Ist- und Soll-Zustände extrem vage definiert: Was sind die Kriterien für das Wohlergehen möglichst aller Bürger? Welche Variablen müssen erfüllt werden, damit es den Bürgern gut geht? Diese zu findenden Variablen sind selbst eine Vielzahl von Zielen. Sie sind Teile des obersten Gesamtziels. Dieses Problem (Dietrich Dörnes „LohausenProblem“) ist polytelisch: d.h. es enthält viele Ziel-Teile. Ein Teil dieses Problems ist die vielen Teile des Ziels zu definieren. Zusätzlich stellt sich die Schwierigkeit: diie verschiedenen Zielteile können im Laufe von 12 Jahren verschiedene Dringlichkeit (Prioritäten) gewinnen: Welche Teil-Ziele müssen zuerst realisiert werden? Wie hängen die Teil-Ziele untereinander zusammen? Z.B. Das Ziel Vollbeschäftigung zum Ziel, die Steuereinnahmen zu erhöhen zum Ziel, die Infrastruktur der Wirtschaft der Stadt zu verbessern? In diesem Bürgermeister- Problem ändern sich in der Zeit die Ist-Zustände laufend: Die richtige Diagnose der Zustandsänderung stellt ein eigenes Problem. Das unterscheidet das Bürgermeister-Problem von so genannten statischen Problemen, deren Ist- und Soll-Zustände sich nicht ändern. P1-P5 sind statische Probleme. Das Bürgermeister(Lohausen-) Problem ist dagegen ein dynamisches Problem, dessen Variablen in der Zeit sich ändern, sowohl in der Anzahl als auch in der Art. Auch die Beziehungen der Variablen zueinander können sich ändern. Wirtschafts- und Politikprobleme sind typisch dynamische Probleme, deren Variablen im Detail häufig intransparent sind, d.h. der Problemlöser kennt nicht von vorherein alle relevanten Variablen und ihre Beziehungen untereinander. Dynamische Probleme haben meist auch eine sehr hohe Anzahl von Variablen und eine noch höhere Anzahl von Beziehungen der Variablen zueinander (hoher Vernetzungsgrad). - Gesamtziel-Teile müssen oft gleichzeitig verfolgt werden andere Teil-Ziele müssen zeitlich in der richtigen Folge angeordnet werden (Prioritäten-Setzen) - Dynamische Probleme zeitigen häufig Folge-Probleme. Eine bestimmte Lösung generiert neue Probleme. Z.B. Industrieansiedlung schafft Umwelt- und Lebensqualitätsprobleme (Verschmutzung, Lärm, etc.). - Dynamische Probleme zeitigen auch ein hohes Maß an Informationsbeschaffungsproblemen über die relevanten Variablen- oft ist dafür wissenschaftliche Forschung notwendig oder wissenschaftlich- methodische Analyse, z.B. Luft- oder Grundwasserverschmutzung diagnostizieren Fazit zu „dynamische Probleme“ 1) Ist- und Ziel- Zustände fast immer nur vage, unklar 2) Die Ist- und Ziel-Zustände ändern sich in der Zeit 3) Die Variablenzahl und ihre Beziehungen ändern sich 4) Dynamische Probleme sind fast immer polytelisch 5) 6) 7) 8) 9) Die Prioritäten der Gesamtziel-Teile ändern sich Sie weisen meist eine hohe bis sehr hohe Variablenzahl auf Die Variablen sind intransparent Verschiedene Ziel-Teile müssen häufig gleichzeitig verfolgt werden Dynamische Probleme zeitigen Folge-Probleme, bei Nichtrealisierung wichtiger Teilziele treten meist eine größere Anzahl von Folgeproblemen auf, z.B. Wenn nicht Industrie angesiedelt wird, dann steigt die Arbeitslosenzahl, dann sinken die Steuereinnahmen, es sinkt die Kaufkraft, Teile der Bevölkerung wandern ab, etc. 10) Dynamische Probleme beinhalten meist ein hohes Maß an InformationsBeschaffungs-Problemen (wegen der Intransparenz der Variablen) 3. Die Klassifikation von Problemen 1) Klassifikation nach den Merkmalen der Ist- und der Ziel-Zustände A) geschlossene Probleme (well-structured problems): Die Ist- und die Ziel-Zustände sind gut bekannt jedoch die Operationen (Strategien) und/oder die Mittel sind unbekannt: Wir wissen nicht, wie die „Barriere“ zu überwinden ist, Beispiel P1 B) offene Probleme (ill-defined problems): Entweder ist der Ist-Zustand oder der SollZustand nicht bekannt, oder beides ist unzureichend bekannt (Beispiele P2-P6). Die Operationen und Mittel sind auch nicht bekannt. Zu den offenen Problemen gehören auch die dynamischen Probleme. C) Einteilung nach Statik/ Dynamik der Zustände. Statische Probleme: Ist- und SollZustände bleiben in der Zeit konstant (Beispiele P1-P5). Dynamische Probleme: Probleme, deren Ist- und/oder Ziel-Zustand in der Zeit sich ändert. 2) Klassifikation nach den Merkmalen der Barrieren Als „Barrieren bezeichnete Dietrich Dörner (Problemlösen als Informationsverarbeitung, 1979) die Schwierigkeiten auf dem Weg vom Ist-Zustand zum Ziel-Zustand. Wir können auf diesem Weg nicht auf ein fertiges know-how zurückgreifen. Wir müssen dieses erst erwerben oder aus bisherigem Wissen zusammen setzen (kombinieren), wobei wir diese Kombination erst selber schaffen müssen, oder wir müssen uns diese von jemandem anderen beschaffen (Infosuche und Info-Kombination). Allgemein: die Barriere besteht darin: Wir haben zum Zeitpunkt des Ist-Zustandes eines Problems kein sofort verfügbares (algorithmisches oder heuristisches) Transformations- oder Umstrukturierungs-Wissen. Barrieren sind das kennzeichnende Merkmal für Probleme!! Fehlt die Barriere, dann haben sie kein Problem, sie haben eine Aufgabe vor sich, die sie vom Ist-Zustand in den Ziel-Zustand mit bereits verfügbarem Transformations-Wissen umbauen können. Wenn sie das Wespen-Nest-Problem oder das Quadrat-Problem bereits einmal gelöst haben, dann sind diese Beispiele in Zukunft keine Probleme mehr sondern Aufgaben, wenn sie damit konfrontiert werden. Barrieren können auftreten, wenn: 1) der Ist-Zustand nicht ausreichend bekannt ist und/oder: 2) der Ziel-Zustand nicht klar definiert (repräsentiert) ist, also bei offenen (statischen oder dynamischen) Problemen. 3) zwischen Ist- und Ziel-Zustand: Dies kann der Fall sein bei geschlossenen und bei offenen Problemen. Ich sage „kann der Fall sein“, denn es gibt Probleme, die Barrieren entweder nur in der Diagnose des Ist-Zustandes haben oder Barrieren beim Definieren des Ziel-Zustandes, oder Barrieren in den Ist-Zuständen und in den Ziel-Zuständen haben, aber keine Barrieren dazwischen. Beispiel: Wenn wir das Problem der Diagnose gelöst haben (=der Ist-Zustand definiert worden ist) und wir ein definiertes Therapieziel haben und wir therapeutisches Wissen sofort einsetzen können, dann haben wir keine Zwischen-Barriere mehr. Die Therapie ist dann nur noch eine Aufgabe. Man kann die Punkte 1)- 3) als Locus der Barriere (=Ort der Barriere) bezeichnen. 4) Barrieren bei der Ist-Zustands-Diagnose und zwischen Ist- und Ziel-Zustand 5) Zwischen Ist- und Ziel-Zustand und bei der Abklärung des Ziel-Zustandes 6) In allen drei Bereichen; häufig der Fall bei dynamischen Problemen, wo laufend die Ist-Zustände neu exploriert, die Ziel-Zustände neu definiert und die Strategien für die Transformation erfunden werden müssen. 3) Klassifikation nach dem Barrieretyp (D. Dörner, 1979) Dörner unterscheidet 3 Barrieretypen - Interpolations-Barrieren - Synthese-Barrieren - Dialektische Barrieren Interpolations-Barrieren: Ist- und Sollzustand sind bekannt, die Transformationsoperatoren ebenfalls; unbekannt ist die Kombination der Operatoren, ihre Sequenzierung ist nicht bekannt; Beispiel dafür ist das Turm von Hanoi Problem. Die Anordnung der Züge ist nicht bekannt. Auch Schimpanse Sultans Bananen Problem hat typische Interpolationsbarrieren: Unbekannt ist ihm zunächst, wie er Kisten und Stöcke koordinieren soll. Weitere Beispiele sind die sogenannten Streichholzprobleme; Das Neun-Punkte-Problem (Duncker, 1940) Synthese-Barrieren: Die benötigten Operatoren sind uns unbekannt (zwischen Ist- und Zielzustand). Beispiel: Zahlenreihe fortsetzen: 2, 4, 7, 3, 8, 14, 7,.... Wir müssen für diese Aufgabe die Operatoren erst suchen: Differenzen bestimmen, Vorzeichen- Wechsel, Induktion P1, P3 Dialektische Barrieren: Typisch für offene (dynamische) Probleme, wo sich der Ist-Zustand (auch ohne Eingreifen) ständig ändert, und die Zielzustände schrittweise definiert werden müssen oder im Zeitverlauf geändert werden müssen (Prioritäten!). Spezifisch für dialektische Barrieren ist demnach, dass die Suche und die Kombination der Transformationsoperatoren sowohl von den Diagnosen des laufend sich ändernden Ist-Zustandes, als auch von den Redefinitionen der Zielzustände abhängt. Weiteres Spezifikum: die vorläufigen Lösungen erzeugen neue Folgeprobleme, d.h. die Barrieren vermehren sich, der Einsatz der gefundenen und kombinierten Operatoren erzeugt Folgeprobleme (unerwünschte Nebenwirkungen). Beispiel: Schädlingsbekämpfung durch Pestizide => Vergiftung von Grundwasser. Tanaland-Problem (Dörner): Tanaland, ein Gebiet in Ostafrika. Durch den Einsatz von Operatoren (Bewässerung, Düngemittel, verbesserte medizinische Versorgung) stieg die Bevölkerungszahl, späteres Folgeproblem: Durch die Übervölkerung eine Hungerkatastrophe: Die Steigerung der Nahrungsproduktion kann mit der Steigerung der Population nicht mithalten. Dialektische Barrieren bestehen also darin dass: 1) die Operatorsuche und Kombination sich laufend ändert (die sie von den sich ändernden Ist-Zuständen und den neuen Redefinitionen der Zielzustände abhängen) 2) Der Einsatz bestimmter Operatoren erzeugt Folgeprobleme 4) Problem- Umfang und Problem- Raum 1) Problem- Umfang: umfasst die Anzahl der möglichen Lösungsalternativen und die Problemkomplexität (Anzahl der beteiligten Variablen und die Anzahl der Variablen- Beziehungen). Der Problemumfang bestimmt den Informationsgehalt eines Problems. Der Infogehalt entscheidet über die Bearbeitungszeit: Je größer der Infogehalt desto längere Bearbeitungszeit: die Bearbeitungszeit steigt linear mit dem Infogehalt (Hick-Hyman-Gesetz 1952/53) 2) Problem Raum: wird in der Literatur verschieden bestimmt. Nach Robert Sternberg (Cognitive Psychology, 1996) enthält der Problemraum alle möglichen Strategien, die vom Ist- zum Zielzustand führen können: Anzahl der Algorithmen und/oder die Anzahl der Heuristiken. Heuristiken sind Transform- Strategien, die nicht immer (sicher) zum Ziel führen; Algorithmen sind sichere Strategien. Nach Friedhart Klix (1971): Information und Verhalten ist der Such- oder Problemraum die subjektive Repräsentation der verschiedenen Transformationsstrategien und der Ist- und Zielzustände. Die objektive Anzahl der Transformations- Möglichkeiten ist uns bei hoch komplexen Problemen gewöhnlich nicht bekannt: Das vollständige Absuchen der Anzahl (mögliche Strategien) ist uns nicht möglich. Beispiel ist Schach: zwar endlich viele Konstellations-Möglichkeiten folglich ist die Menge der Züge und Gegenzüge (Transformationsstrategien) auch endlich groß. Aber die Menge der möglichen Transformationen ist so riesig hoch, dass bisher noch kein Computer alle „sichten“ konnte. Wir sind also gezwungen, den Suchraum (=Problemraum) einzuengen und subjektiv zu repräsentieren. Wir müssen Heurismen (=Findeverfahren) entwickeln (die scheitern können!), und wir müssen den (subjektiven) Prblemraum sukzessive ausdehnen, wenn wir mit den bisherigen Heurismen scheitern. Beispiele, die das illustrieren, sind die Anagramm- Probleme. Wir suchen nicht alle (objektiv) möglichen Permutationen ab (sie können, je nach Elementenzahl in die Tausende, Zehntausende... gehen, Beispiel: ÄNGTRUSK: 40320 Möglichkeiten! Wir haben statt dessen eine Anzahl von Probier-Heurismen, die wir nach einander setzen bis wir STÄRKUNG finden. Solche Heurismen engen Sternbergs objektiven Problemraum zum subjektiven Problemraum (Klix) ein, sodass wir den objektiven Problemraum nicht vollständig durchsuchen müssen. Ein Einengungsverfahren ist das sogenannte hill-climbing: Wir ziehen nur solche Transformaktionen in Betracht, die einen Fortschritt in Richtung Ziel versprechen, d.h. solche, die den Unterschied zwischen Ist- und Zielzustand reduzieren. Dieses Verfahren hat manchmal Tücken: Wir können auf den Nebengipfel statt auf den Hauptgipfel geraten (Umwege). Ein weiteres Verfahren ist die Zerlegung des Problems in Subziele (Zwischenziele) mit Vor- und Rückwärts-Planen (z.B. im Schachspiel). Vgl. zu Problemraum: D. Dörner: 1998: Die Logik des Misslingens... Hamburg, Kap.7. Problemraum wird also einerseits im objektiven, andererseits im subjektiven Sinn verstanden. Zur „objektiven Konzeption“ zählen Allen Newell und Herbert Simon (1972), auf sie geht der Term Problemraum zurück. Problemraum (objektiv): die Gesamtheit aller Zustände, die sich aus der Anwendung aller denkbaren Operatoren auf jeden möglichen Zustand ergeben. John R. Anderson (1989: Cognitive Psychology): Problemraum definiert als alle Zustände, die ein Problem einnehmen kann. Ist-Zustände, intermediäre (=zwischen-) Zustände und Zielzustände. Der Problemraum besteht in der Menge der Zustände und der Transformationsoperatoren. Ähnlich Günther Knoblich (in Müsseler, Prinz: 2002): „der Problemraum ist die Gesamtheit aller möglichen Zustände, die ein Problem einnehmen kann.“ Das subjektive Konzept von Problemraum (F. Klix): umfass demnach eine Teilmenge der Zustände des objektiven Problemraums. Diese Teilmenge wird vom Subjekt kognitiv (unbewusst/ bewusst) repräsentiert. 5. Die Problemschwierigkeit für Personen Die Problemschwierigkeit setzt sich zusammen aus: - Problemumfang und Problemkomplexität - aus den kognitiven Zuständen der Person (=Personenmerkmale) PROBLEMSCHWIERIGKEIT Problemmerkmale Problemumfang: Anzahl der möglichen Lösungsalternativen ProblemKomplexität: Anzahl der Variablen Vernetzung der Variablen (Relationen) Transparenz Personenmerkmale Faktenwissen: Umfang Struktur (=Organisation) Verfügbarkeit Operationswissen Umfang Struktur Verfügbarkeit (Diagramm nach Walter Hussy 1984: Denkpsychologie B1, S. 124) Die Problemschwierigkeit ist inter- und intrapersonal variabel: Für Person X ist ein Problem P leicht zu lösen, für Person Y ist das selbe Problem schwer. Für ein und dieselbe Person kann ein Problem zu verschiedenen Zeitpunkten schwer oder leicht sein: zunächst „unlösbar“ (auf der Leitung stehen), später erscheint ihr das Problem einfach („warum bin ich nicht schon gestern darauf gekommen?“). Zu Problemmerkmale: Problemumfang befasst (Nach Walter Hussy) die Anzahl der möglichen Lösungsalternativen (nach anderen Autoren umfasst der Problemumfang auch die Komplexität!). Der Problemumfang (als Anzahl der Lösungsalternativen) beeinflusst die Entscheidungszeit. Anagramme sind ersichtliche Beispiele für das Anwachsen der Alternativenzahl bei Zunahme der Buchstabenzahl. Tatsächlich steigt zwischen 3 bis 6 Buchstaben die Entscheidungszeit steil an, bei Anagrammen mit höheren Anzahlen wird die Entscheidungszeitkurve aber flacher. Das bedeutet: Personenspezifische Faktoren spielen eine Rolle. Heuristische Strategien reduzieren (subjektiv) die Zahl der Alternativen. Sie treten an Stelle der algorithmischen (das Durchexerzieren aller möglichen Buchstabenkombinationen), der sicheren Strategie. Die (subjektive) Reduktion der Lösungsalternativen bedeutet auch, dass das Arbeitsgedächtnis nicht überlastet wird. Nach der algorithmischen Strategie müssen sie sich bei RBEA jede durchgespielte Kombination im Arbeitsgedächtnis behalten! Statt der systematischen (algorithmischen) Strategie gehen wir über zu ProbierHypothesen (Heurismen) Hypothesen, die durch das bisher, durch Erfahrung, gewonnene Prozedurwissen geleitet sind. Wir testen sukzessiv einige Hypothesen durch. Wir wechseln von der Interpolationsbarriere (Kombinationen durchspielen) auf Synthesebarriere: Hypothesen durchprobieren, was (meist) zur Zeitersparnis führt. Problemkomplexität: Eine ganze Reihe aus der Anzahl der Variablen und VariablenBeziehungen müssen gleichzeitig berücksichtigt werden, damit wir zur Lösung gelangen. Beispiel: Das Mondlandungs-Problem nach J. Funke (1981). Die Aufgabe der Vpn besteht darin, ein Raumschiff, das sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit der Mondoberfläche nähert, mittels Bremsdüsen weich zu landen. Die Bremsdüsen können auf verschiedene Stärken geschaltet werden. Dabei müssen folgende Variablen beachtet werden: a) die Geschwindigkeit des Raumschiffs b) seine Höhe über der Mondoberfläche c) die verschiedenen Bremsstufen d) begrenzter Treibstoff, der durch verschiedene Bremsstufen unterschiedlich stark ausgeschöpft wird, und/oder e) begrenzter Sauerstoffvorrat Die Problemkomplexität (PK) ist demnach eine Funktion der Variablenzahl (VZ): PK = f(VZ) Aber auch Art und Anzahl der Beziehungen zwischen den Variablen spielen eine wesentliche Rolle (Vernetzung) Beispiel: Vernetzung für die Variablen Geschwindigkeitsreduktion (GR), Bremsstufen (BS), Treibstoffreduktion (TR) BS 1 2 3 GR (m/sec) 100 200 300 TR (liter/sec) 10 20 30 Komplexität (K) = f(VZ, VN (=Variablenvernetzung)) Die Transparenz (Dörner, 1979): Darunter versteht man die Durchschaubarkeit der Variablenzahl und ihrer Vernetzungen. Die Transparenz kann unterschiedliche Grade einnehmen: Volle Transparenz: alle relevanten Variablen und ihre Beziehungen sind bekannt; Teilweise transparent bis (Grenzfall) vollständig intransparent: Teilweise bis vollständige Intransparenz erhöht die Problemschwierigkeit: es muss Info über die Variablen und ihre Vernetzung beschafft werden. Mit Variablenzahl, Vernetzung, Transparenz sind die Komponenten für die Problemkomplexität vollständig: PK = f(VZ, VN, TR (=Transparenz)) Dass diese 3 Komponenten eine Rolle spielen, zeigt sich daran, dass die Problemlösegüte sinkt, wenn: a) die Variablenzahl steigt, und b) die Vernetzung der Variablen nicht-linear steigt, und c) die Intransparenz des Problems steigt Die Komponentenanteile (=Determinanten) der Problemkomplexität summieren sich hinsichtlich der Problemlösegüte (Hussy, 1984) Personenmerkmale: Die Problemschwierigkeit ist auch von den Wissenszuständen und der Organisation des Wissens und dessen Verfügbarkeit abhängig. Das Fakten- und das Operations-(Strategie)Wissen ist aber nicht in jedem Fall die Größe, die die Problemschwirigkeit senkt. Wissen kann auch „im Wege stehen“. Fixierung auf „Dogmen“ hindert uns, unser „Wissen“ auf Problemlöserelevanz in Frage zu stellen. Vorannahmen können uns daran hindern, alternative Überlegungen anzustellen. Beispiele: Das Wissen, dass die Sonne im Osten auf- und im Westen untergeht, hat uns zur Annahme verleitet, die Sonne kreise um die Erde (und die „Autorität“ der Bibel betonierte diesen Glauben), so dass uns dieses Dogma fast 2000 Jahre hinderte, die alternativen Hypothesen zu schaffen (Kopernikus), bzw. sich auf die heliozentrische Annahme des Aristarchos v. Samos (320-250 v. Chr.) wieder zu besinnen (Aristarch inspirierte Kopernikus!). Die geozentrische Hypothese behinderte die astronomischen Problelösungen zunehmend bei wachsender Kenntnis der Daten. 1. Wissensumfang und Organisation Fakten- und Operationswissen kann ambivalent sein: kann die Problemschwierigkeit reduzieren (zur Lösung beitragen) oder es kann die Problemschwierigkeit erhöhen (die Lösung behindern). Wissen und Erfahrung können somit die Problemschwierigkeit ändern, dadurch, dass sie: a) Fakten-/ Operationswissen zur Verfügung stellen b) Zu konkreten internen Repräsentationen (Elaboration) des Problems beitragen c) Die Auswahl und Anwendung von Operationen mitbedingen Die Richtung der Änderung (Lösung/ Scheitern) hängt davon ab, wie weit dieses Wissen Problemmerkmalen entspricht oder nicht. Beispiel: ein „Rätsel“ aus Goethes Faust Mephisto zum Schüler (bezüglich Theologie): „Denn eben wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein. Mit Worten lässt sich trefflich streiten, Mit Worten ein System bereiten, an Worte lässt sich trefflich glauben, Von einem Wort lässt sich kein Jota rauben. Ein semantisches Problem für Faust-LeserInnen, dessen Schwierigkeitsgrad von unseren Wissenszuständen abhängt: Wissenszustand 1: kein passendes Wissen, die Barriere zu beseitigen, suche guten FaustKommentar, oder einen theologisch gebildeten Germanisten! Wissenszustand 2: Bibelkenntnis (Mt 5,18f): „Bis dies geschieht, wird kein Jota vom Gesetz vergehen.“ Diese Kenntnis konfligiert aber mit: „Von einem Wort lässt sich kein Jota rauben“, „mit Worten lässt sich trefflich streiten, mit Worten ein System bereiten“. Das Bibelwissen entspricht nicht den Problemmerkmalen. Wissenszustand 3: Dogmen Geschichte: Konzil zu Nicäa, 325. Streit darum, ob Jesus homoi ousios mit Gott(vater) sei oder ob er homo ousios (=wesensgleich mit Gott). Streit mit Worten, die theologische Systeme bereitet haben. Und eines der Jota (i) wurde „geraubt“. Homoi ousios =ähnlichen Wesen (mit Gott) Standpunkt der Arianer („Irrlehrer“); homo ousios der Standpunkt der Katholen (bis heute). Dieses Wissen entspricht den Problemmerkmalen: Mit Worten streiten, ein System bereiten, kein Jota rauben, an Worte glauben. Das semantische Rätsel, das uns Mephisto aufgibt, kann mit diesem Wissenszustand 3 gelöst werden. Mephisto vertritt in der Studentenberatung den Standpunkt der Arianer (kein Jota rauben) kontra Katholen, die ein Jota gestrichen, eliminiert haben. 2. Verfügbarkeit von Wissen Selbst wenn wir Wissen besitzen ist es uns nicht immer verfügbar zum Transfer auf das aktuelle Problem. So kann jemand zwar wissen, dass auf dem Konzil zu Nicäa um die Gottheit Jesu gestritten wurde, aber, wenn er die Faust-Verse liest, dann fällt ihm sein Wissen nicht ein. Verfügbarkeit und Instruktionseffekte beim Seil-Problem (Meier, 1931), funktionale Gebundenheit (unseres Wissens) Schalter (für Stromkreis) und Relais- beides eignet sich zum Gewichten eines Seils (um dieses damit zum Schwingen zu bringen) Unser Wissen ist funktional gebunden: Experiment von Birch & Rabinowitz (1951): 3 Gruppen von Vpn, die das Seilproblem lösen sollten: Gruppe 1: Vpn mussten mit einem Schalter einen Stromkreis herstellen, einen Schalter montieren. Gruppe 2: Gleiche Aufgabe, aber mit dem Relais. Gruppe 3: (Kontrollgruppe) ohne diese Aufgaben von Gruppe 1,2. Diese 3 Experiment-Varianten dienten als Ausgangsbedingungen für das dann folgende SeilProblem Gruppe 1 Personen: wählten für das Seilproblem das Relais als Gewicht für das eine Seil Gruppe 2 Personen: wählten den Schalter Gruppe 3 Personen: keine eindeutige Präferenz für den einen oder anderen Gegenstand. Die Ergebnisse zeigen: Für die Schalter Gruppe 1 war der Schalter (mental) funktional mit Stromkreis gebunden, stand für die Lösung des Seilproblems nicht zur Verfügung, analog bei der Relaisgruppe 2 (10 Vpn: alle wählten Schalter als Gewicht). Die Kontrollgruppe 3 (6Vpn: 3 wählten Schalter, 3 wählten Relais). Bei Gruppe 1 und 2 stand das Wissen („kann Gewicht fürs Seil machen“) nicht zur Verfügung, wenn der Schalter oder das Relais vorher funktional gebunden (fixiert) waren. Wenn also bestimmte Gegenstände oder Wissen (Fakten-/ Operationswissen) mit bestimmten Zwecken stark verbunden (assoziiert) sind, dann fällt uns der Transfer (die „Zweckentfremdung“) viel schwerer oder ist uns gar unmöglich, „es fällt uns nicht ein, obwohl es nahe liegend wäre“. Hussy (1984) hat dieses Experiment variiert. Vorbedingungen gleich wie bei Birch/ Rabinowitz Im Hauptexperiment fanden aber die Vpn nur einen der Gegenstände vor, entweder das Relais oder den Schalter. Genauer: die Hälfte der Vpn der Schalter- bzw. der Relaisgruppe fand entweder den Schalter oder das Relais vor. Folgende Ergebnisse: Die Lösungszeiten (sec.) differieren: Schaltergruppe: Wenn sie Schalter vorfand: 396 sec., wenn sie Relais vorfand 134 sec.; Relaisgruppe: Wenn Schalter 128 sec.; wenn Relais 447 sec.; Kontrollgruppe: (ohne Voraufgaben, d.h. ohne Schalter- oder Relaisaufgaben) Wenn Schalter vorgefunden 127 sec.; bei Relais 140 sec. Daraus ersieht man die enorme Verlängerung der Lösungszeiten, wenn die Gegenstände vorher funktional gebunden wurden. Die relevante Information „ist ein Gewicht“, welche ein Merkmal sowohl von Schalter als auch Relais, steht unter der Bedingung funktionaler Gebundenheit viel schwerer zur Verfügung. Wir müssen den Gegenstand aus dem funktionstypischen (Zweck) Zusammenhang erst lösen, das semantische Netz aufbrechen. Die Verfügbarkeit von Wissen kann aber auch erhöht werden, nämlich dann, wenn die funktionale Bindung der Problemlösung ähnlicher wird, oder wenn mit den Gegenständen eine Vorerfahrung besteht, die mit der Lösung des Problems ähnlich ist, z.B. wenn jemand einige Zeit zuvor einen Schalter oder ein Relais an einem Kabel herunterhängen sah. Die Problemschwierigkeit nimmt dann ab Birch (1945) untersuchte die Bedingungen für einsichtiges Verhalten bei Schimpansen: 4 Schimpansen als Vpn: - Birch platzierte Futter außerhalb des Käfigs - Die Affen haben einen Rechen, dessen Stiel in ihren Käfig reicht (sie könnten also die Banane mit dem Rechen herein in den Käfig angeln). - Ergebnis: 2 von 4 Schimpansen lösten das Problem Birch ließ daraufhin die 2 erfolglosen Affen einige Tage lang mit Stöcken spielen. Effekt: Sie lösten nach diesem Spielen das Problem auf Anhieb. Das relevante Wissen ist verfügbar geworden. Zur Verfügbarkeit von Wissen vgl.: W. Hussy: Denkpsychologie, 1984. 6. Der Problemlösezyklus 7 steps of problem-solving cycle: 1) Problem Identifikation: Eine Lage als problematisch zu identifizieren, ist nicht immer einfach. Beispiel: Die Mephisto-Student-Theologie-Situation (Faust I): Manche vermögen bei dieser Stelle kein Problem zu wittern. Sie erscheint ihnen trivial: „No na, dass man mit Worten streiten und Systeme bereiten kann, und kein J wegnehmen soll“, sie haben kein Problem damit. Manche Probleme müssen erst entdeckt werden. Beispiel: Bis zu David Hume (1711-76) glaubte man, wir könnten allgemeine Sätze induktiv- durch sukzessive Anhäufung von Beobachtungen bestätigen (verifizieren). Erst David Hume (eigentlich schon Nikolaus von Autrecourt, 14.Jh.) entdeckte, dass diese Methode nicht funktioniert. Der Behauptungsgehalt von Allsätzen („Alle Schwäne sind weiss“) ist größer als die Gehalte der Beobachtungssätze. D.h. wir können (offene) Allsätze nie induktiv verifizieren. Nicolaus von Autrecourt und David Hume haben somit das Induktionsproblem in den empirischen Wissenschaften entdeckt, die Induktion wurde zum Problem (und es dauerte bis 1934 bis es von K.R. Popper (negativ) gelöst wurde). 2) Schritt 2: Definition und Repräsentation des Problems Wenn ein Problem entdeckt wurde, dann stellt sich die Frage, wie sind die Ist- und die Zielzustände zu definieren, und wie sind die Operatoren zu finden und zielführend zu organisieren. Beispiel: Humes Diagnose: das (frühere) Ziel, offene Allsätze zu verifizieren, muss aufgegeben werden, es ist nicht realisierbar. Alternative 1: Blindes (irrationales) Vertrauen in eine spekulative „Gleichförmigkeit der Natur“ (seit je und für immer). Alternative 2: Optimiere das Vertrauen auf möglichst rationale Weise, so dass dieses Vertrauen rational als besser einzustufen ist als blindes Vertrauen: neues Ziel. – Aber dieses Ziel ist noch schlecht definiert. Was wären die Kriterien für rational gestütztes Vertrauen. Zur Zieldefinition wären somit die Kriterien erst zu finden. Bekanntlich ist es erst Popper (1934) gelungen, diese Kriterien zu finden. –Fast 200 Jahre nach Humes Diagnose, bzw. seiner Entdeckung des Induktionsproblems. Poppers Kriterium für rational gestütztes Vertrauen in eine Hypothese oder Theorie (in generellen Sätzen) ist: Eine Hypothese verdient dann (vorläufiges) Vertrauen, wenn sie möglichst strengen Widerlegungsversuchen unterzogen worden ist und wenn sie diese bestanden hat. Und das Vertrauen kann rational verbessert werden, wenn die Hypothese eine wachsende Anzahl von Widerlegungsversuchen bestanden hat, wie z.B. die Einsteinsche Theorie. Worin besteht die Rationalität? – Bei der bloß induktiven Bestätigung übersehen wir zu häufig die Fälle, die gegen eine Hypothese sprechen- oder wir sagen leichthin „Ausnahmen bestätigen die Regel“. Wenn aber eine Hypothese gezielte, strenge Widerlegungsversuche bestanden hat, dann haben wir eine Regel die (bisher) keine „Ausnahmen“ aufweist. Es ist rationaler, einer solchen Regel das vorläufige Vertrauen zu geben als einer über deren Gegenbeispiele wir hinwegsehen! Schritt 3: Strategie- Formulieren: Wenn wir ein Problem definiert haben, dann können wir daran gehen, einen Strategieplan zu erstellen, der zur Lösung führen könnte. Das kann bedeuten, dass wir das Problem in handhabbare Elemente zerlegen (Analyse) und/oder dass wir die Elemente in eine zielführende Synthese bringen. Eine weitere Strategie ist divergentes und konvergentes Denken; divergent: verschiedene mögliche Alternativen überlegen; konvergent: mögliche Strategien in eine zielführende logische Anordnung bringen. Beispiel: (Fortsetzung von 2): Wenn das Ziel darin bestehen soll, solchen Hypothesen vernünftigerweise zu vertrauen, die strenge Widerlegungsversuche bestanden haben, dann müssen wir die Hypothesen so formulieren, dass sie potentiell widerlegt werden könnten: sie müssen also empirischen Gehalt haben: d.h. die Charakteristika der möglichen Gegenbeispiele gezielt (experimentell) suchen können. Ein Beispiel aus Freud: die Paranoia- Homosex- Hypothese: Wenn x paranoid ist, dann projiziert x seine unbewussten Homosex- Neigungen auf den Verfolger. Diese Hypothese hat empirischen Gehalt, nämlich alle Paranoiker, die bewusste (=nichtunbewusste) Homosex- Neigungen haben, und alle Paranoiker, die heterosexuell orientiert sind (Freud hat selber widerlegende Gegenbeispiele gefunden!). Kurz: Willst du strenge Prüfung der Hypothesen, dann bringe sie in unwiderlegbare Form! Nur so besteht die Chance, eine Hypothese zu finden, die schließlich strenge Widerlegungsversuche bestehen wird. Eine wichtige Strategie ist häufig die, dass wir zwei oder mehrere Hypothesen miteinander rivalisieren lassen (divergente Strategie): Alternativ- Hypothesen: H1 negiert H2 und umgekehrt; Beispiel: H1: Homosexuelle Paranoiker fürchten (unter bestimmten sozialen Umständen wenn Homosexualität tabu), dass ihre Neigungen entdeckt werden könnten. H2: Paranoiker projizieren ihre unbewussten homosexuellen Wünsche... H1 negiert H2, denn nach H1 sind sich homosexuelle Paranoiker ihrer Neigungen bewusst und sie projizieren nicht unbewusste Wünsche. Divergentes und dann konvergentes Denken (logische Anordnung der Möglichkeiten) ist beim Problemlösen sehr wichtig. Schritt 4: Organisation von Information: Beschaffung und Anordnung von geeigneter Information, die es ermöglicht, die Strategien auch durchzuführen. In unserem Beispiel: Experimente entwerfen, um relevante Daten zu gewinnen, die die Hypothese entscheiden (entweder bewähren oder verwerfen). Sie ermöglichen, die Strategie des Widerlegungsversuches anzuwenden. Schritt 5: Hilfsmittel einsetzen (Ressource allocation): Oft sind unsere Ressourcen begrenzt (einschließlich Zeit und Geld) Nach Sternberg verwenden Experten mehr Aufwand für die allgemeine, die Gesamtplanung als Novizen. Novizen tendieren dazu, mehr Zeit in Problemteile zu verwenden. Experten widmen den Initialphasen mehr Zeit für die Entscheidung wie ein Problem zu lösen ist und dann weniger Zeit für die Aktualisierung – „Gut geplant ist schon fast erledigt“. Experten produzieren weniger Fehlstarts, weniger Umwege, sie sparen so letztlich Zeit und Energie und vermeiden Frustrationen. Nach dem obigen Beispiel: gute Planung von Entscheidungsexperimenten: hier Zeit und mentale Fähigkeiten investieren! Schritt 6: Überwachen des Problemlöseprozesses (Monitoring): Effektive Problemlöser überprüfen ständig die Schritte und Wege bis hin zur Lösung. Wenn sie einen bestimmten Pfad bis zum (Sub-) Ziel realisiert haben, dann prüfen sie, wo sie sind (wie weit sie bis zur Zielannäherung gelangt sind=. Sie versichern sich, was sie getan haben, vielleicht stellen sie fest, dass sie einen falschen Start gemacht haben. Schritt 7: Bewertung der Lösung: Wie weit wurde das Ziel erreicht, vollständig, nicht vollständig? Manchmal stellen sich neue Probleme, bzw. Fragen, die beantwortet werden müssen; neuer Zyklus. BLICK INS TIERREICH: PROBLEMLÖSEN BEI TIEREN 1) Beginn der Tierpsychologie Das Christentum sprach den Tieren intelligente Problemlösefähigkeiten und Denken ab: „Tiere sind ohne Verstand...“ 2 Petrus 2,12. Nach Descartes (1596- 1650) sind Tiere biologische Automaten oder Maschinen. Die Intelligenz Gottes habe die Tiere so geschaffen, dass sie sich im Dasein erhalten können. Tiere selbst können nicht denken: sie haben keine „denkende Substanz“ (=Seele, Geist). Das Christentum spricht vom „weisen Planer Gott“ (Katechismus der Katholischen Kirche, 1993; Christoph Schönborn, 2005). Der Evolution liege „ein höchst intelligenter Plan zugrunde.“, sie geschehe nicht nach „Zufall (Mutation) und blinder Notwendigkeit.“ „Gott, der intelligente Designer.“ David Hume vermutete (Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand, 1748), dass auch Tiere über bestimmte Verstandesfähigkeiten verfügen: Sie stellen aus ihrer Erfahrung bestimmte Erwartungen (Hypothesen) auf, z.B. über Ursache und Wirkung. „Ein erfahrener Windhund überlässt die ermüdende Hetzjagd den Jüngeren, um sich dort zu platzieren, wo der Hase Haken schlagen muss, um ihn dort zu fassen.“ David Hume hat im westlichen Denken erstmals Ähnlichkeiten im Lernen und Verhalten zwischen Tier und Mensch markiert. Nicht, dass Hume Unterschiede übersieht, aber er rückt erstmals die Tiere nahe an den Menschen heran. Die Prinzipien des (operanten) Lernens gelten bei Tier und Mensch, David Hume hat diese bereits über 150 Jahre vor den Behaviouristen in den Grundzügen formuliert. Auf der anderen Seite verwirft Hume die christliche cartesian. Seelen- oder Geist- Spekulation. Eine Seele oder ein „immateriell denkender Geist“ hat keine Basis in der Erfahrung, ist bloß eine Imagination der Theologen und Metaphysiker. Hume hat eigentlich die Grundgedanken für eine vergleichende Ethologie gelegt, die erst im 20. Jh. realisiert wurde. Das waren damals revolutionäre Ideen. Hume’s Gedanken hatten auch Charles Darwin beeinflusst. Immanuel Kant (1724-1804) betont wieder stärker die Unterschiede zwischen Tier und Mensch 1) Kultur, Perfektionierung der Lebensbedingungen 2) In der technischen Handhabung von Sachen 3) Pragmatische Handhabung anderer Menschen zu seinen eigenen Absichten (soziale Manipulation) 4) Moralische Anlage: Fähigkeit, nach allgemeinen Regeln (kategorischer Imperativ) zu handeln 5) Die menschlichen Hände: nicht spezialisiert für bestimmte Sachen, „sondern für den Gebrauch der Vernunft geschickt, in seiner Anlage ein vernünftiges Tier.“ Mit dem letzten Punkt hebt Kant die Unspezialisiertheit der menschlichen Hand hervor: „unbestimmt für alles“. Eine Eigenart, die erst Konrad Lorenz und Eibl- Eibesfeldt wieder betonen werden (ohne Kant zu zitieren!). Der Mensch sei „ein Spezialist für das unspezialisiert sein“, oder anders ein potentieller Universalist mit stets erweiterbaren Problemlösefähigkeiten. Nach Kant hat der Mensch auch einen „Trieb zur Perfektionierung“ seiner Fähigkeiten, in „wetteifernder Eitelkeit“ und unstillbarer Begier zu Haben und zu Herrschen, ohne diese beiden Anlagen würden die vortrefflichen Anlagen unentwickelt bleiben. Der Mensch, im System der Natur ein Tier... aber zur Entwicklung seiner Talente geschaffen. Die Entwicklung seiner Vernunft erlange der Mensch erst in der Gemeinschaft, d.h. im gemeinschaftlichen Handeln. Kant spricht damit einen wichtigen Punkt an: Die Entwicklung unseres Intellekts wäre nicht in dem Maße möglich, wenn uns nicht die soziale Kooperation dazu drängte. Aus dem Druck der sozialen Kooperation ist schließlich auch die Entwicklung der Sprache hervor gegangen. Sie ermöglichte eine Steigerung der Kooperation und die Kommunikation unserer Gedanken: das Denken kann veröffentlicht werden und so in der Gemeinschaft zum Problemlösen beitragen. Es dauerte noch fast 100 Jahre bis eine empirisch arbeitende Comparative Psychology entwickelt wurde (Lloyd Morgan, 1894: Introduction to Comparative Psychology; Lee Thorndike 1898: Animal Intelligence). 2) Tiere als Problemlöser Edw. Lee Thorndikes Puzzle-Box - Hungrige Katze im Problemkäfig. Käfig hat Riegelattrappen (die nicht öffnen) und ein Hebelbrett, das den Käfig öffnen kann. - Vor dem Käfig Futter. Problem: „wie komme ich ans Futter?“ - Katze produziert eine Serie (erfolgloser) Befreiungsversuche: Betätigen der Riegelattrappen, Sich durch die Stäbe zwängen, Stäbe beißen, etc. - Zufällig steigt die Katze auf das Hebelbrett => Türe öffnet sich - In weiteren Versuchsdurchgängen steigt die Katze „gleich“ aufs Hebelbrett, die früheren erfolglosen Befreiungsversuche „verschwinden“; Positiv selektiert ist das erfolgreiche Verhalten (erfolgreich= Belohnung durch Futter). Lernen am Erfolg („Gesetz des Effekts“). Problemlösen ist, nach Thorndike, Versuch und Irrtumselimination, bis erfolgreiches Verhalten entdeckt wird. Die „Entdeckung“ zielführenden Verhaltens ist eher zufällig. Nach „tappenden“ und fehlgeschlagenen Versuchen. Es besteht, nach dieser Sicht im Durchprobieren unserer „Werkzeuge“ (dem Verhaltens-Repertoire) bis eines der Werkzeuge zielführend ist: Operator- Suche nach trial and error. Nach Thorndike gilt dies für Tier und Mensch. Zugestanden in manchen Problemsituationen steht uns nur dieses Durchprobieren zu Gebote (z.B. bisher erfolgreiche Heurismen probieren, bis wir auf einen stoßen, der das Problem löst). Haben wir dann einen erfolgreichen gefunden, wird in Zukunftdas, was bisher ein Problem war nur noch eine Aufgabe sein. Für die Katze im Käfig wird es, nach dem Erfolg, kein Problem mehr sein, ans Futter draußen zu gelangen. Wolfgang Köhler: Problemlösen durch „Einsicht“ Die Alternative zum „blinden“ trial and error Eliminieren. Der trial and error Prozess kann durch „Einsicht“ in die Problemsituation wesentlich abgekürzt werden. Zur Einsicht gelangt man durch aktives kognitives Kombinieren, dieses kann bewusst, aber auch unbewusst geschehen. Köhler postulierte einsichtiges Problemlöseverhalten auch für seine Schimpansen: Durch aktives Kombinieren können auch Affen die Problemsituation umstrukturieren. Bekannt, viel zitiert sind Köhlers Experimente mit dem Banane-Kisten- Stäcke-Problem: Banane hängt an der Decke, Kisten und (ineinander steckbare) Stöcke liegen herum. Nach anfänglich erfolglosem trial and error Verhalten tritt eine „Denkpause“ ein = kognitives Umstrukturieren: Kombinieren, dann Einsicht, dann neuerliches Handeln („überprüfen“ der Einsicht): Schimpanse Sultan stapelt die Kisten aufeinander und steckt die Stöcke zusammen, steigt auf die Kisten und schlägt mit den Stöcken die Banane herunter. De facto verlief der Problemlöseprozess etwas komplexer: Sultan spielte mit den Stöcken, entdeckte, dass sie ineinander steckbar sind, dann erst kam ihm die „Einsicht“. Eine andere Experimentvariante war: Sultan sollte mit Hilfe von zusammensteckbaren Stöcken Futter in seinen Käfig hineinangeln. Der Unterschied zum blinden trial and error Verhalten besteht darin: Die Lösung wird durch kognitives Kombinieren erreicht, nicht mehr bloß „blind“ Versuche starten und zufälliges Entdecken sondern Beziehungen zwischen Operatoren (Mitteln) herstellen. Kognitive Zielkonzepte bei Rhesusaffen? Eibl-Eibesfeldt (Ethologe) vermutet (1967), dass auch Rhesusaffen in ihrem Problemlöseverhalten von „Zielkonzepten“ geleitet sind; Experiment: Man steckt vor den Augen der Affen eine Banane unter einen Blumentopf. Der Affe wird weggebracht, die Banane wird durch ein Salatblatt ausgetauscht. Der Affe wird zurückgebracht, er dreht den Topf um, findet das Salatblatt, stutzt, wirft das Blatt weg und beginnt ausdauernd nach der Banane zu suchen. Eibl-Eibesfeldt nimmt an, dass die Tiere mentale Repräsentationen des Zielobjekts bilden (Zielvorstellung). Sie bleibt während der Abwesenheit des Zielobjekts (Banane) erhalten. Die Zielvorstellung leitet die Suche. Auch Vögel scheinen Dinge „symbolisch“ zu repräsentieren und „kognitive Landkarten“ zu entwickeln: Häher in Eurasien und Nordamerika vergraben im Herbst Nüsse und Eicheln. Im Winter, in verschneiter Landschaft, finden sie das vergrabene Futter mit hoher Zuverlässigkeit. Dies habe ich selbst auch schon mehrfach bei Eichelhähern beobachtet. Sie müssen als sehr detaillierte Ortskonzepte entwickeln, die auch noch in einer (durch Schnee) veränderten Landschaft erfolgreich sind. Einsichtiges Problemlösen bei Kolkraben Bernd Heinrich: Das Schnur-Fleischbrocken-Experiment - 5 handaufgezogene Raben, Lerngeschichte war also bekannt - Fleischbrocken an Schnur, das andere Ende der Schnur an der Sitzstange befestigt - Die Raben versuchen zunächst mehrmals das Fleisch im Flug von der Schnur zu reißen, ohne Erfolg, die Raben geben diese Versuche auf - Nach 6 Stunden (Inkubationszeit?) greift einer der Raben auf der Sitzstange mit dem Schnabel, so weit er kann die Schnur hinab und zieht die Schnur hoch, klemmt das aufgefädelte Schnurstück unter seinen Fuß und wiederholt dieselbe Auffädeltaktik bis er den Fleischbrocken erreicht. - Einige Tage später fand ein zweiter Rabe eine andere Lösung: Er zog die Schnur mit dem Schnabel hoch, wanderte auf der Stange mit der Schnur im Schnabel bis er das Fleisch erreichte. (vgl. Spektrum der Wissenschaft Spezial: Intelligenz, 1999: 57f). Ähnliche Strategien verwenden Kolkraben auch beim Fische-Schmarotzen: sie fädeln die Fischerleine aus dem Wasser, klemmen sie unter die Innenzehe... bis sie den Fisch erreichen. Die Raben beobachten zunächst, wie die Menschen die Fische aus dem Wasser ziehen. Ist der Mensch weg, holt sich der Rabe die beute aus dem Wasser. Rabenkrähen sind auch geschickte Nussknacker. Sie klemmen die Nuss zwischen die Mittel- und die innere Zehe des rechten Fußes und hacken die Nuss der Schalennaht entlang bis sie aufbricht. Sie müssen diese „Technik“ lernen (Versuch und Irrtum). Ich beobachtete zahlreiche solcher Versuche, bis sie die Nüsse spalten konnten. Überraschungsattacken unter Nutzung von Deckung: Steinadler Für effiziente Jagd lernen Steinadler, Kaffern- und Keilschwanzadler (alle drei Arten nahe verwandt) Schatten- und/oder Deckungsmöglichkeiten ausnutzen. Steinadler scheinen auch Täuschungsmanöver einzusetzen: Verschwinden die Murmeltiere auf Warnpfiff in den Löchern, bringt sich der Adler auch in Deckung, wartet ab, bis die Tiere wieder auftauchen. (vgl. Wolfgang Fischer, 1976: Stein-, Kaffern-, und Keilschwanz- Adler. Wittenberg S.127130) Ich selbst beobachtete das Nutzen von Deckungsmöglichkeiten mehrfach, vor allem bei adulten, aber auch bei subadulten Adlern. Ebenso das Nutzen von Schatten (damit das Schattenflugbild des Adlers nicht auf den Boden geworfen werden kann und das potentielle Beutetier gewarnt wird): Nützen des Schattens der Felswände oder der Bäume. Kooperatives Problemlösen: kooperative Jagd Rumänische Wölfe betreiben eine intelligente Strategie: Einige Wölfe des Rudels lenken gezielt die Aufmerksamkeit und Wut der Hirtenhunde auf sich, locken so sukzessiv die Hunde von der Herde fort, die Schafherde wird schutzlos, der Rest des Wolfsrudels überfällt die Herde Treibjagd mit scheinbarem Fluchtweg: Schimpansen Schimpansen jagen für ihren Fleischbedarf manchmal Meerkatzen oder Languren (Affen aus der Gruppe der Cercopitheciden) Sie kreisen die Beutetiere ein, lassen aber einen scheinbaren Fluchtweg. Die Treibergruppen hetzen die Beute Richtung des scheinbaren Fluchtweges. Dort aber halten sich andere Schimpansen in Deckung und schlagen dann zu. Bei solchen Jagden werden auch Techniken des Verwirrens und Überraschens eingesetzt. Die Jäger teilen sich dann die Beute (vgl. Jane Goodall: Wilde Schimpansen, 1971: 166-174). Das Futterteilen scheint bei Schimpansen an die Bedingung der Kooperation und/oder an Freundschaften (Seilschaften) geknüpft zu sein. Futterteilen bei Kooperation ist aber auch bei anderen Affenarten, bei Cebus capillaris und auch bei Pavianen der Fall (vgl. Frans de Waal: Nature, Bd. 404: 563). Kooperationsexperimente: Schwere Lade mit Futter ziehen: Nur zwei Tiere gemeinsam können diese Aufgabe lösen. In der Lade aber nur 1 Napf mit Futter bestückt, der andere Napf leer. Ergebnis: in 9 von 10 Fällen teilten die Affen mit dem Helfer. Bei „Arbeiten“, die einer für sich allein machen kann: sie teilen deutlich weniger häufig; Kapuzineraffen als Problemlöser: Das Experiment von Elisabetta Visalberghi. Sie gab den Affen (Cebus) ein 30cm langes Plexiglas Rohr: darin steckte eine Erdnuss. Die Cebi bekamen Gerten (mit Seitenzweigen). Sie mussten die Gerten also erst herrichten (Seitenzweige abreißen). Damit die Gerten als Stocherinstrumente verwendbar wurden. Verschiedene Stöckchen: dicke, die nicht ins Rohr passten und zu kurze (die nicht für das Hinausstoßen der Erdnuss reichten). Ergebnisse: Die Affen begannen die Stöcke als Stocherinstrumente zu benutzen. Sie rissen die Seitenzweige ab oder sie spalteten mit dem Gebiss die zu dicken Stöcke. Sie probierten die Längen aus. Sie arbeiten an diesem Problem zwischen 30min bis zu 2 Stunden. Ein Weibchen missachtete die Stöcke: es blies die Erdnuss aus dem Rohr. Die schnellste Lösung mit dem geringsten Arbeitsaufwand: Bemerkenswert ist aber auch die Motivation und die Konzentration mit der die Affen mit den Stöcken arbeiteten (vgl. Intelligenz im Tierreich. Stuttgart, 1996). Werkzeuge im multifunktionalem Gebrauch: Schimpansen und Bonobos verwenden 1) ein ganzes Sortiment von Werkzeugen 2) gebrauchen sie diese auch für verschiedene Zwecke, oder auch verschiedene Werkzeuge für bestimmte ähnliche Zwecke. Z.B. verschiedene Werkzeuge für Honig beschaffen (Bienenstöcke öffnen) oder ein bestimmtes Werkzeug zum Nüsse öffnen, zum Bohren, zum Spalten aufbrechen etc. Dies deutet auf einen gewissen Grad von Fähigkeit, Gegenstände, Werkzeuge aus der „funktionalen Gebundenheit“ zu lösen und für andere und auch neue Zwecke einzusetzen (vgl. Bill McGrew) Problemlösen mit Bolzen und Schrauben: Schimpansen Experiment: Bananenkiste öffnen, folgende Stufen: 1. Bolzen muss herausgezogen werden, dann 2. Ein Bolzen mit Gewinde muss herausgeschraubt werden 3. Eine Schraube mit Mutter muss entfernt werden: die Mutter muss von der Schraube gedreht werden. Ergebnisse: Die Affen lösen dieses Problem nach der Methode „Versuch und Irrtumselimination“. Die Affen zeigen hohe Explorationsmotivation bei diesem Problem. Sie zeigen interindividuell verschiedene Begabungsgrade. Sie lösen das Problem in individuell unterschiedlichem Zeitaufwand (vgl. Jane Goodall, 1971: Wilde Schimpansen). Das Bananen-Kisten-Schlüssel-Problem: Experiment: 4 verschiedene Kisten, die 4. Kiste enthält die Banane, für die 1. Kiste wird dem Schimpanse Julia ein Schlüssel zur Verfügung gestellt. Sie muss herausfinden, für welche Kiste dieser Schlüssel passt, dann diese Kiste öffnen. In dieser liegt ein Schlüssel; mit dem Schlüssel muss die 2. Kiste geöffnet werden, diese 2. Kiste muss unter den 3 restlichen herausgefunden werden: Probieren bis diese 2. Kiste herausgefunden und aufgesperrt werden kann. In der 2. Kisten liegt der Schlüssel für die 3. Kiste usw. bis die 4. aufgesperrt werden kann. Die Schimpansin Julia zeigte systematisches Ausprobier- Verhalten. (Die 4. Kiste hatte ein Gitterfenster, durch welches die Banane für Julia sichtbar war (aus: Peter Singer, 1994: Praktische Ethik. Stuttgart). Jane Goodall bemerkt, dass Individuen (Schimpansen) mit hoher Explorationsmotivation und Neugier sich Vorteile im experimentalen Versuch-Irrtums-Lernen verschaffen: Die Wahrscheinlichkeit, etwas brauchbares, ein nützliches Werkzeug zu finden steigt. Sie verschaffen sich ein größeres strategisch-instrumentelles Repertoire, das die Problemlösefähigkeiten steigert; das gilt vor allem für das Explorieren von Material- und Werkzeugeigenschaften. Dadurch prägen sich individuell verschiedene Problemlösekompetenzen aus. Ziele mit Täuschungsmanövern erreichen Im Unterschied zum bloß behaviouristischen „Täuschen“, erfordert „echtes“ Täuschen (=intentionales!), dass die Wissenszustände des anderen für die eigenen Zwecke ausgebeutet werden. Dazu ist nötig, dass wir das Wissen bzw. Nichtwissen des anderen mental modellieren können, das gilt auch dafür, dass wir die Interessen und die Wünsche des anderen uns vorstellen können, besser: Annahmen darüber machen. Das erfordert eine minimale „theory of mind“ (für den „Geist“ des anderen) damit wir mental mehrstufige Intentionen bilden können. „Ich vermute/weiß (=Intention 2. Stufe), dass du die Absicht hast, x zu beschaffen (=Intentionsstufe 1)“. Die Fähigkeit, gestufte Intentionen zu bilden, ist eine notwendige Vorraussetzung für strategisches (=intentionales) Täuschen, nur so können wir die Wissens-/ Nichtwissenszustände und die Absichten anderer für unsere Zwecke manipulieren: ihre Absichten vereiteln oder gezielt durch unser Verhalten zu falschen Annahmen verleiten Die Beobachtungen von Jane Goodall (1971) Figan und Goliath: - Figan entdeckt eine Banane in der Astgabel, darunter hockt Goliath, dominanter Schimpanse - Figan zieht sich zurück (hinter das Zelt der Goodall) - Goliath erhebt sich nach 15 Minuten, geht weg. - Figan kehrt zurück, holt sich die Banane Goodalls Interpretation der Szene: „Es war offensichtlich das Figan die Situation begriffen hatte: Wäre er früher auf den Baum geklettert, um die Frucht zu holen, hätte ihn Goliath diese mit ziemlicher Sicherheit weggeschnappt. Wäre er in der Nähe der Banane geblieben, hätte er vermutlich dann und wann zur Banane hinaufgespäht. Schimpansen aber deuten sehr rasch die Augenbewegungen ihrer Artgenossen, so dass Goliath wahrscheinlich selber die Frucht entdeckt hätte. Deshalb hatte Figan darauf verzichtet, seinen Wunsch unverzüglich zu befriedigen, sondern hat sich zurückgezogen, um sein Geheimnis nicht durch Blicke verraten zu können. Die Interpretation unterstellt implizit sehr komplexe Kognitionen 1) Unterscheiden zwischen „meinen und seinem“ Wissen: Goliath weiß nicht, dass über seinem Kopf eine Banane hängt, ich (Figan) weiß es: „mein Geheimnis“ 2) Unterscheiden zwischen meinen und seinen Absichten: „ich will die Banane“ Goliath wird sie auch wollen... 3) Annahmen über Zusammenhänge zwischen Wissenszustand und Absichten: Wenn Goliath wissen wird, dass... ,dann wird er die Absicht haben... 4) „Zeitplatzierung“ des Wissens und der Absichten: „wenn ich hinaufblicke, dann wird auch Goliath hinaufblicken, dann wird er wissen, was ich (jetzt) weiß, dann wird er die Banane nehmen“; prospektives Denken; 5) (Figans) Annahmen über sein zukünftiges mögliches Verhalten: „Wenn ich bleibe, dann werde ich wieder zur Banane hinaufblicken.“ – Annahmen über Goliaths zukünftiges Verhalten, wenn... 6) Absicht, das eigene Wissen für sich zu behalten (Geheimnis) 7) Absicht, die eigenen Absichten nicht zu verraten. 8) Absicht: keine Signale setzen, die den eigenen Wissenszustand verraten könnten: verhindern, dass ich hinaufblicke 9) Strategie: Verhindern, dass Goliath mein Geheimnis und meine Absicht erfährt: Wenn ich verschwinde, dann wird Goliath nicht zu wissen bekommen, was ich weiß. Er wird auch nicht die Absicht bekommen... 10) Verhaltenskontrolle: Ich verschwinde, damit ich nicht zur Banane blicken kann. Verzicht auf unmittelbare Bedürfnisbefriedigung, Erfüllungsaufschub in die Zukunft 11) Erwartungen: Nach einiger Zeit wird Goliath wieder weg gehen 12) Planen: Ich werde die Banane erst dann holen, wenn Goliath weg gegangen ist. Die Liste zeigt ein wenig, wie komplex die kognitiven Zustände und ihre Zusammenhänge sein müssten, wenn Jane Goodalls Interpretation zutreffen sollte. Falls sie zutrifft, dann bedeutet das nicht, dass alle diese Zustände bewusst ablaufen müssten, das ist nicht einmal bei uns in diesem Explizitheitsgrad der Fall. Die Liste würde aber zeigen, dass die Affen eine „theory of mind“ haben müssten, die zwischen den eigenen und den fremden Wissens- und Absichtszuständen unterscheidet und diese auch zeitlich dimensioniert. Die Liste impliziert auch, dass mehrstufige Intentionen gebildet werden müssten: „beabsichtigen, die eigene Absichten nicht zu verrraten“; beabsichtigen, den eigenen Wissensstand für sich zu behalten; Annahmen machen über zukünftige Ansichten etc. Beabsichtigen, den Unwissenheitszustand des anderen für meine Ziele zu nutzen. Die Explikation würde auch strategisches Planen (Mittel- Ziel) im strategischen Verhalten implizieren. Die sprachlich formulierte Explikationsskizze zeigt einen so hohen Komplexitätsgrad, so dass wir kaum glauben können, dass Affen zu solchen Leistungen fähig sein sollten. Wir sind geneigt anzunehmen, dass solche Denkleistungen nur sprachgebunden möglich seien. – weil wir sie sprachlich explizieren können. Aber dies ist ein Fehlschluss: aus der sprachlichen Explizierbarkeit folgt nicht die Sprachgebundenheit solcher Kognitionsprozesse! Sie können sprach- ungebunden ablaufen, so wie sie auch nur zum geringeren Teil bewusst ablaufen (können). Dieser Punkt ist m. E. zu berücksichtigen, wenn wir Jane Goodalls Interpretation des „Anthropomorphismus“ verdächtigen. User AnthropomorphismusVerdacht könnte sich auf die sprachliche Beschreibung und sprachliche Explikation stützen und auf die apriorische Vorannahme, dass die kognitiven Leistungen beim Täuschen „irgendwie“ sprachlich- begrifflich gestützt sein müssen. Aber ist es den tatsächlich so? Ist Konzeptualisierung (Schematisierung) des Problemlosens mit Täuschungsstrategien notwendig an deskriptiv- diskursive Sprachkompetenzen gebunden? Schon die Befunde Jean Piagets für die sensumotor. Substufen 3.5 legen nahe, dass komplexes intentionales Mittel-Zweck-Handeln vorsprachlich abläuft. Und vermutlich der größte Teil unseres prozeduralen Wissens (know how) scheint nicht sprachgebunden zu sein. Es kostet uns erhebliche Mühe, dieses sprachlich zu beschreiben, wenn wir dazu aufgefordert werden. Auch eine „theory of mind“ (Unterscheiden zwischen meinen Wissens- und Absichtszuständen und denen der anderen), die notwendig für Täuschungsmanöver ist, muss nicht sprachgestützt sein. Sie kann implizit funktionieren. Unser Vorurteil, dass komplexe Täuschungsmanöver sprachgestützt sein müssen, kann uns dazu verführen, dass wir die kognitiven Leistungen der Menschenaffen unterschätzen. Diese Überlegungen sollten uns zumindest skeptisch, vorsichtig machen. Aus ihnen folgt aber nicht, dass wir von vornherein den Affen menschenähnliche Kompetenzen unterstellen, das wäre das andere Extrem. Alternative Überlegung: Schimpansen sind sehr gute Beobachter des (Sozial-) Verhaltens ihrer Artgenossen. Figan könnte solche Täuschungsmanöver von anderen abgeschaut und dieses Verhalten bloß imitiert haben. Und dieses Verhalten könnte sich durch trial and error Lernen entwickelt und durch Erfolg verstärkt haben. Behaviouristische Erklärung ohne Annahmen von Intentionalität etc. Dagegen ist zu sagen: Komponenten von trial and error Lernen spielen bei sehr vielen Problemlösungen zwar eine Rolle, in verschiedenem Ausmaß. Imitationslernen bei Schimpansen unbestritten, aber beides reicht nicht aus, um das ziemlich komplexe Täuschen bei Schimpansen zu erklären. Schimpansen mögen beobachten, wie es denen ergeht, die ihre Bedürfnisse in Gegenwart von raghöheren Tieren nicht aufschieben können. Aber sie müssen dann „Schlüsse ziehen“, um solche Fehler zu vermeiden: zielführende Alternativstrategien entwickeln. Ferner: das Täuschungsverhalten der Schimpansen ist zu variabel und flexibel als dass es allein behaviouristisch erklärt werden könnte. Die Variabilität zeigt sich in den verschiedenen Graden von Komplexität (z.B. Anzahl der reziproken Reaktionsstufen in der sozialen Interaktion, die vermutlich gestufte Intentionalität voraussetzt), in der schnellen Änderung der Strategien bei Misserfolg, und plastische Anpassung an verschiedene Situationen. Weitere Beispiele sollen diese Überlegungen illustrieren: Wenn Figan um Plätze mit (ausgelegtem) Futter wusste, dann führte er seine Kumpanen von solchen Stellen weg in den Wald. 10-15 Minuten später kehrte er allein zurück und holte sich die Bananen. Diese Strategie wandte Figan stets wieder an, bis sie einmal fehlschlug: Figan kam zurück, aber da saß ein Ranghoher Schimpanse und fraß „seine“ Bananen. Figan bekam einen Wutausbruch: schrie und trommelte auf den Boden. Jane Goodall nimmt an, dass Figan den Wegführ-Trick bewusst eingesetzt hat. Dafür spricht, dass er die Strategie wiederholt verwendet hat, und der Wutausbruch. Wenn Figan den Trick bewusst eingesetzt hat, dann verhinderte er, dass seine Kumpanen die Bananen entdecken, verhindern, dass sie Wissen darüber erlangen. Dies aber würde voraussetzen, dass Figan Annahmen über das Nichtwissen seiner Kumpanen gemacht hat, und dass er zwischen seinem Wissen und dem Nichtwissen der anderen unterscheiden konnte. Und prospektives Planen: „Wenn ich sie wegführe, dann werde ich keine Futterkonkurrenten haben“. => Problem gelöst. Die beiden Beispiele als Problemlöseprozesse: Sie zeigen Ist- und Zielzustände: Ist-Zustand: das Wissen Figans um das Futter; Ziel: Futter erlangen; Barriere: die Anwesenheit von Nahrungskonkurrenten. Anwenden von Strategien, die Barrieren zu beseitigen. Im ersten Beispiel: Figan geht selber aus dem „Feld der Versuchung“ und wartet versteckt ab bis Goliath verschwindet. Im 2. Beispiel führt er aktiv die Konkurrenten in den Wald, weg vom Futterplatz. Er musste außerdem darauf achten, dass keiner der Kumpanen bemerkt, dass er die Gruppe heimlich verlässt und zum Futterplatz zurückkehrt. Hätte einer dies bemerkt, so wäre ihm dieser gefolgt. Unbemerkt von der Bande davonschleichen (Intention!), erfordert intendierte Kontrolle der Wahrnehmungen der Kumpanen und bemerken der richtigen Gelegenheit, sich davon machen zu können. Das erfordert aufmerksames (prospektives) Abwarten der Gelegenheit. Dieses Abwarten muss mit Ziel (allein ans Futter zu kommen) verbunden werden. Jean Piaget formulierte 3 wichtige Kriterien für den Erwerb von intentionalem Verhalten in der sensumotorischen Entwicklungsphase: 1) Objekt- Zentrierung: Ziel, bzw. Ziel- Repräsentation, wenn das Ziel nicht im Wahrnehmungsfeld ist: mentale Zielvorstellungen, interne Symbolisation. 2) Koordination von Handlungsschemata zu einem sequentiellen Handlungsplan: Handlung 1 vor Handlung 2 ... Handlungsordnung, bis zum Ziel. Je mehr Zwischenschritte, desto mehr intentionale Handlungen, sind ordiniert unter das intendierte Ziel. 3) Anpassung (=Akkommodation) des Verhaltens an neue Situationen, bzw. andere Situationen, die sich (stark) unterscheiden von früheren Situationen („Flexibilität“). Diese Kriterien werden von Menschenkindern in der 5. und 6. Substufe der sensumotorischen Entwicklung (zwischen 12 und 24 Monaten) erreicht. Das Täuschungsverhalten der Schimpansen scheint alle drei Kriterien zu erfüllen: 1. Figan behält die Objektvorstellung (Bananen) als Zielgehalt seiner Aktionen während der Abwesenheit des Objekts (=Banane nicht im Wahrnehmungsfeld) bei. Die Zielvorstellung leitet seine Aktionen. 2. Die Leitung seiner Aktionen besteht in der Koordination seiner Handlungen: Wegführen seiner Kumpanen, Ablenken vom Futterplatz (=Handlung 1), beobachten ob seine Kumpanen ihn beachten bzw. beobachten (=Handlung 2), Abwarten des Zeitpunkts, wo seine Kumpanen ihn nicht beachten (=Handlung 3), sich davon schleichen (was Vorsicht erfordert, dass er keine Geräusche macht!): Handlung 4. Zielhandlung: zum Futterplatz zurückkehren: Handlung 5. Auch das Piaget- Kriterium 3 erfüllt Figan: Er passt seine Tricks unterschiedlichen Situationen an. In Beispiel 1 versteckt er sich und wartet ab, bis Goliath verschwindet. In Beispiel 2 führt Figan seine Kumpanen weg und setzt sich dann „heimlich“ von ihnen ab. Unterschiedliche Strategien, die Problembarrieren zu überwinden, um zu ein und demselben Ziel (=Futter allein für sich) zu gelangen. Wir können einwenden, dass Figan in dem Verhalten, dass Jane Goodall beschreibt Routinen anwendet, dass er auf bewährte Erfahrungen zurückgreift und dass für Figan diese Täuschaktionen keine Probleme, sondern nur noch Aufgaben sind. Das kann zutreffen. Aber bei den ersten Manövern müssen es Probleme gewesen sein. Wir können ferner einwenden, dass er sich beide Arten von Manövern (durch Beobachtung= von andern abgekupfert hat, und dass er diese bloß nachgeahmt hat, und dass er aus dem Erfolg der anderen gelernt hat. Die Situationen, die er von den anderen schon kannte, riefen bloß seine Erfahrung ab, dann Routinehandeln. D.h. dass die scheinbare Flexibilität der Tricks in der Nachahmung verschiedener bewährter Strategien besteht. Aber bei diesem Einwand stellt sich die Frage, welche Schimpansen haben als erste solche unterschiedlichen Tricks erzeugt? Traditionslernen ist bei Primaten gut dokumentiert, aber in unterschiedlichen Populationen werden sehr verschiedene Traditionen geschaffen. Es gibt Initiatoren von Traditionen, die es in anderen Populationen so noch nicht gab. Es gibt bei Primaten kreative Problemlösungen am Beginn von Traditionen. Viele davon mögen auf zufällige Entdeckungen zurückgehen, wie z.B. das Getreide- oder Kartoffelwaschen bei den japanischen Rotgesicht- Makkaken, andere Traditionen mögen auf reines trial and error Lernen zurückgehen, die keine komplexe prospektive Intentionen mit Stufungen erfordern. Jedoch gezielte Täuschungsmanöver dürften damit schwer erklärbar sein. Es scheint noch komplexere Täuschungsaktionen bei Schimpansen als die beiden Goodall Beispiele zeigen, zu geben: Beispiel 3: (von Frans Ploij, niederländischer Primatenforscher, zitiert in Savagh Rumbaug, 1995): Wild lebende Schimpansen im Gombe- Gebiet (wie Goodalls) Schipanse A schafft an einer Futterkiste. Er verschließt sie schnell, als er hört, dass ein anderer Schimpanse B naht. Schimpanse A entfernt sich lässig (als ob nichts Besonderes der Fall wäre), versteckt sich, warte ab bis B verschwindet. A kehrt zurück, öffnet die Kiste, beginnt zu futtern. Aber B kehrt nun ebenfalls zurück. Interpretationsmöglichkeiten: Handelt es sich in diesem Beispiel um eine Täuschung des Täuschers? Dass der 2. Täuscher den ersten Täuscher täuscht? – Die Beschreibung scheint dies nahe zulegen: Schimpanse A tut so als ob nichts Besonderes wäre => verdächtige Signale unterdrücken: Täuschungsversuch über Zustand der Situation (Futterkiste), sich verstecken. B macht sich nicht an die Futterkiste, verschwindet ebenfalls. Als A glaubt, „die Luft sei rein“, kehrt zurück. B kehrt daraufhin auch zurück. Hat B vermutet, dass A etwas interessantes weiß? Hat B die Futterkiste nicht bemerkt? Hat B gehört/ gesehen, dass A zurückkehrt? Aus dem referierten Bericht selbst können wir diese 3 Fragen nicht beantworten. Möglich wäre aber auch, dass Schimpanse B das Verhalten des A (lässig davongehen, verschwinden) als Täuschungsmanöver gedeutet hat und nun seinerseits eine Täuschungsaktion setzt. In diesem Fall wäre vorausgesetzt, dass B über Erfahrungswissen verfügt: Wenn sich ein Artgenosse aud diese Weise (wie A) verhält, dann gibt es etwas Interessantes für ihn –und für mich. Ferner: B weiß dass wenn ein Artgenosse so verschwindet, dann wird er nach einiger Zeit wieder zurückkehren. Also warte ab, bis er zurückkehrt, dann werde ich wissen, wofür er sich interessiert. – Schimpansen sind ja sehr neugierig. Falls B nicht bemerkt haben sollte, dass da eine Futterkiste ist, dann könnte ihm aufgefallen sein, in welcher Art A sich davon macht, das könnte ihn veranlasst haben, anzunehmen, dass A etwas weiß, was er B nicht weiß, und dass sich B nun dafür interessiert, dass er also an Als Wissensstand interessiert ist. Aber diese Überlegungen über Schimpansen B wären dann gerechtfertigt, wenn B den A nicht gehört/ nicht gesehen hat, wie er (noch in Deckung) zurückkehrt. Hat B dies bemerkt, dann genügte es, dass er dem A einfach folgt. Es wäre keine „Täuschung des Täuschers“. Leider können wir dies an Hand des Berichts nicht entscheiden. Sue Savag-Rumbaugh, nimmt auf Grund solcher Beispiel an, dass Menschenaffen ihren eigenen Kenntnis- und Absichtszustand von denen anderer Artgenossen und dem der Menschen unterscheiden können. M.a.W.: sie hätten eine „theory of mind“. Aber diese Annahme ist in der Fachwelt nicht unumstritten wie ich noch darstellen werde. Beispiel 4: Die Experimente von Emil Menzel (aus: Frans de Waal, 2000: Der gute Affe...) Experiment 1: Belle und Rock (dominanter Schimpanse) - Wenn Rock nicht da war, führte Belle die Gruppe (7 junge Schimpansen) an die Stelle, wo Belle wusste, dass dort Futter ist. Fast jeder der Gruppe bekam Futter, Belle teilte also. - Wenn Rock anwesend, dann nähert sich Belle zunehmend langsamer und umständlich. Der Grund: Wenn Belle Futter aufgedeckt hatte, dann kam Rock, versetzte Belle Tritte und biss sie. Dann nahm er alles Futter für sich selbst. - Folge: Belle deckte kein Futter mehr auf, wenn Rock anwesend ist. Sie setzte sich auf die Futterstelle, bis Rock wieder verschwindet - Rock durchschaute Belles Strategie schnell: Wenn Belle länger als ein paar Sekunden an ein und derselben Stelle hockte, kam er und warf sie beiseite, untersuchte den Platz und fand das Futter - Belles nächste Strategie: Sie setzte sich nicht mehr auf das Futterversteck. Sie ging nicht mehr zur Stelle - Rock kontert: Er sucht in stets größerem Umkreis das Gras ab, wo Belle gesessen hatte. - Daraufhin setzte sich Belle in immer größerer Entfernung zum Futterversteck und wartete bis Rock in die entgegen gesetzte Richtung (vom Futterplatz) zu schauen begann. Dann zog sie los zur Futterstelle. - Rock tat aber nur so, als ob er in die entgegen gesetzte Richtung schaute, bis Belle loszog. Einige Male tat Rock so, als ob er wegsähe. In dem Augenblick aber, wo Belle das Futter aufzudecken begann, drehte er sich um. Das Verhalten der beiden Schimpansen zeigt eine gestufte Serie von bemerkenswerten Gegenstrategien, die ein Wissen über Wissen voraussetzen. Der dominante Rock versucht das Wissen der rangniedrigeren, aber schlauen Belle zu explorieren und auszutricksen: 1) Belle weiß, was Rock tun wird, wenn sie Futter aufdeckt. 2) Verhinderungsstrategie: sich auf den Futterplatz setzen 3) Rocks Gegenstrategie: macht Annahme: Wenn Belle länger an einer Stelle sitzt, dann ist dort Futter. Überprüfung der Annahme: Belle wegstoßen, nachschauen, Erfolg. 4) Belles Gegenstrategie: Verhindern, dass Rock Wissen darüber erwirbt, wo Futter ist: Sich an andere Stellen setzen. 5) Rock überprüft: Fehlschlag: kein Futter, wo Belle sitzt 6) Rocks Gegenstrategie: Annahme: Wenn kein Futter, wo Belle hockt, dann Futter im Umkreis =>Absuchen des Umkreises 7) Belles Gegenstrategie: Annahme: Wenn ich mich immer weiter wegsetze, dann wird Rock seltener Futter finden. Abwarten, bis Rock in die Gegenrichtung schaut 8) Rocks Gegenstrategie: Wenn ich in irgendeine Richtung schaue/ suche, dann gib zugleich immer Acht, ob Belle sich erhebt und loszieht und warte ab, bis Belle das Futter aufdeckt. => Durchführung des Plans => Erfolg. „Ich weiß nun, was Belle weiß“: Exploration gelungen. Die (Gegen-) Strategien enthalten offenbar Manöver, das eigene Wissen nicht zu verraten: Absicht, Wissen geheim zu halten und den Konkurrenten gezielt zu falschen Annahmen zu verleiten (täuschen): - Belle: „Wenn ich mich auf die Futterstelle hocke, dann wird Rock nicht annehmen, dass da Futter (unter meinem Hintern) ist.“ - Manöver schlägt nach einiger Zeit fehl. - 2. Manöver: „wenn ich auf einer Nicht-Futterstelle sitze dann wird Rock annehmen, da sei Futter - Rocks Manöver: „Wenn ich wegschaue“, dann wird Bell annehmen, ich merke nicht, dass sie loszieht => Täuschung der Täuscherin. Dieses Beispiel 4 zeigt (1) mehrstufige intentionale (=echte) Täuschungsmanöver, (2) scheint es weit weniger zweifelhaft zu sein (als in Beispiel 3), dass hier (Beispiel 4) eine Täuschung des Täuschers vorliegt (vgl. Gegenstrategie in Punkt 8! (3) systematisches (strategisches) Bemühen (Explorieren), in den Wissenszustand, den der andere hat, zu gelangen: Lösen des Problems: „Wie komme ich zum Wissen des andern“. Experiment 2 (mit Belle und Rock): Menzel platziert an zwei verschiedenen Stellen Futter: Platz 1 mit wenig Futter, Platz 2 mit viel Futter. Belle konnte die Dosierung beobachten, wusste somit, wo mehr und wo weniger Futter ist. Dann wurde Rock zu Belle gelassen. Belle führte Rock zum kleinen Futterhaufen. Während Rock sich über diese Portion hermachte, rannte Belle zum großen Depot. Nach einiger Zeit ignorierte Rock seinen kleinen Haufen, um Belle im Auge zu behalten. Belle bemerkte das und bekam daraufhin Wutanfälle. Das Beispiel zeigt (meines Erachtens): 1) Belle kann klar zwischen „viel“ und „wenig“ unterscheiden, die unterschiedlichen Quantitäten den Orten zuschreiben, und dieses Wissen in ihrem Arbeitsgedächtnis behalten 2) Belle nutzt ihr Wissen zu ihren Gunsten, setzt sofort ein entsprechendes Täuschungsmanöver. Fraglich ist, ob Belle weiß, dass Rock nicht weiß, wo mehr Futter ist. Also ihren Wissenszustand von dem des Rock unterscheidet. Die Unterscheidung müsste nicht notwendigerweise explizit (bewusst) stattfinden. Andererseits: Wenn Bell (implizit) voraussetzte, dass Rock auch das wisse, was sie weiß, dann wäre fraglich, ob sie das Täuschungsmanöver setzte; unter dieser (falschen) Annahme machte es keinen Sinn (Grund), Rock gezielt zum kleinen Haufen zu führen, denn Belle müsste glauben, dass Rock wisse, dass es einen zweiten Haufen gibt, und dass dieser großer ist. Ich vermute daher, dass Belle, zumindest implizit, zwischen ihrem Wissenszustand und dem von Rock unterscheiden konnte, und dass sie ihr Wissen gegen Rocks Nichtwissen zu ihrem Vorteil benutzte: M.a.W. dass sie ihr Wissen in ihre Interessen integriert und damit strategisch nutzte 3) Rock: Aus dem Text wird nicht klar, was „nach einiger Zeit“ bedeutet: hat Rock beim ersten Täuschungsversuch „nach einiger Zeit“ seine (kleine) Portion ignoriert oder nach einigen Täuschungen, die Belle gelungen waren? Hat Rock zufällig bemerkt, dass Belle sich anderswo zu schaffen macht, und daraus „geschlossen“, dass es dort auch Futter gibt, das er ihr erfolgreich streitig machen kann? Oder ist er ohne solches Bemerken „auf die Idee“ gekommen, Belle „im Auge zu behalten“? Das wissen wir nicht. Hat Rock Belles Täuschungsmanöver „durchschaut“? Oder wusste Rock aus vorausgehender Erfahrung: „Wenn sich Belle anderswo zu schaffen macht, dann gibt es dort Futter“? Sie macht sich anderswo zu schaffen, daher: es gibt dort Futter. Das bedeutete, dass Rock (implizit) die Modus ponens- Regel: „wenn p => Q; p, daher Q“ beherrschen würde? Dieser einfachsten Schluss-Regel scheinen Menschenkinder schon früh implizit zu folgen (nach M. Donaldson, 1982: Wie Kinder denken, schon mit 6/7 Jahren). 4) Belles Enttäuschung (Wut): indiziert (?), dass Belle das Täuschungsmanöver gezielt (intentional, explizit) gesetzt hat. Wie sie merkt, dass es misslingt: Frust => Wut darüber, dass Rock ihr Manöver druchkreuzt. Bei allen bisherigen Beispielen taucht immer wieder die Frage auf: können Schimpansen tatsächlich zwischen ihren Wissenszuständen und denen der anderen unterscheiden. Die Beantwortung dieser Frage entscheidet darüber, ob es sich um Problemlösen mit echter (intendierter) Täuschung handelt oder nicht. Eine solche setzt die Unterscheidung der Wissenszustände voraus. Ein Hinweis, dass dem so sein könnte, liefert ein Experiment, das Frans de Waal (2000) referiert: - 2 Experimentatoren geben einem Schimpansen einen Hinweis unter welchem Becher sich Futter befindet - Nur einer der beiden Experimenter kann wissen, wo Futter, denn der andere war nicht da als Futter versteckt wurde. - Der Schimpanse wusste, dass der Experimenter 1 gesehen hat, als Futter versteckt wurde (Schimpanse aber wusste nicht wo) - Ergebnis: der Schimpanse zeigte auf den Becher, auf welchen der Experimenter 1 deutet, nicht auf den Becher, wo Experimenter 2 (der nichts gesehen hat) hinzeigt. Frans de Waal: „Möglicherweise versteht der Schimpanse, dass sehen zu Wissen führt, d.h. Schimpanse weiß, das Experimenter 1 gesehen hat und nur weiß, und der Schimpanse weiß, dass Experimenter 2 nicht gesehen hat und nicht weiß. Der Schimpanse scheint demnach die verschiedenen Wissenszustände der beiden Experimenter zu unterscheiden und anzunehmen: Experimenter 1 weiß wo, was ich nicht weiß. Meine Alternativ-Überlegung: Schimpansen sind ausgezeichnete Beobachter der Augenbewegungen des Gegenübers: Der Schimpanse könnte beobachtet haben, wo Experimenter 1 hinschaut, als Futter versteckt wurde, sodass der Schimpanse nun selbst weiß, wo Futter, nach Schema: „Wenn der Experimenter 1 dort hinschaut, dann wird dort Futter versteckt worden sein.“ Sodass der Schimpanse nicht mehr zwischen seinem Wissen und dem des Experimenters 1 unterscheiden musste. Weitere Experimente von Daniel Povinelli scheinen nahe zu legen, dass Schimpansen Rollenwechsel in Informationshandlungen durchführen können. Zunächst ist der Mensch Infoübermittler zu Schimpanse, dann wird die Rolle „umgekehrt“: Schimpanse tritt in die Rolle des Infoübermittlers durch Hinweisgesten: sie halfen dem Menschen damit den richtigen Hebel zu wählen. Frans de Waal: „Möglicherweise können Schimpansen sich in die Rolle eines anderen versetzen.“ Experimente dieser Art mit Rhesusaffen zeigen, dass diese das nicht können. Schimpansen können durch zusehen das Wesen der Informantenrolle begreifen, ob sie dabei zusätzlich auch zwischen ihren Wissenszuständen und denen des (menschlichen) Partners unterscheiden, ist damit nicht zweifelsfrei. Frans de Waal referiert noch weitere Beispiele von Täuschungsmanövern: Schimpansen füllen manchmal ihren Mund mit Wasser, sie lassen Artgenossen oder Menschen dann nahe an sich herankommen und spritzen ihn dann an. Sie tricksen sogar Menschen aus, die annehmen, dass der Schimpanse so etwas „im Schilde führt“, und entsprechend vorsichtig sind. In diesem Fall tut der Schimpanse so, als ob er sich für etwas ganz anderes interessiert, er wartet so lange bis das Opfer nicht mehr mit einer Spritzaktion rechnet, dann erst spritzt er ihn an. Dieses Beispiel legt nahe, dass Schimpansen harmlose Absichten vorspielen: Schein- oder Tarnabsichten. Dies schein nahe zu legen, dass der Schimpanse weiß, wie seine (Schein-) Absichten von anderen interpretiert werden: Verleiten zu falschen Annahmen: „Ich tue so und so, dann wird der andere glauben, das sei meine Absicht“. Tarnen der tatsächlichen Absicht durch vorgespielte Absichten oder Tätigkeiten. I, III KURZE GESCHICHT DER PROBLEMLÖSE- THEORIEN 1. Philosophische Ursprünge Aristoteles war wohl der erste, der sich ausführlichere Gedanken über die Bereiche Gedächtnis, Lernen und denkendes Problemlösen machte. Er formulierte Prinzipien, die auch heute noch erstaunlich modern anmuten. Er nahm folgende Komponenten des Denkens an: a) das Gedachte (=Noema): der Gehalt der Denktätigkeiten: das vorgestellte Objekt, oder die gedachten Begriffe (der intentionale Gegenstand). b) Die Verbindungsweisen: Wie die Noemata miteinander verknüpft werden können: 1) nach Kontiguität: Treten zwei Ereignisse (Objekte) in raumzeitliche Nähe zueinander auf, dann werden sie, bzw. ihre Vorstellungen davon, im Gedächtnis miteinander verbunden, z.B. die Vorstellung „Hund“ mit der Vorstellung von „bellen“, „mit dem Schwanz wedeln“, etc. 2) nach Ähnlichkeit der Wahrnehmungen, bzw. der Vorstellungen. Sind zwei Objekte einander ähnlich in ihren Eigenschaften, dann werden sie miteinander im Gedächtnis verknüpft. Z.B. ein Objekt 1 (mit Eigenschaften E1...En), gesehen zum Zeitpunkt t1 mit Objekt 2 (mit Eigenschaften E1... En), gesehen zu Zeitpunkt t2. => Klassifikation: Objekt 1 und Objekt 2 gehören zu derselben Klasse => Begriff (=logos) 3) nach Kontrast (Gegensatz: enantios): Auch wenn zwei Objekte in ihren Eigenschaften gegensätzlich sind, dann werden diese Objekte miteinander im Gedächtnis verbunden, z.B. heiß – kalt; Tag – Nacht; etc. Diese 3 Verbindungsarten sind uns als so genannte „Assoziationsprinzipien“ bekannt. David Hume hat diese 3 Prinzipien des Aristoteles ebenfalls übernommen. Und für die Behaviouristen im 20. Jh. gehören diese zu den Grundprinzipien des konditionierenden und operanten Lernens. Nach Aristoteles steuern diese Assoziationsarten den Ideenfluss des Denkens- nebst Absichten, Interessen, Zielen. Ein Begriff ruft im Gedächtnis einen anderen Begriff ab, der nach einer oder zwei dieser Assoziationsarten mit dem ersten Begriff oder Vorstellung verbunden ist. Diese Verbindungen sind die Grundlage von automatisierten unwillkürlichen Denkprozessen. Darüber hinaus kennt Aristoteles natürlich Denkvorgänge, die (bewusst intentional) zielgerichtet sind. Das was für die Denk- und Gestalt-Psychologen und die moderne Kognitionspsychologie wesentlich ist für Problemlösen. 2. Problemlösetheorien in der ersten Hälfte des 20. Jh. Assoziationstheoretischer Zugang Die Assoziationisten/ Behaviouristen übernehmen die 3 aristotelischen bzw. später die empiristischen Assoziationsprinzipien und integrieren diese in ihre lerntheoretischen Problemlösetheorien. Die Assoziationen bilden je nach der Stärke ihrer Verbindungen Reaktionshierarchien aus: die Stärker der assoziierten Verbindung bestimmt, welche Reaktion als erste in einer (neuen) Situation abgerufen wird, scheitert diese, dann wird die nächste aktiviert usw. Problemlösen wird als trial and error Prozess verstanden. Die stärkste Assoziation wird als erste aktiviert, wenn error, dann die nächste, bis zum Erfolg. Die Erfolge/Misserfolge modulieren die zukünftige Stärke der assoziierten Verbindungen und damit die Hierarchie der Reaktionen für das nächste Verhalten. Das klassische Beispiel sind Thorndikes Problemkäfig- Experimente. Bisher erfolgreiches Verhalten wird „dominant“, d.h. es tritt in zukünftigen Situationen schneller auf als die weniger erfolgreichen, sie steigen in der Reaktionshierarchie, die anderen „sinken“, ohne dass sie gänzlich zerstört werden, sie bleiben latent in Bereitschaft. Problemlösen ist nach dieser Sicht eine Veränderung in der Reaktionshierarchie durch Versuch und Irrtumsbeseitigung. Die Versuche folgen also den bisherigen AssoziationsStärkegraden. Ein Problem liegt also dann vor, wenn eine dominante Reaktion (starke Assoziation) nicht erfolgreich ist. Kritik: Dieser Ansatz erklärt nicht, unter welchen Bedingungen erfolgreiche Problemlösungen zu Stande kommen. Nach dieser Sicht funktioniert Problemlösen nach exhaustivem Durchprobieren bis man zufällig eine erfolgreiche Assoziation aktiviert- oder man hat eben keine solche. Diese Theorie kann weiters nicht erklären, wie spontan neue Verbindungen geschaffen werden: neue Infoverknüpfung, ohne dass wir auf bisherige Assoziationen zurückgreifen können. Nach dieser Theorie sind die Assoziationsbildungen allein reizgetrieben, also letztlich extern verursacht: Entweder haben wir bereits die erforderliche Reaktion bereits in unserer Hierarchie (dann ist es keine Neuverknüpfung), oder die Lösung des Problems geling nicht. Der Organismus ist in dieser Sicht eine rein passive, extern betriebene Assoziationsmaschine, d.h. Verbindungen werden im ZNS des Organismus nur dann hergestellt, wenn sie durch Wahrnehmungen von Ereignissen nach Kontiguität, Ähnlichkeit und Kontrast veranlasst worden sind. „brav empiristisch: nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu. Nach diesem Dogma gibt es im ZNS keine autogene Vernetzungsdynamik, keine interne Umstrukturierung. Nebenbei: Auf aristoteles gehen zwar die 3 Assoziationsprinzipien zurück. Aber Aristoteles war natürlich kein Behaviourist, denn er kennt neben dem assoziativen Denken auch das selbstaktive Denken, das bisherige gebildete Assoziationen trennen, zerlegen kann (Analysis), und das, was nicht durch Assoziation verbunden war (hypothetische) verbinden kann (Synthesis), geleitet von (Erkenntnis-)Zielen. Und genau dieses heben die Denk- und die Gestaltpsychologn gegen die Behaviouristen hervor! Für die Denkpsychologie (Würzburger Schule: Oswald Külpe, Narziß Ach, Karl Bühler, Karl Marbe u.a.) betonten die Zielgerichtetheit des Denkens. Die Zielausrichtung erzeugt „determinierende Tendenzen“, die den Ablauf der Denkprozesse steuern, und diese determinierenden Tendenzen können sich auch gegen etablierte (starke) Assoziationen durchsetzen (Narziß Ach). Zur Lösung von Problemen reichen Assoziationen und ihre Hierarchien (Stärkegrade) nicht immer hin. Problemlösen allein nach Assoziationsmustern ist eher die Ausnahme und von beschränkter Kapazität. Anagramm- Problemlösen läuft nach trail and error. Problemlösen in der Sicht der Gestaltpsychologie Gestaltpsychologie, zwei Linien: a) die österreichische: Christian von Ehrenfels, 1890 Über Gestalt- Qualitäten: Ganzheiten (Gestalten) werden kognitiv erzeugt (synthesiert). b) Die „Berliner“-Richtung, Gründer: der Brentanoschüler Carl Stumpf. Hauptvertreter: Max Wertheimer (dessen Lehrer waren Christian von Ehrenfels, C. Stumpf, Osw. Külpe), Wolfgang Köhler (1887-1967), Kurt Koffka (1887-1941), Karl Duncker, Kurt Lewin u.a. Die Gestaltpsychologen haben bedeutende Arbeiten zum Problemlösen geliefert und viele diesbezügliche Experimente ersonnen, die noch heute in der Literatur zitiert werden, z.B. das Neun-Punkte-Problem, das Bestrahlungs-Problem (beide von Duncker), die Streichholz-Probleme (Katona), das zwei-Seile-Problem (Maier), das Kerzen-Problem (Dunker); Im Gegensatz zum Behaviourismus betonen die Gestaltpsychologen, dass Lebewesen, Schimpansen /Menschen nicht bloß Reiz- Reaktions- Maschinen sind, sondern aktiv organisieren, zielorientiert planen und „produktiv“ (schöpferisch) Probleme lösen. - Problemlösen ist stets „produktives Denken“, nicht allein reproduktiv (wie bei Aufgaben), also Neuorganisation von Wissen (Fakten- und prozedurales Wissen), nicht bloß Abrufen von vorhandenem Wissen. - Gestalten sind sogenannte Ganzheiten: sie umfassen Elemente (Teile) und Relationen der Elemente zueinander - Ein Problem ist demnach eine sogenannte defekte Gestalt, d.h. entweder fehlen uns einige Teile oder Relationen oder beides, sodass die Gestalt (für uns) unvollständig (defekt) ist. - Wir haben die Tendenz, das Ziel, die Gestalt zu vervollständigen, sie zu guten Gestalten zu machen. - Defekte gestalten erzeugen im Subjekt eine (kognitive und motivationale) „Spannung“, die eine Tendenz zur Lösung dieses Spannungszustandes auslösen. Beispiel: Wir kennen alle einen solchen Spannungszustand beim Lösen von (anspruchsvollen) Kreuzworträtseln. Wir können eine starke Motivation entwickeln, das Rätsel zu lösen, d.h. es ist eine „gute Gestalt“ (=vollständige Lösung) zu bringen. Haben wir das Rätsel ganz gelöst, dann verschwindet die Spannung. Die Terminologie „Gestalt“, defekte/gute Gestalt haben die Gestaltpsychologen von der Wahrnehmungspsychologie auf das Denken und Problemlösen übertragen: Wir neigen dazu, unsere Wahrnehmungen in Gestalten zu organisieren, z.B. Sterne zu Sternbildern gruppieren: Kreuz des Südens; oder Töne zu Melodien synthesieren. Die Gestaltbildung ist unsere Leistung. Das gilt nach den Gestaltpsychologen auch für das Problemlösen! Wenn Problemlösen darin besteht, dass eine defekte Gestalt in eine gute (vollständige) Gestalt überführt wird, dann muss eine neue Gestaltbildung vorgenommen werden. Die Gestaltpsychologen nennen diesen Vorgang umstrukturieren oder umorganisieren. Das bedeutet: die Ordnungen, die Relationen der Elemente zueinander ändern. Beispiele: Streichholzaufgaben. Beispiel 2: Quadrat-Parallelogramm-Problem (Wertheimer) Beispiel 3: Karl Dunckers (1903-1950) Bestrahlungsproblem: Krebs mitten im gesunden Gewebe. Der Tumor könnte mit Bestrahlung zerstört werden, aber Problem: die Strahlungsintensität wird auch das gesunde Gewebe zerstören: Wie mit der Bestrahlung an den Krebs kommen, ohne das gesunde Gewebe zu zerstören? Die 3 Beispiele zeigen: Bezogen auf den gesuchten (!) Zielzustand (=“gute Gestalt“) ist der Ist-Zustand eine „defekte Gestalt“. Falls uns die Beispiele nicht bekannt sind. Wir probieren zunächst und scheitern, d.h. wir testen unsere gelernten Reaktionsweisen durch: trial and error und wir scheitern damit. Nach etwas Zeit kommt uns plötzlich die „zündende Idee“: die gute Gestalt mit dem berühmten Aha-Erlebnis, der Einsicht. Die Gestaltpsychologen nehmen an, dass wir zwischen Scheitern und Einsicht die Beziehungen der Elemente (unbewusst) umstrukturiert haben. Beispiel 1: IV = III + III => VI = III + III Behaviouristen könnten zu diesem Beispiel sagen, dass es allein mit trial and error: Iteration von Bewege ein Streichholz bis die Gleichung aufgeht, die Reaktionshierarchie durchgehen. Ähnlich könnten die Behaviouristen bei Beispiel 2 argumentieren: zufälliges Abrufen des Reaktionshabits: „Verschieben“ (des 1. oder des 2. Dreiecks), Parallelverschieben lernt man schon in den unteren Klassen der Sekundarschulen. Diesem Einwand können die Gestaltpsychologen begegnen, in dem sie derartige Probleme transkulturell testen –was sie tatsächlich auch getan haben. Das Wertheimer’sche QuadratParallel- Problem wird auch ohne vorhergehende Erfahrung mit Parallelverschiebung gelöst, d.h. kein Rückgriff auf ein Reaktionshabit, sondern aktives Umstrukturieren. Ebenso können sie beim Bestrahlungsproblem antworten: Kein Rückgriff auf eine bereits vorhandene Reaktionsdisposition (falls uns nicht bekannt: „getrennt marschieren, vereint schlagen“ (General Moltke)). Die Lösung fällt uns nach einem uns weitgehend nicht bewussten Umbau-Prozess ein: Mehrere Kobalt-Kanonen, jede mit einer Strahlungs-Dosis die gesundes Gewebe nicht zerstört. Platziere sie um den Tumor, fokussiere die Strahlung aller genau im Tumor, sodass die Energie den Tumor zerstört. In diesem Beispiel müssen die Elemente der Struktur (Gestalt) vermehrt werden (mehrere Kobalt-Kanonen), und die Beziehung der Anordnung und der Dosis müssen konstruiert werden. Charakteristisch ist dabei, dass uns solche Lösungen plötzlich einfallen. Die einzelnen Umbauschritte müssen uns keineswegs alle bewusst sein. Das unterscheidet das Problemlösen von bloßen Aufgaben. Bei Rechenaufgaben können wir die Schritte bis zur Lösung (während der Operation) genau angeben. Beim Problemlösen wenige Augenblicke vor dem „Aha““ fühlen wir uns so ratlos wie nach den gescheiterten Versuchen, das ist typisch für Einsichtsprobleme. Wir können das Aha die gute Gestalt nicht bewusst planen wie die Lösung einer Rechenaufgabe mit bekannten algorithmischen Schritten. Die Einsichten „passieren“ uns, obwohl wir sie für die eigene „Leistung“ halten. (Früher hielt man sie für eingegeben, inspiriert: der Hl. Geist, der uns erleuchtet, für Offenbarungen). Das was die Gestaltpsychologen defekte Gestalt nennen, entspricht dem, was wir als Ist- oder Ausgangszustand kennen und die gute Gestalt entspricht der Realisation des Zielzustandes. Das Umstrukturieren entspricht dem überwinden/ beseitigen von Barrieren durch Neuorganisation von Relationen zwischen den Problemvariablen (Elementen) => siehe Problemkomplexität (S.18)! Zum Umstrukturierprozess gehört auch, dass wir uns von Fixierungen an gewohnte Reaktionsweisen (Strategien) lösen können. Diese Fixierungen verhindern das Umstrukturieren => siehe: sichlösen von funktionalen Bindungen, oder sich lösen von Bindungen an Wahrnehmungsmustern oder Faktenwissen/ prozedural-Wissen, das die Lösung blockiert. Beispiel: Zur Lösung des 9- Punkte- Problems müssen wir uns von der Fixierung an die Quadrat- Wahrnehmung lösen, sonst gelingt uns die Problemlösung nicht. Beim Bestrahlungsproblem müssen wir uns von der Fixierung an nur eine Strahlungsquelle lösen. Beim platonischen Quadrat-Flächen-Verdopplungs-Problem (Platon: Menon) müssen wir uns von erfolglosen Strategien („Verlängern der Seiten“) lösen. Wir müssen Wahrnehmungs- und Strategiestrukturen aufbrechen. Auch bestehendes Vorwissen oder Vorurteile (Vorannahmen) können die Problemlösung verhindern, so dürfte Isaac Newtons Vorannahmen über „absoluten Raum“ und „absolute Zeit“ ihn daran gehindert haben, ein relativistisches Raum- Zeit- Kontinuum anzunehmen. Vorwissen erzeugt oft Einstellungseffekte, die die Lösung verhindern. Viel-Wissen impliziert nicht auch schon Problemlöse- Effizienz! Beispiel: das Pech-Rätsel: Einem Ornithologen wird einfallen: Unglückshäher. Dieses Wissen wird ihn hindern, „das Pech“ in einem Gattungsnamen („Specht“) zu finden. Ein NichtOrnithologe kann schneller „draufkommen“. Die Phasen des „produktiven (=Problemlöse-) Denkens“ Die Gestaltpsychologen nehmen 4 Phasen an: Vorbereitungs-, Inkubations-, Erleuchtungs-, Verifikations-Phase. 1) Die Vorbereitungsphase: Sammeln von (relevanzverdächtigen) Informationen, erste Lösungsversuche, die gewöhnlich scheitern, Misserfolgs- Frust, weitere Versuche scheitern. Aufgeben, aber die Spannung bleibt: „muss das Problem überschlafen, vielleicht wir mir was einfallen...“ 2) Inkubation: man beschäftigt sich mit anderen Dingen, geht zur Tagesordnung über, man denkt aber gelegentlich (nebenbei) an das Problem, man geht spazieren oder schlafen, stößt manchmal auf relevante Infos, die aber noch nicht bewusst als relevant bemerkt wird. Beispiel: Henri Poincaré arbeitete an einem mathematischen Problem (den sogenannten Fuchs’schen Funktionen). Poincaré arbeitete daran wochenlang erfolglos. Eines Abends, als er nicht schlafen konnte, bemerkte er dass seine ursprünglichen Voraussetzungen falsch sind, aber Poincaré wusste noch nicht wie, welche Voraussetzungen Zielführend sein werden. Er führ in den Urlaub. Als er im Urlaub in einen Bus stieg, bemerkte er plötzlich, dass die Fuchs- Funktionen identisch sind mit den Transformationen in der Nicht- Euklid’schen Geometrie => „Aha“. 3) Die Erleuchtung („Aha“, „heureka“): Der plötzliche richtige Einfall, die Umstrukturierung ist vollendet, es stellt sich ein Plausibilitäts- oder gar Gewissheitsgefühl ein, „ja, so muss es gehen“. Beispiel: Kékulé: Benzolring- Problem. Kékulé träumte von einer Schlange, die sich in den Schwanz beißt als er aufwacht, erinnert er sich daran, dann der Einfall: „Benzol könnte eine Ringstruktur haben!“ (Methaphern-Transfer: Schlange => Ring). 4) Die Verifikationsphase: Die Einsicht wird überprüft. Die Einsicht hat zunächst häufig nur mehr oder weniger klaren Plausibilitäts- Charakter. Der Einfall muss oft noch genauer ausgearbeitet werden, damit man ihn auf die Korrektheit hin überprüfen kann, denn das „Sicherheitsgefühl“ beim Einfall ist ja selbst noch keine kritische Prüfung, Einsicht, Intuition ist als solche noch kein Kriterium der Wahrheit (obgleich viele Leute das glauben). Die Verifikation, die Prüfung, kann oft ein längerer Arbeitsprozess sein, z.B. experimentelle Prüfung von Hypothesen. Kékulé hat seinen Einfall überprüft, indem er die Bindungsvalenzen der Atome „durchrechnete“. Das Ergebnis dieser Prüfung bestätigte in diesem Fall die Idee von der Ringstruktur. Wenn die Verifikation aber scheitert, dann wieder neuer Zyklus (von Phase 1 oder 2) bis zur neuerlichen Verifikation. Die Stadien- oder Phasentheorie des Problemlöseprozesses geht auf Graham Wallas, Gestaltpsychologe, zurück. Kritik: Inkubation und Erleuchtung können zu Mystifikationen der beteiligten Prozesse verführen, weil diese Prozesse von der Gestalpsychologie nicht ausreichend ausgearbeitet worden sind: fehlende Prägnanz. Die Beschreibung der Phasen 2 und 3 gibt keine Erklärung, was in diesen Phasen tatsächlich abläuft, somit lassen sie auch keine Überprüfung der tatsächlichen oder vermeintlichen Vorgänge zu. Die Inkubationsphase bis zum Aha ist eine unbekannte „Blackbox“. Daran nehmen sowohl die Behaviouristen als auch die späteren Kognitionisten Anstoß: die Umstrukturier- Prozesse während der Inkubationsphase bleiben in den einzelnen Schritten unklar, vor allem deshalb, weil sie großteils unbewusst verlaufen. Diese Prozesse ex post facto retrospektiv, aus dem Problemlöseprodukt aufzuklären, bleibt spekulativ. Ein ernsthafter Mangel dieser Gestaltpsychologischen Ansätze ist ihre vage Terminologie und die (retrospektive) Introspektion, die allenfalls heuristischen Wert hat, aber keineswegs die tatsächlichen Prozesse in der Inkubation nachzeichnen muss. Dennoch: die Gestaltpsychologie hat eine sehr große Zahl von Problembeispielen erfunden und viele Ideen leben inder modernen Infotheorie des Problemlösens in präzisierter Weise fort. Die heutige Kognitionspsychologie nimmt sich der Inkubation und der Einsicht wieder verstärkt an und versucht zu modellieren, was in diesen Phasen passiert. Stellan Ohlson: Bei der anfänglichen Repräsentation eines Problems wählen wir automatisch bestimmte Aspekte aus, wir betrachten diese durch die Struktur unseres Vorwissens (Fakten- und Prozeduralwissen), das wir früher erworben haben. Dieses Wissen ist ambivalent: es kann hilfreich oder hinderlich sein. Ohlson sieht gerade in den Misserfolgen die treibende Kraft für das „Umstrukturieren“, die die innere Repräsentation des Problems verändern bis zur Lösung: Einsicht. Abraham Luchins hat experimentell gezeigt, das wiederholtes Anwenden der selben Lösungsversuche dazu führt, dass andere Repräsentationsmöglichkeiten blockiert werden => Fixierung. Die Einstellung auf eine bestimmte Methode macht uns „betriebsblind“ (Luchins ist Schüler von Max Wertheimer). Elisabeth Grant und Michael Spivey (2003) haben eine Blickbewegungsstudie in Zusammenhang mit Dunckers Bestrahlungsproblem durchgeführt. Den Vpn wurde eine bildliche Darstellung des Problems angeboten. Ergebnis: erfolgloser Problemlöser fixierten ihren Blick auf den Tumor. Erfolgreiche Problemlöser „tasteten“ mit ihren Blicken auch das Gewebe an verschiedenen Stellen ab. 2. Experiment: Wenn die Haut in der Computerdarstellung leicht flimmerte, dann erhöhte sich die Anzahl der Problemlösungen deutlich. Das Flimmern lenkte vom Tumor ab. Die Barriere im Tumorproblem scheint darin zu bestehen, dass wir beschränkende Annahmen voraussetzen, die wir aufgeben müssen: Wir gehen zunächst automatisch davon aus, dass wir nur eine Bestrahlungsquelle hätten; wir gehen 2. davon aus, die Strahlungsintensität sei konstant, d.h. nicht variierbar. Solange wir uns von diesen (unbewusst, oder kaum bewussten) Voraussetzungen nicht lösen können, werden wir davon ausgehen, dass die Strahlungsintensität stets auch das umgebende gesunde Gewebe zerstören wird. Das Problem erscheint uns ausweglos. Die Vpn. Im 2.Experiment wurden, so scheint es, von diesen beiden impliziten Annahmen (nur eine Strahlungsquelle; nicht variierbare (dosierbare) Strahlung) abgebracht durch das „Flimmern der Haut“. Sie wanderten mit dem Blick der Peripherie entlang. Das brachte sie auf die Idee, zwei oder mehrere Strahler mit reduzierter Dosierung zu verwenden. Neuere Befunde zur Inkubationsphase: „Da muss ich darüber mal schlafen, dann werden wir sehen.“ Das ist uns geläufig, auch dem Chemiker Kékulé (Benzolring!) scheint es so ergangen zu sein. Nach einer Studie von Ulrich Wagner et al. (Gehirn und Geist, 2005/11, Spektrum) wirkt Schlaf förderlich auf Einsichtsprozesse: Den Vpn wurden logische Aufgaben gegeben, die mit zwei logischen Regeln gelöst werden konnten. Eine von den beiden Regeln war die einfachere Strategie. Diese sollten sie finden, das war die Problemstellung. Die Vpn wurden in 2 Gruppen geteilt: - Die eine Gruppe wurde vor der Entdeckung der einfacheren Strategie schlafen geschickt, - Die andere Gruppe nicht Ergebnis: Vpn der Schlafgruppe kamen häufiger auf die einfachere Strategie als Vpn aus der Nichtschlafgruppe. – Wie ist das zu erklären? Die Autoren vermuten, dass daran Prozesse, die im Hippocampus während des Schlafes ablaufen, beteiligt sind: neue Informationen werden mit dem Wissen im LZG verknüpft, dies geschieht über den Weg des Hippocampus bevorzugt während des Schlafes. Heureka, wo im Hirn? Marc Jung- Beeman, Edw. Bowden (Gehirn und Geist 2005/11) stellten die Frage, in welchem Ausmaß die beiden Hirnhemisphären am Umstrukturieren und an der Einsicht (heureka) beteiligt sind. Hypothese war zunächst: linke Hemisphäre für bewusste sprachgestützte Verarbeitung, rechte Hemisphäre für unbewusste Verarbeitung. Doch neuere Befunde widersprechen dieser simplen „Dichotomie“, aber es gibt „Aufgabenteilung“. Jung- Beeman, Bowden nehmen an, dass die rechte Hirnhälfte eine kritische Rolle bei Einsichtsproblemen spielt: Einsichten seien deshalb so überraschend für uns, weil die Umstrukturierungen rechts stattfinden. Erst wenn das Ergebnis der Umstrukturierungsarbeit in die linke Seite „gesendet“ wird, dann erleben wir überrascht das „heureka“. Die Autoren machten folgendes Experiment: - Den Vpn wurden Probleme vorgelegt. An einigen dieser Probleme scheiterten sie: keine Einsicht - Dann wurde den Vpn die Lösung der Probleme, an denen sie zuvor gescheitert sind, so dem linken Auge dargeboten, dass dieses die Lösung (Einsicht) in die rechte Hemisphäre senden muss. Die gleiche Prozedur wurde mit dem rechten Auge gemacht - Ergebnis: Die Lösungen wurden von den Vpn deutlich häufiger als solche identifiziert, wenn sie vom linken Auge in die rechte Hemisphäre gelangten. Dies legt nahe, dass die rechte Hälfte eine Rolle bei der Einsicht spielt. 3. Problemlösen in der Sicht des Informationsverarbeitungsparadigmas (2. Hälfte des 20. Jh.) Ende der 50er Jahre des 20. Jh. leiteten Newell und Simon (1972) eine Wende in der Problemlöseforschung ein. Die beiden hatten schon Ende der 50er Jahre begonnen, Computermodelle für kognitive Prozesse zu entwickeln und damit die behaviouristischen Sichtweisen (Reiz-Reaktions- Theorien) überwunden. Das Informationsverarbeitungsparadigma ist eine der zentralen Grundlagen, nebst der Neuropsychologie, in der heutigen Kognitionspsychologie. 1967: Ulric Neisser: Cognitiv Psychology; 1970: Gründung der Zeitschrift Cognitive Psychology. Kognition umfasst alle Prozesse, die zu Kenntnissen und Fertigkeiten führen: Wissenserwerb, Organisation und Gebrauch von Wissen, also Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Repräsentation (u.a. Vorstellen), Denken (Problemlösen), Sprachverarbeitung, Transformation von organisierten Kenntnissen. Kognition wird als offenes Verarbeitungssystem gedacht, offen zur Umwelt: Infoeingabe (Speichern, Transformation) => Infoausgabe, und feedback der Infoausgabe zur Eingabe => Kontrolle: kompensierende Rückkoppelung. Walter Hussy (1993: Denken und Problemlösen) hat für dieses Konzept ein Rahmenmodell zur Infoverarbeitung vorgestellt, ein Blockschaltmodell für die Einordnung der theoretischen Ansätze und für die empirischen Befunde, dem er sowohl heuristischen Wert beimisst, als auch er dieses als Rahmen für Forschungsprogramme verstehen will. Das Rahmenmodell nennt Hussy MEKIV: Modell zur Elementaren und Komplexen menschlichen Info- Verarbeitung. Das Blockschaltbild für Mekiv: Ich will nix hören, ich studier’ schließlich ned Kunst! Die Kästchen repräsentieren die Verarbeitungsinstanzen, die fetten Pfeile den Infofluss, dünne Pfeile stehen für Steuer- und Kontrollfunktionen des ZP (Zentralprozessor). Legende: SO= Sinnesorgan; SR = Sensor. Register; LG = Langzeitgedächtnis; ES = epistemische Struktur; HS = heuristische Struktur; EVS = evaluative Struktur; ZP = Zentralprozessor; AG = Arbeitsgedächtnis; KS = Kurzzeitspeicher; MPS = motor. Programmsystem; MO = Motorik; SR: hier wird das Umwandlungsprodukt aus der Sinnesinfo kurzzeitig gespeichert: ikonisches und Echogedächtnis LG: weist eine Binnenstruktur auf: Teilsysteme: Epistem. Struktur ES: Speicherung von Faktenwissen; HS: Veränderungswissen: Heuristik; Das evaluative System EVS bewertet das Wissen. ZP: steuert und kontrolliert den Einsatz von Wissen. Problemlösen nach MEKIV: Für das Problemlösen sind zentral relevant die epistemischen, die heuristischen und die evaluativen Strukturen. Die evaluativen Strukturen mit gespeichertem Bewertungswissen ermitteln die Ist-Ziel- Diskrepanzen: wie weit vom Zielinhalt ist der bisherige Prozess noch entfernt: bewerten des bisherigen Wissens und des Einsates von Heurismen (Strategien) in Bezug auf Zielrelevanz, mit Entscheidungen a) behalte das Wissen/die Strategien und suche nach weiteren b) verwerfe das Wissen/die Strategien, oder c) lege das Problem (vorläufig) beiseite. Beim Bewerten/ Entscheiden spielen aber nicht allein kognitive Prozesse, sondern auch motivationale/ emotionale und Persönlichkeitsvariablen (z.B. Anspruchsniveau, Leistungsmotivation, Frustrationstoleranz, etc.) eine Rolle. 4 Phasen des Problemlösens im MEKIV: Phase 1: modelliert alle Vorgänge, die zur Problemdefinition und zur ZielkriterienStellung beteiligt sind. Analyse der Problemstellung (Instruktion), setzt voraus, dass die relevanten Informationen sich im AG befinden. Die Zielkriterienerstellung: Analyse der in der Problemstellung gesetzten Anforderungen, z.B.: es ist eine Zahl zu finden, die die Zahlenreihe korrekt fortsetzt, d.h. Regel für die Fortsetzung soll gefunden werden. Das Ziel: finde die Regel. Der ZP steuert den Suchbefehl an das epistemische/ prozedurale Wissen, und auch die Suche des Evaluator-Wissens, dann Rückmeldung an den ZP. Wenn Bewertung negativ, dann haben wir ein Problem, wenn positiv, dann haben wir bloß eine Aufgabe. Phase 2: Operator/ Strategiesuche und Anwendung der Operatoren Phase 3: Evaluationswissen suchen, das die Operatoren/ Strategien bewertet, hinsichtlich der Zielkriterien. Die Phasen 2 und 3 dienen der Lösungsfindung, d.h. der Überwindung der Barrieren zwischen Ist- und Zielzustand . Die Suche der Lösung beginnt mit der Neuverknüpfung der Info. Der ZP steuert die Suche nach problemangemessenen Operatoren aus dem HS (Phase 2). Die Suche ist an den Inhalten des AG orientiert, z.B. Suche nach mathematischen Regeln/Operatoren bei Zahlenreihen- fortsetzen. Phase 3 umfasst Bewertungsprozesse: Steuerung der Suche und Anwendung von Bewertungswissen aus der EVS. Kontrolle des Bewertungs- Ergebnisses durch den ZP initiiert, Rückmeldung der Info löst weitere Steuerungsprozesse aus. In diesem Fall wird noch einmal die Phase 2 durchlaufen, z.B. wenn die bisherige gefundene Zahl für die Zielerfüllung nicht tauglich ist (bei Zahlenreihen- fortsetzen). Phase 4: betrifft die Outputsteuerung: Prozesse, die sich an die Lösungsversuche anschließen, wenn die Barrieren überwunden sind und das Ziel erreicht ist. Das Ausgabesystem (MPS und MO) tritt in Aktion, gesteuert vom ZP, die Mitteilung der Lösung an die physische oder soziale Umwelt. Und zugleich wird nun das Lösungswissen an die Subsysteme des LG rückgespeichert: neue Wissensbestände werden im ES und HS und im EVS installiert. In Zukunft wird uns das Problem kein Problem, sondern nur noch eine Aufgabe sein. Bewertung des MEKIV: Das Modell hat heuristischen Wert, aber die Prozesse in den einzelnen Subsystemen (wie ES, HS EVS, ZP, etc. sind damit im Detail noch nicht aufgeklärt. Weitere empirische Studien müssen dieses Modell noch bewähren.